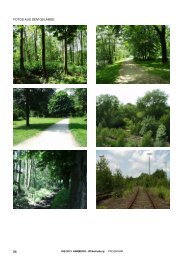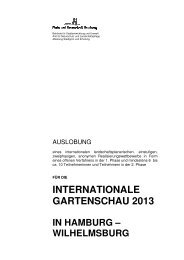Historie
Historie
Historie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Auch die Hamburger Innenstadt blieb nicht verschont.<br />
Bis zum Rathaus drang das Hochwasser<br />
vor, floss in die Keller von Banken und Wirtshäusern<br />
und brach in den alten Elbtunnel ein. Über<br />
300 Menschen kamen in den Fluten ums Leben;<br />
davon waren 207 Bewohner der Elbinsel Wilhelmsburg.<br />
Viele der vom Wasser eingeschlossenen<br />
Menschen saßen bei Temperaturen um den<br />
Gefrierpunkt durchnässt auf den Dächern ihrer<br />
Häuser und Gartenlauben oder in den Baumkronen.<br />
Eine großangelegte Rettungsaktion begann. Polizeisenator<br />
Helmut Schmidt, der spätere Bundeskanzler,<br />
forderte aus dem europäischen Ausland<br />
militärische und zivile Hilfe an. Er koordinierte<br />
Hubschraubereinsätze und Hilfsaktionen zu Wasser.<br />
Rund 20.000 Hilfskräfte kämpften in einem<br />
Wettlauf gegen die Zeit um das Leben der von der<br />
Umwelt abgeschnittenen Menschen.<br />
Nach den Erfahrungen dieser verheerenden Katastrophe<br />
übertrug der Hamburger Senat der<br />
Baubehörde die Planung und den Bau neuer<br />
Hochwasserschutzanlagen. Es ergab sich die<br />
Schwierigkeit, dass es schon aus Platzgründen<br />
nicht möglich war, die sehr stark beschädigten<br />
Deichanlagen nur wieder instand zu setzen, sie<br />
nach neuen Erkenntnissen zu verstärken und zu<br />
erhöhen. Eine neue Hochwasserschutzlinie musste<br />
in kürzester Zeit gefunden werden, damit die<br />
Bauarbeiten beginnen konnten.<br />
GROSS-SIEDLUNGEN UND IMAGEPROBLEME<br />
Das ‚Entwicklungsmodell Hamburg und Umland’<br />
von 1969 ging zunächst davon aus, dass insbesondere<br />
der Wilhelmsburger Westen als Wohnstandort<br />
langfristig zugunsten gewerblicher Nutzungen<br />
aufgegeben werden sollte. Dies führte in<br />
vielen Sektoren zu einer Investitionszurückhaltung.<br />
Gleichzeitig entstand in der Mitte der Insel<br />
und im Osten verdichteter Geschosswohnungsbau,<br />
unter anderem die Großsiedlung Kirchdorf-<br />
Süd. 2242 Wohnungen in bis zu 13 Stockwerken<br />
hohen Hochhäusern. Soziale Probleme waren hier<br />
vorprogrammiert bei nahezu 6000 Bewohnern, deren<br />
wirtschaftliche Situation schlecht ist. Wie als<br />
Kontrastprogramm finden sich unweit davon noch<br />
reetgedeckte Bauernhäuser aus dem 17. bis 19.<br />
Jahrhundert und guterhaltene, stuckverzierte Altbauten<br />
wie in Eppendorf, östlich beginnt die ländliche<br />
Kulturlandschaft. 1974 wurde die<br />
Köhlbrandbrücke, die den Hafen mit der Autobahn<br />
A7 verbindet, eingeweiht.<br />
Seit Mitte der 70er Jahre treten zunehmende<br />
strukturelle Probleme auf den Elbinseln in das<br />
Bewusstsein der Öffentlichkeit. Wilhelmsburg ist<br />
durch den Strukturwandel in der Hafenwirtschaft<br />
stark betroffen. Der Stadtteil gehört in weiten Bereichen<br />
zu den wenigen industriellen Räumen der<br />
Stadt, die noch immer durch eine starke Belastung<br />
von Boden, Wasser und Luft sowie Lärmimmissionen<br />
geprägt sind. Anfang der 70er Jahre<br />
kam die Giftmülldeponie Georgswerder. Als auch<br />
noch eine Müllverbrennungsanlage für Wilhelmsburg<br />
im Gespräch war, gingen die Bürger auf die<br />
Barrikaden und konnten das Projekt verhindern.<br />
Im Gegensatz zu Hamburger Quartieren nördlich<br />
der Elbe ist es in Wilhelmsburg bisher nicht gelungen,<br />
in größerem Umfang neue, zukunftsfähige<br />
Arbeitsplätze zu schaffen. Die Stadt hofft und bemüht<br />
sich darum, dass sich der strukturelle Umbau<br />
der Arbeitswelt in Wilhelmsburg als ein<br />
Wechsel von der Hafenindustrie hin zu Dienstleistungs-<br />
und Produktionsunternehmen vollziehen<br />
wird. Die Belastungen durch die Industrialisierung,<br />
die die Flussinseln zerschneidenden Verkehrsstraßen,<br />
wachsende Arbeitslosigkeit und ein steigender<br />
Anteil ausländischer Bevölkerung führen<br />
zu zunehmender Segregation und massiven<br />
Imageproblemen gerade auch in den stark durch<br />
öffentlich geförderten Wohnungsbau geprägten<br />
Bereichen.<br />
WILHELMSBURG HEUTE<br />
Bei z.Zt. über 34 Prozent Ausländeranteil ist Integration<br />
ein wichtiges Anliegen. Gerade die Kirche<br />
engagiert sich hier stark. Man will die unterschiedlichen<br />
Religionen einander näher bringen und<br />
damit für mehr Toleranz sorgen. Mit verschiedenen<br />
Handlungskonzepten zur Erneuerung und<br />
Stärkung der Stadtteile wird seit 1981 unter intensiver<br />
Bürgerbeteiligung versucht, Potenziale und<br />
Qualitäten im Bestand weiterzuentwickeln. Trotz<br />
vieler Projekterfolge im Einzelnen konnte der insbesondere<br />
durch die Medien verbreiteten Stigmatisierung<br />
des Stadtteils insgesamt nur begrenzt<br />
entgegengewirkt werden. Es stellt sich insbesondere<br />
die Aufgabe, eine jahrzehntelang durch den<br />
Hafen geprägte und teilweise auch beeinträchtigte<br />
Siedlungsstruktur so zu rekultivieren, dass diese<br />
für zukünftige nachhaltige Entwicklungen wieder<br />
offen ist.<br />
IGS-2013 HAMBURG - Wilhelmsburg - PROGRAMM-ANHANG - HISTORIE 75