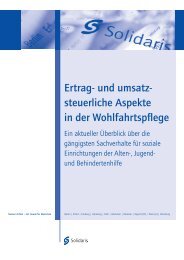medcongress - Solidaris Unternehmensberatungs-GmbH
medcongress - Solidaris Unternehmensberatungs-GmbH
medcongress - Solidaris Unternehmensberatungs-GmbH
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Finanzierung<br />
Mathias Larbig/Prof. Dr. Dagmar Ackermann<br />
Zukunftsgerichtete Instrumente<br />
der Krankenhaussteuerung –<br />
ein Plådoyer fçr die<br />
Kostentrågerrechnung<br />
Noch immer verfçgt nur ein sehr kleiner Teil der deutschen Krankenhåuser çber eine funktionierende Kostentrågerrechnung<br />
(KTR). Dabei sind verlåssliche fallbezogene Kosteninformationen zwingende Grundlage fçr operative und<br />
strategische Entscheidungen im Krankenhaus. Die Autoren haben sich in Theorie und Praxis seit Einfçhrung der DRGs<br />
intensiv mit der Thematik der Kostentrågerrechung auseinandergesetzt. Der vorliegende Artikel stellt die zwingende<br />
Notwendigkeit der Weiterentwicklung der Kostenrechnung als Basisinstrument fçr die Steuerung von Krankenhåusern<br />
heraus. Die Einfçhrung der Kostentrågerrechnung und ihre Ausgestaltung zu einer Prozesskostenrechnung sind<br />
im Kontext der Fallpauschalenvergçtung unerlåsslich.<br />
Rahmenbedingungen<br />
Mit der Einfçhrung der Leistungsvergçtung durch Fallpauschalen<br />
auf der Grundlage der DRGs im Jahr 2003<br />
wurden die Pflegetage von Durchschnittskosten als Grundlage<br />
der Erlæsberechnung abgelæst. Die Verantwortlichen fçr die<br />
Umsetzung des Fallpauschalengesetzes sind gewillt, die Konvergenzphase<br />
wie geplant 2009 abzuschließen. Der Krankenhaussektor<br />
wandelt sich zu einem Markt, auf dem Angebot<br />
und Nachfrage sowie ein kalkulierter kostenbasierter Preis fçr<br />
den Erfolg des einzelnen Hauses verantwortlich zeichnen. Seit<br />
Einfçhrung der Fallpauschalenvergçtung kann beobachtet<br />
werden, wie die vorgesehenen Marktmechanismen ihre Wirkung<br />
entfalten. Der damit einhergehende steigende Wettbewerbsdruck<br />
zwingt die Geschåftsfçhrungen und Abteilungsleitungen<br />
der Krankenhåuser, wichtige strategische und operative<br />
Entscheidungen kurzfristig und oft unter erheblicher Unsicherheit<br />
zu fållen, da die erforderlichen Informationsgrundlagen<br />
zur eindeutigen Positionsbestimmung und fundierten<br />
Steuerung im neuen Wettbewerbsumfeld noch nicht gelegt<br />
wurden. Die Gefahr von strategischen Fehlentscheidungen<br />
oder der Verschleppung wichtiger Weichenstellungen infolge<br />
Informationsmangels ist hoch. Die Auswirkungen zeigen sich<br />
schon heute, und zwar håufig drastisch und unbarmherzig,<br />
wenngleich sie unter gesamtækonomischen Aspekten græßtenteils<br />
durchaus sinnvoll und notwendig sind.<br />
n Durch horizontale Kooperationen, Fusionen und Ûbernahmen<br />
bis hin zum Verdrångungswettbewerb hat sich die<br />
Zahl der Krankenhåuser bereits merklich verringert. Der<br />
336<br />
das<br />
Krankenhaus 4.2008<br />
Konsolidierungsprozess wird sich so lange fortsetzen, bis<br />
die durch die Gesetzgebung und die wirtschaftliche Lage gebotenen<br />
Effizienzziele erreicht sind. Nach einer kurzen und<br />
intensiven Phase der Marktbereinigung, in der wir uns derzeit<br />
befinden, wird sich eine grundlegend verånderte Struktur<br />
im Krankenhausmarkt herausbilden, die gekennzeichnet<br />
ist durch private Ketten und andere Verbçnde sowie durch<br />
spezialisierte kleinere Håuser.<br />
n Es erfolgt eine Arbeitsverdichtung, das heißt, eine sinkende<br />
Zahl von Mitarbeitern der Krankenhåuser versorgt mehr Fålle<br />
bei verkçrzten Verweildauern. Die Tragweite der jçngsten<br />
Umschichtungen zeigt sich insbesondere im Pflegedienst,<br />
seit 1995 wurden allein hier rund 50 000 Vollkråfte abgebaut.<br />
1) Øhnlich betroffen sind das klinische Hauspersonal<br />
(–17 000 VK) sowie der Wirtschafts- und Versorgungsdienst<br />
(–32 000 VK). Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Fålle um<br />
knapp 1 Mio. (+6 Prozent) gestiegen und die durchschnittliche<br />
Verweildauer von 11,4 auf 8,6 gesunken. 2)<br />
n Gleichzeitig fçhren Qualitåtsvorgaben und die enorme Erhæhung<br />
der Transparenz durch die anstehende Veræffentlichung<br />
dieser Daten zu einer vællig neuen Gewichtung der<br />
Nachfrageseite im Gesundheitsmarkt, also der Patienten<br />
und ihrer Interessenvertreter. Diese achten zunehmend auf<br />
die Qualitåt der Behandlung in den Krankenhåusern und<br />
setzen sie in Relation zum Umfang der Versicherungsleistungen<br />
und den Kosten fçr die Versicherung.<br />
n Weiterhin besteht Potenzial zur Verbesserung der Arbeitsablåufe<br />
und Kostenstrukturen. Eine Auswertung der Daten von<br />
28 Krankenhåusern mit Kostentrågerrechnung ergibt das in<br />
Tabelle 1 genannte frappierende Resultat.
4.2008<br />
das<br />
Krankenhaus Finanzierung<br />
Tabelle 1<br />
Status Fälle Anteil<br />
Gewinn/Verlust<br />
in Mio. EUR<br />
intern verlegt 15.398 5,5 % –13,6<br />
nicht verlegt 265.763 94,5 % 15,9<br />
gesamt 281.161 100,0 % 2,3<br />
Datenjahr: 2006, Quelle: eigene Berechnungen<br />
n Deutsche Krankenhåuser erwirtschaften mit ihren DRGs im<br />
Durchschnitt einen Gewinn von ca. 2,3 Mio. E, mit nur 5,5<br />
Prozent der Fålle allerdings einen Verlust von –13,6 Mio. E.<br />
Ursachen dafçr sind neben der den DRGs zugrunde liegenden<br />
Mischkalkulation und der individuellen Fallschwere insbesondere<br />
auch die mangelnde Kooperation der Fachabteilungen<br />
und Kommunikationsdefizite mit der Folge von zu<br />
spåten Verlegungen und Mehrfachleistungen. Zwischen<br />
den Fachabteilungen muss sich im Interesse optimierter Behandlungsprozesse<br />
eine intensivere Zusammenarbeit entwickeln.<br />
Gerade Patienten, die zwischen Fachabteilungen verlegt<br />
werden, erweisen sich in der Regel als hæchst defizitår.<br />
Entwicklungen und Erwartungen<br />
Es steht zu erwarten, dass sich noch weitere tief greifende Verånderungen<br />
ergeben werden.<br />
n Die derzeit zu beobachtende, aus der Not geborene horizontale<br />
Zusammenarbeit zwischen Krankenhåusern wird sich<br />
nach erfolgter Konzentration zu einer reinen Konkurrenzsituation<br />
wandeln und durch eine vertikale Zusammenarbeit<br />
zwischen den ambulanten, stationåren und Reha-Versorgungsformen<br />
abgelæst werden.<br />
n Hierbei werden die Kostentråger als Geldgeber und måchtige<br />
Vertragspartner eine entscheidende Rolle spielen. Sie werden<br />
sich zunehmend darum bemçhen, Patientenstræme zu lenken<br />
und ihren Kunden qualitativ hochwertige und dabei preisgçnstige<br />
Versorgungsangebote machen mçssen, um ihrerseits<br />
im Wettbewerb zu bestehen. Die direkten Einflussmæglichkeiten<br />
der Krankenhåuser auf die Patientenstræme sind,<br />
gemessen an der Marktmacht der Kostentråger, insbesondere<br />
in Ballungsgebieten vergleichsweise gering einzuschåtzen.<br />
n Der Wettbewerb zwischen den Krankenhåusern und den anderen<br />
Anbietern von Gesundheitsdienstleistungen wird infolge<br />
der erhæhten Transparenz und der zunehmenden Einflussnahme<br />
der Kostentråger auf einer sehr eng an die Leistungen<br />
geknçpften Ebene erfolgen und damit die einzelnen<br />
Behandlungsprozesse noch viel mehr in den Mittelpunkt der<br />
betriebswirtschaftlichen Betrachtung rçcken. Diese gilt es<br />
daher bereits heute in all ihren Aspekten genauestens zu<br />
kennen und unter Wahrung græßtmæglicher Qualitåt zu planen<br />
und zu steuern.<br />
n Die Rolle der Fachabteilungen als Objekte der Betriebssteuerung<br />
tritt damit in den Hintergrund. Es ist vielmehr der<br />
(håufig fachabteilungsçbergreifende) Prozess selbst, den es<br />
heute und in Zukunft zu steuern gilt. Freilich liegt die Verantwortung<br />
fçr die medizinischen Leistungen nach wie vor<br />
bei den Ørzten, die natçrlich weiterhin zu einzelnen Fachabteilungen<br />
gehæren. Letztlich jedoch werden såmtliche Organisationsformen<br />
in den Krankenhåusern mehr und mehr<br />
auf die Prozesse abgestellt. Dabei arbeiten idealerweise Ørzte<br />
aus verschiedenen Fachabteilungen gemeinsam in bestimmten<br />
Behandlungsprozessen, die medizinische und ækonomische<br />
Prozessverantwortung vermischt sich, die klare Abgrenzung<br />
der Fachabteilungen tritt somit auch aus ækonomischer<br />
Sicht in den Hintergrund und reduziert sich auf die fachliche<br />
Verantwortung fçr die Ausbildung der Ørzte.<br />
n In der zunehmend håufiger zu beobachtenden Zentrenbildung,<br />
bei der mehrere Fachrichtungen in einem Gebåude gemeinsam<br />
an meist kærperregionsbezogenen, verwandten Behandlungsprozessen<br />
zusammenarbeiten, wird dieser Tatsache<br />
Rechnung getragen. Hierin zeigt sich sehr anschaulich,<br />
dass es einzelne Prozesse oder Gruppen von åhnlichen Prozessen<br />
sind, fçr die der Ressourceneinsatz zu planen ist und<br />
dessen Einhaltung durch die Vergabe von Budgets gesteuert<br />
wird. Die Budgeteinhaltung wird dabei noch deutlicher von<br />
den Ørzten zu verantworten sein und durch die genaue<br />
Steuerung der Prozesse – eben auch unter Kostengesichtspunkten<br />
– bestimmt.<br />
n Hierzu benætigen in Zukunft vor allem auch die Ørzte genaueste<br />
Informationen çber die Kostenzusammensetzung<br />
ihrer Leistungen im Rahmen von Behandlungsprozessen,<br />
denn sie sind es, die die Behandlung festlegen und optimal<br />
steuern mçssen. Es gilt, die Behandlungsprozesse so zu gestalten,<br />
dass sie – unter Beteiligung verschiedener Bereiche<br />
wie Chirurgie, Radiologie, Anåsthesie, OP, Labor, Pflege etc.<br />
���������<br />
�<br />
337
MEDCONGRESS Baden-Baden 29.06. - 05.07.2008<br />
35. Seminarkongress für medizinische Fort- und Weiterbildung<br />
MEDICA Deutsche Gesellschaft für Interdisziplinäre Medizin e. V.<br />
in Kooperation mit<br />
Südwestdeutsche Gesellschaft für Innere Medizin e. V.<br />
Bezirksärztekammer Nordbaden<br />
Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein<br />
Berufsverband Deutscher Internisten e. V.<br />
111 Zusatzbezeichnung Notfallmedizin<br />
PD Dr. J. Meinhardt<br />
112 Reanimation Update<br />
Prof. Dr. P. Sefrin<br />
113 Besondere Notfälle - neue Aspekte<br />
Prof. Dr. P. Sefrin<br />
114 Kardiozirkulatorische Notfallsituationen<br />
Dr. A. Dorsch<br />
115 Pädiatrische Notfälle<br />
Dr. A. Dorsch<br />
116 Notfallsituationen in der zahnärztlichen Praxis<br />
Dr. A. Dorsch<br />
117 Invasive Techniken für die Notfallmedizin<br />
Dr. J. Hinkelbein<br />
121 Sonographie Grundkurs<br />
Dr. G. von Klinggräff / Dr. J. Gebhardt<br />
122 Sonographie Aufbaukurs<br />
Dr. W. Blank / PD Dr. N. Börner / Dr. W. Heinz<br />
123 Sonographie Grund- und Aufbaukurs<br />
124 Sonographisches Fallseminar<br />
Dr. W. Heinz<br />
125 PET/CT: Aktuelle klinische Realität und Zukunftsperspektiven<br />
PD Dr. Dr. H. Bihl<br />
126 Kopf-Hals-Sonographie<br />
Prof. Dr. Dr. R. Schmelzeisen<br />
127 Thorax Sonographie<br />
Dr. W. Blank<br />
128 Interventionelle Sonographie (mit praktischen Übungen)<br />
Dr. W. Blank / Prof. Dr. G. Mathis<br />
201 Best practice:<br />
Rheumatologie / PD Dr. C. Fiehn<br />
Hypertonie / Prof. Dr. K. Kühn<br />
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen / Prof. Dr. T. Andus<br />
Kardiologie / Prof. Dr. M. Leschke<br />
Leitung: Prof. Dr. H.-W. Baenkler<br />
210 Arztrecht<br />
Dr. jur. H. Bartels<br />
211 Demenz<br />
Prof. Dr. M. Daffertshofer<br />
212 Rheumatologie<br />
Prof. Dr. H.-M. Lorenz<br />
213 Kartellrecht in der Gesetzlichen Krankenversicherung<br />
Dr. jur. M. Rehborn<br />
214 Reisemedizin<br />
PD Dr. W. Cullmann<br />
215 Pädiatrie für Nicht-Kinderärzte und Kliniker<br />
Dr. K.-J. Eßer<br />
216 Brennpunkt Gesundheitspolitik<br />
Seminar zu aktuellen Aspekten im Gesundheitswesen<br />
217 Existenzgründungsseminar für Ärzte<br />
S. Grebe / E.-J. Zahorka<br />
218 Praxisabgabe<br />
Prof. h.c. (BG) Dr. K. Goder<br />
220 Notfalltherapie der Herzrhythmusstörungen<br />
Prof. Dr. B. Gonska / Prof. Dr. E. G. Vester<br />
Satelliten-Symposien<br />
310 Neues aus der Gastroenterologie und Hepatologie<br />
311 Tag der medizinischen Fachangestellten / Arzthelferin<br />
316 MTAR-Forum<br />
Hartmannbund - Verband der Ärzte Deutschlands e. V.<br />
Verband medizinischer Fachberufe e. V.<br />
Dt. Verband Technischer Assistentinnen/Assistenten<br />
in der Medizin e. V.<br />
129 Sonographie Refresherkurs<br />
PD Dr. N. Börner / Dr. W. Blank / Dr. W. Heinz<br />
131 Doppler-Echokardiographie<br />
Prof. Dr. A. Geibel-Zehender / Dr. B. Saurbier<br />
132 EKG Grundkurs<br />
Dr. T. Breidenbach<br />
133 Langzeit-EKG<br />
PD Dr. T. Faber<br />
134 Farbdoppler Refresherkurs<br />
Dr. A. Schuler / Dr. W. Schröder<br />
141 Kolo-Ileoskopischer Untersuchungskurs<br />
Prof. Dr. P. Frühmorgen<br />
142 Gastroskopie<br />
Prof. Dr. T. Andus<br />
151 Lungenfunktionsmessung in der Praxis<br />
Dr. H. Mitfessel<br />
161 Beinvenenthrombosen - ambulant behandelt<br />
Dr. M. Hartmann<br />
171 Practical Skills - kleine Chirurgie<br />
Prof. Dr. R. Klein<br />
172 Allergologische Untersuchung - Einführungskurs<br />
Prof. Dr. H.-W. Baenkler / Dr. S. Beckh<br />
181 Neurologie aktuell: Kopfschmerzen<br />
Prof. Dr. H. Wiethölter<br />
182 Neurologie aktuell: Untersuchungskurs<br />
Prof. Dr. H. Wiethölter<br />
191 Palliativmedizin - Aufbaukurs Modul 1<br />
Dr. S. Stehr-Zirngibl / K. Reckinger<br />
221 Angewandte Endokrinologie<br />
PD Dr. M. Breidert<br />
222 Spielregeln und Tipps zur Privatliquidation<br />
Dr. B. Kleinken<br />
223 Körperliche Untersuchungstechniken<br />
Prof. Dr. H.-D. Klimm<br />
224 Sprechstunde Notfallmedikamente<br />
Prof. Dr. P. Sefrin<br />
230 Praxis der Gerinnungshemmung<br />
PD Dr. H. Bechtold / Dr. H. Elsaeßer<br />
231 Volkskrankheit Schilddrüsenknoten<br />
PD Dr. M. Luster<br />
232 Perspektive Assistenzarzt<br />
Prof. h.c. (BG) Dr. K. Goder<br />
240 Angststörungen<br />
Prof. Dr. V. Faust<br />
241 Das metabolische Syndrom: Klinik und Therapie<br />
Prof. Dr. A. Wirth<br />
242 Versorgung chronischer Wunden - erfolgreiche Konzepte<br />
Dr. S. Eder<br />
243 Schnupperkurs Sportmedizin<br />
Dr. H. Pabst<br />
244 Medizinisches Ozon<br />
Dr. R. Viebahn-Hänsler<br />
245 Arzt und Niederlassung<br />
Prof. h.c. (BG) Dr. K. Goder<br />
Arzt-Patienten-Seminare<br />
320 Aktuelles zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen<br />
321 Fibromyalgie<br />
322 Sichtweisen zur Sarkoidose<br />
KURSE<br />
SEMINARE<br />
Die Seminare/Kurse sind als ärztliche Fortbildungsveranstaltung zum Erwerb von Fortbildungspunkten bei der Landesärztekammer beantragt.
Anmeldung MEDCONGRESS Baden-Baden 29.06. - 05.07.2008<br />
Schutz- ermäßigte<br />
Kurse Seminare<br />
� Kongresskarte<br />
2. - 5.7. 09:00 - 20:00 120 �<br />
� Tageskarte<br />
09:00 - 20:00 40 �<br />
� 111<br />
29.6. - 5.7. 09:00 - 19:30 530 � 2<br />
430 � 2<br />
� 112 *<br />
2.7. 09:00 - 17:00 80 � 60 �<br />
� 113 *<br />
3.7. 09:00 - 12:00<br />
� 114 *<br />
3.7. 14:00 - 18:00 60 � 45 �<br />
� 115 *<br />
4.7. 09:00 - 12:00 60 � 45 �<br />
� 116<br />
4.7. 14:00 - 17:30<br />
� 117 *<br />
4.7. 14:00 - 17:00<br />
� 121<br />
29.6. - 2.7. So-Di 09:00 - 19:30 Mi 09:00 - 12:00 320 � 1<br />
250 � 1<br />
� 122<br />
2.7. - 5.7. Mi 14:00 - 19:30 Do-Sa 09:00 - 19:30 320 � 1<br />
250 � 1<br />
� 123<br />
29.6. - 5.7. 09:00 - 19:30 530 � 1<br />
430 � 1<br />
� 124<br />
2.7. 09:00 - 12:00<br />
� 125<br />
2.7. 09:00 - 12:00<br />
� 126<br />
2.7. - 4.7. Mi-Do 09:00 - 18:00 Fr 09:00 - 12:00 160 � 110 �<br />
� 127<br />
3.7. - 4.7. Do 09:00 - 18:00 Fr 09:00 - 12:00<br />
� 128<br />
4.7. 14:00 - 17:00<br />
� 129 � Leber/Abdomen 4.7.<br />
14:00 - 17:00<br />
� Schilddrüse/Thorax 5.7.<br />
09:00 - 12:00<br />
� Retroperitoneum 5.7.<br />
14:00 - 17:00<br />
� 131<br />
2.7. - 5.7. Mi-Fr 09:00 - 16:00 Sa 09:00 - 12:00 160 � 110 �<br />
� 132<br />
2.7. - 3.7. 14:00 - 17:00<br />
� 133 *<br />
3.7. 09:00 - 12:00<br />
� 134<br />
4.7. 09:00 - 18:00<br />
� 141<br />
2.7. - 3.7. 09:00 - 14:00 80 � 60 �<br />
� 142<br />
4.7. - 5.7. 09:00 - 17:00 100� 80 �<br />
� 151<br />
4.7. 14:00 - 18:00<br />
� 161<br />
3.7. 14:00 - 17:00<br />
� 171 *<br />
2.7. 14:00 - 17:30<br />
� 172<br />
4.7. 09:00 - 17:00<br />
� 181<br />
2.7. 14:00 - 15:00<br />
� 182<br />
2.7. 15:30 - 17:30<br />
� 191 *<br />
2.7. - 5.7. 09:00 - 18:30 380 � 300 �<br />
Tag der medizinischen Fachangestellten / Arzthelferin<br />
� 311 Schilddrüse<br />
5.7. 10:00 - 12:00 30 � 15 �<br />
312 3 � Diagnostik bei Schilddrüsenerkrankungen<br />
5.7. 13:30 - 15:00<br />
313 3 � Reanimationstraining 5.7. 13:30 - 15:00<br />
314 3 � Berufspolitik<br />
5.7. 13:30 - 15:00<br />
� 315 Ausbildung in der<br />
Arztpraxis<br />
5.7. 15:30 - 17:00<br />
MTAR-Forum Baden-Baden<br />
� 316 Aktuelle Vorgaben und<br />
Richtlinien in der Radiologie<br />
5.7. 10:00 - 16:00 30 � 15 �<br />
Titel / Name, Vorname<br />
Straße<br />
PLZ / Ort<br />
Telefon tagsüber<br />
E-Mail<br />
� 210 2.7. - 5.7. 09:00 - 11:00<br />
� 211 2.7. 09:00 - 12:00<br />
� 212 2.7. - 3.7. 09:00 - 12:00<br />
� 213 2.7. - 5.7. 11:00 - 13:00<br />
� 214 2.7. 14:00 - 17:00<br />
� 215 2.7. 14:00 - 17:00<br />
� 216 2.7. 16:00 - 18:00<br />
� 217 2.7. 17:30 - 20:00<br />
� 218 2.7. 17:30 - 19:30<br />
� 220 3.7. 09:00 - 12:30<br />
� 221 3.7. 14:00 - 17:00<br />
� 222 3.7. 14:00 - 17:00<br />
� 223 3.7. 14:00 - 17:00<br />
� 224 3.7. 18:00 - 20:00<br />
� 230 4.7. 09:00 - 12:00<br />
� 231 4.7. 14:00 - 17:00<br />
� 232 4.7. 17:30 - 20:00<br />
� 240 5.7. 09:00 - 12:00<br />
� 241 5.7. 09:00 - 12:00<br />
� 242 5.7. 09:00 - 12:00<br />
� 243 5.7. 09:00 - 17:00<br />
� 244 5.7. 10:00 - 12:00<br />
� 245 5.7. 14:00 - 18:00<br />
Bei Bezahlung bis zum<br />
30. April 2008<br />
erhalten Sie 10 % Rabatt<br />
auf alle Gebühren!<br />
* Begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung erforderlich<br />
1 Gebühr inkl. Verpflegung<br />
2 Gebühr inkl. Verpflegung u. Lehrbuch<br />
3 Bitte ein Thema auswählen<br />
Anmeldung und Gebühren<br />
Die Kongressgebühr entfällt bei Teilnahme an den gebührenpflichtigen Kursen. Die ermäßigte Gebühr gilt für Mitglieder der SWGIM e. V., BDI, Hartmannbund, Rationelle Arztpraxis, Abonnenten Via<br />
medici sowie arbeitslose Ärzte (jeweils Nachweispflicht!). Auf die Kongress- bzw. Tageskarte wird keine Ermäßigung gewährt. Mitglieder der MEDICA e. V. sowie Studenten und Auszubildende haben<br />
kostenfreien Zutritt zu allen Veranstaltungen. Bei Rücktritt wird generell eine Bearbeitungsgebühr i. H. von 15 � berechnet. Rücküberweisungen bereits eingezahlter Gebühren werden bei Rücktritt nach<br />
Abzug der Bearbeitungsgebühr unmittelbar nach dem Kongress vorgenommen. Ein Anspruch auf Rücküberweisung besteht nur, wenn der Antrag vor Beginn des Kongresses schriftlich beim Veranstalter<br />
eingereicht und bereits zugesandte Kongress- bzw. Tageskarten zurückgeschickt wurden.<br />
gebühr<br />
Gebühr<br />
Unterschrift / Stempel<br />
� Praxis � Klinik<br />
MEDICA Deutsche Gesellschaft für Interdisziplinäre Medizin e. V. � Postfach 70 01 49 � 70571 Stuttgart<br />
Telefon 0711 / 72 07 12-0 � Telefax 0711 / 72 07 12-29 � E-Mail bn@medicacongress.de � www.medicacongress.de<br />
Kra
Finanzierung<br />
– bei Einhaltung hæchstmæglicher Qualitåt – optimal koordiniert<br />
sind und optimale Kostenstrukturen aufweisen.<br />
Anspruch und Wirklichkeit<br />
Will man diesen Herausforderungen der Zukunft im Krankenhausmanagement<br />
gerecht werden und den Erfolg aktiv gestalten,<br />
dann benætigen das ækonomische und das medizinische<br />
Management detaillierte Daten çber die Art und Menge der<br />
Leistungen im Rahmen der Behandlungsprozesse und deren<br />
exakte Kosten, um Entscheidungen zu treffen çber<br />
n die inhaltliche Ausgestaltung und Planung des Ressourceneinsatzes<br />
der Behandlungsprozesse,<br />
n die Zusammensetzung des Leistungsportfolios,<br />
n die Ausgestaltung der Zusammenarbeit und die Abrechnung<br />
von Leistungen bei der Kooperation mit anderen Sektoren,<br />
n die Preissetzung fçr die DRGs und fçr Einzelleistungen, beispielsweise<br />
in Vereinbarungen mit Krankenkassen.<br />
Ein Großteil der dafçr erforderlichen Informationen låsst sich<br />
nur aus einer Kostentrågerrechnung ermitteln, die auf hauseigenen<br />
Daten beruht. Dazu ist eine solide Datengrundlage not-<br />
340<br />
Zusammenfassung<br />
das<br />
Krankenhaus 4.2008<br />
In der Vergangenheit war die Behandlungsqualitåt fçr die Patienten wenig transparent, starre Rahmenbedingungen schrånkten<br />
den Wettbewerb ein. Fachabteilungen waren die Objekte der betriebswirtschaftlichen Steuerung. Nur sehr begrenzt musste<br />
çber die eigenen Leistungen informiert werden. Bereits heute sind jedoch eine deutliche Aufweichung der starren Strukturen<br />
sowie ein intensiver Wettbewerb zwischen Kostentrågern um Versicherte einerseits und zwischen Krankenhåusern um<br />
Patienten andererseits festzustellen. Die Kunden fordern mehr Leistungstransparenz und preisgçnstige, qualitativ hochwertige<br />
Versorgungsangebote ihrer Versicherer. Die Versicherer stehen untereinander in zunehmendem Preiswettbewerb und<br />
geben den Druck an die Krankenhåuser weiter. Diese stehen vor der Aufgabe, ihre Einzelleistungen optimal zu strukturieren<br />
und kosteneffizient zu gestalten. Dies fçhrt zu der zweifelhaften Notwendigkeit detaillierter Informationen çber Inhalte und<br />
Kosten der einzelnen Leistungen/Prozesse.<br />
Detaillierte Informationen çber die Kosten der Prozesse erhålt man aus einer Kostentrågerrechnung. Eine herkæmmliche<br />
Kostenstellenrechnung, die historisch bedingt auf die Steuerung von Fachabteilungen als Entitåten ausgerichtet ist, kann<br />
diese Informationen nicht liefern. Abteilungspflegesåtze erforderten Kostenstellenrechungssysteme, DRGs erfordern Kostentrågerrechnungssysteme.<br />
Das bedeutet: Das Kosten- und Leistungsrechnungsinstrumentarium im Krankenhaus muss dringend<br />
weiterentwickelt werden. Die Kostentrågerrechnung ist durch das DRG-System und die Kalkulationsvorgaben des InEK<br />
auf dem Weg zum bundesweiten Standard.<br />
Grundlage einer aussagekråftigen Kostentrågerrechnung ist eine umfassende und lçckenlose Datenbasis çber die Kernleistungen<br />
im Krankenhaus. Viele Håuser verfçgen jedoch nicht çber die notwendige Datenqualitåt und verzichten daher auf<br />
die Einfçhrung einer Kostentrågerrechnung. Die Erfahrung der Autoren zeigt allerdings: Gerade wenn die Datenlage noch<br />
Lçcken aufweist, ist die Einfçhrung einer Kostentrågerrechung wichtig, da die intensive Beschåftigung mit der komplexen<br />
Thematik automatisch zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Datenlage fçhrt. Dabei ist in vielen Fållen die Aufstockung<br />
des im Controlling beschåftigten Personals notwendig und in der Regel gut investiertes Geld.<br />
Kostentrågerrechungsdaten werden vor allem durch das damit verknçpfte Benchmarking zu einem starken und wertvollen<br />
Steuerungsinstrument. Entsprechende Mæglichkeiten etablieren sich zunehmend am Markt und potenzieren den Informationsgehalt<br />
der solitår genutzten Kostentrågerrechungsdaten. Die Autoren empfehlen jedem Krankenhaus, die zeitnahe<br />
Einfçhrung einer Kostentrågerrechung – zunåchst nach dem Standard des InEK-Kalkulationshandbuches. Sie bildet die Basis<br />
und ermæglicht die Weiterentwicklung zu Grenzkostenrechnungen und Prozesskostenrechnungen. EDV-technische Hindernisse<br />
bestehen im Grunde nicht, die Aussagekraft wåchst mit der Zeit.<br />
wendig, die in den meisten Håusern nicht bzw. nicht im erforderlichen<br />
Ausmaß vorliegt. Fçnf Jahre nach der Einfçhrung<br />
der DRGs zeigt sich eine ernçchternde Bilanz. Es hat den Anschein,<br />
als sei der gesamte Krankenhausmarkt in eine Wettbewerbssituation<br />
gebracht worden, fçr die ihm die elementaren<br />
Informationen, um in Zukunft bestehen zu kænnen, noch weitgehend<br />
fehlen.<br />
Derzeit verfçgt die große Mehrheit der Krankenhåuser in<br />
der Regel çber eine Kostenstellenrechnung. Diese ist jedoch<br />
zur adåquaten Steuerung eines Leistungsportfolios und der<br />
einzelnen Prozesse hinter den zu DRGs zusammengefassten<br />
Behandlungen weitgehend ungeeignet. Noch immer weisen<br />
Krankenhåuser lediglich vereinzelt eine tragfåhige Kostentrågerrechnung<br />
auf. Geht man davon aus, dass ein Krankenhaus<br />
mit einer den Ansprçchen des InEK gençgenden Kostentrågerrechnung<br />
als Kalkulationshaus diesem seine Daten auch zur<br />
Verfçgung stellen wird, so gibt es derzeit nur 215 Krankenhåuser,<br />
in denen eine solche Kostentrågerrechnung vorhanden ist.<br />
Das sind nur knapp çber 10 Prozent der deutschen Krankenhåuser.<br />
Rund 80 Krankenhåuser sind 2007 bei der Abgabe der<br />
Kostentrågerrechnungsergebnisse an den Anforderungen des<br />
InEK gescheitert. Eine græßere Anzahl von Krankenhåusern<br />
beschåftigt sich nach eigenen Angaben derzeit mit der Einfçhrung<br />
einer Kostentrågerrechnung, kann aber noch keine vali-
4.2008<br />
das<br />
Krankenhaus Finanzierung<br />
den Ergebnisse hervorbringen. Die Angaben çber die Anzahl<br />
der Krankenhåuser schwanken hier betråchtlich, es ist aber anzunehmen,<br />
dass sicher weniger als 50 Prozent der Krankenhåuser<br />
in Deutschland ernsthaft damit begonnen haben, das<br />
Kostenrechungsinstrumentarium hin zu prozessbezogenen<br />
Ansåtzen weiterzuentwickeln.<br />
KTR als Steuerungsinstrument<br />
Durch die Einfçhrung des DRG-Systems, verknçpft mit der<br />
fallbezogenen Vergçtung, verschiebt sich zwangsweise der<br />
grundlegende Ansatz zur Steuerung eines Krankenhauses. Im<br />
Zentrum des Managements stehen nicht mehr die Leistungen<br />
einzelner Abteilungen, vergçtet durch Abteilungspflegesåtze,<br />
sondern Behandlungsfålle mit ihren Fallerlæsen. Die Elemente<br />
der Prozesse, die hinter diesen Fållen stehen, gilt es in ihren<br />
wirtschaftlichen Auswirkungen zu erfassen, zu bewerten und<br />
zu analysieren, um sie effizient zu gestalten. Daraus ergeben<br />
sich Ansprçche an eine Umorientierung und Weiterentwicklung<br />
in der Kostenrechnung der Krankenhåuser.<br />
n Die vorhandene Kostenstellenrechnung muss um eine aussagekråftige<br />
Kostentrågerrechnung ergånzt werden. Es reicht<br />
nicht mehr aus, die Wirtschaftlichkeit der Kostenstellen zu<br />
çberwachen, vielmehr muss ein Kosten-Erlæs-Vergleich bezogen<br />
auf die abgerechneten Leistungen mæglich sein.<br />
n Dazu mçssen auch die innerbetrieblichen Leistungen, die<br />
durch indirekte Kostenstellen fçr andere Bereiche erbracht<br />
werden, hinsichtlich ihres Umfangs und der Empfånger dokumentiert<br />
werden. Nur çber eine saubere Leistungserfassung<br />
ist das Leistungsgeschehen korrekt modellierbar und<br />
durch die Geschåftsfçhrung sowie die Abteilungsleiter optimierbar.<br />
n Die Erfassung der kostenrelevanten Daten muss vollståndig<br />
sein. Nur wenn Daten aus allen Bereichen, die die Gesamtheit<br />
des Leistungsgeschehens abbilden, vorliegen, sind Entscheidungen<br />
systematisch zu treffen. Die Forderung nach<br />
Lçckenlosigkeit der Datenerfassung klingt zunåchst sehr bçrokratisch<br />
und låstig – insbesondere fçr diejenigen, die die<br />
Daten erheben mçssen. Tatsåchlich aber ist jede lçckenhafte<br />
Leistungserfassung im Grunde unbrauchbar, da çber die<br />
Græße der Lçcke çblicherweise keine Transparenz besteht.<br />
Das fçhrt die gesamte Leistungserfassung ad absurdum,<br />
weil ihre Aussagekraft nicht bekannt ist. Kostenseitig bedeutet<br />
dies im ersten Schritt die Notwendigkeit einer sauber gefçhrten<br />
Kostenstellenrechnung.<br />
n Die erfassten Daten mçssen valide sein, das heißt, der kostentreibende<br />
Ressourcenverbrauch muss richtig gemessen<br />
werden. Letztlich bedeutet dies die Auseinandersetzung mit<br />
geeigneten Schlçsseln der Kostenverrechnung, um Leistungen<br />
verursachungsgerecht mit ihren Kosten zu belasten.<br />
n Um Transparenz çber das Leistungsgeschehen im Krankenhaus<br />
herbeizufçhren und gleichzeitig die benætigten Verrechnungsschlçssel<br />
bereitzustellen, mçssen zuallererst elementare<br />
Leistungs- und Kostendaten sauber erhoben werden.<br />
Dies bedeutet die richtige und vollståndige Kodierung<br />
der medizinischen Leistungen sowie die exakte und lçckenlose<br />
Leistungserfassung und Bewertung des Ressourcenverzehrs<br />
in såmtlichen direkten Kostenstellen mit Patientenkontakt,<br />
also: GOØ-Punkte im Labor, OP-Minuten, Dauer<br />
von Eingriffen in der Endoskopie usw., und zwar fçr jeden<br />
einzelnen Fall. Dieser Fallbezug ist von elementarer Wichtigkeit<br />
und sollte stets çber die Fallnummer des Patienten und<br />
in einer EDV erfolgen.<br />
Angesichts der bestehenden Unsicherheit çber kçnftige Entwicklungen<br />
ist es fçr eine verantwortungsvolle Krankenhaussteuerung<br />
ohnehin zwingend notwendig, diese Daten zur Verfçgung<br />
zu haben. Sie dienen dazu, die Leistungsrealitåt mæglichst<br />
wirklichkeitsgetreu abzubilden und so das Risiko von<br />
Fehlentscheidungen aufgrund mangelhafter Informationserhebung<br />
und -verarbeitung zu senken. Håufig werden jedoch<br />
Projekte zur Verbesserung der Datenqualitåt und Informationslage<br />
nachrangig behandelt. Dringende Abrechnungsfragestellungen<br />
werden vorgezogen und Entscheidungen çber die<br />
Weiterentwicklung strategischer Geschåftsfelder priorisiert.<br />
Dabei wird oft çbersehen, dass die Bereitstellung der entscheidungsrelevanten<br />
Informationen im Krankenhaus çberhaupt<br />
erst die Grundlage fçr solche Entscheidungen darstellt und<br />
sie somit mindestens eine genauso hohe Bedeutung hat wie<br />
andere Entscheidungen und parallel betrieben werden muss.<br />
Ein hervorragendes Hilfsmittel zur Umsetzung dieser Ansprçche<br />
ist das Kalkulationshandbuch des InEK. Es stellt eine Anleitung<br />
zur vollståndigen Erfassung der notwendigen Daten<br />
dar, die fçr die Ermittlung der Fallkosten notwendig sind.<br />
Einem integrierten Controlling, in dem Medizincontrolling<br />
und kaufmånnisches Controlling eine Einheit bilden, kommt<br />
dabei eine Schlçsselposition zu. Es ist verantwortlich dafçr,<br />
die Realitåt des Krankenhausbetriebes çber dokumentierte<br />
Kosten- und Leistungsdaten zu erfassen und zu aussagekråftigen<br />
Berichten zusammenzufçhren, auf deren Basis strategische<br />
und operative Entscheidungen getroffen werden. Allerdings<br />
sind die vorhandenen Ressourcen im Controlling håufig<br />
mit zeitraubenden sekundåren Tåtigkeiten gebunden und in<br />
den meisten Håusern viel zu knapp bemessen. Im Zweifel ist<br />
die personelle Besetzung des Controllings vor dem Hinter-<br />
– Anzeige –<br />
341
4.2008<br />
das<br />
Krankenhaus Finanzierung<br />
grund der enorm gestiegenen Anforderungen an die Informationsbereitstellung<br />
anzupassen. Es ist gut investiertes Geld,<br />
wenn damit die Unsicherheit çber die Kosten- und Leistungszusammensetzung<br />
im Hause reduziert und Fehlentscheidungen<br />
vermieden werden kænnen.<br />
Benchmarking mit Kalkulationsdaten<br />
Das Benchmarking der Kostentrågerkosten eræffnet den Krankenhåusern<br />
einen unschåtzbaren Zusatznutzen zur Kostentrågerrechnung.<br />
Ein erster Ansatz ist der Vergleich mit den vom InEK veræffentlichten<br />
Kalkulationsergebnissen der an der Fallkalkulation<br />
beteiligten Kalkulationshåuser. Immerhin eræffnet sich damit<br />
fçr ein Krankenhaus die Mæglichkeit, sich mit dem Durchschnitt<br />
der zur Fallkalkulation zugelassenen Håuser zu vergleichen.<br />
Die vom InEK bereitgestellten Daten liegen allerdings<br />
mit einem durchschnittlich 1,5-jåhrigen Zeitverzug vor. Infolge<br />
der individuellen Zielsetzung des InEK – nåmlich die Ermittlung<br />
der durch DRGs zu refinanzierenden Behandlungskosten<br />
– werden die Daten nach der Abgabe durch die Håuser vom<br />
InEK in vielerlei Hinsicht modifiziert und fçr ein Benchmarking<br />
insofern sehr bedenklich. Verwiesen sei hier nur auf die<br />
Nichtberçcksichtigung von Langliegern und sonderentgeltfåhigen<br />
Leistungen. Die Gefahr der Fehleinschåtzung der eigenen<br />
Kostenstrukturen beim Vergleich mit diesen Daten – und<br />
damit der Fehlsteuerung – ist hoch.<br />
Allerdings sind andere verlåssliche Quellen fçr valide<br />
Benchmarkwerte derzeit nur sehr vereinzelt vorzufinden und<br />
in der Regel einem exklusiven Teilnehmerkreis vorbehalten.<br />
Voraussetzung ist die Beteiligung an einer von einem unabhångigen<br />
Anbieter gepflegten und moderierten Datenbank, in<br />
der die Kosten- und Leistungsinformationen der beteiligten<br />
Krankenhåuser unveråndert gesammelt und die Auswertungen<br />
den Kunden in anonymisierter Form zur Verfçgung gestellt<br />
werden. Zweck ist primår die Situationsanalyse zur Bestimmung<br />
des relativen Erfolgspotenzials.<br />
Die bislang wohl am weitesten entwickelte Datenquelle<br />
stellt das Benchmark-Projekt der <strong>Solidaris</strong> <strong>Unternehmensberatungs</strong>-<strong>GmbH</strong><br />
Kæln dar, welches seit rund zwei Jahren die Kostentrågerrechnungsdaten<br />
aus rund 30 Krankenhåusern auswertet<br />
und den Teilnehmern sowohl auf der Kosten- als auch<br />
auf der Leistungsebene individuelle Benchmarkwerte zur Verfçgung<br />
stellt. Auf der DRG-Ebene werden so detaillierte Vergleiche<br />
der eigenen Kostenstrukturen fçr Behandlungsprozesse<br />
mit den Kosten des Durchschnitts der anderen Håuser oder<br />
gezielt mit den Kostenstrukturen eines bestimmten Hauses ermæglicht,<br />
die unmittelbar zur Kostensteuerung der Prozesse<br />
genutzt werden kænnen. Dabei kænnen beliebige Parameter<br />
zu Auswertungen fçr individuelle Fragestellungen auf der Gesamthaus-,<br />
der Fachabteilungs- oder der DRG-Ebene kombiniert<br />
werden. Das Benchmark-Projekt wird voraussichtlich ab<br />
dem nåchsten Jahr allen InEK-Kalkulationshåusern zugånglich<br />
gemacht, die mit der Abgabe Ihrer § 21-Daten ein unverfålschtes<br />
Kostenbenchmarking in der modularen Struktur untereinander<br />
betreiben kænnen.<br />
Allgemein kann festgestellt werden, dass die Einrichtung entsprechender<br />
IT-Læsungen die zielgerichtete Schaffung einer<br />
brauchbaren Datengrundlage fçr eine steigende Anzahl von<br />
Krankenhåusern beschleunigt. Dies zeigt die Erfahrung aus<br />
bislang çber 170 erfolgreich durchgefçhrten Kalkulationsprojekten<br />
fçr çber 40 Mandanten der <strong>Solidaris</strong> <strong>Unternehmensberatungs</strong>-<strong>GmbH</strong>.<br />
Die Einfçhrung einer Kostentrågerrechnung<br />
ist fast immer problemlos mæglich und birgt ganz erhebliche<br />
Synergien zu der in jedem Fall notwendigen Optimierung der<br />
allgemeinen Datenlage im Krankenhaus.<br />
Entwicklungsperspektiven<br />
Die Zahl der Krankenhåuser, die eine Kostentrågerrechnung<br />
einfçhren, steigt indes stetig. Dies beweist allein die Entwicklung<br />
der Anmeldezahl fçr die jåhrliche Datenerhebung des<br />
InEK, die sich in den letzten fçnf Jahren auf ca. 300 verdreifacht<br />
hat. Mindestens im gleichen Ausmaß schwindet die<br />
Zahl derer, die mit Enthusiasmus verkçnden, zur Steuerung<br />
reiche eine herkæmmliche Kostenstellenrechnung aus. Die Information,<br />
ob eine Behandlung gewinnbringend oder defizitår<br />
sei, nçtze nichts, da man die Kostenstrukturen auf der Basis<br />
dieser Daten nicht zielgerichtet beeinflussen kænne und die Erlæsseite<br />
(also der Basisfallwert oder das Relativgewicht) letztlich<br />
die Ursache fçr die Defizite sei. Wer so denkt, denkt in vielerlei<br />
Hinsicht zu kurz. Verkannt wird dabei insbesondere, dass auf<br />
die oft auch weiterhin notwendigen Steuerungsinformationen<br />
aus der bestehenden Kostenstellenrechnung ja nicht verzichtet<br />
werden muss; die Kostentrågerrechnung baut auf der bestehenden<br />
Kostenstellenrechnung auf, sie ersetzt sie nicht. Håuser<br />
ohne Kostentrågerrechnung verzichten auf wichtige Informationen.<br />
Dabei kommt dem Kalkulationsansatz des InEK nicht nur<br />
betriebswirtschaftlich, sondern auch volkswirtschaftlich eine<br />
åußerst interessante Rolle zu. Wenngleich nicht verbindlich<br />
vorgeschrieben, sind hier die Empfehlungen fçr eine Methode<br />
der Kostenrechnung weitaus strikter als çber die KHBV mit ihrem<br />
bisherigen Konten- und Kostenstellenrahmen. Die Methodik<br />
des Kalkulationshandbuches ist detailliert beschrieben und<br />
Grundlage fast aller derzeit existierenden Softwarelæsungen<br />
– Anzeige –<br />
343
Finanzierung<br />
zur Kostentrågerrechnung im Krankenhausbereich. Sie definiert<br />
so einen Standard fçr die gesamte Branche, weit çber<br />
die fçr das InEK interessante Fragestellung hinaus. Das Kalkulationshandbuch<br />
bewirkt auf diese Weise einen enormen Fortschritt<br />
in Bezug auf die Qualitåt und Quantitåt der im Krankenhaussektor<br />
insgesamt zur Verfçgung stehenden Informationen<br />
zu den Kosten der Behandlungsprozesse. Durch seine<br />
Einheitlichkeit und seine damit verbundene Nutzbarmachung<br />
zu einem bundesweiten Benchmarking sorgt dieser Standard<br />
in Zukunft fçr enorme Informationszugewinne derjenigen<br />
Krankenhåuser, die çber eine Kostentrågerrechung verfçgen.<br />
Nur diese Håuser kænnen hieraus individuelle Wettbewerbsvorteile<br />
durch Informationsvorsprung generieren – Håusern<br />
ohne eigene Kostentrågerrechnung bleibt diese wichtige Informationsquelle<br />
verschlossen.<br />
Ausblick<br />
Die Kostentrågerrechnung als Vollkostenrechung nach dem<br />
InEK-Kalkulationshandbuch ist als ein erster Schritt hin zu<br />
mehr DRG- und damit fallbezogener Kostentransparenz zu betrachten.<br />
Sie stellt die Pflicht dar, der sich die Krankenhåuser<br />
baldmæglichst stellen mçssen. In Zukunft wird es erforderlich<br />
sein, die Kostentrågerrechnung in Richtung auf Teil- und<br />
Grenzkostenbetrachtungen auszubauen und Patientenpfade<br />
mit Hilfe von Prozesskostenrechnungen zu kalkulieren.<br />
Mittlerweile dçrfte niemand mehr bezweifeln, dass der eingeschlagene<br />
Weg in der Kalkulation von Behandlungsfållen<br />
mit einiger Sicherheit irreversibel ist. Zu groß sind bereits der<br />
bçrokratische Apparat und die wirtschaftlichen Strukturen, die<br />
um das Entgeltsystem gewachsen sind, und zu groß ist der Erfolg<br />
im Sinne der politischen Zielsetzungen. Es wird vielmehr<br />
bereits çber die Ausweitung des Systems auf ambulante und<br />
psychiatrische Leistungen nachgedacht und das G-DRG-Sys-<br />
344<br />
tem mit Erfolg in die Schweiz exportiert. Selbst China hat Interesse<br />
an dem System bekundet. Deutsche Krankenhåuser<br />
sollten auch hinsichtlich der Weiterentwicklung der Kostenrechnung<br />
zukunftsorientiert handeln.<br />
Literatur<br />
Bræsel, Gerrit; Kæditz, Franka; Schmitt, Carsten: Kostentrågerrechnung im Krankenhaus<br />
– Anforderungen unter DRG-Bedingungen, in: Controlling & Management – ZfCM.<br />
Wiesbaden, Gabler, 48. Jg. (2004), Seite 247 ff.<br />
Dçsch, Elke; Platzkæster, Clemens; Steinbach, Thomas: Kostentrågerrechnung als<br />
Steuerungsinstrument im Krankenhaus – eine mægliche Weiterfçhrung der Kostenund<br />
Leistungsrechnung, in: BfuP 2/2002, Seite 144 ff.<br />
Greiling, Michael: Prozesskostenrechnung im Krankenhaus, Instrument und Umsetzung<br />
zur Kalkulation von DRGs, in: das Krankenhaus, 6/2002, Seite 467 ff.<br />
Keun, Friedrich; Prott, Roswitha: Einfçhrung in die Krankenhauskostenrechnung, Anpassung<br />
an die neuen Rahmenbedingungen, 6. Auflage, Wiesbaden, Gabler (2006)<br />
InEK (Hrsg.): Kalkulation von Fallkosten, Handbuch zur Anwendung in Krankenhåusern,<br />
Version 3.0, 2007<br />
Anmerkungen<br />
1) Vergleiche Deutsche Krankenhausgesellschaft (Hrsg.): http://www.dkgev.de, siehe<br />
auch: http://www.wdr.de/themen/gesundheit/gesundheitswesen/pflege/070719.<br />
jhtml<br />
2) Vergleiche Deutsche Krankenhausgesellschaft – Zahlen, Daten, Fakten 2007, Seite<br />
16 und 35<br />
Anschriften der Verfasser<br />
31. Deutscher<br />
Krankenhaustag<br />
das<br />
Krankenhaus 4.2008<br />
Dipl.-Oek. Mathias Larbig, Prokurist, <strong>Solidaris</strong> <strong>Unternehmensberatungs</strong>-<strong>GmbH</strong>,<br />
Von-der-Wettern-Straße 13, 51149 Kæln, E-Mail:<br />
m.larbig@solidaris.de/Prof. Dr. Dagmar Ackermann, Hochschule<br />
Niederrhein, Fachbereich 09 Gesundheitswesen, Postfach 100762,<br />
47707 Krefeld, E-Mail: dagmar.ackermann@hs-niederrhein.de<br />
Dçsseldorf, 19.–22. November 2008