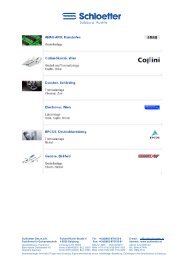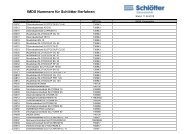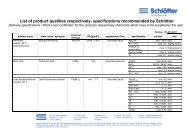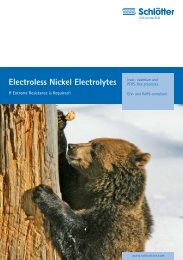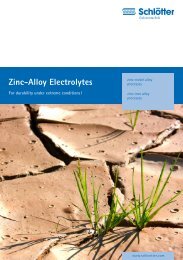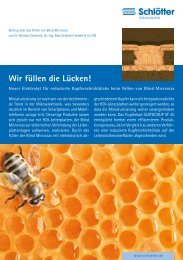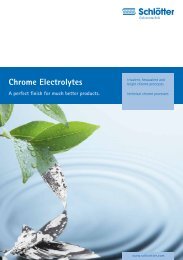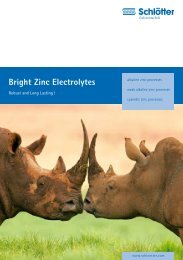Die Metallabscheider BElektrochemieV - Wiley Online Library
Die Metallabscheider BElektrochemieV - Wiley Online Library
Die Metallabscheider BElektrochemieV - Wiley Online Library
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
640 BMagazinV Elektrochemie<br />
Abb. 4. Vollständig mit Kupfer gefüllte Sacklochbohrung; diese<br />
Blind Microvias ermöglichen eine Steigerung der Integrationsdichte<br />
und somit eine weitere Miniaturisierung der Leiterplatte.<br />
(Foto: Dr.-Ing. Max Schlötter)<br />
ner Verfahrensschritte aus der<br />
Kunststofftechnik und der Galvanotechnik<br />
führt zu neuen Designelementen,<br />
beispielsweise hinterleuchteten<br />
Bedienelementen im<br />
Innenbereich der Automobile (Abbildung<br />
1, S. 636).<br />
Galvanoformung<br />
S Mit Galvanoformung entstehen<br />
galvanische Erzeugnisse durch Abscheidung<br />
dicker Schichten auf einer<br />
Negativform. Zu Beginn des<br />
20. Jahrhunderts stellte die Galvanoplastische<br />
Kunstanstalt des<br />
Haushaltswarenunternehmens<br />
WMF in Geislingen an der Steige<br />
Großplastiken her. Ein spektakuläres<br />
Beispiel ist eine originalgetreue<br />
Kopie der 4 mal 6 Meter großen<br />
Paradiestür des Baptisteriums in<br />
Florenz von Lorenzo Ghiberti (Abbildung<br />
2, S. 638). <strong>Die</strong> heutigen<br />
Anwendungen der Galvanoformung<br />
sind zwar weniger spektakulär,<br />
aber dennoch in vielen Anwendungen<br />
präsent. So werden beispielsweise<br />
Scherfolien für Rasierapparate<br />
durch Galvanoformung<br />
hergestellt.<br />
Durch Galvanoformung lassen<br />
sich Mikrostrukturen mit hoher<br />
Genauigkeit abbilden. Im Automobilbau<br />
werden so Komponenten<br />
mit lederartig genarbter Oberfläche<br />
in Spritzgussprozessen hergestellt,<br />
deren Formen durch Galvanoformung<br />
von echten Lederoberflächen<br />
abgenommen wurden (Abbil-<br />
dung 3, S. 638). <strong>Die</strong> Galvanoformung<br />
von Mastern ergibt hochpräzise<br />
Werkzeuge, womit sich preiswert<br />
Bauteile in hoher Stückzahl,<br />
beispielsweise für die Mikrosystemtechnik,<br />
herstellen lassen.<br />
Verschleißschutz, Tribologie<br />
S Galvanisch oder außenstromlos<br />
abgeschiedene Schichten verbessern<br />
auch die tribologischen Eigenschaften<br />
von Oberflächen und verlängern<br />
so die Lebensdauer von<br />
Produkten. <strong>Die</strong> Reibung zwischen<br />
beweglichen Bauteilen zu vermindern,<br />
verringert den Energieverbrauch<br />
und schont Ressourcen<br />
durch die verlängerte Lebensdauer<br />
der Komponenten. Galvanisch abgeschiedene<br />
Chromschichten werden<br />
beispielsweise als Oberflächen<br />
für Hydraulikzylinder oder Druckwalzen<br />
verwendet.<br />
Auch in die galvanisch abgeschiedenen<br />
Schichten eingelagerte<br />
Feststoffpartikel verbessern die tribologischen<br />
Eigenschaften. <strong>Die</strong>se<br />
Möglichkeit wird besonders bei der<br />
elektrolytischen oder außenstromlosen<br />
Nickelabscheidung praktiziert.<br />
Um die Reibung zu vermindern,<br />
werden Trockenschmierstoffe<br />
wie Polytetrafluorethen (PTFE),<br />
Graphit, hexagonales Bornitrid<br />
oder Molybdändisulfid eingesetzt.<br />
<strong>Die</strong> Mitabscheidung von Hartstoffpartikeln<br />
wie Diamant, Carbiden,<br />
Nitriden und Oxiden von Chrom,<br />
Silicium oder Aluminium verbessert<br />
die Härte und Abriebbeständigkeit.<br />
Elektrotechnik und Elektronik<br />
S Für elektronische Baugruppen<br />
dient das Weichlöten als Verbindungstechnik.<br />
Voraussetzung dafür<br />
ist eine gute Weichlötbarkeit der zu<br />
verbindenden Bauteile. Kupfer als<br />
wesentlicher Werkstoff für elektronische<br />
Baugruppen oxidiert sehr<br />
leicht und ist in dieser Form nur<br />
noch mit aggressiven Flussmitteln<br />
zu löten. Da diese wegen ihres korrosiven<br />
Charakters nicht einsetzbar<br />
sind, müssen die Komponenten<br />
mit einem Überzug versehen wer-<br />
den, der sie auch nach einer Lagerzeit<br />
von mehreren Jahren weichlötbar<br />
macht. Früher wurden die Bauteile<br />
daher mit einem elektrolytisch<br />
abgeschiedenen Zinnbleiüberzug<br />
beschichtet. Der Gesetzgeber hat<br />
die Verwendung von Blei in Form<br />
von Bleizinnlot oder galvanischen<br />
Zinnbleiüberzügen stark eingeschränkt;<br />
heute werden deshalb<br />
hauptsächlich Reinzinnbeschichtungen<br />
eingesetzt.<br />
<strong>Die</strong> Kupferabscheidung aus<br />
schwefelsauren Elektrolyten ist ein<br />
wesentlicher Prozessschritt bei der<br />
Produktion von Leiterplatten.<br />
Elektrolyte der neuesten Generation<br />
scheiden Kupfer dabei bevorzugt<br />
in sehr kleinen Sacklochbohrungen<br />
(Blind Microvias) ab. Vollständig<br />
mit Kupfer gefüllte Blind<br />
Microvias (Abbildung 4) steigern<br />
die Integrationsdichte und ermöglichen<br />
somit eine weitere Miniaturisierung<br />
der Leiterplatte. So sind<br />
in der Mobilelektronik immer kleinere,<br />
leichtere und trotzdem leistungsfähigere<br />
Geräte wie Smart -<br />
phones möglich.<br />
Quellen und Anmerkungen<br />
1) IKB Branchenreport Oberflächentechnik<br />
2005.<br />
2) Umweltbundesamt: „Galvanische Oberflächenbeschichtung“,<br />
Internet, Stand<br />
2.3.2011 (www.umweltbundesamt.de/<br />
nachhaltige-produktion-anlagen<br />
sicherheit/nachhaltige-produktion/<br />
galvanik.htm.<br />
3) www.aluminal.de/home.html<br />
4) Karl S. Ryder, „Aluminium Electroplating<br />
in Ionic Liquids“, IONMET DGO, München,<br />
März 2009.<br />
Manfred Jordan, Jahrgang<br />
1949, studierte Chemie an<br />
der Universität Mainz. Der<br />
promovierte Chemiker ist<br />
seit dem Jahr 1980 Mitarbeiter<br />
der Fachfirma für<br />
Galvanotechnik Dr.-Ing. Max Schlötter in<br />
Geislingen an der Steige, seit 2005 leitet er die<br />
Abteilung Forschung und Entwicklung.<br />
jordan@schloetter.de<br />
Michael <strong>Die</strong>tterle, Jahrgang<br />
1966, studierte Chemie<br />
an der Universität<br />
Ulm. Der promovierte Chemiker<br />
ist seit dem Jahr<br />
1997 Mitarbeiter der Forschung<br />
und Entwicklung bei Schlötter, seit<br />
2005 als stellvertretender Forschungsleiter.<br />
Nachrichten aus der Chemie| 60 | Juni 2012 | www.gdch.de/nachrichten