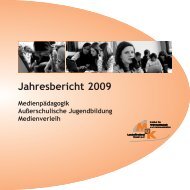Jahresbericht 2006 als PDF laden - MuK
Jahresbericht 2006 als PDF laden - MuK
Jahresbericht 2006 als PDF laden - MuK
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Jahresbericht</strong><br />
<strong>2006</strong><br />
Medienkompetenz<br />
Medienverleih<br />
Präventiver Jugendmedienschutz<br />
Vorgelegt zur Mitgliederversammlung<br />
am 24.1.2007 in Frankfurt/Main<br />
Institut für Medienpädagogik und Kommunikation - Landesfilmdienst Hessen e. V.<br />
Kennedyallee 105a, 60596 Frankfurt/Main T. 069/630094-0, F. 069/63009435 Email: muk@mukhessen.de<br />
http://www.muk-hessen.de
2<br />
Konsolidierung – Intensivierung – Aktivierung<br />
Nach den turbulenten Zeiten des Jahres<br />
2005 mit den Umstrukturierungen ist das<br />
Jahr <strong>2006</strong> zu dem Jahr der Konsolidierung<br />
geworden.<br />
Die ersten Monate waren geprägt von den<br />
organisatorischen Veränderungen, insbesondere<br />
der Eingliederung der vielfältigen<br />
Verleihmaterialien in das Archiv der Frankfurter<br />
Filmothek, von der aus nun zentral<br />
der Medienverleih für ganz Hessen gestaltet<br />
wird.<br />
Dabei wurde das Konzept der Dauerausleihen<br />
konsequent weiter verfolgt. Dadurch<br />
konnten die Verleihergebnisse auf dem<br />
Stand des Vorjahres gehalten werden. Bei<br />
der Anzahl der Vorführungen gab es eine<br />
leichte Steigerung, die Summe der erwirtschafteten<br />
Einnahmen bei der Konferenz<br />
der Landesfilmdienste pendelte sich auf<br />
dem hohen Niveau des Vorjahres ein.<br />
Dies war der konsequenten Verleiharbeit<br />
der Mitarbeiter in der Filmothek zu verdanken,<br />
die den Dauerleihnehmern neue<br />
Produktionen zur Verfügung stellten und<br />
ihre Bedürfnisse kontinuierlich abfragten.<br />
Zum Hessentag wurde eine große Werbeaktion<br />
für Streaming-Media und Download<br />
gestartet. Allerdings zeigte sich, dass dieses<br />
Dienstleistungsangebot nicht in dem<br />
wünschenswerten Umfang angenommen<br />
wird.<br />
Um das zu erreichen, bedarf es eines<br />
konsequenten Umdenkens. Es reicht nicht<br />
aus, ein modernes Distributionssystem<br />
über das Internet bereit zu stellen. Wenn<br />
die Landesfilmdienste in diesem Marktsegment<br />
<strong>als</strong> Partner für vielfältige Filmgeber<br />
wahrgenommen werden sollen, dann<br />
ist es dringend notwendig, die Medien<br />
durch entsprechende Materialien im didaktischen<br />
Sinne zu ergänzen.<br />
Wir haben uns im vergangenen Jahr intensiv<br />
darum bemüht, bei der Konferenz<br />
der Landesfilmdienste zentral ein solches<br />
Dienstleistungsangebot aufzubauen und<br />
weiter zu entwickeln. Zusammen mit dem<br />
KreisJobCenter in Marburg konnten wir in<br />
einem Probearbeitsverhältnis zwei Medienproduktionen<br />
entsprechend bearbeiten<br />
und die Ergebnisse in der Geschäftsführertagung<br />
der Konferenz der Landesfilmdienste<br />
vorstellen.<br />
Leider sind die Vorbehalte gegen eine<br />
derartige professionelle Aufbereitung der<br />
Medien und eine ansprechende Präsentation<br />
zusätzlicher Informationsmaterialien<br />
immer noch nicht aus dem Weg geräumt.<br />
Der Vorstand hat deshalb dringend empfohlen,<br />
dass wir uns in den nächsten Monaten<br />
nochm<strong>als</strong> intensiv um eine personelle<br />
Lösung gemeinsam mit der Konferenz<br />
der Landesfilmdienste bemühen werden.<br />
Wenn wir, die Landesfilmdienste, nicht in<br />
der Lage sind, ein Medienangebot, das<br />
modernsten Anforderungen entspricht, zu<br />
entwickeln, dann wird es schwierig werden<br />
das von der Konferenz der Landesfilmdienste<br />
für uns alle entwickelten Distributionssystem<br />
Streaming und Download auch<br />
finanziell erfolgreich zu etablieren.<br />
Im Laufe des Jahres haben wir uns entschlossen,<br />
unsere Darstellung im Internet<br />
professionell zu verändern. Die Homepage<br />
des Instituts wird intensiv überarbeitet und<br />
modernisiert. Vorab wurde bereits im Laufe<br />
des Jahres der Newsletter neu konzipiert<br />
und den Mitgliedern sowie weiteren<br />
Interessenten zur Verfügung gestellt.<br />
Die medienpädagogische Arbeit hat an<br />
Intensität zugenommen. Es wurde ein weiteres<br />
Projekt „Kinder und Medien“ in zwölf<br />
Kindertagesstätten durchgeführt sowie ein<br />
Radioprojekt in acht ausgewählten Grundschulen<br />
und Horten.<br />
Ein besonderes Highlight war das gemeinsam<br />
mit der Landesanstalt für den Privaten<br />
Rundfunk in Kassel und Radio FFH<br />
durchgeführte Radioprojekt, das hessenweit<br />
Aufmerksamkeit erregt hat.<br />
Um den Weiterbildungsbedürfnissen der<br />
Lehrerinnen und Lehrer nachzukommen<br />
haben wir ein neues Angebot mit zertifi-
zierten Bildungsangeboten im Rahmen der<br />
Medienpädagogik und Medienkompetenzvermittlung<br />
entwickelt. Es zeigte sich aber,<br />
dass diese Veranstaltungen nicht in der<br />
Weise registriert und angenommen wurden,<br />
wie wir es zu erwarten hofften. Wir<br />
werden unsere Anstrengungen intensivieren<br />
müssen, um die Medienpädagogik in<br />
der institutionellen Pädagogik vor allem<br />
eben in der Schule stärker zu verankern.<br />
Dies ist um so notwendiger, weil im vergangenen<br />
Jahr immer wieder neue alte<br />
Mediendiskussionen und Medienwirkungsvermutungen<br />
aufgetaucht sind. Ausgelöst<br />
durch Gewaltexzesse Jugendlicher<br />
ist es verstärkt zu einer Konzentration auf<br />
die angebliche Kausalität zwischen Gewalthandlungen<br />
und Gewalt in den Medien<br />
gekommen.<br />
Es ist unbestritten, dass es zwischen realer<br />
Gewalt und virtueller Gewalt Beziehungen<br />
gibt. Wenn aber die Medien zu alleinigen<br />
Sündenböcken gemacht werden,<br />
dann verhindert dies eine sachliche und<br />
kritische medienpädagogische Auseinandersetzung,<br />
die dringend erforderlich ist.<br />
Hinzu kommt eine unangemessene Abqualifizierung<br />
der Kinder und Jugendlichen,<br />
wenn diese <strong>als</strong> Medienkinder bezeichnet<br />
werden, die „dick, dumm und<br />
gewalttätig“ seien. Das Verhalten von Kindern<br />
und Jugendlichen ist immer Ausdruck<br />
ihrer Rolle in der Gesellschaft, Ausdruck<br />
von Erziehung und Bildung. Es ist deshalb<br />
notwendig, die Rolle der Medien in der<br />
Sozialisation von Kindern und Jugendlichen<br />
kritisch zu hinterfragen und dabei<br />
sowohl die positiven Wirkungen <strong>als</strong> auch<br />
die Risikofaktoren herauszustellen, um<br />
einen sachgerechten und kompetenten<br />
Medienumgang zu erreichen.<br />
Im Jahr <strong>2006</strong> wurde vom Hessischen<br />
Landtag das Jugendbildungsförderungsgesetz<br />
novelliert mit der Möglichkeit, dass<br />
nunmehr neue „Sonstige Träger“ der Jugendbildung<br />
(zu denen wir gehören) anerkannt<br />
werden können. Leider hat die gesetzliche<br />
Veränderung nicht berücksich-<br />
Mitglieder:<br />
tigt, dass bei einer höheren Zahl von<br />
Anerkennungen automatisch auch weitere<br />
finanzielle Mittel benötigt werden, um die<br />
inhaltliche Arbeit personell zu ermöglichen.<br />
Als Geschäftsstelle der „Sonstigen Träger“<br />
haben wir bei der Anhörung zur Novellierung,<br />
dem Sozialministerium direkt sowie<br />
gegenüber der Vorsitzenden des Sozialpolitischen<br />
Ausschusses im Hessischen<br />
Landtag auf diese Problematik hingewiesen.<br />
Ein weiteres Problem mit einer möglichen<br />
finanziellen negativen Auswirkung hat sich<br />
Ende <strong>2006</strong> aufgetan durch die beabsichtigte<br />
Novellierung des Hessischen Privatrundfunkgesetzes.<br />
Wenn, wie im Entwurf<br />
vorgesehen, die Mittel für Offene Kanäle,<br />
die Nicht-Kommerziellen-Lokalradios und<br />
die Projekte der Medienkompetenz erheblich<br />
reduziert werden, dann besteht die<br />
Befürchtung, dass wir in Zukunft weniger<br />
medienpädagogische Projekte erhalten.<br />
Dies wäre für unsere inhaltliche Arbeit<br />
eine erhebliche Verschlechterung und<br />
auch im finanziellen Bereich würde uns<br />
das neue Schwierigkeiten bereiten. Es ist<br />
zu hoffen, dass gerade angesichts der<br />
medialen Situation und der gesellschaftspolitischen<br />
Diskussionen über Medienwirkung<br />
die Mittel für Medienkompetenz nicht<br />
reduziert, sondern eher erhöht werden.<br />
Für die inhaltliche Arbeit ergab sich im<br />
vergangenen Jahr stärker die Herausforderung,<br />
noch mehr <strong>als</strong> bisher in der medienpädagogischen<br />
Fortbildung tätig zu<br />
werden, insbesondere in der medienpädagogischen<br />
Elternbildung. Perspektivisch<br />
werden wir dazu Konzepte erarbeiten und<br />
Modelle anbieten.<br />
Frankfurt, 24.01.2007<br />
3
Landkreise:<br />
Bergstraße<br />
Darmstadt-Dieburg<br />
Fulda<br />
Gießen<br />
Hersfeld-Rotenburg<br />
Limburg-Weilburg<br />
Main-Taunus<br />
Marburg-Biedenkopf<br />
Odenwald<br />
Offenbach<br />
Rheingau-Taunus<br />
Vorstand:<br />
1. Vorsitzender:<br />
Paul Leo Giani, Ginsheim-<br />
Gustavsburg,<br />
2. Vorsitzende:<br />
Doris Reitz-Bogdoll, Hanau<br />
4<br />
Städte:<br />
Darmstadt<br />
Frankfurt<br />
Fulda<br />
Gießen<br />
Marburg<br />
Rüsselsheim<br />
Wetzlar<br />
Wiesbaden<br />
Beisitzer:<br />
Dieter Herwig, Kassel<br />
Birgit Goelnich, Wiesbaden<br />
Helmut Poppe, Kelkheim<br />
Verena Ketter, Wiesbaden<br />
Roland Sautner, Frankfurt<br />
Markus Weber, Dieburg,<br />
Der Vorstand tagte am 25.1.<strong>2006</strong>, 26.4.<strong>2006</strong>, 20.12.<strong>2006</strong><br />
Personal:<br />
Detlef Ruffert<br />
Geschäftsführer<br />
Inge Fartak<br />
Sekretariat<br />
Finanzen:<br />
Karsten Krügler<br />
Jugendbildungsreferent<br />
Peter Schulz<br />
Jugendbildungsreferent<br />
Organisationen:<br />
Deutsches Jugendherbergswerk,<br />
Hessen<br />
Hess. Jugendring<br />
Sparkassen- und Giroverband<br />
Landesverband der Ev. Jugend<br />
Die Falken, Hessen<br />
Ehrenmitglied:<br />
Walter Rosenwald, Wiesbaden<br />
Beratendes Mitglied:<br />
Lorenz Wobbe, Wiesbaden,<br />
Hess. Landkreistag<br />
Franz Hohmann<br />
Filmothek<br />
Peter Vasters<br />
Filmothek<br />
Die positive Entwicklung der Finanzen setzte sich im Wirtschaftsjahr <strong>2006</strong> ungebrochen fort.<br />
In der Planung zum Wirtschaftsjahr <strong>2006</strong> hatten wir ursprünglich mit einem Überschuss in<br />
der Größenordnung von 22.000 € gerechnet.<br />
Durch eine Verbesserung der Einnahmen um rund 20.000 € und eine Verminderung der<br />
Ausgaben um rund 30.000 € ist es gelungen einen Überschuss am Ende des Jahres <strong>2006</strong><br />
von rund 77.000 € auszuweisen.<br />
Unser Bestand am Ende des Wirtschaftsjahres <strong>2006</strong> beläuft sich nunmehr auf 141.195 €.<br />
Erfreulich aus finanzieller Sicht ist die Konsolidierung des Medienverleihs durch die Dauerausleihen.<br />
Ebenso erfreulich ist es, dass wir wieder drei Projekte, die von der Landesanstalt<br />
für Privaten Rundfunk finanziert wurden, im Bereich der Medienkompetenzförderung und des<br />
präventiven Jugendmedienschutzes durchführen konnten.
Medienverleih:<br />
Im Medienjahr <strong>2006</strong> wurde der Medienverleih auf dem Niveau des Vorjahres stabilisiert.<br />
<strong>2006</strong> wurden 103.691 Vorführungen erzielt. Das entspricht einer Steigerung gegenüber 2005<br />
von 1,59 %.<br />
Vorführungen<br />
2004 78.401<br />
2005 102.071<br />
<strong>2006</strong> 103.691<br />
Wir sind mit dem Ergebnis von <strong>2006</strong> mit 13,34 % am Gesamtergebnis der Konferenz der<br />
Landesfilmdienste beteiligt und nehmen weiterhin bundesweit den 2. Platz in der Verleihtätigkeit<br />
aller Landesfilmdienste ein.<br />
Dieses Ergebnis konnte nur durch die festen Verleihkunden erreicht werden. Trotz einiger<br />
Wechsel betreuten wir 135 feste Kunden (Dauerentleiher). Darüber hinaus sind über 500<br />
Medien der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in 122 Mediendepots verteilt.<br />
Hier einige ausgewählte Filmgeber (Auftraggeber) und die im vergangenen Jahr erzielten<br />
Vorführzahlen:<br />
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 36.147<br />
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 20.151<br />
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 12.859<br />
Greenpeace 4.617<br />
SOS-Kinderdörfer 2.971<br />
Chancen für alle – Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft 2.848<br />
Deutscher Bundestag 2.772<br />
Centrale Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft 2.077<br />
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft 2.035<br />
UNHCR 1.546<br />
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 1.115<br />
Sozial- und Entwicklungshilfe Kolpingwerk 1.078<br />
Insgesamt umfaßte das Verleihangebot zum Ende des Jahres <strong>2006</strong><br />
2.815 Titel mit 14.126 Medien.<br />
2005 <strong>2006</strong><br />
Video 10.665 10.714<br />
16mm 2.726 2.737<br />
Dia 3 20<br />
CD 241 241<br />
Folien 23 23<br />
Medienpaket 122 122<br />
DVD 289 269<br />
Neue Titel im Medienverleih (Auswahl):<br />
Die Himmelswiese - Die kleine Wunder von<br />
Baan Gerda<br />
Mama Coulibaly – die Erfolgsgeschichte von<br />
Mikrokrediten<br />
Am Puls des Verbrechens – Das Bundeskrimi-<br />
nalamt<br />
Ergonomie im Büro<br />
Rückenprävention oder Mein innerer Schweinehund<br />
und ich<br />
Der ESF unterstützt junge Menschen<br />
5
Die glücklichsten Menschen der Welt<br />
Vom Kochen und Weinen – Bangladeschs<br />
Frauen auf den Weg aus der Armut<br />
Der Richter und der Fanatiker – Im Dialog mit<br />
dem Terror<br />
Härtetest<br />
Swetlana<br />
SOS Weltmeer – Komm an Bord. Werde Meeresschützer<br />
Global View <strong>2006</strong><br />
Flüchtlinge schützen<br />
BioFuture – Auf kluge Köpfe setzen<br />
Biotechnologie – Made in Germany<br />
Hessentag/Newsletter/Öffentlichkeitsarbeit:<br />
6<br />
Der ESF – Ein Instrument der Arbeitsmarktpolitik<br />
Tatort: Blutdiamanten<br />
Shoot Go<strong>als</strong>! Shoot Movies<br />
China – Eine vierteilige Dokumentation<br />
Globalisierung gerecht gestalten<br />
JuPo – JungPositiv<br />
Pick it up! Prävention von MigrantInnen für<br />
MigrantInnen<br />
Gleiche Chancen in Europa – 50 Jahre Europäischer<br />
Sozailafonds<br />
Cotton King I und II – oder Baumwolle <strong>als</strong><br />
Schicksal<br />
Bionik – Die verborgenen Vorbilder der Natur<br />
Im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit nahmen wir <strong>2006</strong> wieder mit einem Stand am Hessentag<br />
in Hessisch-Lichtenau teil, dieses Mal in der repräsentativen Halle 1 der Landesausstellung.<br />
Neben den Medienvorführungen und Informationen über das Medienangebot wurde am<br />
Stand vor allem StreamingMedia präsentiert und dafür geworben. Wie immer waren die<br />
„Sichtweisen“ unsere besten Give-Aways. Das „Mitmach-Quiz“ zum Thema 60 Jahre Hessen<br />
wurde von der Landeszentrale für politische Bildung mit einer großzügigen Buchspende unterstützt.<br />
Neben einem Flyer zu StreamingMedia wurde im Rahmen der pädagogischen Arbeit ein<br />
Faltblatt mit den zertifizierten medienpädagogischen Angeboten für Lehrerinnen und Lehrer<br />
herausgebracht.<br />
Der Newsletter wurde neu gestaltet und steht den Mitgliedern und Interessenten über das<br />
Netz zur Verfügung.<br />
Kontakte/Organisatorisches/Sonstiges:<br />
Der Geschäftsführer war Mitglied der Jury Allgemeine Programme des Adolf Grimme Preises<br />
und war tätig <strong>als</strong> Prüfer bei der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) in Berlin<br />
und der Freiwilligen Selbstkontrolle der deutschen Filmwirtschaft in Wiesbaden (FSK).<br />
Er ist außerdem beratendes Mitglied im Informationsausschuß der IHK Frankfurt und<br />
Mitglied in der Medienpolitischen Kommission des SPD-Landesverbandes.<br />
Das Institut vertritt die Konferenz der Landesfilmdienste im Fernsehworkshop Entwicklungspolitik<br />
und hat die Geschäftsführung inne.<br />
Das Institut ist Mitglied<br />
• im Deutschen Jugendherbergswerk, Landesverband Hessen,<br />
• in der Hess. Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitserziehung,<br />
• im Bundesverband Jugend und Film,<br />
• in der Gesellschaft für Medienpädagogik, Landesverband Hessen.<br />
Turnusmäßig hat das Institut die Geschäftsführung der „Sonstigen Träger“ nach dem Jugendbildungsförderungsgesetz<br />
übernommen.<br />
Medienpädagogik - Aus der medienpädagogischen Praxis <strong>2006</strong><br />
1. Projekte:<br />
Projekt: Kinder und Medien (Bausteinkonzeption)<br />
Bausteinkonzept in Zusammenarbeit mit der Landesanstalt für Privaten Rundfunk, Kassel, in
zwölf Kindereinrichtungen im Landkreis Offenbach, dem Hoch – Taunus – Kreis, im Maintaunus<br />
– Kreis und in der Stadt Wiesbaden.<br />
(Mai bis Dezember <strong>2006</strong>)<br />
In einer dritten Staffel wurde das Projekt idurchgeführt. Jede Einheit für die jeweilige Einrichtung<br />
bestand aus drei Bausteinen:<br />
- Den Anfang machte eine Fortbildung für das pädagogische Personal, <strong>als</strong>o für die Erzieherinnen<br />
und Erzieher und gliederte sich in vier Einheiten (Theorie, Wirkung, Pädagogik,<br />
Praxis). Sie hatte <strong>als</strong> Kernaufgabe das Ziel, eine qualifizierte Position zum pädagogischen<br />
Umgang mit Medien im Kindergarten entstehen zu lassen und die Befähigung zu<br />
induzieren, ein handlungsorientiertes, am Produkt ausgerichtetes Medienprojekt zu planen<br />
und auch umsetzen zu können.<br />
- In einem zweiten Abschnitt des Projektes wurde eine Wochenveranstaltung für die Kinder<br />
zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geplant, vorbereitet und durchgeführt.<br />
Vier Medien (Fernsehen, Radio, Kino und Computer) bildeten die Grundlage für<br />
die praktische Medienarbeit mit den Kindern. Mit kreativen Medien wurde zu den jeweiligen<br />
Leitmedien künstliche und elektronische Raum- und Zeitverhältnisse selbst generiert<br />
und überschaubare experimentelle Produkte erstellt. Mit diesen Vorgaben wurde den<br />
Medienerfahrungen der Kinder mit Formaten, Serien usw. nachgegangen bzw. Medienwelten<br />
„manipuliert“ und nacherlebt.<br />
- Der dritte Baustein des Projektes (Elternabend) behandelte die vorhandenen und teilweise<br />
berechtigten Vorbehalte der Eltern gegenüber elektronischen Medien. Über ein Impulsreferat,<br />
eine sich anschließende Aussprache und die Berichte, Erfahrungen und Ergebnisse<br />
aus den Bausteinen des Projektes, konnte die Notwendigkeit einer offensiven<br />
Medienerziehung <strong>als</strong> Bestandteil einer kommunikativen Emanzipation und Kompetenzerweiterung<br />
glaubhaft vermittelt werden.<br />
Der Aufbau des Projektes konnte belegen, dass im pädagogischen Dreiecksverhältnis<br />
„Fachkraft – Kind – Eltern“ ein wirksamer Ansatzpunkt liegt, um rechtzeitig medienpädagogische<br />
Strategien zu plazieren und nachhaltig auf die Stärkung kommunikativer Kompetenzen<br />
der Kinder Einfluss zu nehmen.<br />
Projekt: „Du bist Radio“<br />
(Januar – Juli <strong>2006</strong>)<br />
Kooperation mit der Landesanstalt für Privaten Rundfunk und HIT RADIO FFH und Schulen<br />
in Korbach, Bad Wildungen, Frankfurt–Fechenheim, Hanau, Usingen, Bad Emstal, Reichelsheim,<br />
Freigericht, Bad Hersfeld, Münster, Heringen, Bad Elz, Schlüchtern.<br />
Im Dezember 2005 startete das bisher größte Radioprojekt für Schüler in Hessen: Schüler<br />
machen Radio! Schüler der Jahrgangsstufen 9. und 10. aller schulischen Bildungsgänge in<br />
Hessen waren aufgerufen, Ideen für Radiobeiträge zu entwickeln und einzusenden.<br />
Ausgedacht hatten sich die Aktion "Du bist Radio!" die Hessische Landesanstalt für privaten<br />
Rundfunk, LPR (Kassel), das Institut für Medienpädagogik und Kommunikation / Landesfilmdienst<br />
in Frankfurt und HIT RADIO FFH. Eine Jury wählte im Januar aus allen Einsendungen<br />
die 15 interessantesten Ideen und Vorschläge für spannende Rundfunkbeiträge aus. Mit den<br />
Einsendern dieser Vorschläge produzierten dann die Fachleute des Instituts für Medienpädagogik<br />
und Kommunikation gemeinsam professionelle, sendefähige Beiträge.<br />
Nachdem die teilnehmenden Schulen ausgesucht waren, erfolgte zunächst eine Fortbildung<br />
der Lehrerinnen und Lehrer in den Räumen von HIT RADIO FFH.<br />
Über die erfolgreiche Durchführung des Radioprojekts „Du bist Radio“ äußerten sich Schüler,<br />
Lehrer und das Radioteam überaus positiv. Es gab keine Klasse, die am Radioprojekt nicht<br />
noch einmal teilnehmen würde.<br />
7
Für die Durchführung wurden drei Radioteams (Honorarkräfte beim <strong>MuK</strong>) gebildet. Ein Radioteam<br />
bestand aus einer/einem Medienpädagogin/Medienpädagogen und zwei Studentinnen/Studentinnen<br />
(Pädagogik). Die Teams nahmen im März an einem Vorbereitungsseminar<br />
teil und wurden theoretisch und technisch auf die Seminare vorbereitet.<br />
Die Teams teilten sich die 15 Projekte in Hessen – Nord, Mitte und Süd auf. Teilweise waren<br />
durch das relativ enge Zeitfenster (April – Juni), drei Teams gleichzeitig unterwegs.<br />
Ablauf der Seminarveranstaltung des Projektes:<br />
- Der erste Tag wurde zur Vorstellung, Themenfindung, technischen Einführung und erste<br />
Recherchen genutzt. Die Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 15 und 16 Jahren<br />
konnten ihre Stimme ausprobieren und erhielten Tips zur Durchführung eines Interviews.<br />
Fast überall stand die Möglichkeit eines Internetzuganges zur Verfügung, so konnte auch<br />
Online recherchiert werden.<br />
- Am zweiten Tag wurde die Bearbeitung des Themas intensiviert. Durch Erfahrungen des<br />
Vortags wurden Interviewstrategien verbessert, ausgehandelte Termine mit Interviewpartnern<br />
wahrgenommen und Erfahrung im Ton- und Musikschnitt gesammelt. Musik<br />
wurde angehört und ausgewertet, Töne aufgenommen und verfremdet.<br />
- Am dritten Tag erfolgte der „Feinschliff“. Meist wurde der Beitrag auf die vorgegebenen<br />
1,30 Min. gekürzt, <strong>als</strong>o entschieden, was wirklich wichtig für die Zuhörer sein soll. Der<br />
Tag endete mit einer Auswertungsrunde.<br />
Projekt: Radio ist mehr <strong>als</strong> Musik<br />
Radioprojekt in Kooperation mit der Landesanstalt für privaten Rundfunk im Landkreis Landkreis<br />
Darmstadt Dieburg in Griesheim, Roßdorf, Messel, Erzhausen, Münster/Altheim, Klein-<br />
Zimmern.<br />
(Januar <strong>2006</strong> – Dezember <strong>2006</strong>)<br />
Das Projekt „Radio ist mehr <strong>als</strong> Musik“ wurde nach acht Einzelprojekten mit Grundschulklassen,<br />
die sich am Radiomachen beteiligt und jeweils eine Kindersendung bei Radio Darmstadt<br />
gesendet haben, erfolgreich abgeschlossen. Die praktische Arbeit mit den Grundschulkindern<br />
verlief wie üblich problemlos und routiniert.<br />
Durch die Möglichkeit, das Projekt „Radio ist mehr <strong>als</strong> Musik“ ein zweites Mal durchzuführen,<br />
konnte das Konzept und die praktische Durchführung, aufgrund neu gewonnener Erfahrungen<br />
verbessert werden.<br />
Das Radioteam arbeitete routiniert und konnte sich den unterschiedlichen Herausforderungen<br />
in den Schulen problemlos anpassen.<br />
Kleine Medienangebote (Fotografie und Bearbeitung der Bilder am PC zur Erstellung des CD<br />
Covers) für die Kinder, die gerade nicht am Mikrofon beschäftigt sind, ergänzen mittlerweile<br />
die Arbeit mit dem Mikrofon. Ein kleiner Film darüber, wie 1938 ein Hörspiel produziert wurde,<br />
bereicherte das Angebot.<br />
Die Erfahrungen in den einzelnen Schulen mit den Lehrkräften und mit den Eltern waren<br />
dieses Mal sehr unterschiedlich.<br />
Die schwierigste Phase des Projektes lag z. B. zwischen der Entscheidung, ob die Schule an<br />
dem Projekt teilnehmen will bis zur Einreichung des Eigenbeteiligungsformulars und damit<br />
einher gehend die Koordinierung der Fortbildungen.<br />
Am deutlichsten wurde dies bei der Regenbogenschule in Altheim. Die mündliche Zusage<br />
erfolgte vor den Sommerferien im Juli. Im August wurde die Zusage (wegen Zeitmangels)<br />
zurückgezogen. Nach mehrfachen Nachfragen im September wieder zugesagt und schließlich<br />
erfolgte die Durchführung im November gleich mit zwei Klassen.<br />
Interessant war, dass die meisten Vorbehalte gegenüber neuen Medien von jungen Lehre-<br />
8
innen kommen. Nach wie vor scheint die Medienbiografie von Kindern in der Ausbildung<br />
zum Lehramt keine Rolle zu spielen.<br />
Mangas zum Beispiel stellten für den Großteil der Lehrerinnen und Lehrer so etwas wie eine<br />
Bedrohung für die Entwicklung der Kinder dar. Die Bedeutung des Begriffes „Medienkompetenz“<br />
war kaum bekannt war, eher konnten sich die Lehrkräfte an die Schlagzeile: „Medien<br />
machen die Kinder dick, dumm und traurig“ erinnern.<br />
Die Medienarbeit an Grundschulen mit dem Thema Radio ist nach wie vor eine gute Grundlage<br />
zum Einstieg in die Medienpädagogik. Das Medium Radio ist kaum negativ besetzt und<br />
wird den Kindern in der praktischen Umsetzung auch pädagogisch zugetraut.<br />
Allerdings konnte auch wieder beobachtet werden, dass den Kindern von ihren Lehrerinnen<br />
und Lehrern mit ihrer erfahrungsbezogenen vorhandenen Medienkompetenz generell viel zu<br />
wenig zugetraut wird. Lehrerinnen und Lehrer sind nach wie vor immer wieder überrascht,<br />
wozu ihre Kinder in der Medienpraxis fähig sind und welche Fähigkeiten und Phantasie sie<br />
besitzen, wenn es um die Entwicklung und Umsetzung von medialen Ideen geht.<br />
Für Lehrkräfte ist es meist auch eine wertvolle Erfahrung, eine Arbeit in der Schule zu erleben,<br />
die weitestgehend ohne Lesen und Schreiben auskommt.<br />
Ähnlich geht es den Eltern, die um die Gefahren der Medien wissen, jedoch wenig konkrete<br />
Vorstellung von einer sinnvollen und bereichernden Arbeit mit Medien haben. Der Elternabend<br />
bietet eine gute Möglichkeit, hier „Licht ins Dunkle“ zu bringen.<br />
Das Konzept des Elternabends wurde im Verlauf des Projektes am stärksten verändert.<br />
Nachdem immer deutlicher wurde, dass ein reiner Informationsabend mit Fakten und Diskussion<br />
nicht ausreicht um Eltern zu einem Überdenken ihres medialen Weltbildes zu bewegen,<br />
hat sich der Elternabend zu einer Veranstaltung entwickelt, die durch ihren erfahrungsbezogenen<br />
Ansatz Wirkung zeigt.<br />
Das Projekt Radio ist mehr <strong>als</strong> Musik hat bei den teilnehmenden Lehrkräften, bei Schülerinnen<br />
und Schülern sowie bei den Eltern dazu geführt, die Rolle der Medien neu zu überdenken.<br />
Dies wurde deutlich bei den Lehrerinnen und Lehrern, die nun den Medien einen positiveren<br />
Stellenwert zuweisen und diese bewußter im Unterricht einsetzen wollen.<br />
Zwischen Eltern und Kindern hat durch die Praxiswochen ein intensiverer Austausch über<br />
Medien stattgefunden. Dies wurde von Eltern und Lehrerinnen bestätigt.<br />
Projekt: Tag der Politik<br />
In Kooperation mit der Hessischen Landeszentrale für Politische Bildung, der Freiwilligen<br />
Selbstkontrolle (FSK) und Schulen in Darmstadt, Marburg, Ober-Aar, Kirchhain, Eschwege,<br />
Friedberg, Frankfurt<br />
(September – Dezember <strong>2006</strong>)<br />
Im April 2007 werden Schülerinnen und Schüler aus sieben Schulklassen den Hessischen<br />
Landtag besuchen und dort mit den Vertretern der im Landtag vertretenen Parteien ins Gespräch<br />
kommen.<br />
Für diesen Tag werden die Schülerinnen und Schüler in zwei Seminarblöcken zum Thema<br />
„Aufgaben des Jugendmedienschutzes“ und „Politik und Medien“ informiert.<br />
Block I: Geschichte der visuellen Kommunikation - Aufgaben der Freiwilligen Selbstkontrolle<br />
Block II: Medialisierung der Politik – Inszenierung politischer Welten<br />
2. Medienpädagogische Seminare, Kurse, Lehrgänge, Einzelveranstaltungen -<br />
präventiver Jugendmedienschutz<br />
9
Mediensozialisation und ihre Folgen<br />
(Bad Camberg, 14.03. Limburg, 16.03. Weilburg 28.03.)<br />
Kinder und Jugendliche verbringen heute viel Zeit mit Fernsehen, Video, Computer, der<br />
Spielekonsole und auch im Internet. Die vielen elektronischen Medien sind zum festen Bestandteil<br />
ihrer Welt geworden.<br />
Vor diesem Hintergrund sind viele Eltern und Erzieher beunruhigt und besorgt. Einerseits<br />
wissen sie um die Notwendigkeit der Herausbildung medialer Kompetenzen, damit Kinder<br />
und Jugendliche den Herausforderungen der Medien- und Informationsgesellschaft gerecht<br />
werden können, andererseits befürchten sie Realitätsverlust, Suchtgefahren und einen nachteiligen<br />
Einfluss durch mediale Inhalte und eine damit verbundene höhere Gewaltbereitschaft,<br />
Zugang zu pornographischen Inhalten und auch politischem Radikalismus.<br />
Zu dieser Problematik wurde in mehreren Gemeinden und Städten Hessens Abendveranstaltungen<br />
durchgeführt und Informations- und Diskussionsveranstaltungen für Erzieherinnen<br />
und Erzieher, für Lehrerrinnen und Lehrer, für Kinderbüros und Eltern angeboten.<br />
Bei den Veranstaltungen wurde mit medialen Beispielen, Ergebnissen und Beobachtungen<br />
aus Wissenschaft und pädagogischer Praxis die Medienkindheit und die sich anschließende<br />
Jugendzeit diskutiert. Handlungsorientierte und präventive Strategien wurden vorgestellt und<br />
kreativer und selbst verantworteter Umgang mit Medien durchdacht.<br />
Nach Piaget hat der junge Mensch vermutlich eine entwicklungspsychologische Disposition,<br />
die ihn anhält, in einem ganz bestimmten Umfang Gefahren, Grenzüberschreitungen und<br />
aus seiner Sicht abenteuerliche Verhältnisse auszuprobieren.<br />
Die realen, sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen stehen den teilweise<br />
einschränkenden und regelnden Vorgaben gegenüber. Mediale, pseudoreale oder virtuelle<br />
Kommunikationssysteme machen dem jungen Menschen ständig Angebote, die zuvor beschriebenen<br />
Bedürfnisse verträglich und teilweise exzessiv ausleben zu können.<br />
Die Verbindung zwischen angenommenen kindlichen und jugendlichen Grundbedürfnissen<br />
und gestaltbaren Erfahrungsräumen im Alltag stellt die Herausforderung für eine Medienund<br />
Kommunikationspädagogik dar, die einerseits das Recht an einer medialen Partizipation<br />
aufrecht erhält und andererseits eine Realitätsfähigkeit des Menschen berücksichtigt.<br />
Umgang mit Medien und Gewalt<br />
(Kröckelbach, 05.04.06)<br />
Schwerpunkte dieser Fortbildungsveranstaltung für Beratungslehrerinnen und Lehrer aus<br />
den staatlichen Schulamtsbereichen des Odenwaldkreises und des Kreises Bergstrasse<br />
waren die Suchtprävention durch soziales Lernen und das Lebenskompetenz-Training im<br />
Grund- und Förderschulbereich.<br />
Neben den Empfehlungen und Vorschlägen des Mitveranstalters, der Jugendschutzstelle<br />
des Landkreises Bergstrasse, konnten wir die Auswirkungen und Folgen moderner und zeitgenössischer<br />
Kommunikationsstrategien (z.B. Internet), die gängigen Untersuchungen dazu<br />
und eine Auseinandersetzung über das Wechselverhältnis von Medienkonsum und Gewalt<br />
in sechs Arbeitsschritten vorstellen:<br />
- Lernen, Verbieten oder Kompetenz <strong>als</strong> präventive Strategien hinsichtlich der Verhinderung<br />
von Medienverwahrlosung und sogenannter Medienbulimie waren Ausgangspunkt<br />
der Überlegungen. Angeregt durch die gerade stattfindenden Diskussionen um Handy-<br />
Verbote in der Schule und während des Unterrichts wurde der aktuelle Wissenschaftsstreit<br />
zwischen Psychologie und Kommunikationswissenschaft hinsichtlich der Wirksamkeit<br />
des Medien-Kompetenzbegriffes diskutiert.<br />
- Jugendwahn und Altwerden <strong>als</strong> Schlüsselbegriffe für eine längst überfällige Diskussion<br />
um das Generationenbild unserer Gesellschaft. Die Soziologie beschreibt die ältere Ge-<br />
10
neration <strong>als</strong> Schicks<strong>als</strong>gemeinschaft, die eigentlich nicht „alt“ werden will und selbst verstärkt<br />
jugendliche Lebensformen pflegt und verfolgt. Damit generiert sich für die junge<br />
Generation die Folge, dass auch diese nicht älter (erwachsen) werden will. Das Vorbild<br />
„Alterung“ verschwindet und damit verbunden die Bereitschaft und das Interesse junger<br />
Menschen, entwicklungsgemäß das Elternhaus zu verlassen (Nesthocker, Pension Mama)<br />
und Selbständigkeit zu erwerben. In diesem Zusammenhang spielen die pseudorealen<br />
Konstrukte der Medienwelt eine entscheidende Rolle.<br />
- Eine umfassende und ständige Überforderung der Jugend steht <strong>als</strong> weitere sozialpsychologische<br />
Hypothese im Raum. Nachweislich fühlt sich der größte Teil der jungen Generation<br />
durch ökonomische Bedingungen, berufliche Entwicklungsnotwendigkeiten und<br />
Werte- und Normenumbau permanent überfordert. Dazu kommt die Beobachtung, dass<br />
Gewalt ein stilbildendes Mittel der Gesellschaft wird und, so meint die pädagogische Soziologie,<br />
es zu einer „perspektivlosen Euphorie“ unter Jugendlichen in der Mediengesellschaft<br />
kommt.<br />
- Sozialisation und Faszination <strong>als</strong> Wirkmechanismen virtueller Systeme (Medien) stehen<br />
im Kontext zu Wirkungen realer Interaktions- und Sozialisationsräume. Drei Grundannahmen<br />
sind zu vertreten: Medien wirken zum größten Teil auf den Menschen stark affektiv,<br />
sie vermitteln die Inhalte überwiegend symbolisch und sie berühren archetypische,<br />
<strong>als</strong>o vorbewusste Bereiche menschlicher Wahrnehmung.<br />
- Verarbeitung, Wirkung und Transfer sind die weiteren Stichworte der seminaristischen<br />
Erarbeitung des Themas. Die inzwischen gesicherte Erkenntnis der Dreifaltigkeit medialer<br />
Kommunikation (Inhalt-Ästhetik-Subbotschaft) ist Vorgabe bei der Beurteilung von drei<br />
jugendspezifischen Verhaltensweisen: Die Suche nach „gefährlichen“ Herausforderungen,<br />
Suchtstrategien bei der Umsetzung von primären Bedürfnissen und ein Hang zur<br />
Eskapade in der (erprobenden) Lebensgestaltung.<br />
- Vom „Unterrichten“ zum „Aufrichten“ lautet verkürzt die Botschaft der präventiven und<br />
handlungsorientierten Medienpädagogik. Notwendig ist ein anregungsreiches (gestaltbares)<br />
soziales Umfeld, die Berücksichtigung einer „Kultur des Widerspruchs“ (Paradigma)<br />
und die öffentlichkeitswirksame Nutzung kreativer Medien, verbunden mit der konstruktiven<br />
Analyse populärer Medien, deren Intentionen und Formen.<br />
Medienwirkung auf Jungen<br />
(Marburg, 19.06.06)<br />
Getragen durch dem Arbeitskreis Jungenarbeit und das kommunale Jugendbildungswerk<br />
des Landkreises Marburg–Biedenkopf behandelte die Tagesveranstaltung („Helden – Softies<br />
– Androgyne?“) aktuelle Fragen zum sozialpsychologischen Wechselverhältnis von Medienkonsum<br />
und Sozialverhalten von männlichen Jugendlichen und nach den Medienwirkungen<br />
und dem Aufwachsen von Jungen.<br />
Neben der realen Interaktion stehen die elektronischen Medien im Verdacht, einen großen<br />
Teil der Sozialisation und Tradierung von Werten, Verhaltensmustern und Regeln zu übernehmen.<br />
Heldentum, Stärke und Körperlichkeit sind nachweisbare Zeichenvorräte für männliche<br />
Jugendliche im Fernsehen, der Werbewelt und in Computerspielen.<br />
In einem zweiten und tiefer gehenden Blick auf diese Materie entdecken wir aber auch andere<br />
Vorlagen und widersprüchliche Phänomene, die in einer qualifizierten medienpädagogischen<br />
Analyse Berücksichtigung finden sollten.<br />
Bei dieser Veranstaltung konnten die neuesten Untersuchungen ausgebreitet und bearbeitet<br />
werden. Sowohl der monokausale Wirkansatz <strong>als</strong> auch der multioptionale Funktionsansatz<br />
wurden dargestellt und mit dem Dispositionsansatz nach Professor Selg verglichen.<br />
An Filmbeispielen, Textanalysen, Kinder- und Jugendliteratur und den Erfahrungen mit „Helden–Filmen“<br />
(Action) konnte die Vielschichtigkeit realer und virtueller Gewalt belegt werden.<br />
11
Der Gewaltbegriff spielt in der kulturellen Tradierung eine große Rolle und spiegelt wie kaum<br />
ein anderer Zusammenhang die sozialen, politischen und gesellschaftlichen Suchbewegungen<br />
einer Zivilgesellschaft wieder.<br />
Gerade in der Sozialpsychologie und in der pädagogischen Psychologie finden sich seit Jahren<br />
immer wieder Berichte und Befunde, die eine Gewaltbereitschaft besonders bei Jungen<br />
im Kontext zu extensivem Medienkonsum diskutieren. In jüngster Zeit stehen besonders die<br />
Computerspiele im Verdacht, ihre Spieler emotional zu enthemmen, Gewaltbereitschaft zu<br />
fördern und Vorbildfunktion für Problemlösungsverhalten zu induzieren.<br />
Anhand folgender Stichworte wurde der Themenkomplex inhaltlich bearbeitet:<br />
- Paradigmenwechsel zwischen Vorbild und Abbild<br />
- Die Flüchtigkeit der Identitätsbildung<br />
- Das symbolische Lernen<br />
- Reale und pseudoreale Interaktion<br />
- Rolle und männliche Identität in Medienbeiträgen<br />
- Begrenztheit und Unbegrenztheit in Realität und Medien<br />
- Temporäre Beschleunigung sozialer Umfelder<br />
- Hemisphärenshift und verändertes Bewußtsein<br />
- Die „männliche“ Sichtweise der Medien<br />
- Sozialisation, Tradierung, Identität<br />
Den Abschluss der Veranstaltung bildeten die medienpraktischen Vorschläge unserer handlungsorientierten<br />
und auf präventiven Jugendschutz ausgerichteten Medienpädagogik. Die<br />
möglichen Formen sind Einzelveranstaltungen, längerfristig angelegte Projekte und auch die<br />
Maßnahmen, die einen geschlechtsspezifischen Ansatz berücksichtigen.<br />
Multimediale Alphabetisierung<br />
(Frankfurt Main, 27.01.; 10.02.; 17.02.)<br />
Für Studentinnen und Studenten der Johann-Wolfgang-Goethe Universität in Frankfurt wurde<br />
eine Veranstaltungsreihe angeboten, die sich mit der unübersehbaren Durchdringung<br />
aller kulturellen, politischen und gesellschaftlichen Bereiche durch multimediale Plattformen<br />
und elektronischen Kommunikationsformen beschäftigte.<br />
Inhalte waren die Auseinandersetzung mit neuen Kulturtechniken, ihren Stärken, ihrer Vielschichtigkeit<br />
und die Strategien der Aneignung und Verarbeitung. Multimediale Alphabetisierung<br />
meint die Befähigung, elektronische Massenmedien souverän und selbst bestimmt nutzen<br />
und benutzen zu können.<br />
Beleuchtet wurden die unterschiedlichen Wirk- und Verarbeitungstheorien in einem historischen<br />
Exkurs über die Geschichte der Entwicklung technischer Medien und visueller Kommunikation<br />
an folgenden drei Merkmalen:<br />
1. Realität<br />
Visuelle Kommunikation, d.h. stehende und bewegte Bilder werden neuronal auf eine ganz<br />
spezifische Art und Weise wahrgenommen, dekodiert und verarbeitet. Bemerkenswerter<br />
Weise löst sich dabei der intendierte Kommunikationsinhalt, <strong>als</strong>o die logisch-rationale Botschaft<br />
stark von der ästhetischen <strong>als</strong>o formalen Aufarbeitung bzw. Begleitung. Anders <strong>als</strong><br />
z.B. beim Buch, können hier formal-ästhetische Komponenten eine Nachricht völlig oder zu<br />
einem großen Teil unterdrücken<br />
2. Die Kraft der Form<br />
Aus anderen Wissenschaftsbereichen <strong>als</strong> der Medienwissenschaft lassen sich über visuelle<br />
Kommunikation für die Medienpädagogik interessante Folgerungen ableiten. Der menschliche<br />
Wahrnehmungsapparat besitzt keine verläßliche Kontrollinstanz, die verhindern könnte,<br />
dass visuelle Botschaften unkontrolliert unser Bewußtsein unterlaufen und damit direkten<br />
Einfluss auf Gefühle, das Denken und die Entscheidungsfindung nehmen können.<br />
12
3. Der Subtext<br />
In einer inhaltlichen Würdigung über Inhalt und Form kommt der Alphabetisierungsansatz<br />
zum Begriff des Subtextes, <strong>als</strong>o zu einer, dem vermeintlichen Inhalt unterlegten und wenig<br />
oder gar nicht bewußt erlebten Botschaft. Mit Beispielen aus Kino, Film und Werbung können<br />
Kindern und Jugendlichen die ästhetischen Parameter visueller Kommunikation erläutert<br />
und darüber hinaus auch die auditiven Komponenten der audiovisuellen Kommunikation <strong>als</strong><br />
synergetische Erfahrung verdeutlicht werden.<br />
Medienschutz und digitale Spielwelten<br />
(Wiesbaden, 08.09. Groß Gerau, 28.09.)<br />
Digitales Spielen ist zum festen Bestandteil der Jugendkultur geworden. Auch die außerschulische<br />
Jugendarbeit/Jugendbildung kümmert sich vermehrt um Durchdringung von Motiven,<br />
untersucht Gefahren und diskutiert Wege einer pädagogisch belastbaren Akzeptanz.<br />
Der etwa drei Jahre alte Begriff der „Medienverwahrlosung“ <strong>als</strong> Arbeitsbegriff für das Ab- und<br />
Wegtauchen in virtuelle Welten belegt den viel schwereren Exkurs in die Umstände bestehender<br />
Lebens- und Erfahrungsräume von Kindern und Jugendlichen.<br />
Vor diesem Hintergrund stellt sich auch die Frage, wofür und warum junge Menschen ethische<br />
und moralische Determinanten internalisieren sollen, wenn anschließend dafür keine<br />
oder nur begrenzte Möglichkeiten des Auslebens bestehen. Die materialisierte Welt (Freizeit<br />
und Entfaltung kosten viel Geld) hinterläßt bei nachwachsenden Generationen die zentrale<br />
Erfahrung, dass Gefühle den Charakter von Ware besitzen, <strong>als</strong>o materialisiert (kommerzialisiert)<br />
sind.<br />
Das Jugendbildungswerk der Stadt Wiesbaden veranstaltete eine weitere Games@night für<br />
Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren. In angeschlossenen und vorangestellten<br />
Workshops mit Impulsreferaten war das Ziel verfolgt worden, sich mit aktuellen Entwicklungen<br />
auf dem Computerspielemarkt auseinander zu setzen und einen Einblick in den aktuellen<br />
Ist-Zustand der Computerspielewelt der Kinder und Jugendlichen zu erhalten.<br />
- Ego-Shooter im Visier von Counter-Strike, Battlefield bis zu Soaker Championship –<br />
populäre Spiele, viel Unkenntnis und massenhaft Urteile.<br />
- Schnittstelle virtual life – real life –<br />
Theorie und Praxis der digitalen Interaktion an der Schnittstelle von Realität und Imagination.<br />
- History; Computerspielewelten von Kindern und Jugendlichen -<br />
eine Zeitreise durch die Entwicklung von Spielen für und mit Computern, von „Tennis<br />
for two“ bis PS III<br />
Das Jugendbildungswerk des Landkreises Groß-Gerau widmete sich ebenfalls den Computerspielen<br />
und titelte die Mitarbeiter-Fortbildung mit „Ich will doch nur spielen…“ – ein medienpädagogischer<br />
Aufriss der Computerspiele im Kontext von vermeintlicher Verwahrlosung<br />
und aber auch medialer Emanzipation.<br />
Zu den größten Herausforderungen für Menschen zählt die Fähigkeit, zwischen Schein und<br />
Sein, zwischen Realität und Wirklichkeit, zwischen pseudo und faktisch unterscheiden zu<br />
können. Die informationstechnischen und kommunikationskulturellen Veränderungen der<br />
letzten Jahrzehnte haben diese Problemstellung noch verschärft, denn die neuen Medientechnologien<br />
haben die Darstellungsqualität weiter verbessert. Die virtuellen Generatoren<br />
erzeugen perfekte Scheinwelten, die sich nicht mehr eindeutig von der Realität unterscheiden<br />
lassen.<br />
Wenn sich diese neuen medialen Plattformen mit dem vitalen Interesse des Menschen nach<br />
Abenteuer; Eskapade und Gefahrensuche (andere sagen „Spiel“) verkreuzen, haben Pädagoginnen/Pädagogen,<br />
Ethikbeauftragte und Werte-Schützer ein handfestes Problem.<br />
Die virtuelle Inszenierung von Kommunikation zusammen mit dem pseudorealen Handeln im<br />
13
Spiel erzeugen Fragestellungen, die sich nur noch im Kontext von bestehenden Medienwelten<br />
einerseits und einem gestaltbaren und anregungsreichen sozialen Umfeld andererseits<br />
beantworten lassen.<br />
Die Stichworte der inhaltlichen Durchdringung waren:<br />
- mediale Sozialisation und Faszination<br />
- Xenophobie versus Neophilie<br />
- Mediale Verarbeitung, Wirkung Transfer<br />
- Inhalt, Ästhetik, Subtext<br />
- Subliminale Suggestion<br />
- Jugend zwischen Bedürfnis und Mangel<br />
- Kompetenz und Bildung<br />
- Vom Unterrichten zum Aufrichten<br />
- Wissenschaft und Forschung<br />
- Theorie und Praxis und die Prävention <strong>als</strong> Schutz<br />
Präventive Strategien zu entwickeln heißt, junge Menschen andere Erfahrungen mit Medien<br />
und deren Nutzung machen zu lassen durch produktorientiertes Medienarbeiten. Dabei können<br />
einerseits durch Recherchen und Erhebungen neue Erfahrungen mit Umwelt und Mitmenschen<br />
erlebt, andererseits durch die Präsentation der Ergebnisse auch wieder Öffentlichkeit<br />
für die jugendlichen Anliegen hergestellt werden.<br />
Als Forderung formuliert: „Wir müssen es schaffen, den Kindern Lust am Leben zu vermitteln,<br />
die dagegen schützt, ihre Freizeit überwiegend mit problematischem Medienverhalten<br />
zu füllen“. Dieser Satz von Prof. Christian Pfeiffer, Direktor des kriminologischen Forschungsinstitutes<br />
Niedersachsen, kennzeichnet zentral das vorliegende Grundproblem:<br />
Was steht den medialen Welten der bunten Bilder mit ihren unbegrenzten Möglichkeiten an<br />
gestaltbarem Lebensraum gegenüber? Welche Erfahrungs- und Entfaltungsräume sind tatsächlich<br />
noch frei erlebbar? Wo lassen sich zentrale Grundbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen<br />
wie z.B. das erprobende Handeln, Umgang mit Anpassung und Widerstand oder<br />
die eigene Selbstwirksamkeit in noch nicht gestalteten, nicht geregelten und oder nicht<br />
geordneten Räumen umsetzen?<br />
medi@l – re@l – sozi@l<br />
(Frankfurt Main, 22.03.06)<br />
Die südhessische Medienfachtagung <strong>2006</strong> zum Thema „Gesellschaft im Netz“ wurde wieder<br />
von verschiedenen Initiativen und Institutionen aus dem Raum Frankfurt und dem Jugendund<br />
Sozialamt der Stadt Frankfurt getragen.<br />
Bei diesem Fachtag für Pädagoginnen und Pädagogen der schulischen und außerschulischen<br />
Bildungsarbeit wurden die Chancen und Risiken zunehmender Medialisierung diskutiert.<br />
Dazu vermittelt wurden Analysen, die einen fachlichen Dialog befördern können und<br />
medienpädagogische Projekte und Arbeitsformen.<br />
Den Einstieg der Veranstaltung bildete ein Referat über LMS bzw. CMS und ein Vortrag über<br />
Identitätsbildung und Internet.<br />
Learning-Management-Systems beinhalten einerseits das computer based training (CBT)<br />
und andererseits das in der betrieblichen Fortbildung bekannte web based training (WBT).<br />
Dem LMS gegenüber steht das Content Management System, wo online blended learning,<br />
Webquest und Wikis eine größere Rolle spielen.<br />
Mit dem Begriff „web 2.0“ verbinden sich Visionen, Ansätze und Überlegungen zu einer<br />
nachhaltigen Veränderung des Internets und den Möglichkeiten einer stärker auf Partizipation<br />
angelegten Nutzung medialer Räume. Zwischen kognitivem Wissen und sensomotorischer<br />
Intelligenz bewegen sich die identitätsstiftenden Dialogfelder einer medialen<br />
14
„Graswurzel-Bewegung“.<br />
Die Virtualität, <strong>als</strong>o die „nicht-seiende Wirklichkeit“ fordert neue Strategien zur Umsetzung<br />
kultureller, politischer und kommunikativer Kompetenzen.<br />
Dazu wurden innerhalb der Veranstaltung zehn Arbeitsgruppen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten<br />
eingerichtet.<br />
- Rollenonlinespiele, ihre Faszination und die dabei vermittelten Werte, Normen und<br />
Handlungsmuster.<br />
- Virtuelle Austauschprojekte, deren Ansätze, Umsetzung und die Vorstellung konkreter<br />
Ergebnisse.<br />
- Urheberrechte im Internet: „meins und deins“ – der schmale Grad zwischen erlaubter<br />
Partizipation und Gefahren der Rechtsverletzung.<br />
- Weblog: das Schlagwort neuer Formen des Lernen, Nutzens und Verbreitens von<br />
Wissen, Meinung und Verständnis.<br />
- Internetsicherheit <strong>als</strong> Grundvoraussetzung eines pädagogischen Schaffens im Bereich<br />
von Multimedia und Internet.<br />
- Handy – die Kommunikationsplattform von Kindern und Jugendlichen mit der größten<br />
Verbreitungsraten.<br />
- Werte und Normen, auch sie <strong>als</strong> ein Bestandteil einer „nur“ virtuellen Welt der Interaktion<br />
und Kommunikation.<br />
- Film <strong>als</strong> pädagogischer Ansatz bei produkt- oder prozessorientierter Medienpädagogik<br />
mit Kindern und Jugendlichen.<br />
- Digitalfotografie <strong>als</strong> Beitrag zur temporären Beschleunigung von Bild und Abbild, von<br />
Sein und Schein.<br />
- Digitale Musikbearbeitung <strong>als</strong> populärer Ansatz in der auf Produkt und Ergebnis angelegten<br />
Medienpädagogik.<br />
Den Abschluss der Veranstaltung bildete die Aussprache über Ergebnisse und Einsichten<br />
aus den Arbeitsgruppen im Plenum, verbunden mit den Voraussetzungen im Bereich<br />
Werte und Normen, den didaktisch-methodischen Arbeitsansätzen und den unterschiedlichsten<br />
Arbeitsschwerpunkten im Offline- und Online-Bereich.<br />
Medienkompetenz durch Kinder – Film – Arbeit<br />
(Erbach, 10.06.06)<br />
Pädagogen und Erzieher sind zunehmend verunsichert aufgrund der Zunahme des passiven<br />
Medienkonsums von Kindern und Jugendlichen. Ein Übermaß an elektronischen<br />
Medien prägt den Alltag und verändert die kindliche Erlebniswelt.<br />
Die <strong>als</strong> „Zugabe“ zu den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien entstandene<br />
Freizeittechnologie bindet das Freizeitbudget von Kindern und schafft bei den Erwachsenen<br />
eine Hilflosigkeit gegenüber dem Umgang der Kinder mit ihren Medien und<br />
mit deren „Werten“.<br />
Wir leben in einer medialisierten Welt. Persönliche Kontakte, Wirklichkeit aus erster<br />
Hand, tritt immer mehr zurück. Die Medienwelt, eine Welt vorgefundener und erfundener<br />
Wirklichkeit lässt die Grenzen zwischen Realität und Fiktion für Kinder fließend werden.<br />
Da Medien ein wesentlicher Teil der Lebenswelt der Kinder sind, ist es notwendig, dass<br />
sich Erwachsene auch in dieser medialen Umwelt auskennen. Der bewußte Umgang mit<br />
Medien ist eine erzieherische Aufgabe, auf die jedoch Erwachsene nicht vorbereitet sind.<br />
Medienwahrnehmung ist für sie eine Fremdsprache, die aber gelernt werden muss.<br />
Im Odenwaldkreis betreibt deshalb das kommunale Jugendbildungswerk eine kreisweite<br />
Kinderkino–Initiative, um zusammen mit den Kindern den Umgang mit Medien zu erlernen.<br />
Durch das Kinderkino wird versucht, ansetzend an der Attraktivität und Faszination<br />
von bewegten Bildern, einen bewußten und kritischen Umgang mit Film und Fernsehen<br />
15
16<br />
zu vermitteln.<br />
Das Filmerlebnis soll durch eine gezielte Nachbereitung, durch Nacherzählen, Nachspielen,<br />
Nachmalen, Fotografieren, Videoarbeit, Basteln, Spielen und andere musische Aktivitäten<br />
nicht im Konsumerlebnis enden. Phantasie und Kreativität werden angeregt, um<br />
den Kindern ein assoziatives Lernen im Umgang mit dem Film und dem damit verbundenen<br />
Filmerlebnis zu ermöglichen. Soziale und emotionale Erlebnisse werden vermittelt<br />
und dem Kind die Möglichkeiten der Herstellung selbst geschaffener Begegnungsformen<br />
aufgezeigt.<br />
Über sechs Arbeitsschritte wurde das Thema erarbeitet und damit für die Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter der Kinderkino–Initiative eine Weiterqualifizierung organisiert:<br />
- Medienkindheit: Zum Stellenwert der Mediennutzung von Kindern, Medienkompetenz<br />
<strong>als</strong> Teil der kommunikativen Kompetenz.<br />
- Wahrnehmung und Wirkung (Medienwirkungsforschung): Medien- und Filmerleben,<br />
Verarbeitung fiktiver Wirklichkeit.<br />
- Kinderkino – Anstiftung zur Kommunikation: Begegnungskultur unter Medieneinfluss;<br />
Film <strong>als</strong> Teil kindlicher Weltaneignung.<br />
- Aktion – Experimente – Unternehmungen: Die Möglichkeiten der kreativen Bearbeitung<br />
der filmischen Inhalte während und nach der Filmvorführung.<br />
- Filmsichtung: Auswahl einer Filmstaffel für das Kinderkino im Odenwaldkreis und die<br />
Planung und Erörterung der möglichen Aktionen.<br />
60 Jahre Hessen<br />
Produktion eines Filmbeitrages für den Hessischen Rundfunk<br />
(Januar – September <strong>2006</strong>)<br />
Der Hessische Rundfunk (hr) startete im Januar das Medienprojekt „Mein Jahrzehnt – Schüler<br />
führen selbst Regie. Die sechs Dekaden der hessischen Geschichte“. Dabei wurden<br />
Schüler aus sechs hessischen Schulen an Kamera, in Ton und Schnitt ausgebildet. Sie waren<br />
Gewinner eines Aufrufs, an dem sich über 30 hessische Schulen beteiligt hatten.<br />
In Kooperation mit der Landrat–Gruber–Schule in Dieburg wurden Krisen und Katastrophen<br />
der 80iger Jahre nachinszeniert und deren Auswirkungen auf Dieburg gezeigt: Der Tschernobyl-Unfall<br />
kommt darin ebenso vor wie Kriegsflüchtlinge aus dem Nahen Osten oder der<br />
Mauerfall.<br />
Ein Ziel des Projekts war es, die Medienkompetenz an Schulen zu fördern und die Schüler<br />
nicht nur zu passiven Konsumenten der Programme zu erziehen. Die Jugendlichen sollten<br />
Fernsehen aktiv gestalten, um die Gesetze der Medien besser kennen zu lernen. Die Ergebnisse<br />
wurden im Bildungsprogramm „Wissen und mehr“ des HR-Fernsehens gezeigt.<br />
Medienerziehung - Aufsuchende Elternarbeit – medienpädagogische Qualifikation<br />
und Elternbildung<br />
(Fortbildungsseminare für Multiplikatoren 03.02.<strong>2006</strong> und 24.02.<strong>2006</strong>, Stadtallendorf<br />
Elternnachmittag 02.04.<strong>2006</strong>, Stadtallendorf, 18.06.<strong>2006</strong>, Breidenbach)<br />
Das Projekt „Aufsuchende Elternschule für Zuwanderer“ wird vom Landkreis Marburg-<br />
Biedenkopf betreut. Es handelt sich um ein europäisches Projekt, in dem Familien mit Vorschulkindern<br />
im Wege der „Aufsuchenden Elternarbeit“ erziehungskompetent gemacht werden<br />
sollen.<br />
Insgesamt 52 Familien in Stadtallendorf und Breidenbach werden einmal wöchentlich aufgesucht.<br />
Mit dem ehrenamtlichen Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterin finden Gespräche über Erziehungsfragen<br />
statt, so dass von der Sprachförderung bis zur Vermittlung sozialer Kompetenzen<br />
wichtige Impulse gegeben werden.
In diesem Zusammenhang wurde das Projekt „Medienerziehung“ durchgeführt. Zunächst<br />
wurden in zwei Fortbildungsveranstaltungen die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren des<br />
Projektes geschult. Dabei ging es vor allen Dingen um pädagogische Fragen zum Umgang<br />
mit Medien in der Erziehung. Vom aktuellen Medienerleben der Kinder über pädagogische<br />
Fragestellungen bis zu den Fernsehrisiken und der Auseinandersetzung mit Computerspielen<br />
wurden theoretische und praktische Hilfen gegeben.<br />
Gemeinsam erarbeitet wurden Tipps für die erzieherische Medienarbeit in den Familien.<br />
Zusätzlich fanden zwei Elternnachmittage statt, an denen vorwiegend die Mütter der Kinder<br />
aus türkischen Familien teil nahmen. Schwerpunkt dieser Veranstaltungen waren die erzieherischen<br />
Belastungen und Probleme, die sich aus dem Medienkonsum ergeben. Umgesetzt<br />
wurden die erarbeiteten „Regeln“ für das erzieherische Verhalten im Bezug auf den täglichen<br />
Medienkonsum.<br />
Die LAN-Party <strong>als</strong> jugendkulturelles Phänomen<br />
(28.02.<strong>2006</strong>, Weidenhausen)<br />
Im Rahmen der kirchlichen Erwachsenenbildung wurde das Thema LAN-Party <strong>als</strong> jugendkulturelles<br />
Phänomen behandelt. Dabei wurde die Motivation der Jugendlichen dargestellt,<br />
Interviews aus Gesprächen bei LAN-Partys gezeigt und die pädagogische Dimension dieses<br />
jugendkulturellen Phänomens erläutert.<br />
Es ging vor allen Dingen darum, die heutigen Medienjugendlichen mit ihren Erlebnisweisen<br />
besser verstehen zu können und sowohl die Risiken <strong>als</strong> auch die positiven Seiten medialer<br />
Aktivitäten zu begreifen.<br />
Mit der Veranstaltung wurde die Voraussetzung geschaffen, sich mit jugendlichen medienzentrierten<br />
Stilformen kompetenter auseinandersetzen zu können.<br />
Medienfortbildung<br />
(31.03.<strong>2006</strong>, Jugendheim Marbach)<br />
Im Rahmen der kontinuierlichen Fortbildungsarbeit wurde das Medienthema für die Pädagoginnen<br />
und Pädagogen des Heimes intensiv aufgefächert.<br />
Neben den aktuellen Mediendiskussionen ging es um die Rolle der Pädagogik bezüglich der<br />
Medien und die Frage, wie Pädagoginnen und Pädagogen selbst mit Medien umgehen.<br />
Der mediale Alltag der Kinder und Jugendlichen wurde beschrieben und Gefahren und Nutzen<br />
der Medien abgewogen.<br />
Schließlich wurden medienpädagogische Inhalte, Ziele und Projekte vorgestellt und auf den<br />
Jugendmedienschutz und seine pädagogische Bedeutung hingewiesen.<br />
Letztlich wurde das Lernziel Medienkompetenz für die pädagogische Arbeit dargestellt und<br />
inhaltlich entwickelt. Nicht nur die Nutzungskompetenz, sondern vor allem auch die Kompetenz<br />
eigenen aktiven Medienschaffens im Sinne der Verbesserung sozialer Kommunikation<br />
ist dabei ein wichtiges Anliegen.<br />
Gewalt in den Medien – Gewalt im Alltag?!<br />
(06.10.<strong>2006</strong>, Obereisenhausen)<br />
Im Rahmen der Aktionswoche „Laut gegen Gewalt“ wurde ein Informationsabend insbesondere<br />
für die Zielgruppe Eltern und Erzieher angeboten.<br />
Die Zusammenhänge zwischen medialer Gewalt und gesellschaftlicher Gewalt wurden problematisiert.<br />
Ausgehend von der Gewalt <strong>als</strong> permanentes gesellschaftliches Problem wurde<br />
17
die historische Rolle der Medien im Bezug auf Enttabuisierung von Gewalt dargestellt.<br />
Besonderer Schwerpunkt war die Auseinandersetzung mit den vorhandenen aktuellen Gewaltbegriffen<br />
und die Frage der Medienwirkung sowie der Mediennutzung und –<br />
wahrnehmung. Die Darstellung der Gewalttheorien und die Gewaltprävention rundeten das<br />
Themenfeld ab.<br />
Medienkompetenz <strong>als</strong> Ziel<br />
(27.10.<strong>2006</strong>, Marburg)<br />
Im Rahmen des 1. Marburger Kinder und Jugendfilmfestiv<strong>als</strong> wurde zum Thema „Medienkompetenz<br />
<strong>als</strong> Ziel“ eine Veranstaltung für Eltern angeboten.<br />
Ausgehend von der Frage, wozu Medienkompetenz erforderlich ist, ging es um die kognitive<br />
und emotionale Ebene von Medien und ihren Wirkungen.<br />
Die Rolle der Medien im Alltag der Kinder <strong>als</strong> „Freunde“ oder <strong>als</strong> „Störenfriede“ (im Bewußtsein<br />
der Erzieherinnen und Erzieher, der Eltern) wurde diskutiert.<br />
Kinder entwickeln durch ihr individuelles Medienhandeln und Medienerleben vielfältige mediale<br />
Kompetenzen. Diese werden von den Erwachsenen häufig übersehen oder nicht in<br />
positiver Weise wahrgenommen. Kinder benötigen aber auch Ansprechpartner, mit denen<br />
sie ihre Medienerlebnisse besprechen und reflektieren können. Daraus erwächst für Eltern<br />
und Erzieher die Notwendigkeit, die medialen Kompetenzen der Kinder zu erkennen und<br />
durch pädagogische und erzieherische Hilfen auszuformen und weiter zu entwickeln.<br />
Auch auf die besonderen pädagogischen Herausforderungen durch die medialen Risikofaktoren<br />
Gewalt, Angst und sozialethische Desorientierung wurde hingewiesen.<br />
Ziel der Medienerziehung in der Familie, der Schule oder der Kindertagesstätte ist die umfassende<br />
Medienkompetenz.<br />
„Fernsehen macht dick, dumm und gewalttätig“ – Medien und Gewalt<br />
(20.11.<strong>2006</strong>, Neustadt)<br />
Der Elternabend der Gesamtschule und des Schulelternbeirats setzte sich mit der Rolle der<br />
Medien in der Gesellschaft auseinander und den Wirkungen auf Kinder und Jugendliche.<br />
Insbesondere die Rolle des Leitmediums Fernsehen wurde kritisch hinterfragt.<br />
Kinder brauchen Fernsehen, Bilder und Geschichten zur Welterklärung, sie brauchen gesellschaftliche<br />
Vorbilder, die sie sich aber heute verstärkt aus den Medien holen. Das Fernsehen<br />
<strong>als</strong> Leitmedium fördert auch Allgemeinwissen und kommt der kindlichen und jugendlichen<br />
Neugierde entgegen.<br />
Problematisch ist aber, dass mediale Gefährdungen aus der Sicht Erwachsener häufig überbetont<br />
werden und dadurch häufig eine sachgerechte gemeinsame Auseinandersetzung in<br />
pädagogischer Hinsicht verhindern.<br />
Kinder brauchen eine Balance auf der Basis von Selbstwertgefühl und Urvertrauen, auf der<br />
Grundlage von Verläßlichkeit und Sicherheit, einen emotionalen Halt. Wenn dies vorhanden<br />
ist durch die elterliche Zuwendung, dann spielen Medien auch dann, wenn sie problematische<br />
Inhalte oder Bilder, Werte oder Normen vermitteln, nur eine Nebenrolle.<br />
18
Gewalt in den Medien – Gewalt in der Gesellschaft<br />
(05.12.<strong>2006</strong>, Weidenhausen)<br />
Eingebettet in die Auseinandersetzung über den Werteverlust und den Wertewandel in unserer<br />
Gesellschaft wurde im Rahmen der evangelischen Erwachsenenbildung das Thema „Mediale<br />
Gewalt“ im Kontext zur realen gesellschaftlichen Gewalt behandelt.<br />
Auslöser dafür waren die aktuellen Gewaltexzesse Jugendlicher, die vor allem in der veröffentlichten<br />
Ursachenforschung rasch durch das Phänomen Gewaltvideos bzw. Computerspiele<br />
mit Gewaltinhalten erklärt werden.<br />
Die mediale Gewalt, so ist die vorherrschende Theorielage, wird nur dann zu realer Gewalt,<br />
wenn beim Medienkonsumenten individuelle Strukturen vorhanden sind, die eine Gewaltbefürwortung<br />
und eine Gewaltausübung begünstigen. Sowohl soziale Determinanten <strong>als</strong> auch<br />
gesellschaftliche und sozio-kulturelle Einflüsse können zu einer Gewaltdisposition beitragen.<br />
Insofern ist es notwendig, Gewaltwirkungen und die kritische Auseinandersetzung mit den<br />
gesellschaftlichen und sozialen Strukturen bei der Ursachenerforschung nicht zu vernachlässigen.<br />
Kinder lernen mit Bits und Bytes<br />
(0 8.12.<strong>2006</strong>, Frankfurt am Main)<br />
Beim Fachtag des Diakonischen Werkes Frankfurt für die kirchlichen Betreuungseinrichtungen<br />
für Kinder wurde in einem Workshop geeignete Spiele und Lernsoftware für Kinder vorgestellt<br />
und auf die pädagogische Umsetzung in der praktischen Arbeit überprüft.<br />
Darüber hinaus wurden die grundsätzlichen Fragen des Einsatzes von Computern <strong>als</strong> Lern-,<br />
Erfahrungs- und Spielgegenstand in der Kindergartenpädagogik erörtert sowie die Einbeziehung<br />
der Eltern im Rahmen von Medienkompetenz vermittelnden Bildungsangeboten.<br />
Aktuelle Herausforderungen im Kinder- und Jugendschutz .- sexuelle Gewalt<br />
durch neue Medien<br />
Prävention vor sexueller Gewalt durch Fortbildung und Information von Fachkräften und Eltern.<br />
(29.11.<strong>2006</strong>, Berlin)<br />
Im Rahmen der Fachtagung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,<br />
die vom Deutschen Jugendinstitut durchgeführt wurde, ging es um das Thema Prävention<br />
vor sexueller Gewalt durch Fortbildung und Information von Fachkräften und Eltern.<br />
Dargestellt wurden die Probleme präventiver Aktionen in der Fortbildung, die Bereiche, in<br />
denen die Fachkräfte zu schulen sind, Inhalte und Bausteine für Fortbildungskonzepte und<br />
die Ziele der Medienfortbildungen im präventiven Bereich.<br />
Die Medienfortbildung muss das Ziel haben, Kinder und Jugendliche so zu fördern, dass sie<br />
selbstbewußt, akzeptiert und mit eigenen Aktivitäten und Ideen in sozialen Kontexten ausgestattet<br />
aufwachsen und damit in der Lage sind, Medien so zu nutzen, dass sie sich nicht<br />
überfordern, dass sie erkennen, was Realität und Fiktion ist, dass sie auch bei Gewaltszenen<br />
und bei sexueller Gewalt distanziert reagieren können, dass sie Gefährdungen erkennen und<br />
Gefahrensituationen mit realen Interaktionspartnern reflektieren können.<br />
Die Medienfortbildung muss vermitteln, dass es nötig ist Kinder und Jugendliche mit ihrer<br />
jeweils spezifischen Individualität ernst zu nehmen und ihre soziale und emotionale sowie<br />
kognitive Eingebundenheit in das tägliche Medienerleben wahr zu nehmen.<br />
19
Schließlich muss die Medienfortbildung Pädagoginnen und Pädagogen so qualifizieren, aktivieren<br />
und professionalisieren, dass sie Kinder und Jugendliche dabei unterstützen und fördern<br />
können sich selbst zu begreifen und sich selbst in der Konfrontation mit anderen und im<br />
Kontakt mit ihnen zu erleben und zu verstehen, dass sie eigene Maßstäbe entwickeln für ihr<br />
Mediennutzen und vor allem das nutzen, wovon sie einen persönlichen Vorteil haben.<br />
Medienpädagogische Kooperationen<br />
- Kooperation mit der Jugendförderung Groß – Umstadt im Rahmen des Projektes Mini-<br />
Umstadt<br />
Groß-Umstadt 17.07. – 29.07.<strong>2006</strong><br />
- Kooperation mit dem Haus am Maiberg und der Hessischen Landeszentrale für Politische -<br />
Bildung Thema: Demokratie braucht politische Bildung<br />
Heppenheim 11.05.<strong>2006</strong><br />
- Fortbildung „Video mit benachteiligten Jugendlichen“ mit der Theodor–Litt–Schule<br />
Michelstadt 01.10.<strong>2006</strong><br />
- Aufbau einer Video-AG an der Landrat–Gruber–Schule<br />
Dieburg Februar – Oktober <strong>2006</strong><br />
- Durchführung der „Satirewoche“ in Kooperation mit der Stadt<br />
Reinheim 13.09 – 15.09.2005<br />
- Medienarbeit im Deutschunterricht<br />
Dieburg, 20.09, 22.09., 27.09., 29., <strong>2006</strong><br />
20