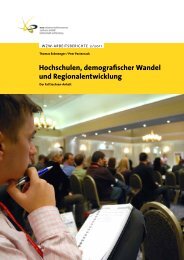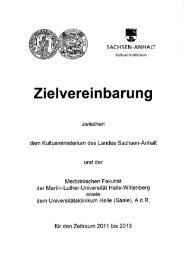Verlangt der demografische Wandel eine neue Zuordnung der ...
Verlangt der demografische Wandel eine neue Zuordnung der ...
Verlangt der demografische Wandel eine neue Zuordnung der ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
376 MedR (2010) 28: 372−378<br />
lich Verän<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong> zusammensetzung <strong>der</strong> Bevölkerung<br />
bezeichnet, ohne dass damit konkrete Aussagen über<br />
inhalt und tendenzen dieser Verän<strong>der</strong>ung verbunden sind.<br />
Die Entwicklung in Deutschland 4 4 bis zum Jahr 2050 ist<br />
vor allem durch drei faktoren bestimmt: (1) das Schrumpfen<br />
<strong>der</strong> Gesamtbevölkerung von ca. 80 auf ca. 60 Millionen<br />
Einwohner 4 5 , (2) die zunahme des Anteils <strong>der</strong> über 75jährigen<br />
von 6 auf 12 Millionen als folge <strong>der</strong> steigenden Lebenserwartung<br />
sowie (3) die Verän<strong>der</strong>ung des Verhältnisses<br />
zwischen Erwerbstätigen und transferempfängern von ca.<br />
2:1 auf 1:1 4 6 . Dieser Prozess vollzieht sich in den einzelnen<br />
Landesteilen nicht gleichmäßig und gleichzeitig. Vielmehr<br />
sind die Verän<strong>der</strong>ungen in den <strong>neue</strong>n Bundeslän<strong>der</strong>n bereits<br />
heute sichtbar, während vor allem im Südwesten erst<br />
mit <strong>eine</strong>r Verzögerung von bis zu zehn Jahren vergleichbare<br />
Verän<strong>der</strong>ungen spürbar werden. Das hängt mit <strong>der</strong> landesinternen<br />
Bevölkerungswan<strong>der</strong>ung vor allem junger frauen<br />
vom Osten in den Süd(west)en zusammen 47 .<br />
2. Auswirkungen in den einzelnen Bereichen<br />
<strong>der</strong> Gesundheitsversorgung<br />
Durch den damit grob skizzierten <strong>demografische</strong>n <strong>Wandel</strong><br />
verän<strong>der</strong>t sich die räumliche Struktur <strong>der</strong> nachfrage<br />
nach Gesundheitsdienstleistungen, vor allem durch den<br />
Bevölkerungsrückgang und die stärkere Überalterung auf<br />
dem Land. Bei weniger Gesamtnachfrage nimmt <strong>der</strong> Anteil<br />
an Pflegedienstleistungen und an<strong>der</strong>en Leistungen, die<br />
spezifisch durch ältere Menschen in Anspruch genommen<br />
werden, zu. Wegen <strong>der</strong> geringeren Mobilität än<strong>der</strong>t sich<br />
zunehmend auch <strong>der</strong> Ort <strong>der</strong> nachfrage nach den Gesundheitsdienstleistungen.<br />
Diese werden in stärkerem Maße zuhause<br />
nachgefragt und nicht in <strong>eine</strong>r ärztlichen Praxis.<br />
Die Auswirkungen machen sich bei den verschiedenen<br />
Berufsgruppen unterschiedlich bemerkbar. Während die<br />
Berufe <strong>der</strong> Geburtshilfe weniger in Anspruch genommen<br />
werden, weitet sich die nachfrage bei den Pflegeberufen<br />
und im Bereich <strong>der</strong> chronischen Krankheiten sowie typischen<br />
Alterskrankheiten weiter aus. Dabei ist umstritten,<br />
ob die Erhöhung <strong>der</strong> Lebenserwartung das Auftreten von<br />
altersbedingten Erkrankungen insgesamt erhöht o<strong>der</strong> <strong>der</strong><br />
Eintritt dieser Krankheiten lediglich zeitlich verschoben<br />
wird, so dass die Gesamtnachfrage in diesem Bereich sich<br />
nur unmerklich verän<strong>der</strong>t 4 8 .<br />
Begleitet wird dieser Prozess von <strong>eine</strong>m Rückgang <strong>der</strong><br />
zahl <strong>der</strong> aktiven Ärzte. Obwohl die zahl <strong>der</strong> Absolventen<br />
k<strong>eine</strong>n großen Verän<strong>der</strong>ungen unterliegt, geht die zahl <strong>der</strong><br />
Berufsanfänger seit einiger zeit zurück, da ein größerer<br />
Prozentsatz <strong>der</strong> Medizinabsolventen <strong>eine</strong> Berufstätigkeit in<br />
an<strong>der</strong>en Bereichen, wie <strong>der</strong> forschung o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Gesundheitsverwaltung,<br />
vorzieht 4 9 .<br />
3. Blick auf die Kostenfolgen<br />
Der Hinweis auf Kostensteigerungen ist ein cantus firmus<br />
je<strong>der</strong> Debatte über die Gesundheitspolitik in Deutschland<br />
und wird pauschal auf den technischwissenschaftlichen<br />
fortschritt und die Alterung <strong>der</strong> Gesellschaft zurückgeführt.<br />
Es bedarf jedoch <strong>eine</strong>r stärker differenzierenden<br />
Betrachtungsweise. So muss <strong>der</strong> Hinweis, dass durch den<br />
technischwissenschaftlichen fortschritt die Behandlungsmöglichkeiten<br />
erweitert und damit zusätzliche Kosten<br />
verursacht werden, jedenfalls durch die Erkenntnis korrigiert<br />
werden, dass zahlreiche <strong>neue</strong> Erkenntnisse auch zu<br />
kostensenkenden Effekten führen, weil entwe<strong>der</strong> die <strong>neue</strong>n<br />
Methoden preiswerter sind o<strong>der</strong> <strong>eine</strong> langfristige Behandlung<br />
durch <strong>eine</strong>n einmaligen Behandlungserfolg ersetzen.<br />
Gerade dieses Beispiel macht aber auch deutlich, dass die<br />
Kostensteigerung bei <strong>der</strong> Krankenbehandlung zu Kostensenkungen<br />
bei <strong>der</strong> Pflege führen kann, also in <strong>eine</strong>m separat<br />
finanzierten und bilanzierten Bereich. umgekehrt kann<br />
Kluth, <strong>Verlangt</strong> <strong>der</strong> <strong>demografische</strong> <strong>Wandel</strong> <strong>eine</strong> <strong>neue</strong> zuordnung <strong>der</strong> Gesundheitsleistungen?<br />
<strong>eine</strong> vermeintliche Kostensenkung durch den „Verzicht“<br />
auf bestimmte Behandlungen für alte Menschen im Rahmen<br />
<strong>eine</strong>r Priorisierung 5 0 zu höheren Pflegekosten führen.<br />
Auch in diesem fall darf nicht all<strong>eine</strong> auf die Kostensenkung<br />
bei <strong>der</strong> GKV geschaut werden.<br />
unter den Effekt Kostenfolgen ist aber auch zu subsumieren,<br />
dass auf Grund des <strong>demografische</strong>n <strong>Wandel</strong>s die<br />
Lastenverteilung für die Gesundheitskosten verschoben<br />
wird. Werden Gesundheitsdienstleistungen in <strong>eine</strong>m höheren<br />
umfang von Versicherten in Anspruch genommen,<br />
die nicht (mehr) erwerbstätig sind und deshalb nur <strong>eine</strong>n<br />
halbierten Beitrag zahlen, so bedeutet das zugleich, dass<br />
die Kostenbelastung <strong>der</strong> erwerbstätigen Versicherten steigt.<br />
Wird zugleich das ziel verfolgt, diese zusätzlichen Belastungen<br />
nicht als Lohnnebenkosten den Arbeitgebern aufzubürden,<br />
so verschärft das die zusätzlichen Belastungen<br />
<strong>der</strong> erwerbstätigen Versicherten weiter. Eine Steuerfinanzierung<br />
verschleiert diesen Effekt nur zum teil, da die abhängig<br />
Beschäftigten naturgemäß auch den größten teil<br />
dieser finanzierungsart bereitstellen. Lediglich die Verteilung<br />
fällt auf diesem Weg etwas „sozial gerechter“ aus.<br />
Schließlich muss aus dem Blickwinkel <strong>der</strong> Kostenfolgen<br />
auch die frage gestellt werden, welche Bedeutung die Gesellschaft<br />
<strong>der</strong> zunahme von Pflegebedürftigkeit aus dem<br />
Blickwinkel <strong>der</strong> finanzierung beimisst. Soll die im internationalen<br />
Vergleich große Kluft zwischen <strong>der</strong> Vergütung<br />
von ärztlicher tätigkeit und pflegen<strong>der</strong> tätigkeit beibehalten<br />
und durch die Maßnahmen <strong>der</strong> Kostenbegrenzung bei<br />
den steigenden Pflegedienstleistungen abgesichert werden,<br />
o<strong>der</strong> soll umgekehrt die zunahme des umfangs <strong>der</strong> in Anspruch<br />
genommenen Pflegeleistungen zum Anlass genommen<br />
werden, die Qualifikation <strong>der</strong> Pflegeberufe zu erhöhen<br />
und dabei auch die Vergütung zu verbessern?<br />
4. Schwierigkeiten <strong>der</strong> Anpassung<br />
Anpassungen bei den Gesundheitsberufen sind k<strong>eine</strong> r<strong>eine</strong>n<br />
Rechtsfragen, son<strong>der</strong>n müssen auch die beson<strong>der</strong>en ökonomischen<br />
und berufspolitischen implikationen dieses Bereichs<br />
berücksichtigen. Auch wenn es sich dabei lediglich<br />
um Rahmenbedingungen handelt, sollten sie im Rahmen<br />
<strong>eine</strong>r juristischen Analyse gleichwohl zur Kenntnis genommen<br />
werden. Der Sachverständigenrat hat in s<strong>eine</strong>m<br />
Gutachten „Kooperation und Verantwortung“ dazu ausgeführt:<br />
„Die Diskussion um den neuzuschnitt von Aufgaben<br />
im Gesundheitswesen mag bei den Berufsgruppen<br />
Konkurrenzgefühle, Ängste und Vorbehalte erzeugen,<br />
nicht zuletzt deshalb, weil die heutige Berufsstruktur, die<br />
zuordnung von tätigkeitsbereichen sowie die zuständigkeiten<br />
bei <strong>der</strong> Verordnung von Leistungen historisch entstanden<br />
sind und damit <strong>eine</strong> lange tradition besitzen. Eine<br />
Verän<strong>der</strong>ung des Professionenmixes setzt auch voraus, dass<br />
dieser gewachsene institutionelle Rahmen auf s<strong>eine</strong> heutige<br />
Sinnhaftigkeit überprüft wird 51 .<br />
44) Die folgenden Angaben basieren auf den Angaben in Berlin-Institut<br />
für Bevölkerung und Entwicklung, Die <strong>demografische</strong> Lage <strong>der</strong><br />
nation. Wie zukunftsfähig sind Deutschlands Regionen, 3. Aufl.<br />
2007.<br />
45) zum Aspekt des Schrumpfens und s<strong>eine</strong>n implikationen grundlegend<br />
Kaufmann, Schrumpfende Gesellschaft, 3. Aufl. 2008.<br />
46) Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung (fn. 44), S. 32 f.<br />
47) Dazu näher Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung (fn. 44),<br />
S. 10 ff., S. 36 ff.<br />
48) Dazu näher Kostorz/Schnapp, Gesundheits und Sozialpolitik<br />
9–10/2006, 26 ff.<br />
49) Dazu Bergmann, MedR 2009, 1. S. dazu auch das „Krankenhausbarometer“,http://www.kgnw.de/download/krankenhausbarometer/.<br />
50) Kritisch zu den kostensenkenden Effekten <strong>eine</strong>r Priorisierung<br />
Huster, Jz 2008, 859 ff.<br />
51) SVRGesundheit (fn. 22), nr. 65.