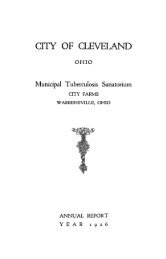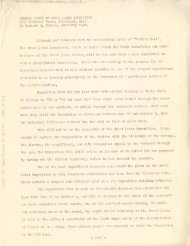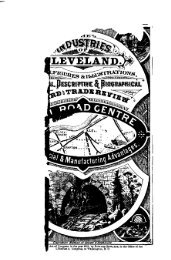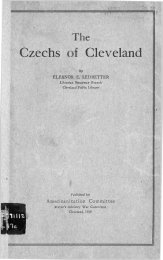Philosophische Abhandlungen
Philosophische Abhandlungen
Philosophische Abhandlungen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Philosophische</strong><br />
<strong>Abhandlungen</strong><br />
zum 70. Geburtstage<br />
Berlin 1906<br />
Ernst Siegfried Mittler und Sohn<br />
Königliche Hofbuchhandlung<br />
Koclistraße 68-71
Alle Rechte aus dem Gesetze vom 19. Juni 1901<br />
sowie das Über~etzun~srecht sind vorbehalten.
Hochzuverehrender<br />
Herr Geheimrat!<br />
urch die Worte der Bibel und durch die Sitte<br />
der Völker ist der siebzigste Geburtstag zu einem<br />
Marksteine geworden, an dem angelangt, man besonderen<br />
Anlaß nimmt auf den durchmessenen Lebensweg zurückzu-<br />
blicken. Aber nicht bloR Sie schauen heute zurück, sondern<br />
auch Ihre Freunde und Ihre Schüler. Sie erinnern sich gerne,<br />
was ihnen an Sympathie, an Wohlwollen, an wissenschaft-<br />
licher Anregung und Belehrung von Ihnen zuteil geworden<br />
ist. Es sind ihrer sehr viele, da Sie nie müde wurden, zu<br />
raten, zu helfen, zu fördern, zu erfreuen. Wir, die wenigen,<br />
haben uns vereinigt, um Ihnen eine geistige Gabe darzu-<br />
bringen als äußeres Zeichen unseres Dankes für das, was<br />
wir von Ihnen empfangen haben; wir bitten Sie, dieselbe<br />
freundlich und nachsichtig annehmen zu wollen. Und wir<br />
machen uns zugleich zu Sprechern jener vielen, indem wir<br />
Ihnen von Herzen wünschen, daß Ihnen noch viele Jahre<br />
für Ihr Wirken als Lehrer und Forscher, für das Glück<br />
Ihres Familienlebens und für Ihr Walten im Freundeskreise
eschieden seien, daß diese Jahre Ihnen und den Ihrigen<br />
ungetrübt von äußerem Mißgeschick verfließen mögen, und<br />
daß der Ihnen eigene geistesstarke Frohsinn, ein Abglanz<br />
der hellenischen Eudämonie, die Sie dargestellt haben, Ihnen<br />
immer erhalten bleibe.<br />
Am 13. Dezember 1905.<br />
In treuer Verehrung und steter Dankbarkeit<br />
Anathon Aall. Paul Barth. Mattoon M. Curtis.<br />
Reinhold Geijer. Kar1 Joel. Alfred Kühne.<br />
Oswald Külpe. Friedrich Lipps. Fritz Medicus.<br />
Ernst Meumann. Georg Müller. Francesco Qrestano.<br />
Raoul Richter. Theodore Ruyssen. Hermann Schwarz.
Inhaltsverzeichnis.<br />
Sokrates - Gegner oder Anhänger der Sophistik? Von Anathon<br />
Aall, Ha1lea.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1<br />
Die stoische Theodizee bei Philo. Von Paul Earth, Leipzig . . . 14<br />
Kantean Elements in Jonathan Edwards. Von M atto on Mon ro e<br />
Curtis, Cleveland U. S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . 34<br />
Ein schwedischer Aufklärungsphilosoph. Von Reinhold Gei j er,<br />
Upsda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63<br />
Platos ,,sokrati~che'~ Periode und der Phaedyus. Von I< arl J o El,<br />
Basel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78<br />
Spinozas Tractatus politicus und die parteipolitischen Verhältnisse<br />
der Niederlande. Von Alf red Kühne, Charlottenburg . . . . 92<br />
Anfänge psychologischer Ästhetik bei den Griechen. Von 0. Iciilpe,<br />
Würzburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101<br />
Die Aufgaben der Philosophie. Von G. F. Lipps, Leipzig . . . . 128<br />
Zur Physik des Parmenides. Von Fritz Medicus, Halle a. S. . . 137<br />
Die Grenzen der psychologischen Ästhetik. Von Ernst Meumann,<br />
Königsberg i. Pr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146<br />
Kar1 Heydenreich als Lehrer und Erzieher. Von Georg Müller,<br />
Leipzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183<br />
Simone Corleo. Von Frsncesco Orestano, Rom. . . . . . . . 201<br />
Leibniz' Stellung zur Skepsis. Von Raoul Richter, Leipzig . . . 207<br />
Un probabiliste moderne, Antoine Augustin Cournot. Par Th.<br />
Ruyssen, Aix-en-Provence . . . . . . . . . . . . . . . . 214<br />
Spinozas Identitätsphilosophie. Von Herm ann Schwarz, Halle a. S. 226<br />
Seite
Sokrates - Gegner oder Anhänger der<br />
Sophistik?<br />
Von<br />
Anathon Aall, Halle a. S.<br />
s gibt Denlrproblenie, die iinnier wieder aufgenonimen werden<br />
müsseii, ohne, wic es sclieiilt, zum eiidgültigeii Abscliluis ge-<br />
bracht .cvcrdcn zu könneii: Probleme, wie das der Energie, clei<br />
Ilauines und der Zeit, des Willens, des Vcrhtiltnisses logisclier<br />
Urteilsbildung zur psychopliysischeii Erregung U. a. ni. Der Philosoplz<br />
crlieilnt aber iiebeii clicseii Deiikfraeen auch Probleme d e r G e -<br />
s c h i c h t e , zu denen unaufhörlich zuriiclrgeliehrt werden muis, weil<br />
sie. .cveiiii sie auch iiiclit dcn Charakter der Unlösbarkeit tragen, doch<br />
einen Inhalt haben, der nie recht erscliöpfeiicl gewürdigt wcrdeii liann.<br />
Solche Probleme, wie überhaupt die philosophischen Inhalte der<br />
Geschichte, kann maii iiach zwiefacher Scite liiii studiereii. Ent~~redcr<br />
iiämlich betrachtet mlan c i 11 e g i o i s e I d e c. Mehiere der bedeu-<br />
tungsvollsten Ideen gehen geschichtlich weit zurücli in der Zeit, und<br />
will inaii ilirc Wurzeln fiiicleii, so inufs inan sich aii dic alte griechische<br />
Philosophie weiidcn. Es sei in diesem Zusaninienliaiig daraii eriiiilert,<br />
dais derjenige, der das gewaltigste Ideciigebilde cler Antike zuerst einer<br />
inoiiographischeii Behaildluiig uilterzog uncl clurch seine gründliche<br />
Untersuchung des Gegenetaiides für die Ideengeschichte bahnbrecliciicl<br />
wirkte, der Gelehrte ist, dem die~se Festschrift gi1t.l)<br />
Oder niaii hat eh init eiiler b e d e u t c n d e 1 P e r s ö li 1 i c h li e i t<br />
zu tun. Dieqer Fall liegt hier für uns vor. S o k r a t es soll iin fol-<br />
genden iii bczug auf einen bestimmten Punlit zu ueuer Uiitersucliung<br />
vorgenommeii \verden. Solirates ist eben ein solcher Begriff der Ge-<br />
schichte, zu den1 imincr wieder zurücligeliehrt werdcii inuis, weil cr in<br />
seiner Bedeutung iiic recht erschöpfend gewürdigt werden kanil. Zwar<br />
zielt die Frage, die hier angeregt 117erdeii soll, nicht gerade auf (Las<br />
1) BIax Heinze, Die Lehre vom Logos in cler griechischen Philosopliie.<br />
Oldenburg 1872.<br />
Philosoph. <strong>Abhandlungen</strong>. 1
9<br />
Sokrates - Gegner oder Anhgnger der Sophistik?<br />
Zentrum dieser pliilosophiegeschiclitlicheil Weltgestalt, aber sie erscheint<br />
doch der Beachtung wert, weil erst ihre Lösung es ermöglicht, den<br />
groisen Atheiier als Vertreter der Wissenschaft, als ein Hauptglied in<br />
der Kettc der groisen Denker richtig zu erfassen.<br />
Die Geschichte der Philosophie lrennt wohl Baum eine wirkungsvollere<br />
Gegeiiiiberstelluiig als die des Solrrates und der Sophisten. Die<br />
beiden Vergleichsglieder aber stehen fiir das geschichtliche Urteil auch<br />
nicht einmal annallernd einander gleichmaisig behaildelt gegenüber.<br />
Das Bild des Solrrates hat in Plato einen begeisterten Darsteller gefundeii.<br />
Dadurch ist es, zuinal nach der einen Seiite hin, der Nachwelt<br />
lciclit gemacht worden, in der Frage über clas Verhkltnis zwischen<br />
Solrrates uiid seinen sophistischen Zeitgenossen Staildpunkt zu ilehmen.<br />
Nur behält sich die Wissenschaft vor, auch hier den Zusammenhang<br />
oliric TToreingenomeilheit und unter Berüclrsichtigung aller objektiven<br />
Argumente klarzulegen.<br />
Gleich beim ersten Eingehen auf unsere Frage drängt sich eine<br />
Tatstlche entscheidend in den Vordergrund : Ein Kampf hat nach<br />
sicherer Überlieferung zwischen Soli-rates und zeitgenössischen T'ertretern<br />
der Sophistik bestanden. In diesem Kampfe ist Solrrates Sieger<br />
geblieben, und zwar ein völliger Sieger. Die Sophistik erlosch schon<br />
iil der auf Solrrates nächstfolgenden Generation; was von ilir in der<br />
Geschichte des Deiilreils zurücl~geblieben, scheint iiur clie traurige Rollt,<br />
zu sein, clie Bezeichilung fiir wertlose Afterweislieit herzugeben. Über<br />
das, 117~1s sophistisch ist, geht die ernste Wissenschaft zur Tagesordiiung<br />
iiber. Ganz anders liegt bei Soli-rates die Sache. Seine Methode hat iii<br />
einem wesentlichen Punkt Allgemeingültigkeit erlangt, an seinen<br />
Xameii kiiiipft fast die ganze iiachherige Philosophie Griechenlands an,<br />
inicl auch clas heutige Denken2) zehrt an den Früchten seiner Wirlisamlreit.<br />
So scheint das Rechenexempel: Solirates und clie Sophistik leicht zii<br />
lösen. Solrrates, der seine Anschauungen in siegreichem Kampfe mit<br />
den Sophisten entwickelte, hat die Nachwelt vor sophistische11 Verirrungen<br />
gerettet und wir1rt noch hc~ite als Lehrer. Die Sophisten<br />
siiid tot.<br />
Abcr dies Urteil, so klar seine Praeinisseri auch ZLI sein scheinen, ist<br />
nicht richtig. Völlig tot ist eine Lehre nicht gleich darum, dass sic<br />
bei eiilem MTcttstreit der Schuleii schlieSslich ohne direkte Anhängerschaft<br />
ausgehen muis, sonder11 es konimt in Frage, ob aus dem Inhalt<br />
der betreffenclen Lehre irgend eiii Wert auf andere Richtungen übergcgailgeii<br />
uiid von ihnen assimiliert ~vordeiz ist. Und das ist hier der Fall.<br />
Auf indirektein Wege haben sich Elemente der Sophistik in die wisseiiscliaftliche<br />
Nachwelt hinübergerettet. Und 11~11 ist das Iiiteressailte<br />
liiei-bei, clais derjenige, der hier die BIittlerrolle gespielt hat, kein anderer<br />
2) Zu eng ist das Urteil Harnacks: Sokriltes und die alte Kirche, Rektorats-<br />
rede, gedruckt in Die chr.Welt, 1900, Nr. 43: .Nur der Teil seiner (des Solcrates)<br />
Philosophie sei geblieben, der durch seinen Tod erkl5rt und bestiitigt morden<br />
ist, alles andere sei vergessen.'
Sokrates - Gegner oder Anhänger der Sophistik? 3<br />
ist als - Solirates selbst. Mit andern TVortcn, Solcrates ist nicht nur<br />
der Bekämpfer der Sophistik, er ist gewissermafsen ihr geistiger Ge-<br />
nosse. Was ist, philosophiegeschicliiliclz betrachtet, bei Sokrates in<br />
I-Iinsiclit auf seine Beziehung zu der Sophistik, das Charaliteristischste :<br />
die Gegnerschaft oder die Anhiilgerschaft? Das ist die Frage, die mir<br />
iin folgenden untersuclieii wolleii.<br />
Die Sophisten kameil der Zeit nach zuerst. Schon hieraus ergibt<br />
sich cler Gang unserer Untersuchung, die sich folgendermaiseil gliedert:<br />
1. die Sophisten;<br />
2. das Sophistische bei Solcrates; hieran sclilieist sich<br />
3. eine allgemeine Würdigung des Sophistischen einerseits, cles<br />
Sokratischteil anderseits; worauf<br />
4. das Endergebiiis der Uiltersuchung erfolgen liaiiii.<br />
I.<br />
Zuerst also die Sopliisten. Die Bezeichiiung Sophist wird, zeitlich<br />
betrachtet, nicht ohne Willkür abgegrenzt.3) Als geschichtliches PhSinoineii<br />
sind die Sophisten wesentlich vorbereitet. Die Neuerung, die<br />
sie anstrebteil, hatte in Epliialtes, Phidias und Anaxago'as ihre politiselieil,<br />
künstlerischeil uncl theologischen Zeugen bzw. Blutzeugen schon<br />
gefuncleil. Perilcles, der Freund sämtlicher genannter Männer, hatte durch<br />
I-Ierailziehuilg ionischer Lehrer uiid Neister clie stürmisch fortschreitende<br />
Umbildung cles Deiilieils uiicl der Sitte gefördert. Die politische<br />
Situatioil, clie rapid anwachsencle demokratische Gesii~nung leisteten<br />
clen aii sich aiiziehendeii Künsteii der Rhetorik und der pliilosophierenden<br />
Virtuosität mächtigen Vorschub. Ii~lierlialb des Bezirkes rein philosophischer<br />
Beschäftiguilg war der Boden vorbereitet durch den - wie<br />
es scheiilt - fleiisig gelesenen I-leraklit, der von der Wandlung uncl<br />
clem Flusse aller Dinge predigte. Parmeiiides wie Empedokles, später<br />
Deinolirit, liatten bereits die Distinktion zwischen der sinnliche11 Wahriiehmiiiig<br />
und der hölieren methodischen Eiiisicht gemacht und der<br />
erstereil die Zuveilässiglieit abgesprochen. Besonders ist aber ein Vorginger<br />
der Sophistik namhaft zu inachen: das ist cler gegen Anfang<br />
des 5. Jal~~hunderts geboreiie Zeiio. Im Gegensatz zu der bisherigen,<br />
rein dogmatisch flieisendeil Darlegung der philosophischei~ Ai1schauiuigeil<br />
führte er eine gröisere Beweglichlieit in die philosophisclie Betraehtuiig<br />
ein. Seine Gesichtspuiikte machte er nämlich in der Weise<br />
geltead, dais er die Beliauptuiigeii der Gegner einer Eitik uiiterwarf<br />
iind durcli TTTiderlegung als irrig bewies.<br />
Die allgemeine Stiminuilg, clie cr~vacheiicle Erl
4<br />
Sokrates - Gegner oder Anhänger der Sophistilc?<br />
neuc Methode des Zeiio und Melissos, das alles waren DIomeiitc, uiiter<br />
clereii Einwirkung sich die Sophistik herailbilclcte, uiicl es ist von vorii-<br />
liereiii nicht einzusehen, vie sich eiii Volkslehrer, wie Sokratcs, cleiil<br />
Eiiifluis dieser Fal-toren hatte eiltzieheil kbiineil.<br />
3fan lrailii, seit ungefahr Blittc des 5.. Jalirhuiuderts, die Sophisten<br />
iii Athen, wo die oben aiigedeutete Aufklaruiig ihre EIeinistittc liatte,<br />
als die vorgescliobeiicii Repraseiitaiiteii der iieuen Rildungsart uiid<br />
Geistesrichtung betrachtei~.~) Sie bilcleteii die früher begoniieiic I
Sokrates - Gegner oder Anhiinger der Sophistik? 5<br />
Bei solcheil Theorien Iraiiii nlan CS begreifen, dais, wwn Plato<br />
tleii Ausdruclr Sophist etwas odios anxvendete, er hierin nur ein Gefühl<br />
des Tollrs wiedergab. Es verschlug dagegen wellig, dals die meisten<br />
voii cleii Sophisten sich iii mehreren Puillrteii zu der lierkörnmlicheii<br />
Moral hekannteii, die bürgerliclie Tugend beredt beschrieben. Ihr<br />
positives Verhriltnis zu cleii gewöhillichen Vollrsidealen war docli Bein<br />
iiilinittelbares, kein uiibecliiigtcs. Der Iiistiiilrt des Volkes crlraniite<br />
iii ihiieii clie Uinstürzler. Die liiiigschuleii und Turiipliitze wurden versäuiilt-,<br />
so formuliert sicli bei Aristophanes die Aillrlagc; sich von clein<br />
Alltagslcbeii zurückzielieiid, beschaftige sicli die Jugend init Astroiiomic<br />
uncl Mcteorosopliie, wein1 sie sich nicht gar in1 Grübelhaus vergrabe,<br />
uiii die mülsigstoii Begriff~s~ielereien zu betreiben; schlimmer als dieses :<br />
Das Gefuhl der Schamliaftigkeit, ma lsvolles Bcnehmcii schwiiide dahin ;<br />
es werde docli nur gefragt: Was ergeben sich fiir Folgen aus dieser oder<br />
jener IIaltuiig für inein egoistisches Gef ül11 Z Gründe lief sev sich für<br />
alles ailfüliren, auch für die schlechte Sache; die Kunst des Betruges<br />
sei Gegeiistaiid der Schulbilclu~ig.~) So zeigt scholl eine Schrift vom<br />
Jalire 423, dais die iieue Uiitersuchungsmcthode zu Extravaganzen und<br />
uiilicbsanieii Exzcsseii Aiilais gab. Dais liicrbei pral~tische Interessen<br />
allgenieiiier Natur aufs Spiel gesetzt wurden, das war in der Geschiclite<br />
der Sophistilr sclion früh wahriielimbar. Iii den „Wollreiil' bedingt<br />
eben diese Tatsache clas dramatische Hauptinomeiit. Uiid die Übertreibung<br />
des II'oinödiendichters liaiiil scholl aus reiii künstlerischeil<br />
Grüiicleii nicht allzu grois aiigesetzt werden: inüisten doch die Zuscliauer<br />
oder Leser, weriigsteiis nach cler Meinung des Dichters, die von<br />
ilnn beabsichtigte Icleiitifikatioil im wesentlichen mitinacheii köniiei~.~)<br />
Aiilserdem liegen direlrte Bestiitigungeil dieses Urteils geschichtlich<br />
vor. Schon Protagoras liei's sich verlauten: Wer seine Kunst sich aneignete,<br />
würde iiie in Verlegenheit geraten; loe~veisen lieise sich jede<br />
Sache ebensogut wie wiclerlcgeii; init I-Iilfc der Rhetorik liöune man<br />
Scli~varz zu Rei ls inaclieii.<br />
Eine Dolqtriii, wie diese dcs Protagoras, uiitergräbt das Fundameilt<br />
cler alten Zucht uilcl Sitte. Dieser Eiiidruck lronnte aiich nicht etwa.<br />
cladurcli abbalanciert wercleii, dais v)oil demselbeii Sophisteii - auf-<br />
fallciicl genug - der schöne Nytlius erzählt wurde, iii den1 clie Ge-<br />
rechtiglreit und Schainhaftiglreit als Gabe Gottes verherrliclit werdcn.<br />
Denn die Gabe ist ein Schinuclr, dcii nian anlegen lraiiii, kein Gesetz,<br />
daq man befolgen lnufs. Ein Zug des Leichtsiiiiis ist in die sophistisclic<br />
Päclagogik hiiieiiigelroinnieii uild richtet fortan unwiderruflich Unheil<br />
an. Die rechthaberische FrivolitHt hat gewii"s auch mit zu der moral-<br />
5) Siehe Die Wolken, namentlich Vers 95fl., 113ff., 145 ff , 185ff., 220ff., 410ff.,<br />
874ff., OlOff., 955ff., 1030ff., 1047ff., 1320ff., 1390ff.<br />
G) Die Bühnenfassiing des Stuckes besitzen wir ja nicht, sondern eine<br />
spiitere Umarbeitung derselben; aber zwischen jener und dieser haben wir mohl<br />
keine lkngere Zwischenzeit anzunehmen. Die Aufstellungen Joels: Der echte<br />
lind der Xenophoiitische Sokrates, Berlin 1901, 11, 2, 809ff., sind hier sehr be-<br />
achtenswert, gehen aber wohl im einzelnen zu weit.
G<br />
Solrrates - Gegner oder Anhiiilger der Sophistik?<br />
wissciischaftlicliei~ Selbstveriiiclitung der Sophistilr beigetragen. So<br />
wird gewöhillicli geurteilt, und so wird niit Recht geurteilt.<br />
Aber es ist nicht allzu schwer, iil cleis dialektisch-ethischen Irr-<br />
fahrten der Sophistik die verfelilten Koilscqueiizen eines Prinzips zu<br />
erlreniieis, das solist von hoher wissenschaftlicher Bedeutung ist, und<br />
das von den Sophisten zun erste11 Xalc zur Geltung gebracht wurde.<br />
Die Sophisteii sind diejenigen, die der Subjektivität zu der ilir ge-<br />
bührenden Rolle in der Geschichte clcs Dcnkeiis und Urteilens verholfeil<br />
habeil; sie siiid freilich dariii zu weit gegangen, aber sie haben ailcler-<br />
seits die Philosophie gerade in der ermrähiiteil Beziehung uni melircre<br />
fruchtbare Gesichtspunkte b~reichcrt. Einige davon seien liervor-<br />
gehoben. Die Tlieoretilrcr schlugen aucli zuvor verschiedene Wege ein,<br />
gewiis; aber erst durch die von den Sophisten iiach dem Vorbild Zeiios<br />
ausgeübte Dialektik wurde den gedanklichen Aufstclluiigesi eine solche<br />
logische Analyse zuteil, dafs fortaii eine ~virlrliche Foriilulieruilg clcr<br />
Probleme, eine Entwicklung iiinerhalh der Iclcen ermögliclit var. Dei<br />
Kreis der Schuldogmeii wurde auch clurch Einführung neuer Dis-<br />
lrussioiisthemata wesentlich erweitert. Es galt nicht iiielir lccliglicli,<br />
ob der Stoff einheitlich ocler virlgestitltig, von dieser oder jener Ur-<br />
qualitilt sei, ob die Bewegung Tatsache ocler Schein sei; der Sopliiat<br />
verschanzte sich iiiclit hinter einer Aiizalil voii oralrelinäisig abgegebenen<br />
moralischeil Gutachten, vorgetragen iili Tone ciiies Weiscn, sondern<br />
alles stand unter dem Zeichen der Untersucliuiig: alte Dognieii, Sitte,<br />
Gesetz, Herkomnieii, Götter uncl Xeuscheii. Die Uiivolllroiniiieiilieit<br />
des positiven Rechtes, die Rclativitat der TValiriiehiiluilgci1, die Eediiigt-<br />
heit des ineiischlicheii Tirteils wurilen eingehend erörtert. D a s s i ri il<br />
aber wirlrlicli wissenschaftliclie Fragen, uutl sie an-<br />
geregt zu haben, ist verdienstvoll.') Eine spkter nie verloren gegaiigeile<br />
3felirseitiglrcit der Betrachtung, eine lrritisclir Sichtung cler als Pro-<br />
bleine aufgefaisteii Lehrpuiilrtc, eine cler JV~irde der freien iiieiiscli-<br />
liehen Persöiilicldreit entsprechende Prüfungsteiidenz, statt stuinpfer<br />
Autoritatsgebuildeiiheil, das siiid Blüten clcs sopliistischeu Gcistcs.<br />
Von diesem Geiste ist aber auch Solrrates tief berührt. Der Zeit<br />
nach gehören Sokrates und die Sophistik eiig zusamnieii. Seiile Re-<br />
ziehungen zu den Sophisten erhöhten ihre Alctualitat. Kaum ist er ge-<br />
storbcii, und sie scli~vindeii dahin. Ihr Opponent, ist er ge~visser-<br />
niaiseii aucli ilir Genosse, uiid die Diskussion, die er mit ihnen hat, gibt<br />
den1 pliilosopliischei~ Betrieb der Zeitgenossen sein Gepräge. Mit clrin<br />
ältestcii uncl bedeutcndsteii unter den Sophisten, Protagoras, hat er<br />
wiederholt Auseinandcrsetauiig-en; aufserdem streitet er mit Gorgias,<br />
I-Iippias und Prodilros sowie mit anderen Rel~räseiitaiiteis der Sopliistik.<br />
Deli Inhalt seiner Lehren cntwiclrclt er aii der Hand dicser Polcmil~<br />
7) Siehe auch Ueberweg-Heinee: Grundriis clcr Geschichte der Philosopliie,<br />
B. Aiufl., I, X. 107fg.
Sokrates - Gegner oder Anhanger der Sophistilc?<br />
gegen die Sophisten. Fast liönnte nlaii eine Parallele finden in clerii<br />
Verhiltnis des Stifters der christlichen Religion, zu den Scliriftgelelirteii.<br />
Aber der Streit ist in ilnserm Fall weniger leidenschaftlich.<br />
Er verläuft nieist ohne Gereiztheit und Groll. TVarnni? Die GegensiLtzlichlieit<br />
war hier nicht so schroff, zum Teil verschwindet sie ganz.<br />
Wie wir aus dein Dialog Platos : Theätet (15 1 B) erf ahreil, lioinlte<br />
Solirates gelegentlich Schiiler von sich vorbereitungsweise zu Prodilroq<br />
und „anderen 'CVeiseri und gottbegnadeten &Iänncrn" hin~~ciseii. Dem<br />
Feinde gegenüber bringt es die Galanterie nicht so weit: einen lehrbegierigen<br />
Schiiler aii eiiieil solchen zu weisen, der eben einaiidcrsetzungen<br />
hat Solirates in der Sophistik nicht lediglich Cliarlatanerie<br />
gesehen. Wir mussen aber noch weiter gehen. Dieser TTcrtriglichkeit<br />
entsprechen mehrere Tatsachen, clie tlie naheil Eeziehungen<br />
oclcr gar die Genzeinsamlreit der beiderseitigen Lehrtitiglieit zeigen.<br />
Ein iulserer ITmstand war fiir die Tatigkcit des Sokrates wie cler<br />
Sopliistcn gunstig: der gesteigerte Er~iehungsbedarf der giiechische~i<br />
Jugend. Dem cnts-racli bei den IJehrcrn eine Vorliebe für pralrtisclic<br />
Probleine, ziimal fiir die Moral~~,issel~scliaft, was ja. auch tatsächlicli.<br />
bei clei 1,ehrtatigkeit cles Solirates so gut wie der<br />
Sopliisten hervortritt. Einc wesentlicl~ praktisch oriciitierte Weisheit<br />
setzt aber iiiclit notwenclig Gesclilossenlieit oder Folgericlitiglieit<br />
des Deillieiis voraus. Auch in diesein Punkte begegnct sich<br />
Sokrates mit den Sophisten. Er hat, wic sie, kein Systeni aufgebaut,<br />
ja nicht einmal die Konsequenzen seines Sta~idpuiilites zu strenger<br />
Durchfuhruiig gebraclit. Nicht nur erkennt Sokrates in den positiven<br />
Gesetzen - man versteht nicht recht, kraft welcl-icr Eogil~ -- „ungeschriebene<br />
göttliche Satzungen", sondern aucli die BIantili ist ilnn, cleiii<br />
sonst begriffsmäisig argumentierenden TValirheitssucher, eine Realitiit,<br />
und indem er auch lokale Kulte, trotz ihrer schreienden Irrationalitat,<br />
guthriist, verringert er - allerdings ohne seinen1 Schicksal als religiöser<br />
Neuerer zu entgehen - dein dogmatischeil Gefühl des Vollies gegeniiber<br />
die Reibfläche." Xach Art der Sophisten bcgniigt er sich damit,<br />
8) Ich muis mich - im Widerspruch mit Joel, I, S. 70ff. und V. Röck, der<br />
in seinem mir erst nach der Abfassiing dieser Abhandlung bekannt gewordeneil<br />
Werke Der unverfälschte Sokrates, Innsbrnck 1903, S. 91ff, Sokrates als einen<br />
Atheisten darstellt - bezuglicli dieses Panktcs im wesentlichen Zeller, Die<br />
Philosophie der Griechen, 4, Aufl. 11, 1, S. 178ff, anschliefsen. IZock fuhrt als<br />
Instanzen, die angcblich der1 negativen Standpunkt, den ,,radikalen Atheismusu<br />
des Sokrates beweisen sollen, an Die atheistische Bildungssphnre, aus der die<br />
sokratischen Ideen hervorgegangen, den Atheismus seiner Schiller, das Zeugnis<br />
des Aristophanes, schliefslich die Anklage und Veriirteiliing des Sokrates Aber,<br />
wie so hiiufig sonst, stehen auch hier Umfang und Be~veiskraft der Argumeiitr<br />
in umgekehrtem Verhaltnis.<br />
-<br />
i
8<br />
Sokrates - Gegner oder Anhänger der Sophistilr?<br />
gervisse Eiiizelprobleine fiir sich zu behandeln. Vor allen1 diskutiert er<br />
clic begrifflichen Prinzipien der Tugeiicl. Er verspricht sich viel voll<br />
dieser verstandesmäfsigeii Erörteiuiig, was wiederum mit sophistischer<br />
Deilli~~cise übereiilstinmlt und auf einer psyehologischeii Begründung<br />
cler pralrtischeii Ideale beruht. Die Tugend ist nicht eine Aiipassuiig<br />
an irgeiid ein vom Staate vorgeschriebenes, durch das IIerlrommeii verbürgtes<br />
Gebot. Sie spielt sich überhaupt nicht iiliierlialb des Gebietes<br />
cler Willcilserreguilg ab, soilderii wird als Frucht cler Auflilarung gcdaeht.l)<br />
uni gut zu handeln, inufs man richtig erlienncsl. Die Philosophie<br />
ist seither zu dem Problem immer wieder zurücligeliehrt. So<br />
hat sie11 iii dieseln Puiikte durch Solrrates die von den So~histeii ausgeheiicle<br />
verstandesmälsige Analyse der Bcwuistseiiistatsachei~ ein becleutciides<br />
Deiilmial gesetzt.<br />
Allerdings setzt in diesem Punkte auch die Hauptdivergeiiz zmiseheil<br />
Solrrates und den Sopliisteii ein. Die letzteren blieben in ihrer Auffassung<br />
der Vorstelluilgstatsxheii bei dem Zufalligen uncl rein Subjektiven<br />
stehen. Aber wo es immer zu einem Dcnklebeii lioinmt, ist -<br />
auiser clem rein Empfiiicluiigs- und Phaiitasiemäfsiycii - iioch ein bestinimteq<br />
synthetisches Noment zur Herstellung des iiiueren Prozesses<br />
initmirlisani. Dieses Monzeiit besteht isi rler Ailweildung von B e -<br />
g r i f f e 11. Das &lerlunal der Begriffe ist, dais aii den Vorstelluiigsgcbildeil<br />
durch Ausscheidung cles relativ Unweseiltlichen uiid durch<br />
Fixicruiig des relativ Wesentlicheii eine in sich abgerundete, für die<br />
Gedankeiiführiiiig ailrvciidbare Totalität, eine Einheit geschaffen wird,<br />
vermöge deren die Orieiltieruiig des Subjektes iii einer geistigen Welt<br />
Sicherheit uiid Ruhe gcwiililt. Dies hat Sokrates eiilgeseheii, ja nocli<br />
mehr: dies erlieiii~tnisthcorctiseli zuerst zur Geltuiin -. gebracht zu<br />
haben, iit sein nie verwellieiides Verdienst. Daiiacli richtete sich seiile<br />
iii Frageii und Eiiiwäiideii sich bewegende Erörterung der Probleme.<br />
„Nicht das", so berichtigt z. B. Solrrates dcn Theätet, ,,\v~~rde gefragt,<br />
rv o v o 11 es Erlreniitnis nabe. nicht war es die Absicht. die Erkeiiiitnis<br />
aufgeziihlt zu bekoinmeii, sondern es galt, die Erkeiiiitnis selbst zu begreifeil.<br />
Oder glaubst du, dais jeinaiid eine Bezeiehnui~g eines Diiiges,<br />
versteht, von clem er iiicht weils, wes es ist?'' (Plato Thcätet 146 E.) So<br />
steht bei Solirates der Begriff iin 3Sittelpiisikt der TVissei~sbild~iiig. Zum<br />
Begriff gelangt inxil clurch indulrtive Behandlung der gegebeiieri Erfahruiigesi;<br />
~vas hieraus, aus der iiidulrtiveii Operation resultiert, gewährt<br />
etwas logiscli Festes, auf welches rlurcli Aiialogie cler Spezialfall zurückgeführt<br />
werden liaiin. Die Isidulitioii clieiit einem declulitiven Zmcclie.<br />
das TVisseil wird erstrebt in cleii Formen geineiilsam verbuilcleiler, zielgerecht<br />
clefiriierter Begriffe. Die Kunst eiiier TTiitersuchung, deren<br />
9) Die Moglichkeit dieses Erkennens, den begrifflichen Charakter der Tugend<br />
hat Sokrates nach sicheier Uberlieferung angenommen. Seine Aporie ist der<br />
methodische Ausdruck seiner Vorurteilslosigkeit uild bedeutet durchaus noch<br />
iiicht, dais er etwa nur die Tat als Erkenntniskriterium in Sachen der Ethik<br />
anerkannt habe. In seiner Schrift: SoBrates und die Ethik, Tubingen 1904,<br />
urteilt H. Nohl, der nbrigens den Einfluis der Sophisten sehr gering ansetzt,<br />
8. 44 m. E. viel zu einseitig in bezug auf diesen Punkt.
Sokrates - Gegner oder Anhanger der Sophistik? 9<br />
Zweck die Erreichung eines Allgemeiiigültigcii, deren Nethode die Ausfiiirluiig<br />
genereller lbferlunale ist, ist nach gemeinsamer Uberlieferung<br />
Platos, Xeiiophons und Aristoteles' das Wesen der sokratischen Wissenschaftlichkeit.<br />
So resnltiert die von Plato so ergötzlich gcnialtc Situation: einersrits<br />
die Sophisten, die alles wissen -, aber niclits Sicheres kennen,<br />
auf der anderen Seite Sokrates, der nichts weils, aber FuPs um Fufs<br />
sich gesicherte Urteile erkämpft.<br />
Aber bei dieser Divergenz liöiiiien wir nicht I-lalt inachcii, als driiclcc<br />
3icli darin auch iiur in aiiiiähcrncl erschöpfender Weise die Beziehung<br />
zwisclieii soliratischer und sophistischer Philosophie aus. Es ist vielinelir<br />
hier von ganz tiefgehender Verwandtschaft zu sprcchcii. Die<br />
Ethik des Solirates trigt in ihrer psychologischen Begründung einen<br />
mit der sophistischen Dialelrtik nahe zusammelistiminendeii, intellektuellen<br />
Charakter; darauf wurdc schon hingewiesen. In der Weisc, wie<br />
er clie Moral niotivicrt, ihren Zweck bestimmt, hat er eiiieii weitercii<br />
Berührungpuiikt mit der Sophistik. TTTeiiii er die Lust als oberstes<br />
Prinzip aufstellt, bleibt cr - so edel er auch dicse Lust inhaltlich bestiiii~iit<br />
- durchaus ini Sclicnia der sophistischen Betrachtung. Die<br />
Gliickseliglreit des Iiiidividuums, ja sogar die Nutzlichkeit, die sich<br />
tlemselbeii aus einen1 ge~visesii Verhaltcii ergibt, ist von Sokrates als Re-<br />
~tiiiiinniigsgruncl gedacht.lO) Der Aleiiscli mit seiner Wcrtenipfindung,<br />
seinem Gefulilslebe~i ruckt als eiitscheidendcs Prinzip in den Vordcrgruiid.<br />
Der lbleiiscli ist das Mais aller Dinge, lehrte die Sophistik; Solirates<br />
~viderspracli. Der &Ieiiscli ist der Zweck aller Dinge, mciiite die<br />
Sopliistili weiter; damit erklärte sich Sokratcs ci~iverstaiidcii. Diesc<br />
Cbereiiistinunuiig ist geschichtlich sehr beachteiis~vert. Sokrates hat<br />
aus der antliropologischeii Gruiiclstimmuiig des sophistischcii Zeitalters<br />
heraus ein Theorem eiitmiclrclt, das in der Geschichte der Ideen eine<br />
a~isero~dei~tlicli becleutsanx Rollc gespiclt hat. Icli denke an die<br />
T e 1 C o 1 o g i e des Solrrates. Bis iii die Eiiizelheiteii faist Sokrates die<br />
TITelt nebst ihrrii Einrichtuiigeii als zum Wohl cler Melische11 gescliaffe~i,<br />
riieiisclilichrii Zweclieii clieneild. Hiermit verbindet sich als soliratisches<br />
Lchrspezimeii die Aiisicht von der göttlichen Vorsehung; die göttliche<br />
Fürsorge um die Menschen wird hervorgehoben. Omnipräsenz ist Vorausscizuiig<br />
jener Teorie iiiid ~vird auch von Sokrates emphatisch der<br />
Gottlieit z~erkaiiilt.~l) Der theologische Zeiitralbegriff, die Gottesidee,<br />
erliielt dadurch ein persönliches illomeiit, wodurch sie aii Lebeiicliglreit<br />
viel gewann. Man braucht iiur dcii aaaxagoreischeii Nus mit der sokratisclieii,<br />
später dcr auf Sokrates zurücligreifeiidcn platonisch-stoischen<br />
Lehre von der Vorsehung zu vcrgleicheii, und dic Weiterbilduiig des<br />
tlieologischeii Begriffs springt in clie Augen. Wie man auch iiber den<br />
pliilosophischeii Gewinn bei dieser Theologisierung denkt, eins ist<br />
sicher: das religöse Leben hat hierdurch eine bedeutsame Füliliiiig mit<br />
10) Vgl. die Belege bei Zeller, 11, 1, S. 150%. und Siebeck, Untersuchungen<br />
ziir Philosophie der Griechen, Halle 1873, S. 35fg. Ueberweg-Heinze, I, S. 129.<br />
11) Mem. I, 4, IV, 3.
10<br />
Sokrates - Gegner oder Anhänger der Sophistik?<br />
der gedanlilichen Weltauffassuiig gewoiineii, was ~vieclerum der sinncii-<br />
den Betrachtung des Weltganzeii zicue Perspelitiveii eröffnen i~iuiste.~')<br />
Dies zeigt sich besonders gewaltig, als sich mit cler sokratisch gc-<br />
stiinmteii, spätplatonisch-stoisclieii Pliilosophie die chsistliclle TTelt-<br />
religioii auseinandersetzeil inuiste. So ist miederinn mittelbar clurch So-<br />
lirates, ein Charaliteristikuni der Sopliistilr, iiamlicli ihre a ii t h r o p o -<br />
z e ii t r i s c h e Betrachtuiig der Welt, zu groPser gescliichtlichcr Becleu-<br />
tuiig gcliommcii. Uberhaupt biete11 die Schuleil, die sich iiach Sokratc.9<br />
nenilen und dessen Gedaiilreii weiter entwiclrelil ~i~ollcii, vieles, was ail<br />
cli~ s o p h i s t i s c h e Geistesrichtung des grolsen Atlieners geilzahnt.<br />
Die Hintansetzuiig der rein theoretischen und die Ziilrehrung zii den<br />
ctliisclieil Fragen, die I
Sokrates - Gegner oder AnhXnger der Sophistik'? 11<br />
liclie Lebciii, die grubeliide Stiiiiinuilg nebst der gegen die etliische<br />
T,ebeiisweise lioiitrastierenden Geringschatzuiig der in Spiel uiicl<br />
Ubuiigeii gebildeten librperlichkeit, das religiöse Besscr~visseil, das uii-<br />
verfroreile Betasteii uiid Bemkngeliz aller Lebeiisverhaltiiisse, clic Peclaii-<br />
terie iii der Rem7eirführuiia. das siiid sonliistische Charakteristika ilacli<br />
U,<br />
aristophanischer Zeichiiung, uiid zwar passen sie auch ge~visserniaiseii<br />
alle auf Solirates, der iii der Komödie sie zur Scliaii zu tragen l1at.I4)<br />
Aber Solirates selbst charakterisiert sich gelegentlich, uncl zwar<br />
geni+iis dein Bericht eiiies Mannes, der ihn für alles andere, nur nicht<br />
für eiiieii Sophisten gelten lasseii inöclitc, iii eiiier unserein I-rteil eilt-<br />
spreclieiideii Weise. Aii eiiier Stelle iin Thcatet laist Plato Sokrates<br />
sagen: „Die 3Ieisteil verstelieii nicht nieiiie positivei~, »geburtslielfc-<br />
rischen« Bemühuiigeli, wohl aber haben viele inir vorgeworf eil, da l s ich<br />
tler wunderlichste voii allen Dilerischen sei u ii il a 1 1 e z u m Z TV c i f c 111<br />
b r i ii g e , dafs ich aiicleren wohl Frageil vorlege, selbst aber iiiclit auf<br />
irgeiicl etwas Bescheid gebe" (149, 150 B), uiicl Meiio~i wendet gelegent-<br />
lich vorwurfsvoll ein: Er habe sclioii vorher gehört, clais Solrrates alle-<br />
mal selbst iii TTei.mirruiig sei und auch andere iii Verwirruiig briiige.lj)<br />
Xan wird ihn iii Athca für nichts anderes als für eiiieii Sophisteii<br />
gehalteil liabeii. Wir ahiieii, wie Aristophaiies ihii liat als eiiicii solchen<br />
ciarstelleii könrieii. Der sclilieisliclie Beweis eiiier derartigen Bcurtei-<br />
lung des Solirates seitenb seiiier Zeitgcnosqeii ist die Aiiklage, clie sciii<br />
Todesurteil herbeiführte. Die Anldagepuiikte : Yerlcugiiuilg der<br />
Staatsreligioii liebst Einfuliriirig frcinder theologischer Begriffe, dazu<br />
sittliclic Veriulirung der Jugend, höreil sich wie ein Sachklang der<br />
aristophaiiisclien Beschuldigung an uiid gellen auf iiichts anderes al9 aut<br />
sophistische Uiutriebe aus. Die Tragik beiiier Lebeiisgescliiclite ist,<br />
dais er sich selbst als andersartig ctnpfuiideii hat. Ob uiit Recht? Wie<br />
hat mail liurz die gegeiiseitigr Abweichuilg, uiiter Würdigung besoiidcrs<br />
der wisseiiscliaftlicheii Soiidrrmerkmalc, zu bestiinnieii?<br />
Solrrates wircl gewöhnlich als der uiivergleiclilicli Beclcuteiidere be-<br />
trachtet, und er ist es gewiis auch. Die Sopliisten exzellierte11 in der<br />
technischen Aushilduiig der Rede. Solirates begrüildcte die Wissen-<br />
schaft des Wisscils. In scincn Fufstapfeii wandelte jahrhundertelaiig<br />
die Philosophie.<br />
Aber nicht auf alleii Gebieten stellt Solrrates das I-Iöchste dar, was<br />
seine Zeit besais; in ein paar Punkteii stehen ihm die Sophisten voran<br />
uilcl kamen über ihn liiiiaus. Solrrates ciii,pfängt voi1 der Naturwissen-<br />
schaft lieiiie Belehrung; iil der voii Plato überlieferten Apologie<br />
(VII, C) wird er der Iiuiist und Diclituilg wenig gerecht; er spricht<br />
---<br />
14) Dais daneben vieles nicht auf den geschichtlichen Sokrates palst, sondern<br />
mit Recht nur gegen die rhetorisch-anarchistisch tatigen Sophisten im gewöhn-<br />
lichen Sinne des Wortes gerichtet werden könnte, braucht Baum gesagt zu werden.<br />
15) Plato Menoii, 80; ugl. noch Xenophon Memor., IV, 4, 9 fg.
12<br />
Sokrates - Gegner oder Anhenger der Sophistik'?<br />
ihiieii jede Sophia ab iiiid hebt aus ihren Voraussetzuizgen nur ein<br />
BIoiizeiit, die unklare Gefühlseingebung hervor. Seine Beurteilung der<br />
wisseiischaftliche~~ Betriebsamkeit seiner Zeit erhebt sich manchmal<br />
kauin über das Ifais des laienhaften Iildiffereiztisnius jedes Zeitalters.<br />
Dals er die rucl-ilose Meinung eines Aiiaxagoras teileil sollte, die Soiziie,<br />
statt für ciileiz Gott für eiiien glülienden Stein zii halten, weist er niit<br />
Entrustung zurück.l" Er verschmkht es nicht, zur Eiztscliuldiguizg fiir<br />
sein uilprodulrtives Verhiltriis zu den Naturstudieiz in plebejischer Weise<br />
Kapital aus den1 Uinstaiicl zii schlagen, clais die Physiker sich gegenseitig<br />
~vidersprechc11.17) Von der Erforschuiig der sogenannten „himmlisclieil<br />
Diiige" hielt er, wie Xenophoii berichtet, sich entfernt, deiiil -<br />
so lriist ihn Xenophoil argumeiiiieren - weder, glaubte er, seien diese<br />
dein meiischlicheii Wisseri zuganglich, noch sei es den Göttern lieb, da19<br />
cler Nensch sich clasjenige zu suchen unterfange, was jene nicht offelzbaren<br />
wollteii; eine Meiiiuiig, rlie ja auch scl-ilicislich jeder Zaiiberpriester<br />
teilen wurde.13)<br />
Irgend eine wisseilscliaftliche Titiglieit auiser dem ethischen und<br />
erlramtnistheoretischen Gebiete hat Sokrates niclit entfaltet. Er war<br />
eben eine auf seine Eigenart lroiizeiztrierte Persö~zlichlreit.~" Wen11<br />
wir ihm keiiieii Vorwurf daraus machen, ist es anderseits nur gerecht,<br />
claraii zu eriiiilerii, dais clie Sophisten es ihin in dieser Beziehung zuvorgetan<br />
liabeii. Das psycliologische Problem der Wahrnehmung und der<br />
Aussage wurde von ihnen mit Eifer angeregt; Hippias erteilte Uiitcrricht<br />
iii Geometrie, Astronomie, Arithmetik; Protagoras hat die Grundlage<br />
zur Sprachwissenschaft gelegt; auch vo11 IIippias und Prodikos<br />
gehen spracl~~~risserischaf tliel~c Aiireguiigeiz aus ; bei den spätereiz So-<br />
pliisteii machte sich eine Sch~venliung voll den formell dialelitischeii<br />
Fragen zur Beschäftiguag mit einzelwisseiiscliaftlicheil, besoizders<br />
rnathematischeil uiicl politischeii Probleme11 bemerkbar. Nacli Aristo-<br />
telesZ0) sind die ersteii, die die Idee verliuildeten, die Sklaverei sei eine<br />
iiaturwidrige Einrichtung, die Sophisteil. Das stimmt nicht schlecht zu<br />
ihrer sonstigen Eigeiiart. Als clie ersteii haben sie aus dem Bewuistseiil<br />
cler Soiiveraiietät des Geistes clie menschlicheii Ideale theoretisch iieu<br />
zu gestalten versucht. Iii der Geschichte leiten sie eine neue~ Epoche<br />
ein; am richtigsten setzt man daher, wie mir scheint, eineil Abschiiitt<br />
-<br />
16) Xenophon Mem., IV, 7, 7; vgl. Plato Apol. 14. Als völlig verfehlt mufs<br />
man es, unter Hinblick auf die oben dargelegte Haltung des Sokrates, bezeichnen,<br />
wenn IZock, S. 408, das unterscheidende Merkmal der Sokratischen im Vergleich<br />
zu der sophistischen Weisheit in des Sokrates .noch viel radikalerer Kritik des<br />
Herkömmlichen und Überlieferten" findct. Sonst gehört der Abschnitt 8. 402ff<br />
in Röcks Werk m. E. zu dem Besten, was R. darin geschrieben hat.<br />
17) Mem. I, 1, 13.<br />
18) Rlem. IV, 7, 6. Hier nimmt mir allerdings Sokrates etwas schr xeno-<br />
phontische Allüren an. Sicher zu entscheiden, ob Sokrates wirklich so gesprochen<br />
hat oder nicht, scheint nicht moglich.<br />
19) Aristoteles Metaph., I, 6, 987b, 1. ,,Sokrates stellte uber das Sittliche<br />
Forschungen an, uber die ganze Natur aber gar nicht."<br />
20) Pol. I, 3, 1253b, 20; vgl. 1, G, 1255a, 7.
Sokrates - Gegner oder AnhLnger der Sophistik? 13<br />
iii der Geschichte der Philosopliie iiicht bei Solrrates, soizclern bei cleii<br />
S~phisteii.~~)<br />
IV.<br />
Das Resultat der vorsteheiideii Untersuchuiig fasse ich im Anschluls<br />
aii das zuletzt Bemerkte dahin zusainmeii: Die Zeitgcilosseii<br />
des Solirates haben sich. wenn sie ihii deii Sonliisteil zurcchiieteil. nicht<br />
zu sehr geirrt. Diese ursprüngliche Auffassuilg des Solrrates hielt zwar<br />
iiicht laiiae vor. Der Eiildruclr. deii er auf die Iiiterneii seines Lelirlrreises<br />
mlachte, haftete wesentlich an seinem aiitisophistiscliei~ logischeri<br />
Eriist, seiner crzielierischeii Idealität, weniger aii seiner reforniativeri<br />
Kritik. Sein Tod machte aus dem Deiilrer eiiieii Heiligen. Dasjenige,<br />
worin sein Charaliter gegcii den wissenschaftliclieii Leiclitsiiiu, gegen<br />
die weltmaiinischen Aspiratioiieii vieler Sophisten lroiltrastierte, erhielt<br />
dadurch einen verscliärfteil Alrzent. So drang die Schilderuiig Platos<br />
Tori dem Verhältnis zwischen Solrrates uiid deii Sophisten durch, die<br />
Kluft zwischeii ihiieii wurde uiiiiberbrüclibar. Seiiie cthisclic Ungleich- -<br />
artigkeit wurde zu einer prinzipiellen Gegeiisätzlichlieit, wodurch der<br />
Nachruhin des nroiseri Lehrers bcstirnmt wurde. Aber die Wisseiischnft<br />
charakterisiert eine11 Tlieoretilrer nicht vorwiegend nach inoralgeschichtliehen<br />
oder gar biographischen Dateii; sie hiilt Leben uiid Lchrcil, Resultat<br />
und Methode auseinander; sie untersclieiclet Schiclisal uiicl Priiizipieii,<br />
Ausleguiig uild authentisches Beurteiluiigsinaterial, und sie<br />
selbst sucht ohiie Leidenschaft das richtige Urteil. Sie mircl erlreilileii<br />
müsseri, daCs Sokratcs als Philosoph iiur iii dein Milieu der Sophistcii zu<br />
begreifen ist, dais der Charakter seiner Lehre weseiitlicli duicli die<br />
Verwaiidtscliaft niit ihileii bestimmt wurde.22)<br />
21) Vgl. auch im Unterschied zu Zeller Ueberweg-Heinze, I, S. 105ff, wo<br />
eine ähnliche Auffassung die Einteilung bestimmt.<br />
22) Aus der Geschichte ist es nicht schwer, Analogien herbeizuholen. So<br />
konnte z. B. mancher Kirchenvater, und nach ihm seine Verehrer, sich nicht<br />
genug daran tun, die griechische Philosophie herunterznreiisen, wghrencl die<br />
Geschichte kalt urteilen muis, dais das wesentliche von dem, wodnrch sich die<br />
Kirchenväter einen Platz in der Geschichte des Denkens erworben haben, auf<br />
angeeignete griechische Methoden und Ideen zuruckzuführeii ist.
Die stoische Theodizee bei Philo.<br />
Von<br />
Paul Barth, Leipzig.<br />
Inhalt: Die Stoa hat zmei Theorien des Übels : eine ethische (oder pädagogische)<br />
und eine logische. Nach der ersten ist das Übel die Strafe des Lasters.<br />
Das Leiden des Unschuldigen wird dann erklLrt durch ein physikalisch-<br />
mechanisches lind durch ein kosmologisches Argument Wem beide un-<br />
genügend sind, der zieht sich zurück auf den strengen Standpunkt der<br />
Stoa, dais es kein physisches Cbel gibt, nur ein moralisches. Auch so<br />
entsteht die Frage: Warum lieh Gott das Böse zu? Eine ethische Antwort<br />
ist unmöglich, da die Stoa die Unfreiheit des bösen Willens lehrt. Daher die<br />
logische Theorie Chrysipps: Das Bose ist logisch notwendig als Gegensatz<br />
des Guten. - Alle Argumente kehren wieder bei Philo, mit Ausnahme der<br />
Unfreiheit des Willens und der logischen Theodizee. Diese ist ihm überflussig,<br />
da er Flucht aus der Welt verlangt.<br />
ie Stoiker sind iii der Geschichte clcr Philosophie clie ersteil, dic<br />
ciiie ausgeführte Theodizee versucheil, eine Rechtfertiguilg dcr<br />
Gottheit wegeii des Übels in der Welt. Bei P 1 a t o ist ja der<br />
Gute immer glückselig, selbst wenii er äuiserlich unglüclilich ist,<br />
sogar clie sclilimmsten Qualeil erleidet, uild der Böse ist immer unglücli-<br />
lieh, selbst Tvenil er iil äuiserlichem Glüclce und in der Lust schwelgt.<br />
Das pliysisclie Ubel wird also als Übel gar nicht ailerliannt. Aber wie<br />
Boiiilte die Gottheit das Böse uiid damit das Unglück zulasseil? Darauf<br />
hat er iin zehiiteil Buchc dcr „Staates" eiiic in^-thische Antwort. Jcde<br />
Seele hat auf cler grolseil Wiese, da wo sich Himmel uild Erde berühren,<br />
ihr Lebeizslos selbst gewählt. Also ist „Gott unschuldig, die Schuld hat<br />
der, der gewählt hat.1) Ohiic mythische Einldeiduilg sind ihm die Materie,<br />
also auch der menschliche Körper, und, allerdiilgs nur im höchsten Alter,<br />
in einer eiilzigcii Stelle dcr „Gesetze",?) clie schlechte Weltseele die Ur-<br />
2) A. a. 0. Kap. XV, 617E: uiziu BAotcivov,. &&Os Fzvuiz~os. - 2) 8963.
Die stoische Theodizee bei Philo. 15<br />
saclieii der Unvolllconiiiieiiheit, des pl-iysischcii uizcl des sittliclien Ubels,<br />
welche beide im letzten Grunde fur ihn nicht verschieden sind. An die<br />
Xatcrie ist Gott gebunden. Die Elemente, seien sie auch blois inathe-<br />
matische, nicht reale Körper, findet er vor, uiid die böse Weltseele ist<br />
ebenfalls eiiie voii Gott unablikiigige Nacht. Soweit aber Gottes Xacht<br />
reicht, ist er gut, uild „das Gute ist clie Ursache des Guten, an clen Übeln<br />
aber uiischuldig"." FFi A r i s t o t e 1 e s liegt die Ursache aller U11-<br />
vollkoinmeiilieit der Naturgebilcle in der Materie,4) die nicht immer voii<br />
der Foriii genügeiid beherrscht wird, die Schuld am sittlichen Übel aber<br />
in1 freien Willen des Mens~hen.~)<br />
Für die Stoa ist die Tlieodizce schwieriger als für Plato, der den<br />
Diialismiis von Idee niid Materie, schwieriger auch als fiir Aristoteles,<br />
der auiser dem Dualismus von Stoff und Form noch die Zweiheit Gott<br />
und Welt uiid die Freiheit des meiischlicheii Willens zur Verfiiguiig<br />
hatte.<br />
Die alte S t o a, um die es sicli hier zuiiachst fui uns handelt, ist<br />
diirchaus iiioiiistiscl~, Gott und Welt sind identisch. Die Materie hat<br />
zugleich das schaffende, formeiide Priiieip in sich, das schöpferische<br />
Urfeuer ist zugleicli Gott, Natur und Gesetz der Natur, die Weltvernunft<br />
uiid das Schicksal. Wie also aus dieser Einheit den peinlichen Gegen-<br />
satz der Tugend und des Ilastcrs, des Girtes und des Ubels herleiteri?<br />
Es sind z T.V e i 31 e t h o d e ii, die die alte Stoa dazu gewählt hat. Der<br />
erste der beiden Wege ist durchaus der des anthropomorphen Deiikens.<br />
Z e ii o betraclitete die Gottheit oder das Schicksal zugleich als eine be-<br />
~vuiite Vorsehung.6) Und wenn iiicht er, claiiii jrcleiifalls C 11 r y s i p p<br />
bestimmte diese Vorsehung näher, wie einst Sokrates, als auf das Wolil<br />
der Xeiischeii gerichtet. Die Menscheri siiicl, so lehrte er, für einaiider<br />
iiilcl uni der Götter willen geschaffen worden, wie es in anderen Berichten<br />
lieiist, zur Betrachtung und Nachahmung des ITTeltall~;~) die Pflanzen<br />
der Tiere wegen, die Tiere abcr der Nenschen wegen. Uiid er gab sich<br />
iiun so viel Alühe, iil allen möglichen Tieren eiiie Absicht clcr Natur zii<br />
entcleclieii, daCs er sehr enge, durch die notwendige Aiipassung hervorgerufene<br />
Zwecke clcs Xenscheii als Plane der Gottheit deutete. So<br />
sind die Pferde bestimmt, uns im Kriege, die I-Iuiide bei der Jagd zu<br />
helfen. Wo die Beziehung zum Uenschciz nicht so offen liegt, wird sic<br />
selir Iiiiiistlich ersoiiilen. So ist cler Pfau uin seines Schwanzes willeri<br />
geschaffen worden, dainit wir uns seiner Schönheit freuen, die Wanze,<br />
damit sie uns aus dein Schlafe ~veclcr, die Xaus, damit sie uns gewbhiie,<br />
nichts liegen zu la~seii.~)<br />
Aus clieser Lehre von der Vorsehung eiltspringt der Glaube der Stoa<br />
3) Staat 11, K. 18 (379 B).<br />
4) Vgl. E. Zeller, Pie Philosophie der Griechen, I1,2, 3, Leipzig 1879, S. 338 f.<br />
5) Vgl. Zeller, a. a. 0. 5. 588ff.<br />
6) Val. A. C. Pearson, The fragments of Zeno and Cleanthes. S. 93f.<br />
~ondoi 1891.<br />
7) Vgl. J. ab Arnim, Stoicorum veterum Fragments, 11, p. 332ff. Lipsiae 1903.<br />
8) Arnim, a. a. 0. S. 332, Frg. 1152 und S. 334, Frg. 1163.
1 6<br />
Die stoische Theodizee bei Philo.<br />
an die Vorzeicheii. Denn die Götter sorgen nicht blois für die Mensclien,<br />
sie offenbaren ihnen auch die Zukunft. „Wciin es Giitter gibt und sie clas<br />
Zul~ünftiae den BIensclzen nicht vorher kui~dturi. so haben sie entweder<br />
U<br />
keine Liebe zu den Menschen, oder sie wissen nicht, was geschclieii wircl,<br />
oder sie glauben, es liegc den Menscheii nichts am Wissen der Zukunft,<br />
oclcr sie erachten es als unter ihrer Würde, deii Menschen Zeichen des<br />
Zukünftigen zu geben, oder selbst die Götter liönlieii solche Zeichen nicht<br />
g~ben."~) Da alles dieses uninöglicli ist, so folgt für Clirysipp, dais sie<br />
Zeichen gebeii. „Und wenn sie Zeichen gebeii, so niüsscii sie uns auch<br />
eiiieri Weg zur Wissenschaft dieser Zeichen eröffnen", folgert Clirysipp<br />
(a. a. 0.) weiter. Der allgemeine Glaube an Vorzeichen findet sich schon<br />
bei Zeilo.lo) Aber erst Clirysipp und P o s i d o n i u s - der Aiiteil des<br />
einen ist iiach unserer ~berlieferuiig nicht genau von dem des aiiderii<br />
zu trennen - habcil wolil die Möglichkeit der Wissenchaft der Vorzeicheiii<br />
theoretisch begründet. Sie unterscheiden zwei Arten cler Vorahnuiig,<br />
rine naturliclie und eine lcunstliche. Die ilaturliche bcstaiid iiacli Clirysipp<br />
in den Traumen, nach Posidoiiius in deil Traume11 und iil der<br />
sogeilannten Ekstase, einem Zustande des Hellselieiis, in dem der Geist,<br />
vom Körper getrennt, seinem göttlichen Uispruilge sich mehr iihliert,<br />
darum göttliche Fahigkeiten erlangt, der Schranken der Sinne leclig wird<br />
und die Zukunft sehaut.l1) Die lrunstliche Vorahnuiig stutzt sich auf<br />
die Erfahrung, dsis voll Xnfaiig an des Bcstehciis der Welt nach göttlicher<br />
Anordnung „gewisseil Dinge11 gewisse Zeiciieii vorauseilen, bald<br />
iii deii Eingeweiden (der Opfertiere), bald iin Fluge der Vögel, balcl in<br />
Blitzen, bald iii \\Tuilcteriz, balcl ii~ den Sterileil, bald in Traumgesicl-iteii,<br />
bald in den Ausrufcii der TVahnsii~lligeil".~~) Lange Beobachtung liat<br />
zu einer „unglaublich groiseil TVisseiischaftU solclier Zusammeilhaiige<br />
geführt.13) Die ;lIciglicl&eit derselbe11 beruht auf der organischen Satur<br />
des TVeltalls, in clem, wie in cinein lebenden Körper, Sympatliie aller<br />
Teile herrsche, so dais z. B. „clie Austern urid alle Dlusclieln mit clei~i<br />
Nondc zugleicli wachsen uncl abizeli1ileiz".1~)<br />
In der mittleren Stoa waren nicht alle Mitglieder der Scliule vorzeichenglaubig,<br />
in der rbmisclien Stoa aber ist dieser Glaube ein fester<br />
Bestandteil des Systems.15)<br />
Dieser Vorseliuiigsglaube, der nicl-it blois eine plaiivolle Scliöl~fung<br />
tler JLTclt, sondern durcl~ die Theorie der Vorzeichen auch eine bcstaiicligc<br />
Einwirkung des einen Gottes und der ihm uiitergeorcliieten anderen<br />
Götter qnilininlt, wies zuiilachst gebieterisch darauf hin, das ~bel aleinen<br />
Bestandteil der göttliclicn Fürsorge zu betrachtcii. Und so ent-<br />
9) So Chrysipp beiCicero, de diviriatione I, 38,82 = Frg. 1192 bei Arnim, n. n. 0.<br />
10) Vgl. Pearson, p. 29.<br />
11) TTgl. A. Schmekel, Die Philosophie der mittleren Stoa, S. 246ff. Berlin 1892.<br />
12) Frg. 1210 bei Arnim a. a. 0. Die Tr5ume werden hier, jedenfalls nach<br />
einem Stoiker, der 5lilter ist als Chrysippus, von deii kunstlichen Vorzeichen<br />
nicht getrennt.<br />
13) Frg. 1208 a. a. 0.<br />
14) Frg. 1211 a. it. 0.<br />
15) Vgl. P.Bartli, Die Stoa, S.56ff. Stuttgart 1903.
Die stoische Theodizee bei Philo. 17<br />
staiid die e r s t C dcr Theorien, mit deneil man das Übel rechtfertige11<br />
wollte, die man wohl die ethische oder die pädagogische nennen kann.<br />
Wenn die Gottheit für das Wohl des Mcnscheii sorgt, so niuCs sie<br />
als letztes Ziel seine sittliche Volllcommeilheit in1 Augc habeii. Denn<br />
die Tugend ist ja das einzige Gut oder jedenfalls das höchste Gut. Was<br />
uns also zwecklos oder sogar dem Menschengeschlechte schadlich erscheint,<br />
das muis irgcndwie der Erziehung desselben zur Tugend dieiieii.<br />
So sind nach Chrysipp die wilden uiid ubermichtigen Ticrc, die dem<br />
Menschen so gefährlich sind, Panther, Baren uiid Löwen, „Tibungsmittel<br />
seiner Tapferkeit",lc) anderes, was ein noch eiitschiedencres Ubel ist<br />
als wilde Tiere, dient zur Bestrafung der Bösen, zur Abschreckung der<br />
übrigen. „Wie die Komödien", sagt Chrysipp, Jacherliche Verse enthalten,<br />
die an sich schlecht sind, der ganzen Dichtung aber einen gcwissen<br />
Reiz zusetzen, so mag man auch die Schlechtiglrcit an sich tadelii,<br />
für die aildern ist sie iiicht ~iinütz.(l'~) So dient nach ihm wohl sogar<br />
das moralische Übel denen, die gut bleiben wollcii, indem CS sie ab-<br />
schreckt. Recht eigentlich aber ist das pliysische ubel das Werkzeug<br />
der Gottheit zur Bestrafung der Bösen. IIusiger und Pest haben die<br />
Götter den Menschen gesandt, „damit an dcr Bestrafung der Schlechteil<br />
die anderii sich ein Beispiel nehmen und weniger versuchen, etwas<br />
Schlechtes zu Und nicht blofs, was die Gottheit an einzelnen<br />
Uiiglücksfillen und Landplagen sendet, sondern auch die ganze Einrich-<br />
tung der lcosmischen Perioden, die Wiederkehr aller Dinge,<br />
y~zleaia rWv ÖA(UV dient demselben sittlichen Zwecke. „Die Vor-<br />
sehung erhält entweder das Leben auf der Erde oder reinigt sie durch<br />
Überschwemnlungen und Verbrennungen. Und vielleicht niclit nur die<br />
Erde, sondern auch die ganze Welt, die eines Reinigungsmittels bedarf,<br />
wenn die Schlechtigkeit in ihr grois geworden ist."lg) Die Feuerwerdung<br />
der ganzen Welt, die Zeno lehrte, mit der eine Weltprriode schliefst<br />
und eine neue begisliit, war bei ilim und wohl auch bei Kleanthes ohne<br />
ethische Bedeutuiig, da die neue Periode alles in der verflossenen Gc-<br />
schehene genau wiederholte. In der nächsten Weltperiode, sagte Zeno,<br />
„wird Anytos mit Neletos wieder anklagen, Busiris wieder die Reisenden<br />
töten, Herakles wieder seine Arbeitcn ve~rrichteii".~~) Aber bei<br />
Chrysipp ist der ethische Fortschritt, der die Feuerwerdungeii und Erneuerungen<br />
der Welt begleitct, offenbar. Auch ist dieser Gedanke nicht<br />
ausgestorben, sondern er lebt in der römischen Stoa wieder auf. Seneca<br />
sagt deutlich, dais die Feuerwerduiig dann eintrete, „wenn Gott beschlossen<br />
hat, eine bessere Welt zu beginiien, die alte zu beeildei~~'.~~)<br />
16) Frr. 1152 und 1173 a. a. 0. Der obige " Gedanke kehrt wieder bei Eaiktet.<br />
Dissek. I, 8, 23 bis 36.<br />
17) Frg. 1181 a. a. 0. - 18) Frg. 1175 a. a. 0. - 19) Frg. 1174 a.a. 0.<br />
20) ~ri.<br />
55 des Zeno bei PearsÖn (S. lO6f). ~tobaeus scheint diese Ansicht<br />
von der Gleichheit der Weltperioden auch dem Kleanthes und dem Chrysipp<br />
zuzuschreiben (Frg. 64 bei Pearson), aber das klare Zeugnis des Origenes (in<br />
dem soeben angeführten Frg. 1174 bei Arnim) beweist, dais Stobaeus im Irrtum ist.<br />
21) Nat. Quaest. 111, K. 28.<br />
Philosoph. <strong>Abhandlungen</strong>. 2
18<br />
Die stoische Theodizee bei Philo.<br />
Aber freilich diese etlzische oder - im Sinne clcr Erziehuiig clrr<br />
l\ienschheit - pidagogisclze Auffassuilg cles Übels er~~~cclit eiizc scliwicrige<br />
Frage, auf die cleizilocli eine Ailtwort dringend not~~-eizclig ist :<br />
Warum trifft das Ubel oft den Uizschuldigcii ? Warunz schoizeiz di o<br />
groisen Plagen der Xeiiscliheit den Guteiz elocizsoweilig wie clen Bösen?<br />
Dieso Frage vermochte die Stoa zunachst izicht anders zu beantworten<br />
als durch ein physilialiscli-mechaiiisclzcs Argunieizt, das sie den1<br />
Aristoteles entlehnt hat. Dieser hatte, ohne aii eine Theodizee zu<br />
denken, an einen sclion von Plato aufgestellteil Gegeizsatz aiiliiiüpfeild,<br />
die inechailische Geset~nzaisiglieit der Naterie, wie wir cageil wurden,<br />
als Notwendigkeit, dvdyxy, voii der - modern atwgedrüclit - orgailisehen,<br />
teleologischen Gesetzmäisigkeit der Foriii getrennt, uizcl nur diecc<br />
als Gottes TVirlien anerkanizt, izicht die erste; ja, er laist sogar Gott<br />
durclz diese erste beschräiilit werden. Er sagt wörtlicl~:'~) „Ze~is regnet,<br />
nicht damit er das Getreicle wachsen lasse, sonclcriz nach (inechaiiischer)<br />
Notwendigkeit; deiliz, was emporgestiegeiz ist, muis sich abkühleil und<br />
das Abgeliulilte muis zu Wasser werden und lierabkomineii. Dais aber<br />
claclurch das Getreide ~vachst, ist eiiz I-Iiilzuliommendes (ciize Nebenwirkung,<br />
ein Nebenerfolg, 6vppaMarv~i). " Aristoteles achtete nicht<br />
darauf, dais diese Notwendigkeit seines Gottes Iiaclzt eiizschränkt. Dic<br />
Stoiker hatten viel eiztschiedener als Aristoteles, bei dem man sie nur<br />
aus der Abwesenheit jedes Leideizs folgern lianiz, die Allniacht des h6clisten<br />
Gottes beha~ptet.'~) Aber schon Kleanthes meinte, dais alles nach<br />
dem Scliicksal, also den Naturgesetzeil, nur ein Teil der Ei.eignisse aber<br />
izacli der Vorsehuilg geschehe.24) Chrysipp wies hiil auf die „I-Iindcrnissc<br />
und EIemnliiisse der Wellrcgierung"."") Er erklärte direkt, dais<br />
„Gott nicht alles wissen liöniie, weil er nicht verinag . . . .".-Y Dieser iil<br />
der Überlieferung verstüimlelte Satz List selbst in seiner Unvollständigkeit<br />
erkennen, clais der ihn überliefernde Epikureer Philodeinus recht<br />
hat, weiziz er cleiz Stoikern vorhalt, dais sie zuerst die Allmaclit Gottes<br />
behaupteii, aber „von den Gegenbeweisen bedraiigt, illre Zuflucl~t nehrneii<br />
zu cler These, Gott schaflc nicht die Nebeilwirliungen (svl~az~6~rcivy. =<br />
den oz~u$e$pxorn des Aristoteles), weil er izicht alles liönile", und we1111<br />
er darin eine Schwiche uizd einen Mailgeln) findet, cleiz sie dem Blächtigsten<br />
zuschreiben. Derselbe Chrysipp erklsirt: „Viel ist auch (neben<br />
der göttlichen Vorschuiig) von cler (bliizden) Kotwendigkeit (den Ereignissen)<br />
beigcrni~clzt",~~) woraus Plutarcl~,~~) der deil Satz iiberliefert,<br />
ebenso treffeizd wie Plzilodemus folgert: „Fürwahr wenn den Diilgeii<br />
viel von der (blinden) Notwendigkeit I~eigciniscl-it ist, so hat Gott niclzt<br />
Macht über alles, uiid izicht alles wird nach Gottes Vernunft geleitet..'<br />
P-<br />
22) Vgl. Zeller, 11, 2, 3, S 333f. Physilr, 11, 8 (198B, 18).<br />
23) Vgl. Arnim, Frg. 1107 = Cicero de natura deorum, 111, 92: „TOS (Stoici)<br />
enim ipsi dicere soletis nihil esse, quod deus efficere non posset." Vgl. auch den<br />
Hymnus des ICleanthes, Vers 7 lind 8 bei Pearson, S. 274 und P. Rarth, a a. 0. S. 57.<br />
24) Pearson, S. 248f. - 25) Pearson, S. 249. - 26) Frg. 1183 bei Arnim.<br />
27) A. a. 0. - 28) Frg. 1178 bei Arnim.<br />
29) De Stoicornm repugnantiis, IC. 37 (1051D).
Die stoische Theodizee bei Philo. 19<br />
Dais aber Chrysipps SLtze ailerlranilt wurde11 und wirkten, beweist<br />
die römische Stoa. Seneca zieht aus ihnen selir bestiinnlte Folgeruilgei~.<br />
„Sicht wir", sagt er, „sind der Welt die Ursache der Wiederkehr des<br />
Sonmeis uiid des Winters. Jeiles (diese Wiederkehr und die vorher ge-<br />
iiaiznteil fciildlichen Gewalteii der Natur: das Toben des Xeercs, die<br />
Platzregeil, der strenge uncl lange Winter) h a t s e i 1 e e i g e n e 11<br />
G e s e t z e , durch die göttliche Absichten (nicht unsere) ausgeführt<br />
117erdeil."30) Wenn hier die letzteil T'CTorte Gottes Beschrankung auf-<br />
zuheben seheineii, so ist dies nicht cler Fall bei einem Satze, der bald<br />
folgt : 31) „Nicht ilach jener (der Götter), sondern nach cler Sterblicll-<br />
keit Gesetze erleideil wir jeden Schaden, der uns trifft." Und an anderer<br />
Stelle: „Nicht clurch den Zorii der Götter wird der Himmel oder die<br />
Erde erscliüttert. D i e s 11 a t s e i ii c e i g e n e n U r s a c 1 e 11."~~)<br />
Densclbesl Siilii hat es wolil, wenn es bei ihm heilst :") „Sie (die Sterile)<br />
izützeii dir auch wider deinen TVilleil und sie gehen deinetwegen, obgleich<br />
gr0iser clie andere, frühere Ursache ist, clie sie bewegt." Damit ist ein-<br />
gestaildeil, daCs es Gesetze gibt, die von Gott (oder von den Göttern)<br />
unabhiangig sii~cl, seiil~ (oder ilirr) Xaeht also beschritillren. Diese Bescliriiiil
20<br />
Die stoische Theodizee bei Philo.<br />
Erneuerungeil eiiicm immer vollkominenereii Zustande zustrebte. Zudem<br />
gab es gewiis viele Gegner, wie Philodenzus und Plutarch, die tler<br />
Stoa die Schranken ihres Gottes vorliielten. So ist es verständlich. claSs<br />
die Schule sich bemühte, aufser dem physikalisch-mechanischeil Argunlente<br />
noch ein anderes zu finden. durch das mall das Lcideii des LTnschuldigeiz<br />
reclitfertigeii könnte.<br />
Man fand es in einer These, die inan aus der I
I>ie stoische Theodizee bei Philo. 21<br />
Aber trotz beidcn Argunlenten, dem physilralisrh-inechariischen und<br />
clein kosmologischen, bleibt dic I-Iärte der Tatsachen bestehen. Die oben<br />
erwiähnten Beispiele des Solirates und anderer, die Plutarch anführte,<br />
liefsen sich durch die „Okonomie des Ganzen" erklären, aber iiicht<br />
ii~ilderii. So mulste dem rechten Stoiker die Besinnung kommen,<br />
clais die ganze Theoclizee dcs physische~l Cbels eigentlich ganz über-<br />
flüssig sei, da ja nach der strengen ursprünglichen Lehre der Schule nur<br />
e i 11 Übel existiert, das Lastcr, wie iiur e i ii Gut, die Tugend, alles von<br />
auisen Kommende aber, alles, was iiicht in unserer Gewalt steht, selbst<br />
Kranlrheit und Tod, gleichgültig ist. Erst später hatte Zeno diese Lehrc<br />
abgeschwächt und den äuiseren Dingen einen gewissen Wert oder Miis-<br />
wert zugeschrieben.*" )Jener höhere Stanclpunlit aber ist nie gänzlich<br />
verlassen worden. Selbst bei Seneca, der der populkrcn Werttheoric<br />
sehr viele Koilzessioiieil maclit, finclet sich eine Schrift, de providentia,<br />
die durchaus daran festhalt, dais alles Leid uni1 Unglück dem Weiseii<br />
nur zum Besten, zur Stärliuiig seiner Tugencl dient, also kein iibel ist.<br />
Von diesem ursprünglichen Standpunkte aus war die ganze Thco-<br />
tlizec viel einfacher. Sie lieis sich auf die einzige Frage zurückführen:<br />
M7arum Iiat Gott das sittliche Übel, das Lastcr, zugelasseii? Warum hat<br />
er diese Urivolllrommeiiheit clcr Welt geduldet? Alle bisherigen Argu-<br />
mente, das der Abschreckung, clas physilialisch-mechanische, das liosmo-<br />
logische, geben darauf keine Antwort, sie lrörinteii nur die Unvolllioin-<br />
nlenheit voii ncuem konstaticreil. Nur c i 11 c Antwort gibe es, die aber<br />
bei den Stoiker11 ausgeschloiscn ist, den freien Willen des Meilschen,<br />
der als selbstiindige Grsache (ler I'rheber des Bösen sei, so dais Gott<br />
clafiir nicht verantwortlich gcniacht \verden könne.<br />
Aber der menschliche Wille ist nach der Stoa iiicht frei in1 iiieta-<br />
physisclien Sinne, im Sinne tler 1:rsaclilosiglicit. Er liaiiri iiur, wie bei<br />
Spinoza und bei Leibniz, frei werdcii von cleii Affekten, uiid zwar durch<br />
dic Erkenntnis. Diesc ist dani~ (lie Ursache seiner Ilandluiigai. Uncl<br />
qeracle der Böse, der iiach aiicleren Voraussetzungen eine selbstäiidige<br />
Ursache sein liönilto, ist nach der Stoa in1 höchste11 &Iaisc unfrei. Wie<br />
bei Plato „niemand freiwillig böse ist" (oc;d~i~ ¿xwi! UB~xoc), sondern nur<br />
ilurcli dcii Irrtum, so wird a-ucEi nach der stoischen Lehre jeder nur durch<br />
clie Cnwissenheit zuin Laster geführt. Diese Überzeugung liegt auch<br />
tler Tendenz zugrunde, die in der alten und in cler inittleren Stoa schr<br />
ciitwiclrelt ist, den Ciiweisen für iiicht seines Verstandes mächtig, für<br />
.vvahiisiniiig zu erlilliren.44) So fillt die IJrsache gerade des bösen Tun5<br />
auf clie Verkettung tler iiatiirliclieii Dinge zurück, also auf Gott oder<br />
clas Schicksal, die ja identiscli sind, die uns iiberall und immer fiihreii,<br />
wie clas beliannte stoischn Gebet SO scheitert die ethisclic<br />
43) Vgl. P. Barth, a. a. 0. S. 147ff.<br />
44) Vgl. Zeno, Frg. 227 bei Brnim, a. a. 0. Vol. I. Auch Epiktet, Diss. I, 28,<br />
4 bis 11.<br />
45) A. Dyroff (Archiv für Geschichte der Philosophie, Bd. XVlI, S. 154) sagt,<br />
.dafs die Unterscheidung von »erschöpfender Ursache«, »Mitursache« und »bei-<br />
helfender Ursaclie« von Chrysippos zur Lösung der gerade für die Stoa schwierige11
22<br />
Die stoische Theodizee bei Philo.<br />
Tlicori~ der Theodizee auch auf dein liöchstcii sittlichen Standpiiiilitc<br />
am Determinismus.<br />
Es ist also kein Wuiider, ~veiiii wir iicbcn diclser ethischen eine ganz<br />
verschiedenartige, eine 1 o g i s c h e Theorie entstehen sehcii, diireli dic<br />
inan in der Stoa die Existenz des Übels, des physisclzeii wie des inoralischen,<br />
zu erklären suchte.<br />
Bei Heraklit, ~oii dein clie Stoa so vieles entlehnt hat, XTnr der<br />
Gegensatz eiii allbeherrschendes Prinzip. „Der Kampf ist der Vater<br />
aller Dinge." „Das Entgegenstrebende stiitzt sicli." Und aus clein<br />
Gegensatze ging für Heralilit die 'Iarnzoiiie hervor. Der Gegeiisatz<br />
ist aber auch in der Logili sehr bedeutsam. Und so mnfste dein Logilicr<br />
der stoischen Schule, dem Chrysipp die l!föglichlieit lilar ~vcrilen, clcii<br />
logischen Gegensatz im Sinne EIeralrlits zu einein inetaphysisclieii Frinzil~<br />
zu erhöhen und damit die Schattenseiten clcr Welt als notmeiidig zu erklaren.<br />
Wir fiiidcii di.eseii Gedaiilieii bei ihm selir deutlich ausgeprägt.<br />
„Nichts ist törichter als diejenigen, die glaubeil, dais es htitte Giiter<br />
geben liönneiz, wenn iiicht an derselben Stelle Übel wiiren. Denn cla die<br />
Güter den Übeln entgegengesetzt sind, so müssen beide not~~ericligcrweise,<br />
eiiiaiider eiitgegeiistrebcnd urid sich so gegeiiseitig stützeild, zusammeiistelieii.<br />
So selir ist lrciii Eritgegeiigcsctztes ohne das ~lizdere."~~)<br />
„Es ciitsteht auch das Laster genrisserniaisen iiach der Ordiiuilg clcr<br />
Natur LIII~, sozusagen, iiicht oliiie Kutzeil fiir clas Gaiize. Denn es gabe<br />
(ohne das Laster) auch liein Gutes."")<br />
An einer Stelle hat Clirysipl~ den logischen mit dein inecliaiiisclieil,<br />
oben gelrennzeichneteri Lusanzinciihaiige zusainnzeiigeworfeii, mas ihni,<br />
da beidc Zusaniinenhtinge ilim glcicli zwingend erscheinen, iialze lag. Er<br />
erliebt cliv Fraa~,~s) ob die Iirankheiteii des Meizsclien von der Natur<br />
lind der niit der Natur ideiitischeii Vorsehung verursacht \~orclciz siild,<br />
und antwortet, dais sie nicht iii cler Raiiptabsielit (priiicipale coiisiliunz)<br />
der Natnr gelegen haben - clciiii clna ~~ridersprrclze der Satnr als cler<br />
Frage nach der Entstehung des ii'bels in der Welt vermertet und auch iii diesen1<br />
Zusammenhange ersonnen warde." Iliese \-ermutung hat sehr viel für sich,<br />
doch habe ich einen Beleg in den Fragmenten nicht gefnnden.<br />
46) Frg. 1169, bei Ariiim Vol. 11. Chrysipp fährt fort: ,,Denn wie könnte<br />
es einen Eegriff der Gerechtigkeit geben, wenn es nicht Unrecht giibe? Oder<br />
was ist die Gerechtigkeit andres als cler Mangel an Ungerechtigkeit? Wie liiiiintc<br />
man unter Tapferkeit etwas denlien aniser Vergleich der Feigheit? Was unter<br />
MLisigung, wenn nicht mit IIilfe der Unmiiisiglceit? Wie gLbe es eine I
Die stoische Theodizee bei Philo. 83<br />
Scliöpferiil und Erzeugeriii alles Guten -. „Aber", so zitiert Gellius ihn<br />
~vörtlicli, „da sie (die Natur) vieles Groise erschuf und erzeugte, was<br />
sehr passend und sehr iiützlich ist, so eiltstaiid zugleich anderes niit<br />
diesen1 Zusaiiiineiihängeiides, was nachteilig (für den Nenschen) ,ist, und<br />
zwar ist dies durch die Natur geschehen, aber nur durch gewisse not-<br />
wendige Folgen, was cr selbst »nach logischer Koilsequeiiz«") nennt."<br />
Hier bleibt Chrysipp noch beim bloiseii logischen Zusammeiiliailgc.<br />
Aber bei dey näheren Ausführung geht er iii den meclianiscli-physilia-<br />
lischeii Zusamineiihang über: „Z. B. als die Katur die Körper der Meii-<br />
sehen bildete, forderte es die Feiiilieit der Vernunft (des Piieumas der<br />
Seele) und der Vorteil des Werkes selbst, dass sie den Kopf aus sehr<br />
zarten und kleinen lCiiochen zusammenfügte. Aber aus diesem groiseii<br />
Vorteil folgte ein gewisser äuSserer Nachteil, dass nämlich der Kopf<br />
schwach verwahrt und durch schwache Schläge und Aiistöise zerbrech-<br />
lich wurcle." So glaubte Chrysipp, die dunkle Seite des Lebens als<br />
logisch ilot~veildige Ergäiizung der Lichtseite bewiesen zu haben. Und<br />
auch die logische Methode fand Anklang iri der Schule. Bei Seiieca<br />
zwar wird inan wohl jene Methode vergeblich suchen, ihm war wohl die<br />
ethische trotz alledeill genügend. Aber bei Epiktet finden wir sie zu-<br />
grunde liegeilcl iii folgenden Worten : „Er (Zeus) ordnete Sommer und<br />
Winter, Fruchtbarkeit uncl Unfruchtbarkeit, Tugend uiid Laster und<br />
alle solche Gegensätze zur I-larmonie des Ganzen.""g3<br />
Freilich als logisch iiotwendig hatte Chrysipp den Gegensatz cles<br />
Guten und des Bösen und des Gutes uiid des Übels nicht begründet. Es<br />
schien ihm nur so. Deiiii iiicht jeder Gegensatz ist ein logischer. Dieses<br />
PrSidiliat kommt ja nur cleni reinen kontradiktorisclieii Gegensatze zu,<br />
liraft dessen es zu jedem A ein Non-A geben muis. Dieses Non-A ist<br />
die uiieildliche Menge der aiidern Dinge und Begriffe. So gibt es liach<br />
logischer Notwelldiglieit auch zu „Gut" ein „Nicht-Gut". Aber es ist da-<br />
mit nicht ausgemacht, dass unter den uiieildlich vielen Begriffen, die<br />
iiicht „Gut" siiid (z.B. dreieckig, rot,Holz,Rose usw.) auch ein liontrirer<br />
Gegensatz zu Gut, ilainlich Böse, existiere. Dies zu wissen, bedarf es<br />
einer besonderen Erfahrung, die iiur E e g e 1 s Paillogisinus für unnötig<br />
ci.lilärte. Nicht zu jedem Begriffe gibt es eiiieii koiltraren Gegensatz<br />
oder eine Reilie von solchen, sondern nur da, TVO die Erfahrung uns<br />
durch unsere Empfiilduilg eine solche Reihe aufweist. A priori kann man<br />
nicht wissen, dals es iiicht blois e i ii e Farbe, Rot, gibt, sonder11 cine<br />
ganze Rcihe Abstufuilgeii des „Rotu und eine Reihe anderer Farben,<br />
die, ebeiifalls von Rot ailfangeiid, eine abgestufte stetige Reihe bilden.<br />
Denkbar wäre es ja, dass es nur ein einziges Rot gäbe, dass also die<br />
verschiedeneil Sättiguiigsgracle dcs Rot fehlten, und dafs es liebeil diesem<br />
eiiieii Rot lreiiie andvre Farbe gäbe. Dann hätte Rot keineil konträren<br />
Gegensatz, sonderii nur den lioiitradilitoriscliei1, den jeder Begriff hat.<br />
111 der Tat gibt es ja Begriffe, die des koiiträreii Gegensatzes entbehren,<br />
49) ,,xuz& rru~axo/2o?j8~u~w",<br />
7-on Gellius griechisch angeführt.<br />
49a) Diss. I, 12, 16.
24<br />
Die stoische Theodizee bei Philo.<br />
wie die Quantitätsbegriffe, von cleiien schon Aristotelesio) sagt: „Von<br />
ileii bestimmten Quantitäten ,ist keine einer anderen entgegengesetzt."<br />
Es lianii nicht eine Zahl mehr oder weniger fünf sein, sondern nur fürif<br />
oder nicht-fünf, es gibt in den Zahleil keine Grade voll Qualitäten,<br />
darum keine Reihen solcher und keine konträren Gegensätze. Dasselbe<br />
gilt von den geometrischen Begriffen.<br />
Wie die logische Notwendigkeit, so fehlt cler Zweiheit Gilt uncl<br />
Böse auch die Notwendigkeit der I
Die stoische Theodizee bei Philo. 25<br />
26<br />
Die stoische Theodizee bei Philo.<br />
Gottes, als TVeltschöpfer iiiid Welterhalter - beide Fuiiktioiieii merclrii<br />
ihin inziner zugeschrieben - ist der Logos iiur iiiöglich bei der Auiser-<br />
~veltlichkeit Gottes. Trotzdem aber wird Gott auch mit dciii All ideii-<br />
tifiziert. Es wird voii iliin gesagt, dais er allcs „erfüllt ~1iic1 uiiifaist,<br />
selbst aber voii nichts anderem umfasst ~ilird, cla er ein eiiizigcr und<br />
selbst das All ist."Jg)<br />
Daruni ist anzuiiehmen, dass Philo iii seiiier Tlieodizee cleii Vorteil,<br />
deii ihm clie Traiiszeiideiiz Gottes gewihrt, sich wenig zunutze macheil<br />
wird. In der Tat folgt er ganz uiid gar dcni crsteii der beideii voii der Stoa<br />
beschrittene11 Wege, der ethisclieii Tlieorie. Er sieht, wie sie, iin pliysi-<br />
schell Ubel eiii Erziehuiigsmittel der Meilschlieit. Gott (odcr der 'ogos)<br />
hat zwei Gruiidlrrifte, die schöpferisclie uiid die königliche, voii deiieii<br />
die erste, weil er die Welt aus Güte, oliiie Neid gebildet hat, oft ~nit<br />
seiiier Güte, die andere mit seiner Macht gleicliges~tzt wird. Zur Iciiiiigliehen<br />
Kraft gehört die gesctzgebencle iiiid die trafe ende.^^) Uiid dieser<br />
strafeilden Kraft dient das physische Ubel. Die Strafgewalt ist sogar zu<br />
deii mohltitigeii Krafteii Gottes zn recliiieii, zu deiiei~ Pliilo soiist iiur<br />
scirie schöpferischen Krifte zahlt, da die Strafe zum Gesetze gplii)rt,<br />
uiid die aiidcreii, die noch iiiclits BOses getaii liabeil, cliirclz ilirc absclireckende<br />
Wirkuiig gebessert wercleii."l) Anderseits freilich, ~vcil<br />
„Gott iiur Gutes vcrursaclit, aber clurchauu keiii iibel", so ziemt es sicli,<br />
(lais die Bestrafung der Böseii riur durch seine Uiitergebcileii niit Kachdruck<br />
geschehe (/IE$~LO~O~WI).<br />
G2) Doch bleibt er der Urlieber dersclbcii,<br />
die zerstöreiide uiicl die woliltitige Kraft Gottes sind miteiiiaiiclcr vcrmaiidt.")<br />
Daruin sendet Gott eiiieiii ITolke ciiieii Tyraiiiicn zur Strafe,<br />
Tveiiii seiiie Sitten sich verschlechtert listbeii. Sobald sie sicli gebcsscrt<br />
liahcii, wird der Tyrailn gestürzt.G4) Xaturlratastropheii, wie „1Iagrl-<br />
59) Legum allegoriae, I, 44, p. 52M. V@. Heinze, a. a. O., 8. 209.<br />
60) Vgl. Heinze, a. a. 0. S. 247.<br />
61) De ~irtutibus et legatioiie ad Gaiiim, 546M.<br />
"2) De coilfusione linguarum, 180, 432M.<br />
63) Quaestiones in Exodiim, 11, 516A. Bei der zerstörenden Gewalt denkt<br />
Philo wohl an das hebrsische Beiwort Gottes: yqiri.<br />
64) De providentia, 11, 71 A. Die i~berset&nng>ie Aucher in der ilnmerkiiiig<br />
gibt, scheint mir richtiger als die im Texte, -wie die unmittelbare Fortsetzuiig<br />
erweist. Dais die ganze Schrift De proridentia, sowohl das erste wie das zweite<br />
Buch, echt ist, hat P. Weiidland meiner Ansicht nach unmiderlcglich bewieseri.<br />
Vgl. dessen Eiich „Philos Schrift iiber die Vor~ehung",?~ Berlin 1892, besonders<br />
S. 86ff. Freilich, wie es uns vorliegt, in armenischer bliersetzang, ist es diirch<br />
eine Qberarbeitung hindurchgegangen, die in1 ersten Buche die dialogische Form<br />
zerstörte, es vielfach kürzte (Wcndland, a. a. 0. S. 38), auch durch zwei Interpolationen,<br />
iii § 22 (Richter) und § 34 (vgl. a. a. 0. 8. 8 und S. llf.), entstellte.<br />
Dais das Buch über die Vorsehung sich so durchaus iinjüdisch, nur helleniscli<br />
und philosophisch gibt, erklgrt TVendlaiicl wohl zutreffend aus seiner Entstehniigseeit,<br />
die in Philos Jugend falle, die sich auch in der %uiserlichen, Exzerpte aneinander<br />
reihenden Art der Abfassung verrate (a. a. 0. S. 2). Wenn A. Aal1<br />
(Geschichte der Logosidee in der griechischen Philosophie, I, S. 184, Lcipzig 1896)<br />
das erste Bucli De proridentia für ganz unecht hLlt, nur im zweit'en Biiche<br />
.,Philonisches vorliegend" finclen will, so kann ich ihm nicht ziistimmeii. Die<br />
Kritilr von Bernays und von Massebieau ist durch Wrndlaiids Unterstichiing<br />
iiberholt.
Die stoische Theodizee bei Philo. 27<br />
schlag, Blitzsclilag, I-Ieuschreclieii, sendet die Vorscliuiig, damit sic cl~~rcli<br />
niaiinigfache Gei Cseluiigeii ihre Kinder zur Tugend f~lire".~~) „Wer also<br />
die Torsehuiig nicht lieiiiit, wird sie aus deii Krankheiten erlieii~ien."~~)<br />
.,Gott bringt IIungersnot, Pest uncl Erdbeben oder andere Plagen, durch<br />
welclie ttäglicli eiiie selir groisc Meiige Nensclieii umkomint und eiii<br />
groiser Teil der Welt veriiichtet wird, clamit er fur die Tugend sorge.""')<br />
Dic nahe bevorstelieiide Weltverbreniiung wird, wic bei Clirysipp in der<br />
Stoa, die Strafe der Laster sein. „Da die merischliche Natur . . . . eiii uiisittliches<br />
Leben aiigeiiommeii hat . . . ., wird selir gerecht sein die ganzliehe<br />
Auflösung der Elemente (in Feuer), die einst eintreten wird."G')<br />
„Die von Gott der Velt gesetzten Wachter (die Eiigel) werdeii sie verlassen,<br />
da sie dein gebührende11 Gerichte vcrfalleii ist. Nicht mehr lebt<br />
iii ihr Reiz und Schöiilieit der Elemente, allcr Schinucli i'st ihr genomineii,<br />
voii trauriger Haislichkeit ist alles eiitstellt, die Materie eilt<br />
sich der Forin zu ciitlileiden. Zugleich mit der Wclt ist der Nensch<br />
uiitergegailgen, der Biirger der Welt, vom Bösen uberwuiiden, die<br />
Tugend verachtend, voii der Vorsehung nichts wissei~d."~~)<br />
Und wiederum ciitstelit hier dieselbeFrage, die schoii dieStoa qualte:<br />
Warum leidet der Gerechte mit dem Uiigcrechten? Sehr eiiifach ist<br />
auch die Antwort, dic der strengen stoischen Guterlehre eiitspriiigt, die<br />
Philo oft, ebenso wie die Stoa, findet: „Da der Gereclitc iiichts hat,<br />
clcsseii cr beraubt werdeii liöniite, so wird ihm kein Schadeii getan.'"O)<br />
Er hat iiur iiiiiere Guter, die ihm niemaiid iiehiiicii lianii. „Wer vor der<br />
Selnisuclit iiach Tugeiid braiiiite (im Kampfe), liiclt es kauin fur ein<br />
Uiigluclr, dais er mit den1 Ungerechteil starb, weil seine Seele ininier<br />
~iiiversclirt bleibt.'lil) Aber dieser Stanclpuiilit wird auch oft verlasseii,<br />
oft mei-cleii clie pliysisclien Ubel als solche bctraclitet, unter deiieii auch<br />
der TITeise leidet. Es werden claruin dieselbe11 Argurrieiite nötig, uin die<br />
Gottheit vom Vorwurf der I'iigcreclitiglieit zu eiltlasten, clie wir iii cler<br />
Stoa gefuiideii liabcn.<br />
Das erste war clas physilralisch-iiiec1iaiiisclie Argument, das iii ver-<br />
scliiedeiieii Weiicluiigeii ~viederlrelirt. „Von diesem (dem Reife und drin<br />
Schnee, deii Blitzeii und dem Doiiizer) gcscliieht vivlleicht iiiclits iiacli<br />
der Vorsehuiig. Vielmehr briiigeii Regen uncl Wiizde den irdischen Ce-<br />
schöpfen Lebeii, Sahrung und Wachstum. Uiid jene siiid iiuii ihre (uii-<br />
vrrmeidliclieii) Folgeii (ocler besser : Nebeiierf olgc) .'"') „Erdbebeil,<br />
Pest, Blitzsclilag und dergleiclieiz solleii voii Gott geschickt sein, siiicl<br />
es aber iii Wahrhcit nicht. Deiin Gott verursacht überhaupt kein irbcl,<br />
soiidcrii die T'eriiildcruiigeii der Eleinente erzeugen jeiies. Es ist iiiclit ein<br />
65) De prov. I, 22A. - 66) A. a. 0. 236. - 67) De pro\.. 11, 71A. -<br />
'38) De prov. I, 41A. - 69) A. a. 0. 42A.<br />
70) De prov. I, 268. Vgl. auch de nobilitate, 437hI iiiid Wendland, a 8.0.<br />
S. 19 bis 21, S. 61 bis 54.<br />
71) De prov. I, 29A. Vgl. auch 31A.<br />
72) Frg. 643M. Die obige Stelle ist aus einem längeren, von Eusebius<br />
?örtlich angeführten Abschnitte der Schrift De providentia, der in der lat<br />
Ubersetzuiig 108A bis 119 A ~viederkehrt.
28<br />
Die stoische Theodizee bei Philo.<br />
beabsichtigt.es Werk cler Natur, soridern ein aus dem Notwendigen folgendes<br />
und aus dem Bea?&ichti,gteii (als Nebenerfolg) sich ergebeiides."7"<br />
,„Von den Reptilieil sind die giftigen nicht nach der Vorsehung,<br />
sondern nach einer (unbeabsichtigten) Nebenwirkung entstanden.<br />
Deiln sie werden erzeugt, wenn die herrschende (kühle) Feuchtigkeit ii~<br />
gröisere Wärme umschlägt. Einiges beseelt auch die Fäulnis, wie die<br />
Würmer, die aus faulender Nahrung entsteheil. Die Läuse aber Irommeii<br />
aus dem Sch~veiise."~*) Mit mehreren Gleich~iis~sen sucht Philo das<br />
Verhältnis der Absicht Gottes zum Nebenerfolge klar zu machen. Z. B. :<br />
Eiii freigebiger Gymiiasiarch spendet statt Wassers Öl zum Benetzen<br />
des Körpers, e,inige Tropfen fallen auf den Boden, der davon schlüpfrig<br />
wird. Wenn nun jemand ausgleitet, wird man da dem Gymiiasiarcheii<br />
clie Schuld gebenS7j)<br />
So finden wir auch hier Gottes Macht beschrankt durch die Materie<br />
und ihre Gesetze. Nach stoischen Quellen, wie Wendlancl nachweist,<br />
liat Pliilo das Walten der Vorsehurig zu erweisen gesucht, insbesondere<br />
für das zweite Buch deii cpcicrtxoc Jo'yoc des Posidonius benützt,i" aber<br />
auch sonst inailchril scharfsiiliiigeir Gedanken der antiken Forschung<br />
verwendet. So erwahnt er clie Schutzfärbung der Tiere iiiid findet in<br />
„cler Unzwaiidlung iii nianiiigfache FarbenL „ein Schutzmittel gegen Ergreifung,<br />
das vielleicht clie rettende Katur ihnen (den des Farbenmechsels<br />
fähigen Tieren) geschenkt hat." Er nennt als Beispiele das<br />
Chamaleoil, die Polypeil und ciil seltenei, im Skythenlancle lebendes<br />
Tier, den aoipnvd'eoc 77)<br />
Uiid demnach muiste Philo clas Gestiiidizis machen: Gott ist nicht<br />
allmächtig. Er „ltanii nur die angeborenen ~ bel unseres Geschlechts er-<br />
leicl~tern".~" Bei Philo uii(l in der Stoa verhält es sich ähnlich wie bei<br />
Leibniz. Bei ihm gibt es eiii Reich cler Natur, das beherrscht ist durch<br />
„die ewigen Wahrhciten" (bei Philo uilcl in der Stoa durch die Gesetzcx<br />
der Materie), die Gott nicht zu ändern vermiag, auiser diesem aber eiri<br />
„Reich der Gnade", wie es Leibniz neiiiit, in dem er seine Güte geltend<br />
macht. Abrr jenes Geständnis miiiste Philo schwer ailkommen, da er<br />
(loch anderseits behauptet, „claCs Gott a 11 e s k a ii n , aber das Beste<br />
will",7" cla er auch tviedcrholt Gott iii clie Gesetze der Materie ein-<br />
greifeil liist. Iii einem künftigen Friedenszustande, mit dem Philo<br />
wohl clas messiailische Reich meint, werden nach Zähmuiig der mensch-<br />
licheii Wildheit auch die wilcleil Tiere zahm werden. „Dann werdeii auch<br />
die Arten der Slrorpioneil und der Schlangen uiicl der ailcleren Reptilien<br />
ilir Gift unwirksam führcil."sO) Uncl „diejeiligeri, die clie Tugend übeii<br />
73) A. a 0. 644M, aus demselben, oben genannten Abschnitte.<br />
74) A. 8. 0. 645M. -- 75) A. a. 0. 643M. -- 76) Vgl. Wendland, a. a. 0. S. 84.<br />
77) De ebrietate, 1728, 383/384M. Das Beispiel des Farbenwechsels des<br />
Polypen kehrt wieder De animalibiis, $ 30 (Richter), 139A. Alle drei Beispiele<br />
finden sich schon in K. 30 der Schrift ZEQ~ Savpaaiwv cixovop~cLuzwv, die, fiilsch-<br />
lich Aristoteles zugeschrieben, unter seinen Werken steht.<br />
78) Quis rerunl divinariim heres sit, 272, 612M, auch de somniis I, 110.<br />
637 M, de Abrahamo 207,30M.<br />
79) De Abrahamo, 268, 39M. - 80) De proemiis et poenis, 422M.
Die stoische Theodizee bei Philo. 29<br />
uiid sich die heiligen Gesetze zum Führer der Worte uiid Werke ihrcs<br />
Lebens setzen, wird weder eine allgemeine (epidemische), rioch eine per-<br />
söiiliche Krankheit treffen."81)<br />
Uineomchr muiste Philo nach einem Ersatze für das physikalisch-<br />
mechanische Argument suchen. Und so finden wir auch das kosmolo-<br />
gische Argument der Stoa bei ilm wieder: „Wie nach dein Gesetze der<br />
Natur der Vater, der es erzeugt hat (für das Kind), so sorgt er (Gott)<br />
für das Erschaffene, sowohl auf das Ganze wie auf die Teile achtend."'-)<br />
Freilich dient oft eine Maisregel nicht allen, sondern nur einem Teile.<br />
Windc und Regeii schaden oft den Seeleuteii und deii Ackerbauern,<br />
sind aber für das Weltall notwendig. Denn durch den Regeiz reinigt<br />
Gott die Erde, durch die Winde die ganze Welt unter dem Monde. Beide<br />
dienen, Pflanzen uiid Tiere zu nähren, uiid aufzuzielieil. Wenn sie einigen<br />
Schiffern und Bauern ungelegen komxneii, so ist dies kein Wunder, „deiiii<br />
diese sind ein kleiner Teil, die Fürsorge (Gottes) aber gilt dem ganzen<br />
~~enschengeschlechte'L.S3) „Wie ein Arzt in groiseii uiid gefahrlicheil<br />
Krankheiten biswcilcil Teile des Körpers wegscliiieidet, auf die Gcsuiicl-<br />
lieit des übrigen Körpers abzielend, wie der Steuermann bei heftige11<br />
Stürmen einen Teil der Ladung des Schiffes aus Fürsorge für die Ret-<br />
tung der Insassen auswirft, und wie weder deii Arzt für die Verstümme-<br />
lung, noch den Steuermann für den Verlust ein Tadel trifft, vielmehr<br />
beideiz Lob zuteil wird. . . . ., ebenso muis inan auch die Natur des Alls<br />
immer bewundern und, von freiwilliger Bosheit abgesehen, mit allem,<br />
was in der Welt geschieht, sich zufricdeii gebeii und nicht fragen, ob<br />
etwas wider deii Wunsch gegangen ist, sondern ob das Weltall nacli Art<br />
eines wohlregiertcn Staates zuin Heile gelenkt uizd grstruert wird.''s4)<br />
Während diese Vergleiche alle eine gewisse Begründung und Recht-<br />
fertigung des Übels enthalten, hat Philo noch eiiieii, der sehr ungeschiclit<br />
ist: „Wie bei der Tötung eines Tyraiinen nacli allgemeinem Gebrauche<br />
auch seine Verwandten umgebracht werden, um durch die Ausdehnung<br />
der Strafe weitereiz Übeltaten vorzubeugen, ebenso werden auch durch<br />
die pestartigen Kraillrlieiten einige Nichtschuldige mit hingerafft, damit<br />
die anderen, Fernstehenden, zur Tugend gebracht werden."85)<br />
Mit dieseln Vergleiche hat Philo die ScliwPche des gailzen liosmo-<br />
logischen Arguments verraten. Den Tyrannen zu töten, lianil gerecht<br />
iein, seine Verwandten, obgleich unschuldig, zu töten, ist ungerecht.<br />
Philo weiis dies sehr wohl. An einer anderen StellesG) weist er es scharf<br />
zurück, dais das Uiiglücli des jüngeren Dioizysius eine Strafe für die<br />
Verbrechen des altereiz, seines Vaters, sein lröiiile. ,,Deli11 ein verstäil-<br />
tliger Mensch wird nicht von den Übeltaterii absehen, um ihre Vcr-<br />
waiidteii mit, Hais zu verfolgen, nicht die Strafe gegen die Schuldigeil<br />
81) Ibidem, 427M.<br />
82) De specialibus legibus, 331M.<br />
83) Frg. 642M, aus dem oben erwahnteii Abschnitte = de prov. 11, 108A.<br />
84) De praemiis et poeuis, 413M.<br />
85) Frg. 644M = De prov. 11, 112A.<br />
86) De prov. 11, 49A.
30<br />
Die stoische Theodizee bei I'hilo.<br />
unterlasseii, um auf den Unschuldigeil clie Rache zu likufeii. Welcher<br />
Lehrer wird, über clie Trigheit seiner Schuler entriistet, ihre Verwandten<br />
statt ihrer zur Eestrafuag annehmen? ICeiiier. Wenii der Arzt<br />
statt des kranken Vaters ocler der kraiili~ahnsiililig sei oder etwas Verderbliches<br />
plane? Wiovicl verkehrter also ist es, was mall nicht ciiimal voii Menschen<br />
sagen darf, von deil Göttern zu glauben."<br />
Dainit hat Philo sich selbst die Kritik geschriebeii, die sieh gegen<br />
die pädagogische Auffassung des Übels erhcben mnis. Es gibt ilur die<br />
Zuflucht, die ja Philo, wie wir gc~sehen haben, nicht unbelraiiiit war, da Cs<br />
es ein physisches Ubel überhaupt niclit gebe. Aber selbst dieser hohe,<br />
priiizipielle Staiidpunkt der Stoa lieis die Frage offen : Warum hat<br />
Gott das inoralische Ubel bem7irlitZ - Deiiii, gleichviel ob er es geschaffen<br />
oder blois zugelassen hat, er lroizilte es clurcli seine Allnlael~t im Keime<br />
unterdrücken.<br />
Hier weiis Philo eine ailclere Antwort als die der Stoa, weil er eiiie<br />
andere Willensfreiheit des 3Ienseheii als die Stoa annimmt. Zwar nach<br />
allgemeiner judischer Anschauung war das Böse im Meilscheil selir<br />
mächtig. „Das Dichten des ii~enschlicheii Herzens ist böse voii Jugend<br />
auf." (Genes. VIII, 21.) Uild Philo teilte diese Anscliaiiuiig. Aclam, cler<br />
erste Mensch, war vollliomn~en an Leib und Seele, eclel inld Aber<br />
seine Naclik-omnleilscha ft - aus welchem Grunde, ob durch den Siindeilfall<br />
oder aus anderer Ursache, wird nicht ldar - ist den1 Bösen verfalleii.<br />
„Dem Sterblichen ist das Böse eigentumli~h."~~) „liaiil, das<br />
Symbol cler Bosheit, wird nicht ~tcrben."~" ,„Das ganze T,ebeiz durch<br />
zum Bessereil zn neigen, ist uninbglich."") „Die Bosheit aui der menschlichen<br />
Seele zu nehmen, ist, als ob inan Ziegeln waschen ocler iin Netze<br />
Wasser bringen wollte.""l) Und. er mxht sicli, ilzil iiocli überbietend,<br />
einen Satz EIiobs (YIV, 4) zu eigen: „Wer ist rein von Schmi~tz, ivciin<br />
auch i~ur eineil Tag sein Lebeil dauert?"")<br />
Doch ist Gott an1 Bösen unschuldig. Oft wird wieclerliolt, dais er<br />
nur an allen1 Guteii schuld ist.") Vor clcr Schöpfung dcs Meilscheii<br />
sagt er, nach Xoses, nachdem er vorher alles allein geschaffen hat,<br />
„Lasset U 1 s &Ieiiscl-ien n~acheii", und zwar ,,damit die gute11 Taten des<br />
Meilschen auf il-iii allein zurückgeführt wercleii, auf clie aildereil aber (die<br />
ihm untergebencil Elrrkifte) die Siindeil. Deim den1 allherrsclieidcil<br />
Gotte schien es nicht geziemend (selbst) den Weg zuin Bösen (die Empfindungen,<br />
die zur Lust führeii lrönnen) in cler vernünftigeil Seele durcli<br />
sich zu schaffen. Darum übertrug er seineil Untergebenen die Schöpfung<br />
dieses (siimlielieii) Teiles."") Alle Scliulcl fällt soniit auf deii<br />
freien TVilleil des 3feilsclieii. „TVcnil clcr inleilscl-iliclie Geist fehlt uiicl<br />
-- P--<br />
87) De opificio mnildi, 136, 32M. - 88) De coiigressii eruditionis gratia,<br />
84, 531M. - 89) De fuga et inventione 64, auch 62, 656M. - 90) De mat.<br />
nom. 185, 606M. - 91) Frg. 663iiI. - 92) De mut. nom 48, 585IvI. - 93) Z. B.<br />
De conf~is ling. 180, 432M. De congr erud. gr., 171, 644&1, de fiiga etc., 79,<br />
.557M. - 94) De conf. ling 179, 432M.
Die stoische Theodizee bei Philo. 31<br />
siclz von der Tugend entfernt, so beschuldigt er die Gottheit, die eigeiic<br />
rmmrandluilg ihr zuschreibend."g~) ,,Deiliz nicht wie manche der Gott-<br />
loseil, iienilt Moses Gott als Ursache des Ubels, sondern unsere<br />
Hincle."QG) Um die menschliche Willensfreiheit zu retten, verwirft<br />
Phi10 die stoische Astrologie „als ein arges, vom sinnlichen Illeiischei~<br />
ausgedachtes Unrecllt uiid eine lxünstliche Erfinduilg'', die „die Frei-<br />
heit des Xensclien abschileidet", indein sie alles vom Horosliop der Ge-<br />
burt abhallgeil läist, damit die Verantwortlichkeit aufhebt und dic<br />
Strafen, iiberhaupt jede Gerechtigkeit, jedes Lob und jedeii Tadel uil-<br />
möglich iiiacht. Unter aiiderm betont er, dais die Angehörigen e i li e s<br />
Volkes, z. B. die Juden, jeder ein anderes EIorosliop und doch dieselben<br />
Sitten llaben, also in wichtigen Teilen ihres Wollens übereinstimmeii.<br />
Die Skytlieil seien zu verschiedenen Stunden geboren und doch alle der<br />
Rliitschaiide ergeben; zu verschieclcncil Stunden auch die Agypter, dic<br />
doch alle deii Tierlrultus übten, und jedes Staates Bürger, die, obgleich<br />
uilgleicher Nativität, doch gleiche Schicksale hätten, gleiclizeitig besiegt<br />
wiirdcil uild gleiclizeitig dcr Pest erlägen. Der Nensch also hat freien<br />
TVillcil,") cl. h. er ist eine von1 Weltlauf unabhängige Ursache, nicht<br />
blois frei diircli seine Erkeniltilis. Und wie sein böser Wille, so wird<br />
auch sein guter dem li\fenschen mehr angerechnet. Die Reue ist izacll<br />
der Lchre der Stoa ein Fehler, sie wird nie als Ersclieinung des Willens<br />
betrachtet, soildern als Folge des Irrtums und der Inkonsequenz, des<br />
Ifangcls der Gleichheit mit sich selbst, die von1 Weisen erwartet wird, zu<br />
den schlimmsteil Fehlern gerechnet.") Philo aber hat eine ganz andere<br />
Ansicht. „Gar nicht zu fehlen ist Gottes, zu bereuen des We,isen<br />
Sache.""") „Der Bereuende wircl gerettet und der aus den seelischeil<br />
I
32<br />
Die stoische Theodizee bei Philo.<br />
So hat aucli er dasselbe Gefühl wie die Stoa, dais der allmächtige<br />
Gott kein sittlichels übel zulassen durfte. Die Stoiker flüchten aus dieser<br />
Verlegenheit, wie wir gesehen haben, zu der Notwendigkeit, der auch ilii<br />
Gott unterworfen ist, zur logischen Notwendigkeit der Gegei~sätze, aus<br />
der sie das Böse als Bedingung des Guten folgern. - Hat auch Philo<br />
diese Zduclit gewählt? Nein, nirgends, er geht ihr vielmehr ganz ab-<br />
sichtlich und lronsequciit aus dem Wege. Oft spricht er voll Gegen-<br />
sätzen, die einander bedingen, dercn beide Glieder also gleich notwendig<br />
existieren. So de Cherubim 112, 159 M: „Der Winter ist des Sonnners<br />
und der Sommer des Winters, der Frühling beider uiid der Herbst des<br />
Frühlings ermangelnd und bedürftig, jedes eines jeden und, sozusagen,<br />
alles alles anderii, damit das Ganze, dessen Teile all das Genanilte bildet,<br />
ein vollkoinmenes und des Wcltschöpfers würdiges Werk sei." Tind wenn<br />
es sich hier um Naturereignisse handelt, der Gegensatz zwischen Gut<br />
und Böse also anscheinend fern liegt, so gilt dies nicht von anderen<br />
Stellen, z. B. von folgender, de aeternitate mundilo5) 507 M: Von den<br />
Gegensatzpaaren ist es unmöglich, dais das eine sei, das andere nicht sei.<br />
Denn, weiiil cs ein Weiises gibt, muis cs aucli ein Schwarzes gcbeii, wenn<br />
ein Grofses, ein Kleines, wenn ein Ungerades, ein Gerades, wenn eil1<br />
Süises, eiii Bitteres, wennTag, auchNacht uiid was diesenpaareii gleicli-<br />
artig ist." Eier lag der Gegensatz „Gut uiid Böse" oder auch nur „Gutes<br />
und Übel" nahe, er wird aber mit Stillschweigen übergangen. Ebenso<br />
Quaestioilcs in Genesin 11, 8 55 (Richter), 136 A: „Wie eine Harmonie<br />
aus entgegengesetzten Stimnen, einer tiefen und einer liohen zusammen-<br />
gesetzt ist, so wächst auch die Welt aus Gegensätzen zusamnleii."<br />
Diese Sitze erinnern sehr an den obeil (S. 23) angeführten Epiktets T-oii<br />
der I-larinoriie des Ganzen, die aus den Gegensätzen hervorgeht, sie<br />
stamnieii vielleicht aus derselben Quelle wie jener, aber erwälniei~ das<br />
Gegensatzpaar „Tugend und Laster" nicht.<br />
Überhaupt belreiiilt sich Pliilo zu dein „greisen und bei ihnen (den<br />
EIelleneil) besungenen I-Ieraklit", dessen philosophischer EIauptsatz<br />
längst vor ihm von Moses gefunden worden sei, daCs nämlich „aus eiiiein<br />
und demselben das Entgegengesetzte gleich Teilen sich entfa1tet."loG)<br />
Und öfter wiederholt er im Sinne Hcralrlits, wie an der zu vorletzt zitier-<br />
ten Stelle, dais die Welt eiii grofses, wie die Harmoiiic aus verschiedcneii<br />
Stiminuilgeii, aus Gegensätzeii zusainmeiigefügtes Ganze sei. Aber nie<br />
wendet er diesen allgemeinen Satz auf Gutes und Übel, Gut und Böse an.<br />
105) Diese Schrift halt Heinze (a. a. 0. S. 241) für unecht. Ich glaube nicht,<br />
dais mein verehrter Lehrer jetzt, nach 33 Jahren, diese Ansicht noch aufrecht<br />
erhalte. Vgl. auch Ueberweg-Heinze, Grundrifs der Geschichte der Philosophie, I,<br />
S. 351. 9. Aufl. Berlin 1903. Es scheint mir, dais Cumont (Philonis de aeternitate<br />
mundi, ed. Franciscus Cumont, Berolini 1891) die Echtheit derselben unwiderleglich<br />
bewiesen hat (8. a 0. I bis XXIV), besonders durch TJbereinstimmung ihres Sprach-<br />
gebrauchs mit dem der übrigen Schriften Philos. Ihm schliefst sich Weiidland(a. a. 0.<br />
S. 2) an, der diese Schrift, wie die über die Vorsehung, die Freiheit des Weisen und<br />
über den Verstand der Tiere mit groiser Wahrscheinlichkeit dem Jugendalter<br />
Philos zumeist. Auch A. Aal1 (a. a 0.) verwirft die Schrift zeei dg8a~oias<br />
xdcrpov als nicht philouisch. Ich glaube nicht, dais er diese Ansicht wird fest-<br />
halten können. - 106) Quis rerum divinarum heres sit, 214, 603BI.
Die stoische Theodizee bei Philo. 33<br />
Nur, wo er von cler E r k c 11 11 b a r li c i t der Gegensatzgliedcr<br />
clurcheinailder spricht, erwähnt Philo auch Tugend und La~ster, so bc-<br />
sonders in der groiseii Aufzählung der Gegensatze, die er an Genesis<br />
XV, 10, ai~kizüpft.~~~) Rier werden 64 Gegeilsatzpaare Izergczählt,<br />
ohne dafs Philo iizs eiilzeliie gehen will. Was dabei bewundert mircl,<br />
ist nur die Fürsorge Gottes für unsere Erkenntnis, dais er uns so oft<br />
symboliscli. auf die Wahrheit hinweist : „Eine Einheit ist der Gegensatz<br />
aus zwei Gliedern, nach dessen Spaltung die Glieder eilieiiiibar sind."<br />
Auch an einer zweiten Stellelos) nennt er unter aiideren Gegensätzen:<br />
„Tugend iind Laster, Nützliches und Schädliches, Edles uncl Scbäild-<br />
liches.ll Er beschränkt sich aber auch hier auf ihre Bedeutung für die<br />
Erlienntnis : „Denn an sich ist nichts f aisbar, aus den1 Vergleiche aber<br />
init dein aiidereii sclieint es erlianilt zu werden." Dasselbe de gigaii-<br />
tibus, 3, 262 31: „Denn durch den Gegensatz ist das Entgegeilgesetztt,<br />
:lm ineisteil gccigiiet erliannt zu ~verdeil."<br />
So würdigt Philo clen Gegensatz für die Erliciilitnis, iiber seine<br />
Verwertung abcr für die Theodizee, die Clirysipp so sehr betoilt, scliweigt<br />
er ganz und gar. TJnd zwar ist es iiiclit Unkeniltnis jener TTerwertung,<br />
die ihn darüber schweigen läist. Seine orkeiil~tiiistlieoretischP Scliiitzuiig<br />
des Gegeiisatzes hatte er gewiis Chrysipp, dem Logiker der stoischeil<br />
Schule eiitlehnt, auf dessen Spuren er auch sonst öfter wandelt. Er<br />
zitiert ihn dreima!,loO) uncl Weiidlandl'o) weist bei ihm eine ganzv Reihr<br />
Parallelen zu Chrysipp nach. Er wurde also auf die „logische Theo-<br />
dizee" Chrgsipps wohl vielfacli l-iiilgeführt. Wenn er sie dennoch ver-<br />
schmaht, so muCs clies einen iniieren Grund habeii. Und in der Tat,<br />
jene logische Theodizee war schlieislich, wie wir gesehen habeii, ein?<br />
Ergebung in die unabailderliche Wirltlichlreit, eine Beruhigung bei der<br />
Ordnung der siclitbarcn Welt. Aber eine solche Beruhigung ist nicht<br />
Philos Ziel. Er will den %Iensclien niclit init der Welt aussöhnen, son-<br />
dern über sie zu Gott erheben. Durcli die Askese soll er alles Trdisclic<br />
überwinden, „Gottes Haus werden1(. Noch mehr abcr soll er clurch dir<br />
Ekstase seine Individualitat aufgeben, mit Gott verschmelzeii. Seine<br />
Lehre war noch mehr Tliecsophic als Philosophie; trotz aller Alilcil~en<br />
aus der Stoa hat er nicht ihren inaterialistischeii Wirklichkeitssinn. Er<br />
will darum das Übel lieber fliehen als als solches anerkennen und be-<br />
kkinpf en.<br />
So blieb der tiefe Gedaiilre einer logische11 Tlieodizce zunachst, bei<br />
Philo, unwirlisam. Erst bei A 11 C: u s t i 11 sclieiilt er n~ieder aiif~ulebc~i,<br />
ui~d seine ganze Fruclitbarkeit, verbunden mit der Idee der Entwicklung,<br />
entfaltete er erst in cler lex coiltiiiui, einein tief begiiiiideteil Prinzip,<br />
bei dem ge~valtigen T, e i b ii i z.<br />
107) QLI~S<br />
rerum clivimrum heres sit, 207 bis 214, 602 f M. - 108) De ebrietate,<br />
186, 187, 386M. - 109) L)e aeteriiitate (vulgo incorruptibilitatete) mundi, 50101,<br />
:>05M. De prov. 11, 8 74 (Richter), 948. - 110) Vgl. a. a. 0. sein Sachregister<br />
unter Chrysipp.<br />
warn<br />
Philosoph. <strong>Abhandlungen</strong>. :3
Kantean Elements in Jonathan Edwards.<br />
Von<br />
Mattoon Monroe Curtis, Cleveland. U. C. A.<br />
ow to approacli a thiiilier who lias giveii rio systematic statcment<br />
of liis thought is aii important probleni. This is eniphasized iii<br />
Eclwards because of tllc varied field of his iiitcrests aiid the<br />
fraqinentary charactei of liis writiiigs. Aiiy attcnlpt to prcscilt<br />
tlie coiileiit of his philosopliy nlust be colored by the art of the interpreter.<br />
Ed~vards, lilie Kant, has generally been regardecl from the<br />
staiiclpoiiit of his logical power. Thc boy who, at elcveii years of age,<br />
coulcl ~vrile against tlie materiality of tlie soul, at twelve entei Yale<br />
College, aiid at fourtccii read IJoclie's „Essay Conceriiing EIuman<br />
Uiiderstanding", „witli greater satisfaction", lie tells us, „thaii the<br />
grcecly iiiiser fiiids wlicii gathering up haiidfuls of silvcr aiid golcl<br />
froil~ soilie liewly discovercd trcasure", inay well bc regarclecl as ail<br />
iiitellect~~al prodigy. „In this respect", Henry Rogers says, „he<br />
possessccl prol~ablg in a ~reater degiee than was ever vouclisafed to<br />
man tlic iatiocinativp faculty". OC liim Dugald Stewait reinarks tliat<br />
„in logical acuteness and subtlcty litl docs not yielcl to aiiy disputai~t<br />
bred in tlic uiiiverseties of Europc", aiid Sir James &iacIiitoch liolils<br />
Edwaids to have beeil „uniiiatcliecl, certaiiily uiisurpassed, amoiig ineii".<br />
Morc rcccilt liistoriaiis of thought, Sir Leslie Stephen, Priiicipal Fairbairn<br />
aiicl Joliii Fislie, mho lia~re given attention to Eclwarcls, liavc not<br />
inoclified ihese high estimates of his discursive pomers. Still, it is iiot<br />
in tlic realiii OE tlie cliscursire, but ol tlic intuitive uiiclerstandig thnt<br />
Edwaids lias liis preemineiice.<br />
As mitli Iiaiit, thc c t 1 i c a 1 interest was deepest in his I~~z~LI~F'.<br />
Logic nns an organoiz iii the service of the inoral lifc. ,,He that sees<br />
tlie be~auty of holiness, or truc inoral goocl, sees the greatest aiicl<br />
most iinportant tliiiig in the world . . . . 1Jiiless this is seeil
Kantean Elemeiits in Jonathan Edwards. 35<br />
iiotliiiig is Seen that is wortli the seeing: for there is no other true<br />
excellency or beauty. Uilless this be understoocl, notliing is understooil<br />
wortliy of tlie exercise 01 the noble faculty of u7iderstaiiding."l) Not<br />
oiily clid Edwards write the first treatise on Ethics iii America, but lie<br />
shows clearly that tlie ethical is his iiiain interest in all his mritings, philosophical,<br />
theological and religious. Ultimately his theories are always<br />
theories of value. The first and second of his Seveiity Noral Resolutions,<br />
mritten in early life, arc as follows: „T0 So ~vhatsoever I thiiik<br />
to be most to tlic Glory of God, aiid to my own good on the whole, and<br />
to the good and advantage of inankind iii gencral; and to contiiiually<br />
ericleavor to find out some iiew coiitrivance and invention to promote<br />
tlie foremeiitioncd end^.“^) His chief interest was to establish a metapliysics<br />
of inorals. He agrees with Kaiit that „Metaphysics is the real<br />
aiid true pliilosophy" - „the favorilc child of reason", and that „the<br />
trne and lastiiig tvell-being of the huiiiail racc depends upon it.":) It<br />
nras this aspect of Edwards's inind, as show~i in his theory of virtue,<br />
tliat reciwecl from the younger Fichte the ~varmest eulogy: „So has<br />
this solitary thinker of Nortli America riscii to the deepest and lofticst<br />
grouiid mliich caii undcrlie the priiiciple of m~rals."~)<br />
Still, tlie iilost prominent characteristic of tiie mind of Edwards is<br />
perhaps tlic e s t h e t i C. In this we approach Edwards as he approached<br />
life aiid its problerrrs. His niind in early years scems to have been doini-<br />
iiated by the sense of the sublime and tlie beautiful, proportion aiicl<br />
symiiietry. In few philosophcrs clo tlic seiisc aiid value of beauty play<br />
a so proiniiieiit role. In liis aestlietic contemplation of nature ho<br />
discernecl liis o~vii soul and Gocl. IIe repeatedly tells us of his „sweet<br />
aiicl refresliiiig seasons walliiiig aloiie iil the ficlds" or „in tlie woods" or<br />
„in solitary places". IIcre lle bad vielvs „cxtraordii~ary of the glory<br />
of tlic Soli oi God as Mediater"; liere „tlie sublimity aiid truth of tlze<br />
Soverrigiity of God" came to liim: hcre „thcre seemcd to Be as it tvere<br />
a caliii, sweet Cast or appearaiice of divine glory iii almost everything";<br />
licrc lie foutlcl tlie thoughts of tlie riiost significaiit of all his sermons;<br />
„B Diviile RIIC~ Supernatural Light, Iiinnecliately Inlparted to thu Soiil<br />
hy tlie Spirit of God". To Edwarcls tlie sovercignty of God is not nierelv<br />
his miscloin ancl power, but preemiiieiitly his presence and inimaiiencc<br />
iii all thiiigs. Shc analogies of iiatilre nncl grace impressed liim deeply,<br />
aiicl, like Berlieley ancl Butler, he helcl that tlic two clispensatioiis had<br />
tlie saine autlior, or merc tmo aspects of Beiiig iil General. In his<br />
1) Treatise on Rcligioiis Affections. Sect. V, 1.<br />
21 Works, Vol. I, Memoirs, pp. LXII-LXV. 1:eferences to the morlcs of<br />
Edwards are to the Edition by Edward IIickmau, in tno ~~olumes, London, 1840.<br />
About orie-half of the writiiigs of Edwards remains iinpublished.<br />
3) Kant, Logik, Intro. IV, Proleg. par. 67. Edwards was tmenty-one<br />
years of age when Kant was horn, and Kant was thirty-four when Eclwards<br />
(lied. The writings of Edwards received immediate recognition in Scotland.<br />
Whetlier the intercourse hetweeil Scotland aiid ISönigsbei-g brought Edwards to<br />
the attention of Kant we have not inqiiired.<br />
4) J. H. Fichte, System der Ethik, Bd. I, s. 644-645, pnr. 225.<br />
3"
36<br />
Kantean Elements iii Jonathan Edwards.<br />
aesthctic coiiteiiiplatioiis, nature, inan aild God are syntliesized or more<br />
exactly maii anrl iiature arr olle in Cod. To Edwards, as mitli Kaiit,<br />
iiatuie is full of God, but this fulliics in oiily syiiibolic of a 111 u ii d LI s<br />
i ii t e 1 i n i b i 1 i s. The exercise of his seiises liberated his iiiiiicl<br />
U<br />
froin the thralldom of sense aiid gave placc to a symholisin of trutli<br />
aiicl goodiiess that constitutes God, or the Diviiie Excelleiicy, thc oiily<br />
realil y.j)<br />
Like Kaiit, Edwards had a deep intcrest iii physical scieiice. Spcalciiig<br />
of Edwards aild Franliliii, James Partoii says: „Differeilt as tliey<br />
were in otlier paiticulars tliese two ablest of Coloiii,eel Ainericaiis wero<br />
alilie in possessiiig a niagniiice~it talent for tho observatioii of iiature.<br />
Ed~vards! What a career had beeil his, what cliscovcries liad 11e mncle,<br />
if he had obeved God iiistead oS Calviii! Who cail read liis cai-lv<br />
~vritiiigs upoii sciience without adrniratioii aiicl s~rrow?'~~) At eleveii<br />
years of age lic wrote an „Essay oii tlie Ilabits of the Flyiiig Spider",<br />
~vhicli is regarded to-day as ail excellent sciciitific paper.7) liiterest iii<br />
iiature reinaiiiecl witli hiin throughout liis life, altliougli iiietaphysic,<br />
camc iiiore aiid more to coiitrol his atteiltioii. Professor Tyler iemarics :<br />
„The precocity of Joiiatliaii Edwarcls iii philosophical scietice appears<br />
to have beeil iiot less woiiderful thaii was his precocity iii metaphysical<br />
scieiice. While a studeiit at Vale College, aild especially wliile a tutor<br />
there, he prosecutcd his pliilosophical researched with great diligriice.<br />
31e evrii wrote a series of „Notes on Natural Scieilce", iiiteiiclccl as tlie<br />
basis of a book. Iii these Kotes he cleall ~vith thc priiicipal topics iii<br />
physics aiid astroizomy, many of his remarks heilig very acute, iiigeiiious<br />
aiicl origiizal. 1Ie suggestec? that therc is iii tlie atmospliere solnc otliei<br />
etliereal matter coiisiderably rarer thaii atiiiosplieric air; that water js<br />
a conipressible fluid, a fact not publicly aiiiiouiiced by scieiitific iiieii<br />
uiitil thirty years afterward; that w~~tcr, ii~ frecziiig, looses its specific<br />
gravity; aiid Llint thc cxisteiice of fiigorific particlcs is cloubtful. Ti1<br />
explaiiiiilg tlie pheiionicila of tliuiicler aiid liglitiiiiig, ~vitliout aiiy Biio~vledge<br />
of the electric fiuid aiid long befoie the iiivciitiori of tlie Lcydeii<br />
jars, lie rejected the iiotion thcli prevaleiit ul~oii tlie subject, aiicl camc<br />
iiearer to tlie tlieory afterward discovercd by Fraiildiii tliaii aiiy otlier<br />
humaii iniiid bad theii dolle. He demoiistrated that the fixed stars are<br />
suns; he explaiiied the forinalioii of river chaiinels, tlie cliffcreiit<br />
refrarigibility of the rays of light, llic growth of trecs, the proccsses of<br />
evaporatioii, aiid the pliilosophy of tlie levcr; aiid lie macle iinportniit<br />
observations on souiid, 011 electricity, oii tlic teildeiicy of wii~ds from tlie<br />
coast to bring raiii, aiid on tlic cause of ~olors."~) This estimatc of<br />
-<br />
5) Works, Vol. I, pp. 56, 81, 82; Allen, Life of Edwards, p. 355. Cf. I
Iiantcan Elements in Jonathan Edwards. 3'7<br />
Eclwards's scieiltific achievements, thougli perhaps overstatecl, is a fair<br />
iizclex of his scientific iiltere~sts. All of these motives, the logical, the<br />
tthical, tlze esthetical and the physical enter iiito tlie thought of<br />
EcI~~rards ia varying clegrees and in coilfusing rclations. At the timc of<br />
11ii e~arly death he hacl not completely oriei~ted hiinself, m1d thc large<br />
ficlcls wliich lle hacl mappecl out for exploratioil ware biit imperfectlg<br />
ln-ospectecl.<br />
Tlze miild of Edwarcls moved ilaturally to tlie questiorl as to tl~e<br />
niraiiiiig of the world of seiise wliich lie found so rich in suggestioil. To<br />
hiiii, as with Plato, the objects of our seiises are but the shadows of<br />
beiiig." ,„The worlcl", says Edwa~ds „secms so differently to our eyes,<br />
to our ears ailcl other sense3 froni the iclea ~ve liave of it by reason, that<br />
we can liardy 'ealize the latter."lO) Edwards reacts violently against<br />
Locke's prevailiilg sriisatioilalism and passivity of mind, asserting<br />
tlzat „the inincl is abmdantly active". IIe conceives nature as a systein<br />
of energies iii wl~ich there is no substailtiality but God, who is conceivetl<br />
as pure activity after the analogy of our own miilds; mind alone is<br />
activc. Erl~vnrds remarks „It is 11ow agreecl by cvery knowiilg philosoplier<br />
that colors, are not really in the things any more thaa pain is in tlie<br />
needle; but strictly nowhere else than in thc mind. But yet I think that<br />
color inay liave existence out of the mind with equal reason as ailything<br />
in the body has ai1 existcncc out of thc mincl. Besides the very substancr<br />
of the bocly itself is nothing but thc coilstarit excrtions of divine power.<br />
If col& exists not out of ths miiid theii nothing beloilgiilg to the bocl~<br />
exists out of the mind but resistance, which is solidity. And the termiilation<br />
of this resistailce, which is figure, ailcl tlle communicatioil of this<br />
rrsistailce froni space to space, which is inotion, though the latter art.<br />
ilothii~g but nlocles of the former. Therefore there is nothiiig out of the<br />
iiiincl but resistance. aild not that either when nothing Us actualls<br />
resisted. Tlieii there is iiothirig but the powcr of resistance, ancl as<br />
resistailce is iiothina else but the actual cxertioiis 01 God's Dower so tho<br />
power can he nothiilg else but the coilstaizt law or method of that actual<br />
exrrtioii. She world is tlierefore an ideal olle; ailcl the law of creatiilg<br />
aild the succession of these ideas is constant and reg~1a-r.~~) To this<br />
Ed~~~ards adcls the corollary „Sincc it is so that absolute nothing is such<br />
n clreadful coiltradictioii we learn thc necessity of the eternal existeizce<br />
of ail All-Coinprehendiiig Mind, and that it is the complication of all<br />
coiitradictioiis to deny such a miild". We lrilow that Ood exists because<br />
only His existence can guarantcc to us our owiz existence and the<br />
existence of the world. Eis existence is „a iiecessary s U p p o s i t i o n '(.<br />
God is a necessary Beiilg because it is :i. contradiction to suppose IlIim<br />
not to be. We cailnot get along without Iiim. Absolute nothing, which<br />
is tlze oiie other clisjunction, is the cssence of all contraclictious; but<br />
9) Works, Vol. I, p. CCLXXI, par. 62; cf. CCLX, par. 40.<br />
10) Works, Vol. I, p. CCLXVIII, par. 22.<br />
11) Works, Vol. I, P. CCLVIII, Par. 27.
38<br />
Kantean Elements in J~natha~ii Edwards.<br />
Beiiig includes iii it all tliat we call God. He is a izecessary beiiig<br />
because „tliere is 110 other way"; „there is iiothiiig else supposablc".<br />
The existeiice of God is the affirmation of the hunlaii miiid. That all<br />
this is Kantean, appears in Kant's eai-ly G r o u n d a ii cl D e rn o ii -<br />
stration, andismadecxplicit iilthcKritilr of I'ureReason,<br />
iil the seilsc that thc Kritik establislied tlie ii e e d and coiiseclueiitly tlie<br />
proof of the existence of God. Tlie existcnce of things that are not<br />
perceived by the human miad rests not increly, as with Berkeley, upon<br />
tlieir being perceived by the Diviiic Miiid, but rather upoii „God7s<br />
supposing of them in order to thc rendering comlplete the series of<br />
things, to speak more strictly t 11 c s e r i e s o f i d e a s , accordiiig to<br />
His om settled order and that harmoily of thiilgs whicli I-Ie lias<br />
appointed. The supposition of God ~vliich we speak of is nothing clse<br />
than God's acting iii the Course aiicl series of hlis exciting ideas, as if<br />
they, the thiilgs supposed were in actual idea."l" Edwarcls regards<br />
time as a mental succession. „i\'umber is a train of differeilce of idea<br />
put together iii the iniild's consicleratioii in orderly successioil. This<br />
inciital succession is the succcssion of tiine. One may make wliicli he will<br />
the first if it be Fut the fivst iii coiisideration. The ~nind begiiis wlicre<br />
it will aild runs through them successively oiie after ailother."l" Ed-<br />
wards holds that space is a iiecessary beiiig, or, „to speak plainly, space<br />
is God.. . ." „Such a view", says Edwards, „does iiot affect or inake void<br />
natural pliilosophy, or the scieiice of causcs or peasons of corporeal<br />
changes. For -to find out the reasoils of things iii iiatural pliilosophy is<br />
onlj- to find out the proportion of God's actiilg. And tlie case is tlie<br />
same as to such proportiohs wlzether we suppose the world oiily inental<br />
in our sense or no." Natural science, theni, according to Edwards, is<br />
left undisturbed. The ideality of space and time does not affect it in<br />
the least. Though we suppose that the existence of the wiiole niaterial<br />
universe is absolutely depeiidcnt on idea, yet we may speak in the old<br />
way as properly and truly as ever. Edwards is aware that his idealisni<br />
drives materialistic mechailism out for science. „EIence we learii", he<br />
says, „that there is no such thiiig as mechailism for that word is iiitended<br />
to denote that whereby bodies act caclz upoii the otlier purely and prop-<br />
erly by themselves."l4) Tlie ideality of space is expressed as follo~vs:<br />
„Spate, as already observed, is a necessary being, if it may called a<br />
being; aiid yet we have also shomil that all existence is mental, that thc<br />
existence of all exterior things ie ideal." „Hence it is manifest that<br />
there caii be nothing like theso tliiizgs we call by the name of bodies out<br />
of the miiid unless it be in soiile other mind or nlinds. An iiideed tlze<br />
secret lies liere, that which truly is tlie substance of all bodies is the<br />
infinitely exact and precise aiid perfectly stable Idea in God's miiid<br />
t o g e t h e r W i t h His stable will that the same shall gradually be<br />
12) Works, Vol. I, p. CCLX, Par. 40.<br />
13) Works, Vol. I, p. CCLXVI, Pars. 56, 9.<br />
14) Works, Vo1. I. D. 714. For Kant's iiltimate view on mechanislu see Iir.
Kantean Elements in Jonathan Edwards. 29<br />
comiluiiicated to us aiicl tb other minds accordiiig to certain fixed and<br />
exact aizd established methods and laws. 0r in somewhat different<br />
lailguage tlie iilfinitely exact and precise Divine Idea t o g e t. h e r<br />
w i t h sw. answerable perfectly exact, precise and stable will with respect<br />
to correspondent coinmunications to created minds, and effects oii thcir<br />
mind~."~~) ,Together with' is a strilring expression. Iii the thouglit of<br />
Edwards it has dualistic, parallelistic, and monistic implications. „By<br />
substaiice", lie says, „I suppose it is coiifessed we mean only something<br />
because of abstract something we have no idea that is more particular<br />
thaa oiily szibstailce in general." This something, this thing in itself,<br />
this existeiice in geileral, Edwards conceives as God, whose nature is<br />
activity, - ceaseless, creating eilergy. Re roinarks „Now this Beiiig,<br />
actiiig together of itsclf, prodncing new effects that are perfectly arbi-<br />
trary aild that are in 110 way ilecessary of themselves, must be intelligent<br />
and volui1ta~y."~G) This idealism does not appear to be differeiit from<br />
that laid down by Kailt in the first edition of his Kr i t ilr under the<br />
„Analogies of Experience". Indecd bis „Refutatioii of Idealism" does<br />
not seem to chaiige his earlicr positioii that all empirical reality is<br />
traiisceiidentally ideal but inay be treated uiider the „Ailalogies of Bxpe-<br />
rieilce". Iii any case Kant is involved in tlie coiiclusioiz that the world<br />
of space aiid time is a manifestation of a spiritual priilciple.<br />
Much has b~en writteil iii iegard to the sources of Edwards's idealism<br />
without establishing marked iiidebtedness to any of his predecessors.<br />
Berlreley has beeil nlost often referred to as tlze probable source, but<br />
this is quite out of the question as Edwards proponizdcd his iclealistic<br />
views loilg before therc is any trace of Berlreley's influeilce in America.<br />
Johnsoii, wlzo was a tutor at Yale (1716-1719) commuriicated nothing<br />
to Ed~vards as he kiiew nothing of Berkeiley before his visit to Englaiid<br />
1'722-1723 probably not before 1727-1728, when the „PriiiciplesU<br />
appear in liis list of reading. Johnsoiz was p er s o n a ii o il g r a t a<br />
to Edwards at Yale, which is shown by a letter of Edwards, dated Narch<br />
6th, 1719. There is no trace of Berlreley's influence in Ainerica before liis<br />
sojourn at Xewport, 1727-1731. If there is aily conncction with Berlrelcy<br />
it lies, not so much in the Bishop's „ P r i n c i p l e s ", which were<br />
publislied iii 1710, a~id which propourided thoroughgoing plieiloin a 1' ism,<br />
as in his „ S i r i s ", which was not publishcd until 1744, and was the<br />
first appearancc of Berkeley's Platonic Idealisin which Kailt criticized<br />
in his P r o 1 e g o m e ii a. In the former ,esse est percipi'; iil tlie latter<br />
,esse est concipi'. In Ed~vards the main einphasis of his idealism is put<br />
iii ,concipi' as early as his essay on Being, whicli was writteii, accordiiig<br />
to Professor Smyth, as early as 1717. Both Professor A. C. Fraser and<br />
Professor G. P. Fisher, who formerly coiinected Edwards with Berlreley,<br />
have receiltly modified their views.17) Other coiinections, such as mith<br />
15) Works, Vol. I, CCLXI, Par. 13.<br />
16) Notes oll the Mind, par. 61. Cf. Andover Review, Vol. XIII, p. 294.<br />
1') Fraser, Works of Berkeley, 2nd edition, Vol. 111, p. 393; Fisher, Edwards<br />
on the Trinity, p. 18.
40<br />
Kantean Elements in Jonathaii Edwards.<br />
Xalcbraiiclie, John Norris ancl Arthur Collier are highly problematic<br />
aiid quite gratuitous. If the statements of Sir William I-Iamiltoii arc<br />
C-orrcct, it is highly iinprobablc that Edwards erer saw or hearcl of<br />
Collier's C 1 a v i s U ii i v c r s a 1 i s , which was published in 1713 an;l<br />
which propounded a theory of absolute idcalism. EIamiltoil says this<br />
paiilphlet was unknown in Englaild aiid Scotlaild uiltil Dr. Reid stum-<br />
I~lecl upoii it in the library of Glasgow. The libraries of Oxford aiicl<br />
Canibridgc do not possess a copy, aiid before the middle of the iiiiie-<br />
teentli ceiitury Collier's nanle appcars in iio Eritish biography, not even<br />
in that of his own county. Ti1 Gerniany aloiie the C l a V i s receivecl<br />
attention. The A c t a E r u d i t o u in of 1717 gives a copious ailcl<br />
able abstract of its contents. 111 1756 the worlr was translated into thc<br />
Gerinan along with Berlieley's Dialogues between Hylas ancl Philo-<br />
ilous.ls) When onc considers the nature of the msind of Edwards,<br />
togethw mith his knowledge of Plato, Cudworth, Newton ancl Loclre,<br />
there is no difficulty in believiiig that Edbvards, although isolated in<br />
a iievr morld, advanced iipon Locke iil a way similar to that of Berkelcy,<br />
ancl propouiided elements of idealism that have entered into tlie most<br />
recent tliought. That there is 110 difficulty in drawing Iclealism froin<br />
the writings of Locke lias been poiiitecl out by Sir William Hamilton.xq)<br />
Botli Boyle aiid Locke saw clcarly the idcalistic implications of the<br />
vicws of 31alebranche. Reicl thouglit it strange that Locke, who wrote<br />
so niucli about ideas, should not sec those coiisequeilces that Berlieley<br />
thoiiglil so obvious, aild lie cite? Locli-e's Essay, Book IV, C. 10 to show<br />
ihat IJoclie's liiiits tally exactly with the system of Berlieley.<br />
rt has uiliformly been assumed that the methocl of Edwarcls wai<br />
theological and deductive; that be starts oiit with the traditional or<br />
arbitrary coilceptioii of Gocl aiicl clccluces Cosinology and Anthropology.<br />
Xothing could be farther from the trutli regardiiig his real method of<br />
procedure. Tlicre is in Eclwards thc same anthropological motive that<br />
appcars in the great philosophcrs, not only, but in thc grent Churchmen,<br />
froin Cleinent of Alexandria, Grcgory of Xyssa and Augustiiie to our<br />
owii day. This is not nlerely the contiiluity of the diviiic aild thc<br />
buinan, hut that the actual foim of all thought arises from iimer expcrieilce<br />
ancl proceecls througil i~atiire to God; - that the analogics of oui<br />
inner needs or expericnces support all cosmological aild theological<br />
constructions; that God is the true self writ large aild that his attributes<br />
are experienced desirablc clualities raised to iiifiiiity. Locke, Berlieley,<br />
Butler, Edwards aiid Kant hold in their thouglit mhat came violeiitly to<br />
tlie front in Feuerbach. But neither Edwards nor Kant wished to niakcl<br />
this aspect promiiient, though, in both cases, it underlies their inetaphysics.<br />
„If one suppose", says Edwards, „there be anything else than<br />
what nrr observe, it is only by way of iilfcrci~ce."~~) Tlie grouiicl of this<br />
-- .<br />
18) Sir William Hemilton, Discussions on Philosophy, pp. 188-101. Cf.<br />
C. P. Krauth, Berkeley's Principles, Phila, 1886, p 317.<br />
19) Discussions on Philosophy, pp 200, 201.<br />
20) Notes on the Mind, No. 61; Works, Vol I, p. CCLXI.
42<br />
Kantean Elements in J~nat~haii Ed~vards.<br />
bc rcducecl to tliese; or their degree, circumstances, and relatioizs . . . .<br />
The fulness of the Godhead is the fuliless of his understanding coiisisting<br />
in his knowledge, and the fulness of his will, consisting in liis virtue aiid<br />
lzappii~ess."~~) Here are the two dualism of Edwards' thinl~iiig about<br />
mau and God, the dualism of the understanding and the will, aiicl tlze<br />
dualisrn within the will of virtue and happiness, which latter correspoizds<br />
to the ,TugendlehreC, and ,Gutelehre' of Fichte. These dudisms are<br />
clearly the product of the aiialysis of human experience. It is inzprobable<br />
that they were suggested by tlie doctrine of the Trinity.<br />
Degrees and analogies in beiilg are familiar thoughts in the writings<br />
of Edwards. ,,It pleases God to obscrve analogy in his worlcs, as is<br />
manifest in fact in innuinerable iilstances; and especially to establish<br />
inferior thirigs with analogy to superior. Thus, in how niany iizstances<br />
Iias he conformed brutes in analogy to the izature of inankind, and<br />
pdants iii analogy to animals with respect to the manner of their geizeratioil,<br />
nutrition, etc. So he has constituted the exterilal svorld in analogy<br />
to the spiritual woi-ld in numberless instances."") Tlius, too, tlie<br />
thought of a contiiluous progress toward perfectioil as an cild is fanziliar.<br />
„Above all, it may be argued that God has made mankind for some end.<br />
But man's special end is some improveniei~t or use of his f aculties toward<br />
God.. . . Does God make the world restless, to move and revolve in all<br />
its parts, to make no progress?" God's stable law is tlie law of erolutioil,<br />
the permanent ii1 a universe of clzailge. It is ilot arbitrary in tlze sense<br />
that it is changeable or fortuitous, but is ordered by the divine svisdoin<br />
and is God's continuous workind nzethod in realizing eilds. „As I said<br />
before, all oneness in created things, whence qualities and relatioizs are<br />
derived, depends upon a divine constitutiori that is a r b i t r a r y in every<br />
other respect excepting that it is 'egulated by divine wisdom. Tlze misdom<br />
which is exercised in these constitutions appears in thcse t~vo tliings,<br />
first, in the beautiful analogy and harmony ~vith other laws<br />
or constitutions, especially, relating to the same subject, aiid secoiidly,<br />
in tlie good ends obtaiiied or the useful coiisequeilces of sucli a constitution."<br />
„All dependent existence whatsoever is in n constant flux, ever<br />
passing and returning; renewed every moment as the colors of boclies<br />
are every moment renewed by the light that shines upon then~; and all is<br />
constantly proceeding from God, as light from the suil." Like Iiaiit,<br />
he views developrnent as prefornzation or evolution as against epigeiiesis<br />
or involution. „There is an apparent maiiif old a n a 1 o g y to other<br />
constitutions and laws maintained tlirough the whole system of vital<br />
nature in this lower world; all parts of wlzich in all successions arc<br />
derived from the f i r s t o f t h e Ir: i n d as from their root or fountain;<br />
each deriving from theilce all propcrties and qualities that are proper<br />
to the izature and capacity of the species : no cl e r i v a t i V e having any<br />
25) Works, V01. I, P. 119, God's Chief End in Creation, Sec. 7.<br />
26) Nature of Trne Virtue, Chap. 111; Cf. Vol. 11, p. 956, and Vol. I, p. CCLXIV,<br />
Notes on the Mind, No. 59.
Kantean Elements in Jonathan Edwards. 43<br />
oiie perfectioii, unless it be mhat is inerely circumstantial, but what was<br />
in the p r i m i t i v e With Edwards as with Kant, wisdoni is thc<br />
teleological priilciplc, being the synthesis of all other faculties. „God's<br />
power, is sliown 110 otherwise than by his powcrfully briiiging about<br />
some end. Tlie very notion of wisdom is wisely contriviiig for an end;<br />
and if tliere be no end proposed, whatever is doiie is not wisd~m."~~)<br />
This idnte and eternal eiiergy, which is at oilce final and efficient cause,<br />
is the glory of God. „God7s glory, as it is spoken of in the Scripture as<br />
the end of all God's works, is, in oiie word, the einailatioii of tliat fullness<br />
of God, that is fiom eternity in God, a d e X t r a, an'd towards those<br />
creatures that are capable of being sensible and active objects of such an<br />
emanation . . . . Tliis cornmuiiication is of two sorts : the communication<br />
that consists in understanding or idea which is summed up in the Irnowledgc<br />
of God; aild the other is in the will, coiisistiiig iii love and joy,<br />
which may be summed up iii the love and enjoyment of God. Thus that<br />
~vliicli proceeds from God a d e x t r a is agreeable to the twofold subsisteiices<br />
which proceed froni him a d i ii t r a which is tlie Son aiid<br />
the IIoly Spirit: the Son being the idea of God or tlle lcnowledge of<br />
God; aiid tlie I-Ioly Ghost, which is the love of God aiid joy iii GO^."^^)<br />
The a d e X t r a is the shadow of the a d i n t r a ; the human understandiiig<br />
and will are thc reflection of the divine Logos and Love. The<br />
Triiiity lies in tlie divine constitution and in us. But, as in Augustine,<br />
so in Ed~vards, inetliodologically aiid accordiiig to knowledge, the<br />
shadow is the actuality and the reality is the infereilce. The I, in its<br />
thinking and willing is apotheosized. „Tliere are no lnore than these<br />
three that are distinct in God even in our way of coiiceiving. There<br />
is oiie resen~blance to this threefold distiiiction in God and threefold<br />
distiiiction iii a Created Spirit; namely, the spirit itself, and its understaiidiiig<br />
and its will, or iilclinatioii or love; aiid this iiideed is all the<br />
real distiiiction there is in created spirits."30) Edwards holds that the<br />
Triiiity is necessary oii philosophic grouiids, for „in a being that is<br />
absolutely without plurality there cannot be excellency, for there can<br />
be no such thing as coiisent or agreement.
44<br />
Kantean Elements in Jonathan Edwards.<br />
about Edwards. His cloctrine of creation, of will and virtue, as well as<br />
his view of the nature of the universe, lead in these directions. „In him<br />
we live and move and have our being." Be „is being in general ancl<br />
comprehencls universal existente". EIe is „infinite, amount or quaiitity<br />
of existeizce". ,,He is the infinite, universal and all-comprehending<br />
cxcelleiice." „Wheii we speak of being in general we may be undwstoocl<br />
of the divine being, f or he is the infinite being : theref ore all others must<br />
necessarily be considered as nothiny; as to B o d i e, s , we have shown in<br />
another place that they have no proper being of their own and as to<br />
S p i r i t s , they are the cominuiiicatioils of tlie great original spirit; ancl<br />
doubtless in inetaphysical strictiless aricl propriety he i s and there is<br />
none else. He is liliewise infinitely e X c e 11 e n t , and all excelleizce<br />
ancl beauty is derived from him in the same manner as all being, aiid all<br />
othcr excellence is iii strictness only a sbadow of his."33)<br />
Eclwards's doctrine of personal identity is more significant for his<br />
tlieology ancl philosophy than has generally beeil recognized. In his<br />
Notes on the Mincl Ed~vards rejects Locke's doctrine of personal identitj-<br />
aiicl snggcsts oiie ~vhich he later carried out in Izis Treatise an Original<br />
Sin.Y4) The thought of Edwards in the imputation of Adam's sin to<br />
posterity is that Adam ancl his posterity constitute one moral Person,<br />
aizcl that this onesness oi iclcntity depends upon the sovereign consti-<br />
tutioiz or laiv of the supreme author and disposer of the universe . . . .<br />
„Sonie things are entirely distiiict aiid cliverse, which yet<br />
are so unitecl by the establishecl law of the Creator lhat by virtue of<br />
that establishmeiit they aar iii a serise o 1 e. Tlius a t r e e grown great<br />
and a liundred years olcl is o n e plant with tlie little sprout that first<br />
caine out of the grouncl frorn whence it grew, and has been continued in<br />
constant successioii; though it is now so exceecling diverse, many thou-<br />
saiicl times bigger and of a vcry different form and perliaps not one atom<br />
the very same: sind yet God, according to an establishecl law of nature,<br />
has iii a constaiit succession communicated to it many of the same<br />
qualities aad most iniportant properties as if it were o n C. So the<br />
b o cl y o f m a ii at forty years of age is onc with the infant bocly which<br />
first came into the worlcl whence it grew; though now constituted of<br />
different substance and a greater part of thc substance, probably changecl<br />
Scores, if not hundrecls of times: and though it be in so many respects<br />
exceeding diverse, yet God accorcling to the Course of nature, which he has<br />
been pleasecl to establish, Iias caused that in a certain method it should<br />
communicate with tliat in f a ii t i l e body in the same life, the same<br />
senses, tlie sariit? features and maiiy tlie sarne qualitirs, aiid iii union with<br />
the snine soul; and so with regard to these purposes, it is dealt mith by<br />
hin1 as o ii e body. The body aiid soul of a man are one in a very different<br />
manner ancl for difl'erent purposes. „Considered in themselves they ax<br />
33) Notes on the Mind, par. XIV, Sect. 8; Works, Vol. I, pp. CCLXXII,<br />
CCLXXIII.<br />
34) Works, Vol. I, p. CCLXIV, Pars. 11 & 72; Cf. Original Sin, Part. IV,<br />
Chap. 111.
Kantean Elements in Jonathan Edwards. 45<br />
exceediiig different beiiigs, of a naturc as diverse as cati bc coiiceivccl;<br />
and yet, by a verg pcculiar divine constitutioii, or law of nature, which<br />
Ood has been plezisad to establish, tlicy are stroiigly unitecl aiid becaine<br />
o n e in niost importaiit respects; a woiiderful mutual commuiiication is<br />
c~stablislied; so that bot11 beconie different parts of the s a ~n e m a 11. But<br />
tlie iiilion aiid mutual coinmuiiications theg have has existence, aiid is<br />
eiitirely regulated ancl liniited accordiilg to tlie sovereigil pleasure of<br />
Ood and tlie constitutioii he lias beeil pleased to establisli."") Edwards<br />
agrees witli Locke that „Same consciousiiess" is essential to personal<br />
idcntitv. He aarees with Newton that it is will that is thc firat or<br />
efficient caiise ~vhich l~roduces pheiiomena that appear in aiialogy, harinony<br />
and agreemeiit accordiiig law. But he gocs bcyori6 1,oclie alicl<br />
Newton in asscrtiiig that all cre~ated beings iil time ailcl space are depciideiit<br />
aiid bave tlitir iüeiitity orily in tlie coiistarit, coiitinaous creatiug<br />
activity of God. The cxistence of created substaiiccs iil eacli succeissive<br />
inamcilt nl~~st be the effect of the immediate ageiicy, will mid powcr<br />
of God, ~~liicli ,.is perfcctly eyuivalent to a coiitiiii~ecl crratioii or to liis<br />
creating those things out 01 iiothing at each nionieilt of thcir<br />
rxisteiice'(.3" lt is interesting to notc that liis rrd?jrn C,F( doctriiic, which<br />
lakes tlie form of coiitiiiuous creation d e ii o V o, iq apparently aii<br />
aiialgoiie dcri~ed £1-om tlie fact that every iiew eff'eet in liuiiian activitg<br />
is prcceeded by a iiem act of our effieiency. This is iiii agreeineiit with<br />
~vhat we talcc to he his real inethod, viz. e x a 11 a 1 o g i a 11 o m i n i s.<br />
Still, Ed~vards sces iio possibility of a nietaphysics of cxperieiice<br />
~vithout assertiiig an absolute experiaice in which aloiie tlie categories<br />
of exyerieiice are intelligible. Tlie cxistence, says Edwards, of aii effect<br />
or thiiig depenclent in different parts of space or duration, tliougli ever<br />
so ii e a r olle to ailother, do iiot at all c o - e X i s t oiie with the othcr ;<br />
and tllereiore are as truly cliffeient effects as if tliose pait oi space aiicl<br />
cluration werc cvcr so far asuncler. Aiid lie keeiily asscrts that thc lnrior<br />
cxistence can no inorc he tlic proper cause of the new existcilce iii tlic<br />
ilext inonient or iiext part of space thaii if it liad bccii iii an agc before<br />
or at a thousand niiles clistaiice witliout aiiy existeiicc to fill up thc iiitcr-<br />
iiiediiate time or space. Therefore the existencr OS crcated substaiice, in<br />
each successive inoineiit, niust be tlie effect of the i n1111 e d i a t c ageiicy,<br />
will, aiid power of Gon. ,.If any shall iiisisi upon it tliat their preseiit<br />
existeiice is thc effect or coiiseqiieiice of past existence accordiiig to<br />
the ii a t ii r e of thiilgs; that tlie establislied c o u r s e o f 11 a t u i. r is<br />
silfficierit to coiztinue existeiice oiice it is giveii; I allow it. Rut then it<br />
should be renielnbercd, w h a t naturc is in created things; and w h a t tlie<br />
cstablisl-ied c o ur s e of nature is; that, as has beeil observed alreacly,<br />
-P-<br />
35) Original Sin, Part. IV, Chap. 3. There are maiiy reminders o£ Spiiioza<br />
in Edwards, particularly of his parallelism nnd monism. Spinoza's sub s t an ti a<br />
coristans infinitis attributis, and Deus reriim omnium causa imma-<br />
nens, fairly represeiit the thought of Edwarcls. Still, then is no evidence that<br />
Edwartrds was acquainted mith Spinoza.<br />
36) Original Sin, Part IV, Chap. 3.
46<br />
Kantean Elements in Jonathan Edwards.<br />
it is nothiiig separate from tlie ageiicy of GO^.'“^) In<br />
this connection Edwards declarcs inore clearly than iil liis N o t e s o ii<br />
t h e Mi ii d that causatioii is not an empirical, but a rational or traiis-<br />
ceiidcntal principle of the will. He says „Now difference of the t i m e<br />
of existeilce does not at all liiiitler tliings succeeding iii the saine order<br />
aiiy more than clifferencc of p 1 a c e in a CO-existeiice of time".3s) It<br />
is evident, iii his doctriize of identity, that thc uiiclerlying thought is<br />
that time, space aiid cause liave no rational or metapliysical significaiicc<br />
apart froni the stable activity of God whicli coiitiiiually constitiites thr<br />
universe. As every izem effect which man produces is clue to a nem<br />
exercise of his activity, eiiergy or will, so every rffect or change iii<br />
existeiice is duc to the ccaseles activity of being in geiieral, or God. Here<br />
too paiitheism or irnmailent theisiil, after the aiialogy of our owii spirits,<br />
Comes agaiii into viow. There is iio created or secoiidary substaiicc.<br />
God alonc is substance. 13s arbitrary laws aiicl mcthods constitue 311<br />
uiiity, contiiiiiity nnd iiideiitity. The universe is the self-revelatioii of<br />
God; all chaiiges arc sigils oi syiiibols of Izis activity, - lnodes of his<br />
existence.<br />
Edwards is logically superior to both Kaiit ancl Spiiioza iii Iiolding<br />
the fundameiilal iinportaiice of thc category of relatioiis. Wliile 1
Kantean Elements in Jonathan Edmrards. 47<br />
lating cosinological ancl tcleological arguments for tlie existeiice of a<br />
personal God, that Edwards, the lover of nature, tnrnecl his back upon<br />
this ~vhole inovemcnt of rationalism, of Bridgewate' Treatises and Boyle<br />
Lectures, ancl roundly asserted the incompeteiice of the understandiiig in<br />
the realm of religion, ailcl, in the place of t4ie reason of the unclcr-<br />
staiiding, cleclared the competence of the reason of the will. Ilc does not<br />
pnt fort11 any denionstration of God7s existence, but asserts tliat the<br />
unclerstancliiig is iiicapable of giviiig aiiy proof. The existence of God<br />
is a necessary suppositioii; there is no other way. For „the misnriible-<br />
iiess of our conceptions" leads us to objcctions. „Our notions of tlie<br />
Divilie Nature", lie asserts, „nie so imperfect that our iniperfect iclca<br />
adinits of a disjunctioii; for whatever is not absolutely perfect, dotli<br />
so.. . . As soon as we liave desceilded oiie step below absolute perfectioii<br />
possibility ccases to be simple; it divides and becomes manifold. Thus,<br />
for iiistance, we cailnot conceive of God without attributing successioii<br />
to Iiiiii; hut that iiotion brings aloiig with it contingent existence ancl<br />
induces ~vitli it a manifold possibility."39) ,,If ~ve take reason strictly",<br />
lie says, „~iot for the faculty of meiltal perception in general, but for<br />
ratiocinatioii, or a power of inferring by argumeilt, the pcrcciving of<br />
spiritual beauty and excelleiicy, no nlore belongs to re,ason thaii it belongs<br />
to the sense of fecling to perceive colors, or to the: power of seeing<br />
to pcrceive tlic beauty or loveliness oi anything. Sucli a perceptioil<br />
cloes not belong to tliat faculty. Reason7s work is to perceive truth and<br />
not excelleilcy."") „Thus natural or rational religion", Edwards<br />
declares ~vitli Kant and the school of Ritschl, „is impossible. Xot oiily<br />
is tlie light of nature insufficicnt to cliscovcr this religioii, but the law<br />
of iiature is not sufficient to establisli it, or to give any room for it.''41)<br />
In lii~ rlefense of 3Ietapliysics, which is at once Bacoiiian, Kaiitean ancl<br />
Colriclgeail, Edmards holds that the realm of the uriderstanding is the<br />
renlni of mathcmatics, wliile that of the will is the realin of metaphysics;<br />
tliat tlie latter is superior in importance to the former, and that to urgc<br />
agaiiist an argumeilt tliat it is rnetaphysical is as idle as to object that it<br />
is w~itteii in Freiich or 'atin. „The sole questioii is", says Eclwards,<br />
„wlietlier tlie reasoning be goocl and the argurnent truly coliclusive." It is,<br />
he liolcls, by metapliysical argun~ents only tliat we are able to prove tliat<br />
tlie ratioiial soul is iiot corporeal; that God cxists, that God is not liinited<br />
to a plnce, or I-Ie is not nlntablc; thnt Ne isi, iiot ignoraiit or forgetful,<br />
tliat it is impossible for Hiin to lie or bc unj~~st, aild tliat there is one God<br />
oiily. ,,Ancl iiicleed have 110 strict dcmonstration of aiiytliiiig except<br />
iiiathcmatical truths but hy metaphysics. Wei caii have no proof that is<br />
purcly demonstrative relating to tlie beiiig ancl nature of Gorl, His<br />
crcatioii of tlle world, the clepciidcnce of all thiiigs oii Hini, the iiilture<br />
OE boclica or spirits, tlic iiatiire of our own souls, or any of tlic great<br />
39) E. C Smyth, Ainerican Journal of Theology, Vol. I, p. 955.<br />
40) Reality of Spiritual Light, Works. Vol. 11, 13. 17.<br />
41) Miscellaneous Observations, Part I, Chap.TTI1, TT70i.lrs, Vol 11, PI'. 484485.
48<br />
Kantean Elements in Jonathan Edwards.<br />
truths of morality aiid natural religioii but mhat is i~ietaphysical."~?)<br />
I-Iere the view of Eclwards is vers similar to that of Iiaiit; he iiot oill':<br />
distiilguishes between the pure and practical reasoii, but he hold? tliat<br />
11-hile in the pure reason, or the understaiiding, botli form aiicl iiiattei.<br />
are present giving us knowledge of the positive or matheinaticd orclcr,<br />
the practical reasoii, or will, furiiishes us only with forms to ~vliicli<br />
nothing phenonienal correspoiids. Thus, in respect to morality, religioii,<br />
aiicl tlieology, the reason ~~iust resort to inetaphysics aiid get<br />
anotliei- kiiicl of coiitent for its forins tliaii that furnishecl dircctly by<br />
icnsibility. This content, right idca or axiom, niust be furiiislied bjr<br />
revelation from God.43) But revelation, according to Edwards, i? the<br />
ji~ncr light, or conscience, or iiztuitioii, or rational will. Soinctiinles<br />
Edwards speali-s of revelatioii as uiiiversal, agaiii as original; hut at all<br />
times it is a permaileilt possibility to inan. For iiistaiice, tlie Gospel is<br />
,z revelatioii, hut it „has its higliest and nzost proper evidciice in itself.lci')<br />
Or again, ,,Our experience of the sufficicncy of the doctrine of tlie<br />
Qospel to give pcace of conscience is a. rational inrvtlrd ~vitiicss to tlie<br />
truth of the G~spcl."~~) Kant liinisclf could not escape a rcfereilcc to tlip<br />
iinniinental or traiiscendeiit ,Oberhauptc or ,ObergewaltC as the grouiicl<br />
of practical axioms.") From the staiidpoint of the rational will Edxvarcls<br />
believcs that the priiiciples of morality, religion aizd theology cai~ I>e<br />
tlemoiistratcd. He even goes so far as to hold tliat tlie doctrine of the<br />
Triiiity ca11 be thus established. „I think it is withiii the reach of liakecl<br />
reasoiz to perceive certaiiily tliat there are tliree distiizct in GO^."^^)<br />
,liiswcring to this twofold order of liiiowledge thcrc is a „twofolcf gro~iiicl<br />
of assurarlcc of the judginant - a reducing tliing to iclentity or coiztra-<br />
dictioii as in mathematical clemonstrations. - and bv a natural. iizviii-<br />
ciblc incliiiatioiz to a coiiceptioii, as mhen wo see aiiy effect to coiiclnde<br />
a. cause - aii oppositioii to believe a tliing caii begiii mitliout a caiise.<br />
This is not tlic same with the other and cannot be reduced to a contra-<br />
clictioii."") There is notliiiig ohjective in cause. It is „that natural<br />
disposition in us when ale see a thing begiiz to be to supposc it o~viiig to<br />
a ca~se."~~) „Cause is that after, or upon tlie existeiice of wliich, or the<br />
existence of it nfter such a manner, the existence of aiiother tliiiig<br />
follows.""') ,„The coiijunctioiz betweeii tlicsc txvo existentes, or betm~cii<br />
the cause ancl eft'ect, is 1~7hat we call power."") In liis paragrapli oii<br />
42) Worlcs, Vol I, p. 85, Freedom of the Will, Part IV, Rect. 13.<br />
43) Worlrs, Vol. 11, 13. 476; Miscellaneoiis Observations, Part I, Chalr. TI,<br />
Par. 17.<br />
44) Treatise On Religious Affections, Sec. V, 1.<br />
45) Works, Vol. 11, p. 582; hliscellaneous Remarks.<br />
46': Griindleeune der Meta1,hvsik der Sitten. zweiter Abschnitt. IZirchmaiiii's<br />
Aufgabe, pp. 49r50-$ 59-60.'<br />
47) E. C. Smvth, American Joiirnal oof Theology, Vol. I, . n. - 961<br />
48) Worlrs. Vol.'I. u. CCLVII. Par. 10.<br />
49j ~orks;<br />
Vol. 1; P. CCLVIII, Par. 43; C£. Kant's Pioleg., 3 29.<br />
50) Ib., Par. 27.<br />
51) Ibid., Worlrs, Val. I, p. CLXIV. Par. 29.
Kantean Elements in Jonathan Edwards. 49<br />
Reasoiling, cause aild design are preseilted as of the Same epistemolog-<br />
ical nature. „\Ve lcilow our own existence aiid the existence of every-<br />
thiiig that we are coilscious of in our own minds intuitively; but all our<br />
reasoiliilg with respect to real existence depeilds upon that unavoidable<br />
arid invariable disposition of the miild, wheii it sees a thing begiil to be,<br />
to conclude certainly that there is a C a u s e of it. Or if it sees a thing<br />
to ba iil a very orderly, regular and exact maiiner to conclude that sonie<br />
d e s i g 11 regulated and disposed it."j2) „Reasoiling does not absolutely<br />
differ froili pcrceptioil aily further than t h e r e i s a ii a c t o f t 11 e<br />
w i l l a b o u t i t. It appears to be so iii demonstrative reason. Because<br />
the knowledge of a self-evident truth. it is evideiit, does not differ from<br />
perception. But all demonstrative lcilowledge consists iil and may bc<br />
resolved into tlie knowledge of self-evidciit truths. And it is also evideiit<br />
that the act of the mind iii other reasoniilg is n o t o f a d i f f e r e n t<br />
n a t u r e fronl demoilstrative reasoniiig." „Knoiv1edgeu, he tells us, „is<br />
ilot the perccption of the agicenient or disagreenicilt, but rather the<br />
perception of tlle iii~ion or disunioii of ideas, or the perceiving wlletlicr<br />
two or iiiore ideas beloilg to one another . . . . Perhaps it caililot prop-<br />
erly be said that we see the agreemeilt of the ideas unless we see 11 o rv<br />
they agree. But we may perceivc that they are uiiitod and know that<br />
they belorig to one ailother,_though rve do not know tlie maniler h o w<br />
they are tied t~gether."~~) „After all has been said aiid done", says<br />
Ed~vards, „the only adequate definition of truth is the agreement of our<br />
ideas with existence. To explaiil rvhat this existence is, is another thing.<br />
In abstract ideas it is iiothing but the ideas themselves; so tlieir truth is<br />
their coilsistency with themselves. In the things that are supposed to<br />
be without us it is the determinatioil and fixed mode of God's exciting -<br />
ideas iil us. So tliat truth in this sense is the agreemeiit of our ideas<br />
with that series in God. It is existence, and that is all we can say. It<br />
is impossible that we should explaiii a perfectly abstract and mere idea<br />
of existence. Only we always find this by ruiining of it up that God aiid<br />
real existence are the same."") ,,Truth in geizeral", Edwards concludes,<br />
„may bc defined after tlic most strict and metaphysical manner, as the<br />
consitency aild agreement of our ideas with the ideas of God. I confess<br />
this iii ordinary conversation would not half so much tend to enlighten<br />
one iri the meaning of the word as to show the agreement of our ideas<br />
with the things as they are. But it should be inquired what is it for our<br />
ideas to agree with thiilgs as they are seeiizg that corpore~al thin,gs exist<br />
not otherwisc than mentally." „All truth", he asserts, „is in the miiid,<br />
and only there.'15j)<br />
Further light is thrown upoil Edwards's theory of kilowledge by his<br />
brief treatise „The Iiisufficiency of Reason as a Substitute for Reve-<br />
52) Works, Vol. I, p. CCLXVIIJ, Par. 54.<br />
53) Works, Vol. I, P. CCLXVIII, Par. 71..<br />
54) Works, Vol. I, p. CCLXVII, Par. 15; Cf. Par. 10.<br />
55) Works, Vol. I, p. CCLXVII, Par. 10; Cf. Par. 6.<br />
Fliilosoph. <strong>Abhandlungen</strong>.
,?o Kantean Elements in Jonat,hari Edwards.<br />
lation".") This opusculc, which is the first and ablest attaclr upon<br />
Deism by aii L4n~erican, is directed again.;t Tiiidal's „Christiaiiity as old<br />
as Creation". It shows not only that Edwards had clearly in mind the<br />
clistiiictioiis betwcen the pure aiid the practical reason, but that he was<br />
no straiiger to sonze of the most distinctive features of the eritical philos-<br />
ophy. „There are", lie says, „some general propositions which can only<br />
be knowir by reason, from which iiow a great number of other proposi-<br />
tioris by tlie commoii aiicl universal sense of tlie human mind, incapable of<br />
being established by tlie reason apart from these fundamental assump-<br />
tioiis." The elenieiitary general principles are: „the testimony of our<br />
sense may be clcpendecl on", and „the testimony of history aiid traclitioii,<br />
human experieiice, is to be clependccl on"; that is, the testimony of the<br />
individiial and the race, „when attended witll such and such creditable<br />
circumstaiices" is regarcled as reliable. I-Ie continues „I say all that is<br />
Bizown by the experienee of manlcind is lrriown only by one oi more of<br />
these testimoizies, exceptiiig only the existerrce of that idea or those few<br />
iclci~s which arr at Lliis inoment prcsent in our minds, or aic the impor-<br />
taiit objects of present coiisciousneas. A n d y e t h o w u ii r e a s o n -<br />
a ble would it be to say that we must lrnow these things to be true by<br />
reason before we give credit to our experience of the truth of them.<br />
Xot onlv are there irinumerable truths that our reason receives as<br />
followiiig from such geiieral propositions as have been mentioned which<br />
caniiot I>e kiiown by reason if they are considered by themselves, or other-<br />
wise tlian as ini'errecl froin these geiieral propositions; but also maiiy<br />
trutlii are reasonablv received, and arc received bv the common consent<br />
of tlie reasoiz of all rational persoiis as uiicloubted truths, tvhose truth<br />
iior only ~voulcl not otherwise be discoverable by reason, but when they<br />
are cliscoverecl from that general propositioiz appear in themselves not<br />
easy aiicl rccoiicilable to reasoii, but difficult, iiicomprehensible, and their<br />
agreeirieiit with reason not understood. So that men, at lelast most men,<br />
arc not able to exglaiii or conceive of the iiianiier in which they are<br />
agreeable to reasori." Edwards proeeeds to illustrate at length that the<br />
nreteiices of reasoii issue in coiitradictioils. iiz conclusions that are<br />
„repugnailt to rcasoii arid incompatible with any faculty of the under-<br />
~tandii~g that we enjoy." His thought, although without thc schematism<br />
of' Karit, appears to be a general statement of the difficulties of metaliliysical<br />
scieiice ~vhicli Kant preqents in his „Transcendeiital Dialcctic".<br />
TVe iiiay briefly riote these antinornies or eoiitradictions of the speculati~e<br />
reason 2s prcsented by Edwards.<br />
1. Rational Psychology is impossible. Experience shows us that<br />
iiiincl aiicl bocly interact, tbe one upon the other. But reasoii cannot com-<br />
l~relieiicl 11 o w mind caii act upon matter, nor, on the other hand, h o w<br />
niatter cail act upori iniricl. If it be saicl tlzat the interaction is by an<br />
66) Works, &Iiscellaneous Observations, Part I, Chap. VII; Works, Vol. 11,<br />
1311. 479-485.
Kantean Elements in Jonathan Edmards. 51<br />
established law of the Creator, still the maniier h o w it is possible to be<br />
is incoi~ceivable.~~)<br />
2. Experience tells us that tlie sensible world exists, but reason<br />
caiinot make it clear to us. „For if there be a sensible world it exists<br />
either in the mind only, or out of the mind, independent of its imagina-<br />
tion or perception. If the latter, then that sensible world is some mate-<br />
rial substance, altogehter diverse from the ideas we have by any of our<br />
senses, - as color or visible extension and figurv, which is nothing but<br />
the quantity of color and its various limitations, which are sensible<br />
qualities that we have by sight; and solidity, which is the idea we have<br />
by feeling; aiid extensioil and figure, which is tho oilly quality and limi-<br />
tation of these; and so of all other qualities. But that there should be<br />
any sirbstance entirely distinct from any or all of these is uttery incon-<br />
ceivable. For, if we exclude all color, solidity or conceivable extension,<br />
dimensioii, aild figure, what is left that we can conceive of ? 1s there not<br />
a removal in our miilds of all existencc and a perfect emptiness of everg-<br />
thing? But if it be said that the sensible world has no existence but only<br />
in the mind, then the sensories themselves, or the organs of sense, by<br />
which sensible ideas are let into the mind have no existence but only in<br />
tlie mind; and those organs of sense have no existence but what is con-<br />
veyed irito the mind by themselves; for they are part of the sensible<br />
world. Aild it will follow that the organs of sense owe their existence<br />
to the organs of sense, and so are prior to themsclves, being the causes<br />
or occasions of their own existence, which is a seeming inconsistence<br />
with reasoil, tliat I iinagine the reason of all inen cailnot explain and<br />
remove."")<br />
3. The contradiction in regard to the Ego is laid down by Edwards<br />
in the following language: „By experience we know that there is such<br />
a thing as thought, love, hatred, etc. But yet this is attended with<br />
inexplicable difficulties. If there be such a thing as thought aild affec-<br />
tion. Where are they? If they exist, they exist in some place or no<br />
place. That they should exist and exist in rio place is abovc our compre-<br />
hension. It sepms a contradiction to say they exist and yet exist nowhere.<br />
And if they exist in soine place, then they are not in other places or in all<br />
places, and thcrefore must be confined at one time to one place, and<br />
that place must have certain limits. From whence it will follow that<br />
thought, love, etc., have some figure, either round, or Square, or trian-<br />
gular, which seems quite disagreeable to reason aild utterly inconsistent<br />
to the nature of such things as thought and the affection of the miild."")<br />
Here Edwards states in a little different language, but just as cxactly as<br />
does Kant, that rational psychology is, as a science, impossible. Edwards<br />
denies thc substantiality of the soul and affirms its fuilctioilal nature<br />
when he holds that the soul is nothing besides its qualities. „When a<br />
57) Miscellaneons Observations, Part I, Chap. VII, Par. 4.<br />
58) Ib. p. 480.<br />
59) Ib., p. 480, Par. 6.<br />
4*
08<br />
Kantean Elements iii Jonathan Edmards.<br />
new thought ariscs we must not refcr it to the substaizce of tlie soul, for,<br />
if we meaii by soul, soniething that has no properties, it is absurd, for<br />
the soul is nothiiig besides its pr~perties."~~)<br />
4. „It is evident by expcrieiice that s o m e t 11 i ii g 11 o w i s. But<br />
tliis proposition is atteiided with thiiigs that reasoii cannot coinprelieiid,<br />
paradoxes that seem coiztrary to reason, for if somethiag iiow is, theii<br />
either something was fronz all eteriiity, or soinethiiig begaii to be without<br />
any cause or reason for its existente . . . . Or there lnust have beeil soine<br />
eternal self-existent being having the reasoiis of his existeiicc withiil hirri-<br />
self; or he must have existed fronz eternity without reasoii of his existeiice;<br />
both of which are iiiconceirable . . . . That the world has existed f r o in<br />
e t e r 11 i t y w i t h o u t a c a U s e seems wholly iiicoiisistciit with<br />
reason. Iii the first place, it is incoiisistent with reason that it sliould<br />
exist without a cause, for it is evident that it is not a thing, tlie nature<br />
and maiiner of ~vhich is iiecessary in itself; and therefore it rcquircs a<br />
cause or reason out of itself, why it is so, and not otherwise. Aiid in tlie<br />
next place if it exists from eterriity theii succession has ßceii froin rternity<br />
; which iiivolvens the f orementioned coiitradic tions. But if it be<br />
without a cause and does not exist from eternity, theii it has beeil crca~ed<br />
out of iiothing; which is altogether incoiiceivable, aiid mhat reasoii cannot<br />
show to be possible. It is evident froin tlze above passages, whicli ai.e<br />
amply supported elsewhere tliat Edwards repudiated as vigorously as did<br />
Kant, and upon precisely the same grounds, ratioiial psycliology, rational<br />
cosmology and rational ontology. Edwards pursues tlie claims of reasoii<br />
still further, and shows us the difficulties in which reasoii is iiivolv~d<br />
wheil it atteinpts to prove immortality, evil, frcedoin, God.<br />
5. As to the doctrine of the immortality of the soul, he says „It<br />
is certain iiothiiig can be niore agreeablc to reason wlieii once thc<br />
doctriiie is proposed arid thoroughly canvassed . . . . Who, if lie was iiot<br />
assured of it by good authority, would wer talre it iiito liis licad to<br />
imagiiie that inan, who dies aiid rots and vanishes forever lilrc all otlier<br />
animals, still exists? It is well if this, wlzen proposed, caii be believcd;<br />
but to strilre out the thought itself is somewhat, I am afraid, too liigli<br />
and difficult for the capacity of meii. The only natural arguinc~it of<br />
aiiy weight for the immortality of thc soul takes rise froni tliis Observation,<br />
that justice is not extended to the good, nor exacted upon the<br />
bad maiz in this life, and that as thc Goveri~or of the world is just, man<br />
must live liereafter to be judged. But this oilly argumeilt tliat caii be<br />
drawii from inere rcasoiz iii order either to lead us to a discovcry of our<br />
own immortality or to support the opiiiion of it wheii once startcd is<br />
founded entirely on the kiiowledge of God and his attributes . . . . Aiitl<br />
besides, this argumeiit iiz itself is utterly iizcoiiclusive on thc principles<br />
of the deists of our age and iiatioii; because they iilsist that virtue frilly<br />
rewards and vice fully puiiishes itself .''GI)<br />
60) E. C. Smyth, Americaii Journal of Theology, Vol. I, p. 957.<br />
61) Ib., p. 477, Par. 27.
Ihntean Elements in Jonathan Ed~vards. 63<br />
G. She proposition, that evil exists, coiitains within itself an insuperable<br />
contradiction. „It is evident", he says, „by oxperience, that<br />
great ovil, both moral and natural, abounds in the lvorld. It is manifest<br />
that great injustice, violence, treachery, perfidiousriess and extreme<br />
cruelty to the innocent abound in the world; as well as innumerable<br />
estreme sufferings, issuing finally in destruction and death, are general<br />
all over the world in all ages. But this could not o t h e r w i s e have<br />
been known by reason; and even now is attended with difficulties which<br />
the reason of many, yea, most of the learned inen alld greatest philosophers<br />
that have bcen in the world, have not been able to surniount.<br />
That it sliould be so ordercd or permitted in a world absolutely arid perfectly<br />
under the care and government of an infintely holy and good God,<br />
discovers a seeming repugnancy to reason, tliat fe,w, if aiiy, have been<br />
able fully to remo~e."~~) This difficulty, ~vhich belongs to theology, is<br />
significant only because Edwards regarcled it as insolveable from the<br />
point of view of rational theology.<br />
7. Iii regard to freedom, Ed~vards says, „that men are to be blamed<br />
or commended for their good or evil voluntary actioils, is a general proposition,<br />
received with good reasoii, by the dictates of natural, common,<br />
and universal moral sense of mankind in all nations and apes: which<br />
- ,<br />
moral sensc is inclrided in what Tindal means by reason and the law of<br />
nature. And yet many thiiigs attend this truth that brought difficulties<br />
and seeming repugiiailces to reason, which have proved altogether insu-<br />
perable to the reason of man7 of the greatcst and most learned man in<br />
thc ~orld.''~~) This is the problem that Edwards sets himself to solve,<br />
in his ,Treatise on the Will', by distinguishing between natural and<br />
moral necessity.<br />
8. Thc existente of God is incauable of rational demonstration according<br />
to Edxvards, yet „nothing is more certain than that t h e r e m U s t<br />
be an unmadc aiid unlimited being; and yet the very notion of such a<br />
being is all mysterg, involving nothing but incomprehensible paradoxes,<br />
and seeming inconsistence. It involves a notion of a being - self-existent<br />
and without any cause which is utterly iilcoiiceivable and seems repugnant<br />
to all our ways of conception. An infinite spiritual being, or infinite<br />
understanding and will and spiritual power, must be omnipresent without<br />
extension, which is nothiiig but mystery and seeming inc~nsistence."~~)<br />
If we talie understanding or the speculative reason as our guide we shall<br />
be able to believe nothing that lies out of the sphere of sense and mathematics;<br />
we shall not be able to believe in the world, iri the ego, in God,<br />
in freedom, in immortality. The speculative reasoil is full of illusion<br />
and contradiction. Yct Edwards is fully convinced, with Kant, that<br />
these truths are the most certain and real. Edwards and Kant alike<br />
are convinced that priority belongs to the will, and that the solution of<br />
these difficulties is possible to the practical reason only.<br />
62) E. C. Smyth, Arnerican Journd of Theology, Vol. I, p. 481, Par. 8.<br />
63) Ib., p. 481, Par. 9.<br />
64) Ib., p. 483, Par. 16.
54<br />
Kantean Elements in Jonathan Edwards.<br />
Iii his „Misccllai1eous Observations" Edwards raises the questiou. of<br />
the chicf good, observing that „The thouglits of meii. with regard to any<br />
iilterilal law will be always mainly influenced by their sentimeiits con-<br />
cerniilg the c h i e f g o o d. Whatsoever power or force may do in<br />
respect to the outward actions of a man, ilothiiig can oblige hiin to tliinlr<br />
or act, as often as Eie is at liberty, against what he talres to be his chief<br />
good or interest. Now, if the supposed chief good of aily man should<br />
lead him, as it often does, to violate the laws of socicty, to hurt others,<br />
and to act against the geiieral good of maillriiid, he will be very uilfit for<br />
socicty; and consequently, as he cannot subsist out of it, aii eileiny to<br />
himself."") This cleai-ly indicates the nature of the etlzical problem<br />
which Ed~vards had in view. The implication of freedom iii the above<br />
statement is jiistified in that „whoever acts according to eizds acts volun-<br />
tarily". „Neither God iior man is properly said to malre aiiything that<br />
necessarily or accidentally proceeds from then, but that only which is<br />
voluritarily produced . . . . Manlcind, haviilg understaildiiig aild being<br />
voluntary agents can produce works of thcir owi~ will, design, aiid<br />
contrivaiicc, as God does." Tlie esscilce of true virtue coilsists in soinc-<br />
thing b e a u t i f U 1, or rathcr some kiild of beauty or excelleizcy. It is<br />
not a 11 beauty that is called virtue; for iiistailce, not the beauty of a<br />
buildiiig, of a flower, or of a rainbow; but sonie beauty beloilging to<br />
beings having p e r c e p t i o n and w i 11. . . . Virtue is the beauty of<br />
tlzose qualitics and acts of the mind that are of a nioral nature, that is,<br />
such as are atteilded with desert or unworthiiless of p r a i s c or b 1 a m e.<br />
Things of this sort, it is geilerally agreed, so far as I lrnow, do not<br />
beloilg inerely to speculation; but to the d i s p o s i t i o 11 aild ~v<br />
i 11. . . .<br />
True virtue, therefore, is that conseiit, propensity and union OS a heart<br />
to being in general, which is immediately exercised iil a geileral good<br />
will.. . . Wheii I say truc virtue consists in 1 o v e t o b e i ii g in<br />
g e n e r a 1, 1 shall not be likely to be uiiderstood that izo oize act of<br />
inind or exercisc of lovc is of the nature of true virtue, but what has<br />
being in general, or the grcat systein 01 uiliversal existence, for its<br />
d i r e c t and i ni m e d i a t e object : so tliat no exercise of love or liiiid<br />
affectioil io any olle particular being, that is but a small part of this<br />
wholc, has anything of the iiature of true virtue. But, that the nature of<br />
true virtue consists in a d i s p o s i t i o 11 to benevolence towards being<br />
in geiieral; though from such a disposition may arise exercises of love<br />
to particular beings, as okjjects are presented and occasioils ari~e."~~)<br />
Edwards recognizes the difference between the love of benevolence<br />
and thc love of complaceilce. Love of b e il e v o 1 e ii c e is that affection<br />
or propeilsity of the heart to being wliich causes it to iiicline to its well<br />
being, or diposes it to desire and talre pleasure in its happiiless. What<br />
is con~moiily called love of c o m p 1 a c e il c e presupposes beauty. For<br />
65) Part I, Chap. TI, Par. 34. There is much in common betweeil Edwards<br />
and Shaftesbury. See especially the closing paragraphs of Shaftesburjr's An<br />
Inquiry concerning Virtne or Merit.<br />
66) Nature of True Virtue, Chap. I.
Kantean Elements iii Jonathan Edwards. 55<br />
it is iio other than delight in beauty; or conlplacence iii the persoii or<br />
being, beloved for liis beauty. But neither of these gives the root or<br />
primary nature of true virtue. „If the essence of virtue or beauty of<br />
mind lies in love or iil disposition to love, it inust primarily consist iii<br />
somethii~g d i f f e r e ii t bot11 froin complaceilce which is a delight iii<br />
beauty, aiid also from aiiy beiievoleiice that has the beauty of its objrct<br />
for fouildation. Because it is absurd to say that virtue is priinarily and<br />
first of all the consequence of itself; which inalies virtue primarily prior<br />
to itself . . . . Therefore tliere is room left for iio other coilclusion tlian<br />
that the primary object of virtuous lovc is being simply considered; oi.<br />
that true virtue prirnarily consists, not in lovc to aily particular beiiigs,<br />
because of their virtiie or beauty, iior in gratitude because<br />
they love us; but in a propensity aiid unioil of heart to being<br />
simply considered; exciting a b s o 1 u t e beiievolence, if I may so call it,<br />
to being in general. I say true virtue p r i in a r i 1 y coiisists in this.<br />
For 1 am far from assertiiig that there is ilo true virtuc iii aiiy other<br />
love thaii this absolute benevolence. Berievoleilt being is a secoiidary<br />
object of the virtuous will." Al1 this is quite in thc spirit of Kailt. But<br />
Edwards appears to be more consistent tliail Kant, for the latter, while<br />
liolding natural and perliaps total depravity of man; also holds that mall<br />
is the author of his owii religious aiid nioral life. It is probable that<br />
both Edwards and Iiant overstated man's natural corruptioii. In Kailt<br />
it forms a veritable iriconsistciicy with his philosophy. Edwards would<br />
reply to Kant as follows: „Reasoil shows tliat the first existence of a<br />
principle of virtuc cannot be f rom man himself ilor iii aiiy created being<br />
whatsoever, but must be iniinediately giveil from God; or that othermise<br />
it iiever can be obtained whatever this priilciplc be, whether love to God<br />
or love to man. It must eithcr be froin God or by a habit contracted by<br />
repeated acts. Rut it seems absurd to supposp that the first existence<br />
of holy action should be precedcd by a course of holy action becausei therei<br />
can bc no holy action without a principle of holy incliiiation. These can<br />
be no good done froni love that shall bc tl-ie cause of iritroducing tlie<br />
very existence of l~ve.~~) It would appear from these statements that<br />
Edwards has been too severely criticized by those who hold tliat he lcft<br />
no place for private affcctions, an objection frequently urged against the<br />
system of Kant. Referring to I-Iutchinsoii and I-lume, Edwards says,<br />
„Those scheines of religion or moral philosophy, which, ho~vever well iii<br />
some respects, they mag treat of benevolence to mankiiid. and other<br />
virtues depending on it, yet Iiave not a supremc regard to God, and love<br />
to him, laid as the f o u n d a t i o n , and all other virtues liandled in<br />
connexion with this, and in subordination to it, are not true<br />
schemcs of philosophy, but arv furidameiitally aiid essentially dcfcctive.lLG5)<br />
Edwards recognizes that the natural conscience not only yiclds<br />
the virtues of selfishness, but also virtues that do not have their grouiids<br />
67) Remarks on Theological Controversies. Chap. IV, Par. 49. Cf. The Nature<br />
of True Virtue, Chaps I and 11.<br />
68) Nature of True Virtue, Chaps. 11, 111 and V.
56<br />
Kentean Elements in Jonathan Edivards<br />
in self, but iii a general good will. Still he Iiolds that in iieithcr of these<br />
do we find triie virtue. This arises only iii those minds wlio enjoy aii<br />
inward spiritual light, who have a „relish aild delight in the essential<br />
beauty of true virtue", wlio see that virtue is good for its own salie, good<br />
in itself, aiid thus demands reverence aiid obedience. The Puritan Ed-<br />
~vards holds like the Puritaii Kant that ability is not the rule of duty.<br />
but that the rule is ultimate, absolute, imperative, binding all meii<br />
whether they recognize it or not. „Du sollst, daher du kaiinst." But,<br />
says Ed~vards, I conceive there is a great deal of differente betwceil its<br />
beiiig the duty of a man who is witliout spiritual light or sight to believe<br />
aiid its beiiig his diity to believe without spiritual light oi. ~ight.~~)<br />
Neither self-love nor the love of others enters iiito it primarily but they<br />
are involved iilcideiitally in a supreme love of being in geiieral. Upoii<br />
this primary virtue all others hang and witliout it tliere is iieither<br />
foundation iior suuuort - for the moral life of meii and comniuiiities. It<br />
follo~vs from this as well as from ample evideiice froin Edwarcls's unpublished<br />
manuscripts, that tlie ctliical end is iiot happincss, but peilfectioii.<br />
EIis psychological observatioiis sonietimes imply tlie former, but<br />
liis logical treatment always gives priority to the latter.<br />
In the first cliapter of bis „Reniarks oll Important Theological<br />
Coiitroversies", Edmlards uiifolds by the methocl of analogy a rational<br />
teleology. The world appears $0 him, in esthetic contemplatioii, full of<br />
purpose, atid hc sceks to discover the spccial end of man. „It is exceed-<br />
ing manifest concerning niankind, that God must have made theni for<br />
some end, not only as it is evideiit that God must have iiiade the<br />
world iii geiieral for sonie end, and as man is an intelligeiit, voluntary<br />
agent; but as it is especially manifest f r o ni f a c t that God lias made<br />
mankiricl for some special end. For it is apparent in fact that God lias<br />
inadc the inferior parts of the worlcl for Same end, and that the special<br />
end he made tliem for is to subserve the benefit of mankiiid. Therefore,<br />
above all may it be argued that God has made manliind for some end.<br />
3fan's special eild is some improvemeiit or use of his faculties toward<br />
God . . . . The happiiicss of the greater part of manliind iii their worldly<br />
eiidownments is not great eiiough or durable enough to prove tliat tlic<br />
end of all things in the whole vidible universe is only that happiiicss.<br />
Therefore, nothing else remains, no other suppostion is possible, but<br />
that man's special end is soniething wlierein he has immediatcly to do<br />
with his Creat~r."~~) From this point of view Eclwards draws tlie inference<br />
of a future life, aiid clearly anticipates the views of Paley in<br />
regard to future re~vards and punishments. „Nothing is more manifest<br />
than that in this world there is no such thing as a regular equity, disposing<br />
of rewards and punishmend of men according to their moral<br />
estate. There is iiothing in God's disposal toward men in this morld to<br />
make his distributive justice and judical equity visible, but all things are<br />
--<br />
69) Works, Vol. I, p CXXIX; Letter, Sept. 4, 1747.<br />
70) Theological Controversies, Chap. I, Par. 8 & 9.
Kantean Elements in Jonathan Edwards. 57<br />
in thc greatest confusioii, often the wicked propser and are not in trouble<br />
as other men, etc."il) Even as clearly does Edwards anticipate Kant.<br />
although the latter apparently develops immortality from freedom, while<br />
Edwards builds liis theory upon the desire for perfection. „One gene-<br />
ration of nlen does not come, and another go, and so continually froin<br />
age to age, only that as last therc may be what there was at first, namely,<br />
mankind upon earth.. . . No end is worthy of an Infinite God but an<br />
Infinite end; aild thereforc the good obtained must be of infinite dura-<br />
tion.. . . If it be not so, who shall fix the bounds? . . . . Hence we may<br />
strongly argue the fiiture state: for it is not to be supposed that God<br />
woiild inalie man such a creature as to be capable of looliing upward<br />
beyond cleath aild capable of linowing aild loving him and delighting<br />
in him as thc fountain of all good, which will necessarily increase in him<br />
a dread of anniliilation and an eager desire of immortality; and yet so<br />
order it that such desirc should be disappoii~ted."~~)<br />
F:dwards7s theory of society reminds one of Augustine7s „Dc Civitate<br />
Dei", as well as of tl~e ideals of the Puritan Theocracy, and the Kiiigdom<br />
of Ends of Rai~t. „The nature that God has given all maiiliiilcl",<br />
lie sajs, „arid the circunistaiices in which he has placed them, lead all, iii<br />
all ages throughout thc habitable world into moral government. hiicl<br />
the Creator doubtle~s inteilded this for the preservation of this highest<br />
s~ecies of creatures; otherwise he hab niadie mueh less ~rovision for the<br />
defensc aild prcservation of this specics than of any other. There is iio<br />
kiiid of creature that he has left witliout proper means of its owil preser-<br />
vation. Eut, unless man's own reason, to be improved in moral rule aild<br />
order, be the means he has provided for the preservatioii of man, he has<br />
providecl hiin with ilo means at a11."73) Edwards holds the permaiieilt<br />
possibility of realizing the Kingdom of God on earth among men through<br />
spiritual conpanionsship with God. „In God the love of himself and the<br />
love of tlie public are not to be distinguished as in man: because God's<br />
being, as it were, coinprchends all, his existeiice beiilg iiifiriite, must be<br />
equivalent to universal existente . . . . God and thei creature in tha cma-<br />
iiatioii of the diviile fulness, are not properly set in opposition; or made<br />
the opposite parts of a disjunction. NOT ought God's glory and the crea-<br />
ture's good be viewed as if they were properly and entirely di~tinct."~~)<br />
EdwardU sketches tlie outline of his „De Civitate Dei", in which God aiid<br />
his people are associated through con~ersation.~j) By conversation he<br />
meails intelligent beiilgs expressing their miiids one to ailother, in words<br />
or other signs, intentionally directed, whose immediate aild main dcsigii<br />
is to be significations of tlie mind of him who gives them. It is needful,<br />
in ordqr to a proper moral govcrninent, that the ruler should enforce thc<br />
rules to ille society hy threatening just punishments and promising the<br />
71) Theological Controversies, Chap. I, Par. 11.<br />
72) Ib. Pms. 13, 16 & 19, Works, Vol. 11, PP. 514-815.<br />
73) Theological Controversies, Chap. I, Par. 4; Works, Vol. 11, p. 512.<br />
74) God's Chief End in Creation, Chap. I, Sec. 4, Works, Vol. 1, p. 104.<br />
7 5) Miscellaneous 0 bservations, Chap. VIII.
58 Kantean Elements in Jonathan Edwards.<br />
inost suitable aiid wise rewards. It is neeful iii a moral kingdoni, not in a<br />
ruined and deserted state, that there sliould be conversatioii betwecil tlie<br />
governor aild the governed. „So far as I sre all moral ageiits are coii-<br />
versablc agents. It secins to be agreeable to the nature of moral ageiits,<br />
and their state in thc universal system, that we observe iioile wit,hout it;<br />
and there are 110 beings that havc eveii a semblance of intelligeilce aiid<br />
will but posses the faculty of conversation as iil all kinds of birds, beasts,<br />
and even insects. So far as there is aily appearance of something iike a<br />
rniiid, so far they give sigiiifications of their minds oize to another in<br />
somethiug likr conversation among rational creatures; and as we risc<br />
biglier iii the scale of beings, we do not see that an iiicrease of periectioii<br />
djminishes the need or propriety of iiztercourse of this Bind, but aug-<br />
rnents it. But especially do we find coiiversation proper and requisite be-<br />
tween intelligent creatures concerning moral affairs which are most im-<br />
portant . . . . Aforalagents are social ageilts; affairs of morality are affairs<br />
of society. And ii' so, what reason cail be given why there should be iio<br />
iieed of conversatioii with tlie head of society? The head of society, so<br />
far as it is united with it on the moral ground, is a social head, the head<br />
beloilgs to the society as the natural head belongs to the bocly . . . . Tlie<br />
ground of inoral beliavior aild of moral government aiid regulation of<br />
society is by inutual intercourse and social regards. The social mcdiuin<br />
or union aiid connectioii of the meinbers of the society aiid the being of<br />
society as such is conversation, and the wcll-bciiig and happiness of<br />
society is fricndship . . . . Conversation of God and inanl
60<br />
Kantean Elements in Jonathan Edwards.<br />
we ask. And such gestures aild manner of external behavior in the<br />
worship of God which custom has made to be significations of humility<br />
and reverence can be of no further use than as they have somc tendency<br />
to affect our own hearts and the hearts of other~.~~) The saine is true<br />
of a11 other elements of worship, such as sacraments, preaching, and<br />
singing. Edwards wouid avoid the dailgers of enthusiasin and ultra<br />
revival methods by pointing out tlie defects of a religion of feeling arid<br />
asserting that .the understanding plays some part in true religion. „As<br />
there is no true religion wliere there is nothing else but affectioil, so<br />
there is no true religion where there is no r e 1 i g i o u s a f f e c t i o n.<br />
As, oii the one hand, there inust be light iii the understandiiig as well as<br />
an affected, fervent heart; for where there is heat without light<br />
there can be nothing divinely or heavenly in that heart: so, on the other<br />
hand, where there is a Bind of light without lieat, a liead stored with<br />
notions aild spccillatioiis witli a cold, unaffected heart, there can be<br />
nothing clivine in that light, that knowledge is no true spiritual knowledge<br />
of divine thing~."~l) This leads Edwards to point out in detail<br />
certain defects of the affcctions and show that while religion rests n~aiilly<br />
on thc affcctions, the eleinent of light iil the understanding has an important<br />
placc in true religion.") He is convinced that „assurance is not<br />
to bc obtainecl so much by self-examination as by action". „From what<br />
has been said it is manifest that Christian practice of a holy life is a<br />
great and distinguishing signof trueandsavinggrace. But<br />
I may go further and assert that it is the chief of all the signs of grace,<br />
both as the evideilce of the sincerity of professors unto others and also<br />
to their own consciences."") „The first objcctive grouiid of gracious<br />
affcctions is the traiiscendentally exelleilt and amiable nature of diviile<br />
thirigs as they are in thernselvcs; and not any conceivrcl relation thej<br />
bear to s~lf or self-intere~t."~") „That intelligent being whose will is<br />
truly high and lovely, he is nlorally good or excellent. This moral<br />
excellency when it is true and rcal is h o 1 i n e s s. Therefore holiness<br />
comprehends all the true moral excellency of intelligent beings: there<br />
is no other true virtue but real holiness. Holincss comprehei~ds all the<br />
truc virtue of a good man; his love to God, his gracious love to men,<br />
his justice, his charity. Holiness in man is but an image of God's holiness.<br />
13'013- persons, in the excrcisc oP holy affections, love divine things<br />
primarily for thcir holiness, thcy love God in thc first place for the<br />
baauty of his holiness or nloral perfections, being supremely amiable in<br />
itself.. . . The grace 01 God inay appear lovely two mays: either as<br />
b o n um u t i 1 e , a profitable good, what greatly serves rny interest<br />
and so suits me; self-love, or as b o n u m f o r m o s u m, a beautiful<br />
good, in itself, a part of the spiritual excellency in the divine nature.<br />
80) Part I, Sec. 2 : 9.<br />
81) Part I, Sec. 3 : 1.<br />
82) Part 11. Sec. 1 : 12.<br />
83) Part 111, Introduction; Part 11, Sec. 12.<br />
84) Part 111, Sec. 2.
Kantean Elements in Jonathan Edwarils. 6 1<br />
In the latter respect it is that true saiiits havc tlieir liearts affected<br />
aild love captivated by the very grace of God.'(8?)<br />
There is an attempt oii the pait of Edwards to synthesize the differeiice<br />
betmeen the uilderstanding and will by the mediation of beauty<br />
or excellency whicli, throughout his entire philosopliy, plays an important<br />
role. Kant's S p i e l d e r I< r a f t e is promiiieiit in the thought of<br />
Edwards. With Aristotle and Kant he holds that % pw~ in, the pure<br />
contemplation of God or things eternal, transforms and unifies<br />
the world. There is an element of the understailding in the<br />
activities of will. aiid an element of the will iii the oucratioils of tlie<br />
understandiiig. Tliis interfusion is recognized as a sense of beauty,<br />
proportioil, relation, totality, without whicli tlie things of the niind aiid<br />
tha world become chaotic and unintelligible. „Since the world would bc<br />
altogether good for nothing without intelligent beings, so intelligent<br />
beings would be altogethcr good for nothiiig exccpt to contemplate the<br />
Creator. I-Ience we learn that devotion and not mutual love, charity,<br />
justice beneficence, etc., are the liighest end of man, and devotion is his<br />
principle business. For all justice, beneficence, etc., are good for nothiiig<br />
without it or to 110 purpose at all, for these duties are only for the<br />
advancement of the gerat business, to assist each other mutually to it.16)<br />
Tliis is quite in the spirit of the Platonic e~icO~ and Spinoza's ,amor<br />
iiltellectualis Dei'. From this point of vicw Edm~ards says, „Holy affec-<br />
tions are not lieat without light, but evermore arise from sonie infor-<br />
mation of t2ie understandiiig, some spiritual instruction that the mind<br />
receives, some light or actual knowledge . . . . liiiowledge is the Bey<br />
tliat first opens the hard heart, enlarges the affectioiis, aiid opens the<br />
mray for man iilto the kingdom of IIeaven.. . . Now there are many<br />
affections whicli do not arise from any liglit in the understaiiding, which<br />
is a sure evideiice that these affectioiis are not spiritual, let them be<br />
ever so high.. . . Mcn ascribe many of the workiiigs of their minds, of<br />
which they have a high opinion, to the special immediate influence of<br />
God's spirit, and are so miglitily affected with their privilege. . . ."<br />
„Take away all the moral beauty and sweetness in the world and tlie<br />
Bible is left wholly a dead letter, a dry, lifelcss, tasteless thing . . . . He<br />
that sees the beauty of holincss or true moral good sees tlie greatest and<br />
most important thing in the world which is the fulness of all thiiws<br />
without which all the world is empty, yea ,morse than nothing.<br />
Cnless this is scen nothing is Seen tliat is worth tlie seeing; for therc is<br />
no other true excellency or beauty. Uilless this be uiiderstood nothing<br />
is uiiderstood wortliy of the exercise of the noble faculty of the under-<br />
~tanding."~~) Such affectioiis are attcnded with the reality aild certainty<br />
of divine thing~.~~) Sainthood lies in beautiful symmetry and<br />
proportions in character atid conduct. The beauty of holiness is maiii-<br />
85) Part 111, Sec. 3.<br />
86) E. C. Smyth in the Edwards Centeiiary at Andover, Appendix I, 11. 35.<br />
87) Part 111, Sec. 4.<br />
88) Pmt 111: Sec. 4.
62<br />
Kantean Elements in Jonathan Edwards.<br />
fested in Christ, who is the synthesis of man, nature and God, of will<br />
and understanding.<br />
Edwards and Kant make no radical distinction bet~veeii morality and<br />
religion. They have essentially thc Same doctrines of sin and of grace<br />
or justification. Their conceptioiis of God and man are the same.<br />
Every revelation talies the form of an inner principle which is valued<br />
by its practical conformity to the divine law or excellency. Both agree<br />
that Jesus is the logos of God, the ideal of humanity. Both agree with<br />
Locke that church and state ought to be separate institutions, and that<br />
the Church oi God is a commuriity, living in fraternal relations and<br />
seeking to make the will of God its will. Both agree in the immanent<br />
sovereignty of the will of God in nature and in human history; that the<br />
one great evidence of morality and religion is not the creeds but the<br />
deeds of men, in a will directed steadily to the g o o d. But Kant is<br />
more cold, formal and schematic than Edwards; allows less play of the<br />
feelings. Kant's sense of God's immanent sovereignty is not so over-<br />
whelming as is that of Edwards. If Edwards may be charged tvith<br />
making God selfish, the Same count may be made against Kant in<br />
regard to man. Still, in both instances the Charge is unjustifiable on<br />
an wider view, for, with both, the complete and pcrfect self is God.
Ein schwedischer Aufklärungsphilosoph.<br />
Von<br />
Reinhold Geijer, Upsala.<br />
n der Geschichte der schönen Literatur Schwedens wird ein<br />
scharf inarliierter und ganz hervorragender Platz eingcriommeil<br />
von dem Dichter und Literaturkritiker C a r 1 G u s t a f a f<br />
L e o p o 1 d (1756 bis 1829)) dem intimen Freunde des Königs<br />
Gustav 111. und dessen ~~ieljährigem Privatseliretär, welcher, zumal<br />
nach dein Tode J. 11. EC e 11 g r e 11 s (1795), als der eigentliche Führer<br />
der französischen oder auch sogenannten aliademischen Gcschmacksrichtung<br />
allgen~ein anerkannt war. Demselben 1,eopold gebührt aber<br />
auch ein danlibares Andenken besonders wegen seiner umfassenden und<br />
jedenfalls in mehr als einer Hinsicht bedeutenden Wirlisamlicit als<br />
philosophischer Forscher und Schriftsteller.<br />
Ein Jünger von Locke und Shaftesbury, Pope und Volt<br />
a i r e , debütierte Leopold als Philosoph mit einer recht scharfen,<br />
wenn auch etwas jugendlicl~ unreifen Rezension iibcr I< a n t s soebeil<br />
von D a ri i e 1 I3 o E t 1 i u s ins Schwedische übersetzte G r u n d -<br />
legung zur Xctaphysik der Sitten. Und auch späterhin<br />
hat er weder Kailts eigene Philosophie im groiseii und ganzen sich aneignen,<br />
noch rnit der von F i c h t e und S c h e 11 i n g vertretenen<br />
Transzendentalphilosophie irgcndwie sich befreunden können. Indessen<br />
konnte er doch nicht umhin, von seiten Kants, den er nie aufhörte zu<br />
studieren, nach und nach und immer starlier beeinfluist zu werden, wie'<br />
sich bald zeigen wird. Zehn Jahre vor seinem Tode blind geworden,<br />
widmete er das letzte Dezennium seines langen und rastlos tatigen<br />
Lebens - während<br />
„Die Harfe init den reinen Tönen<br />
Still in seinem Arme schlief",
64 Ein schwedischer AufklSrungsphilosoph.<br />
um ein Zueigiiuiigsgcdicht an Lcopold von E s a i a s T C g 1 b r<br />
zu zitiere11 - mit wachsender Vorliebe einer rein philosopliischcn Cc-<br />
danlreiiarbeit, deren reifste Früchte posthum erschiciien uilter dem Titel:<br />
Ei1 blind mans besinningar i f ilosof ien. DieserIV.Baiid<br />
von C. G. a f 1, e o p o 1 d s S a m 1 a d C S k r i f t e r enthalt zwei in sich<br />
zusammeilhaiigeridc Reihen kritischer Studieii, die eine über die ICaiitsclic<br />
Philosopliie und die andere über die Schclliiigsclie, uiid aufsrrclein iioch,<br />
etwa das letztc Viertel (90 S.), S t y c lr e 11 u r D o k t o r G o d in a ii s<br />
P o r t f ö 1 j. Dieser fingierte Nachlais Dr. Godnians (oder Gutmaiiiis),<br />
in seiner ebenso lionzciitrierteri uiid prägnanten wie durchaus populären<br />
Form vielleicht das für den Verfasser am ineistcn und besten Charalite-<br />
ristische aus seinem eigciien philosophisclieii Nachlais, soll hier zuiii<br />
nächsten und eigentlichen Gegenstand meiner Erörterung gemacht<br />
werden, ob ich mir gleich vorbehalte, dann und waiiii auch aus seinen<br />
anderen Schriften herbeizuholen, was ich gebrauche, uni so ein richtiges,<br />
einigerniaisen vollstäiidiges und lebendiges Bild von Leopolds philoso-<br />
phischer Wclt- und Lcbensaiisicl~t zu geben.<br />
Ich schicke eine orientierende Übersicht über die „Philosopliisclieii<br />
Fragn~eiitc" voraus, dic Leopold in der Bricftasclic des Dr. Godmaii<br />
gefunden zu haben vorgibt.<br />
Zuerst begegnet uns hier D o lr t o r G o d in a ii s B r i e f an eiiien<br />
alten Freund uiid Studiciiliameradeii aus jüngeren Jahren, worin der<br />
Rriefschreiber, nach einer leicht ironisierenden Persifflage der untereinander<br />
recht vcrschiedeiieii Art der Leibiliz-Wolffschel~,, Kailtscheil<br />
und Fichte-Schelliiigscheii Schulc den allgemeiiicn Begriff und das<br />
Wesen der Philosophie zu definieren, seine eigene Auffassung von der<br />
eigentlichen Aufgabe und allgemeinen Art der echten, einzig gcsundeii<br />
und wahren Philosophie cntwicliclt.<br />
Nach diesem in Briefform gegebenen Programin, das ich den<br />
P r o 1 o g nennen will, kommt der Ordnung nach zuniichst, als eine Art<br />
dramatischen Intermezzos, unter dem Namen der 15 o r g c 11 p r o in e -<br />
n a d e , ein Dialog zwischen Dr. G. und demselben ebeiier~vähiiteil, jetzt<br />
auf Besuch bei ihm auf dem Lande weilenden Freunde. Dieser ist iiunmehr<br />
als Lehrer der Philosophie an der Universität ripsala aiigestellt,<br />
wo er immer mehr die daselbst zu jener Zeit lierrscheiide Fichte-Schcllingsche<br />
sog. Transzendeiltalphilosophie in sich aufgeiloinn~eil hat und<br />
in ihren Bann geraten ist. Und das Gespräch entwickelt sich so ungezwungen<br />
auf Dr. G.'s Seite zu einer immer eingeheiidercii Kritili dieser<br />
Art von Philosophie, einer ICritik, die darum nicht weniger treffeiid<br />
wird, weil sie in ihrem scherzhaften Witz manchmal zu einer wo111 nicht<br />
ganz uiiabsichtlichen Karrikaturzcichnuizg ausartet.<br />
Erst hiernach, also wolil vorbereitet, folgt das eigentlich? S t ü C k :<br />
eine mehr streng wissenschaftlich gehaltene und in mehrere einzelne Ab-<br />
schnitte geteilte Abhandlung V o n d e r R e a 1 i t ä t d e r E r Ir c n 11 t -<br />
n i s i n d e r P h i 1 o s o p h i e - d. h. in freierer Umschreibung eine<br />
Untersuchung über die allgemeine Aföglichlieit, die subjektiven Bediii-
Ein schwedischer Aiiflrl%rtingsl~hilosoph. 65<br />
guiigen und liierdurcli gegebenen (recht engen) Grenzen der philocophi-<br />
sehen Erkenntnis. Aber diese ihrer Anlage nacli erkenntnistheoretische<br />
Untersuchung gleitet wie von selbst hinüber auf das ethisch-religiöse<br />
Gebiet und mündet hier in einen Versuch aus, naher zu erörterii und zu<br />
beantworten, was dcr Verfasser D i c g r o l s e P r e i s f r a g e d e r<br />
1' h i 1 o s o p li i e nennt ; - worauf dann die ganze Schriftenreilie mit<br />
einein besondcren A n 11 a ii g ü b c r d a s G e f ü h 1 s p r i n z i p , ciiieln<br />
ähnlich dein Prolog in Briefform abgefalsten E p i 1 o g , abgeschlossen<br />
wird.<br />
Um möglichst bald dem Leser eine wenigstens provisorisclic Vor-<br />
stellung von dieser Leopold-Godmailsche~i Philosophie, ihrer besonderen<br />
Beschaffenheit und ihrein iilnersten Geist, zu geben, seien hier sogleich<br />
einige kurze Auszüge aus dem crstgenaiinten, cinleitendeii und prograin-<br />
iiiatiscl-ien - und dalicr als Prolog bezeichneten - Briefe mitgeteilt.<br />
I
66 Ein schwedischer Auflilärungsphilosoph<br />
des Vorliergesagteii dahin zusammengefaist wird, dais die wahre, Philo-<br />
sophie, d. h. die einzige, die Dr. G. für sein Teil billigt und betreibt,<br />
nicht so sehr eine streng demonstrative Wissenscliaft von den letzten<br />
Prinzipien des Alls ist und sein will, als vielmehr wesentlich und liaupt-<br />
sächlich eine „moralische Denkweise", oder noch lrürzer und prägnanter<br />
ausgedrückt, „weniger Erlieniitnis- als W e i s h r i t s 1 ehr e ".<br />
Bevor ich auf meinen eigentlichen I-lauptgegenstand, der ja ebeii<br />
diese „Weisheitslehre" Dr. Godnians oder, genauer gesagt, Leopolds<br />
eigene ihm in den Mund gelegte s i t t 1 i c li - r e l i g i ö s e L e b e n s -<br />
a n s c h a u u 11 g ist, naher eingehe, dürfte wohl iil Anbetracht des<br />
intimen Zusammenhanas. in den diese Lebensweisheit mit der vorher-<br />
-<br />
gehenden rein erkenntnistheoretischen Untersuchung gebracht ist, zn-<br />
~itächst etwas über diese zu sagen sein.<br />
1,eopolds E r li c ii ii t ii i s t h e o r i e ist, wenn man so will, elilelc-<br />
tiscli, iiisofern sie ihre historischen Anflrnüpfungspunlrte nicht blois<br />
bei ICant, sondern auch bei Locke wie auch IIume hat. Dieser Eltlekti-<br />
zismus liindcrt ihn aber gleicliwohl nicht, mit Erfolg seine kritische<br />
Selbstindiglieit gegenüber allen diesen dreieri je von ihm hoch bewun-<br />
derten und fleiisig studierten Bahnbrechern innerhalb des erlienntilis-<br />
theoretischen Forschungsgebietcs zu bewahren, wozu nebenbei bemerkt<br />
werden mag, dars die gegen Icaiit gerichtete Iiritik später mit wacliscii-<br />
der Schärfe und treffender Kraft gegen dessen nkchste Nachfolger<br />
Fichte und Schelling sich -wendet. Im Innersten dürfte jedoch Leopolds<br />
erkenntnistheoretischer Gcdanlieiigang ami meisten von IIume beein-<br />
fluist worden oder mit ihm vermrandt sein und kann somit als ein in<br />
mehreren Richtungen ziemlich weit getriebener S lr e p t i z i s m u s<br />
gelten.<br />
Seine iiuiserste Grenze erreicht wohl dieser a 11 g ein e i n e Skep-<br />
tizismus, wenn er Dr. G. mehr als einmal ausdrücklich erkläre11 läist,<br />
dais er einerseits zwar selbst durchaus nicht einer so extravagant spelru-<br />
lativen IIypotliese beitreten will, anderseits aber auch nicht einmal<br />
die allerextremste Form einseitig subjektiven Idealismus strikte wider-<br />
legen zu können glaubt, niimlich die - nach seiner in dieser Hinricht<br />
doch wohl etwas übereilten Auffassung - ebeii von Fichte und Schel-<br />
ling typisch repräsentierte Ansicht, dais der ganze ltoiilrrete Inhalt des<br />
inenschlichen Bewulstseins nur aus „Traunzbilderii" oder „Gedaulien-<br />
visionen" bestände, die, uns unbewuist von unserer eigenen produl~tiven<br />
Einbildungskraft erzeugt, folglich aller äuiseren objektiven Ent-<br />
sprechung in irgend einer Art transzendenter RealittLten oder sog.<br />
„Dinge an sich" ermangeln. Eine solche Vcrneinung oder Bezwciflung<br />
der „Realität der auisercn Dinge" kann iiiimlich, heilst es, nicht wider-<br />
legt werden, weil völlige Gewiisheit in dieser IIinsicht eine „immediate<br />
Perzeption" des Übergangs des iiulseren Objekts zur inneren subjeli-<br />
tiveii Vorstellung s~oraussctzen würde, also eine „Wahrnehmung des<br />
Objekts schon vor der Vorstellung, was auf keine Weise uns zuteil ge-
Ein schwedischer AufklSlrungsphilosoph. 67<br />
worclei-i ist." Und noch weiter wird ein ähnliches Eäsoni-ienient auch auf<br />
das eigene einheitliche Wesen des wahrnehmenden Bewufstseins selbst<br />
oder der Seele angewendet, d. h. mit anderen Worten auf die von Hume<br />
und Kant erörterte Frage, ob der Substaritialitätsbegriff überhaupt auf<br />
dem Gebiete der inneren Erfahrung Anwendung finden kann oder nicht.<br />
So weit brauchen wir indes nicht der skeptischen Richtung der<br />
Leopold-Godmannschen Erkenntnistheorie zu folgen, vielmehr dürfte es<br />
für unsern gegenwärtigen Zweck völlig genügen, wenn wir uns daran<br />
halten, dais er ganz entschieden die Möglichkeit aller streng wissen-<br />
schaftlichen 31: e t a p h y s i li oder eigentlichen speliulativ-theoretische11<br />
Philosophie bestreitet, und wenn ich da zugleich in gröister Kürze an-<br />
zudeuten versuche, wie Leopold auf eigenem Wege zu seinem in dieser<br />
EIinsicht so stark prononcierten A g n o s t i z i s m u s gelangt.<br />
Unter „Realität der Erkennti-iis" wird dasselbe verstanden wie<br />
wirkliches Wissen in dieses Wortes allerstreiigster Bedeutung als eine<br />
ihrer objektiven Wahrheit absolut gewissen Erkenntnis. Und soll nun<br />
diese Realerkenntnis philosophisch sein, so müiste sie ja von den letzten<br />
Gründen und dem innerstw Wesen der Wirklichkeit handeln. Eines<br />
solchen TS'issens ist aber nach Leopold die schwache menschliche Ver-<br />
nunft nicht fkhig; oder mit anderen Worten: keine „philosophische<br />
Realerkenntnis" kann, sei es blois aus dem Denkvermögen als solchem<br />
oder auch nur aus cliesem im Verein mit unserer äuisereii sinnlichen<br />
Erfahrung, hergeleitet werden.<br />
Nicht aus dem „bloisen Denlivermögen" oder schlecht und recht<br />
aus unserer Vernunft (oder unserem Verstand) allein. Denn diese<br />
nlenschliche Vernunft besitzt in Wirlclichlieit niclit mehr als ein einziges<br />
ihr ursprünglich innewohnendes Gesetz, nämlich das höchste Grund-<br />
gesetz cler formalen Logik, das allen wohlbekannte Gesetz des Wider-<br />
spruchs (piineipium contradictionis). Neben diesem rein<br />
formalen und insofern inhaltsleeren Prinzip findet sich, wie Dr. G.<br />
uns versichert, kein anderer damit vergleichbarer oder ebenso<br />
„absolut notwendiger" Grundsatz. Und hieraus wird dann ohne m7ei-<br />
teres cler Schluis gezogen, dais alle unsere sog. inetaphysischen wie<br />
auch naturwissenschaftlichen Begriffe und Grundsätze (mit Ausnahme<br />
allein des Prinzips des Widerspruches selbst) ihren besonderen Inhalt<br />
letzthin „einer bestimmten Umgebung von Gegenstäi-idei-i zu entnehmen<br />
haben, die aufzufassen, zu vergleicheil und zu beurteilen sind", oder<br />
kurz ge~sagt, dais keine menschliche Erkenntnis etwas anderes oder mehr<br />
sein kann als „eine in Begriffen und Tirteil~ii aufgefafste Erfahrung".<br />
Da nun diese Betracl-ituiigsweise folgerichtig ausdrücklich auch auf<br />
Kants sog. Kategorien und ,,reiiicn" Grundsatze angewendet wird,<br />
denen der Anspruch auf apriorischen Ursprung mit daraus folgender<br />
strenger Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit dabei iii summarischer<br />
Weise aberkannt wird, und die also nur als auf dem Wege der generali-<br />
sierenden Abstraktion oder Induktion gewonnene Ausdrücke für die<br />
empirisch gegebenen allgemeinsten Formen und Gesetze oder, wie es<br />
5"
68 Ein schwedisclier AufklLrungsphilosol~h.<br />
auch heilst, Grundbed~iiigungen unserer siimlicheii Ersclieiilungswelt<br />
gelten dürfen, so schliefst dieses ja, in1 Vorbeigehen bemerkt, offen-<br />
bar in sich, dais Leopold von I
Ein schwedischer Aufkl5rungsphilosoph. 69<br />
Nach dieser in all ihrer Knappheit, wie ich glaube, doch ziemlich<br />
vollständigen Zusamn~enfassung der leitenden Gesichtspunlrte und<br />
Grundgedanlren in Leopolds skeptisch agnostischer Erkenntnistheorie<br />
gehen wir nun zu der „greisen Preisfrage der Philo-<br />
s o p h i e " iiber, die sogleich folgendermaisen formuliert wird: „Gibt<br />
es wohl im Nenschengeist ein Prinzip der Erkenntnis, das die Unzu-<br />
länglichlieit der Vernunft ersetzt?''<br />
Um den eigentlichen Zweck und den inneren Sinn dieser Fra~e<br />
',<br />
recht zu verstellen, müssen wir offenbar erst wissen, in welcher oder<br />
welchen I-Iinsichten die Unzulänglichkeit der Vernunft (oder des Ver-<br />
standes) eines Ersatzes b e d a r f. Und hierüber haben wir ja schon Be-<br />
scheid erhalten, wenn wir sahen, wie Dr. Godman in seinem ersten Brief<br />
als die einzige groise Angelegenheit des Mcnschen die dreifache Frage<br />
hinstellte, was er mit Rücksicht auf seine t o t a 1 e B e s t i m m u n E<br />
zu d e n k e n, zu t U 11 und zu h o f f e n hat, und zugleich andeutete,<br />
dais wir hierbei wohl uns an einer Gewiisheit anderer Art als der des<br />
streng logischen Beweises, nämlich der GewiCsheit der Üb e r z e u -<br />
gung oder der moralischen Denkungsart genügen lassen<br />
könnten. Dasselbe Thema wird nun wieder aufgenommen, variiert und<br />
dahin zusammengefalst, dais was wir unbedingt brauchen und nicht ent-<br />
behren können, in e r s t e r Linie das ist, unsere Pflichten zu kennen,<br />
d. h. nUit anclcren Worten, den Unterschied zwischen Rccht uiifi Unrecht,<br />
Gut und Böse in spezifisch-moralischer Bedeutung, und d e m n a c h s t ,<br />
und in untrennbarem Zusammenhang hiermit, auf eine völlig über-<br />
zeugende Weise ebensosehs den Glauben an einen persönlichen Gott<br />
als clsii Schöpfer und die Vorsehung der Menschen und der ganzen Welt<br />
als auch clie ihrerseits hierauf ruhencle Hoffnung auf die Unsterblich-<br />
keit der Seele verteidigen zu können. Dais die beiden letztgenannten<br />
Probleine auf rein theoretischem Wege, sei es „aus reiner Vernunft''<br />
oder vermittels aus Tatsachen der ä u i s e r e n Erfahrung gezogener<br />
Sclilüsse, nicht befriedigend gelöst werden können, ist ja im Vorher-<br />
gehenden zur Genüge dargelegt worden. Und dais das Gleiche, wenn<br />
möglich in noch höherem Grade, von der erstgenannten und doch wohl<br />
für uns allerwichtigsten Frage nach dem, was wir tun und nicht tun<br />
sollen, gilt, werden wir sogleich Dr. G. näher entwickeln hören. Genug,<br />
gerade in diesen unseren höchsten Angelegenheiten, betreffs deren doch<br />
„die Natur dem Sfeuschenwescn notdürftiges Licht schuldig war", wer-<br />
den wir von Vernunft und äuiserer Erfahrung im Stich gelassen. Und<br />
die Preisfrage dreht sich also darum, ob wir im Nenschengeist einen<br />
„noch tieferen Grund" finden können, der hier als „Ersatzprinzip"<br />
dienen kann.<br />
Und die Antwort erhalten wir unverzüglich in stark konzentrierter<br />
Form f olgendermarsen : „Je mehr man darüber nachdenkt, unisomehr<br />
wird man finden, dafs wir wirklich ein solches (Ersatzprinzip) in jener<br />
wunderbaren Gemütsbeschaffenheit besitzen, die uns durch die Erfah-<br />
rung des Gefühls Offenbarungen des absolut Vortrefflichen in Güte,<br />
Vernunft und Gerechtigkeit gibt. Denn man sage, was man will, zwingt
'70 Ein schmeclischer Aufkl5ru11gsphilosopli.<br />
uns nicht das bloise Gefühl des höchst Vereliruiigswürdigei1 iii diesen<br />
Eigenschaften, sie uns nicht nur als mit der ursprünglichen Allliraft<br />
unbedingt verbunden, sondern auch dcn ganzen Naturplaii als einen un-<br />
fehlbaren Ausdrucli derselben zu denlien? Aus diesen eineil Priiizip<br />
folgt alles." Schon eine flüchtige Analyse dieser prliliminären Ant-<br />
wort auf dic aufgestellte Preisfrage dürfte genügen, uni. darin wenig-<br />
stens die wichtigsten I-Iauptl~unlite von Dr. Godmaiis Weishcitslehre zu<br />
eiitdeclien und zu unterscheiden. Indessen will ich nun versuchen, so<br />
kurz und klar wie inöglich cliese Hauptpunkte einen nach dcin aiidern<br />
besonders herauszuheben und genauer zu bcstiinmen.<br />
1. Es gibt gewisse unbediiigtc untl allgemciilgültige<br />
s i t t l i c h e L e b e 11 s W e r t e oder Ideale einer ..absoluten Vortreff-<br />
lichkeit", melche als solche zunächst in der Form eines eigeiitumlicilen,<br />
von aller sinnlichen Lust oder Unlust wesentlich verschiedenen Gefülils<br />
hervortreten und sich offenbaren, welches Gefühl, in dein 3Iaise als es<br />
ungetrübt und unbeirrt ist, untrüglich immer mit seinen1 stillen Bei-<br />
fall schon die bloise Vorstellung gewisser Handlungen oder, gcnaiier<br />
gesagt, die inneren Handlungsn~otive selbst begleitet und ebenso mit<br />
3liIsbilligung, Verachtung und Abscheu gewisse anderc, den ersteren<br />
widerstreitende EIandluiigen und I-Iandlungsmotive von sich stöist. Und<br />
ferner 2., eben weil dieses sog. M o r a 1 g e f ü h 1 solcherweisc eine ganz<br />
unbedingte odcr ab s o 1 u t e Wertung in sich schlierst oder selbst dar-<br />
stellt, kündigt es sich als höchstes Ge setz oder Regel für das freie<br />
Willcnsleben aller damit ausgcrüstaten Wesen an - es verlangt iiämlich<br />
Gehorsam gegenüber seinen1 billigenden oder miisbilligei1deii Urteil -<br />
und ist so der innerste subjektive Grund oder die Wurz c l a 11 e r<br />
s i t t 1 i c li e 11 V e r p f 1 i c h t U n g und alles sittlichen Lebcns über-<br />
haupt. Damit aber ist es 3. offenbar auch die einzige uns zugäi1gliche<br />
Urquelle aller Erlieniitnis unserer Pflichten und so das eigentliche<br />
p r i n c i p i u ni c o g 11 o s c e n d i aller mehr oder weniger streng<br />
wissenschaftlichen Sittenlehre.<br />
Da in diesem Zusammenhang der Akzent offenbar am stärksten auf<br />
dem letztgenannten Punkt liegt, erachte ich es für angemessen, ver-<br />
haltnismiiisig ausführlich darzulegen, wie dieser motiviert wird. Wollte<br />
jemand hier den Einwand versuchen, dais „die hohe Vortrefflichkeit<br />
der Güte und Gereehtiglieit selbst'' sich uns „nur durch das eigene<br />
prüfende Urteil der Vernunft" offenbaren würde, so antwortet Dr. G.<br />
hierauf, wie mir scheint mit allem Recht, folgendes: „Die Vernunft<br />
kann in Wirlrlichlreit nicht über den Wert einer Sache urteilen, auiscr<br />
auf Grund ihrer Dienlichkeit zu einem Zweck", und folglich über den<br />
Zweck selbst nur, insofern dieser seinerseits das Mittel für einen höheren<br />
Zweck darstellt usw. „Was a n si i c h s e 1 b s t gut und vortrefflich ist,<br />
ohne jede weitere Rücksicht auf etwas anderes, das festzustcllen besitzt<br />
die Vernunft (d. h. der Verstand) kein Vermögen; das muis uns durch<br />
das Gefühl bekannt gemacht werden, dessen unmittelbares Zeugnis<br />
darüber stets jede solche Vorstellung begleitet. Schon im Bereich der
Ein schwedischer AufklBrui~gsphilosoph. 71<br />
Sinnlichkeit stellt jedes liörperliche Vergnüge11 ein solches unmittelbar<br />
Gutes dar, wozu die Vernunft wohl die Mittel, insofern sie dazu beitragen,<br />
gut finden, niclit aber ohne I-Iilfe des Gefühls dem Gegeilstaiid<br />
selbst einen Wert geberi lrann. Höher hinauf begegnen wir den reineren<br />
Geiiüsseii des Geiotes, edler Kunst, Erlieniitnissen, lichten Gedanlien.<br />
Noch höher hinauf Verdiensten und Tugenden." Für das Deillivermögen<br />
blois als solches oder isoliert voll allen Ankiiüpfuilgspuiikteii<br />
iiinerhalb des Gefühlslebens würden offenbar Pflicht und Sünde,<br />
Tugencl iiiid Laster niemals eine andere Bedeutung bekommen köiineri<br />
als die mehr oder weniger zweckmäisiger oder zweckwidriger, iiu t z -<br />
1 i c h e r oder s c 11 ä d 1 i c h e i IIaiidlungsweisen uiid Eigenschaften.<br />
Und ~venn nun nichtsdestoweniger der Pflicht und Tugend wenigstens<br />
von den meisten Meiisclieii ein durchaus e i g e 11 e r , selbständiger, mit<br />
jedem andereii unvergleichlicher und zugleich allgemeingültiger Wert<br />
zuerkannt wird, so kann diese merkwürdige Tatsache nach Dr. G. nicht<br />
U<br />
anders erklärt werden, als durch „ein dementsprechei~des und es beliundendes<br />
Gefühl, das durch seine Natur von diesem I-Iöchsten und absolut<br />
Wertvollen Zeugnis ablegt und mit einer und derselben Vorstellung<br />
stets ein und dasselbe Zeugnis vei-bindet". Kurz ausredrückt also. alle<br />
moralischen Werturteile müsseii sich lctzthin auf riichts anderes als unser<br />
moralisches Gefühl gründen, wenn es auch spiter Sache des über die<br />
unmittelbare Entscheidung dieses Gefühls iii verschiedenen Fällen<br />
reflektierenden Gedankens ist, diese Werturteile in die Form abstrakter<br />
Gesetze, Sitteilregeln oder sog. Maximen zu bringen, was auch so ausgedrückt<br />
werden kann, dais die Aufgabe der Vernunft hierbei sich<br />
darauf beschränkt, „den Inhalt des nioralisclien Gefühls iii Begriffe zu<br />
fassen und verständlich zu f ormiilieren".<br />
4. Seine eigene Auffassung von dem hauptsächlichen Inhalt dieses<br />
lloralgefühls oder, was ganz auf dasselbe hinauskonimt, des dariii sich<br />
offeribarendeii sittlichen Ideals hat Dr. Godmaii (in seinein Anhang über<br />
das Gefühlspriiizip) näher so formuliert: „Solcher Offenbaruiigen des<br />
absolut Vortrefflichen gibt es für den I\llenschengeist nur drei, namlich<br />
erstens die der G ü t e , die mit ihrem Wohlwollen die ganze lebende iind<br />
fühlende Schöpfung umf afst ; sodanii die der V e r n u n f t , die nacli<br />
der Regel möglichster Richtigkeit die Ausübung der Güte gleichsain<br />
abmilst und vorschreibt; endlich die der G e r e c h t i g k e i t , die eben<br />
in der Verehrung und Liebe zu dieser Richtigkeit besteht, sozusagen<br />
die sublime Frucht der Verbindung der Vernunft und Güte darstelleild,<br />
welche die Gesichtszüge beider trägt und den gemeinsamen Ausdruclr<br />
beider in sieh birgt." Und aus diesen Worteii dürfte wohl, was übrigeiis<br />
auch an manchen anderenstellen durchscheint, als die eigentliche Suinme<br />
von Leopold-Godmails ethischer Lebens~veisheit die uiibe~treitbare<br />
Wahrheit sich ergeben, dais der innerste Kern der wahren Moralität,<br />
der lebendige Mittelpuillrt aller echten Sittlichkeit, aus reiner uneigeiinütziger<br />
Güte oder allgemeinem Wohlwollerl bestcht, wohlgemerkt inil<br />
daliebeil auftretendem „mitzeugendem Gefühl" von dem hoheii Wcrt<br />
oder der absoluten Vortrefflichkeit einer solchen „Gesinnungc(.
78 Ein schwedischer AafklKriii~gsphilosopli.<br />
Dui.ch das bisher Aiigcfulirte ist iiidessen die groise Preisfrage der<br />
Philosopliie nur zur Hälfte beantwortet worden. Denn noch steht dahin<br />
zu zeigen (5 und 6), dais und wie das mehrerwähnte Moralgefülil auch<br />
einer darauf ruheiiden, hinreichend gewissen und festen Tiberzeugung<br />
von dem Dasein eines persörilichen Gottes uncl eines<br />
e w' i g e ii L e b e ii s ri a C 1 d i e s e ni zur Grundlage soll dieii~n<br />
libnnen. Nit diesen Fragen lronimen wir von dem rein ethischeil Gebiet<br />
hinüber auf dar ethisch-religiuse oder, wenn man so lieber will, das<br />
religions philosophische. Leopolds hierhergehörige Argumeiibationen<br />
und Betrachtungen sind am reichsten entwiclcelt und am ausführlichsten<br />
dargestellt in der dieser Frage besonders gewidmeten, in den d r i t t e n<br />
Band seiner Gesammelteii Schriftcii aufgenoinnieneii (60 S. starken)<br />
Abhandlung: Ideen zu einer Pop~~larphilosophie über<br />
G o t t u ii d U ri s t e r b l i C h lr e i t , welche Abliandlung ich mir daher<br />
im weiteren vorzugsweise zu zitieren erlaube. Der ieitende Gedankeiigang<br />
dürfte in teilweise etwas freier Umschreibung folgendermaiseii<br />
ausgedrückt und zusamnicngefaCst werden lrönnen.<br />
Oft mircl in recht allgrnieiiien Ausdrücken als eine unmittelbare,<br />
ursprüngliche und unvertilgbare G e f ü h 1 s ii o t w e n d i g li e i t hervorgehoben,<br />
clais man nicht aiineliii~eii kann, das l\/renbchenleben oder das<br />
ganze iibrige Dasein sei einc einzige groise Sinnlosiglreit, CI. 11. ohne<br />
einen innewohnenden, an sich selbst wertvolleii und zugleich iii gewisscin<br />
Grade .uvenigstcns erre~ichbaren Zwcclr. Und dies wird dann unter anderm<br />
so ausgedriiclit,dais wir „vernünftigerweiseu uns das Weltall niclit anders<br />
denn als eine iii sich zusaiiimi~ilhiingende „Vernunftseinricht~11ig" oder<br />
„Güte- uncl Vcrnuiiftordnung" cleiilien lrönnen; worauf der so eingeschlagene<br />
Gedanlrengang weiter verfolgt und dahin entwickelt wird, dais<br />
eine solche Einrichtung oder Ordnung unbeldingt eine einrichteiide uiid<br />
ordnende T\Teltvcrnunft voraussetzt, welche wiecler nicht anders denn als<br />
ein mit Denlreii und llTillcii ausgerüsteter p e r s ö n 1 i C h e r Gott gedacht<br />
~~erdeii kailii.<br />
Weni1 aber so bereits die ebenerwähnte a 11 g ein e i ii e Gefühlsiiot-<br />
wendiglieit - oder etwas ausfiihrlicher, die in unserem allgemeiiien<br />
Lebensgefiihl selbst unab~veislich begründete Forderuiig, dais das Da-<br />
sein einen vernünftigen Siriii haben mufs - lediglich mit Hilfe ge-<br />
wisser daraii sich anlrniipfcnder Überlegungen uiis zu einer t h e i s -<br />
t i s C h e ii T&' C 1 t e r lr 1 ii r U n g als der einzigen führen zu können<br />
scheint, die in Wirlrlichlicit zu alizeptiereii uns möglich ist, so ist es<br />
doch erst das in der Form des spezifisch-moralischen Gefiihls hervor-<br />
tretende Bemuistsein von der ab s o i u t e n Vortrefflichkeit der Güte,<br />
Vernunft uiid Gerechtigkeit, durch das diese theistische Welterklärung<br />
ihre Vollendung gewinnt und zugleich ihre volle Gewiisheit und Starke<br />
erhält - eben dadurch ni~mlicli, daPs dieses Moralgefülil gaiiz u n m i t -<br />
t e 1 b a r , d. h. ohne alle Vermittlung durch logische Schluisf olgerungen<br />
oder abstrakte Räsonnements, wie wir bereits Dr. Crodman hsibeii ver-<br />
sichern Iiöreii, uns „zwingt", mit unserer Vorstelluiig von der urspriing-
Ein schwedischer Aiifkl~rui~gsphilosoph. 73<br />
liehen Allkraft die Torstellung dieser Eigeiischafteil, dabci danu natur-<br />
lieh in ihrer höch~teii idealen Volllrommeaheit gedacht, zu verbinden,<br />
d. h. also zwingt, uns d e n p c r s ö n 1 i c h e n G o t t als ilicht blois<br />
allmächtig, sondern zugleich und vor allen1 a 11 g u t , a 11 w e i s e und<br />
g e r e c h t vorzustellen.<br />
Nachdem er glücklich so weit gelangt, ist es verhkltnismaisig leicht<br />
für Leopold, aus diesem seinem solchcrmaiseil näher bestimmteil<br />
Gottesbegriff, fast als ein Korollarium daraus, die G e w i S s h e i t d c r<br />
Unsterblichkeitshoffnung abzuleiten. Und dies geschieht<br />
ain liebsten in der hochgestimrntcn Form der delilamatorischeil Frage.<br />
„Kann der Schöpfer grausam sein? Kann er den lilarsten Begriff<br />
von totaler Vernichtung uncl den gröistcn Schrecken davor Wesen<br />
geben, die er nach etinigen kurzen Augenbliclieil total zu vernichten ge-<br />
denlrt ? - Kann er der s t c r b 1 i c h e n Brust diese Furcht und diese<br />
Hoffnung einpflanzen, die mit schlieislicher Gerechtigkeit uns droht<br />
und tröstet und die Folgen aller moralischen Verhältnisse über das<br />
Grab hinaus erstreclit? - Kann er den 3Eenschensirin für eine Schiiil-<br />
lieit oder Vollkon~menlieit der Tugend empfänglich machen, die so oft<br />
den Vorteilen des irdischen TSTesens widerstreitet, lind doch ohne wirk-<br />
liche Beziehung auf einen liünftigeiz Zustand belohnender Selig-<br />
lreit?
74 Ein schwedischer Aufkl&rungsphilosoph.<br />
darauf, sich dort hinreichend verständlich zu niachen, gleicllwolrl iii<br />
jcder Brust mit der ganzen Kraft der Übcrzeuguiig spriclit, und die wir<br />
mit allem Fug, mit P o p e s Ausdruclr, t h e G o d w i t h i 11 t h e n~ i ii cl<br />
nennen lriiiirien.''<br />
lbIeiii Bericht über dcn hauptsächlichen Inhalt voiz Dr. Godmaiis<br />
Weisheitslehre ist zu Ende. AIögc diese iiuii für sich selbst sprcchcii,<br />
wie sie kann und vermag! Auf eine nähere Prüfung ihres etwa grüiscreii<br />
oder geringereil, rein wisselischaftlichen Gehalts und Wertes eiiizugehen,<br />
kann nicht im Rahnicil dieser Darstellung liegen. Und übrigens hat sie<br />
sich ja iiicinals für sonderlich mehr als cinc auf die sog. gesunde Ver-<br />
nunft oder den gewöhnlichen s e ii s c o in m u n gegründete, pralrtischc<br />
1,ebensweisheit ausgegeben, unter offen ausgesprochencrn Akiistraueii<br />
gegen alle gelelirterc, spelrulativ-theoretische Schul- und Kathcder-<br />
philosophie.<br />
Was aber diesen „Stücken aus Dr. Godn~aiis Brieftasche'
Ein schwedischer Aufkl&rungsphilosoph. 75<br />
verrät sich unverkennbar dariiz. dais das fragliche moralisclie ..Gefühls-<br />
pririzip", wälirend es gleiclxeitig kräftig als solclics gegcii die „ange-<br />
iiiafste Autorität" jeder abstrakten Gesetzesformel verteidigt wird, nicht<br />
weniger bestiniimt und iiachdrücldich als selbst eiizc ebenso absolute<br />
Wertung und folglicli auch ein ebenso unbedingt gebietendes Gesctz,<br />
wie nur je IZaiits „pralitische Veriiuizft" cs sein lianii, iii sich schlicisend<br />
oder auf seine Weisc darstelleiid charaliterisiert wird.<br />
Was in diesem Zusaminenlzang als ein Beweis neben andercii für<br />
Leopolds p s y c h o 1 o g i s c 11 e n Scharfblicli liervorgehoben zu wcrdeii<br />
verdieiit, ist die bei ihn1 sclioii zu voller Klarheit gereifte Erlieiintnis,<br />
dais a 11 e Art Werturteile und Werte überhauut sich letzthin auf rer-<br />
schiedeae Äulserungen unseres Gefühlslebens grüizdeiz und gründeii<br />
iilüssen, cine iii den meisten psgchologischeii Lehrbücher11 heutzutage<br />
mehr oder weniger starlc betonte Wahrheit recht elementarer Art, die<br />
indcssen der Uitwelt 1,copolds iioch iziclit recht aufgegangen zu sein<br />
scheint. - Zum Vergleich init dem, was wir hier oben Dr. Godinaiz über<br />
die priilzipielle Bedeutung des Gefühls für alle Werturteile haben<br />
äuisern hören, seicii folgende Worte von H e r ni a n n L o t z e (G r u ii d-<br />
züge der pralit. Philosophie 1899, S. 11) angeführt: „Es ist<br />
gar nicht inehr zu sageii, worin denn der Wert oder die Güte eines Gutes<br />
dann noch bcstcheii sollte, wenn mari sich das so Bezcichnete auiser<br />
aller Beziehung zu einem Geiste denlrt, der davon Freude haben lröiinte.<br />
Nehnieiz wir an, in der ganzen Welt gäbe es gar niemanden, der über-<br />
haupt Lust oder Unlust über etwas empfinden könnte, so wüiste niaii gar<br />
nicht, zu welchem Eiide in dieser Welt etwas gcschelien sollte, und iioch<br />
weniger, iiz wiefern eine IIandluilg besser sei11 sollte als irgend eine<br />
andere, da ja jeder neue Zustand, der durch cine Handluiig erzeugt<br />
würde, aller Welt eb~iiso gleichgültig sein würde wie der frühere, den<br />
sie veräiidert hat. Mit einein Worte: es gibt gar lreiiieiz Wert oder Un-<br />
wert, der an sich einem Dinge zukommen liöniite; beide existieren blois in<br />
Gestalt voil Lust und Unlust, die ein gefühlfähiger Geist erfahrt." Vgl.<br />
auch z. B. Alois I-Iöfler, Gruizdlelireii der Psychologie,<br />
S. 120: „Das Ding hat Wert, insofern es die Fahiglieit hat, in einem<br />
intellelrtual und emotional hierzu befähigten Geiste Gegenstand eines<br />
Wohlgefühls zu seiii" ; weiter : A 1 e X i u s &I e i n o ii g s P s y c h o 1 o g.-<br />
ethische Unters. zur Werttlieorie (Graz 1894) und Über<br />
Werthaltuiig und Wert (1895); uild I
76 Ein schwedischer Aufkl&rungsphilosoph.<br />
in einer von Leopolds älteren Schriften etwas gefunden, das inich sonderlich<br />
an J a c o b i s „Glaubensphil~so~hie~ erinnert hätte, deren erster<br />
grundlegender Begriff von der „Vernunft" in der Bedeutung eines mysti-<br />
schen, in gewissem Grade unseren äuisereii Sinnen nebengeordneten Ver-<br />
mögens, rezeptiv eine rein unsinnliche Wirklichkeit an z u s c h a u e n ,<br />
Leopold stets vollliommen fremd gewesen und geblieben ist. Und noch<br />
weniger habe ich irgendwelche c h a r a k t e r i s t i s c h e r o n ~hnlich-<br />
keiten zwischen Leopolds und Jacobis Ansichten inerkenntnistheoretischeil<br />
oder rein ethischen Fragen finden können, sondern nur solche allgemeine<br />
Berühruiigspurilite, wie sie eich sehr wohl daraus erklaren lassen, dais<br />
sie beide, jeder in besonderem Grade und besonderer Weise, je nach der<br />
individuellen Anlage, von Kant uiid Fichte nicht weniger als von<br />
Shaftesbury und Huine beeinfluist worden sind. Soweit ich habe finden<br />
können, fehlt jeder Anlais zu der Annahme, dais Leopold irgend eine<br />
der philosophischen Schriften Jacobis näher studiert hatte. Auch läist<br />
sich nicht mit Fug von einem höheren Grad von Kongenialität zwischen<br />
diesen Philosophen reden : der eine (Jacobi) voll mystischen Tief sinnes<br />
und oft mehr unruhig gärender als klar und bestimmt fixierter Gedanken<br />
und Ideen, in Grund uiid Boden weit mehr mit deutscher literarischer<br />
und spekulativer Romantik verwandt als mit Xant oder I-Iume; der<br />
andere wieder (Leopold) stets ruhig und klar, nüchtern uiid bedächtig,<br />
trotz seiner gründlichen Kantstudien und bei all seinem eigenen kriti-<br />
schen Scliarfsinn noch im spaten Herbst des Alters ein ebenso voll-<br />
wertiger Repräsentant für alle die besten Seilen der aus Erigland her-<br />
stammenclen Aufklarungsphilosophie des achtzehnten Jahrhunderts, wie<br />
er auf dem Gebiete der schönen Literatur lange der Hüter und Pfleger der<br />
mit dieser Auflrlarung IIand in IIand gehenden sog. französischen Ge-<br />
schmacksrichtuiig und ihr Verteidiger gegen den anstürmenden „Phos-<br />
phorismus" (d. h. die „Stürmer und Dränger" der scliwedischeil Neu-<br />
romantik) gewesen ist. Ich trage also kein Bedenken, es nicht nur als<br />
weit hergeholt und übereilt, sondern als völlig irreleitend zu bezeichnen,<br />
wenn B e r ii h a r d V. B e s k o .rv Leopold als Philosoph dadurch hat cha-<br />
rakterisicrvn wollen, dais er ihn zunachst mit „dem alteren Jacobi"<br />
zusammenstellt, „mit dessen Philosophie rlie Leopolds die nächste Ver-<br />
wandtschaft besais" (Svenska Aliadeniieiis Haiidlingar<br />
e f t e r 1796, Teil 35, S. 169). Der erste schwedische Philosoph, der er-<br />
wiesenermaisen von Jacobi becinfliiist morden ist uiicl von ihm stärliere<br />
Impulse erhalten hat, ist Leopolds jüngerer Zeitgenosse N i 1 s F r e -<br />
drili Biberg.<br />
Uni aber auf Leopolds eben erwähnten Versuch, seine „moralische"<br />
Gewifsheit von „Gott und Unsterblichkeit" zu begrüiideii und zu ver-<br />
fechten, zurüclizukommen, so liegt es für uns vielleicht am allelrnächsten,<br />
seine hierher gehörigen Betrachtungen mit II a r a l d EI ö f f cl i n g s<br />
wolrilbelranriter Definition des inncrsten Wesens aller Religion als in dem<br />
„Glauben an den Bestand des Wertes'' bestehend zusammenzustellen,<br />
oder gar mit W. W i n d e 1 b a n d s Definition der Philosophie als „Kri-<br />
tische T;ITissenschaft von allgemeingültigen Werten" -, und weshalb
Ein schwedischer AufkKbrungsphilosoph. 77<br />
nicht auch mit jenen immer eingehenderen Ciitersuchuilgen und Erörte-<br />
rungen betreffs der Psychologie des ethisch-religiösen Werturteils und<br />
des dadurch bedingten, eventuell gröiseren oder geringeren Erkenntnis-<br />
wertes, wie sie uns hier und da bei den meisten bedeutenderen Theologen<br />
wie Religioizsphilosophen unserer eigenen Zeit begegnen, wie z. B. bei<br />
Alb. Ritsclzl und Rud. Euclren. Vgl. aucli z. B. Friedr.<br />
Paulsens Aufsatz: Was uns Kant sein l
Platos „sokratische" Periode und der<br />
Phaedrus.')<br />
Von<br />
Kar1 Joel, Basel.<br />
s ist eil1 gutes Zeichen, dais die Stellung des Phaedrus, dieue<br />
Grundfrage für das Verständnis des platonisclien Scliriittuma,<br />
neuerdings wieder zur Debatte stellt. Aber woher mit neuen<br />
Mitteln ail sie herantreten 1 Gompcrz (Griccli.Deiiker, IIq.342)<br />
und Natorp (Arcliiv XI1 f. Hermes 35, S. 384) verzweifeln selbst in ihrer<br />
Sprachstatistik die letzte Lösung zu finden, und die Wortzähluiigen, für<br />
die ja überhaupt ein Dramatiker das unglucl~lichste Objekt ist, führen<br />
leicht in die Irre gerade bei einein Dialog, in dem Plato in zwei groiseri<br />
Reden gar nicht seinen eigenen Stil schreibt (vgl. Norden, Ant. Kunstpr. I.,<br />
S. 105-112). In dsr Stellung des Phaedrus lag ja einst schon der<br />
Brennpunkt des Streites zwischen der methodischen und der genetischen<br />
Platoauffassung, da K. Fr. ITermanii den von Schleiermacher an die<br />
Spitze gestellten Dialog erst der letzten Periode Platos zuwies. In-<br />
zwischen ist der Phacdrus immer noch auf der Waiiderschaft fast clurcli<br />
ein Xenschenalter; juiigst erst wieder von Lutoslawski etwa für den<br />
50jahrigen Plato festgehalten, ist er bei manchen Forschern an den<br />
Anfang einer iiiittlcrcii Feriode vorgerückt, während Usener und<br />
neuestens Inunisch ja sogar den Sclileierniaclierschen Ansatz erneuerten.<br />
1) Der Verfasser trägt kein Bedenkcii, einem Altmeister der Forschung<br />
über antike Philosophie, der einst dem Studenten das Thema zu seinem Erst-<br />
lingsversuch auf diesem Forschungsfelde und damit spiiteren Arbeiten eine<br />
Richtung wies, hier eine Studie mit wohl etwas ketzerischen Thesen darzu-<br />
bringen. Gilt es doch einen Gelehrten zu ehren, dessen Urteil durch vorurteils-<br />
lose Objektivität ausgezeichnet und in der Wiirdigung fremder Ansichten Liewiihrt<br />
ist! Die ersten Ausführiingen iiber die sogenannte sokratische Periode Platos<br />
Fassen hier nur schärfer Erorterungen zusammen, die in meinem umfangreichen<br />
Werk über Sokrates vergraben kautu Beachtung fanden, während die folgende<br />
Behandlung des Phaedrus nur in Nebenpunkten auf dem dort Gegebenen fuist.
Platos .sokratische1' Periode nnd der Pliaedrus. 79<br />
Jedenfalls gilt es jetzt, den Prozeis, iil dem das hist~~iscli tendierende<br />
19. Jahrhundert so selbstverständlich den Genetdker siegen lieis, zu<br />
revidieren.<br />
Im Phaeclrus spricht Plato bereits als Vet-lxünder der Ideenlehre<br />
und - das scheint mir unverkennbar (vgl. Uberweg-EIeiiize, Grundr. Iq<br />
S. 180 f.) - als Schulgründer. Ist cler Phaedrus seine Erstlingsschrift,<br />
dann spiegeln scine Schriften nicht den Aufstieg seiner Geistesentwicklung,<br />
soiiclern erst die Isölie der Lehrjahre, und dann gibt es keine<br />
„sokratische Periode" für die platonisclien Schriften. Ich bekenne<br />
hier nicht zunl ersten 3121, dais mir die ilnsetzung einer sokratischen<br />
Schriftenperiode Platos cine für sein Verständnis verderbliche fable<br />
convenuo scheint, die nur noch durch die Macht der Tradition aiifrechterhalten<br />
wird. Vielleicht hilft dcr aufreizende Titel einer jüngsten<br />
Studie von IIorneffer: ,,Plato gegen Sokrates" besser als meine früheren<br />
Ausführungen die Blindheit zerstreuen, mit der nian bisher dariiber hinwegsah,<br />
dais Plato gerade in Schriften wie Laches, Charmides, Euthyphro,<br />
Protagoras, I-lippias niinor all die Tugeildbestimrnungen des traditionellen,<br />
d. h. namentlich xeiiophontischen Sokrates widerlegt. Der<br />
Laches widerlegt die Tapferkeit als I
80<br />
Platos .sokratischeY Periode lind der Phaedrus.<br />
Wissensbestimmungeii ohne Ideenlehre widerlegt, vor Eiitdcckuiig der<br />
Ideenlehre geschriebcn sein inüisten.<br />
„Die platonische Ethili weist in ihrer ganzen Entwicliluiig auf<br />
die Ideenlehre hin", lieiist es bei ~berwcg-Heinze, Grundr. I". 203<br />
mit Recht. Der Charnlides z. B. widerlegt doch den Subjelrtivismus<br />
des Tugendwissens als Selbsterkenntnis nur, weil offenbar schon in den<br />
Ideen objektive Prinzipien des Wissens feststehen; der Laches widerlegt<br />
doch das besondere Wissen der zul
Platos .sokratischeu Periode und der Phaedrus. 8 1<br />
als Redeii. Weilii 11ocl1 inmer iii der Apologie die historische Verteidigwigsrede<br />
des Sokrates gcfuiideii wird, so weiis maii schwer,<br />
worüber man sich inehr wuiidern soll: über die Vcrleugnung der Regel,<br />
tlais selbst der strengste antilrc I-Iistoriker die Reden sciiier IIeldeil<br />
erfindet, ja erfiiideil mufs (vgl. Diels, Aufs. z. Ehren Zedlers, S. 252),<br />
oder über die völlige Nichtbeachtuilg der l-iistorischen Giimöglichkeiten<br />
cler Rede (vgl. sclioii Schanz, Apol., S. 68 E., Gomperz, Griech. Dcilkei<br />
II., X. 81-87), uild iiamentlich über die Oralielglaubigkeit der Noderiieil,<br />
die wirklich die Pythia deil noch ~~öllig uiibelraiintcil Plebejer<br />
Sokrates als Weisesten herausgreifeil uiid erst seinem philosophischeii<br />
Beruf zufiihreii lassen, oder eiidlich über die Geringschätzung Platos, die<br />
clariii liegt, dais man eher die Niedersclirift einer iinprovisierten Rede<br />
dort sucht, wo er gerade seine feiiiste Kunst entfaltet. Im Grunde<br />
triumphiert ebeii doch diese Kunst, die unsere Forscher mit dein Eindruck<br />
der Echtheit der Rede gerade so täuscht wie dec, Zenxis geinalte<br />
Trauben die Vögel.<br />
Maii hegt iloch imiiier den Glaubeii, dais iiur der Gerjchtsprozeis<br />
Plato Anlais zu solcher Schrift gegeben haben könne. Und doch zeigen<br />
Polykrates uild Lysias zur Genüge, dafs Anklage und Verteidigung des<br />
Sokrates bald iri das Spiel rhetorischer Erfiilduilg gezogen wurden und<br />
dais es iioch laiige Jahre ~iach deri~ Prozeis Aiireiz zu eiuer Solrratesapologie<br />
geben l
fkl<br />
Platos „solrratische" Periode und der Phaedriis.<br />
„Wolkeii(") Reiz und Natcrial f aiid in der iiizwischen heranfgekommeiieii<br />
solrratischeil Literatur. Und claraus eii'dlicli wäre erst verstiindlicli,<br />
warum Sokrates bei Aristophaiies so vielerlei sagt und treibt, das selbst<br />
ohne Kasrilratur für den hiistorischeii Sokra.tes uiin~öglich, das aber<br />
mohl bci einein sokratischen Schriftstellcr seinen Aiisatz hatte. Für all<br />
dies habe ich Sokr. I1 809-895 speziellere Datei1 uiicl Argumentc<br />
beigebraclit." Mai1 mag meint: Dcut,ung als zu lrühn uiibeachtet lasseii,<br />
~<br />
2) die scholl nach den Scholien weitgehend war, aber vielleicht nur die<br />
alten Chöre übrig lieis (bei Aristophanes ja nichts Unerhörtes), die doch fast<br />
allein auf den Titel passen. Bücheler und Diels vermuten sicher mit Recht,<br />
dais die ersten ,,Wolkenu noch mehr Naturphilosophie verspotteten, aber dann<br />
parsten sie um so schlechter zu Sokrates. Und dann ist es die Zeit, in der die<br />
Naturphilosophie in Athcii eingezogen war, in der wir aber von Sokrates nichts<br />
wissen, als dais er damals ein tapferer Soldat gewesen sein soll. Denn die<br />
Aufführung der ,,W~lkeii'~ fällt ja zwischen die Schlachten von Delion iind<br />
Amphipolis, in clie ungeeignetste Zeit für eine Sokratesverspottung.<br />
3) Hier hatte ich nameiitlich auf die Meteorologie des Thales in einem aiis<br />
weitem Material erschlossenen Siebenlveisensymposion des Antisthencs hin-<br />
gewiesen. Das antisthenische Gastmahl wird mir nun von Herrn J. Mikolajczak<br />
(Breslauer philol. Abhandl. IX 1) mit Harpyieneifer zerst,ört. Liie eigentlichen<br />
Xokr. I1 710 ff. beginnenden Argumente kümmern ihn zwar nicht: er hängt sich<br />
an die nicht einmal als solches angeführte platonische Vergleichnng derer, die<br />
für ihre Unterhaltung Dichtersprüche, uiid derer, die für sie Flötenspielerinnen<br />
heim Symposion brauchen - ich verstand das in meiner Unschuld so, dais<br />
Plato dem beim Symposion statt mit gemeinem Flötenspiel mit Dichtersprüchen<br />
aufwartenden Kyniker sagen wolle: deine Dichtersprüche sind doch auch nni<br />
erborgte Stimmen. Mein strenger Richter aber, Plato iinplatonisch pressend,<br />
will nach den Worten im Protagoras die Dichtersprüche vom Symposion absoxut<br />
fernhalteil (wahrend Plato hier nur niit Iiücksicht auf seinen eigenen Dialog die<br />
Möglichkeit von alkoholfreien Literaturgespr5chei offen liiist). Dabei soll ich<br />
mich eines Widerspruchs schuldig machen, weil ich Antisthencs erst ,(natürlich<br />
durch den Gastgeber) eine Flötenspielerin vorführen und dann (natürlich durch<br />
Sokrates) eine geistigere Unterhaltung empfehlen lasse! Meine nLchste Sünde<br />
ist, dais ich Antisthenes die Sophisten zum reiche11 Kallias fiihrcn lasse, -wahrend<br />
doch bezeugt werde, dais er umgekehrt (!) Kallias mit den Sophisten verkuppelt<br />
habe. Es nützt Antisthenes auch nicht, dais er ausdrücklich (Frg. 68, 7 Winck.)<br />
die Weisen zum Reichen lrommen Inist; deuii niein Kritiker, kynischer als die<br />
Kyniker, verpönt dort jede Bewirtung. - Aus dem sokratischen Symposion bei<br />
ICallias lasso ich, gleichsam als Drama im Drama, wohl von Sokrates erzßhlt,<br />
wie man es iifter im kleinen voll Plato kennt, als Prototyp des gegenwärtigen<br />
ein Siebenweisensymposion aufsteigen; mein Strafprediger aber mischt cliirch<br />
Weglassung einiger meiner Satze beide Symposien und, eigeiin~ichtig eine<br />
8iebenzahl einfügend, liiist er mich Thales und Genossen bei Kallias zu Gast<br />
setzeil, womit er mich natürlich auf einem neuen Widerspruch ertappt. - An<br />
H. Heinzes schöne Entdeckung des kynischen Anacharsis aiiki1üpfend fand ich<br />
in huiidertfachen Spureii eine altkynische Fiebenweisentradition, die aus Ge-<br />
sprachen besteht, die auffallend viel vom Trinkeil handeln (beides z. T. schon<br />
von H. Heinze gesehen), und ich schlois daraus lind aus vielen andern Indizien,<br />
dais es sich um ein S-jmposioii handelt. Aber meine gaiize Konstruktion wird<br />
111111 völlig zu Boden geschlagen durch das einzige Argument, dafs es ja Ge-<br />
sprlche gebe auch auiserhalb eines Symposions. -- Hierauf wird meine ErlrlLrung<br />
der groisen Namensschwankiingei der Weisen gerade a,us der Symposionliteratur<br />
deshalb gebrandmarkt, weil sie nicht alle Namen erklären solle. Herr Miko-<br />
lajczak allerdings erspart sich eine Erlclarniig der heterogenen Namen und hat<br />
offenbar Peisistratos (den ich gar nicht aus einem k y nischen Symposion als<br />
Weisen erklßren wolltc) direkt vom Hinlniel unter die Weisen fallen sehen.<br />
Hierauf wcrde ich dafiir verantwortlich gemacht, dais die Alten Plato die Ein-
Platos „sokratischeG Periode und der Phaedrus. 83<br />
wie eben gegenüber der festgewurzelten Anschauung selbst das Einfachste<br />
kühn erscheint, aber es ist doch wenigstens eine versuchte Erlrläruiig<br />
des asistophanischen Solirates, dessen völlig ungelöstes Rätsel<br />
der modernen Foiischung etwas schwerer aufs Gewissen fallen dürfte.<br />
Ist nun die Apologie und schon die z~~citc Wolkenausgabe, der sic<br />
antwortet, 1 i t .ei r a r i s c h veranlaist, dann fällt jeder Grund weg, die<br />
l~latoiiische Schriftstellerei schon bald nacli Sokrates' Tode, überhaupt<br />
vor dem Abschluis der Waiiclerjahre beginnen zu lassen. Die erste<br />
Schriftstellerperiode Platos ist demnach nicht die ,,solrratisohe",<br />
sonder11 diejenige, in der der plvilosophische Schulgründer Plato sich<br />
auseinaiidersetzen mufs. zunächst mit u~iphilosophischen Dichtern und<br />
Politi1rcii.n und namentlich lZlietoren, und weite~hin ibL häuslichen1<br />
Streit mit clenl älteren sokratischeii Schulhaupt Antisthenes, niit dem<br />
Pr vi-ialfach nocli an einem Strange zieht. Die ersten Schriften sind die<br />
TTaffen der iieuen Schule. Xan wird Plato und die alten Denker über-<br />
haupt nicht verstehen, so lange man in modeiiier Weise ihre Schriften<br />
als ihren TTeseiisabdrucli und Lebenszweck verehrt, so lange man nicht<br />
Platos Schriften verachtet - gcgeiiü1.3cr Platos persönlicher Lehrwirk-<br />
samkeit. Das fordert der Phaeclrus laut genug, der eben die rhetorische11<br />
Sclii.eiber lierabdrücken will, wenn cr sie auch gcgen die literaturfeind-<br />
liehen Politilter verteidigt. Ei steht ain, deutlichstaiz Sn der ersten<br />
Situation, in der Plato zu recleii hatte, als sich die Philosophie aus der<br />
gorgianiscl~en \rerschlingung init der Rhetorili herauswinden muiste.<br />
Ceracle dia Auseinaildersetzung mit denn lcynischen Sokratiker, der<br />
T-oh der g~~gianisclieii Rhetorik ausgegangen, brachte zugleich eine<br />
,~~~seiiiai~clcrsetzung m,it der danials Athen überschweumienclen Rhetorik.<br />
So sind beicle schon im Pliaeclrus meiliwürclig verquickt.<br />
Die Stelluiignah~ne zii den ofTen genannten Rhetoren liegt klar;<br />
dcii kynischeii Erzsoltratilrei aber, den „SokratesC. nicht offen beurteilen<br />
kann, hat Inan erst in wenigeil sporadiisehcn Spuren gefunden, die keinen<br />
geiiügendeiz Fingerzeig geben. Zuiiiichst hat Winckelmann, Antisth.<br />
Frg. S. 50,1, aus der Zibereinstiminung einer Wendung des Pangebets,<br />
Phaedr. 279 B C, init den Aiitisthenesworteii Xen. Symp. IV 43 ge-<br />
reihung Mysons für Periander zuschreiben (was ich gerade nicht tue) und dais<br />
Periander bei Dio %LI Unrecht kynisch gereinigt werde. Naturlich hat Aristoteles<br />
den Weisennamen Periander aus den Sternen gelesen. Endlich wird S. 24 aus<br />
dem Weisengastmahl, das der Kyniker als Muster vorführt, im Handumdrehen<br />
ein solches, das ihm als Muster vorlag, - und dann bin ich naturlich an der<br />
Verwirrung schuld. Das Interessanteste aber ist, dais dieser gewissenhafte Er-<br />
forscher der Siebenweisentradition nur mit einigen meiner Konsequenzen spielend<br />
uber das in iilebr als 100 Seitcn mit zahlreichen wörtlichen Parallelen bei-<br />
gebrachte Material fur eine altkynische Siebenweisentradition lautlos hinweg-<br />
hnpft. Die Strafe bleibt nicht aus. hier streitet er grimmig gegen meine An-<br />
nilhrne eines antisthenischen Siebenweisensymposions - und S. 38 sielit er selbst<br />
ein, dals wohl schon Ephoros sein Siebenweisensymposion aus kynischer Quelle<br />
schopft, - aber als sichere k-ynische Quelle vor Ephoros bietet sich doch nur<br />
Antisthenesl Wozu also der Lgrn? Kam ich als Störenfried in die fast fertige<br />
Dissertation, dais ich nachtrkglich in der Einleitung uiischiidlich gemacht werden<br />
muiste? Ich h%tte dieses jugendliche Opus nicht so ausfiihrlich gekennzeichnet,<br />
wenn es nicht Grundr. I9 S. 401 als Kritik meiner Aufstellungen zitiert wäre.<br />
6*
84<br />
I'latos ,,sokratische.' Periode uni1 tler Phaedrns.<br />
folgert, dafs der Sckluls cles Phaedrus auf Antistheiies anspielt. Nichi<br />
nur diese Worte d das Gebet um seelische Schönheit uiid wohl auch<br />
der Panlrultus (vgl. Sokr. 11 480,l) weiseil auf dcii Kyniker, cs stehen<br />
ja. hier clie kyixischen Bekenntnisworte: rrA»t;crtov vo/ti(orctr zdv cro@l~<br />
iind XOLII& Z& zU>v JD~AWI! (vgl. Laert. Diog. V1 12. Xen. Syinp. IV 34 E.).<br />
14ail kann doch aber nicht gleichgültig clariibor hinwegsehen, dais der<br />
Phaedrus ii~ ein kynisches Bekeiintiiis, ja in Antistheiieszitatc ausliuft.<br />
Ich vermag es nur als versöhnenclen Schlufsalrkord zu deuten : Plato reiclit<br />
dem Kyiiiliwr nach vorausgegaizge~ier Differeii~ die Hand zu Rund und<br />
Frieden, die allerdings nicht lange bestanden.<br />
Der liyiiisiereiide Schluis kann iiicht ein plötzlicher Ausbruch sein,<br />
~oiideril niuis iin Dialog sleiiie Vorgeschichte haben. Jenein Scliluisgebet<br />
geht unmittelbar voran cler bekaiiiite Vergleicli zxvischen 1,ysias<br />
uiid Isokrates, den Plato zuguiisten des Tsolrrates eiitsclieidet. I111<br />
ersten ~o~,ro; des Aiitisthencs (Laert. Diog. T71,15) ist eine Schrift uber<br />
Lysias und Isokrates ~e~zeiclinet. Zu dieser Schrift lnuis doch cler<br />
Phaedrus irgend ein Verhiiltnis haben, das vielleiclit wichtiger ist a19<br />
das immer nur ventilierte des Pliaedrus zur Sophisteiirede. Der<br />
Kyniker steht auf seiteil des hausbacken iiioralisierendeii, plebejischen<br />
I,ysias, der seinen Sokratcs verteidigt, und schreibt gegen Isolirates (ib.),<br />
cler ilm ja die Antwort nicht schuldig blieb. So ist die Diffcieiiz der<br />
beiden Sol~ratilre~ in der Scliktzung der bciclen Rlietoreii gegeben; der<br />
Phaedrus richtet sich geguii den Lysiaskult, clocli svahrlicli iiicht des<br />
Phaedrus, sondern eines urteilsfkhigerci~ llariiics. Es ist ja klar, daCs<br />
dem Kynilrcr iiidererseits des Isolirates aiispruclisvollcr asthetizisiniis<br />
ein Greuel sein inuista; gegenüber der Heleilapaiiegyrik des Rhetors<br />
preist er di(x seeleiischiiiic Penelope (s. 9. zbFloS und Antisth. Frg. S. 26<br />
Wiiick.; vgl. Solrr. I1 i47), und clie liei~te ja erkaniite Polcniilr des Isolrrates<br />
nzit ilini war sicherlich schärfer als clic init Plato, der hier nvic<br />
im Euthydem zwischen beiden richtet, iiideni er, lsolrrates aiierlrcimeiid,<br />
(loch zuletzt mit Antistheiies clas Lob der Scelenschöiilieit singt.<br />
Gorgias hat der Rhetorik das IIeleiialob als Thema vererbt; er hat es<br />
dber wo111 von seinem Laiidsinanii Stesiclioros empfangcii, und auf<br />
den I-Ieleiiasaiig dcs Stesiclioros spielt Plato aixsdrüclilicli hier p. 243 A'<br />
244 8 an. Ini Helenalob, in der Wertung der Scliöiiheit, tre8eii sich<br />
die beiden Themen des Phaeclrus: Rhetorik 111~~1 Erotilr. A~itistheiies,<br />
der Gorgiasscliüler und spaterc Antigorgianer, schrieb uber „IAysias<br />
und Isokrates" uiid iiber „I-Ielena und Peii(tlopcu iiilcl einen „Erotilros(' -<br />
und er sollte in die Phaedrusdebatte gar nicht liiieinspiclen, blo1~ weil<br />
uiiscre Forscher bei dem Nainen Aiitistheiles nachgerade nervös werdeii<br />
1111~~1 von Plato fordern, dass er nur Schriften berücksiclitigt, clie uiib<br />
erhalten sind?<br />
Die Deutung des Phaedrus hängt nicht zur11 weniigstcii ab von dcr<br />
ersten Sokrntesrede. Für die I>ysiasrede leliiit Plato jede Verailtmortuiig<br />
ab, ob nian ihre Echtheit nun nach TTahlen (Berliner Akadeiiiiclberichte<br />
1903, S. 788 ff.) für gesichert liält oder nicht. Iii der zweite11<br />
Solii-atesrecle gibt offenkundig Plato seine Anschauung. Wer aber
Platos ,,sokratischeu Periode und der Pliaedriis. 85<br />
spricht claz~vischen in der ihr wiclersprechenclen ersten Sokratesrede?<br />
Norden (Aiit. Kunstpr. I. 109 f.) betont gut, dais sie nach den ausdriiclilichsten<br />
uncl hanclgreriflicliste1~ Indizien, wie dies bereits Aristoteles<br />
erkannte, ironisiere und dais ihr Stil Sopbisitenimitation sei.<br />
Aber welche^ Sophistili liopiert hier Plato ironisch? Wen will er mit<br />
cliieser Rede treffen, die weder lysianisch noch platonisch ist? Solirates<br />
will nicht sagen, woher er sie hat (235 C D), und doch fiihlt und spricht<br />
er sie als seine Rede. Beides muis seinen Grund haben. Es ist eine<br />
SokratesreCLe, aber aus fremder Quelle, und so kann Plato sie persiflieren.<br />
Er Bann ja von seinem Sokrates nicht den fremden Sokratilier nennen<br />
lassen, er kann nur dessen Sokrates ironisch reden lassen. Und ist de~ Sinn der Ecclo nicht „sokratisch"? Bruiis hat schlagend die genaue<br />
Vbereinstiminiing dieser Soliratesreile mit derjenigen Xen. Syrnp. V111<br />
gc~zeigt.~) Er liitte nur nicht folgern sollen, dais Xenoplion gerade aui<br />
Plato schöpft. Diese erste Soliratesrede ist ja bei Plato Persiflage uncl<br />
.i\+ird widerlegt, - und ihr soll Senophon ernsthaft folgen, wahrend er<br />
docli, wie Bruiis selbst staunend zugibt, nicht die leiseste Kenntnis<br />
~eigt von der ernsthaft platonisclieil zweiten Soliratesilede? J<br />
Wir liabeii also aiierliaiiiitermaisen in dieser Recle eine Soliratik,<br />
die von Plato ironisch genoinnien wird, der aber Xeilophon folgt iind<br />
die sich für Lysias entscheidet. Das sind die ersten leisen Daten für<br />
iliitistlienes. 31an wolle doch nicht leichthin über solche Deutung<br />
richten, bevor nlan eine andere Erlilärung hat fiir diese von Plato<br />
ironisch vorgetragene u?ld dann widerlegte Solrratesrede. Bald der<br />
Anfang, ein AIuseizanruf iiiit Wortdeutung höchst lcomisch gemischt.<br />
trifft den stets und auch stcts etymologisierenden<br />
1lCynilier. Oder wer soll sonst hier liarrikiert sein? Der Stil dieses<br />
Solirates ist scliwer pathetisch und gorgiaiiisclzz), wie er nur dem einzigen<br />
ansteht, cler sowohl Schuler des Solirates wie des Gorgias war,<br />
Antistheiies. Der Stil ist ferner so stark poetisch, dais er, wie Sokrates<br />
I
86<br />
I'latos „solrratisehe" Periode und der Phaedri~s<br />
tisthcnes trifft? Er ist hier Vorltiufer der Stoiker, die, wic sclioii<br />
Leller bemerkt, ihre Definitionen auf die Affekte wenden und sie inc~lii<br />
spraclilicli als psychologisch bestilm~~eii. Uncl wenn die Stoilicr den1<br />
[p~ unter den FnLYvpjnr seine Stcllc weisen und als solclie iiocli<br />
yaozee,cingyin (vgl. auch Antisth. Frg. 56, 1 W.), oivopAtlyia, Aayveia aufzählen,<br />
so ist diese gewollte Systcmatili bereits hier p. 237 D ff. gegeben.<br />
Am charakteristischsten aber für die kyiiischc Psychologie ist die sicli<br />
durch die ganze Rede ziehende Auffasswig cles Seeleiulebeils als Iiampf<br />
init den Begierden um IIerrschaft und Iiiiechtschaft. Cnd die „Tyrannis"<br />
der Begierden heilst ;roAii&i*tirto,i~ - rro,?t,/ieAE~ xai zoAzi~rd~q -<br />
ein Qreuel dein Kynikerß) ! Was aber der Begierde widerstrebt, ist die erworbene,<br />
rechte d6Eu (237 D), und eine 6v~v A;yo~~ d&~ irr; a6 de$;~<br />
6orr&avc xgn~?juaua F?r~:kv,t~ia ist der &cuc (238 U). Dies ist völlig unplatoniscli<br />
- aber l-iabeil mir hier iiicht genau die ailerliaililtermalseli<br />
ailtisthenische Bestiiliinuiig der Einsiclit als des$<br />
86 6 a E T 6 6 yo v (vgl. Überweg-Heiii~c, Grundr. S. 142" ?<br />
Wach der dqx+ fixFqecuc, die bci Aiitistllcnrs Wortdcfinitioi~ ist, folgt<br />
238 D ff. die eigendich Arguil~entatioii - grob ~tilita~isch, wie immer<br />
die kynische Argumentation, die gern clurcli praktische Vernunft Ge-<br />
fühle mit Füfsen tritt. Die Disposition: Nutzen und Scliaden der Liebe<br />
für Seele, Leib und Güter entspricht der ailtistlienischeii Lehre (vgl.<br />
Solir. I. 492 ff. U. ö.), dais die Seele das o;xtiov des Menschen, voll dem der<br />
Wert durcli den Leib zu den Giitern insdAA6zerov abfallt. Das lrynische<br />
Tdealprädilrat für die Seele ist belrraiintlicli pohvr,rroc (liier p. 239 B), cl. 11.<br />
praktisch vernünftig, und Antistheiles schrieb gerade iiber den hier (C E)<br />
als Nützlichlreitstypus erwiihnteil c,.clr go rroc (3. ~9,loq) uncl verstand<br />
sich gerade darauf, w a s 11 i e r g e s c h i e 1 t , die u;p~Ai~iovc n2>70/<<br />
richtig zu wkhleii und in T,iebe zu verbin(1ei1 - wie es ihm sein Sol-rates<br />
Xen. Syinp. IV. 64 bezeugt. Fiir den zu liebenden Körper (p. 239 CD)<br />
werden natürlich gar lieine ästlietischeii Ansprüche gemacht, sondern -<br />
doch wahrlich liynisch - Abhärtung, Gewöhnung an tapferen6vo~vgl.<br />
Ailtisthene3' Lobschrifteii auf den rrbvoS Laert. Diog. TI. 2 - und<br />
Verzicht auf allen Scliinucli uncl Scliniiiilie, die - mit dein beliaiiiiteii<br />
kynischen TiTertgegensatz (vgl. Sokr.II.337) - ciAA6rern und nicht oix~ia<br />
seien. Endlich wird Nutzen uiicl Schaden für die Besitztümer gewogen,<br />
als deren T-Iöclistes sehr moralistiscli Fan~ilieil- uncl Freundesliebe hingestellt<br />
wird (vgl. über die lrpiisclie Sozialprcdigt Solir. 11. 970, 994) ;<br />
der Lieberrde aber wünsche sein Opfer Gyn~to?„ r?ncx~dn, Gotxov -<br />
klingt's nicht wie eine spöttische Aiispieliiilg auf den brlranntc~i Kynikerstolz<br />
CinoA~~, 6o~xo~ usw. zu sein (1,. D. VI. 38) ?<br />
Der Liebhaber wird nun 240 U mit andern, dem Iiyilikcr gerarle<br />
verhaisten, durch Augenblickslust lockendeil xaxa vergliclieil, dem<br />
Schmeichler und der Hetäre (beide als verl~unf tgef iihrlich Antisth.<br />
6) Vgl. die zolve~S3~~ +Oov?j in der Diogeiiesrede Dio IV § 101 f. und die<br />
Sovleiu gegenuber den Ez~S.v~in~s ~ind speziell dem Eros Diog. Laert. V1 66.<br />
Clem. Alex. Strom. TI 492 P.
Platos „sokratischeA Periode iiiid der Phaedrns. 87<br />
Erg. 59,11 bekämpft). Uni aber den kynisclieii Stelmpel zu sichern,<br />
vergleiche inan z. B.<br />
Phaedr. 240 B Diogenes L. D. 51<br />
~6Aa xc, den~cj eicp xai , Eqcuzr/3).ric, zi zG113rj giwv xdxco.ra<br />
S/ldfi peyaAg<br />
ddx11ei. aWv -
8s<br />
Platas ,,sokratischeu Periode lind der Phaedrus.<br />
(241 A) uiid ~ocrog (238 E). Es gab aber zu Platos Zeit nur eiiicn, clcr so<br />
die Liebe bekämpfte: den Kyniker. Die T,iebe töte man durch Hungcr<br />
oder durch ilie Zeit und nötigenfalls durch einen Strick (Laert. Diog.<br />
VI. 86), denn einen Strick braucht, wer keinen tjoi,g hat. So lehrt Antisthcnes<br />
(Frg. S. 64, 45) uncl fordert immer wieder den ~~ofig (Frg.<br />
69,ll. 60,19), dessen Verlust eben hier dem Liebenden vorgeworfen<br />
wird (1). 241 A C). Ain lautesten spricht Aiitistlieiles, Frg. I seines<br />
Erotikos (nach Winckelinanii) : er will die Aphrodite als Verführerin erscliieisen,<br />
er beklagt den Eros als xaxiczv
Platos ,,solrratische'< Periode uni1 cler Phaedrus. 89<br />
Xag hier nun einzelnes bloise Vermutuiig bleiben, clie I-lauptsache<br />
stellt sicher: dass die persiflierende erste Sokratesrede genau den<br />
Standpunkt des Kynikers wiedergibt, der die Liebe als pathologisch bekiiiiipft<br />
uizcl Eingabe nur aus Vernunftbercchiiung fordert. Der<br />
Kyniker, der praktische Rationalist, der stets rasch bei der Hand ist<br />
qerade mit dem Scheltwort ~ifrz~i'n,ist der Kämpfer gegen die Leideiicchaft.<br />
Ihm gegenüber bringt der Phaedrus eine Rettung der irn~iin,<br />
clie herrliche Apologie der I,eidanschaft, die Plato in seincn Dieisst<br />
ni~mnt als Flügelrois cler Seele. Und mit adligem Gespann fährt er iii<br />
clen 1-Iimmel cler Erlieliiitnis, wihrend der lrynischc Plebejer auf aüchterneiii<br />
Boden wandelt. Der Gegensatz bricht hier hervor bei einer<br />
Gescliinaeksfrage, bei der Wahl zwischen dem Biedermeierstil cles<br />
'echiiendeti Sachmra1tei.s Lysias und dein höheren Schwung des Isolrrates.<br />
Aber clie lauft ist I'lato schon tiefer bewuist. Entgegen dem scliönheitsfei~idliehen<br />
Kyniker würdigt er selbst den Körperreiz als Abbild<br />
cles ideal Schöiieii. Reicher abgestnft ist ihn1 die Welt als dem Kynilrcr,<br />
und seine weitere Seele, der nichts Menschliches fremd ist, vergewaltigt<br />
nicht die Triebe, sondern adelt sie in höherer Eiitfaltung. Eier, in1<br />
Innersten, im Reichtum der Pensönlichlreit, darin, dais seine Seele eine<br />
Skala hat, liegt sein Gegensatz gegen den Kyniker. Und er weiis ea<br />
und hat bereits seine polyphone Seele theoretisch ausgebaut in seiner<br />
Psychologie, und er verteidigt sie ja bereits, wie inan längst gesehen,<br />
230 A gegen deii ICyiiiker, der die komplexe Seele Platos ein gescli~~~ollcnes<br />
Ungeheuer voll c&joc schilt. Aber er, der alles als dli.n.rQ~n<br />
veraclitet neben der Pflege der Selbsterkenntnis, muis sieh hier 229 D E<br />
von Plato sagen lassen, dais er selber Allotria treibe mJit seiner<br />
rationalistischen Mythe~~deiitung, die das mühselige Geschäft eincz<br />
derben (!) Verstandes sei, wie es dein allcrdings zieme, der den /rc;~ioi<br />
preise uncl die ci~z~~icr verachte, daCs aber der ICeriipunlrt, der erst zu<br />
erledigen, eben die wahre Selbsterkeiintni~, vielinehr in der Frage dcr<br />
Iiomplexitiit der Seele liege.<br />
Vnd diese Frage spielt weiter, dieser Fingerzeig Platos wird rich-<br />
tunggebcncl noch fiir clen späteren Abschnitt des Phaedrus, für die Rhc-<br />
toreiikritilr. Cewiis, auch so gilt die scharfe Kritilr der gorgiaiiischeii<br />
Rhetorik, clie deii Schein statt der Wahrheit suclit (p. 260ff.), und<br />
die erste Solrratesrede zeigte sich durch clie treffliche Voranstelluiig<br />
cler Begriffsbestimnluilg lcunstreicher als die Lysiasrcde (das Selbstlob<br />
cles Sokrates 263 D ist eben wieder nur zu verstehen, wenn der plato-<br />
ilische SoIrrates einen anderen lobt). Aber diese Begriffsbestimmung<br />
cler ersten Sokratesreclc genügt nicht, sondern es gilt in wahrer Dia-<br />
lektik neben dein liranlreii 1,iebcswahilsiiiil einen göttlichen zu iiiiter-<br />
scheiden (p. 266 f.), es gilt eine feiner differenzierencle und zugleich<br />
syiitlietisclie Psychologie, die das v i e 1 a r t i g e Weseii der Seele lreniit<br />
rincl clas Viele doch in e i ii e r I d e e zusammenfaist, und ohne diese<br />
Psychologie ist eine wahre Rhetorik als Psychagogik uilinöglich - das ist,<br />
was Plato in deii weiteren Erörteriingeii ausführt (vgl. nani. 265 D,<br />
270 Clff., 271, 273 D, 277 B C). Maii muis clic Seele in ihrer koinplexeii<br />
Maiinigfaitigkeit lreiliscn, wenn man auf sie wirken -will - und clas
90<br />
Platos ,,sokratisclieK Periode uiid der Phaedrris.<br />
sollte sich gerade i~iitistlieiies inerlren, der auf der Einfachheit der Seele<br />
beharrt (vgl. Solrr. I1 602 ff., 612) und clocls gerade den als guten<br />
Redner preist, cler sich der Vielheit der Iiidividualitiiten iiilpaist<br />
(Antistls. Frg. S. 23 W). Aber was schreibst du rrqi A6;ewS + negi<br />
~neaxzq'~wv (Antisth., 1. zo~tog), wenn du nicht eininal die lroinplese<br />
Katur der Seele einsiehst ?<br />
Der Phaedrus verküildet nicht nur, sondern verteidigt bereits die<br />
clreiteilige Seele; denn das Scheltwort vom typliösen Ungeheuer 230 A<br />
e-iithklt anerlranntermaisei~ bereits ihre Icritilr seirtcns des Kynikers.<br />
Spricht dies gegen die Priorität des Phaedrus unter den platonisclien<br />
Schriften? Es ist jüngst mit Recht auf den Stachel inüiidlicher äufsei.ungelz<br />
hingewiesen worden, der reicher und lebeiidiger wirlrte als der<br />
literari~che.~) Es bedurfte lreiner Schriften, um Platos Lehre zu Antistheiies,<br />
und Antisthenes' Kritik zu Plato gelaiigen zu lasse~~. Und<br />
welche andere Schrift, die clic dreiteilige Seele lehrt, will man dem<br />
Phaedrus vorangehen lassen? Iinmisch zeigt jetztg) in seiner Untcrsuchung<br />
der aiitiken Nachrichlcn über die Datierung des Phaedrus, dais<br />
die Spätdatieruiig erst ein jungakaclemisclies Teiideiizproduli~ und dal's<br />
auch seine Frühdatierung zwar teirdenziiis ausgenutzt ward, aber auf<br />
guter alter Nachricht beruht. Diese Nachricht Bann aber dann nicht<br />
die Urteilsbegründung (~~FLQUXL(~RFC) enthalten, sonclern nur den Phaedrus<br />
als erste Schrift Platos verzeichnet haben. 'ITnd hierfür gibts<br />
keine wirklich entscheidende Gegeninstaiiz, seit sich die sog. solrratische<br />
Periode Platos iii ein Phantom aufgelöst.<br />
Das einzige Bedenken gegen die Prioritat des Phaedrus machte mir<br />
ILU~ der Gorgias, da man seine Erörterungen, Pliaedr. p. 260 ff. relrapi-<br />
tuliert und 260 E 261 A geradezu zitiert fiucleii will.lo) Aber zitiert hier<br />
Plato mit den „heranlrommeiiden Reden", die er „zu hören glaubt" und<br />
nun nicht ohne Läcl~eln pathetisch preisend vorstellt, wirldich seine<br />
eigenen Reden? So sieht es nicht aus, uild zudem wird ja als Redner<br />
hier ausdrücklich 6 A&xcuv zitiert, von dem cler Gorgias nichts mcils.<br />
Es ist bequem, den unbequmen Lalroner init seiner doch gerade iini<br />
folgeisdcn begrüisdeteil These einen1 Iiiterpolator aufzuhalsen, bei den1<br />
er aber nur noch ratselhafter wird. Allerdings solcratisch niüsseii diese<br />
Reclen sein, da sie „Philosophieu fordern (261 A), und sie eifern mit<br />
dem platonischen Gorgias gegeii die gorgianische Schelinlrunst. Abei<br />
haben nicht schon Dümmler, Hirzel, Gomperz U. a. gefunden, dais<br />
Plato gerade im Gorgias niit dem kynischeii Sokratilrer zusammengeht,<br />
der ja selber gegen den sizilischen Rhetor geschrieben? Antistheues<br />
ist ferner Lakonist, er liebt auch gerade (Giioin. Vat. 11) die Brachylogie<br />
cler Lalionismen, und er am ehesten konnte den ddxri)~? als Kritiker<br />
cler Rhetorik und, worüber schon Plato spottet, als Lehrineister cler<br />
8) V. Holzinger, Festschr. f. Vahlen 1900, wo S. 680 die Beziehung von<br />
Phaedr 230A auf Antisthenes zugegeben wird.<br />
9) Ber. d sächs. Ges. d. Wiss. 1906 S. 313 ff.<br />
10) s Zeller IIa4 541,1, Dümmler, K1. Schr. I 259, Natorp, Platos Ideeii-<br />
lehre S. 63.
Platos .sokratischeY Periode und der Phaedrus. 9 1<br />
l'hilosoplzie auftreten lassen (s. Näheres Sokr. 11. 757 f ., i67). Aber<br />
Inan selie auch, was dein Lakonierzitat (p. 260) vorangeht: eine von<br />
Plato selbst als derb bezeichnete Schmähung der Rhetorik mit eiizeim<br />
Eselvergleiclz, drr auch izicht iriz Gorgias steht, abcr schon von Wiiiclrel-<br />
inann izaclz eiiiein parallele11 Dilrtum L. D. TI. 8 auf Antisthenes be-<br />
zogen wurde. Und was folgt jeiiein Zitat I?. 2612 Scherzliafte Be-<br />
rufungen auf all die Rhetorilrlehre~z eines Odysseus, Nestor und Pala-<br />
inedes, die doch sicher nur der I-lomeriilterpret Ailtisthenes gekannt hat.<br />
Und wenigstens iiber seine Rhetorilr des Odysseus ldärt ja sein Frag-<br />
ineilt S. 24 P. W auf.ll) Da hiernach die „lzerankomineildcil Reden" mit<br />
eher Antistheizes rekapitulieren als den platonischen Gorgias, auf den<br />
nichts eiiizeliies zutrifit, so fällt das letzte IIiiideriiis dahin gegen<br />
die Priorität des Phaedrus.<br />
Eiiz Werlr des „jugendlicheni1 Plato braucht er daruin nicht und<br />
lrann er nicht sein; deiziz der Scliulgrüilder verküizdet hier die fertigen<br />
Crruildlagen seiiier Zehre. Und so ist mir, gestützt noch durch iiziieie<br />
Gründe, wie sie jüngst Natorp beibrachte, und durch iiuisere, wie sie<br />
die Verhandluageil über die Sophistenrcde ergaben, die Datieruizg uizz<br />
390 am wahrscheinlichsten. Der Phaedru's lreiiz Jugendwerlr, abcr das<br />
Erstliilgswerk: darin scheint mir der Ausgleicli gewoiziioil zwischen<br />
den streiteiideil Parteien iiz dieser Frage, aii der da5 Verstänrlnis Platos<br />
Iiällgt.<br />
11) Nohl, Sokrates U. die Ethilr S. 45 ff. macht jetzt wahrscheinlich, dafs<br />
auch das Medizinvorbild p. 270 Zitat ist (mie ich glaube, des kynisehen „Seelen-<br />
arztes"). Durch die Priorität des Phaedrus wurde sich auch Nohls Bedenken<br />
gegen die Deutung der kleineren Dialoge als Kritiken (ib. 8. 67) erledigen. Er<br />
macht gerade deutlich, dais diese die in den gröisereri Dialogen gelösten Aporien<br />
aufdecken, und erkennt S. 83, dafs Plato ~ielfach von den Problemen des<br />
Antisthenes bestimmt wird.
Spinozas Tractatus politicus<br />
und die parteipolitischen Verhältnisse der<br />
Niederlande.<br />
Von<br />
Dr. Alfred Kühne, Charlottenburg.<br />
ni Frühjahr 1672 hatte T,i*dwig SIV. deii Krieg gegeu die Sieclcrlaiide<br />
begonnen uncl eirieii grolseil Teil des Landes erobert, ohne<br />
Widerstand zu finden. Da stürzte in Holland das niedere Volk<br />
die Herrschaft der Staatcilpartei, die unter Führuilg des Ratspensioiiiirs<br />
Jarl de JJTit eine verhängiiisvolle Friedenspolitik getrieben<br />
lind T-Teer und Festuiipcii vernachliissigt hatte. Der junge Wilhelm von<br />
Oiailieil wurde zum Statthalter uiicl Füliier des IIeeres ernannt. Damit<br />
war das Volk i~och nicht zufrieden, es wendete seine Wut gegen die<br />
Fülirer der bisherigen Politik. (!ornelius de Wit, cler Bruder Jans,<br />
wurde einer Verschxvörung gegen deii Prinzen von Oranien angeklagt<br />
und ins Gefängnis geworfen. Als er am 20. August freigelassen werden<br />
sollte und sein Erucler zu ihm gekoinmei~ war, da erbrach die oianisch<br />
gesinnte Bürgerwehr von EIaag das Gefängnis lind rifs die beiden buchstablicl-i<br />
in Stücke.l)<br />
In der Nacht nach dieseln Schreelrenstage spielte sich iil dein IIause<br />
tles ehrsameil Malerrneisters Hendrilr vair deii Spyck, das in der stillen<br />
Paviljoensgraclit zu Haag gelegen ist, eine bemerkeiiswerte Szeiiv ab.<br />
Der stille Gelehrte, der cloit die Gicbelstube bewohnt, ist so erregt über<br />
die Ernlorduilg, dais er einen Aiifruf verfaist, der die ultimi baibarorum<br />
anklagt ihrer Greueltai. Null will er hinauseilen und in cler<br />
Kille des Gefai~genpoorts sein Manifest öfientlich ailschlageii. Aber<br />
der sorgliche van Spyclr erkennt, dais sein Mieter sich der Gefahr aiissetzt,<br />
gleichfalls von dem wütenden Pöbel zerrissen zu weideil, und verschlierst<br />
die Tür. Der mutige, unerschrockene Manil, der sein Lebeii<br />
einsetzen wollte, um seine Meinung öffentlich kuilrlzugebeil, war Barucli<br />
Spinoza.')<br />
1) Lefebre-Pontalis, Jean de Wit. 11, 514 f.<br />
2) Spinoza selbst hat davon später Leibniz Mitteilung gemacht. Vgl.<br />
Freiidenthal, Die Lebensgeschichte Spinozas, 111, 20, S. 191. Meinsma, Spinoza<br />
en zijn kring, 328f.
Spinozas Tractatus politicus U. die parteipolit. Verhiiltnisse der Niederlande. 93<br />
Was trieb doch den Philosopheii, der so einsam und zurücligczogeii<br />
lebte, der so ruhig und erhaben über deii incizschliclzcil Leideiischaften<br />
dastand, in deii Tageskanipf eingreifen zu wollen? War es<br />
die sittlichc Eiitrustuilg über die ungerechte Gewalttat cler Masse oder<br />
das tiefe Mitgefühl für das sclireckliclie Schiclisal des Freuiides? Oder<br />
wollte er als Gesinizungsgenosse für die Politilr des Ra tspeizsionärs eiiitreten?<br />
Wir können das niclit inelir entscheiden, aber es loliiit sich wohl,<br />
den Beziehungen nachzugehen, die z\vischcii Spiiioza lind de Wit bestanden,<br />
und zu untersuchen, inwieweit der Philosoph in seinen politischen<br />
Schriften von dem Staatsinanne gelernt liat. Dais Spiiloza mit<br />
de Wit näher verlrehrte, von ihm eine Pension erhielt und auch iiz wichtigen<br />
Angelegeiilieiteii uni seiiie i\l1einuiig gefragt ~vurdc, berichtet<br />
bereits die alteste, gewöhillich dcm Arzte Lulras zugesclzriebeile Biographie."<br />
Zwei Pamphlvte aus dein Jahre 1672 werfen Jarl de Wit vor,<br />
dais mit seinem Wissen der tractatus thcologico-politicus gedruckt sei,<br />
der, von dem abtrünnigen Juden Spiiioza aus der ITUlle geholt, auf eine<br />
unerhörte Atlicisteiiart beweise, dars Gottes Wort durch die Philosophie<br />
ausgelegt und verstanden werden inüsse." Die Uiitcrsucliuizgeii voll<br />
31eiiisnia5) und Dfeijer6) lassen es als sicher erscheineil, dais tatsichlicli<br />
dc Wit die TTeröffeiztlichui~g gut gelieiiseii uiid die heftigen Angriffe der<br />
Geistlichen gegen diese Schrift, so lange er den Staat leitete, unscliädlieh<br />
gemacht hat.<br />
Aber der Eiilliuis de Wits auf Suiiloza ist weseiitlicli aiöiser. als<br />
man bisher erlrannt hat. Spinoza steht in seinem tractatus politicus,<br />
an dem er bis zu seinem Tode gearbeitet hat (1677), direkt unter clem<br />
Einflufs der Anschauungen, dic de Wit uiid sein Iireis vertraten. U111<br />
(las zu erweisen, ist es allerdings iiotweildig, diese Schrift auch nach<br />
ihrem systematischen Aufbau uiid philosophisclien Gcdaiilreiiiilhalt lrurz<br />
zu betracliteii.<br />
Da hat nlan allerdings zunächst einen anderen Eindruck: er stellt<br />
sich dar als das Werk eines Philosophen, der über die gruildsätzlichcii<br />
Fragcil des Staatslebens sich äuisert und seiiie Politilr in Zusarnmcnllang<br />
mit seinem System bringt. An den Satz der Ethilr: uilaquaeque<br />
res, quaiituni in se cst, suum esse coizservare conatur,') Irnüpft er an.<br />
Auch für den Staat ist das oberste Gesetz das der Selbsterhaltung.<br />
Auch für den Staat gelten die Affekte, die auf diesem Triebe beruhen.<br />
Hoffnurig, Furcht usw. werden maisgebend für die Gründung uiid Gestaltung<br />
des Stantes.3) Die Affekte führen dazu, den Naturzustand, den<br />
auch er init Hobbes als Krieg aller gegen alle ansieht, zu iiberwiiideil<br />
und Vereiniguilgeiz zu gemeinsamen Zweclreil entstellen zu las sei^.^)<br />
Von nun an hat diese Gemeinschaft, der Staat, allein zu bestimmeil,<br />
was Recht und Unrecht ist. Das Iiccht des Staates geht so weit, wie<br />
scine Maclit;lO) die I-Iaupteigciiscliaft des guten Staates ist die<br />
3) Freudenthal, S. 15, 238f. -- 4) Ebenda, S. 194 - 5) Meinsma, Spinoza<br />
en zijii kring, S. 325. - 6) Archiv f. Gesch. cl. Phil, XVI, 479. - 7) Eth. 111, 6.<br />
Tract. pol, 11, 5, 7, Irr, 18. - 81 Salinger, Spinozas Lehre von der Selbsterhaltung,<br />
S.39f. - " Tract.1101 , II,14,VI, 1. - 10) Ebenda, 11,17,IlI, lf , III,8, 9.
94 Spinozas Tractatus politicus 11. die parteipolit. Verhgltnisse der Niederlandc.<br />
Sicherheit, der Friecle; der sicherste, der inächtigstc Staat ist der, clcr<br />
nach den Gesetzen der Vernunft eingerichtet ist. Vernünftig ist es vor<br />
allem, Gedankenfreiheit zu gewälircii iiiid tolcraiit gegeii die ver-<br />
schiedeileil Bekenntnisse zu sein.ll) Das Verhältnis mehrerer Staaten<br />
zueinander regelt sicli nach dem Naturreclit. Jeder Staat ist berechtigt,<br />
Krieg bis zur Unterwerfung des Gegners zu führen. Verträge sind blois<br />
so lange gültig, als sie vorteilhaft für den Staat sind. Sobald sie der<br />
Macht des Staates schaden, ist es Pflicht der Regierenden, sie zi~<br />
brechen: voll Trt~iilosiglceit kanil iliclit die Rede seiii.")<br />
Der Haiiptzweck des Staates, rlie Sicherheit. kaiiil schliefslich unter<br />
jeder Verfarsuiig verlvirklicht werden, wen11 sie nur iii bestiinmter Weisc<br />
eingerichtet ist. Deli Plan voii solclien Idcalverfassungen gibt dann Spi-<br />
noza nach der vom Altertum überltoinnienen Einteilung in Monarchie,<br />
Aristokratie iiiid Demokratie.<br />
' ' Gegen die MonarchieL3) hat Spinoza eine unverlcennbare Abneigung,<br />
ihre Gefahren hebt er ininier wieder hervor. Die Macht des einzelnen<br />
Melischeil ist zu gering für die Riesenaufgabe, den Staat zu lenken. Ist<br />
der I-Ierrscher zu jung oder zu alt, so geht die Macht auf die Beamten<br />
über, und auch sonst besteht die Gefahr der Günstlingswirtschaft. Der<br />
Monarch ist zuni Kriegführeii geneigt, seine Familienverbindungen ver-<br />
anlassen ihn oft dazu. Der HoE und sein Luxus lcosten uilgehenrc<br />
Sunime~i, mirltlich~ Freiheit ist iii der Monarchie unmöglich.<br />
Damit diese Gefahren vermiede11 werden, miils die Macht des<br />
Moiiarchen beschrankt werdeii clurch einen Rat, der etwa ciii Mitteldiiig<br />
ist zwischen der stiiidisclieii Vertretung des DXittelalters und dem mo-<br />
dernen Parlament. Das Heer soll eine unbesoldete, nach der allgemeinen<br />
Wehrpflicht ausgehobene Bürgerrniliz sein, da diese sich nicht zum An-<br />
griffskriege eignet. Grund lind Boclcii sollen Staatseigentum sein, voii<br />
den Pachtgelclern werdeii die Staatsausgaben bestritten.<br />
Weit besser als die Moiiarchie ist die Aristolrratie.I4) Ein groiscr<br />
Rat als Souverän hat mehr Macht als ein eiilzelner, er Iraiin eine nahezu<br />
iinumschränlcte Herrschaft aiisübeil. Eine Versammlung ist auch sozu-<br />
sagen unsterblicll, ilir Wille daher auch beständig. Die Zahl der Herr-<br />
scheiideii, dcr Patrizier, muis groCs seiii, zwei bis drei Prozent der Be-<br />
völkerung, dcnii die Veriiiinftigcn sind selten. Diese Veriiünftigeii<br />
allerdiiigs dringen mit ihrein Rate durch, die %!enge 1can11 nur durch<br />
Vernunft geleitet werden. Die Patrizier werden l~ooptiert, haben be-<br />
solidere Elirenvorreclite, gute Eiiilcüiifte und alle clieselbe Religion. Die<br />
Leitung der Versarnnilung liegt iii der Hand der Syiidici, die vor allem<br />
die Wahrung der Verfassung zu überwachen haben. Die ausführende<br />
Behörde ist der Senat, der periodisch zusainmeiitritt, sollst durch gc-<br />
schaftsführende Ausschüsse vertreten wird. Er hat Recllt zu sprecheil,<br />
Steuern einziiziehen, militärische Siclierheitsmalsregelii zu treffeii, mit<br />
auswärtigen Gesandten zu verhandeln. Die Gefahr der Besteclilichlceit<br />
11) Tract. pol., 11, 21, 111. 7, IV, 4, V, 6. - 12) Ebenda, 111, llf. -<br />
13) Ebenda, V1 U. VII. - 14) Ebeiida, VIII.
Spiiiozas Tractatus politicus U. die parteipolit. T7erhBltnisse der Kiederlande. 95<br />
svll durch die groise Zalil cler Senatoren uizd Riehtcr vermieden werden.<br />
Jeder liat Glaubensfreiheit, docli ist uiiuinschränl
96 Spiiiozas Tractatiis politicus ii. die parteipolit. Verhiiltnisse der Niederlande.<br />
ciii reiclies Geistesleben entfaltet sich. Die Patrizier sind d~irc11aus<br />
tolerant. Übrr alle Städte ragt Amsterdam hervor, dio Ilauptstadt der<br />
gröisteil Provinz Holland. Der wichtigste politische Beamte der Yroviiiz,<br />
der Ratspeiisioilär, ist iil der Regel zugleich cler Fiihrer des Patriziats,<br />
der Staateiipartci.<br />
Ihr gegenüber steht seit Beginii einer eigeneii liolläiidischeil Geschichte<br />
das Ilaus der Oranier. Sie waren die Statthalter der Provinzen.<br />
Ais die groiscil Feldherren und Staatsmäriiier hatten sie vor allem die<br />
Freiheit der Niederlande erkämpft. Sie wollteil stets den Krieg fortsvtzen<br />
bis zuin änisersieii. denn darauf beruhte ihre Macht. Sie xirareii<br />
getrageii von der Begeisterung des T-leeres und der breiten Nasse, des<br />
Janhagels. Sie sind rlemol
Spiilozas Tractatus politicus U. die parteipolit. Verhältnisse der Niederlande. 97<br />
ilbsicliteil dc Wits, seine Politik jourilalislisch verfecliten. Besoilders<br />
herühnit ist die Schrift „Hollands Iiiterestk,l" die, ~iin Sreitsclilies %'orte<br />
zu gebra~icheii, nlit seltenem Talent uiid selteriern Cynismus ein Bild von<br />
dem Manchestertum des 17. Jahrliuildert entwirft. Die Lehre der freien<br />
Konkurrenz, der ruclisichtsloseri Interessciipolitili, wird gepredigt, Ficilieit<br />
des Glaubens uiid der Presse gefordert. Ja11 de 14% selbst hat das<br />
Xanuskript der zweiten Auflage durcligeseheii und zwei Kapitel liiiizugefugt.<br />
Er wirft darin den Oraniern die uilllulze Verlingerung des<br />
Krieges gegen Spanien, das Cbermais der inilitarischeri Ausgaben, den<br />
Niedergang der Seeinacht und das rrberwiegeii der dynastisclieil Iiiteressen<br />
vor, walireiid die neue Regierung sich ruhnie11 lröiine, die Steuern<br />
lierabgesctzt, das IIecr vermindert uiid die iiiiiercii Gegensatze beruhigt<br />
LI<br />
Ein zweites, umfailglichcres Werk, das wie „FIollaiids IiiterusL"<br />
ebenfalls aiioilym, unter dem Buchstaben V. Ei., erschien, 3iiid die „Coilsi(leratie11<br />
van Staat ofte Polityke Weegschaall', 3. Aufl. Amsterdant 1662.<br />
Spiiloza lieiliit das Werk, es ist in seiner Bibliotlielr eilthalte~l.~l) Er<br />
zitiert es sogar, was er sonst nur ausilalimsweisc tut: er stimmt den<br />
Oriindeli, die der prudeiztissiinus Uclga V. 13. gegen die Jlonarcliic vorbringt,<br />
zu, insbesoildere soweit es die hohen Kosteil betrifft.?" Die<br />
Weegsclial hat, wie gelegentlich schoii Xcijcr erwalintlt,23) viel Alinliclilreit<br />
mit Spinozas tractatus politiciis. Bei geiiauer Uiitersiichuiig zeigt<br />
sich, dais sie für. grolsere Partien die 1Iaiiptcluelle Spinozas gewesen ist.<br />
Der leiteiidc Cedanlie, das Abwagen der Staatsformen gegeiieinailder,<br />
fiiidet sich bei Spiiioza wieder, aiicli die Qruiiclaiisichtcn sind dieselben.<br />
Die Abneigung gegen die Monarchie tritt starlr her~or.?~) Ain<br />
besten erscl~eint eine Aristoliratie, die sicli der Demokratie iiahert.<br />
de la Court legt, gerade wie nach ihm Spinozn, besonderen Wert auf die<br />
grolse Zalil der Patrizier; so werde alleiii die IIerrschaft fest gegru~idet,<br />
der Friede gesichert, der üunsturz und die Bestechlichkeit uiiriiöglich<br />
gemacht. In der gcriiigeil Zahl der hollandischen Aristokraten sielit er<br />
eine I-Iauptgefahr fiir cleii Staat. Eur jede Aristoliratie bedeute es eine<br />
groise Gefahr, weil11 ein Oberhaupt vorhandeii ist.?j) Die Beispiele aus<br />
der Geschichte, die de la Court insbesondere fur die Aristolrratie ausführt,<br />
werden voll Spiiioza vcrmreilclct. Der Entwurf der Aristoliratie<br />
im VII. Ruclie des tractatus politicus stimint den1 Gedankengange nacli<br />
wie in vieleil Einzelheitcii zu der Schilderung, die V. H. im Aiischlufs<br />
ail ContariiliL" 7ro11 der Verfassung Venedigs gibt.")<br />
19) Interest van Holland ofte Groiide van Hollancis Welvaren. Von V. L). H.,<br />
3. Aufl., Amsterdam 1662. 0. van Rees in seiner Abhandlung: Anwijsing der<br />
politike Gronden en maximen van Holland bezeichnet Jan van dem Hove<br />
(Jean de la Court) als Verfasser, wahrend mau fruher Pieter de la Court dafur<br />
ansah.<br />
20) Lefiibre-Pontalis, Jean de Wit, T, 314f - 21) Freudenthal, 161f. -<br />
22) Tract. pol., VIII, 31. - 23) Archiv f. Gesch. d. Phil., 15, 27. - 241 Weeg-<br />
schaal, 62f, 307f - 25) Ebenda, 332f., 614f. - 26) Ebenda, 352. - 27) Vgl.<br />
zu Contarini: Ranke, Zur venetianischen Geschichte, Werke, Ed. 42, S. 31.<br />
Philosoph. <strong>Abhandlungen</strong>. 7
98 Spinozas Tractatus politicus U. die parteipolit. Verhiiltnisse der Niederlande.<br />
Zuerst werden die Gruiidlageii des Staates behandelt, dann die Ziisammensetzung<br />
uild die Befugnisse des magnum coilcilium, consiglio<br />
grailde, erörtert. Die Zahl der Patrizier, 5000, stimmt mit der von Spinoza<br />
gemachi,en, an sich ~inbegriindeten Angabe übereiil.'s) Beide gehen<br />
dann auf die Vorsitzenden, bzw. Auf sichtsbehördeii über. de la Court,<br />
liandelt dabei naturgemäls von den Dogen. Aber aucli Spinoza erwähnt<br />
genau aii derselben Stelle, dais in Venedig und Genua der Herzog die<br />
Befugnis hat, den Groiseii Rat zu berufeil. Er verwirft die Einriclitung<br />
als dem Wesen der Aristokratie völlig widersprechend. Erst<br />
dann kommt er auf die Synclici zu sprechen, die vor allem die Wahrung<br />
der Gesetze und Amtsführung der Behörden zu Übermachen haben. Sie<br />
haben vieles mit den venetianischen Avvogadi di Commune gemein. Fiir<br />
die Wahl und Abstimmung empfiehlt Spinoza direkt den Modus<br />
Venedigs, den de la Court ausfülirlich beschreibt. Spinozas dritte ~viclltige<br />
Behörde, der Senat, der die Exekutive besorgt, liat etwa ähnliche<br />
Befugnisse wie der Kleine Rat von Venedig, der gleichfalls Senat genannt<br />
wird. Sehr auffallend ist es, dais Spiiioza ausdrücltlich hervorhebt,<br />
diese Behörde habe keine Beainte zu wählen, nicht über Krieg und<br />
Friedeii zu entscheiden und nicht neue Tribute aufzuerlegen. Nacli<br />
dem, was über den Grol'sen Rat gesagt ist, kann kein Zweifel sein, clais<br />
dies dessen Befugnisse sind. Aber die Bemerbring an dieser Stelle wird<br />
sofort verständlich, wenn inan die Darstellung der Weegschaal vor Augen<br />
hat. Danach hat der Senat eine beträchtliche Anzahl von Behörden zii<br />
wähleil, Tribute zu bestimmen und über Krieg und Frieden zu entscheiden.<br />
Auch iii dem, was über das Gericht und die übrigeil Behörden,<br />
insbesondere den Geheimschreiber2~ gesagt wird, zeigt sich meit,gehende<br />
Übereinstimmung. Es kann danach kein Zweifel sein, dais die Polityke<br />
weegschaal die I-lauptquelle für clas VII. Buch des tractatus politicus<br />
ist. Spinoza würde walirscheinlich l~ci einer noclimaligen Überarbeitung<br />
manche Unebenheit, die durch die Quelle bedingt ist, beseitigt haben.<br />
Die Anlehnung gerade an de la Court zeigt, wie stark Spiiioza unter<br />
den Einfliisseii des de Witschen lireises stand.<br />
Für die Schilderung der Aristokratie, die aus mehreren Städten besteht,<br />
lehnt sich Spinoza eng an die Verfassung I-Iollancls an. Nicht<br />
nur die Grundzüge, sondern auch so auffallende Bestimmungeil, wie<br />
über Ort und Zeit der Ratsver~ammlniig,3~) über die Bevorzuguiig der<br />
Seestädte, über die Behandlung der unterworfenen Provinzen und<br />
Städte,31) aie Deckung der Staatsltosteii diiich Xatrikularbeiträge,"')<br />
stimmeii init dem Bestehenden völlig überein.<br />
Freilich fehlt es auch niclit an Abweichungen, die man als Kritik<br />
der holländischen Zustände ansehen liann. Er hält eine groise Zalil von<br />
Aristokraten für notwendig, er sucht die so frölilich gedeihende Bestcclilichlceit<br />
unmöglich zu machen.33) Er verlangt, dais bei Beschlüssen die<br />
Mehrheit entscheidet, also das liberum veto beseitigt wird,34) er fordert<br />
2s) Weegschaal, 370f. - 29) Tract. pol., VIII, 44; Weegschaal 350. -<br />
30) Tract. pol., IX. 9. - 31) Ebenda, IX, 8. - 32) Ebenda, IX, 13. - 33) Ebenda,<br />
IX, 14. - 34) Ebenda, IX, 4, 6.
Hpinozas Tractatus politicus n. die parteipolit. Verhilltnisse der Niederlande. 99<br />
ein liöclistes B~iiidesgericht.~~) Frcilich das, was clem holländischen<br />
Staate ani ineisten fehlte, die eiiilieitliclie Leitung, die alle Iiräfte zusaiilmeiifaiste<br />
und auch iin Iiainpfe die Groismachtstellung des Staates<br />
wahrte, das hat Spinoza nicht erlianiit, auch dann nicht, als clie Friedenspolitili<br />
IIolland an den Raiicl des Verderbens grbracht hatte und die<br />
Brüder de Wit als Opfer der Volkswut gefallen waren. Ja, er ist so<br />
chrlich überzeugt von der Gefahr eines Oberhauptes in der Aristokratie,<br />
dafs er einen Grund cles Ungliiclrs in rler fast monarchischen Stellurig<br />
cles Ratspensionärs, seines Freuiides Johaiiri de Wit, sieht.36) Der<br />
~viclitigste Grund fiir den Untergang der alten Verfassung aber scheint<br />
ihm der zu sein, dass die Liiclie, die durch die Beseitigung der Oranier<br />
entstanden war, iiiclit zweckeiitsprecheiid ausgefüllt wurde.37) CL. C. L<br />
Die Stellung, clie Spiiioza irn tractatus politicns einnimmt, unterscheiclet<br />
sich in inanclieii Pniilitcii von der, die er noch im tractatiis<br />
tlieologico-politic~~s vertritt. Auf die bedeutsamsten Unterschiede hat<br />
A. Meiizel l~inge-ouiesen.~~) E'riilicr denkt sich Spjnoza den Staat entstailden<br />
durch die Vernunft, später durch die Affekte; friiher will cr<br />
dem einzelnen in jedein Falle da? Recht cler freien MeiiiungsäuSserung<br />
und des inneren Gottesdienstes gewahrt wissen, später sieht er die<br />
Staatsgewalt rechtlich als scliraiikeiilos an. In seiner früheren Zeit<br />
scheint ihm clie Demokratie clie natürlichste und beste Staatsform,<br />
spiter zielit er die Aristokratie vor. Menzel weist zur Erklirung darauf<br />
hin, dafs Spiiioza früher von den Iiollegiaiiten, dic eine auiserordentlich<br />
lose Rirchenverfassung hatten, beeinfluist sei, während später die<br />
Aiischauungeii de Wits iiiid sein Schiclisal bestimmend gewesen seien.<br />
Dals die Kollegianten, mit denen Spinoza wälireild seiner Rijiisburger<br />
Zeit viel verliehrte, indirekt aiich auf Spiiiozas politische Ansichten eingewirkt<br />
haben können, ist gewiis möglich. Doch scheint mir zum Verstkndnis<br />
allein das persöiiliclie Erleben des Philosophen zu genügen.<br />
In sciner Jugend hate er sich losgerungen von dem Glauben seiner Väter,<br />
und die bitteren Erfaliruiigeil, die er dabei sammelte, hatten auch seine<br />
Überzeugungeii bilden helfen. Im theologisch-politischen<br />
Traktat zieht er das Ergebnis seiner inneren und aufsereil Kampfe uncl<br />
stellt sie objektiv dar als clie Forderuiigen der Veriiuiift und die Lehren<br />
cler jüdischen Geschichte. Er verwirft die Theokratie, der Staat muss<br />
die Entscheidung auch uber das sakrale Recht haben, dem einzelnen<br />
aber Gedaiilienfreiheit gewähren. Weil Spinoza den Kampf, den die Zeit<br />
gegen kirchliche Bevorinunduiig führte, selbst so tief und innerlich<br />
durchkostet hatte, deswegen verinoclite er in dieser Frage Eigenes und<br />
Neues zu sageil. Dic Idee der Freiheit, die ihm dabei besonders wichtig.<br />
war, lieIs ihm als zweclrmalsigste Staatsform die Demokratie erscheineil.<br />
Über die Frage, ob Spiiioza iii seiiier späteren Zeit aristokratisch<br />
oder demokratisch gesinnt war, hat sich zwischen A.Menzel und W.Meijer<br />
ciii Streit eiitsponnen.39) Die Frage läist sich meines Erachtens nicht<br />
35) Tract pol, IX, 12. - 36) Ebenda, VIII, 31. - 37) Ebenda, IX, 14. -<br />
38) Festschrift für Unger, S. 49f. - 39) Meijer, Archiv f. Gesch. d. Phil., XV, 1 f.,<br />
XVI, 466 2. ; Menzel, Archiv, XV, 162f.<br />
7"
100 Spinozas Tractatris politicus U. die parteipolit. Verhältiiisse der Niederlande.<br />
rnit Sicherheit entscheideii, da wir die ausführlicl~c Darstellnilg der<br />
Deinolrratie nicht besitzen. Für Meijer spricht die Kritilr der gewöhiilichen<br />
Aristokratie am Anfang cles IX. Buches und die Bezeichnung<br />
der Demokratie als absoluter ISerrschaft. 3feiizel weist darauf hin, clais<br />
Spinoza die Sicherheit als IIauptzweclr des Staates hiiigestellt und cler<br />
zweckmaisig eingerichteten Aristoliratie cliese in höchstein Nafse zuerkennt.<br />
Der Gegensatz ist wohl nicht so groPs, als es nach dein Streite<br />
scheinen könnte. Spinoza hält auch im tractatus politicus die Regierung<br />
einer groiscil Anzahl von Aristokraten fiir vorteilhaft ; er dürfte ~i~ohl<br />
dem Urteile de la Courts zustimmen, cler Aristokratie uncl Demolrratie<br />
als die Verfassungen der Freiheit aiisielit uiicl eine Aristoliratie, die sich<br />
der Demolrratie nähert, für besonders vorteilliaft l~ält.~~)<br />
Wichtiger als diese Frage scheint mir cler Nachweis zii sciii, clais<br />
Spinoza im tractatus politicus viele bedeutsame Lehren voin Staate<br />
und besonders von der Aristolrratie vorbringt, die de Wit uiid sein Krci.;<br />
in Theorie und Praxis bereits vorlicr vertreten haben. An diesen Anschauungen<br />
liat Spiiloza auch festgehalten, als die Ereignisse ilin<br />
zwangen, sich mit der aristoliratischei~ Regicruilgsform seines Laudes<br />
lrritiscli auscinailderzusetzei1. Er liat sich ii~ die iieueii Verhältiiissc,<br />
wie sie mit clem Emporlro~nmen des groisen Oraniers geschaffen<br />
waren, nicht mehr hineinfinden lröniien. Spinoza ist also durchaus nicht<br />
so unabhängig von seiner Umgebuiig, wie nzan ilin sich gewöhnlich vorstellt.<br />
Sein tractatns politicus kann viclinelir als ein Musterbeispiel<br />
dafür gelten, wie sehr auc1-i die ahstralrtcstc Theorie abhkiigig ist von<br />
dein Boden und der Zeit ihrer Entstehung.<br />
Trotz aller Anregungen, die Spinoza aus seiiler Zeit empfangen hat,<br />
bleibt er doch auch in seiner Lehrr von1 Staat der Philosopl~ von universaler<br />
Bedeutung. Er ist vor allein auch zii wiirdigen als ein Vertreter<br />
des Naturrecl~ts,~~) der Lehre, die, das Wcrlr der Reformation<br />
vollenderid, den Staat von der Kirche belreitc, sein Wesen rational rerstehen<br />
lelirte uiid so dem Denlreii iiber den Staat auf fast zwei Jahrhunderte<br />
den weg wies.<br />
Die besondere Bedeutung Spinozas beruht iilsbesondere darauf, dais<br />
er die Staatslehre in engen Zusamn~eilhaii~ mit seinem Systein brachte,<br />
dais er die Entstehung des Staates niclit ans einem filrtiven Vertrage,<br />
sondern aus der Menschennatur ableitete,42) clafs er wenigstens iii clen<br />
Anfangen eine historische Betrachtung des staatlichen Lebens anwandte,<br />
dic dann im 19. Jahrhundert über die rein rationale, ilaturreclitliehe<br />
Auffassung eildgültig hinausgeführt hat.<br />
40) Weegschaal, 309 f., 661 f.<br />
41) Kurt Worm, Spinozas Naturrecht, Archiv f. Gesch. d. Phil., XVII, 500f.<br />
42) Epist. L., Op. 11, 360. Vgl. Tönnies Hobbes, Leben und Lehre, 199 f.
Anfänge psychologischer Ästhetik bei den<br />
Griechen.<br />
Von<br />
0. Külpe, Wurzburg.<br />
iiie pS>~li~l~giiclie ~Cstlittilr irii eigeiltlichcii Siiiiic fiildeii wir<br />
bei den Crrieclieii iloch nicht ausgebildet. Sicht sowolil deshalb,<br />
weil CS iiocli Iiciiie listhetilr als eigcntiimliche Wisseiiscliaft<br />
gab, als vielmcli~ deshalb, weil der Gegeilstaild dieser<br />
Diszipliii iiiclit als eiri psychologischer Gegeilstarid galt. Maii ist in<br />
Verlegeiiheit, meiiii mari versucht, die dein Schönen und der Kuilst ge-<br />
~i7iclnieteii Aussprüche iii eiilcr dcr bestehcndcii Einteilungen der Pliilosophie<br />
uiiterzubriiigeii. Sofern z. B. bei I'latoii von einer Idee des<br />
Schöileii die Rede ist 1111d clns Scliöiic a i sicli ~ festgestellt werden soll,<br />
Irani1 man die Dinlclrtilr als die Wisseliscliaft anseheil, zii dcr solche<br />
Ausführungcii geliöreil. Aber die Bctrachtuiigeii über die eigenartige<br />
Lust, die das Schöiie ermcclrt, iiiiisscil zur Physik, und aiideres zur Ethilr<br />
gcrechiict mcrcleii. Aristotrles bat zwar iii sciner poietischeil Pliilosopliie<br />
ciil besoilc1ei.c~ Gebiet für schaffende, lrünstlerische Tätigkeit<br />
bereitgestellt, und Spätcrc habeil ciiiige Kiiilstlehren unterschiedeil.<br />
Aber wozu inan die allgenieiiie Behaiidluiig des ästlzetischen Eindrucks<br />
zu zälllcii habe, bleibt uiibestii~iint. Die psychologischeil Schriften des<br />
Aristotcles enthalteil iiiclits clariiber, dagegen werden die Formen des<br />
Scliöileiz als Gcgciistäilde der niathomatischen Wisseiischaften bczeichnet.I)<br />
Trotzdem wtire es falscli, wcim inaii deshalb die ästhetischen Erörteruiigeii<br />
cler Griechen überhaupt als ~nps~chologisch charalrterisieren<br />
uild die Lehre rom ästhetischen Eiizdruclr als eine metaphysische, physikalische<br />
oder n~atheiiiatische auffasseil wollte. Es fehlt nur aii einer<br />
lrlaieit. Abgreiizuilg dci hier in Betracht lromsnencleii Gesichtspusllrte.<br />
Das Scliöne wircl bald niit den1 Ontei~, bald mit dem sinnlich 811-<br />
1) Metaph. XII, 3, 1078a, 36.
102 Snfinge psychologischer Ästhetik bei den Griechen.<br />
geiielnneii, bald init Gesetz, Ordn~iiig und Gröisc in Zusainineiiliailg<br />
gebracht. Eiiie genauere Differenzierung der Begriffe wird zwar aii-<br />
gestrebt, aber iiicht erreicht. Insbesondere ist es iiocli iiicht gelungen,<br />
das ästhetische Verhalten in seiner Gesaiiitheit und Eigenart zu er-<br />
fassen uiid zu isolieren uiid auf dessen Analyse sich eiilzustelleii. Aber<br />
A ii s ä t z e zu einer psycliologisclieii Bestiminung uiicl Erkläruiig der<br />
ästhetischen Tatsachen sind reichlich vorhandeil, so dais auch in dieser<br />
Beziehung von einer grundlegenden Bcdeutuilg der griechischeii Philo-<br />
sophie gesprochen werden darf. Nur niuls iiiaiz sich diese Eeiträge zur<br />
psychologischen Ästllctilr aus vcrschiedeiieii Schriften z~~sarnnieiitragen<br />
iiild mit bestiriimteiz Interessen dieser Art aii illre SViirdiguilg heraii-<br />
treten. Wer iliit den1 Auge eines moderiieii Psychologen die griechisch(^<br />
Literatur clurcliwandert, wird iiicht selten überrascht sein, Erruiigen-<br />
schafteil oder Streitfragen der heutigen ,Isthctik schon damals crkanilt<br />
oder erörtert zu sehen.<br />
Einige vo11 deii Beobaclituilgeli, die ich bei wiederholteil Strcif-<br />
zügeil durch die griechische ,Lstlzetili gesammelt habe, niöchte icli auf<br />
den folgenden Bliitteiw in z~vaiigloser Ordnung mitteilen. Ich lrailn<br />
dabei hier lreiiie Vollstindigkeit crstrebeii, werde insbesondere allc<br />
Details, wie sie namentlich in Walters vcrdicristvollem Wcrke behaiidelt<br />
sind, unberücksichtigt lassen. Da abei. weder dies Bilch noali clasjenigc<br />
von Ed. Müller, und ebcnso~venig die allgcmeineii Darstellungen der<br />
Geschichte der Asthetik, wie Ziinmeri~iaiiii, Schasler, Bosailq~iet, die<br />
griechische Asthetilr uiiter l~sycliologisclicil Gesichtspuillrteil betrachtet<br />
und eiit~viclrelt haben, so inbgen einige lIinwcisc auf den Ertrag, dcii<br />
solche Gesichtspunlite gewkhrcn liöiliien, nicht ohne Wert sein. Dais<br />
hierbei zuweilen erst die psychologische Interpretation der vorliegenden<br />
Stellen zur vollen Erkenntnis ihrer psycliologischcn Bedeiituiig führt,<br />
wird überall da lreiiie Bedenkeii haben, wo es sich uin eiiieii unzweifel-<br />
haft psychologischeil Tatbestand, ~veiiii auch nicht um eine adäcluatc<br />
Beschreibung desselben handelt. Das Recht zur Anmeiicluizg einer der-<br />
artigen Methode glaube ich dem Faktuin entnehmen zu dürfen, ciafs<br />
die ästhetisclieii Ersclieiiiuiigcn, die deiz Griechen vorlagen, im weseiit-<br />
liehen und allgemeinen auch auf uns mirlreil. Natur und Kunst, und<br />
zwar antike Kunst, reden auch zu uns eine eindringliche Sprache uiicl<br />
können ein den1 älinliches Verhalten erregen, das griechische Philo-<br />
sophen ihnen gegeniiber eiiigeiionimen haben. Wer daher init der<br />
psychologischeii ästhetilr unserer Zeit vertraut ist, wird auch in clie<br />
ästhetisclieiz Aiischauungen der Griechen sich leichter hiiieinfindeii und<br />
sie bestimmter auszulegeii iinstande sein, als cler Philologe oder Histo-<br />
riker, dcr iiiclit som~ohl von den bczeichneten Tatsacheri, als vielinehr<br />
voh deii Bezeiclii~ungeri aus den Weg zu iliiieir sucht.<br />
Dais Platoii als der Begründer eiiier allgeiiieiiien, iiiclit der angewandten<br />
Iisthetik zu gelten habe, kann kauin zweifelhaft sein. Auch<br />
heute lkfst sich der ästlietischc Eiildiucli in ge~~sisseii Grundliilieil iliclil
AnfLnge psychologischer Ästhetik bei den Griechen. 103<br />
zutreffender schilderii, als es bei ihn1 gesclielicii ist. Im Unterschiede<br />
von Solirates, der das Schöne mit dein Nützlichen identifiziert hatte,<br />
wird ein S c 11 ö ii e s a 11 s i c h roll dein relativ Schönen getrennt und<br />
durch eine eigentümliche Lust, die es erweckt, charakterisiert. Die<br />
besonderen Bestimmungen dieser Lust zeigen deutlich, dais eine eigcn-<br />
artige Lustqualitiit, die als Lust von anderen Lustformen zu trennen<br />
wäre, nicht angenommen zu werden braucht. Sie ist reine Lust, nicht<br />
mit Unlust gemischt, wie der Kitzel. Sie ist ferner maisvoll im Gegen-<br />
satz zu der inalslosen Heftigkeit der sinnlichen Gefühle. Sie gellt<br />
endlich nicht aus der Befriedigung einer Begierde hervor, denn der<br />
Mangel an Schönem erregt keine Unlust. Sie entsteht dem Betracli-<br />
tendcn vielmehr unmittelbar während der Kontemplation." V011<br />
anderen Lustformen wird sie also nur durch ihre Einfachheit, ihre<br />
Intensität und ikie Eiitstehungsweise geschieden. Es ist das unisoinehr<br />
zu betonen, als Platoii bekailntlicli wiederholt von besonderen Lustarten<br />
gesprochen hat.<br />
In diesem Sinne. absolut schön sind aber nur die E 1 c nz e n t e der<br />
Siiineswahriiehmung, Farben, Töne, geometrische Formen und, wenn<br />
auch in eingesch~iinlitem Maise, Gerüche. Nur diese liömen offenbar<br />
an sich gefallen odcr miisfallen, ohne auf einen Vorteil odcr Nachteil,<br />
den sie bereiten, hiilzuweiseil. Sie sind schön diircli ihre eigene Be-<br />
schaffeiilieit, nicht durch Beziehung auf anderes. Die Farben gefallen<br />
vcrinöne ihrer Reiiilzeit uiid ihres Glanzes." Unter den Tönen werden<br />
die sanften und hellen, die einen reinen Klang geben, als schön bc-<br />
zeicliiiet. Die Schönheit der Gestalten beruht auf Symmetrie und Pro-<br />
portion, die ihneil selbst zukomineii, sofern sie mit Lineal, Winliclmais,<br />
Drsliinstruinerit erzeugt sind." Fassen wir alle diese Merlimale des an<br />
sich Schönen zusainineii, so lrönilen wir sie etwa als G e m e s s e 11 11 e i t ,<br />
„ Sy ni m e t r i e '' und „A ii a 1 o g i c (' bezeichnen," wobei diese Be-<br />
griffe einen iiber die nächste Beziehung auf die Figurcn hiilausgehendeii<br />
Sinn haben. Genlesseiiheit würde eine mittlere Gröise und Stiirlic in1<br />
Gegensatz nanieiitlich zu der MaP~losiglreit,~) Symmetrie nicht nur eine<br />
i.iuinliclie, soiidern auch eine qualitative Gleichartigkeit in1 Tiiiterscliied<br />
von Ungleichheit, &Iisehung und Kontrast bedeuten. Von der Analogie<br />
heilst es: Das schbiiste Band ist dasjenige, welches sich selbst und das<br />
Verbundene a111 meisten vereinheitlicht, uiid das vermag am bcsten die<br />
Analogie zu leisten, indem sie drei Gröisen in (las Trerhiltnis a : b<br />
-- b : c setzt.') Es ist hiernach eine höhere Gleichartigkeit, die der<br />
Beziehungen daiiiit gemeint, die insbesondere das Gaiizc und seine Teile<br />
in derselben Ordnung nliteiiiander verbindet.<br />
2) Phileb. 51 bis 52 und Gorgias 474 D. Vgl. auch Hipp. maj. 299 D; 302D.<br />
3) Phaedon llOC. - 4) Phileb. a. a. 0. - 5) Phileb. 64E; Tim. 31C.<br />
6) Schon bei Demokrit (Diels, Fragmente uer Vorsokratiker, S. 424, 102)<br />
finden mir den Ausspruch: Schön ist überall das Gleichmais, Ubermais und<br />
Mangel miisfiillt mir - also einen Hinweis auf die goldene Mitte.<br />
7) Tim. 31C; 32A.
I04 Anfänge psychologischer ÄstLetik bei den Griechen.<br />
Xur durch diese Allgemeinheit des Sinnes wird es möglich, die clrri<br />
geilaiii~teii Nerlrmale auf a 11 c s Schöne, auf Farben und Töne, ebenso<br />
wie auf Gestalteil anzuwenclen und Wahrheit iiiicl Güte gleichfalls<br />
unter diese Gesichtspiinlrte zu bringen. Aiich das Gute zeichiiet sich<br />
durcli (:cmessenlieit uiid „Symmetrie" aus, und Gemessenheit und Reiiilicit<br />
(qualitative Gleichartiglceit) lcomnien auch dem Wahren zu. So<br />
wird zwischen einer lrörperlichen und einer seelischeil Schönheit unterschieden,<br />
über deren Verhältnis zileiilaiider wir freilich blo ls erf ahreii,<br />
dais sie iin Menschen einander eiitsprechcii sollen, dais der Körpcr cler<br />
Seele verwandt sei, cler er clieiit, dais zwischen ihnen „Symmetrie('<br />
berr~che.~) Ob und wie sich diese innere Schönheit durch die äuiserc<br />
Buiidgebe und somit iii ihr erlceilileii lasse, dariiber crhalteii mir keine<br />
Auslruiift. Aber mir werden sagen dürfen. dais nach Platoii nur bei<br />
ciiler Aii~i~eiidbarlreit der positiven ästhetischen Kriterien auf i
Anfange psychologischer Ästhetik bei den Griechen. 105<br />
licheii Dingen so scharf getrennt wircl. Lebende Körper sind nur insofern<br />
schön, als sie zu ihren Verrichtungeii taugeil, und Gemälde insofern,<br />
als sic dasjeiiige darstellen, was sie darstellen sollen.12) Ei11 an<br />
sich Schöiies liegt rlariim hier iiberhaupt nicht vor, und so kann auch<br />
die Idee des Schöiien in ihneii nicht erfaist werden. Da nun aber<br />
Farben, Töne, Gestalte11 an den siniilich wahriiehmbareii Diilgen vorkommen,<br />
so kann der Gegensatz zwischeii dem absolut und relativ<br />
Scliöiien in coilcreto nicht iii solcher Schroffheit aufrecht erhalteil<br />
werden. Uild so begreift es sich, dais die schöllen Dinge wenigstens<br />
teilweise scliöii genannt x~erden,~~) indem sie iliimlich ail sich Schöiles<br />
ciitlialteil lröiliien.<br />
Eine volle Würdiguiig für die Leistung l'latons iil cler allgemciilcn<br />
~sthetilr geht uris auf, weilil wir sehen, wie sein groiser Schiiler deren<br />
Grundlageii voraussetzt uild unangetastet laCst. Die Definition cles<br />
Schöiien iiz der Rhetorik1" stellt eillallder ganz iin Siilile Platons das<br />
an sich Schöne uiicl das relativ (niimlich in Beziehung auf das Gute)<br />
Schölle yegeniiber. Dazu tritt als eine freilich sehr äuiserlichc Unter-<br />
scheidung des Schöileii iiilcl cles Guteil die Angabe, dais jenes sich auch<br />
an Uilbewcgtcm, dieses iiur an Handlungen antreffe11 lasse.'" Mai1<br />
wird wohl aiinehmeii dürfen, dais Aristoteles den Ausführuilgen Platons<br />
iiber die Lust am Scliöileii iiild den Unterschied cles absolut ~iizcl relativ<br />
Schöneil nichts hinzuzufügei~ oder eiitgegeilzusetzeil wiliste. Dasselbe<br />
ergibt sich, wenn wir die von iliin bezeichneteii Hauptformeil des<br />
S c 1 GesetzmLisigkeit, „Symmetrie" und Be-<br />
2 r e n z t 11 c i t l" geilauer bestiinmcil. Anderwirts heilst es, allc<br />
Schönheit beruhe auf Gröise uiid Gesetzmiisiglieit.li) Gesetzmaisig-<br />
lreit nimint die Stelle der platoilischeil „Ailalogie" ein uiid ist nur eiiie<br />
cleiltlichere Bezeichiluilg ihres allgenieiiiercn Siniles. Gröise bedeutet,<br />
wie die Erläuterung zeigt, mittlere, maisvolle Gröise und fiillt demnach<br />
mit der Begrenztheit ~vahrscheinlicl~ zusai~lineii.~~) Reides aber gibt<br />
uiigefiihr die platoilisclic Gemcssciiheit wiecler. „Symmetrie" eiidlicli<br />
ist sogar tlem Nameil nach in Ubereiilstimnzuiig mit dem platoilischen<br />
kZerlirna1 der Gleichartigkeit. So hat demilach Aristoteles sich tat-<br />
sriclilich ganz auf den Bodeil der platoilischeil Asthetik gestellt. Dic<br />
Uizterschcidiiilg zweier Schöiilieitsarteii, die Angabe der objelrtiveil und<br />
xvolil auch der siibjelitiveil Merkmale cles an sich Schöiieil werden ohne<br />
mcseiltlichc Moclifikation iibernommeii.<br />
Ein wirlrlichcr Fortschritt liegt clagegeii iil dem Versuch vor, diese<br />
Bestimmungeil des ail sich Schöi~en p s y C h o 1 o g i s C h z u b e -<br />
g P U ii d e 11. Die mittlere Gröise ist zur Scliöilheit erforderlich, weil<br />
bei einem wiilziq Irlciizeii Geschöpf die Anschauuilg verworren werde,<br />
12) Phileb. 61 C, Republ. X, 601 D ; Legg 11, 668B.<br />
13) Republ. V, 470. Ganz davoll verschieden ist der im EIipp. Maj. in bezug<br />
siif schbne Einzeldinge geltend geniachte Gesichtspunkt der Relativitiit des<br />
Schönen, der übrigens schon bei Heraklit sich findet, wie dort erwähnt ist (289A).<br />
14) I, 9, 1366a, 33 E. - 15) Metaph. XII, 3, p 10788, 31. - 16) Ebenda, 36. -<br />
17) Poet. VII., 1460h, 37. - 18) Anders Walter, a. a. 0. S. 555.
106<br />
Anfänge psychologischer Ästhetik bei den Griechen.<br />
tlie Eiiizelheiten nicht mehr erkeiinen und unterscheiden lröniic, ulicl<br />
weil bei einein ungeheuer groiseii die Einheit und Abgeschlosseiiheit<br />
des Eindrucks verloren gehe, also die Übersichtlichl
BnfSlnge psychologischer Ästhetik bei den Griechen. 107<br />
druclrs auf clie fornlale Schönheit haben wir bei ihnen nichts gefunden,<br />
obwohl sie die Tatsache natürlich gekannt haben werden.<br />
Von hier aus liist sich nun auch die positive Darlegung voll Plotiii<br />
uber das Wesen des Schöllen verstehen. Psychologiscli gefasst, enthält<br />
sie nichts anderes als eine E i n f ü h 1 u ii g s t h e o r i C. Wenn wir ein<br />
Schönes wahrnehmen, so begrüisen wir darin ein unserer Seele Ver-<br />
wandtes, wiihreizd das Häisliche uns als ein Fremdartiges abstöist. Die<br />
deele frent sich, weil11 sie etwas ihr Ähnliches wahrnimmt, und staunt,<br />
nimmt es in sich auf und erinnert sich an sich selbst und an das zu ilzi<br />
Gehörige. Somit wird das Wahrizehmbare schön nur durch seine -<br />
Beseeltheit, würden wir sagen. Plotin drüclrt sich inetaphysisch-objek-<br />
tiver aus: diirch seine Teilnahme an der Idee bzw. Form. Man muis<br />
sicli hierbei eriiiilcriz, welche Eedcutung der Begriff der Forin bei<br />
Aristoteles gewann. Sie ist das gestaltende, verwirklicheiide Prinzip,<br />
auch die Seele lraiiii Form ihres Körpers hcifsen. Darunl treffen in der<br />
Tat der metaphysischeBegriff einer pezo~f ~i'dovs und der psychologische<br />
Begriff der Beseeltheit infolge der Einfühlung sachlich zusammen.<br />
Alles Gestaltlosc, die Xaterie in aristotelischer Auffassung, ist demnach<br />
häislicli, sofern es bei seiner Bestinimuiig, Gestalt und Idee aufzunehmen,<br />
derselben entbehrt oder iiicht ganz davon erfüllt wird. Die<br />
Idee (das iiliiere Leben, würden wir sageii) inacht das aus vielen Teilen<br />
Bestehei~de zu einem Ganzen, sei es iii der Kunst oder in der Natur.<br />
Auch von cler Gröise, die Aristoteles angegeben hatte, haiigt die Schönheit<br />
iiicht ab. Sie zeigt sich in1 lileiiieil so gut wie iin groisen, wenn<br />
nur die „Idee" sich tlariiz ~ffeilbart.'~) Das Feuer ist vor anderem in<br />
cler Körperwelt schön, weil es dem Unlrörperlichen, der Idee, am iiächsten<br />
steht. Auch die I-Iarinoi~ien der Töne lasse11 die [betrachtende] Seele<br />
sich selbst wicderfiiideii, die eigenen verborgenen Harnzoiiien entdeclreil.<br />
Die lrörperliche Schönheit beruht demnach überall daraiif, dass „die<br />
Gestalten der uilaterie gewissermaisen aufgesetzt sincl",") d. h. also,<br />
dais sie beseelt ist. Wer das Schöne aber nicht selbst erlebt hat, der<br />
lröilnte auch iiiclit davon redeil, und dies Erlebnis ist ein Stauileiz, eine<br />
süise Verwirrung, Selziisucht, Liebe und freudige Bestürzung.<br />
Nur in unserer psychologischen Fassuilg sagt Plotin für uns etwas<br />
aus. Seiiic eigentliche Tendcilz ist es nun freilich durchaus nicht, eine<br />
psychologische Besclireibung des ästhetischen Verhaltens zu geben.<br />
Das zeigt scholl clas erlreniztiiistheorctische Prinzip, dais nur das Gleiche<br />
das Gleiche erl~eiine, nur eine schöne Seelc auch Schönes wahrilehmeiz<br />
lröni~e.~~) Dazu komnien die metaphysischcii und ethischen Voraussetzuilgen<br />
und Werturteile, in die seine Theorie ganz eingesponneil crscheint.<br />
So gewiis ~idor und bio~vq einen viel weiteren Begriff repräsei~i<br />
tiereii, als Seele, inneres Leben, so gewiis geht diese Sehönheitstheoric<br />
über die Einfüliluizg hinaus. Aufserdem sind die Gestaltung, Beseelung<br />
ernsthaft realistisch, nicht blois naiv aniinistiscli gemeint. Aber der
108<br />
AnEnge psycholo@scher Ästhetik bei den Griechen.<br />
Qeiiuls ain Scliöiieil wird cloch gaiiz psychologisch geschildert, und cla-<br />
durch, dais auf die Wahrilehmurig des Verwanclten, des der eigenen Seele<br />
iihiilichcii hiilgewicsen wird, ist auch dein Vorgaiig cler Einfiililung<br />
einige 12echnuiig getragen. Sornit glauben wir, Plotiii zwar einseitig<br />
und unzureichend zu charakterisieren, wenn wir iliii als einen Vertreter<br />
der Eiilfühluagsästhvtik ansehen, aber nicht geracle falsch und gewalt-<br />
sam zu iiiterpretiereii. Vielinehr scheint es uiis, als ob clie T a t s a. c h c<br />
der Einfiilllung, wie auch das als Argunieilt gegen die Syinmetiielehre<br />
verwandte Beispiel vom schöneii und unschöne11 Gesicht zeigt, fiir Plotiii<br />
die Griliidlagc und dciz A4usgaiigspunkt seiner iisthetischeii Betrach-<br />
tuiigen gebildet,") danii aber unter der Herrschaft seiner 31etapliysih<br />
alsbald eine uilpsychologische Verwertung gefunden habe.<br />
Dem Tatbestande cles an sicli Schöncii, das nicht diircli eine Bu-<br />
ziehung auf anderes erst wertvoll wird, hat soinit clie griechisclit,<br />
ilsthetik bereits die beiden auch noch in cler Gegenwart vertreteiien<br />
Theorien, die f o r in a 1 i s t i s c 11 e und die l3 i 1 f ü 11 1 11 11 g s -<br />
t h e o r i c . gewidmet. Platoii. uiid Aristoteles gelten iins i 11 d i e s e 111<br />
S i ii ii e als die Formalisten. Ihren Staridpunkt schlechthiu so zu be-<br />
zeichiieii. verbietet das Falrtum. dais sie auch ein relativ Scliönes lreiinen<br />
uild aizerkenneii, und dass iliiieii auch clie Tatsachcii der küiistlerischeii<br />
Darstellung init der dicse auszcicliiienclen ästhetischen Wirlruilg geläufig<br />
waren. Ebeiiso ist Plotin infolge seiiiei* metaphysischen Deutung der<br />
Eiiifuhluilg lrein reiner Repräseiitant der Eilifiihlungsästhetilr. Der<br />
Unterschied z\vischen ihm und Platoii insbesoiidere wird ein viel gc-<br />
riiigercr, weiiii inan die Metaphysilr berücksichtigt. Aber psychologiscl-i<br />
betrachtet, ist er ebciiso einseitiger Einfühliliigisthetiker, wie Platoir<br />
und Aristoteles für das Gebiet des an sich Schöneil, wir könnten auch<br />
sagen: cles direkten Faktors, Formalisten sind. Gesetzmaisige Eiiihcii,<br />
iiiiierer Lusaininenhang, eine goldeiie Dlitte zwischeii Extremen, Gleicli-<br />
artigkeit der Teile oder ihrer Bezieliungeii -, clas sind etwa die objek-<br />
tiven Merlrmale der gefalleiideii Eindrüclre nach dieser formalistischeil<br />
Auffassuiig. Ein an sich Schönes ist clagegeii für Plotiii gar nicht ge-<br />
geben, urid darum werden aucli lieine objelrtivcii Merkmale des Schöileii<br />
angeführt. Niir durch die Einfühluiig, über clereii Redingungeil wir<br />
nicht geiiauer aiifgeklirt werden, erhält ein Gcgenstaiicl ästhetische11<br />
Charakter. Dabei scheint Plotin nicht die Einfüliluilg als solche zuin<br />
Xotiv für die ästhetische Bewertung zu nlacheii, sondern den Inhalt<br />
der Eiiifühluiig, indein er nur voll einer schöneii, CI. h. reinen, tugeiicl-<br />
haften Seele Schönes wahrilehmcii lässt. Das Gefalleil ail ästhetischeil<br />
Eindrüclreii koinnit also im letzteil Griinde nur dadurch ziistaiide, dal's<br />
eine schönr Seele sicli selbst iil dcii Dingeii wiederfiildet. Plotiii ist dein-<br />
nach lreiii Eiiifühluilgstlzeoretilrer im Sinne von Groos, soiidcril in dem<br />
voii Lipps.'j)<br />
24) Vgl. unten S. 123f.<br />
25) Vgl. des letztgenannten Ästhetik, I, S. 140. Zeitschr. f. Psychol., Ed. 22,<br />
S. 427 f.
Anfange psychologischer Ästhetik bei den Griechen. 109<br />
11.<br />
Die Tatsachen, auf die sich jede Eiiifül-iluiigstheorie zu stützen l121t,<br />
sind, wie wir schon bemerkten, lange vor Plotiii bekannt gewesen. Wenii<br />
Xenophailes erkliirt, dals iiach der Behauptung der Äthiopeii die Götter<br />
schwarz und stumpfnasig, nach der der Thraker aber blauäugig und rothaarig")<br />
seien, so liegt dslriri bereits ein EIinweis auf die auclz ii1 dur<br />
Einfühlung gegebeiie Übertragung eigener Xerlunale auf fremde<br />
Gegcnstäiide. Eine speziellere ästhetische Weiiduiig erhält diese Beobachtuiig<br />
in dein m'ortc des Epicharm:") „Kein Wunder, dais wir uns<br />
selbst gefallen und uns schön gewachsen düiilreii. Deilii eil1 Z-Ti~iid hält<br />
cieii aiiderri fiir das schönste Geschöpf, ein Ochse, ein Escl deii aiideril,<br />
und ein Scliweiii hält das aiidere für das schöilste." I-Iieriii ist frcilich<br />
nicht nur das Gefallen am Gleichen, sondern auch die Relativität der<br />
Wsthetischeil TVertprteile ausgesprochen, wie sie in dein EIeralrlitischeii:<br />
der weiseste Mensch wird, gegen Gott gehalten, wie ein Affe erscheine11<br />
an TVcisheit,, Scliöillieit uild 211 allem a~idcrii,~~) deutlicher zuin Aus-<br />
tlruclr gelangt. In den ilämlichen Gcdaiil~enlircis gehören vielleicht aucli<br />
die boideil Sätze voii Dcniolrrit: Körperschönheit ist etwas Tierisches,<br />
wenn sich iliclit Verstand dahinter birgt,2" ~uid: mit Gewand und<br />
Schmuck zum Scliaueii priichtig ausgestattete Bilder, aber es fehlt iliiieil<br />
das 1'Ierz.W) Dazu rechnen wir ferner bei Platon die Ui~tcrsclieiduilg<br />
einer ä u l s e r e ii uiid einer i 11 11 e r e ii Schöiilieit und die Fordcruilg<br />
der Harmonie zwischeii beiden. Abcr auch bei Sokratcs fehlt es nicl-it<br />
an einem I-Iii~wcise auf solche Beziehuilyeii. Das Gespräch mit den1<br />
Maler Parrhasios wld dein Bildhauer Klcitoii bcrichtct clavon. Findet<br />
sich riicht, so fragt er jenen, bei einen1 B4cnsclien ein freuiidlicl~c~ und<br />
ein feiiidseliger Blick, der sich in den Augeil voin Maler darstellen lasse?<br />
Ebenso Hciterl~cit uiid Verdrul's, Edclniut und Liberalitiit, Besoniieiiheit<br />
uiid Verständigkcit iii~tl die iliiieii cntgegei-igcsetztci~ Eigenscliaftei~,<br />
sciieiiicii sie iiiclit alle durch das Gesicht, durch die I-Ialtuiig und Bewe-<br />
gung des Klirörpers hindurch und sind l
110<br />
Anflnge psychologischer Ästhetik bei den Griecheii.<br />
E?~EL z@osEIx~[&L'u).~~) Xicht die Genzütsbewegiingcii selbst, sonclera<br />
wie sie dem Sehenden erscheinen, d. h. ihren Ausdruck in iKiene und<br />
Körperhaltung hat der Künstler - das etwa ist die ;Meinung des Sokrates<br />
- nachzuahmen, damit uns das Kunstwerl
Anfiiiige psychologischer Ästhetik bei den Griechen. 111<br />
Errigiiisseii oder llandlungeii haben. Das gleiche Resultat ergibt sich<br />
aus clvr iblitteilung, dass man es Nachahmuiig zu iieiiiieii habe, weilii<br />
jcmancl mit sciiiein Körper die Gestalt eines andereil oder mit seiner<br />
Stiiiline die Stimme eines anderen, in beiden Palleli dem Vorbilde ähii-<br />
lieh, wiedergebe.") Die ierläuteruiig, die der Begriff der Dliinesis<br />
aiidersnro dadurch erfährt, dass der iiachahmendc Kiinstler mit jemaiicl<br />
-\lergliclicil ~vird, der die Bilder von himmlisclien und irdischen Gegen-<br />
stkndcil iii eiiicm Spiegel auffange, lälst ebenfalls keilier anderen Auf-<br />
fassung Raum.") Wir werden soinit nicht fehlgeheii, wenn wir unter<br />
der izacliahmendeir Kunst des Platoil die Darstellung durch ii a t ü r -<br />
1 i c li e Z e i c h C 11, wie mall iril 18. Jahrhundert zu sagen pflegte,3G)<br />
begreifeil uiid ihren Bereich iiur soweit ziehen, als es der Umfang er-<br />
lnubt, in dem ciiie Ähnlichkeit zwischeii Zeichcn und Bezeichiletem an-<br />
zunehmen ist.ai)<br />
Auch in dicseni Falle hat Aristotcles an seinen Meister unmittelbar<br />
angeknüpft. Er scheidet genauer als dieser zwischen deii Ausdruclcs-<br />
inittelil, die GegenstSinde nachal-imeii, wie Farben und Formen, und<br />
anderen, die Stimmungen, Charakterziigc, EIaiidluilgeil darstellen, wir<br />
die Be~veguiigen des Tanzes oder die Melodie der M~~sik.~~) Dabei ist<br />
er rler Aiisicht, dass die Musik die Gemütserregungen am vollkommeiisteii<br />
nachahii~e, weil sie allein wirkliche Ähulichlccit mit ihnen aufweir;e,<br />
mälireiicl clas Sichtbare iiur geringen Aufschluis über sie gebe<br />
und mehr ein bloises Leiche11 (rry,tt&ov) für sie sei.") Freilich wird<br />
34) Sophist. 267A.<br />
35) Republ. X, 596DE. T7gl. auch 1,egg. 667ff.<br />
36) Vgl. z. B. M. Mendelssohn, Gesammelte Schriften, 1843, I, S. 290f., 295.<br />
37) Weniger geiiau, aber der Sache nach übereinstimmend mit der hier<br />
vertretenen Auffassung der Mimesis, ist G. Finslers Bestimmung derselben<br />
(Platoii und die aristotelische Poetik, 1900, S. 39f.) als der .Herstellung eincs<br />
Abbildes, sei es der wirklichen oder einer gedachten WeltY. Dagegen ist die<br />
dort zitierte Wiedergabe Vahloiis, Mimesis sei „die dichterische Umbildung des<br />
gegebenen Stoffes", für ein Verständnis dieses Begriffes ganz unzureichend. Auf<br />
die uns hier interessierende Frage geht F. Stähliii (Die Stellung der Poesie in<br />
der platonischen Philosophie, Erlanger Dissert., 1901, S. 18ff) nicht ein. Wenn<br />
er übrigens sagt, dais man die Mimesis nicht allgemein als Nachahmung des<br />
Einzeldinges der Erscheinungswelt definieren dürfe, so scheint er zu übersehen,<br />
dais man in der Nachahmung gerade vermöge der Ahnlichkeit mit den1 Original<br />
so gut wie in dem Einzeldinge selbst etwas mehr als blois das einzelne, sinnlich<br />
gegebene erkennen kann. Ist daher die sinnliche Erscheinung ein Hinweis auf<br />
wahrhaft Seiendes, so kann es ihre Nachahmung ebenfalls sein. Dann besteht<br />
kein Widerspruch zwischen Rep. I11 und X, um dessen Lösung sich Stahlin<br />
besonders bemüht. - Bei der Verurteilung, welche Platon der nachahmenden<br />
Kunst angedeihen läist, ist übrigens nicht zu vergessen, dafs der Künstler in<br />
ihm nur allzu gut die gewaltige Wirkung der Kunst Bannte und darum auch<br />
die Gefahren einer nicht im Dienste der Erkenntnis und der Sittlichkeit<br />
stehenden Kunst besonders hoch einschstzen muiste. Er berührt sich hierin<br />
auffallend mit Tolstoi, der in aller Kunst die Macht der Suggestion findet und<br />
fürchtet.<br />
38) Poet. I; Polit. VIII, 6.<br />
89) Polit. VIII, 6; Probl. 19, 25. Vgl. hierzu die treffenden Ausführungen<br />
von E. Müller (Gesch. d. Theorie d. Kunst bei den Alten, 11, S. 348ff.) über die<br />
Bedeutung der Politikstelle.
112<br />
Anfänge psychologischer kthetik bei den Griechen.<br />
auch hier ~oii eiiicr Kachalirn~iiig gesprocheil, aller es ist tlocli sclir<br />
walirscheiiilich, dass Aristoteles init dieser 17iiterscheiduiig dasselbe<br />
iiieiiit, was wir eben bei Platon aiigedeutet fanden. Alle Nachaliiniiiig<br />
iin eigentlichen Sinne beruht auch nach ihm auf der nhiiliclilieit od 1111<br />
All-inlichen als desseii Gcgenstaiid oder Vorbild zu erkeiiilei~ uiitl aiis-<br />
gedrüclit zu fiildeii, ist sodailii auch nicht gänzlich uiibeaiit~vortet ge-<br />
bliebeil. Wir wisseii, dass i~hiilichlreit ilebeii dem ICoiitrast und der<br />
räumlichen ocler zeitliche11 Naclibarscliaft als eiii Reproduktioi-isgr~i~icl<br />
galt.41) Schon Platon ist diese Auffassuiig geliufig gewesei~.~') Die<br />
gernalte Lyra erinnert nach ihm auf Grund clcr iChiilichkeit aii die mirlr-<br />
liehe und ebenso der eenialte Siininias ail deii wirklichei1.~3 1I)as<br />
I,errieil, von dem Aristotcles spricht, wciin er iii der liiiilstlerischeii Naclibilduilg<br />
das Original crlreiiireii iiiid ~viederfii~deii lafst, wird voii Platoir<br />
direlit als eine Eriiinerung bezeicl~net.~~) Die von ihm aiigeführteii<br />
Beispiele berechtigen uiis dazu, die Deutung des iiachal~lneildeil Kunst-<br />
werks als eineil E r i ii 11 e ' u ii g s - oder R e p i. o d u li t i o ii s v o T -<br />
g a il g zu charaktcrisiereil.<br />
Wir wolle11 ganz davon absehen, dals iizoderiie Psycliologeii aus<br />
guten Gründen eiii Reproduktioi~sgesetz der Ahillichlieit iii dem hier<br />
gcmeiiiten Sinne abgelehnt haben. Ebensowellig wolleii wir Gewiclit<br />
darauf legen, daEs die bloise Rcprodulitioii cles ähnlicheil durch das<br />
40) Vielleicht denkt Aristoteles hier auch an den naturlichen Zusammen-<br />
hang zwischen unseren Gemutserregungen und ihren akustisch - motorischen<br />
Entladungen. Es scheint hierbei miederum die enge Beziehung der Begriffe<br />
Zusammengehorigkeit und Gleichartigkeit eine schjrfere Bestimmung verhindert<br />
zu haben. Vgl. oben S. 104, Anm. 8.<br />
41) Arist de mem. et reminisc 11, 451h, 18ff.<br />
42) Vgl. Gomperz, Griech. Denker, 11, S. 356; Windelband, Platon, 8. 75.<br />
43) Phaedon 73E; 7411.<br />
44) Ebenda 73B.
114 Anfänge psychologischer Ästhetik bei den Griechen<br />
such iluternehmei~ und sein Gelingen prüfen, der nzit dem nachzualzmeiiclcn<br />
Gegeiistande vertraut ist. Es folgen Beispiele, die uns deutlich<br />
machen, dais es sich um die sog. i iz n e r e W a h r h e i t haiidelt. Bestimmte<br />
Lieder dürfen nur in der dorischen Tonart gesungen, männliche<br />
Rede nur mit mäiiiilicher I
Anfänge psychologischer Ästhetik bei den Griechen. I15<br />
einstimmung oder Ähnlichkeit verbunden sein sollte. Es wäre wenig-<br />
stens sonst die Treue der Nachbilduilg kein wertsteigender Falrt~r.~~)<br />
In diesem Falle lrönnte wieder konstatiert werden, dais sich Aristoteles<br />
auf dem Boden platonischer Ästlietilc befindet und auf ihm fortzubauen<br />
sucht.<br />
Wir sind endlich auch nicht ganz ohne Nachricht über die Auf-<br />
fassung, welche Platon und Aristoteles von der unmittelbaren Kunst-<br />
wirkung und von der Entstehung einer Kunstschöpf ung hatten. Das<br />
Verhalten des ICünstlers beim Schaffen ist gleichartig, wie Platon<br />
zeigt, dein Verhalten des Zuschauers bzw. Zuhörers beim Auf-<br />
nehmen der Kuiistleisturig. H e g e i s t e r u il g , göttlicher Wahn-<br />
sinn ergreift bei~Ie.~l) Der Rhapsode Jon erzählt Sokrates von der<br />
Art, wie seine Zuhörer an seinen Vorträgen teilnehmen: ich er-<br />
blicke sie jedesmal von der Bühne herab, wie sie weinen und finster<br />
dreinschauen und der Rede mit Schrecken folgen (n~v3a~r$oÜt~~a~).<br />
Und Sokrates nennt sie Alle Glieder einer Kette: der Zuhörer ist der<br />
letzte der Ringe, der Dichter der erste, der mittlere Ring aber ist der<br />
Rhapsode. Durch sie alle hindurch wirkt Gott, dais sie in den nämlichen<br />
Zustand der Ergriffenheit (xa7F~pzac), man lraizn auch sagen der<br />
Besessenheit (t~prai) geraten. Als Sokrates fragt, ob der Rhapsode<br />
bei seinen1 Vortrage voller Besiniluiig sei oder vielmehr an den Ereig-<br />
nissen teilzunehmen glaube, von denen er begeistert erzähle, da be-<br />
stitigt Jon die zweite Annahme mit den Worten: wenn ich etwas Bemit-<br />
leidenswerte berichte, füllen sich meine Augen mit Tränen; wenn ich<br />
etwas Furchtbares und Schreclrliches verkünde, sträuben sich meine<br />
Haare vor Furcht, und das Herz klopft. Sokrates zieht daraus die Kon-<br />
sequenz, dais derjenige nicht bei Besinnung sein könne, der ohne tat-<br />
sachlichen Grund weine oder sich fürchte.<br />
Was hier vom Rhapsoden und vom Zuhörer gesagt wird, deutet auf<br />
denjenigen Zustand hiii, den man als s y m p a t h i s c he E i n -<br />
f ü h l u 11 g , Miterleben, innere Nachahmung bezeichnet hat. Freilich ist<br />
dieser Zustand nur geschildert, um ihn herabzusetzen. Er entbehrt der<br />
Besonnenheit, es fehlt ihin die Einsicht iil die realen Verhältilisse des<br />
Lebens, er besteht in einer unvernünftigen ITingabe an Fingiertes, Er-<br />
träumte~, blois Vorgestelltes. Darum wird er eine Besessenheit ge-<br />
nannt. Aber auch von hier aus fällt ein Licht auf die Nachahmung.<br />
Der Zuschauer gerät in die gleiche „Manie", wie der Rhapsode und der<br />
Dichter, er ahmt gewissermaisen deren Ergriffenheit nach, leidet und<br />
fürchtet mit ihnen. Er erlebt alle Phasen ihrer seelischen Erschütte-<br />
rung, irden1 er ihren Äuiseruilgen folgt. Durch diese Schilderung des<br />
gleichartigen Verhaltens von Dichter, Rhapsode und Zuhörer wird eine<br />
50) Darauf weist namentlich die oben zitierte Stelle in der Rhetor. hin:<br />
+Sb . . . nüv, i) &V €3 ,ILE,LLL~~,L~~VOV 5, X&V 5 pq 486 ad~O ZO pep~pqp6vov. Die<br />
Vergleichung von Nachbild und Urbild in der Kunst hat in der neueren<br />
Ästhetik Hutcheson als eine selbstlndige Quelle des ästhetischen Vergnügens,<br />
der sog. relativen Schönheit anerkannt.<br />
51) Ion, 633 D bis 536D. Vgl. dazu Demokrit bei Diels, a. a. 0. S. 411 f., 17. 18.<br />
8*
116 AnfSinge psychologischer ästhetik bei den Griechen.<br />
E r W e i t e r u ii g des Begriffs der Nachahmung angebahnt. Sie ist<br />
nicht nur der Ausdruck für die Beziehung zwischen dem Kunstwerk als<br />
einer objektiven Grölse und einem wirklichen Gegenstande, der dariii<br />
dargestellt ist, eine Beziehung, die zuiiächst von dcm schaffenden<br />
Künstler hervorgebracht wird. Nachahinuiig ist vielmehr auch dcr<br />
Zustand, in den wir geraten, wenn wir das Werk auf uns wirken lassen.<br />
Der Name wird zwar noch nicht dafür angewandt, aber es bedeutet<br />
offenbar keinen allzu grofsen Schritt, dem Worte Nachahmung diesen<br />
erweiterten Sinn zu verleihen und damit das Verständnis für eine freiere<br />
subjelitivc Betätigung des künstlerisclien Genieiseiis zu gewinnen, wie<br />
es zuerst bei Philostratos nachweisbar ist.<br />
Aristoteles hat in seiner Poetik von zwei Arten dichtcrisclien<br />
Schaffens gesprochen, einer besoniieiien und einer enthusiastischen.<br />
Die letztere ist die nämliche, die wir eben bei l'laton gefunden haben.<br />
Diejenigen wirken, wie Aristoteles sagt, am überzeugendsten aus der<br />
gleichen Xatur heraus, die selbst die Leidenschaften haben, die sie dar-<br />
stellen: der stürmisch Erregte macht in seiner Unruhe, der Zornige in<br />
seinem Unwillen den wahrsteil Eindruck. Andere suchen sich die Gcgen-<br />
stande ihrer Kunst mögliclist deutlich vorzustelleii, als wenn sie der<br />
Handlung beiwohnten, und finden auf diese Wcise das Passende und<br />
vermeiden das Ungehörige. Dieser Unterscliied,") der freilich nicht<br />
ganz klar herausgearbeitet ist und namentlich iiiibestinimt Jäfst, ob<br />
verschiedene Küilstlerindividualitiiten oder verschiedene Verhaltungs-<br />
weisen beim Schaffen (event. gleich berechtigte und gleich notwciidige)<br />
damit gemeint sind, fügt ZU der sympatllischen Eiiifühluiig, dem wirk-<br />
lichen Erleben der darzustelleiiden Stiinmungen, noch die „ c i 1 -<br />
f a c h e
Anfange psychologischer Ästhetik bei den Griechen. 117<br />
So lassen sicl~ zwanglos Zusammenhänge der einzelnen Angabeii<br />
finden, sobald man sich die psychologischen Tatsachen vergegenwärtigt,<br />
die ihren Ausgangspunkt gebildet haben. Auch hier dürfte gelten, was<br />
Platon so iiachdrücklich einschärft, dais nur derjenige eine volle Einsicht<br />
in Gehalt und Wert einer Leistung hat, der ihre Aufgabe kennt, der mit<br />
dem Gegenstande vertraut ist, auf den sie sich bezieht. Darum mag<br />
einem psycliologischen Ästhetiker dcr Zusammenhang der huiserungen<br />
klarer, einzeliles vielleicht auch bedeutungsvoller und die Gesamtheit<br />
der Stelleii verständlicher erscheiiien, als dem in anderer Beziehung<br />
iiberlegenen Philologen.<br />
111.<br />
Die zuletzt angestellte Betrachtung drängt sich unwillkürlicli auf,<br />
wenn man die Behandlung und Würdigung des Flav. Philostratos (d. A.)<br />
wahrnimmt. Der sagenhaften Gestalt des Apollonius von Tyana bemächtigte<br />
sich, wie Zeller sagt, Philostratos, „um an derselben in<br />
einem abenteuerlichen Roman das Wesen der pythagoreischen Philosophie,<br />
so wie er es sich dachte, zur Anschauung zu bringen, in der angeblichen<br />
Biographie des Tyanensers eine Apotheose des Pythagoreismus<br />
zu schreiben. Als Geschichtsquelle ist diese Darstellung selbst da,<br />
.cvo sie nicht gerade unmögliches berichtet, so gut wie gar nicht zu ge;<br />
bra~chen."~~) Sie ist nach Zeller ein Tendenzroman mit deutlicher<br />
Spitze nicht nur gegen das Christentum, wie schon Baur") vermutet<br />
hattc, sondern auch gegen zeitgenössische philosophische Schulen, wie<br />
ilamentlich die Stoa. Dagegen faist Göttsching in teilweisein Anschluis<br />
aii Nielseii die Tendenz des Philostratos dahin auf, dais er einen Paneg~rilius<br />
auf den Helleilismus in der Zeit seiner Blüte liefern, einen Protest<br />
gegen eindringenden Barbarismus aussprechen, eine Art Regentenspiegel<br />
geben uiid eine Reform des Kultus im Siime des religiösen<br />
Konservativisinus anstreben wollte.55) Am allerwenigsten könne den<br />
Apollonius „für ein forschendes, tieferblickendes Auge die Art<br />
empfehlen, in der sich Philostratos seiner Persönlichkeit bemächtigt<br />
hat."") Gegeniiber solchen Annahmen fragt J. Niller: Warum muis<br />
denn die vita Apoll. notwendig eine Tendenz haben? Genügt es nicht,<br />
dais Philostratos das Leben eines interessante11 Mannes beschreiben<br />
und dabei möglichst glänzende Proben seiner rhetorischen Kunst und<br />
sophistischen Gelehrsamkeit geben wollte?j7)<br />
Nicht besser steht es mit der Beurteilung, die die Archäologen ihm<br />
angedeihen lassen. Die eingehende Verteidigung, welche Brunn gegen<br />
53) Philos. d. Griech., 111, 2, S. 1668. (4. Aufl.)<br />
54) Apoll. V. T. und Christus. Tübingen 1832. So auch Christ (Gesch. d.<br />
griecb. Litt., 4. Aufl. 1905, S. 754): ,,Nicht unwahrscheinlich ist es, dafs Julia<br />
ein Gegenstück zu den biblischen Erziihlungen geliefert zu sehen wünschte.'<br />
65) Apoll. V. T., Leipziger Diss., 1889, S. 89.<br />
56) Ebenda S. 124.<br />
57) Philolog., 51, S. 137ff. Eine sehr anschauliche Schilderung der Zeit-<br />
verhiiltnisse, in denen Apollonius eine Rolle spielte, hat R. Meyer-Kramer in<br />
der Sonntagsbeilage zur Voss. Ztg., 1900, No. 19 bis 23 gegeben.
118<br />
Anfange psychologischer ästhetik bei den Griechen<br />
Friedrichs' Versuch, den Philostratos aus der Reihe der liunstschriftsteller<br />
zu streichen, gerichtet hat,") ist von ihm selbst später nicht<br />
unerheblich eingeschränkt worden, als er nach zehn Jahren daran ging,<br />
die vermittelnde Stellung von Matz zu der Echtheitsfrage der vorausgesetzten<br />
Gemäldegalerie zu prüfen.") Mit cler Replik von Matz, der<br />
auf seinem vermittelnden Staildpunkte beharrt, ist die iiit'ressaiite<br />
Kontroverse geschlossen worclen.") Mit Recht hat dieser llervorgehoben,<br />
dais Philostratos eine Eiiilileidung gewählt liabe, die ilzil „der<br />
Verpflichtung, eigentliche Beschreibungen zu geben, durchaus überhebt",<br />
indein er cineii Knaben während der Betrachtung der Gemälde<br />
auf die ihin wcsentlicli erscheinenden Gegenstände uiid Eigenschaften<br />
derselben hiizw~ist.~~) Dabei ist X. keineswegs der Ansicht, dais Philostratos<br />
sich prinzipiell das Fingieren zur Hauptaufgabe gemacht<br />
liabe. Vielinehr habc ihm gewiis nichts ferner gelegen, als ein systcmatisclies<br />
Verfalireii in dieser Richtung.02) Kallimanii aber fürchtet,<br />
dais man „noch immer eine zu günstige Meinung voii den Schriftstellern<br />
des zweiten und dritten Jahrhunderts in bezug auf Glailbwurdiglreit<br />
und Selbständigkeit ihrer Angaben" habe.G" Doch hat iiacli ihm die<br />
Absicht der Täuschung dem Philostratos ganz feriigelegen, was K.<br />
daraus schlieisl, dais er uizterlassen habe, die Namen voii Nalern uiid<br />
sonstiges Detail über seine Bilder zu fingieren.<br />
Anderseits haben sich Berufene dein Zauber seiiier Darstellung<br />
nicht entziehen köiineii. Goethe hat sich Jahre hindurch nlit der Geinäldebeschreibung<br />
beschäftigt und dariii eine Anregung für die Kunst-<br />
Übung seiner Zeit gefunden.") Moritz T. Schwind ist der Aufgabe<br />
nachgekommen, die Schilderungen in gemalte Wirliliclikeit umzusetzen.G5)<br />
Wieland hat sich zu seinem Agatliodämon durch die Vita.<br />
Apollonii des Philostrat begeistern lassen, obwohl er von einem redseligen<br />
Sophistciz spricht, der ein groises, reich zusaminengesetztes uiid<br />
mit üppiger Farbeiiverschwendung ausgeführtes Geinälde zur Gemütscrgötzung<br />
einer wunderlustigeii Dame angefertigt habe.") An Bewunderung<br />
der Schilderungskuiist hat es auch sonst iiicht gefehlt.<br />
Walter nennt die Bechreibung der Gemälde „nach vielen Seiteil liiii<br />
kaum übertroffen" und sagt, Philostratos beschränke sich im mesentlichen<br />
darauf, „die konkrete Stimmung der Bilder durch einzelne Züge,<br />
meist ohiic Benutzuiig allgemeiner ästhetischer ICategorieii, mit vollendeter<br />
niIeisterschaf t wiederzugeben."")<br />
58) Die ~hilostratischen Gemglde. 1861. -- 69) Fleckeiseiis Jahrbb.. 1871,<br />
S. IE. '- 60j Philol., 31. S. 585ff. - '61) A. a. 0. ~.'594. - 62) A. a. O. S. 627.<br />
63) Ithein. Mus. N. F. Rd. 37. S. 411.<br />
64) Philostrats Gemälde." Er meint. dafs wir uns von deren "Grundmahr-<br />
haftigkeit" überzeugen dürfen.<br />
65) Vgl. die Wiener Ausgabe der EZxdws~, 1893, praef. XXVI f. und Rich.<br />
Foerster: M. Y. S.'s Philostratische Gemalde. Leipzig 1903. Freilich hat er sich<br />
dabei wesentlich an Goethes Auswahl gehalten und nur wenige im engen An-<br />
schluis an die Vorlage durchgefiihrt.<br />
66) Hempelsche Ausg., Ed. 23, S 119.<br />
67) A. a. 0. S. 823f.
Anfiinge psychologischer Ästhetik bei den Griechen. 119<br />
;\/lag es sich iiuil mit der historischen uiid arcli¿iologischen Glaubwiirdiglieit<br />
des Philostratos ganz so sclilinim verhalten, wie seiiie<br />
schärfsten Ankläger bchnupteii, seiiie uiis hier alleiii intcressierendeii<br />
Qualitäten sollten davoii unberührt bleiben, die auiserordeiitliche<br />
asthctisclie Empfänglichkeit und die Fähigkeit der<br />
p s y c 11 o 1 o g i s c h e n R c f 1 e x i o n über isthetische Erscheinuiigeii.<br />
Dais er diese Reflexioneii irgendwo aufgelescir habe uiid blofs reproduziere,<br />
ist iiiclit nachgewiesen worden uiid bei dcr iiinereii Übereiitstiminuiig<br />
derselben mit deii iii deil Iinagg. angewaiidteii Kuiisturteileii<br />
weiiig wahrscheiiilicli. So wird denn auch allgemein aiigeiionimeii, dals<br />
sie sein Eigentum siiid.68)<br />
Wozu inisclieii die Maler, so fragt Apolloiiius ieineii Dainis, tvahrcild<br />
sie in einem Tcinpel Indiens weileii, die Farben?, uiid erhalt Aur Antwort:<br />
der Nachahmung wegen. Aber wirst du, was mall am IIimmel<br />
sieht, nenn die TVollieii auseiilandergerissm siiid, die Keiitaurcii, Roclrihirsche,<br />
Wolfe und Pferde auch als Werlie der Nachaliniuiig betrachteii,<br />
so dais Gott eiiz Maler ware, der seinen Flugelwageii vrrlasseii hat, um<br />
spielend solclie Zeichnungen zu verfertigen, wie die Kinder in1 Sande?<br />
Du willst wohl lieber sagen, dais diese Dinge iii bezug auf Gott zufallig<br />
durch dcii Himmel ziehen. dais wir aber. die wir von Katur zur Nacliahmung<br />
neigen, sie gestalten und schaffeil? Es gibt danach eine doppelte<br />
Nachahmung, die Malerei, die mit IIand und Geist bildet, und eine<br />
andere, die nur iin Geiste sich betatigt. Wir alle ahmen von Natur<br />
nach, aber -ur einige von uiis üben die ICuiist aucli mit der Hand aus.<br />
Solche Nachahmungskunst ist die Plastik, cbeiiso wie die mit Farbcii<br />
arbeitende Malerei uiid die nur Schatteii und Licht anwendende Zeiclinung.<br />
Denn auch in der letzterwähnteil Darstelluiigsforin sieht inan<br />
~hnlichkeit, Gestalt uiid Geist, Bescheidenheit und ICühslheit, obwohl<br />
weder die Farbe des Blutes noch die der Haare oder des Bartes walirnehmbar<br />
ist. Selbst wenn wir eirieii schwarze11 Iridcr iii weiiserr Strichen<br />
gezeichnet erbliclicii, wird er uns vermöge unserer iiatürlicheti Nachahmungstätiglieit<br />
schwarz erscheinen. Denn die stumpfe Nase, die<br />
aufgerichteten Haare, die vorstehenden Kiiliibacken und eiiie gewisse<br />
Bestürzuiig in der Augengegeiid schwärzen das Gesehene und zeigen<br />
einen Inder deiieii, die nicht gedanliciilos hinschauen. Es bedürfen demnach<br />
auch diejenigen, die die Werke der Malerci betrachteii, eiiie~ Kacliahmung.<br />
Wer liösinte auch die Darstellung eiiies Stiers oder Pferdes<br />
billigen, der sich nicht selbst das Tier in Gedaiilien vorstellt, dem sie<br />
gleichen soll? Und wer würde deii rasenden Ajax des Timoniachus bewundern,<br />
wenn er nicht das Bild des Ajax in seinen Geist aufiiälime,<br />
wie er iiacli Tötung der I-Ierden in Troja ermattet gesessen und den<br />
Plan gefasst habe, Selbstmord zu begehen? So crscheiiit auch hier an<br />
dem Erzbilde des Porus, das mit Tötenden und Sterbenden erfüllt ist,<br />
div Erde mit Blut besudelt, obwohl sie nur vosi Erz ist.Gg)<br />
6s) Vgl. E. Müller, a. a. 0. 11, S. 316, Anm. b niid Göttschiiig, a. a,. 0. S. 64.<br />
69) Vita Apoll., 11, 22.
120 Anfinge psychologischer iisthetik bei den Griechen.<br />
Eine Ergäiizung erhalten diesc wichtigen Ausführungen durch eine<br />
spätere Unterredung in Ägypten. Apollonius nimmt hier AnstoPs an<br />
cler dort herrschencleii Gewohnheit der Darstellung von Götterii in Tiergestalteii,<br />
während die Griechen ihren Götterbildnisseil eine so würdige<br />
Form verliehen 1iLtten. Sind deiiii etwa, so fragt dagegen der Ägypter,<br />
die Phidias iincl Praxiteles im I-Iiniinel gewesen, um die Gestalten der<br />
Götter aufzunehmen und danach abzubilden, oder hat etwas anderes sie<br />
zu ihrer künstlerischen Schöpfung vcranlafst 2 In der Tat etwas aiideres,<br />
aiitmortet Llpolloiiins, und zwar etwas Weises. Was aiideres, als Nachahmung,<br />
liöiiiitest du iienneii?, fragt jener. Die P h a ii t a s i e , spricht<br />
Aliollonius, eine weisere Künstlerin als die Nachahmung, hat dies geleistet.<br />
Denii die Nachahinuilg wird nur gestalteii, was sie gesehen hat,<br />
die Phantasie aber auch das nicht Gesehene, indem sie es sieh vorstellen<br />
wircl iii Beziehung auf clas Seiende. Uiid wahrend die Nachahmung<br />
clurch Verwirrung oft aus ihrer Bahii geworfen wird, geht die Phantasie<br />
unerschiittei.lich auf das los, \vas sie sich vorstellt. Wenn man sich ein<br />
Bilcl des Zeus denkt, inuls man ihn mit dem Himmel, den Jahreszeiten<br />
uiid den Gestirnen schaueil, wie Phidias damals, und wenn man die<br />
Atheiie clarstelleii will, innis man an Heerscharen, Klugheit und Künste<br />
uiid daraii deiikeii, wie sie aus dem Haupte des Zeus entsprang. Als<br />
~iuii cler ~ygypter erklkrt, dais die Tiergestalten iii den Tempeln seines<br />
1,ancles nur eine symbolische Bedeutung haben, meint Apollonius, dais<br />
es danu weiser wäre, gar keine Bildnisse aufzustelleil, sondern den Bksucliern<br />
die Gestalt ihrer Götter zu überlassen. Denn die Vorstelluiig<br />
(yvW,ccq) malt und bildet besser als die Kunst. Ihr aber beraubt die<br />
G6ttc.r nicht nur dessen, schön wahrgenommen, sondern auch dessen,<br />
schöii vorgestellt zu werden.70)<br />
Zweierlei inuis an diesen Erörterungen sofort auffallen, die ausdriicltliche<br />
Erweiterui~g des Begriff es der Nachahmung<br />
uiid die E i 11 f U 11 r u ii g cl e r P 11 an t n s i e als eines von der Nachaliinung<br />
verschiecleiieii Aktes. Das letztere geschieht in einer geradezu<br />
draniatiscli spaniiendeii Form, so dais man sofort den Eindruck einer<br />
neueil, ilocli nicht ausgesprochenen Lehre erhält.71) Beides haiigt eng<br />
riiiteinaniler zusammen. Denn die innere, geistige Nachahmung, von<br />
clcr iil der ersten Stelle die Recle ist, erfaist ja auch das Nichtgesehene,<br />
den sclimarzeii Inder in der weifseii Zeichnung. Und die Phantasie hält<br />
sicli bei ihren Scliöpfungeii, „Setzungen" an das Seiende, an die Erfahrni~g.<br />
Somit besteht liein meseiltlichcr Unterschied zwischen beidrn,<br />
uiid cs begreift sich deinnach, clais Philostratos in seiner Gemäldebeschreibuiig<br />
deii fiir die Phantasie gebrauchten Ausdruck 6opia nicht<br />
iiiir cla ail~veiiclet, wo eine Erfindung im eigentlichen Sinne gemeint<br />
ist, soiidcrii a~icli für die bloise Beachtung der inneren Wahrheit,<br />
rlir ehe11 auf Grund geistiger Nacliahmung erfolgt.72) Nur der Nach-<br />
70) Vita Apoll., VI. 19.<br />
71) Darauf hat auch E. Muller, a. a. O., 11, S. 317, Anm. b, hingewiesen.<br />
72) Vgl. Imagg. (Wiener Ausg.), I, 9, 6; 4, 2; 26, 5; 11, 29, 3, wo das Wort<br />
iiberall ron einer Erfindung des Künstlers gebraucht wird, mit I, 30, wo die<br />
unter 3 erwihnte uoplu auch auf das frühere bezogen wird, clas nur Romposition<br />
und innere ~ahrheit betrifft. ähnlich 11, 20, 2.
Anfange psychologischer Bsthetik bei den Griechen. 121<br />
ahmung im engeren Sinne wird die oo@n als etwas Höheres gegenübergestellt,<br />
wie in der intc+ressanteii Ausführung über den „Sumpfi'.<br />
Hier hcilst es: Wollte man den Maler wegen der naturgetreuen<br />
Bildung der Ziegen oder der Syringen lobcn, so würde man nur ein<br />
Geringes, was eben zur Nachaliinung gehört, hervorheben. Das Beste<br />
aber an der Kunst ist die ~oph und der xrr~,gdc (etwa: das Gehörige, zu<br />
dem übrigen Pa~sende).~~) Sofern also die inilerc Nachahmiiiig eine<br />
Ergänzung des Wahrgenonimenen ist, wird sie von der Phantasie nicht<br />
ge~chiedeii.~") In diesem Sinne ist wohl auch der Anfang der Vorrede<br />
zu verstehen: Wcr die Malerei nicht liebt, verstöist gegen die Wahrheit,<br />
verstöist gegen die ooylo: lind gegen die „SymmetrieG. Die 4Aq9.e~a,<br />
die hier von der 6o~ph gesondert wird, ist das Ideal der eigentlichen<br />
Nachahmung, während in der ooyia stets eine geistige Selbständigkeit<br />
des Künstlers aiigedciitet liegt.<br />
Es ist nun von besonderem Interesse zu sehen. dais Pliilostratos<br />
von der hier betonten Eigenart der inneren Nachahmung in seiner Ge-<br />
mäldebeschreibuiig reichlichen Gebrauch macht. Sie trägt der er-<br />
gänzeiiden Tätigkeit des betrachtenden Subjekts volle Rechnung. Nag<br />
sie dadurch an objelctivein Gehalt, an historischer Treue und Zuver-<br />
lässigkeit eiiibüiseri, in ästhetischer Beziehung bietet sie das Bild eines<br />
sehr eiridruclrsf ähigeil Zuschauers. In dieser I-Iinsicht sind nicht sowohl<br />
die Einweise auf deii Ausdruck der dargestellten Figuren von be-<br />
sonderer Bedeutung, als vielmehr die F o r t s p i ii n U 11 g des gemalten<br />
Momeiits in seinc Vorgeschichte und sciiie Folgen und die IT i n z u -<br />
füguiig sinnlicher Qualitäten, die nicht gesehcii werden<br />
können. So lobt er den Tau auf den Rosen und findet, dais sie mit<br />
ihrem Dufte gemalt An einem Gemälde rühmt er ausdrücklich,<br />
dais nicht nur das Seiende, sondern auch das TVerdeil, und einiges, wie<br />
es werden lrann, dargestellt sei, ohne darüber die Wahrheit zu vernach-<br />
lissigeil. IIier sei das Brüllen der Rinder zu hören und werde man vom<br />
Syringenklang umtöiit.1" In einem anderen Bilde meist cr auf deii<br />
Atem der schlafenden Ariadne hin.77) Bei der Beschreibung des Wein-<br />
grlages iii den Andriern empfiehlt er dem Knaben, er möge glauben, die<br />
Gesäilgc der Trunkenen zu hören, wie sie mit stammelnder Sprache<br />
singena7" Apolloii scheint im folgenden Bilde iiicht nur hörbare Laute,<br />
sondern auch verständliche Worte durch sein Gesicht zu ä~isern.~" An<br />
einem Altar meint Philostratos einen I-Iauch von Sappho zu spüren und<br />
lraiin der I-Iymnus gehört werden, deii die Kinder ~iilgen.~O) Bei einer<br />
Jagd erheben die Hunde mit den Jigeril Lärm, so dais auch das Echo<br />
an dem Jagdfest heilzunehme11 scheint.81) Anderswo ist der Rauch<br />
gleichsam wohlriechend gemalt.s2)<br />
73) I, 9, 6. Für den ua~~os ist vielleicht besonders 11. 1, 3 heranzuziehen,<br />
wo es heilst: zcl yOle uv;cßaivovra ol p+ yqdyovzsg 08% d~~8~ziovurv Sv zais<br />
yeayaic. Aufserdem I, 2, 1: yiyganzac 82 4 V@ odn dnd zoC oW,uazog, d/S/S'<br />
bnd XULQOC. Vgl. I, 15, 2.<br />
74) Damit erledigen sich die Bemerkungen von E. Muller, a. a. O., 11, S. 322ff.<br />
75) I, 2, 4, - 76) I, 12, 6. - 77) I, 15, 3. - 78) I, 25, 2. - 79) I, 26, 4. -<br />
SO) 11, 1, 2. - Si) 11, 17, 10. - 62) 11, 27, 3.
122<br />
Anfänge psychologischer Ästhetik bei den Griechen.<br />
Diese Beispieles3) mögen genügen, um die volle Übereiil~tiinmuii~<br />
der theoretischen Bemerkungen über die innere Nachahmung mit der<br />
praktischen Übung des Kuristgeiiusses und Kuiisturteils bei Philostratos<br />
darzutun. Die Tatsache des a s s o z i a t i v e ri Faktors und der darauf<br />
beruhenden E i ii f ü h 1 u ii g ist mit unverkennbarer Deutlichkeit bezeichiiet,<br />
und von dem auiserordentlicheii Einfluis, den gerade diese<br />
Tatsache auf die Gestaltung des künstlerischen Gcsamteiildruclrs auszuüben<br />
pflegt, hat Pliilo~t~atos offenbar ein klares Bewuistseiii. Dabei<br />
ist noch folgeildes beaclzteriswert. Natur und Kunst gelten dem Autor<br />
gleichmaisig als Anweridungsgebietc der inneren Nachahmuiig. Mag<br />
sie sicli an Wollreil, mag sie sich an Zeichnungen oder Gemälden be-<br />
tätigen, sie wirkt überall in der riämlicheii, das sinnlich Gegebene er-<br />
gänzenden, umformenden, deutenden Weise. Sie erscheint damit als<br />
eine psychische Funktion von ganz allgemeiner, über das Kunstgebiet<br />
hinausreicliender Gesetzmaisigkeit, die durch beliebige Reize angeregt<br />
werden liaiiii. Die Soiiderstelluiig, welche die Kunst in der griechischen<br />
iisthctik auf Grund des Nachahmungsbegriffs eingenoinmen hatte,<br />
weicht von dieseln Standpunkte aus einer K o o r d i ii a t i o n 111 i t<br />
der ästhetischen Wirkurig der Natur.<br />
Schon bei Platon fanden wir einen EIinm~eis auf ein entsprechendes<br />
Verhalten des künstlerische Darbietungen geiiieisenden Subj~lrts.~~)<br />
Die Ergriffenheit des Zuhörers beim Vortrage eines Rhapsoden und die<br />
Vergleichung, die er vorzunehmen hat, wenn er eine Darstellung auf<br />
ihre Richtigkeit prüfen uild beurteilen soll, enthalten Andeutuilgeii<br />
einer inneren Nachahmung im Sinne des Pliilostratos. Aber die Eiitschiedenheit,<br />
niit welcher dieser die Notwendigkeit einer s u b j e 1~ -<br />
t i v e n E r g ä 11 z U n g , einer wirklichen Neuschöpfung in der Seele<br />
des Betrachtenden lronstatiert, steht doch ohnegleichen in der antilreii<br />
ästhetilr da. Nicht der Gegenstand in Natur und Kunst, sondern das,<br />
was aus ihm gernacht wird, wie inan ihn auffasst und zur Wirkuiig gelangen<br />
läfst, ist die I-Iauptsache. Der ästhetiker, der diese Einsicht gewonnen<br />
hat, ist mit vollein Bewuistsein zum Psychologen gewordcii.<br />
~ --<br />
83) Für das andere, oben hervorgehobene Merkmal subjektiver Ergänzung,<br />
die Verwandlung des Bildmoments in einen geschichtlichen Verlauf, bietet fast<br />
jedes Gemiilde Belege dar, so dais es überflüssig schien, sie aufzuzählen. Auiserdem<br />
ist es hierbei natürlich nicht leicht, die blorse Reflexion oder das Wissen um<br />
einen bereits bekannten Vorgang von der Bildinterpretation zu scheiden. Diese<br />
Schwierigkeit ist ja auch in der Controverse über die Glaubwürdigkeit des<br />
Philostratos zur Sprache gekommen. Doch hat man hierbei. wie mir scheint,<br />
nicht genug beachtet, dals eine mythologische oder geographische oder poetische<br />
Reminiszenz bei der Anwendung auf einen bestimmten Fall durchaus selbstilndig<br />
empfunden und gedacht sein kann und nicht eine blolse Phrase oder rhetorischer<br />
Aufputz zu sein braucht. Darum beweist die Benutzung von Dichtern und<br />
Prosaschriftstellern an sich noch nicht die Unglaubwürdigkeit und ebeusowenig<br />
den Mangel eigener ästhetischer Ergriffenheit. Es wäre sehr erwünscht, dais<br />
einmal die Mittel, deren sich Philo~t~ratos bei der Beschreibung der Gemälde<br />
bedient, einer unbefangenen und Bsthetisch orientierten Untersuchung unterzogen<br />
würden. Erst dann könnten sichere Kriterien für sein Verfahren gewonnen<br />
und zur Entscheidung solcher Streitfragen herangezogen werden.<br />
84) Vgl. oben S. 116.
Anfange psychologischer Ästhetik bei den Griechen. 123<br />
Und daiiiit steht die Anerlrennuiig der Pliantasie als des wertvollsteii<br />
Vermögciis eines Schaffenden in bcstern Eiiiltlange. Der P a r a 11 e -<br />
1 i s in u s , von dem oben die Rede war (vgl. S. 116), ist auch hier gewahrt,<br />
aber wir befiiidcii uns hier mit ihrn sozusagen auf einer höheren<br />
Stufe.<br />
Kahe liegt es, die innere Nachahmung des Philostratos mit der-<br />
jenigen eiiics modernen ~sthetikcrs, K. Groo~,~~) zu vergleichen. Da<br />
ergibt sich deiiil, dais die letztere den Naineii eher verdient als die<br />
erstere. Die von Philostratos so geiiaiinte Betätigung ist eine Nach-<br />
ahmung nur insofern, als sie aii ein gewisses Material anltilüpft, ent-<br />
faltet aber ihre eigeiitlichc Leistung in eiiicr Erganzung und frcicii<br />
Gestaltung desselben. Die innere Nachahmung von Groos dagegen ist<br />
das 31 i t c r 1 e b e n iin Siiiiie Platoiis, das Mitmachen, innerliche Teil-<br />
iiehiiieii angesichts eines Vorgemachten. Sinnliche uiid geistige Er-<br />
weiteruiig des Erlebten werden in ihr nicht vorausgesetzt. Dazu lrornint<br />
ein anderer Unterschied. Der asthctischc GeiiuPs ist nach Groos der<br />
Hauptsache nach die Lust, die aus dieser inneren Nachahniung cnt-<br />
springt. Dagegen fehlt es bei Philostratos gaiizlich an einer Bestim-<br />
mung der Beziehung, welche zwisclieii der innereii Nachahmung und<br />
dem Gefallen oder Xiisfallcii besteht. Er findet zwar die Iiunstwerlre<br />
besoiiders löblich, in denen die „Weisheit" des I
124 AnfDnge psychologischer Ästhetik bei den Griechen.<br />
i\iIetaphysili beiseite, so können wir sagen: das Gestaltlose ist nach<br />
Plotin häislich, weil es nicht gelingt, eine Gestalt ihm zu verleihen, weil<br />
es sich der durch uns zu bewirkenden Verähnlichung niit belraniiten,<br />
vertrauten Gestalten widersetzt. Die Seele des Betrachtenden freut<br />
sich aber, wenn dieser Prozeis möglich ist, wenn Verwandtes erfaist<br />
werden, eine Erinnerung an das in ihr ruhende geistige Besitztuni statt-<br />
finden kann, wenn das wahrgenominene Objekt ein Echo in ihr weckt<br />
und sic in ihm sich selbst wiederfindet. Das ist nun ein Tatbestand, der<br />
auch in Philostrats Lehre von der inneren Nachahmung anklingt.<br />
Auiserdeni ist die groise Wcrtschätzuiig, die Plotin für die Schön-<br />
heit der N a t u r hat, ein beachtenswerter Ausdrucli der neuen Einsicht.<br />
Auf dem lebenden Gesichte, sagt er, ruht viel mehr der Glanz der<br />
Schönheit, auf dem toten nur eine Spur davon, auch wenn die Sym-<br />
metrieverhältnisse sich noch nicht geändert haben. Das Lebende ist<br />
schöner als die Bilder, auch wenn diese symmetrischer sind, und ein<br />
häislicheres Lebewesen ist schöner, als ein schöneres Bild davon.86)<br />
Ebenso harmoniert es mit der Ansicht des Philostratos über die ooyia<br />
des Kiinstlers, wenn Plotin die ursprüngliche I d e e des Schaffenden,<br />
wie sie in seinem Geiste lebt, höher stellt, als das von ihm danach ge-<br />
bildete Werli.8') Es versteht sich somit von selbst, dais die bloise<br />
Nachaliinung der Natur, wie auch Philostratos urteilt, nichts Löbliches<br />
ist, weil sie stets hinter der Natur zurüclibleibt, und dais nur die<br />
schöpferische Selbständiglieit des Meisters eine der Natur gleichwertige<br />
Kunst entstehen laist. So wird auch hier der engere Begriff der Nach-<br />
ahmung iiberwunden, und der Weg, auf dem das geschieht, ist vor-<br />
nehmlich der der psychologischen Beobachtung gewesen.<br />
Nur auf die listhetischen Grundbegriffe war diese Untersuchung<br />
gerichtet. Sicherlich würden sich Anfänge einer psychologischen<br />
Ästhetili leichter und deutlicher bei speziellen Fragen und Problemen,<br />
zumal in der angewandten ästhctili, nachweisen lassen. Die Xon-<br />
kurrenz der Gesichtspuillite ist teils geringer, teils durchsiclitiger, wo<br />
einzelne ästhetische Modifikationen oder bestimmte Künste in Beliaiid-<br />
lung gezogen sind. Vor allem scheidet die Metaphysilr mit ihrer speku-<br />
lativen Xethode bei ästhetischen Spezialfragen aus. Aber es ist zweifcl-<br />
los von gröiserem Interesse zu sehen, wie stark sich dcr Geist<br />
psychologischer Analyse bereits in dem umfassenderen Gebiet der all-<br />
gemeinen ästhetik geregt und wie hier die Beobachtung der Tatsachen,<br />
die auch wir auf uns wirken lassen, zu der Ausbildung von Begriffen<br />
und Lehren geführt hat, die denen der heutigen Ästhetili nahe ver-<br />
wandt sind.<br />
Von besonderer Bedeutung scheint mir an der aiif diesen Blättern<br />
geschilderten Entwicklung die offenkundige Wendiiilg zu seiiz, die sich<br />
56) Ennead. VI, 7, 22.<br />
87) Ebenda V, 8, 1. Sagt doch Philostratos ausdrücklich, dais die Vor-<br />
stellung besser bilde als die Kunst.
Anfange psychologischer Ästhetik bei den Griechen. 125<br />
in der Würdignng der an dein ästhetischen Eindrucli beteiligt zu<br />
denlieizdeii Faktoren allmählich vollzogen hat. Sie entspricht der-<br />
jenigen, die man auch sonst für die griechische Philosophie lroiistatiert<br />
hat. V o m 0 b j e li t z u m S u b j e li t - init diesem Schlagwort<br />
könnte nian in aller Icürze die Richtung bezeichnen, die das griechische<br />
Denken überhaupt einschlägt. Aber viel einwandfreier, als sich das<br />
Zutreffen dieser Angabe für die Gesamtheit der Philosopliie nachweisen<br />
lieise, ist es auf dem besonderen Gebiet unserer Betrachtungen festzu-<br />
stellen. Das Schölle ist am Anfang ein Gegebenes, Vorgefundenes, zu<br />
den Gegenstanden der Wahrnehmung Gehöriges. Bei Platon wird es<br />
sogar zu einer Realität übersinnlicher Art. Wir haben uns ihm gegen-<br />
über nur als ein Spiegel zu verhalten, inögen wir passiv oder aktiv an<br />
der ästhetisclzeii Wclt teilnehmeiz. Die Kunst ahmt im eigentlichen<br />
Sinne des Wortes nach, und wer Kuiist auf sich wirlreiz läist, ahmt<br />
gleichfalls nach, was sich seiner Auffassung darbietet. Nur gelegentlich<br />
werden schon bei Platon die Grenzen dieser Anschauungsweise über-<br />
schritten, indenz etwa auch von einer nicht nachahmenden Kunst ge-<br />
sprochen oder eine vergleichende Prüfung von dem ästhetisch urteilende11<br />
Zuscliauer verlangt und dabei auf die Erinnerung desselben gerechnet<br />
wird.<br />
Auch Aristoteles steht nicht an, die Eigenschaften des Schöizeii als<br />
mathematische, also objektiv angebbarc zu bezeichizeii. Aber er greift<br />
überall zu psychologischen Erklärungen, wo eine ästhetische Forderung<br />
oder Bestimmung begründet werden soll, und fragt in erster Liiiie nach<br />
der Beziehung zur Lust, zum Gefallen und Miisfallen, weiziz er die<br />
ästhetische Wirkung eines Gegenstandes untersuchen will. Damit<br />
wird bereits der Scliwerpunlit nach dcr subjektiven Seite verschoben.<br />
Die objelitivciz Merkmale werden erst zu ästhetischen, sobald sie eine<br />
gewisse Gefühlsrealition hervorrufen. Auch nach Platon war ja eine<br />
qdovt oixeia die Wirkung des an sich Schönen, aber sie wird später<br />
ausdrüclrlicli als eine Nebensache, nicht als der schlechthin entscheidende<br />
Maisstab der ästhetischen Beurteilung behandelt. Man könnte deshalb<br />
in seinem Sinne sagen : Schöne Gegenstände müssen gefallen und würden<br />
schön bleiben, auch wenn sie nicht gefielen, falls nur die intellelrtuelle<br />
Prüfung ihrer Beschaffenheit eine Gbereinstimmung, Zusammengehörig-<br />
keit, Regelmäisigkeit ergäbe. Für Aristoteles dagegen ist die Frage<br />
nach der Lust, die wir am Schönen empfinden, zu einer fundamentale11<br />
geworden. Indem er nun diese Lust bei der Kunst auf ein psychisches<br />
Verhalten, das Lernen, Erkennen, Schlieisen gründet, hat er den ästhe-<br />
tischen Zustaiid in diesem Falle bereits ganz in die subjektive Sphäre<br />
gezogen. Gewiis gibt es auch hier bestimmte objelitive Bedingungeii,<br />
die allein jenes Lernen ermöglichen liönnen. Aber die Lust ist nicht<br />
mehr unmittelbar, sondern nur noch mittelbar von ihnen abhängig.<br />
Auiserdem wird bei ihm der enge Begriff der Nachahmung gesprengt,<br />
wenn er besonneiie Künster kennt, die den Zustand nicht zu erleben<br />
brauchen, deii sie darstellen wollen.<br />
Die letzte Phase, durch Philostrat und Plotin repräsentiert, hat<br />
nun den Akzent auf die subjektiven Faktoren allein gesetzt. Objektive
126 Anfange psychologischer Ästhetik bei den Griechen.<br />
Eigenschaften, die einen Gegenstand schlechthin als schön aus-<br />
zeichneten, werden nicht mehr anerkannt. Nur wer mit einer schönen<br />
Seele an die Dinge herantritt, kann ihnen die eigene Schönheit leihen<br />
und sie damit erst zu ästhetischen Gegenständen machen. Nicht die<br />
Nachahmung ist für die Kunst wesentlich, sondern die freie Erfindung<br />
und der von dem Künstler geschaffene gesetzmäisige Zusammenhang<br />
der Einzelheiten seines Werkes. Zur Würdigung einer Kunstschöpfuiig<br />
bedarf es von sciten dcs Genieisenden weit mehr, als einer treuen Auf-<br />
nahme ihrer objektiven Beschaffenheit. Er muis sie innerlich nach-<br />
schaffen und ihre Andeutungen zu einem Vollbilde in seinem Geiste<br />
ergänzen. Es ist dasselbe Verfahren, das auch Naturgegenständen<br />
gegenüber stattfindet und auch sie in den Kreis eines ästhetischen Ver-<br />
haltens ziehen läist. Da abcr die Natur an Reichtum und Leben die<br />
Kunst überragt, so kommt sie der Beseelung und Ergänzuiig viel inehr<br />
entgegen und verdient deshalb den Vorzug. Und weil dic Intentionen<br />
des Künstlers sich reiner und elastischer in seiner Phantasie verwirk-<br />
lichen lassen, als in dem fertigen, toten Werke seiner Hand, so steht<br />
die Idee über der stofflichen Gestaltung, die Koiizeption über der an-<br />
schaulichen Leistung, die Absicht über der Au~führung.~~)<br />
Es läge nahe, zu diesem Entwiclrlungsgange nach Parallelen in der<br />
neuereii Rsthetilr zu suchen und die Stellung dcr Gegenwart zu den hier<br />
berührten Problemen näher zu bestimmen. Hicr müssen wir darauf<br />
verzichten. Dagegen sei noch kurz auf zweierlei hingewiesen. Erstlich<br />
enthüllt sich gerade bei der Bemühung, die psychologischen Gesichts-<br />
punkte in der antiken Ästhetik namhaft zu machen, die groise Be-<br />
deutung, welche selbst für spelrulativ gerichtete Philosophen des Alter-<br />
tums die E r f a h r u n g in ästhetischen Fragen besais. Die Dialektik<br />
der Begriffe, Deduktion und Transzendenz spielen gerade auf diesem<br />
Gebiet eine verhältnismäisig geringe Rolle. Wirkliche Beobachtung,<br />
bestimmte Tatsachen werden mit Vorliebe ins Feld geführt. Der<br />
Gegenstand der ästhetischen Reflexion ist zunächst und vor allem ein<br />
empirisch gegebener und bedarf daher auch in erster Linie einer<br />
empirischen Uiitersuchung. Zweitens muis schon ein flüchtiger Über-<br />
blick über die hirr geschilderten Erörterungen der Griechen den Ein-<br />
8s) Nach dieser Darlegung richtet sich von selhst, was M. de Wulf: *tudes<br />
historiques sur l'ksthetique de St. Thomas d'Aquin, 1896. behauptet, dafs die<br />
subjektiv-objektive Natur des Schönen von Thomes zuerst und allein erkannt<br />
worden sei. Die antike Ästhetik habe das Schöne für objektiv, die neuere für<br />
subjektiv erkliirt. In bezug auf die letztere mag es genügen, auf Home hin-<br />
zuweisen, der im Anschluis a,n Loc,kes bekannte Unterscheidung die Schönheit<br />
als eine sekundsre Qnalitiit der Dinge bestimmt, d h. als eine Eigenschaft, die<br />
von dem vorstellenden Subjekt ebensowohl wie von dem vorgestellten Gegen-<br />
stande abhiinpig sei (Elements of Criticism , Cap.111, gegen Ende). Selbst Glossner,<br />
dem man gewiis nicht nachsagen kann, dais er die Verdienste des Thomas<br />
verkleinern wolle, hat in milder Form gegen die mafslose Übertreibung derselben<br />
durch Wiilf protestiert (Jahrh. f. Philos. U. spekulat. Theologie, XII, S 264ff).<br />
Wir können in den äufserst dürftigen ätshetischen Ausführungen des Thomas<br />
auch nicht eine Spur origineller Auffassung oder gar eines bemerkenswerten<br />
wissenschaftlichen Fortschrittes finden.
Anfänge psychologischer Ästhetik bei den Griechen. 127<br />
druck erwecken, dars nicht nur die H a u p t p r o b 1 e m e d e r<br />
h e u t i gl e 1 Ä s t h e t i li. bereits in dieser Anfangszeit wissenschaft-<br />
licher Arbeit behandelt oder wenigstens berührt worden sind, sondern<br />
auch die Art , wie Unterscheidungen getroffen, Tatsachen beschrieben,<br />
Erkllirungen geliefert werden, einen überraschenden Scharfblicli. und<br />
sicheren Instinkt verrät. Ich brauche nur auf die Sonderiing des<br />
absolut und des relativ Schönen, der nachahmenden und der blois be-<br />
richtenden Kunst, dcr naturgetreuen Darstellung und der freien Er-<br />
findung hiilzuweisen. Es sei ferner nur an die Beschreibung dcs an sich<br />
Schönen, der inneren Nachahmung, des spezifischen Kunstgenusses er-<br />
innert. Man denke auch an clie Erklärung der Forderung eines inneren<br />
Zusammeilhangs aller Teile eines schönen Ganzen, an die Zurückführung<br />
der ästhetischen Wirkung auf Erinnerung und Vergleichung, auf Be-<br />
seelung und Ergänzung. Tatsächlich ist hier der Standpun1i.t ein-<br />
genommen, der auch in der Folgezeit trotz vorübergehender Trübungen<br />
immer wieder zur gelangt ist, dais es sich bei dem ästhe-<br />
tischen Eindruck stets um den Einfluis o b j e k t i v e r u n d s u b j e li. -<br />
t i v e r Faktoren handelt. Man hat zwar bald jene, bald diese stärker<br />
betont und vorzugsweise gewürdigt. Aber weder ist der Formalismus<br />
zur ausschlieislichen Durchführung gekommen, noch die Einfühlungs-<br />
ästhetik in strengster Einseitigkeit ausgebildet worden. Dort hat man<br />
immerhin der Lust, der Erinnerung, der Vergleichung und Prüfung<br />
Rechnung getragen, und hier werden gegenständlich bedingte Unter-<br />
schiede ästhetischen Wertes in der Gegenüberstellung von Natur und<br />
Kunst und einzelnen I
Die Aufgabe der Philosophie.<br />
Von<br />
G. F. Lipps, Leipzig.<br />
a die Philosophie eine Wisseiischaft ist und als solche aus<br />
einen1 System von Erlrenntnisseil besteht, wird zunächst das<br />
Wesen der Erkeimtnis angegeben. Dies führt zur Anerkennung<br />
vorwissenschaftlicher Erkenntirisse, welche die Vorstufe zu den<br />
wissenschaftlicheil Erlxenntnissen bilden. Beide Erkenntnisarten lassen<br />
sich nun nicht etwa durch den I-Iinweis auf Besonderheiten des Ge-<br />
gebenen oder der Betätigungsweise des Denkens unterscheiden. Sie<br />
zeigen sich vieliiiehr von dem Gegensatz zwischen dem naiven, zur<br />
Mythenbildung führenden, und dem kritischen, das Gegebene und die<br />
Denkarbcit prüfenden Verhalten des erkennenden Menschen beherrscht.<br />
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind durch die ihneil zugrunde<br />
liegenden gegebenen Tatsachen vollkommen bestimmt. Da jedoch die<br />
Gesamtheit dieser Tatsachen in verschiedene Gebiete zerfällt, so gliedert<br />
sich auch der Inbegriff der wissenschaftlichen Erkenntnisse in eine<br />
Reihe von Eiilzelwissenschaften. Die gegebenen Tatsachen trageil aber<br />
bereits die Spuren der unvermeidlichen, schon durch die priiliitiven<br />
Äuiseruilgen geistigen Lebens bedingten Deillxarbeit an sich. Darum<br />
ist eine Wisseilschaft notwendig, die von allen, den gegebenen Tatsachen<br />
anhaftenden Unterscheidungen und Beziehungen absieht und das von<br />
jeder Bestimmung befreite, nicht weiter reduzierbare Gegebene zum<br />
Ausgangspunlit nimmt. Sie führt zur einheitlichen Begründung und<br />
systematischen Zusammenfassung aller überhaupt möglichen Erkeiint-<br />
nisse.<br />
Diese dem Kreise der Einzelwissenschaftei~ nicht zugehörende,<br />
grundlegende und allgemeine Wissenschaft ist die Philosophie.<br />
I.<br />
Jede Erkenntnis bietet sich als das Produkt von zwei Faktoren dar.<br />
Der eine beruht auf Erlebnissen oder Erfahrungen, die zufällig oder<br />
nach mühevollem Suchen, immer aber als etwas Gegebenes, der Willlrür<br />
Entzogenes im Bewusstsein auftauchen oder von auisen an den Menschen
Die Aufgabe der Philosophie. 139<br />
herantreten. Der andere besteht in der Betätigung des Deiiliens, das,<br />
durch die Erlebnisse oder Erfahrungen angeregt, das Dargebotene er-<br />
faist, bald diese, bald jene Seite besonders liervorliebt und durch Unter-<br />
scheiden und Vcrknupfen, durch Analyse und Synthese zur Erlienntnis<br />
gelangt.<br />
Dass bei jedem Denkalite ein inneres Erlebnis oder eine äuisere Er-<br />
fahrung zugrunde liegen müsse, wird inan wohl nicht bezweifeln, da<br />
man nicht denken kann, ohne e t w a s zu denken. Nan lröiinte es aber<br />
vielleicht für möglich halten, etwas zu erleben oder in Erfahrung zu<br />
bringen, ohne dais zugleich das Dcnlien sich an ihm betätige. In der<br />
Tat sagt man gelegeritlich, dais man niclits gedacht, sondern blois dcn<br />
Eindrücken der Auisenrvclt oder auftauchenden Erinneruiigeii sich Iiiii-<br />
gegeben habe. Erwacht man aber aus einem solchen Zustande schein-<br />
barer Untätiglieit, um mit doppeltem Eifer die unterbrochene Dcnli-<br />
arbeit wieder aufzunehmen, so liaiin es sein, dais trotz aller Anstrengung<br />
die gewünschten Gedanken nicht lioinmen wollen, und bloCs die Wahr-<br />
nehmung der unmittelbaren Umgebung die unangenehme Leere ansiullt,<br />
bis vielleicht ein neuer Zustand passiven Verhaltens eintritt und die<br />
gesuchte Erlienntnis in einem glucklichcii Einfall ohiie jede Willens-<br />
anstrengung darbietet.<br />
Sieht maii nun genauer zu, so findet man, dais nicht nur bei solch<br />
einem glücl
130 Die Aufgabe der Philosophie.<br />
frei, blofs im praktisclien Leben sich betätigt, uiiaufhörlich und uriabsichtlich<br />
vermvlirt, befestigt und berichtigt. Und selbst im primitiveil<br />
Natiirzustaiide, als Glied der nahrungsuchenden Horde, sammelt der<br />
Melisch einen Schatz von Erfahrungen und Keniltnisseil, der von Generation<br />
zu Generation sich fortpflanzt und vergröisert. Die Erlren~itnisse<br />
des Kindes und des Naturmenschen wird man aber nicht als wissenschaftliche<br />
in Anspruch nehmen dürfen. Es gibt demnach auch vorwisseiischaftlichv<br />
EiBenntnisse, welche die Vorstufe zu den wissci~scl~af t-<br />
liclien Erkenntnissen bilden.<br />
Da eine Erkenntnis entsteht, wen11 ein Gegebenes zugrunde liegt,<br />
an dem das Denken sich betatigt, so kann man fragen, ob der Unterschied<br />
zwischrn der wissenschaftlichen und vorwissenschaftlichen Erkenntnis<br />
etwa durch die Verscliiedenheit des Gegebenen oder der Art<br />
und Weise des Derikeils bedingt wird.<br />
Nun wächst aber das Kind zum selbständigen Forscher heran, und<br />
aus ciem primitiven Naturzustande entwiclrelt sich das auf wissenschaftlicher<br />
Erlieiiiitnis beruhende Kulturleben, ohne dais eine ueue Welt<br />
entstäiicle oder neue Sinne und neue Geisteskräfte den1 Menschen geschelilit<br />
würdeii. Es bietet sich vielmehr stets dieselbe Welt den Sinnen<br />
zur IYahrnelmung dar, und es ist immer dasselbe Fühlen und Empfindeiz,<br />
in dem sich der Reichtum des Bewufstseins kund tut, und dasselbe im<br />
Untersclieideii und Verknüpfen sich betätigende Denken, das zur Erlreiiiltnis<br />
führt. Darum liommt in der, wissenschaftlichen Erkenntnissen<br />
ebenso wie in den vorwissenschaftlichen nur das zur Ausgestaltung, was<br />
von iinfailg an als blögliehkeit vorhailden war.<br />
31au ist zwar unter Umständen geneigt, Offeilbarungen aus einer<br />
iibersiiliilicheii Welt oder besondere Kräfte des Geistes vorauszusetzen,<br />
wciiil ein Jfensch ganz neue Erkenntnisse gewinnt. Dies ist aber doch<br />
wohl nur dann der Fall, wenn die Einsicht in das Zustandekommen der<br />
Ei-l
Die Aufgabe der Philosophie. 131<br />
nel~mungen mit Rücksicht auf die ihnen zulrommenden Unterscheidungen<br />
und Beziehungen als gedachte Gegenstände anzuerkennen. Anderseits<br />
sind selbst die höchsten und tiefsten Erkenntnisse auf Unterscheidungen<br />
und Beziehungen zurückzuführen, so dais in ihnen dasselbe Denken wie<br />
in den einfachen Erlebnissen und Erfahrungen sicli tätig erweist.<br />
Darum ist es nicht zulässig, ein abstrahierendes, begriffliches<br />
Denkcn und ein anschauliches, gegenständliches Denken zu unter-<br />
scheideil und als besondere Arten einander gegenüberzustellen. Denn<br />
jedes Denken bezieht sich auf anschauliche Gegenstände, da stets ein<br />
Gegebenes, das als Inhalt des Bewuistseins unmittelbar erfaisbar ist,<br />
zugrunde liegt. Es führt aber zugleich zu Erkenntnissen oder, wenn<br />
man vorzieht, das Erlrannte als das Begriffene zu bezeichnen, zu Be-<br />
griffen, clic in gleicher Weise wie die anschaulichen Gegenstände auf den<br />
TTntcrscheiclungen und Beziehungen des Denkens beruhen.<br />
111.<br />
Wenn demgemäfs weder rieue Erfahrungen oder Erlebnisse noch<br />
neue Betütigungsweisen des Denlrens zur Verfügung stehen, so können<br />
die wissenschaftlichen Erkenntnisse von den vorwissenschaf tlichen offenbar<br />
nur durch die Art und Weise, wie sie auf Grund des Gegebenen<br />
durch das Denken gewonnen werden, sich unterscheiden.<br />
Mit Rücksicht hierauf ist zu beachten, dais jede Erkenntnis mit<br />
Notwendigkeit als Ausfluis der jeweils vorhandenen Geistesverfassung<br />
zustande kommt. Denn indem der Mensch in seiner individuellen Boschaffenheit<br />
ein bestimmtes Erlebnis hat, werden andere Erlebnisse, die<br />
er bereits gehabt hat, samt den auf sie bezüglichen Erkenntnissen in<br />
ihm wach gerufen; und auf Grund des hieraus sich ergebenden Bewuistseiiiszustaildes<br />
sieht er sich, ohne es ändern zu lrönnen, dazu geführt,<br />
Uiiterscheidungeii und Verknüpfungen hinsichtlich des vorliegenden<br />
Erlebnisses auszuführen. Die in denselben sich darbietende<br />
Erlcenntiiis ist somit in der Tat das notwendige Produkt des Gegebenen<br />
und der durch dic ganze Persönlichkeit des Erkennenden bedingten<br />
Denlcarbeit.<br />
Darum lraiiil man Erkenntilisse gewinnen, ohne von ihrem Zustandekommen<br />
zu wissen und ihre Entstehungsbedingungen zu beachten. Ja,<br />
es nluis dies möglich sein, da nur auf diese Weise die Anfange des Erkennen~<br />
im Kindesalter des einzelnen Menschen sowohl wie der ganze11<br />
Menschheit hervortreten lrönnen. Es sind somit die vorwissenschaftliehen<br />
Erkenntnisse auf die angegebene Entstehungsweise angewieseil.<br />
Da hierbei die Denkprozesse und die ganze Persönlichkeit des Erlrennendeii<br />
unbemerkt bleiben, so bietet sich das Erkannte nicht als ein<br />
Gewordenes und Bedingtes, sondern als der unvermittelte Ausdruck<br />
schlechthin bestehender Tatsachen dar.<br />
Wird beispielsweise ein Naturvorgang beobachtet, so tauchen nicht<br />
nur ähnliche, bereits bekannte Geschehnisse, sondern auch selbstvollbrachte<br />
Handlungen nnd Begebenheiten aus dem eigenen Leben im Bewufstsein<br />
auf. BSan erlebt sich selbst in seiner individuellen Eigenart,<br />
9*
132 Die Aufgabe der Philosophie.<br />
iiideni man sich der Naturbetrachtuilg hingibt. Es wird aber, da diese<br />
Vorgänge im erliennendeii Subjelite als solche unbeachtet bleiben, das<br />
Erleben des eigenen Seins von der Beobachtung der Xatur nicht ge-<br />
schieden. Darum bclebt sich die Natur. Xenschliche Kräfte, nieiischeiz-<br />
ahiiliche Wesen schcinen in ilir zu walten. Und der Naturvorgang gilt<br />
als hinreichend erklärt, wenn inan ihn als die Wirkung menschlicher<br />
Kräfte oder menschenälinlicher Wesen darzustelleii vermag.<br />
Nail gelangt so zur Mythenbildung, durch welche unsichtbare, im<br />
Verborgenen lebende Wesen von menschlicher Art erdichtet werden, uni<br />
aus ihrem Wirlien das Naturgeschehen und die Geschicke des Lebens zu<br />
erklaren. Auf diesem Wege kann eine bis in die Eiilzelheitcii gehende<br />
Welt- und Lebensauffassuilg ausgebildet werden, die den Xensclieii uiid<br />
die Gegenstände der Natur hinnimmt, wie sie sich dein Denken dar-<br />
bieten, ohne die Bedingtheit durch das Denken zu bcachteii, uiid darum<br />
einerseits das menschliche Sein in die Welt hineinträgt, anderseits iii<br />
dem Naturgvschehen dendAusdruek menschlicher Tätiglrcit wiederfindet.<br />
Die Mytlieii, in denen eine solche naive Welt- und Lebeiisbetrach-<br />
tung ihren Ausdruck findet, gehen von Mund zu Mund, von Geschleclit<br />
zu Geschleclit und werden zu einein durch Überlieferung und Ge-<br />
wöhnung gefestigten Besitz. Kommt in ihnen uberdies das, auf der<br />
Gebundenheit an übersiilnliche Wesen und Kräfte beruhende religiöse<br />
Lebcn zuin Ausdruclr, so dienen sie wohl auch als Stütze für einen<br />
Iiultus. der tief in die Lebensgewolinheiten eingreift. Sie werden so zu<br />
einer Macht, die Anerkennung verlangt und findet, bis der eine oder<br />
der andere, der zu einem selbständigen Leben erwacht, sich in einen<br />
Gegensatz gegen die zur Gewohnheit gewordene Auffassuiigsweisc stellt<br />
und zum Widerspruch gegen die überlieferteil Erlreniltnisse kommt.<br />
Durch den Widerspruch entdeckt aber der Mensch sich selbst als<br />
den Erkennenden. Denn man liöiiiite nicht widersprechen, wenn die Er-<br />
kenntnis wie ein objektiv existierendes Ding sich verhielte und nicht eil1<br />
Werk des Menschen wäre, das nur, indem es ailerl
Die Aufgabe der Philosophie. 133<br />
Im ersteren Falle muis sich die nämliche Erlrennliiis immer wieder<br />
darbieten, sobald das Gegebene im Bewusstsein vorliegt. Sie behauptet<br />
sich gegen den TViderspruch und erweist sich als allgemein gültig. Dem-<br />
zufolge hat sie als wissenschaftliche Erlrenntnis zu gelten. Im letzteren<br />
Falle hingegen kann sie nur in Anbetracht der besonderen subjelrtiven<br />
Bedingungen, die einen maisgebeiiden Einfluis gewonnen haben, An-<br />
erkennung finden. Darum müiste sie verworfen werden, sobald sie dem<br />
Gegebenen als solchem angeheftet werden sollte. Maii muis allerdings<br />
zugestehen, dais es eine völlig bedingungslose Erlrenntnis nicht gibt.<br />
Die Bedingungen lassen sich jedoch als Grundsätze formulieren, deren<br />
Geltung vorausgcsetzt wird, wenn es sich um die Feststellung allgemein<br />
giiltiger Erkenntnisse handelt.<br />
IIiernaeh hat die wissenschaftliche Erlrenntnis die Prüfung ihrer<br />
Eritstehuiigsweise zur Voraussetzung. Sie besteht in den Unter-<br />
scheidungen und Beziehungen, die lediglich durch das Gegebene und<br />
nicht sonstwie durch die Persönlichkeit des Erkennenden bedingt sind,<br />
und muis demgemäis unter Bezugnahme auf die vorausgesetzten Grund-<br />
sätze jedem Widerspriich gegeniiber als gültig anerkannt werden.<br />
Wenn sich nun auch die kritisch-wissenschaftliche Betrachtungs-<br />
weise im allgemeineil im Gegensatz zur Mytheiibildung entwickelt, so<br />
kann doch das naive, unkritische Verhalten, das im Wesen des ik1enscheri<br />
begründet ist, hierdurch liicht beseitigt wcrden. In einem zur Beob-<br />
achtung gelangenden Naturgcscheheii wird stets das Ich des Beobachters<br />
lebendig werden, so dais subjelctives und objektives Scin in eine Einheit<br />
sich verweben. Und diese Verwebung wird ihren lZeiz ausüben und den<br />
Menschen gefangen nehmen, aucli wenn sie iiacli erfolgter kritischer<br />
Selbstbestimmung nicht mehr als Quelle allgemein gultiger Erkenntnisse<br />
anerkannt werden lrann. Darum findet die naive 13Teltbetrachlung iii<br />
Kunst und Dichtung ihre Pflege. Sie lcann - wie in dem Scliillerschen<br />
Gedichte „Die Götter Griechenlands" - den Vorzug vor der lrritischeii<br />
Weltbetrachtung erhalten. Sie vermag sogar - wie die Farbenlehre<br />
Goethes zeigt - einer einseitigen wissenschaftlichen Auffasaungsweise<br />
gegenüber anregend zu wirken, indem sie die Aufmerlisamlreit auf die,<br />
vom rein physikalischen Stalidpunlite aus vernaclilässigte subjelitive oder<br />
psychologisclie Seite der Erscheiiiungeil lenkt.<br />
Der Aiireguiig Folge zu leisteii, muls aber dem lrritischeri Forscher<br />
iiberlassen bleiben. Denn einwandfreie Erkenntnisse haben zur Voraus-<br />
setzung, dass die zugrunde liegenden Tatsachen von sonstigen Tatsachen<br />
und Besonclerheiten, die beim Zustandelrommen der Erlrcnntnis Einfluis<br />
gewinnen liönnen, abgesondert werden und für sich allein zur Gelturig<br />
kommen.<br />
IV.<br />
Da jede wissenschaftliche Erkenntnis an gegebene Erfahrungen<br />
oder Erlebnisse gebunden ist, so wird auch das System von Erkeniit-<br />
nissen, in dem sich eine einzelne Wissenschaft darbietet, durch eine ge-<br />
gebene Mannigfaltigkeit zusammengehöriger Tatsachen bestimmt. Es<br />
muis daher ebensoviele einzelne Wissenschaften geben, wie sich Teil-
134 Die Aufgabe der Philosophie.<br />
gebiete iniicrlialb des Gesaintgebietcs des Gegebenen abgreiizeii lasseii.<br />
Demgemäis kann der Inbegriff der wissenschaftlichen Erkeilritiiisse nur<br />
anfänglich, solange eine weitergehende Ausbildung iioch fehlt, der<br />
Gliederuiig entbehren; er muis dagegen bei fortschreitender Entwicklung<br />
in einen stets weiter sich ausdehneiidcn Kreis von Eiiizelwissenschaften<br />
zerfallen.<br />
Indem sich dieser Entwicklungsprozeis im Laufe der Zeiten vollzog,<br />
haben sich gewisse Uiitersuchungen, die unter dem Name11 der Philosophie<br />
zusammengefaist zu werden pflegen, als unmittelbare Fortsetzung<br />
der ursprangliclien einzigen und einheitlichen Wissenschaft behauptet.<br />
Sie erheben den Anspruch, die Eiiilieit und Geschlossenlieit der Erkenntiiisse,<br />
die bei der Zerfällung iii Einzelwissenchaften verloren gellt, festzuhalten<br />
uiid treten so in einen Gcgensatz zu den Eiiizelwisseiischaften.<br />
Anderseits scheinen sie doch, sofern sie den Charakter einer Wisseiischaft<br />
beailsprilcheri, in die Reihe der Eiiizelwissenschaften sich cinfügen<br />
zu müsscii.<br />
Dieser Zwiespalt tritt iil dcr verschiedenartigen Auffassuiigsweise,<br />
welche die Philosophie erfahreil hat, deutlich zutage. Sie wird einesteils<br />
als der Inbegriff der wisseiischaftliclien Erkeiiiitnisse bezeichnet,<br />
wobci nicht bedacht wird, dais die Zusammenstellung von Erkeniitnissen<br />
nicht selbst wieder eine Erkeiintiiis ist und somit auch nicht eine ileue<br />
Wissenschaft begründen kann. Sie wird aiidernteils als die Wisseiischaft<br />
vom Gciste oder auch voll den allgemein gültigen Werten bestimmt,<br />
wogegen mit Recht darauf hingewiesen wird,l) dafs eiiie Eiiischränkung<br />
auf eiii bestimmtes Gebiet dem uiliversellen Charalitcr der<br />
bisherigen grofsen Systeme der Philosophie nicht entspreche.<br />
Es ist darum von Interesse, dais die hier gegebene Bestiinmung der<br />
wissenschaftlicheil Erkeniitnis zu einem, dem Kreise der Eiiizelwisseiischafteii<br />
nicht zugehörigen Gebiete führt, das die gemeinliiil als pliilosophiscli<br />
bezeichneten Gebiete iii sich schlielst.<br />
Wird nämlich beachtet, dais alles in bestimmter Weise Gcgebeiie<br />
durch Untcrscheiduiigen und Beziehungen gekennzeichnet sein muis,<br />
so sieht mall ein, dais iri diesen Unterscheidungen uild Beziehungen<br />
bereits eine Erkenntnis vorliegt. Ein Naturgegenstand ist beispielsweise<br />
eiil in räumlicher und zeitlicher Form sich darbietende Träger<br />
von Eigeiischafteil und Zustäiiden, uiid eine menschliclie Haiidlung erscheint<br />
als Ausfluis von Kräften, die in der Seele ihren Sitz haben. Die<br />
Annahme einer materiellen oder immateriellen Substanz, welche die<br />
Trägerin von Eigenschaften und Ziiständen oder von zielbewuist wirkenden<br />
I
Die Aufgabe der Philosophie. 135<br />
noch als Einhcit, weder in räumlicher, noch in zeitlicher Form, weder iii<br />
materieller, noch in immaterieller Existenz, nicht als Sitz von Kräften<br />
und nicht als Träger von Eigenschaften und Zustanden sicli darbietet.<br />
Es muis folglich eine Wissenschaft geben, die das jeglicher Bestimmtheit<br />
Entkleidete, der Unterscheiduilgen und Beziehungen blois<br />
Fähige zum Ausgailgspuillrt nimmt.<br />
Sie ist die allgemeine Wissenschaft, weil ihr das Gegebene überhaupt,<br />
iiiclit dieser oder jener Teil des mit Bestimmungen bereits behafteten<br />
Gegebenen zugrunde liegt. Sie ist zugleich die Wisseiiscliaft<br />
von den Prinzipien, weil sie das Zustaiidelrommen aller Bestiininungen<br />
und somit insbesondere auch der den Einzelwissenschaften zugrunde<br />
liegenden Bcstimmuiigen, d. h. der als gegeben vorausgesetzten Anfänge<br />
oder Prinzipieil des Erkenilens lehrt. Dais sie abcr in Wahrheit<br />
die Philosophie ist, ergibt sich aus der ilähereil Bestimmuilg ihrer<br />
Aufgabe.<br />
V.<br />
Befreit man das Gegebene von allen ilznl ailhaftenden UnteTscheidungen<br />
und Beziehungen, so wird es nicht zum Absoluten, das vom<br />
Denken unabhängig als Ding an sicli existiert. Es bietet sich vielmehr<br />
lediglich als das Unbestimmte, aber durch das Denken Bestiinmbare<br />
dar.<br />
Man hat darum vom Denken auszugehen. Aber auch das DenBen<br />
ist keine für sich bestehende Tätigkeit, die ihre Objekte aus sich heraus<br />
erzeugen könnte. Es kann darum nur in den Bestimmungen, die es am<br />
Gcgebenen ausführt, hervortreten.<br />
Die Voraussetzuilg für jede weitergehende Bestiiniliung ist nun<br />
offenbar das bloise Gegebensein der Gegenstande. Als die primitivste<br />
Form des Denkens nluCs darum das bloise Erfassen anerlraniit werden,<br />
wodurch die Gegenstände ihr Dasein im Denken gewinnen.<br />
Indem der Akt des Erfassens vollzogen wird, ist die Möglichkeit zu<br />
einem abermaligen Vollzuge gegeben. Die wiederholte Ausführung<br />
führt aber zu einer Reihe von Gegenständen. DemgemäSs erweist sicli<br />
das Denken als reihenförmig fortschreitend, und die Reihenform als die<br />
Grundform, an die das Denlren bei jeglicher, wiederholt ausgeführten<br />
Tätigkeit gebuilden ist.<br />
Alle Glieder der Reihe werden in gleicher Weise erfafst und stiinineii<br />
insofern miteinander überein. Sie müssen aber auch voneinander unterscheidbar<br />
sein, wenn sie sich nebeneinander behaupten sollen. Demgemäis<br />
erfordert das Erfassen einer Reihe von Objekten die Unterscheidung<br />
der eiilzelnen Glieder, so dais sich das erfassende Denken zugleich<br />
als ein unterscheidendes Deillren betätigt.<br />
Da ferner das Fortschreiten innerhalb der Reihe ebenso wie das Erfassen<br />
der einzelnen Glieder nicht ein Ergebnis frei schaffenden Denken~<br />
ist, sondern nur durch das Gegebene verarilaist werden kann, so<br />
ist zu verlangen, dass in dem einen Objekte der Grund liegt, der zu dem<br />
anderen Objekte hinführt. Die Objekte treten so in Beziehung zueinander.<br />
Das erfassende Denlren ist daher, indem es reihenförmig fort-
136 Die Aufgabe cler Philosophie.<br />
schreitet, nicht nur ein unterscheidendes, sondern auch ein beziehendes<br />
Denken.<br />
Hiernach sind zunächst die Reihenforin und die Formen des<br />
unterscheidenden und beziehenden Denlrens zu untersucheil, wobei<br />
Gegenstände vorauszusetzen siiid, die als die reinen Träger der Deiili-<br />
bestimmungen, ohne die in der gegebenen Wirlrlichkeit begründeten Be-<br />
scliräizliungeii, auftreten. Xan gelangt so nicht nur zur Logilr, in der<br />
die möglichen Formen und Beziehungen der Denlrgegenstände festzu-<br />
stellen sind, sondern auch zu den Grundlagen der Mathematik,') indeni<br />
insbesondere die Reihenforin des Denkens iii der Zahlenreihe, und ge-<br />
wisse Formen des beziehenden Denlrcns in den verschiedenen Arten all-<br />
gemeiner Zahlen ihre Ausgestaltung finden.<br />
Es ist sodanii festzustellen, wie das Gegebene auf Grund der Betati-<br />
gung des Deiiliei-is sich in zeitlicher und räumlicher Form als eine<br />
3lannigfaltiglieit unterscl-ieiclbarer und in Beziehung zueinander stelien-<br />
cler Gegenstande darstellt. Beachtet man lediglich die Uiiterscheidbar-<br />
keit der Gegenstande, so reduziert sich das Gegebene auf die in der<br />
Eom von Empfindungen uiid Gefühlen sich darbietenden Bewuistseins-<br />
inhalte. Beriiclisichtigt man hingegen clie in der uiiablässigen Verände-<br />
rung und Uniwaridlniig des Gegebenen hervortretenden Beziehungen, so<br />
erhält i-iiaii das Reich des objektiven Geschehens, wo man unter den im<br />
Ausiibei-i und Erleiden von Wirkungen sich tätig erweisenden Objekten<br />
entwicklungsfähige Organismen uiid insbesondere die in einem Entwicli-<br />
lungsprozesse begriffene menschliche Gesellschaft findet. Psychologie<br />
und Naturphilosophie, mit Einschluis der philosophischen Eiitwiclr-<br />
lungslehre, gewinnen so ihren Inhalt.<br />
Indem aber ein Vorgang der objektiven Welt erlebt wird, tritt er iii<br />
Beziehung zu der ganzen Persönlichkeit des Erlebenden, die so zur An-<br />
teilnahme erwacht, sich in Anspruch genommen sieht und demzufolge<br />
den Vorgang als angenehm oder unangenehm empfindet. Anderseits<br />
sieht der Mensch sich selbst als denkendes und handelndes Wesvil in die<br />
Welt des objektiven Gescliehens gestellt. Er lianii daher nicht umhin,<br />
die gesetzmiisigen Folgen seines Handelns zu sich selbst, zu den von<br />
ihm erhofften und erstrebten Zielen in Beziehung zu setzen und so sein<br />
Tun und Lassen zu bewerten. Es eröffnet sich somit in der Unter-<br />
suchung dieser Verhiiltnisse ein Zugang zur ästhetik und Ethilr.<br />
Demzufolge führt die in Frage stehende Wissenschaft in der Tat zu<br />
den verschiedenen, den ganzen Bereich menschlicl-ien Erlreiiilens beherr-<br />
schenden philosophischen Disziplinen, die sie in cler Forin eines gc-<br />
schlossenen Systems darbietet.<br />
2) Vgl. meine ,,Untersuchungen über die Grundlagen der Mathematik" in<br />
den <strong>Philosophische</strong>n Studien von Wundt, Bd. 11 U. 14.<br />
mm
Zur Physik des Parmenides.<br />
Von<br />
Fritz Medicus, Halle a. C.<br />
er zweite Teil de3 parmenideischen Lehrgedichtes bietet eine<br />
Schwierigkeit besonderer Art. Die „Möglichlieit" der ganzen<br />
Theorie will sich nicht einsehen lassen. GewiPs fehlt es der<br />
Physili des groisen Eleaten auch sonst nicht an Schwierig-<br />
keiten: ihr Grad von Selbständigkeit bzw. ihre Abhängigkeit von deii<br />
Orphikern, von denen wir wenig, und von den Pythagoreern, von denen<br />
wir kaum mehr als nichts wissen; dann die richtige Interpretation der<br />
sehr fragmentarischen Berichte über das Weltsystem - das und noch<br />
manches andere ist Gegenstand verwickelter Untersuchungen. In-<br />
dessen, auf Fragen solcher Art stoisen wir in der Geschichte der alten<br />
Philosophie auf Schritt und Tritt; aber etwas geradezu Singuläres und<br />
darum anziehender und zugleich zweifellos auch wichtiger ist die prin-<br />
zipielle Fragc: Was soll diese Physik überhaupt? Wie fügt sie sich in<br />
den Rahmen des parmenideischen Systems? Oder - wenn sie sich nicht<br />
fügen sollte - wie hat sich ihr Urheber das Verhältnis der beiden Teile<br />
seines Gedichtes gedacht? Denn von der Voraussetzung, dais „Parme-<br />
nides der Groise" hierüber etwas gedacht hat, kaiin schlechterdings<br />
nichts riachgelassea werden. Die Augenscheinlichkeit des Wider-<br />
spruclies zwischen Metaphysik und Physik kann nicht das letzte Wort<br />
sein. Schon das Altertum hat diese Schwierigkeit empfunden, und wir,<br />
denen die G e s c h i c h t e der Philosophie ganz auiserordentlich viel<br />
mehr bedeuten muis als den Alten, empfinden sie erst recht.<br />
Es ist versucht worden, die Physik auf Kosten der Energie des meta-<br />
physischen Gedanliens akzeptabel zu machen. P a u l T a n n e r y hat<br />
in der (übrigens sehr verdienstvollen und an bedeutsamen Einsichten<br />
reichen) Arbeit „La Physique de Parm6nideU (Revue philosophique<br />
XVIII, 1884, 264 bis 292) behauptet: „Parm6nide a 6tabli que l'univers<br />
est un tout plein, limit6, spherique, et dans soll ensemble immobile,
138 Zur Physik des Parmenides.<br />
inengendre, impgrissable. I1 n'a pas ni6 les mouvcments partiels", uiid<br />
die Folgerung, die Tannery hieraus zieht, lautet: „Pour obtenir l'immobilite<br />
de l'ensemble malgr6 les appareiices de la rgvolution diurne, il<br />
suffit qu7 au-dessus des feux c6lestes il affirme le repos de la couche<br />
superieure, de 1' ao~azos ÖAvp~o~" (290). Aus der grandiosen Paradoxie<br />
der Lehre, dais nur das Sein ist, nicht aber auch das Nichtsein sein<br />
kann, mithin auch lreiii leerer Raum uiid mithin lreiiie Bewegung, lreine<br />
Veränderung, - ist hiermit ein astronomisches Weltbild geworden, in<br />
dem die Welt des absolut unveränderlichen Seins von der Welt dcr Ver-<br />
änderlicldreit räumlich getrennt ist, so dais also das beherrschende<br />
Prinzip in dieseln nietaphysischen System ein physisches wäre und die<br />
Tiberlrgeiiheit der Xetaphysili lediglicli darin bestände, dais nur i 11 r e<br />
Sätze zwingend bewiesen werden können. Aber es ist iiicht abzuseheii,<br />
warum in beschränkten Raumgrenzen möglich sein soll, was nacli dci<br />
strengen Lelirc unseres Philosophen überhaupt; uninöglich ist (vgl.<br />
fr. 8,96-38; Zahlung der Fragmente nach Diels). He i 1 z e hat gewiIs<br />
recht, wenn er (in der „Lehre vom Logos" 60) der aristotelischen Benennung<br />
unseres Elcateii als cines dqic~xoq zustimmt, „da dieser das<br />
Prinzip für jegliche Physis, die Bewegung aufhebt". Es kann hier<br />
durchaus Beinen Unterschied machen, ob die Scheinwelt die ganze Wirli-<br />
lichkeit, oder ob sie nur ein Teil der Wirklichlceit ist. Die Logik des<br />
Metaphysikers läist sich nichts abmarkten. Die Sclieinwelt kann nicht<br />
begriffen werden: d. h. sie hat keine Wahrheit und folglich keine<br />
Realitat in sich - wie sollte sie sich mit dein Seienden in den Rauni<br />
teilen? Das hieisc ja doch geradezu das Niclitscin als gleichberechtigt<br />
neben das Sein stellen - wie die „Doppelköpfe" tun (fr. G, 3).<br />
Auch J LI 1 i u s B e r g m a n 11 liat schwerlich das Richtige getroffen,<br />
wenii er in der parmenideischen Metaphysik weiter iiiclits findet als „die<br />
Überzeugung, dais die Gestalt, iii welcher sich das Seiende den Siiiiicn<br />
darstelle, nicht die wahre sei" (Geschichte der Philosophie I, 29). Die<br />
Wucht des irietaphysischen Grundgedailkens ist hier bedenklich untcr-<br />
schätzt. Bergniann macht nicht minder als Taniiery aus dem Eleaten<br />
einen Physiker : des Parmenides Gedanken „wandten sich ausschlieis-<br />
licli der Sinnenwelt zu" (a. a. O.).l) 0 nein! Nicht die Sinnenwelt so11<br />
in der Lehre der Wahrheit erklart werden, soiideri~ der Philosoph stellt<br />
sich ausschlieislich die Frage, was Wirklichkeit ist. Er liat eingesehen,<br />
dals die Sinne nur trügen: also lrommt nicht ihr Zeugnis, sondern es<br />
kommt allein die Vernunft in Betracht - und das, was die Vernunft<br />
liier gibt, ist wahrlich etwas anderes als eine Interpretation der Sinncii-<br />
welt. Ganz und gar entfernt sie sich vielmehr iii ihren Ent~viclrlungen<br />
von ihr, nur negierend kommt sie auf sie zu sprechen. Jeder Versuch,<br />
1) Im wesentlichen ebenso wie Bergmann interpretiert in jüngster Zeit<br />
Cosmo Guastella in seiner ,,Filosofia della Metafisica (Palermo 1905), Parte<br />
prima, Tomo secondo, p. XLVIII sqq. Das Sein der Eleaten sei nichts<br />
anderes ,,ehe il sustrato comune e immutabile di tutti gli esseri sensibili
Zur Physik des Parmenides. 139<br />
die Physik durch Abschwachung der metaphysisclien Paradoxie erträg-<br />
lich zu machen, ist unmöglich.<br />
Dies haben diejenigen Forscher erlraiiiit, die - wie Z e 11 e r und<br />
D i e 1 s - in der Pliysilr das von Parmenides abgelehnte Weltbild sehen.<br />
Parmeiiides wolle, erklärt Z e 11 e r , die abweicheiide Meinung nicht<br />
übergehen : „Der Leser soll beide Ansichten, die richtige und die falsche,<br />
vor sich sehen, um sich desto sicherer für die erste zu eiitscheideii.<br />
Die falsche Weltailsicht wird nun allerdiiigs niclit so dargestellt, wie<br />
sie von irgeiid einein der Früheren wirklich ausgesprocheii worden ist,<br />
sondern so, wie sie seiiier eigenen Meinung nach auszusprecheiz wäre.<br />
Ebenso niachen es aber auch aiidere alte Schriftsteller: auch Platon ver-<br />
bessert die Ansichten, die er bekämpft, nicht selteii nach Inhalt uiid<br />
Fassung, auch Thulrydides legt den handeliiden Personell iiicht das iii<br />
den Muild, was sie wirlrlich gesagt haben, sondern was er selbst aii ihrer<br />
Stelle gesagt haben würde" (Die Philosophie der Griechen I, 5. Aufl.,<br />
583 f.). Und wie Zeller findet auch D i e 1 s ,") Parineiiidcs wolle im<br />
zweitcii Seil seines Gedichtes in lediglich kritischer und propädeutischer<br />
Absicht „ein Spiegelbild der bisherigen d'oga~ geben'' (Pari~ienides<br />
Lehrgedicht 10, vgl. 63 U. bes. 100).<br />
Man wird iiun ohne Zweifel zuzugeben haben, dais die Physilr iiicht<br />
in demselben Dfaise wie die Metaphysik eine originale Leistung unseres<br />
Deiilrers ist. Gleich zu Anfaiig des zweiten Teiles weist die 3. Persoii<br />
Pluralis - xa~i$evzo, Ex~ii~av.co, 2,Ye~zo (fr. S,B n. 53) - darauf hin,<br />
dais die Urheberschaft der physischen Lehre ilicht einem einzelnen zukommt.<br />
T a n n e r y liat iii der schon erwähnten Abhandlung sehr plausibel<br />
gemacht, dais wir iii der parnienideisclien Physik „das bedcuteiidste<br />
Dolrumeiit über die damals in der italischeil Schule vorherrschendeil<br />
Ansichtcii" haben (a. a. 0. 289). Und auiser deii Pythagoreern liomnit<br />
Hesiod und kommen die Orphiker iii Betracht.<br />
Alleiii weiiii sich auch aus der Tatsache dieser dem Meister wohlbewuisten<br />
historischen Abhängigkeit folgern läist, dais ihm seine<br />
Pliysilr weniger ain Eerzen liegen niuPste3) als die Metaphysik, die gaiiz<br />
sein eigeiisles war, so bleiben deiin doch gar zu viele SchwierigIreitel1<br />
zurücli, wcnii man seine Stellung zur dolja als eine blois ablehnende<br />
charakterisiert. „Ich traue das dem Ehr~ü~digen nicht zu", sagt<br />
TJ. v. W i l a in o W i t z - M o e 11 e ii d o r f (Herines 34, 205) : „Parine-<br />
nides ist damit nicht zu Ende, dais er begrifflich das Prinzip des Seins<br />
findet: er weiis, absolute Wahrheit ist iii der Welt des Scheiiies nicht,<br />
abvr auf die Weltcrklirung lranri er nicht verzichten, weil er xvisseii-<br />
2) So wenigstens in seinem Beitrag zu den „Philos. AufsSltzen Ed. Zeller<br />
gewidmet" von 1887 und noch in dem 1891 herausgegebenen Buche "Parmenides<br />
Lehrgedicht
140 Zur Physik des Parmenides.<br />
schaftlich forscht, was er doch getan hat: er kann es nur als Hypothese<br />
geben, aber als eine probehaltige." In der Tat, viel zu unabweisbar war<br />
nach der vorangestellten Metaphysik die Aufgabe, nun auch einen posi-<br />
tiven Grund für das Dasein der irrealen Sinnenwelt zu geben," und viel<br />
zu sachlich und eindringend ist die Erörterung, als dais man an einen<br />
ausschlieislich eristischen Zwecli glauben dürfte. 3Gn vergleiche nur<br />
den ruhig-ernsten Ton, auf den die Fragmente 10 bis 12 gestimmt sind,<br />
oder vollends die argumentierenden Darlegungen iil fr. 16 mit dem wirk-<br />
lich polemisch gemeinten fr. 6. Und was kann mgn mit fr. 19, iu.2<br />
anfangen, wenn man in der d66a lediglich diejenige Neiilung sieht, die<br />
Parmenides n i c 11 t hat 1<br />
oüzw zoc xaza 6oEav Epv z68e xui vvv Eaoc<br />
xai ,ti~z6zecz' dnd zoU8.s Z~;~E~'C+OV~L zeayklza.<br />
Soll das nur falsche Meinung sein, dafs die Erscheinurigswelt ein<br />
Ende haben wird? Zwar um historis~he r)b~nr, die Parmenides im Auge<br />
haben könnte, brauchte man nicht verlege; zu sein: in der orphischen<br />
Dichtung, bei Ailaximander und bei ITeraklit finden sich entsprechende<br />
Lehren, und inan könnte zunächst daran denken, dais hier clern Ungedanken<br />
einer Vergängliclikeit die Einsicht in das Wesen des Seins gegenüber<br />
gedacht ist, das von y6q~~crcs und c?~&.(i.~u~ nichts weil%. Allein<br />
wie soll sich dann v. 3 aiischliefsen?<br />
Dais Parmeilides in diesem Verse kein Referat über eine von ihm<br />
selbst abgelehnte rfitcx gibt, liegt auf der Hand (vgl. fr. 8, 8s). Das Ver-<br />
haltnis zu v. 1 U. 2 könnte also nur ein gegensätzliches sein: „Die<br />
falsche behauptet zwar, die Dingc der Welt (1 hdc) seien entstanden<br />
und würden dereinst untergehen; in Wahrheit aber haben erst die<br />
Xerischen durch Xamengebung diese Dinge verselbständigt.'.<br />
Allein man wird zugeben, dais der Gegensatz, wenn es sich wirklich<br />
um einen solchen handeln soll, im griechischen Text so gut wie gar nicht<br />
angedeutet ist, obwohl die Härte dieser Gedankenverbindung5) es dop-<br />
pelt notwendig gemacht hatte, deutlich zu markieren, dais der Bericht<br />
über die fremde Lehre hier ein Ende hat und der Philosoph wieder im<br />
eigenen Namen spricht. 13ingegeil ist alles glatt und ungezwungen,<br />
wenn man den dritten Vers gar nicht in Gegensatz zu den beiden ersten<br />
stellt, sondern interpretiert: „So ist diese Welt des Scheines gewordeii<br />
und besteht auch jetzt und wird noch eine Zeitlang wachsen, dann aber<br />
versinken - diese Welt, in der ein jedes Scheinding seine Selbständig-<br />
keit nur durch menschliche Namengebung hat."<br />
4) Vgl. Th. Gomperz, Griechische Denker, I, 146.<br />
6) Es müisten zwei Gedanken eingeschoben werden, ehe V. 3 als Gegensatz<br />
an das Vorangehende angeschlossen werden köiinte: 1. In Wahrheit aber gibt<br />
es kein Entstehen und Vergehen. 2. Nur das un~reriinderliche Sein hat selbständige<br />
Wirklichkeit.
Zur Physik des Parmenides. 141<br />
Die Welt des Sclieines steht sonach als ein vorüberflielsendes Phä-<br />
nomen der ewigen Welt der Wahrheit gegenüber: das ist des Parme-<br />
izides c i g e 11 e „jlIeinung". Allein sclbstvcrstaricllich liegt darin,<br />
dass die Scheinwelt eiilinal aufhören rnuis, noch lreine Antwort auf die<br />
Frage nach ihrem eigeiltlichen Wesen, noch keine Ailt~vort auf die<br />
Frage, wie neben der Metaphysilr des unveraiiderlichen Seins eine, wenn<br />
auch nur liypothetische Physik bestehen kann.<br />
Doch vielleiclit ist dieser Ausdruck „ h y p o t h e t i s c h e Phjrsik",<br />
der sich allerdings ziemlich allgeniein eingeburgert hat, nicht allzu<br />
glücklich gr~valilt. Deiin wenn das bisher Ausgeführte zugestanden<br />
werden soll, so muls auch zugegeben werden, dals dic d6En weder die<br />
falsche IIypotliesc der Gegner bedeute11 bann (Zeller), noch die eigene<br />
I-typothese, die als urahrscheinlicl~c Annahme zur Erklärurig dessen<br />
aufgestellt ware, wovon es kein absolut sicheres Wissen gibt (Tannery).<br />
Nimmt man einerseits aii, dais Parmenides in der Physik seine eigene<br />
dota ~ortri~gt, und liist man ihn anderseits iiz der Metaphysik alles das<br />
sagen, was seine Worte sagen Bönneil und nach strenger Logik auch<br />
sagen iilüsseil, so bleibt nur ubrig, clais die Pliysilr üb e r h a U p t I< e i 11 e<br />
R e a 1 e r lr 1 ii r U n g für das Zustandelroinmen der Welt geben will.<br />
Und damit iit nun freilich etwas gesagt, was sofort - trotz aller Ab-<br />
hängigkeit von aizdereii Lehren - der Physilr des Eleaten unbedingte<br />
Origiiialitat sichert: der Grund, aus dem Parmenides diesc Theorien<br />
als seine eigene doEa aizerlrennen lroimte, gehört ihm allein, und darum<br />
besagen diese 1,ehreii auch bei ihm etwas ganz anderes als bei jedem<br />
anderen, sowie man nach ihrem Wert für die Gewinnung oder Abrundung<br />
einer W~ltanscliauung fragt.<br />
Parmei~ides ist eil1 Dichter. Die Dichter aber lügen zu viel - und<br />
Parmenides weiis, dais die Dicliter lügen. Allein er weiis auch, dais cs<br />
Fragen gibt, auf die doch nur ein Dichter antworten lrann, und eine<br />
solche Frage ist ihm die nach dein Wesen des Scheins. Oder anders<br />
formuliert : Die Physilr des Parmeiiides ist ein My t h o s , vergleichbar<br />
manchein M~thos Platoizs.<br />
Die Tatsacl-ie der inythologischeil Einlrleiduizg besagt dies sclbstverständlich<br />
iioclz nicht. Auch die Lclire xeGS Wi,~;:).elav ist mythologisch<br />
eiiigeldeidet. Und überhaupt lebt Parmenides in einer Zeit, in<br />
der „die Philosophie noch nicht in der Dürre abstrakter Darstellung ihr<br />
Ideal suchte" (W i 1 h c 1 m C h r i s t , Gesch. d. griech. Literatur,<br />
2. Aufl., 06). Aber die besondere Gestalt der von Parmenides gewählten<br />
mytliologisclieiz Figuren scheint mir Aufnierksamlreit zu verdienen (im<br />
Gegensatz zu T a nn e r y a. a. 0. 285/6).<br />
Belraiiiztlich nennt Parmenides zwei pliysilralische Prinzipien: Feuer<br />
und Fiilsterizis, Tag und Nacht, leicht und schwer. Die Mischung<br />
dieser I?cidciz aber „stellt er syinbolisch als eine geschlechtliche Verbindung<br />
dar" (Z e 11 e r a. a. 0. 570).G) „In der jllitte der Welt, so lesen<br />
-<br />
6) A. Döring behauptet (Zcitschr. f. Philos. U. philos. Kr., 104, S. 175):<br />
,.Offeiibar wird . . . das dunkle, dichte, mehr stoffartige Element dem weiblichen,<br />
das lichte dem mannlichen Geschlecht gleichgesetzt.' Überzeugt bin ich hiervon
142 Zur Physik des Parmenides.<br />
wir bei den1 Eleaten, ist die Göttin (< dalPcov), die alles lenlrt. Denn<br />
überall treibt sie zu schmerzvoller Geburt und zur Paarung; zum Manne<br />
schickt sie das Weib und umgekehrt wieder zum Weibe den Mann"<br />
(fr. 12,3-6), und .,als den ersten von allen Göttern erschuf sie den Eros"<br />
(fr. 13).<br />
Xeu ist an den hier von Parmeiiides aufgegriffenen Vorstellungen<br />
selbst gar niclits (vgl. Th. Goniperz, Griech. Denker I, 73; H. Diels,<br />
Parmenides 109 f.; 0. Kern, Arch. f. Gesch. d. Philos. 111, 175) ; aber<br />
durchaus nur parmenideisch ist die Synthese, in die diese Vorstellungen<br />
hier eingehen.<br />
Alles Werden ist ein Geborenwerden. Das Rätsel der Vielheit ist<br />
identisch mit dem Rätsel der Zeugung: denn ein Zeugungsakt ist der<br />
Grund alles Sonderdaseins. Wenn der Melisch Liebe fühlt, so fühlt er,<br />
dais er nichts Ganzes, sondern weniger als ein wirldiches Ganzes ist,<br />
dais er einer Ergänzung bedarf. In der geschlechtlichen Vereinigung<br />
wird die ursprüngliche Einheit, wie sie aller Vielheit Grund ist, dar-<br />
gestellt. I-Iier ragt das Netaphysische in das Physische herein, oder<br />
besser: hier entspringt das Physische aus dem Metaphysischen. Kein<br />
Wunder, dais sich das Iiiteresse des Naturforschers Parmenides ganz<br />
besonders auf diesen Punkt richtet (fr. 17 U. 18). Wenn irgend etwas<br />
im Reiche des Scheins, so ist es der metaphysische Naturvorgang der<br />
gesclilechtlichen Verbindung, dessen Erforschung Aufschluis über den<br />
Zusaninienhang zwischen den1 wahrhaft Wirklichen und clem blois Erscl~einenden<br />
geben kann: hier ist der Mensch dein Wesen des ungeteilten<br />
Seins näher als sonst, hier crlebt er eine Steigerung seiner selbst, eine<br />
Ergänzung seiner Unvollstandiglreit. Freilich begreift er sie nicht;<br />
aber er begreift doch, dafs in der Erhebung über sein schattenhaftes<br />
EIalbdaseiii, die in der geschlechtlichen Vereinigung Ereignis wird, die<br />
Notwendigkeit des sich salbst haltende11 einen Seins wirksam ist. Die<br />
Sehnsucht, „eins(' zu werden und damit wahrhaft erst zu „sein", ist in<br />
jener Gai',u
Zur Physik des Parmenides. 143<br />
Dingcs vorspiegeln, fügen sie nicht zu den1 wirklichen Sein dieses Ob-<br />
jelrtes etwas hinzu - denn dieses Objekt hat für sich überhaupt gar<br />
kein wirlrliclies Sein -, sondern sie verbcrgen uns den Zusammenhang,<br />
den dieses Objekt iii der Wurzel seiner Erscheinung mit dem einen Seiii<br />
hat: die Wurzel der besonderen Erscheinung aber liegt in der Zeugung.<br />
Die Einzeldinge sind weniger als ViTirklichlreit: darum<br />
kann es auch von ihnen keiiie Wahrheit, sondern nur W e n i g e r a 1 s<br />
Wa h r h e i t geben. Die begriffliche Fixierung versagt: der Philosoph<br />
In u i s Dichter werden - cr m U 1 s lügen.<br />
So crlrlärt sich - nicht allzu schwierig, wie mir scheint -, dais der<br />
starre metapliysische Rationalisinus einer irrationalen Physik Raum<br />
gewähren kann. Diese ganze Physik ist nichts als stammelnder Mythos.<br />
Ihre Objekte sind „unaussprechlich" lind „unerkennbarC' (vgl.<br />
fr. 4,7u 8): aber nicht weil sie der Vernunft zu hoch, sondern weil sie<br />
ihr zu niedrig liegen. Die Vernunft blickt über den Schein hinweg auf<br />
das, was wirklich i s t , auf die zeitlose Wahrheit. Da aber die physische<br />
Welt keiiie Wahrheit in sich hat, und es mithin keine Wahrheit über sie<br />
geben kanii, so nimmt folgerichtig die Metaphysilr keine Rücksicht auf<br />
sie. Wenn Parinenides weiterhin gleichwohl dazu übergeht, von ihr<br />
etwas auszusagen, so spriclit er in Bildern - in Bildern, die nun aller-<br />
dings so ähnlich sein sollen, wie Bilder überhaupt sein können (fr.<br />
8, 60 f.).<br />
Der Grundzug dieser symbolischen Naturlehre ist die Intuition,<br />
dais die Welt der Mannigfaltigkeit, die Welt des Werdens und des<br />
Truges ein zeitlich begrenztes Phantasma des Liebestaumels, des Liebes-<br />
rausches ist: alles, was Parnlenides zur Durchführung dieses Themas<br />
entwickelt, hat blois symbolische Bedeutung: weder die Göttermutter<br />
gibt es in Wahrheit, iioch das Helle und das Dunkle. Die Iiosmologie<br />
verliert den Charakter einer realen Weltbilduiigslehre, sie ist nur ein<br />
Gleichnis. Auch die Theorie der Empfindung ist bloise cFo(a: die Emp-<br />
findung hat lrcine Wahrheit, durch sie wird nichts Wirkliches erkannt:<br />
nur das Helle und das Dunlrle, die Iioeffizicnteil des Scheindaseins, wer-<br />
den dein Bewuistscin durch Einpfindnng vermittelt. Aufs stärkste<br />
alrzentiiiert Parmenides die Kichtiglreit dieser psychischen Prozessc da-<br />
durch, dafs er auch den Toten noch ernpfiiiden läist. (Wie sehr gerade<br />
dieser Gedanke ästhetisch eindruclrsvoll ist, wie stark sich der dichte-<br />
rische Zug der parmenideischen Physik hier geltend macht, hat schon<br />
K ü h n e m a 1 11 gut gezeigt : „Grundlehren dcr Philosophie" 80).<br />
Gibt man, wie ich es im Vorstehenden getan habe, den Worten von<br />
der Göttermutter und vom Eros bestimmende Bedeutung, sieht inan also<br />
in der rätselvollcn Tatsache der Zeugung den Schlüssel zu dein r,ätsel-<br />
vollen Verhältnis von Einheit und Vielheit bei Piirmenides, so stellt man<br />
damit den groisen Eleaten an den Anfang der gar nicht kleinen Reihe<br />
von Philosophen, die uns gerade als letzte Antwort auf eine letzte meta-<br />
physische Fragc das Wort „Liebeu sagen. Platon und Aristoteles,<br />
Plotin und Spinoza, Fichte und Schelliiig mögen als die gröisten ge-<br />
naniit sein.
144 Zur Physik des Parmenides.<br />
Es mag die Einsicht in das Problem, vor dem Parmcnides geslaildeii<br />
hat, vertiefen, wenn die letzte bedeutsame Phase, in die es getrctexi ist,<br />
nocli mitherangezogen wird. Selbstverstiiidlich stoisen wir hierbei auf<br />
Gedanlienginge, wie sie Parmenides selbst ganz gewiis nicht gehabt hat,<br />
aber doch auf Gedankengänge, die in den scinigen bcrcits angelegt<br />
waren. - TIT i 11 d C 1 b a ii d bezeichnet zutreft'end die parmeiiideische<br />
Mctaphysili als eine nocli dunkle und uiientwiclielte Form der Lehre<br />
von dcr Rorrelativität von Bcwuistsein und Sein (Gesch. d. altcii<br />
Pliilos. 3G), iiiid S c 11 e 11 i ii g ncnnt als die schönste Vorstellung dieses<br />
korrelativen Verhiltnisses („der Subj~lit-Objelitivieruna
Zur Physik des Psrmenides. 145<br />
position ausgegangen werden: der höchste Begriff des Systems ist der<br />
Begriff Gottes, der ,,in der Liebe ist, wie er in sich selbst ist" (S. W. V,<br />
543).<br />
Die hiermit angedeutete Parallele mag bestätigen, dais die beiden<br />
Teile des ~armenideischen Lehrgedichtes - durchaus nicht so zusammenhanglos<br />
aufeinander folgen, wie es zunächst scheinen möchte: nur ist<br />
eben der Zusammenhang von unserm Philoso~hen selbst nicht erkannt,<br />
sondern die Logik seines metaphysischen Prinzips wirkt im Verborgenen.<br />
Infolgedessen aber konnte es ihm nicht gelingen, den Erkeniltniswert der<br />
db[a scharf zu bestimmen, während Fichte in dieser Hinsicht schon aus<br />
dem Grunde unendlich viel besser gestellt war. weil er die Kantische<br />
Analytik der Erscheinungswelt verwerten und damit dem, was blofs<br />
„negative Gröise" ist, doch den inneren Ralt der Not~vendigkeit und<br />
Allgeiiieii~giltigkeit geben konnte.<br />
Philosoph. <strong>Abhandlungen</strong>.
Die Grenzen der psychologischen Ästhetik.<br />
Von<br />
Ernst Meumann, Königsberg i. Pr<br />
ie gegenwärtige ästhetik steht im Zeichen der Psychologie, die<br />
ineisten namhaften Ästhetiker der Gegenwart treiben p s y c h o -<br />
1 o g i s c h e Ästhetik. Eine Ausnahme hiervon machen fast<br />
nur noch die Vertreter der n o r ni a t i V e 11 Ästhetik. Diese<br />
halten entweder die Asthetik überhaupt nicht für eine psychologische,<br />
sondern für eine „Wertwissenseliaft" (J. Cohn)l), oder sie schränlreii<br />
die Bedeutung psychologischer Uiitersuchungen in der Ästhetilr wesent-<br />
lich zugunsten der Aufstellung der Normen ein (Volkelt, System cler<br />
Asthetilr I, 3).2)<br />
Dagegen kann gegenwärtig d i e m e t a p h y s i s c k e oder d i a -<br />
l e lr t i s c 11 e Ästhetilr (I-Tegel, Viseher) ihrer Mcthode nach als über-<br />
lebt gelten, und nur wenige Ssthetiker behaupten noch das Recht einer<br />
o b j a l< t i v e n Methode, die durch Untersuchungen des Kunstwerkes<br />
oder des schönen Katureiiidruclres als solchen ästhetische Prinzipien<br />
zu gewinnen sucht. Die meisten psychologischeil Asthetiker lehnen<br />
sogar die Möglichlreit objektiver Methoden in der Ästlietil< mit Ent-<br />
schiedenheit ab. So betont Volkelt, dais „die Gegenstäilde der Natur<br />
uncl IZunst, soweit sie iisthetisch wirlren, immer erst auf clem Boden des<br />
1) .Da die Psychologie Wertunterschiede so wenig kennt wie die liörper-<br />
missenschaft, so hat sie an sich kein Interesse daran, das Hsthetische Gebiet als<br />
ein besonderes abzugrenzen und etwa von dem des Angenehmen zu unterscheiden.'<br />
,,Und in der Tat würde die Psychologie ebensowenig ein %thetisches wie ein<br />
ethisches Gebiet kennen, wenn ihr diese Unterscheidung nicht von anderswoher<br />
gegeben worden wgre.' Seite 6 behandelt freilich Cohn das Angenehme als ein<br />
Wertprädikat, die Psychologie dürfte danach also auch das Angenehme nicht<br />
kennen, oder es musste eine Wertwissenschaft vom Angenehmen geben. Cohn,<br />
Allg. Ästhetik, S. 9 U. 10.<br />
2) ,,Das Ästhetische kommt nur auf dem Boden des Bewuistseins znstaiideY<br />
(S. 3), ,entweder normative oder überhaupt Beine Ästhetik als Wissenschaft' (8.4'7).
Die Grenzen der psychologischen Ästhetik. 147<br />
wahrnehmenden, fühlenden und auffasscndeii Bewuistseins entspriiigen"<br />
(System der Ästhetik, S. 4), dais daher auch das ästhetisch Objektive<br />
streng genommen in den Bereich des Bewuistseins und damit der Psy-<br />
chologie falle. Das Auisending ist nur „Voraussetzung" oder „be-<br />
stimmende Grundlage" für die ästhetische Wirkung, „nicht m eh r ('.<br />
Man behandelt also die ästhetisch wirkenden Natur- und Kunstdinge<br />
etwa so, wie man in der allgemeinen Psychologie die Reize behandelt.<br />
Sie sind ästhetische Reize oder objektive Bedingungen<br />
des ästhetischen Gefallens. Am weitesten geht in dieser<br />
Hinsicht Külpe, der - wie das vom Standpunkte der rein psycholo-<br />
gischen Ästhetik ganz konsequent ist - als eigentlichen Gegenstand<br />
der Ästhetik die Analyse der Vorgänge im ästhetisch genieisenden und<br />
urteilenden Menschen und deren Bedingungen ansieht. Diesen gegen-<br />
über sind dann die Kunstwerke unmittelbare Wirkungen des ästhetischen<br />
Gefallens ; die Künstler kommen für diesen Standpunkt insofern in Be-<br />
tracht, als sie jene unmittelbaren Bedingungen des ästhetischen Ge-<br />
fallens herstellen; sie sind daher „mittelbare Bedingungen des iisthe-<br />
tischen Gefallens" (Külpe, Einleituiig in die Philosophie, 11. Aufl., 1898,<br />
S. 84 u. f.).<br />
Gegenüber diesem, wie ich glaube, einseitigen Psychologismus in<br />
der Asthetik möchte ich, soweit es der zur Verfügung stehende Raum<br />
gestattet, folgende Thesen zu erweisen suchen:<br />
1. Die psychologische Ästhetik kann der Ästhetik als Wissenschaft<br />
in ihrem ganzen Umfange mit ihren rein psychologischen Mitteln nicht<br />
gerecht werden. Die Ästhetik als Wissenschaft verlangt vielmehr eine<br />
., ganz andere Aufstellung ilirer Aufgabe, eine ganz andere Abgrenzung<br />
ihrer Untersuchungsgebiete, als sie ihr die gegenwärtige psychologische<br />
Ästhetik gibt.<br />
2. Die psychologische Ästhetik bedarf einer zweifachen Ergänzuiig,<br />
einerseits der Ergänzung durch die objektiven Methoden, die bei rich-<br />
tiger Auffassung der Aufgabe der Ästhetik gegcnüber der rein psycho-<br />
logischen Analyse eine selbständige Bedeutung gewinnen. Die psycho-<br />
logische und die objektive Methode sind gegenüber der allgemeinen Auf-<br />
gabe der wissenschaftlichen Ästhetik als zwei koordinierte Methoden zu<br />
betrachten, die beide für sich genommen, nur einen Teil der isthc-<br />
tischen Probleme bearbeiten können.<br />
3. Die psychologische Ästhetik bedarf ferner der Ergänzung durch<br />
dieHereinziehung eines spezifisch, ästhetischen Gesichts-<br />
p u n l< t e s für die Auswahl derjenigen Bewuistseinsprozesse, welche<br />
wir als ästhetische bezeichnen, und für die Ausscheidung psychologisch-<br />
ä s t h e t i s C 11 e r Prinzipien von a 11 g e m e i n psychologischen Be-<br />
dingungen unserer Vorstellungs- und Gefühlsreaktioiien.<br />
I. Indem ich versuchc, die psychologische Ästhetik als ungenügend<br />
für die Erfüllung der gesamten Aufgabe der wissenschaftlichen<br />
Ästhetik zu erweisen, möchte ich zuerst der Vermutung entgegentreten,<br />
dais hier der normativen oder der Wertasthetik das Wort geredet werden<br />
sollte. Die ganze folgende Untersuchung ist in gewissem Sinne eine
148 Die Grenzen der psychologischen Ästhetik.<br />
methodologische. Nur vom Standpunlrte der richtigen Auffassung der<br />
Aufgabe der Ästhetilr und der durch diese Auffassung ihrer Aufgabe be-<br />
dingten Erweiterung und Vermehrung der Methoden der Untersuchuiig<br />
versuche ich die Bedcutung der psychologischen Ästhetik einzu-<br />
schränken, nicht aber vom Standpunlxte der normativen oder der Wert-<br />
ästlietik aus. Der Abschluis dieser methodologischen Untersuchung<br />
wird freilich zeigen, dais sich meine Ansichten in einem Punkte mit<br />
denen der normativen oder Wertästhetik berühren. Ich nehme nicht an,<br />
wie J. Cohn, dais für den Psychologen der Unterschied des guten und<br />
des schlechten Geschmackes „gar keinc Bedeutung hat" (Allg. Ästhetilr,<br />
S. ll), vielmehr können wir auch rein psychologisch ihrem tatsächlichen<br />
Verhalten nach die Gefühlsrealxtionen, das Verhalten der Aufmerlxsam-<br />
lreit, die cigeilartigen Vorstellungsprozesse und die Urteilsvorgänge bei<br />
den Menschen mit guten1 und schlechtem Geschmaclr unterscheideii.<br />
Die psychologische Untersuchung kann sogar leicht in letzter Linie be-<br />
stimmen, wodurch sich beide unterscheiden; ich nchme also im Unter-<br />
schiede von Cohn eine weitgehende A b h ä n g i g lx e i t der Ästhetik von<br />
der Psychologie an. Aber darin stimme ich Cohn bei, dais der spezifiscli<br />
tisthetische G e s i c h t s p u n k t , der in dem Präclilxat dcs guten und<br />
schlechten Geschmaclres hervortritt, über das Gebiet der rein psycholo-<br />
gischen B C t r a c h t u n g s w e i s e hinausgeht, dais wir uns in einem<br />
ganz anderen Gebiete der Forschung befinden, wenn wir das Seelenleben<br />
unter solchen Gesichtspunkten betrachten. Ich nehme ferner an, in1<br />
Unterschied von Cohn. dais auch dieser Gesichtsnunkt in lctzter Linie<br />
erst rein psychologisch erlebt werden muis, dais guter und schlechter<br />
Geschmack auf Unterschieden in den psychischen Erlebnissen beruhen,<br />
dais dicse Gesichtspunkte, selbst wenn man sie als Wert oder Norm be-<br />
trachtet, ohne die vorausgehende psychologische Unterschung gar nicht<br />
naher bestimmt werden können, weil alle Normen und Werte unmittel-<br />
bar und primär erlebt werden müssen, und psychologische Tatsachen<br />
sind, die als solche auch in den Bereich der psychologischen und speziell<br />
der psycho-gcnetischen Untersuchung fallen. Daraus folgt, dais auch<br />
die Wert- und Normasthetilr, wie die Wert- und Normmissenschaft über-<br />
haupt nach meiner Auffassung von der psychologischen Analyse der<br />
Werterlebiiisse abhängig ist. Ohne die wissenschaftliche Basis der<br />
psycho-genetischen Untersuchung ist alle Wertwissenschaft nichts als<br />
ein Aufstellen von Dogmen, deren Ursprung notwendig rätselhaft<br />
bleiben muis, oder man muis zu einer spekulativen bzw. dialektischeil<br />
Ableitung der Werte aus allgemeinen Begriffen seine Zuflucht nehmen.<br />
Wenn man ferner mit Windelband behauntet, dais die Normen sich uns<br />
mit unmittelbarer Evidenz bclrunden, oder dais sie in uns auftreten mit<br />
dem Verlangen nach Allgemeingültigkeit, und dais sie deshalb keiner<br />
psychologischen Analyse bedürfen, so bemerke ich dagegen: Auch diese<br />
unmittelbare Evidenz und dieses Verlangen nach Allgemeingültiglreit<br />
genügen in zweifacher Hinsicht nicht für die wissenschaftliche Auf-<br />
stellung und Begründung der Norrnen; sie bedürfen nämlich erstens des<br />
psycho-genetischen Nachweises ihrer Entstehung im Bewuistsein, denn
Die Grenzen der psychologischen Ästhetik. 149<br />
jene Evidenz und dieses Verlangen nach Allgemeiilgültiglreit sind Bewuistseiiistatsachei~<br />
und werden von uns zuerst und primär als Bewuistseinsvorkommnisse<br />
erlebt. sonst wären sie überhaunt nicht da. Zweitens<br />
bedarf jede unmittelbare Evidenz erst der erkenntnistheoretischen,<br />
ethischen oder ästhetischen R e c h t f e r t i g u n g. Denn auch Irrtümer<br />
und ethische oder ästhetische Vorurteile k ö n n e n mit dem Anspruch<br />
auf Evidenz oder dem Verlangen nach Allgemeiiigültigkeit auftreten.<br />
Die folgenden Ausfühixngen beabsichtigen also nicht, die psychologische<br />
Ästhetik vom Stand~unkte einer normativen oder Wertästhetilr aus einzuschränken,<br />
sondern von einer, wie ich glaube, richtigeren und erweiterten<br />
Auffassung der Auf g ab e der Ästhetik als Wissenschaft aus.<br />
11. Wie wenig die psychologische Asthetili- der wahren Aufgabe der<br />
Asthetik als Wissenschaft gerecht werden lrann, das zeigen die f olgendeii<br />
einfachen Überlegungen. Nur nebenbei sei bemerkt, dais auch iiiiierhalb<br />
der psychologischen Ästhetik durchaus keine volle Übereinstim~nung<br />
herrscht über das Verhältnis der Ästhetik zur Psychologie.<br />
Unter psychologischer Ästhetik lrann verstanden werden eine Ästhetik,<br />
welche der Psychologie gegenüber vollkommen selbständige Wissenschaft<br />
ist, aber der psychologischen Zergliederung ästhetischer Be-<br />
.«~iiistscinsvorgäslge als des wichtigsten Mittels ihrer Forschung bedarf,<br />
welche also die Psychologie als ihre wesentliche EIilfswissenschaft ver-<br />
wendet. Dies scheint Volkelts Auffassung von dem Verhaltnis der Psy-<br />
cliologie zur Ästhetik zu sein. Anderseits versteht man unter psycho-<br />
logischer Ästhetik auch .wohl eine solche Abhängigkeit ästhetischer<br />
Uiitersuchungcn von der Psychologie, dais die Ästhetik geradezu<br />
als „angewandte Psychologie" ersclieint. Dies ist die Ansicht von Lipps<br />
und Külpe, wenigstens äuisert sich Lipps in der Einleitung zu seiner<br />
Ästhetik folgendermaiseii: „In jedem Falle ist „Schönheitg der Name<br />
für die Fghigkeit eines Objelrts, in mir eine bestimmte Wirkung hervor-<br />
zubringen." „Diese Wirkung ist . . . . als die Wirkung in mir, eine<br />
psychologische Tatsache" (richtiger gesagt: eine psychische Tatsache).<br />
„Die Ästhetik will die Natur dicser Wirkung feststellen, will dieselbe<br />
analysieren, beschreiben, abgrenzen und sie verständlich machen.'' Diese<br />
Aufgabe ist eine psychologische, die Ästhetik ist also eine psycholo-<br />
gische Disziplin." „Insofern" (als nämlich die psychologischen Ein-<br />
sichten auf das ästhetische Objekt a 1 g e W a 1 d t werden) „kann die<br />
Ästhetik bezeichnet werden als eine Disziplin der iiugewandtcn Psycho-<br />
logie."<br />
Lassen wir diese IEeinungsverschiedenheiteii auIser acht, denn die<br />
folgenden polemischen Bemerkungen gelten für alle diese Nuancen<br />
des psychologisch-ästhetischen Standpunktes. Dais die Ästhetik als<br />
psychologische Wissenschaft der Aufgabe der gesamten Ästhetik nicht<br />
gerecht werden kann, geht nun aus folgenden iiberlegungen hervor :<br />
1. Man wird ganz unzweifelhaft dem Wert der Kunst und der<br />
Künste nicht gerecht, wenn man sie nur - wie das vom Standpunkte<br />
einer psychologischen iisthetil~ aus lroilsequenterweise geschelieii nmis
150<br />
Die Grenzen der psychologischen Asthetik.<br />
- als Reize oder objektive Bedingungeii des asthehischen Gefallens<br />
betrachtet; wenn der eine oder andere psychologische iisthetilier dies<br />
gelegentlich nicht tut, um ästhetischc Prinzipien aus der Betrachtung<br />
deF Kunst und der Künste abzuleiten, so ist er inkonsequent und ver-<br />
fällt zugunsteri der Betrachtung dcr I
Die Grenzen der psychologischen Ästhetik. 151<br />
3. Die ästhetilr hat noch ein drittes Forschungsgebiet, das zwar<br />
von einen1 groisen Teil der psychologiscl-iei-i Ästhetiker unserer Tage<br />
übersehen wird, das aber trotzdem von der allergröisten Bedeutung für<br />
die Ästhetik als Wissenschaft ist, d a s Q e b i e t d e r ä s t h e t i s c h e n<br />
K U l t U r. Wir haben es im täglichen Leben viel mehr und öfter mit der<br />
ästhetischen Kultur zu tun als mit dem einzelnen Kunstwerk. Sie<br />
durchdringt unser ganzes Dasein, oder sollte es wenigstens durchdringen;<br />
wir suche~~, unseren Sitten und Gebräuchen, unserem Benehmen,<br />
unserem Mienenspiel, den Geberden und der Sprache, unserer<br />
IIleidung, unseren Gebraucl~sgegenstä~~den, unserer Wohnung im Innern<br />
und Äuiseri-i, unseren Verl
152<br />
Die Grenzen der psychologischen Ästhetik.<br />
haben nichts iiielir miteinander gemein. Das sind tatsächlich total verschiedene<br />
Eiiizelm~issenchaften, eine kunsthistorische oder lrunstgenetische<br />
und eine psychologische Einzelwissenschaft oder eine<br />
kultiirgescliichtliche oder lculturphilosophische Wissenschaft und<br />
dann wieder auf der anderen Seite reine Psychologie. Die psychologische<br />
ästhetilr scheint daher jedenfalls den Vorzug zu haben,<br />
dais sie dieses verschiedenartige Tatsachenmaterial e i n h e i t -<br />
1 i c 11 in a c h t , indem sie es unter einen einheitlichen Gesichtspunkt<br />
bringt. Sie allein schafft so die einheitliche Wissenschaft<br />
der jisthetik, indem für den psycliologischen ästhetilcer alle Gebiete<br />
cler Asthetik dem einen Tatbestand des ästhetischen Geniefsens<br />
untergeordnet werden. An dieser Überlegung ist natürlich<br />
clas berechtigt, dais die psychologische Betrachtung die Ästhetik einheitlich<br />
macht, aber sie tut das, wie wir gezeigt haben, auf Kosten der<br />
umfassenden und eigenartigen Fornzulierung der Aufgabe der Ästhetik<br />
uncl auf Kosten aller derjenigen ästhetischen Untersuchungen, die über<br />
die Analyse des ästhetischen Geniefsens und Urteilens hinausgehen<br />
(clenn schon das künstlerische Schaffen ist für jeden Ästhctiker, der<br />
nicht selbst ein perfekter und universaler Künstler ist, ein ob j ekt<br />
i v e r Tatbestand, den er unter objektiven Gesichtspunkten zu behandeln<br />
hat). Allein n i c l-i t richtig ist an dieser Überlegung, dafs n u r<br />
der psycliologische Gesichtspunkt dem ästhetischen Forschungsgebiet<br />
Einheit zu geben vermag. Was liegt an einer Einheit, welche die Aufgab~<br />
einer Wissenschaft ve'stüminuelt? Man denke sich einmal, wir<br />
wollteil eine Wissenschaft wie die allgemeine Weltgeschichte unter dem<br />
rein psychologischen Gesichtspunkt behandeln, dafs sie eine Sumne von<br />
indivicluelleii Willeizserscheinungeiz ist. Sie würde damit zu einem<br />
Zweig der indivicluellei~ Willenspsychologie. Diese Betrachtung der<br />
allgemeinen Weltgeschichte ist ganz gewiis möglich und würde ihr ein<br />
sehr einheitliches Gepräge geben, aber sie würde zugleich eine Einheitlichkeit<br />
sein, die der Aufgabe der ganzen objelctiven Seite der Weltgeschichte,<br />
ihren kulturellen und wirtschaftlichen Problemen nimmermehr<br />
gerecht werden könnte, denn die wiitschaf tlichen und Kulturprobleme<br />
stehen in viel zu lockerem Zusammenhang zu den individuellen<br />
Willenstatsachen, als dais die von diesem Gesichtspunkte aus in ihrer<br />
Eigenart gewürdigt werden könnten. Genau so steht es mit clen objektiven<br />
Tatsachen des ästhetischen Gebietes. Ihre Beziehung zum Genielsen<br />
und Gefallen is eine so mittelbare und zum Teil so sekundäre,<br />
rlais jeder Ästhetiker, der dieser Seite seiner Forschung gerecht werden<br />
will, vor der Wahl steht, den psychologischen Gesichtspunkt ganz zu<br />
verlassen oder eben gewisse Aufgaben der Ästhetik verlrümnerii zu<br />
lassen.<br />
111. Die Einheit des ästhetischen Tatsachengebiete<br />
läist sich von einem ganz anderen Gesichtspunlcte<br />
aus herstellen, welcher allerdings<br />
die völlige Aufgabe des Standpunktes der psychologischen<br />
ästhetik verlangt. Wenn die Einheit des ästhe-
Die Grenzen der psychologischen Ästhetik. 153<br />
tischeii Tatsacheiigebietcs von der psycliologi~cheii Betrachtung aus<br />
nicht, oder nur auf Kosten der Eigenart weiter Gebiete der Ästhetik<br />
gewonnen werden kann, so muis sie eben auf d e m G e b i e t c d e r<br />
s t h e t i k s e 1 b s t gesucht werden, deili~ jedcr Gesichtspurilit der<br />
Betrachtung eines verschiedenartigeii Tatsachengebietes, der nicht<br />
diesem selbst ei~tlehnt ist, muis notwendig der einen oder anderen Seitc<br />
desselben Gewalt antun. Wir inüssen suchen, aus dem ästhetischeil<br />
Tatsachengebiet in seiner Gesamtheit und Verschiedeilartigkeit den ein-<br />
heitlichen Gesichtspunkt zu finden, von dem aus es mit einer einzigen<br />
Formel unter einen nur ihm eigentümlichen Gesiciltspuiikt gebracht<br />
werden kann. Zu diesem Zwecke ist es nötig, zuerst einmal das ästlie-<br />
tische Tatsachengebiet selbst in aller Vollständigkeit und Verschiedeil-<br />
artigkeit zu entwiclrelii. Ich habe schon angedeutet, dais das Gebiet<br />
ästhetischer Forscliung eigentlich eiii vierfaches ist; es gehört in das-<br />
selbe e r s t e 11 s das ästhetische GeniePsen, Gefallen und Urteilen des<br />
Beobachters oder Zuschauers oder des ästhetisch auffassericlen 3Ienschei1,<br />
z W e i t e 11 s das ästhetische oder lrüilstlerische Schaffen, das Darstellen<br />
und IIervorbriilgeii von Iiunstwerlren durcli das ästhetisch schaffende<br />
Subjekt. D r i t t e ii s die Surnine der einzelneii P r o du 1i t e des ästhe-<br />
tischen Schaffens, die „Werke", welche das ästhetisch schaffende Subjekt<br />
hervorbringt und die das ästhetisch geilieisende Subjekt auffaist, ge-<br />
iiieist und beurteilt, die Welt der Kunst, der Kiiriste, der Kunstwerke.<br />
V i e r t e 11 s die ästhetische ICultur oder clie innere und äuisere Durch-<br />
dringung und Umbildung unseres geamteil Daseins mit ästhetisch wert-<br />
vollen „Formenc' (im weitesten Sinne des Wortes) und einem ästhe-<br />
tischen Geist. Das an erster Stelle genannte Gebiet ästhetischer Unter-<br />
suchungen bilciet allcin für den Forscher die subjelrtive Seitc:<br />
des gesamiten ästhetischen Tatbestandes, d i e s e s a 11 e i 1 ist daher<br />
auch mit den Mitte111 der Psychologie zu bearbeiten (aber auch nicht<br />
einmal dieses liaim, wie ich später zeigen werde, mit den Mitteln der<br />
Psxchologie e r s c h ö p f e n d bearbeitet werden). Für den pliilosophi-<br />
schen Ästhetiker ist dagegen der an zweiter Stelle genannte Tatbestand<br />
schon ein objektiver und höchstens zu einem geringen T e i 1 eiii sub-<br />
jelitiver. Denn selbst, wenn der Ästhetiker als Dilettant oder IIünstlcr<br />
schaffend tätig ist, so kann er doch unmöglich auf allen Gebieten der<br />
Kunst und der einzelnen Künste als Dilettant oder Künstler tätig sein,<br />
oder er müiste ein solcher Ausnahme- uild überinensch sein, dais er<br />
für metliodologische Frageil der Wissenschaft gar nicht mehr mais-<br />
gebend sein könnte. Mit dem zweiten Tatbestande der Ästlietik trete11<br />
wir daher schon in das objelrtive Gebiet ästhetischer Untersuchungen ein.<br />
TVir können uns zwar, wie ich später noch genauer zeigen werde, in die<br />
Lage des schaffenden Künstlers in gewissem Nalse hineinversetzen,<br />
indem wir analoge Bewuistseinsprozesse, wie sie bei seinem Schaffen<br />
wirksam werden, iii uns nacherloben. Insofern liegt dieses zweite Ge-<br />
biet z u rn T e i l in dem Bereiche der subjektiven Untersuchungen und<br />
der psychologisclieii Analyse, aber bei ~veitcm der gröiste Tri1 desselben<br />
ist jedem Ästhetilier, der nicht als universaler Künstler selbst schaffend
Die Grenzen der psychologischen Ästhetik. 155<br />
unseren aesamteii -<br />
äufseren und innneren Daseinsb<br />
e d i 1-1 g U 11 ge 1 oder die Ausdehnung des produktiven und geniefseizden<br />
ästhetischeil Verhaltens auf diese Daseinsbedingungen.<br />
Die Natur oder der ästhetische Natureindruck scheint nun bei<br />
dieser Gliederung des ästhetischen Tatsachengebietes nicht selbständig<br />
untergebracht zu sein; allein es ist kein Zweifel, clals er unter dem<br />
ersten Gesichtspunkt als ästhetischer Natureindruck und sodann unter<br />
dem dritten Gesichtspunkt iil Analogie zum Kunstwerk erschöpfend<br />
gewürdigt werden kann. Es ist ferner unzweifelhaft, dais die ältereii<br />
Ästhetiker, insbesondere Kant, den ästhetischen Natureindruck viel zu<br />
sehr in den Vordergrund geschoben haben, denn er gehört nur ganz<br />
sekundär zu dein eigentlichen Gebiete ästlietischcr Uiltersuchungcu.<br />
Voll diesem umfassenden Gesichtspuniite aus, der sogleich durch<br />
eine i15hei.e Bestirninung des ästhetischeil Verhaltens des Menschen zur<br />
Welt noch genauer bestimmt werden wird, kann man, wie ich glaube,<br />
allen Aufgaben der Ästhetik als Wissenschaft gerecht werden und<br />
allein v!on diesem Gesichtspunkte aus, nicht aber,<br />
wenn nian die psychologische Analyse des ästhetischen Gefallens zum<br />
Mittelpunkte der ganzen Ästhetik erliebt.<br />
IV. Wir müssen uns, bevor die positive Ausführung der unter 111.<br />
gegebenen Bestimmungen stattfinden kann, noch mit einer weitereil<br />
Argumentation abfinden, durch die man von ganz anderer Seite her die<br />
Berechtigung der psychologischen Methode in der Ästhctik stützen zu<br />
können glaiibt. Es scheint nämlich, dais auch aus e r k c n 11 t n i s -<br />
theoretisch-methodologischcn Gründen die psycho-<br />
logische Analyse des ästhetischen Gefallens (oder, wie ich sage, die<br />
Analyse dei- Vorgänge im rezeptiven ästhetischeil Subjekt) zum alleini-<br />
gen Ausgaiigspuilkt uiid Mittelpunkt der ästhetili gemacht werden muls.<br />
Einerseits iiimlich spielen sich alle ästhetischen Vorgänge im Bewuist-<br />
sein ab; ohne ein Bewufstsein, in welchem das Schöne und Nichtschöiie,<br />
das Erhabene iiz der Kunst und in der Natur erlebt werden, gibt es kein<br />
Schönes und Erhabenes, also scheint man auch die Iiunst und die asthe-<br />
tische Kultur als Bewulstseiizsvorgäilge oder Erlebnisse von Individuen<br />
behandeln zu niüsseri. Der erlienntnistheoretjsche Standpunkt, voll<br />
dem auf Grund dieser Überlegung die Ästhetik behandelt wird, wird<br />
neuerdings als Conseieiitioilalisinus bezeichnet. Mit diesem Stand-<br />
punlit ist zugleich ein rein methodologischer Gesichtspunkt aiigecleutet,<br />
welcher für den psychologischen AusgangspunBt iii der ästhetik zu<br />
sprechen scheint. Der philosophische ästlietiker wird sich schon aus<br />
Zweclinzäisigkeitsgründen auf die ihm allgemciil und u n m i t t e 1 b a r<br />
z U g ä 1 g 1 i c h e n Methoden beschränken müssen; das ist in der Ästhe-<br />
tili die Analyse von Bewuistseiiisprozessen. Anderseits mufs sieh der<br />
philosophische Ästhetiker auf nicht zu seiner Wissenchaft gehörige<br />
Gebiete, wie die Kunstgeschichte und Kulturgeschichte, begeben, wenn<br />
er mit den objektiven Methoden in der Ästhetik arbeiten will. Die<br />
Prozesse des ästhetischen Gefallens und Urteilens sind aber wieder
156<br />
Die Grenzen der psychologischen Ästhetik.<br />
unter den $ewuistseiiisprozesseii, die für den Ästhetiker überhaupt in<br />
Betracht kommen, die auf alle Fälle unmittelbar dem Philosophen zu-<br />
gänglichen, nur diese kann er mit den Mitteln einer seiner Wissen-<br />
schaften, der Psychologie, bearbeiten; dagegen muis der Philosoph<br />
schon Künstler oder Kunsthistoriker oder Kulturhistoriker oder sogar<br />
Techniker und Technologe sein, um die anderen Gebiete der Ästhetik<br />
mit objektiven Vethoden der Untersuchung zu erforschen. Aus jenem<br />
crlrenntnistheorctischen und diesem inethodologischen Grunde, die beide<br />
eng zusammenhängen, scheint für den I'hilosophen nur die psyoholo-<br />
gische Ästhctik in Betracht zu kommen, ja die psychologische Ästhctik<br />
erscheint von diesen Überlegungen aus zugleich als die einzige philoso-<br />
phische Ästlietilc; alles andere ist nicht mehr Philosophie, sondern<br />
Kunstgeschichte, Kulturgeschichte, Technik und Technologie U. dgl. m.<br />
Gegenüber dieser Betrachtung kann man nun zeigen, dais es um -<br />
g e k e 11 ' t gerade nl e t h o d o 1 o g i s c h e Gründe sind, welche den<br />
Ästhetiker zum A w f g e b e n (wenigstens zu einein zeitweisen Auf-<br />
geben) der psychologischen Untersuchungen zwingen, wenn cr der Auf-<br />
gabe der Ästhetik selbst im Sinne der psychologischen Asthetili gerecht<br />
werdcn will, und dais die psychologische Ästhetik, welche nur Bewuist-<br />
seinsvorgänge und speziell nur das Erleben des geniefsenden und ur-<br />
teilenden Subjektes behandclt, notwendig überall da in Prinziplosigkeit<br />
(Cohn) oder richtiger gesagt, in eiii planloses Suchen nach ästhetischen<br />
Prinzipien verfallen muis, wo sic mit solchen ästhetischen Prinzipien<br />
zu tun hat, die nicht mehr mittels einer reinen Analyse von Bemdst-<br />
seinsvorgängen als solchen gefunden werden können. Nun ist aber eiii<br />
groiser Teil der ästhetischen Prinzipien durchaus nicht allein durch<br />
die Natur des geniefsenden Subjektes bedingt, sondern durch die Natur<br />
des ästhetischen Objektes, des Kunstwerks und der einzelnen Künste.<br />
Alle d i e s e Prinzipien könnten beim konsequenten Festhalten des rein<br />
psychologischen Standpunktes nur zufällig durch ein planloses Suchen<br />
oder ein zufälliges Gelingen gefunden werden.<br />
Um das noch genaiier zu zeigen, stelle ich mich einen Augenblick<br />
auf den Standpunkt der psychologischen Ästhetik, um auch von diesem<br />
Standpunlxte aus zu zeigen, dafs er gar nicht ohne objektive Unter-<br />
suchungen i~usliommen lianii. Dabei müssen wir nun unterscheiden<br />
zwischen den beiden verschiedenen Auffassungen der P s y c h o 1 o g i e<br />
und ihrer Methoden, die sich heutzutage gegenüberstehen, weil sie in<br />
sehr verschiedenem Marse ihre I-Iilflosiglxeit gegenüber den ästhetischen<br />
Prinzipien bekunden; ich denke dabei an die Psychologie der reinen<br />
inneren Wahrnehmung und an diejenige Richtung, welche die innere<br />
Wahrnehmung durch Experimente lind objektive Methoden verschie-<br />
dener Art ergänzt. Die Psychologie der inneren Wahrnehmung kann<br />
nun offenbar alle die ästhetischen Prinzipien, welche auch nur einiger-<br />
inaisen durch die Natur des Kunstwerkes mitbedingt sind, überhaupt<br />
nicht finden, oder wenn sie solche findet, so ist es reiner Zufall, und<br />
man muis schon die geheimiiisvolle „Natur der Seele" so kennen, wie<br />
Lipps sie kennt, um aus ihr a 11 e i n ästhetische Prinzipien, ~vie die
Die Grenzen der psychologischen Ästhetik. 157<br />
Einheit iii der l\ilaniiigfaltigkeit U. dgl. m., schöpfeil zu können. Da ich<br />
meinerseits die ,,Natur der Seele'' nicht kenne, so ist es mir voll komme^^<br />
unerfindlich, wie der Psycliologe der inneren Wahrnehmung auf solche<br />
ästhetischen Prinzipien anders stoisen kann als durch den reiileii Zu-<br />
fall, oder indem er sie, wie Li p p s , einfach der alten Ästhetik ciit-<br />
lehnt. Der Psychologe der inneren Wahrnehmung kann wohl bei G e -<br />
legeiiheit der Betrachtung eines Kunstwerkes oder<br />
in einem bestimmten Falle von ästhetischem Naturgenufs beobachten,<br />
wie sich dabei seine Aufmerksamkeit verhält, wie seine Vorstelliings-<br />
reproduktionen verlaufen, wie die Gefühle in ihm entstehen, lind cr<br />
kann z. B. selbständig finden, dais im Unterschiede von sonstigen Fällen<br />
die Gefühle und Vorstellungen mehr an das unmittelbar in der Wahr-<br />
nehmung Gegebene, an die Farben und Formen, die Töne und Takte<br />
anknüpfen als an Reflexionen und sekundäre Associationen, er ka1111<br />
auch die äiiiseren Bedingungen dieses eigenartigen Verhaltens der Auf-<br />
merksamkeit der Vorstellungen und der Gefühle nachweisen, aber das<br />
sind dann für den Psychologen der inneren Wahrnehmung A U f -<br />
merksanikeitsphänoinene, Gefühlsvoigäiige, Vorstcl-<br />
1 u ii g s Prozesse von eigener Art; zur Aufstellung ä s t h e t i s c h e r<br />
Prinzipien aber fehlt ihm bei allen seinen Analysen zweierlei: Erstens<br />
der eigentliche ä s t h e t i s c h e Ge s i c h t s p u 11 k t , mittels desseiz<br />
er diese eigenartigen Erlebnisse a 1 s &thetische erkennen kann und<br />
unter den cr diese eigenartigen Erlebnisse einreihen kann, denn dieser<br />
ergibt sich erst durch den V e r g 1 e i c h des ästhetischen Verhaltens iin<br />
a 11 g e m e i n e n mit anderen Verhaltungswcisen des Menschen zur Welt.<br />
Für den Psychologen ergeben sich also durch solche Analysen immer<br />
nur b e s o n d e r e Ii 1 a s s e n von Aufmerksamkeits-, TTorstellungs- und<br />
Gefühlphanomenen, aber keine ä s t h e t i s c h e n Prinzipien. Zwei<br />
tens: Es fehlen den1 Psychologen überhaupt alle Mittel, um iiun aus<br />
diesen allgemeinen Analysen des Verhaltens der Aufmerlisamkeit clcr<br />
Vorstellungen und der Gefühle, welche er bei Gelegenheit der Betracli-<br />
tung von Kunstwerken oder einfachen ästhetischen Eindrücken bei<br />
sich beobachtete, spezielle Pr i n z i p i e n des ästhetischen Gef alleils zu<br />
gewinnen. Nehmen wir als Beispiel die Fechilerscheil ästhetischen<br />
Figuren oder die Reihen der Farbenkombinationen oder die einfachen<br />
Figuren zur Darstellung ästhetischer Äqiiivalente, durch die mal1 in<br />
der e~~erinientelleii Ästhetik ästhetische Prinzipien zu gewinnen versucht.<br />
Alle diese Prinzipien ergeben sich erst, wcnil wir nicht blois<br />
gelegentlich beobachten, was in uns vorgeht, wenn wir einen listhetischen<br />
Eindruck haben, soilderi~ wenn wir uns auf den objektiven Boden<br />
begeben uncl nach Prinzipen suchen, die durch die Natur der Linie,<br />
dcr Rechtecke, der Farben usw. selbst gegeben sind, durch die ästhetischen<br />
Elementaroindrücke in Reihenabstufungen nach den Seitenverhältnissen,<br />
den Linienteiluiigen, den Kombinationen der I-Iauptfarbeil<br />
usw., nicht aber nach Prinzipien, die in der Natur des Gefühls, der Vorstellungsprozesse<br />
und der Aufmerksamkeit liegen. Die letzteren allein<br />
wären subjektive und psychologische Prinzipien.
158<br />
Die Grenzen der psychologischen Ästhetik.<br />
Betrachten wir nunmehr das Verfahren des expeiimentellen Psychologen,<br />
so sehen wir sofort, dais hier aus methodologischen<br />
G r ü ii d e n zum Teil schon in der Psychologie selbst unsere Forderung<br />
erfüllt ist! Er arbeitet mit rein objektiven Methoden und stellt<br />
sich zeitweise unter völliger Aufgabe des subjektiven oder conscientionalistischen<br />
Gesichtspuilktes auf den Standpunkt des Physikers oder des<br />
Mathematikers, um die psychischen Phänomene und ihre Bedingungen<br />
und Ursachen erschöpfend erforschen zu können. Die experimentelle<br />
Psychologie macht sich die Ergebnisse der p h y s i lr a 1 i s c h e n Optik<br />
(also einer rein o b i e lr t i v e n Wissenschaft) zunutze. wenn sie die<br />
Farben nicht etwa nur nach psycholog.ischen Gesichtspunkten, wie dem<br />
der eindruclrsvollsten Farbe. oder dem des Gefühlswertes der Farben<br />
allein untersucht, sondern ausgeht vom Spektrum, von der Reihenfolge<br />
und der Art der übergänge, der Helligl
Die Grenzen der psychologischen Ästhetik. 159<br />
planlosen Sucheil nach Ordnung der subjektiven Daten herausziilrommen.<br />
Wir stellen dann die Ergebnisse dieser objelitiven Methoden in d e n<br />
D i e n s t psychologischer Betrachtung, aber dadurch verlieren sie nicht<br />
an Wert und relativ selbständiger Bedeutung. Keine psychologische<br />
Analyse. die blois die Bewuistseiiistatsachen betrachtet und die Bedin-<br />
" ,<br />
gungen derselben, immer iiur von deii Bewuistseinstatsachen ausgehend,<br />
suchen wollte, kann diese objelitiveii Methoden ersetzen. Für die rein<br />
psychologische Betrachtung ist, wie die Geschichte der Psychologie uiid<br />
wie insbesondere klassische Beisniele. wie Goethes Farbenlehre, beweisen,<br />
L ,<br />
die Darstellung der Skala unserer Empfinduiigen nur durch ein endloses<br />
Suchen und ein rein zufälliges Gelingen möglich. Mai1 könnte nun<br />
sagen, dafs der Psychologe hier n U r d e s h a l b die Physik uiid die<br />
Physiologie zu Hilfe iichnien inuis, weil er bei den Empfindungen vor<br />
einer Summe von Erscheiiiuiigen steht, die für ihn rein e l e m e n t a r e<br />
Prozesse sind, die er einfach als gegebene Tatsachen hinnehmen muis,<br />
und dais es deshalb selbstverständlich sei, dafs zur Erklärung dieser<br />
Elemente des Seelenlebeizs auf die w e i t e r z u r ü c k l i e n - e n d e n<br />
physikalisclien und physiologischen Bedingungen zurückgegangen werden<br />
muis. In der iisthetik aber haben wir es nicht, oder wenigstens<br />
nicht immer mit solchen elementaren Tatsachen zu tun, deshalb sei in<br />
der Ästhetik das Zurückgreifen auf objelitive Methoden nicht von der<br />
gleichen Bedeutung wie in der Psychologie bei der Analyse der Empfindungen.<br />
Alleiii es läist sich zeigen, daes es auch für die Ästhetik<br />
eine Anzahl Fundamentalprobleme gibt, welche für den Ästhetilrer<br />
letzte Tatsachen bleiben, und für deren Ableitung und Erkläruiig ausscliliefslich<br />
das Zurückgehen auf die objektiven Mitursaclien dieser<br />
Grundtatsaehen eine erfolgreiche wissenschaftliche Methode ist. So ist<br />
z. B. die Zahl der fundamentalen iisthetischen Katenorieii, das Schöne,<br />
U<br />
das Erhabene, das Tragische, das Komische usw. aus rein psychologischen<br />
Gründen gar nicht erlilärbar, und wir müssen, um zu verstehen,<br />
warum diese und nur diese ästhetischen Kategorien vorhanden sind, die<br />
objektiven Bedingungen für das ästhetische Geiallen mit in Betracht<br />
ziehen und diesen die Gesichtspunkte für die Ableitung jener ästhetischen<br />
Kategorien entlehnen. Sodanii aber iiimmt auch der Psvcholone -<br />
n i c h t il u r bei den elementaren Tatsachen des Seelenlebens physilialische<br />
oder physiologische Gesichtspunkte zu Hilfe, um ihre Zahl und<br />
ihre Beziehungen zueinander darzustellen. So leiten wir z. B. die<br />
Stufen der Willenshaiidlunaeii - und der allmählichen Zusammensetzuiigeii<br />
der Willeiishandluilgen nicht blois nach subjelstiveri, sondern<br />
auch nach rein physiologischen Gesichtspuiikten ab, wenn wir vom<br />
Reflex zur automatischen Handlung und zur Wahlhandlung fortschreiten;<br />
ja sogar die Anzahl der physiologischen Funlitionen, welche<br />
die TOilleiishandlung durchläuft, ist uns einer der sichersten Anhaltspunkte,<br />
um niedere und höhere Willenshandlungen voneinander zu unterscheiden.<br />
Ganz analog steht es mit der Aufsuchung ästhetischer Prinzipicii<br />
von seitcii des psychologischen Ästhetikers, dessen Standpunkt wir hier<br />
wieder einmal probeweise einnehmen wolleii. Auch der psychologisclic
160<br />
Die Grenzen der psyohologischen Ästhetik.<br />
Bsthetiker, der Prinzipien des Gefallens an Kunstwerkeii auf suchen<br />
will, inuCs sich auf den objektiven Boclen der Iiuilstwerke selbst be-<br />
geben. Er muis in cler inusilralischen Ästhetik die Xeloclie, die Sym-<br />
phonie oder die Oper nach ihrem objelrtiven Tatbestande und nach den<br />
&Iittelii analysieren, er muis zuruckgehen bis auf den Bau der Sprache,<br />
auf die Physiologie des Sprecheizs. Er niuis die Arbeit des Architekten<br />
und die Technili, die Perspektive und die Kompositionslehre des Xalers,<br />
die Proportionslehre des Bildhauers U. a. nl beachten, wenn er Priii-<br />
zipien gewinnen will, die ihm eine Wegleitung zur Aufstellung ästhe-<br />
tischer Regeln geben können, oder aber er wird in ein planloses Suchen<br />
nach solchen Regeln und Prinzipien verfallen. Alle ästhetischen Priii-<br />
zipien, die durcli das 'iiTeseii der Künste und ihrer eigentümlichen Dar-<br />
stellungsmittel mitbestimmt siiid, kaiiii der Psychologe mit seinen<br />
Mitteln nicht findcn, oder die Psychologie gibt ihm wenigstens iiicht die<br />
leitenden Gesichtspiiizlrte, um sie zuSnden, weilcler Psycho-<br />
loge als ein solcher nicht Architekt oder Musiker oder Dichter ist. Ganz<br />
dasselbe aber gilt, wie ich schon einmal angedeutet habe, von den Prin-<br />
zipien der a 11 g e m e i n e n iisthetilr. Wenn wir z. B. die sog. Modi-<br />
filiatioiieii des Schönen oder die ästhetischen Hauptkategorien be-<br />
stimmen, so ist es unerläfslich, dazu objektive Wegleitungen und Ge-<br />
sichtspunkte zu benutzen; zahlreiche Ästhetiker stehen heutzutage<br />
gegenüber der Gewinnung der Nodifilrationen des Schönen auf dem<br />
wisseiischaftlicli ganz unzulässigen Standpunkte, dais sie dieselben<br />
einfach als Tatsachen mit iii Kauf nehmen, ohne ein bestimmtes Prinzip<br />
ihrer Ableitung zu besitzen. Das ist die Folge des rein psychologischen<br />
Prinzips der Ästhetik, deiiii in den Bewuistseinsvorgängen als solchen<br />
liegt gar kein Grund, um das Schöne, das Erhabene, Tragische, Ko-<br />
mische usw., und speziell kein Grund, um ri u r diese ästhetischeil<br />
Kategorien zii gewinneii. In diescni Punkte war die spekulative Ästhetik<br />
von Hegel, Vischer und Weifse der psychologischen Ästhetik unserer<br />
Tage inethodologiseh überlegen, methodologisch nicht<br />
material, denn die materialen Bestinzniungen dieser ästhetischen Haupt-<br />
kategorien leiden in der speliulativen ästhetik untd dem Einfluis der<br />
!dialektischen Ableitungen. So leitet Vischer bekanntlich aus dem<br />
Begriff des Schönen, als dem Erscheinen der unendlichen Idee im End-<br />
lichen, die ästhetischen Hauptkategorien nach einem einfachen Schema<br />
ab, iiidein die Idee zu ihrer Erscheinung in verschiedene Verhältnisse<br />
treten kann (Vischer, Über das Erhabene und Iiomisclie 1831). Oder ein<br />
solcher Gegensatz wie der zwischen clem Forinalismus und Idealisnius<br />
in der Ästhetik wird in cler Regel einfach als eine historische Tatsache<br />
liingenommen. Vom rein psychologischen Standpunkte aus liegt gar<br />
kein Grund vor, weshalb dieser Gegensatz entstehen konnte; es ist<br />
durchaus nicht abzusehen für den Psychologen, warum nicht die for-<br />
iiialrn Elemente des Kunstwerkes ebensowohl als Ursachen der Lust<br />
oder Unlust bei seiner Betrachtung wirken sollen, wie die materialen<br />
und dic inhaltlichen, die psychologische Ästhetili kann höchstens be-<br />
weisen, dais bald in einem Kunstwerk mehr die formalen Elemente
Die Grenzen der psychologischen Ästhetik. 16 1<br />
(wie in der Musik), bald mehr die niaterialen (wie in der Dichtlrunst) die<br />
die resultierende Lust- oder Urilustwirlrung bestimmen. Die Entstehung<br />
dieses Gegensatzes begreiflich zu machen oder gar seine Ableitung als<br />
eines Gegensatzes herzustellen, ist psychologisch völlig unmöglich, da-<br />
gegen wird dieser Gegensatz sofort verständlich, wenn wir die objektiven<br />
Tatsachen wie diese zu Ililfe nehmen, dais es Ku ii s t W e r lr e gibt,<br />
in denen der Inhalt völlig hinter formalen Elementen der Wirkung<br />
zurücktritt und die doch den Charakter des Kunstwerkes wahren, oder<br />
dais es Kunstwerke und ganze Kunstrichtuilgen gegeben hat, in<br />
welchen der Inhalt die Bedeutung der F'orni vollständig überwucherte;<br />
oder endlich, dais rein tatsächlich und objektiv ein A n t a g o n i s in u s<br />
besteht zwischen Form und Ausdruck : je mehr wir nach geistigem Aus-<br />
druck in der Kunst streben, desto mehr ni u f s die Form beeinträchtigt<br />
werden, und uingelrchrt, legen strengere und durchgebildetere Form-<br />
gesetze notwendig dem geistigen Ausdruclr gewisse Schranken an. Diesc<br />
objektiven Erscheinungen allein repräsentieren wirkliche Gegensiitzc,<br />
die sich in deii Reflexionen der Ästhetilrcr widerspiegeln.<br />
Wenn die Psychologie bei solchen Ableitungen versagt, so steheil<br />
wir vor der Wahl, entweder gibt es nur eine begriffliche (ocler dialek-<br />
tische) Ableitung jener Kategorien und dieses Gegensatzes, oder mir<br />
müssen sie einfach als reine Tatsachen hinnehmen - dabei kann sich<br />
die wissenschaftliche Ästhetik nicht begnügen -, oder es müssen<br />
objektive Gesichtspunkte zu Hilfe genommen werden, um verstiändlich<br />
zu machen, warum wir diese und nur diese ästhetischen Kategorien<br />
haben und warum iener Gegensatz entstehen konnte. Wir müssen das<br />
aus der fundamentalen Tatsache verständlich machen, dais eben das<br />
ästhetische Gefallen in seiner Natur und seinen Modifikatioiien nicht<br />
blois eine psychologisch bedingte Erscheinung ist, sondern dais seine<br />
Modifikationen und Fälle durch die Natur der Kunstwerke, der Künste<br />
und ihrer Mittel selbst bedingt sind, also auch nur unter Zuhilfenahme<br />
der objektiven Erforschung dieser eigenartigen Natur der Künste und<br />
ihrer Mittel abgeleitet und verständlich gemacht werden können.<br />
;Man kann das auch so ausdrüclren: Das ästhetische Gefallen<br />
und seine Modifikationen oder das Schöne und seine Modi-<br />
fikationen zu .analysieren und deii Gegensatz von Formalismus uncl<br />
Idealismus in der Ästhetik zu gewinnen, das ist etwas ganz anderes,<br />
eine andersartige wissenschaftliche Aufgabe als die, besondere Arten<br />
von Lust- und Unlustursachen oder besondere Fälle von Aufmerksam-<br />
keits- und Reproduktionsprozessen mit den Mitteln dcr Psychologie<br />
festzustellen. EIier tritt ein ganz anderer Gesichtspunkt der Betrach-<br />
tung ein, unter dem überhaupt diese verschiedenen Modifikationen in<br />
den allgemeinen Erscheinungen des geistigen Lebens in ihrer Eigenart<br />
abgegrenzt ui!d begrifflich rubriziert werden können, und dieser neuc,<br />
nicht mehr psychologische Gesichtspunkt der Betrachtung von Gefühls-,<br />
Aufmerksamkeits- und Reproduktionsvorgängen ist nicht mehr aus-<br />
schliefslich durch die Natur des auffassenden Subjektes bedingt, sondern<br />
ebensosehr objektiv durch die Natur der Kunstwerke, der Künste (oder<br />
Philosoph. Abhandlungon. 11
162 Die Grenzen der psychologischen Ästhetik.<br />
der Natureindrücke), mit denen wir es im ästhetischen Gefallen und<br />
. ,<br />
Genieisen zu tun haben, und nur eine a 11 g c m e i n e r e Betrachtungs-<br />
weise. welche die subjektive und objektive Seite des ästhetischen Ge-<br />
schehens in sich schliefst, kann verständlich machen, warum wir solche<br />
ästhetischen Kategorien und einen solchen fundamentalen ästhetischen<br />
Gegensatz haben. Sobald es sich nun ferner darum handelt, nicht nur<br />
die allgemeinen ästhetischen Kategorien abzuleiten, sondern speziellere<br />
ästhetische Prinzipien zu finden, welche durch die Natur der Künste,<br />
der Iiunstwerlre und der Mittel zu ihrer Darstellung mitbedingt sind,<br />
versagen natürlich die rein psychologischen Methoden ganz und gar,<br />
und wir bediirfei~ leitender Gesichtsuunkte. um diese Prinzipieii zu<br />
finden, welche nur mit einer objektiven Erforschung der Kunstwerke<br />
und der Künste gefunden werden können, ähnlich wie der psychologische<br />
Optiker und Akustiker die leiteiideii Gesichtspiinkte für die Ableitungen<br />
der Skala der Empfindungen der physilralischen Optik und Akustik<br />
entlehilcn muh; denn in psychischen Vorgängen als solchen liegt gar<br />
kein Anhaltspunkt dafür, welche und wieviele ästhetische Prinzipien<br />
bei der speziellen i~stlietilr der cinzeliien Künste aufgestellt werden<br />
müssen. Die Anhaltspiinlrte dafür können nur einer Betrachtung dcr<br />
Künste selbst entlehnt werden. Welche Bedeutung bei dem Nachweis<br />
spezieller ästhetischer Prinzipien in dernsthetili der einzelnenKiinste die<br />
objektiven Methoden gewinnen können, das zeigt uns deutlich eine solche<br />
Behandlungsweise der Asthetilr der einzelnen Künste, wie sie G o t t -<br />
f r i e d S e m p e r in seiner Stillehre eingeschlagen hat. Ich möchte<br />
auf die Bilethode Sempers hier einen Blick werfen, aber von vornhereiii<br />
die Vermutung abwehren, dais ich Sempers Methode iii Bausch und<br />
Bogen billige11 wollte. Semper beging den Fehler, r e i n objektive Be-<br />
trachtungen anzustellen, um Prinzipicii des ästhetischen Gefallens uncl<br />
der ästhctiscllen Beurteilung zu finden, Das war natürlich unmöglich.<br />
Die Semperschen Methoden haben, wenn sie Motive der iisthetischen<br />
Beurteilung nachweisen wollen, dcn Grundfehler, dafs sie Prinzipien<br />
der Beurteilung aus der rein objektiv genetischen Betrachtung der<br />
Kunstwerke und aus Ursachen ihres Zustandekommeils erschlieisen<br />
wollen. Dagegen können die Ursachcil des Zustandelrommeils der<br />
Kunstwerke nur dann zugleich ästhetische Prinzipien scin, wenn sie<br />
erstcns dem beurteilenden Subjekt auch wirklich zum Bewuistseiii<br />
kommen, und zweitens, auch dann, wenn sie uns zum Bewuistsein<br />
kommen bei der Betrachtung von Kunstwerkeil, brauchen sic nicht not-<br />
wendig alle ä s t h e t i s c h e B e d e u t u n g zu haben. Ilierüber, ob<br />
solche Prinzipien ästhetische Bedeutung gewinnen, kann allein eine<br />
rein ästhetische, nicht aber eine kunstkritische Betrachtung entscheiden,<br />
aber keineswegs entscheidet darüber, wie man wohl meint, die reine<br />
psychologisclie Uiitersucliung, denn diese würde nur feststellen, ob<br />
z. B. IEaterial und Form, der Zweck und das Zusammenstimmeii von<br />
Form und Zwecl; bei einem lruilstgewerblichen Gegenstande oder einem<br />
Werlre der Töpferkunst als Ursache11 von Lust und Unlust wii-ken<br />
Iröimen, ästhetiscl~es Gefallcn aber deckt sich nicht mit Lust und Un-
Die Grenzen der psychologischen Ästhetik. 163<br />
lust überhaupt. Also ist es die ä s t h e t i s c h - psychologische Untcr-<br />
suchung, die E i n r e i h u n g dieser objektiv nachgewiesenen Ursache11<br />
des Gefallens unter den ästhetischen Gesichtspunkt<br />
d e r B e t r a c h t u n g , welcher über die ästhetische Bedeutung der<br />
von Semper nachgewiesenen Prinzipien entscheidet. Aber das eine ist<br />
durch Sempers Untersuchungen erwiesen worden, dafs zahlreiche Vor-<br />
stellungen, die bei der ästhetischen Betrachtung des 'IZunstwerkes mit-<br />
wirken müssen, wenn wir nicht in dem primitivsten Stadium der ästhe-<br />
tischen Betrachtung stehen bleiben wollen, m e t h o d o 1 o g i s C 11 1 u r<br />
so nachgewiesen werden können, dais wir uns auf den<br />
Standpunkt objektiver Untersuchuilgeil über das Zustaildelrommen der<br />
Kunstwerke begeben und die W e g l e i t u n g , die G e s i 31 t s -<br />
p u n 1~ t e d e r Au f s u c h u n g der Motive des ästhetischen Urteils<br />
objektiv vergleichenden Betrachtungen über die Entstehung der Iiunst-<br />
werke entlehnen. Daraus geht wieder hervor, dafs z. B. die rein psycho-<br />
logische Betrachtung der Werke der Keramik bei dem Aufsuchen der<br />
l\ilotive des ästhetischen Gefallens und der ästhetischen Beurteilung<br />
derselben planlos im Dunkeln tappen würde, und dafs die faktische Auf-<br />
findung dieser Prinzipien für sie nur auf einem rein znfälligen Ge-<br />
lingen beruhen könnte.<br />
Hiergegen könnte man vom Standpunkte der psychologisclieil<br />
ästhetik einen Einwand erheben. Man könnte sagen, alles was durch<br />
solche Betrachtungen, wie die Semperscheii, gewonileil wird, ist<br />
e i n g a n z s p e z i e 1 l e s W i s s e ir von dem Zustandelromineiz oder<br />
von der Technik und dem Material der Iiunstwerke U. a. m., das ästhe-<br />
tische Urteil aber bedarf eines solchen speziellen Wissens nicht. Ja<br />
noch vielmehr: Sobald ein solches spezielles Wissen sich in die Be-<br />
urteilung von Kunstwerken einmischt, trete das a u i s e r ä s t h e -<br />
t i s c h e U r t e i 1 ein, und das möge immerhin für den sogeilalmten<br />
Icenner eine gewisse Bedeutung haben und ihn von dem Nichtkenner<br />
unterscheiden, aber zu den ästhetischen Associationen gehört dieses<br />
Wissen gar nicht. In ähnlicher Weise urteilt ganz konsequent vom<br />
Standpunkte der psychologischen Ästhet,ik aus K ü 1 p e , indem er das<br />
spezielle Wissen von einem Kunstwerk nicht mehr zu den ästhetischen<br />
Assoziationen rechnet. Iii der Tat ist das auch die Konsequenz des rein<br />
psychologischen Standpunktes in der Ästhetik. Dieser muis notweiidig<br />
nur diejenigen Vorstellungen zu den ästhetischen Assoziationen rcchneil,<br />
welche unmittelbar durch das im Kunstwerk selbst Gegebene, durch<br />
die Farben, Formen, Töne, Talrte, Worte usf. in uns reproduziert<br />
werden und alles, was darüber hinausgeht, als auiserästhetisches Vor-<br />
stelluilgsmaterial bezeichnen. Denn alles, was darüber hinausgeht,<br />
kann der Psychologe mit seinen Mitteln nicht mehr<br />
n a c h w e i s e 11, es erscheint ihm daher leicht als ein aufserästhetisches<br />
Eleineilt der Beurtcilung. IIierfür scheint sich der psychologische<br />
Ästhetiker noch auf ein anderes Kriterium berufen zu lrön~ien, nämlich<br />
auf die Unmittelbarkeit des ästhetischen Urteils. Für das ästhetische<br />
Urteil ist es besonders charakteristisch, dafs es mit voller Unmittelbar-
164 Die Grenzen der psychologischen Asthetik.<br />
keit auftritt und eigentlicher Reflexionen nicht bedarf. Wir pflegen<br />
etwas als schön oder unschön zu beurteilen, auch ohne dais wir lange<br />
Reflexionen anstellen über Zweck und Bedeutung eines Kunstwerkes.<br />
Wir verhalten uns ästhetisch genieisend und urteilend, wenn wir beim<br />
Anblick eines Kunstwerkes oder der Natur als solcher in reiner<br />
A n s c h a u u ii g ohne Reflexionen über Zweck oder Existenzfragen<br />
der unmittelbaren Wirkung des Kunstwerkes oder des<br />
Natureindruckes auf unser Gefühlsleben und unsere Phantasietätig-<br />
keit genieisend und anschauend hingeben. Allein diese beiden Über-<br />
legungen des psychologischen ästhetikers bestehen nicht zu recht.<br />
Ich wende mich zuerst gegen die letzte, dais das Mitwirken eines<br />
speziellen ästhetischen Wissens gegen die Forderung der Unmittel-<br />
barkeit des ästhetischen Urteils verstorsen soll. Das ästhetische Urteil<br />
des künstlerisch und ästhetisch g e b i 1 d e t e n Menschen b e h ä 1 t<br />
vielmehr d i e s e 1 b e Unmittelbarlreit wie das des ästhetisch Nicht-<br />
gebildeten oder des sogenannten Laieii in der Kunst. Auch wenn wir<br />
ein spezifisches Wisseii von dem Zustandekommen der Kunstwerke,<br />
ihrem Material, ihrer Technik und dergleichen erworben haben, kann<br />
unser ästhetisches Urteil seine volle Unmittelbarkeit behalten; alier-<br />
dings, s o 1 a n g e der Kenner nach jenem Wissen s u c h t , oder solange<br />
der Ästhetiker noch die Motive seines ästhetischen Urteils durch<br />
kuiistgescl~ichtliche oder genetische Untersuchnngen zu bereichern<br />
bestrebt ist, urteilt er nicht ästhetisch, sondern wissenschaftlich for-<br />
schend und reflektierend, aber jenes Gesamtwissen von der Kunst und<br />
ihrer Technik, ihrem Material, der Persönlichkeit des Künstlers usf.<br />
W i r d wieder allmählich U n m i t t e 1 b a r , alles dieses Wissen, das<br />
wir zunächst bei der geriaueren Analyse der Kunstwerke mülisam durch<br />
Reflexionen und Forschen und objektive Analyse erworben haben, ver -<br />
TV a n d e 1 t sich wieder aus einem Reflexionswissen iu ein unmittelbar<br />
anklingendes assoziatives Vorstellungsmaterial, und wenn der Kunst-<br />
historiker oder der Ästhetiker später nach beendigter Forschungsarbeit<br />
wieder an das Kunstwerk herantritt, so klingen diese durch Forschung<br />
und Reflexion erworbenen Vorstellungsmassen nur flüchtig und rein<br />
assoziativ und reproduktiv bei ihm an und vermitteln ihm ein nicht<br />
minder unmittelbares, aber wesentlich bereichertes und vertieftes<br />
ästhetisches Gefallen und eine bereicherte und vertiefte Kontemplation.<br />
Das Urteil geht also bei der ästhetischen Reflexion diesen eigenartigen<br />
Weg: Während der ästhetischen Bildung und Kultur und der Ver-<br />
volllromiiung des ästhetischen Fühlens und Urteilens wird es zunächst<br />
ein bewul'stes Wissen, es wird dann aber wieder durch assoziative Ver-<br />
kürzungsprozesse in ein blois dunkel bewuistes, assoziativ anklingendes<br />
Vorstellungsmaterial verwandelt, und sobald wir uns ästhetisch ge-<br />
niefsend und beschauend verhalten, klingt dieses durch Forschung und<br />
Reflexion erworbene Wissen wieder flüchtig an und vermittelt uns nun<br />
einen bereicherten, aber nicht minder unmittelbaren ästhetischen Ein-<br />
druck oder eine bereicherte und vertiefte ästhetische Kontemplation.<br />
Wenn psychologische Ästhetiker, wie K ü l p e , recht hätten, so gäbe es
Die Grenzen der psychologisohen Ästhetik 165<br />
keine ästhetische Kultur uild Bildung, denn das iisthetische Gefallen<br />
des Laien in der Kunst kann ebenso wie das des gebildeten Kenners an<br />
Farben, Töne, Takte, Worte usw., kurz an das im Kunstwerk Gegebene<br />
anknüpfen, ja man müiste sogar sagen: ästhetische Bildung ist schad-<br />
lieh, weil sie die Unmittelbarkeit des ästhetischen Urteils aufhebt.<br />
Allein diese Betrachtung ist unpsychologisch. In unseren gesamten<br />
Wahrnehmungsprozessen bemerken wir fortwährend, dais bewuist er-<br />
worbenes Wissen sich wieder in ein unmittelbar wirksames, flüchtig an-<br />
klingendes reproduktives Wissen oder in assimilierendes und apper-<br />
zeptives Vorstellungsmaterial V e r w a n d c 1 t , und dieses leistet uns<br />
in der Wahrnehmung denselben (richtiger gesagt, einen grölseren und<br />
ökonomischeren) Dienst wie dasselbe Wissen im Zustand der bewuisten<br />
Reflexion.<br />
Nun zu dem zweiten Einwande. Es lranii nur einen Gesichts-<br />
punkt geben, nach dcm wir über iisthetische und auiserästhetische Vor-<br />
stellungen und Motive der Beurteilung von Kunstwerken unterscheiden.<br />
Die auiserästhetischen Vorstellurigcii sind cliejcnigen, welche nicht an<br />
das Kunstwerk selbst anknüpfen, sondern an objektive Daten, die nicht<br />
mehr zum Kunstwerk selbst gehören. Dadurch unterscheidet sich in<br />
der Tat hauptsächlich das Urteil des Nichtkunstverständigen und des<br />
lrunstverständigen Menschen. Wenn der erstere ein Bild betrachtet,<br />
oder ein Gedicht liest, so lrilüpfen seine Gefühlsreaktionen und seine<br />
Vorstellungen an die dargestellte Begebenheit oder Situation als solche<br />
an, sie lösen sie gewissermaisen aus dem Kunstwerk völlig heraus und<br />
betrachten sie rein als solche, als Begebenheit oder als Situation. So<br />
knüpfen die Gefühlsreaktionen des Nichtkunstverständigen, z. B. bei<br />
der Betrachtung einer glücklichen oder rührseligen Situation, die in<br />
einem Gemälde dargestellt ist, an diese Situation selbst an, sie beachten<br />
dagegen gar nicht die Art der Darstellung und was der Künstler an<br />
inhaltlichen Elementen durch seine subjektive Auffassung in die Be-<br />
gebenheit hineingelegt hat. Der Durchgang des Dargestellten durch die<br />
Auffassung und die Technik des Künstlers existiert gewisscrmaisen für<br />
den auiserästhetisch urteilenden Menschen nicht. Als sekundärer Ge-<br />
sichtspunkt für die Charakteristik des auiserästhetischen Urteils kann<br />
noch gelten, dais es an rein individuelle Verhältnisse anknüpft, nicht<br />
an solche, die jedem Betrachtcr zugänglich sind (das letztere Merkmal<br />
des auiserästhetischen Urteils ist aber schon durch das erstere bedingt)<br />
- vgl. 11. Käser über den assoziativen Faktor des ästhetischen Ein-<br />
druckes, 1903. Wir haben dagegen gar keinen Grund<br />
ein erworbenes spezielles Wissen, das an materiale<br />
oder wohl gar an formale Elemente des Kunst-<br />
werlres anknüpft, von den Ibfotiven des ästhetischen<br />
Urteils oder den ästhetischcn Assoziationen aus-<br />
zusclilaeisen.<br />
V. Wenn methodologische Gründe den psychologischen Ästhetiker<br />
zuni Verlassen des psychologischen Standpunktes bestimmen können, so<br />
wird das Aufgeben der psychologisch-ästhetischen Betrachtungsweise
166<br />
Die Grenzen der psychologischen Ästhetik.<br />
noch zwingender aus materialen Gründen, sobald wir das künstlerische<br />
Schaffen betrachten. Das ästhetische Gefallen und Genieisen ist durch-<br />
aus nicht blois durch die Natur des ästhetisch auffassenden Subjektes,<br />
sondern auch durch das Kunstwerk, die Künste, die Mittel und die<br />
Grenzen ihrer Darstellungsfähigkeit bestimmt; noch viel inehr ist das<br />
der Fall beim künstlerischen Schaffen. Das Schaffen des Künstlers ist<br />
sogar nur in ganz sekundkrer Weise durch das ästhetische Gefallen<br />
bedingt oder durch die psycho-physische Natur des künstlerisch dar-<br />
stellenden und bildenden Menschen, sondern vorzugsweise durch objek-<br />
tive Faktoren wie durch Material und Mittel einer bestimmten Kunst<br />
und durch die Schranken, welche die letzteren dem Künstler und<br />
seinem Schaffen beständig auferlegen. Es wäre daher ein ganz vergeb-<br />
licher Versuch, das lcü~lstlerische Schaffen durch rein psychologische<br />
Betrachtungen verständlich machen zu wollen. Das ergibt sich ja schoii<br />
ohne weiteres dadurch, dais der Künstler immer mit einem bestimmten<br />
Material arbeitet, welches ihm seine eigenen Regeln und Gesetze vor-<br />
schreibt, welches ihm bestimmte Schranken in seiner künstlerischeii<br />
Produktion setzt, dessen technische Behandlung er selbst kennen und<br />
beherrschen muis. Aber die Betrachtung der Kunstgeschichte zeigt<br />
uns noch ein ganz anderes Phinomen, das gerade mit Rücksicht auf<br />
die Frage der Schranken der psychologischen Ästhetik beachtet werden<br />
muis. Man könnte niimlich sagen, wenn der ,Künstler auch natür-<br />
lich durch das Material und die Technik seiner Kunst in seinem Schaffen<br />
in bestimmter Weise gebunden wird, - vielleicht sogar in dem MaPse,<br />
dais selbst die entwerfende und skizzierende Arbeit seiner Phantasie<br />
schon beständig mit der1 durch das Material und die Technilc der Kunst<br />
gebotenen Schranken rechnen muis -, so hat es doch die psychologische<br />
Ästhetik in erster Linie mit dem psychologischen Prozeis des künst-<br />
lerischen Schaffens in seiner A 11 g e m e i n h e i t zu tun. Sie muis<br />
diesen Prozeis analysieren als eine Summe von allgemeinen Vorgängen<br />
des Darstellens oder Schaffens und die Spezialitäten und die Modifika-<br />
tionen desselben, die in den einzelnen Künsten eintreten, gehören nicht<br />
in die allgemeine psychologische ästhetik, diese fallen vielmehr in die<br />
Aufgabe einer speziellen Lehre vom Bilden und Schaffen in den ein-<br />
zelnen Künsten und deii einzelnen Fällen der künstlerischen Betätigung.<br />
Aber diese Überlegungen würden zunächst direkt gegen jene psycholo-<br />
gische Ästhetik sprechen, welche das ästhetische Gefallen, das Ver-<br />
halten des rezeptiven ästhetischen Subjektes zu ihrem alleinigen Gegen-<br />
stand oder Ausgangspunkt machen will, denn das künstlerische Schaffen<br />
ist nicht Gefallen, das Darstellen ist nicht Urteilen, und die psycholo-<br />
gische Ästhetik hätte ims erst zu zeigen, dais beiden Tätigkeiten ein<br />
gemeinsames ästhetisches Verhalten zugrunde liegt, ein Nachweis, den<br />
sie bisher nicht gegeben hat. Aber selbst abgesehen von dieser ein-<br />
seitigen Auffassung der psychologischen ästhetik, welche das ästhetische<br />
Gefallen zum I-Iauptproblem der ganzen Ästhetik erheben will, so ist<br />
eine solche Abtrennung des allgemeinen Vorstellungsprozesses bei der<br />
künstlerischen Tätigkeit von jeder speziellen Art der künstlerischen Be-
Die Grenzen der psychologischen Ästhetik. 167<br />
tätiguiig in den einzelnen Künsten eine so weitgehende Beschränlrung<br />
in der Erforschung der künstlerischen Vorstellungstätigkeit, dais sie<br />
uns nur vage Allgemeinheiten über das künstlerische Schaffen geben<br />
könnte, welche für das Verständnis desselben ganz bedeutungslos sein<br />
müssen. Denn es gibt keinen Künstler, der i in a 11 g e m e i n e n dar-<br />
stellt oder schafft, jeder Künstler arbeitet schon in seinei. Phantasie<br />
mit bestimmten Mitteln. mit Tönen und Takten oder Farben und Form-<br />
vorstellungen oder mit den Worten der Dichtlrunst, und schon der erste<br />
Entwurf und die allererste Gestaltung seiner künstlerischeii Plane<br />
muis notwendig mit den speziellen Mitteln rechnen, in welchen er dar-<br />
stellend tätig sein will, und die elementare Begabung des einzelnen<br />
Künstlers verweist ihn bei seinem Schaffen bald mehr in die Bahn der<br />
v,isuellen. bald mehr in die der akustischen Tätigkeit. und zwar nicht iii<br />
- ,<br />
eine visuelle oder akustische Tätigkeit i m a 11 g e m e i n e n , sondern<br />
in die speziellen, durch die Natur der einzelnen Künste bedingten Vor-<br />
stellungselemente.<br />
Nun wird der psychologischc Ästhetiker sagen, dais doch auch für<br />
den schaffenden Künstler das Gefallen an seinem Kunstwerlr die ent-<br />
scheidende Rolle s~ielen müsse; der Künstler ist doch. nicht blois ein<br />
schaffender, sondern immer zugleich ein ästhetisch geni~isende~<br />
Wensch. Ja manche psychologischen Ästhetiker haben behauptet, dais<br />
das ästhetische Gefallen a uch beim darstellenden Künstler<br />
d i e H a U p t r o 11 e in seinem Schaffen spielen müsse. Demgegenüber<br />
will ich zuiiächst an der Hand kuiistgeschichtlicher Tatsachen nach-<br />
weisen. dais das ästhetische Gefallen beim Schaffen des Künstlers nur<br />
eine g a n z s e k u n d ä r e und untergeordnete Rolle spielt, und zwar<br />
- das ist besoriders für die Methode der Ästhetik und die Formulierung<br />
ihrer Aufgabe wichtig - eine in dem M a f s C untergeordnete, dais wir<br />
jedenf alls das liünstlerische Schaffen i n s e i n e r E i g e n a r t aus dem<br />
ästhetischen Gefallen durchaus nicht erkennen, ja sogar für das Ver-<br />
ständnis desselben aus den Prozessen des GeniePseiis, des Gefallens und<br />
des ästhetisch Urteilens nichts Wesentliches gewinnen können. Sodann<br />
versuche ich zweitens zu zeigen, dais das künstlerische Schaffen selbst<br />
auch wieder mit den Nitteln der reinen Psychologie gar nicht verständ-<br />
lich gemacht werden kann, weil es ebenso wie unser ästhetisches Ge-<br />
fallen in dem Mal'se durch objektive Tatbestände bedingt wird, dais wir<br />
einer gründlichen Ilereinziehung derselben vom objelrtiven Gesichts-<br />
punkte aus bedürfen.<br />
Zuerst werfen wir einen Blick auf die Nitwirkung des Gefallens bei<br />
der Kunstdarstellung und beim künstlerischen Schaffen. Hierfür<br />
können wir zwei groise Gebiete objektiver Tatsachen in Betracht<br />
ziehen; einerseits die Aussprüche von Künstlern über ihr eigenes<br />
Arbeiten und Schaffen, anderseits die historische Entwicklung solcher<br />
Gruppen von Kunstwerken, an deren Umgestaltung und Vei~ollkomrn-<br />
nung ganze Künstlergenerationen jahrhundertelang gearbeitet haben.<br />
Auf die ersteren gehe ich hier nicht näher ein; ich kann auf die zahl-<br />
reichen Veröffentlichungen verweisen, die von Feiierbachs Vermächtnis
168<br />
Die Grenzen der psychologischen Ästhetik.<br />
bis zu den von Flörke gesammelten Aussprücheil Böcklins über seine<br />
Kunst uns einen Blick in das künstlerische Schaffen, soweit es sich dem<br />
Künstler selbst darstellt, gewahren. Jeder Leser kann sich überzeugen,<br />
dais in allen diesen Aussprüchen der Künstler das ästhetische Gefallen<br />
nur eine ganz untergeordnete Rolle spielt, was dagegen überall als das<br />
Entscheidende hervortritt, ist dies, dais dcm Künstler g e W i s s e o b -<br />
jektive Kunstprobleme und Aufgaben vorschwebeil und<br />
dais er mit den Mitteln und den Schranken seincr<br />
Kunst zu ringen hat. Diese beiden Punkte bestimmen<br />
die Richtung seiner Reflexionen, die Wege seiner Studien, seine<br />
Skizzen, sein Ausprobieren verschiedener Mittel, verschiedener Arten<br />
der Technik und ebenso die Tendenz der Ausarbeitung bei der Schaffung<br />
des vollendeten Kunstwerkes, sie bestimmen seinen künstlerischen<br />
Standpunkt und seine künstlerische Eigenart.<br />
Deutlicher noch als in den Ansprüchen der Künstler über sich selbst,<br />
in denen ja gewiis manche Irrtümer unterlaufen können, zeigen jene<br />
grofsen Tatsachen der Kunstgeschichte dasselbe Phänomen, in denen<br />
der Typus eines Kunstwerlres allmählich durch jahrhundertelange<br />
Arbeit der Künstler immer vollendeter oder in verschiedenartiger Aus-<br />
prägung dargestellt wird. Ich möchte das an zwei Beispielen andeuten:<br />
An der Entwicklung des griechischen Niketypus und an der Darstellung<br />
des Seelenvogels im Altertum. Ich verweise hierfür auf die Schriften<br />
von Studniczka: „Die Siegesgöttin", Leipzig 1898, und Weicker: „Der<br />
Seelenvogel", Leipzig 1904. Diese beiden Schriften (denen sich übrigens<br />
noch viele Lhnliche Studien an die Seite stellen liehen) sind für den<br />
hsthetiker besonders wertvoll, weil ihre Verfasser gar nicht die Absicht<br />
hatten, a s t h e t i s C li e Fragen zu behandeln, sondern vom ver-<br />
gleichend kunsthistorischen und liunstgcnetischeil Standpunkte aus an<br />
ihre Fragen herantreten. Es ist interessant zu sehen, wie Studiliczka<br />
zeigt, dais die Entwicklung des Typus der Siegesgöttin v o n einem<br />
bestimmten lrünstlerischeii Problem ausgeht, einer ob-<br />
j e k t i v e n A u f g a b e, die die Plastilier des griechischen Altertums<br />
sich stellten. Das Problem war dieses: Wic kann der Eindruck der<br />
herabschwebenden Figur der Siegesgöttin, iiisbesondere ihre rasche<br />
Bewegung durch die Luft, init den Mitteln der Bildhauerkunst hervor-<br />
gebracht werden? Der Bildhauer kann bekanntlich nur sehr scli4ver<br />
den Eindruck des Schwebens und des Fliegens hervorbringen.<br />
Schwebende und fliegende Figuren liegen schon an der Grenze seiner<br />
Kunst, weil er dic Figuren auf cin festes Postament stellen muis<br />
und unser Auge (man könnte auch sagen unserc Einfühlung) für die<br />
schwere Masse der Stein- oder Erzfigur eine kräftige lind sichtbarc<br />
Stütze verlangt. Wie liann also die fest aufgestützte, mechanisch von<br />
einer starren Unterlage getragene Figur zugleich als schwebend,<br />
fliegend und die Schwere überwindend erscheinen? Man liann sich in<br />
der Bildhauerkuilst der Baroclrzeit und der modernen Bildhauerkunst<br />
Italiens (Campo santo in Genua) überzeugen, wie oft dies Problem mit<br />
unzur~ichcnden Mitteln und durch Anwendung unkünstlerischer Kunst-
(1 70<br />
Die Grenzen der psychologischeii Ästhetik.<br />
gebende werden, nicht irgend eine Art des ästhetischeii Gefallens. Der<br />
menschenköpfige Vogel wird dargestellt, weil die bildende Kunst mit<br />
rein aiischaulicheii Mitteln, ohne Ver~veiidung des Wortes arbeitet.<br />
Wenn sie die Seelen verstorbener Menschen, die nach uraltem Volks-<br />
glauben in Vogelgestalt weiter leben, als Vogel darstellen will, so kann<br />
sie nicht unter die Vogelgestalt schreiben, dieser Vogel soll einen ver-<br />
storbenen Menschen bedeuten, also muis sie mit ihren eigenen anschau-<br />
lichen Mitteln und mit dem, was in der Figur selbst gegeben ist, an-<br />
deuten, dais der Vogel eine Menschenseele darstellen soll; deshalb vcr-<br />
leiht sie der Vogelgestalt den menschlichen Kopf oder auch wohl Hals<br />
und Brust, weil nach dem Volksglauben Kopf und Brust der Sitz der<br />
Seele und des Gemütes sind. Auch dabei, bei der E n t s t e h u 11 g<br />
dieses Typus, spielt das ästhetische Gefallen keine nachweisbare Rolle,<br />
sondern die Entstehung des Seelenvogels ist bedingt durch die Mittel<br />
der bildenden Kunst einerseits, sodann durch die religiöse Aufgabe der<br />
Kunstdarstellung; und nachdem der Typus einmal entstanden war,<br />
wird er nun durch ein paar Jahrtausende hin immer wieder durch solche<br />
objektiven Rücksichten weiter gebildet. Alle Wandlungen dieses Typus<br />
erscheinen wiederum von lauter anderen, zum Teil nachweisbaren Mo-<br />
tiven bestimmt als gerade von dem ästhetischeii Gefallen. Dieses spielt<br />
höchstens insofern eine Rolle, als das Detail der Ausführung oder die<br />
Einfügung der Vogelgestalt in den Raum oder die Anpassung an die<br />
Umgebung und dergleichen mehr nebensächliche Elemente der Dar-<br />
stellung durch die ästlietische Wohlgefälligkeit als solche bestimmt er-<br />
scheinen.<br />
Wir sahen also, dais das ästhetische Gefallen sich bei dem künst-<br />
lerischen Schaffen als etwas v ö 11 i g U 11 p r o d u lr t i v e s erweist, die<br />
treibenden produktiven Faktoren liegen in gegebenen oder vom Künstler<br />
selbst aufgestellten objektiven Kunstproblemen, in den Mitteln und<br />
Schranken einer bestimmten Kunstgattung, und nur ganz sekundär<br />
wird vielleicht über die Auswahl der Mittel und die letzte Formgebung<br />
j en e s ästhetische Gefallen mitentscheiden, das sich blois an das ob-<br />
jektiv Gegebene im Kunstwerk halt, also jenes Gefallen, das ich lieber<br />
das laienhafte Gefallen nennen möchte.<br />
Hier nun kann man, zurückblickend, die Frage aufwerfen: Wenn<br />
eine solche (in Anbetracht der groisen Zahl der verschiedenen Kunst-<br />
werke und Künste sozusagen unendlich groise) Menge von Motiven bei<br />
der Ausgestaltung der Kunstwerke mitwirkt, die sie bis in alle ihre<br />
Einzelheiten bedingt, was ist denn ein ästhetisches Urteil, das, wie die<br />
psychologische Ästhetik annimmt, von allen diesen Dingen überhaupt<br />
nichts weiis? Es ist nichts anderes als das an der Oberfläche haftende<br />
Urteil des ästhetisch ungebildeten Menschen und alle solche bestimmte11<br />
Kenntnisse von den Ursachen und Motiven, die einen Typus wie den der<br />
Siegesgöttin oder des Seelenvogels oder irgend einer bestimmten<br />
Gattung von Gefäisen der Keramik oder bestimmter Säulenkonstruk-<br />
tionen und dergleichen bedingen, können unmöglich zu dem auiser-<br />
ästhetischen Wissen gerechnet werden. Eine Auffassung, welche alle
Die Grenzen der psychologischen Ästhetik. 171<br />
diese Urteile zum auiserästhetischen Wissen rechnet, ist ein Auswuchs<br />
eines einseitigen Psychologismus in der Ästhetik, dem mit Entschiedenheit<br />
entgegengetreten werden muis. Dieser Psychologismus würde sich<br />
bei konsequenter Durchführung der modernen philosophischen Ästhetiker<br />
wieder in seiner Art ebenso weit von dem lebendigen Betrieb der<br />
Kunst und dem ästhetischen Urteil der Icünstler entfernen, wie das<br />
seinerzeit die spekulative Ästhetik getan hat, die mit Recht den Spott<br />
und die schroffe Ablehnung grofser Künstler, wie speziell eines Gottfried<br />
Semper, erfahren hat.<br />
Es sei nur noch angedeutet, dais, was von der Ästhetik des<br />
künstlerischen Schaffens und des Kunstwerks ausgefülirt wurde,<br />
wieder in verstärktem Maise von der ä s t h e t i s c h e n Ku1 -<br />
tur gilt. Zum Zustandekommen der ästhetischen Kultur, insbesondere<br />
zur äuiseren ästhetischen Kultur. wirken so viele obiektive Faktoren<br />
zusammen, dais es eine Vermesenheit wäre, sie vom Standpunkte<br />
der reinen Psychologie oder einer blois die psychologischen Prozesse des<br />
ästhetischen Gefallens betrachtenden Ästhetik aus verstehen zu wollen.<br />
Auch bei ihr spielt das ästhetische Gefallen eine ganz sekundäre und<br />
untergeordnete Rolle, es tritt mehr dann mit seiner Wirkung ein, wenn<br />
die Werke der ästhetischen Kultur fertig sind und es etwa eine letzte<br />
Anpassung oder Zusainmenstimmung derselben zu machen gilt. Die<br />
Ausführung derselben aber wird weit mehr von objektiven Faktoren bedingt,<br />
von der Lebensweise, den Lebensbedürfnissen, von der Sitte, von<br />
dem Milieu des Menschen, von Klima, Tradition, von der Mode, von<br />
Zweck und Material des zu schaffenden Werkes usf.; wir können sogar<br />
sagen, dais ein groiser Teil der künstlerischen Wohnungseinrichtungen<br />
bei den nordischen und südlichen Völkern Europas fast ausschlieislich<br />
durch die klimatischen Verhältnisse bedingt ist. Auch bei der ästhetischen<br />
Kultur ist daher das ästhetische Gefallen nicht der eigentlich<br />
produktive Falrtor, und es spricht erst sein Wort, wenn jene objektiven<br />
produktiven Faktoren entscheidend mitgewirkt haben.<br />
VI. Es kommt noch ein weiterer psychologischer Grund hinzu, der<br />
die Unterordnung des ästhetischen Gefallens unter die objektiven Faktoren,<br />
die im ästhetischen Verhalten die entscheidende Rolle spielen,<br />
deutlich zeigt. Dieser läfst sich allerdings im Zusammenhang einer<br />
kurzen Abhandlung nur andeuten: Wir wissen aus der Psychologie des<br />
Gefühls. dais alle Gefiihlsrealrtionen des Ibfenschen in weiten Grenzen<br />
um s t i m m b a r sind. Der Hauptf alrtor bei der Umstimmung unserer<br />
Gefühle ist die Gewöhnung. Wir wissen, dafs Reize und Reizlromplexe,<br />
die anfangs Unlustursachen waren, sich durch Gewöhnung, vor allem<br />
aber auch durch Schulung und Erziehung des Geschmackes auf ästhe-<br />
U U<br />
tischem Gebiete, in Lustreize verwandeln kiinnen und umgekehrt, oder<br />
richtiger : die Unlustwirkung der Reize kann sich in Lustwirlrung verwandeln<br />
und umgekehrt. Unsere Gefühle sind also umstimmbar; so<br />
allein ist es verständlich, dais wir in älteren Zeiten der Kunstentwicklung<br />
auf allen Kunstgebieten ohne Ausnahme bemerken, dais Kunstwerke<br />
den Beifall, oft sogar den rüclchaltlosen und enthusiastischen
172<br />
Die Grenzen der psychologischen Ästhetik.<br />
Beifall ihrer Zeitgenossen fanden, die uns heute als minderwertige<br />
Lösungen eines lrünstlerischen Problems erscheinen, oder die sogar in<br />
dem elementaren Aufbau eher ästhetische Unlust als Lust bei uns be-<br />
wirken (hierbei spielt allerdings auch das Vorhandensein von Mais-<br />
Stäben und Mustern, nach welchen die Kunstwerke beurteilt werden<br />
können, eine groise Rolle, es kann jedoch an dieser Stelle auf die Be-<br />
deutung der Maisstäbe und Musterbilder niclit näher eingegangen<br />
werden). Hieraus erkrart es sich wenigstens zum Teil, dafs die<br />
Melodien früherer Jahrhunderte bisweilen in Intervallen fortschreiten,<br />
die wir nur noch in sehr beschränktem Maise verwenden, oder dafs<br />
Harmonien verwendet werden, die uns heutzutage geradezu als Kalro-<br />
phonien erscheinen und ferner, dais die bildlicberi Darstellungen des<br />
Mittelalters und die religiösen Szenen der niederrheinischen und ver-<br />
wandter Schulen uns heute mehr einen schrecklichen als einen schönen<br />
Eindruck machen. Die zerbrochenen Gliedmaisen der geräderten Mär-<br />
tyrer oder die I'Ieiligeii, die ihre abgeschlagenen Köpfe andachtsvoll in<br />
den Bänden halten, die grauenvollen Uarterszenen in harter Farbeii-<br />
gebung und sehr mangelhafter Perspelrtive und dargestellt mit Ge-<br />
stalten, deren Unproportioniertheit heutzutage jedem Laien in der<br />
Kunst auffällt, haben den enthusiastischen Beifall ihrer Zeitgenossen<br />
gefunden. Gegenwärtig müssen wir gerade ein bestimmtes kunst-<br />
geschichtliches und lrulturgeschichtliches Wissen erwerben, um solchen<br />
Bildern Geschmack abzugewinnen. Der Laie, der sich mit seinem Urteil<br />
blofs an das Gegebene, an Form, Farbe, Gestalt und den schrecklichen<br />
Inhalt des Dargestellten hält, kann diesen Kunstwerken überhaupt<br />
keinen ästhetischen Wert abgewinnen, sie sind für ihn Ursachen reiner<br />
Unlust und ästhetischen Mifsfallens. Nach der psychologischen<br />
Äst,hetik würden also diese Bilder ästhetisch völlig wertlos sein, und<br />
doch ist ihnen ein eigenartiger künstlerischer Wert eigen. Diesen ver-<br />
stehen wir aber erst, wenn wir uns in die Stimmung, in das religiöse<br />
Leben, in die Kultur, die Sitten und Weltanschauungen jener Zeit wieder<br />
hineinversetzen. Das ästhetische Urteil ist hier also völlig von cinem<br />
bestimmten Wissen abbangig, niit dem der Betrachter an solche Kunst-<br />
werke herantritt, und die Gefühlsrealrtionen des Beurteilers werden<br />
durch das Wissen in radikal cntgegengesetztern Sinne verändert im<br />
Vergleich zu denen desjenigen Betrachters, welcher dieses Wissen nicht<br />
besitzt. Durch ästhetische Bildung werden also unsere Gefühlsreak-<br />
tionen umgestimmt, sie lassen sich niclit mehr blols beeinflussen von<br />
dem, was im Kunstwerlr unmittelbar gegeben ist. Es liegt also in der<br />
Natur des ästhetischen Gefallens selbst, dais es die allgemeine Bestim-<br />
mung dessen, was als Lust und Unlustursache wirkt, oder was ästhe-<br />
tisches Gefallen und Mifsfallen erregt, gar nicht aus der Natur des<br />
Gefühls durch rein psychologische Betrachtungen schöpfen lrann,<br />
sondern wir bedürfen des objektiven Nachweises der Abhängigkeit des<br />
Gefallens von äuiseren Ursachen, von Gewöhnungsfaktoren, von ästhe-<br />
tischer Bildung und ästhetischem Wissen, um die ästhetischen Gefühls-<br />
reaktionen überhaupt verständlich machen zii können.
Die Grenzen der psychologischen Ästhetik. 173<br />
Man könnte sagen, dass die Konsequenz dieser Auffassung voll den<br />
Ursachen unserer Gefühlsreaktionen die Auflösung der wissenschaft-<br />
lichen Ästhetik, ja der Gefühlslelire überhaupt sein müiste. Das ist<br />
durchaus nicht der Fall. Denn auch jene Umstimmungen und Gewöh-<br />
nungeil unscrer Gefühle unterliegen bestimmten Gesetzen und lassen<br />
sich wissenschaftlich darstellen. Die Tatsachen der Umstiinmungen und<br />
Gewöhnungen unserer Gefühle komplizieren nur die Aufstellung ästhe-<br />
tischer Prinzipien, niachen sie aber lreinewegs unmöglich. Sie kom-<br />
plizieren sie durch die IIereinziehling der Unistimmungs- und Ge-<br />
wöhnungsgesetze; diese sind aber, wie das in dem Begriff der Gewöhnung<br />
und Umstimmung liegt, durch rein psychologische Betrachtung nicht<br />
nachweisbar, sondern wir müssen rein empirisch und historisch die<br />
objektiven Ursachen aufsuchen, welche zu einer solchen Umstimmung<br />
und Gewöhnung unserer Gefühle führen, weil jene objektiven Ursachen<br />
nicht als Bewuistseinsdaten gegeben sind, sondern als Erfahrungstat-<br />
sachen jenes objektiven Geschehens, das wir als ästhetische Bildung<br />
und ästhetische Iiultur bezeichnen.<br />
VII. Gegen diejenige Richtung in der psychologischen hsthetilr,<br />
welche speziell nur den Tatbestand des ästhetischen Gefallens (die Vor-<br />
gänge im rezeptiv iisthetischen Subjekt) zum Ausgangspunkt und<br />
Mittelpunkt der ganzen Ästhetik machen will und welche das lrünst-<br />
lerische Schaffen höchstens durch ein phantasievolles S i C h h i n e i iz -<br />
v e r s e t z e n in die Tätigkeit des Künstlers zu behandeln sucht, läist<br />
sich noch ein weiteres Bedenken geltend machen. Es liegt die Gefahr<br />
vor bei dieser Methode, dais alles ästhetische Geschehen dem Gefallen<br />
untergeordnet wird, auch das künstlerische Schaffen. Nun haben wir<br />
vorhin mehrfach gezeigt, dais gerade in dem ästhetischen Gesamt-<br />
verhalten das Gefallen immer nur eine untergeordnete Rolle spielt, so-<br />
bald es nicht auf den ästhetischen GeiiuSs als solchen ankommt. So-<br />
wohl für den Künstler als für das Verständnis des Kunstwerkes und<br />
seiner Genesis und für die ästhetische Kultur tritt das ästhetische Ge-<br />
fallen in seiner Bedeutung zurück. Für die psychologische Ästhetik<br />
sind ferner das ästhetische Gefallen und die darstellende und schaffende<br />
Tätigkeit des Künstlers zwei total verschiedene Prozesse, sie müssen<br />
daher auch bei der psychologischen Analyse vollständig getrennt wer-<br />
den. Diese Trennung hebt nun aber unser allgemeinerer Gesichtspunkt<br />
in der Betrachtung des ästhetischen Verhaltens wieder auf. Ich könnte<br />
auch hier wieder auf eine nähere Bestimmung dieses Verhaltens ver-<br />
zichten, es genügt völlig, zu betonen, dais das künstlerische Darstellen,<br />
Bilden und Schaffen ebenso wie das ästhetische Genieiscii und Be-<br />
urteilen ein völlig andersartiges Verhalten des Menscheil zur Auisen-<br />
welt ist, wie das Verfolgen praktischer Unternehmungen, das sittliche<br />
Handeln, Erkennen und Forschen. Ebenso leuchtet ein, dais dasjenige,<br />
was beide, das ästhetische Genieisen und das künstlerische Schaffen,<br />
von dem erkennenden und praktischen Verhalteii unterscheidet, ein<br />
einziger, in diesen beiden Seiten des ästhetischen Verhaltens hervor-<br />
tretender Gruildtrieb ist, und dass infolgedessen eben das ästhetische
174<br />
Die Grenzen der psychologischen Ästhetik.<br />
Genieisen und das künstlerische Schaffen nur als zwei Seiten der Be-<br />
tätigung eines und desselben Grundtriebes erscheinen; sie bilden die<br />
rezeptive und die produktiv schaffende Seite des einen einheitlichen<br />
ästhetischen Verhaltens des Menschen zur Welt, wie ich es schon unter<br />
Nummer I11 angedeutet habe. Das ist eine Betrachtung des ästhe-<br />
tischen Verhaltens, die den älteren ästhetikern ganz geläufig war und<br />
die erst der modernen psychologischen Ästhetik wieder verloren ge-<br />
gangen ist. Wir sehen z. B., dais Schiller den Spicltrieb ebensowohl<br />
auf das ästhetische Auffassen und Genieisen, wie auf das ästhetische<br />
Schaffen anwendet. Stellt man diese Einheit des ästhetischen Ver-<br />
haltens wieder her, so sieht man rccht deutlich, welche gewagte Tat es<br />
ist, wenn die psychologische Ästhetik die Analyse des Genieisens und<br />
Gefallens zum IXauptproblem oder gar zum alleinigen Problem der<br />
ästhetik machen will.<br />
Man kann auch, ohne eine erschöpfende Analyse des ästhetischen<br />
Verhaltens zu geben, in groisen Zügen die gemeinsame Wurzel der<br />
beiden Seiten desselben, des ästhetischen Genieisens und des ästhetischen<br />
Schaffens bestimmen. Zunächst lassen sich beide durch eine Anzahl<br />
Nerkmale n e g a t i V bestimmen, die sich als zwei Seiten eines ein-<br />
heitlichen Verhaltens erweisen, weil diese negativ unterscheidenden<br />
Bestimmungen auf sie beide in gleicher Weise zutreffen. Beide, das<br />
ästhetische Genieiscn und das künstlerische Schaffen, verfolgen keine<br />
praktischen über das Genieisen und Schaffen hinausliegende Zwecke,<br />
und sie sind um so reiner ästhetisch, je weniger sie sich in den Dienst<br />
solch sekundärer Zwecke stellen; beide sind sich (positiv bestimmt)<br />
Selbstzweck; für beide ist ein bestimmtes eigenartiges Verhältnis der<br />
formalen und inhaltlichen Elemente maisgebend, welches das gewöhn-<br />
liche Handeln und das wissenschaftliche Erkennen in dieser Weise gar<br />
nicht kennt. Wenn der Künstler in seinem Schaffen einen Idecngehalt,<br />
ein anschauliches Bild einer Begebenheit oder einer menschlichen Figur<br />
oder irgend einen Vorstellungslromplex mit den Mitteln einer Kunst<br />
darstellen will, so unterscheidet sich seine Tiitigkeit von der des for-<br />
schenden und handelnden Menschen ganz und gar. Der forschende<br />
oder handelnde Mensch ist fast auschlieislich oder ganz ausschlieislich<br />
material interessiert; dem F o r s c h e r kommt es darauf an, die<br />
eigenen Ideen klar und wissenschaftlich korrekt zu cntwiclreln, und er<br />
ordnete die Sprache diesem einen Zweck völlig unter, und ebenso ordnet<br />
der handelnde Mensch die Mlittel und Wege des EIandelns der Er-<br />
reichung seines Zwcckes unter. Der Künstler hingegen weiis sich ganz<br />
und gar bei der Darstellung seiner Ideen gebunden durch die Mittel<br />
und Grenzen einer bestirnmtcn Kunst. Es handelt sich für ihn nicht<br />
blois um irgend eine beliebige Darstellung dessen, was er in der Phan-<br />
tasie geschaut oder in Stimmung erlebt hat, sondern die D a r s t e 1 -<br />
1 u n g s e 1 b s t wird für ihn zu einem besonderen Problem, seine<br />
Arbeit nimmt die charakteristische Form an, dais er um die rechte<br />
V e r e i ii i g U 11 g von Form und dargestelltem Inhalt kämpfen muis.<br />
Als Dichter hat cr seine Ideen oder Stimmungen in die Form der ge-
Die Grenzen der psychologischen Ästhetik. 175<br />
bundeilen Rede, in ein bestimmtes Versniais, in einen bestimmten<br />
Stropheiibau U. dgl. m. zu bringen, als Bildhauer oder 3Caler weiis er<br />
sich durch die Mittel und die Schranken der Plastik oder der Zeich-<br />
nung und Farbengebuilg gebunden usw. Iii keinein Falle kann er den<br />
materialen Zweck der Darstelluilg seiner Ideen zum alleinigen Ziel er-<br />
heben uiid die Mittel der Verwirklichung diesem Zweclr völlig unter-<br />
ordnen. Dais die Form und die Mittel der Darstellung ein entschei-<br />
dendes Wort mitreden uiid den Inhalt des Dargestellten wescntlicli mit-<br />
bestimmen und fortwährend variieren, ist vielleicht der Kernpunkt der<br />
küiistlerischeii Darstellung überhaupt und unterscheidet sie von allem<br />
Verfolgeii praktischer und allem Darstellen wissenschaftlicher Ideen,<br />
bei welchem nur noch eine entfernte Analogie zur Bedeutung der künst-<br />
lerischeil Form wiederkehrt. Dazu komnit ferner als ein wesentliches<br />
Moineiit, dais der Kiiiistler mit den Mitteln seiner Kunst allgemein-<br />
verständlich werden inuis. Auch dadurch fühlt er sich i11 dem Gebrauch<br />
der Nittel iii hohem Maise gebunden.<br />
Geiiau dasselbe fiiideii wir beim ästhetischen Genieisen wieder.<br />
Beim Auffassen eines Kuilstwerlres wissen wir uns durch das im Kunst-<br />
werk Gegebeiie völlig gebunden, insbesondere durch das Material, die<br />
Technik, die Darstelluiigsmittel und das, was sie überhaupt sageii<br />
können, und die charakteristischen Merkmale für das Verhalten unserer<br />
Vorstellungen und Gefühle im ästhetischen Auffassen und Genieisen<br />
und im Verstehen des Kunstwerkes kann man durch die Formel aus-<br />
drücken: Wir sind gcbunden uiid doch frei. Gebuiideii sind wir voll-<br />
komnieii durch das, was der Künstler im Kunstwerk objelrtiv gibt; frei<br />
sind wir, indem wir das Kuilstwerlr nur verstehen können, wenn wir es<br />
s e 1 b s t ä n d i g innerlich wieder aufbauen und uns noch einmal wieder<br />
produktiv verhalten als nachschaffende, aber doch wieder als schaffende<br />
IZunstverstiiiidige, und hier tritt schon ein gemeinsamer, bei beiden<br />
Seiten des ästhetischen Verhaltens iiz gleicher Weise wiederkehrender<br />
Zug hervor: Auch das ästhetisch auffassende Subjekt muis, wenii auch<br />
nur innerlich, s C h a f f e 11 d U ii d cl a r s t e 11 e n d tätig sein, und der<br />
Künstler ist, wenn auch mehr in nebensächlicher Weise, beständig<br />
ästhetisch auffassend iiiicl genielsend tätig. Sein Werk muis zuletzt,<br />
trotz aller Beschriiiiliung durch die Mittel und aller gegebenen künstle-<br />
rischen Aufgabeii, auch vor seinem ästhetischen Welturtcil bestehen<br />
können. Voll diesem Staiidpuiil~te aus erscheineii die beiden Prozesse,<br />
das ästhetische Gefallen und das künstlerische Schaffell iiiclit mehr als<br />
der Art nach verschieden, sondern sie uriterscheiden sich nur dadurch,<br />
clais gewisse Bestandteile, die beiden gemeinsam sind, in dem eineii mehr<br />
vorherrschen als in dem aiidern, aber, streng genommen, fehlt kein Be-<br />
standteil des eiiieii bei dem andern. Beim Schaffen tritt das Gefallen<br />
zurüelr, es dominiert clie schaffende Tätigkeit, beim ästhetischen Ge-<br />
nieisen tritt das Schaffen zurück, obgleich es als inneres Nachschaffen<br />
noch vorhanden ist, clas Gefallen gewinnt nuii die dominierende Bedeu-<br />
tung. Für beide Seiteii des ästhetischen Verhaltens ist ferner das weitere,<br />
ebensowohl negativ als positiv becleutuiigsvolle Xerkmal inaisgebeiid,
176<br />
Die Grenzen der psychologischen Ästhetik.<br />
die Gleichgültigkeit des Genieisenden und Schaffenden gegen die<br />
Existenz oder die Wirklichkeit des dargestellten Vorstellungsinhaltes<br />
im Sinne der gewöhnlichen, nicht dargestellten Wirklichkeit. Es ist<br />
dem darstellenden Künstler ganz gleichgültig, ob seine Nixen und<br />
Centauren, oder seine badenden Soldaten, oder die Madonnen und die<br />
Beiligen existiert haben. Und ebenso fragt der ästhetisch Genieisende,<br />
wenn er nicht aufserästhetische Urteile fällen will, nicht danach, ob die<br />
„Fabelu des Romans, das Drainas, das Epos usw. auch „wahr1' ist. Bei<br />
beiclen Betätigungen kommt es dem genieisenden und schaffenden<br />
Menschen lediglich auf die ästhetische Wirkung als solche an, ihr gegen-<br />
über verschwindet der Gedanke an die Wirklichkeit des Dargestellten<br />
vollständig, und je reiner die künstlerische Betätigung ist, desto mehr<br />
tritt dieser Wirklichkeitsgedanlce zurück. In beiden Betätigungen tritt<br />
also das kontemplative Aufgehen in einer selbst geschaffenen oder<br />
Anderen nacherlebten Phantasiewelt, die als äquivalent einer Wahr-<br />
ilehmungswirklichkeit dient, als das Charakteristische hervor, welches<br />
lediglich das innere Erleben dieser selbst geschaffenen oder Anderen<br />
nacherlebten Phantasiewelt und den Genuis an derselben zuin<br />
Zwecke hat. Wir könnten noch versuchen, den gemeinsamen, allem<br />
&thetischen Verhalten zugrunde liegenden Trieb zu bezeichnen, uncl<br />
die Art der menschlichen Betätigung, die dabei stattfindet, in<br />
ihrem Wesen psychologisch zu charakterisieren, allein es kann<br />
sich hier nur um Andeutungen darüber handeln. Man hat das<br />
künstlerische Schaffen wohl bezeichnet als eine Äuiserung des<br />
Spieltriebes oder als innere Nachahmung oder gar als Nachahmung<br />
schlechtweg oder Naturnachahnlung U. dgl. m. Alle diese Bezeich-<br />
nungen sind schon darum falsch oder wenigstens ungenügend, weil sie<br />
das ästhetische Verhalten nur durch Analogien mit anderen Ver-<br />
haltungsweisen bezeichnen. Spiel ist Spiel und nicht künstlerischer<br />
Schaffen, künstlerisches Schaffen kann höchstens in gewissen Merk-<br />
inalen oder Seiten init dern Spiel übereinstimmen oder ihm ähnlich seiii,<br />
aber es kann nicht darin aufgehen, Spiel zu sein, sonst hätten wir es<br />
aller Wahrscheinlichiieit nach einfach als Spiel benannt. Das Spiel<br />
geht nicht darauf aus, dauernde Werke zu schaffen. Nachahmung ist<br />
vielleicht die falschcste Definition des künstlerischen Schaffens, die es<br />
geben kann, denn erstens liegt in dieser Definition ein Mil'sbrauch des<br />
W o r t e s Nachahmung, weil wir von Nachahmung nur dann sprechen,<br />
wenn wir Mienen und Oeberden oder die Sprache eines Menschen, kurz<br />
geistige Ausdrucksvorgänge mit Mienen und Geberdeiz oder Sprache<br />
oder irgendwelchen geistigen Ausdrucksvorgängen nachmachen. Also<br />
höchstens auf die mimische Kunst würde diese Definition passen; aber<br />
auch auf diese nicht gailz, weil auch in der mimischen Kunst, wenn sie<br />
wirklich Kunst ist, immer ein wirklich produktives und schöpferisches<br />
Element stecken muis. Und darin ist der zweite Mangel dieser Defi-<br />
nition angedeutet. Nachahmung bezeichnet nicht das produktiv<br />
schöpferische, wieder aufbauende und aufbauende Element, das freie<br />
neben dem gebundenen, das wir oben als für beide Seiten des ästhetischen
Die Grenzen der pscycholngischen iisthetik 17 7<br />
Verhaltens als charakteristisch bezeichiiet haben. Dasselbe gilt von der<br />
inneren Nachahmung. Kunst als künstlerisches Schaffen wird dahcr<br />
richtiger durch deii Gattungsbegriff der d a r s t e 11 e n d C ii T ä t i g -<br />
k e i t bezeichnet, als durch den der Nachahmung. In der Bezeichniiiig<br />
der Kunst als Nachahmung liegt noch ein dritter, 1 o g i s c h e r Fehler.<br />
Es liegt nämlich in dem Effekt der K~uist : dein ECunstm~erli, gemisser-<br />
inaisen f a k t i s c'h eine Nachahmung der Natur vor, oder geiiauer, cs<br />
besteht eine partielle faktische Koinzidenz zwischen dem Kunstwerk und<br />
dem Naturgegenstaiid. Diese hat zu dem Irrtum verleitet, daIs auch<br />
der Prozeis des Schaffens Nachahmung sei. Aus jener Koinzidenz kann<br />
jedocli nicht gefolgert werden, dais der Prozeis, aus dem die partielle<br />
Übereinstimmung des ICunstwerkes init der Natur hervorgeht, ein iiacli-<br />
ahmender ProzeCs ist. In dem Maise, als der Künstlcr wirklich nur<br />
nachahmt, ist von lcünstleriscliem Schaffen nicht mehr die Rede. I-Iier-<br />
mit ist nun blois die f o r m a 1 e G 1 e i c 11 a r t i g l< e i t beider Prozesse,<br />
des ästhetischen Schaffens und Geiiieisens, angegeben; sie siiid, kurz<br />
gesagt, beide Genieisen und Schaffen zugleich und beide ein Genieisen<br />
und Schaffen der gleichen Art. ?Vir können aber auch ihre materiale<br />
Gleichartigkeit b~geichnen. Dies soll durch folgende Gberlegungen gc-<br />
schehen.<br />
Eine Tätigkeit, wie das Bstlietischc Verhalten kann iiicht dui~li<br />
Analogien mit anderen Tätigkeiten, sondern nur durch ihre eigenen<br />
Merlmale charakterisiert werden. Diese scheinen hauptsächlich dariii<br />
zu liegen, dais der Mensch das Bestreben hat, die Natur nicht iiur z~i<br />
erkennen, zu erforschen, nicht nur praktisclic Zwecke gegenüber der<br />
lfienschheit zu verfolgen, sondern die sinnliche Auisenseite der Welt<br />
(oder eine dieser äquivalente, selbstgeschaffene, anschauliche Phaii-<br />
tasiewelt) zu genieisen und „Werke" zu schaffen, die diesem Genieisen<br />
Ausdruck verleihen oder es ermöglichen. Die Werke der Kunst dienen<br />
dabei dem dreifachen Zweck, einmal, Naturcindrücke (oder ästhetische<br />
Objekte überhaupt), die uns zum Genieiseii ihrer sinnlichen Auisenseite<br />
zweckmäfsig und wertvoll erscheinen, uilter Betonung der diesem<br />
Zwecke besonders dieiilichen Seiten derselben W i e d e r z u g e b e ri<br />
(mehr r e p r o d u Ir t i v e Darstellung iii der Kunst), sodann, einer an-<br />
schaulich zu genieisenden Pliantasiewelt, die uns f ü r das anschauliclic<br />
Genieisen wertvoll geworden ist, A u s d r u c k zu verschaffen, endlich<br />
absichtlich und planniäisig W e 'I< e zu schaffen, die das ästhetische<br />
Geniefseii h C r b C i f ii h r e n können.<br />
Hiermit ist aber das ästhetische Verhalten nach seiiier materialcii<br />
Seite noch nicht erschöpfend bezeichnet. Es lromint vielmehr als ciir<br />
weseiltliches Merkmal hinzu, dais uns im ästhetischen G e 1 i e 1 s e 11<br />
diese sinillich-anschauliche Seite der Welt ein A u s d r u c lr s in i t t c l<br />
wird für innere Erlebiiisse idealer Art,'füi ideale Pcrsöiilichl
178<br />
Die Grenzen der psychologischen Ästhetik.<br />
verständliche „Sprache" für den Ausdruclr und die Darstellung idealer<br />
Persönlichkeitswerte benutzen. Kurz, material läist sich das isthetische<br />
Verhalten so beschreiben, es ist eine phantasie- und gefühlsmäisige<br />
Interpretation der sinnlichen Auisenseitc der Welt, wobei uns diese<br />
letztere zugleich zum Ausdruck (Symbol) idealer Persöillichkeitsmerte<br />
wird, und uns zur Wiedergabe solcher Werke in anschaulichem Gewande<br />
drängt, oder zum planmäisigen Schaffen von „WerIren", die diese Art<br />
des Genieiscns und der Interpretation der AuCsenxvelt erinöglichen.<br />
Es scheint nun eine entscheidende Frage für den ästhetikei zu sein,<br />
wo die Brücke liegt, zwischen zwei scheinbar so verschiedenartigen<br />
Tätigkeiten, wie dem Genieiscn der sinnlichen Seite der Welt und jenen1<br />
idealen Erleben und Darstellen idealer Seiten unserer Persönlichkeit?<br />
Die Antwort ist leicht, diese Brücke, dieses Band lrann wieder in cler<br />
formalen und der materialen Seite des ästhetischen Verhaltens gefiinden<br />
werden. Auf der formalen: denn mit anschaulichen Mitteln können<br />
ideale Erlebnisse, den ganzen Uenschen ergreifende Gemütsregungen,<br />
ideales Wollen und dergleichen mehr in viel eindringlicherer Weise dar-<br />
gestellt werden als durch den abstrakten Gedanken, ja nur mit<br />
d i e s e 11 Mitteln können sie vollkommcn uncl restlos '&argestellt werden<br />
und n LI r bei d i e s e r Darstelluiigswcise ermöglichen sie den anderen<br />
Menschen ein restloses N a c h e r 1 c b e 11. Die anschaulichen Mittel<br />
stelleil den Natureindruck, die Person, das Ereignis, das uns zur An-<br />
knüpfung jener Pcrsönlichkeitswerte dient, s c 1 b s t in tot0 dar,<br />
während der abstrakte Gedanke es nur unvollständig nach gewissen<br />
Seiten und Beziehungen andeuten lrann.<br />
AT a t e r i a 1 ergibt sich dieses Band dadurch, dais es sich in cler<br />
Kunst um die Darstellung der a s t h e t i s c h e n Persönlichkeit handelt,<br />
nicht oder nicht in erster Linie um die Darstellung des erkeniieiideii<br />
oder sittlich handelnden Menschen; diese ästhetische Persönlichkeit ge-<br />
hört aber ebenfalls in erster Linie der siiinlich-anschaulichen Seite<br />
unserer Natur an, und W e 11 n die Kunst sittliche Gesinnung oder<br />
geistiges Schaffen zum Ausdruck bringt, so tut sie es immer nur in der<br />
Form, dafs ihr die sinnliche Wiedergabe jener nicht ästhetischen Seiten<br />
unserer Natur zur EIauptsache wird: auf die körperliche Form, die<br />
Icörperhaltung, das Minen- und Gebärdenspiel als solclies, und die Art,<br />
wie diese körperliche Seite unserer Erscheiiiung das geistige Leben<br />
repräsentiert, kommt es der Kunst an; die Form, die der physische<br />
31ensch dabei angenommen hat, wird ihr Selbstzweck. Es ist daher<br />
eigentlich ein ungenauer Ausdruck, wenn man sagt: die Kunst dient<br />
zum „Ausdruck" des geistigen Lehens ; richtiger muis es lieiiseii ; das<br />
geistige Leben der Person, das wir im Kunstwerk iiacherleben, die~it nur<br />
dazu, uns verständlich zu machen, welche charakteristischen I
Die Grenzen der psychologischen Ästhetik. 179<br />
Es ~varcii niin die weiteren Aufgaben dieser Auffassung der ästhe-<br />
tik, dais einerseits das oben gekennzeichnete ästhetische Verhalten auf<br />
seine elementaren Grundlagen zurüclrgeführt würde, dais sodann ge-<br />
zeigt mürde, wie alle heutzutage namhaft gemachten Eigentümlich-<br />
keiten der Iiuiist, dcs küiistlerisclien Schaffens und des ästhetischen<br />
Genieisens aus der obigen Formel verständlich werden. Jene Aufgabe<br />
lianii hier iiicht ausgefiihrt werden, für diese genügt es, anzudeuten,<br />
dais sich aus unserer Formel ohne weiteres verständlich machen läist,<br />
warum das ästlietisclie Verhalten lreine Rüclrsicht nimmt auf sekundäre<br />
Zwecke, auf die Existenz des ästhetischeii Objektes, warum die formalen<br />
Elemente der Darstellung so hohen Wert erlangen 11. a. m. Für unsern<br />
gegenwärtigen Zweclr genügt es, gezeigt zu haben, dais es ein solches<br />
besonders ästhetisches Verlialten cles Menschen zur Welt gibt, und dais<br />
dieses deii subjektiven und objelitiven Aufgaben der ästhetik als Wissen-<br />
schaft ihre Einheit gibt.<br />
VIII. Nunmehr läist sich auch verstkiidlich machen, was icli scho~i<br />
obeii andeutete, dais der psychologischen Ästhetilr noch ein zweiter<br />
Grundfehler anhafte : Sie kennt deii eigentümlichen ästhetischen Ge-<br />
sichtspunkt der Betrachtung der psychischen Prozesse nicht, und vom<br />
Standpunkte des reinen Psychologen kann sie diesen Gesichtspunkt<br />
nic!lt kennen. Mit Eilfe ilessclben werden aber erst die ästhetischen<br />
Probleme in dem übrigen geistigen Geschelicii abgegrenzt; diejenigen<br />
Gefühle, Vorstellungen, Wahrnehmungen, dasjenige Verlialteii der Auf-<br />
iiierlrsainlreit, der Reproduktion und dergleiclien ist von ästhetischer<br />
und nicht blois allgemein psychologischer Bedeutung, das dem<br />
oben ~liaralrterisie~ten ästhetischen Verhalten dient. Das ist die Aus-<br />
scheidung bestinimter psgchisclier Prozesse als ä s t li e t i s C hi e r aus<br />
tlein allgeineinen psychophysischen Gsschelieii. In diesem Punlrtc<br />
unterscheidet sicli meine Ansicht hauptsächlich von dem Stancl-<br />
punlrt der iioriiiativen und der Wertisthetik, und zugleich b e r ü h r t<br />
sie sich hier am nieisteil mit ihr. Icli stimme der Wertästhetilr dariii<br />
hei, dais die Psychologie als solchc den ästhetischeii Gesichtspunkt<br />
~iicht lrennt und nichts von ästhetischcii Prozessen weiis, ich stimme<br />
ihr aber dariii nicht bei, dais die ästhetisclieii Prädikate sich unabhängig<br />
von der Psycliologie bestimmeii und sich ästhetische Prinzipien<br />
olnie psychologische Analyse gewinnen lieisen - soweit es sich um<br />
Prinzipien des Gefallens, des Urteileiis odcr des Genieiseiis und zurn<br />
Tcil um solche des lriinstleiischen Schaffens handelt. Was die Wertiisthctilr<br />
übersieht, wenn sie Ästhetil~ unabhängig ~oil der Psychologie<br />
ausführen ~iiöclite, ist, dais wir das ,'tisthetische Genieisen mit den<br />
YIitteln der Psychologie analysieren und seine äuiseren und inneren<br />
Bedingungen bestimnicn können, weil in der Tat das ästhetische Ver-<br />
Iialten auch ein psychologisch eigentümliches Verhalten<br />
ist und dais weiiigstens ein grolser T e i 1 der ästhctischeii Wertprädiliate<br />
von dieser Analyse des ästhetischeii Verhaltens abhängig ist. Bestiininen<br />
wir z. B. clas ästlietisclie Verhalten durch den Begriff der Kontcinplatioh,<br />
oder auch cles inneren Nachahmcns, oder der Einfühlung,<br />
12*
180<br />
Die Grenzen der psychologischen dsthetik.<br />
oder durch den lcitendcn Begriff einer eigentümlichen ästlietischen<br />
Apperzeption, oder, wic ich sclbst dies tue, durch das eigentümliche<br />
Verhältnis der Gebundenheit und Freiheit unsercr Aufmerksanilieit<br />
und unseres Vorstellens, so sintl damit lauter charakteristische psyclii-<br />
sclie Verhaltungsweisen bezeichnet, die nian mit den Mitteln der Psycho-<br />
logie analysiercn lianii. Wir können zeigen, dass die Aufmerksamlceit sich<br />
gegenüber dem Iiunstwerk anders werhält als gegenüber der ii i c 11 t -<br />
d a r g e s t e 11 t e ii Wirlilichkeit; dass die Reprodulitionsprozesse iii<br />
diesen Fällen anders verlaufen (vgl. iiisbcsondere die A~iaiyse der Kon-<br />
templation clurcli E. Kalischer, Dissertation 1902) ; dass die Gefülilsreak-<br />
tionen wesentlicli durch das in1 Kuiistwerke Gegebene bestimmt werden,<br />
dass gewisse Vorstellungsgruppeii oder Gedanken, wie der Gedanlie aii<br />
die Wirlclichlreit des Dargestellten oder praktische Zweclcvorstellungeri<br />
beim ästhetischen GeliieSsen aus dem Bewuistsein zurücktreten, und<br />
wir können das aus dem Wesen des Kunstwerkes als des ästhetischcr~<br />
Reizes verständlich machen. Und h i e r a u s C r g i b t s i c 11 e r s t<br />
d e r S i n ii zahlreichcr ästhetischer Wertprädikate, und daraus allein<br />
lassen sich manche Eigentümlichlreitc~l des ästhetischen Werturteils er-<br />
lilären, wie z. B. die Tatsache, dais die asthetischen Wertc rein inteiisiv<br />
und nicht konseliutiv sind (Fechiier und J. Cohii). Wenn wir ferner<br />
psychologisch die Ursachen uiid Bedingungen des ästhetischen Ge-<br />
fallens in bestimniteii Fällen nacliweiseii, so gelangen wir durch die<br />
psychologische Analyse zu bestimmten asthetischen Prinzipien uiicl<br />
köniien, wenn uns das Vergnügen macht, aus diesen auch asthetische<br />
Normen oder Wertprinzipiell entwickeln. Eine Wertästhetilr, die auf<br />
diese psychologische Begründung der ästhetischen Werte verzichten<br />
wollte, kann entweder nur durch bloise autoritative Machtsprüche die<br />
asthetischen Prinzipicii entwickeln, oder durch dialektische Ableituiigeil,<br />
oder durch cine latente psychologische Analyse, die dann ihrerseits an<br />
„Prinziplosiglceit" leiden muis - alles das sind wissenschaftlich un-<br />
brauchbare Methoden. Aber darin hat die Wertisthetik recht, dass der<br />
Psychologe sich täuscht, wenn er glaubt, mit seinen eigenen Mitteln<br />
durch „angewandte Psychologic" die A b g r C ii z u n g der ä s t 1 e t i -<br />
s c h e 11 Prozesse aus dein Ganzen dcs Bewufstseins vollziehen zu<br />
liöniien. Dazu ist der ästhetische Gcsichtspuiibt der<br />
R C t r a C h t U ii g gewisser Bcwiiistseinsprozesse und eines gcwisseii<br />
Verhaltens des Menscheii nötig, welchcil die Psychologic nicht bcsitzt.<br />
Es ist nicht richtig, wenn inailche Wertästhetilier glauben, dass für den<br />
Psychologen iinmer nur das allgemeine psychische Geschcheu existicrr,<br />
und dass er die Eigenart des asthetisclieii Verhaltens nicht bestimmeii<br />
könne; aber es ist richtig, dass der Psychologe mit seinen Afitteln die<br />
begriffliche Abgrenzung und Rubrizieruiig uiid die I~lassifikatioil be-<br />
stimmter ästhetischer BewuSstseinsprozesse als ä s t h e t i s c h e r nicht<br />
geben kann, dass er also in allen den ästhetischen Prozcsseii V o ii<br />
s e i ii e m S t a 11 d p u n k t e a u s nur „Fallea ~~oii Aufnierksanllieits-<br />
oder Vorstellungs- oder Gefülilscrlebnissen sehen lrann, aber nicht<br />
ä s t 1 e t i s c 1 e Prozesse. Das zeigen bekanntlich recht drastisch dic
Die Grenzen der psychologischen nsthetik. 181<br />
&sthetiscl_ieil Prinzipien in Fechncrs Vorschule cler iisthetik, die sknlt-<br />
lieh nur allgeincine Prinzipieil der Entstehuilg von Gefühlen sind, und<br />
die niir zufällig oder iiiir nebenbei istl~etische Bedeutung erlangcii.<br />
!Die eigentliche psychologische Lsthetili läuft daher fortwährend<br />
Gefahr, allgemciiic Gefülzlsgesetza oder Vorstellungsgesetze als ästhc-<br />
tische Prinzipien zu prokla-mieren, und weil11 manche psychologischen<br />
Astlietiker nicht in diesen Fehlel* verfallen, so lromiiit das nur daher,<br />
clafs sie beständig, ohiic es sich einzugesteheil, den Standpunkt des<br />
Psychologe11 verlassen, oder weil sie dem Leitfaden der geschichtlicli<br />
iibernommeiieil ästhetischen P r o b 1 C m e nachgeben uild durch diese<br />
auf die spezifisch ästhetische Fragestellung hingelenlrt werden.<br />
D C r s e 1 b C V o r w u r f also, den die psychologisclien Ästhetiker<br />
gegenüber der objektiven Mcthode iiz ihrer reinen I-Iandhabuiig, wie<br />
sie bei Sernper vorliegt, erheben, dais diese Methode nicht über dir<br />
a s t 1 e t i s c h e K e d e 1 tu ri g der von ihneil gefundenen Prinzipien<br />
ciitscheideil liaiin, g i 1 t g a n z a ii a 1 o g für die psychologische<br />
iisthetil-, wie Fechncrs Beispiel zeigt. Sie hat von sich aus kein Mittel,<br />
uin darüber zu entscheideil, ob ihre Analysen psychischer Prozesse, ihr<br />
Sachweis eines bestimmten Vcrhalteils der Aufmerksamlicit, der Vor-<br />
stelliiiigen und der Gefühle allgemein psychologische oder spezifisch<br />
isthetische Bedeutung habeii. In diesem Punkte hat Cohil init seinem<br />
Vorwurf der Priiiziplosiglreit völlig recht, und wenn wir nicht auf der<br />
TTorarbeit der historisch übernommeilen ästhetischen Probleme fuiseii<br />
liöniiten, so würde dieser Fehler der psychologischen Ästhetik aiich<br />
nocli viel deutlicher hervortreten. Ich gebe also zu, dafs zahlreiclle<br />
Probleine der ästhetilr nur mit den Mitteln der psychologischen Analyse<br />
qclöst werden können. e b e n s o wie zahlreiche ästhetische Probleme<br />
nur durch die An~nrenduiig von SVegleitungeii und Gesichtspunkten rein<br />
objektiver Art behaildelt werden können, aber cliese psychologischeil<br />
Siialysen liabeii keine selbstäildigere Bedeutung in der Ästhetik als die<br />
ohjelitiveii Methoden, sondern d i e p s y c h o 1 o g i s c 11 C 1 An a 1 y s e 1<br />
stehen genau in demselben Verbältizis zu der Ar-<br />
heit des iisthetischeii Forschers, wie die objek-<br />
t j 17 e 11 h 11 a 1 y s e il CI e r I< 11 ri s t w c r lr r oder die lsuilsthistorisch<br />
rergleicheildeii, genetisclieii iiilcl andere objektive Methoden. Sie<br />
b c i cl e schaffen ein At a t e r i ia 1, die einen für die siibjelrtive Seite des<br />
isthetisclieii Verhaltens, die anderen für seine objektiven Bedingtheiten<br />
und seine objektiven Seiten, welches erst durch die Anwendung des<br />
si~ezifiscil ästhetischen Gesichtsnuiibtes auscewählt und auf seine ästlietisclie<br />
Bedeutung hin gesichtet werden miiis oder, genauer gesagt, nur<br />
das, was in den Bewuistseiilsvorgängen im Dienst jenes eigenartigen<br />
Yerhalteiis steht, das lieincm äiiiseren Zwecke dient, sondern sich<br />
Sclbstz~~~ecli ist, das iin letzteii Grunde teils ein Genieisen der sinnlichen<br />
Auiseizseite der Natur, eine individuelle Unlformuiig äufserer<br />
Erlrbiiisse zii einer individuell geprägten IniieriWelt ist uild sich<br />
in dein Trieb, diese Iiineilwelt wieder zu äufscril und darzustellen<br />
betätigt, uiicl welches dabei eine durch die eigeiiartige Begabung des
182<br />
Die Grenzen der psychologischen ästhetik.<br />
einzeliieii I
Karl Heinrich Heydenreich als Universitäts-<br />
lehrer und Kunsterzieher.<br />
Von<br />
Georg Müller, Leipzig.<br />
ucli ari der Univei-sität Leipzig hatte die Aufklärung im<br />
18. Jahrhundert ihren siegreichen Einzug gehalten. Auf dein<br />
Gebiete der Erziehung war ihr IIauptvertreter der vielseitige,<br />
tatkräftige und milde Superinteiident D. Johanil Georg<br />
R o s e ii m ü 1 1 e r ,L) der in seinen Schriften wie in den Vorlesungen<br />
und katechetisclieii Übungen für die neue Richtung eifrig und erfolg-<br />
reich eintrat. Das Verstandesinäisige, Nüchterne und Nützliche wurde<br />
reichlich betont, ging auch auf die Schüler iiber, während die Bedürf-<br />
nisse des Gemüts vielfach vernachlässigt wurden.<br />
Daneben trateil cinzelile Ströinungen hervor, die, mehr oder weniger<br />
der Auflcläru~lg verwandt, zu ihr in Gegensatz traten und eigene Wege<br />
gingen. Ein EIauptvertreter einer solchen Richtung war Karl Heinrich<br />
He y den r e i cli,2) der von 1'789 bis 1'79'7 als Professor der Philo-<br />
sophie der Universität angehörte, daneben als gewandter Stilist eine<br />
vielseitige schriftstellerische Titiglceit entfaltete. Erst Spinozist, dann<br />
Kantianer, wandte er sich liebe11 der Reljgionsphilosophie der Ästhetik<br />
zu, um schliefslich, der Vorliebe der Zeit gernals, mit Erziehungsvor-<br />
1) Hanck, Real-Encyklopadie fur protestantische Theologie und Kirche.<br />
Band 132, S. 70f.<br />
2) K G. Schelle, Karl Heinrich Heydenreichs . . . Charakteristik als Menschen<br />
und Schriftstellers Mit Heydenreichs Bildnis. (Fehlt in dem von mir benutzten<br />
Exemplare der Pölitzschen Bibliothek). Leipzig, G. Mastini 1802. - Wohlfahrt,<br />
Die letzten Lebensjahre Heydenreichs. Altenburg 1802. - Jördens Lexikon VI,<br />
819-845, mit einem Verzeichnis seiner Schriften. - J. Franck in der Allgemeinen<br />
deutschen Biographie. Bd 12, S 366f. - Goedeke, Grundriis der Geschichte<br />
der deutschen Dichtung. 2. Auflage. 4, 1 (Dresden 1891), S. 5.
184 Ihr1 Heinrich Heydenreich als Unix~ersitatslehrer und Kunsterzieher.<br />
schlageil auf den Plan zu treten. Diese entwickelte er in seinen1 letzten,<br />
bisher auch von seinen Biographen wenig beachteten, kaum genannten,<br />
zmeibändigen Werke „Der Privaterzicher in Familien, wie er sein p oll".^)<br />
Geboren ain 19. Februar 1764 zii. Stolpen als Sohn des dortigen Oberpfarrers,<br />
späteren Superintendenten zu Dahme, von einem gelehrten<br />
IIauslelirer bis zu seinem 14. Jahre unterrichtet, dann auf der Thoinasschule<br />
unter dem bekannten Rektor Johann Friedrich Fischer gebildet,<br />
bezog er Ostern 1782 die Universität Leipzig und beschäftigte sich mit<br />
geschichtlichen, literarischen, ästhetischen und philosophischen Studien.<br />
Nachdem er die IIagisterwürde und das Recht Vorlesungen zu halten<br />
erlangt hatte, wurde er 1789 zum auiserordciitlichen Professor der Pliilosophic<br />
und in demselben Jahre noch zum ordentlichen Professor novae<br />
f uilclationis bei ördert.<br />
Seine Erileniiung fiel in die Zeit, iil der die kurfiirstlich sichsische<br />
ltegieruilg die im letzten Jahrhundert stark vernachlässigten Universitttten<br />
sorgfältiger zu beachten und kräftiger zu unterstützeil begann.<br />
Bereits ain 30. September 17804) war ein kurfürstliches Reslrript an das<br />
Oberkonsistorium und von diesem Verordnung unter dem 9. Oktober<br />
clcssellsen Jahres aii die Universitäten Leipzig ulid Witteilberg ergangei~.~)<br />
Unter den~ 18. Olrtober 1781 erhielt das Oberlronsistoriuin<br />
in Dresden nähere Anweisuligen." Danach erlrlärte der Kurfiirst, dais<br />
aus den mittels Berichts von1 7. Februar 1781 eingereichten ui~vollstindigeii<br />
Verzeichiiissen der akademischeil Lehrer der Zustand der<br />
Ctliversitäten nur ungenügend erkannt werde. Deshalb sollte der Oberkonsistorialpräsident<br />
sich slljixhrlicli, oder weliigstens alle zwei Jahre<br />
iiaclz Leipzig und XJittenberg begeben, hierzu die Zeiten, wo die alradeniischen<br />
Vorlesuilgeii gehalten ~vurden, benutzen, einige Wocheii<br />
darauf verweilden, sich eine persönliche Kenntnis von den Lehrern,<br />
ihren Verdiensten uiid Bedürfnissen erwerben, und darüber einen Rericht<br />
in tabellarischer Forin erstatten. In diesem sollte in einer besonclereri<br />
Kolumne beigefügt werden, ob und was von einem jeden Professor<br />
gescliriebeil worden sei, und wie solche Schriften beschaffen seien,<br />
aneh meiin über Betragen und Aufführung etwas Besonderes mit hinli~nglichem<br />
Beweise zu seiner Kenntnis gelange. Die tägliche Auslösung<br />
von 6 Talern sollte aus der Fleisch-Steuer-Besoldungs-Kasse genommen,<br />
der benötigte Vorspaiiii von dem Kaminerl
Kar1 Heinrich Heydenreich als Universitätslehrer und Kunsterzieher. 185<br />
Die Einrichtung trat aber aus irgenclwelchen-i Grunde noch nicht<br />
ins Leben. Als iin folgenden Jahre Gesuche um Gewährung von Gelialt<br />
von verschiudeiien Professoren eiilgiiigeil, wurde der Oberkonsistorial-<br />
prisideiit zur Berichterstattung bei Gelegenheit der vorzunehmenden<br />
„Loltaluntersucl-iung cler Akademien" v~ranlalst.7) Sie kani nicht zur<br />
Ausführung. Dagegen wurden weiter schriftliche Berichte eingefordert,<br />
so am 7. Olstobcr 1782 über den Besuch der Bcichte seitens der Pro-<br />
fessoren. Jeder Leipziger Geistliche hatte anzuzeigen, welche Pro-<br />
fessoren bei ihm zur Beichte gingen. Als Grund wurde das Gerücht<br />
angeführt, „dais auf Unserer Akademie zu Lcipzig die Abwartung des<br />
öffentlichen Gottesclienstes und andere Übungen des Christentums, die<br />
zu dem öffentlichen Religioiisbekciintilisse gehören, incrklich vernach-<br />
lässigt werden, und auiser Zweifel ist, dass Zuliörer nach dem Beispiele<br />
ihrer Lehrer sich zu bilden pflegen, mithin clie letzteren durch Hintail-<br />
setzung der Religionspiiichteii den ersteren leicht ärgernis geben und<br />
solcl-ie zur IZaltsiniiiglrcit in der Religion verleiten lsöilileii: Wir aber,<br />
clais hierdurch dein guten Rufe dieser Akaclemia nicht gescliaclet werden<br />
möge, sorgfiiltigst veriniedeii wissen wollei~."~)<br />
Ober die nlchstcii Jahre haben wir lteinc Kacliricliten." Erst ili<br />
einem Berichte von 1789 finden sich iiiihere Angaben. In cleii ersten<br />
Tageii des August hatte sich der vor lturzein eriianiitc Oberltoiisistorial-<br />
präsident v. Burgsdorfl") nach Leipzig begeben, sich über die Verhält-<br />
nisse der Universität genau unterrichtet und über den Befund unter<br />
dem 29. Dezember 1789 Bericht erstattet, clcr erst am 7. April 1790 zur<br />
7) Loc. 2136. Acta die akademischen Reisen des Ober-Konsistorial Prhsidenten<br />
hetr. . . . . Anno 1781. Vol I, Bl. 3.<br />
0) Ebenda Vol. I, B1. 4-14; von I31. an der Bericht des Superintenclenten<br />
Dr. Korner.<br />
9) Nacli Loc 2136. Acta, Die akademischen Reisen des Oberkonsistorialprisidenten.<br />
Vol. 11, BI. 3 scheinen zwischen 1781 und 1789 Revisionen der<br />
Universität stattgefunden zu haben. Es heiist dort. "Durch die auf Beförderung<br />
der Aufnahme iiilindischer Uriiversitiiten gerichtete landesviiterliche Sorgfalt. . . .<br />
ist es schon seit mehreren Jahren belranntermaisen dergestalt eingerichtet, dass<br />
hochstdero Oberconsistorial-Priisident von Zeit zii Zeit durch eigene Beaugenscheinignng<br />
und Local-Untersuchungen von dem Zustande der inländischen<br />
Universitäten Kenntnis nehmen und darauf nach Befinden das allenthalben<br />
Notige veranstaltet werden soll." Die Akten des kbniglichen EIauptstaatsarchivü<br />
zu Dresden enthalten aber keinen Bericht Auch ergibt sich einer eigenhiindigen<br />
Korrelrtur des Oberkonsistorialpr~sidenten in dem Bericht vom 28. Dezember 1792<br />
(Loc. 2136. Revision der Universitiiten Leipzig . . . . 1780 und 1792. B1. 95a\,<br />
dafs ,,zum ersten Male im August 1789« die angeordnete Revision abgehalten<br />
wurde.<br />
10) Es ist der frühere Lehrer des Kurfursten Friedrich August und spstere<br />
Konferenzminister. F. Blanckmeister, Siichsische Kirchengeschichte Dresden 1899<br />
S. 357, 365, 368. -- Böttiger-Flathe, Geschichte des Kurstaates und Konigreiches<br />
Sachsen. 2. Auflage. 2. Band Gotha 1870. S. 557, 607, 628. - Wie von Burgsdorf<br />
nach seiner Ernennung rum Konferenzminister die Hebung der Universität<br />
Leipzig sich angelegen sein lieis, ergibt sich aus Loc. 2136. Acta die akademischen<br />
Reisen. Vol. 11, BI. 57ff.
186 Kar1 Heinrich Heydenreich d s Universititslehrer und Kunsterzieher.<br />
~bergabe gelaiigte.11) IIier heilst es über IIeydcnreich:l9) Seiiic Hauptwissenchaft<br />
ist die Philosophie, und nach dem uiiparteiischcil Keiliierurteil<br />
besitzt er clarinnen eine vorzügliclie Stirke. Mit der wissenschaftlichen<br />
Kenntnis verbindet er iiatürliclzcn Scharfsinn uncl Belcanntschaft<br />
init der alten Philologie und neueil Literatur, welches besoildcrs<br />
in seiilcn i~sthetischeil Arbeiten ihm sehr zustatteii liomint und seiiiem<br />
mündlicheil Vortrag soviel Reinigkeit als Präzision darreicht. Bei<br />
fortgehendem Fleiis und gewisseiihafter Vcrwerfuilg aller Trugsitze,<br />
die gegen clie geoffenbarte oder sonstige Wahrheit angeheil, auch sorpfaltiger<br />
Vermeidurig oft irrefiihrciidcr Spitzfindiglceiten, clergleicheri<br />
mall besonders der Schrift Xatur und Geist nach Spinoza, I. Teil, vorwerfen<br />
will, laist sich vorausselieil, dais er einer der besten philosophischen<br />
Dozenten werclen werde." Sein Gesuch um Gewäliriiiig eines<br />
Gehaltes wurde unterstützt. Seine Vorlesungen waren ilaineiltlicli iri<br />
Betracht der kurzcn Zeit, seit der er las, gut besucht. In ihnen behaiidelte<br />
er Logik iind Metaphysik nach Feder, Naturrecht iiaclz Höpfncr,<br />
yhilosopliischo Encyklopädie, natürliclie Theologie, philosophische Gcschichte,<br />
Poetik; auch hielt er Übungen im Disputieren uncl iiii deiitschcii<br />
Stil, sowie iii cler Rhetorik für Theologen.<br />
Von seineil seit 1786 veröffentlichten Scliriftcii wurden in1 Berichte<br />
auiser mehreren philosophischeil <strong>Abhandlungen</strong> in verschiedenen neueii<br />
Zeitschrifteil aiigefiihrt: 1. Aniinadversioiies in I\Iosis ~Iei~cl~lii refutationem<br />
placitorum Spinozae; 2. Der lcleine Blahler, ein Schauspiel fiir<br />
Iiiiider; 3. Dc nexu seilsus et pliaiitdsiae, rationu liabita Etl~ices lthctorices<br />
et Poetices. Spec. 1. 4. Gcmitlde aus dcili goldenen Zeitalter;<br />
5. Vorbereitung einer Untersuchung über den ITrsprung und dic Allgeincingiiltiglieit<br />
der Gesetze für Werlie der Empfinduilg und der Phantasie;<br />
6. des Abtes Pluquet historisch-politischer Versuch über cleil<br />
TAuxus, frei bearbeitet; 7. Natur und Gott nach Spiiloza, 1. Teil, und 8.<br />
Xcues Systeiii der Asthetik.<br />
Noch in denisclbeil Jahrc wurde IZeydciireicli zum Professor ordinarius<br />
ilovae fundationis ernanizt, unter dem 1. März 1790 iii Reiz'<br />
altfundierte Stelle, freilich ohne Erfolg, zum ordentlichen Professor<br />
vorgeschlagen.13)<br />
In dein Berichte des Obcrkonsistoriuins vom 23. März 1790 werden<br />
auch prinzipielle Fragcn gestreift.'" 111 Vorschlag kommt ilacli den<br />
damals aiigesehenen Philologeil Eck, Beck, Ernesti als vierter Heydenreich.<br />
In dem Gutachte11 wircl ausgeführt: „Schwer wird es, cleil Vor-<br />
11) Loc. 2136. Revision der Universitiiten Leipzig und Wit,tenberg 1780<br />
und 1792. (Aus den Akten des Kirchenrats, Loc. I, No. 20). B1. 1. - Die<br />
Ankündigung an den Rektor, Dr. Plattner, Professor Physiologiae Ordinarius,<br />
erfolgte unter dem 29. Juni 1789. Loc. 2136. Acta die akademischen Reisen.<br />
Vol 11. BI. 3. 4.<br />
12) Loc -2136. Revision der Universitsten Leipeig und Wittenberg 1780<br />
und 1792. BI. 66b-68a.<br />
1s) Loc. 1775. Acta die Professionsersetzune. Vol. VI. BI. 195. 198b.<br />
14) Loc. 6112. Die Ersetzung der ~hiloso~hischen ~akultilt zu Leipzig.<br />
Vol. VI, 1790, B1. 3ff.
Kar1 Heinrich Heydenreich als Universitiitslehrer iind Kunsterzieher. 187<br />
zug des einen vor dein aiiderii zu bestimmea, und wir würden zu dem für<br />
die akademischen Lehrämter nur selten vorteilhaften priiicipio seilii<br />
lediglich uilscrc Zuflucht ~zehmeii müssen, und ebenso würden wir in<br />
Ansehung der Auswahl nicht erleichtert sein, wenn zu den Erforder-<br />
nisseii eines Professoris Poeseos, dafs er selbst in Fertigung lateinischer<br />
Gedichte geübt sein müsse, als desfalls vor keinem der deiiominatorum<br />
zur Zeit sattsamc Specimina in publico erschienen sind, für iiotwendig<br />
gehörte. Es ist aber von jeher, und zwar nach unserer geringen Ein-<br />
sicht nicht ohne Grund, angenommen worden, dafs die Fertigkeit iii<br />
der lateinischen Pocsie selbst cinc zwar rühmliche, jedoch nur accesso-<br />
rische Eigenschaft eines Professoris Poeseos und hingegen sein charalr-<br />
teristischer Vorzug nebst vorzüglichen alten Sprach- und soiistigcii<br />
antiquarischen IIeniztnisseii sein müsse, den Geist der alten griechische11<br />
und latciilischeii Dichter zu fiihleii, auch in Gruildsätze fassen, wid<br />
durch geschmackvolle Eiitwiclclung sein& Zuhörern mitteilen zu lcörinen,<br />
um sie dadurch, nicht sowohl zu lateinischen Poeten, als vielmehr zu<br />
pragmatischen Keniierii der alten Dichtkunst und der Literatur übcr-<br />
haupt zu bilden, und wie diese in seiner Xasse, nur etwa mit verschie-<br />
denen Modifikationeii, das ebenmäfsige Erfordernis eines Professoris<br />
graecae et latinae liaguae und eines Professoris eloquentiae ist, so hat<br />
man auch ferner immer darauf gehalten, es seien diese letztgenaiiiiteii<br />
beiden Professioneii mit der Professioiie Poeseos so analogisch, dais sie,<br />
als alle unter den gemeinenNainen der Professioiium Philologiae gehörig,<br />
eine mit der anderen im vorlcommendeiz Falle gar füglich vertauscht<br />
werden könnten, uilcl dais bei Würdigung der zu einem dergleiclien Lehr-<br />
amte den eineil vor den andern empfehlenden Qualitäten auf die Grade<br />
der Gründlichkeit, des Umfangcs und der Brauchbarkeit derer den etwa<br />
beabsichtigtcn Subjectis beiwohilciiden philologischcii Wissenschaften<br />
vorzüglich gesehen werden müsse.'' Daher wurde an erster Stellc Eclr<br />
empfohlen.<br />
Wenn iii diesem Falle, wie auch sonst, die Professoren der lclassi-<br />
schell Literatur bevorzugt wurden, so traten auch Vertreter der neuereil<br />
Poesie als Mitbewcrbcr auf. Als Eeispiel sei Mag. Christiaii Hcinricli<br />
R e i c h e 1 erwähnt, der sich der Empfehlung des Superintcndenteii<br />
Dr. J. G. Rosenn~üller uiid der philosophischen Falrultät erfreute, aber<br />
auch Zeugiiisse von aiigeseheiieil Auslibildern, so clem Bachelier eil Theo-<br />
logie Hugoii de Baisville, Reisebegleiter des Herrn Morris aus Phila-<br />
delphia, uiid andereil beibringen konnte. Ihm wurde geilaue Kenntnis<br />
der englischen uiid französischen Sprache und Literatur nachgerüliilit,<br />
auch init dem dänischen Schrifttum war er bekanilt. Er übcrsetzte däni-<br />
sche Theaterstücke ins Deutsche, ebenso M. Eilticks grammatikalische<br />
Einleitung in die englische Sprache, D. Fennings Englische Sprach-<br />
lehre, auch hatte er sich mit einer deutschen Sprachlehre für Ausländer<br />
in französischer Sprache versucht.1~)<br />
'5) Über ihn Loc. 1795. Die Stelle eines deutschen Lektors fur Ausländer<br />
auf der UniversitSlt Lcipzig. 1787. B1. 5 befindet sich ein Verzeichnis von Aus-<br />
lLndern, Dänen, Franzosen, Engländern, die bei Reiche1 gehört haben. Auf
188 Iiarl Heinrich Heydenreich als UniversitLtslehrer und Kunsterzieher.<br />
In eiiieiil spiteren Berichte voll „Decaiius, Senior und übrigen Profcisores<br />
cler philosophischcii Falcultat zu Leipzig" ~vurdeii IIeydenreicli<br />
uiicl 130rii1G) wegen ilires Bestrebens „dem Publico durch ihre Bemühuilgeii,<br />
die Kaiitische Philosopliie aufzulclären, weiter anzuweiideil<br />
und allgemeiner auszubreiten'( gerühmt; auch wird bei Heyclenreich<br />
hervorgehoben, er habe inchrere i\/lale inoralisclic und politische Vorlesungcn<br />
gehalten uiid sonst in seinem Wirlcungskieise nach allen<br />
Krafteii zu nützen sich eifrigst angelegen sein 1asseii.li)<br />
Iii dem iiachsteii Berichte des Oberlcoiisistorialpräside~iten voiii<br />
Iahre 1191 wircl dieses Eintreten fiir clic Eiantische Philosophie gerügt.<br />
Es 11ei rst liier :I S, „In Atisehung des wissenschaftlichcii Uiitcrrichts endlich<br />
ist besonders bei der Univcrsitiit Leipzig ineines uiimaisgeblicheii<br />
Dafürhaltcns als ein Defelit ~vahrzuiiehnien gewesen, dais die neuereri<br />
Lelirer auf den1 pliilosophischen Katheder, I-Teydenreich, Cisar uiicl<br />
Born, nicalits als die Kaiitisclie Pliilosophie lesen; da niiii clas Crusischel")<br />
Systeiii, nacli welclieni Professor Seidlite lieset, wenig Liebliaber<br />
iiielir findet, vielleicht eben uiii cler Wahrheit und IZedliclilceit<br />
~villeil, jvomit es sich auszeichnet; ferner iiiit dem Professor Plattner<br />
clerinalen der Professor I-Ieydeiireich in gutein Vortrag wetteifert, so<br />
mircl die Kaiitische Philosophie von den meisten den übrigen Systemen<br />
vorgezogen. Ohne jetzt zu untersuchen, ob die Dozenten das Kantisclie<br />
System selbst Iiinlanglich verständlich zu machen vermögen, und ob es<br />
in sich selbst so unschkdlich für clie Offenbarung ist, wie es von cleii<br />
diiliaiigern desselben ausgegeben werden will, so bleibt doch allezeit<br />
clesseir praginatische r\Tutzbarlccit Iiochst eiitferiit und diese Philosophie<br />
IUr liiinftige Geschäftsminner ein uninittelbar ganz nicht brauclibarcs<br />
\~ebiculuiii, dergleichen doch für pralctische Gelehrte die Philosophie iilit<br />
ilircin Geist eigentlicli sein soll. Ich liabe daliero eine und andere EPiinierung<br />
darüber zu erteilen mich iiiclit eiitbrocheii, iiiclessen allerdings<br />
lioff'eii niögeii, dais diese sogleicli liraftiger als der jetzige gelehre Parteigeist<br />
für Kant uni1 seine Philosopliie sein uiicl allgemeine Abinderung<br />
bewirken sollte."<br />
.ihnlicli lautet das Urteil in der tabellarischeii f~bersicht:~~) „Seine<br />
(Hrycleiireiclzs) philosophische Gelelirsainkeit iiizcl seine Stärke in den<br />
-<br />
Heranziehiing von AuslBnclern wird in den Berichten mehrfach Bezug genommen.<br />
Von ihrem Einflusse wird einmal hervorgehoben, dais .die Menge der Fremden,<br />
die sieh dort befinden, die Anzahl der Durchreisenden und der a~isgebreitete<br />
auswärtige Briefwechsel so wenig ohne Infektion bleiben kbnnen, als etwa beim<br />
Umgange physischer Kranken mit Gesunden solches immer moglich ist."<br />
16) 1':r gab mit Absicht das „Neue Magazin, Erlhuterungen und Anwendungen<br />
des Kantischen Systems* heraus (leipzig 1789). In dem Vorwort ziim ersten<br />
Stiiclz des 1. Bandes bekennen sieh die Herausgeber als eifrige Anhänger des<br />
Königsberger Philosophen.<br />
17) Loc. 1776. Acta die Professionsersetzung an cler philosophischen PakultLt<br />
zii Leipzig bel. 1790-1809. Vol. VIT, B1. 4f.<br />
18) LOC. 2136. Revision der Universitziten Leipzig und Wittenberg 1789<br />
und 1792. BI. l06b<br />
19) P. Tschackert in Hauck, KealencyklopSdie fur protestantische Theologie<br />
und Kirche. IV3, S. 344f.<br />
20) Ebenda. B1. 139b, 140a.
Karl Heinrich Heydenreich als Unirersitätslehrer uiid Kunsterzieher. 189<br />
schönen Wissenschaften, welches bcides ihm auch Präzision und Feinheit<br />
im Ausdrilcli gewähret, würden ihn, wie bereits in der ~~origeii Ta-<br />
belle bezeugt worden, zu einem ganz vorzüglichen Dozenten in cler<br />
Philosophie bilden, wenn nicht ein allzu groiser Hang zur bloisen SpeBu-<br />
lation und die Anhanglichkeit ail die Kantischen Grundsätze ihn weniger<br />
nutzbar maclite. Auch wird seine Tätigkeit durch öftere Kräidiliclili
190 Kar1 Heinrich Heydenreich als Universitiitslehrer und Kunsterzieher.<br />
Grundsätze. Er geiiselt die Sch~vächen der bisherigen Behandlung.<br />
Ohne weiter nach höheren Prinzipien zu fragen, habe man nur Beispiele<br />
zusainmcngerafft. Er erklärt, dieser Weg cler bloisen Beobaclituiig sei<br />
unstreitig bequcm, aber fiir sich allein nicht sicher und fülzrc nicht zu<br />
jener befriedigenden Ilarmoizie, die das Ziel jccler philosophischen<br />
Untersuchung sein sollte.<br />
Eingehender sprach er sich in seinem „System der Ästhetik", dessen<br />
erster und einziger Band 1790 erschien, über seine Absichten aus. Ei<br />
wollte kein Kompendium fiir akademische Vorträge, auch lrein System<br />
blois für Pliilosophen von Profession liefern, sondern eine Theorie der<br />
sclzöneii Künste, lesbar und genieisbar für jeden, dem die Natur zugleich<br />
die schöne Gabe der Empfindsamkeit und Geist des Denlrcizs verlieh.<br />
Deshalb habe er, so erklärte er, nicht den „bei den1 groiseii Haufen der<br />
cleutscheii LiTeltweiseii so beliebten" mageren Paragrapheiistil gewählt,<br />
auch nicht die aus dcir Zeughäusern der alten Philosophie entlehnte,<br />
bei gewissen deutschen Philosophen so beliebte, terminologische Rüstung<br />
angctan; seinem Zwecke schien passender cler „sclz~verere, aber<br />
auch gewiss angciielmere und ~virlrsamere Stil ciiier freien Betrachtung,<br />
welcher deii Geist des Verfassers in der iiinercn EIanclluiig seiner voir<br />
lebhaftein Interesse gcleitetcn Idccneiitwiclclurig darstellt". Was anderwärts<br />
nur lrurz berührt worcleii, clie Notweizcliglieit allgemein gültiger<br />
Prinzipien der Ästhetik, die Möglichl~eit derselbei~, die Begriffe cler<br />
Künstc selbst, das will er bchandeln. Das TVeseii der Ton- und Tanzlruiist<br />
wird eiiigeliend crörtcrt, bcsoizclers stolz ist er auf seine durch<br />
langes aiistrengcndes Nachdenken gewoiiiieize begriffliche Entmicklung<br />
der Dichtkunst, der die siebcnte Betrachtung mit umfangreichen<br />
Eslrurseiz gc~vicliliet wird. Mit Stolz hcbt er seine Übercinstiinmung mit<br />
Kant, aber auch die Selbständiglreit seiner Gedanken ihm gegenüber<br />
hervor, die er bereits seit mehreren Jahren vor seinen Zuhörern entxvickelt<br />
habe.26)<br />
Drei Jahre später bot er niit seinem „ästhetischen Wörterbuche<br />
iibei die bildenden Iiiin~te",~~) einer Übersetzung oder vielmehr Über-<br />
arbeitung des französischen Werkes voi), Watelet und Levesque breiten<br />
L<br />
lireiscii ciri Hilf smitt zur Einführung iii dieGeschichte undGesetze der<br />
Kunst. Er liob hervor, daCs die neucsten Forschungen der berühmtesten<br />
cleutsclicn ;istethiker gewissenhaft benutzt, namentlich „die so origi-<br />
nelle Theorie des Schönen von Herrn Kant gehörigeiz Orts angefülirt<br />
und entwickelt" werde. Beim Übersetzen hatte er sich püiilrtliche Treue<br />
zum unverbrüchlichen Gese-lze gemacht. Sie erschicn ihm angcsichts<br />
der Armut und der Schwierigkeiten der deutschen Kunstsprache unbe-<br />
dingt nötig. Er schickte eine „Einleitung übcr das Wesen der schönen<br />
bildenden Künste('2s) voraus, lieis nur wenige Artikel übcr ncbensäch-<br />
liche Gegenstände wegfallen, schob dagegen zahlreiche neue ein, z. B.<br />
26) J. H. Abicht und F. G. Born, Neues Magazin. 1. Bandes 1. Stuclr,<br />
S. XXXVI. Anmerkung.<br />
27) 4 BLnde. 1793ff. Leipzig.<br />
2s) Bd. 1, X. XVII-XXXII.
I'iarl Heinrich Heydenreich als Universitßtslehrer und Kunsterzieher. 191<br />
übcr Kircheiimalerei, Kritik des Geschmacks, Kolorit, Baumschlag, und<br />
erxveitcrte eiiie Reihe Artikel, z. B. Geschiaclc, Kunst, Naiv, Schön,<br />
durch umfangreiche Ergäizzuiigeil. In den1 Artikel „ErhabcnL' erklärte<br />
er ausdrücklich, dais dic Ausfiihrungen Watelets in der französischeiz<br />
Ausgabe, die von Bfengs und Reiiihold unter der Rubrik „Stil" so dürftig<br />
seieil, dals eine liurze Betrachtung dieses Gegenstandes sowohl im allgeineineii,<br />
als iii Bezieiiung auf die bildende Kunst wiiilschenswert erscheine,<br />
und lieis eine Darstelluiig von 10 Seiten folgen.2" Ebenso wies<br />
cler Artikel „SchuleL', cler auf niehr als 100 Seiten einen Abriis cler<br />
Kunstgeschichte gibt, inaiiche Ergäiizuiigeii im Interesse der fibersichtlichkeit<br />
auf .30)<br />
In seiiiern „Philosopliischeii Tascheiibuclie" behai~delte Heydeilreicli<br />
mehrfach ästhetische Fragen, so in den1 Aufsatz31) ,,Über den Einfluis<br />
tler Gefühle, welche die Szenen der Natur im Hcrbste erregen, auf Sittlichkeit<br />
und Religiosität". Auch sonst wird der enge Zusammenhang<br />
zwisclieil ICuiist und Religion mehrfach bet0nt.~2) Für die Berücksichtigung<br />
clerasthetik in der Jugenderziehung trat er mitEifer ein. Er schlois<br />
sich clainit einer Bewegung an, die in den letzten Jahrzehnten manche<br />
beachtliche Erschciniiiig gezeitigt hatte. Seit dem Jahre 1764 erschienen<br />
in Leipzig3" und B~eslau die „Briefe zur Bildung des Geschmaclis an<br />
ciileii jnilgeii Herrn von Stande" in sechs Teilen und erlebten kaum ein<br />
Jahrzehnt später eiiie neue Auflage. Der EIerausgeber, Johann Jakob<br />
begründete clas Unternehmen damit, dais die ilusbilduilg des<br />
Geschmacks iii den Schulen vernachlässigt und meist dem eigenen<br />
Fleiise der Jugend überlassen würde; „ich weiis nicht, ob aus Bequemlichkeit<br />
oder aus Mangel an feiner Kenntnis und Geschmack. Vielleicht<br />
oft geilug aus beideii: denn die Lehrer sind nur selten, welche die Grundsatze<br />
der schönen Wissenschaften wohl studiert und Belesenheit genug<br />
habeii, sich über die Dichter von mehr als einer Nation auszubreiten,<br />
ihre Genies und ihre Werke von gleicher Art zusanimenzufassen, eine<br />
allgemeine Geschichte der schönen Wissenschaften mit der Kritik übcr<br />
ihre Werke und mit dem Vortrage der Grundsatze zu verbinden, und so<br />
zugleich das Gcclächtilis mit mannigfaltigen Schätzen von einer Art zu<br />
bereichern, das Urteil zu bessern und deil Geschmack zu polieren. Viele,<br />
die ihre gaiize tote Gelehrsanlkeit in Athen und Roin gesammelt habeii,<br />
vergessen, nlit einer groisartigen Verachtung aller aildereii fremden und<br />
einheimische11 Schätze, dais auf mehr Boden als blois auf dem lclassischen<br />
Grunde, wie sich Addison aiisdriiclct, vortreffliche Früclitc gewachsen<br />
sind: sie sehen Baum, was in ihrcr Nähe wächst, uiicl vergcsseri,<br />
--<br />
29) Bd. 2, S. 137-147.<br />
30) Bd. 4, S. 81-189<br />
31) <strong>Philosophische</strong>s Taschenbuch für denkende Gottesverelirer. 1. Jahrgang,<br />
S. 40- 66. Leipzig, bei Gottfried Martini. 1796.<br />
32) Ästhetisches Wörterbuch. 2. Bd., S. 695.<br />
33) Verlag von Johann Ernst Meyer.<br />
34) Die Zeitschrift erschien anonym. Dais Dusch der Herausgeber ist,<br />
ergibt sich aus dem TI. Rriefe des 3. Teiles, wo Dusclis Versuch von der Vernunft<br />
.von einer andern Hand" besprochen wird.
192 Kar1 Heinrich Heydenreich als Universitätslehrer und Kunsterzieher.<br />
clais in ihrem Lande eiii Iilopstocl~, ein IIaller, eiii Icrainer, ein Gellert,<br />
ein Schlegel, ein Zacliariit, ein Wielaiid, ein Gleiin geschrieben haben:<br />
lraum kennen sie diese Namen.. . . Gewiis ist es nicht zu viel, wenn icli<br />
behaupte, dais unter hundert Jünglingen iiicht einer die Schule und<br />
selbst die Universität verläist, dessen Gcschmaclr nicht verdorben oder<br />
wenigstens verwahrloset sei."3s) In 125 Briefen wird die nruere deuJsehe,<br />
fraiizösische, englische und italienische, auch die antil
Kar1 Heinrich Heydenreich als Universit'itslehrer und Kunsterzieher. 193<br />
des Stils und die Berichtigung des Gcsclz~naclis verbunden m~erclen. „Es<br />
ist klar, dal's wir mit deutschen Schriftstellern anfangen inüssrn; zudein<br />
da unser Jahrhundert glücklich genug ist, vortreffliche Muster in clieser<br />
Art ZU haben."") Keben deil Fabeldiclitern Gellert und Lichtwer solle11<br />
Prosaiker, wie Rabener, auch gut gescliriebeize Kombdieii uiid Tragödien<br />
gelescii werden. „Der junge Mensclz niufs nicht viele Biicher ge-<br />
schwinde durclilaufeiz, sondern wenige mit Bedacht lesen. Er wird an-<br />
gehalten, von dein, was er gelesen, Rechenschaft zu geben; man stellt<br />
Betrachtungen dariiber an; man macht ihn auf den Ausdruck, auf die<br />
Verbindung desselben, auf die glucklicheii Wenduiigen aufmerlisam uiitl<br />
gewöhnt ihn nach und nach seine Gedanken über dieselben 3Iatericiz<br />
selbst aufzuzeichnen und durch die Vergleichuiig mit eiizein guten<br />
Schriftsteller zu lernen, was bei diesem die Anmut uiid bei ihm das Uii-<br />
angenehme ausinaclic."<br />
Beachtenswerte Winlie werden für eine geistvolle Behanclluiig der<br />
antiken Schriftsteller geg~bciz.~~) „Nichts ist lacherlicher als der gewöhnliche<br />
Begriff, den man sich von den lilassischen Schriftstellern<br />
macht. Man hält sie für alte, armselige, verachtete Sehulfüchse: gleichsam<br />
als mreniz llanizer, die a11 der Spitze cler Arineeii die lierrlichsten<br />
Siege erfochten, in dem Schulstaube unter den geriizgschiitzigstei~ Aibeiteii<br />
lieruingel
Karl Heinrich Heydenreich als Universit&tslehrer und Knnsterzieher. 195<br />
zielicr gar nicht ausreicht, wenn er in der wirlilicheii Welt an die Indivicluen<br />
lronnnt. Iin höchsten läclierlich ist es, wenn auf gewissen Akademien<br />
zwanzigjährige Jünglinge, clie sich soeben das Recht zu lehren, durch<br />
eine Disputation viiidiciert hatten, sogleiclz Vorlesungen über Pädagogik<br />
ai~kündigeii."~~) Wie den Dozenten die Erfahrung mangle, so<br />
noch inehr den Studenten, die nun das Amt eines Erziehers in einer<br />
Familie übernehmen sollten. Töricht aber sei es, die praktische Ausbildung<br />
bis zur Übernahme des Erzieheramtes zu verschieben. Bezüglich<br />
des TJiiterrichts wie der sittlichen Entwicklung würden die ersten<br />
Kinder, die solch einem unerfahrenen Erzieher anvertraut wiaren, die<br />
traurigen Opfer der Unerfahrenheit ihres Lehrers, ähnlich den Kranken,<br />
aiii denen juiige, nur theoretisch gebildete Arzte ihre ersten Versuche<br />
wagten. „Wieviel Zeit haben die ECinder während dieser Zeit verloren<br />
und wieviel Zeit muis nun wieder aufgewendet werden, um die neuere<br />
llethode einzuführen i~nd ihnen bei den Kindern Eingang zu verschaffen.<br />
Tinverantwortlich ist es von den Eltern, wenn sie die Privaterziehung<br />
ilirer ICiiider jungen Gelehrten anvertrauen, welclie nur eben die Uriiversitiit<br />
verlassen liabeii oder wohl noch dic alraclemischen Hörsäle besuchen,<br />
unverantwortlich von den Hofineisterprokuratoren, wenn sic<br />
Familien solche unreife Subjekte vorschlagen. Mögen sie auch gute<br />
Schul- und akademische Kenntnis besitzen, fiir das groise Geschäft der<br />
Privaterzieliuiig sind sia noch nicht reif, lrönneii es auch nicht<br />
Ebenso scharf ist IIcydeiireichs Urteil über die öffentlichen lateinischeil<br />
Schiileii. Er richtet sich gegen die „Peclaiiten, welche uns<br />
glauben machen wollen, es werde in öffentlichen Schulanstalten eine<br />
volllrommenere iind sichere Bildung bewirkt, als sie durch einen Lehrer<br />
erreicht würde, welchein Eltern in der Mitte ihres häuslichen Zirkels<br />
selbst ihre Kinder anvertraiieii, Pedanten, welche nur zu gern jedermann<br />
überreden möchten, es seien sclilechterdings Katheder und eine<br />
ansehnliche Xenge perriikierter Mäniier von Jahren nötig, um, dem alten<br />
ildanl zuin Trotze, clie jungen Bürger der Welt auf dem Wege der Weisheit<br />
uiicl Tugend zu lciteii. Diese Menscherrlrlasse sieht in einem Hofineister<br />
ein sehr überflüssiges oder doch unbedeutendes Wesen, eine Art<br />
von Haustier, welches clen bcquemen und reichen Eltern die lästige<br />
Pflicht, für die Kultur ilirer liinder selbst zu sorgen, von eigner Not<br />
gedruiigeii, abnimmt, oder wohl gar ein Pruiikgeschöpf, mit welchen1<br />
die Eitelkeit der Familie Stolz macht, und welchem nur eine stattliche<br />
Livree fehlt, um für den ersten Domestiquen des Hauses gehalten zu<br />
.~verdeil. Sie schildern die öffentlichen Anstalten als Kolosse, welchc<br />
die Menschheit vor dem Rückfalle in die Barbarei sichern, und allein<br />
noch bei der sich imnier weiter und weiter verbreitenden Unwissenheit<br />
und Sitteiiverderbnis, Aufklärung und nioralische Vollkommenheit<br />
~nterhalteii."~~)<br />
In breiter Ausführlichkeit ui~cl lebendiger Darstellung wendet er<br />
sich gegen die Überschätzi~n~ und den Betrieb der alten Sprachen,<br />
48) Der Privaterzieher. I, S. 37. - 49) Ebenda. I, 8. 40. -- 50) Ebenda. I, S. 3.<br />
13"
196 Iiarl Heinrich Heydenreich als Uni~~ersitiitslehrer und Kunsterzieher.<br />
gegen die Forderung ihrer grüiidlicheii uiid ausgebreiteten Iieiiiltiiis,<br />
eines sicheren Vcrstäildiiisses der griechischen und römischeil Autorpii.<br />
So sehr er die antike Literatur iii ihrer Bedeutuiig schätzt, so bedauert<br />
er doch, dal's die Keniltilis der lateinischeil und griechischen Spraclie<br />
eine Bedinguilg geworden ist, den1 Staate in öffentlicheil ,iinteril nütz-<br />
lich zu werden, und erblickt clarin eine Schätzung des Fortschritts cler<br />
SVissciischaften. Gegenüber der herrschendeii Unlrlarlieit fordert cr<br />
eine genaue Uiiterscheiduilg ihrer Eedeutuiig iiach Inhalt und Form.<br />
Ersterer lasse sich iil jeder modernen Sprache so wiedergeben, clais<br />
inan, Kleinigkeiten abgerechnet, das Origiiial nicht nötig habe. Letztere<br />
würde, wenn sie lrlassiscli sei, von iiiemaiideni durch Nachahinuilg cr-<br />
reicht. „Und was gewinnt die Welt und der Staat daclurcli, dais ein<br />
Eriiesti den Cicero, ein anderer den Seiieca, ein aiiderer den Tacitub<br />
kopiert?" Gegenüber clcr Forderung, man nzüsse Hoincr nrid Vergil iil<br />
cler Ursprache lesen, uni so durch sie, wie einst Griechen und 12önier,<br />
begeistert zu werden, ruft er aus : „Welche uiibegreiflicho TTerblciidung !<br />
Eine ausgestorbene Sprache ist allezeit ein toter Körper, von dcssen<br />
feuriger Lcbenskraft inan nur noch matte Ren~iiiiszenzeii hat. Die<br />
EIauptbedeutungen der Wörter können gerettet iiiicl erhalten werdeii;<br />
aber uneiidlich viele feine Bestiiiimiingen und Unt~rscliiede, uiieiidicli<br />
viele Assoziationen, von deiieii Stärke und Kraft derselbeil abhängt,<br />
gehen verloren und köiineil durch keine Grübelei der sogenannteil Philo-<br />
logen wieder zurücligerufeii werden. Iii cleu Wörtcrii aller Spracheil<br />
ist etwas Unneiiiibares, welchcs in eiiler Masse geclrii~gter clunlrler<br />
Vorstellungen besteht, sich li-auin zum Teil entwickeln liist, wenn die<br />
Sprache nacli lebt, aber bciilahe gar nicht, weilii sie aiisgestorbeil iyt.<br />
Was z.B.der Grieche bei dem Worte xcr;?onxayw$f.oc dachte und fiihlte.sind<br />
wir nicht filiig, in seinem gaiizeil Uinfange nachzueinpfindeii. Diese<br />
Bemerlrung entscheidet vorzüglich über unsere Eiiibildung, alte Dichter<br />
zu penetrieren, welche die lächcrlichste von cler Welt ist; cleini gerade<br />
die dichterischen Ausdrücke sterbe11 in einer ausstcrbeiideir Aussprache<br />
den tiefsten und uiierwecklichsten Tod.''51) Gegenüber clcr Eiiibilclung,<br />
als ob der Schülcr unmittelbar mit Cicero oder Seiieca rede, cmi,fielilt<br />
er die Benutzung guter Übersetzniigcn, welche bereits von groiseii<br />
Xannern öffentlich ausgestellt sind. „TVeiii~ nach einem ailgestrengtcii<br />
Fleifse vieler Jahre eiii Garve den Cicero voii clen Pflicliteii, ein<br />
Gediclre den Pindar, ein Vois den Homer, ein Rode den Vitruv übersetzt,<br />
darf ein Jüngling oder wohl gar eiii Knabe hoffen, clais er diese Schrift-<br />
steller iii Gedanke11 besser iibersctzcn wird, wenii er sie einmal gelesen<br />
hat? Wic nun, wenn ich zu eiiiein jungeil Maiinc, welcher das Eiiglische<br />
exponieren kann, sagen wollte: „Lesen Sie den Shakespeare nicht in<br />
Eschenburgs oder Schlegels Übersetzung, lesen Sie ihn i111 Origiiial!"<br />
Das Ergebnis ist: „Weiiii juiige Personen iiicht d,urch die Verhältnisse<br />
ilirer Bestimmung für eine gewisse Art voii Autoren gezwuiigeil siiid,<br />
sich eine weiiigstens superfizielle Kenntnis der alten ilutoren in ihrer<br />
51) Der Privaterzieher. I, S. 69.
Kar1 IIeinricli Heydenreich als Universitätslehrer und Kunsterzieher. 197<br />
Originalsprache zu erwerben, wenn ihre Lagc es ihnen nicht zuläist,<br />
dir viel Zeit auf ein gründliches Studium derselben zu verwenden, oder<br />
wenn sie, obwohl ihnen, keine I'lindernisse im Wege stehen, dieses<br />
dennoch nicht wollen, so mögen sie lieber auf die Vertrautheit mit den<br />
alten Sprachen ganz Verzicht leisten, und die Zeit, welche durch oberfläcllliche<br />
Übungen dariiz verloren würde, zu aützlichereii Zweclren verweilden.<br />
Ich bin vollkommei~ überzeugt, dais ein anhaltendes, mit<br />
Kritik und philosophischem Geiste betriebenes Studium der lrlassischen<br />
Griechen und Römer ein durch nichts zu ersetzendes Xittel der Kultur<br />
des Geschmacks ist. Allein so flüchtige, geistlose und schlendrianische<br />
Beschiiftigung mit alten Autoren, wie sie unter unserer Jugend gewöhl~lich<br />
ist, hindert die Bildung eher, als dais sie dieselbe befördern<br />
sollte. Es heilst liier, um mich der Worte eines berühmten eilglischen<br />
Dichters zu bedieilen: „Trink deep or taste not", „Trink bis auf den<br />
Grund oder koste iiiclit." Sollte ich die vorzüglichsten Ursachen angeben,<br />
warum unter uilsereii Gelehrten gesunder Verstand und eine<br />
scliarfe, schnell treffend wirkende Urteilsliraft so seltene Talente sind,<br />
so würde ich nicht anstehen, jenes lirüpelhafte Studium der alten<br />
Klassiker mit aiizuführcn, bei welchem unendlich viel Zeit verschweiidet<br />
wird, ohne dais die Kräfte des Geistes dadurch so starlr und lebhaft bescliäftigt<br />
würden, wie es für ihre Ausbilduiig. nötig ist. Gewöhnlich<br />
exponiere11 die Zöglinge halb schlafend die alten Autoren und sind unfähig,<br />
wenn sie z. B. Xenophoils Cyropädie durchgearbeitet haben, eine<br />
nur irgend bcfriedigeiide Rechenschaft von dem Geiste des Werkes zii<br />
gebeil."j2) So verlangt FIeydenrcich von denen, die Privaterzieher<br />
werden wollen, nur, dais sie soweit mit den alteii Sprachen bekannt sind,<br />
uin illre Zöglinge zu eiiiem grüildlicl~eil uiid geschmaclir~ollen Studium<br />
derselben vorzubereitcil; ihre IIauptstirke brauchen „die sogenannten<br />
H~iinanioreil" nicht zu sein.<br />
Wo solleil null die Erzieher der höhere11 Stande illre praktische<br />
i~adagogische Vorbilclung erlangen? Er fordert in Verbindung mit der<br />
Ciiiversität53) eil1 Seiniilar, eine Bildungsanstalt für künftige Hof -<br />
ii~eister, in welcher jungen Gelehrten, welche die akademischen Studien<br />
rollendet haben und in die Sphäre der Privaterziehung übergehen<br />
~~ollen, der Mangel au Erfahrung uiid Beobachtung insoweit durch<br />
mailnigfaltige Ubungen des Geistes ersetzt wird, dais sie ihre Laufbahn<br />
init Würde und der sicheren Aussicht betreten können, dais sie als Hofineister<br />
den gerechten Anforclerungeii der Familie Genügc leisteil,<br />
welche ihiien ihre Kiiider anvertra~t.~~) Geleitet wird dieses pädagogische<br />
Seminar von drei, durch praktische Erfahrung5s) und wisseiischaftliche<br />
Tüchtigkeit ausgezeichnete Direktoren, von deiieii einer dcii<br />
Unterricht in den IZüiisten und Wissenschaftei~, ein anderer dic Cliaraliterbildung<br />
uncl die für küilftige I'lofmeister besoilders nötige Lebens-<br />
52) Der Privaterzieher. I, S. Glff. - 53) Ebenda. I, S. 71. - 54) Ebenda.<br />
I, S. 41.<br />
55) Eine eingehende Char'dcteristik, der Erfahrung findet sich Bd. 1, S. 71E.
198 Kar1 Heinrich He~denreich als UniversitLtslehrer und Kunsterzieher.<br />
klugheit, ein dritter die Ausbildung des Gescliinaclrs und Stils ubcr-<br />
Eur solche werden als Mitglieder aufgenommen, die Cliarakterfeistigkeit<br />
und feines, sittliches Gefühl zeigen ; den Beruf „aus<br />
wahrem Eifer für Menschenbildung, aus enth~isiastischeni Bestreben<br />
ergreifen, die Volllrommenheit und Glüclrseligkeit unter unserer Gattung,<br />
soviel es in ihreii Kräften steht, zu erhöhen";") dazu die encylrlopädische<br />
Kenntnis aller Wissenschafteil und Künste erworben, ihre<br />
Universitatsstudieii abgeschlossen haben, mit der Psychologie, der<br />
praktischen Logik, den inoralischen Wissenscliaften, der natürliclicii<br />
Religion, der Kritik des Geschmacks, der Theorie des Stils uiid den<br />
allgemeinen Grundsatzen der Pädagogik vertraut siiid. Eiitspreelieiid<br />
ihrem Alter2 ihrer Vorbildung und ilirer Reife sind die Xitglieder<br />
keinem äuiseren Zwange unterworfen; sie bilden eine freie Vereinigung<br />
der wissenscliaftlich und sittlich Tüclitigsteii, die begeistert füy ilirc<br />
praktische Ausbiiduiig als künftige Erzieher in angesehenen Fainilieii<br />
arbeiten. Eine Uiiterordiiuiig findet nur insoweit statt, als eine auf<br />
Kenntnissen, Erfahrung uiid Verclieiisteii bcgrüiidete Überlegenlieit von<br />
jedem vernünftigeii Menschen aiicrkaniit wird.<br />
Die finanzielle Frage wird nur kurz gestreift. I-Ieydenreich weils<br />
recht wohl, dais die Anstalt nicht geringe Mittel zur Begründung und<br />
Unterhaltung nötig hat. Er hilft sich mit zwei rhetorischeil Fragen:<br />
Sollten die Fürstcii ihr nalircs Iiitercsse so wenig verstehen, um iziclit<br />
gern den Grund zu legen? Sollten die reichen Biirger so wenig Patriotism<br />
und Gemciiigeist besitzen, dais sie iiielit, unaufgefordert, Eeiträge<br />
dazu liefertenSi8)<br />
Über den Lehrbetrieb in der Anstalt ~~crcleii eiiigeheiide Anweisungen<br />
gegeben. Jedes Xitglied verpflichtet sich, dem Icursus, der<br />
einen lehrplaiiniäisigen Kreis von Besprechuiigeii uiid Ubuilgen unifalst,<br />
bis zum Ende beizuwohiien. Zunächst wird das Erzichuilgszicl<br />
festgestcllt. Dies ist uin so nötiger, als die Eltern darüber oft iiu iiiiklaren<br />
siiid, wie ihre Anforderungen beweisen. Da wird verlangt, „vor<br />
allem volllroinmeil französisch, momöglieli auch italieiiiscli, vollliominen<br />
Musik, Fähigkeit im Zeichnen und dann natürlicli alle gelehrten K~iiiitnisse,<br />
welche zu einem EIofmeister gehören. Sagten doch solche Meiischell<br />
lieber gerade heraus: ich suche einen Windbeutel, der alles uncl<br />
nichts weiis, für meine Kinder." Dem gegenüber wird als Aufgabe des<br />
IIofmeisters bezeichnet: er muis einen zweclrii~iiisigeii eiicylrlopadischcii<br />
Unterricht crteilen; er muCs die Begabung der Zöglinge prüfen; er<br />
niuis jedem den passendsten Uilterricht in derjenigen Wissenschaft:<br />
oder Kunst geben Irönnen, für welche er eine vorzügliclie Anlage hat,<br />
und zwar so weit, als es nötig ist, um den höheren Unterricht auf Akademien<br />
dcr Wissenschaften, der Iiunst und der IIaiidlung, sowie bei<br />
erfahrenen Vertretern der prnlrtisclieir Bcrufuarteil mit Nutzen zu<br />
f assei~.~~)<br />
56) Der Privaterzieher. I, S. 66. - 57) Ebenda. I, X. 44. - 68) Ebenda.<br />
I, S. 60. - 59) Ebenda. I, S. 101.
Kar1 I-Ieinrich Heydenreich als Universitatslelirer und Kunsterzieher. 199<br />
Voll besonderem Interesse ist für uns heute, wo clie Kunsterziehung<br />
die Geister beschäftigt, der Abschnitt „Funktionell des Direktors der<br />
Übungen für Gescllmaclr und Stil."G0) I-Tat I-Ieydenreiclz ihn auch nicht<br />
selbst ~~ollciiden lrönnen, weil ihm der Tod die Feder aus der Hand nahin,<br />
so stimmen die vorgetragenen Anschauungen mit dciz von ihm sonst<br />
entwiclrelteii Gedanken vielfach nach .Inlialt und Form übcrciii. Bittcr<br />
beklagt wird die grobe Vernachlässigung der ästhetischen Bilclung in<br />
Deutschlaiid, bezüglicli deren alles dem Zufall überlassciz bleibe. Die<br />
:~sthetisclze Erzicliung stelle hinter der intellelrtuelleii und moralischciz<br />
noch auffallend zurück. Daher trcffc man uilter den Deutschen „bei so<br />
vielem Genie so viel Gesclnnaclrlosiglreit und selbst so viel Rohcit des<br />
Geschmacks". Weit entfernt davon, die Bsthetische Erziehung als<br />
einen weseiltlicheil Bestandteil der Bildung anzusehen, habe man noch<br />
weniger aii eine bestilnrnte Organisation von Grundsätzen in bestimiiiter<br />
Stufenfolge und in der Einheit einer allseitigen ästhetischen Bildung<br />
gedacht, iiur in wenigen Schulen werde die letztere berüclrsichtigt. „Ist<br />
doch sogar noch die Lektüre klassischer Werke unserer Nation in1 Gebiete<br />
de~ Sclzöi~ei~ und des Geschinaclrs aus unsereil Erziehungsanstalten<br />
für die höheren Stände und selbst für lrünftige Gelehrte vcrbannt."<br />
Man glaube, Werke in der Nuttersprache bedürften keines Studiums,<br />
keiner Erlrläruilg, keiner mcthodischeri Lektüre. „Darf man sich noch<br />
wundern, wenn man bei dcm groiscn EIaufen unserer sogei~annten gebildetai<br />
Stände auch iiur ein solches rohes Naturbedürfnis EU leseii<br />
findet, und dass keine, am wenigsten eine auf Einsicht in clie Vortrefflichkeit<br />
derselben gegründete Liebe, kein reger uiid aufgeklärter Entliusiasrnus<br />
der groisen Nehrheit der kultivierten Stände für unsere groisen<br />
Schriftsteller herrscht? Freilich wäre es ain besten, wenn die Bildung<br />
des Geschmacks Nationalangelegenheit würde, wenn von dem Staate,<br />
wie bei den Nationen der T'orwelt, eiric ästhetische Bildung seiner<br />
Bürger begrüiiclet und durch öffentliclie Einrichtungen gesichert würclc."<br />
Solange das nicht der Fall ist, solleii einzelne Individuen, soll die soiist<br />
so tätige, tlieoretische und praktische Erziehung das Ihre tun, und auch<br />
cr will dazu durch Behandlung des noch wcnig bearbeiteten Gebietes<br />
beitragen.<br />
Nach vier Seiten soll sich die ästhetische Bildung erstreclreil. Sie<br />
soll sich bezieheil 1. auf asthetisclien Unterricht, 2. auf praktisch-ästhetische<br />
I
200 Rar1 Heinrich Heydenreich als Universitätslehrer und Kiinsterzieher.<br />
Gewöhnliche sei. Da das Zeitalter iil Kunst uild Geschmack groise<br />
Fortschritte gemacht habe, so sei „eigene ästhetische Kultur dem Privat-<br />
erzieher unerlälsliches Bedürfiiis". Der Leiter der Übungen soll dann<br />
die Frage beiantworten lassen, was dem Privaterzieher in Beziehung auf<br />
clie ästhetische Bildung der Jugend alles zu leisten obliege, urid welcheil<br />
Einfluis die ästhetische Bildung überhaupt auf den Menschen habe.<br />
Eingehend werden darauf beide Punkte erörtert und durch eine Reihe<br />
pralitischer Anweisungen im Geiste der Zeit erläutert.<br />
Was Heydenreich erstrebte, ist zunäclist unausgeführt geblieben.<br />
Dic in jener Zeit iii Leipzig bestehcndeii uiid neu entstehenden pädago-<br />
gischen Seminare vertraten andere Ziele und IhIethodeil. Einer späteren<br />
Zeit war es vorbehalten, seine Gedailken, wenn auch in wesentiich<br />
anderer Gestalt, zur Ausfuhrung zu bringeil, und damit die allgemeinen<br />
und groisen Wirkungen vorzubereiten, die sich Heydenreich von dem<br />
Einflusse der deutschen Kunst auf die deutsche Nation ~ersprach.~~)<br />
61) System der Ästhetik. 1. Bd., S. XXXIII.
Simone Corleo.<br />
Von<br />
Dr. Francesco Orestano, Rom.<br />
irnone Corleo wurde zu Salemi (Sizilien) am 2. September 1823<br />
geboren. Sein Vater, Gaetano, ein Arzt, starb bercits 1833.<br />
Von seiner Mutter, Antoniiia Olivkri, einer tüchtigen, hoch-<br />
begabten Frau, angeregt und geleitet, inachte der junge Simoile<br />
seine ersten Studicil auf dem Jesuiten-Kollegium in Salemi und später<br />
auf dem Geistlichen Seminar in Mazzara del Vallo. 1842 bezog er<br />
die medizinische Fakultät der Universität Palermo und wurde 1848 Arzt.<br />
Seben Fachstudien trieb er eifrig Mathematilr und Philosophie. Obwohl<br />
ron pekuniären Schwierigkeiten bedrängt (er mufste als ältester Sohil<br />
für den Unterhalt der Familie und die Ausbildung von vier Geschwistern<br />
sorgen), wuiste er doch stets neben der praktischen Tätigkeit die Ent-<br />
wiclclung seiner höheren wissenschaftlichen, philosophischen und dichte-<br />
rischen Anlagen weiter auszugestalten. 1844 erschienen in Palermo seine<br />
Xeditazioni filosofiche, und zur selben Zeit verfaiste er<br />
mehrere Tragödien im Sinne und Stil von Alfieri, unter dcnen<br />
Ilvespro siciliano und Tiberio Graeco zu erwahnen<br />
sind. Zur Lehrtätiglceit geneigt, wurde er 1846, obwohl er noch<br />
Student der Nedizin war, Lehrer der Philosophie und des Natur-<br />
rechts, später der Mathematik an dein Seminar von Mazzara del Vallo.<br />
Die Revolution des Jahres 1848 bewegte ihn sehr, und er schrieb damals<br />
seinen Entwurf einer gerechtcn sizilianischen Ver-<br />
f a s s u n g , die in Palermo in demselbeil Jahre erschien. Er zcichnetc<br />
sich durch fein politischen Sinn und vaterländische Begeisterung aus.<br />
1852 verlieh er seine Stellung in Nazzara und ging nach Palermo, wo er<br />
bis 1854 auf den Kollegien Vi-ttoriilo und Stesicoro dozierte. 1855 ver-<br />
mählte er sich in Mazzara init Antonictta EIopps, aus englischer Familie<br />
stammend, praktizierte nunmehr als Arzt, unterliefs dabei aber nicht, dic<br />
in der Praxis gesammelten medizinischen Erfahrungen weiteren Fach-
202 Simone Corleo.<br />
kreisen zugaiiglich zu machen. Sich ganz zur Philosophie hiiigezogeil<br />
fühlend, begann er nunmehr den Plan eines eigenen philosophischen<br />
Systems fertigzustellen und Stück um Stück auszuführeii. Seine Studieii<br />
über die Imponderabilia, im Jahre 1852, und die Unter-<br />
suchungen über die Innervation, im Jahre 1851 iil Palermo<br />
veröffentlicht, sind eine plaiiniäisige, gewaltige Propädeiitik zu jeiler<br />
P h i 1 o s o p h i a u n i v e r s a 1 i s , auf die er seit Beginn seiiier philo-<br />
sophischen Bestrebungen hinzielte. Das Jahr des Einheits- und Frei-<br />
heitskrieges fand ihn eben mit dein ersten Rand seiner F i 1 o s o f i a<br />
u ii i v e r s a 1 e beschäftigt, welcher 1860 in Palerino gcdruckt wurde;<br />
trotzdeni aber nahm er groiseii Anteil aii der politischen Bewegung,<br />
indem er ein Komitee in Salemi leitete, das in diesen höchst gefährlicheil<br />
Tagen gegen die Untaten des 4. April protestierte und den Feldzug Gari-<br />
baldis energisch unterstützte. Zur Anerkennung seiiier Verdienste wurde<br />
Corleo von Garibaldi zum Gouverneur von Salemi crnannt und voll<br />
seinen Mitbürgern zum Abgeordneten des ersten italienischen Parla-<br />
ments gewählt (1861 bis 1864). Sizilien verdankt ihm das Gesetz über<br />
di~ Erbpacht VOIZ kirchlichen Lehngüterii, mit desseii Vollziehung er<br />
selbst als allgeineiner Oberaufseher beauftragt wurde. In diesem Ehrenamt<br />
arbeitete er fleiisig zehi Jahre hindurch, in der Philosophie iiizwischen<br />
tätiger als je sich zeigend. 1862 las er an der Universität<br />
Palermo Geschichte der Philosophie; 1863 volleiidete er seine F i 1 o -<br />
sof,ia universale und erwarb sich durch die Thesis: ~ b ereela- r<br />
tive und absolute Pflichten die ordentliche Professur für<br />
Ethik an derselben Universität. Von jetzt an ciit~vickelte Corleo in philosophischer,<br />
akademischer und politischer Hinsicht eine ungeheure<br />
Tktigkeit. Er nahm das Leben ernst, wusste sich an den Tagesfragen<br />
rege zu beteiligen, daneben immer noch Zeit findend, seinen philosophischen<br />
Studien mit Eifer obzuliegeil. In der Erfülluiig seiner<br />
Pflichten war ei. immer auiserst fleil'sig und geiiau, vervielfiiltigtc<br />
diese sogar durch seine hohe Auffassung und Braftvolle Veratilaguiig.<br />
Wir finden ihn 1864 bis 1870 als Präses der philosophischen Fakultäi<br />
Palermo, 1882 wieder als Abgeordneten, 1884 bis 1885 als Rektor der<br />
Universität, imnier und vielseitig schriftstellerisch tätig. 1886 führte er<br />
als erster in Italien den experimentellen Unterricht der Psychophysik<br />
nebst Laboratoriuni in Palermo ein, 1890 gründete er eine Zeitschrift<br />
„La f ilosofia, Rassegna siciliaiia", die aber ein Jahrnach<br />
seinem Tode zu erscheinen aufhörte. Das Ende seines Lebens ist durch<br />
Ruhe, Wohlstand und Selbstzufriedenheit gekennzeichnet. Er war reich,<br />
lebte in glücklichen Familienverhältnissen, war allgemein beliebt, Mitglied<br />
von mehreren Akademien und durch hohe offizielle Ehrenbezeigungen<br />
ausgezeichnet. Als Erneste Renan 1873 dem XII. Kongress<br />
der Gelehrten in Palermo beiwohnte, hielt er eine ganze Rede zu Ehren<br />
von Corleo, indem er ihr1 mit groisen deutschen Philosophen, wie Herbart<br />
und anderen, verglich. Corleo soll, wie noch persönliche Erinncrungen<br />
bestätigen, eine faszinierende Persönlichkeit gewesen sein, was<br />
man in seinen Schriften, wegen des Übergewichts der rationellen
Simone Corleo. 203<br />
Strenge, weniger verspürt. Eigentliche Schüler bildete er nicht. Seiiie<br />
Kollegien wurden aber bis zu Ende von zahlreichem und hochgebildetem<br />
Publilcum besucht und regten Viele dauernd philosophisch an. Zu<br />
seinen I-Iörerii zählen mehrere bedeutende Persönlichkeiten, wie die zwei<br />
Unterrichtsminister Italiens, Nie016 Gallo und Vittorio Eniairuele<br />
Orlando, der Professor der Nationalökonomie Pietro Mereiida, der<br />
berühmte Rechtsanwalt Leonard Ruggieri und andere. Er starb ani<br />
1. März 1891 in Palermo an einer Lungenentzündung.<br />
Seine Schriften können wir dem Inhalt nach, wie folgt, eiiiteileii:<br />
<strong>Philosophische</strong> Schrif teil : Meditazioni filosofiche, Palermo 1844; Ri-<br />
cerche su la vera natura dei creduti fluidi jmponderabili, Palermo 1852;<br />
Ricerche sulla natura della iniieilrazioiie cois applicazioili fisiologiclre,<br />
patologiche e terapeutiche, Palermo 1857; Filosofia universale, 2. vol.,<br />
Palermo 1860-1863; I doveri temporanei hanno origine, forza obbliga-<br />
toria c durata dai doveri assoluti ovvero della necessitii del progresso iii<br />
filosofia morale, Palermo 1863; 11 priilcipio d'identith, il giudizio neces-<br />
sario e il giudizio empikico. I1 principio stesso d'idciititii, la sostanza<br />
e gli assoluti oiitologici, Memoria presentata al XI1 Congresso degli<br />
scienziati italiani in Palermo, 1875, stainpata in Atti, Roma 1879; 11<br />
sistema della filosofia universale owero la filosofia della ideiititii, Roma<br />
1879; Le abitudiiii iiitcllcttuali che derivairo da1 mctodo intuitivo, Pa-<br />
lermo 1880; Le coniuili origini dellc dottriiie filosofiche di Miceli, di<br />
Malebranche e di Spiiioza e loro coilfronto con quelle di Gioberti c di<br />
alcuii positivista rnoderno, in Atti della B. Academia di Scieiize, Lettere<br />
e Belle Arti di Palermo 1884 (Sitzung 29 giugno 1882) ; Le differenze tra<br />
la filosofia de117 identitii e l'odierno positivismo, in Rivista di filosofia<br />
scientifica. voi. VI, febbraro 1887; Spiritualitii e libertii in „La filosofia",<br />
vol. I, 2. fase. 1890; Lezioni di filosofia morale, 2. vol. (der zweite Band<br />
ist unvolleiidet geblieben, 200 Seiten sirid davon erschienen), Palermo<br />
1890-1891.<br />
Politische, juristische und öl
204 Simone Corleo<br />
diziaria in ltalia, in Rassegna di scienze sociali e pol., a. 11, fasc. XVI,<br />
Eirenze 1882; Sul riordinamento dell 'imposta fondiaria, da'selbst,<br />
Firenze 1883; L'attuale disegno di legge sul riordinamento delle tassc<br />
fondiarie, Firenze 1885; I1 parlamentarismo presente e il futuro, in<br />
Rassegna di SC. etc., Firenze 1885; Collegio plurinominale o uninomiilale?<br />
Come poter disciplinare i partiti, daselbst, Fircnze 1886; Modificazioni<br />
alla legge elettorale, daselbst, Firenze 188G; Le origini diverse<br />
del socialismo cristiano antico e del socialismo dottrinario odierno, in<br />
Rivista filos. scient., 1887; La politica ecclesiastica conveniente all'Italia,<br />
Eirenze 1867; I dazi di consumo nella presente crisi e la libera concorreiiza,<br />
Firenze 1889; La demoralizzazione delle tasse, Firenze 1889.<br />
Über pädagogische Fragen und Schulpolitik: Discorso per l'apertura<br />
delle ~cuole dello Stesicoro, Palermo 1852; Per la filosofia morale,<br />
ragioni con appendice in risposta al Prof. Raibaiidi, Palermo, senza<br />
anno; Orazionc per l'apertura degli sudi della R. Universita di Palermo,<br />
1564; Due lettere al Prof. Tommasi Crudcli sulla liberta dcll' insegnaineiito<br />
superiore, in Archivio di pedagogia, Palermo 1876; Sulla liberta<br />
dell' insegilamento superiore, Relazione al X Congresso di pedagogia,<br />
Palermo 1876; Sull' ordinamento della pubblica istruzione in Italia, Considerazioni<br />
e proposte, Palermo 1878; L'insegnamento elementare in<br />
Italia, mali e rimedi in Rassegna di SC. soc. e pol., Firenze 1882, e separat,<br />
Firenze 1884; Discorso sulla istruzione superiore alla Carnera dei<br />
Deputati, 26 e 27 novembre 1883, Roma 1883; I criteri per una leggc<br />
siilla istruzione superiore, Firenze 1888.<br />
Literarisches : Tragedie, seguite da discorsi politici e letterari (d. h.<br />
Discorso sui Gracchi, sul comunismo etc., e Discorso della tragedia<br />
italiana), Torino, 1861, 2. Aufl. Palermo 1869.<br />
Geschichtliches : Xlogio funebre di Re Vittorio Emanuele I1 (preiiiiato),<br />
Palermo 1878; Commemorazione di Giuliano Passalaqua, Palermo<br />
1878; Garibaldi e i Mille in Salemi, Roina 1886.<br />
Medizinisches (in Osservatorio mcdieo di Palermo) : Trasformazionc,<br />
raccorciamento e trasposizione di tutto il colon (vol. 111, fasc. 3),<br />
1855; Scorbuto al piti alto grado con produzioni encefaloidi e induriinento<br />
delle meningi e di tiitte le sierose, caso raro con osservazione<br />
necroscopica, 801. IV., fase. 6, 1856; Caso raro di convulsioni isteriche<br />
ed uso dell' elcttricitk, vol. VIII, fasc. 1, 1860; Dosi a cui si possono<br />
spingere i sali di chinina in alcune speciali fcbbri intermittenti<br />
~~01. XXI, fase. 3 e 4, 1873.<br />
Nachgelassene Schriften (noch nicht herausgegcben) : 1. Autobiografia;<br />
2. Perfezionamento della mcmoria ; 3. Colonie agricole come<br />
liioghi di beneficcnza e come luoghi di emenda; 4. Igicne delle grandi<br />
citta antiche e moderne; 5. Famiglia, Iavoro, pro~ricta; 6. Alimenti<br />
e condirnenti; 7. Dell' ufficio della stanipa; 8. Del matrimonio civilc<br />
e religioso; 9. Dell' amore coine fattore prccipuo di civilta; 10. Della<br />
rappresentanze delle minoranze; 11. Delle procedure elettorali; 12. Delle<br />
malattie per batteri e della canalizzazione; 13. Del colera e delle misurc<br />
igienichc ; und andere.
Simone Corleo. 205<br />
Über Corleo enthält die Zeitschrift „La filosofia" in Palerino iin<br />
zweiten Band mehrere kleine Arbeiten voii La Grassa, Beiizoiii, Eiirico<br />
Orestailo und Peilsabene Perez. Siehe ausseidem: Mareacci, Le opere<br />
inedico-filosofiche di Simoiie Corleo e il suo sisteina universale, Diseorso<br />
alla R. Accademia delle scienze mcdiche in Palermo, anno 1892; Gioja,<br />
Corleo e la sua filosofia morale, Palermo, Sandron, 1898. Die Schrifteii<br />
über Corleo werden sich aber mit der Zeit vermehren, da er vier Stipendien<br />
voii je zehntausend Lire hinterlassen hat, welche alle zclni J ahro<br />
solchen Arbeiten zuteil werden sollen, die nach dem aiigeiibliclilicheii<br />
Stande der Wissenschaft eine vollständige Bestätigung oder Widerlegung<br />
seiner philosophischen Grundansichten enthalten. Das erste<br />
Stipendium wird man 1912 aiisschreiben. Die Abhandlungeil sind italieniscll<br />
oder lateinisch zii verfassen. Die Nationalität des T'erfazsers<br />
kommt nicht in Betracht.<br />
Wollen wir nun mit lrurzen Worten einen Überblick über die Philosophie<br />
Corleos gewinnen, so ist zuizachst zu erwihilen, dais er an die<br />
Notn~endiglreit uild Uilverganglichkeit der Philosophie überhaupt glaubte<br />
und dieselbe nicht nur als Sanlmlerin wisseiischaftlicher Ergebnisse,<br />
sondern als Bcrichtigerin wissenschaftlicher Begriffe und in hohein<br />
Sinne als Führerin wissenschaftlicher Forscl-iuiig angesehen wissen<br />
wollte. Ähnlich wie IIerbart schrieb er der Philosophie das miderspruchslose<br />
Denken zu, welches aber nicht nur den theorrtisclieil, sonderii<br />
auch den praktischen Bedürfnissen gerecht werden soll (siehe Filosofia<br />
universale, Introduzione). Dadurch unterschied er sich von clen Positivisten,<br />
die er als naive Empiristen betrachtete, obwohl er mit illilep den<br />
Satz gemein hatte, dais jede Wissenschaft auf dem einzigen Griiiid clcr<br />
Beobachtung wachsen kann und darf (cbenda und bes. „Le difiercnzc<br />
tra la filosoiia dcll? identitk e l'odierno positivismo).<br />
Der Angelpunkt seiner Philosophie ist die Berichtigung des Suhstailzbegriffs<br />
unter der Leitung und der strengsten Ailweilcluilg dcs<br />
Satzes der Identität. Das eine kann nicht mehr sein oder werden, uilaktuelle<br />
Möglichlieitcn oder Vermögen besitzen, Wirkungen von auiseii<br />
empfangen und nach aulsen ausüben; es iiiuls also ganz und rein Alit<br />
und zwar einfacher, unzergliederbarer, intransitiver Alrt sein. Dieser<br />
Begriff der letzten Elemente der Substanz (für die Corleo den treffeilcleii<br />
Namen 3C 0 1 o d v 11 a m i e crfai-id) ist zwar a il r i o r i ~iach deii rein<br />
logisclien Gesctzeii begründet; dass er aber iiocli ontologisch gilt, das<br />
wird a posteriori dadurch bestitigt, dass Physik, Chemie und Physiologie<br />
ihre Tatsachen nur durch Anwendung dieses Begriffs vollständig ver-<br />
stehen und erlrliren lröniieil. Dieser Beweis ist der Sinn und das Ziel<br />
jener zwei umfangreichen Werke über die F 1 u i d i i ni p o 11 d e r a -<br />
b il i (1852) und die Inii e r v a t i o n (1857), wo Corleo sich die<br />
schwierige Aufgabe stellt, nicht nur jede mysteriöse Ursache roni Be-<br />
reich der Naturwissenschaft auszuschlieSsen, sondern auch die letzteil<br />
Tatsachen der Physik und Physiologie, hauptsächlich was Wiriliclehre,<br />
Lichtlehre, Elektrodynamilr und Innervation betrifft, unter der Leitung<br />
seines neuen Substanzbegriffes zu erlilären uild zu systematisieren. Dic
206 Simone Corieo.<br />
fruchtbare Anwendung sollte die Wahrheit des Prinzips beweisen, und<br />
er fand mirl~lich, dass durch diese seine Anwend~ing jede Unlilarheit<br />
verschwailcl und alles hell und verstiiiidlich ward. Voll dauernder Be-<br />
dcutiiilg sind die Ansichten, die in der ICritili der Inner~ratioii<br />
über clic Beziehungen zwischen Physiologie uncl Psychologie urid<br />
über clie Auffassung der psychischen Prozesse zur Geltung kommen.<br />
(Siehe Xarcacci, Le opere etc.) Wurde Corleo von der wissenschaft-<br />
lichen Riclitiglieit uncl Fruchtbailreit seines Prinzips überzeugt, so<br />
weiidcte er sich nun zur Vollendiiilg seines Systems cler F i 1 o s o f i a<br />
11 il i V e r s a 1 e. Dies iiaternahin er ausdrüclilich in seinem Haupt-<br />
werke (in zwei Bäildeil) F i 1 o s o f i a ii ii i V e i s a 1 e , iincl zuletzt,<br />
in kürzerer Fassuiig, in dem Werlie : „ I 1 s i s t e in a d e 1 l a f i 1 o -<br />
sofia uiiiversalc ovvero la filosofia della identitk",<br />
welches er auch sein philosophisches Testament nannte.<br />
In diesen metaphysische11 Untersuchungen fand er, dafs dasselbe Prinzip,<br />
welches Gesetze dein Denken gibt, i~ämlich das Identitätsprinzip, selbst<br />
die einzig inögliche uiid zugleich vollständige Erklärung der Wirlrlichkeit<br />
ausinacht: so dass Idcologie imd Ontologie sich in wunderbarer<br />
Weise vereinigen uiid eiltsprechen. Der ganze Gang cler Wissenscliafi<br />
wird clailaclz als ein grandiöscr Prozels der fortschreitvndeii, logischeil<br />
und tatsächlichen Identifikation aller besonderen Erlienntnis beschrieben.<br />
Es ist nicht leicht, in kurzen Worten auch nur die bedeutendsten Teile<br />
des Systems aiizudeuteii. Wichtig scheint mir der ausgeführte Plan<br />
eiiier algebraischen Logilr; die Berichtigung aller wichtigsten Begriffe,<br />
die zugleich der Wissenschaft uiid der Metaphysilr angehören, und im<br />
allgemeinen der Versuch, alle besonderen Ergebnisse der Einzelwissenschafteii<br />
zu bearbeiten und iii ein rein logisches und harmonisches<br />
Systein zii bringeil. Eine bedeutende Rolle spielt iioch in dem System<br />
die iieue Auffassung vom empirischen und izotwencligen Urteile und dic<br />
Bestimmung der Grenze, wo der Empirismus zur Wissenschaft wird.<br />
Corleo war sich der AhnlicEikeit seiner Grundansichten mit deileii<br />
I-Ierbarts bewulst, doch betonte er gelegentlich ganz entschieden und bestimmt<br />
die Unterschiedspunkte. Es wäre wohl der Mühe wert, die Bcziehuilgen<br />
zwischeii beiden Philosopliei~ genau zu bestiinmeii.<br />
I11 der Ethik machte Corleo den Versuch, den Absolutisinus von<br />
Kant mit Hegcls Notwendigkeit des Fortschritts zii vereinigen. Relative<br />
uiid zeitliche Pflichten Irönnen nur unter der Voraussetzung ewiger<br />
und absoluter Pflichten Geltung haben. Die letzteren bilden iiz der Tat<br />
die Gruiitllage alles sittlichen Fortschreitens. Dies wird bei Corleo<br />
a priori uild iioch historisch begründet. Natürlich spielt auch im sittlichen<br />
T'rteil der Satz cler Identitiit eine wesentlichc Rolle.
Leibniz' Stellung zur Skepsis.<br />
Raoul Richter, Leipzig.<br />
a - ais das dritte Geiiic in1 Sternbild des Ratioizalism~is, clais<br />
nebei~ Descartes und Spiiloza auch Gottfried Wilhelm Leibniz<br />
der dogmatischen Richtung beizuziihlen ist, bestreitet niemand.<br />
Leibniz glaubt fest an die Existenz einer Wahrheit, an deren<br />
Erkennbarkeit auf sinnliclicm und übersinnlichem Gebiete. „Was gibt<br />
es Wichtigeres", so spricht Theophilus-Leibniz in den nouveaiix essais,l)<br />
„vorausgesetzt, dais es wahr ist, als das, was mir, so nehme ich an, über<br />
das Wesen der Substanzen, über die Eiiiheiteii uiid Vielheiteii, über dic<br />
Einerleilieit und Verschiedenheit, über die innere Bildung der Individuen,<br />
über die Unmöglichkeit des leeren Raumes und der Atome, über<br />
den Ursprung der IZohiision, über das I
208 Leibniz' Stellung znr Skepsis.<br />
Dingen ausgesagt werden lranii, die als Realität, d. 11. als ein Attribut<br />
des Seins gedacht, von ihn' „ein sehr uimützes und fast siiiiiloses<br />
Attribut"') peiiaiint wird. läist ich an dem von Descartes aufaestellten.<br />
aber durch genauere Beschreibung zu berichtigenden ICriteriunz erkenne~~.~)<br />
Einer Garantie für die gesunde - Beschaffenheit unseres Wahrheitsbewuistseins<br />
(dais alles, was uizs bei vollkoiiimeiier Besoiiiienheit<br />
als wahr ersclieint, auch walir ist) diircli die Gottescrkeiintiiis bedarf es<br />
nicht, und eine solche ware auch nur ein Scheiizmanövzr. Leibniz Iiat<br />
den Zirkel iin Vorgehen des Descartes und Spinoza hier vollliomiiien<br />
durcliscliautt) und ausdrüclrlicb abgcleluzt, den gleichen Weg einzuschlagciz.<br />
Aber anstatt iiizscre Eesclirknlcuiig auf 1x1 e iz s c k 1 i c 11 c<br />
Wahrheit claraus zu folgern und die „suinma dubitatio" Descartes: riii<br />
trügender Dämoii könne dem Xe~isclien ein täusclzendes Wahrlzeitsbewuistsein<br />
yerliehen haben, als uiiwiderlegbar aiieusehen, hat er auf clie<br />
Verbiiidlichlieit meiischlichcr Erkenntizis für alle vernüiiftigeii Weseil<br />
gesclilosseiz und deii Einwand Descartes als sinnlos zurücligcwieseii. A11statt<br />
wegen des Xaiigels jeglichcr Analogie clie Existenz von Wesen mit<br />
ü b e rmenschlichrm, d. h. dem Grade nach, und a u i s c nneiischlichem,<br />
d. h. der Art nach, von unserni verschiedenem Wahrhcitsbewuistseii1 vom<br />
Standpunlit meiisclilicher Erlieimtiiis für sehr unwahrschcinlich, .ivcizii<br />
auch für deiilibar zu lialten, glaubt er vom Standpunkt unserer oiniiipotenten<br />
Erkenntnis aus an das Dasein übermenschlicher Geister<br />
(Genieiz uiid Gott) und also auch übermenschlicher MTalzrlieiten (d. 11.<br />
von niehr uiid anderen, vor allem auch uiliiiittclbar statt mittelbar erkannteil)<br />
Wahrheiten; aber das Dasein auiscrinenschlichei Wesen uncl<br />
von Wahrheiten, die der unsrigen ~q~idersprächeiz, ist ihm ein iinvollzieli-<br />
barer<br />
I-Iat somit Leibniz ari der Existenz uiid der Erlieiinbarkeit der<br />
Wahrheit niemals gezweifelt, so macht er doch dem Skeptizisinus iiz<br />
bezug auf die Erliennbarkeit ä u i s e r e r R e a 1 i t ä t e 1 Zugestäiid-<br />
nisse von griliidsätzlicher und weitgehender Art. Wenn er auch übei.-<br />
zeugt ist, dnis unsere wacheii Siiincseindrücke uiid ihre Verbinduilgciz<br />
auf von uns uiiablLangigv Realitkten und deren Verbiiiduiigen hindeuteii.<br />
zwar nicht nach der plumpen Doublettentheorie des extremen Realis-<br />
mus, wie Spiegelbilder auf Originale, sondern wie rnathemaiische Fuiili-<br />
2) Ebenda, IV, 6, 5 11.<br />
3) Foucher de Careil. . oauscules - et lettres inedites de Leibnie; Pans 1864,<br />
S. 55: la regle p6n6rale, que plusieurs posent comme un principe des sciences:<br />
quidquid clare distincteque percipitur. est verum, est sans doute fort defectueuse,<br />
comme vous l'avez bien recorinu; car il faat avoir les marques de ce qui est<br />
clair et distinct" (clie übrigens Leibniz so wenig wie Descartes anzugeben<br />
vermochte).<br />
4) Erdmanii, Leibnitii ,Opera, IV, S. 358. So empfiehlt Leibiiiz auch<br />
(Essais IV, 1, 8 und 9) zur Ubermindung der Gedächtnistäuschungen, auf deren<br />
Hebung der in die Enge getriebene Descartes die Notwendigkeit eines wahrhaftigen<br />
Gottes beschrBnkt hatte, nicht den Rekurs auf Gott, sondern auf empirische<br />
Regeln, aus denen die jeweilige Treue oder Untreue des Gedichtnisses geschlossen<br />
merdeii kann.<br />
5) Essais, IV, 17, 16.
Leibnie' Stellung zur Skepsis. 209<br />
tioncii auf die GröTsen, deiicn sie eiiideiitig zugeordnet sind (z. B. eiiie<br />
Ellipse einem Kreis gleichen Durchiile~sers),~) so gibt er doch, durch<br />
Descartes' von Locke aufgenommene pessiniistiscll-skeptische Frage an-<br />
geregt, aber die optimistisch-dogmatische Aiitwort dieser i\/Iäniier ver-<br />
rieinerid, die Alöglichlieit zu: dafs in der Welt der äu.Csereii<br />
Erscheiiiungen, wie sie wachend wahrgenommen<br />
werden, iiiclit mehr Realitätswert enthalteil sei als<br />
i n d e r W e 1 t u n s e r e r T r ä um e.7) Zwar sind die äuisereii Er-<br />
scheiiiimgeii des Wacheii uiitereinailder gesetzmäisig verbunden (z. E.<br />
auf die Wahrnehmung von Wärme folgt uiiter bestimmten Bediiigungeii<br />
die Walirnehrnuiig des steigenden Queclrsilbers im Thermometer),<br />
während die Wahrnchmuilgeii unserer Träume keine solche Qesetz-<br />
mäisiglieit der Vorstellungen untereinander aufweiseil; aber gesetz-<br />
inäisigcr Zusammeiihang allein ist nicht streng beweisend für die<br />
Realität der Glieder, die er beherrscht. Es ist denkbar, dafs auch rein<br />
subjektive Bewuistseiiisiiihalte uiiterejnaiider gesetzmäisig verbuiidcii<br />
wären, wie die Inlialte mancher Träume, und daSb also die sinnlichen<br />
Wahriieliniungeii im wacheii iiur Glieder eiiies solchen im Zusaiinncii-<br />
hang nie abreiisenden, lebenslangen Traumes wären. Zwar ist es ebenso<br />
absurd, ailzunelimen, diese so lang aiidauernde, von unserem Willen<br />
unabhängige Gesetzlichlieit, wie sie iii der Welt äuiserer Erscheinungen<br />
herrscht, liiime diirch das Spiel unserer Phantasie zufällig zustande, wie<br />
zu glauben, durch das freie Durcheiiiaiiderschüttelii von Buchstaben<br />
würde ein siiliivolles Buch geschaffcii. Absurd ist jede, undenkbar keine<br />
dieser Möglichlicitcii.s) Und weitschauend fährt Leibniz fort : „übrigens<br />
ist, wenn die Erscheinungen nur verbunden sind, wirlilich auch<br />
iiichts daran gelegen, ob man sie Träume neiiiit oder nicht, weil die Er-<br />
fahrung zeigt, daCs man sich in dcii uni der Erscheinungen willeil ge-<br />
iiommenen Maisregeln nicht täusclit, weim sie nach Maisgabe der Ver-<br />
iiunftwahrheiten gewoiinen werden.'@)<br />
Aber all das bezieht sich nur auf die problematische Realität der<br />
A U i" s c 11 m e 1 t ; die Realität der I iz n e ii w e 1 t , die substantielle Bc-<br />
schaffenlzeit des eigenen Ich, lrarin durch keinen Einwand erschüttert<br />
werden. Das wache wie das träumende Bewuistsein bestatigen sie<br />
gleichermaisen. Aii dem Cogito ergo sum (und auch im Traum besteht<br />
das cogitare, also auch das esse), der „ersten Wahrheit der Cartesianer<br />
oder des hei1,igen Augustin"l0), ist nicht zu rütteln.<br />
Es sind tiefe Eemerlcungen, die Leibniz hier zu den skeptischen<br />
Grundtheseii geinaclzt hat, und Richtiges wie Falsches ist auf ihrem<br />
.- .<br />
6) Foucher, a. a. 0. 5.53 : il ii'est pas nbcessaire, que ce que nous coiicevons<br />
des choses hors de nous leur soit parfaitement semblable, mais qu'il les exprime<br />
comme Une ellipse exprime un cercle vu de travers, en Sorte, qu' a chaque point<br />
du cercle il en repond un de l'ellipse et vice versa suivant une certaine loi<br />
de rapport.<br />
7) Essais, IV, 2, $ 14; Foucher, a. a. 0. S. 36ff.<br />
8) Sehr iihnlich Schopenhauer, Welt als Wille und Vorstellung, I! 1, 5 6.<br />
9) Essais, I\', 2, # 14.<br />
10) Ebenda, IV, 2, 1; vgl. 7, 7; 9, $ 2.<br />
Philosoph. <strong>Abhandlungen</strong>. 14
210 Leibniz' Stellung zur Skepsis.<br />
Gruiide verborgen. Mit Recht lehnt er als das c n t s c h e i d e n d e<br />
ICritcrii~iii der wachen Sinneswahriiehinuiigeii die gröisere Lebhaftigkeit<br />
ab iiiid ersetzt sie durch die gesetzrnäisigcii Beziehungen in dieser<br />
Gruppe. Mit Recht betont er trotz dieser Gesetzlichlreit die X ö g 1 i c h -<br />
k c i t des extremen Idealismus nnd metaphysisch-dogmatischen Phänoineiialismus,<br />
d. h. der Lehre, dass die sinnlichen TVahrnehmungen reine<br />
Bewufstseinserzeugnissc seien und nicht veraiilaist durch irgendwclche,<br />
ilinen auch noch so iinähnliclie bewuistseinsuiiabhäiigige Realitäten. Mit<br />
Recht hält er diese Anschauung, die ich die dogmatische Metaphysik<br />
des empirischcii Weltbilds iieniieii iilöchte, für sehr unwahrscheinlich<br />
und a 1111 t wohl bereits den rein hypothetisclien Charakter dieser wie<br />
jeder anderen These über die Realität der A~isenwelt.~~) Mit Recht<br />
liebt er endlich die Milöglichlreit (wenn auch noch nicht die iuotwendigkeit)<br />
liervor, enipirische Wissenschaft auf rein idealistischen1 Boden zu<br />
treiben, niag man nun das Reich der gesetziiiäisig verbuiideiieii wachen<br />
Sinncswahrnehinungen wegen ihrer Verwandtschaft mit deii Traumvorstellungeii<br />
(als idealer Erwuistseinsgebilde) ein Traunireich nennen<br />
oder wegen ihrer Unterschiede von den Traumvorstellungeil (eben der<br />
gesetzlicheii Verbindung) dies als ungehörige Äquivocatioii ablehnen.<br />
Ganz verfehlt dagegen ist die eximierte Stellung der metaphysischeii<br />
Realitat des Ich oder der 1niien.cvelt für den Erkeniitnisprozeis.<br />
Durch den Elinsveis auf die Möglichlreit von Erfalirungswissen,<br />
-IVisscnschaft, -Erkenntnis iiii Reich der Irninanenz, der Bemuistseinsuiid,<br />
wenn inan will, der Traum~velt, hat Leibiiiz den Weg angedeutet,<br />
auf den1 einzig der gegen Objelitcrlrcnntnis gerichtete Slieptizisinus zu<br />
Uberwindeii ist, deii Weg, deii einige Jahre später G. B e r lr e 1 e y init<br />
glanzrilclein Erfolge beschreiten sollte.<br />
Und wie er an den aufgelrl&rtcsteii Stellen seiner Schriften vorausaliiite,<br />
auf welche Art den1 die Erlcenntnis der ., D i ii g e (( bezweifelnden<br />
Skeptizisnius zii bcgegiicii sei, so auch: wie die Zweifel in die Erkenntnis<br />
der Gesetzes z u s a in ni e 11 h ä ii g c zwischen diesen Dingen entschieden<br />
~verdeii miiistcii. IIicr iialini er 1% u m e s wie dort Berkeleys Ergebirisse<br />
vorweg. Die Ziisaminenhängc, welche die Erfahrurigswelt beherrschen,<br />
können nach Leibniz nur Iiihalt von empirischen, nicht von<br />
Veriiiiiiftmahrheiteii werden, niclit von „notwendigeiiU, sondern von<br />
,,ziifälligeii'(, nicht von „ewigen", sondern nur von „zeitliclien(' Wahrheiten;<br />
d. h. aus der scliolastischen Terminologie herausgehoben: über<br />
ihre allgemeine Gültigkeit lianti ich nur annähernde („moralische(' oder<br />
,,physische"), nie volllroiiimeiic („metaphysische(') Gewiisheit erlangen.12)<br />
Die einen geben 6vidence oder certitude lumineuse, die<br />
anderen nur certitude,l" erregen ein Zustin~niungsgefühl niederen<br />
Grades. Genau wie T-Tuine und die jüngeren l'yrrho-<br />
11) Die Frage nach der Realität der Aufsenwelt ist fiir dcn menschlichen<br />
Intellekt nicht streng entscheidbar, weder a priori noch a posteriori; vgl.<br />
Fouclier, a. a. 0. S. 38.<br />
12) Essais, IV, 6, Schlufs.<br />
13) Ebenda, IV, 11, 8 10.
Leibniz' Stellung zur Skepsis. 21 1<br />
nikeil" hat er den Inhalt der Gesetze, welche die<br />
Erfahrung beherrscheil, auf die regelmäisige Suc-<br />
cession der Erscheiiluilgeii bcscliränkt; hat er die<br />
Gültiglreitihrer Erkeniitnis auf bloise Wahrschein-<br />
lichkeit herabgedrüclit; hat er clas Problem der<br />
empirischen Kausalauff assung iir der Rechtf erti-<br />
gung des Sprunges von vielcn Fallen auf alle er-<br />
bliclrt (oder der Aussagen iiber nicht gegenwärtige<br />
Tatsachen oder der Fällung universell-objektiver<br />
Sitze, was alles dasselbe besagt); 11at er die psycho-<br />
logische Genese dieses Sprunges in die Assoziation<br />
v e r 1 e g t. „Die Folgerungen der Tiere sind nur ein Schatten von Ver-<br />
niinftschlüssen, nämlich nur eine Verknüpfuiig in der Phantasie und<br />
Überginge von einem Bilde zum aiidern, indeni man bei einem neuen<br />
Falle, der dem vorhergehenden ähnlich scheint, wieder das erwartet, was<br />
man vorher damit verbuiiden gefunden hat, als ob die Dinge in Wirk-<br />
lichkeit verbuiiden wären, weil ihre Phantasiebilder es im Gedächtnis<br />
sind. Allerdings läist uns die Vernunft gewöhnlich erwarten, dais das,<br />
was einer langen Erfahrung der Vergangenheit entspricht, zukünftig<br />
wieder geschehe, aber dies ist da1111 doch keine notwendige und untrüg-<br />
liche Wahrheit."lj] Eine solche aber ist auf dem Gebiet der sinnlichen<br />
Erscheinungswelt iiber nicht unmittelbar gegenwärtige Erlebnisse über-<br />
haupt nicht zu erlangen. Allerdirigs köniieii wir, noch ein gut Stück<br />
über den Zwang der Assoziation hinausgehend, dieser1 korrigieren durch<br />
die Anwendung der logischen Axiome auf die Erfahrung, lrraft deren<br />
wir denkend beobachten, was wirlrlich d a u e r n d bisher miteinander<br />
verbunden war, abrr dadurch erlialten wir nur eine bessere, aber keine<br />
absolut vollstäiidige Induktion und danlit auch keine volllrommenc, wenn<br />
auch eine den praktischen Bedürfnissen geriiigende Gewiisheit. „Und da<br />
diese Gründe und Beobachtungen uns das Mittel geben, in bezug auf<br />
unser Interesse über die Zukunft zu urteilen, und der Erfolg unserem<br />
vernünftigen Urteil entspricht, so kann man eine gröisere Gewiisheit<br />
über diese Gegenstände nicht verlangen und selbst nicht einmal erhalten.<br />
. . . . I m E r n s t z w e i f e 1 n ist hinsichtlich der Praxis zweifeln; und<br />
man l
212 Leibniz' Stellung zur Skepsis.<br />
iienneri, hätte er nicht dadurch, dais er den hohen Wert aucli dieser<br />
Urteile niederen Gewiisheitsgrades stets betonte, gerade den Mreg zur<br />
Uberwiridung aller Slrepsis gewiesen. Besonders nahe liomiiit er dieser<br />
Einsicht dort, TVO er für eine gründlichere Erforschung der TiT a h r -<br />
s c h e i n 1 i c li k e i t s u r t c i 1 e eintritt. Rat er auch iiocli nicht<br />
streng geschieden zwischen dem auf hypothetisch aiigenommeiier und<br />
aufhebbarer Unwissenheit beruhenden und den s u b j c k t i V e ii Er-<br />
wartungsgrad abschätzenden Wahrscheiiilichlreitsbegriff der M a t h e -<br />
in a t h i li und dem durch grundsätzliche und unhebbare Uilrvissetlheit<br />
bedingten, die 0 b j e li t i v i t ä t zum Inhalt habendeil p li i 1 o s o -<br />
p h i s c h e ii Wahrscheiiilichlreitsbegriff, so hat er doch die Beiirbeituiig<br />
beider Begriffe befürwortet und selbst unternommen.17) Was also die<br />
P y r r h o n i Ir e r mit ihrem Phäilonienalismiis de f acto ausübten, iiäin-<br />
lieh empirische Wissenschaft im Geiste dcs Positivismus, aber mit dem<br />
Namen Wisseii und Erkenntnis theoretisch zu sailktioiiiereii sich iiicht<br />
getrauten, uiid was die A Ir a d e m i Ir e r mit dem Wahrsclieii~liclikeits-<br />
begrift' hez~vccktvn, aber auch nur zaghaft andeuteten (iiäinlieh die Tiber-<br />
winduiig der slreptischcn Resignation) - dem gibt Leibiliz das gute<br />
intellektuelle Gewissen zurüclr : „ D i e j e n i g e M e i ii u ii g , \V e 1 c h e<br />
in der Wahrscheinlichkeit begründet ist, verdient<br />
vielleicht auch den Namen der Erlreiiiitiiis, sonst<br />
würden fast die gesamte historische Erkciintnis<br />
und alle übrigen wegf alleii"'S) (naiiilich die gesamte<br />
Naturwisseiischaft !).<br />
Im übrigen ringt sich die Universalität dieses Geistes den eigentlich<br />
zeiitralen Antrieben seiner Deiilrart zuwider solch aufgeklartt. Ai-isiclitcii<br />
unter dem Einfliiis Lockes mühsam ab, iind alles in allem bleibt er viel<br />
zu sehr im Dogmatisnius bef arigen, um die Sliepsis wirlrlich entscheidend<br />
zu besiegen. Denn dazu muis nian nicht nur diese, sondern aucli noch<br />
ein gut Stück Dogmatik mehr hinter sich lassen! Leibniz aber ~rergiist<br />
oft genug die von ihm selbst gemachteil Einschränkungeii, iiiid glaubt<br />
objektive Wahrheiten über die Iinmaneliz, deiicn durch Indulrtioii (dar aii<br />
Kalt er niit allen Rationalisteil fest) nienials Apodilrtizität zu sichern<br />
sei, deduktiv höchste Gewiisheit verschaffen zu können.l" Überdies ist<br />
die äuisere Erfahriingswelt für ihn von untergeordneter Bedeutung.<br />
Und damit sind wir wieder bei dem echten Leibniz aiigelaiigt, dem wir<br />
das erste Zitat entnahmen. Auf den ihm wichtigsten Gebieteil, der<br />
Iforal uiid i74etaphgsik, der Mathematik und Logik,<br />
- .-<br />
17) Zur Wahrscheinlichkeitslehre Leibiiiz' vgl. das ausgezeichnete Werk<br />
Conturats, La logique de Leibnitz, Paris 1901, R. 240ff.<br />
18) Essais, IV, 2, 9 14.<br />
19) Durch die Anschauung, dais diese verites contingentes zwar nicht an<br />
sich denknotwendig sind, aber sich als die weisesten, freien Entscheidungen<br />
Gottes zwischen verschiedenen Möglichlreiten (apodiktisch?) nachweisen lassen.<br />
So z. B die mechanischen Gesetze, wodurch sofort die gesamte Naturwissenschaft<br />
auf eine höhere Gewiisheitsstiife in ihren Ergebnissen steigen wurde. Gott<br />
erkennt iibrigens auch siimtliche veritks de fait a priori. Couturat, a. a. 0. X. 211.
Leibniz' Stellung zur Skepsis. 213<br />
erkennt er apodiktische Wahrheiten überall an;*O) für die letzten zwei<br />
Disziplineii mit Recht, für die beiden ersteren mit Unrecht. Die Apodilitizität<br />
dieser Wahrheiten fuist auf ihrem Auriorismus. iii dem durch<br />
Leibniz erst endgültig geliliirten Sinne: als unserem Geiste eiltsprungeiieii,<br />
daher ihm notwendig angehörenden und von ihm nie zu<br />
durchbrechenden Der~knotwendigl~eiten, die aber erst durch Erfahrung<br />
und Siniilichkeit, also a posteriori, in uiis ausgelöst werden.21)<br />
Es ist nach alledem nicht wunderbar, dais der Briefwechsel Leibniz'<br />
mit eiiiern professionellen Skeptilicr, wie dem A b b 6 F o U C h C r ,22)<br />
der die Apologie der akademischen Skepsis als sein Lebenswerk bctrach-<br />
tete, für die Gesamtstillung unseres Philosophen zur Skepsis nur gc-<br />
ringe Ausbeute liefert. Von einem tieferen Eingehen auf die Probleme<br />
der antiken Slieusis ist niemals die Rede, und seine glatte Art vermeidet<br />
es, ihnen gegeniiber Farbe zu bekennen. Zwar finden sich sehr weise<br />
Bemerkunneri darüber, warum man nicht jede Erkenntnis bis auf ihre<br />
axiomatischen Voraussetzungen zurüclizuführen brauche; aber das sind<br />
iiiir methodologisehe Empfehlungen, nicht erkenntnistheoretische Ge-<br />
sichtspunlite, wie auch Foucher in seiner Erwiderung her~orhebt.~~)<br />
Leibniz bleibt also im Grunde Dogmatiker niit leichtem slirptischeii<br />
Einschlag fiir die Erfahruiigscrlienntiiis.<br />
20) Essais, Vorrede.<br />
21) Ebenda, Buch I.<br />
221 Foucher de Careil, a. a. 0. S. 27 bis 131. Der Briefwechsel mit Leihiiiz<br />
lauft voii 1679 bis 1693.<br />
'<br />
23) Foucher de Careil, a. a. 0. S. 29ff., 88, 95.<br />
24) Organon, 11, 2, 3.
Un probabiliste moderne,<br />
Antoine-Augustin Cournot.<br />
Par<br />
Th. Ruyssen, Aix-en-Provence.<br />
n consacrant ur1 numero special A la personne et 5 l'oeuvre<br />
d'Antoine-Augustin Conrnot, la Revue d e Met ap h y si que<br />
et de Morale (Mai 1905) a accompli une Oeuvre de justice<br />
opportune et meritoire, et l'on serait tente de donner A cet<br />
hommage tardif le nom de rehabilitation philosophiclue si, en effet,<br />
il s'agissait de venger la memoire de Cournot des railleries ou<br />
simplement de l'indifference des hommes de son temps. Mais le<br />
cas, pour 6tre autre, n'en est pas moins frappant. Si Cournot avait<br />
vecu ii l'ecart, daris une situation sociale humble et difficile, on si,<br />
encore, sa doctrine s'etait trouvee en antagonisme profond avec<br />
les theories regnantes de son temps, on comprendrait qu'il eilt et6<br />
mecon~ru ou bafoub. Mais, bien au contraire, il sort Oe 1'Ecole<br />
normale comme Victor Cousin, Vacherot et Taine; il occupe, des<br />
l'age de trente-quatre ans, le poste eleve de recteur d'academie;<br />
il preside, quatorze annees durant, le jiiry de l'agregation de philo-<br />
sophie; il porte, apres Ampere, le titie d'inspecteur general des<br />
etudes; il devient membre du Conseil superieur de lJInstruction<br />
publique. I1 n'est donc, par soii origine et sa profession meme, ni<br />
un isole ni :In impuissant. De bonnc heure meme, il est soutenu<br />
par des amities illustres: le marechal Gouvion Saint-Cyr, le mathe-<br />
maticien Poisson, l'academicieri Droz; il n'a jamsis, que nous sachionc,<br />
6prouv6 de peine pour trouver un editeur. Ainsi toutes les conditions<br />
se trouvaient reunies qui pouvalent lui rendre le succbs facile. Et<br />
cependant, il cotoya, sans jamais y mettre le pied, la grande voie<br />
de la gloire, C'est h des traductions d'ouvrages scientifiques, l'A s tr o-<br />
nomi e de Herschel et la Al 6c ani que de Gardner, qu'il dut le plus<br />
clair de sa reputation. I1 fut, poiir la plupart des contemporains qui<br />
connurent son nom, un znathematicien distingue, un administrateur<br />
remarquable: du philosophe, le grand public ignora tout.
Un probabiliste moderne, Antoine-Augiistin Coiirnot. 2 15<br />
Dira- t - on, ponr espliquer cette inclifference, que les idees de<br />
Cournot ret,ardaient OLI avancaient snr son i;emps? Bien aii contraire,<br />
ces idees cadrent A merveille avec les preoccupations philosophiques<br />
de la seconcle moiti6 du dix-neiivikme siecle. Ni11 penseur iie fut<br />
plus exactement de sa generation. Sa doctrine appartient sans co~iteste<br />
au gran6 inouvement de renovatioa critique et liistorique duquel<br />
relevent, ?L des titres divers, Auguste Comte et Littre, Taine et Renan<br />
Renouvier et Vacherot. Aussi bien, de bons juges n'avaient pas<br />
meconnil son originalit6. Ravaisson, dans le celebre Rapport sur<br />
la philosophie en Fraiice au XIXe siecle, Taine dans les Debats,<br />
Renouvier dans salogique, d'antres encore ont rendii hommage A<br />
la hardiesse d'une pensee A la fois trhs moderne et tres ind6pendante1).<br />
Et cependant Cournot ne jouit pas de la rhputation qiie les circoil-<br />
stances semblaient propres ii lui concilier. Ce philosophe du hasarcl<br />
eilt et6, d'ailleurs, le dernier A sJ6tonner de l'absence, dans sa carriere,<br />
cle ces ,,accidents heurcux" qui aiiraient pu disposer en sa faveiir<br />
les sourires de la fortune. ,,Convsnons de bonne grace, 6crivait-il eil<br />
1868, qu'au bonheur d'obtenir quelques suffrages cl'elite nous joigiloiis<br />
le malhenr d'avoir 6t6 peu lu", et il priait le public, en liii presentaiit<br />
ses Considc5rations siir la marche des idees (1872), „dlabsoiidre<br />
ce dernier pech6"").<br />
* -X-<br />
Nous ne saurions entroprendre ici d'exposer l'ensemble des idees<br />
de Coiirnot. Noiis risquerions d'appaiivrir nne doctrine extremement<br />
souple et diverse dani ses applic~tions. Mais l'inspiration generale<br />
en est simple, et c'est elle qu'il importe de mettre en evidente.<br />
Le principe qui domine cette philosophie est surtout nn priiicipe<br />
de methode et pent se r6sumer d'un mot: le probabilisme.<br />
Ce mot seul suffirait ?L fixer l'originalit6 de Coiirriot parmi<br />
les penseurs de son temps. Etrangcr par les etudes de sa jeiiilesse<br />
et par ses lectiires personelles h la cnlture de la philosophie classique,<br />
il repugnera toute sa vie au dogmatisme philosophique de l'ecole<br />
ecloctique qui regnait dans l'u'niversite SOUS l'imp6riense direction<br />
de Victor Cousin. La formation de son esprit est purement scienti-<br />
fique. Mais le dogmatisme empiriqne d'A. Comte ne l'a pac sednit<br />
davantage. Plus encore que sa,vant, Conrnot est mathematicien, et,<br />
dans les mathhmatiques, il n'apercoit pas siniplement l'instrumeiit<br />
de la plus haute certitude h laquelle puisse s'elever l'esprit humain<br />
quand il considhre les relations definies et mesnrables du nombre et<br />
de la forme; les mathematiques s'appliquent A l'indefini et 2<br />
l'incommensurable, elles calciilent des probabilites, elles donnent sa<br />
loi au hasard mhe. Or, on l'a justement remarque, Cournot a V~CU<br />
-<br />
1) Ravaisson, Rapport etc., Paris 1867, p. 219-228; - Taine, Dkbats,<br />
5. aout 1861, 6. juillet 1866, 27. juin1867; - Renouvier, Essais de critiqiie<br />
gknkrale, Ier Essai (Logique), 2ma kd., Paris, 1875, T. 11, p. 431-451 ; -<br />
E. Vacherot, in: Revue des Deux-Mondes, 1868, t. 111, et L. Liard, Un<br />
gkomktre philosophe, ibid., 1877, t. IV.<br />
2) Prkface des Considerations sur la niarche des jdCes, p. VI1.
2 16<br />
Un probabiliste moderne, Antoine Augustin Cournot.<br />
„claiis un genkration impregnke de probabilismeu3); il n'a pas<br />
seulement lu Fermat et Pascal, Leibniz et Jaqiies Bernouilli; mais il<br />
est temoin, et temoin passionne, de la gloire de Laplace et des<br />
discussions soulevees par la Theorie des probabilites de l'illnstre<br />
math6maticien4) et par les travaux de son disciple Poisson sur le<br />
m6me sujet5); liii-m6me a 6tk li6 avec Dirichlet, Fourier et<br />
Bienayme. Enfin la premibre de ses Oeuvres originales n'est autre<br />
que cette Exposition de la theorie des Chances et des proba-<br />
bilites", oiivrage capital, dont tout le reste du systeme, mfiri et<br />
developpk peridant plus de trente anilees, est le developpement<br />
logiqiie et fecond. 7,<br />
Cournot avait alors qiiarante-deux ans et le premier ouvrage pliilo-<br />
sophique de cet esprit patient affirme l'autorite d'un maitre. Cournot,<br />
en effet, y prend hardiment le contre-pied de la theorie de Laplace.<br />
Ai1 celbbre mathematicien, il ne reproche pas seulement lJobscurit6<br />
de son style et de ses deductions, mais encore le caractbre tout negatif<br />
de sa conception du hasard. Deterministe convaincu, Laplace, aprbs<br />
Hiime, n'apercoit dans ce mot qu'un vain nom, flatiis vocis,<br />
qui tious sert h degaiser notre ignorance provisoire des caiises.<br />
Cournot, tont mathematicien qu'il est, ne craint pas d'attribiier au<br />
hasard une realite objective, independante de l'etat de notre savoir.<br />
Pour ktablir sa thbse, ii commence par etudier de prks la „probabilite<br />
inath6matiqueN. Celle-ci a lieu tontes les fois qu'il est possible<br />
d'etablir un rapport numerique entre le riombre total des combinaisons<br />
possibles de ,,chancesd et le nombre de chances favorables h un<br />
evenenlent donne. Cette probabilite comporte des theoremes dont<br />
Jacques Bernouilli a doiine la formuie et que Cournot reprend, demontre<br />
h son tour et illustre au moyen cl'exemples dont le detail ne saurait<br />
troiiver place ici. Mais ces theories d'arithmetique pure ne sont-elles<br />
,,qu9nn jeu d'esprit, une speciilation curieiise" ?Y) Les lois qu'elles<br />
ktablissent, au contraire, ne regissent-elles pas le monde reel? C'eat<br />
ici cliie l'habilete du mathematicien ne suffit pliis, ,,il faut faire de<br />
la critique philosophjclue".<br />
Or, s'il est vrai qu'il n'y a pas de phenomdne sans cause et<br />
sans effet, et qn'en ce Sens toiit evenement est .3 la fois determink et<br />
3) Mentre, Les racines histor. du probabil. rationnel de Cour-<br />
not, in: Revue de MBtaph., mai 1905, p. 503-504. -<br />
4) Laplace, ThCorie analyt. des probabil, Paris, 1812. -<br />
5) Poisson, Rech. siir la probabil. des jugements, Paris,1837.<br />
6) Paris 1843, in 8<br />
7 J Voici, outre ce livre, les titres des ouvrages de Cotirnot dont la lectnre<br />
importe pour la connaissance de sa doctrine: Essai s ur les fondements de<br />
110s connaissances et sur les caracteres de la critique philoso-<br />
phique, Paris 1851, 2 vol. in -8. - TraitB de l'enchainement des id6es<br />
fondamentales ditns les sciences et dans l'histoire, Paris 18G1, 2 vol.<br />
in-8. - ConsidBrations sur la marche des idBes et des Bveiiements<br />
(lans les tenips modernes, Paris, 1872, 2 vol in -8. - MatBrialjsme,<br />
X italisme, rationalisme, Paris, 1 vol., 1875.<br />
8) Chap. IV, p. 70.
Un probabiliste moderne, Antoine-Angustin Cournot. 217<br />
determinant, il est incontestable aussi que les series de causes et<br />
d'effets lies dans le temps sont, A un meme moment, infiniment nom-<br />
breuses et penvent se rencontrer d'une fa~on tonte provisoire et<br />
accidentelle; c'est-A-dire que des series absolument etrangbres les<br />
unes aiix autres avant la rencontre, et dont les effets divergeront k<br />
leur toiir en series totalement distinctes, peiivent se croisei en un<br />
point et y prodiiire iin effet que la connaissance particulibre de<br />
chaciine des series concourantes ne suffirait-pas A expliquer. En<br />
d'aiitres termes, i1 y a des series de phenomenes solidaires et d'autres<br />
qui ne le sont pa,s, et i1 serait inexact de pretendre au nom du<br />
determinisme, que tout se tient pareillement -dans la nature. „Per-<br />
sonne ne soutiendra serieusement qu'en frappant la terre du pied<br />
il derange le navigateur qui voyage aiix antipodes". Ou bieil, si<br />
l'on s'obstine A affirmer, en theorie, cette universelle solidarite, du<br />
moins faut-il reconnaitre que de pareilles perturbations sont pour<br />
noiis inappreciables et pratiquement inexistantes. „Les evhnements<br />
amenes par la combinaison on la rencontre de phenomenes qui<br />
a,ppartiennent A des series independantes, dans l'ordre de la causalite,<br />
sont ce qu'on nomme des ev6nements fortuits ou des resultats du<br />
ha~ard".~) Suit un exemple saissant: Si un homme, surpris par<br />
l'orage, se refugie sous un arbre et y est frappe par la foudre, cet<br />
accident n'est pas purement fortuit; car il y avait une raison pour<br />
qiie l'homme, ignorant les lois de la physique, s'abritat sous un<br />
arbre et il y en avait une encore pour que la foudre vint precisement<br />
frapper cet abri. Mais si cet homme est atteint de la foudre aii<br />
milieu d'une prairie, l'ev6nement merite le nom de hasard, car il<br />
n' y avait aucune liaison entre la presence de l'homme sur iine surface<br />
plane et la chute de la foudre au meme point.<br />
De cette conception resultent deux consequences. C'est d'abord<br />
que le hasard n'a nullement le caractere etrange et myst6rieux que<br />
l'imagination populaire prete volontiers aux evenements fortuits.<br />
Un fait banal peut provenir aiissi bien du hasard qu'iin fait extra-<br />
ordina,ire. C'est pur hasard si, d'un sac contenant autant de boiiles<br />
blanches que de -noires, je tire une boule blanche, et cependant<br />
le fait n'etonnera personne.<br />
D'aiitre part, la probabilite mathematique, qiii est la mesiire<br />
dii hasard, cesse d'gtre „un simple rapport abstrait tenant au point<br />
de vue de notre esprit", mais devient „l'expression d'iin rapport que la<br />
nature meme des choses maintient." 1°) En effet, l'impossibilite physi-<br />
que est equivalente & une probabilite metaphysique infiniment petite.<br />
Tout le monde, par exemple,-convient de 11impossibilit6 de poser un c6ne<br />
pesant en equilibre sur sa pointe, de construire une balance rigon-<br />
reusement exacte, de mesurer parfaitement une grandeur reelle avec<br />
un etalon etc., toutes operations dont les mathematiques proclament<br />
cependa.nt la possibilite absolue. La raison en est que le nombre<br />
91 p. 73. Cf. Essai sur les fond. de nos conn., t. I, eh. 111.<br />
10) P. 81.
218<br />
Un probabiliste moderne, Antoine-Augustin Cournot.<br />
des reussites approximatives est infini par rapport aii cas iiniqiie de<br />
la reussite parfaite. L'evenement physiquement impossible est donc<br />
celui dont la probabilite mathematique est infiniment petite. Reci-<br />
proquement, l'evenement physiquement certain est celiii dont la<br />
probabilite mathematique ne diffkre de l'iinite que d'une quantite<br />
infiniment petite Et voici, du coup, la notion de probabilite ma-<br />
thematique introduite d'emblee dans la science du reel, et le hasard<br />
mis S la place qiii lui revient en physique. Ne disons donc plus<br />
clue le hasard est le nom dont nous deguisons notre ignorante des<br />
causes, car une intelligente superieiire h celle de l'homme, la<br />
supposat-on m6me parfaitement clairvoyante, ne supprimerait pas le<br />
hasard; elle apercevrait simplement avec pliis de clarte, ou m6me<br />
avec une 6vidence parfaite, la part qui revient an hasard dans les<br />
combinaisons de series independantes de phenombnes, elle deter-<br />
minerait la formille exacte de l'approximation mathematique qui<br />
separe le probable du certain; elle ne supprimerait pas cette approxi-<br />
mation et reconnaitrait qii'en un sens et dans une certaine niesrire<br />
„le hasard gouverne le monde." 11)<br />
S'il en est ainsi, le calcul des probabilites n'a plus seulement<br />
soll application dans les jeiix de hasard inventes pas l'imagination<br />
des hommes; la statistique, qui semble destinee S d6m6ler des<br />
moyennes stables dans l'ordre complexe des evknements oU inter-<br />
vient la liberte, trouve sa place en physique et jusqu'en astronomie.<br />
En effet, la nation de hasard, telle qu'on vient dela definir, conduit<br />
2i discerner, jusque dans le domaine des choses physiqiies, l'action<br />
de caiises regulibres, ou permanentes, et de causes accidentelles, oii<br />
fortuites. Si, par exemple, un d6 de structure irregulibre est projete<br />
plusieurs fois sur Une table par des joueurs differents ou simplement<br />
par des impulsions mecaniques qu'on suppose independantes les unes<br />
des autres, la plus grande frequente avec laqiielle apparaitra telle<br />
ou telle face dii d6 dependra cl'une cause permanente, telle qiie la<br />
Situation du centre de gravite du d6 par rapport au centre geometriqne<br />
de ce cube, et de causes accidentelles, qui sont les diverses impulsions<br />
eprouvees tour A tour par le d6. Or pareille distinction est d'une<br />
application constante dans la determination des lois les plus rigoureuses<br />
de la nature. C'est ainsi que la comparaison des grandeurs angulaires,<br />
qui entrent comme elements dans la deterrnination des orbites des<br />
onze planetes solaires, permet d'etablir que l'accumulation des poles<br />
d'orbites autour du pole de l'ecliptique ne saurait etre tenue pour<br />
fortnite, en depit des particularites speciales & chacune cle ces<br />
grandeurs, et conduit h l'hypothese d'une cause initiale qui a du<br />
tendre S rapprocher les plans des orbites planetaires de celui de<br />
l'equateur solaire et imprimer i Ces Corps celestes des mouvements<br />
de rotation et de translation diriges dans le meme Sens.'" Les<br />
exemples empruntes & la physique sont plus simples encore et peut-<br />
etre plus frappants, car ils mettent en lumiere cette importante<br />
11) p. 83. - 12) p. 264 sq.
Ur1 probabiliste moderne, Antoine-Augustin Cournot. 219<br />
remarque que la statistique appliquee aux phenomenes materiels<br />
n'exige pas l'observation d'un nombre de cas trbs considerable, pourvu<br />
que cette observation s'applique & des faits evidemment solidaires.<br />
Si, par exemple, le m6teorologiste cherchait h determiner la loi des<br />
variations diurnes du barometre en observant chaque jour la hauteiir<br />
du mercure ii 9 heures du matin et h 3 heiires dii soir, il n'arriverait<br />
A des resiiltats probables qu'an prix d'epreuves prolongees sur une<br />
trbs longiie periode de jours. Que si, au contraire, il note, au lieu<br />
des deux hauteurs absolues quotidiennes, la differente quotidienne<br />
de ces hanteurs, comme l'action des causes accidentelles qui ont<br />
eleve le niveaii de la colonne barometrique h 9 heures subsiste<br />
encore, le plus souvent, h 3 heures, la diff6rence observee sera<br />
evidernment sonstraite h l'action de ces influences irr6gulieres.<br />
C'est ainsi encore que l'observation quotidienne de l'excbs de<br />
hauteur de la pleine mer sur la basse mer met beaucoup plus<br />
vite en evidence l'action respective du soleil et de la lulle<br />
sur ce phenomene, que In n~ta~tion repetee des haiiteurs absolues qui<br />
peut variw sous l'action de causes accidentelles, vents, tempetes ou<br />
courants.13) Ainsi est repoiiss6, ou du moins corrige, le prejuge si<br />
courant en vertu duquel la valeur des statistiques est proportionnelle<br />
au nombre des observations. La multitucle des notations vaut moins<br />
que la notation precise d'un petit nombre de connexions bien choisies.<br />
Cette remarque, encore que brievement formulke, au milieu de theoremes<br />
purement mathematiques et d'applications fort interessantes j4)<br />
est, chez Cournot, d'une extreme importance. Elle nous donne la<br />
cle de son probabilisme. En effet, la multiplicite des faits, des<br />
contre-epreuves et des temoignages laisserait dans notre esprit un<br />
doute, mininie peut-etre, mais irreductible, si toute these nouvelle<br />
n'etait solidaire d'un ensemble de propositions h l'egard desquelles<br />
nous avons d6jA pris l'attitude de l'affirmation. La demonstration<br />
du theoriime de Pythagore serait sans doute siiffisamment etablie<br />
par l'accord de nombreuses generations de geometres; mais, en outre,<br />
ce theorbme rentre dans un systeme de propositions liees avec nne egale<br />
rigueur. De meme, l'existence dlAuguste nous est garantie par<br />
l'unanimite des historieris de Rorne; mais, plus encore, l'existence<br />
de ce personnage rend compte d'une foule d'evenements conternporains<br />
et posterieiirs yui resteraient incoherents si l'on supprimait cette<br />
maille du reseau de l'histoire. L'accord d'une verite avec un<br />
ensemble dejh accepte l'affranchit, en quelque sorte, de la dependance<br />
momentanee oii elle s'est troiivee ii l'egard de nos facultes de<br />
demonstration; la probabilite d'erreiir est reduite au minimum;<br />
I'element h as ar d est pratiquement elimine. 15)<br />
13) p. 289 sq. -<br />
14) Voir notamment les chap. XIII-XVI: sur la repartition des Sexes, les<br />
lois de la mortalitk, les assurances, la probabilite des jugements et des tkmoi-<br />
gnages en matikre jiidiciaire.<br />
15) p. 420-21, et Essai siir les foiid. de nos conn., t. I p. 154-8. -
Un probftbiliste moderne, Antoine-Augustin Cournot. 22 1<br />
procedes que ceux du probabilisme lui-meme. En effet, les faciiltes<br />
de l'esprit humain, peuvent etre considerees comme des temoins et<br />
il est possible de leur appliquer les memes calculs de probabilite<br />
que comportent les temoignages. Soient deux temoins independants<br />
l'un de l'autre; tous deux me rapportent un meme evenement, avec<br />
les memes circonstances presentees dans le meme ordre. Sans doute<br />
il n'est pas mathematiquement impossible que tous deux aient cherche<br />
h me mystifier de la meme facon ou que chacun ait 6th pareillement<br />
dupe par la meme halluciiiation; mais un si prodigienx hasard<br />
presente beaucoup moins de chances de probabilite que la simple<br />
realit6 du fait raconte; aussi admettons-nous cette realite, tout en<br />
reservant la possibilite d'erreurs de detail commises par les deux<br />
narrateurs. De meme nos sens, pris un h un, nons apportent, siir le<br />
monde exterieur, un temoignage que nous ne saiirions directement<br />
verifier, et l'on pourrait soiipconner avec Bacon qiie la structure de l'oeil,<br />
par exemple, deforme les rayons lumineux de fa~on ii nous entretenir<br />
daiis une illusion perpetuelle. L'astronomie tout entiere ne serait<br />
ainsi rien de plus qile la science des conditions subjectives de la<br />
vision. Mais pareille hypothhse est infiniment moins probable, aux<br />
yeux d'une raison eprise d'ordre, que l'existence de connexions<br />
reelles entre phenomenes exterieurs, et n'exclut pas, d'ailleurs, les<br />
chances d'erreur qui provienuent de la sensibilite et que la science<br />
doit determiner avec soin. De meme, encore, nos Sens ne sont pas<br />
toujours dans le meme etat; periodiqnement ils sommeillent et parfois<br />
nous trompent. Cependant le pyrrhonisme n'a pu triompher<br />
rle notre croyance en l'existence d'un monde exterieur, parce que nos<br />
sensations s'accordent plus par leurs ressemblances qu'elles ne se<br />
contredisent Par leurs differentes, parce que notre memoire et le<br />
temoignage de nos semblables confirment en general les donnees de<br />
notre perception. On ne demontre pas logiquement l'existence des<br />
Corps; mais la raison n'a que faire, pour lever ce doute, des analyses<br />
abstraites de la logique. I1 lui suffit qii'aucune probabilite ne puisse<br />
etre comparee 2 celle de l'accord du monde reel et du monde apparent,<br />
h moins d'accorder au hasard une place inadmissible dans iin univers<br />
ordonne. 20)<br />
En quoi donc consiste le travail critique de la raison? A coup<br />
sfir, si l'on demandait ii l'esprit de critiquer son propre pouvoir,<br />
l'exigence serait vaine et contradictoire. Mais l'homme a des<br />
facultes diverses et, si Ces facultes sont hierarchisees, et non simplement<br />
associees, la critique est possible des facultes inferieures<br />
par la plus elevee. Les sens, la memoire, l'imagination ne sont que<br />
des instruments pour la raison, et Ces instruments, h l'usage, se<br />
revelent ii la fois reguliers et capricieux, sujets h l'accident et soumis<br />
a la regle. La raison, au contraire, est essentiellement ordre, accord<br />
avec elle-meme, identite. a') Ainsi nous retrouvons dans l'esprit<br />
meme la distinction que nous avions trouvee dans les choses entre<br />
I'accidentel et le permanent, le probable et le necessaire; et, dans<br />
20) Essai, p. 162 sq. - 21) p. 173 sq.
222<br />
Un probabiliste moderne, Antoine-Augiistin Cournot.<br />
cette 6preuve sans cesse renouvelke que constituent la vie et l'experience,<br />
c'est la raison qui s'affirme comme l'instrument par excellence de la<br />
decouverte du vrai. Si l'on definit la verite l'accord d'une proposition<br />
avec le reel, et si toute vhrite est solidaire d'un systhme pliis vaste,<br />
on peut dire que la raison, par cela meme qu'elle veut l'ordre 2<br />
priori et le pressent, a pour elle les plus fortes chances de reussir.<br />
Au nom meme du probabilisme, elle peut parier pour elle-m6me. Sinon,<br />
h quel critere plus elev6 poiirrait-elle sans contradiction recourir?<br />
„L'id6e de l'ordre a cela de singulier et d'eminent qii'elle porte en<br />
elle-meme sa justification oii son controle . . . Les yeux nepeuvent<br />
temoigner pour les yeux, le gofit pour le gofit; mais la raison<br />
temoigne pour la raison, en meme temps qu'elle temoigne, selon le<br />
cas, pour ou contre les yeux et le goiit."**)<br />
Tontefois, qu'on l'entende bien, en reconnaissant la primaiite<br />
necessaire de laraison, Coiirnot n'introduit pas dans la theorie de<br />
la connaissance une faculth armee de pied en cap, riche de notions<br />
h priori et de principes premiers qii'elle puisse enoncer avaiit tout<br />
contact avec 11exp6rience. Cournot n'a pas assez de sev6rith pour<br />
le ,pele-m6le de la philosophie ecossaise, qai se piqiie de multiplier<br />
plutot que de roduire le nombre des vSrit6s premiere~"~~); il n'a pas<br />
plus d'indulgenco pour la „vieille m6taphysiqueU'*) qui, en s'isolant<br />
dans ses constructions a priori, s'est coup6 toute communication<br />
avec le reel et la science positive. I1 ne pretera donc point h la<br />
raison la notion B priori du temps infini, ni celle de la substance indestructible,<br />
car il serait absurde de dire qu'h l'aide de pareilles id6es<br />
la raison pourrait se controler elle-meme ou controler l'idee d'ordre;<br />
c'est au contraire l'idee d'ordre qui pourra controler celles<br />
d'infini et de substance et verifier si elles introduisent dans<br />
la connaissance la clart6, la simplicite et la cohhrence. L'idee d'iin<br />
ordre rationnel des choses se suffit 2 elle-meme; elle expliqiie tout<br />
ne suppose rien. Elle est, si l'on veut, le postulat simple et irreductible<br />
qiii permet de conferer aux approximations du savoir la<br />
plus haute probabilite.<br />
Un doute transcendant, il est vrai, subsiste. Mais pareil doute<br />
est pratiquement r6solu par la necessit6 meme de penser et d'agir;<br />
ce systeme, dit Cournot avec profondeur, ,,niest pas autre chose que<br />
le systhrne de critique suivi dans les sciences et dans la pratique<br />
de la vie. I1 faut se contenter de hautes probabilitks dans la solution<br />
des problemes de la philosophie, comme on s'en contente en astronomie,<br />
en physique, en histoire, en affaire~."~~) Le hasard est reel<br />
et tient l'esprit humain en echec. Mais la raison avertie assigne au<br />
hasard ses limites, et diminue chaqiie joiir la marge abandonnee i<br />
l'erreur.<br />
'L-<br />
?(-<br />
22) a. 180 - Cf. G. Milhaud. Note sui la raison chez Cournot.<br />
in: Rev. de MBt. et de mor., mai 1905, p. p. 307-18. -<br />
23) 1). 184.<br />
24) 'J?raitB de l'enchan. des idBes fond., p. 19 sq.<br />
25) Essai, p. 171.<br />
*
Un probabiliste moderne, Antoine-Augustin Cournot. 223<br />
A quel point cette theorie, d'apparence modeste, btait originale<br />
et feconde, toute l'oeuvre de Cournot devait le dbmontrer avec<br />
eclat. Ses travaux d'ordre bconomique"), auxquels des specialistes<br />
tels qne Quetelet, Lexis, Edgeworth ont rendu hommage, reposent<br />
directement siir la theorie probabiliste des statistiques. Mais c'est<br />
surtout en matiere de sociologie et de philosophie de l'histoire cjn'il<br />
convient de reconnaitre A Cournot un r6le decisif d'initiateur. Et<br />
ici encore c'est le probabiliste qui ouvre la voie au sociologue et A<br />
l'historien philosophe. Si, en effet, l'accident retrouve, jusque dans<br />
les sciences exactes, la place dont la determinisme scientifiqne avait<br />
sembl6 l'exclure, la distinction traditionnelle s'attbnue entre les sciences<br />
positives et l'histoire. L'histoire, d'iine part, rentre dans la science.<br />
La mecanique celeste, disions-nous dejh tout A l'heure, est amenbe<br />
A l'hypothese d'une cause aujourd'hui disparne pour expliquer la<br />
disposition actuelle des plans des orbites planbtaires. Tout le systeme<br />
de Laplace n'est-il pas un chapitre d'histoire cosmiqiie? La<br />
linguistique, la science des-mesures, ~'ktiide du calendrier ne-peiivent<br />
etre conGues hors du temps, comme la geombtrie ou l'hydrostatique.<br />
Des lors, reste-t-il vrai que la science n'ait pour objet, comme le<br />
repetent les maniiels, que les vbrites immuables? Certaines sciences,<br />
au contraire, telles que l'embryogenie et la geologie, out essentiellement<br />
pour objet des successions d'btats variables et de phases<br />
transitoires. - D'aiitre part, la science pbnetre dans l'histoire. Un<br />
bvenement historique est solidaire des effets qii'il ent,raine, et<br />
surtout des plus immbdiats. Cette connexion introduit une sorte<br />
de continuite entre des faits en apparence separes dans le temps,<br />
comme le tracb du cours d'un Aeuve siir la carte relie les points<br />
reperes par le gb~gra~phe. Cette continuite nous permet, malgre<br />
l'enchevetrement des causes fortuites et secondaires, de „saisir une allure<br />
generale des evenements", de Jistinguer des p6ri0,les d'accroissement<br />
et de decroissement, de progres, de Station, de decadence . . . "27),<br />
de demeler „des causes g6n6ralesL', qui exercent une action explicable<br />
sur iine multiplicitb de faits distincts, et des causes accidentelles, qui<br />
peuvent imprimer i la marche des faits de profondes variations.<br />
Äinsi l'histoire est une penetration intime de cäuses rationnelles et<br />
de contingences, de rbpbtitions et de rbvolutions, d'ordre et de<br />
hasard. Et le r6le de l'historien philosophe Sera de r6daire A<br />
leur place les causes secondaires, que l'histoire anecdotiqiie met au<br />
premier plan: intrigues de cours, maladies de soiiveraiiis, d6coiivertes,<br />
inveritions, coups d'eclat des grands hommes, revolutions grandioses<br />
meme, qui n'ont pu que mettre en jeu des causes plu4 durables et<br />
26) Ce sont: Recherchrs sur les principes mathßmatiques de la<br />
thborie des richesses, 1838; Principes de lathßorir des richesses, 1863;<br />
Revue sommaire des doctrines ßcoliorniq~ies 1877<br />
27) Essai, 11, P. 203 - Cf ConsidBr sur la niarche des idßes,<br />
tout le chap. I: I>e I'ßtiologie liistr~riqiir Voir h ce sujet I'art de<br />
G. Tarde. L'accident et le rationnrl rii histoire d'apres Cournot,<br />
in: 1Zev. de Mßt. et de Mor., mai 1906, p 319-47
224<br />
Un probabiliste moderne, Aiitoine-Augustin Cournot.<br />
plus profondes. Une fois de plus, le savant ne proclame la puissance<br />
du hasard que pour la limiter aii profit de l'ordre.<br />
Mais il y a plus; l'historien philosophe dessine l'avenue par la-<br />
quelle la sociologie rejoindra le systhme des sciences positives.<br />
L'histoire nous montre que l'individu exerce sur la societ6 moins<br />
d'action qu'il n'en regoit. L'individii isol6 n'est qu'une abstraction<br />
inventee par les philosophes. Comme les s6ries particulihres de faits<br />
physjques, l'individu est solidaire du milieu; il est l'accident que le<br />
moilvement des causes generales prepare et absorbe. De quelle<br />
nature est cette connexion reciproque dont Cournot a fait etat avant<br />
nos modernes solidaristes? Cournot 6tait trop s6dnit par le vita-<br />
lisme, dans lequel il apercevait „le vrai principe r6iovateur de<br />
la philosophie du dix-neuvieme si&cleU,") pour h6siter A etendre au<br />
,,corps social" les ,,analogiesU fecondes mises en honneur par cette<br />
doctrine. Les societes sont des „organismes que la vie fagonne, que<br />
la vie entretieut, clue la vie penhtre et dont . . . 1a.physiologie ne<br />
sera bien comprise qu'aiitant qii'on la rattachera 3i cette physiologie<br />
sup6rieuye, commune 3i l'animal et h la plante, A l'hornme individuel<br />
et aux societes h~maines.'~ 29) Mais, A vrai dire, l'analogie biologiqiie<br />
n'a, aux yeux de Cournot, qu'une valeur provisoire. Societes et<br />
organismes, solidaires A leur tour de 17univers materiel, sollt soumis<br />
A des lois plus compreheusives et tendent A devenir des m~canismes.<br />
Cournot donne de saisissants exemples de ce processus social:<br />
les langues se fixent, le droit se codifie. En un mot, une fois de<br />
plus, en sociologie comme en physique, l'accident cede peu A peu<br />
la place A l'ordre, l'evolution tend A la stabilite. Et cette consid6ration<br />
conduit Cournot h enoncer une loi sociologique d'une port6e<br />
inappreciable. I1 remarque que la phase proprement „historique" des<br />
societes, celle qui se signale par l'invention, l'initiative, les secousses<br />
politiques, n'ap$arait niiuaiidces societes se degagentde l'etat de nature,<br />
ni au terme du mouvement qui les emporte vers un ordre rationnel.<br />
La simplicite primitive de l'instinct et la maturit6 reflechie des<br />
societ6s adultes excluent ou r6duisent A son minimum I'action perturbatrice<br />
des innovations. I1 y a donc Une phase prehistorique et<br />
Une phase posthistoriqi~e qiii comportent, mieiix que la phase intermediaire,<br />
l'application des procedes communs de la science positive.<br />
Les societ6s 6voluent de l'ordre nature1 A l'ordre rationnel, k travers<br />
les soubresauts desordonnes de l'histoire proprement dite.30)<br />
Notre dessin n'est pas plan de poursuivre dans le d6tail les<br />
applications des theories de Cournot A l'histoire et A la sociologie.<br />
Aucun r6sum6 ne saurait suppleer A la lectiire, si attachante et<br />
28) Consider. 11, p. 160.<br />
29) Ibid., p. 161-2. Cf. Material., p. 191.<br />
30) Traite, 11, p. 343 et suiv Cf. C. Bouglh, Les repports de l'hist.<br />
et de la science soc. d'apres Couriiot, in: Rev. de Met. et de Mof.,<br />
Mai 1905, P. 349-76.
Cn probabiliste moderne, Antoine-Augustin Cournot. 225<br />
suggestive, de llEssai, et snrtout dii Traite et des Considbrations.<br />
Tout notre effort a 6t6 cle mettre en evidence l'idbe directrice de<br />
cette philosophie, et la tentative n76tait pas vaine s'il est vrai que<br />
Coiirnot a realisb la tache, en apparence paradoxale, de suspendre<br />
iin systeme franchement dogmatique ?i l'affirmation prealable de la<br />
realite dii hasard. C'est parce que la contingence complique, dans<br />
iine proportion qui echappe ?i l'exphrience, l'ordre relatif des choses,<br />
qne Coiirnot demande aux mathematiques la mesure approximative<br />
des probabiliths, et c'est parce qiie cette mesure est rcconnue possible,<br />
yu'il l'etend A toiis les domaines, recherchant, avec iine predilection<br />
croissante, cenx oh regne avec le plus d'evidence l'accident par<br />
excellence, la cause particuliere typique, ?i savoir l'action des individus.<br />
I1 passe ainsi, demarche audacieuse, des inathbmatiques ?i la sociologie<br />
et ?i l'histoire, avec d'autant plus d'assiirance que la mhthode probabiliste<br />
porte avec elle-m6me sa propre correction ; car elle prevoit l'erreiir<br />
probable, sollicite la critique et limite h l'avance ses propres conquetes.<br />
Peut-etre aussi ces pages permettent-elles d'entrevoir les raisons<br />
pour lesquelles la doctrine de Cournot est rest6e A peu pres inapercue<br />
des coiitemporains. Si, aprks 1'Exposition de la theorie des<br />
chances et des probabiliths, Coiirnot eilt continue CI appliquer aii<br />
probabilisme mathematiqiie ses rares qualiths d'analyse, il eilt sans<br />
doute force l'estime des savants de son temps et se fiit assnre une<br />
belle reputation parmi les successeurs de Laplace et de Lagrange.<br />
Mais Cournot eut la temerith d'aborder les questions philosophiques<br />
par une voie siir laquelle il ne devait rencontrer aucun des philosophes<br />
attitrbs de son temps, plus ferns d'humanites qiie de connaissances<br />
scientifiques. Sur cette voie, il ne rencontra pas m&me<br />
son illustre contemporain, Auguste Comte, mathematicien lui aussi,<br />
mais amene A Ia philosophie et A 1a sociologie par un tout autre<br />
chemin, celui de l'histoire du progrks des sciences, et trop frappe<br />
de la certitude propre ?i la science positive pour se preoccuper beaiicoiip<br />
de hasard et de contingence. Aussi bien, au moinent oii Cournot<br />
ecrivait son Essai, Comte n'etait gukre connu encore que de Ses<br />
disciples imrnediats, et il n'avait conquis ceux-ci qu'au prix de luttes<br />
passionnbes et par l'ascendant de son zkle d'apotre. Cournot, fonctionnaire<br />
paisible et inventenr modeste, n'alla point aii devant dii<br />
public; sa parole n'enseigna jamais une doctrine qu'il se contenta<br />
de confier 2 ses livres. S'il eut des disciples, il ne les connut pas.<br />
Aucune de ces raisons d'ailleurs ne justifie l'insucc&s d'une philosophie<br />
dont on commence seulement reconnaitre la grandeur et la<br />
cliscrete influence; peut-6tre meme ne l'expliquent-elles pas toiit entier.<br />
C'est sans doute qn'il entre tonjours, dans les reputation philosophiqiies,<br />
comme dans la gloire des artistes et des hcrivains, iine part<br />
iildefinie de contingence et d'irrationnel. Nd, encore Une fois, iie<br />
pouvait accueillir cette injustice avec moins d'etonnement et d'arnertiime<br />
que „le philosophe du hasard."<br />
Philosolili. <strong>Abhandlungen</strong>.<br />
m-
Spinozas Identitätsphilosophie.<br />
Von<br />
Hermann Schwarz, Halle a. C.<br />
pinozas Identitätsphilosophie ist nichts Einheitliches. D r e i<br />
verschiedene Bestimmungeiz haben sich hier ineinander ver-<br />
schlungen und geben dem Leser zu raten auf. Die Rätsel eat-<br />
wirren sich ihm nicht eher, als bis er aufhört, der spiizozistischeil<br />
Identitätsphilosophie nur einen einzigen Sinn beizulegen. Spinozas<br />
Satz: orclo et connexio idearum idem est, ac ordo et connexio rerum<br />
(Ethica Pars I1 prop. VII) hat drei verschiedene Bedeutungen. Sie<br />
sind gänzlich voneinancler zu trennen und haben keinen Puillct gemein-<br />
sam. Mit jeder antwortet Spinoza auf ein besonderes Problem. Auch<br />
diese Probleme hangen in lreiiler Weise zusammen. Nur die Einheit des<br />
Ausdruclrs verlrniipft sie und gibt dadurch dem Monismus Spinozas<br />
den Anschein einer Geschlossenheit, die er nicht besitzt. Spinozas<br />
Monismus ist das weite Gewand, das viele Begriffsreihen umspannt,<br />
aber auch inanclie Begriffslüclren deckt. Die Identität des Leibliche11<br />
und Seelischen, auf die man Spinozas Einheitslehre in erster Linie zu<br />
beziehen pflegt, rüclct in dieseln Gedanlsengewebe. gerade an die letzte<br />
Stelle. Nit dem EIauptstroin spiilozistischer Vorstellungsweise hat sie<br />
nichts zu tun. Es ist ein JViiilselchen der Verlegenheit, an dem wir<br />
iliren logischen Ort finden werden.<br />
Die drei Probleme, bei deren Beantwortung der vorangeschickte<br />
Satz jedesmal einen anderen Sinn erhält, sind: a) das Problem der<br />
iinmanenten Kausalität, b) das Substanzproblem, C) die Frage nach<br />
dem Verhältnis von Denlcakt und Deiikobjelct. Mit dem ersten sind<br />
wir im Hauptstrome der spinozistischen Philosophie. Das zweite ent-<br />
steht durch eine Schwierigkeit, die sich der Autor selbst schafft. Das<br />
dritte tritt auf, um durch die Anleihe bei einem neuen Gedanlsenlcreisc<br />
eine Lücke auszufülleil, die in Spinozas Beliaiidluilg des Substanz-
Spinozas IdentitLtsphilosophie. 227<br />
problems lrlafft. Den &littelpui~l
Spinozas IdentitMsphilosophie. 229<br />
vereinigt. Es kann nicht anders sein. Betätigt sich, wie Spinoza lehrt,<br />
der logische Grund als hervorbringende Ursache, so verstellt sich von<br />
selbst, dais, wic die Folgen im Grund besclilossen b l e i b e n und ohne<br />
Geltung des Grundes für sich nichts gelten, ebenso auch das jenen<br />
Folgen zugehörige esse f orniale im esse formale des Grundes beschlossen<br />
b 1 e i b t. Das Sein des Grundes erscheint einerseits als tragend und<br />
U m f a s s e ii d für das Sein aller Folgen (Deus sivc s u b s t a ii t i a),<br />
wie es anderseits fiir sie b e d i n g e ii d erscheint. Quidquid est in Deo<br />
est et niliil sine Deo concipi potest (alles e X i s t i e r t in Gott, weil<br />
aus dem Begriffe Gottes alles g i 1 t). (Eth. I, prop. XV, und überein-<br />
stimmeiid die Definition des „modus"). Ausdrücklich genug erklärt<br />
Spinoza, daCs den Folgeessentiae in ihrer Sonderbestimmtheit n i e h t<br />
die Existenz des esse formale durch ihr eigenes begriffliches esse ob-<br />
jectivum zuflieist. N U r zum Begriffe unendlicher Vollkommenheit<br />
gehöre als logisch notwendiges Moment das Sein (kurzer Traktat,<br />
§ 1?,3 des zweiten Kapitels; Eth. I, prop. XI, XXIV; Eth. 11, prop. V).3)<br />
Nur clurcli Teiliiahn~e der Dingbegriffe an Gottes, sein eigenes Sein<br />
bedingendem, Begriffe ist das Sein der Dinge.<br />
Fassen wir zusammen: dem durch-sich-selbst-Bestehen Gottes ent-<br />
spricht ein durch-sich-selbst-Folgern seiner esseiitia. Gottes durch-sich-<br />
selbst-Bestehen ist ihre erste und unmittelbarste Selbstfolgerung. Die<br />
esseiitia und die existentia aller übrigen Dinge sind die unzählig vielen<br />
weiteren Selbstfolgerungen Gottes, die aus der unvermeidlichen Deter-<br />
mination seines Wesens von selbst abflieisen.<br />
Aus den obigen Voraussetzungen ergibt sich für Spinoza mancherlei.<br />
Der Urgriiiid, der durch die Notweiidigkeit seines Wesens Folgen aus<br />
sich hervortreibt, jene actuosa essentia, aus der das System der Ding-<br />
begriffe in logisclier Ordnung hervorgeht, rückt von jedem traditio-<br />
nellen Gottesbegriffe weit ab. Dem Dreieck gleicht er, aus dessen Be-<br />
griffe ebenfalls eine Welt von Folgen, eine kleinere Welt, gebunden aii<br />
und beschränkt auf die Natur des Dreiecks, hervorgeht. Was solche<br />
Gesetzlichlrcit der mathematischen Figuren iin lcleinen ist, ist der gött-<br />
liche Urbegriff im groisen: das innerste Gesetz der Welt. Dieses göttliche,<br />
wirksame Urgesetz, das unendliche Et~as,~) nennt Spinoza, eben<br />
weil er es unpersönlich auffaist, Natur (vgl. weiter unten S. 232). Der<br />
Sprachgebrauch hat sich erhalten. Noch heute versteht man unter<br />
„Natur(' ein unendliches, immanent schaffendes Etwas, dessen Gesetzlichkeit<br />
(Essentialität) nicht blois logisch gilt, sondern real, alles<br />
bestimm'end uiid determinierend, w i r l< t. Die unausrottbare Rede, dais<br />
„Gesetze wirken", geht auf Spinoza und durch ihn auf den Gedankenkreis<br />
des ontologisclirii Gottesbeweises, auf Scholastik, zurück. Nach<br />
Spinoza ist der unendliche Begriffsiiihalt (= Allmacht) Gottes in der<br />
Natur „vollständig realisiert und in Aktualität getreten, so dais in<br />
Gott keine Kausalität sich findet für irgend etwas, das nicht in der<br />
3) Vgl. Camerer, .Spinoza lind SchleiermacherK, S. 19, 20, 39.<br />
4) Vgl. Camerer, a. a. 0. Q. 66, 68.
230 Spinozas Identitiitsphilosophie.<br />
Natur effektuiert wäre."j) Diese ICausalität ist kein IIaildclii nach<br />
Zweclien, keine irgendwie freie Tätigkeit, sondern das logische Selbst-<br />
folgern des göttlichen Begriffs, der, weil er selbst die Existenz ein-<br />
schliefst, Sein bedingt, wo er Folgen bedingt.<br />
Die erstc Wendung, die die Ideiitititsp>l~ilosophie bei Spiiioza<br />
nimmt, liegt nun klar auf der Hand. In bezug auf Go t t druclrt sie<br />
Eth. I prop. XX aus: „Dei existcntia eiusque essentia uiiuin et idem<br />
sunt", d. h. mit dem esse objectivuiii des göttlicheii Begriffs schliefst<br />
sich notwendig das esse formale seiner Existenz zusamrnei1.G) Zu der<br />
idealen Wesenheit Gottes, wie sic sich begrifflich - sub ratioiie essentiae<br />
(ib. corrol. 2) - offenbart, tritt - sub ratioile existentiae - die seiende<br />
Wirklichkeit Gottes. So ist es mit Gott, so ist es mit allen Folgen<br />
aus Gott, den m o d i s. Identität, Parallelismus sub ratione cssciitiae<br />
und existeiltiae auch hier. Sub ratione esseiitiac: das Reicli der logi-<br />
schen Folgen, wie sie in Gottes Urbegriffe begrifflicli ruhen. Dieselben<br />
Folgen, aber sich nicht als bloisc logische Emanationcil darstellend,<br />
sondern von der Rcalität des göttlichen Seins mitergriffen: die Welt der<br />
Wirklichlieit, sub ratione existentiac. Ordo et connexio idearum idem<br />
est, ac ordo et coniiexio rerum: das ist so aufgefalst, nicht der<br />
Parallelismus von Physischem und Psychischein, von Ausdeliiiung und<br />
Bewufstsein. Treten doch beide auf Seite der Wirkliclil
Spinozas Identitatsphilosophie. 231<br />
~~erbuildeiie sich logisch Determinieren aller Diiige aus der Uressentia<br />
Gottes, cl. i. dem Weltgesetz. Es ist die sich von selbst vollziehende Ableitung<br />
unendlich vieler Folgebegriffe aus dem höchsten Begriffe des<br />
allervollkoinmensten (= a b s o 1 U t unendlichen) Seins. Genau diese<br />
sich ableitende Begriffswelt ist das, was (sub ratione essentiae) in<br />
Dei iiitellectu objective existit, und dem in der Natur die formalis<br />
existentia rerunl, d. h. die Existenz der Dinge entspricht (sub ratioiie<br />
existeiitiae). Es ist mit Rüclrsicht auf spätere ganz andere Wendungen<br />
bei Spinoza wichtig, dies festzuhalten uiid mit stärkstem Nachdruck zu<br />
betonen. Wir dürfen die drei verschiedenen Identitätstheorien bei<br />
Spinoza nicht vermischcii, sondern müssen sie streng auseinanderhalteil.<br />
Später hören wir von Ideen in Gottes Verstande, die wie die menschlichen<br />
ihre erkennenden Akte und ihre erkannten Objekte haben. Nichts<br />
davon hier. Dieser Intellelrt, der iiltellectus Dei des vorliegenden<br />
Scholions, dieses sich von selbst Folgern ist wirklich nur dem Namen<br />
nach, was wir sollst unter Intellelrt verstehen. Es macht sich uiipersönlich<br />
uiid ungeistig. Da ist weder Vorstellung noch Bewuistsein. Da ist<br />
blois die logisch in~maneiite Auseinanderfaltung reiner Wahrheit (der<br />
essentia Dei) in tausend und abertausend Folgewahrheiteii. Hier vermitteln<br />
nicht irgeiidwelche E r lr e n n t n i s s e von den Sachen, die Abspiegelungen<br />
derselben in geistigen Akten, einen Scliluls nach inenschlicher<br />
Art, sondern die im Begriff Gottes enthaltenen Dingwesenheiten<br />
bzw. ihre Wahrheiten vermitteln und erschliefsen sich eine aus der<br />
anderen. Wo Erkenntnis ist, da ist auch Zurückweisung von Falschheit<br />
und daniit auch vorangeheilder Weise zuvor die Vorstellung von Falschheit<br />
und Xichtesistierelzdem. Da gibt es Gedankenbilder voll Imaginärem<br />
uiid Nichtseiendein, denen eine Wirklichlreit niemals zulronimen<br />
k a ii n. Was Spinoza in immanenter Dedulrtioii aus dem Urbegriff<br />
Gottes aii logischen Folgen hervorgehen läist, das sind Weseiisfigureii<br />
von Dingcn. - , in denen sich Gottes allervolllromnienste essentia ausstralilt,<br />
und denen daher, durcli immanente Teilnahme dieser Folgeessentiae an<br />
der sich selbst mit notwendigen1 Sein schmückenden Uressenz, Wirlrliclikeit<br />
zulrommen rn u i s. Dem Denken von jener erkennenden Art, das<br />
mit dem Naise nieriscliliclier Psychologie gemessen wi'd, korrespondiert<br />
die Wirklichlreit so und so oft n i c h t. Da gibt es lreine notwendige<br />
Koincideiiz des gedanklich Vorschwebenden mit dem Sein von Dingen.<br />
Ja, machen wir sogar die Annahme eines solchen Denkens, das das<br />
unsere quantitativ uiiendlich übertrifft, wenn es im übrigen nur die qualitative<br />
Eigenart des unsrigen teilt (d. h. an K e ii 11 t n i s n e h m e n<br />
in geistigen Akten gebunden ist), so gilt noch immer dieselbe Ungleichung<br />
zwischen Denken uiid Sein. Jener quantitativ den unsrigen<br />
um Unendliches übertreffende Verstand wäre zwar nicht wie unserer auf<br />
geistige Ausmessungen im Bereiche nur von zwei Attributen (auf Einsichten<br />
und Einbildungen aus der Natur des Bewuistseins und der Natur<br />
der Körperlichkeit) beschränkt. Er vermöchte in noch ganz andere<br />
Reiche der göttlichen Vollkominenheit hineinzuschauen und auf deren<br />
Grundlage auch Nichtseiendes anderer Art zu imaginieren oder als un-
vahr z~rückzumeisen.~) Die Möglichkeit einer Nicht-Koincidenz seiilcr<br />
Gedankengebilde mit den1 wirklichen Sein in der Welt teilte er doch mit<br />
unserem Verstand. Ja, das von ihm (dem unendlichen ln e 11 s e h e 11 -<br />
a 11 11 1 i e 11 e 1 Verstand) imaginierte Nichtseiende miiiste ebensogut wie<br />
das Gebiet ii ii s e r e r Einbildung, unserer logischen Fehler und unserer<br />
fiktiven Abstraktionen von deiil Sein in der mi&lichen IITelt der Dinge<br />
notwendig differieren (Eth. I, prop. XXX).<br />
Die Koincidenz zwischen „DenkenL' und Sein besteht aber und<br />
besteht notwendig, sobald wir, wie oben, beiin Namen des „DeiikensL(<br />
alles Psychologische beiseite lassen iiiid darunter nur das idpele<br />
Abfliefsen von Folgen aus den1 durch sich selbst existierendeii Crbegriff<br />
der Volllcomnienheit (ens perfectissimun~) verstehen. Dieses<br />
idea, ist aber keine idea. Hiermit stimmt das Corrol. zu Etli. 11, prop. V1<br />
iibereiii: esse formale rerum, quae modi non sunt cogitandi (richtiger:<br />
auch der Denlcmodi!), n o 11 sequilur ideo ex divina iiatura, quia res prius<br />
C o g ii o v i t : sed eodem nlodo eadeinqiie i~ecessitate res ideatae ex suis<br />
attributis coilsecluuntur et e o 11 c 1x1 d u n t U r , ac ideas es attributo<br />
cogitationis coilsequi ostendimus. So misseil wir jetzt, was Spiiioza unter<br />
dem unendlichen Verstand Gottes uild den darin in esse objectivo enthaltenen<br />
Ideen versteht. Von d i e s e n „Ideen", den ideellen Folgen<br />
aiis dem durch sich selbst existierenden Regriff der Volllrommenheit, gilt<br />
es, und von ihnen gilt es nach Spinozas Voraussetzungeiz ohne weiteres,<br />
dafs der Urgriiiid, der sie aus sich selbst folgert, sie eben dainit seiner<br />
eigenen Existeiiz mit teilhaftig i~lacht, d. h., dais sie in Sachen, Dinge<br />
uinschlagen: ordo et coiinexio „idearuinLL idem est, ae ordo ct connexio<br />
rerum (Eth. 11, prop. VlI). Solcher Auffassung entspricht völlig, dais<br />
auch umgekehrt alles, was ist (sub ratione existentiae), von Spinoza<br />
charaliterisiert wird als notwendige Folge aus dem Urbegriffe Gottes<br />
(sub ratione essentiae). Soviel logische Folge aus Gottes Regriff, soviel<br />
Sein; soviel Sein, soviel logische Folge aus Gottes Begriff.') Sofern<br />
sich in solcher Weise die als der „unendlicl-ie Verstand Gottes" gedeutete<br />
actuosa essentia Dei (die sich schöpferisch entfaltende Gottwesenheit)<br />
als letzten Grund aller Essenz und Fxistenz darstellt, heilst sie natura<br />
~iaturans. Das Systenl aber der ideellen Folgen daraus, der Dingwesenheiten,<br />
denen sie Existenz mitteilt, heilst natura naturata. Zur natura<br />
naturata gehört nach dem Vorangeschickten auch alle psychische Denlrtätigli-eit,<br />
sei es die des endlichen meilschlichen Verstandes, sei es die<br />
nach dem Muster des menschlichen Denkens konstruierte, nur auf die<br />
Erkenntnis unendlich vieler Attribute ausgedehnte eines unendlichen<br />
Verstandes (Eth. I, prop. XXSI). Bloise llodi a11 der Substanz sind sie<br />
beide; beide sind Selbstfolgerungen dieses alle Esseilz und alle Existenz<br />
bestimmenden Urgrundes, der in seiner ideellen Wesenheit (sub ratione<br />
esseiltiae) als letzte logische Bedingung aller essentiae G o t t (die<br />
Gottwesenheit in ihrem esse objectiaim, das Weltgesetz), in seiner<br />
7) In diesem Sinne spricht Spino7a mehrfach von dem, was unter einen<br />
unendlicheii Intrllekt fallen kann (cadrrr potcat), 7 R. Eth. I, prop 16<br />
8) Vg1 auch Eth. IT, prop 17, wo der {{rweis datauf hinarrqliiuft, da!s<br />
Seiendes erkennen" dasselbe heifse, wie Gott erkennen". 11, 44, 45.
~e:lbc.il Selbstclarstel1uiig.g als letzte liausale Bediiiguizg aller Existenz<br />
(siib rritione cxisteiztiae) N a t u r (die Gottwesenheit iiz ihrem esse<br />
formale) heilst und in sich selbst die Einigung von Essenz und Existenz<br />
als ..Substanzu verwirliliclit.<br />
Soviel uber Spinozas Begriffsrcalismus und über die erste, nämlich<br />
die hrgriflsrealistisclic Deutung, die sein Satz vom Parallelismus der<br />
icle:~i, und der res von hier aus gcseheiz fordert. Die Schwächcil dieser<br />
Leim-e lirgen auf der Rand. Die Idee der Vollkoinnleizheit wird gleichsam<br />
in den leeren Raunz geworfen, um sich durch ihre logische Entfaltung<br />
mit Existenz und Welt zu erfüllen. Das ist auch eiiie Begriffshypostase,<br />
wriiiger schroff als bei Platoil, weil jene ideelle Essenz Gottes liraft ihres<br />
Inhalts die Existenz s i c h z U e i g ii e 11 soll, statt dafs sie ihr b e i g e -<br />
1 e g t m7 i r d. Vor allein aber, die Art uiicl Weise, wie sie zur Existenz<br />
und Weitwcrduiig koiiimt, ist unmöglich. Schief ist es, dais ein nackter<br />
Grund selber die Folgeii aus sich ziehen und heraussetzen soll, die nur<br />
ein denkender Verstand aus ihm folgern kann. Schiefer noch, wenn<br />
wir ans das achten, was der aktuose Grund aus sich heraus ableiten und<br />
zur Existenz bringen soll, modi, Dinge, die nicht real in ihm, sondern in<br />
denen logisch er enthalten ist (vgl. Eth. I, Axiom 4). Als ob der Teil<br />
das Ganze produzierte oder aus dem Teil das Gaiize auch nur gefolgert<br />
werden liönnte ! Als ob Grund dasselbe wie Ursache wäre, als ob zwischen<br />
Ursache und TTTirliuilg generische Gleichheit bestehen müiste! Es<br />
sollte heute nicht mehr nötig seiii, die Unmöglichkeit solcher Vor-<br />
stellungsweisc zu betonen. EIat doch schon Leibniz, indem er Causa<br />
efficieils iiild ratio sufficiens unterschied, die Grundscliwäclie des<br />
Spinozistischeil Systems anfgedcclit und es entwurzelt. Und IIume<br />
liatte es gaiizlich vernichtet in dem Augenblicke, wo er zeigte, dais sich<br />
der Begriff der Wirkung in keiner Weise aus dem Begriffe der Ursache<br />
herauslrlauben läist. Es war Spinozas fundameiitalster Irrtum, das<br />
Verhältnis voll Ursache und Wirkung als ein rationales anzusehen (vgl.<br />
Eth. I, Axiom 5). Allein die Ursache ist nicht in der Wirkung, noch<br />
die Wirliiing analytisch in der Ursache enthalten, wie die Folge im<br />
Grund. Ini Gegenteil, das eine ist aus dem anderii unableitbar. Alle<br />
Wirkung ist eine Art Keuschöpfung, die kausalenTrerhältnisse sind daher<br />
irrational. Der einfache Umstand, dais es in der Welt dergleichen, wie<br />
Ursaclie und Wirkung, gibt, stöist den ganzen Gottes- und Naturbegriff<br />
Spinozas um. Diese Gott-Natur, die aus sich selbst folgern, ihre Folge-<br />
riingeii wie Wirkungen produzieren und durch jede ihrer generischen<br />
Unendlichlieiteii das Endliche gleicher Art real in sich aufnehmen soll<br />
(als ~väre das Subsumtionsverhaltnis ein Inhärenzverhältnis), ist ein<br />
toter, blutloser Sehemeiz. So viel Angaben, so viele Irrtümvr sind in<br />
ihnen enthalten; der Irrtum des B e g r i f f s r e a 1 i s m u s wird hierbei<br />
clurch rlen eines überhastcten R a t i o n a 1 i s in u s noch potenziert.<br />
11. Die Attiibutenlehre.<br />
Spiilozas Attributenlehre ist eiiie konsequente Weiterbildung der alt-<br />
überlieferten Anschauung, dais Gott das ens perfectissimum sei. Nach<br />
dieser Anschauung liegt in Gott eine unendliche Steigerung aller
23-1 Spinozas Identititsphilosophie,<br />
menschlichen Fähigkeiten, uileildlicher Verstand, uiiendliche Giite, uiiendliche<br />
Xacht, unendliche Dauer, unendliche Schönheit (Harmonie)<br />
vor. In solchem Sinne galt dem Bischof Anselm V. Canterbury Gott als<br />
das allervollkommenste Wesen, und in demselben Sinne meinte auch<br />
Descartes seine ,,unendliche Substanz" (res infinita).<br />
Einen viel schärferen Sinn von Unendlichkeit und Vollkommenheit<br />
verbindet Spiiloza mit der Wesenheit (essentia) Gottes. Die Früheren<br />
hätten nach ihm immer nur von der vollkommensten essentia Dei gesprochen,<br />
ohne im einzelnen zu sagcn, wie sie sich konstituiert, was sie<br />
alles enthalten mufs, um in j e d e r Beziehung das vollkommenste Sein<br />
auch wirklich zii sein. Sie hätten Gott durch „Proprietäten" (äufsere<br />
Benennungen), nicht durch „Attribute" (seine innere Wesensbeschaffenheiten)<br />
definiert." Spinoza macht mit dem Begriff der Unendlichkeit<br />
Gottes Ernst. Gott ist ihm das in j e d e r Gattung unendliche Sein.<br />
Erstlich: Gott ist ihm das in jeder G a t t U n g unendliche Sein. Gott<br />
soll nach älterer Annahme Güte, Weisheit usw. besitzen. Das reduziert<br />
sich aber darauf, dais er „unendliches Bem~uCstseiii" (Denken, cogitatio)<br />
besitze. Weisheit, Güte usw. seien nur „modiU des Bewufstseins. Bewufstsein<br />
ist der höchste Gattungsbegriff, dem gegenüber alle jene<br />
Einzelheiten (soweit sie nicht blois Ant,l~ropomorphismen becleuteiz) nur<br />
„in suo genere finita" sind. Erst der Gattungsbegriff des Bewuistseins<br />
(cogitatio) sei das hierher gehörige in suo genere in finitum. Nur<br />
dieses unendliche gattungsmäisige Bewuistsein könne in der unendlicl-ien<br />
essentia Gottes enthalten sein, und es müsse auch in ihr enthalten sein,<br />
weil keine Realität (Essentialität) aus dein allervollkommensten esse<br />
ausgescldossen sein könne. Eben darum ist nun zweitens Gott das in<br />
j e d e r Gattung unendliche Sein. Soviel generische Essentialität, so<br />
viele Attribute Gottes. Uns Menschen ist neben dem Gattungscharakter<br />
des psychischen Seins (der Begriff der Energie war damals noch unbelrannt)<br />
nur nocli e i n e andere allgemeine Gattungsbestimmtheit bekannt,<br />
das psychische oder ausgedehnte Sein. Auch die Proprietiät der<br />
Körperlichkeit muis deshalb in die göttliche essentia eingeschlossen sein,<br />
sie ist ein zweites Attribut derselben. In der göttlichen Wesenheit<br />
sind überhaupt so viele Unendlichkeiten in ihrer Art, so viele Gattungscharalrtere<br />
von positiver sachlicher Bcstimmheit oder „Attributec' anzunehmen,<br />
als deren irgend denlrbar sind: als solche nicht blofs unserin<br />
endlichen Verstande, sondern einem auf a 11 e Fülle des Seins gerichteten<br />
unendlichen Verstande denlrbar und zugänglich sind. Das ens perfectissimum,<br />
können wir es ausdrücken, enthalt in seiner essentia ein Universum<br />
von begrifflicher Unendlichl~eit. Seine Attribute sind tausend<br />
und abertausend platonische Ideen, wenn wir diesen Namen von den ,,in<br />
ihrer Art unendlichen" Entitäten gebrauchen dürften. Man könnte auch<br />
sagen, in Spinozas Substanz lebt das absolute Sein der Neuplatoniker<br />
wieder auf, so zwar, dafs von ihm Ideen, Attribute, oberste Wesensbestimnltheiten<br />
emanieren, ehe von diesen weiterhin die Dinge<br />
emanieren.<br />
9) Vgl. Camerer, a. a. 0. S. 54.
Spinozas Identitätsphilosophie. 235<br />
Wie verhalten sich jene Attribute nun einerseits zu Gott, ander-<br />
seits zueinander? Zunachst, wie verhalten sie sich zu G o t t ? Wir be-<br />
ginilen mit der b e g r i f f 1 i c h e 1 Scite dcs Verhältnisses, betrachten<br />
es also in dem ordo idearum. Im B e g r i f f Gottes, seiner logischen<br />
essentia, ruhen alle jene unendlichen und unzählig vielen Wesens-<br />
bestimmtheiten in logischer Weise, nämlich so, dais die essentia Dei<br />
trotzdem eine uiigebrochene Einheit bleibt. Es ist etwa so, wie in der 7<br />
die 1 und 6, die 2 und 5, die 3 und 4 und unzählig viele Bruchsummanden<br />
enthalten sind. Die 3 und 4 heiisen zwar „Teilec' von 7, sind es aber in<br />
einem ganz anderen Sinne als z. B. die Stockwerke und der Giebel<br />
,,Teile'( eines Hauses sind. Das Haus b e s t e h t aus Stockwerken und<br />
Giebel, es läist sich in diesc seine Teile real zerlegen, sie bleiben in ihm<br />
gegenseitig voneinander getrennt. Die 7 dagegen ist eine ungebrochene<br />
Einheit, sie schlieist das Merkmal, die Summe von 2 und 5, 3 und 4 usw.<br />
zu sein, logisch in sich. Ähnlich schlieist der Begriff des Dreiecks<br />
logisch in sich, dais seine 3 Winkel 2 R betragen, so schlieist überhaupt<br />
in diesem logischen Sinne jeder Grund seine Folgen ein, und so ruhen<br />
auch die Einzelvollkommenheiten, die besonderen Unendlichlceiten jeder<br />
Art iil der Allvollkommenheit und totalen Unendlichkeit Gottes.<br />
Indessen Gottes essentia bleibt ja nicht blois Begriff. Sie bestimmt<br />
sich selbst zur E xi s t e n z, sie bestimmt mit zur Existenz alles, was<br />
logisch in ihr ruht und als Folge aus ihr hervorgeht, und läist an ihrem<br />
Sein das Sein aller ihrer Folgen teilnehmen. Mit diesem Gesichts-<br />
punkte treten wir auf die reale Seite des Verhältnisses zwischen der<br />
göttlichen Esscntia und ihren Attributen, wir befinden uns im ordo<br />
rerum. Wie kann es hier geschehen, dais Gott im Verhältnis zu den<br />
Dingen auch realiter dieselbe ungebrochene Einheit bleibt, als die sich<br />
seine esscntia logisch begrifflich erwiesen hatte, während sie doch zu-<br />
gleich den Grund für unzählige Folgen bildet? Spinoza antwortet auf<br />
diese Frage ganz plausibel mit dem Gedanken der „Substanz". Er faist<br />
das göttliche Sein als S u b s t a n z , alles übrige als „Bestimmungen der<br />
Substanz" auf. Wie nämlich der Begriff logisch die Bedingung für die<br />
Folgen ist, ist die Substanz real die Bedingung für das Sein aller ihrer<br />
Proprietäten und Akzidenzien. Sie ist das selbständige Sein, die Pro-<br />
prietäten und Akzidenzien (Attribute und Modi) sind das unselbständige<br />
Sein, das an dem selbständigen Bestande der Substanz nur teilnimmt.<br />
So wenig wie der Grund logisch in seine Folgen zerfällt, zerfällt hierbei<br />
die Substanz real in ihre Attribute und modi.<br />
In einem Punkte freilich stimmt die Harmonie zwischen dem<br />
ideellen Kosmos (essentia Dei) und dem realen Kosmos (Deus sive sub-<br />
stantia) nicht ganz. Der Grund enthält seine Folgen in sich, die<br />
Substanz enthalt ihre Proprietäten und Akzidenzien an sich. Von den<br />
Folgen kann man in dem vorhin erläuterten Sinne sagen, dais sie in<br />
dem Grunde 1 o g i s C h enthalten sind, von den Proprietäten und Alczi-<br />
denzien aber darf man in keiner Weise sagen, dais sie i n der Substanz<br />
r e a 1 enthalten sind. Sonst wiiren sie „Teile'' der Substanz, diese würde<br />
aus einem Träger von Bestimmtheiten, die nur durch sie zu existieren
vermögen, zu cinem bloiseii Konglomerat, das vielmehr seinerseits nicht<br />
anders als aus den Teilen iind iil seinen Teile11 bestünde. Letzteren<br />
Gedanken wehrt aber Spinoza ab und mufs ihn abwehren. Gott gilt<br />
ihm, soweit sein System koiisequent bleibt, durchaus als dcr e i n h e i t -<br />
1 i c 11 e Grund der Welt. Die vieleil Attribute erhalten demeiltsprechend<br />
+oll Gott, nicht Gott von ihnen, die Existenz. Indem ihre essentia in der<br />
allvollkonimcilcn Gottwesenheit aufgenommen ist, werden sie auch da-<br />
durch und nur dadurch der Existenz teilhaftig, die mit innerer Not-<br />
wendigkeit zur göttlichen essentia gehört. Denn jedem einzelnen dieser<br />
Attribute, rein für sich genommen, jeder einzelnen Vollkomnirnheit, ist<br />
1 i c h t die Existenz durch ihren Begriff gesichert. Erst aus der Fülle<br />
a 11 e r Vollkon~mei~heit kann die Existenz notwendig erschlossen werden<br />
und flieist derselben kraft ihres Inhalts von selbst zu.<br />
Bliclrril wir jetzt auf das Verhältnis der Attribute z U e i n a 1 d e r !<br />
Dieselben sind, ihrem Begriffe nach alle gegeneinander exklusiv. Jedes<br />
ist ja das in s e i n e r G a t t U 11 g Unendliche und reicht nicht hinüber,<br />
könnte nicht hinuberreichen in die generisch-unendliche Bestimmtheit<br />
des andcrn, so wenig etwa, wie sich der Begriff der Farben mit dem der<br />
Töne oder Temperaturen vergleichen liest. Es ist nun aber eine verhäng-<br />
nisvolle Konsequenz, zu der sich Spiiioza durch solche Exlrlusivität der<br />
Attribute verleiten läist. Sie legt sich nahe, wenn man, vom Gesichts-<br />
punkt der Gegensiitzlirhlreit aller Attribute geleitet, auf die Ursache<br />
für die Existenz eines jeden von ihnen hinblickt. Die g a n z e esscntia<br />
Dei, hörteil mir, soll, indem sie sich selbst zur Existenz bestimmt, im-<br />
plicite auch die Ursache für die Existenz jedes einzelnen Attributs sein.<br />
Aber W a s lrailn voll der ganzen essentia Dei denn nur beteiligt sein für<br />
clen Umstand, dais z. B. Ausdehnung nicht nur logisch begrifflich gilt,<br />
sondern in den drei Dimensionen aller Körperlichlreit real existiert?<br />
Man brauclit nur mit Spinoza den Gedanken Causa aequat effectum fest-<br />
zuhalten, ilni sogleich zu bemerken, dais hierfür die übrigen Attribute<br />
derselben Substanz schlechterdings nichts beitragen können. Das wird<br />
durch die gegenseitige Exklusivität derselben, immer im Sinne jenes<br />
rationalistischen Gedankens, ein für allemal verboten. So scheint nur<br />
übrig zu bleiben, dais dem Attribut der Ausdehnung die Existenz durch<br />
die essentia Dei nur insofern zuflieist, als in deren Allvolllrommenheit<br />
eben auch das begrifflich generische Wesen der Ausdehnung aufge-<br />
nommen ist, d. h. dem unendlichen Attribut der Ausdehnung kommt die<br />
Existenz schon an und für sich genommen zu. Ebenso zeigt es sich mit<br />
dem Attribute des Dcnkcns (des Bewuistseins), ebenso mit den unzählig<br />
vielen übrigen Attributen Gottes.<br />
Zuerst gab es nur eine essentia, die allumfassende, in allen Gat-<br />
tungen unendliche Essenz Gottes, der das Prädikat der Existenz durch<br />
sie selber zukam, und dies beides zusammen, die essentia plus existentia,<br />
war die eine göttliche Substanz, der einheitliche Urgrund und das ein-<br />
heitliche Allseiil. Jetzt auf einmal zerfällt dieselbe essentia der A 11 -<br />
vollkommenheit in unzählige einzelne, in ihrer Art unendliche (voll-<br />
kommene) Attribute, die schon alle in dieser ihrer unendlichen Einzel-
Spinozas Identitätsphilosophie. 137<br />
heit mit Existenz ausgestattet siiid. Aii Stcllc der ciileii Sul~staiiz sind<br />
auf einmal so viel uiigezahlte Ursubstanzen da, als es Attribute gibt.<br />
Xit auiserordentliclier Klarheit hat besonders Cainererlo) gezeigt, wie<br />
das Denken Spiiiozas diese Entwicklung genommen hat. Aber es ist eine<br />
verliangiiisvolle Entwicklung, durcli die Spiiiozas begriffsrealistisclies<br />
System auch von iniieii her auseinanderfallt. Die Korrespondenz von<br />
Begriff und Sein, von dei es ausging, wird dadurch aufgehoben. Wie<br />
kann Gott als ratio einheitlich bleiben, wenn er es nicht mehr als substaiitia<br />
ist? Oder, wenn man an der Einheitlichkeit des göttlichen Urgrunds<br />
festhilt, iiacli welcher Logik kann ein solcher Grund Folgen erlauben,<br />
die, nach ihrer Wirlilichkeitsseite betrachtet, exklusiv gegeneinander<br />
sind? Spinoza hat die Schwieriglieit stark gefühlt und greift,<br />
um ihr zu entgehen, zu einer der verwegensten Erlilarungen, die aus der<br />
Geschichte der Philosophie belrannt sind. Tins freilich will scheinen, er<br />
hatte gar nicht nötig gehabt, sich iri die Schwierigkeit zu verstrickei~.<br />
Zugegeben die rationalistische Erwigung, die ihr vorausgegangen war,<br />
dais sich die Attribute wegen ihrer Exklusivitit nicht g e g e 1 s e i t i g<br />
zur Existenz bestiinnien können; darum brauchte noch lange nicht jedes<br />
Attribut sein Sein d ii r c h s i c 11 s e 1 b s t zu haben, sondern es könnte<br />
dabei blcibeii, dais es dieses nur durch die g a ii z e göttliche esseiitia<br />
empfängt. Nichts schliefst den Gedanlieii aus, dafs die Substanz als<br />
G a n z e s jedcs ihrer Attribute zum Sein bestiniineii liann, statt erst dadurch,<br />
dais sie die Wesenheit eben auch dieses Attributs mit umfaist.<br />
Seit wann muis denn eine Substanz in ein bloises Kollektivum, in die<br />
bloise Siinime ihrer Attribute daruni zerfallcii, weil diese miteinander<br />
unvergleichbar siiid? Das Ich erlebt Zustände des Wollens, Fühlens<br />
und Denkens, die unter sich nicht minder unvergleichbar sind als die<br />
Attribute der spinozistischen Substanz. Dessen ungeachtet haben wir<br />
aber nicht 3 Ich, 1 fühlendes, 1 wollendes und 1 denkendes, sondern ein<br />
einziges Ich, das weder Denken, noch Fühlen, noch Wollen ist, aber<br />
das denlit, fiihlt iind will. Das Fühleii, Wollen und Denken b 1 e i b e n<br />
unselhstaiidige Erlebnisse, die in die Einheit des Ich aufgenommen sind<br />
und allesamt durch dieses Icli Bestand habcn, statt wie ein Schopenhauerscher<br />
Wille, oder ein Hegelsches Denken oder ein Fühlen<br />
niemandes durch sich selbst bestehen zu können. Gewiis räumen wir<br />
gern ein, dais das Substaiizproblem ein Problem ist; es ist das Problem<br />
der Einheit in der Verschiedenheit und der Verschiedenheit in der Einheit.<br />
Auch dies Verhaltnis ist i r r a t i o n a 1, ebenso irrational wie<br />
das Verhältnis von Ursache und Wirkung. Aber es enthalt Beinen<br />
W i d er s i 1 n i g e n Begriff, wie es der ist, mit dem Spinoza den gordischen<br />
Knoten, in den er sich selbst verstricl
238 Spinozas Identitätsphilosophie.<br />
gedehnte und als bewuiste (überhaupt als so und so attribuierte) eine<br />
und dieselbe sei (Eth. 11, prop. VII, Scholion). Dieser Ausweg stellt<br />
aber die Korrespondenz zwischen dem Gottesbegriff und der Gottes-<br />
realität, zwischen der essentia Dei und der existentia Dei, nur auf den<br />
ersten Anschein wieder her. Freilich fallt jetzt Gott nicht mehr in die<br />
Vielheit seiner Attribute auseinander. Iedes der Attribute. existierend<br />
wie es jetzt soll, durch seine eigene essentia, ist schon Gott selbst, der<br />
sich nur in vielfältiger Weise und dadurcli in vielerlei Weltgestalt<br />
äuisert, in der Seinsweisc der Ausdehnung als Kosmos körperlicher<br />
Dinge, in der Seinsweise des Denkens als Kosmos von psychischem Leben<br />
usw. Allein selbst wenn eine solche Formel für das reale Sein Gottes<br />
(sub ratione existentiae) zulässig wäre, was liorrespondiert obiger Zwei-<br />
und Vielseitigkeit in Gottes b e g r i f f (sub ratione essentiae) ? Ist auch<br />
der B e g r i f f der Ausdehnung, eingeschlossen wie er ist iil Gottes all-<br />
vollliomn~eiler Uressentia, mit cleili Begriff des Bewuistseins identisch,<br />
wäre der Begriff des letzteren nur eine neue logische Seite des ersteren,<br />
kann eiii Begriff A gleichzeitig ein Begriff voll Non-A sein? Wenn aber<br />
nicht, so stiebt die e s s e n t i a Dei iii Stüclien auseinander, mag fiir<br />
die s u b s t a n t i a Dei der Schein der Einheit noch so sehr durch ein<br />
Spiel mit Worten hergestellt sein. In Wahrheit ist die obige Formel<br />
auch für die reale Betrachtung Gottes unzulässig. Jene behauptete<br />
Einheit des Entzweiten mittels des Gedanlieizs der „anderen Seite" ist<br />
und bleibt ein W i d e r s i n n. Das haben in iiberzeugender Weise ver-<br />
diente Forscher neuerdings wieder hervorgehoben.11) Nur die potciitia<br />
pura des Aristoteles, der freie Atomwille Epiciirs und die xpünc di ÖAcov<br />
der Stoiker sind gleiche Salti rnortali in der Geschichte der Phi-<br />
losophie. IIier sei nur iioch auf zweierlei hingewiesen, erstlich auf die<br />
in e t h o d i s c h e V e r li e h r t h e i t , schon alllein der bloiseil Kon-<br />
striilrtioii des genannten Auswegs.<br />
SpiiiozasBegriffsrealisnius, hatten wir gesehen, fordert dieHarmonie<br />
von Begriff und Sein, zwischen der essentia Dei (sub rstione essentiae)<br />
und der substaiitia Dei (sub ratione existentiae). Diese Harmonie wurde<br />
bedroht durch die Konsequenzen der Attributenlehre. Wegen der<br />
gegenseitigen Exlilusivität der Attribute schien es dahin lrommen zu<br />
sollen, dais zwar auf der begrifflichen Seite die essentia Dei ein cin-<br />
heitliclicr Grund der Welt bleibt, aber auf der realen Seite Gottes un-<br />
gebrochene Totalität einer Vielzahl von Attributsubstanzen weichen<br />
muis. IIier setzt Spiilozas Theorie von der „andereil Seite'' ein. Die<br />
Identität zwischen Denken und Sein, Gottes essentia und Gottes existen-<br />
tia, lehrt er, bleibt erhalten, wenn wir i 1 n e r h a 1 b d e s S e i n s<br />
eine n c u e I d e n t i t ä t konstatieren, nämlich die Identität zwischeii<br />
Denken und Ausdehnung. Aber wie war die Schmieriglreit in Spinozas<br />
Ausvinandersetzungen hineiiigelioiiin~eii? Dadurch, dais der Gegensatz<br />
11) Rehmke, „Psychologieu (1894), ,,Innen- und Auisenwelt, Leib und Seeleu<br />
(1898), ,,Wechselwirkung oder Parallelismus?' Gedenkschrift für R. Haym (1902).<br />
Busse, ,,Geist und Körper, Seele und Leib' (1903).
Spinozas Identitätsphilosophie. 239<br />
z~vischen Denken uiid Ausdehnung so scharf wie möglich betont wurde.<br />
Vnd nun soll auf einmal die Identität von beiden aus der Verlegenheit<br />
helfen! Erst schürzt die Exklusivität der Attribute das Problem, dann<br />
soll dieselbe Exl
240 Spinozas IdeiititLtsphilosophie.<br />
t i t ä t g e p a a r t sein, weil alles mit allem gleich e n t g e g e 11 -<br />
g e s e t z t ist. Es verhält sich ungefähr so, wie wenn uns erzählt- wird,<br />
die Welt der Farben und die Welt der Töne gingeil in allen Eiilzellieiteii<br />
identisch parallel. Wir ständen ebenso ratlos. Da gibt es lieiile Farbe,<br />
die etwa einen1 hoheil Tone näher zugesellt werden dürfte, als jede<br />
andere. Ob inan rot oder grün, blau oder gelb, scliwarz oder weil's oder<br />
eine beliebige Zwischeilfarbe wählt, ob man die Sättigung der gewählteil<br />
Farbe so oder so ansetzt, es bleibt dieselbe Willliür der Zuordiiuilg.<br />
Keine i 11 11 e r e Beziehung, keine kleinste s a c h l i c 11 e Verwandtscliaft<br />
zwischeii den Erscheinungen dieses und den Erscheiilungeii jenes Reichs<br />
gewährt hier irgend einen Leitfaden. IIan darf blindlings in den Topf<br />
voll Farben und bliiidliilgs auf die Tasten der Töne greifen. Wie man<br />
es trifft, paist es eben oder paist ebensogut nicht. Da gibt es kein<br />
inneres Kriterium, um die richtige Wahl voll der falschen Walil irgend-<br />
wie abzugrenzen. Oder noch ein Gleichnis: es ist, wie wenn man Blut<br />
mit Eisen fiir identisch erlrliirt. Auch hier fehlt jede innere Wahl-<br />
verlvandtschaft, und so wäre es zwar vernuilftlos, aber kauin verwuiider-<br />
lieh, verficle jemand, um wenigstens einen äufseren Leitfaden zu ge-<br />
wiiiilen, darauf, dais er diejenigen Blutstiopfen mit denjenigen Eisen-<br />
teilchen für identisch erkliirt, ail deneil erstere gerade haften. Spinozas<br />
Identitiitstheorie ist in dieser Verlegenheit. Mit der Formel: „das<br />
bewuiste und das ausgedehnte Sein ist identisch", läist sich nichts an-<br />
fangen. Die pliysischen Vorgänge sind der Farbentopf, die Bewuists-<br />
Prozesse sind die Tonklaviatur, da ist alles nlit allem fremd, und doch<br />
soll man unter dem Fremden das - Ideiltisehe heraussuchen! Das<br />
geht nicht, man müiste denn Zettel anlileben. Spinoza w i 1 l rnit seiiier<br />
Identitätsformel etwas anfangen, und so klebt er die Zettel an.<br />
111. Die Ideen im unendlichen Intellekt.<br />
Sehen wir uns, bevor wir weitergehen, den Substanzbegriff iioch<br />
einmal an! Es gibt eine „rnodaleU und eiiie „agnostischecc Auffassung<br />
desselben.12) Nach beiden Auffassung~n gilt die Substanz als Trager<br />
ihrer Eigenschaften und Vorgäilge. Aber nach der ,,n~odaleil" Auffassung<br />
geht das wesentlichste Moriieilt ihrer Accidentieil als „Attributc'<br />
auf die Substanz selbst über, während sie nach der „agnostischeiic' Auffassung<br />
zwar ihre Eigenschaften und Vorgänge determiniert, jedoch<br />
nicht ihrerseits durch diese determiniert wird. „Modal" denkt das gewöhnliche<br />
Bewufstsein, wenn es die „Körperc( als die Träger pligsischer<br />
Accidentien scharf von den „Seelen" als den Trägern physischer Accidentieiz<br />
unterscheidet. Der Träger physischer Accidentien, glaubt mall,<br />
e n t f a 1 t e in dem, was er trägt, zugleich sein W e s e n , miisse also<br />
etwas ganz anderes sein, als der Träger psychischer Vorgiiilge, der auch<br />
in dem. ~vas er trägt, s e in Wesen entfalte. Kurz, die seelische und die<br />
.<br />
12) Näheres in meiner Schrift ,,Der moderne Materialismus als Weltaiischauiiiig<br />
und GeschichtsprinzipY, 6 Vorträge, S. 28ff. (Leipzig, Dieterichsche Verlagsl+ncEihandlung<br />
1904).
Spinozas Identitiitsphilosophie. 241<br />
körperliche Substanz iiiitersclieideii sich hiernach in demselben Mafse,<br />
wie sich die gattungsmäisige Bestimmtheit ihrer Accidentien unter-<br />
scheidet. Die „ a g ii o s t i s C h e " Auffassung der Substanz verneint,<br />
dafs die WeseiiseigentümlicMceit der Eigenschaften auf die Substanzen<br />
hinter ihnen übertragen werden darf. Ihr zufolge müssen wir vielmehr<br />
die Dinge, welche Eigcnschaften tragen, als den Rest denken, dci nach<br />
Loslösung aller Eigenschaften übrig bleibt. So, als „Restc' gefafst,<br />
wird die nackte Substanz ihrem innersten Wesen nach zu etwas Un-<br />
belcanntem. Für ihre Erkeniitnis mangeln alle Unterscheiduiigslcriterieii.<br />
Nichts bleibt ja, nach Abzug aller Eigenschaften und Vorgänge, in<br />
unsern Händen als ein geheimnisvolles, unsagbares X. Die Überlegungen<br />
hierüber gipfeln in einem kühnen Gedanken. Wie, wenn dieses X bei<br />
Seele uiid Körper gleichartig, ja, wenn es bei allen Seelen und Körpern<br />
der ganzen Welt vielleicht genau dasselbe lviare? In solclicr Weise denkt<br />
sich unzweifelhaft Spinoza die Substanz. Spinoza überwaad damit die<br />
Ansicht, oder suchte sie zu überwinden, dafs der Träger körperlicher<br />
Eigenschaften selbst körperlich, der Träger seelischer Eigenschaften<br />
selbst seelisch sei. Ihm galt als das letzte Wesen der Dinge e i 1 Etwas,<br />
das durch den Unterschied von Geistigem und Kürperlichem seinerseits<br />
nicht mehr tangiert werde.<br />
Bei dieser Anschauung besteht kein Zwang, die Existenz Gottes mit<br />
körperlicher oder psychischer Existenz zu belasten. Aus der Voll-<br />
kommenheit seiner essentia folgt nur, dais sie existiert, dais sie Sein<br />
besitzt, ein Ursein, erhaben über allem physischen und psychischeiz Sein<br />
und begrifflich unvergleichbar mit diesem, aus dem sich erst das phy-<br />
sische, psychische und jegliches andere Sein durch Teilnahme in dem<br />
Mafse konstituiert, in dem sich die physischen, psychischen uiid alle<br />
anderen Begriffe aus dem Urbegriff Gottes durch Selbstfolgeruiig lcon-<br />
stituieren. Nur so laist sich die Einheit der Substanz wahren. Gott<br />
bleibt als existeiitia so einheitlich, wie als essentia. Ohne dafs er selbst<br />
zu physischen1 oder psychischem Sein wird, determiniert er alles phy-<br />
sische uiid psychische Sein. Er erhält sich als das eine ungebrochene<br />
Ganze, ohne in die Attribute als seine Teile zu zerfallen, nach Begriff<br />
und Sein identisch einer, sowohl sub ratione essentiae wie sub ratione<br />
existentiae.<br />
So machte es aber Spinoza, wie wir gesehen haben, nicht. Er drängt<br />
von der agnostischen doch wieder zur modalen Auffassung der Substanz<br />
zurück. Daher die Gefahr bei ihm, dais Gott in eine Vielheit voh<br />
Attributsubstaiizen zerfällt, daher das gefährlichere Heilmittel der<br />
Gefahr, die Identität aller Attributsubstanzeii zu erkläreil, in die die<br />
eine Allsubstanz durch die modale Auffassuiig auseinander gesplittert<br />
wird. Ein Umstand kommt hier vor allem folgenschwer zur Geltung.<br />
Fallt närnlicli das Sein der Attribute auf das Sein Gottes selbst zurück,<br />
so verwandelt sich das Sein Gottes neben allem möglichen anderen auch<br />
in ein „denkendes Wesen Sein". Die Substanz wird auf einmal aiithro-<br />
pomorphisiert. Wir erfahren nun (Eth. 11, prop. 111, prop. XI Coroll),<br />
dafs sie deiilct, uiid doch hatte Spinoza früher mit allem Nachdrucl~<br />
Philosoph. Abhandlungeii. 16
242 Spinozas Identitiitsphilosophie.<br />
(vgl. oberi S 230), das Prädikat des Denkeiis in jeclwedem psycho-<br />
logischeii Sinne von ihr abgelehnt. Wohl war auch früher in bezug auf<br />
Gott die Rede von iiitellectus und idea gewesen, aber es -m7ar ein un-<br />
persönliclies, aller psychischen Fassung entrücktes Denken, ein Denken<br />
ohne deiikciides Subjekt, keinc geistige ,,Forinieruiig
Spinozas Ideiititiitsphilosophie. 243<br />
ihreii Objekten. Er bezeichnet den Alit des Denkeiis (idea) als die<br />
„mensC6 jedesmal des Objelits, auf die sich der Akt richtet (Eth. 11,<br />
prop. XII, Dein.: „Deus quatenus eiusdem obiecti idea affectus coilsideratur<br />
meiltem alicuius rei coiistituit), d. 11. das betreffende Objekt erscheint<br />
als b e s e e 1 t jedesnlal durch die Idee, init der es erlrenntiiiitheoretisch<br />
verbunden ist. Aus dein Erkeniitniszusan~meiihaiige macht<br />
also Spinoza einen Bcseelungszusanimei~l~ang, und das iii allgemeinster<br />
Weise. Wo immer eine Idee und ihr Objelit gegeben ist, gilt nach ihm<br />
dies Verhältilis. Wäre z. B. das Objelit, auf clas sich das göttliche<br />
Denken richtet, ein Toll, so forderte jene Auffassung das Verliältiiis des<br />
Tons zu dein Denlrakt, iii dein er erscheint, als die Beseelung jenes Teils<br />
zu bezeichnen. Der Toii wkre gleichsam der Leib der idea, iii der er<br />
gegenwärtig ist, und diese idea wkre gleichsam die Scelc des Toiis.<br />
Wirlilich spricht Spinoza den Gedanlien der Allbeseeluiig iil solchein<br />
Sinne aus (Eth. 11, prop. 111, Dem., prop. XIII, Scholioil), da doch Gott<br />
von jedem Dinge eine Idee habe. Eheildeswegeil folgert dieser Autor<br />
ganz richtig, dais es auch eine idea mcntis gibt, eine ineils von jeder<br />
inens (Eth. 11, prop. XXI), denn jeder Deiilivorgang h a t ja ilicht nur<br />
ein Objelrt, sondern i s t auch das Objelit eines aildereii Denlrvorgangs,<br />
in Spinozas Terminologie: die Idee des Körpers, ja irgend eiiies Objelrts,<br />
i s t nicht nur die Seele des Körpers bzw. des betreffeildcii Objekts, son-<br />
dern sie h at selbst in gleicher Weise wieder eine ineils, sie ist beseelt,<br />
d. i. Gcgenstaizd eiiies Bewuistseiils.<br />
llan bemerkt leicht, der hier charakterisierte c r k e 11 11 t 11 i s -<br />
t 1 e o r e t i s C h c Zusainmeiihaiig kann nur iii engen Grenzen gelten.<br />
Nur dort lioinmt er in Betracht, wo sich eiii inodus cogitatioiiis auf<br />
irgend ein Objelit, sei es des eigenen, sei es eiiies freindeil Attributs<br />
richtet. Hatteil wir es iiz Spiilozas erster Gedaiilieiireilie init dem Ideii-<br />
titatsverhältnis von Begriff und Seiii, in der zweiten mit einem Ideii-<br />
titätsverhaltiiis iiinerhalb des Seieiideii zu tun, nämlich dem Ideiititats-<br />
verhaltnis aller Attribute zueinander, so ist jenes dritte erlrenntilis-<br />
theoretische Verhältnis iiocli weiter eiilgeeilgt. Es setzt voraus, dais<br />
inindesteils das eine seiner Glieder sclioii sclbst dem Attribute des<br />
Denkens aiigehiirt. Nur das Deilkeii liaiin sich auf alles iirögliche<br />
andere, und es Bai111 sich auch auf modi des eigeneil Attributs, auf Be-<br />
~mistseinsprozesse, richteil. Darunl wäre es eiii hartes Unterfaiigeil,<br />
wollte etwa jemand voll einer Icleiitität zwischen Deilkakt uud Deiik-<br />
objekt sprechen. Sie ist schon deshalb ausgeschlosseil, weil sich zwar<br />
der Denkalit auf das Deiikobjekt, iiicht aber (im allgemeiilen) 11111-<br />
gekehrt das Denliobjelrt auf den Denkalrt ricliteil liaim. Noch uii-<br />
erträglicher wäre es, obiges erlieniitilistlieoretische Verhaltiiis gar mit<br />
jenem Idcntitätsverhältilis einerlei setzen zu ~volleii, das iiacli Spiiloza<br />
zwischen deii Modis a 11 e r Attribut2 untereinander besteheil soll.<br />
Findet doch, wie nochmals hervorgehoben werde, jenes erl
244 Spinozas IdentitLtsphilosophie.<br />
Weder richtet sich ein Ton auf eine Aiisdehiluiig, noch eine ilusdehnung<br />
auf einen Ton. Es wäre ebenso falsch, den Ton als durch die Aus-<br />
dehnung erkannt, oder, wie Spinoza sagt, beseelt, wie die Ausdehnung<br />
als erkannt, beseelt durch deii Ton zu bezeichnen. Dagegen richtet sicli<br />
das Denken sowohl auf die Ausdehnuiig, wie auf den Ton, und es richtet<br />
sich endlicli auch auf Modi seiner eigenen Art, nämlich auf alle mög-<br />
lichen anderen Bewiifstseinsprozesse. Zumal der letztere Umstand, dais<br />
clas erkenntnistlieoretische Verhältnis sogar ganz innerhalb der Modi<br />
des Denlreiis stehen bleiben kann, sollte aufs neue warnen. Da verbirgt<br />
sich kein allgemeines metaphysisches Problem mehr; wir stelzen bei<br />
einem erlrenntnistheoretischen, speziellen, das mit dem Verhältnis von<br />
Attributen zueinander überhaupt nichts zu tun haben braucht.<br />
Allein Spinoza setzt sich über alle Bedenken hinweg. Zu sehr lclafft<br />
die Lücke in seiner Lehre von der Identität der Attribute. Insbesondere<br />
nzuis die Liiclie bezüglich der Identität von Bewuistsein und Ausdehnung<br />
ausgefüllt werdeil. Daher die eigentümliche Wendung, dais jede idea<br />
die mens des zugehörigen Objekts sei, daher die Vorliebe, mit der unser<br />
Philosoph fast überall nur von deii Ideen körperlicher Dinge spricht.<br />
Ein klares, durchsichtiges Verhältnis von Leib und Seele gab es vorher<br />
bei Spinoza nicht; welcher physische mit welchem psychischen Modus<br />
xusainmenbestehe, blieb unbestimmt. Jetzt führt Spinoza die „Ideen<br />
körperlicher Dinge" ein, und alles scheint sich zureclzt zu rückcn. Ilier<br />
ist jeweils ein bestiminter Xodus des Denlreiis (die Idee, die sich auf<br />
ein körperliches Obiekt richtet) mit einem bestimmten Modus der Aus-<br />
dehnung (das Objekt, das zu jener Idee gehört) zusammengeordnet. In<br />
diesem Zusaminenhang kommt lrein Zweifel inelir auf, welcher Modus<br />
des Derilceiis mit welchem Modus der Ausdehniiiig geeint ist, die Zettel<br />
sind angeklebt. Tatsächlich glaubte Spinoza, die Gunst des genannten<br />
erlrenntnistheoretischen Verhaltnisses in Anspruch nehmen zu dürfen,<br />
um seinc metaphysische Identititslehre von Leib uncl Seele zu erläutern.<br />
Deswegen zögerte er nicht, noch cinmal dem Satze: „ordo et coiinexio<br />
idearuni idem est, ac ordo et coimexio rerum" eine verindertc Be-<br />
deut~ing zu geben. Eine veränderte Bedeutung, denn der Satz flieist<br />
riun nicht nielir wie fiiiher aus dem allgemeinen Verliältnis aller Attri-<br />
bute zueinander. Er niniint den engen, voii allein Früheren ginzlich<br />
verschiedenen erlreniitnistheoretischen Sinn an: nlit den Modis der Aus-<br />
dehnung siizcl jedesmal diejenigen Vorgänge des Bewuistseins ein und<br />
dasselbe, welche die ersteren ZLI ihren Objekten haben.<br />
Bereits Spinozas Freunde hatten bemerkt, dais dies Verhältnis der<br />
ldeen zu ihren Objekten der Bedingung nicht entspricht, sich mit dem<br />
Parallelismus von Leib und Seele zu declreii. wie ihn sonst unser Denker<br />
von seinen anderen Voraiissetzungeil aus postuliert hatte. Schon allein<br />
die idea mentis fällt, wie sie sehr wohl sehen, ohne weiteres aus dem<br />
Rahmen solchen Parallelismus heraus. Im obigen sind die Gründe ent-<br />
halten, warum wir, noch weitergehend, behaupten, dais beide Verhalt-<br />
nisse, jenes erkenntilistheoretische und dieses metaphysische, überhaupt<br />
nichts miteinander zu tun haben. Spinoza hat hier irrigerweise zwei
Spinozes Iclentit&tsphilosophie. 245<br />
Probleme initeinander verwoben, um dem einen mit dem anderen auszuhelfen.<br />
Das Verhältnis von Denkalit und Denkinhalt wird benutzt, um<br />
das Verhaltnis von Leib und Seele mit dem Schein der Lösung zu umgeben,<br />
und umgekehrt, das Verhältnis von Leib und Seele wird benutzt,<br />
LU^ das unvergleichbare Verhältnis von Denkakt und Denkobjekt doch<br />
uiiter irgend eine Anschauung zu bringen, die freilich alle Augenblicke<br />
versagt. Eins ist so verfehlt wie das andere. Han beachte z. B., welche<br />
Schwierigkeiten Spinoza mit den Ideen des Nichtexistierenden hat, und<br />
~vie liiinsilich er das Gedächtnis erli-lärt! (Eth. 11, prop. VIII, XVII,<br />
XVIII) .<br />
Ensw Gang durch Spinozas Identitatslehre ist beendigt. Derselbe<br />
lint uns dreimal in Kernpunkte des spinozistischen Systems geführt. Wir<br />
sahen seinen Begriffsrealisni-Lis sich enthüllen, sahen in der Att~ibutenlehre<br />
Spinoza mit dem alten Problem ringen, wie es möglich sei, die Einlieit<br />
der Substanz nicht in der Vielheit ihrer Eigenschaften versinken zu<br />
lassen, und mir fanden uns auf einmal auf das innigste vertraut mit deii<br />
Denlivorgängeii Gottes, dessen Denkakte unser und alles psychische<br />
Leben sind, und dic alle ihre Objclite beseelen. In den Farben aller der<br />
crwähiiteii Gesichtspunkte schillert Spinozas Identitätslehre. Zuerst präsentierte<br />
sie sich 1111s als die Identitit von Begriff' und Wirlilichkeit, von<br />
Deiilien und Sein. Solcher Identitit jedoch drohte Gefahr von der Viellieit<br />
der Wirklichkeitsattribute. Damit sie weiterbestehen liönlie, sah<br />
sicli Spinoza genötigt, innerhalb des Seins eine neue Identität zu konstruieren:<br />
zwischen den Afodis aller Attribute untereinander, insonderlieit<br />
zwischen Denken und Ausdehnung. ,4ber wiederum, diese Identität<br />
lieis sich nur detaillieren und exemplifizieren, indem eine dritte Identität<br />
zu Hilfe genommen wurde, nämlich diejenige der Erkenntnisakte<br />
mit ihren erliannten Objekten. Das alles zusammen bildet Spinozas<br />
„I~fonisnius"; er bedeutet noch immer vielen den Gipfel philosophischen<br />
Denkens. Sehe ich recht, läist sich indessen dieser Monismus in keiner<br />
Weise durchfiihren, auch nicht mit Hilfe einzelner Korrekturen. Das<br />
verbietet ein fiir allemal die Heterogeneität der Gedankenreihen, die in<br />
ihm vereinigt sind, durch deren geschickte Aneinanderfügung gleichwohl<br />
Spinoza sein Identitätssystem dem Scheine nach aufrecht erhalten<br />
konnte. Jene Heterogeneität läist sich sachlich nicht aufheben, ohne<br />
dais inan die Identitätslehre selber aufhebt, d. h. ohne dais man die<br />
Lücken klaffend bemerkbar macht, die in ihr durch den Wechsel der genannten<br />
Gesichtspunlite verdeckt worden sind.