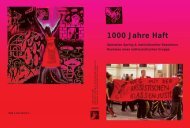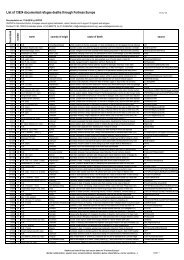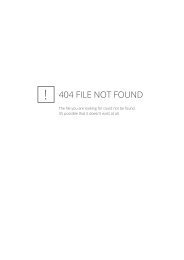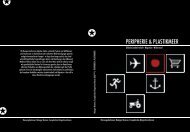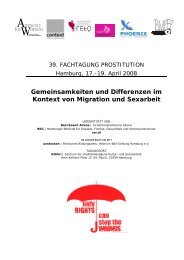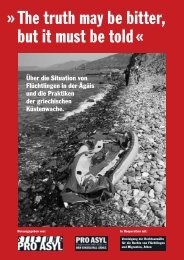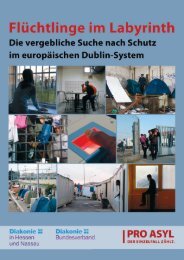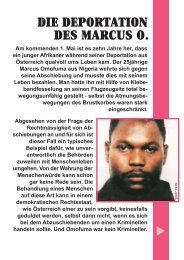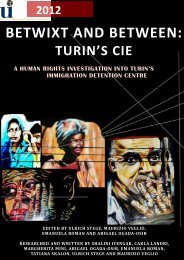Feminismus und kulturelle Dominanz - no-racism.net
Feminismus und kulturelle Dominanz - no-racism.net
Feminismus und kulturelle Dominanz - no-racism.net
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
gen hat? Integrationsdiskurse <strong>und</strong> Integrationsregime<br />
Integration <strong>und</strong> Gouvernementalität<br />
Nehmen wir das Foucault’sche Konzept der Gouvernementalität als Analysefolie, wird das Integrationsgeschäft<br />
deutlicher. Gouvernementalität bezeich<strong>net</strong> eine Regierungskunst, deren Machttechniken weit über den Herrschaftsbereich<br />
des Staates hinausreichen. Sie wird gebildet aus Institutionen <strong>und</strong> Verfahren, die es ermöglichen,<br />
eine Macht auszuüben, welche die Bevölkerung zur Zielscheibe hat. Die Bevölkerung, ihre Arbeitskraft, ihre Lebensformen,<br />
ihr Konsum, ihre Vorlieben <strong>und</strong> ihr Wachstum werden hier zum Gegenstand von Intervention <strong>und</strong> regulierender<br />
Kontrollen (vergleiche Foucault 2000). Damit zielt sie auf alle Teile der Gesellschaft von der Wirtschaft<br />
bis zur Wissenschaft, von der Familie bis zur Religion. Es lässt sich damit zeigen, wie die Regierung ihre<br />
Macht entfaltet, ohne dabei nur auf die Androhung von Strafe zu rekurrieren, <strong>und</strong> wie die Bevölkerung sich formen<br />
lässt, ohne dass sie bemerkt, in welcher Art <strong>und</strong> Weise sie gelenkt wird. Die Macht der Regierung wird mithin<br />
nicht auf staatliche Gewalt reduziert. Im Gegenteil, gerade die Prozesse der Normalisierung <strong>und</strong> die darin ein -<br />
gebetteten Disziplinierungstechniken werden berücksichtigt.<br />
Unter einer solchen Perspektive können Integrationsregime beschrieben werden als ein Bündel (sozial-)politischer<br />
Maßnahmen, welche für die hiervon Regierten ein beständiges Mehr an Ausschluss <strong>und</strong> Kontrolle bedeuten. Integrationspolitik<br />
kann dann als „Normalisierungs- <strong>und</strong> Disziplinierungsregime“ beschrieben werden, das all jenes,<br />
welches sich nicht in eine Vorstellung des „Normalen“ <strong>und</strong> mithin „Richtigen“ fügen lässt, ausschließt <strong>und</strong>/oder<br />
marginalisiert. So wird verständlich, warum der zunehmenden Exkludierung von Eingewanderten eine Akkumulation<br />
von Integrationsforderungen gegenüber steht, die über sich verschärfende staatliche Kontrollregime erzwungen<br />
werden. Wer beispielsweise keine Garantie erhält, auf Dauer in einem Land leben zu dürfen, kann sich schwer<br />
eine Zukunft in diesem vorstellen. Eine Integration von Menschen, die etwa nur über eine Duldung verfügen, ist<br />
damit unmöglich. Die sozialen Folgen hiervon sind gravierender, als es auf den ersten Blick scheinen mag: Menschen,<br />
die nur auf Zeit in einem Land leben dürfen, unterziehen sich verständlicherweise nur mit Mühen den geforderten<br />
Integrationsmaßnahmen. Warum sich assimilieren, wenn der Aufenthalt morgen schon gewaltsam beendet<br />
werden kann – ist eine Duldung doch offiziell nur eine „Aufschiebung der Abschiebung“. Die sogenannte<br />
„Härtefallregelung“ hat hier nur wenig zur Verbesserung der sozialen Lage beigetragen. Doch auch das im Zusammenhang<br />
mit der Arbeitsmigration bis Mitte der 1980er-Jahre <strong>no</strong>ch gültige Rotationsverfahren <strong>und</strong> die nach wie<br />
vor bei der Vergabe von Aufenthaltstiteln sehr restriktiv vorgehenden Ausländerbehörden haben hier Unrühmliches<br />
geleistet.<br />
Für die meisten Migrant(inn)en bietet die eigene Community auch deswegen einen Raum der „Sicherheit“. Die<br />
Diffamierung schwer erarbeiteter sozialer Netze als „Parallelgesellschaften“ erscheint hier als ein gewaltsamer<br />
Diskurs, der dazu führt, dass auch gut funktionierende Selbstorganisationen – die viel dazu beigetragen haben,<br />
eingewanderte Menschen zu unterstützen <strong>und</strong> ihnen die <strong>no</strong>twendigen Informationen zukommen zu lassen, die ihnen<br />
die weithin interkulturell verschlossenen staatlichen Institutionen vorenthalten haben – diskreditiert werden.<br />
Gleichzeitig ist innerhalb der Communitys die (Re-)Konstruktion sogenannter „Traditionen“ zum bestimmenden<br />
Faktor geraten. Die Soziologin Ursula Apitzsch spricht in diesem Zusammenhang von „Traditionsbildung“ <strong>und</strong><br />
macht darauf aufmerksam, dass „Tradition offenbar sehr viel mehr mit ‚invention’ zu tun hat als mit ‚Altem’ <strong>und</strong><br />
‚Hergebrachtem’“ (Apitzsch 1999, S. 11). Communitys konstituieren sich in der Migration neu <strong>und</strong> geben sich dafür<br />
Regeln, die vor allem die Aufgabe übernehmen, die Abgrenzung von der Mehrheit nun selbst zu steuern, das<br />
heißt, Handlungsmacht zu entwickeln. In den dabei entstehenden Räumen ist Platz für eine Vielfalt politischer Positionierungen,<br />
die nur eines gemeinsam haben: Sie sind eben neu <strong>und</strong> nicht althergebracht. Unter dieser Prämisse<br />
können auch die unter-schiedlichen geschlechtsspezifischen Alltagspraxen untersucht werden (vergleiche Castro<br />
Varela <strong>und</strong> Dhawan 2006).<br />
Die Integrationsforderungen der Regierung übersehen diese Konstituierungsprozesse <strong>und</strong> naturalisieren <strong>und</strong> homogenisieren<br />
stattdessen nicht nur die heterogenen Migrationskollektive, sondern beschreiben auch Integration lediglich<br />
als einen linear fortschreitenden Prozess, der keine Brüche, keine Widersprüche zu benennen zulässt. Darüber<br />
hinaus unterlaufen die staatlichen Maßnahmen selbst immer wieder die postulierten Integrationsziele. So ist<br />
es vollkommen unverständlich, warum das Zuwanderungsgesetz kurz vor dem Zweiten Integrationsgipfel im Juli<br />
2007 verschärft wurde. Das Gesetz legt nun das Mindestalter für den Nachzug von Ehepartner(inne)n auf 18 Jahre<br />
fest <strong>und</strong> verlangt zumindest einfache Deutschkenntnisse des nachkommenden Partners oder der Partnerin. Ausge<strong>no</strong>mmen<br />
sind bemerkenswerterweise Eingewanderte aus Staaten wie den USA, Japan <strong>und</strong> Australien, von denen<br />
es heißt, dass sie „wenig Integrationsbedarf“ hätten. Wer die Werte des Gr<strong>und</strong>gesetzes missachtet, kann künftig<br />
ausgewiesen werden. Außerdem wurden einige Visaregelungen aus angeblichen Sicherheitsgründen verschärft.<br />
38