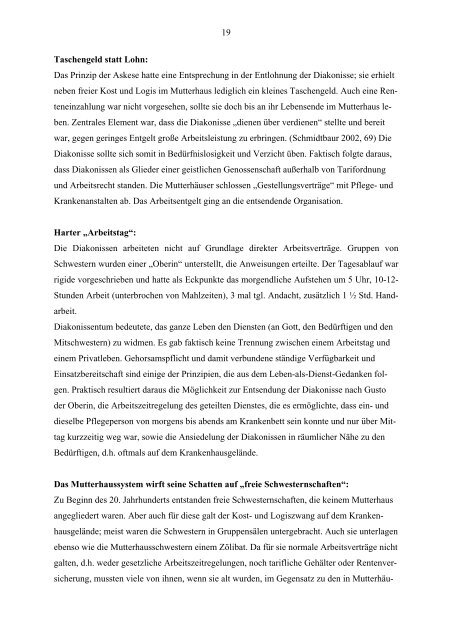Christel Kumbruck - artec - Universität Bremen
Christel Kumbruck - artec - Universität Bremen
Christel Kumbruck - artec - Universität Bremen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
19<br />
Taschengeld statt Lohn:<br />
Das Prinzip der Askese hatte eine Entsprechung in der Entlohnung der Diakonisse; sie erhielt<br />
neben freier Kost und Logis im Mutterhaus lediglich ein kleines Taschengeld. Auch eine Renteneinzahlung<br />
war nicht vorgesehen, sollte sie doch bis an ihr Lebensende im Mutterhaus leben.<br />
Zentrales Element war, dass die Diakonisse „dienen über verdienen“ stellte und bereit<br />
war, gegen geringes Entgelt große Arbeitsleistung zu erbringen. (Schmidtbaur 2002, 69) Die<br />
Diakonisse sollte sich somit in Bedürfnislosigkeit und Verzicht üben. Faktisch folgte daraus,<br />
dass Diakonissen als Glieder einer geistlichen Genossenschaft außerhalb von Tarifordnung<br />
und Arbeitsrecht standen. Die Mutterhäuser schlossen „Gestellungsverträge“ mit Pflege- und<br />
Krankenanstalten ab. Das Arbeitsentgelt ging an die entsendende Organisation.<br />
Harter „Arbeitstag“:<br />
Die Diakonissen arbeiteten nicht auf Grundlage direkter Arbeitsverträge. Gruppen von<br />
Schwestern wurden einer „Oberin“ unterstellt, die Anweisungen erteilte. Der Tagesablauf war<br />
rigide vorgeschrieben und hatte als Eckpunkte das morgendliche Aufstehen um 5 Uhr, 10-12-<br />
Stunden Arbeit (unterbrochen von Mahlzeiten), 3 mal tgl. Andacht, zusätzlich 1 ½ Std. Handarbeit.<br />
Diakonissentum bedeutete, das ganze Leben den Diensten (an Gott, den Bedürftigen und den<br />
Mitschwestern) zu widmen. Es gab faktisch keine Trennung zwischen einem Arbeitstag und<br />
einem Privatleben. Gehorsamspflicht und damit verbundene ständige Verfügbarkeit und<br />
Einsatzbereitschaft sind einige der Prinzipien, die aus dem Leben-als-Dienst-Gedanken folgen.<br />
Praktisch resultiert daraus die Möglichkeit zur Entsendung der Diakonisse nach Gusto<br />
der Oberin, die Arbeitszeitregelung des geteilten Dienstes, die es ermöglichte, dass ein- und<br />
dieselbe Pflegeperson von morgens bis abends am Krankenbett sein konnte und nur über Mittag<br />
kurzzeitig weg war, sowie die Ansiedelung der Diakonissen in räumlicher Nähe zu den<br />
Bedürftigen, d.h. oftmals auf dem Krankenhausgelände.<br />
Das Mutterhaussystem wirft seine Schatten auf „freie Schwesternschaften“:<br />
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden freie Schwesternschaften, die keinem Mutterhaus<br />
angegliedert waren. Aber auch für diese galt der Kost- und Logiszwang auf dem Krankenhausgelände;<br />
meist waren die Schwestern in Gruppensälen untergebracht. Auch sie unterlagen<br />
ebenso wie die Mutterhausschwestern einem Zölibat. Da für sie normale Arbeitsverträge nicht<br />
galten, d.h. weder gesetzliche Arbeitszeitregelungen, noch tarifliche Gehälter oder Rentenversicherung,<br />
mussten viele von ihnen, wenn sie alt wurden, im Gegensatz zu den in Mutterhäu-