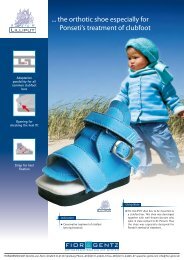CP-Handbuch (600 KB) - Fior & Gentz
CP-Handbuch (600 KB) - Fior & Gentz
CP-Handbuch (600 KB) - Fior & Gentz
- TAGS
- fior
- gentz
- www.fior-gentz.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>CP</strong>-<strong>Handbuch</strong><br />
Ein Konzept zur<br />
orthetischen Versorgung<br />
der unteren Extremität<br />
bei Cerebralparese<br />
4. Auflage
Einleitung<br />
Ärzte, Physiotherapeuten und Orthopädietechniker haben uns in den letzten Jahren<br />
immer wieder aufgefordert, ein neues Knöchelgelenk zu entwickeln. Unterschiedlichste<br />
Anforderungen aus diversen Fachgebieten, Regionen und Nationen wurden an uns<br />
herangetragen. Auch die International Society of Prosthetics and Orthotics (ISPO) fordert<br />
Einstellmöglichkeiten bei Unterschenkelorthesen (AFOs) [Mor, S.258ff]. Resultat<br />
war die Entwicklung unseres neuen Systemknöchelgelenkes NEURO SWING. Neben<br />
vielen anderen Einsatzgebieten kann das NEURO SWING bei der Versorgung von<br />
Patienten mit Cerebralparese (<strong>CP</strong>-Patienten) in AFOs eingebaut werden.<br />
Während unserer Recherche zur Cerebralparese (<strong>CP</strong>) haben wir festgestellt, dass bei<br />
der Behandlung von <strong>CP</strong>-Patienten und insbesondere beim therapiebegleitenden Einsatz<br />
von Orthesen noch sehr viel ungenutztes Potenzial vorhanden ist. So werden zum<br />
jetzigen Zeitpunkt weltweit unterschiedliche Strategien verfolgt. Begründet liegt dies<br />
zum einen an der fehlenden einheitlichen Klassifikation des pathologischen Gangbildes<br />
der <strong>CP</strong>-Patienten und zum anderen am bisher nicht vorhandenen Orthesengelenk,<br />
das allen Anforderungen gerecht wird. Können die eingeschränkten <strong>CP</strong>-Patienten<br />
nicht einheitlich klassifiziert werden, ist es sehr schwer, dem interdisziplinären Team<br />
ein Therapiekonzept und die dazugehörige orthetische Versorgung zu vermitteln. Im<br />
Moment entscheiden sich Fachleute für die orthetische Versorgung, von der sie sich die<br />
meisten Vorteile versprechen und gleichzeitig die Nachteile akzeptieren können.<br />
Aufgrund der neuen Möglichkeiten, die sich durch das NEURO SWING Systemknöchelgelenk<br />
in der orthetischen Versorgung ergeben, müssen die meisten bisher<br />
verwendeten Orthesenkonzepte für <strong>CP</strong>-Patienten überdacht werden. Um auf die unterschiedlichen<br />
Anforderungen eingehen zu können und ein Konzept für das gesamte<br />
interdisziplinäre Team zu haben, empfanden wir es als wichtig, adäquate Vorschläge<br />
für die orthetische Versorgung zu unterbreiten, die sich auf eine authentische und<br />
international anerkannte Klassifikation des Gangbildes stützen.<br />
Dabei ist das vorliegende <strong>CP</strong>-<strong>Handbuch</strong> - Ein Konzept zur orthetischen Versorgung<br />
der unteren Extremität bei Cerebralparese entstanden. Es richtet sich an Ärzte,<br />
Physiotherapeuten, Orthopädietechniker, Orthopädieschuhtechniker und nicht zuletzt<br />
an die Eltern oder die betreuenden Personen der Patienten und natürlich an die<br />
Patienten selbst.<br />
Zum Verständnis unseres Konzeptes ist ein Grundwissen zum physiologischen Gang<br />
zwingend erforderlich. Die wichtigsten Fachbegriffe und die Gangphasen sind in<br />
diesem <strong>Handbuch</strong> erklärt.<br />
Da das Interesse aller befragten Fachleute sehr groß war, konnten diverse Rechercheergebnisse<br />
und Erfahrungen zusammengeführt werden. Für die Mithilfe aller Beteiligten<br />
möchten wir uns herzlich bedanken.<br />
Unser <strong>CP</strong>-<strong>Handbuch</strong> hat nicht den Anspruch perfekt zu sein. Vielmehr soll es ein<br />
Anstoß zu einem innovativen Konzept für die orthetische Versorgung von <strong>CP</strong>-Patienten<br />
sein. Dabei sind wir auch weiterhin auf Anregungen angewiesen, um die Qualität<br />
kontinuierlich zu verbessern.<br />
2Ihr<br />
FIOR & GENTZ Team<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Einleitung ........................................................................................ 2<br />
Inhaltsverzeichnis .............................................................................. 3<br />
Das Therapieziel ................................................................................ 4<br />
Die orthetische Versorgung in der <strong>CP</strong>-Therapie .......................................... 6<br />
Dynamisch ....................................................................................... 8<br />
Statisch ........................................................................................... 9<br />
Das NEURO SWING in einer dynamischen AFO ........................................ 10<br />
Patientenklassifikation ...................................................................... 14<br />
Versorgungsvorschlag zum Gangtyp 1 ................................................... 16<br />
Versorgungsvorschlag zum Gangtyp 2 ................................................... 18<br />
Versorgungsvorschlag zum Gangtyp 3 ................................................... 20<br />
Versorgungsvorschlag zum Gangtyp 4 ................................................... 22<br />
Versorgungsvorschlag zum Gangtyp 5 ................................................... 24<br />
Glossar .......................................................................................... 26<br />
Literaturhinweise ............................................................................. 30<br />
3
Bei der Cerebralparese leitet das Gehirn falsche Impulse an Muskeln weiter, was dazu<br />
führt, dass diese zu stark, zu schwach oder zu einem falschen Zeitpunkt aktiviert<br />
werden. Dadurch kommt es häufig zu Funktionsstörungen einiger Muskelgruppen,<br />
die in der Regel zu einem pathologischen Gangbild führen [Gag, S.65]. Zusätzlich<br />
können diese Funktionsstörungen durch Spastiken begleitet werden [Pea, S.89], was<br />
den Muskeltonus wiederum so verändert, dass sich das Gangbild verschlechtern aber<br />
auch verbessern kann.<br />
Der erste Schritt des Therapiekonzeptes sollte der sofortige Beginn einer Physiotherapie<br />
sein [Kra, S.188], die von ganganalytisch geschulten Physiotherapeuten durchgeführt<br />
4<br />
Physiologische Gangphasen<br />
1 2<br />
3<br />
1 2 3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
4 5 6<br />
7 8<br />
9<br />
7 8 9<br />
Abb.<br />
Englische<br />
Bezeichnung<br />
Das Therapieziel<br />
werden sollte. Ziel dabei ist es, die defizitären Muskelgruppen so zu behandeln, dass<br />
zum einen die richtigen cerebralen Verknüpfungen durch motorische Impulse hergestellt<br />
[Hor, S.5-26] und zum anderen einzelne Muskelgruppen durch ein gezieltes<br />
Muskelaufbautraining gestärkt werden. Beide Maßnahmen sollen dazu beitragen,<br />
sich dem physiologischen Gangbild zu nähern.<br />
Das physiologische Gangbild eines gesunden Menschen wird in der Abbildung in seinen<br />
einzelnen Phasen dargestellt. Diese beziehen sich auf das rechte Bein (Referenzbein).<br />
Sich diesem physiologischen Gangbild zu nähern, ist das Ziel des interdisziplinären<br />
Teams bei der Behandlung von <strong>CP</strong>-Patienten [Goe, S.14ff, 44ff].<br />
Deutsche<br />
Bezeichnung* Hüftwinkel Kniewinkel<br />
1 Initial contact Anfangskontakt 20° Flexion 5° Flexion<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
Loading<br />
response<br />
Early<br />
mid stance<br />
Late<br />
mid stance<br />
Terminal<br />
stance<br />
6 Pre swing<br />
7 Initial swing<br />
8 Mid swing<br />
9<br />
Terminal<br />
swing<br />
Belastungsübernahme<br />
Mittlere<br />
Standphase<br />
(frühe Phase)<br />
Mittlere<br />
Standphase<br />
(späte Phase)<br />
Standphasenende<br />
Schwungphasenvorbereitung<br />
Schwungphasenbeginn<br />
Mittlere<br />
Schwungphase<br />
Schwungphasenende<br />
20° Flexion 15° Flexion<br />
10° Flexion 10° Flexion<br />
5° Extension 5° Flexion<br />
20° Extension 5° Flexion<br />
10° Hyperextension<br />
40° Flexion<br />
15° Flexion 60° Flexion<br />
25° Flexion 25° Flexion<br />
20° Flexion 0° Flexion<br />
* laut Bundesfachschule für Orthopädietechnik, Dortmund<br />
Knöchelwinkel<br />
Neutral-<br />
Null-<br />
Stellung<br />
5° Plantarflexion<br />
Neutral-<br />
Null-<br />
Stellung<br />
5° Dorsalextension<br />
10° Dorsalextension<br />
15° Plantarflexion<br />
5° Plantarflexion<br />
Neutral-<br />
Null-<br />
Stellung<br />
Neutral-<br />
Null-<br />
Stellung<br />
5
<strong>CP</strong>-Therapie im interdisziplinären Team<br />
Es ist wichtig, dass das interdisziplinäre Team ein gemeinsames Therapiekonzept<br />
verfolgt, bei dem Arzt, Physiotherapeut, Ergotherapeut und Orthopädietechniker<br />
eng miteinander arbeiten [Doe, S.113ff].<br />
Für einige <strong>CP</strong>-Patienten sind neben der physiotherapeutischen Behandlung auch<br />
medikamentöse Behandlungen z.B. mit Spasmolytika wie Botulinumtoxin [Mol, S.363]<br />
und operative Korrekturen von orthopädischen Fehlstellungen erforderlich [Gag2].<br />
Zur Unterstützung der physiotherapeutischen sowie operativen Therapie sind wirkungsvolle<br />
Orthesen unerlässlich. In einigen Fällen muss die orthetische Versorgung<br />
durch orthopädisches Schuhwerk oder Schuhzurichtungen ergänzt werden [Gru,<br />
S.30]. Abhängig vom pathologischen Gangbild des Patienten, den Anforderungen des<br />
Arztes und dem Ziel der Physiotherapie muss der Orthopädietechniker die Orthese so<br />
aufbauen, dass sie eine gewünschte Hebelwirkung erzielt [Nov2, S.488ff; Owe].<br />
Zusätzlich sollte ein operatives Ergebnis durch den richtigen Aufbau und die richtige<br />
Einstellung der Bewegungsfreiheit der Orthese gesichert werden, ohne die<br />
Physiotherapie zu behindern. Genau an dieser Stelle setzt die Schwierigkeit für den<br />
Orthopädietechniker ein, denn bisher war der Bau einer wirkungsvollen Orthese in<br />
der Praxis aufgrund mangelnder Einstellmöglichkeiten nur schwer realisierbar.<br />
Bisherige Möglichkeiten der orthetischen Versorgung<br />
„One orthosis may not be optimal to address all of the goals.“ [Nov1, S.330]<br />
Zurzeit werden <strong>CP</strong>-Patienten häufig mit einfachen Hilfsmitteln wie supramalleolären<br />
Orthesen (SMOs) oder speziellen orthopädischen Einlagen bis hin zu Unterschenkelorthesen<br />
(AFOs) in Ausführungen mit und ohne Knöchelgelenk versorgt. Alle derzeitigen<br />
Versorgungen können zu einem Therapieerfolg führen, aber diesen auch negativ<br />
beeinflussen, da jede Konstruktion nicht nur Vorteile sondern auch Nachteile mit<br />
sich bringt [Rom, S.473].<br />
Überwiegend werden AFOs ohne Knöchelgelenk hergestellt. Sie werden in dynamische<br />
AFOs (s. Abb. DAFO) und starre/statische AFOs (s. Abb. SAFO) unterteilt [Nov, S.330ff].<br />
So lassen DAFOs z.B. Bewegung im anatomischen Knöchelgelenk zu, jedoch ohne<br />
definierten Drehpunkt und definierte Bewegungsfreiheit. In der Literatur werden<br />
SMOs (s. Abb. SMO) mitunter fälschlicherweise auch als DAFOs bezeichnet, fallen<br />
aber nicht in diese Kategorie. Bei SAFOs wird die Bewegung ganz verhindert.<br />
Seltener werden AFOs mit Knöchelgelenk (s. Abb. hinged AFO) eingesetzt, die Bewegung<br />
mit definiertem Drehpunkt und definierter Bewegungsfreiheit im anatomischen<br />
Knöchelgelenk zulassen. Meist sind sie aber nur mit einfachen Elastomerfedergelenken<br />
ohne rückfedernde Wirkung und ohne Dorsalanschlag oder anderen Gelenken mit<br />
zu schwacher rückfedernder Wirkung ausgestattet, was dazu führen kann, dass sich<br />
der Kauergang entwickelt [Nov, S.345]. Deshalb und weil es bisher kein geeignetes<br />
Die orthetische Versorgung in der <strong>CP</strong>-Therapie<br />
Knöchelgelenk gab, werden AFOs mit Knöchelgelenk kaum zur orthetischen Versorgung<br />
von <strong>CP</strong>-Patienten eingesetzt.<br />
Seit einiger Zeit werden AFOs mit rückfedernder Wirkung wie z.B. die Posterior-Leaf-<br />
Spring AFO (s. Abb.) eingesetzt. Allerdings haben sie keinen definierten Drehpunkt<br />
und keine definierte bzw. einstellbare Bewegungsfreiheit.<br />
Zudem erschweren alle Ausführungen eine optimale Anpassung an das pathologische<br />
Gangbild des Patienten und verringern somit die Wirkung der Orthese.<br />
Welchen Standpunkt vertritt FIOR & GENTZ?<br />
Es ist weiterhin sinnvoll, eine Differenzierung in dynamische und statische AFOs<br />
vorzunehmen.<br />
Dynamische AFOs (s. Seite 8) sind orthetische Hilfsmittel, die eine definierte Bewegung<br />
des anatomischen Knöchelgelenkes zulassen, während statische AFOs (s. Seite 9) keine<br />
Bewegung zulassen.<br />
Sowohl dynamische als auch statische AFOs sollten mit einstellbarem Knöchelgelenk<br />
gebaut werden. Damit kann sowohl auf das pathologische Gangbild des Patienten als<br />
auch auf die benötigte Bewegungsfreiheit eingewirkt werden. Eine Einstellung auf das<br />
Gangbild ist zwingend erforderlich, da die Stellung des Fußes beim Gipsen meist nicht<br />
der notwendigen Stellung bei Belastung mit der Orthese entspricht. Die einstellbare<br />
Bewegungsfreiheit ermöglicht es, ohne größeren Aufwand auf Veränderungen des<br />
Gangbildes zu reagieren, die sich während des Therapieverlaufes ergeben können.<br />
6 7<br />
SMO<br />
DAFO<br />
Hinged AFO<br />
SAFO Posterior-Leaf-<br />
Spring AFO
Dynamisch<br />
Statisch<br />
DYNAMISCHE ODER STATISCHE AFO? – WELC HES IST DAS RICHTIGE FIOR & GENTZ GELENK?<br />
Bei dynamischen AFOs wird das NEURO SWING<br />
bzw. NEURO SPRING eingesetzt.<br />
Die meisten <strong>CP</strong>-Patienten sollten mit dynamischen AFOs mit Knöchelgelenk versorgt<br />
werden. Die dadurch ermöglichte Bewegung wird benötigt, um Muskeln,<br />
die aufgrund einer Hirnschädigung zu stark, zu schwach oder zu einem falschen<br />
Zeitpunkt aktiviert werden, zu behandeln. So werden zum einen die richtigen<br />
cerebralen Verknüpfungen durch motorische Impulse hergestellt [Hor, S.5-26] und<br />
zum anderen einzelne Muskelgruppen durch ein gezieltes Muskelaufbautraining<br />
gestärkt. Dies führt zu einem physiologischeren Gangbild.<br />
Auf den folgenden Seiten des <strong>Handbuch</strong>es werden detaillierte Versorgungsvorschläge<br />
zum Bau von dynamischen AFOs aufgeführt. In dynamische AFOs werden je nach<br />
Versorgungskonzept entweder das neu entwickelte NEURO SWING oder das bereits<br />
im FIOR & GENTZ Sortiment vorhandene NEURO SPRING Systemknöchelgelenk<br />
eingesetzt.<br />
Bei statischen AFOs wird das<br />
NEURO VARIO eingesetzt.<br />
Für einige <strong>CP</strong>-Patienten ist eine orthetische Versorgung mit statischen AFOs mit<br />
Knöchelgelenk die bessere Wahl. Wird z.B. ein <strong>CP</strong>-Patient mit Spasmolytika wie<br />
Botulinumtoxin behandelt, was erforderlich und sinnvoll sein kann [Mol, S.367],<br />
so wird seine Muskulatur kurzfristig gelähmt. Diese Wirkung ist jedoch flüchtig.<br />
Ein zu häufiger Einsatz kann die physiotherapeutische Behandlung behindern.<br />
Der Muskel kann nicht optimal trainiert werden, atrophiert zunehmend und der<br />
physiotherapeutische Erfolg kann ausbleiben. In diesem Fall kann mit einer statischen<br />
AFO eine größtmögliche Hebelwirkung erreicht werden [Nov2, S.488ff].<br />
Auch wenn generell kein physiotherapeutischer Erfolg zu erwarten ist oder<br />
der <strong>CP</strong>-Patient sehr starke Fußdeformitäten hat, ist die Versorgung mit einer<br />
statischen AFO sinnvoll. Während der Erstellung des Gipsnegatives lässt sich<br />
nur schwer einschätzen, wie der Winkel zwischen Unterschenkel und Fuß bei<br />
Belastung mit angelegter Orthese sein wird. In statischen AFOs empfiehlt sich<br />
der Einbau des bereits im FIOR & GENTZ Sortiment vorhandenen NEURO VARIO<br />
Systemknöchelgelenkes, da Abweichungen vom notwendigen Aufbau der Orthese<br />
durch die Einstellmöglichkeiten ausgeglichen werden können.<br />
Da Versorgungen mit statischen AFOs nicht so komplex sind, werden sie auf den<br />
folgenden Seiten des <strong>Handbuch</strong>es nicht weiter berücksichtigt.<br />
Dynamische AFO mit NEURO SWING Systemknöchelgelenk Statische AFO mit NEURO VARIO Systemknöchelgelenk<br />
8 9
Vor der Entwicklung des NEURO SWING Systemknöchelgelenkes entschieden sich<br />
Fachleute für die orthetische Versorgung, von der sie sich die meisten Vorteile<br />
versprachen. Gleichzeitig mussten sie deren Nachteile akzeptieren.<br />
Eigenschaften<br />
NEURO SWING<br />
Nachteile<br />
existierender AFOs<br />
Einstellbarer Aufbau Nicht einstellbarer Aufbau<br />
Definierter Drehpunkt Kein definierter Drehpunkt<br />
Plantarflexion möglich Plantarflexion blockiert<br />
Das NEURO SWING in einer dynamischen AFO<br />
Eine AFO mit integriertem NEURO SWING Systemknöchelgelenk verbindet alle notwendigen<br />
Eigenschaften, die von einer modernen orthetischen Versorgung erwartet<br />
werden.<br />
Beschreibung<br />
Da die Orthese immer so aufgebaut sein muss, dass sie eine gewünschte<br />
Hebelwirkung erzielt [Nov2, S.488ff; Owe], ist der Einbau eines einstellbaren<br />
Knöchelgelenkes erforderlich. Nur so kann zum einen der Aufbau der Orthese genau<br />
an das pathologische Gangbild des <strong>CP</strong>-Patienten angepasst und zum anderen flexibel<br />
auf Veränderungen des pathologischen Gangbildes reagiert werden.<br />
Ein definierter Drehpunkt bringt folgende Vorteile mit sich:<br />
- Unterstützung einer qualifizierten Physiotherapie<br />
- gezieltes Muskelaufbautraining<br />
- Verhinderung von Muskelatrophien [Goe, S.98ff]<br />
- keine ungewollte Verschiebung der Orthesenschalen am Bein.<br />
Durch einstellbare Federkraft und Bewegungsfreiheit in Plantarflexion wird eine<br />
physiologische Plantarflexion ermöglicht. Dies bringt folgende Vorteile mit sich:<br />
- Unterstützung einer qualifizierten Physiotherapie<br />
- gezieltes Muskelaufbautraining<br />
- Entgegenwirken einer fortschreitenden Muskelatrophie [Goe, S.98ff]<br />
- Verhinderung einer übertriebenen Fersenkipphebelfunktion und keine zu starke<br />
Beanspruchung des M. quadriceps [Goe, S.134ff; Per, S.195].<br />
10 11
Eigenschaften<br />
NEURO SWING<br />
Nachteil<br />
existierender AFOs<br />
Einstellbare Bewegungsfreiheit Nicht einstellbare Bewegungsfreiheit<br />
Beschreibung<br />
Nach einer Operation kann es erforderlich sein, dass die Bewegungsfreiheit einer<br />
Orthese eingeschränkt oder ganz aufgehoben werden muss und erst im Laufe der<br />
weiteren Therapie wieder frei gegeben wird. Demnach muss ein Knöchelgelenk<br />
in die AFO eingebaut werden, bei dem die Bewegungsfreiheit individuell einstellbar<br />
ist.<br />
Tellerfeder Elastomerfeder- und Schraubenfedergelenk Das pathologische Gangbild einiger <strong>CP</strong>-Patienten erfordert sehr hohe Federkräfte.<br />
Dafür wurden bisher Posterior-Leaf-Spring AFOs eingesetzt. Mit dem NEURO SWING<br />
Systemknöchelgelenk werden diese Federkräfte durch Tellerfedern erreicht, die zu<br />
kompakten Federeinheiten geschichtet werden. Die Federeinheiten werden vorgespannt<br />
und speichern die durch das Körpergewicht eingebrachte Energie. Wird die<br />
Energie wieder frei gegeben, unterstützt dies die Beschleunigung des Beines in die<br />
Vorwärtsbewegung [Nov, S.333]. Eine AFO mit NEURO SWING Systemknöchelgelenk<br />
erreicht diese Wirkung mindestens genauso gut wie eine Posterior-Leaf-Spring<br />
AFO. Gängige Konstruktionen wie z.B. Elastomer- oder Schraubenfedergelenke<br />
können diese Wirkung nicht annähernd erzielen.<br />
Gleichzeitig wird der Gleichgewichtssinn positiv beeinflusst, was zur Stabilisierung<br />
der Gang- und Standsicherheit führt.<br />
Hohe Federkraft Geringe Federkraft<br />
Austauschbare Federeinheiten<br />
Veränderbare Federkraft Keine veränderbare Federkraft<br />
Weiche Anschläge Harte Anschläge<br />
Das NEURO SWING in einer dynamischen AFO<br />
Die Federkraft in Plantarflexion und Dorsalextension kann ohne großen Aufwand<br />
durch unterschiedlich starke Federeinheiten individuell an das pathologische<br />
Gangbild des Patienten angepasst werden. Bei AFOs ohne Knöchelgelenk ist die<br />
Federkraft nur schwer veränderbar.<br />
Durch die integrierten Tellerfedern werden weiche Anschläge gewährleistet, die<br />
der Entstehung oder Verschlechterung von Spastiken entgegenwirken.<br />
12 13
Um das gewünschte Therapieziel zu erreichen, benötigt das interdisziplinäre Team<br />
eine gemeinsame Grundlage zur Beurteilung der unterschiedlichen Ausprägungen<br />
der <strong>CP</strong>. Die Grundlage kann durch das Einstufen von <strong>CP</strong>-Patienten nach bestimmten<br />
Kriterien, einer sogenannten Klassifikation, geschaffen werden.<br />
Mit den bereits existierenden Klassifikationen Gross Motor Functional Classification<br />
System (GMFCS) und Functional Mobility Scale (FMS) können die grobmotorischen<br />
Fähigkeiten und die Mobilität von <strong>CP</strong>-Patienten beurteilt und deren Entwicklung<br />
vorhergesagt werden. Die <strong>CP</strong>-Patienten werden je nach Klassifikation in fünf bzw.<br />
sechs Stufen eingeteilt [Õun, S.151ff]. Jedoch gehen diese Klassifikationen nicht<br />
ausreichend auf das pathologische Gangbild des <strong>CP</strong>-Patienten ein. Für eine effektive<br />
orthetische Versorgung ist dies allerdings notwendig.<br />
Im Jahr 2001 haben Rodda und Graham bereits Patienten mit spastischer Hemiplegie<br />
und Diplegie unter Berücksichtigung des Gangbildes und der Körperhaltung mithilfe von<br />
Videoaufzeichnungen analysiert und in vier Gangtypen klassifiziert [Rod, S.98ff].<br />
GANGTYPEN<br />
Patientenklassifikation<br />
Neben dieser Klassifikation existiert die Amsterdam Gait Classification, die am VU<br />
University Medical Center in Amsterdam speziell für <strong>CP</strong>-Patienten entwickelt wurde.<br />
Sie unterscheidet fünf Gangtypen voneinander und beurteilt die Stellung des Knies und<br />
den Kontakt des Fußes zum Boden in mid stance (s. Abb. unten). Die in der Abbildung<br />
dargestellte mid stance befindet sich in Bezug auf die physiologischen Gangphasen<br />
(s. Seite 4-5) zwischen der early mid stance und der late mid stance. Dieser Zeitpunkt<br />
wurde gewählt, da sich das pathologische Gangbild dann leichter beurteilen lässt. Die<br />
Amsterdam Gait Classification ist sowohl bei unilateral als auch bei bilateral betroffenen<br />
Patienten gleichermaßen anwendbar [Gru, S.30]. Daher kann sie optimal als<br />
Klassifikation für eine einheitliche orthetische Versorgung genutzt werden.<br />
Die Amsterdam Gait Classification ermöglicht es, Gangbilder leicht zu erkennen<br />
und <strong>CP</strong>-Patienten entsprechend zu klassifizieren. Dadurch werden die fachübergreifende<br />
Kommunikation und die Therapiefindung erleichtert. Außerdem trägt sie zur<br />
Standardisierung und Qualitätssicherung der orthetischen Versorgung bei.<br />
Die Bücher von Perry und Götz-Neumann geben Ihnen einen verständlichen Überblick<br />
über die klinische Gangbildanalyse [Per; Goe].<br />
GANGTYPEN NACH DER AMSTERDAM GAIT CLASSIFICATION<br />
Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5<br />
KNIE Normal<br />
Überstreckt Überstreckt Gebeugt Gebeugt<br />
FUSSKONTAKT Vollständig<br />
Vollständig Unvollständig Unvollständig Vollständig<br />
Darstellung der Gangtypen in mid stance (zwischen early mid stance<br />
und late mid stance des physiologischen Gangbildes)<br />
14 15
Pathologisches Gangbild<br />
Charakteristisch für Gangtyp 1 ist neben einem zu<br />
schwachen M. tibialis anterior ein meist verkürzter<br />
M. gastrocnemius. Diese defizitären Muskeln führen<br />
zu einer Fußheberschwäche, die wiederum eine<br />
gestörte Dorsalextension in der Schwungphase verursacht.<br />
Dadurch berührt bei initial contact zuerst der<br />
Vorfuß den Boden und nicht die Ferse. In mid stance<br />
liegt der Fuß vollständig auf und die Kniestellung<br />
ist physiologisch unauffällig [Gru, S.31; Bec, S.5].<br />
Empfohlene Orthese<br />
Dynamische AFO mit dorsaler Schale, langem<br />
und teilflexiblem Fußteil (rigide Sohle mit flexiblem<br />
Zehenbereich) sowie NEURO SPRING<br />
Systemknöchelgelenk.<br />
16<br />
Versorgungsvorschlag zum Gangtyp 1<br />
GANGTYP 1 GANGTYP 2 GANGTYP 3 GANGTYP 4 GA<br />
mid stance mid Wirkungsweise stance der Orthese mid stance mid stance<br />
m<br />
Knie: Normal<br />
<strong>CP</strong>-Patienten dieses Gangtyps wurden bisher fast ausschließlich mit einfachen<br />
Hilfsmitteln wie knöchelhohen Schuhen, supramalleolären Orthesen (SMOs) oder<br />
speziellen orthopädischen Einlagen versorgt [Gru, S.33; Nov, S.331]. Dies liegt zum<br />
einen an der geringen Abweichung vom physiologischen Gangbild und zum anderen<br />
an der höheren Akzeptanz dieser Hilfsmittel. Jedoch müssen die fußhebende Wirkung<br />
und weitere physiologische Einschränkungen kritisch betrachtet werden.<br />
Die integrierte Feder des NEURO SPRING Systemknöchelgelenkes ist stark genug,<br />
um den Fuß in Neutral-Null-Stellung zu halten und dadurch bei initial contact den<br />
Boden mit der Ferse zu berühren. Diese Funktion ermöglicht eine physiologische<br />
Plantarflexion, indem sie die exzentrische Arbeit der prätibialen Muskulatur ersetzt<br />
und somit die Fersenkipphebelfunktion erhält. Der Vorfuß wird vom initial contact<br />
zur loading response kontrolliert gegen die Federkraft abgesenkt.<br />
Beim NEURO SPRING Systemknöchelgelenk kann der Dorsalanschlag bis zur gewünschten<br />
Bewegungsfreiheit entfernt werden, so dass die physiologische Dorsalextension<br />
Knie: Überstreckt Knie: Überstreckt Knie: Gebeugt<br />
in der mid stance und terminal stance ermöglicht wird. Die integrierte Feder bringt<br />
Kn<br />
Fußkontakt: Vollständig Fußkontakt: den Vollständig Fuß von der pre Fußkontakt: swing bis zur Unvollständig mid swing in Fußkontakt: die Neutral-Null-Stellung. UnvollständigDies Fußkont<br />
verhilft dem <strong>CP</strong>-Patienten zu stolperfreiem Gehen und somit zur Entlastung von<br />
Rumpf und Hüfte. Therapieunterstützende Elemente der oben genannten einfachen<br />
Hilfsmittel, wie z.B. ein sensomotorisches Fußbett, können weiterhin in die vorgeschlagene<br />
Orthese integriert werden.<br />
Orthopädische Hilfsmittel und knöchelhohe Schuhe, die die physiologische<br />
Plantarflexion einschränken, führen nur sehr schwer zum bestmöglichen Kompromiss<br />
von Fußheberwirkung und Fersenkipphebelfunktion. Eine qualifizierte Physiotherapie<br />
nutzt den physiologischen Fersenkipphebel. So werden zum einen die richtigen<br />
cerebralen Verknüpfungen durch motorische Impulse hergestellt [Hor, S.5-26] und<br />
zum anderen einzelne Muskelgruppen durch ein gezieltes Muskelaufbautraining<br />
gestärkt. Dies führt zu einem physiologischeren Gangbild.<br />
Bewegungsfreiheit<br />
Federkraft<br />
17
Pathologisches Gangbild<br />
Charakteristisch für Gangtyp 2 ist neben einem<br />
zu schwachen M. tibialis anterior eine falsche<br />
Aktivierung des M. triceps surae. Hierdurch entsteht<br />
eine Plantarflexion im Knöchel und eine leichte<br />
Flexion im Knie in terminal swing. Dies bewirkt, dass<br />
bei initial contact zuerst der Vorfuß und nicht die<br />
Ferse den Boden berührt. Durch die dabei entstehende<br />
Hebelwirkung kommt es zu einem kniestreckenden<br />
Moment. Zusätzlich wird das Knie ab initial<br />
contact durch den zum falschen Zeitpunkt aktivierten<br />
M. soleus zu stark nach hinten gezogen. Beides führt<br />
dazu, dass der <strong>CP</strong>-Patient das Knie überstreckt und<br />
so Sicherheit im Stand erlangt. In mid stance liegt<br />
der Fuß vollständig auf und das Kniegelenk bleibt<br />
Knie: Normal<br />
überstreckt [Gru, S.31; Bec, S.5].<br />
Fußkontakt: Vollständig<br />
Empfohlene Orthese<br />
Dynamische AFO mit hoher dorsaler Schale, langem<br />
und teilflexiblem Fußteil (rigide Sohle mit<br />
flexiblem Zehenbereich) sowie NEURO SWING<br />
Systemknöchelgelenk.<br />
Zu verwendende Federeinheiten:<br />
Dorsal: gelbe Markierung (sehr starke<br />
Federkraft, max. 10° Bewegungsfreiheit)<br />
Ventral: grüne Markierung (mittlere<br />
Federkraft, max. 15° Bewegungsfreiheit).<br />
Einstellmöglichkeiten des NEURO SWING<br />
Systemknöchelgelenkes<br />
Individuelle Anpassung an das pathologische<br />
Gangbild durch:<br />
Austauschbare Federeinheiten<br />
Einstellbaren Aufbau<br />
Einstellbare Bewegungsfreiheit.<br />
Alle drei Einstellungen sind unabhängig voneinander<br />
veränderbar und beeinflussen sich nicht gegenseitig.<br />
18<br />
mid stance mid stance mid Wirkungsweise stance der Orthese mid stance<br />
mid stance<br />
Knie: Überstreckt<br />
<strong>CP</strong>-Patienten dieses Gangtyps wurden bisher meist mit Polypropylenorthesen mit<br />
Elastomerfedergelenken (hinged AFO) versorgt, die die Dorsalextension frei geben<br />
und die Plantarflexion blockieren. Durch diese Bauweise steht der Fuß in Neutral-<br />
Null-Stellung oder leichter Dorsalextension und die physiologische Plantarflexion<br />
wird verhindert [Gru, S.33]. Der Fersenkipphebel verursacht dadurch zwischen initial<br />
contact und loading response ein übertriebenes Drehmoment in Flexionsrichtung im<br />
Unterschenkel, das an das Knie übertragen wird. Dies führt dazu, dass der M. quadriceps<br />
sehr stark beansprucht wird (z.B. bergab laufen mit einem Skistiefel) [Goe,<br />
S.134ff; Per, S.195].<br />
Die integrierte dorsale Federeinheit des NEURO SWING Systemknöchelgelenkes ist<br />
stark genug, um den Fuß in Neutral-Null-Stellung zu halten und dadurch bei initial<br />
contact den Boden mit der Ferse zu berühren. Sie ermöglicht eine physiologische<br />
Plantarflexion, indem sie die exzentrische Arbeit der prätibialen Muskulatur zulässt.<br />
Somit wird die Fersenkipphebelfunktion aktiv unterstützt und kein übertriebenes<br />
Knie: Überstreckt Knie: Gebeugt Knie: Gebeugt<br />
Drehmoment in den Unterschenkel eingeleitet. Der Vorfuß wird vom initial contact<br />
Fußkontakt: Vollständig Fußkontakt: zur Unvollständig loading response Fußkontakt: kontrolliert gegen Unvollständig die Federkraft Fußkontakt: abgesenkt. Die Vollständig physiologische<br />
Plantarflexion soll verhindern, dass der M. gastrocnemius zu früh aktiviert wird. Wird<br />
die Fersenkipphebelfunktion durch die empfohlene, sehr starke dorsale Federeinheit<br />
(gelbe Markierung) zu stark eingeschränkt, muss sie gegen eine mittlere Federeinheit<br />
(grüne Markierung) getauscht werden.<br />
In Kombination mit der dorsalen Federeinheit verhindert die dorsale Schale in mid<br />
stance die Überstreckung des Kniegelenkes.<br />
Hinged AFOs, die die physiologische Plantarflexion verhindern, führen nur sehr<br />
schwer zum bestmöglichen Kompromiss von Fersenkipphebelfunktion und physiologischer<br />
Knieflexion. Eine qualifizierte Physiotherapie nutzt den physiologischen<br />
Fersenkipphebel. So werden zum einen die richtigen cerebralen Verknüpfungen durch<br />
motorische Impulse hergestellt [Hor, S.5-26] und zum anderen einzelne Muskelgruppen<br />
durch ein gezieltes Muskelaufbautraining gestärkt. Dies führt zu einem physiologischeren<br />
Gangbild.<br />
Bewegungsfreiheit<br />
Federkraft<br />
Versorgungsvorschlag zum Gangtyp 2<br />
GANGTYP 1 GANGTYP 2 GANGTYP 3 GANGTYP 4 GANGTYP 5<br />
19
GANGTYP 1 GANGTYP 2 GANGTYP 3 GANGTYP 4 GANGTYP 5<br />
Pathologisches Gangbild<br />
Charakteristisch für Gangtyp 3 ist neben einem zu<br />
schwachen M. tibialis anterior eine zu frühe bzw. zu<br />
frühe und zu starke Aktivierung des M. triceps surae.<br />
Hierdurch entsteht eine Plantarflexion im Knöchel<br />
und eine leichte Flexion im Knie in terminal swing.<br />
Dies bewirkt, dass bei initial contact zuerst der Vorfuß<br />
und nicht die Ferse den Boden berührt. Durch die<br />
dabei entstehende Hebelwirkung kommt es zu einem<br />
kniestreckenden Moment. Zusätzlich wird das Knie<br />
ab initial contact durch den zum falschen Zeitpunkt<br />
aktivierten M. soleus zu stark nach hinten gezogen.<br />
Beides führt dazu, dass der <strong>CP</strong>-Patient das Knie<br />
überstreckt und so Sicherheit im Stand erlangt. In mid<br />
stance bleibt die Belastung auf dem Vorfuß und der<br />
Knie: Normal<br />
Fuß liegt nicht vollständig auf.<br />
Fußkontakt: Ein zu schwach Vollständig arbeitender M. gastrocnemius kann in<br />
terminal stance zu einer lang anhaltenden Aktivierung<br />
des M. vastus lateralis führen [Bec, S.6]. Dies führt zu einer fortschreitenden Überstreckung<br />
des Kniegelenkes [Gru, S.31; Bec, S.6]. Außerdem kann eine rigide Plantarflexionskontraktur<br />
entstehen, da der <strong>CP</strong>-Patient nie in die Dorsalextension geht. Beides kann das pathologische<br />
Gangbild so sehr verändern, dass sich die Überstreckung zu einer Knieflexion<br />
entwickelt. Dann muss der <strong>CP</strong>-Patient dem Gangtyp 4 zugeordnet werden.<br />
Empfohlene Orthese<br />
Dynamische AFO mit hoher ventraler Schale, langem<br />
und teilflexiblem Fußteil (rigide Sohle mit<br />
flexiblem Zehenbereich) sowie NEURO SWING<br />
Systemknöchelgelenk.<br />
Warum eine ventrale Schale? Lesen Sie dafür Absatz 4<br />
in die Wirkungsweise der Orthese auf der nächsten<br />
Seite.<br />
Zu verwendende Federeinheiten:<br />
Dorsal: grüne Markierung (mittlere<br />
Federkraft, max. 15° Bewegungsfreiheit)<br />
Ventral: gelbe Markierung (sehr starke<br />
Federkraft, max. 10° Bewegungsfreiheit).<br />
Einstellmöglichkeiten des NEURO SWING<br />
Systemknöchelgelenkes<br />
Individuelle Anpassung an das pathologische<br />
Gangbild durch:<br />
Austauschbare Federeinheiten<br />
Einstellbaren Aufbau<br />
Einstellbare Bewegungsfreiheit.<br />
Alle drei Einstellungen sind unabhängig voneinander<br />
veränderbar und beeinflussen sich nicht gegenseitig.<br />
20<br />
mid stance mid stance mid stance mid stance<br />
Bewegungsfreiheit<br />
Federkraft<br />
Versorgungsvorschlag zum Gangtyp 3<br />
mid Wirkungsweise stance<br />
der Orthese<br />
<strong>CP</strong>-Patienten dieses Gangtyps wurden bisher mit rigiden Polypropylenorthesen ohne<br />
Knöchelgelenk (SAFO) mit dorsaler Schale versorgt. Dabei steht der Fuß in Neutral-Null-<br />
Stellung oder leichter Dorsalextension [Gru, S.33]. Durch die rigide Bauweise wird jedoch<br />
die physiologische Plantarflexion verhindert. Der Fersenkipphebel verursacht dadurch<br />
zwischen initial contact und loading response ein übertriebenes Drehmoment im<br />
Unterschenkel, das an das Knie übertragen wird. Dies führt dazu, dass der M. quadriceps<br />
sehr stark beansprucht wird (z.B. bergab laufen mit einem Skistiefel) [Goe, S.134ff; Per,<br />
S.195]. Durch die dorsale Schale wird zusätzlich der Reflex des <strong>CP</strong>-Patienten verstärkt,<br />
sich mit der Wade an der Schale abzustützen, um Sicherheit im Stand zu erlangen.<br />
Die integrierte dorsale Federeinheit des NEURO SWING Systemknöchelgelenkes ist<br />
stark genug, um den Fuß in Neutral-Null-Stellung zu halten und dadurch bei initial<br />
contact den Boden mit der Ferse zu berühren. Sie ermöglicht eine physiologische<br />
Plantarflexion, indem sie die exzentrische Arbeit der prätibialen Muskulatur zulässt.<br />
Somit wird die Fersenkipphebelfunktion aktiv unterstützt und kein übertriebenes<br />
Drehmoment in den Unterschenkel eingeleitet. Der Vorfuß wird vom initial contact<br />
zur loading response kontrolliert gegen die Federkraft abgesenkt. Die physiologische<br />
Plantarflexion soll verhindern, dass der M. gastrocnemius zu früh aktiviert wird.<br />
Die ventrale Federeinheit wird von der mid stance bis zur terminal stance bis zur eingestellten<br />
Bewegungsfreiheit vorgespannt und speichert die durch das Körpergewicht<br />
eingebrachte Energie. Von der terminal stance bis zur pre swing gibt die ventrale<br />
Federeinheit die Energie wieder frei, wodurch sie die Beschleunigung des Beines in<br />
die Vorwärtsbewegung unterstützt.<br />
Eine Orthese mit hoher ventraler Schale kann erst durch die sehr hohen Federkräfte der<br />
integrierten Federeinheiten gebaut werden. Durch die ventrale Schale wird der Reflex<br />
des Patienten, sich abzustützen, dahingehend verändert, dass er sein Körpergewicht<br />
über das Schienbein in die Schale drückt und auch so Sicherheit im Stand erlangt. So<br />
wird der stetigen Überstreckung des Kniegelenkes und dem Entstehen von Kontrakturen<br />
im Knöchelgelenk vorgebeugt.<br />
SAFOs, die die physiologische Plantarflexion verhindern, führen nur sehr schwer<br />
zum bestmöglichen Kompromiss von Fersenkipphebelfunktion und physiologischer<br />
Knieflexion. Eine qualifizierte Physiotherapie nutzt<br />
den physiologischen Fersenkipphebel. So werden<br />
zum einen die richtigen cerebralen Verknüpfungen<br />
durch motorische Impulse hergestellt [Hor, S.5-26]<br />
und zum anderen einzelne Muskelgruppen durch<br />
ein gezieltes Muskelaufbautraining gestärkt. Dies<br />
führt zu einem physiologischeren Gangbild.<br />
Im Gegensatz zu einer AFO mit dorsaler Schale, beugt<br />
eine ventrale Schale der stetigen Überstreckung des<br />
Kniegelenkes und dem Entstehen von Kontrakturen<br />
im Knöchelgelenk vor.<br />
Knie: Überstreckt Knie: Überstreckt Knie: Gebeugt Knie: Gebeugt<br />
Fußkontakt: Vollständig Fußkontakt: Unvollständig Fußkontakt: Unvollständig Fußkontakt: Vollständig<br />
Schuhzurichtung<br />
Sollte trotz Orthese bei initial contact nicht zuerst die<br />
Ferse den Boden berühren, ist eine Absatzerhöhung<br />
am Schuh erforderlich. Die dadurch wiedererlangte<br />
Fersenkipphebelfunktion trägt dazu bei, dass sich<br />
der <strong>CP</strong>-Patient dem physiologischen Gangbild annähert<br />
[Goe, S.31].<br />
21
GANGTYP 2 GANGTYP 3 GANGTYP 4 GANGTYP 5<br />
Pathologisches mid stance Gangbild mid stance<br />
Charakteristisch für Gangtyp 4 ist eine zu starke<br />
Aktivierung der ischiocruralen Muskeln, die mit einer<br />
falschen Aktivierung des M. gastrocnemius oder<br />
des M. psoas major einhergeht. Dadurch kommt es<br />
zu einer Knie- und Hüftflexion, die bewirkt, dass<br />
bei initial contact zuerst der Vorfuß und nicht<br />
die Ferse den Boden berührt. In mid stance bleibt<br />
die Belastung auf dem Vorfuß und der Fuß liegt<br />
nicht vollständig auf. Außerdem bleiben Knie und<br />
Hüfte gebeugt. Da der <strong>CP</strong>-Patient beim Gehen<br />
sehr viel Energie verbraucht [Bre, S.102], ist zu<br />
erwarten, dass sich das pathologische Gangbild<br />
verschlechtert. Die betroffenen Muskeln können<br />
mid stance<br />
mid stance<br />
sich verkürzen und Flexionskontrakturen in Knie<br />
Knie: Überstreckt Knie: Überstreckt<br />
und Hüfte entstehen [Gru, S.31; Bec, S.6]. Bei<br />
Knie: Gebeugt Knie: Gebeugt<br />
Fußkontakt: einer Verkürzung Vollständig des M. Fußkontakt: gastrocnemius Unvollständig kann sich Fußkontakt: Unvollständig<br />
außerdem eine Plantarflexionskontraktur entwickeln.<br />
Um Kontrakturen zu korrigieren, können die verkürzten Muskeln durch Operationen<br />
verlängert [Nov3, S.445ff] oder mit Spasmolytika wie Botulinumtoxin behandelt<br />
werden [Mol, S.367]. Dies kann das pathologische Gangbild so sehr verändern, dass<br />
sich die Ferse bis auf den Boden absenkt. Dann muss der <strong>CP</strong>-Patient dem Gangtyp 5<br />
zugeordnet werden.<br />
Fußkontakt: Vollständig<br />
Empfohlene Orthese<br />
Dynamische AFO mit hoher ventraler Schale, langem<br />
und rigidem Fußteil sowie NEURO SWING<br />
Systemknöchelgelenk.<br />
Zu verwendende Federeinheiten:<br />
Dorsal: blaue Markierung (normale<br />
Federkraft, max. 15° Bewegungsfreiheit)<br />
Ventral: gelbe Markierung (sehr starke<br />
Federkraft, max. 10° Bewegungsfreiheit).<br />
Einstellmöglichkeiten des NEURO SWING<br />
Systemknöchelgelenkes<br />
Individuelle Anpassung an das pathologische<br />
Gangbild durch:<br />
Austauschbare Federeinheiten<br />
Einstellbaren Aufbau<br />
Einstellbare Bewegungsfreiheit.<br />
Alle drei Einstellungen sind unabhängig voneinander<br />
veränderbar und beeinflussen sich nicht gegenseitig.<br />
22<br />
Bewegungsfreiheit<br />
Federkraft<br />
Versorgungsvorschlag zum Gangtyp 4<br />
Wirkungsweise der Orthese<br />
Hat der <strong>CP</strong>-Patient keine Plantarflexionskontraktur, ist die integrierte dorsale<br />
Federeinheit des NEURO SWING Systemknöchelgelenkes stark genug, um den Fuß<br />
in Neutral-Null-Stellung zu halten und dadurch bei initial contact den Boden mit<br />
der Ferse zu berühren. Sie ermöglicht eine physiologische Plantarflexion, indem<br />
sie die exzentrische Arbeit der prätibialen Muskulatur zulässt. Somit wird die<br />
Fersenkipphebelfunktion aktiv unterstützt und kein übertriebenes Drehmoment in<br />
den Unterschenkel eingeleitet. Der Vorfuß wird vom initial contact zur loading response<br />
kontrolliert gegen die Federkraft abgesenkt. Eine qualifizierte Physiotherapie nutzt<br />
den physiologischen Fersenkipphebel. So werden zum einen die richtigen cerebralen<br />
Verknüpfungen durch motorische Impulse hergestellt [Hor, S.5-26] und zum anderen<br />
einzelne Muskelgruppen durch ein gezieltes Muskelaufbautraining gestärkt. Dies führt<br />
zu einem physiologischeren Gangbild. Ist die empfohlene, normale dorsale Federeinheit<br />
(blaue Markierung) aufgrund einer vorhandenen Plantarflexionskontraktur zu schwach,<br />
um den Fuß in der terminal swing in Neutral-Null-Stellung zu halten, muss sie gegen<br />
eine sehr starke Federeinheit (gelbe Markierung) getauscht werden.<br />
Durch das lange und rigide Fußteil und die ventrale Schale entsteht in mid stance<br />
ein kniestreckendes Moment, das den <strong>CP</strong>-Patienten aufrichtet und somit das pathologische<br />
Gangbild verbessert. Außerdem erlangt er Sicherheit im Stand.<br />
Die ventrale Federeinheit wird von der mid stance bis zur terminal stance bis zur eingestellten<br />
Bewegungsfreiheit vorgespannt und speichert die durch das Körpergewicht<br />
eingebrachte Energie. Von der terminal stance bis zur pre swing gibt die ventrale<br />
Federeinheit die Energie wieder frei, wodurch sie die Beschleunigung des Beines<br />
in die Vorwärtsbewegung unterstützt. Sowohl durch die Bauweise der Orthese als<br />
auch durch die Unterstützung der ventralen Federeinheit verbraucht der <strong>CP</strong>-Patient<br />
weniger Energie beim Gehen.<br />
Während der Erstellung des Gipsnegatives lässt sich nur schwer einschätzen,<br />
wie der Winkel zwischen Unterschenkel und Fuß bei Belastung mit angelegter<br />
Orthese sein wird. Abweichungen vom notwendigen Aufbau der Orthese können<br />
durch die Einstellmöglichkeiten des NEURO<br />
SWING Systemknöchelgelenkes aus-geglichen<br />
werden. Außerdem kann nachträglich auf mögliche<br />
Kontrakturen in Knie und Knöchel als auch<br />
auf Veränderungen, die sich durch die Therapie<br />
ergeben, reagiert werden. Ein optimaler Aufbau<br />
ist für den Therapieerfolg und energiesparendes<br />
Gehen erforderlich.<br />
Schuhzurichtung<br />
Sollte trotz Orthese bei initial contact nicht<br />
zuerst die Ferse den Boden berühren, ist eine<br />
Absatzerhöhung am Schuh erforderlich. Die<br />
dadurch wiedererlangte Fersenkipphebelfunktion<br />
trägt dazu bei, dass sich der <strong>CP</strong>-Patient dem physiologischen<br />
Gangbild annähert [Goe, S.31]. Dies<br />
kann vor allem eintreten, wenn der <strong>CP</strong>-Patient eine<br />
Plantarflexionskontraktur hat.<br />
23
GANGTYP 3 GANGTYP 4 GANGTYP 5<br />
Pathologisches mid stance Gangbild mid stance<br />
mid stance<br />
Charakteristisch für Gangtyp 5 ist eine zu starke<br />
Aktivierung der ischiocruralen Muskeln, die mit einer<br />
zu schwachen Aktivierung des M. gastrocnemius oder<br />
einer falschen Aktivierung des M. psoas major einhergeht.<br />
In mid stance kommt es zu einer zu starken Knieund<br />
Hüftflexion, durch die der <strong>CP</strong>-Patient beim Gehen<br />
sehr viel Energie verbraucht [Bre, S.102]. Die Knie- und<br />
Hüftflexion kann sich kontinuierlich verstärken und<br />
zum Kauergang mit Kontrakturen führen. Außerdem<br />
liegt der Fuß in mid stance vollständig auf. Es kommt<br />
zu einer exzessiven Dorsalextension, so dass sich die<br />
Ferse verspätet oder gar nicht vom Boden ablöst.<br />
Der zu schwache M. gastrocnemius kann durch zu wenig<br />
Bewegung im Knöchelgelenk, durch eine übertriebene<br />
Knie: Überstreckt Knie: Gebeugt Knie: Gebeugt<br />
operative Verlängerung der Achillessehne sowie durch<br />
ußkontakt: krankheitsbedingte Unvollständig oder Fußkontakt: künstliche Lähmungen Unvollständig ent- Fußkontakt: Vollständig<br />
stehen. Die künstliche Lähmung kann durch zu häufige<br />
Anwendung von Botulinumtoxin hervorgerufen werden [Goe, S.136]. Bei einer übertriebenen<br />
operativen Verlängerung kann der <strong>CP</strong>-Patient die neu gewonnene Bewegung<br />
im Knöchelgelenk nicht immer neurologisch kontrollieren [Per, S.194ff].<br />
Im Vergleich zu den anderen Gangtypen hat ein <strong>CP</strong>-Patient dieses Gangtyps nur eine geringe<br />
Aussicht auf Besserung und muss konsequent therapiert werden. Sollte das interdisziplinäre<br />
Therapiekonzept nicht zu einer deutlichen Verbesserung führen, kann der <strong>CP</strong>-Patient<br />
seine Gehfähigkeit in der Pubertät vollständig verlieren [Gru, S.31; Bec, S.6].<br />
Empfohlene Orthese<br />
Dynamische AFO mit hoher ventraler Schale, langem<br />
und rigidem Fußteil sowie NEURO SWING<br />
Systemknöchelgelenk.<br />
Zu verwendende Federeinheiten:<br />
Dorsal: blaue Markierung (normale<br />
Federkraft, max. 15° Bewegungsfreiheit)<br />
Ventral: rote Markierung (extra starke<br />
Federkraft, max. 5° Bewegungsfreiheit).<br />
Einstellmöglichkeiten des NEURO SWING<br />
Systemknöchelgelenkes<br />
Individuelle Anpassung an das pathologische<br />
Gangbild durch:<br />
Austauschbare Federeinheiten<br />
Einstellbaren Aufbau<br />
Einstellbare Bewegungsfreiheit.<br />
Alle drei Einstellungen sind unabhängig voneinander<br />
veränderbar und beeinflussen sich nicht gegenseitig.<br />
24<br />
Bewegungsfreiheit<br />
Federkraft<br />
Versorgungsvorschlag zum Gangtyp 5<br />
Wirkungsweise der Orthese<br />
Hat der <strong>CP</strong>-Patient keine Plantarflexionskontraktur, ist die integrierte dorsale<br />
Federeinheit des NEURO SWING Systemknöchelgelenkes stark genug, um den Fuß<br />
in Neutral-Null-Stellung zu halten und dadurch bei initial contact den Boden mit<br />
der Ferse zu berühren. Sie ermöglicht eine physiologische Plantarflexion, indem<br />
sie die exzentrische Arbeit der prätibialen Muskulatur zulässt. Somit wird die<br />
Fersenkipphebelfunktion aktiv unterstützt und kein übertriebenes Drehmoment in<br />
den Unterschenkel eingeleitet. Der Vorfuß wird vom initial contact zur loading response<br />
kontrolliert gegen die Federkraft abgesenkt. Eine qualifizierte Physiotherapie nutzt<br />
den physiologischen Fersenkipphebel. So werden zum einen die richtigen cerebralen<br />
Verknüpfungen durch motorische Impulse hergestellt [Hor, S.5-26] und zum anderen<br />
einzelne Muskelgruppen durch ein gezieltes Muskelaufbautraining gestärkt. Dies<br />
führt zu einem physiologischeren Gangbild.<br />
Durch das lange und rigide Fußteil sowie die ventrale Schale entsteht in mid stance<br />
ein kniestreckendes Moment, das den <strong>CP</strong>-Patienten aufrichtet und somit das pathologische<br />
Gangbild verbessert, wenn die Knieflexion noch nicht so groß ist, dass die<br />
Schwerelinie hinter dem anatomischen Drehpunkt verläuft. Außerdem erlangt er<br />
Sicherheit im Stand.<br />
Die extra starke ventrale Federeinheit wird von der mid stance bis zur terminal stance<br />
bis zur eingestellten Bewegungsfreiheit vorgespannt und speichert die durch das<br />
Körpergewicht eingebrachte Energie. Die Hebelwirkung des Fußteiles und der optimal<br />
eingestellte Dorsalanschlag bewirken die Fersenabhebung zum richtigen Zeitpunkt<br />
in der terminal stance. Von der terminal stance bis zur pre swing gibt die ventrale<br />
Federeinheit die Energie wieder frei, wodurch sie die Beschleunigung des Beines<br />
in die Vorwärtsbewegung unterstützt. Sowohl durch die Bauweise der Orthese als<br />
auch durch die Unterstützung der Federeinheit verbraucht der <strong>CP</strong>-Patient weniger<br />
Energie beim Gehen.<br />
Während der Erstellung des Gipsnegatives lässt sich nur schwer einschätzen, wie<br />
der Winkel zwischen Unterschenkel und Fuß bei Belastung mit angelegter Orthese<br />
sein wird. Abweichungen vom notwendigen Aufbau der Orthese können durch die<br />
Einstellmöglichkeiten des NEURO SWING Systemknöchelgelenkes ausgeglichen<br />
werden. Außerdem kann nachträglich auf mögliche Kontrakturen im Knie als auch auf<br />
Veränderungen, die sich durch die Therapie ergeben, reagiert werden. Ein optimaler<br />
Aufbau ist für den therapeutischen Erfolg und energiesparendes Gehen erforderlich.<br />
25
AFO<br />
(engl. Ankle Foot Orthosis): Unterschenkelorthese.<br />
Amsterdam Gait Classification<br />
Einteilung pathologischer Gangbilder der <strong>CP</strong>-Patienten in 5 Gangtypen. Sie beurteilt<br />
die Stellung des Knies und den Kontakt des Fußes zum Boden in mid stance.<br />
Die Amsterdam Gait Classification wurde am VU University Medical Center (VUMC)<br />
in Amsterdam unter Mitwirkung von Prof. Dr. Jules Becher entwickelt.<br />
atrophieren<br />
Muskelatrophie<br />
Botulinumtoxin<br />
Handelsname u.a. Botox®. Das Botulinumtoxin stellt eines der stärksten bekannten Gifte dar. Die<br />
giftigen Eiweißstoffe hemmen die Signalübertragung von den Nervenzellen zum Muskel.<br />
cerebrale Verknüpfung<br />
(lat. cerebrum = i.w.S. Gehirn): Das Gehirn speichert Steuerungsprogramme für komplexe<br />
Bewegungsmuster. Wiederholte Übungen von physiologischen Bewegungsmustern<br />
führen zur Korrektur dieser Steuerungsprogramme im Gehirn. Wiederum kann jede<br />
Störung aus der Umwelt zur wiederholten Störung der Steuerungsprogramme und<br />
damit zu pathologischen Bewegungsmustern führen.<br />
DAFO<br />
(engl. Dynamic Ankle Foot Orthosis): dynamische Unterschenkelorthese.<br />
Der Begriff DAFO wird international sowohl für supramalleoläre Orthesen als auch für<br />
teilflexible AFOs aus Polypropylen verwendet. Er ist in seiner bisherigen Verwendung nicht<br />
eindeutig, da auch AFOs mit Gelenk als dynamische AFOs bezeichnet werden sollten.<br />
dorsal<br />
(lat. dorsum = Rückseite, Rücken): zum Rücken bzw. zur Rückseite gehörend, an der<br />
Rückseite gelegen; z.B. bei einer AFO liegt die Schale an der Wade an.<br />
Dorsalextension<br />
Anheben der Fußspitze. Gegenbewegung: Absenken der Fußspitze ( Plantarflexion).<br />
Im Englischen dorsiflexion genannt, da eigentlich eine Flexion des Körperteils vorliegt.<br />
Funktionell ist dies aber besser als Extension zu bezeichnen.<br />
dynamisch<br />
(griech. dynamikós = wirkend, stark): eine Bewegung aufweisend, durch Schwung und<br />
Energie gekennzeichnet; d.h. eine dynamische AFO lässt eine definierte Bewegung<br />
im anatomischen Knöchelgelenk zu.<br />
Extension<br />
(lat. extendere = strecken): ist die aktive oder passive Streckbewegung eines Gelenkes.<br />
Die Streckung ist die Gegenbewegung zur Beugung ( Flexion) und führt charakteristischerweise<br />
zu einer Begradigung des betreffenden Körperteils.<br />
exzentrische Muskelarbeit:<br />
Die Arbeit, die der Muskel erledigt, wenn er ein Gewicht in seiner Bewegung bremst;<br />
z.B. ein Gewichtheber hat eine Hantel über seinen Kopf gestemmt und lässt sie langsam<br />
wieder herab. Die Kraft, die seine Muskeln aufbringen, ist exzentrische Muskelarbeit.<br />
exzessiv<br />
(lat. excedere = herausgehen, überschreiten) i.w.S. übertrieben.<br />
Fersenkipphebel<br />
(engl. heel rocker): ist ein Hebelarm, der vom Drehpunkt (Punkt, wo Ferse den Boden<br />
berührt) bis ins Knöchelgelenk reicht. Dieser Hebelarm verursacht zusammen mit<br />
dem Körpergewicht ein Drehmoment um diesen Drehpunkt.<br />
Fersenkipphebelfunktion<br />
(auch Heel-Rocker-Funktion): umfasst die komplette Drehbewegung des Fußes um<br />
einen Drehpunkt an der Ferse (heel rocker) beim Auftreten. Dabei arbeitet die prätibiale<br />
Muskulatur gegen diese Funktion und verhindert somit das unkontrollierte<br />
Absenken der Fußspitze.<br />
Flexion<br />
(lat. flectere = beugen): ist die aktive oder passive<br />
Beugebewegung eines Gelenkes. Die Beugung ist die<br />
Gegenbewegung zur Streckung ( Extension) und führt charakteristischerweise<br />
zu einer Krümmung des betreffenden Körperteils.<br />
hamstrings (1)<br />
ischiocrurale Muskeln<br />
Heel-Rocker-Funktion<br />
Fersenkipphebelfunktion<br />
ischiocrurale Muskeln (1)<br />
(engl. hamstrings): liegen auf der Dorsalseite<br />
(Rückseite) des Oberschenkels; im Hüftgelenk bewirken<br />
sie eine Extension und im Kniegelenk eine Flexion.<br />
Kauergang<br />
(engl. crouch gait): Gangbild mit dauernd gebeugten Hüften und Knien.<br />
Glossar<br />
Kontraktur<br />
(lat. contrahere = zusammenziehen): unwillkürliche Dauerverkürzung bzw. -schrumpfung<br />
eines Gewebes z.B. bestimmter Muskeln oder Sehnen. Sie führt zu einer rückbildungs-<br />
oder nichtrückbildungsfähigen Bewegungseinschränkung bzw. Zwangsfehlstellung in<br />
anliegenden Gelenken. Es gibt elastische und rigide Kontrakturen.<br />
M. gastrocnemius (2)<br />
Musculus gastrocnemius: Wadenmuskel, zweiköpfiger Muskel, der die Plantarflexion<br />
des Fußes bewirkt. Ein Teil des M. triceps surae.<br />
26 27<br />
1<br />
2<br />
5<br />
3<br />
4<br />
4a<br />
6
M. psoas major (3)<br />
Musculus psoas major: „großer Lendenmuskel“, von den Lendenwirbeln ausgehender,<br />
innerer Hüftmuskel, der den Oberschenkel im Hüftgelenk beugt und nach außen dreht.<br />
M. quadriceps (4)<br />
Musculus quadriceps femoris: vierköpfiger Schenkelstrecker. Bewirkt hauptsächlich<br />
die Extension des Unterschenkels im Kniegelenk.<br />
M. soleus (5)<br />
Musculus soleus: „Schollenmuskel“, Unterschenkelmuskel, dessen Sehne sich mit der<br />
des M. gastrocnemius zur Achillessehne vereinigt und der an der Plantarflexion des<br />
Fußes beteiligt ist. Ein Teil des M. triceps surae.<br />
M. tibialis anterior (6)<br />
Musculus tibialis anterior: vorderer Schienbeinmuskel, vom Schienbein zum medialen<br />
Fußrand ziehender Muskel, der die Dorsalextension des Fußes bewirkt.<br />
M. triceps surae (2 und 5)<br />
Musculus triceps surae: dreiköpfiger Wadenmuskel, zusammenfassende Bezeichnung<br />
für den zweiköpfigen M. gastrocnemius und den M. soleus.<br />
M. vastus lateralis (4a)<br />
Musculus vastus lateralis: äußerer Schenkelmuskel, von der Hinterfläche des<br />
Oberschenkels zur Kniescheibe ziehender Teil des M. quadriceps, ist an der Extension<br />
des Unterschenkels im Kniegelenk beteiligt.<br />
Muskelatrophie<br />
(griech. atrophia = Auszehrung, Abmagerung): sichtbare Umfangsabnahme eines<br />
Skelettmuskels durch verminderte Beanspruchung.<br />
Neutral-Null-Stellung<br />
Bezeichnet die Körperposition, die ein Mensch im normalen aufrechten, etwa hüftbreiten<br />
Stand einnimmt. Aus der Neutral-Null-Stellung wird der Bewegungsumfang<br />
eines Gelenkes ermittelt.<br />
pathologisches Gangbild<br />
(griech. path = Schmerz; Krankheit): krankhaft (verändertes) Gangbild.<br />
physiologisch<br />
(griech. physis = Natur; logos = Lehre): die natürlichen Lebensvorgänge betreffend.<br />
plantar<br />
(lat. planta = Fußsohle): die Fußsohle betreffend, sohlenwärts.<br />
Plantarflexion<br />
Absenken der Fußspitze. Gegenbewegung: Anheben der Fußspitze ( Dorsal-extension).<br />
Glossar<br />
Polypropylen<br />
(PP): Gruppe thermoplastisch verformbarer und schweißbarer Kunststoffe. Wird häufig<br />
zur Herstellung von einfachen Orthesen verwendet. Ökonomische Herstellungstechnik.<br />
Nachteil gegenüber hochwertigeren Werkstoffen, wie Kohlefaser, ist das deutlich<br />
höhere Gewicht, wenn die gleiche Steifigkeit erreicht werden soll.<br />
Posterior-Leaf-Spring AFO<br />
(lat. posterior = hinten; engl. leaf spring = Blattfeder): Unterschenkelorthese mit<br />
hinter der Achillessehne angebrachter Blattfeder, häufig aus Kohlefaser.<br />
prätibial<br />
(lat. prä… = vor, vorher; tibia = Schienbein): vor dem Schienbein gelegen.<br />
SAFO<br />
(engl. Solid Ankle Foot Orthosis): starre Unterschenkelorthese.<br />
Der Begriff SAFO wird international für starre AFOs aus Polypropylen verwendet. Er ist in<br />
seiner bisherigen Verwendung nicht eindeutig, da auch statische AFOs starre AFOs sind.<br />
Spasmolytikum<br />
(griech. spasmos = Krampf): Krampflösendes Arzneimittel. Es senkt den Spannungszustand<br />
der glatten Muskulatur oder löst deren Verkrampfung.<br />
Spastik<br />
(griech. spasmos = Krampf): Tonuserhöhung der Skelettmuskulatur, die die Extremitäten<br />
in typische, nicht funktionelle Haltungsmuster zwingt. Sie wird immer durch<br />
eine Schädigung des Gehirns oder Rückenmarks hervorgerufen.<br />
statisch<br />
(griech. statikós = stellend, stehen machend): das Gleichgewicht der Kräfte, die Statik<br />
betreffend, im Gleichgewicht, in Ruhelage befindlich, stillstehend; d.h. eine statische<br />
AFO lässt keine Bewegung im anatomischen Knöchelgelenk zu.<br />
supramalleolär<br />
(lat. supra = über, oberhalb; Malleolus = Knöchel des Fußes): oberhalb eines (Fuß-)<br />
Knöchels gelegen; z.B. supramalleoläre Orthesen reichen medial (innen) und lateral<br />
(außen) bis über den Knöchel.<br />
Tellerfeder<br />
Kegelige Ringschale, die in Achsrichtung belastbar ist und sowohl ruhend als auch<br />
schwingend beansprucht werden kann. Kann als Einzelfeder oder Federsäule verwendet<br />
werden. In einer Säule können entweder einzelne Tellerfedern oder aus mehreren<br />
Federn bestehende Federpakete geschichtet werden.<br />
ventral<br />
(lat. venter = Bauch, Leib): bauchwärts, nach vorne gelegen; z.B. bei einer AFO liegt<br />
die Schale an der Vorderseite des Unterschenkels an.<br />
28 29
[Bec] Becher, Jules G. (2002): Paediatric rehabilitation in children<br />
with Cerebral Palsy: General Management, classification<br />
of motor disorders. PDF. Amsterdam: Department of<br />
Rehabilitation Medicine of the VU University Medical Centre.<br />
[Bre] Brehm, Merel-Anne (2007): The Clinical Assessment of<br />
Expenditure in Pathological Gait. Academisch Proefschrift.<br />
Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam, Nollet/Lankhorst/<br />
Harlaar.<br />
[Doe] Döderlein, Leonhard (2007): Infantile Zerebralparese. Diagnostik,<br />
konservative und operative Therapie. Darmstadt: Steinkopff<br />
[Gag] Gage, James R. (2009): „Gait Pathology in Individuals with<br />
Cerebral Palsy. Introduction and Overview.” In: Gage, James R.<br />
et al (2009) (Hrsg.): The Identification and Treatment of Gait<br />
Problems in Cerebral Palsy. 2nd Edition. London: Mac Keith<br />
Press, 65.<br />
[Gag2] Gage, James R. et al (2009): „Section 5. Operative Treatment.”<br />
In: Gage, James R. et al (2009) (Hrsg.): The Identification and<br />
Treatment of Gait Problems in Cerebral Palsy. 2nd Edition.<br />
London: Mac Keith Press, 381-578.<br />
[Goe] Götz-Neumann, Kirsten (2006): Gehen verstehen. Ganganalyse<br />
in der Physiotherapie. Stuttgart: Georg Thieme.<br />
[Gru] Grunt, Sebastian (2007): „Geh-Orthesen bei Kindern mit<br />
Cerebralparese.“ In: Paediatrica, Vol. 18, Nr. 6, 30-34.<br />
[Hor] Horst, Renata (2005): Motorisches Strategietraining und PNF.<br />
Stuttgart: Georg Thieme.<br />
[Kra] Krämer, Jürgen (1996): Orthopädie. 4. Auflage. Berlin u.a.: Springer.<br />
[Mol] Molenaers, Guy/Desloovere, Kaat (2009): „Pharmacologic<br />
Treatment with Botulinum Toxin.” In: Gage, James R. et al (2009)<br />
(Hrsg.): The Identification and Treatment of Gait Problems in<br />
Cerebral Palsy. 2nd Edition. London: Mac Keith Press, 363-380.<br />
[Mor] Morris, Christopher/Condie, David (2009) (Hrsg): Recent<br />
Developments in Healthcare for Cerebral Palsy: Implications<br />
and Opportunities for Orthotics. Copenhagen: International<br />
Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO).<br />
Literaturhinweise<br />
Abk. Quelle Seite Abk. Quelle Seite<br />
16, 18,<br />
20, 22,<br />
24<br />
22, 24<br />
6<br />
4<br />
6<br />
5, 11, 15,<br />
19, 21,<br />
23, 24<br />
15-22,<br />
24<br />
5, 8, 11,<br />
17, 19, 21,<br />
23, 25<br />
4<br />
6, 9, 22<br />
2<br />
[Nov] Novacheck, Tom F. et al (2009): „Orthoses.“ In: Gage, James R.<br />
et al (2009) (Hrsg.): The Identification and Treatment of Gait<br />
Problems in Cerebral Palsy. 2nd Edition. London: Mac Keith<br />
Press, 327-348.<br />
[Nov2] Novacheck, Tom F. (2008): „Orthoses for cerebral palsy.” In:<br />
Hsu, John D./Michael, John W./Fisk, John R. (2008) (Hrsg.):<br />
AAOS Atlas of Orthoses and Assistive Devices. 4th Edition.<br />
Philadelphia: Mosby/Elsevier, 487-500.<br />
[Nov3] Novacheck, Tom F. et al (2009): „Orthopaedic treatment of<br />
muscle contractures.“ In: Gage, James R. et al (2009) (Hrsg.):<br />
The Identification and Treatment of Gait Problems in Cerebral<br />
Palsy. 2nd Edition. London: Mac Keith Press, 445-471.<br />
[Õun] Õunpuu, Sylvia et al (2009): „Classification of Cerebral<br />
Palsy and Patterns of Gait Pathology.” In: Gage, James R. et<br />
al (2009) (Hrsg.): The Identification and Treatment of Gait<br />
Problems in Cerebral Palsy. 2nd Edition. London: Mac Keith<br />
Press, 147-166.<br />
[Owe] Owen, Elaine (2008): „The Importance of Being Earnest about<br />
Shank and Thigh Kinematics especially when using Ankle-Foot<br />
Orthoses.” In: Prosthetics and Orthotics International, Sep.<br />
2010, Vol. 34, Nr. 3, 254-269.<br />
[Pea] Peacock, Warwick J. (2009): „The Pathophysiology of<br />
Spasticity.” In: Gage, James R. et al (2009) (Hrsg.): The<br />
Identification and Treatment of Gait Problems in Cerebral<br />
Palsy. 2nd Edition. London: Mac Keith Press, 89-98.<br />
[Per] Perry, Jaquelin/Burnfield, Judith M. (2010): Gait Analysis: Normal<br />
and Pathological Function. 2nd Edition. New Jersey: Slack.<br />
[Rod] Rodda, J./Graham, H.K. (2001): „Classification of gait pattern<br />
in spastic hemiplegia and spastic diplegia: a basis for a<br />
management algorithm.“ In: European Journal of Neurology 8<br />
(2001), Suppl. 5, 98-108.<br />
[Rom] Romkes, J./Hell, A.K./Brunner, R. (2006): „Changes in muscle<br />
activity in children with hemiplegic cerebral palsy while<br />
walking with and without ankle–foot orthoses.“ In: Gait &<br />
Posture 24 (2006), 467–474.<br />
30 31<br />
6, 13, 17<br />
6, 9, 11<br />
22<br />
14<br />
6, 11<br />
4<br />
11, 15,<br />
19, 21,<br />
24<br />
14<br />
6
FIOR & GENTZ GmbH · Dorette-von-Stern-Straße 5 · D-21337 Lüneburg<br />
Tel. +49 (0)4131-24445-0 · Fax +49 (0)4131-24445-57<br />
www.fior-gentz.de · info@fior-gentz.de<br />
PR0221-DE-06/2012