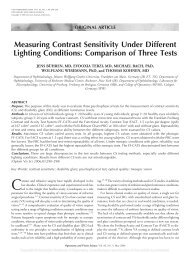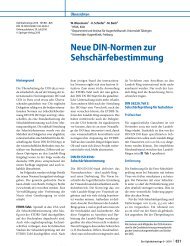Die Grenzen der Sehschärfe, Teil 1 - Höhere Fachschule für ...
Die Grenzen der Sehschärfe, Teil 1 - Höhere Fachschule für ...
Die Grenzen der Sehschärfe, Teil 1 - Höhere Fachschule für ...
- TAGS
- grenzen
- fachschule
- www.hfak.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Physiologische Optik<br />
<strong>Die</strong> <strong>Grenzen</strong> <strong>der</strong> <strong>Sehschärfe</strong>,<br />
<strong>Teil</strong> 1:<br />
Im Folgenden wird die Behauptung, Astronauten hätten<br />
im Weltraum eine beson<strong>der</strong>s hohe Optotypensehschärfe,<br />
entkräftet. Der Unterschied zwischen dem Minimum<br />
visibile und dem Minimum separabile wird anhand von<br />
Beispielen diskutiert. <strong>Die</strong> <strong>Grenzen</strong>, bis zu denen helle<br />
bzw. dunkle Punkte und Linien zu sehen sind, werden<br />
erläutert.<br />
Einleitung<br />
Wenn von „<strong>Sehschärfe</strong>“ gesprochen wird, denkt <strong>der</strong> Augenoptiker<br />
ganz automatisch an die Optotypensehschärfe. <strong>Die</strong>s ist<br />
verständlich, denn die mit Landoltringen, Buchstaben o<strong>der</strong> Zahlen<br />
gemessene Optotypensehschärfe ist eine Sehfunktion, die<br />
tagtäglich im Rahmen <strong>der</strong> Augenglasbestimmung ermittelt wird.<br />
So ist es auch verständlich, wenn augenoptische Fachleute aus<br />
populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen zur <strong>Sehschärfe</strong><br />
falsche Schlüsse ziehen. Genau dies passierte in dem Artikel von<br />
Herrn Riedl in <strong>der</strong> DOZ 3 und 4/2001.<br />
Hintergrund: Seit 1991 schreibt Riedl in loser Folge Artikel, in<br />
denen er behauptet, dass einzig die Hornhautreflexbildchen <strong>für</strong><br />
die Brillenglaszentrierung maßgeblich sein sollen. In diesen<br />
Artikeln werden die traditionelle Optik und <strong>der</strong>en Vertreter heftig<br />
angegriffen. Riedl for<strong>der</strong>t Beweise da<strong>für</strong>, dass die Augenpupille<br />
als Aperturblende des visuellen Systems wirkt. Fachleute wie Dr.<br />
Goersch und Dr. En<strong>der</strong>s haben sich kritisch mit diesen Artikeln<br />
auseinan<strong>der</strong>gesetzt und versucht, Riedls Ansichten zu wi<strong>der</strong>legen.<br />
Auch ich habe in einem Artikel (Wesemann, 1996) erläutert,<br />
warum ich mit den Vorstellungen von Herrn Riedl nicht einverstanden<br />
bin. Trotzdem präsentiert er seine alten Thesen immer<br />
wie<strong>der</strong> in neuem Gewand. So berichtet er in den Ausgaben <strong>der</strong><br />
DOZ (3 und 4/2001):<br />
26 ■ DOZ 8/2001<br />
Priv.-Doz. Dr. W. Wesemann,<br />
Köln<br />
Das Märchen von <strong>der</strong><br />
fantastischen <strong>Sehschärfe</strong> <strong>der</strong> Astronauten im Weltraum<br />
1. von <strong>der</strong> außerordentlich hohen <strong>Sehschärfe</strong>, die Astronauten<br />
im Weltraum erreichen und folgert daraus,<br />
2. dass das visuelle System nur einen kleinen Ausschnitt aus<br />
dem realen Pupillenquerschnitt selektiert, <strong>der</strong> einen Durchmesser<br />
von weniger als 1 mm hat, denn an<strong>der</strong>s wären nach seiner<br />
Meinung die hohen Visuswerte <strong>der</strong> Astronauten nicht erklärbar.<br />
Beide Behauptungen sind falsch. In diesem kurzen Artikel<br />
möchte ich zum ersten Punkt Stellung nehmen.<br />
<strong>Die</strong> <strong>Sehschärfe</strong> <strong>der</strong> Astronauten<br />
<strong>Die</strong> NASA hat zur <strong>Sehschärfe</strong> im Weltraum wissenschaftliche<br />
Untersuchungen durchgeführt. In einer Arbeit von Task und<br />
Genco mit dem Titel „Effects of short-term space flight on several<br />
visual functions“ wird von Messungen berichtet, die an NASA-<br />
Astronauten vor, während und nach dem Raumflug vorgenommen<br />
wurden. Unter an<strong>der</strong>em wurden die visuellen Parameter:<br />
Kontrastempfindlichkeit, Flimmerfusionsfrequenz, Stereopsis und<br />
<strong>Sehschärfe</strong> untersucht. Auch die Augendominanz und das<br />
Muskelgleichgewicht wurden bei 15 Astronauten erfasst. Das<br />
Ergebnis <strong>der</strong> Visusprüfungen ist in Abbildung 1 wie<strong>der</strong>gegeben.<br />
Aufgetragen ist die mittlere <strong>Sehschärfe</strong> und die<br />
Schwankungsbreite über alle untersuchten Astronauten.<br />
Deutlich sieht man, dass die <strong>Sehschärfe</strong> während des<br />
Weltraumfluges keineswegs besser wird. <strong>Die</strong> Verbindungslinie<br />
verläuft praktisch horizontal.<br />
<strong>Die</strong> amerikanischen Forscher schreiben dazu: „Einige <strong>der</strong><br />
ersten Astronauten wiesen darauf hin, dass sie das Gefühl<br />
hatten, im Weltraum bei Erdbeobachtungen besser sehen zu<br />
können.“ <strong>Die</strong>s hätte eine Verbesserung des Fernvisus bedeutet.<br />
Aus Abbildung 1 geht aber hervor, dass die <strong>Sehschärfe</strong> während<br />
des Raumflug etwas schlechter ist (nicht statistisch signifikant) als<br />
vor o<strong>der</strong> nach dem Raumflug.
Abb. 1: Ergebnisse <strong>der</strong> Fernvisusprüfung mit einem Sehtestgerät<br />
bei 15 Astronauten. Aufgetragen ist <strong>der</strong> mittlere Visuswert und<br />
die Schwankungsbreite. Gemessen wurde vor, während und<br />
nach dem Raumflug. Bei diesen Messungen ergab sich ein<br />
mittlerer Fernvisus von etwa 1,5. Der Fernvisus verän<strong>der</strong>te sich im<br />
Weltraum nur unwesentlich. (neu gezeichnet nach Task und<br />
Genco, 1987)<br />
In einer an<strong>der</strong>en Untersuchung berichten Ginsburg (<strong>der</strong><br />
Erfin<strong>der</strong> <strong>der</strong> VisTech-Tafel) und Van<strong>der</strong>ploeg über Nahsehschärfeund<br />
Kontrastempfindlichkeitsmessungen während <strong>der</strong> Raumflüge<br />
von 1981-1986. In ihrer Zusammenfassung schreiben<br />
die Autoren: „Während <strong>der</strong> Raumflüge mit dem Space-Shuttle<br />
konnten keine signifikanten Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Nahschärfe<br />
nachgewiesen werden “ und weiter „Eine signifikante Verschlechterung<br />
<strong>der</strong> Kontrastempfindlichkeit (während des Raumflugs)<br />
ist möglich“.<br />
O´Neal et al. berichtete auf dem Kongress <strong>der</strong> Internationalen<br />
Astronautischen Fö<strong>der</strong>ation in Dresden (1990) über detaillierte<br />
Fernvisusmessungen an 23 amerikanischen Astronauten. In dieser<br />
Untersuchungsreihe wurden auch Wie<strong>der</strong>holungsmessungen<br />
durchgeführt, um herauszufinden, ob sich <strong>der</strong> Visus im Laufe des<br />
Raumfluges verän<strong>der</strong>te. <strong>Die</strong>se Ergebnisse sind in Abbildung 2<br />
dargestellt. Deutlich sieht man, dass <strong>der</strong> Fernvisus während des<br />
Raumfluges bei den meisten Astronauten gleich bleibt. Bei einem<br />
Astronauten sank <strong>der</strong> Visus nach 48 Stunden auf etwa 0,6 und<br />
erholte sich dann in den folgenden Tagen langsam wie<strong>der</strong>.<br />
Als Ursache <strong>für</strong> die Verschlechterung werden u.a. Ödeme <strong>der</strong><br />
Netzhaut genannt, die in <strong>der</strong> Schwerelosigkeit auftreten können.<br />
Im Mittel betrug die Fernvisusverschlechterung 7,9 Prozent.<br />
O´Neal et al. berichteten außerdem über weitere Untersuchungen,<br />
die von den russischen Astronauten im Wostock und Sojus<br />
Programm durchgeführt worden waren. Auch dort war im Mittel<br />
eine geringfügige Visusverschlechterung (5-10 Prozent) während<br />
des Raumfluges gefunden worden.<br />
<strong>Die</strong>se Informationen, die ich u.a. über die Deutsche Forschungsanstalt<br />
<strong>für</strong> Luft- und Raumfahrt in Köln erhalten habe,<br />
sind auch Herrn Riedl bekannt, denn auch er hat mir Einblick in<br />
die ihm vorliegenden Unterlagen gewährt, wo<strong>für</strong> ich ihm an<br />
dieser Stelle ausdrücklich danke. Trotzdem glaubt er nach wie vor<br />
an die Geschichte von <strong>der</strong> hohen <strong>Sehschärfe</strong> <strong>der</strong> Astronauten. Er<br />
meint, dass das Ergebnis <strong>der</strong> <strong>Sehschärfe</strong>prüfung besser gewesen<br />
wäre, wenn die Astronauten nicht in ein standardisiertes Sehtestgerät<br />
hineingeschaut, son<strong>der</strong>n aus dem Fenster auf die Erde<br />
geblickt hätten. In einem Brief, den Herr Riedl an mich schrieb,<br />
verweist er zur Untermauerung seiner Ansicht auf Schriften von<br />
Hoimar von Ditfurth und ein Buch, das <strong>der</strong> deutsche Astronaut<br />
Dr. Walter im Jahre 1997 veröffentlichte. In diesem Buch schreibt<br />
Walter: „Das theoretische Auflösungsvermögen des Menschen,<br />
begrenzt durch den Abstand <strong>der</strong> Sehstäbchen auf <strong>der</strong> Augennetzhaut,<br />
beträgt eine halbe Bogenminute.“ <strong>Die</strong>ser Satz<br />
beschreibt den Abstand <strong>der</strong> Photorezeptoren in <strong>der</strong> Fovea vollkommen<br />
richtig (siehe Østerberg, 1935). Aus diesem theoretischen<br />
Auflösungsvermögen und seiner praktischen Erfahrung<br />
folgert Walter: „In einer Entfernung von 300 km (. . . ) kann man<br />
damit tatsächlich alles erkennen, was größer ist als 30 Meter!“<br />
<strong>Die</strong>se Folgerung von Walter ist etwas großzügig, denn, wenn<br />
man genau nachrechnet, kann man mit einem Auflösungsvermögen<br />
von einer halben Bogenminute aus 300 km höchstens Landoltringe<br />
erkennen, <strong>der</strong>en Lücken mindestens 44 m breit sind.<br />
Doch die Größenordnung stimmt. Über die Differenz lohnt auch<br />
kein langer Streit, denn das entscheidende Problem ist ein ganz<br />
an<strong>der</strong>es. Walter denkt nämlich bei <strong>der</strong> Art <strong>der</strong> Sehleistung, die er<br />
beschreibt, nicht an die Optotypensehschärfe, son<strong>der</strong>n an eine<br />
an<strong>der</strong>e Art <strong>der</strong> <strong>Sehschärfe</strong> – das sogenannte Minimum visibile.<br />
Minimum visibile/Minimum perzeptibile<br />
<strong>Die</strong> beide Begriffe Minimum visibile bzw. Minimum perzeptibile<br />
kennzeichnen die Erkennbarkeit eines Objektes aufgrund seiner<br />
Abb. 2: Fernvisus von 23 Astronauten vor, während und nach<br />
dem Weltraumflug. Im Unterschied zu Abbildung 1 wurden im<br />
Rahmen dieser Untersuchung mehrere Messung an aufeinan<strong>der</strong>folgenden<br />
Tagen durchgeführt. Der Zeitpunkt <strong>der</strong> Messungen (in<br />
Stunden nach dem Start) ist auf <strong>der</strong> x-Achse angegeben. Vor und<br />
nach dem Weltraumaufenthalt hatten die Astronauten mit <strong>der</strong><br />
besten <strong>Sehschärfe</strong> einen Visus von 2,5. <strong>Die</strong> Astronauten mit <strong>der</strong><br />
schlechtesten <strong>Sehschärfe</strong> erreichten nur 0,9. (ungerechnet nach<br />
O´Neal et al., 1990)<br />
DOZ 8/2001 ■ 27
Physiologische Optik<br />
Helligkeit o<strong>der</strong> seines Leuchtdichtekontrasts zur Umgebung. <strong>Die</strong><br />
absolute Empfindungsschwelle <strong>für</strong> Lichtpunkte gehört in diese<br />
Kategorie genauso wie die Erkennbarkeit <strong>der</strong> Prüfpunkte bei <strong>der</strong><br />
Perimetrie. Typische Testfiguren <strong>für</strong> diese Art <strong>der</strong> <strong>Sehschärfe</strong> sind<br />
dunkle Testobjekte auf hellem Grund bzw. helle Testobjekte auf<br />
dunklem Grund. <strong>Die</strong>se Art <strong>der</strong> <strong>Sehschärfe</strong> wird von Paliaga (1993)<br />
auch als „Punktsehschärfe“ bezeichnet (siehe Abb. 3).<br />
Abb. 3: Beispiele <strong>für</strong> unterschiedliche Testfiguren mit denen man<br />
die Sehleistung des Menschen prüfen kann. a) Minimum visibile/Minimum<br />
perzeptibile: a1) heller Punkt auf dunklem Grund a2)<br />
dunkler Punkt auf hellem Grund a3) dunkle Linie auf hellem<br />
Grund b) Nonius-<strong>Sehschärfe</strong> c) Minimum separabile/angulare<br />
<strong>Sehschärfe</strong>: c1) zwei Punkte c2) zwei Linien c3) Gittermuster c4)<br />
Landoltring d) Minimum legibile/Leseempfindlichkeit: Lesetext<br />
aus <strong>der</strong> Nieden Tafel.<br />
Wahrnehmung dunkler Objekten auf<br />
hellem Grund<br />
Dunkle Punkte, dunkle Linien o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e dunkle Objekte auf<br />
hellerem Umfeld können bei gutem Kontrast bis hinunter zu einer<br />
Kleinheit von circa. 14 Bogensekunden wahrgenommen werden<br />
(Hecht et al., 1947). Aus 300 km Entfernung entspricht dieser<br />
Zahlenwert einer Objektgröße von 20,4 m. Unter günstigen<br />
Bedingungen sollen dunkle Linien sogar bis herab zu einer Linienbreite<br />
von einer halben Winkelsekunde sichtbar sein (Hecht und<br />
Mintz, 1939). Aus 300 km entspräche dies einer dunklen Linie<br />
von 73 cm Breite! <strong>Die</strong>s ist aus dem Weltraum wegen <strong>der</strong> Luftunruhe<br />
und dem Dunst allerdings nicht erzielbar, son<strong>der</strong>n nur im<br />
Labor auf <strong>der</strong> Erde.<br />
Walter schreibt in diesem Zusammenhang: „Mit einem <strong>der</strong>art<br />
geschärften Sehvermögen lassen sich sogar Strukturen erkennen,<br />
28 ■ DOZ 8/2001<br />
die nur in einer Ausdehnungsrichtung größer sind als 30 Meter<br />
und in <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en sogar kleiner. Straßen in monotonem Gelände<br />
eben.“ Denkt man zum Beispiel an die Wahrnehmung eines asphaltierten<br />
amerikanischen Highway in <strong>der</strong> Wüste Nevada, so ist<br />
die Sehaufgabe, die Walter hier beschreibt, genau die oben beschriebene<br />
Wahrnehmung einer dunklen Linie auf hellem Grund.<br />
<strong>Die</strong>se Sehaufgabe kann gemäß <strong>der</strong> oben beschriebenen<br />
Leistungsfähigkeit des Auges durchaus bewältigt werden.<br />
Das, was die Astronauten beschreiben, ist aber keine <strong>Sehschärfe</strong>aufgabe,<br />
die mit <strong>der</strong> Optotypensehschärfe vergleichbar ist,<br />
son<strong>der</strong>n eine ganz an<strong>der</strong>e Sehfunktion.<br />
Aus physiologisch-optischer Sicht kann die Wahrnehmung<br />
dunkler Testobjekte auf die Fähigkeit zur Wahrnehmung kleinster<br />
Leuchtdichteunterschiede zurückgeführt werden. Infolge <strong>der</strong><br />
nicht idealen Abbildungsverhältnisse im Auge fließt Licht aus dem<br />
hellen Umfeld in das dunkle Gebiet hinein und verringert den<br />
Kontrast. <strong>Die</strong>ses Phänomen wird auch als „Irradation“ bezeichnet.<br />
<strong>Die</strong> Wahrnehmungsgrenze ist erreicht, wenn <strong>der</strong> Leuchtdichteunterschied<br />
zwischen <strong>der</strong> dunklen Linie und <strong>der</strong> helleren<br />
Umgebung nicht mehr groß genug ist. Zur Wahrnehmung einer<br />
dunklen Linie reicht dem Menschen aber bereits ein Helligkeitsunterschied<br />
von etwa 1 Prozent.<br />
Wahrnehmung heller Objekte auf<br />
dunklem Grund<br />
Noch besser kann das Auge helle Objekte auf dunklem Grund<br />
wahrnehmen. <strong>Die</strong>se Sehaufgabe ist typisch <strong>für</strong> die Perimetrie<br />
aber auch <strong>für</strong> an<strong>der</strong>e, ganz normale Sehaufgaben wie die Wahrnehmung<br />
von Lichtquellen im Dunkeln. Je<strong>der</strong>, <strong>der</strong> schon einmal<br />
mit einem Flugzug nachts in einer Großstadt gelandet ist, kennt<br />
dieses Phänomen. <strong>Die</strong> Sichtweite wird scheinbar endlos. Geringe<br />
Mengen von Dunst und Nebel behin<strong>der</strong>n die Sicht weniger als am<br />
Tage. Jede Lampe im Lichtermeer einer Stadt ist deutlich sichtbar,<br />
solange sie hell genug ist.<br />
<strong>Die</strong> absolute Empfindungsschwelle <strong>für</strong> punktförmige Lichtreize<br />
im dunkel adaptierten Auge liegt bei einer Hornhautbeleuchtungsstärke<br />
von ungefähr 10 –9 lx. Umgerechnet auf die Zahl <strong>der</strong><br />
auf die Photorezeptoren einwirkenden Lichtquanten ergibt sich,<br />
dass – unter optimalen Bedingungen – bereits wenige Lichtquanten<br />
zur Wahrnehmung eines Reizes ausreichen. <strong>Die</strong>se<br />
Leuchtdichte wird offensichtlich von allen genügend hellen Lichtpunkten<br />
– und seien sie noch so klein – erreicht.<br />
Sternenname Scheinbarer Wieviel mal Äquivalenter<br />
(Spektraltyp) Durchmesser ist dieser Visus<br />
des Sterns von Stern größer (= Kehrwert<br />
<strong>der</strong> Erde aus als die <strong>der</strong> Größe in<br />
betrachtet Sonne? Winkel-<br />
(Winkel- (R/R Sonne ) minuten)<br />
sekunden)<br />
Antares (M1) 0,04“ 740 1 500<br />
Arktur (K2) 0,022“ 26 2 730<br />
Sirius (A1) 0,0068“ 2,05 8 830<br />
Wega (A0) 0,0037“ 3,9 16 200<br />
Tabelle 1: Vier <strong>der</strong> hellsten Sterne im Vergleich
Ein gutes Beispiel da<strong>für</strong>, dass wir mit unseren Augen extrem<br />
kleine Objekte problemlos sehen können, sind die Sterne am<br />
Himmel. Lassen Sie mich dies an einem Beispiel verdeutlichen.<br />
Nach Voigt (1969) haben vier <strong>der</strong> hellsten Sterne <strong>für</strong> einen<br />
Beobachter auf <strong>der</strong> Erde folgende scheinbare Durchmesser<br />
(Sehwinkel) und Größen (im Verhältnis zur Größe <strong>der</strong> Sonne), die<br />
in <strong>der</strong> Tabelle 1 dargestellt sind.<br />
Aus dem Durchmesser in Winkelsekunden habe ich zusätzlich<br />
einen Wert berechnet, den ich den äquivalenten Visus nenne,<br />
und in die letzte Spalte eingetragen. <strong>Die</strong>ser Wert gibt an, welcher<br />
Visus nötig wäre, um einen Landoltring zu erkennen, dessen<br />
Lücke genauso breit ist wie <strong>der</strong> Durchmesser des Sterns.<br />
Aus Spalte 2 <strong>der</strong> Tabelle kann man ablesen, dass die Sterne am<br />
Himmel nur eine winzige räumliche Ausdehnung haben, die<br />
wesentlich geringer als eine Bogensekunde ist. <strong>Die</strong> Umrechnung<br />
in den äquivalenten Visuswert (Spalte 4) ergibt deshalb astronomisch<br />
hohe Werte. So wäre ein Visus von 16200 nötig, um<br />
einen Landoltring zu erkennen, dessen Lückenbreite so groß<br />
ist wie <strong>der</strong> Stern Wega. Dabei bedenke man, dass die vier aufgeführten<br />
Sterne zu den hellsten am Himmel zählen. <strong>Die</strong> dunkleren<br />
Sterne sind natürlich viel weiter entfernt und deshalb<br />
entsprechend kleiner.<br />
Man bedenke aber auch, dass alle Sterne, aber auch alle an<strong>der</strong>en<br />
sehr kleinen Lichtpunkte, unabhängig von ihrer tatsächlichen<br />
Größe, immer gleich groß auf <strong>der</strong> Netzhaut abgebildet werden.<br />
Durch die Lichtbeugung im Auge ergibt sich bei Sehobjekten<br />
kleiner als 10 Winkelsekunden stets eine gleichgroße, beugungsbegrenzte<br />
Bildgröße. Bei einer 3 mm großen Pupille beträgt die<br />
minimale Halbwertsbreite des Beugungsscheibchens auf <strong>der</strong><br />
Netzhaut etwa 1,3 Winkelminuten. Daraus folgt, dass selbst die<br />
allerkleinsten Sehobjekte nach <strong>der</strong> Abbildung auf <strong>der</strong> Netzhaut<br />
eine Breite haben, die größer als drei foveolare Zapfen ist. Insofern<br />
hat <strong>der</strong> Astronaut Walter unrecht, wenn er schreibt (sinngemäß):<br />
„Winzige Objektdetails, die genau zwischen zwei<br />
Stäbchen fallen, bleiben unerkannt.“ <strong>Die</strong>se Art <strong>der</strong> Abbildung<br />
kommt beim Menschen prinzipiell nicht vor, da durch die Lichtbeugung<br />
und die Abbildungsfehler grundsätzlich ein Netzhautbild<br />
entsteht, das mehrere Zapfendurchmesser groß ist und deshalb<br />
niemals zwischen zwei Photorezeptoren fallen kann.<br />
Literatur:<br />
[1] Riedl, H.W., Wissenschaft ist Irrtum auf den letzten Stand gebracht. <strong>Teil</strong>1+2,<br />
DOZ 3+4/2001.<br />
[2] Wesemann, W., Wo liegt die lichtenergetische Mitte <strong>der</strong> Augenpupille?<br />
NOJ, 3/1996.<br />
[3] Task, H.L., Genco, L.V., Effects of short-term space flight on several visual<br />
functions. In: Results of the life sciences DSOs conducted aboard the space<br />
shuttle 1981 – 1986. (Hrsg.: Bungo, M.W.). NASA, 5/1987.<br />
[4] Ginsburg, A.P., Van<strong>der</strong>ploeg, J., Vision in space: Near vision acuity and contrast<br />
sensitivity. In: Results of the life sciences DSOs conducted aboard the space<br />
shuttle 1981 – 1986. (Hrsg.: Bungo, M.W.). NASA, 5/1987.<br />
[5] O´Neal M.R., Task H.L., Genco L.V., Effect of microgravity on several visual<br />
functions during STS shuttle missions. In: Berichte vom 41st Congress of the<br />
International Astronautical Fe<strong>der</strong>ation, Dresden, 1990.<br />
[6] Lazarev A.I., Vision in space. Opticheskiye Issledovaniya v Kosmose, 66-87,<br />
1979.<br />
[7] Østerberg, G. , in: Topography of the layer of rods and cones in the human<br />
retina. Acta Ophthalmol. Suppl. 13:1-103, 1935.<br />
[8] Paliaga, G.P. <strong>Die</strong> Bestimmung <strong>der</strong> <strong>Sehschärfe</strong>, Quintessenz Verlag, München,<br />
1993.<br />
[9] Hecht, S., Mintz, E.U., The visibility of single lines at various illuminations<br />
and the retinal basis of visual resolution. Journal of General Physiology, 1939,<br />
593-612.<br />
[10] Hecht, S., Shlaer, S., and Pierenne, M.H. (1942). Energy, quanta and vision.<br />
J. Gen. Physiol. 25, 819-840.<br />
[11] Voigt, H.H., Abriss <strong>der</strong> Astronomie. Bibliographisches Institut, Mannheim,<br />
Seite 161, 1969.<br />
Zusammenfassung<br />
Das menschliche Auge kann beliebig kleine helle Objekte<br />
wahrnehmen, solange sie hell und kontrastreich genug sind.<br />
<strong>Die</strong> tatsächliche Winkelgröße ist nicht von Bedeutung. <strong>Die</strong> entsprechende<br />
Grenzgröße ist das „Minimum visibile“ (die „Punktsehschärfe“).<br />
Das „Minimum visibile“ hat nichts mit <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Augenoptik<br />
üblichen Optotypensehschärfe zu tun. <strong>Die</strong> Optotypensehschärfe<br />
ist eine spezielle Unterart des „Minimum separabile“ also ein<br />
Maß <strong>für</strong> das Auflösungsvermögen, <strong>für</strong> die Trennschärfe, <strong>für</strong> die<br />
Fähigkeit des Auges, Einzelheiten und Strukturmerkmale eines<br />
Objektes wahrzunehmen.<br />
Aus wissenschaftlichen Experimenten <strong>der</strong> NASA folgt, dass die<br />
Optotypensehschärfe <strong>der</strong> Astronauten auf <strong>der</strong> Erde und im Weltraum<br />
gleich o<strong>der</strong> geringfügig schlechter ist.<br />
Deshalb ist und bleibt die Geschichte von den außergewöhnlich<br />
hohen Visuswerten <strong>der</strong> Astronauten ein Märchen, das auch<br />
durch die Erwähnung in populärwissenschaftlichen Büchern nicht<br />
wahrer wird.<br />
(<strong>Teil</strong> II folgt in DOZ 9/01)<br />
Autor: Priv.-Doz. Dr. W. Wesemann,<br />
<strong>Höhere</strong> <strong>Fachschule</strong> <strong>für</strong> Augenoptik Köln,<br />
Bayenthalgürtel 6-8,<br />
50968 Köln<br />
DOZ 8/2001 ■ 29