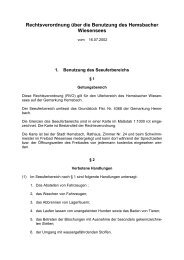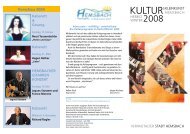Sport- und Freizeitgelände an der Hans-Michel-Halle in Hemsbach
Sport- und Freizeitgelände an der Hans-Michel-Halle in Hemsbach
Sport- und Freizeitgelände an der Hans-Michel-Halle in Hemsbach
- TAGS
- hemsbach
- www.hemsbach.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Universität Stuttgart<br />
Institut für <strong>Sport</strong>wissenschaft<br />
Mo<strong>der</strong>ation:<br />
Henrik Schra<strong>der</strong><br />
Horst Delp<br />
UNIVERSITÄT STUTTGART<br />
INSTITUT FÜR SPORTWISSENSCHAFT<br />
<strong>Sport</strong>- <strong>und</strong> <strong>Freizeitgelände</strong><br />
<strong>an</strong> <strong>der</strong> H<strong>an</strong>s-<strong>Michel</strong>-<strong>Halle</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Hemsbach</strong><br />
Bedarfs<strong>an</strong>alyse <strong>und</strong> Raumpl<strong>an</strong>ung
Inhaltsverzeichnis<br />
2<br />
1 EINLEITUNG ....................................................................................................................4<br />
2 SPORTSTÄTTEN IM WANDEL........................................................................................6<br />
2.1 W<strong>an</strong>del des <strong>Sport</strong>s.................................................................................................. 7<br />
2.2 W<strong>an</strong>del <strong>der</strong> K<strong>in</strong>dheit.............................................................................................. 12<br />
2.3 Ziele e<strong>in</strong>er zukunftsorientierten <strong>Sport</strong>stättengestaltung................................... 14<br />
3 DAS MODELL DER KOOPERATIVEN PLANUNG .......................................................17<br />
3.1 Die lokale Pl<strong>an</strong>ungsgruppe als Zentrum des Pl<strong>an</strong>ungsprozesses................... 18<br />
3.2 Beratungstätigkeit des Expertenteams............................................................... 22<br />
3.3 Wissenschaftliche Beratung ................................................................................ 23<br />
3.4 <strong>Sport</strong>- <strong>und</strong> l<strong>an</strong>dschaftsarchitektonische Beratung............................................ 24<br />
3.5 Zusammenfassung ............................................................................................... 24<br />
4 DER PLANUNGSPROZESS ..........................................................................................26<br />
4.1 Die Pl<strong>an</strong>ungsgruppe – Zusammensetzung <strong>und</strong> Arbeitsweise .......................... 26<br />
4.2 Beschreibung des realen Pl<strong>an</strong>ungsverlaufes..................................................... 27<br />
4.2.1 Sitzung 1: Konzeptionelles Vorgehen <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>legende Bedarfsermittlung....... 27<br />
4.2.2 Sitzung 2 – Pl<strong>an</strong>ungsgr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Kle<strong>in</strong>gruppenpläne ................................... 30<br />
4.2.3 Sitzung 3 – Pl<strong>an</strong>ung des Gesamtgeländes <strong>in</strong> heterogenen Gruppen.................. 31<br />
4.2.4 Sitzung 4 – Verabschiedung des Gesamtgestaltungspl<strong>an</strong>s................................. 36<br />
5 ERGEBNIS DES PLANUNGSPROZESSES – DER GESAMTGESTALTUNGSPLAN .38<br />
5.1 Der <strong>der</strong>zeitige Ist-St<strong>an</strong>d des <strong>Sport</strong>geländes um die H<strong>an</strong>s-<strong>Michel</strong>-<strong>Halle</strong> .......... 38<br />
5.2 Kommentierte Darstellung des Gesamtgestaltungspl<strong>an</strong>s ................................ 41<br />
5.3 Bewertung des Gesamtgestaltungspl<strong>an</strong>s........................................................... 43<br />
5.3.1 Allgeme<strong>in</strong>e Bewertung: ........................................................................................ 44<br />
5.3.2 Qualitative Bewertung <strong>der</strong> H<strong>an</strong>dlungsleitl<strong>in</strong>ien .................................................... 45<br />
6 LITERATURVERZEICHNIS............................................................................................47
Abbildungsverzeichnis<br />
3<br />
ABBILDUNG 1: LEISTUNGSSTAND.................................................................................................... 7<br />
ABBILDUNG 2: MOTIVE FÜR SPORTTREIBEN ................................................................................. 8<br />
ABBILDUNG 3: WANDEL DES SPORTVERSTÄNDNISSES .............................................................. 9<br />
ABBILDUNG 4: ORGANISATORISCHER RAHMEN.......................................................................... 10<br />
ABBILDUNG 5: NUTZUNG VON SPORTSTÄTTEN .......................................................................... 11<br />
ABBILDUNG 6: SCHAFFUNG VON ATTRAKTIVEN BEWEGUNGSRÄUMEN................................. 15<br />
ABBILDUNG 7: MITGLIEDER DER PLANUNGSGRUPPE................................................................ 19<br />
ABBILDUNG 8: FAKTOREN EINER ERFOLGREICHEN PLANUNG ................................................ 19<br />
ABBILDUNG 9: KONZEPTIONELLES VORGEHEN .......................................................................... 20<br />
ABBILDUNG 10: BERATUNGSTÄTIGKEIT DES EXPERTENTEAMS .............................................. 22<br />
ABBILDUNG 11: UNTERSCHIEDLICHE ANSÄTZE .......................................................................... 25<br />
ABBILDUNG 12: BEDARFE "ÜBERGREIFENDE PLANUNGSASPEKTE" ....................................... 32<br />
ABBILDUNG 13: SPORTIVEBEDARFE ............................................................................................. 33<br />
ABBILDUNG 14: SPIELERISCHE BEDARFE .................................................................................... 34<br />
ABBILDUNG 15: SONSTIGE / KOMMUNIKATIVE BEDARFE........................................................... 35
0 E<strong>in</strong>leitung<br />
4<br />
Die „sport- <strong>und</strong> bewegungsfre<strong>und</strong>liche Stadt“ wird häufig als Leitbild e<strong>in</strong>er zukunftsgerechten<br />
<strong>Sport</strong>stättenentwicklungspl<strong>an</strong>ung beschrieben. Die allgeme<strong>in</strong>e Zielsetzung e<strong>in</strong>er mo<strong>der</strong>nen<br />
kommunalen <strong>Sport</strong>stättenentwicklungspl<strong>an</strong>ung ist es, e<strong>in</strong> engmaschiges <strong>und</strong> qualitativ<br />
hochwertiges Versorgungsnetz für <strong>Sport</strong>-, Spiel- <strong>und</strong> Bewegungsaktivitäten aller Menschen<br />
auf- <strong>und</strong> auszubauen. Dabei wird von e<strong>in</strong>em weiten Verständnis von <strong>Sport</strong> <strong>und</strong> Bewegung<br />
ausgeg<strong>an</strong>gen, das sowohl das zunehmende <strong>in</strong>formelle <strong>Sport</strong>treiben als auch die traditionelle<br />
vere<strong>in</strong>sbezogene <strong>Sport</strong>kultur umfasst (WIELAND 2001).<br />
Denn Spiel, <strong>Sport</strong> <strong>und</strong> Bewegung s<strong>in</strong>d konstitutive Elemente des menschlichen Lebens<br />
schlechth<strong>in</strong>. Diese Erkenntnis wird nicht nur von Anthropologen, Entwicklungspsychologen,<br />
Mediz<strong>in</strong>ern <strong>und</strong> Pädagogen vertreten, son<strong>der</strong>n ist heute Best<strong>an</strong>dteil des kollektiven Bewusstse<strong>in</strong>s<br />
<strong>der</strong> Menschen. Vielfältige <strong>und</strong> authentische Bewegungs- <strong>und</strong> Körpererfahrungen<br />
im K<strong>in</strong>desalter leisten e<strong>in</strong>en entscheidenden Beitrag zur Entfaltung <strong>der</strong> Gesamtpersönlichkeit<br />
<strong>und</strong> zur Entwicklung e<strong>in</strong>es positiven Selbstbildes. Gleichermaßen benötigen Erwachsene<br />
<strong>und</strong> Ältere regelmäßige körperliche Belastungsreize - nach Möglichkeit <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit sozialen<br />
Erfahrungen <strong>und</strong> Erlebnissen - zur Erhaltung von Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Wohlbef<strong>in</strong>den. Für<br />
diese mediz<strong>in</strong>isch <strong>und</strong> psychosozial begründeten vielseitigen Bewegungsaktivitäten s<strong>in</strong>d<br />
junge wie ältere Menschen auf e<strong>in</strong>e <strong>an</strong>regungsreiche Bewegungsumwelt, auf e<strong>in</strong>e adäquate<br />
räumliche Infrastruktur <strong>an</strong>gewiesen. Die Herstellung e<strong>in</strong>es engmaschigen Netzes von <strong>Sport</strong>-,<br />
Spiel- <strong>und</strong> Bewegungsmöglichkeiten im urb<strong>an</strong>en Raum zählt mit zu den wichtigsten kommunalen<br />
Aufgaben <strong>der</strong> Zukunft <strong>und</strong> erhöht die menschliche Lebensqualität.<br />
In <strong>Hemsbach</strong> sah die Stadtverwaltung H<strong>an</strong>dlungsbedarf zum Aufbau dieses Versorgungsnetzes<br />
– zwar wird das <strong>Sport</strong>gelände um die H<strong>an</strong>s-<strong>Michel</strong>-<strong>Halle</strong> genutzt, doch aufgr<strong>und</strong> se<strong>in</strong>er<br />
zentralen Lage <strong>und</strong> <strong>der</strong> Nähe zum Wiesenseegelände stellt diese <strong>Sport</strong>fläche e<strong>in</strong> Juwel<br />
dar, <strong>der</strong> durch Umbaumaßnahmen zum Glitzern gebracht werden könnte.<br />
Die Besichtigung <strong>der</strong> kooperativ gepl<strong>an</strong>ten <strong>Sport</strong><strong>an</strong>lage <strong>in</strong> Bad Hersfeld ermutigte die Vertreter<br />
<strong>der</strong> <strong>Hemsbach</strong>er Stadtverwaltung auch das Gelände um die H<strong>an</strong>s-<strong>Michel</strong>-<strong>Halle</strong> <strong>in</strong> die<br />
Hände e<strong>in</strong>er lokalen Pl<strong>an</strong>ungsgruppe zu legen.<br />
Bei e<strong>in</strong>em ersten Informationsgespräch im Sommer 2001 zwischen Vertretern <strong>der</strong> Stadtverwaltung<br />
<strong>und</strong> Herrn Delp kam <strong>der</strong> Kontakt mit dem Projektteam „<strong>Sport</strong>stättenentwicklungspl<strong>an</strong>ung“<br />
des Instituts für <strong>Sport</strong>wissenschaft <strong>der</strong> Universität Stuttgart zust<strong>an</strong>de. Bereits Anf<strong>an</strong>g<br />
Oktober 2001 nahm die Pl<strong>an</strong>ungsgruppe ihre Arbeit auf <strong>und</strong> sollte unter Anwendung des<br />
Modells <strong>der</strong> kooperativen Pl<strong>an</strong>ung e<strong>in</strong> <strong>in</strong> sich schlüssiges Raumkonzept entwickeln.
5<br />
Unser Kompliment <strong>und</strong> D<strong>an</strong>k gilt <strong>an</strong> dieser Stelle allen Ver<strong>an</strong>twortlichen, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong><br />
Pl<strong>an</strong>ungsgruppe, die geme<strong>in</strong>sam dazu beigetragen hat, das Projekt „<strong>Sport</strong>- <strong>und</strong> <strong>Freizeitgelände</strong><br />
um die H<strong>an</strong>s-<strong>Michel</strong>-<strong>Halle</strong>“ vor<strong>an</strong>zutreiben.<br />
Der hier vorliegende Abschlußbericht dokumentiert die Pl<strong>an</strong>ungsphase vom Oktober 2001<br />
bis Dezember 2001. Im e<strong>in</strong>zelnen glie<strong>der</strong>t sich <strong>der</strong> Bericht <strong>in</strong> 4 Teile:<br />
Im ersten Kapitel werden die theoretischen H<strong>in</strong>tergründe <strong>der</strong> aktuellen <strong>Sport</strong>stättendiskussion<br />
aus unterschiedlichen Perspektiven aufgezeigt. Ergebnisse von empirischen Untersuchungen<br />
zum W<strong>an</strong>del des <strong>Sport</strong>verhaltens, pädagogische Überlegungen zum W<strong>an</strong>del von<br />
K<strong>in</strong>dheit <strong>und</strong> Jugend, Erkenntnisse <strong>der</strong> Freizeitforschung <strong>und</strong> Entwicklungen im Städtebau<br />
zeigen auf, dass neue Antworten für die Gestaltung von <strong>Sport</strong>- <strong>und</strong> Freizeit<strong>an</strong>lagen gef<strong>und</strong>en<br />
werden müssen.<br />
Das Kapitel 2 macht das konzeptionelle Vorgehen des kooperativen Pl<strong>an</strong>ungsverfahrens<br />
tr<strong>an</strong>sparent, <strong>in</strong> dessen Mittelpunkt die lokale Pl<strong>an</strong>ungsgruppe steht, die sich aus den örtlichen<br />
beteiligten Nutzergruppen zusammensetzt. Damit steht das Verfahren unter dem Leitmotto<br />
„Mit den Bürgern für die Bürger“, das auch von <strong>der</strong> UNO für die Entwicklung <strong>der</strong> Städte<br />
<strong>und</strong> Geme<strong>in</strong>den im Rahmen <strong>der</strong> „Lokalen Agenda 21“ empfohlen wird.<br />
Der genaue reale Pl<strong>an</strong>ungsprozess wird im nachfolgenden Kapitel 3 beschrieben.<br />
Im Mittelpunkt des vierten Kapitels stehen die „Früchte <strong>der</strong> kooperativen Pl<strong>an</strong>ung“ - <strong>der</strong> Gesamtgestaltungspl<strong>an</strong><br />
<strong>und</strong> se<strong>in</strong>e Beschreibung.
1 <strong>Sport</strong>stätten im W<strong>an</strong>del<br />
6<br />
Im Zuge <strong>der</strong> Diskussion um e<strong>in</strong>e ges<strong>und</strong>e, "sportgerechte" o<strong>der</strong> besser "bewegungsfre<strong>und</strong>liche"<br />
Stadt als e<strong>in</strong> Leitbild zukunftsorientierter Stadtentwicklung hat die sportwissenschaftliche<br />
Diskussion vermehrt die Frage aufgegriffen, wie e<strong>in</strong>e Bewegungs- <strong>und</strong> Spielflächen<strong>in</strong>frastruktur<br />
aussehen soll, die sich <strong>an</strong> den neueren Entwicklungen <strong>in</strong> unserer sich schnell w<strong>an</strong>delnden<br />
Gesellschaft <strong>und</strong> <strong>Sport</strong>l<strong>an</strong>dschaft orientiert.<br />
Die Entwicklung <strong>und</strong> Implementation zukunftsfähiger <strong>Sport</strong>-, Spiel- <strong>und</strong> Bewegungsräume<br />
stellt seit vielen Jahren e<strong>in</strong>en beson<strong>der</strong>en Schwerpunkt <strong>in</strong>nerhalb des Arbeits- <strong>und</strong> Forschungsbereichs<br />
"<strong>Sport</strong>entwicklungspl<strong>an</strong>ung <strong>und</strong> Politikberatung" am Institut für <strong>Sport</strong>wissenschaft<br />
<strong>der</strong> Universität Stuttgart dar. Nach dem Gr<strong>und</strong>satz <strong>an</strong>wendungsorientierten Forschens,<br />
von Problemen aus <strong>der</strong> Praxis zu Lösungen für die Praxis zu kommen, ist am Stuttgarter<br />
Institut e<strong>in</strong>e Fülle von Modellprojekten gepl<strong>an</strong>t, umgesetzt <strong>und</strong> evaluiert worden:<br />
Das Arbeitsfeld reicht von Spielplatzpl<strong>an</strong>ungen bis zu Schulhofumgestaltungen, von <strong>der</strong> Umgestaltung<br />
bestehen<strong>der</strong> Vere<strong>in</strong>s<strong>an</strong>lagen im Modellprojekt "Familienfre<strong>und</strong>licher <strong>Sport</strong>platz"<br />
über die Pl<strong>an</strong>ung kommunaler <strong>Sport</strong>stätten <strong>und</strong> die Erstellung von <strong>Sport</strong>stättenentwicklungsplänen<br />
<strong>in</strong> mehreren Kommunen <strong>in</strong> Baden-Württemberg <strong>und</strong> Hessen bis zur <strong>Sport</strong>stättenpl<strong>an</strong>ung<br />
für die Stadt Ditz<strong>in</strong>gen bei e<strong>in</strong>em 20-Millionen-Projekt.<br />
Doch wie sieht e<strong>in</strong>e <strong>Sport</strong>stätte <strong>der</strong> Zukunft aus? E<strong>in</strong>e erste Annäherung <strong>an</strong> diese Frage erfolgt<br />
durch kurze theoretische Gr<strong>und</strong>überlegungen für e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>novative <strong>Sport</strong>stättenentwicklungspl<strong>an</strong>ung,<br />
die folgende Punkte aufgreifen:<br />
� W<strong>an</strong>del des <strong>Sport</strong>s<br />
� W<strong>an</strong>del <strong>der</strong> K<strong>in</strong>dheit<br />
� Ziele e<strong>in</strong>er zukunftsorientierten <strong>Sport</strong>stättengestaltung
1.1 W<strong>an</strong>del des <strong>Sport</strong>s<br />
7<br />
Die Verwirklichung e<strong>in</strong>es zukunftsorientierten Projektes erfor<strong>der</strong>t e<strong>in</strong>e Orientierung <strong>an</strong> den<br />
wesentlichen neuen Entwicklungstendenzen <strong>in</strong> unserer Gesellschaft <strong>und</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Welt des<br />
<strong>Sport</strong>s. Strukturdaten dafür liefern uns die Ergebnisse <strong>der</strong> empirischen Studien zum <strong>Sport</strong>verhalten<br />
<strong>und</strong> zu den <strong>Sport</strong>bedürfnissen <strong>der</strong> Bevölkerung <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>d, die ab Ende <strong>der</strong><br />
achtziger Jahre <strong>in</strong> mehr als 20 Städten <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>d durchgeführt wurden. Diese konstatieren<br />
übere<strong>in</strong>stimmend e<strong>in</strong>en tiefgreifenden W<strong>an</strong>del des <strong>Sport</strong>s <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>es Exp<strong>an</strong>sions<strong>und</strong><br />
Differenzierungsprozesses, <strong>der</strong> die Entscheidungsträger <strong>in</strong> den <strong>Sport</strong>org<strong>an</strong>isationen <strong>und</strong><br />
Kommunen mit <strong>der</strong> schwierigen Frage konfrontiert, welche Art von <strong>Sport</strong><strong>an</strong>geboten, von Org<strong>an</strong>isationsformen<br />
<strong>und</strong> vor allem von <strong>Sport</strong>stätten den Wünschen <strong>und</strong> Bedürfnissen <strong>der</strong> Bevölkerung<br />
jetzt <strong>und</strong> <strong>in</strong> naher Zukunft entspricht.<br />
Abbildung 1: Leistungsst<strong>an</strong>d<br />
35,80%<br />
5,20%<br />
DERZEITIGER LEISTUNGSSTAND<br />
0,40%<br />
2,10%<br />
56,50%<br />
regelmäßiger Freizeitsport<br />
unregelmäßiger<br />
Freizeitsport<br />
Wettkampsport bis Bezirk<br />
Wettkampfsport bis L<strong>an</strong>d<br />
Hochleistungssport<br />
Anh<strong>an</strong>d ausgewählter Beispiele <strong>der</strong> repräsentativen Untersuchung „<strong>Sport</strong> <strong>und</strong> Freizeit <strong>in</strong><br />
Stuttgart“ (WIELAND/RÜTTEN 1991) sollen exemplarisch wichtige Trends aufgezeigt werden:<br />
Nach den Bef<strong>und</strong>en k<strong>an</strong>n zunächst re<strong>in</strong> qu<strong>an</strong>titativ von e<strong>in</strong>er hohen <strong>Sport</strong>nachfrage<br />
ausgeg<strong>an</strong>gen werden: 73% <strong>der</strong> Befragten bezeichnen sich als sportlich aktiv 1 .<br />
1 Auch bei e<strong>in</strong>em Vergleich aller <strong>Sport</strong>verhaltensstudien, die seit 1988 durchgeführt wurden, ist die<br />
Aktivenquote sehr hoch, erreicht allerd<strong>in</strong>gs nicht den Durchschnittswert von 73%. Acht Studien geben<br />
Aktivenquoten zwischen 60% <strong>und</strong> 65% <strong>an</strong>, acht Studien über 65%. Nur <strong>in</strong> 5 Studien wurden Aktivenquoten<br />
von weniger als 60% ermittelt (vgl. HÜBNER 1994, 49ff).
8<br />
Von diesen <strong>Sport</strong>aktiven ordnet sich <strong>der</strong> Großteil den Gruppen <strong>der</strong> unregelmäßigen (35,8%)<br />
o<strong>der</strong> regelmäßigen Freizeitsportler (56,5%) zu. Nur etwa 8% s<strong>in</strong>d im Wettkampfsport auf<br />
verschiedenen Ebenen aktiv. Das große Übergewicht <strong>an</strong> Freizeitsportaktivitäten verän<strong>der</strong>t<br />
sich auch d<strong>an</strong>n nicht entscheidend, wenn m<strong>an</strong> den <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel höheren zeitlichen Aufw<strong>an</strong>d<br />
für den Wettkampfsport berücksichtigt 2 .<br />
Abbildung 2: Motive für <strong>Sport</strong>treiben<br />
G e s u n d h e i t<br />
S p a ß / F r e u d e<br />
a m S p o r t<br />
A u s g le ic h<br />
G e s e llig k e it<br />
N a t u r e r l e b n i s<br />
Z e itv e rtre ib<br />
K ö r p e r e r l e b n i s<br />
L e i s t u n g<br />
W e ttk a m p f u .<br />
E r f o l g<br />
M O T I V E F Ü R D A S S P O R T T R E I B E N<br />
F i t n e s s<br />
F i g u r<br />
Ä s t h e t i k<br />
0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 1 0 0 %<br />
A n te il <strong>in</strong> %<br />
w i c h t i g<br />
te ils / te ils<br />
w e i ß n i c h t<br />
u n w i c h t i g<br />
Die verän<strong>der</strong>te Motivstruktur <strong>der</strong> <strong>Sport</strong>aktiven lässt den W<strong>an</strong>del des <strong>Sport</strong>systems beson<strong>der</strong>s<br />
plastisch vor Augen treten: An <strong>der</strong> Spitze r<strong>an</strong>gieren die Motive des Freizeit- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitssports<br />
(Ges<strong>und</strong>heit, Spaß, Fitness, Ausgleich, Geselligkeit, Naturerlebnis); die<br />
„klassischen“ <strong>Sport</strong>motive (Leistung, Wettkampf <strong>und</strong> Erfolg) s<strong>in</strong>d am Ende <strong>der</strong> Skala zu f<strong>in</strong>den.<br />
Dies zeigt, dass die Wettkampf- <strong>und</strong> Breitensportler im Vere<strong>in</strong> Konkurrenz erhalten haben<br />
durch e<strong>in</strong>e immer größer werdende Personengruppe, die ihr <strong>Sport</strong>verständnis nach<br />
neuen Qualitätsmerkmalen def<strong>in</strong>iert<br />
2 Der Vergleich aller <strong>Sport</strong>verhaltensstudien zeigt, dass <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> Freizeitsportler zwischen 66%<br />
<strong>und</strong> 92% variiert, <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> Wettkampfsportler pendelt zwischen 8% <strong>und</strong> 34% (vgl. HÜBNER<br />
1994, 50ff).
Abbildung 3: W<strong>an</strong>del des <strong>Sport</strong>verständnisses<br />
M ite<strong>in</strong><strong>an</strong><strong>der</strong><br />
m om ent<strong>an</strong>es<br />
Erleben<br />
Spont<strong>an</strong>ität<br />
Entsp<strong>an</strong>nung<br />
Körpergefühl<br />
Das "Neue <strong>Sport</strong>verständnis"<br />
0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />
9<br />
Stimme zu<br />
te ils/te ils<br />
weiß nicht<br />
stimme<br />
nicht zu<br />
K ö rp erg efü hl:<br />
E<strong>in</strong> gutes Körpergefühl zu haben, ist beim <strong>Sport</strong>treiben wichtiger als<br />
Perfektion<br />
Entsp<strong>an</strong>nung:<br />
<strong>Sport</strong>liche Aktivitäten sollten nicht unbed<strong>in</strong>gt <strong>an</strong>strengend se<strong>in</strong>, viel<br />
wichtiger ist das Gefühl e<strong>in</strong>er wohltuenden Entsp<strong>an</strong>nung<br />
S p o n t<strong>an</strong>ität:<br />
Freiheit <strong>und</strong> Spont<strong>an</strong>ität s<strong>in</strong>d beim <strong>Sport</strong>treiben wichtiger als das E<strong>in</strong>halten<br />
von festen Regeln<br />
m om ent<strong>an</strong>es Erleben:<br />
Im <strong>Sport</strong> sollte das moment<strong>an</strong>e Erleben wichtiger se<strong>in</strong> als das H<strong>in</strong>arbeiten<br />
auf e<strong>in</strong> gesetztes Ziel<br />
Mite<strong>in</strong><strong>an</strong><strong>der</strong>:<br />
Statt des W ettkampfes sollte im <strong>Sport</strong> ausschließlich das M ite<strong>in</strong><strong>an</strong><strong>der</strong><br />
betont werden<br />
Die Motivstruktur <strong>der</strong> Jugendlichen zeigt - wenn auch mit stärkerer Akzentuierung des Leistungsmotivs<br />
beson<strong>der</strong>s bei jüngeren <strong>und</strong> männlichen Jugendlichen - <strong>in</strong> die gleiche Richtung.<br />
Bei Jugendlichen ist die Tendenz zu beobachten, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Freizeit nicht nur e<strong>in</strong>e <strong>Sport</strong>art dauerhaft<br />
<strong>und</strong> wettkampforientiert zu betreiben, son<strong>der</strong>n statt dessen o<strong>der</strong> d<strong>an</strong>eben selbst org<strong>an</strong>isiert<br />
neue <strong>und</strong> <strong>an</strong><strong>der</strong>e Erfahrungen mit dem Körper, dem <strong>Sport</strong> bzw. <strong>der</strong> Bewegung zu machen,<br />
die sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Fülle sogen<strong>an</strong>nter Trendsportarten bzw. <strong>in</strong>formeller sportlicher Aktivitäten<br />
m<strong>an</strong>ifestieren. Trends <strong>und</strong> Traditionen stellen dabei ke<strong>in</strong>en Wi<strong>der</strong>spruch dar.<br />
E<strong>in</strong> zukunftsorientierter Bewegungsraum muss für die verschiedenen Personengruppen mit<br />
g<strong>an</strong>z unterschiedlichen Interessenslagen <strong>und</strong> Motivstrukturen adäquate Angebote bereithalten.
Abbildung 4: Org<strong>an</strong>isatorischer Rahmen<br />
ohne festen Rahmen<br />
<strong>Sport</strong>vere<strong>in</strong><br />
T<strong>an</strong>z-/<strong>Sport</strong>schule<br />
Firma (Hoch-) Schule<br />
Fitness-Studio<br />
VHS / Komm. Kirche<br />
Verbände / Org<strong>an</strong>is.<br />
Kr<strong>an</strong>kenkassen<br />
Mehrfachnennungen<br />
Sonstiges<br />
10<br />
RAHMEN FÜR SPORTAKTIVITÄTEN<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55<br />
Nennungen <strong>in</strong> %<br />
ohne festen Rahmen<br />
<strong>Sport</strong>vere<strong>in</strong><br />
T<strong>an</strong>z-/<strong>Sport</strong>schule<br />
Firma (Hoch-) Schule<br />
Fitness-Studio<br />
VHS / Komm. Kirche<br />
Verbände / Org<strong>an</strong>is.<br />
Kr<strong>an</strong>kenkassen<br />
Mehrfachnennungen<br />
Sonstiges<br />
54% <strong>der</strong> <strong>Sport</strong>aktiven bevorzugen ke<strong>in</strong>e Org<strong>an</strong>isation, son<strong>der</strong>n e<strong>in</strong>en privaten Rahmen für<br />
ihre Bewegungsaktivitäten. Im Vere<strong>in</strong>, <strong>der</strong> nach wie vor <strong>der</strong> größte aller org<strong>an</strong>isierten <strong>Sport</strong><strong>an</strong>bieter<br />
ist, treiben ca. 20% <strong>der</strong> <strong>Sport</strong>aktiven ihren <strong>Sport</strong>. Dieser Org<strong>an</strong>isationsgrad im Vere<strong>in</strong><br />
ist <strong>in</strong> Großstädten wie Stuttgart am ger<strong>in</strong>gsten <strong>und</strong> steigt <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>eren Geme<strong>in</strong>den auf bis<br />
zu 50%.<br />
Auch vor diesem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> wird klar, dass e<strong>in</strong>e wichtige Aufgabe <strong>der</strong> <strong>Sport</strong>stättenentwicklungspl<strong>an</strong>ung<br />
dar<strong>in</strong> besteht, org<strong>an</strong>isierten Vere<strong>in</strong>ssport <strong>und</strong> selbstorg<strong>an</strong>isiertes <strong>Sport</strong>treiben<br />
auf e<strong>in</strong>em Gelände zu verb<strong>in</strong>den.<br />
Die dokumentierte Tendenz zum Freizeit- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitssport bestimmt auch die Ergebnisse<br />
zur Nutzung <strong>und</strong> Bedeutung <strong>der</strong> <strong>Sport</strong>stätten: Als Ort ihrer <strong>Sport</strong>aktivität geben 18%<br />
<strong>der</strong> <strong>Sport</strong>aktiven vere<strong>in</strong>seigene bzw. städtische <strong>Sport</strong>hallen <strong>an</strong>, 14% kommerzielle E<strong>in</strong>richtungen<br />
<strong>und</strong> Schwimmbä<strong>der</strong>, während 30% im freien Gelände o<strong>der</strong> zu Hause ihr <strong>Sport</strong>bedürfnis<br />
befriedigen.
Abbildung 5: Nutzung von <strong>Sport</strong>stätten<br />
Ort <strong>der</strong> <strong>Sport</strong>aktivität<br />
sonstiges<br />
Mehrfachnennungen<br />
zuhause<br />
<strong>Sport</strong>platz<br />
priv., kommerz. <strong>Sport</strong>stätte<br />
Schwimmbad<br />
städt. / vere<strong>in</strong>s. <strong>Halle</strong><br />
Wald / Gelände<br />
3,6<br />
3,2<br />
5,2<br />
11<br />
Ort <strong>der</strong> <strong>Sport</strong>aktivität<br />
13,7<br />
13,8<br />
16,9<br />
17,9<br />
25,8<br />
0 5 10 15 20 25 30<br />
Häufigkeit <strong>in</strong> %<br />
Lediglich 5,2 % <strong>der</strong> <strong>Sport</strong>aktiven - <strong>und</strong> das ist e<strong>in</strong>e doch überraschend niedrige Zahl - bezeichnen<br />
den herkömmlichen <strong>Sport</strong>platz als den Ort ihrer <strong>Sport</strong>aktivitäten; 78 % aller Befragten<br />
<strong>und</strong> sogar 89 % <strong>der</strong> bis zu 35-jährigen wünschen sich zusätzliche Gelegenheiten zum<br />
<strong>Sport</strong>treiben, die ke<strong>in</strong>eswegs aufwendig ausgestattet, dafür aber offen zugänglich <strong>und</strong> vielfältig<br />
nutzbar se<strong>in</strong> sollen. Diese Zahlen stellen sowohl für den org<strong>an</strong>isierten <strong>Sport</strong> als auch für<br />
die Kommunen e<strong>in</strong>e Herausfor<strong>der</strong>ung dar, <strong>in</strong>novative Konzepte für die Gestaltung <strong>und</strong> Nutzung<br />
von <strong>Sport</strong>räumen, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e von <strong>Sport</strong>außen<strong>an</strong>lagen zu erproben - e<strong>in</strong>e gr<strong>und</strong>legende<br />
Neuorientierung sche<strong>in</strong>t hier unumgänglich.
1.2 W<strong>an</strong>del <strong>der</strong> K<strong>in</strong>dheit<br />
12<br />
E<strong>in</strong>en weiteren wichtigen theoretischen Bezugspunkt für die Gestaltung von Bewegungsräumen<br />
bildet die neuere Lebensweltforschung, die aus soziologischer <strong>und</strong> pädagogischer<br />
Sicht e<strong>in</strong>en W<strong>an</strong>del <strong>der</strong> k<strong>in</strong>dlichen <strong>und</strong> jugendlichen Lebenswelt konstatiert. Dieser W<strong>an</strong>del<br />
wird <strong>in</strong> <strong>der</strong> wissenschaftlichen Literatur <strong>an</strong> folgenden charakteristischen Phänomenen beschrieben<br />
3 :<br />
� Verlust <strong>der</strong> Straßenk<strong>in</strong>dheit<br />
� Ver<strong>in</strong>selung <strong>der</strong> Lebensräume<br />
� Institutionalisierung <strong>der</strong> K<strong>in</strong>dheit<br />
� Verhäuslichung von K<strong>in</strong>dheit<br />
� Mediatisierung <strong>der</strong> k<strong>in</strong>dlichen Erfahrungswelt<br />
Mit "Verlust <strong>der</strong> Straßenk<strong>in</strong>dheit" ist geme<strong>in</strong>t, dass <strong>der</strong> Spiel- <strong>und</strong> Lernort „Straße“ 4 für e<strong>in</strong>e<br />
natürliche Bewegungssozialisation <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> weitgehend verlorengeg<strong>an</strong>gen ist - mit <strong>der</strong><br />
Folge, dass die verfügbaren <strong>und</strong> kompensatorisch aufgesuchten „Bewegungs<strong>in</strong>seln“ (Spielplätze,<br />
<strong>Sport</strong>stätten <strong>der</strong> Vere<strong>in</strong>e) zu e<strong>in</strong>er weitgehenden Kontrolle <strong>der</strong> Erziehung durch die<br />
Erwachsenen, zu e<strong>in</strong>er frühzeitigen Versportung des K<strong>in</strong><strong>der</strong>alltags <strong>und</strong> zu e<strong>in</strong>er erheblichen<br />
E<strong>in</strong>schränkung <strong>der</strong> unüberschaubaren Vielfalt des k<strong>in</strong>dlichen Spiel- <strong>und</strong> Bewegungsrepertoires<br />
geführt haben.<br />
Straßen waren noch bis <strong>in</strong> die 60er Jahre Dreh- <strong>und</strong> Angelpunkte des Lebens, waren Orte<br />
<strong>der</strong> Arbeit, <strong>der</strong> Freizeit <strong>und</strong> Kommunikation. Vor allem aber waren sie Spielbereiche <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>.<br />
Straßen waren Spiel-, Erfahrungs- <strong>und</strong> Kommunikationsorte für K<strong>in</strong><strong>der</strong> 5 . Dem Raum<br />
„Straße“ kommt aus Sicht <strong>der</strong> Pädagogen für K<strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>und</strong> Jugendliche e<strong>in</strong>e überragende Bedeutung<br />
zu, denn „ke<strong>in</strong>e Altersgruppe benutzt diesen gesellschaftlichen Raum so viel <strong>und</strong> so<br />
<strong>in</strong>tensiv, wie es die Sechs- bis Achtzehnjährigen tun; <strong>und</strong> was die K<strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
<strong>an</strong> diesem Ort alles lernen, läßt sich <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Bedeutung durchaus den Lernorten ‚Schule‘<br />
o<strong>der</strong> ‚Familie‘ gleichsetzen“. 6<br />
3<br />
Vgl. zusammenfassend ROLFF/ZIMMERMANN 1985; ROLFF 1991; WIELAND 1995; ZEIHER 1991;<br />
ZINNECKER 1979)<br />
4<br />
Synonym k<strong>an</strong>n auch von Wohnumfeld o<strong>der</strong> Wohnumwelt gesprochen werden. Der Begriff „Straße“<br />
umfaßt also nicht nur den Verkehrsraum, son<strong>der</strong>n auch die <strong>an</strong>grenzenden Räume <strong>und</strong> Gebäude.<br />
5 Vgl. LEYENDECKER 1989, 336.<br />
6 ZINNECKER 1979, 727
13<br />
An Bedeutung verloren hat <strong>der</strong> Lern- <strong>und</strong> Spielort Straße <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie durch die ras<strong>an</strong>te<br />
Zunahme des Automobilverkehrs 7 . Diese Entwicklung ist nicht mehr rückgängig zu machen.<br />
Es gilt aber zu überlegen, welche Faktoren die Attraktivität des Straßenraumes ausmachen,<br />
um diese bei <strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ung von Spiel- <strong>und</strong> Bewegungsräumen berücksichtigen zu können (vgl.<br />
ausführlicher die H<strong>an</strong>dlungsleitl<strong>in</strong>ien <strong>in</strong> Kapitel 1.6.). Zu nennen s<strong>in</strong>d hier die G<strong>an</strong>zheitlichkeit<br />
<strong>und</strong> Vielfältigkeit des Raumes, vor allem aber die Offenheit des Raumes. Es k<strong>an</strong>n je<strong>der</strong>zeit<br />
selbst bestimmt werden, w<strong>an</strong>n <strong>der</strong> Ort aufgesucht wird <strong>und</strong> wer <strong>der</strong> Spielpartner se<strong>in</strong> soll.<br />
Notwendig ist dabei e<strong>in</strong> dichtes <strong>und</strong> vernetztes Angebot von offenen Spiel- <strong>und</strong> Bewegungsräumen,<br />
um dem Phänomen <strong>der</strong> „Ver<strong>in</strong>selung von Lebensräumen“ entgegenzuwirken. Mit<br />
diesem Bild wird sehr plastisch beschrieben, dass für K<strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>und</strong> Jugendliche nur noch Teilräume<br />
erlebbar werden, die von <strong>der</strong> Wohn<strong>in</strong>sel <strong>an</strong>gesteuert werden wie z.B. K<strong>in</strong><strong>der</strong>garten,<br />
Schule o<strong>der</strong> <strong>Sport</strong>vere<strong>in</strong>. Die vone<strong>in</strong><strong>an</strong><strong>der</strong> getrennten Bereiche verb<strong>in</strong>det all zu oft nur noch<br />
das Auto, Eltern werden nahezu zw<strong>an</strong>gsläufig zum Chauffeur ihrer K<strong>in</strong><strong>der</strong>.<br />
Für K<strong>in</strong><strong>der</strong> bedeutet e<strong>in</strong>e „Ver<strong>in</strong>selung <strong>der</strong> Bewegungsräume“ e<strong>in</strong>e „Institutionalisierung<br />
<strong>der</strong> K<strong>in</strong>dheit“ <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e „Versportung des K<strong>in</strong><strong>der</strong>alltags“. Damit erfolgt e<strong>in</strong>e frühzeitige Angleichung<br />
<strong>an</strong> das Bewegungsverhalten Erwachsener. Die eigenständige k<strong>in</strong>dliche Spiel- <strong>und</strong><br />
Bewegungskultur mit ihrer Vielfalt <strong>an</strong> Spiel- <strong>und</strong> Bewegungsformen wird auf diese Weise<br />
zw<strong>an</strong>gsläufig e<strong>in</strong>geschränkt.<br />
Zusätzlich führt die „Ver<strong>in</strong>selung <strong>der</strong> K<strong>in</strong>dheit“ <strong>und</strong> <strong>der</strong> Verlust <strong>der</strong> Straßenk<strong>in</strong>dheit zu e<strong>in</strong>er<br />
„Verhäuslichung <strong>der</strong> K<strong>in</strong>dheit“. K<strong>in</strong><strong>der</strong> können nicht mehr gefahrlos <strong>in</strong> ihrem unmittelbaren<br />
Wohnumfeld spielen <strong>und</strong> ziehen sich mehr <strong>und</strong> mehr <strong>in</strong> den Schutz <strong>der</strong> eigenen vier Wände<br />
zurück 8 .<br />
Beschleunigt wird dieser häusliche Rückzug durch die zunehmende „Technisierung <strong>und</strong><br />
Mediatisierung <strong>der</strong> K<strong>in</strong>dheit“. K<strong>in</strong><strong>der</strong>typische Bewegungsspiele werden immer mehr zurückgedrängt<br />
zugunsten <strong>der</strong> Beschäftigung mit audiovisuellen Medien <strong>und</strong> ihrem Programm<strong>an</strong>gebot.<br />
Der Ersatz <strong>der</strong> Bewegungsspiele bedeutet nicht nur e<strong>in</strong>e dramatische Abnahme <strong>der</strong><br />
körperlichen Belastbarkeit, son<strong>der</strong>n gleichermaßen e<strong>in</strong>en Verlust <strong>an</strong> wichtigen Primärer-<br />
fahrungen. K<strong>in</strong><strong>der</strong> leben zunehmend <strong>in</strong> „Secondh<strong>an</strong>dwirklichkeiten“, die Erfahrung aus zweiter<br />
H<strong>an</strong>d wird <strong>in</strong> <strong>der</strong> technischen Welt zum Lebenspr<strong>in</strong>zip.<br />
7<br />
So gab es z.B. <strong>in</strong> Freiburg Mitte <strong>der</strong> 50er Jahre noch doppelt so viele K<strong>in</strong><strong>der</strong> pro Hektar wie zugelassene<br />
Fahrzeuge, während es heute pro Hektar Stadtfläche nur noch fünf K<strong>in</strong><strong>der</strong>, dafür aber 20 zugelassene<br />
Kraftfahrzeuge gibt.<br />
8<br />
Politisch hoch<strong>in</strong>teress<strong>an</strong>t s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> diesem Zusammenh<strong>an</strong>g die Ergebnisse e<strong>in</strong>er Freiburger Studie zu<br />
Aktionsräumen von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>in</strong> <strong>der</strong> Stadt (vgl. BLINKERT 1993). Dort wird schwarz auf weiß belegt,<br />
dass die tägliche Spielzeit <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> vom Verkehr im unmittelbaren Wohnumfeld abhängig ist. Bei<br />
E<strong>in</strong>führung von Tempo-30-Zonen verdoppelte, bei E<strong>in</strong>führung e<strong>in</strong>er Spielstraßenregelung vervierfachte<br />
sich fast sich die tägliche Spielzeit im Freien im Vergleich zu Tempo-50-Zonen.
14<br />
In <strong>der</strong> Pädagogik herrscht e<strong>in</strong>mütiger Konsens darüber, dass unmittelbare, körperbezogene<br />
Spiel- <strong>und</strong> Bewegungserfahrungen elementare Bedeutung für die motorische, emotionale,<br />
soziale <strong>und</strong> kognitive Entwicklung des K<strong>in</strong>des<br />
besitzen. Die oben dargestellte E<strong>in</strong>schränkung<br />
<strong>der</strong> Bewegungsmöglichkeiten<br />
<strong>und</strong> des Bewegungsrepertoires k<strong>an</strong>n zum<strong>in</strong>dest<br />
zum Teil für die zunehmenden<br />
Haltungsschäden <strong>und</strong> koord<strong>in</strong>ativen<br />
Schwächen <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>in</strong> unserer Zeit ver<strong>an</strong>twortlich<br />
gemacht werden.<br />
Mit diesen Überlegungen ist e<strong>in</strong> Konzept<br />
<strong>an</strong>gesprochen, das auf die enge Verschränkung<br />
von Bewegung, Wahrnehmung,<br />
Umwelterfahrung <strong>und</strong> Lernen im H<strong>in</strong>blick auf e<strong>in</strong>e g<strong>an</strong>zheitliche Entwicklung des K<strong>in</strong>des<br />
h<strong>in</strong>weist <strong>und</strong> damit e<strong>in</strong>e För<strong>der</strong>ung von Primärerfahrungen, e<strong>in</strong>e Betonung <strong>der</strong> S<strong>in</strong>neswahrnehmungen<br />
sowie die Selbsttätigkeit des K<strong>in</strong>des <strong>in</strong> den Vor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong> stellt. Dazu eignen<br />
sich <strong>in</strong> beson<strong>der</strong>em Maße naturnahe Spielräume sowie e<strong>in</strong>fache <strong>und</strong> verän<strong>der</strong>bare Gestaltungen,<br />
die <strong>an</strong> die verlorengeg<strong>an</strong>genen Aktionsräume <strong>der</strong> „Straße“ er<strong>in</strong>nern.<br />
Auch Argumente <strong>der</strong> Sicherheitserziehung müssen <strong>in</strong> diesem Zusammenh<strong>an</strong>g <strong>an</strong>gesprochen<br />
<strong>und</strong> diskutiert werden. Neuere Untersuchungen <strong>der</strong> Geme<strong>in</strong>deunfallversicherungsverbände<br />
haben unter <strong>an</strong><strong>der</strong>em zu dem Ergebnis geführt, dass Bewegungsför<strong>der</strong>ung ke<strong>in</strong> Unfallrisiko<br />
darstellt, son<strong>der</strong>n e<strong>in</strong> wirksames Mittel <strong>der</strong> Unfallverhütung, wie es beispielhaft <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> Studie „Weniger Unfälle durch Bewegung“ deutlich wird 9 . Die im Zuge <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>nisierung<br />
zunehmende Diszipl<strong>in</strong>ierung des Körpers, ausgedrückt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er bei uns vorherrschenden<br />
Bewahrungspädagogik, hat dazu geführt, dass es K<strong>in</strong><strong>der</strong>n immer schwerer fällt, e<strong>in</strong>e positive<br />
Risikokompetenz aufzubauen. Auch für diese Aufgabe müssen <strong>an</strong>regungsreiche, erlebnis<strong>in</strong>tensive<br />
<strong>und</strong> vielfältige Bewegungsräume zur Verfügung stehen.<br />
1.3 Ziele e<strong>in</strong>er zukunftsorientierten <strong>Sport</strong>stättengestaltung<br />
All dies verdeutlicht, dass <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Sport</strong>stättenentwicklungspl<strong>an</strong>ung dr<strong>in</strong>gen<strong>der</strong> H<strong>an</strong>dlungsbedarf<br />
besteht. Ausg<strong>an</strong>gspunkt für e<strong>in</strong>e Konzeption zur Gestaltung zukunfts- <strong>und</strong> bedürfnisorientierter<br />
<strong>Sport</strong>stätten ist die Überlegung, dass die bestehenden formell ausgewiesenen<br />
<strong>Sport</strong>räume (<strong>Sport</strong>plätze, <strong>Sport</strong>hallen) meist ausschließlich nach funktionalen Gesichtspunk-<br />
9 KUNZ 1993
15<br />
ten gepl<strong>an</strong>t <strong>und</strong> <strong>an</strong> den normierten <strong>Sport</strong>stättendesigns des Wettkampfsports orientiert s<strong>in</strong>d<br />
<strong>und</strong> damit nur teilweise den Bedürfnissen <strong>der</strong> sporttreibenden Jugendlichen <strong>und</strong> Erwachsenen<br />
von heute entsprechen. Die vorherrschende Geradl<strong>in</strong>igkeit, die Genauigkeit <strong>der</strong> Abmessungen,<br />
die e<strong>in</strong>fallslosen Flächen <strong>in</strong> genormter Rechteckausdehnung <strong>und</strong> die räumlichen<br />
Abgrenzungen h<strong>in</strong>ter hohen Drahtzäunen o<strong>der</strong> <strong>und</strong>urchsichtigen Betonwänden s<strong>in</strong>d s<strong>in</strong>nbildhafter<br />
Ausdruck e<strong>in</strong>es traditionellen <strong>Sport</strong>verständnisses, das <strong>in</strong> unserer Gesellschaft - wie<br />
oben gezeigt - se<strong>in</strong>e Gültigkeit schon weitgehend verloren hat (WETTERICH/WIELAND<br />
1995).<br />
Abbildung 6: Schaffung von attraktiven Bewegungsräumen<br />
"Klassischer" <strong>Sport</strong>platz<br />
Strukturw<strong>an</strong>del im <strong>Sport</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gesellschaft<br />
- E<strong>in</strong>seitige Nutzung <strong>der</strong> <strong>Sport</strong><strong>an</strong>lagen - Differenzierung <strong>und</strong> Individualisierung<br />
- Aussparung potentieller Nutzer- des <strong>Sport</strong>systems<br />
gruppen - Geän<strong>der</strong>te <strong>Sport</strong>präferenzen <strong>der</strong> Be-<br />
- Pl<strong>an</strong>ung ausschließlich nach funktiona- völkerung<br />
len Gesichtspunkten - W<strong>an</strong>del <strong>der</strong> <strong>Sport</strong>motive <strong>und</strong> des<br />
- Normierte <strong>Sport</strong>stättendesigns für den <strong>Sport</strong>verhaltens<br />
Wettkampfsport - W<strong>an</strong>del <strong>der</strong> K<strong>in</strong>dheit <strong>und</strong> Jugendphase<br />
- Neue Anfor<strong>der</strong>ungen <strong>an</strong> bedarfsgerechte<br />
<strong>Sport</strong>stätten<br />
Zielsetzung:<br />
Schaffung von vielfältig nutzbaren, attraktiven <strong>und</strong> am lokalen <strong>Sport</strong>bedarf orientierten<br />
Bewegungsräumen für Menschen unterschiedlicher Interessen <strong>und</strong> jeden Alters<br />
Diese <strong>Sport</strong>räume bevorzugen e<strong>in</strong>seitig e<strong>in</strong>e bestimmte Personengruppe <strong>und</strong> schließen <strong>an</strong><strong>der</strong>e<br />
S<strong>in</strong>nrichtungen des <strong>Sport</strong>treibens <strong>und</strong> neue Nutzergruppen (Ältere, Freizeit- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitssportler)<br />
meist aus. Auch als Aktions- <strong>und</strong> Bewegungsräume für K<strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>und</strong> Jugendliche<br />
s<strong>in</strong>d sie <strong>in</strong> ihrer Gestaltung nicht bedürfnisgerecht, wie pädagogische <strong>und</strong> soziologische<br />
Studien zeigen.<br />
Vor diesem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> k<strong>an</strong>n als erste Zielsetzung e<strong>in</strong>er zukunftsorientierten <strong>Sport</strong>stättenpl<strong>an</strong>ung<br />
die Schaffung vielfältig nutzbarer, attraktiver <strong>und</strong> am lokalen <strong>Sport</strong>bedarf orientierter
16<br />
Bewegungsräume für Menschen unterschiedlicher Interessen <strong>und</strong> jeden Alters formuliert<br />
werden.<br />
Dabei geht es <strong>in</strong> ke<strong>in</strong>er Weise darum, das bisherige wettkampf- <strong>und</strong> breitensportorientierte<br />
<strong>Sport</strong>treiben <strong>in</strong> den Vere<strong>in</strong>en zu diskreditieren o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>zuschränken. Dieses soll <strong>und</strong> wird<br />
auch <strong>in</strong> Zukunft e<strong>in</strong>en zentralen Platz <strong>in</strong> unserer <strong>Sport</strong>l<strong>an</strong>dschaft e<strong>in</strong>nehmen.<br />
Es geht vielmehr darum, das Angebot s<strong>in</strong>nvoll zu ergänzen, die <strong>Sport</strong>stätten für den Freizeit<strong>und</strong><br />
Ges<strong>und</strong>heitssport zu öffnen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e multifunktionale Nutzung, die das Nebene<strong>in</strong><strong>an</strong><strong>der</strong><br />
unterschiedlicher <strong>Sport</strong>praxen <strong>in</strong> unserer Gesellschaft wi<strong>der</strong>spiegelt, zu ermöglichen.<br />
Viele <strong>der</strong> neuen <strong>Sport</strong>formen <strong>der</strong> Jugendlichen können beispielsweise auf den herkömmlichen,<br />
normierten <strong>Sport</strong>stätten nicht ausgeübt werden. Orientiert m<strong>an</strong> sich <strong>an</strong> den neuen<br />
<strong>Sport</strong>bedürfnissen <strong>der</strong> Jugendlichen, müssen neben die traditionellen <strong>Sport</strong>plätze <strong>Sport</strong>gelegenheiten<br />
treten, die frei zugänglich s<strong>in</strong>d, als Treffpunkte bzw. Szeneplätze betrachtet werden<br />
<strong>und</strong> erlebnis<strong>in</strong>tensive Angebote bereitstellen, die <strong>der</strong> jugendlichen Suche nach Abenteuer,<br />
Sp<strong>an</strong>nung <strong>und</strong> Flow-Erlebnissen <strong>in</strong> kalkulierbarem Maße entsprechen.
17<br />
2 Das Modell <strong>der</strong> Kooperativen Pl<strong>an</strong>ung<br />
Die Entwicklung von Spiel-, <strong>Sport</strong>- <strong>und</strong> Bewegungsräumen ist nicht länger als isolierte Bauaufgabe<br />
zu begreifen, son<strong>der</strong>n als <strong>in</strong>tegraler Best<strong>an</strong>dteil e<strong>in</strong>er zukunftsgerechten Stadtentwicklungspl<strong>an</strong>ung.<br />
Unter dieser Maxime ist e<strong>in</strong>e Vernetzung aller gesellschaftlichen Gruppen<br />
<strong>an</strong>zustreben, die dar<strong>an</strong> <strong>in</strong>teressiert s<strong>in</strong>d, die Stadt als lebenswerten <strong>und</strong> bewegungsfreudigen<br />
Ort zu gestalten: zum Beispiel <strong>Sport</strong>ler, Familien mit K<strong>in</strong><strong>der</strong>n, Ärzte, Pädagogen, <strong>Sport</strong>wissenschaftler,<br />
Stadtpl<strong>an</strong>er, Grünpl<strong>an</strong>er <strong>und</strong> L<strong>an</strong>dschaftsarchitekten, Bürgergruppen,<br />
Kommunalpolitiker o<strong>der</strong> die Vertreter verschiedener städtischer Ämter (vgl. SCHEMEL/<br />
STRASDAS 1998, 12/13). Damit wird e<strong>in</strong>erseits gewährleistet, dass unterschiedliche Sichtweisen<br />
<strong>in</strong> die Pl<strong>an</strong>ung e<strong>in</strong>gebracht werden; <strong>an</strong><strong>der</strong>erseits reiht sich die <strong>Sport</strong>stättenentwicklungspl<strong>an</strong>ung<br />
damit e<strong>in</strong> <strong>in</strong> die umfassende Aufgabe <strong>der</strong> Entwicklung e<strong>in</strong>er menschengerechten<br />
Stadtkultur.<br />
Die Gestaltung von zukunftsorientierten <strong>Sport</strong>stätten stellt <strong>an</strong> die Pl<strong>an</strong>ung neue <strong>und</strong> erhöhte<br />
Anfor<strong>der</strong>ungen. Die Pl<strong>an</strong>ung wird sich nicht mehr ausschließlich <strong>an</strong> den bisher vorherrschenden<br />
pauschalen Berechnungsmethoden <strong>und</strong> den qu<strong>an</strong>titativen Richtwerten für die<br />
sportliche Gr<strong>und</strong>versorgung <strong>der</strong> Bevölkerung orientieren können. Zusätzlich s<strong>in</strong>d st<strong>an</strong>dortspezifische<br />
<strong>und</strong> bedürfnisorientierte Fe<strong>in</strong><strong>an</strong>alysen notwendig, die die konkrete Situation im<br />
E<strong>in</strong>zugsbereich <strong>der</strong> gepl<strong>an</strong>ten <strong>Sport</strong><strong>an</strong>lage <strong>und</strong> die spezifischen lokalen <strong>und</strong> regionalen Bedürfnisse<br />
berücksichtigen.<br />
Dieser For<strong>der</strong>ung wird das folgende partizipatorische Pl<strong>an</strong>ungsverfahren <strong>der</strong> „Kooperativen<br />
Pl<strong>an</strong>ung“ gerecht. Die Pl<strong>an</strong>ungskonzeption strebt e<strong>in</strong> Verfahren <strong>der</strong> Entscheidungsf<strong>in</strong>dung<br />
<strong>an</strong>, bei dem von vornhere<strong>in</strong> Betroffene, Nutzer, Pl<strong>an</strong>ungs- <strong>und</strong> lokale Experten sowie die<br />
Vertreter lokaler sozialer Gruppen <strong>in</strong> den Pl<strong>an</strong>ungsprozess e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en werden. Die<br />
frühzeitige <strong>und</strong> kont<strong>in</strong>uierliche Beteiligung unterschiedlicher lokaler Interessens- <strong>und</strong><br />
Zielgruppen sowohl bei <strong>der</strong> Bedarfsbestimmung <strong>und</strong> Raumpl<strong>an</strong>ung als auch bei allen<br />
weiteren Pl<strong>an</strong>ungs- <strong>und</strong> Umsetzungsschritten bietet die größte Ch<strong>an</strong>ce, dass<br />
bedarfsgerechte Anlagen geschaffen werden, die die Bürger auch <strong>an</strong>nehmen. Das<br />
kooperative Pl<strong>an</strong>ungsverfahren nimmt damit die For<strong>der</strong>ungen auf, die im Rahmen <strong>der</strong><br />
„Lokalen Agenda 21“ als Ziel für zukünftige Pl<strong>an</strong>ungen formuliert wurden (RÜTTEN 1998,<br />
43).<br />
Das Verfahren wurde vom Projektteam des Instituts für <strong>Sport</strong>wissenschaft <strong>der</strong> Universität<br />
Stuttgart speziell für die Pl<strong>an</strong>ung von <strong>Sport</strong>- <strong>und</strong> Bewegungsräumen entwickelt, seit Jahren<br />
<strong>in</strong> verschiedenen Modellprojekten erprobt <strong>und</strong> e<strong>in</strong>em wissenschaftlichen Prüfverfahren unterzogen<br />
(WETTERICH/ KLOPFER 1995). In allen Modellprojekten hat die sportspezifische<br />
Bedarfs<strong>an</strong>alyse <strong>und</strong> Raumpl<strong>an</strong>ung <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>es „r<strong>und</strong>en Tisches“ zu überzeugenden Lösungen<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong>novativen Ergebnissen geführt. Nicht nur bei <strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ung von Vere<strong>in</strong>s<strong>an</strong>lagen
18<br />
<strong>und</strong> kommunaler <strong>Sport</strong>- <strong>und</strong> Freizeitzentren, son<strong>der</strong>n auch bei <strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ung bewegungsfre<strong>und</strong>licher<br />
Schulhöfe <strong>und</strong> Spielplätze konnte die Methode <strong>der</strong> „Kooperativen Pl<strong>an</strong>ung“ ihre<br />
Tauglichkeit überzeugend unter Beweis stellen.<br />
Auch die Daten <strong>der</strong> wissenschaftlichen Evaluation <strong>der</strong> oben gen<strong>an</strong>nten Projekte unterstreichen<br />
die Notwendigkeit <strong>und</strong> Bedeutung des Instruments e<strong>in</strong>er wissenschaftlich begleiteten<br />
Kooperativen Pl<strong>an</strong>ung. Es stellt nach übere<strong>in</strong>stimmenden Aussagen e<strong>in</strong> effizientes Pl<strong>an</strong>ungsverfahren<br />
dar, das situative Anpassungsfähigkeit mit e<strong>in</strong>er hohen Problemlösungskapazität<br />
verb<strong>in</strong>det <strong>und</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lage ist, komplexe Aufgaben im Bereich <strong>der</strong> <strong>Sport</strong>stättenpl<strong>an</strong>ung<br />
zu bewältigen. Kooperative Pl<strong>an</strong>ung heißt <strong>der</strong> Schlüssel zum Erfolg bei <strong>der</strong> Gestaltung zukunftsorientierter<br />
<strong>Sport</strong><strong>an</strong>lagen.<br />
2.1 Die lokale Pl<strong>an</strong>ungsgruppe als Zentrum des Pl<strong>an</strong>ungsprozesses<br />
Die Kooperative Pl<strong>an</strong>ung stellt lokale, dezentrale Pl<strong>an</strong>ungsgruppen, die weitreichende Kompetenzen<br />
besitzen <strong>und</strong> ver<strong>an</strong>twortlich <strong>und</strong> <strong>in</strong> weitgehen<strong>der</strong> Selbständigkeit die Pl<strong>an</strong>ungs-,<br />
Entscheidungs- <strong>und</strong> Umsetzungsprozesse vornehmen, <strong>in</strong>s Zentrum des Pl<strong>an</strong>ungsprozesses.<br />
Ziel ist die Zusammenarbeit aller pl<strong>an</strong>ungsrelev<strong>an</strong>ten Gruppen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Pl<strong>an</strong>ungs<strong>in</strong>st<strong>an</strong>z, <strong>der</strong>en<br />
Arbeit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em e<strong>in</strong>zigen Pl<strong>an</strong>ungsentwurf kulm<strong>in</strong>ieren soll. Daher müssen e<strong>in</strong>e differenzierte<br />
Auswahl <strong>der</strong> Teilnehmer sowie <strong>der</strong>en kont<strong>in</strong>uierliche, <strong>in</strong>tensive <strong>und</strong> ver<strong>an</strong>twortliche<br />
Mitarbeit <strong>in</strong> den Pl<strong>an</strong>ungssitzungen gewährleistet se<strong>in</strong>.<br />
Der Auswahl <strong>der</strong> Teilnehmer <strong>der</strong> lokalen Pl<strong>an</strong>ungsgruppen kommt damit e<strong>in</strong>e zentrale Bedeutung<br />
zu. Unter <strong>der</strong> Perspektive, die gesellschaftliche Wirklichkeit <strong>in</strong> ihrer Komplexität<br />
möglichst breit zu erfassen, die Bedarfe vor Ort umfassend zu erheben <strong>und</strong> sportive Angebote<br />
für alle Alters- <strong>und</strong> Interessengruppen zur Verfügung zu stellen, muss e<strong>in</strong>e möglichst heterogene<br />
<strong>und</strong> breite Zusammensetzung <strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ungsgruppen <strong>an</strong>gestrebt werden. Die wesentlichen<br />
Entscheidungsträger <strong>und</strong> Experten sowie die Vertreter <strong>der</strong> lokalen Org<strong>an</strong>isationen <strong>und</strong><br />
Interessensgruppen (z.B. Vere<strong>in</strong>e, Kulturgruppen) <strong>und</strong> <strong>der</strong> öffentlichen Institutionen (Schule,<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>garten etc.) müssen von Anf<strong>an</strong>g <strong>an</strong> <strong>in</strong> die Arbeit <strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ungsgruppen e<strong>in</strong>bezogen<br />
werden. Vier Funktionsgruppen sollen dabei Berücksichtigung f<strong>in</strong>den:
Abbildung 7: Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ungsgruppe<br />
- Vere<strong>in</strong>svertreter z.B.: Vorst<strong>an</strong>dsmitglied, Vertreter / Leiter <strong>der</strong> Abteilungen,<br />
Vertreter des Freizeitsports <strong>und</strong> <strong>der</strong> Jugendarbeit, <strong>in</strong>teressierte<br />
Mitglie<strong>der</strong><br />
- Politisch-adm<strong>in</strong>istrative z.B.: Bürgermeister, Geme<strong>in</strong><strong>der</strong>äte, Vertreter <strong>der</strong> Verwaltung<br />
Funktionsträger <strong>und</strong> Mitarbeiter <strong>der</strong> Fachämter, Stadtpl<strong>an</strong>er, Vertreter<br />
<strong>der</strong> Parteien<br />
- Vertreter sozialer Gruppen z.B.: Vertreter aus den Bereichen Schule, K<strong>in</strong><strong>der</strong>garten, offene<br />
<strong>und</strong> öffentlicher Institutionen Jugendarbeit, Kirche, Naturschutz; Vertreter von<br />
Auslän<strong>der</strong>-, Senioren- <strong>und</strong> Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>tengruppen,<br />
Vertreter des Wohnumfelds<br />
- Pl<strong>an</strong>ungs- <strong>und</strong> lokale Experten z.B.: <strong>Sport</strong>- <strong>und</strong> L<strong>an</strong>dschaftsarchitekten, Institute für <strong>Sport</strong>wissenschaft,<br />
Bau-Experten für E<strong>in</strong>zelfragen<br />
19<br />
Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ungsgruppe<br />
Als Bed<strong>in</strong>gungen e<strong>in</strong>er erfolgreich arbeitenden lokalen Pl<strong>an</strong>ungsgruppe haben sich nach den<br />
Evaluationsergebnissen <strong>der</strong> oben gen<strong>an</strong>nten Modellprojekte folgende Faktoren erwiesen:<br />
Abbildung 8: Faktoren e<strong>in</strong>er erfolgreichen Pl<strong>an</strong>ung<br />
- Kompakte Durchführung <strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ungsphase<br />
- Zeitliche Verzahnung von Pl<strong>an</strong>ungs- <strong>und</strong> Umsetzungsphase<br />
- Heterogene Zusammensetzung <strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ungsgruppe<br />
- Kont<strong>in</strong>uierliche Teilnahme <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong><br />
- Hohes Engagement e<strong>in</strong>es lokalen Leiters <strong>und</strong> Org<strong>an</strong>isators <strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ungsgruppe<br />
(bei kommunalen Projekten <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel e<strong>in</strong> hochr<strong>an</strong>giger Vertreter <strong>der</strong> Stadtverwaltung<br />
bzw. e<strong>in</strong> Führungsteam)<br />
- Enge <strong>und</strong> frühzeitige Kooperation Kommune/Vere<strong>in</strong>/Schule<br />
- Frühzeitige E<strong>in</strong>beziehung lokaler Experten <strong>und</strong> e<strong>in</strong>es Architekten<br />
- Vorbereitung <strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ungsarbeit <strong>in</strong> <strong>der</strong> Öffentlichkeit<br />
- Externe Mo<strong>der</strong>ation <strong>und</strong> wissenschaftliche Beratung<br />
Gerade die externe Mo<strong>der</strong>ation <strong>und</strong> wissenschaftliche Beratung durch das „Expertenteam“<br />
des Instituts für <strong>Sport</strong>wissenschaft hat sich nach den wissenschaftlich ermittelten Evaluationsergebnissen<br />
als Erfolgsgar<strong>an</strong>t für e<strong>in</strong>e dynamische <strong>und</strong> zielgerichtete Arbeit herauskristallisiert<br />
(s.u.).
Abbildung 9: Konzeptionelles Vorgehen<br />
20<br />
Pl<strong>an</strong>ungskonzeption<br />
Sitzung 1<br />
Vorstellung <strong>der</strong> Teilnehmer<br />
Projektvorstellung<br />
Überblick über das Pl<strong>an</strong>ungsverfahren<br />
Gr<strong>und</strong>legende Bedarfs<strong>an</strong>alyse<br />
Sitzung 2<br />
Bedarfskonkretisierung <strong>und</strong> –hierarchisierung<br />
Begehung des Geländes<br />
Übergeordnete Pl<strong>an</strong>ungsgr<strong>und</strong>lagen<br />
Aufzeigen von weiteren Ideen<br />
Raumpläne <strong>in</strong> homogenen Kle<strong>in</strong>gruppen<br />
Sitzung 3<br />
Auswertung <strong>der</strong> Bedarfshierarchisierung<br />
Synoptischer Vergleich <strong>der</strong> Raumpläne<br />
Raumpläne <strong>in</strong> gemischten Gruppen<br />
Sitzung 4<br />
Diskussion <strong>und</strong> Verabschiedung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>samen Raumpl<strong>an</strong>es<br />
Verabschiedung des Gesamtgestaltungspl<strong>an</strong>es<br />
Diskussion zur Gestaltung e<strong>in</strong>zelner Bereiche<br />
Weiteres Vorgehen (Arbeitsgruppen für E<strong>in</strong>zelbereiche, Öffentlichkeitsarbeit)<br />
Zu Beg<strong>in</strong>n <strong>der</strong> geme<strong>in</strong>samen Arbeit werden sowohl die theoretischen Gr<strong>und</strong>lagen, die Projektkonzeption<br />
als auch das Pl<strong>an</strong>ungsverfahren vom Expertenteam vorgestellt.<br />
Die Pl<strong>an</strong>ungsphase selbst beg<strong>in</strong>nt mit e<strong>in</strong>er gr<strong>und</strong>legenden, unbee<strong>in</strong>flussten Bedarfsermittlung,<br />
bei <strong>der</strong> dem Vorstellungsvermögen <strong>und</strong> <strong>der</strong> Kreativität <strong>der</strong> Teilnehmer ke<strong>in</strong>e Grenzen<br />
gesetzt s<strong>in</strong>d, auch nicht durch f<strong>in</strong><strong>an</strong>zielle Aspekte. In dieser Sammel- bzw. Ph<strong>an</strong>tasiephase<br />
(Sitzung 1) wird e<strong>in</strong> breiter Katalog von Wünschen <strong>und</strong> Vorstellungen erstellt, <strong>der</strong> noch nicht<br />
durch Machbarkeits- <strong>und</strong> Durchführungserwägungen e<strong>in</strong>geschränkt wird. Die Vielzahl <strong>der</strong><br />
auftretenden Wünsche macht den Teilnehmern bewusst, dass die Interessenkonflikte nur<br />
durch Kompromissf<strong>in</strong>dung zu e<strong>in</strong>er Lösung gebracht werden können.
21<br />
In <strong>der</strong> Arbeitsphase (Sitzung 2 bis 4) werden durch Diskussionsprozesse <strong>und</strong> mit Hilfe e<strong>in</strong>es<br />
Fragebogens Bedarfe herausgefiltert <strong>und</strong> nach ihrer Bedeutung geordnet. Anschließend sollen<br />
alle Beteiligten <strong>in</strong>dividuell o<strong>der</strong> <strong>in</strong> Kle<strong>in</strong>gruppen konkrete Vorschläge <strong>und</strong> erste Raumpläne<br />
erarbeiten, wobei alle Vari<strong>an</strong>ten im Protokoll festgehalten werden. Die mehrheitsfähigen<br />
Vorschläge werden diskutiert <strong>und</strong> Räumen zugeordnet, wobei alle Vorschläge gleichberechtigt<br />
zu beh<strong>an</strong>deln s<strong>in</strong>d. Geländebegehungen unterstützen den Pl<strong>an</strong>ungsprozess; zusätzlich<br />
fließen Informationen seitens <strong>der</strong> externen Experten e<strong>in</strong>. Konsensbildungsprozesse <strong>in</strong> homogenen<br />
<strong>und</strong> heterogenen Kle<strong>in</strong>gruppen sowie im Plenum führen am Ende dieser Phase zu<br />
e<strong>in</strong>em idealtypischen, von allen Teilnehmern getragenen Raumpl<strong>an</strong>, <strong>der</strong> vom Architekten <strong>in</strong><br />
Form e<strong>in</strong>es maßstabsgerechten Gesamtgestaltungspl<strong>an</strong>es ver<strong>an</strong>schaulicht wird.<br />
In <strong>der</strong> Schlussphase (Sitzung 4) <strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ung steht die Vorbereitung <strong>der</strong> Umsetzung des erarbeiteten<br />
Pl<strong>an</strong>es im Vor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong>. Dazu sollen die Umsetzungsideen <strong>und</strong> -vorschläge für die<br />
e<strong>in</strong>zelnen Bereiche – evtl. durch die Bildung von Arbeitsgruppen bzw. Patenschaften <strong>in</strong>nerhalb<br />
<strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ungsgruppe - konkret ausgestaltet, ergänzt <strong>und</strong> auf ihre Durchführbarkeit untersucht<br />
werden. Gleichzeitig wird vom beauftragten Architekten e<strong>in</strong> Vorentwurf erarbeitet, <strong>der</strong><br />
auch e<strong>in</strong>e Kostenaufstellung be<strong>in</strong>haltet. Auf dieser Gr<strong>und</strong>lage bereitet die Pl<strong>an</strong>ungsgruppe<br />
die Verabschiedung e<strong>in</strong>es F<strong>in</strong><strong>an</strong>zierungs- <strong>und</strong> evtl. e<strong>in</strong>es zeitlichen Stufenpl<strong>an</strong>s, die öffentliche<br />
Präsentation <strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ungsergebnisse <strong>und</strong> die Beschlussfassung im Geme<strong>in</strong><strong>der</strong>at vor.
22<br />
2.2 Beratungstätigkeit des Expertenteams<br />
Die oben skizzierte Pl<strong>an</strong>ungsmethode versteht sich als pl<strong>an</strong>erischer Mischprozess aus<br />
sportwissenschaftlichem <strong>und</strong> sportarchitektonischem Fachwissen auf <strong>der</strong> e<strong>in</strong>en <strong>und</strong> lokalem<br />
Sachverst<strong>an</strong>d auf <strong>der</strong> <strong>an</strong><strong>der</strong>en Seite. In dem engen Zusammenwirken von Fachexperten mit<br />
den Experten für die kommunalen <strong>und</strong> örtlichen Bel<strong>an</strong>ge liegt e<strong>in</strong> beson<strong>der</strong>s ch<strong>an</strong>cenreicher<br />
Weg für die Entwicklung von brauchbarem <strong>und</strong> exemplarischem H<strong>an</strong>dlungswissen.<br />
Praktische Erfahrungen <strong>und</strong> wissenschaftlich ermittelte Evaluationsergebnisse belegen e<strong>in</strong>drücklich,<br />
dass e<strong>in</strong>e externe Mo<strong>der</strong>ation <strong>und</strong> wissenschaftliche Begleitung des Pl<strong>an</strong>ungsprozesses<br />
von großem Nutzen s<strong>in</strong>d, sowohl <strong>in</strong> Bezug auf die reibungslose <strong>und</strong> zielgerichtete<br />
Durchführung <strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ung als auch h<strong>in</strong>sichtlich des Innovationspotentials <strong>der</strong> um- o<strong>der</strong> neugestalteten<br />
<strong>Sport</strong>- <strong>und</strong> Bewegungsareale.<br />
Abbildung 10: Beratungstätigkeit des Expertenteams<br />
Beratungstätigkeit des Expertenteams<br />
Leitung <strong>und</strong> Mo<strong>der</strong>ation Wissenschaftliche Beratung Architektonische Beratung<br />
des Pl<strong>an</strong>ungsprozesses<br />
- Leitung <strong>der</strong> Sitzungen -Erkenntnisse aus verschiedenen - Maßstabsgerechter Pl<strong>an</strong><br />
- Vor- <strong>und</strong> Nachbereitung <strong>der</strong> Wissenschaftsdiszipl<strong>in</strong>en - L<strong>an</strong>dschaftsarchitektonische<br />
Sitzungen<br />
- E<strong>in</strong>zelgespräche<br />
Gestaltung <strong>und</strong> Modellierung<br />
2.3 Leitung, Begleitung <strong>und</strong> Mo<strong>der</strong>ation des Pl<strong>an</strong>ungsprozesses vor Ort<br />
Innerhalb <strong>der</strong> lokalen Pl<strong>an</strong>ungsgruppen kommt <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung primär e<strong>in</strong>e<br />
Beratungs- <strong>und</strong> Initialfunktion zu, die auf die örtlichen Verhältnisse abgestimmt ist. Die<br />
Experten, die <strong>in</strong> den dezentralen Projektgruppen tätig s<strong>in</strong>d, haben nach dem Pr<strong>in</strong>zip <strong>der</strong><br />
Subsidiarität (= Pr<strong>in</strong>zip <strong>der</strong> Nachr<strong>an</strong>gigkeit <strong>und</strong> Hilfestellung) "Hilfe zur Selbsthilfe" zu leisten<br />
<strong>und</strong> beispielsweise folgende Aufgaben zu erfüllen:<br />
� Vorbereitungstreffen mit den lokalen Projektver<strong>an</strong>twortlichen<br />
� Festlegung <strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ungsgruppenteilnehmer <strong>in</strong> Zusammenarbeit mit dem Leiter <strong>der</strong><br />
Pl<strong>an</strong>ungsgruppe<br />
� Mo<strong>der</strong>ation, Vor- <strong>und</strong> Nachbereitung <strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ungsgruppensitzungen vor Ort<br />
� Erstellen e<strong>in</strong>er Bedarfsliste<br />
� Auswertung <strong>der</strong> Bedarfshierarchisierung
23<br />
� Auswertung <strong>der</strong> E<strong>in</strong>zel- <strong>und</strong> Kle<strong>in</strong>gruppenraumpläne<br />
� Vermittlung von Kontakten <strong>und</strong> Kooperationspartnern<br />
� Evtl. Org<strong>an</strong>isation von Informationsfahrten<br />
� E<strong>in</strong>zelgespräche (z.B. mit Anwohnern)<br />
Hierfür s<strong>in</strong>d Kenntnisse z.B. über das Pl<strong>an</strong>ungsverfahren, lokale Strukturen, Gesprächsführung<br />
<strong>und</strong> rechtliche Bestimmungen sowie org<strong>an</strong>isatorisches Geschick <strong>und</strong> E<strong>in</strong>fühlungsvermögen<br />
unverzichtbar.<br />
2.4 Wissenschaftliche Beratung<br />
Innovative <strong>und</strong> zukunftsorientierte Praxisprojekte im Bereich <strong>der</strong> <strong>Sport</strong>stättenpl<strong>an</strong>ung erfor<strong>der</strong>n<br />
e<strong>in</strong>e f<strong>und</strong>ierte <strong>in</strong>haltliche Beratung <strong>und</strong> <strong>in</strong> theoretischer H<strong>in</strong>sicht die breite, <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>äre<br />
Zusammenarbeit <strong>der</strong> Experten, die im Bereich <strong>der</strong> <strong>Sport</strong>stättenpl<strong>an</strong>ung arbeiten. Das<br />
Wissen um die Möglichkeiten <strong>und</strong> Notwendigkeiten e<strong>in</strong>er zukunftsorientierten <strong>Sport</strong>stättenentwicklungspl<strong>an</strong>ung<br />
muss aus verschiedenen Blickw<strong>in</strong>keln gebündelt <strong>und</strong> für den Pl<strong>an</strong>ungsprozess<br />
fruchtbar gemacht werden.<br />
Dabei geht es <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e darum, die Erkenntnisse verschiedener sportwissenschaftlicher<br />
Teildiszipl<strong>in</strong>en für e<strong>in</strong>e f<strong>und</strong>ierte <strong>und</strong> <strong>an</strong> neuen gesellschaftlichen Entwicklungen orientierte<br />
Pl<strong>an</strong>ung zusammenzuführen. Die damit verb<strong>und</strong>ene Beratungstätigkeit bezieht sich auf<br />
� allgeme<strong>in</strong>e Erkenntnisse über die Entwicklung unseres <strong>Sport</strong>systems <strong>und</strong> die daraus<br />
resultierenden Anfor<strong>der</strong>ungen <strong>an</strong> bedürfnisgerechte Bewegungsareale <strong>und</strong><br />
� die konkrete Ausgestaltung <strong>und</strong> Anordnung <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen Bereiche.<br />
Beispielsweise werden zentrale Fragestellungen <strong>der</strong> <strong>Sport</strong>psychologie (z.B. Berücksichtigung<br />
<strong>der</strong> motorischen Entwicklung von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Jugendlichen - w<strong>an</strong>n lernt m<strong>an</strong> welche<br />
motorischen Gr<strong>und</strong>tätigkeiten bzw. Fertigkeiten), <strong>der</strong> <strong>Sport</strong>soziologie (z.B. W<strong>an</strong>del <strong>der</strong><br />
<strong>Sport</strong>bedürfnisse <strong>in</strong> allen Altersgruppen, Individualisierung <strong>und</strong> Differenzierung des <strong>Sport</strong>s,<br />
Entstehung <strong>und</strong> Bedeutung neuer <strong>Sport</strong>arten) <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>Sport</strong>pädagogik (z.B. Bedeutung <strong>der</strong><br />
Raum<strong>an</strong>eignung für die k<strong>in</strong>dliche Entwicklung, Neudef<strong>in</strong>ition <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Jugendphase,<br />
didaktische Fragen des Erwachsenensports) her<strong>an</strong>gezogen, um e<strong>in</strong>e <strong>an</strong> den Bedürfnissen<br />
<strong>der</strong> Zielgruppen <strong>und</strong> <strong>an</strong> neuen gesellschaftlichen Entwicklungen orientierte Pl<strong>an</strong>ung zu erreichen.
2.5 <strong>Sport</strong>- <strong>und</strong> l<strong>an</strong>dschaftsarchitektonische Beratung<br />
24<br />
Neben dieser breit <strong>an</strong>gelegten sportwissenschaftlichen Beratung ist e<strong>in</strong>e sport- <strong>und</strong> l<strong>an</strong>dschaftsarchitektonische<br />
Beratung <strong>der</strong> lokalen Pl<strong>an</strong>ungsgruppen <strong>in</strong> den meisten Fällen unverzichtbar.<br />
Die architektonische Beratung hat die Aufgabe, - unter E<strong>in</strong>beziehung eigener gestalterischer<br />
Vorstellungen - die erarbeiteten Raum- <strong>und</strong> Zonierungspläne nach funktionalen <strong>und</strong> räumlich-ästhetischen<br />
Gesichtspunkten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Gesamtpl<strong>an</strong> darzustellen. Die Notwendigkeit dazu<br />
ergibt sich vor allem unter zwei Gesichtspunkten:<br />
� Für die konkrete Umsetzung <strong>und</strong> für erste Baumaßnahmen ist e<strong>in</strong> maßstabsgerechter<br />
Pl<strong>an</strong> mit exakten Abmessungen <strong>und</strong> Größenordnungen unumgänglich. Die graphische<br />
Darstellung des Gesamtpl<strong>an</strong>s hat damit auch die Funktion e<strong>in</strong>er Machbarkeits- <strong>und</strong><br />
Durchführbarkeitsprüfung, die die Pl<strong>an</strong>ungen <strong>in</strong> die realen Verhältnisse e<strong>in</strong>passt.<br />
� Eng damit zusammenhängend verfolgt die architektonische Beratung das Ziel e<strong>in</strong>er<br />
l<strong>an</strong>dschaftsarchitektonischen Gestaltung <strong>und</strong> Modellierung <strong>der</strong> zu pl<strong>an</strong>enden Flächen.<br />
Dem liegt die E<strong>in</strong>sicht zugr<strong>und</strong>e, dass e<strong>in</strong> "Wohlfühlen" auf dem <strong>Sport</strong>gelände nicht nur<br />
von attraktiven <strong>Sport</strong>gelegenheiten, son<strong>der</strong>n auch von räumlich-ästhetischen Gestaltungskriterien<br />
(Bepfl<strong>an</strong>zung, Sitznischen, Wegeführung <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Anlage, raumglie<strong>der</strong>nde<br />
Gestaltungselemente, e<strong>in</strong>laden<strong>der</strong> E<strong>in</strong>g<strong>an</strong>gsbereich, Geländemodellierung<br />
etc.) abhängig ist. In diese l<strong>an</strong>dschaftsarchitektonischen Maßnahmen fließen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
<strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>ären Prozeß die schon <strong>an</strong>geführten sportpädagogischen <strong>und</strong> entwicklungspsychologischen<br />
Gesichtspunkte wie<strong>der</strong> e<strong>in</strong>: So werden beispielsweise Böschungen<br />
sowohl nach ästhetischen Kriterien, nach ihrer Funktionalität (Abgrenzung von Bereichen,<br />
Lärmschutz, Zugänge) als auch unter H<strong>in</strong>weis auf ihre "Bespielbarkeit" (Spieltürme,<br />
erhöhte Absprungstelle etc.) gestaltet.<br />
2.6 Zusammenfassung<br />
Die Methode <strong>der</strong> Kooperativen Pl<strong>an</strong>ung, die Fachexperten, lokale Experten, Betroffene <strong>und</strong><br />
potentielle Nutzer zusammenführt <strong>und</strong> <strong>der</strong>en Wissen <strong>und</strong> Kompetenzen <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>es "r<strong>und</strong>en<br />
Tisches" für die Pl<strong>an</strong>ung nutzbar macht, bietet gegenüber <strong>an</strong><strong>der</strong>en Pl<strong>an</strong>ungsmethoden<br />
zusammenfassend folgende Vorteile:
Abbildung 11: Unterschiedliche Ansätze<br />
25<br />
Traditionelle Pl<strong>an</strong>ung Kooperative Pl<strong>an</strong>ung<br />
Zentrale Pl<strong>an</strong>ung Dezentrale Pl<strong>an</strong>ung vor Ort<br />
Expertenwissen Verb<strong>in</strong>dung von lokalem Expertenwissen<br />
mit externem Fachwissen<br />
Richtwertfixiert Bedarfsorientiert<br />
Genormt, monoton Individuell, vielfältig<br />
Hierarchisch, von oben Demokratisch, von unten<br />
Me<strong>in</strong>ungsvielfalt <strong>und</strong> Pluralität<br />
Pl<strong>an</strong>ung am „Grünen Tisch“ Pl<strong>an</strong>ung am „R<strong>und</strong>en Tisch“<br />
Ger<strong>in</strong>ge Bürgerbeteiligung Frühzeitige E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>der</strong> Bevölkerung,<br />
aktive Beteiligung während des gesamten<br />
Pl<strong>an</strong>ungs- <strong>und</strong> Umsetzungsprozesses<br />
Ke<strong>in</strong>e Rückkopplung Ständige Rückkopplung<br />
Kosten<strong>in</strong>tensiv Zeit<strong>in</strong>tensiv<br />
M<strong>in</strong>imierung <strong>der</strong> Kosten durch Eigenleistungen<br />
<strong>und</strong> Beziehungen vor Ort<br />
Konflikte nach <strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ung Konflikte bewusst bereits während <strong>der</strong><br />
Pl<strong>an</strong>ung<br />
Schnelle <strong>und</strong> unbürokratische Diskussion<br />
um Kompromisse<br />
Ger<strong>in</strong>ger Informationsst<strong>an</strong>d <strong>der</strong> Bevölkerung Gute Information <strong>der</strong> Bevölkerung durch<br />
durch externe Pl<strong>an</strong>ung Multiplikatorenrolle <strong>der</strong> Teilnehmer <strong>der</strong><br />
Pl<strong>an</strong>ungsgruppe<br />
Ger<strong>in</strong>ge Identifikation mit den Plänen Hohe Identifikation mit den Plänen
3 Der Pl<strong>an</strong>ungsprozess<br />
3.1 Die Pl<strong>an</strong>ungsgruppe – Zusammensetzung <strong>und</strong> Arbeitsweise<br />
26<br />
Herzstück des Verfahrens <strong>der</strong> Kooperativen Pl<strong>an</strong>ung ist die örtliche Pl<strong>an</strong>ungsgruppe, die<br />
sich aus Vertretern <strong>der</strong> Stadtverwaltung, den Fraktionen im Geme<strong>in</strong><strong>der</strong>at, <strong>der</strong> Schulen <strong>und</strong><br />
Vere<strong>in</strong>e sowie weiterer sozialer Gruppen zusammensetzt. Dieses Pl<strong>an</strong>ungsgremium sollte<br />
sich für den Pl<strong>an</strong>ungsprozess sowie das Raumkonzept als Pl<strong>an</strong>ungsergebnis ver<strong>an</strong>twortlich<br />
zeichnen.<br />
Die Pl<strong>an</strong>ungsgruppe war mit folgenden Personen besetzt:<br />
Name Institution<br />
1 Delp, Horst Mo<strong>der</strong>ation<br />
2 Drissler, Marlies Fraktion Pro <strong>Hemsbach</strong><br />
3 Ehret, Elke Bürger-Drehscheibe<br />
4 F<strong>in</strong>deisen, Ralf KSV <strong>Hemsbach</strong><br />
5 Fischer, Dieter KV <strong>Hemsbach</strong><br />
6 Frömel, Felix DPSG <strong>Hemsbach</strong><br />
7 Göpfert, Wiel<strong>an</strong>d DLRG <strong>Hemsbach</strong><br />
8 Hauß, Angelika Schulverb<strong>an</strong>d<br />
9 He<strong>in</strong>zelbecker, Rol<strong>an</strong>d SG <strong>Hemsbach</strong><br />
10 Hoffm<strong>an</strong>n, Jörg TC Wiesensee<br />
11 Kirchner, Jürgen Stadtverwaltung <strong>Hemsbach</strong><br />
12 Launer, Erich BSG <strong>Hemsbach</strong><br />
13 Mart<strong>in</strong>-Lucas, Margit Ev.Bonhoeffer K<strong>in</strong><strong>der</strong>garten<br />
14 Müller, Gisela Hebelschule<br />
15 Ochs, Hartmut DLRG <strong>Hemsbach</strong><br />
16 Palm, Michael L<strong>an</strong>dschaftsarchitekt<br />
17 Pehle, Tim DRK<br />
18 Pfliegensdörfer, Kurt TV <strong>Hemsbach</strong><br />
19 Richter, Rol<strong>an</strong>d CDU Fraktion<br />
20 Ritter, Heiko Fraktion Pro <strong>Hemsbach</strong><br />
21 Rittersbacher, Thomas Stadtverwaltung <strong>Hemsbach</strong><br />
22 Rössl<strong>in</strong>g, Bertram Stadtverwaltung <strong>Hemsbach</strong><br />
23 Schim<strong>an</strong>ski, Rolf SPD Fraktion<br />
24 Schra<strong>der</strong>, Henrik Mo<strong>der</strong>ation<br />
25 Schweikert, Günter KV <strong>Hemsbach</strong><br />
26 Seifert, Helmut KSV <strong>Hemsbach</strong>
27<br />
27 Seret, J<strong>an</strong> Jugendkommission<br />
28 Wieg<strong>an</strong>d, Ursula Kulturför<strong>der</strong>kreis<br />
29 W<strong>in</strong>kenbach, Gerhard Jugendzentrum<br />
30 Zimmer, Michael Agenda 21<br />
31 Zopf, Christ<strong>in</strong>e Stadtverwaltung <strong>Hemsbach</strong><br />
Damit erfüllte sowohl die Zusammensetzung als auch die Arbeitsweise <strong>der</strong> Projektgruppe die<br />
theoretisch gefor<strong>der</strong>ten Bed<strong>in</strong>gungen (vgl. Kapitel 2), die <strong>an</strong> e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>novative <strong>und</strong> erfolgreiche<br />
Pl<strong>an</strong>ungsarbeit gestellt wird, <strong>in</strong> nahezu idealer Weise:<br />
� Heterogene Zusammensetzung <strong>der</strong> Projektgruppe unter Berücksichtigung <strong>der</strong><br />
Funktionsgruppen von Stadtverwaltung, Fraktionen, Vere<strong>in</strong>en, Schulen <strong>und</strong><br />
Vertretern sonstiger Gruppen<br />
� Kont<strong>in</strong>uierliche Teilnahme <strong>der</strong> Projektgruppenmitglie<strong>der</strong> <strong>an</strong> den vier Sitzungsterm<strong>in</strong>en<br />
� Enge Kooperation mit den Vere<strong>in</strong>en<br />
� Frühzeitige E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung architektonischen Fachwissens durch die E<strong>in</strong>beziehung von<br />
Herrn Palm<br />
� Externe Mo<strong>der</strong>ation <strong>und</strong> wissenschaftliche Beratung<br />
3.2 Beschreibung des realen Pl<strong>an</strong>ungsverlaufes<br />
3.2.1 Sitzung 1: Konzeptionelles Vorgehen <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>legende Bedarfsermittlung<br />
Die erste Sitzung f<strong>an</strong>d am 10. Oktober 2001 <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schillerschule <strong>in</strong> <strong>Hemsbach</strong> statt.<br />
Nach <strong>der</strong> Begrüßung <strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ungsgruppe durch Herrn Bürgermeister Pauli wurde e<strong>in</strong>e kurze<br />
Vorstellungsr<strong>und</strong>e <strong>der</strong> Teilnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Teilnehmer durchgeführt. Herr Rößl<strong>in</strong>g <strong>in</strong>formierte<br />
die Anwesenden kurz über das Projekt „Überpl<strong>an</strong>ung <strong>der</strong> Außen<strong>an</strong>lagen <strong>der</strong> H<strong>an</strong>s-<br />
<strong>Michel</strong>-<strong>Halle</strong>“. Im Anschluss stellten die Mo<strong>der</strong>atoren die Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> den St<strong>an</strong>d <strong>der</strong><br />
heutigen <strong>Sport</strong>stättendiskussion dar <strong>und</strong> erläuterten das Modell <strong>der</strong> kooperativen Pl<strong>an</strong>ung.<br />
E<strong>in</strong> Diskussionspunkt stellte das zur Verfügung stehende Gelände dar. Insbeson<strong>der</strong>e die<br />
Anb<strong>in</strong>dung bzw. Ausweitung <strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ung auf das Wiesenseegelände wurde diskutiert. Als<br />
Ergebnis dieses Diskussionsprozesses wurde festgehalten, dass e<strong>in</strong>e Anb<strong>in</strong>dung des <strong>Sport</strong>areals<br />
von großer Bedeutung sei, die Überpl<strong>an</strong>ung beschränke sich jedoch vorerst auf das<br />
<strong>der</strong>zeitige <strong>Sport</strong>areal um die H<strong>an</strong>s-<strong>Michel</strong>-<strong>Halle</strong>. Dennoch sollten Ideen, Wünsche <strong>und</strong> Bedarfe<br />
h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ung daraufh<strong>in</strong> geprüft werden, ob <strong>der</strong>en räumliche Ansiedlung<br />
nicht besser im Wiesenseegelände untergebracht werden können – e<strong>in</strong>e zweite Pl<strong>an</strong>ungsphase<br />
„Wiesenseegelände“ müsste nach Me<strong>in</strong>ung e<strong>in</strong>iger Pl<strong>an</strong>ungsgruppenmitglie<strong>der</strong> zu e<strong>in</strong>em<br />
späteren Zeitpunkt erfolgen.
28<br />
Als E<strong>in</strong>stieg <strong>in</strong> den eigentlichen Pl<strong>an</strong>ungsprozess führten die Teilnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Teilnehmer<br />
e<strong>in</strong> 30-m<strong>in</strong>ütiges Bra<strong>in</strong>storm<strong>in</strong>g zur gr<strong>und</strong>legenden Bedarfssammlung <strong>in</strong> Kle<strong>in</strong>gruppen<br />
durch <strong>und</strong> stellten ihre ermittelten Bedarfe dem gesamten Pl<strong>an</strong>ungsgremium vor.<br />
Bedarfssammlung für das Gelände um die H<strong>an</strong>s-<strong>Michel</strong>-<strong>Halle</strong><br />
� Übergreifende Pl<strong>an</strong>ungsaspekte:<br />
� Verb<strong>in</strong>dung zum Wiesenseegelände<br />
� G<strong>an</strong>zjährige Öffnung/Optimale Auslastung des Geländes<br />
� E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung des bestehenden Spielplatzes<br />
� Teilbereich Wiesenseegelände mitnutzen<br />
� Verbesserung <strong>der</strong> Raum- <strong>und</strong> <strong>Halle</strong>nnutzung/Vergabe<br />
� Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>tengerechte Gestaltung<br />
� Berücksichtigung von Lärmschutzaspekten<br />
� Möglichst zentrale Lage des RK- <strong>und</strong> DLRG-Gebäudes<br />
� Getrennte An- <strong>und</strong> Abfahrtswege für den Rettungsdienst<br />
� Platzwart/Aufsicht<br />
� Ausgabe von Spielgeräten<br />
� Parkplätze multifunktional nutzen<br />
� Bestehende <strong>Sport</strong>e<strong>in</strong>richtungen:<br />
� Erhalt <strong>der</strong> Leichtathletike<strong>in</strong>richtungen<br />
� Erneuerung <strong>der</strong> Aschenbahn<br />
� Umgestaltung Hartplatz <strong>in</strong> Kunstrasenplatz<br />
� Rasenplatz Stadion<br />
� Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gs- <strong>und</strong> Bolzplatz <strong>in</strong> Kunstrasenplatz umgestalten<br />
� S<strong>an</strong>ierung <strong>der</strong> Umkleide- <strong>und</strong> S<strong>an</strong>itärbereiche<br />
� Umgestaltung <strong>der</strong> H<strong>an</strong>s-<strong>Michel</strong>-<strong>Halle</strong> <strong>in</strong> Multifunktionshalle<br />
� Kraftraum <strong>in</strong> <strong>der</strong> H<strong>an</strong>s-<strong>Michel</strong>-<strong>Halle</strong><br />
� Teilbare Gymnastikhalle<br />
� T<strong>an</strong>z, Gymnastik im Erdgeschoss des <strong>Sport</strong>centers<br />
� <strong>Sport</strong>ive Bedarfe:<br />
� Bolzplatz<br />
� Multifunktionsspielfeld für Trendsport
� Angebot für Inl<strong>in</strong>er<br />
� Angebot für Skater<br />
� Kletterw<strong>an</strong>d<br />
� Beachsport<strong>an</strong>lage<br />
� Tischtennisplatten<br />
� Streethockey<br />
� Trimm-Dich-Pfad<br />
� Schlittschuhbahn<br />
� Baseballplatz<br />
� Tennisplätze<br />
� Halfpipe verlegen<br />
� Hockey<br />
� Multifunktionale Eisfläche<br />
� Kle<strong>in</strong>spielfeld für Fe<strong>der</strong>ball<br />
� Spielerische Bedarfe:<br />
� Trampol<strong>in</strong><br />
� Spielwiese<br />
� Wasserspiele<br />
� Abenteuerspielplatz<br />
� Spielparcours<br />
� S<strong>an</strong>dkasten <strong>in</strong> mo<strong>der</strong>ner Form<br />
� Abenteuerplatz für 12 – 15jährige<br />
� W<strong>an</strong>d zum Besprühen (Wall of Fame)<br />
� S<strong>in</strong>nesweg<br />
� Pl<strong>an</strong>schbecken für Babys<br />
� Kommunikative <strong>und</strong> generationsübergreifende Angebote:<br />
� Jugendcafe<br />
� Cafe allgeme<strong>in</strong><br />
� Grillplatz<br />
� Viele Sitzgelegenheiten<br />
� Gaststätte/Bewirtung <strong>in</strong>nen <strong>und</strong> aussen<br />
� Treffpunkt „Platz <strong>der</strong> Begegnung“<br />
� Party Location<br />
� Boulebahn<br />
� Bodenschach<br />
29
� Kneipp-Anlage<br />
� M<strong>in</strong>igolf<br />
30<br />
� Freiluftbühne/Amphitheater mit Überdachung<br />
3.2.2 Sitzung 2 – Pl<strong>an</strong>ungsgr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Kle<strong>in</strong>gruppenpläne<br />
Die zweite Sitzung war auf den 24. Oktober 2001 term<strong>in</strong>iert. Zu Beg<strong>in</strong>n <strong>der</strong> Sitzung f<strong>an</strong>d e<strong>in</strong>e<br />
geme<strong>in</strong>same Geländebegehung statt bei <strong>der</strong> die Vertreter <strong>der</strong> <strong>an</strong>sässigen <strong>Sport</strong>vere<strong>in</strong>e die<br />
<strong>der</strong>zeitige Nutzung <strong>und</strong> die Probleme erläuterten. Als Ergebnis <strong>der</strong> Begehung ließen sich folgende<br />
Punkte für die Pl<strong>an</strong>ung festhalten:<br />
� Die Außenflächen s<strong>in</strong>d re<strong>in</strong> monofunktional, auf den Fußball (3 Normspielfel<strong>der</strong> <strong>und</strong><br />
e<strong>in</strong> Bolzplatz), ausgerichtet.<br />
� Die Fußballspielfel<strong>der</strong> werden stark frequentiert, wobei das Hauptspielfeld nur für<br />
Heimspiele <strong>der</strong> ersten M<strong>an</strong>nschaft benutzt werden darf.<br />
� Die Laufbahnen um das Hauptspielfeld werden schwach frequentiert <strong>und</strong> wachsen<br />
allmählich zu.<br />
� Die Aufgabe e<strong>in</strong>es Normspielfeldes bed<strong>in</strong>gt e<strong>in</strong>e qualitative Aufwertung des Best<strong>an</strong>des,<br />
um den fehlenden Platz zu kompensieren.<br />
� Die S<strong>an</strong>itäre<strong>in</strong>richtungen bef<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em baufälligen Zust<strong>an</strong>d.<br />
Im Anschluss begrüßte Herr Rößl<strong>in</strong>g die neu h<strong>in</strong>zugekommenen Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong><br />
Pl<strong>an</strong>ungsgruppe <strong>und</strong> bat sie, sich kurz vorzustellen.<br />
Herr Schra<strong>der</strong> zeigte den Anwesenden mittels Dias Anregungen <strong>und</strong> Ideen aus <strong>an</strong><strong>der</strong>en Projekten<br />
<strong>und</strong> Geme<strong>in</strong>den. Im Anschluss wurde die von <strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ungsgruppe <strong>in</strong> <strong>der</strong> ersten Sitzung<br />
erstellte Bedarfsliste ergänzt <strong>und</strong> hierarchisiert, d.h. alle Teilnehmer mussten die Bedeutung<br />
<strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen Bedarfe für das <strong>Sport</strong>- <strong>und</strong> <strong>Freizeitgelände</strong> um die H<strong>an</strong>s-<strong>Michel</strong>-<strong>Halle</strong>"<br />
mittels Fragebogen gewichten.<br />
Der letzte Tagesordnungspunkt be<strong>in</strong>haltete die Erstellung von ersten Raumkonzepten <strong>in</strong> drei<br />
homogenen Kle<strong>in</strong>gruppen. Hierbei sollten die jeweiligen Interessenvertreter die für sie als<br />
wichtig bef<strong>und</strong>enen Bedarfe dem zur Verfügung stehenden Raum zuordnen. Die drei Raumpläne<br />
wurden <strong>an</strong>schließend dem gesamten Pl<strong>an</strong>ungsgremium vorgestellt. Bei <strong>der</strong> Vorstellung<br />
ergaben sich folgende Übere<strong>in</strong>stimmung <strong>und</strong> Unterschiede:<br />
Übere<strong>in</strong>stimung:<br />
� Das Hauptspielfeld (Stadion) soll am jetzigen St<strong>an</strong>dort erhalten bleiben. E<strong>in</strong>e S<strong>an</strong>ierung<br />
(Dra<strong>in</strong>age <strong>und</strong> Beregnungs<strong>an</strong>lage) ist vorgesehen, was zu e<strong>in</strong>er Nutzungsverbesserung<br />
führt.
31<br />
� Die <strong>der</strong>zeitigen S<strong>an</strong>itäre<strong>in</strong>richtungen sowie Umkleidekab<strong>in</strong>en s<strong>in</strong>d abzureißen, da die<br />
Bausubst<strong>an</strong>z als sehr schlecht bezeichnet wurde, so dass ke<strong>in</strong>e S<strong>an</strong>ierung bzw. Renovierung<br />
möglich sei. Demnach muss e<strong>in</strong> neuer S<strong>an</strong>itärbereich erstellt werden.<br />
� E<strong>in</strong> Normspielfeld soll zu e<strong>in</strong>em Kunstrasenplatz für den Fußballsport umgestaltet<br />
werden. Dadurch entsteht Platz für die Unterbr<strong>in</strong>gung <strong>an</strong><strong>der</strong>er Bedarfe, da dieser<br />
Platz e<strong>in</strong>e deutlich höhere Frequentierung ermöglicht. Allerd<strong>in</strong>gs ist die räumliche<br />
Anordnung des Kunstrasenplatzes unterschiedlich vorgenommen worden.<br />
� Inhaltlich s<strong>in</strong>d weitere Übere<strong>in</strong>stimmungen festzustellen, die jedoch räumlich <strong>an</strong><strong>der</strong>s<br />
platziert wurden: Halfpipe, S<strong>an</strong>dspielfläche für Trendsportarten, multifunktionales<br />
Kle<strong>in</strong>spielfeld (Funcourt), R<strong>und</strong>laufstrecke, K<strong>in</strong><strong>der</strong>spielbereich, Kletterw<strong>an</strong>d, Freiluftbühne,<br />
Bouleplatz, Verb<strong>in</strong>dung zum Wiesensee, Bolzplatz.<br />
� Neugestaltung (Nutzungserweiterung) <strong>der</strong> H<strong>an</strong>s-<strong>Michel</strong>-<strong>Halle</strong>.<br />
Unterschiede:<br />
� Folgende Inhalte tauchen nicht <strong>in</strong> allen Raumplänen auf: Sprühw<strong>an</strong>d, Multihalle, Geräteschuppen,<br />
Kiosk, S<strong>in</strong>nesweg, M<strong>in</strong>igolf (auf Wiesenseegelände)<br />
� Verb<strong>in</strong>dung zum bestehenden K<strong>in</strong><strong>der</strong>spielplatz<br />
Während dieser e<strong>in</strong>stündigen Kle<strong>in</strong>gruppenarbeit f<strong>an</strong>d <strong>in</strong> allen Kle<strong>in</strong>gruppen e<strong>in</strong> offener Informations-<br />
<strong>und</strong> Me<strong>in</strong>ungsaustausch statt, <strong>der</strong> zu diesem ersten breiten Konsens führte.<br />
Des weiteren wurde <strong>an</strong>geregt, ob das <strong>Sport</strong>gelände beim BIZ nicht stärker genutzt werden<br />
könnte, da das Gelände im Gr<strong>und</strong>e genommen brach liege <strong>und</strong> somit e<strong>in</strong>e wertvolle<br />
Raumressource vergeudet würde - <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e aufgr<strong>und</strong> des bestehenden Platzm<strong>an</strong>gels.<br />
3.2.3 Sitzung 3 – Pl<strong>an</strong>ung des Gesamtgeländes <strong>in</strong> heterogenen Gruppen<br />
Die dritte Zusammenkunft <strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ungsgruppe erfolgte am 14. November 2001. Die Mo<strong>der</strong>atoren<br />
fassten die ersten Arbeitsergebnisse <strong>der</strong> letzten Sitzung kurz zusammen <strong>und</strong> stellten<br />
<strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ungsgruppe die Auswertungen <strong>der</strong> Bedarfshierarchisierung vor.
Abbildung 12: Bedarfe "Übergreifende Pl<strong>an</strong>ungsaspekte"<br />
G<strong>an</strong>zjährige Öffnung / optimale Auslastung des Geländes<br />
Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>tengerechte Gestaltung<br />
Getrennte An- <strong>und</strong> Abfahrtsw ege für den Rettnugsdienst<br />
Platzw art / Aufsicht<br />
Verbesserung <strong>der</strong> Raum- <strong>und</strong> <strong>Halle</strong>nnutzung / Vergabe<br />
Teilbereich Wiesenseegelände mitnutzen<br />
Möglichst zentrale Lage des RK- <strong>und</strong> DLRG-Gebäudes<br />
Verb<strong>in</strong>dung zum Wiesenseegelände<br />
Parkplätze multifunktional nutzen<br />
E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung des bestehenden Spielplatzes<br />
Berücksichtigung von Lärmschutzaspekten<br />
Ausgabe von Spielgeräten<br />
32<br />
(1 = unwichtig; 2 = weniger wichtig; 3 = teils/teils; 4 = wichtig; 5 = sehr wichtig)<br />
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0<br />
Übergreifende Pl<strong>an</strong>ungsaspekte erhalten tendenziell e<strong>in</strong>e hohe Zustimmung. Wichtigstes Ergebnis<br />
bei <strong>der</strong> Hierarchisierung dieser Teilrubrik ist jedoch, dass <strong>der</strong> Bedarf „g<strong>an</strong>zjährige<br />
Öffnung“ den ersten R<strong>an</strong>g belegt. Dies besagt nämlich, dass das Gelände allen <strong>Sport</strong><strong>in</strong>teressierten<br />
frei zugänglich se<strong>in</strong> soll, was zu e<strong>in</strong>er hohen Auslastung führt <strong>und</strong> die Kosten <strong>der</strong><br />
Umgestaltungsmaßnahmen rechtfertigt, da alle Bürger am <strong>Sport</strong>gelände partizipieren können.<br />
2,8<br />
3,3<br />
3,8<br />
3,8<br />
3,7<br />
3,7<br />
3,9<br />
4,2<br />
4,1<br />
4,4<br />
4,6<br />
4,6
33<br />
Abbildung 13: <strong>Sport</strong>iveBedarfe<br />
4,8<br />
4,7<br />
M ultifunktionsspielfeld für Trendsport<br />
S<strong>an</strong>ierung <strong>der</strong> Umkleide- <strong>und</strong> S<strong>an</strong>itärbereiche<br />
4,2<br />
4,2<br />
4,2<br />
Umgest altung <strong>der</strong> H<strong>an</strong>s-M ichl-<strong>Halle</strong> un M ultifunkt ionshalle<br />
Rasenplatz Stadion<br />
Bolzplatz<br />
3,7<br />
Umgest altung Hartplat z <strong>in</strong> Kunst rasenplat z<br />
3,7<br />
3,7<br />
Beachsport<strong>an</strong>lage<br />
Erhalt <strong>der</strong> Leichtathletike<strong>in</strong>richtungen<br />
3,5<br />
Erneuerung <strong>der</strong> Aschenbahn<br />
3,4<br />
3,4<br />
3,4<br />
3,4<br />
Teilbare Gymnast ikhalle<br />
Angebot für Skater<br />
Kraf t raum <strong>in</strong> <strong>der</strong> H<strong>an</strong>s-M ichl-<strong>Halle</strong><br />
Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gs- <strong>und</strong> Bolzplat z <strong>in</strong> Kunst rasenplat z umgest alt en<br />
3,3<br />
3,3<br />
Angebot für Inl<strong>in</strong>er<br />
3,2<br />
3,1<br />
T<strong>an</strong>z, Gymnastik im Erdgeschoss des <strong>Sport</strong>centers<br />
Streethockey<br />
Trimm-Dich-Pf ad<br />
2,9<br />
Tischt ennisplat t en<br />
2,9<br />
2,9<br />
Hockey<br />
Kletterw<strong>an</strong>d<br />
2,8<br />
Kle<strong>in</strong>spielfeld für Fe<strong>der</strong>ball<br />
2,6<br />
Halfpipe verlegen<br />
2,5<br />
2,5<br />
2,5<br />
M ultifunktionale Eisfläche<br />
Baseballplatz<br />
Schlittschuhbahn<br />
2,1<br />
Tennisplätze<br />
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0<br />
(1 = unwichtig; 2 = weniger wichtig; 3 = teils/teils; 4 = wichtig; 5 = sehr wichtig)
34<br />
Die Bedarfshierarchisierung bestätigt e<strong>in</strong>erseits die Erkenntnisse <strong>der</strong> Geländebegehung <strong>und</strong><br />
<strong>an</strong><strong>der</strong>erseits f<strong>in</strong>den wir die hohe Bedeutung <strong>der</strong> ersten Bedarfe <strong>in</strong> den Raumplänen <strong>der</strong><br />
Kle<strong>in</strong>gruppen wie<strong>der</strong>. Im Allgeme<strong>in</strong>en lassen sich aus <strong>der</strong> Grafik zwei Kernaussagen ableiten:<br />
E<strong>in</strong>e notwendige S<strong>an</strong>ierung des Best<strong>an</strong>des <strong>und</strong> <strong>der</strong> forcierte E<strong>in</strong>bezug für jugendliche<br />
Trendsport<strong>an</strong>gebote wird gefor<strong>der</strong>t.<br />
Und letztendlich die Aussage, welche <strong>Sport</strong><strong>an</strong>gebote für weniger attraktiv <strong>und</strong> passend für<br />
das Nutzungskonzept um die H<strong>an</strong>s-<strong>Michel</strong>-<strong>Halle</strong> gehalten werden, wie z.B. Tennisplätze,<br />
Schlittschuhbahn, eigenständiger Baseballplatz.<br />
Abbildung 14: Spielerische Bedarfe<br />
Spielw iese<br />
Abenteuerspielplatz für 12 - 15jährige<br />
S<strong>an</strong>dkasten <strong>in</strong> mo<strong>der</strong>ner Form<br />
Spielparcours<br />
Abenteuerspielplatz<br />
W<strong>an</strong>d zum Besprühen (Wall of Fame)<br />
Wasserspiele<br />
S<strong>in</strong>nesw eg<br />
Trampol<strong>in</strong><br />
Pl<strong>an</strong>schbecken für Babys<br />
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0<br />
(1 = unwichtig; 2 = weniger wichtig; 3 = teils/teils; 4 = wichtig; 5 = sehr wichtig)<br />
Die spielerischen Bedarfe – mit Ausnahme <strong>der</strong> freien Spielwiese- werden <strong>in</strong>sgesamt für weniger<br />
wichtig betrachtet. Dies korreliert sicherlich mit dem nahgelegenen K<strong>in</strong><strong>der</strong>spielplatz.<br />
2,1<br />
2,4<br />
2,5<br />
2,7<br />
2,7<br />
3,1<br />
3,5<br />
3,5<br />
3,6<br />
3,9
Abbildung 15: Sonstige / kommunikative Bedarfe<br />
Viele Sitzgelegenheiten<br />
Gaststätte / Bew irtung <strong>in</strong>nen <strong>und</strong> außen<br />
Treffpunkt "Platz <strong>der</strong> Begegnung"<br />
Freiluftbühne / Amphitheater mit Überdachung<br />
Boulebahn<br />
Jugendcafe<br />
Grillplatz<br />
Cafe allgeme<strong>in</strong><br />
Party Location<br />
Bodenschach<br />
Kneipp-Anlage<br />
M<strong>in</strong>igolf<br />
35<br />
2,0<br />
2,1<br />
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5<br />
(1 = unwichtig; 2 = weniger wichtig; 3 = teils/teils; 4 = wichtig; 5 = sehr wichtig)<br />
Die Bedarfe „M<strong>in</strong>igolf<strong>an</strong>lage“ sowie „Kneipp-Anlage“ werden <strong>in</strong> ihrer Bedeutung für das Gelände<br />
ger<strong>in</strong>g e<strong>in</strong>geschätzt. Insbeson<strong>der</strong>e die hohe Zustimmung für die ersten drei Bedarfe<br />
unterstreichen allerd<strong>in</strong>gs, dass das neue Gelände aus Sicht <strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ungsgruppenmitglie<strong>der</strong><br />
nicht nur e<strong>in</strong>e Bewegungsl<strong>an</strong>dschaft, son<strong>der</strong>n auch e<strong>in</strong>e Begegnungsstätte werden müsse.<br />
Im Anschluss <strong>an</strong> die Präsentation <strong>und</strong> Diskussion dieser Auswertungen wurde die Pl<strong>an</strong>ungsgruppe<br />
<strong>in</strong> zwei heterogene, größere Kle<strong>in</strong>gruppen aufgeteilt, die erneut den Auftrag bekamen,<br />
unter Berücksichtigung <strong>der</strong> vorgestellten Pl<strong>an</strong>ungs<strong>in</strong>formationen je e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>sames<br />
Raumkonzept zu erstellen. Hierbei sollte <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die Lage des Kunstrasens geklärt<br />
werden, da sich durch se<strong>in</strong>e Anordnung g<strong>an</strong>z unterschiedliche Raumszenarien ergeben. Das<br />
jeweilige Raumkonzept wurde <strong>an</strong>schließend im Gesamtgremium vorgestellt.<br />
Während e<strong>in</strong>e Kle<strong>in</strong>gruppe e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>samen, e<strong>in</strong>heitlichen Raumpl<strong>an</strong> als Ergebnis erzielte,<br />
konnte <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweiten Kle<strong>in</strong>gruppe h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>satzentscheidung „St<strong>an</strong>dort<br />
Kunstrasenplatz“ ke<strong>in</strong> e<strong>in</strong>heitlicher Beschluss erzielt werden. Die Gr<strong>und</strong>satzentscheidung fiel<br />
mittels Abstimmung (6 zu 4 bei e<strong>in</strong>igen Enthaltungen) zugunsten <strong>der</strong> Umgestaltung des<br />
Hartplatzes <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Kunstrasen aus.<br />
Bei <strong>der</strong> Vorstellung <strong>der</strong> beiden Raumpläne im Plenum wurde offensichtlich, dass, abgesehen<br />
von den unterschiedlichen St<strong>an</strong>dorten des Kunstrasens, e<strong>in</strong> weitgehen<strong>der</strong> Konsens über die<br />
<strong>an</strong><strong>der</strong>en Raum<strong>an</strong>gebote herrscht. Die Gr<strong>und</strong>satzfrage wurde deshalb erneut im Plenum aufgegriffen<br />
<strong>und</strong> diskutiert.<br />
2,8<br />
2,9<br />
2,9<br />
3,0<br />
3,3<br />
3,2<br />
3,2<br />
4,0<br />
4,0<br />
4,2
36<br />
Die Mo<strong>der</strong>atoren schlugen folgendes Vorgehen h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>satzentscheidung<br />
„Kunstrasen“ vor:<br />
� Vorstellung <strong>und</strong> Prüfung <strong>der</strong> beiden Pl<strong>an</strong>ungsalternativen durch Experten des <strong>Sport</strong><strong>in</strong>stituts<br />
<strong>der</strong> Universität Stuttgart, des Württembergischen L<strong>an</strong>dessportb<strong>und</strong>es, des<br />
Württembergischen Fußballverb<strong>an</strong>des (Expertenrat<strong>in</strong>g).<br />
� Auf Gr<strong>und</strong>lage <strong>der</strong> Arbeitsergebnisse <strong>und</strong> <strong>in</strong> Rücksprache mit dem von Herrn Delp<br />
<strong>und</strong> Herrn Schra<strong>der</strong> durchgeführten Expertenrat<strong>in</strong>g entwirft Herr Palm e<strong>in</strong>en Gesamtgestaltungspl<strong>an</strong><br />
als Diskussionsvorschlag für die nächste Sitzung.<br />
3.2.4 Sitzung 4 – Verabschiedung des Gesamtgestaltungspl<strong>an</strong>s<br />
Am 5. Dezember f<strong>an</strong>d die letzte Sitzung <strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ungsgruppe statt. Herr Schra<strong>der</strong> <strong>in</strong>formierte<br />
die Pl<strong>an</strong>ungsgruppe über die Ergebnisse des Expertenrat<strong>in</strong>gs h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> St<strong>an</strong>dortfrage<br />
des Kunstrasens. Die befragten Experten befürworteten e<strong>in</strong>heitlich die Umgestaltung des<br />
Rasenspielfeldes am R<strong>an</strong>de des Gesamtgeländes <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Kunstrasen aus folgenden Gründen:<br />
� Dadurch liegt das öffentliche, multifunktionale Gelände <strong>in</strong> <strong>der</strong> Mitte des Gesamtareals<br />
<strong>und</strong> die monostrukturierten Spielfel<strong>der</strong> für den Fußball besitzen e<strong>in</strong>en „e<strong>in</strong>rahmenden<br />
Charakter“, was die Zusammengehörigkeit des Geländes herausstellt. E<strong>in</strong>e Verdrängung<br />
des multifunktionalen Geländes <strong>an</strong> den R<strong>an</strong>d wirke demgegenüber wie „schmuckes<br />
Beiwerk“.<br />
� Das öffentliche, multifunktionale Teilgelände stellt für alle <strong>Hemsbach</strong>er Bürger e<strong>in</strong> attraktives<br />
Angebot dar <strong>und</strong> besitzt demnach auch e<strong>in</strong>e Sozialfunktion im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er<br />
bewegungsfre<strong>und</strong>lichen Stadtteilbegegnungsstätte. Dies wie<strong>der</strong>um spricht für die<br />
zentrale Anordnung des Teilgeländes.<br />
� Durch die zentrale Lage, <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit dem Gastronomiebereich, stellt dieser<br />
Teilabschnitt auch e<strong>in</strong>en stark frequentierten Raum dar, wodurch sich auch e<strong>in</strong>e gewünschte<br />
soziale Kontrolle entwickeln k<strong>an</strong>n.<br />
Im Anschluss stellten Herr Palm <strong>und</strong> die Mo<strong>der</strong>atoren den Teilnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Teilnehmern<br />
<strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ungsgruppe den auf <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> bisherigen Projektgruppenarbeit entworfenen<br />
Pl<strong>an</strong> zur Diskussion vor (vgl. Kapitel 4.2.). Nach <strong>der</strong> Präsentation wurden folgende Aspekte<br />
diskutiert <strong>und</strong> aufgenommen:<br />
� Stadion: Die Innensektoren s<strong>in</strong>d <strong>der</strong> leichtathletischen Gr<strong>und</strong>versorgung vorbehalten<br />
(z.B. Weit- <strong>und</strong> Hochsprung, Kugelstoßen etc.). Alternative Nutzungen wie z.B.<br />
Beachvolleyball s<strong>in</strong>d h<strong>in</strong>sichtlich ihrer räumlichen Anordnung eher am Wiesenseegelände<br />
vorzunehmen.<br />
� Die Zuschauertribüne im Stadion soll teilüberdacht se<strong>in</strong>. Diese kle<strong>in</strong>ere Tribüne soll<br />
bei (zukünftig stärkeren) Bedarf erweiterbar se<strong>in</strong>.<br />
� E<strong>in</strong>e Geländemodellierung soll als Rasenatrium konzipiert werden, so dass kle<strong>in</strong>ere<br />
kulturelle Open-Air-Ver<strong>an</strong>staltungen wie auch Spielerbesprechungen möglich s<strong>in</strong>d.
37<br />
Des weiteren unterrichtete Herr Rößl<strong>in</strong>g die Pl<strong>an</strong>ungsgruppe über das weitere Vorgehen im<br />
Projekt. Bis Mitte J<strong>an</strong>uar 2002 erfolgt die Erstellung des Abschlussberichts durch die Mo<strong>der</strong>atoren.<br />
Der Bericht wird allen Geme<strong>in</strong><strong>der</strong>äten sowie den Mitglie<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ungsgruppe<br />
zuges<strong>an</strong>dt. Ende Februar 2002 wird die Arbeit <strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ungsgruppe sowie <strong>der</strong> entwickelte<br />
Gesamtgestaltungspl<strong>an</strong> im Geme<strong>in</strong><strong>der</strong>at <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er öffentlichen Sitzung vorgestellt.
38<br />
4 Ergebnis des Pl<strong>an</strong>ungsprozesses – <strong>der</strong> Gesamtgestaltungs-<br />
pl<strong>an</strong><br />
4.1 Der <strong>der</strong>zeitige Ist-St<strong>an</strong>d des <strong>Sport</strong>geländes um die H<strong>an</strong>s-<strong>Michel</strong>-<strong>Halle</strong>
4.2 Kommentierte Darstellung des Gesamtgestaltungspl<strong>an</strong>s<br />
Gesamtgelände betreffend:<br />
� F<strong>in</strong>nenlaufbahn<br />
41<br />
Das Gesamtgelände wird von e<strong>in</strong>er F<strong>in</strong>nenlaufbahn („naturnahe Laufstrecke“) erschlossen<br />
(nach Möglichkeit beleuchtet). Die Strecke besitzt e<strong>in</strong>e Verb<strong>in</strong>dung zum Wiesenseegelände.<br />
� Verb<strong>in</strong>dung zum Wiesenseegelände<br />
E<strong>in</strong>e Verb<strong>in</strong>dung zum Wiesenseegelände ist von großer Bedeutung – e<strong>in</strong>erseits um den<br />
Spielplatz zu vernetzen <strong>und</strong> <strong>an</strong><strong>der</strong>erseits besitzt das Wiesenseegelände e<strong>in</strong>en hohen<br />
Freizeitwert <strong>und</strong> ist zukünftig <strong>in</strong> e<strong>in</strong> größeres Raumkonzept zu <strong>in</strong>tegrieren. Deshalb ist e<strong>in</strong>e<br />
gefahrlose Überquerung <strong>der</strong> Straße sicherzustellen.<br />
� Parkplätze<br />
Hochbauten betreffend:<br />
� Vere<strong>in</strong>sheim<br />
(Gebäude mit Sem<strong>in</strong>arraum, M<strong>an</strong>agement für <strong>Sport</strong>areal, Geschäftsstelle etc.)<br />
� Gastronomie mit Außenbewirtung<br />
Die Gaststätte k<strong>an</strong>n <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Gebäudekomplex (Verb<strong>in</strong>dung mit Vere<strong>in</strong>sheim <strong>und</strong> S<strong>an</strong>itär/Umkleiden)<br />
erstellt werden. Die Außenterrasse ist als „zentraler Kommunikationsplatz“<br />
<strong>an</strong>gedacht, von dem aus die e<strong>in</strong>zelnen <strong>Sport</strong>räume e<strong>in</strong>sichtig s<strong>in</strong>d.<br />
� S<strong>an</strong>itär- <strong>und</strong> Umkleidegebäude<br />
Die bestehende E<strong>in</strong>richtung soll aufgr<strong>und</strong> des schlechten Bauzust<strong>an</strong>ds abgerissen werden.<br />
Der Neubau soll als Anbau <strong>an</strong> die <strong>Sport</strong>halle o<strong>der</strong> als eigenständiges Gebäude realisiert<br />
werden.<br />
� H<strong>an</strong>s-<strong>Michel</strong>-<strong>Halle</strong><br />
Integration von Multifunktionsräumen (Gymnastik-/T<strong>an</strong>z, Kraftraum, Foyer/Cafe), Kletterw<strong>an</strong>d<br />
außen.
Außen<strong>an</strong>lagen betreffend:<br />
Fußballspezifische Bereiche:<br />
42<br />
Die fußballspezifischen Bereiche umfassen das Stadion, e<strong>in</strong>en Kunstrasenplatz <strong>und</strong> Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsfeld.<br />
� Hauptspielfeld Stadion<br />
Das Stadion erhält e<strong>in</strong>e qualitative Aufwertung durch e<strong>in</strong>e Dra<strong>in</strong>age <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Beregnungs<strong>an</strong>lage,<br />
sowie die S<strong>an</strong>ierung <strong>der</strong> 400m-Bahn für den Breiten- <strong>und</strong> Wettkampfsport<br />
<strong>und</strong> die Umgestaltung <strong>der</strong> Innensektoren für Leichtathletik.<br />
� Kunstrasenplatz<br />
Der bestehenden Fußballplatz soll <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Kunstrasenplatz mit Flutlicht umgestaltet<br />
werden. Um den Kunstrasenplatz können Sitz- <strong>und</strong> Zuschauerplätze <strong>an</strong>gelegt werden.<br />
� Kle<strong>in</strong>es Rasenspielfeld<br />
Dieses Spielfeld dient e<strong>in</strong>erseits als Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsplatz für den Vere<strong>in</strong>ssport, als Bolzplatz für<br />
den Freizeitsport <strong>und</strong> k<strong>an</strong>n ebenso für Faustball etc. verwendet werden.<br />
Familienorientierter Bereich:<br />
Dieser Funktionsbereich be<strong>in</strong>haltet folgende generationsübergreifenden Angebote: e<strong>in</strong>e<br />
Spiel- <strong>und</strong> Liegewiese, e<strong>in</strong>en Bouleplatz, e<strong>in</strong>e Tischtennisarena, e<strong>in</strong>en K<strong>in</strong><strong>der</strong>spielbereich<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Grillstelle. Durch die kompakte, nebene<strong>in</strong><strong>an</strong><strong>der</strong> liegende Anordnung dieser Raum<strong>an</strong>gebote<br />
ist e<strong>in</strong> schneller Wechsel <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en <strong>an</strong><strong>der</strong>en Bereich möglich <strong>und</strong> die Aufsicht vere<strong>in</strong>facht.<br />
Durch die Integration e<strong>in</strong>iger Angebote <strong>in</strong> die Geländemodellierung <strong>und</strong> die Bepfl<strong>an</strong>zung<br />
ist je<strong>der</strong> Raum für sich dennoch e<strong>in</strong> heimeliges Kle<strong>in</strong>od.<br />
Neben <strong>der</strong> „fließenden Trennungsfunktion“ besitzt die Geländemodulation e<strong>in</strong>e Lärm- <strong>und</strong><br />
Sichtschutzfunktion zu <strong>der</strong> Wohnbebauung. Daher s<strong>in</strong>d hier auch die geräuscharmen Nutzungen<br />
vorgesehen.<br />
� Spiel- <strong>und</strong> Liegewiese<br />
Die Spiel- <strong>und</strong> Liegewiese bietet vielen Spiel- <strong>und</strong> Bewegungsaktivitäten e<strong>in</strong> Raum<strong>an</strong>gebot:<br />
Neue asiatische Bewegungsformen, Gymnastik im Freien, Spiele wie Foulei etc.,<br />
Frisbee, Indiaka etc.<br />
Durch e<strong>in</strong>e Bepfl<strong>an</strong>zung soll <strong>der</strong> Charakter dieses Raum<strong>an</strong>gebots offensichtlich gemacht<br />
werden.
� Grillplatz<br />
43<br />
Der Grillplatz k<strong>an</strong>n als mobile Grillstelle o<strong>der</strong> als fest <strong>in</strong>stallierter Grill <strong>an</strong>gelegt werden.<br />
� Tischtennisarena<br />
� Bouleplatz<br />
Der Bouleplatz entsteht durch die Öffnung des Weges <strong>und</strong> ist <strong>in</strong> die Geländemodellierung<br />
e<strong>in</strong>gefasst. Neben Sitzbänken schafft e<strong>in</strong>e Bepfl<strong>an</strong>zung „Wohlfühlatmosphäre“.<br />
� Naturnaher K<strong>in</strong><strong>der</strong>spielbereich<br />
Naturnah gestalteter Spielberg (ev. mit Matchbereich) mit verschiedenen Auf- <strong>und</strong> Abstiegsmöglichkeiten<br />
(z.B. F<strong>in</strong>dl<strong>in</strong>ge; Holzpalisaden etc.) zum F<strong>an</strong>gen, Verstecken, Bal<strong>an</strong>cieren,<br />
Klettern etc.<br />
Trendsportbereich:<br />
Der Trendsportbereich umfasst e<strong>in</strong>en Funcourt, e<strong>in</strong> multifunktionales Asphaltfeld <strong>und</strong> die<br />
Halfpipe (Anlage versetzen). In <strong>der</strong> Mitte dieser Angebote wird e<strong>in</strong>e sternförmige Modellierung<br />
vorgesehen. Sie ist als Jugendtreffpunkt gestaltet <strong>und</strong> dient als erhöhte Fläche zum Zuschauen.<br />
� Multifunktionales Asphaltfeld<br />
Die Asphaltfläche wird für die jugendgerechte Rollkultur benötigt wie z.B. Inl<strong>in</strong>ehockey.<br />
Das Spielfeld ist so zu bauen, dass es bei kalten W<strong>in</strong>tern als Eisfläche nutzbar ist. Neben<br />
Inl<strong>in</strong>ehockey k<strong>an</strong>n hier bei Bedarf auch Streetball <strong>und</strong> Streetsoccer gespielt werden.<br />
� Halfpipe<br />
Die <strong>an</strong> den Tennisplätzen gelegene Halfpipe soll <strong>in</strong> den Trendsportbereich <strong>in</strong>tegriert werden.<br />
� Funcourt<br />
Multifunktionales Kle<strong>in</strong>spielfeld für verschiedene Spiel- <strong>und</strong> Bewegungsmöglichkeiten.<br />
4.3 Bewertung des Gesamtgestaltungspl<strong>an</strong>s<br />
Der von <strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ungsgruppe verabschiedete Gesamtgestaltungspl<strong>an</strong> soll im folgenden aus<br />
sportwissenschaftlicher Perspektive <strong>an</strong>alysiert werden. Diese E<strong>in</strong>schätzung bezieht sich auf<br />
e<strong>in</strong>e allgeme<strong>in</strong>e Bewertung <strong>der</strong> Gesamt<strong>an</strong>lage <strong>und</strong> auf e<strong>in</strong> vom Projektteam des Instituts für<br />
<strong>Sport</strong>wissenschaft entwickeltes Bewertungsraster, das e<strong>in</strong>e qualitative Bewertung von <strong>Sport</strong>stätten<br />
ermöglicht, <strong>in</strong>dem es sich <strong>an</strong> den oben gen<strong>an</strong>nten H<strong>an</strong>dlungsleitl<strong>in</strong>ien orientiert.
4.3.1 Allgeme<strong>in</strong>e Bewertung:<br />
44<br />
Die Gesamt<strong>an</strong>lage ist so konzipiert, dass sie e<strong>in</strong>em breitgefächerten Spektrum <strong>der</strong> Bevölkerung<br />
nicht nur sportliche, son<strong>der</strong>n auch spielerische, regenerative <strong>und</strong> kommunikative Nutzungsmöglichkeiten<br />
bietet. Somit s<strong>in</strong>d aus sportsoziologischer <strong>und</strong> pädagogischer Perspektive<br />
die pl<strong>an</strong>erischen Voraussetzungen gegeben, dass sich das "<strong>Sport</strong>- <strong>und</strong> <strong>Freizeitgelände</strong><br />
um die H<strong>an</strong>s-<strong>Michel</strong>-<strong>Halle</strong>" für die Bevölkerung vor Ort zu e<strong>in</strong>er altersübergreifenden Begegnungsstätte<br />
entwickeln k<strong>an</strong>n, die <strong>Sport</strong>, Spiel <strong>und</strong> Bewegung für alle Gesellschaftsteile bereithält.<br />
Das e<strong>in</strong>g<strong>an</strong>gs formulierte Ziel e<strong>in</strong>er zukunftsorientierten <strong>Sport</strong>stättenpl<strong>an</strong>ung, vielfältig<br />
nutzbare, attraktive <strong>und</strong> am lokalen <strong>Sport</strong>bedarf orientierte Bewegungsräume für Menschen<br />
unterschiedlicher Interessen <strong>und</strong> jeden Alters zu schaffen, ist <strong>in</strong> dem <strong>Hemsbach</strong>er<br />
Projekt erfüllt.<br />
Die wegweisenden Qualitäten <strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ung liegen <strong>in</strong> folgenden, hier nur stichwortartig aufgeführten<br />
Punkten:<br />
� Es entsteht e<strong>in</strong> Platz zum <strong>Sport</strong>treiben für die g<strong>an</strong>ze Familie <strong>und</strong> für alle Generationen<br />
mit zielgruppenorientierten Schwerpunktbildungen. Auch für die immer größer<br />
werdende Gruppe <strong>der</strong> “neuen” <strong>und</strong> noch sehr aktiven “Alten” wurden Räume für Bewegung<br />
<strong>und</strong> Kommunikation gepl<strong>an</strong>t.<br />
� Es entsteht e<strong>in</strong> Platz für K<strong>in</strong><strong>der</strong>, <strong>der</strong> e<strong>in</strong>fache naturnahe Angebote bietet. Insbeson<strong>der</strong>e<br />
die große freie Spielwiese for<strong>der</strong>t zur Selbständigkeit <strong>und</strong> Selbsttätigkeit auf. Zudem<br />
ist die räumliche Nähe zum bestehenden K<strong>in</strong><strong>der</strong>spielplatz zu nennen, <strong>der</strong> motorische<br />
Gr<strong>und</strong>tätigkeiten <strong>und</strong> Erfahrungen im Umg<strong>an</strong>g mit natürlichen Materialien ermöglicht.<br />
� Es entsteht e<strong>in</strong> Platz für die Jugend. Sie erhält hier den Raum, <strong>der</strong> ihr <strong>an</strong><strong>der</strong>norts oft<br />
verwehrt wird. Sie f<strong>in</strong>det eigene Treffpunkte <strong>und</strong> beliebte, jugendkulturelle <strong>und</strong> sportive<br />
Angebote vor. Bei den Trendsportarten f<strong>in</strong>den gerade diejenigen Berücksichtigung,<br />
die weit über die Zielgruppe <strong>der</strong> Jugendlichen h<strong>in</strong>aus zahlreiche Anhänger gef<strong>und</strong>en<br />
haben. Mit dieser Konzeption wird die heute deutlich beobachtbare Tendenz<br />
bei Jugendlichen zwischen 12 <strong>und</strong> 20 Jahren berücksichtigt, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Freizeit nicht nur<br />
e<strong>in</strong>e <strong>Sport</strong>art dauerhaft <strong>und</strong> wettkampforientiert zu betreiben, son<strong>der</strong>n stattdessen<br />
<strong>und</strong> d<strong>an</strong>eben vielfältig expressive Erfahrungen mit dem eigenen Körper, mit Bewegung<br />
<strong>und</strong> <strong>Sport</strong> zu machen, <strong>und</strong> dabei so ungeb<strong>und</strong>en wie möglich zu bleiben.<br />
� Es entsteht e<strong>in</strong> Platz, <strong>der</strong> traditionelles <strong>Sport</strong>treiben <strong>und</strong> neue Trends, org<strong>an</strong>isierten<br />
<strong>Sport</strong> im Vere<strong>in</strong>, Schulsport <strong>und</strong> freies <strong>Sport</strong>treiben <strong>in</strong> gleichem Maße ermöglicht.<br />
Dieses Nebene<strong>in</strong><strong>an</strong><strong>der</strong> verschiedener <strong>Sport</strong>praktiken stellt e<strong>in</strong>en zentralen Maßstab<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Qualität zukünftiger <strong>Sport</strong><strong>an</strong>lagen dar. Diesem Anspruch entspricht e<strong>in</strong>erseits<br />
die Gesamt<strong>an</strong>lage mit ihren vielfältigen <strong>und</strong> <strong>in</strong> unmittelbarer Nachbarschaft zue<strong>in</strong><strong>an</strong><strong>der</strong><br />
liegenden Bereichen <strong>und</strong> <strong>an</strong><strong>der</strong>erseits <strong>der</strong> Anb<strong>in</strong>dung <strong>an</strong> den Wiesensee, <strong>der</strong> e<strong>in</strong><br />
f<strong>an</strong>tastisches Erweiterungsgelände darstellt. Durch diese Verb<strong>in</strong>dung können aus<br />
dem gepl<strong>an</strong>ten <strong>Sport</strong>- <strong>und</strong> Bewegungsraum wichtige Impulse für die Weiterentwicklung<br />
des Schulsports o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Vere<strong>in</strong>s<strong>an</strong>gebote hervorgehen.<br />
� Es entsteht e<strong>in</strong> Treffpunkt <strong>und</strong> Begegnungsraum, <strong>der</strong> auch zu Ruhe, Kommunikation<br />
<strong>und</strong> Erholung e<strong>in</strong>lädt. Alle E<strong>in</strong>zelbereiche be<strong>in</strong>halten auch Gelegenheiten zum Sitzen,<br />
Reden <strong>und</strong> Zuschauen, sei es <strong>in</strong> den eigens <strong>an</strong>gelegten Treffpunkten, sei es auf den
45<br />
vielen Geländemodellierungen, die das große Gelände glie<strong>der</strong>n <strong>und</strong> damit auch optisch<br />
attraktiv machen.<br />
� Es entsteht e<strong>in</strong> kompaktes <strong>Sport</strong>- <strong>und</strong> Bewegungsareal, das alle diese Funktionen<br />
auf engem Raum erfüllt. Gerade die räumliche Nähe <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen Bereiche <strong>und</strong> Altersgruppen<br />
verh<strong>in</strong><strong>der</strong>t das Entstehen separater Räume, die unverb<strong>und</strong>en nebene<strong>in</strong><strong>an</strong><strong>der</strong><br />
stehen. Die offene Gestaltung des Geländes ermöglicht dagegen immer e<strong>in</strong><br />
Überwechseln von e<strong>in</strong>em Bereich <strong>in</strong> den <strong>an</strong><strong>der</strong>en, schafft die Neugier zum Erproben<br />
<strong>an</strong><strong>der</strong>er <strong>und</strong> unbek<strong>an</strong>nter Spiel-, <strong>Sport</strong>- <strong>und</strong> Bewegungsformen <strong>und</strong> för<strong>der</strong>t damit die<br />
Bereitschaft, sich l<strong>an</strong>gfristig sportlich zu betätigen.<br />
Zusammenfassend entsteht e<strong>in</strong> Platz, <strong>der</strong> die oben erwähnten Gestaltungspr<strong>in</strong>zipien für e<strong>in</strong>e<br />
zukunftsorientierte <strong>Sport</strong>stättengestaltung voll erfüllt. Diese Aussage soll mit Hilfe e<strong>in</strong>er qualitativen<br />
Analyse weiter untersucht <strong>und</strong> differenziert werden:<br />
4.3.2 Qualitative Bewertung <strong>der</strong> H<strong>an</strong>dlungsleitl<strong>in</strong>ien<br />
Dieses vom Institut für <strong>Sport</strong>wissenschaft entwickelte <strong>und</strong> auf <strong>der</strong> Methode des Expertenrat<strong>in</strong>gs<br />
beruhende Analyseverfahren ermöglicht e<strong>in</strong>e Bewertung <strong>der</strong> H<strong>an</strong>dlungsleitl<strong>in</strong>ien. Diese<br />
werden hierzu <strong>in</strong> abgrenzbare Teilaspekte ausdifferenziert <strong>und</strong> beurteilt.
H<strong>an</strong>dlungsleitl<strong>in</strong>ien Differenzierung<br />
Vielfältigkeit<br />
Alters- <strong>und</strong> generationsübergreifende<br />
Gestaltung<br />
Vielfältigkeit/Multifunktionalität e<strong>in</strong>zelner Angebote<br />
Verb<strong>in</strong>dung von Kommunikation <strong>und</strong> Bewegung:<br />
Treffpunktcharakter<br />
Vielfältigkeit <strong>der</strong> Gesamt<strong>an</strong>lage 0<br />
Angebote für alle Altersgruppen +<br />
Angebote für geme<strong>in</strong>same Aktivitäten 0<br />
Fließen<strong>der</strong> Überg<strong>an</strong>g <strong>und</strong> räumliche Nähe<br />
gruppenspezifischer Angebote<br />
Ökologische Gestaltung Naturnahe Spiel- <strong>und</strong> Kommunikationsräume +<br />
Verän<strong>der</strong>barkeit<br />
Bewegungs- <strong>und</strong><br />
Erlebnis<strong>in</strong>tensität<br />
Offenheit<br />
E<strong>in</strong>bezug von Geländemodellierungen als<br />
Spiel- <strong>und</strong> Bewegungsraum<br />
Verän<strong>der</strong>barkeit von K<strong>in</strong><strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendbereichen<br />
durch die Nutzer<br />
Erlebnis<strong>in</strong>tensive Angebote für K<strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>und</strong><br />
Jugendliche<br />
Hoher Auffor<strong>der</strong>ungscharakter des Gesamtgeländes<br />
für Bewegung<br />
Offenheit des Geländes <strong>und</strong> <strong>der</strong> Angebote für<br />
Nichtmitglie<strong>der</strong><br />
E<strong>in</strong>fachheit Angebote mit ger<strong>in</strong>gen f<strong>in</strong><strong>an</strong>ziellen Mitteln zu<br />
erbauen<br />
Erreichbarkeit <strong>und</strong> Vernetzung<br />
E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> das örtliche Fuß- <strong>und</strong> Radwegenetz<br />
sowie gefahrlose Erreichbarkeit<br />
Ästhetische Gestaltung Atmosphäre schaffende Maßnahmen +<br />
+<br />
+<br />
+<br />
+<br />
+<br />
0<br />
0<br />
+<br />
0<br />
+
5 Literaturverzeichnis<br />
- 47 -<br />
BLINKERT, B.: Aktionsräume von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>in</strong> <strong>der</strong> Stadt. Pfaffenweiler 1993.<br />
GROSS, P.: Multioptionsgesellschaft. Fr<strong>an</strong>kfurt/Ma<strong>in</strong> 1994.<br />
HEINEMANN, K./SCHUBERT, M.: Der <strong>Sport</strong>vere<strong>in</strong>. Schorndorf 1994.<br />
HEINEMANN, K.: E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> die Soziologie des <strong>Sport</strong>s. Schorndorf 1998 4 .<br />
HÜBNER, H.: Von lokalen <strong>Sport</strong>verhaltensstudien zur kommunalen <strong>Sport</strong>stättenentwicklungspl<strong>an</strong>ung.<br />
Beiträge zu e<strong>in</strong>er zeitgemäßen kommunalen <strong>Sport</strong>entwicklung. Münster 1994.<br />
KUNZ, T.: Weniger Unfälle durch Bewegung. Schorndorf 1993.<br />
LEYENDECKER, B.: Die Invasion frem<strong>der</strong> Arten - E<strong>in</strong> historischer Überblick über den W<strong>an</strong>del des<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>spiels <strong>in</strong> den Straßen <strong>der</strong> Stadt. In: Brettschnei<strong>der</strong>, W.-D./Baur, J./Bräutigam, M. (Hrsg.):<br />
Bewegungswelt von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>und</strong> Jugendlichen. Schorndorf 1989, 329-337.<br />
OPASCHOWSKI, H.W.: Deutschl<strong>an</strong>d 2010. Wie wir morgen leben – Voraussagen <strong>der</strong> Wissenschaft<br />
zur Zukunft unserer Gesellschaft. Hamburg 1997.<br />
ROLFF, H.G./ZIMMERMANN, P.: K<strong>in</strong>dheit im W<strong>an</strong>del. We<strong>in</strong>heim 1985.<br />
ROLFF, H.G.: Massenkonsum, Massenmedien <strong>und</strong> Massenkultur - Über den W<strong>an</strong>del k<strong>in</strong>dlicher Aneignungsweisen.<br />
In: Preuss-Lausitz u.a. (Hrsg.): Kriegsk<strong>in</strong><strong>der</strong>, Konsumk<strong>in</strong><strong>der</strong>, Krisenk<strong>in</strong><strong>der</strong>. Zur<br />
Sozialisationsgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg. We<strong>in</strong>heim 19913 , 153-167.<br />
RÜTTEN, A.: Kooperative Pl<strong>an</strong>ung – e<strong>in</strong> umsetzungsorientiertes <strong>Sport</strong>stättenentwicklungskonzept. In:<br />
RÜTTEN, A./ROSSKOPF, P.: (Hrsg.): Raum für Bewegung <strong>und</strong> <strong>Sport</strong>. Zukunftsperspektiven<br />
<strong>der</strong> <strong>Sport</strong>stättenentwicklung. Stuttgart 1998, 41–51.<br />
SCHEMEL, H.-J./STRASDAS, W.: Bewegungsraum Stadt. Bauste<strong>in</strong>e zur Schaffung umweltfre<strong>und</strong>licher<br />
<strong>Sport</strong>- <strong>und</strong> Spielgelegenheiten. Aachen 1998.<br />
WETTERICH, J./KLOPFER, M.: Kooperative Pl<strong>an</strong>ung <strong>und</strong> <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>äre Beratung. In: WIELAND,<br />
H./SENGLE, A. (Hrsg.): Familienfre<strong>und</strong>licher <strong>Sport</strong>platz. E<strong>in</strong> Modellprojekt. Stuttgart 1995, 14–<br />
21.<br />
WETTERICH, J./WIELAND, H.: Von <strong>der</strong> qu<strong>an</strong>titativen zur qualitativen <strong>Sport</strong>stättenpl<strong>an</strong>ung das Modellprojekt<br />
Familienfre<strong>und</strong>licher <strong>Sport</strong>platz. In: Olympische Jugend 40 (1995), 6, 12–17.<br />
WIELAND, H./RÜTTEN, A.: <strong>Sport</strong> <strong>und</strong> Freizeit <strong>in</strong> Stuttgart. E<strong>in</strong>e sozialempirische Erhebung zur <strong>Sport</strong>nachfrage<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Großstadt. Stuttgart 1991.<br />
WIELAND, H.: Wissenschaftliche Gr<strong>und</strong>lagen <strong>der</strong> Projektkonzeption. In: WIELAND, H./SENGLE, A.<br />
(Hrsg.): Familienfre<strong>und</strong>licher <strong>Sport</strong>platz. E<strong>in</strong> Modellprojekt. Stuttgart 1995.<br />
WIELAND, H./WETTERICH, J./KLOPFER, M./SCHRADER, H.: Spiel-, <strong>Sport</strong>- <strong>und</strong> Bewegungsräume<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Stadt. Aspekte e<strong>in</strong>er zukunftsorientierten Infrastrukturpl<strong>an</strong>ung von <strong>Sport</strong>stätten unter dem<br />
Leitbild e<strong>in</strong>er menschengerechten Stadt. Forschungsbericht für die Württembergische <strong>Sport</strong>jugend,<br />
Stuttgart 1999.<br />
ZEIHER, H.: Die vielen Räume <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>. Zum W<strong>an</strong>del räumlicher Lebensbed<strong>in</strong>gungen seit 1945. In:<br />
PREUSS-LAUSITZ, U. u.a. (Hrsg.): Kriegsk<strong>in</strong><strong>der</strong>, Konsumk<strong>in</strong><strong>der</strong>, Krisenk<strong>in</strong><strong>der</strong>. We<strong>in</strong>heim/Basel<br />
19913 , 176 - 195.<br />
ZINNECKER, J.: Straßensozialisation. Versuch, e<strong>in</strong>en unterschätzten Lernort zu thematisieren. In:<br />
Zeitschrift für Pädagogik, 25 (1979), 5, 727 - 746.