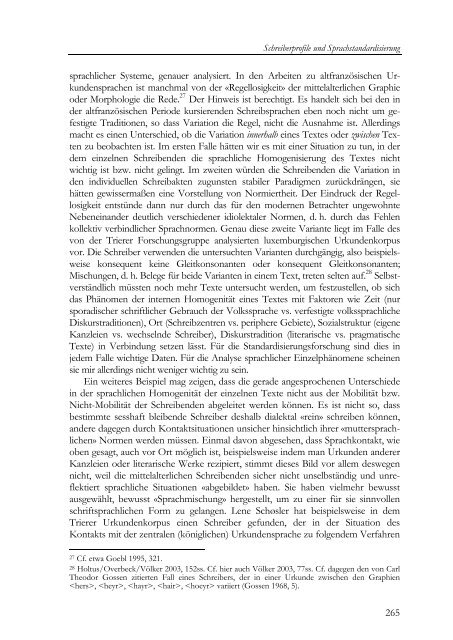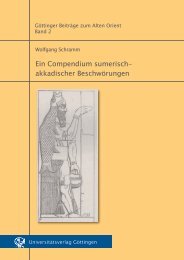Historische Pragmatik und historische Varietätenlinguistik ...
Historische Pragmatik und historische Varietätenlinguistik ...
Historische Pragmatik und historische Varietätenlinguistik ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Schreiberprofile <strong>und</strong> Sprachstandardisierung<br />
sprachlicher Systeme, genauer analysiert. In den Arbeiten zu altfranzösischen Urk<strong>und</strong>ensprachen<br />
ist manchmal von der «Regellosigkeit» der mittelalterlichen Graphie<br />
oder Morphologie die Rede. 27 Der Hinweis ist berechtigt. Es handelt sich bei den in<br />
der altfranzösischen Periode kursierenden Schreibsprachen eben noch nicht um gefestigte<br />
Traditionen, so dass Variation die Regel, nicht die Ausnahme ist. Allerdings<br />
macht es einen Unterschied, ob die Variation innerhalb eines Textes oder zwischen Texten<br />
zu beobachten ist. Im ersten Falle hätten wir es mit einer Situation zu tun, in der<br />
dem einzelnen Schreibenden die sprachliche Homogenisierung des Textes nicht<br />
wichtig ist bzw. nicht gelingt. Im zweiten würden die Schreibenden die Variation in<br />
den individuellen Schreibakten zugunsten stabiler Paradigmen zurückdrängen, sie<br />
hätten gewissermaßen eine Vorstellung von Normiertheit. Der Eindruck der Regellosigkeit<br />
entstünde dann nur durch das für den modernen Betrachter ungewohnte<br />
Nebeneinander deutlich verschiedener idiolektaler Normen, d. h. durch das Fehlen<br />
kollektiv verbindlicher Sprachnormen. Genau diese zweite Variante liegt im Falle des<br />
von der Trierer Forschungsgruppe analysierten luxemburgischen Urk<strong>und</strong>enkorpus<br />
vor. Die Schreiber verwenden die untersuchten Varianten durchgängig, also beispielsweise<br />
konsequent keine Gleitkonsonanten oder konsequent Gleitkonsonanten;<br />
Mischungen, d. h. Belege für beide Varianten in einem Text, treten selten auf. 28 Selbstverständlich<br />
müssten noch mehr Texte untersucht werden, um festzustellen, ob sich<br />
das Phänomen der internen Homogenität eines Textes mit Faktoren wie Zeit (nur<br />
sporadischer schriftlicher Gebrauch der Volkssprache vs. verfestigte volkssprachliche<br />
Diskurstraditionen), Ort (Schreibzentren vs. periphere Gebiete), Sozialstruktur (eigene<br />
Kanzleien vs. wechselnde Schreiber), Diskurstradition (literarische vs. pragmatische<br />
Texte) in Verbindung setzen lässt. Für die Standardisierungsforschung sind dies in<br />
jedem Falle wichtige Daten. Für die Analyse sprachlicher Einzelphänomene scheinen<br />
sie mir allerdings nicht weniger wichtig zu sein.<br />
Ein weiteres Beispiel mag zeigen, dass die gerade angesprochenen Unterschiede<br />
in der sprachlichen Homogenität der einzelnen Texte nicht aus der Mobilität bzw.<br />
Nicht-Mobilität der Schreibenden abgeleitet werden können. Es ist nicht so, dass<br />
bestimmte sesshaft bleibende Schreiber deshalb dialektal «rein» schreiben können,<br />
andere dagegen durch Kontaktsituationen unsicher hinsichtlich ihrer «muttersprachlichen»<br />
Normen werden müssen. Einmal davon abgesehen, dass Sprachkontakt, wie<br />
oben gesagt, auch vor Ort möglich ist, beispielsweise indem man Urk<strong>und</strong>en anderer<br />
Kanzleien oder literarische Werke rezipiert, stimmt dieses Bild vor allem deswegen<br />
nicht, weil die mittelalterlichen Schreibenden sicher nicht unselbständig <strong>und</strong> unreflektiert<br />
sprachliche Situationen «abgebildet» haben. Sie haben vielmehr bewusst<br />
ausgewählt, bewusst «Sprachmischung» hergestellt, um zu einer für sie sinnvollen<br />
schriftsprachlichen Form zu gelangen. Lene Schøsler hat beispielsweise in dem<br />
Trierer Urk<strong>und</strong>enkorpus einen Schreiber gef<strong>und</strong>en, der in der Situation des<br />
Kontakts mit der zentralen (königlichen) Urk<strong>und</strong>ensprache zu folgendem Verfahren<br />
27 Cf. etwa Goebl 1995, 321.<br />
28 Holtus/Overbeck/Völker 2003, 152ss. Cf. hier auch Völker 2003, 77ss. Cf. dagegen den von Carl<br />
Theodor Gossen zitierten Fall eines Schreibers, der in einer Urk<strong>und</strong>e zwischen den Graphien<br />
, , , , variiert (Gossen 1968, 5).<br />
265