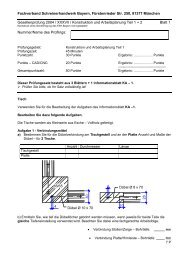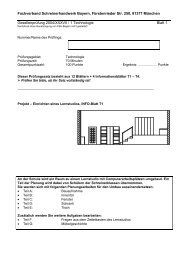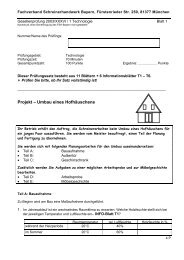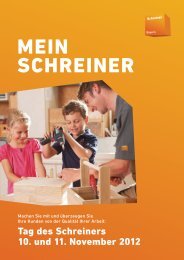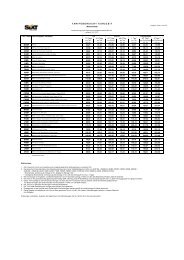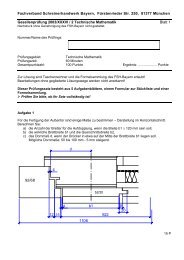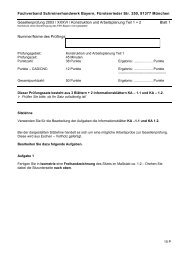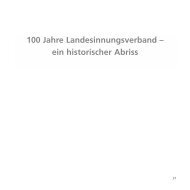Historischer Exkurs - Schreinerhandwerk Bayern
Historischer Exkurs - Schreinerhandwerk Bayern
Historischer Exkurs - Schreinerhandwerk Bayern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Historischer</strong> <strong>Exkurs</strong><br />
Die Entwicklung des Handwerks und seiner Organisationen seit dem Mittelalter<br />
Von Eckhard Heyelmann<br />
Der goldene Boden<br />
Das städtische Handwerk war<br />
vom Spätmittelalter bis zur Einführung<br />
der Gewerbefreiheit im 19.<br />
Jahrhundert in Interessenvereinigungen,<br />
den Zünften, organisiert. Diese<br />
garantierten ökonomische und soziale<br />
Sicherheit, berufliche Bildung,<br />
handwerkliche Erfahrung und Tradition,<br />
kulturelle Identität und religiöse<br />
Gemeinschaft. Gleichzeitig fungierten<br />
die Zünfte mit Unterstützung<br />
der Städte und Landesfürsten<br />
als Instrumente städtischer Wirtschaftspolitik,<br />
indem sie die Versorgung<br />
der Bevölkerung gewährleisteten<br />
und Kunden sowie Käufer vor<br />
finanzieller Übervorteilung schützten.<br />
Mittel dieses marktbeherrschenden<br />
und politischen Einflusses<br />
waren zum einen der den Zünften<br />
verliehene sogenannte „Zunftzwang“.<br />
Darunter wurde das Recht<br />
verstanden, jeden Handwerker, der<br />
ein Zunftgewerbe betrieb, zum Eintritt<br />
in die Zunft und zur Einhaltung<br />
der „Zunftstatuten“ zu zwingen.<br />
Als Ordnungsinstitutionen regelten<br />
die Zünfte bis ins Kleinste die<br />
berufliche Tätigkeit ihrer Mitglieder,<br />
die von der Privatsphäre nicht zu<br />
trennen war. Sie legten die gültigen<br />
Ausbildungsrichtlinien und die<br />
Anforderungen für Gesellen- und<br />
Meisterprüfung fest, regelten die<br />
Konkurrenz durch strenge Niederlassungsbestimmungen,<br />
bestimmten<br />
die Arbeitszeit, den Werkstoffeinkauf,<br />
die Menge und Qualität der<br />
Warenproduktion, grenzten den<br />
Bereich der verschiedenen Arbeitsgebiete<br />
ab, traten als Schiedsstelle<br />
bei Streitigkeiten auf und waren<br />
Sprachrohr und Vermittler gegenüber<br />
der Obrigkeit . Der Geltungsbereich<br />
der schriftlich niedergelegten<br />
Zunftordnungen erstreckte sich prinzipiell<br />
auf alle im Handwerk Tätigen,<br />
Verstöße dagegen wurden hart<br />
geahndet. Die außerzünftigen „Pfuscher“,<br />
“Stümper“ oder „Störer“<br />
standen abseits vom Schutz der<br />
Gemeinschaft und wurden von dieser<br />
mit unterschiedlichem Erfolg<br />
bekämpft und bestraft. In den<br />
Landstädten und –märkten fand das<br />
Zunftsystem der großen Städte und<br />
Residenzen in eigenen Verbänden<br />
seinen Niederschlag.<br />
Im 14.-16. Jahrhundert - in ihrer<br />
Blütezeit - waren die Zünfte wirtschaftlich<br />
und sozial so bedeutsam<br />
und selbstbewusst geworden, dass<br />
sie sich gegen die feudalen Stad-<br />
therren nach zünftiger Autonomie<br />
und rechtlich politischer Teilhabe an<br />
der bürgerlichen Ratsherrschaft<br />
bemühten und diese in vielen Fällen<br />
auch bekamen. Das Handwerk war<br />
Kernstück des Mittelstandes, Zunftzwang,<br />
Zunftordnung und die Tätigkeit<br />
der Meister hatten eine verstärkte<br />
wirtschaftliche Produktion<br />
zur Folge. Damit wurden der Wohlstand<br />
aller Gewerke jener Jahre und<br />
die kulturelle und wirtschaftliche<br />
Blüte der Städte gefördert.<br />
In der Zeit der Gotik war es<br />
zunächst die alte Oberschicht – adlige<br />
Landesherren und vor allem der<br />
Klerus – die als Auftraggeber z.B.<br />
für Chorgestühle und Altäre höhere<br />
Anforderungen an die schreinerische<br />
Kunstfertigkeit und Geschikklichkeit<br />
stellte. Mit der Erfindung<br />
der Sägemühle zu Beginn des 14.<br />
Jahrhunderts war das Schneiden<br />
dünner Bretter möglich. Dies bildete<br />
die Voraussetzung für die Einführung<br />
des Rahmenbaus, der eine der<br />
markantesten Zäsuren im Möbelbau<br />
darstellte.<br />
Die verfeinerte Wohnkultur und<br />
ein daraus entstandener vermehrter<br />
Bedarf des wohlhabenden Bürgertums<br />
nach Ausstattung der Räume<br />
105
mit verbesserten Innenausbauten<br />
und Möbeln führte dazu, dass sich<br />
das Tischlerhandwerk, das zunächst<br />
in einem natürlichen Verband mit<br />
anderen verwandten Gewerben der<br />
Holzbearbeitung, vor allem mit der<br />
Zimmerei stand, aus dem Zimmermannsberuf<br />
entwickelte. Um 1308<br />
taucht erstmalig die Bezeichnung<br />
Tischler (weitere Namen u.a. Kistler,<br />
Kästner, Schreiner) auf. Kistler- und<br />
Schreinerzünfte gibt es seit etwa<br />
1400. In der Folge blieben dem Zimmermann<br />
die rohen, genagelten,<br />
derberen Arbeiten, die feinere und<br />
die geleimte Arbeit war Sache des<br />
Schreiners. Bevor es zu einer klaren<br />
Abgrenzung und Verselbständigung<br />
des Tischlerhandwerks kam, ist es<br />
zweifellos zu harten Zunftkämpfen<br />
gekommen.<br />
Unter den Auswirkungen großer<br />
Entdeckungen und Erfindungen im<br />
14.-15.Jahrhundert sowie durch den<br />
Einfluß von Renaissance und Humanismus,<br />
die gleichermaßen auf antike<br />
Quellen zurückgreifen, änderte<br />
sich das Weltverständnis. Es<br />
erwuchsen eine auf den Menschen<br />
gerichtete, das Diesseits bejahende<br />
Lebensauffassung und Kultur.<br />
Zunehmender Wohlstand in den<br />
106<br />
Städten führte zu gesteigerten<br />
Bedürfnissen nach geistigen und<br />
kulturellen Werten und der Nachfrage<br />
nach einer Vielfalt von hochentwickelten<br />
hand- und kunsthandwerklichen<br />
Erzeugnissen. Dies hatte<br />
eine Aufgliederung der Stammhandwerke<br />
in weitere spezialisierte<br />
Berufstätigkeiten und einen Aufschwung<br />
der Gewerbe zur Folge.<br />
Letztlich führte es auch zu einer Blütezeit<br />
des deutschen Kunstgewerbes,<br />
das in der innigen Verbindung<br />
von Kunst und Handwerk seine<br />
Stärke hatte. Auch das städtische<br />
<strong>Schreinerhandwerk</strong> brachte in dieser<br />
Phase herausragende Leistungen in<br />
der Formgebung und Ausführung<br />
von gediegenen Möbeln hervor, z.B<br />
in Nürnberg und Augsburg. Man<br />
nahm aus Italien Gestaltungsprinzipien<br />
für die Flächengliederung und<br />
neue Techniken wie z.B. die Intarsia<br />
auf und setzte sie in eigenständigen<br />
Entwürfen um. Einige Schreinereien<br />
entwickelten sich zu Kunstschreinereien,<br />
und so wurde der Schreiner<br />
zum Kunstschreiner, zum Ebenisten.<br />
Die Kunstschreiner jener Zeit waren<br />
gerühmt und gesucht. Fürsten hielten<br />
sich eigene Hofebenisten (so<br />
benannt nach den Ebenholzmöbeln)<br />
nicht zuletzt, um die strenge Regle-<br />
mentierung der Zünfte zu umgehen.<br />
Zeichen des Verfalls<br />
Schon in der Zeit, in der das<br />
Handwerkertum seinen Höhepunkt<br />
erreichte, als Wohlhabenheit und<br />
Bürgerstolz weit verbreitet waren,<br />
zeigten sich die ersten Zeichen des<br />
Niedergangs.<br />
Gegen Ende des 15. Jahrhunderts<br />
wurden die Zunftbestimmungen<br />
immer kleinlicher und engherziger,<br />
die Vergehen gegen diese<br />
Bestimmungen zunehmend strenger<br />
geahndet. Die einschneidenden Produktions-<br />
und Verkaufsbestimmungen<br />
sollten zwar dem Handwerker<br />
helfen, in Wirklichkeit erwiesen sie<br />
sich jedoch in der Folge als Hemmschuh.<br />
Sie erwuchsen letztlich aus<br />
der Konkurrenzangst der eingesessenen<br />
Meister.<br />
Um den enger werdenden<br />
Lebensraum in den Städten für die<br />
bereits Selbständigen abzusichern,<br />
versperrte man vielfach den Gesellen<br />
zunehmend mehr den Aufstieg<br />
in die Selbständigkeit dadurch, dass<br />
die Zugangsvoraussetzungen zur<br />
Zunft höher gesetzt wurden. In zeitlicher<br />
Hinsicht durch Forderungen<br />
an eine längere Dauer der Ausbildungs-<br />
und Gesellenzeit sowie der
Wanderschaft, in finanzieller Hinsicht<br />
durch unangemessen hohe<br />
Forderungen an Aufnahmegebühren<br />
und oft zudem durch den verbürgten<br />
Nachweis der Verfügung<br />
über beträchtliches eigenes Vermögen.<br />
Vom ausgehenden 16. bis zum<br />
beginnenden 17. Jahrhundert wurden<br />
die Zunftschranken immer starrer,<br />
es entstanden sog. „geschlossene<br />
Zünfte“. Das bedeutete, dass<br />
eine Höchstzahl an Meistern pro<br />
Zunft festgesetzt wurde. Der Erwerb<br />
der Meisterschaft wurde damit<br />
erschwert und fremden, zugewanderten<br />
Gesellen oft unmöglich<br />
gemacht. Gleichzeitig schwächte<br />
sich das soziale Pflichtbewußtsein<br />
ab, und die Zünfte erstarrten in Formalismus,<br />
Geldstrafensystemen und<br />
anderen regulierenden Maßnahmen.<br />
Diese Entwicklung brachte das<br />
Handwerk und die Zünfte in Mißkredit.<br />
Diese ersten inneren Anzeichen<br />
des Niedergangs verstärkten sich<br />
deutlich durch äußere in der folgenden<br />
Zeit des Dreißigjährigen Krieges<br />
(1618-1648), der die Bevölkerung<br />
durch Tod und Krankheiten drastisch<br />
dezimierte, viele Städte und<br />
Dörfer zerstörte, Elend und wirt-<br />
schaftliche Armut in einem bisher<br />
nicht gekannten Ausmaß mit sich<br />
brachte und in dem Gewerbe und<br />
Handel weitgehend zum Erliegen<br />
kamen. In manchen Städten führte<br />
er das Handwerk seiner völligen<br />
Auflösung entgegen. Viele handwerkliche<br />
Fähigkeiten und Fertigkeiten<br />
gingen ganz verloren, Materialgefühl,<br />
Maßbewußtsein, Formempfinden,<br />
Füge- und Verbindungstechniken<br />
sowie Geschmack und künstlerische<br />
Fertigkeiten verkümmerten,<br />
die Kunst verödete. Erst viel später<br />
wurde einiges von der Kunstfertigkeit<br />
der Werkstätten wieder entdeckt<br />
oder durch die Einwanderer<br />
der kommenden Jahrzehnte wiederbelebt.<br />
In den bayerischen Landschaften<br />
führten Truppendurchzüge<br />
zu schweren Schäden, ehe sie<br />
besonders in den Jahren ab 1631<br />
von feindlichen Soldaten besetzt<br />
und verwüstet wurden.<br />
Im „Westfälischen Frieden“ wurden<br />
den deutschen Reichsfürsten<br />
und den reichsfreien Städten die<br />
volle Landeshoheit und ein Bündnisrecht<br />
zugestanden. Dies führte zu<br />
einer weiteren Aufspaltung<br />
Deutschlands in zahllose Einzelstaaten.<br />
Das Oberhaupt des Reiches, der<br />
Kaiser, war nahezu völlig machtlos<br />
geworden. Die politische Macht verlagerte<br />
sich jetzt von den Städten<br />
auf die Territorialfürsten, der<br />
Anspruch der Stände als organisierter<br />
Körperschaft auf politische Mitbestimmung<br />
wurde weitgehend<br />
beseitigt, das Gleichgewicht zwischen<br />
Fürst und den drei Landständen<br />
(Adel, Geistlichkeit und Städte)<br />
zugunsten der souveränen Fürsten<br />
verschoben.<br />
Die Behebung der Schäden des<br />
30-jährigen Krieges erforderten in<br />
besonderem Maße das Eingreifen<br />
der Landesherren, dies führte zur<br />
Ausbildung des „höfischen“ oder<br />
„fürstlichen“ Absolutismus, der<br />
Regierungsform des Barock, wie er<br />
sich beispielhaft unter Ludwig XIV,<br />
dem „Sonnenkönig“, herausgebildet<br />
hatte.<br />
Früher als im übrigen Deutschland<br />
kommt es in <strong>Bayern</strong> zur Entfaltung<br />
des Absolutismus. Schon zu<br />
Beginn des 17. Jahrhunderts war es<br />
hier zu einer Machtkonzentration<br />
auf den Landesherrn gekommen,<br />
dem 1623 die Kurwürde verliehen<br />
worden war. Die Stände wurden<br />
entmachtet, die Verwaltung modernisiert,<br />
eine moderne Armee ins<br />
107
Leben gerufen und ein Landrecht<br />
organisiert, das die Rechtseinheit in<br />
<strong>Bayern</strong> herstellte. Die Wirren des<br />
30-jährigen Krieges hatten den Ausbau<br />
des modernen Staatswesens<br />
mit absolutistischer Prägung<br />
gebremst, jetzt konnte er zügig fortgesetzt<br />
und vollendet werden. An<br />
die Verwaltungszentren zogen Adel,<br />
Beamtentum und Offiziere und<br />
prägten nun das Bild der Residenzstädte.<br />
In der Folgezeit bestimmte<br />
das Streben nach einer Rangerhöhung<br />
des Kurfürsten die bayerische<br />
Politik.<br />
Höfisches Fest, höfisches Zeremoniell<br />
und repräsentative Schloßbauten<br />
verliehen dem fürstlichen<br />
Machtanspruch sichtbaren Ausdruck.<br />
In <strong>Bayern</strong> wird München das<br />
einflußreichste Kunstzentrum. Die<br />
älteren Sitze kunstgewerblicher Produktion,<br />
Städte wie Augsburg und<br />
Nürnberg, sind nur mehr Sitz der<br />
ausführenden Meister. Bei der Ausstattung<br />
mit Möbeln bilden<br />
zunächst italienische, später vor<br />
allem französische Importe Vorbilder<br />
für die einheimische Produktion.<br />
Paris wurde die hohe Schule der<br />
Kunstschreiner. Man liess sich, wenn<br />
es etwas Besonderes galt, zuweilen<br />
Ebenisten von dort kommen oder<br />
108<br />
schickte die seinen dorthin, um sie<br />
ausbilden zu lassen. Für die Ausstattung<br />
der Bauten werden eigene<br />
große Hofschreinereien gegründet,<br />
an denen besonders qualifizierte<br />
Meister und Gesellen beschäftigt<br />
wurden. Es entstehen Möbel, die<br />
den höfischen Anforderungen entsprechend<br />
Schönheit, Pracht sowie<br />
Kraft und Pathos ausdrücken. Auch<br />
der Bequemlichkeit wird durch Polsterung<br />
von Stühlen und Sesseln<br />
jetzt Rechnung getragen. Eine in<br />
Frankreich entwickelte Einlegetechnik<br />
auf holzfremden Materialien, die<br />
sog. Boulle-Technik, wird eingeführt,<br />
vielfach angewendet und<br />
kommt wie die weiterentwickelte<br />
Furniertechnik zur Blüte. In der Folgezeit<br />
des Rokoko werden der<br />
Ornamentreichtum größer, das<br />
Dekor extravagant und exotisch, die<br />
Motive häufig fernöstlicher Kunst<br />
entlehnt. Das Mobiliar wird ergänzt<br />
und steht in Bezug zur Innenarchitektur,<br />
die Raumgestaltung verwandelt<br />
Schwere und Pathos des<br />
Barocks in Anmut, Grazie und heiter-festliche<br />
Leichtigkeit. In den Zentren<br />
München, Würzburg , Bayreuth<br />
u.a. fanden neben Kunstschreinerei<br />
verwandte Gewerbe der Holzbearbeitung<br />
wie die Schnitzerei, Bildhau-<br />
erei und Vergolderei in dem üppigen<br />
Schmuck-und Rankenwerk des<br />
Rokokostils reiche Aufgaben.<br />
Zur Finanzierung dieser Aufgaben<br />
reichten die Einnahmen des<br />
Kurfürsten und die Beiträge der<br />
Landstände nicht aus. Eine staatliche<br />
Wirtschaftspolitik, die auf die<br />
Stärkung und Förderung der Wirtschafts-<br />
und Finanzkraft des Staates<br />
abzielte (Merkantilismus), sollte<br />
Abhilfe schaffen. Dahinter standen<br />
die Bestrebungen der Landesfürsten,<br />
die gewerbliche Produktion<br />
und ihren Export zu fördern und<br />
gleichzeitig die Importe einzuschränken,<br />
umgekehrt bei Rohstoffen.<br />
Ziel war es, durch Exportüberschuß<br />
eine aktive Handelsbilanz zu<br />
erreichen. Die Gewerbepolitik sah in<br />
erster Linie die Gründung und Förderung<br />
arbeitsteilig arbeitender<br />
Großbetriebe (Manufakturen) vor,<br />
die durch die Bildung von Monopolen<br />
und Schutzzöllen gegenüber der<br />
ausländischen Konkurrenz wettbewerbsfähig<br />
gemacht werden sollte.<br />
Erst in zweiter Linie galt das Interesse<br />
der Förderung, Weiterentwikklung<br />
und dem Wohlergehen des<br />
zünftigen Handwerks. Die Synthese<br />
von Absolutismus und aufgeklärtem
Gedankengut, der sogenannte<br />
"aufgeklärte" Absolutismus, entsprach<br />
in <strong>Bayern</strong> nur sehr bedingt<br />
dem Staatsverständnis des Fürsten.<br />
Er blieb bei den Folgerungen, die<br />
sich aus seinem Selbstverständnis<br />
„von Gottes Gnaden“ ergaben und<br />
betrachte den Staat als seinen Privatbesitz.<br />
Während die Zünfte früher einmal<br />
ein wichtiges tragendes Element<br />
der Staatsgewalt dargestellt<br />
hatten, erstarrten sie jetzt zu<br />
inhaltsleeren Formen und traten<br />
nun immer mehr in Widerspruch zur<br />
wachsenden absoluten Staatsidee<br />
In dieser Wechselwirkung von<br />
äußeren Einflüssen und innerem<br />
Verharren wuchsen die<br />
Verkrustung und der Stillstand<br />
im Handwerk, und die Missbräuche<br />
der ehemals sinnvollen und ehrlichen<br />
Gebote wurden in verstärktem<br />
Maße von den Landesherren<br />
nicht mehr toleriert. Um gegen die<br />
allgemeine Verelendung und die<br />
durch die Zunftordnungen bedingten<br />
Mängel vorzugehen, wurde <strong>Bayern</strong><br />
bereits durch den Reichstagsabschied<br />
von 1654 die Neuregelung<br />
seines Handwerkswesens übertragen.<br />
Die landesherrliche Staatsgewalt<br />
reichte aber zu diesem Zeit-<br />
punkt nicht immer aus, um Regelungen<br />
zur Behebung von Mißbräuchen<br />
gegen den Widerstand der<br />
Zünfte und der Städte durchzusetzen<br />
und durchzuführen.<br />
1672 beriet der Reichstag das<br />
Reichsgutachten zur Abstellung der<br />
Handwerksmißbräuche, es bildete<br />
die Grundlinie, auf der sich die<br />
Gewerbegesetzgebung des 18.<br />
Jahrhunderts bewegte. Die immer<br />
stärkere Einflussnahme auf die<br />
Zunftgesetzgebungen fand 1731<br />
ihren ersten Abschluss im Reichsbeschluss,<br />
der großen “Reichszunftordnung”.<br />
Mit ihr wurden zentrale<br />
Privilegien angegriffen, da sie u. a.<br />
die ständische Gerichtsbarkeit und<br />
das Versammlungsrecht einschränkte,<br />
den schriftliche Verkehr von<br />
Zunft zu Zunft ebenso verbot wie<br />
den „blauen Montag“. Damit<br />
wurde die Autonomie der Zünfte<br />
beseitigt, und sie wurden unter<br />
staatliche Kontrolle gestellt.<br />
Zwar ließen sich die Bestimmungen<br />
des Gesetzes in den Reichsstädten<br />
und Territorien nicht durchsetzen,<br />
die alten Verhältnisse blieben,<br />
aber die Verrechtlichung des Handwerks<br />
hatte damit ihren Anfang<br />
genommen. Die Zünfte verloren in<br />
der Folge ihre Bedeutung als Selbstverwaltungskörperschaften<br />
und,<br />
bedingt durch die ökonomische Entwicklung<br />
(Ausbildung des Verlagsund<br />
Manufakturwesens), an politischer<br />
und ökonomischer Macht.<br />
Die Gewerbefreiheit<br />
und ihre Folgen<br />
Die Verhältnisse änderten sich<br />
unter dem Einfluß der amerikanischenMenschenrechtserklärung(1776),<br />
des Gedankenguts der<br />
Aufklärung (Thomas Hobbes und<br />
John Locke) und des darin wurzelnden<br />
Liberalismus (Adam Smith) und<br />
vor allem den Folgen der französischen<br />
Revolution (1789-99) und den<br />
Auswirkungen der Napoleonischen<br />
Herrschaft und Kriege (1799-1815)<br />
sowie mit der beginnenden „industriellen<br />
Revolution“.<br />
Gewerbefreiheit wurde in<br />
Deutschland zunächst Anfang des<br />
19. Jahrhunderts in jenen Regionen<br />
eingeführt, die sich während der<br />
Zeit Napoleons I. unter französischer<br />
Herrschaft befanden. Es war<br />
erkannt worden, dass die staatliche<br />
Wirtschaftslenkung im merkantilistischen<br />
System mit seinen Ständebindungen<br />
Kräfte für die wirtschaftli-<br />
109
che Entwicklung lahmlegte.<br />
Als erster Staat folgte Preußen<br />
über die Einführung einer Gewerbesteuer<br />
durch Edikte von 1810 und<br />
1811, orientiert am französischen<br />
Vorbild und unter dem Druck der<br />
Finanznot des Königreichs, die neue<br />
Steuerquellen zu erschließen zwang.<br />
Die Kriegsniederlage 1806/7 und die<br />
dabei erlittenen großen Gebietsverluste<br />
bewirkten grundlegende innere<br />
Reformen (Stein/Hardenberg)<br />
auch des Gewerbewesens.<br />
Voraussetzung für den Betrieb<br />
eines Gewerbes wurde der Erwerb<br />
eines Gewerbescheines. Die zuvor<br />
geforderte Mitgliedschaft in einer<br />
Zunft (Zunftzwang) bzw. das bisherige<br />
Verfahren einer behördlichen<br />
Genehmigung (Konzession) wurde<br />
aufgehoben. Nur einige polizeiliche<br />
Beschränkungen wurden aufrecht<br />
erhalten. Die Zünfte blieben als freie<br />
Körperschaften bestehen. In Preußen<br />
forderte schon kurz nach dem<br />
Befreiungskrieg (1815) der Freiherr<br />
von Stein die Zurückführung der<br />
Gewerbefreiheit in gesetzmäßige<br />
Grenzen. Unter dem Eindruck der<br />
nicht mehr zu übersehenden Mißstände<br />
auf handwerklichem Gebiet<br />
schränkte Preußen in der Gewerbeordnung<br />
von 1845 und nochmals<br />
110<br />
mehr in der Ergänzungsverordnung<br />
von 1849 die Gewerbefreiheit wieder<br />
ein. Für eine große Anzahl von<br />
Gewerben wurde die Zulassung<br />
davon abhängig gemacht, ob der<br />
interessierte Handwerker einen<br />
Befähigungsnachweis erbringt. Die<br />
Gesellen und Gehilfen wurden<br />
gesetzlich verpflichtet, nur bei Meistern<br />
ihres Fachs Arbeit aufzunehmen.<br />
Die Innungen (der Begriff<br />
taucht hier erstmals auf) hatte das<br />
alleinige Recht der Lehrlingsaufsicht.<br />
Eine entschieden wieder liberalere<br />
Wende dieser Gewerbepolitik sollte<br />
erst zwanzig Jahre später erfolgen.<br />
Für die Entwicklung des modernen<br />
Staatsbayern ist die französische<br />
Revolution besonders prägend.<br />
<strong>Bayern</strong> geht als der Hauptnutznießer<br />
aus der von Napoleon eingeleiteten<br />
„politischen Flurbereinigung“(Säkularisation<br />
und Mediatisierung)<br />
hervor. Das alte Kurfürstentum<br />
<strong>Bayern</strong> hatte nur Ober- und<br />
Niederbayern sowie die Oberpfalz<br />
umfaßt, Gebiete mit einer geschlossen<br />
katholischen Bevölkerung. Nach<br />
1803 wurde das bayerische Staatsterritorium<br />
jedoch um die gemischtkonfessionellen<br />
Gebiete Frankens,<br />
Ostschwabens und die territorial<br />
getrennte Rheinpfalz sowie um ehemaligen<br />
Reichsstädte wie Regensburg,<br />
Nürnberg und Augsburg<br />
erweitert. Diese Länder unterschiedlichster<br />
Größe, Struktur und Tradition<br />
sahen sich damit, in manchen<br />
Fällen gegen ihren Willen, in einem<br />
Gesamtstaat vereint.<br />
1806 schlossen sich <strong>Bayern</strong> und<br />
andere deutsche Mittelstaaten mit<br />
dem Kaiser der Franzosen im Rheinbund<br />
zusammen und sagten sich<br />
damit vom Reich los. Franz I. legte<br />
daraufhin die Kaiserkrone nieder,<br />
das Heilige Römische Reich Deutscher<br />
Nation war endgültig erloschen.<br />
<strong>Bayern</strong>s Herrscher aber<br />
erhielt seine Belohnung: Als Max I.<br />
Joseph (1806-1825) wurde er erster<br />
bayerischer König.<br />
Die Formierung zum modernen<br />
Staatswesen oblag dem "allmächtigen<br />
Minister" Maximilian Graf von<br />
Montgelas, der bis 1817 eine wirksame<br />
Staatsverwaltung mit hochqualifizierter<br />
Beamtenschaft, Zentralregierung<br />
und Fachministerien<br />
schuf, das Rechtswesen neue ordnete<br />
und eine Wirtschaftsreform<br />
durchführte (Vereinheitlichung der<br />
Maße und Zölle, Abschaffung der<br />
Grundherrschaft und Aberkennung<br />
des alten Status der Zünfte). Mit der
Konstitution von 1808 und insbesondere<br />
der Verfassung von 1818<br />
vollzog <strong>Bayern</strong> zugleich den wenn<br />
auch erst allmählich spürbar werdenden<br />
Übergang vom Absolutismus<br />
zu einem konstitutionellen<br />
Staatswesen mit Parlament und Teilhabe<br />
der Volksvertretung an der<br />
Gesetzgebung.<br />
Bereits mit der Gewerbeordnung<br />
von 1804 werden das Zunftwesen<br />
modernisiert und der Zunftzwang<br />
eingeschränkt. In mehreren Verordnungen<br />
von 1804-07 wurden -<br />
durch die Verleihung von staatlichen<br />
Gewerbekonzessionen auf Lebenszeit<br />
– die monopolistische Zulassungsgewalt<br />
der Zünfte zur gewerblichen<br />
Niederlassung geschwächt.<br />
Als 1818 das Gewerbekonzessionsrecht<br />
erst an den Staat und<br />
dann an die Kommunen überging,<br />
führte das zu einem Rückgang der<br />
Zulassungen. Das Gewerbegesetz<br />
von 1824/25 setzte den Gewerbevereinen<br />
als Nachfolger der Zünfte<br />
obrigkeitliche Kommissäre vor, ohne<br />
deren Vorsitz keine Beschlüsse<br />
gefasst werden konnten und die im<br />
Einzelfall einer Konzession zustimmen<br />
mussten („Prüfung des Nahrungsstandes“).<br />
In den Jahren 1825-<br />
26 kam es zur Auflösung der Zünfte,<br />
und an ihre Stelle traten die<br />
Gewerbevereine (Innungen). In den<br />
folgenden Jahrzehnten gründete<br />
sich eine Vielzahl von Gewerbevereinen,<br />
deren Mitglieder sich aus Meistern<br />
unterschiedlicher Gewerbe<br />
zusammensetzten. Unter maßgeblicher<br />
Beteiligung des <strong>Schreinerhandwerk</strong>s<br />
z.B. in Fürth (1843),<br />
Memmingen und Mindelheim<br />
(1848) und in München (1848). Als<br />
Selbsthilfeorganisationen und z.T.<br />
auch als Dachorganisationen bestehender<br />
Innungen, vertraten sie die<br />
Interessen des Handwerks.<br />
Auch im weiteren Verlauf betrieb<br />
<strong>Bayern</strong> mit den Verordnungen von<br />
1834 und 1853 eine „zunftfreundliche“<br />
Gewerbepolitik, die mit<br />
erweiterten Kriterien für die Vergabe<br />
von Konzessionen und einer verschärften<br />
Befähigungsüberprüfung<br />
die Weitervermehrung der Gewerberechte<br />
wirksam drosselte. Doch<br />
all diese Verordnungen konnten den<br />
tendenziell stärkeren Einzug des<br />
Liberalismus in die Politik nicht aufhalten.<br />
Im Zuge der Revolution von<br />
1848 fand sich parallel zur tagenden<br />
Reichsversammlung in Frankfurt<br />
ein „Handwerkerparlament“ (Handwerker<br />
und Gewerbekongress)<br />
zusammen, das grundlegende Forderungen<br />
zur Neuordnung des<br />
Handwerks in der sich formierenden<br />
Industriegesellschaft aufstellte. Die<br />
Errichtung von Pflichtinnungen, ein<br />
Prüfungs- und Befähigungsnachweis,<br />
die Einschränkung der Meisterzahl,<br />
eine dreijährige Lehrzeit<br />
und die Einrichtung von Gewerbekammern<br />
gehörten dazu. Die handwerklichen<br />
Proteste waren Ausdruck<br />
von Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung<br />
aber auch „Angst vor<br />
der Proletarisierung“ Mit dem Scheitern<br />
der Nationalversammlung,<br />
gelang es weder, dem deutschen<br />
Volk die erhoffte staatliche Einheit<br />
und Freiheit zu bringen, noch eine<br />
sichernde Ordnung für die Zukunft<br />
des Handwerks zu schaffen.<br />
Im Krieg von 1866 fiel endgültig<br />
die Entscheidung zugunsten Preußens<br />
und der kleindeutschen<br />
Lösung. Bismarck, der preußische<br />
Ministerpräsident, bestrafte <strong>Bayern</strong>,<br />
das im Bund mit Österreich den<br />
Krieg verloren hatte, mit Gebietsabtretungen<br />
und Kriegskostenentschädigungen.<br />
Zugleich aber band er<br />
durchSchutz- und Trutzbündnisse<br />
die süddeutschen Staaten an den<br />
111
neu gegründeten Norddeutschen<br />
Bund. Durch die Vereinheitlichung<br />
der Zölle (Zollverein) wurden die<br />
Wirtschaftseinheit gestärkt und Voraussetzungen<br />
für die Errichtung des<br />
preußisch-deutschen Reiches als<br />
Bundesstaat geschaffen.<br />
Seither war die bayerische Politik<br />
zunehmend auf Preußen ausgerichtet.<br />
So wundert es nicht, dass die<br />
bayerische Staatregierung mit der<br />
Gewerbeordnung vom 30. Januar<br />
1868 eine neue, aber im Trend liegende<br />
Richtung einschlug und die<br />
volle Gewerbefreiheit einführte.<br />
Durch das Gewerbefreiheitsgesetz<br />
erfolgte die formelle Auflösung der<br />
wenigen noch bestehenden Innungen.<br />
Sie konnten sich nur als freie<br />
Gewerbevereine erhalten, wenn die<br />
Satzungen dieser Vereine staatlich<br />
genehmigt wurden.<br />
1870 trat <strong>Bayern</strong> im Bündnis mit<br />
Preußen in den Krieg gegen Frankreich<br />
ein, den Bismarck geschickt<br />
inszeniert hatte und der mit der Proklamation<br />
des preußischen Königs<br />
Wilhelm I. zum Deutschen Kaiser<br />
am 18.1.1871 in Versailles endete.<br />
<strong>Bayern</strong> trat dem deutschen Reich<br />
bei, behielt jedoch weitgehend eine<br />
112<br />
staatliche Selbständigkeit. 1873<br />
übernahm <strong>Bayern</strong> wie bereits vorher<br />
andere süddeutsche Staaten die<br />
Gewerbeordnung des Norddeutschen<br />
Bundes von 1869, die wieder<br />
den Grundsatz der völligen Gewerbefreiheit<br />
proklamierte.<br />
Mit der Gründung des deutschen<br />
Kaiserreichs beginnt eine<br />
Konjunkturphase, die sog. „Gründerzeit“,<br />
sie wird von der industriellen<br />
Produktion und von einer regen<br />
Bautätigkeit begleitet.<br />
Die nachfolgenden Jahre (1871-<br />
74) des wirtschaftlichen Aufschwungs,<br />
der zunächst durch die<br />
von Frankreich gezahlte Kriegsentschädigung<br />
und den Zollabbau<br />
beflügelt wurde, werden vielfach als<br />
„Gründerjahre“ bezeichnet. Sie<br />
lösten eine Wachstumseuphorie und<br />
eine Welle von Firmengründungen<br />
auf spekulativer Basis aus. Die<br />
Möbel-, Wohn- und Baukultur der<br />
Gründerzeit, die sich in der Spätphase<br />
des Historismus insbesondere<br />
als „Neorenaissance“ („altdeutscher<br />
Stil“) ausprägt, erlebte eine einzigartige<br />
Hochkonjunktur, die breiteste<br />
Bevölkerungsschichten in Stadt und<br />
Land erreichte. Um und nach 1890<br />
konkurrieren andere Neostile und<br />
der Jugendstil (1894-1906) mit der<br />
Gründerzeit. Trotz aller stilistischen<br />
Einflüsse aber bleibt die Gründerzeit<br />
bis 1914 der vorherrschende Wohnund<br />
Möbelstil.<br />
Vieles von dem, was in der Stilentwicklung<br />
der Gründerzeit<br />
bedeutsam wird, bahnt sich bereits<br />
Ende des 18. bis zum frühen<br />
19.Jahrhundert in drei Phasen des<br />
Klassizismus an. Die Abkehr vom<br />
barocken Formenüberschwang<br />
hatte sich bereits im Zopfstil bzw.<br />
im Stil Louis XVI durch eine klarere<br />
und sparsamere Formgebung angekündigt.<br />
Hier waren aber nicht nur<br />
ästhetische Gründe maßgebend,<br />
sondern auch eine zunehmende Kritik<br />
an der absolutistischen Gesellschaftsform,<br />
als deren Ausdruck<br />
man den Barock und Rokoko empfand.<br />
Mit der französischen Revolution<br />
gelangte der Wille zu einer<br />
neuen Kultur an seinen Höhepunkt.<br />
Als Quelle für neue Formvorstellungen<br />
hatte man die griechische und<br />
römische Antike wiederendeckt.<br />
Hauptanliegen der Gestaltung<br />
waren gerade Flächen, klare Umris-
se und übersichtliche Gliederungen<br />
an den meist kantigen Grundformen.<br />
Hinzu kamen Säulenmotive<br />
und antike Ornamente. Das Empire<br />
behält allerdings in der Auschmükkung,<br />
entsprechend dem Machtanspruch<br />
des französischen Kaisers,<br />
noch repräsentativen Charakter.<br />
Nach der politischen Niederlage<br />
Napoleons 1815 versuchten die<br />
Machthaber Europas, die alten Verhältnisse<br />
im Sinne des Absolutismus<br />
wiederherzustellen („Restauration“),<br />
aber das einmal erwachte politische<br />
und kulturelle Bewußtsein der Bürger<br />
ließ sich nicht mehr auslöschen.<br />
Mit dem von der Generation der<br />
Freiheitskriege getragenen Biedermeier<br />
bildeten sich bis zur Revolution<br />
von 1848 neue, spezifisch bürgerliche<br />
Ausdrucksformen, die in<br />
der Möbel- und Wohnraumgestaltung<br />
eine echte Alternative zu den<br />
vorher weitgehend stilprägenden<br />
Formen der aristokratischen Gesellschaft<br />
schufen. Die klassizistischen<br />
Vorbilder des Empire, aber auch<br />
noch des Louis XVI und der englischen<br />
Möbelentwerfer (z.B. Th. Sheraton)<br />
boten ein genügend großes<br />
Formenrepertoire, aus dem man<br />
schöpfen konnte. Die einfachen,<br />
zweckmäßigen, handwerklich soli-<br />
de gefertigten Möbel sollten in<br />
behäbigen Wohnhäusern den Rahmen<br />
für eine intime gemütliche<br />
Wohnlichkeit schaffen.<br />
Während das erste Drittel des<br />
19. Jahrhunderts vom Klassizismus<br />
und seinen Stilen Empire und Biedermeier<br />
beherrscht wird und die<br />
Abfolge der Stile sukzessive ersichtlich<br />
ist, kommt es ab ca.1830-40 bis<br />
1890 zu einem Stilpluralismus und<br />
einer eklektizistischen Stilvermischung.<br />
Es entsteht eine auffällige<br />
Wohnkultur mit der Tendenz zur<br />
Fülle und zur Repräsentation, die<br />
der Selbstdarstellung des gründerzeitlichen<br />
Bürgertums entgegenkommt.<br />
Dieser aufwändige, großbürgerliche<br />
Einrichtungsstil ist durch<br />
Rückgriffe auf frühere Stilepochen<br />
gekennzeichnet, die er zitiert, adaptiert<br />
und aktualisiert. So entwickeln<br />
sich nacheinander und nebeneinander<br />
vor allem „Neogotik“ oder<br />
„Neugotik“, „Zweites Rokoko (Louis<br />
Philippe)“, „Neorenaissance“. Das<br />
Zusammenwirken von nationaler<br />
Einheit, politischer Stärke, wirtschaftlichem<br />
Aufschwung, voranschreitender<br />
Industriealisierung, allgemeiner<br />
Mobilität, gefördertem Bildungswesen<br />
und kunststilistischer<br />
Fixierung bilden die Basis für die<br />
auffällige Wohnkultur der Gründerzeit.<br />
Die Nachfrage von seiten der vor<br />
allem in den Großstädten gewachsenen<br />
Bevölkerung nach einem ihrer<br />
ideellen Haltung entsprechenden<br />
identifikationsfähigen Einrichtungsstil<br />
ist derart hoch, dass im ganzen<br />
Land Möbel entworfen, geschreinert<br />
und vertrieben werden. Besonders<br />
auffällig ist die Entwicklung des<br />
Schreinergewerbes in den Städten.<br />
München nimmt auch in dieser<br />
Zeit seine Stellung als Wirtschaftsund<br />
Kulturmetropole ein. Viele<br />
Anregungen und Förderungen<br />
gehen hier vom Hof aus. König Ludwigs<br />
II. rege Bautätigkeit in und um<br />
München und die damit verbundenen<br />
staatlichen Einrichtungsaufräge<br />
geben auch dem bayerischen<br />
<strong>Schreinerhandwerk</strong> einen kräftigen<br />
Impuls.<br />
Markt wie neue Technologien<br />
entfalten ihre eigene Dynamik,<br />
wobei sich unter den veränderten<br />
wirtschaftlichen und sozialen Vorzeichen<br />
des neuen Jahrhunderts im<br />
Prinzip durchaus vergleichbare Konstellationen<br />
im <strong>Schreinerhandwerk</strong><br />
113
herausbildeten, wie sie bereits im<br />
18. Jahrhundert vorzufinden waren.<br />
Auf der einen Seite standen die traditionell<br />
arbeitenden Kleinbetriebe,<br />
auf der anderen Seite die Möbelfabriken,<br />
die – fast als getreue Nachfolger<br />
der Hofschreinereien –<br />
schließlich auch das werbewirksame<br />
Firmenschild einer „Hof-Möbelfabrik“<br />
anbringen durften. Wer für<br />
den örtlichen Bedarf und gegen<br />
Auftrag oder allenfalls beschränkte<br />
Nachfrage arbeitete, der war in die<br />
Grenzen des Kleinbetriebs gewiesen.<br />
Die Betriebsführung und damit<br />
zusammenhängend die Betriebsgröße<br />
mit bis zu fünf Beschäftigten<br />
blieb weitgehend unverändert , die<br />
selbständigen Kleinunternehmer<br />
planten gleichsam „auf Sicht“. Die<br />
Auftragslage spielte die entscheidende<br />
Rolle. In den Städten war sie<br />
etwas günstiger als auf dem Lande,<br />
so dass dort die Anzahl der Betriebe<br />
und die darin beschäftigten Gesellen<br />
durchaus wuchsen.<br />
Auch solche Kleinbetriebe nutzten<br />
eingeschränkt arbeitsteilige Produktion.<br />
Feine Schnitzer-, Drechsler-,<br />
Polsterer- und Lackierarbeiten wurden<br />
nach aussen vergeben, gelegentlich<br />
kaufte man Versatzstücke<br />
114<br />
hinzu und baute sie<br />
ein. Holzeinkauf und<br />
zeichnerischer Entwurf<br />
lagen in den<br />
Händen des Meisters.<br />
Die schulische Ausbildung<br />
wie die Fortbildungseinrichtungen<br />
suchten gerade in<br />
diesem Bereich die<br />
notwendigen Kenntnisse<br />
zu vermitteln.<br />
Die neu entstandenenMöbelmagazine<br />
übernahmen in<br />
immer stärkerem<br />
Umfang die Vermarktung<br />
von Möbeln aus<br />
Fabriken und kleinen<br />
Werkstätten. Viele<br />
der an den lokalen<br />
Absatz gebundenen<br />
Kleinbetriebe verloren<br />
ihre Privatkunden. Der Kunde kaufte<br />
ab Lager und ging stärker mit der<br />
Mode. Die Mehrzahl der Schreiner<br />
produzierte überwiegend für den<br />
Handel und damit für den anonymen<br />
Markt. Ein Teil versuchte, mit<br />
Anzeigen oder eigenen Lagern seine<br />
Produkte wieder selbst direkt zu verkaufen.<br />
Profile aus dem Musterbuch einer Kehlleistenfabrik<br />
Die technisch anspruchsvolle<br />
Herstellung von Möbeln blieb bis in<br />
das 20. Jahrhundert hinein weitgehend<br />
handwerklich bestimmt. Auch<br />
in Betrieben, die sich zu „Möbel-<br />
Fabriken“ entwickeln, fertigen ausgebildete<br />
Schreiner in werkstattähnlichen<br />
Zusammenhängen die Möbel<br />
an. Zur stiltypischen Ausschmük-
kung des Möbels werden z.B. vorgefertigte<br />
Applikationen, Profilleisten<br />
oder Füße benutzt, die im Zuge<br />
der Spezialisierung andere Betriebe<br />
als Fertigprodukte anbieten. Drechsler,<br />
Bildhauer , Tapezierer übernahmen<br />
die Veredlung. In der Mehrzahl<br />
der „Möbel-Fabriken“ wurde vor<br />
der Jahrhundertwende statt großer<br />
Serien gleicher Möbel eine Produktpalette<br />
gefertigt. Sie arbeiteten<br />
nicht nur für den Handel,<br />
sondern auch für die Privatkundschaft.<br />
Sie fertigten in handwerklicher<br />
Qualität „Stil“-Möbel,<br />
Kirchenausstattungen, Hotel-,<br />
Büro- und Ladeneinrichtungen<br />
und übernahmen den Innenausbau<br />
von Wohnungen, Villen und<br />
Schlössern . So übernimmt z.B.<br />
die Möbelfirma Anton Pössenmacher<br />
in München als „Königlich-Bayerischer-Hoflieferant“<br />
die<br />
Lieferung von Möbeln für die<br />
Königsschlösser, daneben fertigt<br />
die Firma die Ausstattung von<br />
bürgerlichen Wohnungen. Im<br />
Raum Oberpfalz tut sich in<br />
Cham die Möbelfabrik Andreas<br />
Schoyerer hervor. Auch die Firma<br />
Anton Schoyerer liefert Schloßeinrichtungen<br />
und bürgerliche<br />
Wohnungseinrichtungen.<br />
„Buffet“ um 1880, ausgeführt von<br />
Anton Pössenbacher, München<br />
Die massenhafte Herstellung einfacher<br />
Möbel für die Möbelmagazine<br />
blieb dagegen vorerst die Aufgabe<br />
kleinerer Werkstätten in den<br />
Städten und in Stadtnähe auf dem<br />
Land. Diese Kleinbetriebe spezialisierten<br />
sich oft nur auf wenige Produkte.<br />
Sie fertigten für den Händler<br />
große Stückzahlen nach gleichen<br />
„Salon Schrank“ Federskizze<br />
(zwischen 1895-1900)<br />
Andreas Schoyerer junior<br />
Mustern, z.B. Polstergestelle, die<br />
sie entweder als Rohware ablieferten<br />
oder selbst mit industriell produzierten<br />
Halbfabrikaten veredelten.<br />
Die Abhängigkeit solcher Betriebe<br />
vom Handel war groß und der<br />
Verdienst gering. Die starke Spezialisierung<br />
machte es dem Handwerker<br />
schwer, auf die Anforderungen<br />
115
Die wichtigsten Handwerkzeuge einer Schreinerei im 19. Jahrhundert<br />
(Lithographie um 1875, München Deutsches Museum<br />
von Privatkunden einzugehen.<br />
Spezialisierte Betriebe entzogen<br />
den Handwerksbetrieben die Produktion<br />
von Stühlen, Möbelgestellen,<br />
Matrazenrahmen, Schatullen,<br />
Kindermöbeln u.a.m. Diese<br />
besonders maschinengerechten Artikel<br />
wurden schon früh in großen<br />
Serien fabrikmäßig hergestellt. In<br />
den Bereichen der Spiegelrahmenherstellung,<br />
der Parkett- oder Jalousie-Fabrikation<br />
entstanden schnell<br />
Großbetriebe.<br />
Das Werkzeug des Schreiners hat<br />
seit der Ausbildung des Handwerks<br />
einen nahezu unveränderten technischen<br />
Stand. Säge, Hobel, Stechbei-<br />
116<br />
tel und Bohrer sind bis in das 19.<br />
Jahrhundert hinein die wesentlichen<br />
Werkzeuge zur Herstellung von<br />
Möbeln.<br />
Entscheidende und für das<br />
ganze 19. Jahrhundert wichtigere<br />
Neuerungen bringen die Holzbearbeitungsmaschinen.<br />
Kurz vor 1800<br />
und in der ersten Hälfte des 19.<br />
Jahrhunderts wurden, vor allem in<br />
England aber auch in Frankreich<br />
Maschinen für das <strong>Schreinerhandwerk</strong><br />
entwickelt, die einen entscheidenden<br />
Bruch mit der Vergangenheit<br />
brachten. Die Frühformen von<br />
Hobel- und Furnierschneidemaschinen,<br />
Band- und Kreissägen, Fräs-,<br />
Bohr- und Stemmmaschinenwurden,<br />
in Europa,<br />
vor allem aber in<br />
Amerika zu leistungsstarken<br />
Standard- und<br />
Spezialmaschinen<br />
weiterentwickelt<br />
und im letzten<br />
Drittel des 19.<br />
Jahrhunderts in<br />
Großbetrieben<br />
vermehrt kostensparend<br />
für Teilar-<br />
beiten eingesetzt. Dabei bewirkte<br />
der Einsatz von Maschinen keine<br />
grundsätzliche Änderung der Produktionsweise,<br />
sondern lediglich<br />
eine Beschleunigung, bestenfalls<br />
eine Präzisierung. Durch den<br />
Maschineneinsatz verlagerte sich die<br />
Möbelproduktion zunehmend in<br />
Großbetriebe, die in den großen<br />
Städten angesiedelten kleinen<br />
Werkstattbetriebe mit weniger als<br />
zehn Mitarbeitern verloren an<br />
Bedeutung. Sie blieben nur noch<br />
bedingt konkurrenzfähig und gerieten<br />
mehr und mehr als Zulieferbetriebe<br />
in Abhängigkeit oder mußten<br />
sich auf das reparieren von Möbeln<br />
beschränken.<br />
Bevor jedoch Holzbearbeitungsmaschinen<br />
in kleineren Betrieben<br />
wirklich genutzt werden konnten,<br />
mußte die Frage des Antriebs gelöst<br />
sein. Dampfmaschinen waren technisch<br />
aufwendig, sehr teuer und<br />
daher nur für große Betriebe geeignet.<br />
Eine andere Möglichkeit waren<br />
schon früher genutzte Wasserräder.<br />
Gegen Ende des Jahrhunderts<br />
kamen Gas- oder Benzinmotor<br />
dazu. Letztlich blieb für die Maschinen<br />
die menschliche Muskelkraft<br />
der einzige Antrieb, die durch Über-
Vielzweckmaschine um 1903 - bestehend<br />
aus Bandsäge, Dekoupiersäge, vertikaler<br />
Bohrmaschine, Kreissäge, Fräsmaschine,<br />
Langloch- und Horizontalbohrmaschine<br />
setzungssysteme bei gringem Aufwand<br />
zu größeren Ergebnissen führte.<br />
Die Mehrzahl der kleineren<br />
Betriebe mußte mit dieser Lösung<br />
zunächst vorliebnehmen. Wirkungsvoll<br />
war das nicht, da auf diese<br />
Weise keine hohen Drehzahlen<br />
erreicht werden konnten. Wo es<br />
irgend ging wurde das Holz zur<br />
Bearbeitung in eine nahegelegene<br />
Fabrik mit Dampfbetrieb gebracht.<br />
Speziell auf dem Land, aber auch<br />
in den kleinstädtischen Schreinereien<br />
kam die durchgängige Mechanisierung<br />
aufgrund dieser Bedingungen<br />
nur langsam voran. Zudem<br />
war das Festhalten am alten und<br />
das Mißtrauen gegenüber einem<br />
umfassenden Maschineneinsatz weit<br />
verbreitet.<br />
Die starke Konkurrenz ausländischer<br />
Waren insbesondere die billigen<br />
Importe aus England, dessen<br />
Industriealisierung früher – mit der<br />
Erfindung der Dampfmaschine 1769<br />
– eingeleitet wurde, prägten das<br />
Bewußtsein von der Rückständigkeit<br />
der allgemeinen wie auch der bayerischen<br />
Verhältnisse. Dieses Selbstverständnis<br />
wurde<br />
bestärkt als mit dem Einsetzen<br />
der Industriealisierung in Deutschland<br />
1835 zum Zeitpunkt der Eröffnung<br />
der Ludwigs- Eisenbahn von<br />
Nürnberg nach Fürth – erstmals<br />
Massenkonsumgüter auf den Markt<br />
kamen, die die bisher handwerkliche<br />
Produktion ersetzen. Mit dem<br />
Ziel der Modernisierung sollten nun<br />
mehr naturwissenschaftliche<br />
Erkenntnisse stärker in die Technologie<br />
einbezogen werden, die die<br />
Arbeitsweise in den Werkstätten<br />
bestimmte. Daneben richtete sich<br />
nach 1820 die Aufmerksamkeit allmählich<br />
auch auf gestalterische<br />
Aspekte als wichtigen Faktor für die<br />
Marktfähigkeit.<br />
Eine wesentliche Rolle bei der<br />
Erneuerung und Förderung des<br />
Handwerks wurde der Allgemeinwie<br />
der Fachbildung beigemessen.<br />
Einen wichtigen Beitrag dazu leisteten<br />
die großen Vereine, wie z.B. der<br />
Polytechnische Verein in Würzburg,<br />
die das Ziel verfolgten die Produktionen<br />
auf den technisch-gewerblichen<br />
Fortschritt hin auszurichten.<br />
Sie vermittelten in ihren Vereinszeitschriften<br />
Orientierungen sowie spezielle<br />
Kenntnisse über Rohstoffe,<br />
Halb- und Fertigerzeugnisse, Werkzeuge,<br />
Maschinen und Arbeitsweisen.<br />
Örtliche Gewerbevereine entstanden<br />
vor allem nach 1848,<br />
manchmal gründeten sie auch Fortbildungsschulen,<br />
wie z.B 1856 der<br />
Gewerbeverein Memmingen.<br />
Gegenüber der traditionellen<br />
Ausbildung mit Lehr- und Gesellenjahren<br />
in der Werkstatt erlangte das<br />
sich entfaltende Schulwesen zunehmend<br />
an Gewicht. Manche Vereine<br />
betrieben oder förderten Zeichenund<br />
Sonntagsschulen, an deren<br />
Stelle später die gewerblichen Fortbildungsschulen<br />
traten. Andere<br />
Schulen machten es sich zur Aufgabe<br />
den kunstgewerblichen Nachwuchs<br />
auszubilden, wie ab 1855 die<br />
„Zeichen- und Modellierschule“ des<br />
117
1851 gegründeten<br />
„Vereins zur Ausbildung<br />
der Gewerke“(ab<br />
1868 Bayerischer<br />
Kunstgewerbeverein)<br />
in München oder dienten<br />
der heimischen<br />
handwerlichen Gewerbeförderung<br />
wie die<br />
1869 gegründete<br />
„Distrikts- Zeichenund<br />
Schnitzschule<br />
Werdenfels“ (Die<br />
bereits bestehenden<br />
„Filial-Zeichnungsanstalten“,<br />
Garmisch,<br />
Partenkirchen, Oberammergau<br />
und Mittenwald<br />
wurden der neu<br />
gegründeten Schule<br />
angegliedert). Ein zentralerUnterrichtsgegenstand<br />
war das<br />
Zeichnen. Von ihm<br />
wurde bei der Aneignung von Neuerungen<br />
oder von fremden Entwürfen,<br />
bei der Darstellung und Umsetzung<br />
von Arbeitsvorhaben wie allgemein<br />
für die ästhetische Erziehung<br />
große Wirksamkeit erwartet.<br />
Bedingt durch die Auflösung der<br />
alten Arbeitswelt und den Verlust<br />
118<br />
Warenproduktion im Schuljahr 1883<br />
„Distrikts-Zeichen- und Schnitzschule Werdenfels“ Partenkrichen<br />
an eigenständiger Gestaltungsqualifikation<br />
erschien die Bereitstellung<br />
von Vorlagen und Vorbildern für die<br />
Werkstatt wichtig. Man versprach<br />
sich von der Zuwendung zu diesen<br />
Vorbildern – zunächst vor allem aus<br />
der Gotik und der Renaissance –<br />
eine Wiederherstellung der alten<br />
Verbindung zwischen Kunst und<br />
Handwerk. Diese Bestrebungen verfolgte<br />
mit weitreichender Resonanz<br />
der 1851 in München entstandene<br />
Verein zur Ausbildung der Gewerke,<br />
der sich 1868 in Bayerischer Kunstgewerbeverein<br />
umbenannte, mit<br />
seiner Zeitschrift und großen Ausstellungen<br />
( Kunstgewerbeausstellungen<br />
von 1863 und 1876 im Glaspalast<br />
in München und „Deutsch-<br />
Nationale Kunstgewerbe-Ausstellung“<br />
in den Ausstellungsbauten<br />
am Isarufer). In die gleiche Richtung<br />
zielte eine Teil der Aktivitäten des<br />
Bayerischen Gewerbemuseums in<br />
Nürnberg, das 1872 seine Arbeit<br />
aufnahm.<br />
Ab der Jahrhundertmitte nahm<br />
die Abfolge von Kunst- und Kunstgewerbeausstellungen<br />
zu, so dass<br />
man sich laufend über den Zeitgeschmack<br />
informieren konnte. Eine<br />
erweiterte Sicht des internationalen<br />
Entwicklungsstandes handwerklicher<br />
und industrieller Produktion<br />
der bürgerlichen Gesellschaft vermittelten<br />
die Weltausstellungen,<br />
deren erste 1851 im Kristallpalast in<br />
London stattfand. Sie gab mit ihrer<br />
systematisch gegliederten Exposition<br />
von Rohstoffen – also Naturstoffen<br />
und daraus hergestellten Produkten
Ausstellungsraum der Deutschen Kunst- und Industrieausstellung 1876 in München<br />
und Maschinen einen aufschlußreichen<br />
Überblick.<br />
Zu einer wichtigen technischen<br />
Informationsquelle auch für das<br />
bayerische <strong>Schreinerhandwerk</strong> wurden<br />
Ausstellungen in München<br />
(1854 „Allg. deutsche Industrie-<br />
Ausstellung“ im Glaspalast sowie<br />
1888 und 1889 „Kraft- und Arbeits-<br />
maschinen- Ausstellung“) und<br />
Nürnberg (1882, 1896 „Landes -<br />
Industrie -Gewerbe- und Kunstaustellung“).<br />
Sie zeigten den Stand<br />
der Entwicklung der Maschinen-,<br />
Elektro- und Werkzeugtechnik und<br />
stellten Anwendungsbereiche vor.<br />
Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts<br />
nahm der Einsatz von<br />
Holzbearbeitungsmaschinen in den<br />
Betrieben stetig zu. Damit stieg<br />
auch die Zahl der Arbeitsunfälle, da<br />
es eine gezielte Unterweisung im<br />
sicheren Umgang mit Holzbearbeitungsmaschinen<br />
noch nicht gab,<br />
Schutzvorrichtungen unzureichend<br />
waren oder fehlten, so dass deren<br />
sachgerechter Einsatz nur sehr<br />
bedingt oder gar nicht stattfand.<br />
Zum anderen stellten die Dampfmaschinen,<br />
die im letzten Drittel des<br />
Jahrhunderts zunehmend als<br />
Antriebsmaschinen verwendet wurden,<br />
ein großes Gefahrenpotential<br />
dar. Aufgrund des hohen Drucks<br />
des Wasserdampfes im Kessel und<br />
mangelhafter Wartung kam es<br />
immer wieder zu Explosionen, die<br />
verheerende Zerstörungen, zahlreiche<br />
Unfälle und Todesopfer zur<br />
Folge hatten. Dies hatte dazu<br />
geführt, dass u.a. Dampfmaschinen<br />
zu den sog. „überwachungsbedürftigen“<br />
Betriebsanlagen gehörten,<br />
die einer staatlichen Überprüfung<br />
unterlagen.<br />
Die Gewerbeordnung des Norddeutschen<br />
Bundes von 1869, die<br />
seit 1873 auch für <strong>Bayern</strong> galt, enthielt<br />
die Verpflichtung zur Durchführung<br />
des Unfall- und Gesund-<br />
119
Blick in die Maschinenhalle der Landesausstellung 1896 auf dem Maxfeld in Nürnberg<br />
heitsschutzes, aufgrund der seit<br />
1839 erlassenen Gesetze. Für den<br />
Vollzug der in ihr enthaltenen<br />
Gesetze waren Fabrikinspektoren<br />
zuständig. Dadurch vollzog sich<br />
kurze Zeit später die Umbenennung<br />
der Fabrikinspektoren in Gewerbeaufsicht.<br />
Damit war die Frage der sozialen<br />
Sicherung von Arbeitern, die einen<br />
Arbeitsunfall erlitten hatten, jedoch<br />
nicht geklärt. Sie fand eine Antwort<br />
erst in der Fassung des ersten<br />
120<br />
Unfallversicherungsgesetz von 1884,<br />
dem ersten in der Welt. Es war - im<br />
Rahmen der Bismarckschen Sozialgesetzgebung<br />
im Deutschen Kaiserreich<br />
von 1883-89 – nach mehreren<br />
Gesetzesvorlagen und nach langen<br />
Diskussionen verabschiedet worden.<br />
Diese Erörterungen wurden vor<br />
dem Hintergrund einer bereits<br />
bestehenden Tradition der sozialen<br />
Fürsorge in Teilen der Gesellschaft<br />
geführt. Die im patriarchalischen<br />
Verhältnis von Meister zu Gesellen<br />
und Lehrling gewachsene Fürsorge-<br />
pflicht setzte sich nicht aus sich heraus<br />
in dem Verhältnis von Unternehmer<br />
zu Arbeitnehmer in Fabriken<br />
fort. Eine – gleich aus welchen<br />
Motiven entstandene – Übertragung<br />
der sozialen Verantwortung für den<br />
abhängig Beschäftigten auf Arbeitsverhältnisse<br />
in Fabriken war dringend<br />
notwendig geworden.<br />
Dies Gesetz forderte die Bildung<br />
von Berufsgenossenschaften und<br />
bildete mit der Aufnahme der<br />
Arbeit der Holzberufsgenossenschaft<br />
im Jahr 1885 auch die<br />
Grundlage für deren Aktivitäten. Die<br />
branchenbezogenen, selbstverwalteten<br />
Genossenschaften mit ihren<br />
vom Gesetz geregelten Aufgaben<br />
waren umso erfolgreicher, je größer<br />
die Zahl der pflichtversicherten Mitglieder<br />
war. Viele Betriebe waren<br />
weder erfasst noch angemeldet und<br />
sträubten sich gegen eine Anmeldung<br />
unter Verneinung ihrer Versicherungspflicht.<br />
Vorbereitende<br />
Arbeiten bestanden darin, aus den<br />
700 zur Holz-BG gehörigen Gewerben<br />
ausreichend große Gruppen<br />
vergleichbaren Risikos zu bilden und<br />
die Aufstellung eines für alle Tätigkeiten<br />
und Gewerbezweige gerechten<br />
Gefahrtarifs. Erfahrungswerte<br />
gab es nicht. Zum anderen erfolg-
ten häufig zeitgemäße Ergänzungen<br />
und Veränderungen, so wurde z.B.<br />
1887 die Versicherungspflicht auf<br />
handwerksmäßige Bauschreinereien<br />
erweitert. Dies alles führte in den<br />
ersten Jahren der Arbeit der Berufsgenossenschaft<br />
zu mehreren Beitragserhöhungen<br />
und Unklarheiten<br />
darüber, welche Betriebe zur Mitgliedschaft<br />
verpflichtet waren. Der<br />
hohe Beitragssatz, dessen mehrmalige<br />
Erhöhung und die letzliche Erfassung<br />
aller Betriebe, wurden vom<br />
<strong>Schreinerhandwerk</strong> heftig kritisiert.<br />
Hinzu kamen Probleme aufgrund<br />
der Doppelzuständigkeit von staatlicher<br />
Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaften.<br />
Sie betrafen die<br />
Aufsicht sowohl in ihrer Organisation<br />
und Durchführung als auch<br />
hinsichtlich der Rechtsvorschriften,<br />
die von der jeweiligen Aufsichtsperson<br />
zu überwachen waren. Wegen<br />
mangelnder Abstimmung der<br />
Zuständigkeiten kam es zu widersprüchlichen<br />
Anordnungen im<br />
Betrieb und zu Überschneidungen<br />
der Betriebsrevisionen. Diese negativen<br />
Auswirkungen der Doppelzuständigkeit<br />
blieben im wesentlichen<br />
weiter bestehen, auch nachdem<br />
1900 durch das Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz<br />
eine rechtliche<br />
Klarstellung erfolgte.<br />
Danach wurden die Berufsgenossenschaften<br />
verpflichtet, durch technische<br />
Aufsichtsbeamte die Einhaltung<br />
der Unfallverhütungsvorschriften<br />
zu überwachen.<br />
Informationsmangel seitens der<br />
Betriebe war sicherlich auch eine<br />
der Ursachen, weshalb in der<br />
Anfangsphase die Tätigkeiten der<br />
Beauftragten der Holzberufsgenossenschaften,<br />
die der Umsetzung<br />
und Überwachung der Unfallverhütungsvorschriften<br />
galten, Empörung<br />
und heftige Diskussionen auslösten.<br />
Ein weiteres Problem für die<br />
Schreinereibetriebe stellte die Höhe<br />
der festgesetzten Brandschutzversicherungsbeiträge<br />
dar.<br />
Aufgrund mangelnden Sicherheitsvorkehrungen,<br />
der Staubentwicklung,<br />
Art der Holz- und Spänelagerung,<br />
Ofenheizung, Ofentisch<br />
für die Heißverleimung, Reibungswärme<br />
beim Maschineneinsatz und<br />
der Kraftübertragung sowie – wenn<br />
vorhanden durch maschinelle<br />
Antriebsaggregate – und vor allem<br />
durch das Gefahrenpotential der<br />
Dampfmaschinen gab es in den<br />
Schreinereien und Fabriken häufig<br />
Brände. Versicherungsschutz für<br />
Brandschäden im industriellen und<br />
gewerblichem Bereich wurde zur<br />
damaligen Zeit fast ausnahmslos nur<br />
von privaten Feuerversicherungsgesellschaften<br />
angeboten. Bereits<br />
1871 hatte sich der Verband der privatenFeuerversicherungsgesellschaften<br />
gegründet. Er wuchs zu<br />
einem Syndikat heran, Versicherungsgesellschaften<br />
bildeten Kartelle,<br />
die unter Ausschluss des Wettbewerbs<br />
die Prämienhöhe und Versicherungsbedingungen<br />
regelten. In<br />
der Wirtschaft regte sich immer<br />
mehr Widerstand. Nicht zuletzt aus<br />
diesem Grund wurde 1875 in <strong>Bayern</strong><br />
das Gesetz zur Errichtung der<br />
„Königlichen Brandversicherungs -<br />
Kammer“ erlassen. Damit wurde die<br />
seit 1811 tätige Landesbrandversicherungsanstalt<br />
, die Rechtsvorgängerin<br />
der Bayerischen Versicherungskammer,<br />
in die Verwaltung<br />
einer zentralen öffentlichen Staatsbehörde<br />
überführt. Da auch hier ein<br />
Mangel an Erfahrung bezüglich<br />
einer differenzierten Erfassung der<br />
Gefahrtarife für Schreinereien und<br />
Fabriken vorlag, führte auch dies<br />
anfänglich zu einer ungerechtfertigt<br />
hohen Einstufung der Betriebe als<br />
„feuergefährliches Handwerk“.<br />
121
Auch dieses Thema wurde auf<br />
Innungsversammlungen häufig<br />
debattiert und war Anlaß von<br />
Beschwerden vieler Schreinermeister.<br />
Noch in der ersten Jahrhunderthälfte<br />
war eine Handwerkerbewegung<br />
aus Handwerkervereinen und<br />
Gewerbevereinen entstanden, die<br />
gegen den wirtschaftlichen Liberalismus<br />
und die fortschreitende Industrialisierung<br />
ankämpfte. Sie<br />
bemühte sich um staatlichen Schutz<br />
und Förderung des Handwerks<br />
durch den Staat. Als einzelne Gruppierungen<br />
von Handwerkern nach<br />
1870 erfolglos versucht hatten, den<br />
Reichstag für ihre Anliegen zu<br />
gewinnen, bildeten sich – besonders<br />
in der Phase der Konjunktur-Krisen<br />
zwischen 1873 und 1896 - größere<br />
Interessenverbände wie z.B. der<br />
„Verein selbständiger Handwerker<br />
und Fabrikanten“ (1873) ,der „Verband<br />
bayerischer Gewerbevereine“<br />
(1874), der „Bayerischer Handwerkerbund“<br />
(1883) und der „Allgemeine<br />
Deutsche Handwerkerbund“.<br />
Als Träger der politisch orientierten<br />
Handwerkerbewegung fungierten<br />
die Handwerkertage, wie z.B. der<br />
„Allgemeine Deutsche Handwerker-<br />
122<br />
tag“, der 1888 in München stattfand.<br />
Sie alle forderten eine Veränderung<br />
der Gewerbeordnung. Das<br />
Verlangen zielte vor allem auf die<br />
notwendige Verbesserung der unzureichende<br />
Berufsausbildung, um die<br />
Qualität handwerklicher und industrieller<br />
Erzeugnisse zu verbessern<br />
und damit mit den übrigen westeuropäischen<br />
Ländern auf dem Weltmarkt<br />
konkurrieren zu können.<br />
Unter dem Druck des handwerklichen<br />
Mittelstandes und mit Hilfe<br />
handwerksfreundlicher Parteien<br />
konnten einige Novellen zur Gewerbeordnung<br />
erzielt werden. Stationen<br />
auf dem Wege waren Gewerberechtsnovellen<br />
von 1881 bis<br />
1887, die die Innungen im Interesse<br />
der Erneuerung der Berufsausbildung<br />
wieder mit öffentlich-rechtlichen<br />
Befugnissen ausstatteten und<br />
u.a. die Befugnis zur Ausbildung<br />
von Lehrlingen auf die Mitglieder<br />
von Innungen beschränkten.<br />
Danach gründeten sich zahlreiche<br />
bayerische Schreiner-Innungen:<br />
1886 in Nürnberg, 1988 in München,<br />
1899 in Augsburg, Regensburg,<br />
Bamberg und Ingolstadt,<br />
1900 Aschaffenburg.<br />
Die entscheidenden Schritte<br />
erfolgten durch das „Handwerksge-<br />
setz „vom 26.7.1897 mit der Errichtung<br />
der Handwerkskammern und<br />
der fakultativen Zwangsinnungen<br />
sowie der Neuregelung des Lehrlingswesens<br />
und der Befugnis, den<br />
Meistertitel zu führen. Die Forderung<br />
des Handwerks nach einem<br />
Befähigungsnachweis wurde nicht<br />
erfüllt.<br />
Das Innungswesen bekam einen<br />
neuen Auftrieb, als im Jahr 1900 die<br />
Handwerkskammern gegründet<br />
wurden, so z.B. die Handwerkskammer<br />
für München und Oberbayern<br />
am 1.4.1900<br />
Die Probleme mit den Berufsgenossenschaften<br />
und der Brandversicherung<br />
waren über lange Zeit<br />
Anlass für zahlreiche Diskussionen<br />
im bayerischen <strong>Schreinerhandwerk</strong><br />
und in den bestehenden Innungen<br />
mit dem Ergebnis, sich zusammen<br />
zu schließen und einen gemeinsamen<br />
Verband zu gründen. Dies<br />
erfolgte schließlich mit der Gründung<br />
des „Landesverbandes Bayerischer<br />
Schreinermeister“ am 9./10.<br />
November 1902.