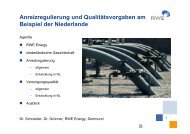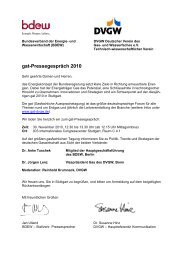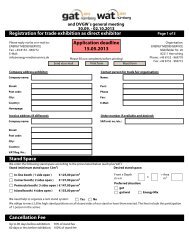Mikroelektronischer Haushaltsgaszähler EGZ-G4 D - gat
Mikroelektronischer Haushaltsgaszähler EGZ-G4 D - gat
Mikroelektronischer Haushaltsgaszähler EGZ-G4 D - gat
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
TECHNIK<br />
<strong>Mikroelektronischer</strong> <strong>Haushaltsgaszähler</strong><br />
<strong>EGZ</strong>-<strong>G4</strong><br />
In der hier vorgestellten Neuentwicklung wird aktuellste „Sensor on-chip“ Technologie eingesetzt, um<br />
das mehr als 150 Jahre alte Prinzip der Haushalts- und Gewerbegaszähler in eine neue Ära zu führen.<br />
Das neue Gerät der EMS PATVAG AG ist klein und handlich, misst unabhängig von Temperatur und<br />
Druck und kann mit diversen Schnittstellen bzw. Fernauslesemodulen kombiniert werden.<br />
D<br />
ie europäischen Energiemärkte befinden<br />
sich im Umbruch. Zunehmende<br />
Marktliberalisierungen, neue gesetzliche<br />
Auflagen, wie z. B. die neue „Energieeffizienzrichtlinie“<br />
oder die neue „Messstellenzugangsverordnung“<br />
für Deutschland<br />
sowie eine zunehmende Kundenfokussierung<br />
erfordern neue Ansätze in der Messund<br />
Abrechnungssystematik. „Smart Metering“<br />
heißt das Zauberwort. Was bedeutet<br />
dies nun für die Energieversorger, welche<br />
Maßnahmen müssen im Messwesen<br />
getroffen werden? Eines ist klar, die Messtechnik<br />
wird modernisiert und die Kundenorientierung<br />
gewinnt im zunehmend härteren<br />
Wettbewerb an Wichtigkeit.<br />
Erdgas hat weltweit gesehen einen Anteil<br />
von ca. 25 Prozent am Gesamtenergieverbrauch<br />
– Tendenz steigend. In einigen Län-<br />
26<br />
Kunde<br />
Bedürfnisse:<br />
- Individualisierung<br />
- Transparenz<br />
Strom Wärme<br />
COM<br />
Gas Wasser<br />
COM<br />
COM<br />
COM COM<br />
Abb. 1: Übersicht Smart-Metering-Landschaft<br />
dern innerhalb Europas ist der Anteil noch<br />
höher, beispielsweise werden in Deutschland<br />
mehr als 75 Prozent der neu erstellten<br />
Wohnungen mit Erdgas beheizt [1]. Um die<br />
Erdgasbezüge der einzelnen Erdgaskunden<br />
zu messen, werden Gaszähler benötigt.<br />
In Haushalten und im gewerblichen<br />
Bereich kommen heute überwiegend so<br />
genannte Balgengaszähler zur Anwendung.<br />
Der jährliche Bedarf an solchen<br />
Messgeräten liegt weltweit bei ca. 20 Millionen<br />
Einheiten, mit einem Gesamtmarktwert<br />
von etwa 1 Milliarde Euro. Balgengaszähler<br />
haben sich weit über 100 Jahre als<br />
zuverlässig erwiesen, allerdings haben sie<br />
auch gravierende Mängel: Sie messen<br />
druck- und temperaturabhängig, sind groß<br />
und schwer und eignen sich nur schlecht<br />
für die immer wichtiger werdende Zählerfernauslesung.<br />
Kundenbeziehung<br />
EVU<br />
Bedürfnisse:<br />
- Billingprozesse<br />
- Produktmanagement<br />
- Netzmanagement<br />
- Datenmanagement<br />
Quelle: EMS-PATVAG<br />
Smart Metering<br />
Die Disziplin Smart Metering beschreibt<br />
die Messung von Energieverbrauchsdaten<br />
mit anschließender Übermittlung und<br />
Verarbeitung beim Energieversorgungsunternehmen.<br />
Dies betrifft hauptsächlich<br />
den Bereich Strom, jedoch auch Gas,<br />
Wärme und Wasser. Die Politik möchte<br />
durch Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen<br />
im Bereich Messung<br />
und Abrechnung mehr Transparenz in die<br />
Energieabrechnungen bringen, was dem<br />
Konsumenten entgegenkommen und<br />
schlussendlich den Gesamtenergieverbrauch<br />
senken soll. Aus diesem Grund<br />
beschloss die deutsche Bundesregierung<br />
am 6. Juni 2008, dass das Messwesen<br />
für Strom und Gas liberalisiert werden soll.<br />
Mit der Änderung des Energiewirtschaftgesetzes<br />
(EnWG) und der neuen Messstellenzugangsverordnung<br />
wird diese<br />
neue gesetzliche Grundlage ab Ende Juli<br />
2008 in Kraft gesetzt. Ab diesem Zeitpunkt<br />
bekommt Smart Metering eine<br />
neue Bedeutung, es wird Pflicht.<br />
Smart Metering kann für Energieversorgungsunternehmen<br />
eine große Chance<br />
darstellen (Abb. 1); folgende Vorteile können<br />
resultieren, wenn Kundendaten präzise<br />
und nicht zeitverzögert beim Versorger<br />
sind:<br />
• Prozessoptimierung für Ablesung und<br />
Verrechnung aller Medien (Strom/Gas/<br />
Wasser/Wärme),<br />
• verbessertes Netz- und Datenmanagement,<br />
Optimierung des Energiehandels,<br />
• Produkte nach individuellen Verbrauchsverhalten<br />
der Kunden (Mehrwert auch für<br />
Kunde),<br />
• Integration von erneuerbaren Energien<br />
nach Bedarf,<br />
• Transparenz gegenüber dem Kunden, bei<br />
Bedarf monatliche Rechnungsstellung,<br />
• Kundenbindung, Differenzierung gegenüber<br />
auftretenden Konkurrenten.<br />
energie | wasser-praxis 9/2008
Die Umstellung auf Smart Metering bedarf<br />
neuer Mess- und Kommunikationsgeräte,<br />
die präzise Verbrauchsdaten aufnehmen<br />
und dem Energieversorger übermitteln<br />
können. Ein Gerät, welches all diese Erwartungen<br />
und Bedürfnisse deckt, ist der<br />
neue Gaszähler von EMS PATVAG, welcher<br />
hier näher vorgestellt wird (Abb. 2).<br />
Die thermische Durchflussmessung<br />
Thermische Durchflusssensoren basieren<br />
normalerweise auf der Kühlung eines erwärmten<br />
Objektes im Fluss. Die im <strong>EGZ</strong>-<strong>G4</strong><br />
zur Anwendung kommenden CMOS (Complementary<br />
Metal-Oxide Semiconductor)<br />
Durchflusssensoren bedienen sich der Temperaturdifferenz<br />
von zwei bezüglich des Mikroheizers<br />
symmetrisch stromauf- und<br />
stromabwärts angebrachten Temperaturfühlern.<br />
Fließt kein Gas über den Sensor,<br />
messen die beiden Temperaturfühler im<br />
Heizmoment, d. h. während der Mikroheizer<br />
stromdurchflossen ist und sich dabei gegenüber<br />
der Umgebungstemperatur um einige<br />
Grad erwärmt, die gleiche Temperaturerhöhung.<br />
Fließt nun ein Gasstrom über das<br />
Sensorelement, wird diese Symmetrie gestört.<br />
Zwischen den beiden Temperatursensoren<br />
entsteht eine Temperaturdifferenz, die<br />
gemessen wird. Dieses, in der Form einer<br />
Spannungsdifferenz anliegende, Temperaturdifferenzsignal<br />
wird im Analogteil des<br />
Sensorchips aufbereitet und anschließend<br />
digitalisiert. Diese spezielle Art der thermischen<br />
Durchflussmessung zeichnet sich<br />
unter anderem durch den hohen Messeffekt<br />
und die weit gehende Unabhängigkeit gegenüber<br />
Temperatur- und Druckeinflüssen<br />
aus (Abb. 3).<br />
Der in enger Zusammenarbeit mit der Firma<br />
Sensirion in Stäfa (CH), einem „Spinoff“<br />
des Physikalisch Elektronischen Labors<br />
(PEL) der ETH Zürich, entwickelte und für<br />
diese Anwendung optimierte Halbleiter-<br />
Chip beinhaltet auf rund 16 mm 2 einen<br />
Sensorteil sowie eine analoge und eine digitale<br />
Elektronik für die Signalaufbereitung.<br />
Mit einer elektrischen Gesamtleistung von<br />
ca. 0,2 mW ist es möglich, den neuen Gaszähler<br />
mit einer Lithium-Thyonilchlorid Batterie<br />
über 16 Jahre lang zu betreiben.<br />
Der aus Polysilizium gefertigte, mikrothermische<br />
Sensor misst den durchflussabhängigen<br />
Wärmetransport des über ihn<br />
strömenden Gases (Abb. 4). Der sich in<br />
der Mitte der Anordnung befindende integrierte<br />
Heizer wird in einem quasi-periodischen<br />
Pulsbetrieb mit einigen mW Heizleistung<br />
P el erwärmt. Bei einer Fließgeschwindigkeit<br />
ν des Gases und einer konstanten<br />
Heizleistung P el bildet sich eine Tempera-<br />
Gas Flow<br />
Temperature Sensors<br />
Abb. 3: Prinzipschema der thermischen Durchflussmessung<br />
turdifferenz ΔT(ν) zwischen den beiden<br />
Temperaturfühlern. Aus ΔT(ν) wird dann die<br />
Fließgeschwindigkeit ν bestimmt.<br />
Die Temperaturdifferenz ist, bedingt durch<br />
das Messprinzip, von den physikalischen<br />
Eigenschaften des strömenden Gases abhängig.<br />
Um die Gasabhängigkeit des Sensorsignals<br />
herzuleiten, muss die zugehörige<br />
Differenzialgleichung betrachtet werden.<br />
Für einen Kanal mit einem Durchfluss in x-<br />
Richtung mit Wärmeerzeugung nur in den<br />
Wänden des Kanals kann die Gleichung<br />
annähernd geschrieben werden als [2]:<br />
∂ 2 T ∂ 2 T ∂ 2 T ⎧ν x⎫ ∂<br />
––– + ––– + ––– = –– –– (T) (1)<br />
∂x 2 ∂y 2 ∂z 2 ⎩ α⎭∂x<br />
wobei ν x die axiale Flussgeschwindigkeit<br />
und α die Diffusivität sind; Letztere definiert<br />
als ν = λ/c p ρ mit λ der thermischen Leitfähigkeit,<br />
c p der spezifischen Wärmekapazität<br />
und ρ der Gasdichte. Damit zeigt sich, dass<br />
1/α denselben Einfluss auf das Sensorsignal<br />
hat wie die Änderung der axialen Durchflussgeschwindigkeit<br />
ν x . Aus Gleichung 1 ist<br />
ebenfalls ersichtlich, dass es sich bei der<br />
thermischen Durchflussmessung nicht um<br />
eine Betriebsvolumen-, sondern um eine<br />
Normvolumenmessung handelt, was nachfolgend<br />
dargelegt wird. Da proportional zu<br />
Abb. 2: Bild des<br />
neuen elektronischen<br />
Gaszählers, der<br />
auf einem mikrothermischen<br />
CMOS-<br />
Durchflusssensor<br />
basiert – Abmaße:<br />
97 mm x 97 mm<br />
ρ · ν x gemessen wird, ist diese Methode<br />
prinzipiell temperatur- und druckunabhängig.<br />
Mit einer Korrektur, auf die hier nicht im<br />
Detail eingegangen werden soll, welche auf<br />
einer periodischen Messung der thermischen<br />
Leitfähigkeit λ des Gases basiert,<br />
wird im Gaszähler <strong>EGZ</strong>-<strong>G4</strong> diese auf den<br />
ersten Blick ne<strong>gat</strong>ive Eigenschaft der thermischen<br />
Durchflussmessmethode weit gehend<br />
kompensiert. Darüber hinaus wird die<br />
Möglichkeit dieser einfachen Gasartenerkennung<br />
im neuen Gaszähler benutzt, um<br />
am Display anzuzeigen, ob sich Luft in der<br />
Gasleitung befindet. Diese Anzeigemöglichkeit<br />
kann auch als Indikator für eine unzulässige<br />
Manipulation verwendet werden, indem<br />
der Gaszähler anzeigt, ob er sich nach<br />
dessen Einbau zeitweise in Kontakt mit Luft<br />
befand oder temporär deinstalliert wurde.<br />
Der mechanische Aufbau<br />
Die thermische Durchflussmessung ist an<br />
sich eine bekannte Messmethode. Die<br />
große Herausforderung bei der Entwicklung<br />
eines neuen Gaszählers war das Erfüllen<br />
der äußerst strengen Vorgaben bezüglich<br />
des elektrischen Leistungsbedarfs,<br />
der Langlebigkeit, des Messbereichs<br />
und der Messgenauigkeit. Die<br />
Komponenten des Gaszählers <strong>EGZ</strong>-<strong>G4</strong><br />
energie | wasser-praxis 9/2008 27<br />
Heater<br />
ca. 2,8 mm<br />
Silicon<br />
Silicon nitrite (glass)<br />
Gap for<br />
pressure<br />
equalisation<br />
Quelle: EMS-PATVAG<br />
Quelle: Sensirion
TECHNIK<br />
28<br />
Abb. 4: CMOS Durchflusssensor mit 2,8 x 5,8 mm 2<br />
Abb. 5: Funktionsprinzip und Schnittbild des neuen elektronischen Gaszählers<br />
Abb. 6: Explosionszeichnung des neuen Gaszählers<br />
Sensor<br />
Batterie<br />
EEPROM Regulator<br />
MSP430<br />
Durchflusssensor<br />
Supply<br />
SPI<br />
GRUNDFUNKTIONEN<br />
Abb. 7: Blockdiagramm der Gaszählerelektronik<br />
μc<br />
LCD<br />
Anzeige<br />
SCI<br />
Kalibrierung<br />
Automatische<br />
Zählerauslesung<br />
Kommunikation<br />
ERWEITERTE<br />
FUNKTIONEN<br />
Quelle: Sensirion<br />
Quelle: EMS-PATVAG<br />
Quelle: EMS-PATVAG<br />
Quelle: EMS-PATVAG<br />
wurden einzeln und unter Verwendung<br />
von Computer-Fluid-Dynamik-Simulationen<br />
und Berechnungen sowie den neusten<br />
Erkenntnissen auf dem Gebiet der Materialwissenschaft<br />
entwickelt.<br />
Der Gaszähler ist als Bypass-Konstruktion<br />
ausgelegt (Abb. 5). Der im Hauptgasfluss<br />
angebrachte „Pressure Dropper“ erzeugt<br />
bei maximaler Erdgas-Durchflussrate von<br />
6 m 3 /h einen Druckabfall von 0,8 mbar. Weniger<br />
als 1 Prozent des Gases wird dadurch<br />
gezwungen, durch den Bypass und über<br />
den Sensor zu strömen. Mit dieser Bypasskonstruktion<br />
kann eine große Messdynamik<br />
von ca. 150 zu 1 erzielt werden.<br />
Bezüglich der angestrebten hohen Messdynamik<br />
war die genaue Auslegung des<br />
Hauptrohres mit „Pressure Dropper“ und<br />
dem Bypass von großer Bedeutung. Um sowohl<br />
für kleine Durchflussmengen einen hohen<br />
Messeffekt als auch für hohe Flüsse stabile<br />
Verhältnisse zu haben, mussten die laminaren<br />
und turbulenten Strömungsanteile beider<br />
Pfade aufeinander abgestimmt werden.<br />
Für eher blendenartige Rohrverengungen<br />
ergeben sich hohe turbulente Strömungsanteile<br />
und der erzeugte Druckabfall Δp in<br />
Funktion des Volumenflusses kann beschrieben<br />
werden mit der Gleichung [3]:<br />
1 ξp<br />
Δp = ––– · ––– · Φ2 v 2<br />
A 2 ƒc<br />
(2)<br />
Wobei A 2 ƒc für den offenen Querschnitt der<br />
Lochblende, ρ für die Gasdichte, ξ als dimensionsloser<br />
Formfaktor der Blende und<br />
Φ v für den Volumenstrom stehen. Es ergibt<br />
sich also ein Differenzdruck, der proportional<br />
zum Quadrat der Durchflussgeschwindigkeit<br />
ist. Damit ist dieser Teil des erzeugten Differenzdruckes<br />
klein für kleine Durchflussraten,<br />
aber sehr groß für große Durchflussraten.<br />
Betrachtet man eher röhrenförmige Differenzdruckerzeuger,<br />
dann ist das Strömungsprofil<br />
in einer solchen Kapillare laminar<br />
und Δp entsteht vor allem durch viskose<br />
Reibungsverluste. Daraus ergibt sich eine<br />
lineare Beziehung zwischen erzeugtem<br />
Differenzdruck und Durchflussrate entsprechend<br />
der folgenden Gleichung [3]:<br />
L μCƒ<br />
Δp = –––––– · –––– · Φv 2<br />
A ƒc D 2 h<br />
(3)<br />
Hierin beschreibt Cƒ den Reibungskoeffizienten,<br />
der von der Form der Kapillare abhängig<br />
ist. Im Gegensatz zur blendenförmigen<br />
Geometrie zeigt sich hier eine konstante<br />
Sensitivität des erzeugten Differenzdruckes<br />
zur Durchflussrate über den<br />
ganzen Durchflussbereich.<br />
energie | wasser-praxis 9/2008
In älteren Versorgungsnetzen können sich<br />
z. B. durch rostige Rohre kleine Teilchen<br />
im Gas suspendieren. Dies ist allerdings<br />
nur beschränkt möglich, da die Fließgeschwindigkeiten<br />
im betrachteten Anwendungsgebiet<br />
sehr gering sind. Die Massenträgheit<br />
der sich möglicherweise im<br />
Gasstrom befindenden Partikel verhindert<br />
ein Eindringen in den Bypassbereich, womit<br />
der Sensor vor Verschmutzungen geschützt<br />
ist – ein weiterer Vorteil der Bypassmethode.<br />
Durch die für diesen<br />
Zweck am besten geeignete Beschichtung<br />
für Halbleitersensoren (Si 3N 4, Siliziumnitrid)<br />
wird der Sensor zusätzlich gegen<br />
Korrosion geschützt.<br />
Ein weiterer wichtiger Vorteil des neuen Gaszählers<br />
ist die geringe Anzahl der Komponenten<br />
und der einfache Zusammenbau, der<br />
größtenteils automatisiert werden kann (Abb.<br />
6). Dies hat wiederum einen positiven Effekt<br />
auf die Herstellungskosten des Gerätes.<br />
Der Gaszähler der EMS PATVAG hat keine<br />
beweglichen Teile, was seine mechanische<br />
Anfälligkeit minimiert. Diese Konstruktionsund<br />
Messart hat zudem den Vorteil, dass<br />
keine störenden Geräusche auftreten. Der<br />
Gaszähler besticht durch die kleine, hand-<br />
liche Bauart, was ihn in Punkto Logistik<br />
und Optik klar bevorteilt. Ein <strong>EGZ</strong>-<strong>G4</strong> entspricht<br />
in der Baugröße etwa einem Zehntel<br />
eines <strong>G4</strong>-Balgengaszählers. Bei größeren<br />
Versionen des <strong>EGZ</strong> wird dieser Vorteil<br />
noch beträchtlicher werden.<br />
Die Messtechnik<br />
Die Messfehler eines herkömmlichen Balgengaszählers,<br />
der den Betriebsvolumendurchfluss<br />
misst, können bei ungünstigen<br />
äußeren Verhältnissen – bezogen<br />
auf den Normvolumenfluss – beträchtlich<br />
sein. Die Temperatur- und<br />
Luftdruckschwankungen am Ort des<br />
Gaszählers wirken direkt auf das Messresultat<br />
ein, wie dies vereinfacht mit der<br />
universellen Gasgleichung [4]:<br />
p · V<br />
––––– = const (4)<br />
T<br />
gezeigt werden kann.<br />
Diese Darstellung besagt, dass sich das<br />
Messergebnis bezüglich Luftdruck um 0,1<br />
%/mbar und bezüglich der Temperatur um<br />
zusätzlich 0,37 %/°C ändert. Es ist also entscheidend,<br />
wie ein Balgengaszähler beim<br />
Kunden eingebaut ist. Entsprechend gestal-<br />
tet sich der jeweilige Fehler, der eine direkte<br />
Auswirkung auf die Energieabrechnung hat.<br />
Der Gaszähler <strong>EGZ</strong>-<strong>G4</strong> zeigt das Volumen<br />
unabhängig von Luftdruck und Temperatur<br />
an. Außerdem zeigt der neue Gaszähler<br />
neben der total verbrauchten Gasmenge<br />
auch den momentanen Durchflusswert an,<br />
was für den Endkunden einen praktischen<br />
Zusatznutzen darstellt.<br />
Für einen Gaskunden, der mit Erdgas heizt<br />
oder kocht, ist die Energie E entscheidend,<br />
die mit dem Erdgas geliefert wird. Bei der<br />
Verwendung von Balgengaszählern wird<br />
jedoch der über eine bestimmte Zeitperiode<br />
integrierte Volumenstrom V · (p,T) zur<br />
Bestimmung der konsumierten Gasenergie<br />
bestimmt, der dann vom Gasversorger<br />
mit einem für die Periode i gemittelten<br />
Brennwert H – n (i) multipliziert wird:<br />
E = H – n (i) · ∫ iV · (p,T) · dt (5)<br />
Für die Referenztemperatur, auf welche der<br />
Brennwert des Gases bezogen ist, wird heute<br />
normalerweise 15 °C gewählt (nach<br />
DVGW-Arbeitsblatt G 685). Wenn es am<br />
Standort des Gaszählers wärmer ist, be-<br />
Zustandsüberwachung in Bestform<br />
Das Kamstrup Inspektionssystem für Gas-Druckregelanlagen<br />
• Überwachung von GDR-Anlagen bis PN 100.<br />
• Senkung der Instandhaltungskosten.<br />
• Passt in allen Instandhaltungsstrategien.<br />
• Unterstützt DVGW Arbeitsblatt G 495 und G 1000 (TSM).<br />
• Umfangreiche Software mit integrierten Funktionen für Trendanalysen.<br />
• Personenunabhängige, objektive, reproduzierbare und standardisierte<br />
Inspektionen und Funktionsprüfungen.<br />
• Menüführung für Inspektionen und Funktionsprüfungen.<br />
• Drahtloser Datenaustausch für optimale Bewegungsfreiheit.<br />
• Systemintegration in Betriebsmanagementsysteme.<br />
• Einstellungen der GDR-Anlage müssen nicht verändert werden.<br />
• Explosionssichere Ausführung für ATEX Zone 2.<br />
• Bewährte Technologie vom Marktführer für intelligente<br />
Inspektionssysteme für Gas-Druckregelanlagen.<br />
Kamstrup<br />
Werderstrasse 23-25<br />
D-68165 Mannheim<br />
TEL: +49 (0) 621 321 689 60<br />
FAX: +49 (0) 621 321 689 61<br />
info@kamstrup.de<br />
www.kamstrup.de<br />
energie | wasser-praxis 9/2008 29
TECHNIK<br />
zahlt der Kunde pro 3 °C ein Prozent zu viel<br />
für die von ihm bezogene Erdgasenergie. Bezüglich<br />
des nach der barometrischen Höhenformel<br />
gegebenen geodätischen, also<br />
höhenabhängigen, Luftdrucks p h in kPa, mit<br />
h als geodätischer Höhe (Meter über Meer)<br />
in km [4]:<br />
⎡ 6,5 · h ⎤5,255 ph = 101,3 kPa ·<br />
⎣<br />
1- ––––––– (6)<br />
288 km ⎦<br />
30<br />
Abb. 8: Elektronik des Gaszählers: Stromverbrauch und Zuverlässigkeit prägen die Elektronik<br />
müssen die Energieversorger heute für die<br />
Berechnung der bezogenen Gasenergie<br />
den Brennwert je nach geodätischer Höhe<br />
des Bezugsortes variieren. In Deutschland<br />
ist eine Abstufung von maximal 100 Meter<br />
vorgeschrieben.<br />
Der Gaszähler von EMS PATVAG misst den<br />
Gasverbrauch unabhängig vom Luftdruck.<br />
Der Brennwert bleibt für die Verrechnung<br />
von Ascona (200 m ü. M.) bis Zermatt<br />
(1.620 m ü. M.) derselbe. Die Anzeige erfolgt<br />
in Normvolumen bezogen auf 15 °C<br />
und 1013,25 mbar.<br />
Anforderungen an die Elektronik<br />
Der Sensor des elektronischen Gaszählers<br />
kann als das Herzstück bezeichnet werden.<br />
Daneben wird aber eine „Zentrale“ benötigt,<br />
welche alle Abläufe koordiniert und steuert.<br />
Diese Aufgabe übernimmt ein Mikrocontroller.<br />
Er initiiert die Messung zum richtigen<br />
Durchflussmessung<br />
Aktive Zeit der CPU<br />
Bestimmung der<br />
Gaszusammensetzung<br />
Kontrollmessung<br />
Zeitpunkt, liest den bereits kalibrierten<br />
Messwert in digitaler Form aus dem Sensor<br />
und verrechnet die Informationen, sodass<br />
verschiedene Werte über das Display oder<br />
die Schnittstelle angezeigt werden können.<br />
Zusätzlich werden verschiedene Überwachungsaufgaben<br />
abgearbeitet, wie zum<br />
Beispiel das Batteriemanagement oder das<br />
Management des nichtflüchtigen Speichers<br />
(EEPROM) (Abb. 7).<br />
Neben den in der Industrieelektronik üblichen<br />
Anforderungen wie Zuverlässigkeit,<br />
einfache Wartung und lange Verfügbarkeit<br />
der Komponenten, ist es beim elektronischen<br />
Gaszähler zusätzlich der niedrige<br />
Stromverbrauch, dem ein hoher Stellenwert<br />
zugemessen werden musste. Außerdem<br />
möchte man die Vorteile des elektronischen<br />
Gaszählers nutzen, in dem man den Zähler<br />
über ein Fernauslesesystem (AMR, Automatic<br />
Meter Reading) abfragen kann.<br />
Low-Power System<br />
Beim elektronischen Gaszähler handelt es<br />
sich um ein autonomes, batteriebetriebenes<br />
Gerät. Um eine möglichst lange Betriebsdauer<br />
des Systems zu gewährleisten,<br />
muss der Stromverbrauch möglichst<br />
tief gehalten werden. Beim EMS PATVAG<br />
Gaszähler kommen fast ausschließlich<br />
Komponenten für Low-Power-Systeme<br />
Abb. 9: Die obere Kurve zeigt<br />
die verschiedenen Messmodi<br />
(Monitormessung: Messung mit<br />
reduzierter Auflösung und<br />
daher reduziertem Stromverbrauch,<br />
Accurate-Messung:<br />
Messung mit hoher Auflösung,<br />
- Messung: Gasbestimmung).<br />
Die untere Kurve zeigt, wie klein<br />
das Verhältnis zwischen Aktivund<br />
Standby-Modus Zeit im<br />
System ist (Signal high, entspricht<br />
ca. 0,2 % der Zeit).<br />
Quelle: EMS-PATVAG<br />
zur Anwendung. Dabei ist zum Beispiel für<br />
den Mikrocontroller nicht die Rechenleistung<br />
oder der Stromverbrauch alleine das<br />
ausschlaggebende Kriterium, sondern der<br />
Quotient aus Rechenleistung und Stromverbrauch.<br />
Andere wichtige Komponenten<br />
für ein Low-Power-System können<br />
Verstärker oder Spannungsregler sein.<br />
Hier ist vor allem der Ruhestrom ausschlaggebend.<br />
Entsprechend der Anwendungen<br />
können auch diese Komponenten<br />
beim <strong>EGZ</strong> in einen Standby-Modus versetzt<br />
werden.<br />
Ein ausgeklügeltes Strommanagement im<br />
Gaszähler berücksichtigt, dass nur diejenigen<br />
Komponenten und Funktionen aktiv<br />
sind, die auch für die aktuellen Messprozesse<br />
benötigt werden. Auf diese Weise<br />
kann die elektrische Gesamtleistung bei<br />
maximal 0,2 mW gehalten werden, was<br />
wiederum eine lange Batteriebetriebsdauer<br />
ermöglicht (Abb. 8).<br />
Ablauf der Messung<br />
Die meiste Zeit ist sowohl der Mikrocontroller<br />
als auch der Sensor in einem Low-<br />
Power- oder Sleep-Modus und nur ein Timer<br />
und der LCD-Treiber im Mikrocontroller<br />
sind aktiv. Der interne Timer signalisiert<br />
den Start einer neuen Messung und<br />
„weckt“ den Mikrocontroller mit einem Interrupt<br />
aus dem Sleep-Modus auf. Abhängig<br />
von der Vorgeschichte können drei verschiedene<br />
Messabläufe initiiert werden:<br />
Accurate-, Monitor- oder λ-Messung. Bei<br />
allen Messungen ist der Ablauf jedoch sehr<br />
ähnlich: Der Mikrocontroller programmiert<br />
Register im Sensor und parametrisiert damit<br />
die Messung. Nach dem eigentlichen<br />
Start der Messung kann der Mikrocontroller<br />
wieder in den Sleep-Modus versetzt<br />
werden. Er wird durch einen neuen Interrupt<br />
wieder aufgeweckt, sobald die Messung<br />
abgeschlossen ist und das Messresultat<br />
aus dem Sensor ausgelesen, weiter<br />
verrechnet und dargestellt werden kann<br />
(Abb. 9).<br />
energie | wasser-praxis 9/2008<br />
Quelle: EMS-PATVAG
Abb. 10 + 11: Verschiedene drahtgebundene Zählerauslesemöglichkeiten zur Datenfernauslesung<br />
Batteriebetrieb<br />
Da es sich beim Gaszähler der EMS PATVAG<br />
AG um ein batteriebetriebenes Gerät handelt,<br />
ist es wichtig, einen zuverlässigen,<br />
qualitativ hochwertigen und dauerhaften<br />
Batterietyp zu verwenden. Die Batterie<br />
muss hohe und tiefe Temperaturen aushalten<br />
können, ein für diese Anwendung geeignetes<br />
Stromprofil haben und eine möglichst<br />
geringe Selbstentladung aufweisen.<br />
Die umfangreiche Evaluation hat gezeigt,<br />
dass für die Anwendung im neuen Gaszähler<br />
eine Lithium/Thionylchlorid (Li/SOCl 2 )<br />
Batterie eingesetzt werden muss. Nur in<br />
dieser Technik lassen sich heute Zellen<br />
herstellen, die auch über mehrere Jahre<br />
hinweg eine genügend kleine Selbstentladung<br />
haben (0,2 % pro Jahr). Zusätzlich<br />
lassen sich diese Zellen über einen weiten<br />
Temperaturbereich einsetzen. Die Nominalspannung<br />
der Zelle liegt mit 3,6 Volt in<br />
einem Bereich, in dem sich eine Elektronik<br />
gut betreiben lässt. Die minimale elektrische<br />
Leistung des Zählers (0,2 mW) erlaubt<br />
einen Betrieb von 16 Jahren pro Batterie.<br />
Danach kann die Batterie durch eine<br />
neue ersetzt werden.<br />
Schnittstellen<br />
Bei konventionellen Balgengaszählern zur<br />
Verbrauchsmessung muss ein beträchtlicher<br />
Aufwand betrieben werden, um die<br />
Geräte elektronisch auslesen zu können.<br />
Beim <strong>EGZ</strong> liegen die Messwerte und Daten<br />
bereits in elektronischer Form vor. Eine einfache,<br />
flexible Schnittstelle im Inneren des<br />
Gaszählers stellt die Daten bereit, welche<br />
anschließend über ein Zusatzmodul weitergeleitet<br />
werden können. Derzeit ist eine<br />
M-Bus Schnittstelle (Abb. 10) oder eine<br />
RS-232 Schnittstelle (Abb. 11) in den<br />
<strong>EGZ</strong>-<strong>G4</strong> integrierbar und für die Verbrauchsabrechnung<br />
zugelassen. Damit<br />
lassen sich der momentane Zählerstand<br />
und Statusinformationen des <strong>EGZ</strong>-<strong>G4</strong> auslesen.<br />
Bei Verwendung der optional erhältlichen<br />
Recorderversion können zudem<br />
auch Lastprofile ausgelesen werden. Die<br />
M-Bus Schnittstelle kann mit einem externen<br />
Funkmodul erweitert werden, die RS-<br />
232 Schnittstelle eignet sich für die Auslesung<br />
per GSM/GPRS Modem. Ab Ende<br />
2008 wird ein <strong>EGZ</strong>-<strong>G4</strong> mit einem integrierten<br />
Funkmodul erhältlich sein, der das<br />
standardisierte M-Bus Protokoll verwendet.<br />
Offene und standardisierte Protokolle<br />
und Kommunikationspfade sind die<br />
Grundlage für die Investition und einen<br />
wirtschaftlichen Betrieb einer Smart Metering<br />
Lösung. In Abbildung 11 sind die bereits<br />
erhältlichen Zählerfernauslesemöglichkeiten<br />
dargestellt.<br />
Die Software des neuen<br />
Gaszählers<br />
Auf Grund der Anforderungen, die in erster<br />
Linie hinsichtlich des Energieverbrauches<br />
an die Hardware gestellt werden, sind die<br />
Ressourcen, die für die Software zur Verfügung<br />
stehen, relativ bescheiden. Einen<br />
weiteren Engpass stellt der zur Verfügung<br />
stehende Speicherplatz dar. Es wurde deshalb<br />
während der gesamten Entwicklung<br />
des Gaszählers darauf geachtet, dass die<br />
primären Funktionen im Vordergrund stehen:<br />
die Messung, Kumulierung und Darstellung<br />
des Gasverbrauches. Hinzu kommen<br />
weitere zwingend notwendige Funktionen,<br />
die sich aus den Vorschriften für<br />
elektronische Gaszähler ergeben. Weitere<br />
wichtige Merkmale sind die Fehlererkennung<br />
und Protokollierung im Falle von Manipulationen<br />
oder Unterbrüchen der<br />
Stromversorgung sowie die Minimierung<br />
des Energieverbrauches. So ist der Mikrocontroller,<br />
wie bereits erwähnt, im Mittel<br />
nur gerade während ca. 0,2 Prozent der<br />
Betriebszeit des Gaszählers im aktiven<br />
Modus, während der restlichen Zeit befindet<br />
er sich im Ruhezustand.<br />
Die Auslegung der Software sollte ein hohes<br />
Maß an Flexibilität aufweisen, um zukünftigen<br />
Entwicklungen und Bedürfnissen, wie<br />
z. B. weiteren Kommunikationsschnittstel-<br />
len, Rechnung tragen zu können. Bewährt<br />
hat sich in diesem Zusammenhang der Aufbau<br />
der Software aus mehreren Zustandsmaschinen,<br />
die eine sichere, übersichtliche<br />
und modulare Struktur ermöglichen.<br />
Die Messstrategien (Abb. 12) sowie die<br />
Schnittstelle zum Sensor wurden in enger<br />
Zusammenarbeit mit der Sensirion AG entwickelt.<br />
Um bei konstanten Flüssen energieintensive<br />
Präzisionsmessungen zu vermeiden,<br />
werden in der Regel Kontroll- oder<br />
Monitormessungen mit niedrigerer Auflösung<br />
durchgeführt. Wird bei einer Monitormessung<br />
eine Veränderung des Flusses<br />
festgestellt oder ist nach einer festgelegten<br />
Anzahl an Messungen keine Flussänderung<br />
mehr festgestellt worden, so wird eine<br />
präzise Messung durchgeführt. Im Weiteren<br />
kann die Wärmeleitfähigkeit λ des<br />
Gases periodisch bestimmt und zur Korrektur<br />
der Gasabhängigkeit genutzt werden.<br />
Dafür müssen weitere Parameter mit<br />
dem Sensor erfasst und ausgewertet werden.<br />
Durch Abtasten in unregelmäßigen<br />
Zeitabständen (Jitter), anstelle einer fixen<br />
Periodendauer, wird verhindert, dass der<br />
Gaszähler durch einen pulsierenden Gasfluss<br />
beeinflusst werden kann.<br />
Normen und Zulassung<br />
Der elektronische Gaszähler <strong>EGZ</strong>-<strong>G4</strong> wurde<br />
im Jahr 2007 durch die benannte Stelle ME-<br />
TAS (Schweizerisches Bundesamt für Metrologie)<br />
nach MID (Measuring Instruments<br />
Directive) zertifiziert. Der Gaszähler wurde<br />
mit der Modulprüfung B (Bauartprüfzertifikat<br />
Nr. CH-MI002-07001) und D (Konformitätszertifikat<br />
Nr. 511-00201) zertifiziert. Seither<br />
ist es in Europa gestattet, den Gaszähler in<br />
Verkehr zu bringen und für die Verrechnung<br />
von Erdgasverbrauchsmengen zu verwenden.<br />
Der Zähler ist für die Verwendung mit<br />
Erdgasen des Typs H und L (nach EN 437,<br />
ISO 12213-2) zugelassen. Die Eichgültigkeitsdauer<br />
wurde durch die jeweils zuständige<br />
nationale Behörde festgelegt. In der<br />
Schweiz beträgt diese sechs Jahre (METAS)<br />
energie | wasser-praxis 9/2008 31<br />
Quelle: EMS-PATVAG
TECHNIK<br />
und in Deutschland fünf Jahre (PTB). Diese<br />
Eichgültigkeit kann, nachdem genügend Erfahrungswerte<br />
gesammelt sein werden, in<br />
Zukunft hochgesetzt und auf ein Stichprobenverfahren<br />
erweitert werden (Losverfahren).<br />
Ein Zertifikat besteht ebenfalls für die<br />
M-Bus- und die RS-232 Schnittstelle sowie<br />
für die Recorderoption. Der DVGW und der<br />
SVGW haben den <strong>EGZ</strong>-<strong>G4</strong> ebenfalls geprüft<br />
und zertifiziert. Entsprechende Dokumente<br />
liegen vor.<br />
Druck, Einbauhöhe, Temperatur<br />
Die heute zur Anwendung kommenden<br />
Balgengaszähler messen Gas in Betriebsvolumen<br />
(V b ). Dieses gemessene Volumen<br />
muss anschließend aufwändig über Temperatur-<br />
und Druckkompensierungen in<br />
Normvolumen (V n ) umgerechnet werden.<br />
Für die gesetzlich vorgeschriebene Höhenkompensation<br />
wird die Einbauhöhe jedes<br />
32<br />
Auswertung<br />
Abb. 12: Ablaufsteuerung der Messung<br />
Monitormessung<br />
keine<br />
präzise<br />
Messung<br />
präzise<br />
Messung<br />
AGND<br />
präzise<br />
Messung<br />
Temp.<br />
Delta λ<br />
Temp.<br />
Oberlauf<br />
keine<br />
λ-Messung<br />
λ-Messung<br />
Temp.<br />
Unterlauf<br />
Zählers erfasst und im Verrechnungssystem<br />
hinterlegt, was den Energieversorgern<br />
oft großen Aufwand verursacht. Auf diese<br />
Weise wird gewährleistet, dass alle Konsumenten<br />
die richtige Energiemenge (Q) – die<br />
vom Normvolumen (V n ) über den spezifischen<br />
Brennwert des Gases ermittelt wird<br />
– in Rechnung gestellt bekommen.<br />
Der neue elektronische Gaszähler misst direkt<br />
Normvolumen bezogen auf 15 °C und<br />
1.013,25 mbar, also Meereshöhe. Dadurch<br />
kann jeder Kunde individuell genau abgerechnet<br />
werden, unabhängig davon, ob in<br />
seinem Keller, wo der Gaszähler üblicherweise<br />
installiert ist, eine Temperatur von konstant<br />
15 °C herrscht oder nicht. Unerheblich<br />
ist auch die Einbauhöhe des Gaszählers, auf<br />
die Bildung von Höhenzonen kann verzichtet<br />
werden bzw. es können alle <strong>EGZ</strong> der gleichen<br />
Höhenzone zugeordnet werden.<br />
Abb. 13: Kalibrier-Rack der EMS PATVAG AG in Domat/Ems: Bis zu 24 Geräte<br />
können gleichzeitig kalibriert werden.<br />
Quelle: EMS-PATVAG<br />
Quelle: EMS-PATVAG<br />
Gaszusammensetzung<br />
Dank der thermischen Messmethode, die<br />
abhängig von der zu messenden Gasart<br />
ist, kann der Gaszähler zwischen Erdgas<br />
und Luft unterscheiden. Für Erdgas des<br />
Typs H und L sind jeweils verschiedene<br />
Modelle erhältlich, eine Zertifizierung existiert<br />
bereits für beide Varianten. Zu einem<br />
späteren Zeitpunkt wird es auch einen<br />
<strong>EGZ</strong>-<strong>G4</strong> für Propan- oder Butanmessungen<br />
geben.<br />
Zukunftsvision<br />
Denkbar ist ebenfalls, die neuen Gaszähler<br />
unmittelbar für die bezogene Energie<br />
(kWh) zu kalibrieren (Abb. 13), auch dies<br />
ist gemäß PTB ein gangbarer Weg, bedingt<br />
jedoch einen Paradigmenwechsel<br />
der heute bestehenden Volumenmessung<br />
in die Richtung der Energiemessung. Ob<br />
und wann solche Lösungen die heutige<br />
Abrechnung über die Hilfsgröße des Volumens<br />
ablösen werden, muss die Zukunft<br />
zeigen.<br />
Zusammenfassung und Ausblick<br />
Der elektronische Zähler der EMS PATVAG<br />
AG erfüllt die hohen Erwartungen der Energieversorger<br />
an ihre zukünftigen Smart-Metering-Komponenten.<br />
In der Schweiz laufen<br />
seit sieben Jahren Feldtests im Erdgasabrechnungsbereich<br />
– die Resultate sind sehr<br />
gut: keine Falschmessungen oder Ausfälle<br />
und keine Degradation der Sensorik. Praktisch<br />
alle großen Energieversorger in<br />
Europa führen derzeit Pilotversuche mit<br />
dem <strong>EGZ</strong>-<strong>G4</strong> durch. Aber auch kleinere<br />
Unternehmen und Stadtwerke zeigen großes<br />
Interesse, sich für die anstehenden Veränderungen<br />
auf dem Markt vorzubereiten.<br />
Literatur:<br />
[1] Stat. Bundesamt, Stat. Landesamt und Ruhrgas:<br />
Heizenergie: Erdgas ist unangefochten die Nr. 1. –<br />
In: GWF Gas Erdgas (2002) Nr. 9, S. 448.<br />
[2] F. Mayer, G. Salis, J. Funk, O. Paul und H. Baltes:<br />
Scaling of Thermal CMOS Gas Flow Microsensors:<br />
Experiment and Simulation.- In: Proceeding<br />
IEEE Micro Electro Mechanical Systems, (IEEE San<br />
Diego, 1996) Nr. 9, S. 116 - 121.<br />
[3] W. Bohl: Technische Strömungslehre. 8. Aufl.,<br />
Würzburg 1989.<br />
[4] F. Kneubühl: Repetitorium der Physik. 2. Aufl.,<br />
Stuttgart 1982.<br />
[5] tm, Technisches Messen, 3/2004<br />
Kontakt:<br />
Dipl.-Ing. Robert Braun<br />
EMS-PATVAG AG<br />
Reichenauerstraße<br />
CH-7013 Domat/Ems<br />
Tel.: +41 (0)56 470 24 58<br />
Fax: +41 81 632 76 62<br />
E-Mail: robert.braun@emspatvag.com<br />
Internet: www.emspatvag.com ■<br />
energie | wasser-praxis 9/2008