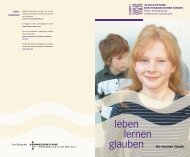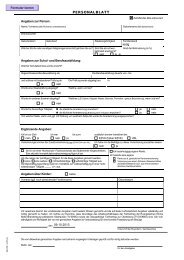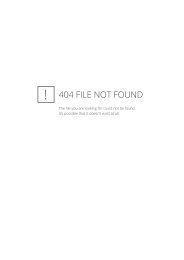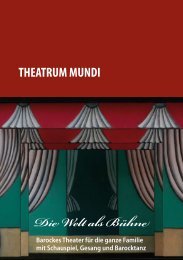Literaturrecherche zum Thema - Schulstiftung der Evangelischen ...
Literaturrecherche zum Thema - Schulstiftung der Evangelischen ...
Literaturrecherche zum Thema - Schulstiftung der Evangelischen ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Literaturrecherche</strong><br />
<strong>zum</strong> <strong>Thema</strong><br />
”Schulqualität”<br />
Manfred Leiske & Matthias Silcher<br />
1
Inhaltsverzeichnis<br />
Zum Vorgehen 3<br />
Hinweise zur Zitation und <strong>zum</strong> Aufbau des Rechercheberichts 4<br />
1. Rechercheergebnisse <strong>zum</strong> <strong>Thema</strong> Schulqualität 5<br />
1.1. Theoretisch orientierte Beiträge 8<br />
1.2. Empirisch orientierte Beiträge 46<br />
1.3 Studien zu einzelnen Schulformen 64<br />
2. Rechercheergebnisse <strong>zum</strong> <strong>Thema</strong> Lehrerarbeit 70<br />
2.1 Zur Lehrerrolle/Lehrerarbeit allgemein 72<br />
2.1.1 Rollen und Arbeit des Schulleiters 83<br />
2.2 Zufriedenheit (job-satisfaction) bei Lehrern 87<br />
2.3 Belastungen/Streß im Lehrerberuf 97<br />
2.4 Burnout-Syndrome bei Lehrern 111<br />
2.5 Angst bei Lehrern 130<br />
3. Rechercheergebnisse <strong>zum</strong> <strong>Thema</strong> Schule/Schüler 133<br />
3.1 Schülerurteile 135<br />
3.2 Leistungen/Leistungserwartungen/Motivation bei Schülern 146<br />
3.3 Zufriedenheit in <strong>der</strong> Schule/Schulspaß 153<br />
3.4 Streß in <strong>der</strong> Schule/Belastungen 156<br />
2
Zum Vorgehen<br />
Für die Recherche wurden unterschiedliche Quellen herangezogen.<br />
• Recherche in den folgenden wissenschaftlichen Datenbanken:<br />
Fis Bildung<br />
Enthält über 200 000 Literaturhinweise zu den Bereichen Bildung und Erziehung,<br />
Schulpädagogik, Didaktik und Methodik einzelner Unterrichtsfächer, frühkindliche<br />
Erziehung, berufliche Bildung, Erwachsenenbildung und Son<strong>der</strong>pädagogik.<br />
Ausgewertet werden Zeitschriften, Bücher, Sammelwerke und Graue Materialien,<br />
überwiegend aus dem deutschsprachigen Raum.<br />
Eric<br />
Steht für ‚Educational Resources Information Center‘. Enthält Literaturhinweise zu<br />
mehr als 750 ausgewerteten erziehungswissenschaftlichen Fachzeitschriften ab 1966.<br />
Die Erschließung erfolgt über englische Stich- bzw. Schlagwörter.<br />
Wiso III (Foris und Solis)<br />
Steht für ‚Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Literatur‘. Fasst u. a. die Datenbanken<br />
Solis und Foris zusammen, die sozialwissenschaftliche Literatur und sozialwissenschaftliche<br />
Forschungsprojekte aus dem deutschsprachigen Raum<br />
dokumentieren.<br />
Psyclit<br />
Erfasst psychologische Literatur mit ihren Randgebieten. Ausgewertet werden 1.500<br />
internationale Zeitschriften sowie weltweit erscheinende englischsprachige Monographien<br />
und Beiträge aus Aufsatzsammlungen.<br />
Psyndex<br />
Enthält Nachweise zu Publikationen aus <strong>der</strong> Psychologie und verwandten Gebieten.<br />
Erfasst werden Artikel aus 250 Fachzeitschriften, Monographien, Beiträge aus<br />
Sammelwerken sowie Dissertationen aus Deutschland, Österreich und <strong>der</strong> Schweiz.<br />
• Recherche in den Handbeständen wissenschaftlicher Bibliotheken und Institute<br />
Die Recherche erfolgte in Autoren- sowie Schlagwort-Katalogen und in den elektronischen<br />
Verzeichnissen <strong>der</strong> einschlägigen Bibliotheken.<br />
• Stichwortsuche in Internet-Suchmaschinen<br />
Über Stichwort-Suche in gängigen Suchmaschinen konnten einige Hinweise auf<br />
relevante Publikationen (<strong>zum</strong>eist Verlags-Seiten) gefunden werden.<br />
3
Hinweise zur Zitation und <strong>zum</strong> Aufbau des Rechercheberichts<br />
Die Datenbanken geben ihre Ergebnisse in unterschiedlicher Zitation aus. Zugunsten <strong>der</strong><br />
Lesefreundlichkeit und eines einheitlichen Erscheinungsbildungs wurden sie so weit wie<br />
möglich angepasst. Die Präsentation <strong>der</strong> in den Handbeständen gefundenen Resultate<br />
erfolgt ebenfalls in diesem Format. So ergibt sich (bis auf Abweichungen aufgrund des<br />
Dokumentationstyps o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Quelle) folgen<strong>der</strong> Aufbau<br />
AUTHOR<br />
TITLE<br />
SOURCE<br />
PUBLICATION YEAR<br />
DESCRIPTORS<br />
ABSTRACT<br />
Die Recherergebnisse wurden zu 3 Themenkomplexen zusammengefasst<br />
Teil 1: Schulqualität, Schulentwicklung, Schulklima, Schulkultur, Schulreform<br />
Teil 2: Lehrerarbeit, Belastung, Lehrerzufriedenheit, Lehrerunzufriedenheit,<br />
Burnout-Syndrom<br />
Teil 3: Schule aus Schülersicht, Schulmotivation, Schulspaß,<br />
Schülerzufriedenheit, Schulstress, Schulverweigerung<br />
Diese Aufteilung dient vor allem <strong>der</strong> Übersichtlichkeit. Es ist damit nicht gesagt, dass die<br />
Themen tatsächlich streng abgrenzbar sind; im Gegenteil, es gibt vielfache<br />
Überschneidungen und zahlreiche Publikationen, die sich mit allen in <strong>der</strong> Recherche berücksichtigten<br />
Themen und Aspekten befassen. Ein Band zur Schulqualität nimmt selbstverständlich<br />
auch zur Rolle und Funktion des Lehrers Stellung, ebenso wie sich Studien<br />
<strong>zum</strong> Arbeitsplatz des Lehrer o<strong>der</strong> zur Lehrerzufriedenheit auch mit <strong>der</strong> Lehrer-Schüler-<br />
Beziehung und mit <strong>der</strong> Schulmotivation befassen. Die Unterteilung soll also lediglich auf<br />
gewisse Schwerpunkte hinweisen.<br />
Insgesamt wurden 228 Titel aufgenommen.<br />
4
Teil 1: Rechercheergebnisse <strong>zum</strong> <strong>Thema</strong> Schulqualität 1<br />
„Was ist eine gute Schule?“ Diese Fragestellung ist in den letzten Jahren in <strong>der</strong><br />
Bundesrepublik Deutschland mehr und mehr in den Mittelpunkt <strong>der</strong> Schulforschung und<br />
auch in die Schulpraxis gerückt. Der Frage nach Qualität und Leistung <strong>der</strong> einzelnen<br />
Schule wurde aber in Deutschland lange Zeit lange Zeit keine beson<strong>der</strong>e Aufmerksamkeit<br />
geschenkt. Obwohl schon in den sechziger Jahren mit <strong>der</strong> durch Georg Picht<br />
ausgesprochenen Warnung einer Bildungskatastrophe und <strong>der</strong> darauf folgenden<br />
Bildungsdebatte und <strong>der</strong> Reformierung des Schulsystems auch Fragen aufgeworfen<br />
wurden, welche Faktoren es letztlich sind, von denen das Gelingen von Schule abhängt,<br />
war es im Bereich <strong>der</strong> Schulforschung ein Desi<strong>der</strong>at geblieben, nach Faktoren zu Fragen,<br />
von denen das Gelingen von Schule abhängt und die zu Unterschieden in <strong>der</strong><br />
Wirksamkeit einzelner Schulen führen. Schulforschung war eingebettet in<br />
bildungspolitisch geleitete Schulreformen, in denen Organisationsformen des<br />
Schulsystems und neue Lehrpläne die Steuerungsinstrumente zur Umsetzung<br />
bildungspolitischer Zielsetzungen waren und <strong>der</strong>en Effizienz durch die Schulforschung<br />
überprüft wurden. Die bildungspolitisch geleitete Reformierung des Schulsystems in <strong>der</strong><br />
BRD wurde begleitet von großangelegten Schuluntersuchungen. Im Zentrum dieser<br />
Untersuchungen stand dabei in den siebziger Jahren vor allem <strong>der</strong> Vergleich von<br />
Gesamtschulen vs. dem dreigliedrigen Schulsystem mit Hauptschule, Realschule und<br />
Gymnasium. Ziel dieser Untersuchungen war es, die Überlegenheit <strong>der</strong> einen bzw. die<br />
Unterlegenheit <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Schulstruktur zu belegen. Ex post können die Ergebnisse<br />
dieser „Systemvergleiche“ cum grano salis dahingehend zusammengefaßt werden, daß<br />
keine <strong>der</strong> Schulstrukturen durch die Untersuchungsergebnisse als das bessere<br />
ausgewiesen werden konnte. Die schulischen Systemvergleiche als auch die Steuerung<br />
<strong>der</strong> Schulentwicklung mittels Reformen und Curricula erbrachten nicht die erhofften<br />
Ergebnisse. An<strong>der</strong>erseits wurde in den Untersuchungen ein entscheiden<strong>der</strong> Befund<br />
festgestellt dahingehend, daß bei einem Leistungsvergleich zwischen Schulen <strong>der</strong><br />
gleichen Schulart große Unterschiede bestehen können. Diese Erfahrungen und die<br />
Auseinan<strong>der</strong>setzung darüber, inwieweit die Schule auf gesellschaftliche Verän<strong>der</strong>ungen<br />
eingestellt sei und auf damit verbundene Probleme bei Kin<strong>der</strong>n und Jugendlichen, die<br />
sich im Schulalltag bemerkbar machen, angemessen reagieren könne, gaben gegen Ende<br />
<strong>der</strong> 70er Jahre und Anfang <strong>der</strong> 80er Jahre in <strong>der</strong> BRD den Anstoß, sich verstärkt<br />
erziehungswirksamen Prozessen in Schulen zu widmen. Schulkritik und Erörterungen<br />
über eine humanere und erziehungswirksamere Gestaltung von Schulen trugen im<br />
weiteren dazu bei.<br />
In den 80er Jahren wurde das Interesse <strong>der</strong> schulrefomerischen Aktivitäten und damit<br />
auch das Interesse <strong>der</strong> Schulforschung in <strong>der</strong> BRD weg von einer eher technologisch und<br />
einseitig organisationssoziologischen Ausrichtung dahin gelenkt, mehr die<br />
pädagogischen Handlungszusammenhänge und <strong>der</strong>en Wechselwirkungen zu<br />
berücksichtigen und zunehmend die einzelne Schuleinheit als Handlungs- und<br />
Interaktionssystem zu sehen. Letztlich war dies auch das Ergebnis <strong>der</strong> im Kontext <strong>der</strong><br />
Schulreformphase und <strong>der</strong> Gesamtschuldiskussion großangelegten Untersuchungen: Die<br />
1 Relevante Stichworte: Schulqualität, Schulentwicklung, Schulklima, Schulkultur, Schulreform<br />
5
Wie<strong>der</strong>entdeckung <strong>der</strong> einzelnen Schule. Als gemeinsamer Befund wurde ermittelt, daß<br />
die „einzelne Schule“ um ein Vielfaches mehr Einfluß auf das Zustandekommen<br />
fachlicher und überfachlicher Leistungen von Schülern hat als die Systemzugehörigkeit<br />
<strong>der</strong> Schule. Es zeigte sich, daß trotz weitgehend einheitlicher makroorganisatorischer<br />
Rahmenbedingungen an den einzelnen Schulen sehr unterschiedliche Bedingungen<br />
beobachtet werden können, und daß diese durch innerschulische Prozesse und<br />
Gegebenheiten beinflußt sind. Dies bestärkte die Auffassung, daß am ehesten die<br />
Beschäftigung mit <strong>der</strong> einzelnen Schule Erkenntnisse über die Wirksamkeit und Qualität<br />
<strong>der</strong> Schule geben kann. In <strong>der</strong> BRD gab Ende <strong>der</strong> 80er Jahre nach dem Abflauen <strong>der</strong><br />
Gesamtschuldiskussion die Rezeption <strong>der</strong> „school-effectivness research “ <strong>der</strong> angloamerikanischen<br />
Län<strong>der</strong> den entscheidenden Impuls, die Betrachtung <strong>der</strong> zentralen<br />
Faktoren des Schul- und Unterrichtsgeschehens in den Mittelpunkt <strong>der</strong> Schulforschung<br />
zu stellen. Die Forschungen in Großbritannien und den USA zielte darauf ab, Kriterien<br />
und Merkmale zu ermitteln, durch die sich gute Schulen von weniger guten abheben und<br />
auf denen die Wirksamkeit von Schulen hinsichtlich ihres pädagogischen Auftrags<br />
beruht, sowie Erkenntnisse über <strong>der</strong>en Zusammenhänge und Wechselbeziehungen zu<br />
gewinnen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen kumulierten in <strong>der</strong> Auffassung, von<br />
einer Schulkultur, d. h. <strong>der</strong> Gesamtheit schulischen Geschehens und pädagogischen<br />
Umgangs, auszugehen. Ziel dieser Untersuchungen war es, beobachtbare Unterschiede<br />
zwischen Schulen durch das Zusammenwirken verschiedener schulischer Situations- und<br />
Prozeßvariablen zu erklären. Aufgrund dieses kumulativen Gesamteffektes verschiedener<br />
Faktoren <strong>der</strong> Schulsituation wurde in den Untersuchungen davon ausgegangen, daß eine<br />
Grundstruktur von Wertorientierungen, Einstellungen und Verhaltensmustern für jede<br />
Schule charakteristisch ist und die Qualität von Schulen bestimmt.<br />
Für die Schulforschung <strong>der</strong> letzten 15 Jahren in <strong>der</strong> BRD läßt sich damit ein Umbruch<br />
konstatieren, <strong>der</strong> einem wissenschaftlichen Paradigmenwechsel gleichkommt und<br />
dadurch zu erklären ist, daß die einzelne Schule zunehmend in den Mittelpunkt<br />
schulischer Reformprozesse rückt und anstelle einer zentralistischen staatlichen<br />
Bildungsplanung eine entbürokratisierte Planung und Steuerung von Reformprozessen in<br />
<strong>der</strong> Schule selbst Garant für eine langfristige Verbesserung <strong>der</strong> Schulqualität sein soll.<br />
Die Einzelschule selbst wird Dreh- und Angelpunkt einer auf Qualitätssteigerung<br />
abzielenden permanenten Reform schulischer Prozesse und die Schulforschung stellte<br />
sich <strong>der</strong> Aufgabe, diese Prozesse wissenschaftlich zu begleiten.<br />
Mit <strong>der</strong> vorliegenden <strong>Literaturrecherche</strong> soll das Ziel verfolgt werden,<br />
Veröffentlichungen und Forschungsprojekte <strong>der</strong> Schulforschung <strong>der</strong> letzten Jahre in <strong>der</strong><br />
BRD zusammenzustellen, die sich mit dem <strong>Thema</strong> Schulqualität befassen.<br />
In Teil 1 dieser <strong>Literaturrecherche</strong> sind die Literaturangaben aufgeführt, die sich<br />
theoretisch und/o<strong>der</strong> empirisch mit Fragen nach <strong>der</strong> Qualität von Schule<br />
auseinan<strong>der</strong>setzen und diese Fragen im Kontext einer allgemeinen Diskussion über<br />
för<strong>der</strong>nde und hemmende Bedingungen <strong>der</strong> Sicherung und Erweiterung von<br />
Schulqualität behandeln.<br />
Teil 2 beinhaltet Literaturangaben, die sich im engeren Sinne mit <strong>der</strong> Lehrerrolle und<br />
dem Lehrberuf auseinan<strong>der</strong>setzen. Die Notwendigkeit <strong>der</strong> Behandlung dieser <strong>Thema</strong>tik<br />
6
läßt sich damit begründen, daß motivierte und qualifizierte Lehrkräfte <strong>der</strong> Schlüssel zur<br />
Qualitätsentwicklung sind. Das Anheben des methodisch-didaktischen Niveaus ist dabei<br />
ebenso von Bedeutung, wie <strong>der</strong> Ausbau <strong>der</strong> fachlichen und sozialen Kompetenzen <strong>der</strong><br />
LehrerInnen. Denn: Qualitätsentwicklung ist unmittelbar abhängig von <strong>der</strong> Vitalität <strong>der</strong><br />
Kompetenz <strong>der</strong> Lehrerschaft.<br />
Teil 3 <strong>der</strong> <strong>Literaturrecherche</strong> beinhaltet Literaturangaben, die <strong>der</strong> Frage nachgehen, wie<br />
Schüler aus ihrer Perspektive heraus Schule auffassen und beurteilen. Daß die Ermittlung<br />
<strong>der</strong> Schülerperspektive ein wichtiger Bestandteil von Qualitätsmanagement in <strong>der</strong> Schule<br />
darstellt, begründet sich damit, daß bei Kenntnis <strong>der</strong> Erwartungen und Sichtweisen <strong>der</strong><br />
Schüler über die Schule Lehrer und an<strong>der</strong>e an Schule Beteiligte sich darauf einstellen<br />
können und dies bei <strong>der</strong> Gestaltung von Schule, sofern es pädagogisch gerechtfertigt ist,<br />
berücksichtigt werden kann.<br />
7
1. 1 Theoretisch orientierte Beiträge<br />
� (1)<br />
AUTHOR<br />
Achs, Oskar (Hrsg.); u.a.<br />
TITLE<br />
Schulqualität, Facetten und Fel<strong>der</strong> einer Entwicklung.<br />
Vorträge und Diskussionen anlässlich des 1. Europäischen Bildungsgespräches '94.<br />
SOURCE<br />
Wien (ÖBV Pädagogischer Verlag)<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1995<br />
DESCRIPTORS<br />
Konferenzschrift; Schule; Qualitaet; Autonomie; Schulkultur; Paedagogische Forschung;<br />
Bildungspolitik; Schulpolitik; Schulentwicklung; Unterricht; Lehrer; Schulverwaltung;<br />
Schulleitung; Lehrerausbildung; Schulqualitaet; Oesterreich; Vereinigtes Koenigreich;<br />
Frankreich; Schweden<br />
ABSTRACT<br />
Es werden Vorträge und Diskussionen des 1. Europäischen Bildungsgesprächs im November<br />
1994 in Wien dokumentiert. Themenschwerpunkte sind Entwicklungslinien,<br />
Funktionen und Positionen von Schulqualität unter verschiedenen Aspekten vornehmlich<br />
in Österreich, Großbritannien, Frankreich und Schweden. In den Diskussionsforen<br />
werden vor allem die Erforschung von Schulqualität, Bildungspolitik und Schulqualität<br />
sowie Schulqualität aus dem Blickwinkel von Schulautonomie reflektiert. In einzelnen<br />
Statements wird vor allem Qualität des Unterrichts, des Lehrers, des Schuldirektors und<br />
<strong>der</strong> Schulverwaltung, <strong>der</strong> Lehrerausbildung thematisiert. (Fis Bildung nach DIPF/Mar.)<br />
� (2)<br />
AUTHOR<br />
Ackermann, Heike; Nasse, David<br />
TITLE<br />
Gemeinsam eine "Neue Schule" gestalten. Zum IV. Bamberger Schulleiter-Symposion<br />
"Schulleitung und Schulaufsicht".<br />
SOURCE<br />
In: Schulverwaltung. Ausgabe Bayern, 18 (1995) 3, S. 103-106<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1995<br />
DESCRIPTORS<br />
Autonomie; Dokumentation; Individualisierung; Schulaufsicht; Schule; Schulleitung;<br />
Schulreform; Schulverfassung; Schulverwaltung; Sozialer Wandel; Tagungsbericht; Verantwortung;<br />
Deutschland; Europa; Osteuropa<br />
8
ABSTRACT<br />
Es wird auf die Vortraege <strong>zum</strong> IV. Bamberger Schulleiter-Symposion eingegangen. Hier<br />
einige <strong>der</strong> dargestellten Positionen: Schulleitung und Schulaufsicht duerfe sich nicht an<br />
Beduerfnissen <strong>der</strong> Verwaltung orientieren, son<strong>der</strong>n muesse ihr Handeln an fundamentalen<br />
Zielen <strong>der</strong> Schule orientieren. "Schule ist nicht einfach als Ausdruck unserer heutigen<br />
Gesellschaft zu verstehen, son<strong>der</strong>n sie ist selbst in den gesellschaftlichen Aen<strong>der</strong>ungsprozess<br />
involviert und wird mit Phaenomenen konfrontiert, die sie miterzeugt." Schule<br />
muesse aus den bisherigen administrativen Bindungen befreit werden und sich nach<br />
innen und aussen paedagogisch oeffnen. Die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen<br />
hierarchischen Ebenen innerhalb und ausserhalb <strong>der</strong> Schule muesse sich an paedagogischen<br />
Maximen orientieren, die Schule vermitteln soll. (Fis Bildung nach<br />
DIPF/Mar.)<br />
� (3)<br />
AUTHOR<br />
Ackermann, Heike; Rosenbusch, Heinz S.<br />
TITLE<br />
Qualitative Forschung in <strong>der</strong> Schulpädagogik.<br />
SOURCE<br />
Grundlagen qualitativer Forschung. Weinheim (Dt. Studien Verl.), S. 135-167<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1995<br />
DESCRIPTORS<br />
Empirische Forschung; Forschungsstand; Methode; Paedagogische Forschung; Qualitative<br />
Forschung; Schule; Schulqualität; Schulpaedagogik; Unterrichtsforschung;<br />
Deutschland-BRD<br />
ABSTRACT<br />
Die Verfasser definieren zunächst, daß die qualitative Schulforschung "versucht, Aufschluß<br />
über Handlungen und Erleben von Menschen im pädagogischen Kontext von<br />
Schule mittels spezifischer empirischer Methoden zu gewinnen. Die Forschungsrichtung<br />
hat sich in ihrer Ausrichtung als subjektorientierter Forschungsansatz gekennzeichnet.<br />
Es geht um die Ergründung <strong>der</strong> subjektiven Grundlagen für Handlungen, um die Erlebniswelt<br />
und -sicht <strong>der</strong> Untersuchten." Der Artikel zeigt zuerst das Aufkommen und die<br />
Entwicklung qualitativer Forschungsparadigma in <strong>der</strong> Bundesrepublik und gibt dann einen<br />
Überblick über schulpädagogische Forschungsansätze, die sich qualitativ verstehen.<br />
Die Themen "sind durch die Streuung <strong>der</strong> Forschungsinteressen weit gespannt und unterschiedlich<br />
akzentuiert, und die Verfahren sind uneinheitlich." Abschließend wird "an<br />
einigen Beispielen etwas ausführlicher <strong>der</strong> theoretische Ansatz und die Spezifik qualitativer<br />
Methodenwahl betrachtet". Die Beispiele befassen sich mit dem beruflichen Selbstverständnis<br />
von Schulräten (Max-Planck-Institut), <strong>der</strong> biografischen Wirksamkeit von<br />
Schule (Arbeiten aus <strong>der</strong> Laborschule Bielefeld) und <strong>der</strong> lebensgeschichtlichen Bedeutung<br />
<strong>der</strong> Schulleistung. (Fis Bildung nach DIPF/ Bi.).<br />
9
� (4)<br />
AUTHOR<br />
Altrichter, Herbert; Buhren, Claus G.<br />
TITLE<br />
Schulen vermessen o<strong>der</strong> entwickeln? Zur Bedeutung von Evaluation in<br />
Schulentwicklungsprozessen.<br />
SOURCE<br />
In: Journal für Schulentwicklung, (1997) 3, S. 4-21<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1997<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulentwicklung; Schulentwicklungsplanung; Evaluation (fis Bildung)<br />
ohne ABSTRACT<br />
� (5)<br />
AUTHOR<br />
Beetz, Sybille.<br />
TITLE<br />
Hoffnungsträger „Autonome Schule“. Beiträge zur empirischen Erziehungswissenschaft<br />
und Fachdidaktik, Band 10<br />
SOURCE<br />
Frankfurt a. Main (Peter Lang)<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1997<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulqualität; Schulentwicklung; Autonomie, Autonomiedebatte<br />
ABSTRACT<br />
Die Autorin untersucht den historischen Argumentations- und Handlungszusammenhang,<br />
in dem die bildungspolitische Diskussion um die Autonomie <strong>der</strong> Schule steht. Der analytische<br />
Blick führt zu <strong>der</strong> Erkenntnis, dass das organisationstheoretisch fundierte Modell<br />
‚Autonome Schule‘ eine Verbesserung <strong>der</strong> Schulqualität in Aussicht stellt und somit in<br />
die reformpädagogische Wünschdebatte eingebunden ist. Konsens besteht in <strong>der</strong> Autonomiedebatte<br />
<strong>der</strong> 90er Jahre – so die Autorin – hinsichtlich <strong>der</strong> kritischen Beurteilung<br />
staatlicher Reglementierung sowie <strong>der</strong> Vorgabe von Makrolösungen im Schulbereich.<br />
Dagegen setzen die Befürworter von mehr Autonomie auf Mikromodelle als Motoren <strong>der</strong><br />
Schulentwicklung. Die Autorin kommt anhand <strong>der</strong> kritischen Sichtung <strong>der</strong> Vorläufermodelle<br />
<strong>zum</strong> dem Schluss, dass die Schulforschung jenseits <strong>der</strong> betriebswirtschaftlichen,<br />
organisationstheoretischen, bildungsökonomischen und verwaltungstechnischen Neubesetzung<br />
des Autonomiethemas den ideengeschtlichen Diskussionsstrang nutzen kann, um<br />
tragfähige Schulmodelle für die Gegenwart zu entwerfen. (CP)<br />
10
� (6)<br />
AUTHOR<br />
Bessoth, Richard<br />
TITLE<br />
Organisationsklima und Organisationskultur. Synenergie und Potential an Schulen.<br />
SOURCE<br />
In: Pädagogische Führung, 7 (1996) 4, S. 175-177<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1996<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulklima; Analyse; Verhalten; Motivation; Kooperation; Schulorganisation;<br />
Schulentwicklung; Deutschland<br />
ABSTRACT<br />
Der Autor befasst sich mit <strong>der</strong> Wirkung eines positiven Organisationsklimas und zeigt,<br />
wie Schule durch ihre Umwelt geprägt wird. Es wird erläutert, warum Organisationsklima<br />
als Maßtab für Motivation und Synergie angesehen werden kann. (Fis Bildung<br />
nach DIPF/Mar.).<br />
� (7)<br />
AUTHOR<br />
Bessoth, Richard; Seidel, Berthold; Weibel, Walter; Landwehr, Norbert; O'Neil, John;<br />
Strembitsky, Michael; Weiss, Angelika; Klippert, Heinz; Risse, Erika; Stotz, Horst;<br />
Gautschi, Peter<br />
TITLE<br />
Mehr Autonomie - mehr (Selbst-)Verantwortung (Themenheft).<br />
SOURCE<br />
In: Pädagogische Führung, 8 (1997) 2, S. 49-104<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1997<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulwesen; Schulautonomie; Selbstverantwortung; Selbstverwaltung;<br />
Qualitaetsmanagement; Schulentwicklung; Schluesselqualifikation; Lernziel;<br />
Deutschland<br />
ABSTRACT<br />
Das Themenheft enthält eine Reihe von Aufsätzen zu theoretischen Positionen, Konzeptionen<br />
sowie zu Praxisbeispielen, die sich mit <strong>der</strong> Autonomie <strong>der</strong> Schule, <strong>der</strong> Qualitätsentwicklung<br />
und Qualitätssicherung sowie mit Detailfragen des Unterrichtsprozesses<br />
beschäftigen. Die Beiträge betreffen fast ausschliesslich die allgemeinbildenden Schulen;<br />
die angesprochenen Schwerpunkte sind jedoch in <strong>der</strong> gegenwärtigen Diskussion auch für<br />
die berufsbildenden Schulen von Interesse. Im einzelnen sind das: BESSOTH: "Selbstverantwortung:<br />
ein Konzept auf <strong>der</strong> Suche nach Anwen<strong>der</strong>n"; SEIDEL: "Was zählt<br />
morgen? Selbstverantwortlich sein!"; WEIBEL: "Qualitätssicherung durch Qualitätsentwicklung<br />
in <strong>der</strong> Schule"; LANDWEHR: "Schlüsselqualifikationen als transformative<br />
Fähigkeiten"; O'NEIL/STREMBITSKY: "Die Kraft <strong>der</strong> selbstverantwortlichen Schule<br />
11
anzapfen"; WEISS/BESSOTH: "Kooperationsverhalten : ein Schlüssel zu mehr<br />
Selbstverantwortung in einer Klasse"; KLIPPERT: "Pädagogische Schulentwicklung :<br />
ein integriertes Qualifizierungs- und Innovationsprogramm"; RISSE: "Netzwerke als<br />
Motoren <strong>der</strong> Schulentwicklung"; STOTZ: "Kontinuierliche Verbesserungsprozesse beim<br />
Schulträger"; GAUTSCHI/ LANDWEHR: "Blockunterricht im Fachlehrersystem".<br />
Forschungsmethode: anwendungsorientiert. (Fis Bildung nach BIBB).<br />
� (8)<br />
AUTHOR<br />
Bielefeldt, Heinz<br />
TITLE<br />
Bewegung von innen. Schulmanagement und Schulkultur.<br />
SOURCE<br />
In: Schulmagazin 5 bis 10, 10 (1995) 10, S. 9-12<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1995<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulklima; Schule; Schulleben; Management; Schulleitung; Schulreform; Sozialarbeit;<br />
Lernen; Lehrerrolle; Schulqualitaet<br />
ABSTRACT<br />
Die Diskussion über eine größere Selbständigkeit <strong>der</strong> einzelnen Schule und auch die in<br />
dieser Richtung eingeleiteten Entwicklungsprozesse sind nicht neu, aber eine stärkere<br />
Professionalisierung im Sinne von Schulmanagement, um zielgerichtet und geplant zu<br />
handeln, beginnt sich erst herauszubilden. Im Beitrag werden Erfahrungen verschiedener<br />
Schulen, verschiedener Schultypen dargestellt, die den Zusammenhang von Schulmanagement,<br />
Qualitätssicherung und Schulkultur verdeutlichen. Auf die Bedeutung <strong>der</strong> "Bewegung<br />
von innen" wird hingewiesen. (Fis Bildung nach DIPF/Sch.)<br />
� (9)<br />
AUTHOR<br />
Bois-Reymond, Manuela du<br />
TITLE<br />
Lernen für Europa: die Ohnmacht <strong>der</strong> Schule? (Gefälligkeitsübersetzung: Learning for<br />
Europe: limits of school?)<br />
SOURCE<br />
Jugend - Wirtschaft - Politik. München (DJI Verl.), S. 191-202<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1993<br />
12
DESCRIPTORS<br />
Schule; Europäische Erziehung; Schulreform; Europäisches Bewußtsein; Bildungspolitik;<br />
Schulpflicht; Lernen; Wissen; Privatschule; Neue Medien; Curriculum<br />
ABSTRACT<br />
Der Beitrag, in Form von Thesen-Essays, behauptet, dass die historisch-national verfaßte<br />
Schule ihre Blütezeit hinter sich hat und dass eine Erneuerung <strong>der</strong> Schule von innen heraus<br />
nicht zu erwarten ist. Auch wird eine (weitere) Kommerzialisierung und<br />
Privatisierung schulischer Teilfunktionen prognostiziert. "Lernen für Europa" bedeutet<br />
inhaltlich motiviertes Lernen. Gefragt wird, ob die neuen Chancen und Impulse, die von<br />
"Europa als Lernfeld" ausgehen, den Verfallsprozeß <strong>der</strong> historisch-national verfaßten<br />
Schule aufhalten können. Es wird diskutiert, in welchen Formen und an welchen Orten<br />
ein europarelevantes Lernen stattfinden kann und welche sozialen Folgekosten sich für<br />
bestimmte Gruppen Jugendlicher ergeben könne. Abschließend wird unter strategischen<br />
Aspekten überlegt, wie eine radikale Schulkritik zu verfahren hat, um öffentlichkeitswirksam<br />
zu werden. (Fis Bildung)<br />
� (10)<br />
AUTHOR<br />
Buchner, Christina<br />
TITLE<br />
Schulkultur mehr Schein als Sein?<br />
SOURCE<br />
In: Grundschulmagazin, 11 (1996) 12, S. 55-56<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1996<br />
DESCRIPTORS<br />
Grundschule; Schulleben; Kultur; Schulleitung; Schulprofil; Schulklima; Schulkultur;<br />
Deutschland<br />
ABSTRACT<br />
Die Autorin faßt unter dem Begriff "Schulkultur" folgendes zusammen: "Pädagogische<br />
Eigeninitiative, Verbesserung des Schulklimas, gemeinsame Maßstäbe des schulischen<br />
Zusammenlebens, mehr Zusammengehörigkeitsgefühl, Konsensbildung über<br />
erzieherische Normen und Werte, Verbesserung <strong>der</strong> erzieherischen Arbeit, För<strong>der</strong>ung<br />
sozialer Interaktionen, Schülerorientierung, Einsatz offener Lernformen, Kooperation mit<br />
den Eltern, Betonung musischer und kreativer Elemente, mehr persönliches Engagement<br />
und höhere Berufszufriedenheit <strong>der</strong> Lehrer, Präsentation <strong>der</strong> Schule nach außen." Sie<br />
setzt sich kritisch mit den Motivationen, die diesen verschiedenen Aktivitäten zugrundeliegen,<br />
auseinan<strong>der</strong>. (Fis Bildung nach DIPF/Sch.).<br />
13
� (11)<br />
AUTHOR<br />
Büeler, Xaver<br />
TITLE<br />
Gute Schulen besser machen. Ein systemischer Ansatz.<br />
SOURCE<br />
In: Praxis Schule 5 - 10, 8 (1997) 5, S. 44-46<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1997<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulentwicklung; Schulautonomie; Schulprofil; Innovation; Organisation-Struktur;<br />
Lernprozess; Lehrer; Schulqualitaet; Qualitaet; Sachinformation<br />
ABSTRACT<br />
Auch gute Schulen müssen sich ständig weiterentwickeln. Doch <strong>der</strong> Frage, wie man<br />
Qualität in <strong>der</strong> Schule erlangen kann, muss vorangestellt werden, was Qualität ausmacht<br />
und woran Qualität gemessen werden soll. Die Klärung solcher Fragen gehört zur Profilbildung<br />
einer Schule. Die Schule muss als ganzes System gesehen werden. Empirischanalytische<br />
Studien (USA/ Großbritannien), welche "School effectivness" untersuchen,<br />
sind nur bedingt übertragbar. Der Beitrag stellt Wege und Möglichkeiten vor, um eigene<br />
Innovationen auf den Weg zu bringen. Hierbei stehen die Lernprozesse im Zentrum.<br />
Schulinterne und -externe Gestaltungsstrukturen müssen immer wie<strong>der</strong> <strong>der</strong> aktuellen<br />
Situation angepasst werden. Ausserdem werden Hinweise gegeben, wie Innovationen<br />
ausgelöst und durchgehalten werden können. (Fis Bildung/Pl).<br />
� (12)<br />
AUTHOR<br />
Buhren, Claus G.<br />
TITLE<br />
Auch Schulen koennen lernen - Organisationsentwicklung in <strong>der</strong> Praxis.<br />
SOURCE<br />
In: Pädagogische Rundschau, 7 (1994) 4, S. 175-180<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1994<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulpolitik; Schule; Innovation; Schulreform; Organisation ; Lernen<br />
ABSTRACT<br />
Eingangs wird "Schule unter Veraen<strong>der</strong>ungsdruck" diskutiert. Bei <strong>der</strong> Organisationsentwicklung<br />
als Institutionelles Schulentwicklungsprogramm werden folgende Aussagen<br />
getroffen: -"Die Schule ist <strong>der</strong> Ort <strong>der</strong> Veraen<strong>der</strong>ung und <strong>der</strong> Motor <strong>der</strong> Entwicklung. -<br />
Veraen<strong>der</strong>ung entsteht aus Kooperation, und Konflikte sind als Chance zu begreifen. -<br />
Planung und Ausfuehrung sind miteinan<strong>der</strong> verbunden. - Schulen koennen lernen, und<br />
sie haben die Freiheit zu handeln. Abschliessend geht es um Aspekte einer Schule auf<br />
dem Weg zur selbstlernenden Organisation." ( Fis Bildung nach DIPF/Sch.).<br />
14
� (13)<br />
AUTHOR<br />
Buhren, Claus G.<br />
TITLE<br />
Entfaltung <strong>der</strong> Lernkultur durch Organisationsentwicklung.<br />
SOURCE<br />
Aus: Entwicklung von Schulkultur. Neuwied (Luchterhand) S. 200-221<br />
(Monographieauszug)<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1995<br />
DESCRIPTORS<br />
Organisationsentwicklung; Definition; Schulorganisation; Lehrer; Qualitaet;<br />
Schulentwicklung; Lernen; Lernkultur; Individualitaet; Modellversuch<br />
ABSTRACT<br />
Der Autor verdeutlicht, wie die Lernkultur <strong>der</strong> Schule durch Organisationsentwicklung<br />
entfaltet werden kann. Nach einer Klärung des Verhältnisses von Lernkultur und Schulorganisation<br />
ordnet er die pädagogischen Dimensionen von Lernkultur in Entwicklungsperspektiven<br />
von Schulqualität ein. Anschließend zeigt er auf, wie über OE-Verfahren<br />
Schulen auf den Weg zu einer selbstlernenden Organisation gelangen können. Aus dem<br />
Modellversuch zur Lernkultur-Entwicklung in Schulen <strong>der</strong> Sekundarstufe werden Ziele<br />
und Themen von OE-Prozessen vorgestellt und am Beispiel eines realen Fallverlaufs<br />
illustriert. (Fis Bildung nach DIPF/Text übernommen).<br />
� (14)<br />
AUTHOR<br />
Buhren, Claus G.; Lindau-Bank, Detlev; Müller, Sabine<br />
TITLE<br />
Lernkultur und Schulentwicklung. Ansätze und Perspektiven zu einer Weiterentwicklung<br />
von Schule.<br />
SOURCE<br />
Dortmund (IFS), 230 S.<br />
REIHE<br />
Beiträge zur Bildungsforschung und Schulentwicklung, 4<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1997<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulentwicklung; Nordrhein-Westfalen; Entwicklung; Brandenburg;<br />
Organisationsentwicklung; Lernen; Lernkultur; Sekundarbereich (fis Bildung)<br />
ohne ABSTRACT<br />
15
� (15)<br />
AUTHOR<br />
Burkard, Christoph; Pfeiffer, Hermann<br />
TITLE<br />
Evaluation von Einzelschulen - Entwicklungslinien und aktuelle Trends.<br />
SOURCE<br />
In: Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie, 15 (1995) 4, S. 294-312<br />
DESCRIPTORS<br />
Evaluationsforschung; Schule; Nordrhein-Westfalen; Ausland; Schulentwicklung; Situation; Bremen<br />
ABSTRACT<br />
"Evaluation ist gegenwärtig ein wichtiges Stichwort in <strong>der</strong> Diskussion um Qualitätsentwicklung<br />
und -sicherung von Schule. Bislang gibt es in Deutschland in diesem Arbeitsfeld<br />
sehr wenige praktische Erfahrungen. In diesem Beitrag wird zunächst einigen<br />
Traditionen <strong>der</strong> systematischen Evaluation von einzelnen Schulen nachgegangen. Dabei<br />
wird deutlich, dass es sich bei <strong>der</strong> Evaluation von Einzelschulen keinesfalls um ein <strong>der</strong><br />
Schul- und Erziehungssoziologie bisher völlig fremdes Anliegen handelt. In einer sehr<br />
knappen internationalen Bestandsaufnahme wird im zweiten Teil dargestellt, welche Ansätze<br />
und Entwicklungen <strong>der</strong> Schulevaluation gegenwärtig beobachtet werden können.<br />
Danach werden erste Erfahrungen mit Schulevaluation aus einer nordrhein-westfälischen<br />
Fortbildungsmaßnahme berichtet und zentrale Passagen des Bremischen Schulgesetzes<br />
als Beispiel für die Konzeption eines Evaluationssystems von Schule vorgestellt. Den<br />
Abschluss bildet ein Resümee, das - dem Stand <strong>der</strong> Entwicklung entsprechend - offene<br />
Fragen <strong>der</strong> Schulevaluation formuliert. (Fis Bildung nach LSW).<br />
� (16)<br />
AUTHOR<br />
Duncker, Ludwig<br />
TITLE<br />
Schulkultur als Anspruch und Realisierung von Bildung. Anmerkungen <strong>zum</strong><br />
pädagogischen Selbstverständnis <strong>der</strong> Schule.<br />
SOURCE<br />
In: Pädagogische Welt, 49 (1995) 10, S. 442-445<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1995<br />
DESCRIPTORS<br />
Bildung; Erziehungsziel; Gesellschaft; Schule; Schulgeschichte; Schulklima; Schulkultur<br />
ABSTRACT<br />
Gegenwärtig werden zahlreiche Bemühungen um die Weiterentwicklung und Reform <strong>der</strong><br />
Schule unter dem Begriff <strong>der</strong> Schulkultur thematisiert. Der folgende Beitrag will diese<br />
Diskussion <strong>zum</strong> Anlass nehmen, solche pädagogischen Begründungslinien nachzuzeichnen,<br />
die diesen Anspruch einer Verbesserung <strong>der</strong> Schule in den Horizont ihres Bildungsauftrags<br />
stellen. Damit ist vorweg behauptet, dass Schulkultur als Realisierung von<br />
Bildung in Erscheinung treten muss, womit auch verdeutlicht werden soll, dass diese<br />
Reformbemühungen nicht nur durch Erneuerungen, son<strong>der</strong>n auch durch Kontinuität ge-<br />
16
kennzeichnet sind. Die Kontinuität des Bildungsauftrags wird unter dem Begriff Schulkultur<br />
in einer neuen Aktualität ausgeleuchtet. Dadurch erwachsen Chancen, neue<br />
Impulse für die Praxis freizusetzen, ohne einem vor<strong>der</strong>gründigen Mo<strong>der</strong>nismus zu erliegen.<br />
(Fis Bildung nach DIPF/Text übernommen)<br />
� (17)<br />
AUTHOR<br />
Eikenbusch, Gerhard<br />
TITLE<br />
Praxishandbuch Schulentwicklung.<br />
SOURCE<br />
Berlin (Cornelsen Scripto), 245 S.<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1998<br />
DESCRIPTORS<br />
Handbuch; Schulentwicklung; Praxisbezug; Schulprofil; Verbesserung; Schulqualitaet; Schulklima;<br />
Schulklasse; Gestaltung; Schulleben; Schulmilieu; Lehrerfortbildung (fis Bildung)<br />
ohne ABSTRACT<br />
� (18)<br />
AUTHOR<br />
Emert, Karl<br />
TITLE<br />
Kommission ‚Schulentwicklungen – Beratung – Fortbildung‘ beim nie<strong>der</strong>sächsischen Kultusministerium.<br />
Bericht über ein Schul(verwaltungs)reformprojekt<br />
SOURCE<br />
In: Recht <strong>der</strong> Jugend und des Bildungswesens, 45 (97)<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1997<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulreform; Schulentwicklung; Beratung; Fortbildung; Schulqalität; Schulevaluation; Nie<strong>der</strong>sachsen<br />
ABSTRACT<br />
Der Autor fasst Ergebnisse des Ende 96 vorgelegten Berichts im Kontext <strong>der</strong> Schulverwaltungsreform<br />
zusammen. Zunächst werden Aufgaben und Ziele <strong>der</strong> Kommission erläutert<br />
sowie Gründe, Ziele und Handlungsfel<strong>der</strong> einer selbständigen Schule aufgezeigt.<br />
Es werden Vorschläge für ein landesweit koordiniertes, dezentral organisiertes Verbundsystem<br />
an regionalen Beratungs-Fortbildungszentren unterbreitet und Fragen <strong>der</strong> Qualitätssicherung<br />
und Evaluation diskutiert. (Fis Bildung nach DIPF)<br />
� (19)<br />
AUTHOR<br />
Gass, E.;Strittmatter, A.<br />
TITLE<br />
FQS: Das Bemuehen um redliche Qualitaetsevaluation.<br />
17
SOURCE<br />
In: Basellandschaftliche Schulnachrichten, Jg. 58, 1997, 3, S. 6f.<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1997<br />
DESCRIPTORS<br />
Schweiz; Schule; Schulqualitaet; Team; Evaluation; Organisationsentwicklung; Schulentwicklung;<br />
Dienstleistungsunternehmen; Lehrer<br />
ABSTRACT:<br />
Das Formative Qualitaetsevaluations-System (FQS) wurde vom LCH, dem Dachverband<br />
<strong>der</strong> deutschschweizerischen Organisationen <strong>der</strong> Lehrerschaft, entwickelt. Zwar gibt es<br />
Varianten fuer verschiedene Formen von Organisationen im Dienstleistungsbereich;<br />
primaer ist FQS aber auf Schulen ausgerichtet. Das System beruht auf <strong>der</strong> Ueberzeugung,<br />
Output-Messungen seien keine hinreichende Basis zur Verbesserung von Schulqualitaet,<br />
und sie lasse sich auch nicht durch obrigkeitliche Massnahmen dekretieren. Gemaess<br />
FQS bedingt Qualitaetssicherung eine Sensibilisierung <strong>der</strong> Schulteams fuer Fragen <strong>der</strong><br />
Qualitaet, die eigenverantwortliche Definition von Qualitaetskriterien auf lokaler Ebene<br />
und den festen gemeinsamen Willen <strong>der</strong> Teams, gemeinsam zu ueberpruefen, ob die gesetzten<br />
Ziele erreicht werden. Nach Anton Strittmatter, <strong>der</strong> im hier angezeigten Projekt<br />
als Berater mitwirkt, im uebrigen Hauptautor dieses Systems von Qualitaetsevaluation,<br />
lassen sich fuenf FQS-Handlungsfel<strong>der</strong> unterscheiden: Bestimmung <strong>der</strong> Qualitaetsansprueche;<br />
Auswahl und Anwendung <strong>der</strong> Instrumente, mit denen die Zielerreichung<br />
ueberprueft wird; Schaffung von Umsetzungsstrategien zwischen Evaluation und Organisationsentwicklung<br />
(bzw. zwischen diagnostizierten Maengeln und Bemuehungen um<br />
ihre Behebung); Evaluation <strong>der</strong> Evaluation in regelmaessigen Abstaenden; Berichterstattung<br />
in geeigneter Form ueber das, was man tut, zuhanden von Behoerden und<br />
OEffentlichkeit. (Zwischen)ergebnisse: Im Kanton Baselland haben 1995 bzw. 1996<br />
neun auf fuenf Gemeinden (Lausen, Muenchenstein, Reinach, Sissach und Therwil) verteilte<br />
Schulen mit Pilotprojekten <strong>zum</strong> Formativen Qualitaetsevaluations-System begonnen,<br />
um Erfahrung mit Anwendungen in <strong>der</strong> Praxis zu sammeln. Die Fe<strong>der</strong>fuehrung fuer<br />
das Ganze liegt beim Lehrerinnen- und Lehrerverein Baselland, <strong>der</strong> dabei mit <strong>der</strong><br />
kantonalen Erziehungs- und Kulturdirektion zusammenarbeitet. Ein Bericht zuhanden<br />
des Erziehungsrates soll im Januar 1998 vorliegen. (Foris)<br />
� (20)<br />
AUTHOR<br />
Helsper, Werner.; Krüger, Heinz-Hermann; Wenzel, Hartmut (Hrsg)<br />
TITLE<br />
Schule und Gesellschaft im Umbruch, Bd.1: Theoretische und internationale Perspektiven<br />
SOURCE<br />
Weinheim (Deutscher Studien Verlag)<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1996<br />
DESCRIPTORS<br />
Schule; Schulentwicklung; Mo<strong>der</strong>nisierung; internationale Schulentwicklung; Lernprozesse; Lehrerarbeit;<br />
Geschlechtsverhältnisse<br />
ABSTRACT<br />
18
Der Band wendet sich global <strong>der</strong> Lage <strong>der</strong> Schule unter den Bedingungen beschleunigter soziokultureller<br />
Mo<strong>der</strong>nisierung zu. Die einzelnen Beiträge dokumentieren die internationale Fachtagung ‚Schule und<br />
Gesellschaft im Umbruch – Probleme und Perspektiven <strong>der</strong> Schulentwicklung auf dem Weg in eine<br />
reflexive Mo<strong>der</strong>ne?‘ 1995 an <strong>der</strong> Martin-Luther-Universität in Halle. Beleuchtet werden in den Aufsätzen<br />
u. a. das Verhältnis von Bildung und Gesellschaft, <strong>der</strong> Zusammenhang von Gewalt, Ausgrenzung und<br />
Bildungsprozessen vor dem Hintergrund einer Globalisierung des Kapitalismus, internationale<br />
Perspektiven, (USA, Japan, Polen), die Konsequenzen aus den Verän<strong>der</strong>ungen des Aufwachsens für Schule<br />
und Schulentwicklung, schulische Lernprozesse und die Reproduktion tradierter Geschlechtsverhältnisse,<br />
die hohen Anfor<strong>der</strong>ungen an die Lehrerarbeit, die nach Meinung <strong>der</strong> Autoren in grundlegenden Paradoxien<br />
des Lehrerhandelns begründet sind. In diesem Kapitel SCHÜTZE, F./BRÄU, K./LIERMANN, H./<br />
PROKOPP, K./SPETH, M.; /WIESEMANN, J.: Überlegungen zu Paradoxien des professionellen<br />
Lehrerhandels in den Dimensionen <strong>der</strong> Schulorganisation) werden Paradoxien offengelegt, die<br />
insbeson<strong>der</strong>e mit Organisationszwängen und hoheitsstaatlichen Herrschaftsfunktionen verbunden sind. Als<br />
empirisch augenfällig werden folgende Paradoxien genannt: Problembearbeitung selber vormachen – frei<br />
erkunden lassen; offene Lernkontexte anzustreben – feste Lernmuster vorzustrukturieren; fertige Problemlösungsmuster<br />
– offene kreative Prozesse; Orientierung auf feste Zeittakte – Moratorien für<br />
Ausprobieren, Erkunden, Reflektieren; Beurteilungshandeln gemäß <strong>der</strong> schulischen und gesellschaftlichen<br />
Anfor<strong>der</strong>ungen – Identitätsentwicklung und Stärkung des Selbstbewußtseins. (CP)<br />
� (21)<br />
AUTHOR<br />
Hentig, Hartmut von<br />
TITLE<br />
Die Schule neu denken. Anmerkungen <strong>zum</strong> Schicksal <strong>der</strong> Bildungsreform.<br />
SOURCE<br />
In: Neue Sammlung, 31 (1991) 3, S. 436-448<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1991<br />
DESCRIPTORS<br />
Sachinformation; Erziehungswissenschaft; Schulpaedagogik; Schultheorie; Bildungsreform;<br />
Bildungspolitik; Schulpolitik; Schulreform; Schule; Gesellschaft; Veraen<strong>der</strong>ung; Verbesserung;<br />
Schulentwicklung<br />
ABSTRACT<br />
Einleitend wird, im Blick auf 30 Jahre Bildungsreform, die For<strong>der</strong>ung erhoben, "Schule<br />
neu zu denken", als Abgrenzung von zwei an<strong>der</strong>en moeglichen Auspraegungen von Bildungsreform:<br />
"verbessern" und "Veraen<strong>der</strong>n". Als Voraussetzung hierfuer wird im ersten<br />
Teil eine Theorie <strong>der</strong> Schule bzw. eine "Theorie <strong>der</strong> Theorie" entwickelt. Aufgrund <strong>der</strong><br />
veraen<strong>der</strong>ten gesellschaftlichen Bedingungen wird die Bestimmung <strong>der</strong> Schule als Aufenthaltsort<br />
bzw. Lebensort gesehen. Die sich daraus ergebenden Anfor<strong>der</strong>ungen werden<br />
in sechs Thesen formuliert. In <strong>der</strong> anschliessend erfolgenden Analyse <strong>der</strong><br />
ausserschulischen Bereiche paedagogischer Instanzen wird neben dem Einfluss <strong>der</strong><br />
Medien beson<strong>der</strong>s <strong>der</strong> <strong>der</strong> Familie und <strong>der</strong> 'polis' hervorgehoben. Im zweiten Teil werden<br />
als Gruende fuer die Notwendigkeit einer neuen Bestimmung von Schule aufgefuehrt:<br />
die Schwierigkeit auf die Zukunft vorzubereiten, da Zukunft immer weniger zu<br />
antizipieren ist; <strong>der</strong> nicht bearbeitete Wi<strong>der</strong>spruch zwischen einer paedagogisch guten<br />
Schule und <strong>der</strong> Realitaet des gesellschaftlichen Lebens; die Diskrepanz zwischen<br />
schulischer Wirklichkeit und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Als Fazit soll eine<br />
Schule stehen mit einem neuen Verhaeltnis zwischen Kin<strong>der</strong>n und Erwachsenen, in <strong>der</strong><br />
19
Lernen weniger durch Belehrung als durch Beteiligung erfolgt, in <strong>der</strong> eigene Verantwortung<br />
eine zentrale Rolle im Sinne <strong>der</strong> demokratischen 'polis' erfaehrt. (Fis Bildung)<br />
� (22)<br />
AUTHOR<br />
Holtappels, Heinz G.<br />
TITLE<br />
Innere Schulentwicklung: Innovationsprozesse und Organisationsentwicklung.<br />
SOURCE<br />
Aus: Zukunftsfel<strong>der</strong> von Schulforschung. Weinheim (Deutscher Studien Verlag), S. 327-<br />
354 (Monographieauszug)<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1995<br />
DESCRIPTORS<br />
Innovation; Paedagogische Forschung; Qualitaet; Schule; Schulentwicklung;<br />
Schulreform; Organisationsentwicklung; Schulkultur; Deutschland-BRD<br />
ABSTRACT<br />
Der Beitrag befasst sich mit dem Forschungsstand und den Forschungsperspektiven zu<br />
schulischer Innovation, beschränkt sich aber auf die innere pädagogisch-organisatorische<br />
Schulentwicklung. Im ersten Teil sollen kurz zentrale Überlegungen und Erkenntnisse zu<br />
schulischen Wandlungsprozessen skizziert werden. Dies mündet im zweiten Teil in<br />
empirisch gestützte Reflexionen <strong>zum</strong> Paradigmenwechsel in Reformstrategien wie auch<br />
in <strong>der</strong> Innovationsforschung, womit die Einzelschulentwicklung fortan in den Mittelpunkt<br />
rückt. Im dritten Teil werden basierend auf <strong>der</strong> Schulqualitätsforschung bedeutsame<br />
empirische Resultate <strong>zum</strong> Verlauf und zur Wirkung von Innovationsprozessen bzw.<br />
zur Schulqualitätsentwicklung referiert, im vierten Teil gezielte Verän<strong>der</strong>ungsstrategien<br />
einschließlich <strong>der</strong> Konzept- und Organisationsentwicklung in den Blick genommen.<br />
Überlegungen <strong>zum</strong> Forschungbedarf sind in einzelnen Kapiteln integriert und <strong>zum</strong><br />
Schluss zusammengefasst. (Fis Bildung nach DIPF/Text übernommen)<br />
20
� (23)<br />
AUTHOR<br />
Holtappels, Heinz G.<br />
TITLE<br />
Schulkultur und Innovation. Ansätze, Trends und Perspektiven <strong>der</strong> Schulentwicklung.<br />
SOURCE<br />
Aus: Entwicklung von Schulkultur. Neuwied (Luchterhand), S. 6-36<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1995<br />
DESCRIPTORS<br />
Innovation; Schulentwicklung; Qualitaet; Bildungstheorie; Schulorganisation;<br />
Schulklima; Unterrichtsmethode; Schulreform; Management; Bedingung;<br />
Organisationsentwicklung; Schulkultur; Deutschland<br />
ABSTRACT<br />
Der Autor thematisiert den Perspektivenwechsel <strong>der</strong> Schulentwicklung von Gesamtsystemstrategien<br />
hin zur Entwicklung <strong>der</strong> Einzelschule. Dies führt <strong>zum</strong> Begriff <strong>der</strong> Schulkultur,<br />
dessen Explikation exakt jene Aspekte in den Blick nimmt, die auch zentrale<br />
Komponenten von Schulqualität ausmachen. Dabei darf das Wechselverhältnis zwischen<br />
Schulstruktur und Schulkultur nicht übersehen werden. Wenngleich durchgreifende<br />
Erneuerung entscheidend durch Gestaltungskompetenzen und Innovations-Management<br />
auf <strong>der</strong> Ebene <strong>der</strong> Einzelschule geschieht, sind Initiation und Steuerung von Innovationen<br />
seitens <strong>der</strong> Ebene des Gesamtsystems und regionaler Unterstützungssysteme vonnöten.<br />
(Fis Bildung nach DIPF/Text übernommen).<br />
� (24)<br />
AUTHOR<br />
Holtappels, Heinz Günter<br />
HG: Bauer, Karl-Oswald (Mitarb.)<br />
TITLE<br />
Entwicklung von Schulkultur. Ansätze und Wege schulischer Erneuerung<br />
SOURCE<br />
Neuwied u.a. (Luchterhand), 249 S.<br />
21
PUBLICATION YEAR<br />
1995<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulentwicklung; Schulqualitaet; Schulreform; Schulorganisation; Schulautonomie;<br />
Schultheorie; Lerntheorie; Interkulturelle Erziehung; Curriculumentwicklung; Lehrer;<br />
Sozialpaedagoge; Schuelerbetreuung; Ganztagsschule; Integrative<br />
Behin<strong>der</strong>tenpaedagogik (Fis Bildung)<br />
ohne ABSTRACT<br />
� (25)<br />
AUTHOR<br />
Hurrelmann, Klaus<br />
TITLE<br />
Tendenzen <strong>der</strong> Privatisierung des deutschen Schulsystems. Chance o<strong>der</strong> Gefahr für<br />
Qualität und Chancengleichheit <strong>der</strong> Bildung?<br />
SOURCE<br />
In: Forum E, 48 (1995) 11-12, S. 24-26<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1995<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulwesen; Privatisierung; Schule; Schulqualitaet; Chancengleichheit; Schulreform;<br />
Privatschule<br />
ABSTRACT<br />
Das deutsche Schulwesen beginnt fast unmerklich sich zu privatisieren. Das ist einmal<br />
am wachsenden Anteil von Privatschulen ablesbar, <strong>zum</strong> zweiten an immer größer<br />
werdenden Anteilen von sozialen und finanziellen Investitionen, die nicht aus Staatskassen<br />
kommen." Der Autor stellt die Motive von Eltern und Schülern für die Auswahl von<br />
Privatschulen zusammen. Er hinterfragt, ob und wie das öffentliche Schulwesen auf diese<br />
Wünsche reagieren kann. Es geht dabei um die Fragen: - Wie können die Mitwirkungswünsche<br />
<strong>der</strong> Eltern stärker berücksichtigt werden? - Wie kann eine zeitliche und<br />
inhaltliche Auswirkung des schulischen Angebots erreicht werden? - Wie kann den<br />
Wünschen <strong>der</strong> Eltern nach verstärkter Leistungsför<strong>der</strong>ung nachgekommen werden? Insbeson<strong>der</strong>e<br />
die letzte Frage weist auf "strukturelle Defizite des heutigen Schulsystems"<br />
hin, denn immer mehr Eltern geben viel Geld für privaten Zusatzunterricht aus. Dies<br />
drückt "ein Mißtrauen gegenüber <strong>der</strong> Staatsschule aus, <strong>der</strong> unterstellt wird, das eigene<br />
Kind nicht ausreichend leistungsmäßig und sozial zu för<strong>der</strong>n". Der Autor for<strong>der</strong>t daher<br />
einmal eine Diskussion über den Stellenwert <strong>der</strong> rein kommerziellen Privatschulen neuen<br />
Typs innerhalb unseres Bildungssystems und <strong>zum</strong> an<strong>der</strong>en eine "Diskussion über angemessene<br />
und flexible Formen <strong>der</strong> Leistungsdifferenzierung". (Fis Bildung nach<br />
DIPF/Kr.)<br />
22
� (26)<br />
AUTHOR<br />
Hurrelmann, Klaus<br />
TITLE<br />
Das deutsche Schulsystem privatisiert sich.<br />
SOURCE<br />
In: Pädagogik, 48 (1996) 9, S. 35-39<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1996<br />
DESCRIPTORS<br />
Privatschule; Bildungspolitik; Schule; Schulsystem; Oeffentliche Schule; Kritik;<br />
Qualität; Reform; Chancengleichheit; Schulorganisation; Deutschland IS: 0933-422x<br />
ABSTRACT<br />
Ausgehend von <strong>der</strong> wachsenden Zahl von Schulen in privater Trägerschaft und dem Anstieg<br />
<strong>der</strong> Schülerzahlen, die diese Schulen besuchen, konstatiert <strong>der</strong> Autor eine sinkende<br />
Akzeptanz des öffentlichen Schulsystems von Seiten <strong>der</strong> Eltern. Er benennt daran anschließnd<br />
die Motive für die Unzufriedenheit (starre Schulorganisation, fehlende Betreuungsangebote,<br />
geringe Leistungsfor<strong>der</strong>ung), zeigt die schleichende Privatisierung des<br />
öffentlichen Schulsystems auf (Bsp. Nachhilfeunterricht) und stellt Risiken (Chancengleichheit)<br />
aber auch Chancen dieser "auf einzelne Bereiche begrenzten Privatisierung<br />
des Bildungssystems" dar. Abschließend „äußert <strong>der</strong> Autor seine Befürchtung, dass ohne<br />
ordnungspolitische Korrekturen im Bereich des Bildungssystems, private Schulen weiter<br />
an Einfluss gewinnen und ähnliche negative Folgen zu erwarten seien, wie im Bereich<br />
des Rundfunks/Fernsehens. (Fis Bildung nach DIPF).<br />
� (27)<br />
AUTHOR<br />
Ipfling, Heinz-Jürgen<br />
TITLE<br />
Schulkultur. Ein Weg zu einem neuen Schulverständnis.<br />
SOURCE<br />
In: Schulmagazin 5-bis-10, 10 (1995) 10, S. 4-7<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1995<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulklima; Kultur; Schulreform; Innovation; Schule; Schulleben; Personalentwicklung;<br />
Schulkultur<br />
ABSTRACT<br />
In drei Schritten soll versucht werden, das <strong>Thema</strong> "Schulkultur" zu behandeln: Zuerst<br />
geht es um eine Klärung des Begriffs, dann gilt es mögliche Ansatzfel<strong>der</strong> für Schulkultur<br />
aufzuzeigen, und schließlich werden Probleme und Grenzen bei <strong>der</strong> Verwirklichung von<br />
Schulkultur thematisiert. (Fis Bildung nach DIPF/Text übernommen)<br />
23
� (28)<br />
AUTHOR<br />
Ipfling, Heinz-Juergen<br />
TITLE<br />
Humane Schule - Paradoxie o<strong>der</strong> Pleonasmus? Doktor Ludwig Eckinger <strong>zum</strong> 50.<br />
Geburtstag gewidmet.<br />
SOURCE<br />
In: Forum E, 47 (1994) 6, S. 7-10<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1994<br />
DESCRIPTORS<br />
Schule; Humanitaet; Lehrer; Ethik; Aktion Humane Schule; Schulqualität<br />
ABSTRACT<br />
Der Beitrag will darauf aufmerksam machen, dass sich Schule dem von <strong>der</strong> schulkritischen<br />
und schulreformerischen Bewegung <strong>der</strong> 70er und 80er Jahre gefor<strong>der</strong>ten Ideal <strong>der</strong><br />
humanen Schule noch nicht weit genug angenaehert hat. Dazu werden die damals von<br />
<strong>der</strong> Buergerinitiative "Aktion Humane Schule" formulierten Leitsaetze fuer eine humane<br />
Schule ins Gedaechtnis gerufen. Dem werden Elemente gegenuebergestellt, die <strong>der</strong> Verwirklichung<br />
einer humanen Schule entgegenstehen, wie Schulangst, Politisierung von<br />
Schule unter totalitaeren Regimen und die Einfluesse einer konkurrenzorientierten<br />
Leistungsgesellschaft. Die Diskussion um den Rahmen, in dem die humane Schule entstehen<br />
soll reicht von Ideen <strong>der</strong> Expansion (Schule als Lebensstaette,<br />
Ganztagsbetreuung) ueber die Reduktion (keine Vereinnahmung durch die "totale<br />
Schule") bis hin zur Besinnung auf die originaere und primaere Funktion <strong>der</strong> Schule als<br />
Unterrichtseinrichtung, die nicht nur dem staatlichen Sektor vorbehalten bleiben darf,<br />
son<strong>der</strong>n sich auch privaten Traegern staerker oeffnen sollte. Unabhaengig vom eingeschlagenen<br />
Weg zur Humanisierung, stehen in <strong>der</strong> Schulpaedagogik konkrete Reformfor<strong>der</strong>ungen<br />
an, denen <strong>der</strong> Autor, analog <strong>zum</strong> Hippokratischen Eid, die von Hartmut von<br />
Hentig formulierten paedagogische Grundsaetze, den Sokratischen Eid, an die Seite<br />
stellt. Auch wenn mit diesem Eid ein hoher Anspruch verbunden ist, sollte am Ideal <strong>der</strong><br />
humanen Schule festgehalten und ihre Verwirklichung <strong>zum</strong> Programm gemacht werden.<br />
(Fis Bildung nach DIPF/Kr.).<br />
� (29)<br />
AUTHOR<br />
Ipfling, Heinz-Jürgen<br />
TITLE<br />
Schule öffnen!?<br />
SOURCE<br />
In: Bayerische Schule, 49 (1996) 5, S. 13-17<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1996<br />
24
DESCRIPTORS<br />
Schule; Schulentwicklung; Lebensnahe Erziehung; Offene Schule; Durchlaessigkeit;<br />
Schulerziehung; Schulorganisation; Schulreform; Offener Unterricht<br />
ABSTRACT<br />
Mit dem Ausrufe- und Fragezeichen im Titel will <strong>der</strong> Autor seine Position <strong>zum</strong> <strong>Thema</strong><br />
"Schule öffnen" ausdrücken. Dies wird im Beitrag näher begründet. Nach einer zunächst<br />
theoretischen und historischen Betrachtung zu Zweckbestimmungen <strong>der</strong> Schule, Lernen<br />
in <strong>der</strong> Schule(Schule und Leben - Lebensferne, Lebensnähe) wird auf das "begründete"<br />
Öffnen näher eingegangen: Absichten, Richtungen, Fel<strong>der</strong>... Zugleich ist aber auf<br />
Kontemplation und notwendige Konzentration verwiesen worden. Der Autor kommt zu<br />
folgen<strong>der</strong> Synthese: "Schule als Bildungseinrichtung muss sich öffnen; aber sie kann sich<br />
nicht nur diesem einen verschreiben, sie muss sich auch von Zeit zu Zeit schließen.... Wir<br />
haben es wie<strong>der</strong> einmal mit jener 'Doppelendigkeit' <strong>der</strong> Pädagogik zu tun ...So definiert<br />
sich auch <strong>der</strong> Bildungsprozess in <strong>der</strong> Spannung zwischen Öffnung und Sammlung“.<br />
(DIPF/Ko.).<br />
� (30)<br />
AUTHOR<br />
Ipfling, Heinz-Jürgen<br />
TITLE<br />
Schulkultur in <strong>der</strong> Diskussion.<br />
SOURCE<br />
In: Grundschulmagazin, 11 (1996) 12, S. 4-6<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1996<br />
DESCRIPTORS<br />
Grundschule; Kultur; Schulreform; Definition; Schulentwicklung; Unterschicht;<br />
Erziehung; Schulleben; Schulklima; Organisation
� (31)<br />
AUTHOR<br />
Kallbach, Marina<br />
TITLE<br />
Untersuchungen zur Qualitaet von Schule - Einfuehrung in einen aktuellen<br />
Forschungsansatz.<br />
SOURCE<br />
In: Pädagogik und Schulalltag, 49 (1994) 3, S. 344-353<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulreform; Schule; Qualitaet; Paedagogische Forschung; Bildungstheorie; Empirische<br />
Untersuchung; Schulklima; Bildungspolitik<br />
ABSTRACT<br />
Schulqualitaetsuntersuchungen als neuer Schwerpunkt von Schulforschung sollen dazu<br />
beitragen, konkrete Hilfestellungen fuer die Verbesserung von Schule zu erarbeiten.<br />
Rezepte gibt es dafuer nicht. "Eine Schulkultur, die eine kritische Sichtweise auf Missstaende<br />
ermoeglicht und ein schoepferisches, schuelerorientiertes Herangehen an die<br />
Bewaeltigung von Problemen foer<strong>der</strong>t, ist nicht nur Voraussetzung fuer die gemeinsame<br />
Arbeit an einem Schulkonzept, son<strong>der</strong>n auch ihr Ziel. (Fis Bildung nach DIPF/Sch.).<br />
� (32)<br />
AUTHOR<br />
Klafki, Wolfgang<br />
TITLE<br />
Wohin soll sich die Schule entwickeln? Perspektiven <strong>der</strong> Schule unter<br />
bildungstheoretischen Gesichtspunkten.<br />
SOURCE<br />
Aus: Schule von innen veraen<strong>der</strong>n. Braunschweig (SL), S. 21-37<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1993<br />
DESCRIPTORS<br />
Bildungsbegriff; Bildungstheorie; Erziehungsziel; Schule; Schulreform; Unterrichtsinhalt<br />
ABSTRACT<br />
Der Autor umreisst zunaechst in Thesenform sein "Bildungskonzept fuer unsere Gegenwart"<br />
und beschreibt dann "Konsequenzen aus <strong>der</strong> Bestimmung, dass zukunftsorientierte<br />
Bildung heute als 'Bildung im Medium des Allgemeinen' verstanden werden muss, als<br />
geschichtlich vermitteltes Bewusstsein von zentralen Problemen <strong>der</strong> Gegenwart und <strong>der</strong><br />
Zukunft, verbunden mit <strong>der</strong> Einsicht in die Mitverantwortlichkeit aller angesichts solcher<br />
Probleme und mit <strong>der</strong> Bereitschaft, an ihrer Bewaeltigung mitzuwirken." Diese<br />
"epochaltypischen Schluesselprobleme" wie z. B. Krieg und Frieden, Interkulturalitaet,<br />
Oekologie, gesellschaftlich produzierte Ungleichheit u. a. werden diskutiert;<br />
abschliessend skizziert <strong>der</strong> Autor eine unterrichtspraktische Umsetzung des Schluesselproblem-Vorschlags.<br />
(Fis Bildung nach DIPF/Bi.).<br />
26
� (33)<br />
AUTHOR<br />
Klafki, Wolfgang<br />
TITLE<br />
Schulpolitische und pädagogische Schulgestaltung im Spannungsfeld konkurrieren<strong>der</strong><br />
Prinzipien. Überlegungen zu einem Kapitel <strong>der</strong> Schultheorie.<br />
SOURCE<br />
Aus: Bildungsreform und Vergleichende Erziehungswissenschaften. Münster Westfalen<br />
(Waxmann), S. 5-29 (Monographieauszug)<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1995<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulpolitik; Schulentwicklung; Organisationsentwicklung; Theorie; Schulreform;<br />
Schulorganisation; Dezentralisierung; Schulerziehung; Handlungstheorie;<br />
Paedagogischer Prozess; Mitbestimmung; Schueler; Lehrer; Eltern; Schulverfassung;<br />
Autonomie; Lehren; Lernen; Lernbedingungen; Deutschland<br />
ABSTRACT<br />
Ausgehend von dem Nachweis, dass die verschiedenen Richtungen, die in den<br />
schulpolitisch-pädagogischen Erörterungen und Kontroversen vertreten werden, meistens<br />
nur einige Gesichtspunkte aus dem breiten Spektrum von Prinzipien <strong>der</strong> Schulgestaltung<br />
berücksichtigen, werden vom Autor fünfzehn solcher Gestaltungsgrundsätze angeführt.<br />
Sie beinhalten in <strong>der</strong> verkürzten Wie<strong>der</strong>gabe folgendes: 1. Optimale För<strong>der</strong>ung jedes<br />
einzelnen Kindes o<strong>der</strong> Jugendlichen gewährleisten; 2. Orientierung am Prinzip <strong>der</strong><br />
Bildungschancengleichheit; 3. solides Fundament gemeinsamer Erkenntnisse,<br />
Fähigkeiten, Einstellungen vermitteln; 4. Hinreichende Stabilität <strong>der</strong> sozialen<br />
Beziehungen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> und Jugendlichen untereinan<strong>der</strong> und zu Lehrer(innen)<br />
ermöglichen; 5. Über den verbindlichen Unterricht hinaus jedem einzelnen jungen<br />
Menschen möglichst viele Wahlmöglichkeiten zur individuellen Interessen- und Fähigkeitsentwicklung<br />
bieten; 6. hohes Maß an Kontinuität (Durchgängigkeit) bei <strong>der</strong><br />
Gestaltung <strong>der</strong> Bildungsgänge/des Schulsystems sichern; 7. deutliche Phasen und Stufen<br />
- Überschaubare Zeitabschnitte mit sinnvollen Abschlussmöglichkeiten schaffen; 8. zugleich<br />
horizontale Übergangsmöglichkeiten (Durchlässigkeit) bieten; 9. auf Wünsche <strong>der</strong><br />
Eltern für ihre Kin<strong>der</strong> eingehen; 10. Bildungsgerechtigkeit innerhalb <strong>der</strong> Elterinteressen<br />
herstellen; 11. Mitbestimmungsrecht <strong>der</strong> Eltern darf die "pädagogische Freiheit" <strong>der</strong><br />
Lehrer nicht in Frage stellen; 12. Mitwirkungs- und -gestaltungsmöglichkeiten <strong>der</strong><br />
Schüler(innen) gewährleisten; 13. vor allem in <strong>der</strong> Sekundarstufe I wohnortnahen Schulbesuch<br />
(in <strong>der</strong> Lebenswelt <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>) sichern; 14. zugleich weitgehende freie Anwählbarkeit<br />
bestimmter Schulen ermöglichen; 15. Autonomie <strong>der</strong> Einzelschule o<strong>der</strong><br />
Schulregionen (Dezentralisierung <strong>der</strong> Verantwortung) sichern. Die Analyse <strong>der</strong> Grundsätze<br />
macht deutlich, dass diese jeweils begründbar sind. Zahlreiche Spannungen und<br />
Wi<strong>der</strong>sprüche ergeben sich, sobald die Beziehungen zwischen ihnen untersucht und die<br />
Frage nach ihrer Vereinbarkeit gestellt wird. (fis Bildung)<br />
27
� (34)<br />
AUTHOR<br />
Kliebisch, Udo W.; Fleskes, Heinz Dieter; Basten, Karl Heinz<br />
TITLE<br />
Schule mit Profil. Bausteine zur Schulprogramm-Entwicklung<br />
SOURCE<br />
Baltmannsweile (Schnei<strong>der</strong>-Verlag Hohengehren)<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1997<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulprogramm, Schulentwicklung, Kollegium, Fortbildung, Schulleitung, Schul-<br />
Management, Projektunterricht, Stressbewältigung, Wellness<br />
ABSTRACT<br />
Der Band versteht sich als ein Handbuch für Schulen, die sich mit Schulprogramm-Entwicklung<br />
auseinan<strong>der</strong>setzen wollen und konkrete Anregungen suchen. Ansatzpunkt ist<br />
die Kritik an <strong>der</strong> politischen Organisation des Schulwesens, die keine Beweglichkeit im<br />
Umgang mit beson<strong>der</strong>en Umständen vor Ort erlaubt. Diesem Missstand setzen die<br />
Autoren die Entwicklung von Schulprogrammen entgegen. Sie stellen eine Reihe von<br />
Bausteinen vor, die für die Schulprogramm-Entwicklung von Interesse sind. Nach <strong>der</strong><br />
Erläuterung des theoretischen Rahmens folgt im 2. Kapitel die Darstellung von<br />
Verfahren <strong>der</strong> Selbstdiagnose, die „als Voraussetzung für jede programmatische Weiterentwicklung<br />
gelten kann“. In den letzten Kapiteln beschreiben die Autoren Beispiele für<br />
die Umsetzung einzelner Aspekte eines Schulprogramms (Kollegiumsinterne Fortbildung,<br />
Schulmanagement-Stil, Stress-Bewältigung bei Lehren und bei Schülern<br />
[Wellness-Erfahrungen], Projekt-Arbeit und fächerübergreifendes Lernen). (CP)<br />
� (35)<br />
AUTHOR<br />
Kleinschmidt, Gottfried<br />
TITLE<br />
Unterrichtsforschung und Schulentwicklung.<br />
SOURCE<br />
In: Erziehungswissenschaft und Beruf, 46 (1998) 2, S. 147-165<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1998<br />
SOURCE<br />
Unterrichtsforschung; Schulentwicklung; Qualitaet; Effektivitaet; Schuelerleistung;<br />
Internationaler Vergleich; Mathematikunterricht; Naturwissenschaftlicher Unterricht;<br />
Bildungsforschung; Lehrerausbildung; Vereinigte Staaten; Kreativitaet<br />
ABSTRACT<br />
„In <strong>der</strong> Schulentwicklung wird zwischen Schulqualität und Schuleffektivität<br />
unterschieden. Im Zentrum <strong>der</strong> Schuleffektivität stehen die Lehr- und Lernprozesse unter<br />
28
eson<strong>der</strong>er Berücksichtigung <strong>der</strong> einzelnen Fachdidaktiken. Entscheidend ist die<br />
Effektivität des Lehrens und Lernens im jeweiligen Fach. Schlüsselbegriffe <strong>der</strong> Schulqualität<br />
sind u. a. die Schulkultur, das Schulklima, das Schulprogramm, das<br />
Schulportrait, das Schulprofil usw. Es kann zu Diskrepanzen zwischen Schulqualität und<br />
Schuleffektivität kommen. Schulen können sich durch eine beson<strong>der</strong>e Schulqualität auszeichnen<br />
und gleichzeitig eine geringe Schuleffektivität aufweisen. Daher wird neuerdings<br />
die wichtige Frage erörtert: Welche Schulen brauchen wir?" Diskussion dieser<br />
Frage anhand <strong>der</strong> TIMSS-Studie. U. a. wird dargestellt, welche Schlussfolgerungen amerikanische<br />
Schulforscher aus den Teilergebnissen <strong>der</strong> TIMSS-Studie ziehen. Drei<br />
leitende Konzepte <strong>der</strong> inneren Schulentwicklung: systemisches Denken, ergebnisfundiertes<br />
Lernen und Konstruktivismus. (Fis Bildung nach ISB).<br />
� (36)<br />
AUTHOR<br />
Knau<strong>der</strong>, Hannelore<br />
TITLE<br />
Burnout bei LehrerInnen und die Auswirkungen auf das Schulklima. Ergebnisse einer<br />
Grazer Untersuchung.<br />
SOURCE<br />
In: Erziehung und Unterricht, 146 (1996) 9, S. 682-688<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1996<br />
DESCRIPTORS<br />
Lehrer; Schulklima; Empirische Untersuchung; Wirkung; Schueler; Schuelerverhalten;<br />
Lehrerverhalten; Burnout-Syndrom (Fis Bildung)<br />
ohne ABSTRACT<br />
� (37)<br />
AUTHOR<br />
Mack, Wolfgang<br />
TITLE<br />
Schulkultur und Autonomie. Argumente für eine basisnahe und dezentrale<br />
Schulentwicklung.<br />
SOURCE<br />
Aus: Hauptschule als Jugendschule. Ludwigsburg (Süddeutscher Pädag. Verl.), S. 150-<br />
157<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1995<br />
DESCRIPTORS<br />
Schule; Autonomie; Schulkultur; Schulentwicklung; Dezentralisierung; Schulklima;<br />
Hauptschule; Deutschland<br />
29
ABSTRACT<br />
Im folgenden wird eine Reformperspektive skizziert, für die zwei Bezugspunkte leitend<br />
sind: Zum einen ist hierbei die "Entdeckung" <strong>der</strong> Einzelschule seit ungefähr Anfang <strong>der</strong><br />
achtziger Jahre zu nennen. Nach den an Strukturfragen orientierten Bildungsreformen <strong>der</strong><br />
sechziger und siebziger Jahre spielt seither die Frage, wie sich einzelne Schulen weiterentwickeln<br />
können, eine immer größere Rolle. Begriffe wie "Schulkultur" und "gute<br />
Schule", mittlerweile <strong>zum</strong> schulpädagogischen Grundwortschatz gehörend, verweisen<br />
auf dieses Interesse an <strong>der</strong> Einzelschule. Eine an<strong>der</strong>e, im Grunde ältere Debatte um die<br />
Autonomie von Schule wird in den letzten Jahren verstärkt geführt und hat seit Beginn<br />
<strong>der</strong> neunziger Jahre durch neue Argumente an Aktualität gewonnen, die die alte<br />
For<strong>der</strong>ung nach Autonomie bekräftigen ... Im folgenden wird versucht zu begründen,<br />
warum nur so eine Weiterentwicklung von Schulen darstellbar ist, und skizziert, welche<br />
Konsequenzen sich daraus für die konkrete Arbeit an <strong>der</strong> Schule ergeben. (Fis Bildung<br />
nach DIPF/Orig.).<br />
� (38)<br />
AUTHOR<br />
Melzer, Wolfgang<br />
TITLE<br />
Zur Transformation des Bildungssystems in Ostdeutschland. Verän<strong>der</strong>ungen im<br />
Verhältnis von Schule, Elternhaus und Jugendkultur.<br />
SOURCE<br />
Aus: Schule und Gesellschaft im Umbruch. Bd. 2. Trends und Perspektiven <strong>der</strong><br />
Schulentwicklung in Ostdeutschland. Weinheim (Deutscher Studien-Verlag), S. 49-69<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1996<br />
DESCRIPTORS<br />
Erziehungsgeschichte; Transformation ; Sozialer Wandel; Schulsystem;<br />
Strukturwandel; Bildungsreform; Schulklima; Soziale Situation; Jugend; Familie;<br />
Jugendkultur; 20. Jahrhun<strong>der</strong>t; Deutschland-DDR; Vereinigung; Deutschland-Oestliche<br />
Laen<strong>der</strong>. (Fis Bildung)<br />
ohne ABSTRACT<br />
� (39)<br />
AUTHOR<br />
Melzer, Wolfgang; Stenke, Doris<br />
HG: Rolff, Hans-Günter (Hrsg.); Bauer, Karl-Oswald (Hrsg.); Klemm, Klaus (Hrsg.)<br />
TITLE<br />
Schulentwicklung und Schulforschung in den ostdeutschen Bundeslän<strong>der</strong>n.<br />
SOURCE<br />
Aus: Jahrbuch <strong>der</strong> Schulentwicklung. Band 9. Weinheim u.a. (Juventa), S. 307-337<br />
30
PUBLICATION YEAR<br />
1996<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulentwicklung; Schulreform; Schulsystem; Schulpaedagogik; Paedagogische<br />
Forschung; Empirische Forschung; Transformation ; Schulpolitik;<br />
Differenzierung; Qualitaet; Schulleben; Schulklima; Bewertung; Schueler; Oekologie;<br />
Lehrerkollegium; Schulkultur; Deutschland-Oestliche Laen<strong>der</strong><br />
ABSTRACT<br />
Die Autoren geben einen Überblick über die Situation des Bildungssystems und <strong>der</strong><br />
schulbezogenen Forschung in Ostdeutschland im Jahre sechs nach <strong>der</strong> Wende. Enthalten<br />
sind aktuelle Daten zur Schulentwicklung und ihrer Bewertung. Sie wählen dazu einen<br />
"spezifischen Ansatz <strong>der</strong> Verbindung von Schulforschung und Schulentwicklung, mit<br />
dessen Hilfe eine Verbesserung <strong>der</strong> Schulqualität erreicht werden soll". Dabei wird <strong>der</strong><br />
Schulkultur beson<strong>der</strong>e Beachtung geschenkt. Glie<strong>der</strong>ung des Beitrags: 1. Entwicklung<br />
<strong>der</strong> schulbezogenen Forschung in Ostdeutschland 2. Die Entwicklung des Schulsystems<br />
im Kontext des gesellschaftlichen Transformationsprozesses (u. a. Der kurze Weg <strong>der</strong><br />
Zweigliedrigkeit in Sachsen - Das Zwei-Säulen-Modell in Sachsen, Beschreibung und<br />
erste Bilanz) 3. Auf <strong>der</strong> Suche nach Schulqualität - Analyse von Einzelschulen und<br />
Schulentwicklung (u. a. Einschätzung des Schulklimas durch Schüler -Zusammenwirken<br />
von Lehrerhandeln, Schulökologie und Schülerpartizipation mit dem Schulklima -<br />
Schulkultur und Schulqualität, mit Übersichten <strong>zum</strong> Schulqualitätsindex und einer<br />
Variablenübersicht zur Schulkultur). (Fis Bildung nach DIPF/Ko.).<br />
� (40)<br />
AUTHOR<br />
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.).<br />
Beiträge von: Springer, Ruth; Behler, Gabriele; Rolff; Hans-Günter; Alterichter, Herbert;<br />
Posch, Peter<br />
TITLE<br />
Evaluation in <strong>der</strong> Schulpraxis. Beiträge zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung<br />
von Schule<br />
SOURCE<br />
Schule in NRW, Heft. 9023, Frechen (Verlagsgesellschaft Ritterbach)<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1998<br />
DESCRIPTORS<br />
Evaluation; Lehrer, Schulleiter; Schulpraxis; Schulentwicklung<br />
ABSTRACT<br />
In dem Band werden zunächst die Aufgaben und Ziele von Evaluation bestimmt. Der<br />
Selbstevaluation (sowohl <strong>der</strong> Schulleitung, <strong>der</strong> Lehrer-Selbstevaluation und <strong>der</strong> Selbstevaluation<br />
ganzer Schulen) wird dabei Vorrang gegenüber externer Evaluation eingeräumt.<br />
Für die Selbstevaluation ganzer Schulen wird das IFS-Barometer vorgestellt, ein<br />
mehrspektivistisches Instrument zur Erfassung von Schulwirklichkeit für<br />
31
Sekundaschulen. Der mittlere Teil des Bandes beschreibt Praxisbeispiele zur Evaluation,<br />
u. a. wird über die Erfahrungen aus dem BLK-Modellversuch ‚Selbstevaluation als Instrument<br />
einer erweiterten Selbständigkeit von Schulen‘ berichtet. Abschließend werden<br />
Thesen zu den bisherigen Erfahrungen mit Evaluation in Schulen sowie Perspektiven<br />
zusammengefaßt: Nach Meinung <strong>der</strong> Autoren/Mitarbeiter an den Arbeitsgruppen haben<br />
sich überschaubare Evaluationsprozesse in begrenzten Bereichen schulischer Arbeit bewährt.<br />
Wünschenswert sind außerdem Methodenvielfalt (die Methoden sollten nicht von<br />
außen vorgegeben werden, son<strong>der</strong>n je nach Problemstellung von den Schulen gewählt<br />
werden) und die Beteiligung <strong>der</strong> Schüler. (CP)<br />
� (41)<br />
AUTHOR<br />
Phillip, E.<br />
TITLE<br />
Gute Schule verwirklichen.<br />
SOURCE<br />
Weinheim und Basel (Beltz Verlag)<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1992<br />
DESCRIPTORS<br />
Organisatoinsentwicklung; Schulklima; gesellschaftlicher Wandel; schulischer Wandel; Lehrerbelastung<br />
ABSTRACT<br />
In diesem Buch geht es um die Organisationsentwicklung als eine Strategie zur Verbesserung<br />
des Schulklimas: Schulen sind mit bedeutsamen gesellschaftlichen Verän<strong>der</strong>ungstrends<br />
sowie mit Verän<strong>der</strong>ungen innerhalb <strong>der</strong> Schulen (Informations-und Kommunikationsthechnologie,<br />
Gewalt an den Schulen, Öffnungsvorhaben, gestiegenen<br />
Bildungswünsche, Burn-out bei Lehrern etc.) konfrontiert. Angesichts neuer Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
muß die pädagogische Arbeit als gemeinsame Tätigkeit und gemeinsame Verantwortung<br />
des Kollegiums betrachtet werden. Diesem Postulat steht die traditionell als<br />
isolierte Einzelarbeit angelegte Lehrerrolle gegenüber. Daraus wird gefolgert, dass<br />
Schulen zur inneren Reform und Erneuerung Hilfe und Unterstützung brauchen. Als ein<br />
Weg zu mehr Gemeinsamkeit und Kooperation wird die Lernstrategie ‚Organsationsentwicklung‘<br />
vorgestellt, die als kontinuierlicher Prozeß an den Schulen implementiert<br />
werden kann und darauf abzielt, das Verhalten <strong>der</strong> Organisationsmitglie<strong>der</strong> (in dem Fall<br />
die Lehrer) zu än<strong>der</strong>n. Beschrieben werden Instrumente und Methoden <strong>der</strong> schulischen<br />
OE sowie konkrete Fallbeispiele. (CP)<br />
� (42)<br />
AUTHOR<br />
Posch, Peter; Altrichter, Herbert; Specht, Werner; Klafki, Wolfgang; Brinek, Gertrude; Radnitzky, Edwin;<br />
Schratz, Michael; Zach, Christel; Almer, Alois; Pendl, Rupert; Rieger, Maria; Grabher, Werner;<br />
Strittmatter, Anton; Engleitner, Johann; Keppelmöller, Joachim; Schwarz, Wolfgang T.; Rottensteiner,<br />
Erika; Winter, Maria<br />
HG: Kraus, Geraldine (Red.)<br />
TITLE<br />
Qualitätsentwicklung und Evaluation. (Heftthema)<br />
32
SOURCE<br />
In: Erziehung und Unterricht, 148 (1998) 7-8, S. 537-678<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1998<br />
DESCRIPTORS<br />
Schule; Qualitaet; Schulqualitaet; Schulentwicklung; Evaluation; Schulprogramm; Selbstevaluation;<br />
Lehrer; Unterricht; Kooperation; Schulaufsicht; Schueler; Organisationsentwicklung; Organisationslernen;<br />
Europa; Europaeische Union; Oesterreich<br />
ABSTRACT<br />
Inhalt: Schulen am Weg zu Schulprogramm und Qualitätsevaluation (Posch u. a.).<br />
Selbstevaluation <strong>der</strong> Schule und Qualitätssicherung des Bildungswesens im europäischen<br />
Kontext (Specht). Schulqualität -Schulprogramm - Selbstevaluation <strong>der</strong> Kollegien<br />
(Klafki). Der Lehrer als Qualitätsmanager (Brinek). Evaluation <strong>der</strong> Qualität von Schule<br />
und Unterricht. Ein Pilotprojekt <strong>der</strong> Europäischen Union (Radnitzky u. a.). Befunde einer<br />
externen Evaluation - Bil<strong>der</strong> aus dem Arbeitsfeld einer Bezirksschulinspektorin (Zach).<br />
Kooperation - Erkundungen zur Beziehung von Selbst- und Fremdevaluation zwischen<br />
Schule und Schulaufsicht (Almer u. a.). Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Schulen<br />
auf dem Weg zur "Lernenden Organisation" (Grabher). Evaluationswerkzeuge funktional<br />
einsetzen (Strittmatter). EVIST - Evaluation und IST-Analyse (Engleitner u. a.).<br />
Fotografie als Instrument <strong>der</strong> Evaluation bzw. Reflexion (Rottensteiner). Analyse eines<br />
lerntypengerechten Methodensets in Zusammenarbeit mit den betroffenen SchülerInnen<br />
(Winter). (Fis Bildung nach LSW).<br />
� (43)<br />
AUTHOR<br />
Risse, Erika<br />
TITLE<br />
Ein Schulprogramm für den "Kunden Schüler".<br />
SOURCE<br />
In: Pädagogische Führung, 6 (1995) 2, S. 69-71<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1995<br />
33
DESCRIPTORS<br />
Erziehung; Jugend; Lehrer; Nachhilfeunterricht; Schueler; Schule; Schulentwicklung;<br />
Schulprogramm, Sozialer Wandel; Veraen<strong>der</strong>ung; Wertewandel; Individuum;<br />
Gesellschaft; Paedagogische Autonomie<br />
ABSTRACT<br />
Ausgehend von <strong>der</strong> Tatsache, dass sich das Verhalten <strong>der</strong> Jugendlichen än<strong>der</strong>t, zeigt die<br />
Autorin Qualitätsmerkmale dieser Verän<strong>der</strong>ung in <strong>der</strong> heutigen Gesellschaft auf. Daraus<br />
leitet sie die Frage ab und beantwortet diese, wie sich die Schule zu verän<strong>der</strong>n habe, um<br />
heutigen Anfor<strong>der</strong>ungen von Schülern und <strong>der</strong> Gesellschaft gerecht zu werden. Es sind<br />
also nicht die Schüler an die bereits existierende Schule "anzupassen", son<strong>der</strong>n die<br />
Schule muss sich verän<strong>der</strong>n. Hier einige <strong>der</strong> aufgeführten Richtungen <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ung<br />
von Schule: - Schule muss diffuses Wissen strukturieren helfen, - Soziale Kompetenzen<br />
sollen entwickelt werden, - Schule muss Kreativität durch eigenes Handeln freisetzen, -<br />
Offene Lernformen müssen antizipatorisches Lernen ermöglichen, - Schule muss Entscheidungskompetenz<br />
entwickeln. Um das realisieren zu können, benötigt die Einzelschule<br />
ein eigenes "Schulprogramm", eine Marschroute für ihr pädagogisches Handeln.<br />
(Fis Bildung nach DIPF/Mar.)<br />
� (44)<br />
AUTHOR<br />
Risse, Erika<br />
TITLE<br />
Schule zwischen ihrem gesellschaftlichen Auftrag und <strong>der</strong> individuellen Erwartung.<br />
SOURCE<br />
Aus: Lernen in einer offenen Gesellschaft. Frankfurt, Main (DGBV)<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1995<br />
DESCRIPTORS<br />
Autonomie; Erziehungsziel; Gesellschaft; Schulentwicklung; Kind; Mitbestimmung; Schueler;<br />
ABSTRACT<br />
Ich will darüber sprechen, mit welchen gesellschaftlichen Entwicklungen sich die Schule<br />
heute konfrontiert sieht, welche Rolle die Gesellschaft <strong>der</strong> Schule <strong>zum</strong>isst und wie diese<br />
mit den gesellschaftlichen Erwartungen umgeht, ob die Selbstgestaltung von Schule ein<br />
adäquates Lösungsmodell für eine notwendige Weiterentwicklung von Schule sein<br />
kann." Die Autorin macht deutlich, dass "eine Schule, die sich als Serviceeinrichtung<br />
versteht", für sie die Schule <strong>der</strong> Zukunft ist: "Diese Schule praktiziert Mitbestimmung,<br />
sie stellt im Diskurs mit allen Beteiligten <strong>der</strong> Schulgemeinde ein eigenes Schulprogramm<br />
auf, das verbindlich für den gesamten fachlichen und überfachlichen Lernprozess gilt und<br />
auf dessen Einhaltung geachtet wird." (Fis Bildung nach DIPF/Text übernommen/Bi)<br />
34
� (45)<br />
AUTHOR<br />
Risse, Erika<br />
TITLE<br />
Schulprogramm und Schulprofil: Selbstverständlichkeit, Aufgabe und Herausfor<strong>der</strong>ung.<br />
SOURCE<br />
In: Pädagogische Führung, 8 (1997) 3, S. 116-120<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1997<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulprofil; Definition; Schueler; Eltern; Evaluation; Verantwortung; Schulleben; Schulprogramm;<br />
Schulkultur; Lernkultur; Deutschland<br />
ABSTRACT<br />
Im Zusammenhang mit <strong>der</strong> Erläuterung, was ein Schulprogramm ist und wie sein Entstehungsprozess<br />
verläuft, wird gezeigt, welchen Einfluss das Umfeld auf das<br />
Schulprogramm hat, dass Schüler und Eltern zu beteiligen sind und dass zu einem Schulprogramm<br />
auch immer eine bestimmte Lernkultur gehört. Mit <strong>der</strong> Frage nach <strong>der</strong><br />
Wirkung von Schulprogrammen wird das Problem <strong>der</strong> schulinternen Evaluation aufgeworfen<br />
und hervorgehoben, dass für Lehrer und Schule mehr Freiheiten entstehen, aber<br />
auch mehr Verantwortung gefor<strong>der</strong>t ist. (Fis Bildung nach DIPF/Mar.)<br />
� (46)<br />
AUTHOR<br />
Rolff, Hans-Guenter; Haase, Sigrid; Pardon, Hermann; Bauer, Karl-Oswald; Bussigel,<br />
Margaret; Tillmann, Klaus-Juergen<br />
TITLE<br />
Theorien von Verlaufsbedingungen geplanten Wandels – Innovationsverlaeufe<br />
CS: Deutsche Forschungsgemeinschaft<br />
PUBLICATION YEAR<br />
m .J.<br />
DESCRIPTORS<br />
Bundesrepublik Deutschland; Innovation ; Planung ; sozialer Wandel ; Implementation;<br />
Schulentwicklung; organisatorischer Wandel; Bildungsreform; Modellentwicklung;<br />
Orientierungsstufe; Gesamtschule; Hessen<br />
ABSTRACT<br />
In Ergänzung <strong>der</strong> Forschungen in den bereits gefoer<strong>der</strong>ten Schwerpunktprogrammen<br />
sollen die Arbeiten des vorliegenden Projektes dazu dienen, die Variablen zu<br />
identifizieren, die Einfluss auf die Entwicklung von Innovationen im pädagogischen<br />
Bereich nehmen. Im Projekt sollen komplexe Innovationsablaeufe in und von Schulen<br />
unter beson<strong>der</strong>er Beruecksichtigung des Planungsaspektes möglichst detailliert und differenziert<br />
untersucht werden, um genau empirische Deskriptionen von<br />
Innovationsablaeufen zu erhalten und einige Schluesselbegriffe zu konzeptualisieren, d.h.<br />
präzis und systematisch zu definieren und auch operational zu bestimmen. Vor diesem<br />
Hintergrund sollen die wichtigsten vorliegenden Modelle von Innovationsverläufen an<br />
diesen Faellen auf ihre Triftigkeit und Modifizierungsnotwendigkeit hin durchgeführt<br />
35
werden. Ein heuristisches Modell soll gewonnen werden, das die untersuchten Fälle zu<br />
erklären vermag und auch einige Prognosen zulässt. Ausserdem sollen Bedingungen für<br />
eine Generalisierung dieses Modells bestimmt werden. Die Untersuchungsergebnisse<br />
sollen Vorarbeiten zur Entwicklung einer Theorie geplanten sozialen Wandels in und von<br />
Bildungssystemen leisten. Der vorliegende Zwischenbericht konnte noch nicht alle rückgelaufenen<br />
Frageboegen berücksichtigen, ausserdem müssen noch Rekodierungen vorgenommen<br />
werden. (Foris/MW)<br />
� (47)<br />
AUTHOR<br />
Rolff, Hans-Günter<br />
HG: Adick, Christel (Mitarb.)<br />
TITLE<br />
Zukunftsfel<strong>der</strong> von Schulforschung.<br />
SOURCE<br />
Weinheim (Deutscher Studien-Verlag), 394 S.<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1995<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulforschung; Bildungsoekonomie; Schulverfassung; Schulautonomie;<br />
Unterrichtsforschung; Schulentwicklung; Bildungsbeteiligung; Chancengleichheit;<br />
Frauenforschung; Maedchenbildung; Frauenbildung; Sozialisationsforschung; Soziales<br />
Lernen; Son<strong>der</strong>paedagogik; Integrative Behin<strong>der</strong>tenpaedagogik; Lehrerrolle;<br />
Lehrplanentwicklung; Curriculumforschung; Informationstechnische Bildung; Computer;<br />
Medieneinsatz; Schulqualitaet. (Fis Bildung nach DIPF)<br />
ohne ABSTRACT<br />
� (48)<br />
AUTHOR<br />
Schmidt, Gerhard<br />
TITLE<br />
Sicherung paedagogischen Handelns durch Schulentwicklung.<br />
SOURCE<br />
In: Die Bayerische Realschule, 42 (1997) 11, S. 17-23<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1997<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulentwicklung; Schulpaedagogik; Management; Lehrerkollegium; Kooperation;<br />
Evaluation; Unterricht; Corporate Identity<br />
ABSTRACT<br />
36
"Hier soll ein Ansatz erläutert werden, <strong>der</strong> an immer mehr Schulen Resonanz findet, um<br />
<strong>der</strong> sich ausbreitenden Frustration, dem vorzeitigen Kräfteverschleiss und <strong>der</strong><br />
Larmoyanz bei vielen Kollegen entgegenzuwirken. Es ist <strong>der</strong> Versuch, durch systemische<br />
Reflexion Kräfte an <strong>der</strong> Schule zu bündeln, mit dem Ziel, eine neue, höhere Qualität von<br />
Unterricht(sleistungen), Schulklima, Zufriedenheit am Arbeitsplatz zu erzielen." (fis<br />
Bildung/Orig.).<br />
� (49)<br />
AUTHOR<br />
Schoenwael<strong>der</strong>, Hans-Georg<br />
TITLE<br />
Schulklima und Schulqualitaet.<br />
SOURCE<br />
In: Zeitschrift für Bildungsverwaltung, 9 (1994) 3, S. 20-34<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1994<br />
DESCRIPTORS<br />
Schule; Qualitaet; Schulklima; Effizienz; Lernbedingungen; Lernprozess; Unterricht;<br />
Schulqualitaet; Schulmilieu (Fis Bildung)<br />
ohne ABSTRACT<br />
� (50)<br />
AUTHOR<br />
Schwaner-Heitmann, Barbara<br />
TITLE<br />
Schulreform konkret. Auf dem Weg zu einer gesunden Schule<br />
SOURCE<br />
Baltmannsweiler (Schnei<strong>der</strong>-Verlag Hohengehren)<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1995<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulentwicklung, Gesundheitsför<strong>der</strong>ung, WHO, health-promoting school, Bewegung,<br />
Spielen<br />
ABSTRACT<br />
Amerikanische und englische Untersuchungen über Merkmale <strong>der</strong> guten Schule haben<br />
gezeigt, dass das allgemeine soziale Klima, das Ethos <strong>der</strong> sozialen Organisation von entscheiden<strong>der</strong><br />
Bedeutung ist. Anknüpfend an diese Befunde und den von <strong>der</strong> WHO mit<br />
entwickelten Begriff <strong>der</strong> ‚health promoting school‘ geht die Autorin <strong>der</strong> Frage nach, wie<br />
sich Schulkultur durch gesundheitsför<strong>der</strong>nde Maßnahmen herausbildet. Nach einer<br />
knappen Skizzierung des gegenwärtigen Forschungsstandes wissenschaftlicher und<br />
praktischer Modelle <strong>der</strong> Gesundheitsför<strong>der</strong>ung stellt die Autorin die von ihr durchge-<br />
37
führte ethnographisch orientierte (u. a. teilnehmende Beobachtung und unterschiedliche<br />
Formen von Interviews, Beschreibung <strong>der</strong> aktuellen Wirklichkeit) Fallstudie vor, die <strong>zum</strong><br />
Ziel hatte herauszuarbeiten, „wie die ausgewählte Schule Bewegung in<br />
gesundheitsför<strong>der</strong>n<strong>der</strong> Absicht organisiert“. Als theoretischer Hintergrund wird <strong>der</strong> Zusammenhang<br />
von Bewegung und Gesundheit als Erkenntnisgrundlage für ausgewählte<br />
Aspekte <strong>der</strong> Schulentwicklung dargelegt. Nach <strong>der</strong> Analyse und Interpretation <strong>der</strong> Beobachtung<br />
schließt <strong>der</strong> Band mit <strong>der</strong> Beschreibung diverser, in den Zusammenhang von<br />
Bewegungsför<strong>der</strong>ung und Organisationsentwicklung eingebetteter Projekte. (CP)<br />
� (51)<br />
AUTHOR<br />
Spanhel, Dieter<br />
TITLE<br />
Die Bedeutung des Schul- und Klassenklimas fuer Erziehung und Unterricht.<br />
SOURCE<br />
In: Pädagogische Welt, 47 (1993) 5, S. 224-234, 237<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1993<br />
DESCRIPTORS<br />
Sachinformation; Empirische Untersuchung; Paedagogik; Schulpaedagogik; Erziehung;<br />
Schulleben; Schulklima; Schulsystem; Schulgemeinde; Schueler-Lehrer-Beziehung;<br />
Schulmilieu; Schulerfolg; Unterricht; Unterrichtsanalyse; Unterrichtserfolg;<br />
Unterrichtsmethode; Unterrichtsorganisation; Lernatmosphaere<br />
ABSTRACT<br />
Bedenkt man, dass Kin<strong>der</strong> ueber viele Jahre hinweg zur Schule gehen, Lehrer teilweise<br />
ihre gesamte Dienstzeit an einer Schule verbringen, so ist die Bedeutung des Schulklimas<br />
offensichtlich. Mit dem Terminus Schulklima soll hierbei eine einheitliche<br />
paedagogische Grundkonzeption angesprochen werden, die alle Bereiche umfasst. Untersuchen<br />
und Verstehen laesst sich die Bedeutung des Schul- bzw. Klassenklimas nur im<br />
Rahmen einer Oekologie <strong>der</strong> Schule, d. h. im Rahmen soziooekologischer Systeme. Unterscheiden<br />
lassen sich dabei 3 Kontextebenen mit entsprechenden Regelkreisen: die<br />
unterste Ebene <strong>der</strong> Lehrinhalte und Lernsituationen, die mittlere Ebene des Unterrichts<br />
und die oberste Ebene <strong>der</strong> Schule. Entscheidend ist, dass die Analyse und Beschreibung<br />
<strong>der</strong> klimatischen Bedingungen von Schule und Unterricht in Form von Regelkreisen dem<br />
Lehrer, <strong>der</strong> stets in mehrere involviert ist, jeweils Moeglichkeiten, Ansatzpunkte und<br />
Zeitpunkte bietet, positive Veraen<strong>der</strong>ungen in Gang zu setzen o<strong>der</strong> negative zu<br />
verhin<strong>der</strong>n. (Fis Bildung/Hessisches Institut für Pädagogische Foschung).<br />
38
� (52)<br />
AUTHOR<br />
Steffens, Ulrich<br />
TITLE<br />
Schulqualität und Schulkultur. Bilanz und Perspektiven <strong>der</strong> Verbesserung von Schule.<br />
SOURCE<br />
Aus: Entwicklung von Schulkultur. Neuwied (Luchterhand), S. 37-50<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1995<br />
DESCRIPTORS<br />
Schule; Qualitaet; Schulklima; Schulentwicklung; Schulreform; Innovation; Lehrer; Kooperation;<br />
Autonomie; Schulkultur<br />
ABSTRACT<br />
Der Autor gibt in seiner Meta-Analyse von Innovationsstudien einen Überblick über<br />
innerschulische Struktur- und Prozessmerkmale effektiver Schulen. Für die Entfaltung<br />
<strong>der</strong> Schulkultur bzw. eines för<strong>der</strong>lichen Schulklimas formuliert er Konsequenzen für die<br />
Schulentwicklung, etwa Grenzen externer Steuerbarkeit, innerschulische Freiräume und<br />
zu entwickelndes Gestaltungsbewusstsein <strong>der</strong> Lehrerschaft. Daran anknöpfend zeigt er<br />
Strategien zur Erreichung höherer Schulqualität auf, etwa intensivere Lehrerkooperation<br />
und Arbeit am Schulkonzept. Handlungsbedarf zur För<strong>der</strong>ung dieser Entwicklung sieht<br />
<strong>der</strong> Autor in einer erweiterten Autonomie <strong>der</strong> Einzelschule, Fortbildung, Schulberatung<br />
und -begleitung. (Fis Bildung nach DIPF/Text übernommen).<br />
� (53)<br />
AUTHOR<br />
Struck, Peter<br />
TITLE<br />
Schulreport. Zwischen Rotstift und Reform o<strong>der</strong> brauchen wir eine an<strong>der</strong>e Schule?<br />
SOURCE<br />
Reinbek bei Hamburg (Rowohlt Taschenbuch Verlag)<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1995<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulsystem; Notenwesen, Abschlußwesen; Lehrerrolle; Lehrerausbildung; Burn-out-<br />
Syndrom; Schulreform; Schulqualität; Schulentwicklung; Profilbildung;<br />
Projektunterricht; co-teaching, team-teaching<br />
ABSTRACT<br />
Der Autor diagnostiziert die Schule als eine unzeitgemäße Institution, die we<strong>der</strong> ihrem<br />
Erziehungsauftrag noch ihrem Auftrag <strong>der</strong> Wissensvermittlung gerecht wird. Er kritisiert<br />
sowohl das dreigliedrige Schulsystem als auch das Noten- und Abschlusswesen als einen<br />
Selektionsmechanismus, <strong>der</strong> stigmatisiert statt Fähigkeiten zu för<strong>der</strong>n. Ursachen für das<br />
Versagen <strong>der</strong> <strong>der</strong>zeitigen Schule sieht er u.a. in einer erstarrten Praxis, in einem<br />
fragwürdigen Fächerkanon, in einer schlechten, zu wenig auf pädagogische und psychologische<br />
Kompetenz ausgerichtete Lehrerausbildung, einer unangemessenen Lehrerarbeitsplatzbeschreibung,<br />
unengagierten Lehrern, Sparmaßnahmen und schlechter<br />
39
Organisation in den Schulen. Problematisch erscheint auch, daß die meisten Lehrer auf<br />
eine verän<strong>der</strong>te, z. T schwierigere Schülerschaft mit klassischen schulischen<br />
Instrumenten reagieren und selten eigene Verän<strong>der</strong>ungsbereitsschaft zeigen. Dies führt<br />
zu Berufsstress und Burn-out-Syndromen. Nur wenige beschreiten den Weg, einen Teil<br />
ihres Engagements vom Unterricht weg in außerschulische erzieherische Bemühungen zu<br />
verlagern, was – wenn es getan wird – zu mehr Berufszufriedenheit führt. Zur Gewaltproblematik<br />
an den Schulen wird gesagt, dass – trotz des allgegenwärtigen <strong>Thema</strong>s <strong>der</strong><br />
Schülergewalt - die Zahl <strong>der</strong> gewaltlosen jungen Menschen in den letzten 35 Jahren abgenommen<br />
habe und dass vor allem in Gymnasien in psychischen Belastungssituationen<br />
mit Autoaggression und den entsprechenden psychosomatischen Erkrankungen reagiert<br />
werde. Den Eindruck <strong>der</strong> Öffentlichkeit, es herrsche massive Gewalt an den Schulen,<br />
führt er auf einen verän<strong>der</strong>ten Maßstab bei <strong>der</strong> Wahrnehmung von Gewalt zurück. Im<br />
Abschlusskapitel nennt <strong>der</strong> Autor einige Voraussetzungen für eine Reform des<br />
Schulwesens und Merkmale einer zeitgemäßen Schule: Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Lehrerrolle im<br />
Sinne <strong>der</strong> Wahrnehmung des Erziehungsauftrages und damit einhergehend eine<br />
Ausbildung, die dazu befähigt, offener Unterricht, fächerübergreifen<strong>der</strong><br />
Projektunterricht, Co-teaching und Team-Kleingruppen-Modell (mehrere Lehrer führen<br />
gemeinsam wenige Parallelklassen durch die Schulstufe), feste Klassenräume und einen<br />
konstanten Lehrerverband für eine Klasse, kleinere Klassenfrequenzen, Profilbildung <strong>der</strong><br />
einzelnen Schulen. (CP)<br />
� (54)<br />
AUTHOR<br />
Struck, Peter<br />
TITLE<br />
Die Schule <strong>der</strong> Zukunft. Von <strong>der</strong> Belehrungswerkstatt zur Lernwerkstatt<br />
SOURCE<br />
Darstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft)<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1996<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulreform, Schulentwicklung, Lehrer-Schüler-Beziehung, Lehrerausbildung, Schulformen,<br />
Unterrichtskonzepte, Neue Medien<br />
ABSTRACT<br />
Der Autor nimmt alle Funktionsbereich <strong>der</strong> Schule in den Blick. Er geht auf die Lehrer-<br />
Schüler-Beziehung ein, <strong>der</strong> er eine größere Bedeutung beimisst als <strong>der</strong> Wissensvermittlung,<br />
er hinterfragt die <strong>der</strong>zeitige Rekrutierungspraxis <strong>der</strong> Schulleitung, und wendet sich<br />
dann den Schulformen zu, die er für ‚ hoffnungslos‘ überholt hält. An den Gymnasien,<br />
die er als ‚Belehrungsschule‘ definiert, herrscht nach Meinung des Autors die größte<br />
Schulnot (u. a. unzeitgemäße Lernformen, wenig motivierte Leher, keine<br />
Bezugspersonen, Mangel an Atmosphäre). Er plädiert für eine Bündelung von Haupt-,<br />
Real- und Gesamtschulen zu Sekundaschulen, für eine neue Lehrerbildung, für offene<br />
Unterrichtskonzepte und Projektmethoden, für CD-Rom und Online-Lernen sowie für<br />
neue Formen des Schulmanagments. (CP/teilweise Umschlagtext)<br />
40
� (55)<br />
AUTHOR<br />
Terhart, Ewald<br />
TITLE<br />
Schulkultur. Hintergruende, Formen und Implikationen eines schulpaedagogischen<br />
Trends<br />
SOURCE<br />
In: Zeitschrift für Pädagogik, 40 (1994) 5, S. 685-699<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1994<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulpaedagogik; Schule; Kultur; Erziehungswissenschaft; Bildungsreform;<br />
Schulsystem; Schulklima; Lehrerrolle; Unterricht<br />
ABSTRACT<br />
Im Beitrag wird zunaechst festgestellt, dass nicht Erziehungs- und<br />
Bildungswissenschaften Impulsgeber fuer die neue Bildungsdiskussion in allen<br />
Bildungsbereichen mit zunehmenden Krisenbewusstsein sind, son<strong>der</strong>n die oeffentlichen<br />
Medien. Dabei stehen auch die paedagogischen Berufe von Vorschulerzieherinnen bis zu<br />
den Hochschullehrern in <strong>der</strong> Kritik. Die gegenwaertige Bildungsdiskussion befindet sich<br />
im Stadium <strong>der</strong> Krisendiagnostik, es fehlt eine einheitliche, konsensfaehige Linie<br />
hinsichtlich <strong>der</strong> Formulierung von Schlussfolgerungen. Es geht vor allem um Begriffe<br />
wie Pluralisierung und Flexibilisierung des Schulsystems, Einfuehrung des<br />
Marktprinzips und Staerkung <strong>der</strong> Konsumentenautonomie (als Konsumenten werden<br />
Schueler und Lehrer verstanden), um Kostenbewusstsein und Effizienzsteigerung, um ein<br />
hoeheres Mass an Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht <strong>der</strong> Lehrer, um Staerkung<br />
<strong>der</strong> Schulkultur insgesamt. (Fis Bildung nach DIPF/Sch.).<br />
� (56)<br />
AUTHOR<br />
Timmermann, Dieter<br />
TITLE<br />
Qualitätsmanagement an Schulen.<br />
SOURCE<br />
Wirtschaft und Erziehung, 48 (1996) 10, S. 327-333<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1996<br />
41
DESCRIPTORS<br />
Schule; Schulentwicklung; Qualitaet; Definition; Modell; Schulleistung; Schulerfolg;<br />
Lernerfolg; Berufsschule; Evaluation; Management; Steuerung; Bewusstsein; Verhalten;<br />
Handlungskompetenz; Bildung; Dienstleistung; Zertifikat; Bildungsindikator;<br />
Deutschland; Schuelerleistung<br />
ABSTRACT<br />
Ausgehend von Schulentwicklungs- und Qualitätsdiskussionen und gewachsenem<br />
Qualitätsbewußtsein wird begründet, warum Qualitätsmanagement an Schulen schwierig<br />
umzusetzen ist und daß dazu eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein müssen, damit die<br />
Qualität schulischer Leistungen gesteuert werden kann. Zwei Bedingungskomplexe<br />
werden genauer betrachtet: erstens die Frage, was Qualität ist bzw. sein soll - wie sie<br />
operationalisiert und gemessen werden kann und zweitens, ob und wie Qualität von<br />
Schule von wem gesteuert werden kann. Der Beitrag ist wie folgt geglie<strong>der</strong>t: 1. Die<br />
Qualitätsbewegung im Wirtschafts- und im Bildungssystem (Einleitung), 2. Qualitätsbegriff<br />
und Qualitätskonzept - u. a. zur Definition von Qualität - Konzept am Beispiel<br />
beruflicher Schulen illustriert - Operationalisierung <strong>der</strong> Qualität von Leistungen (u. a. zu<br />
Problemen <strong>der</strong> Notenbemessung bei Schülern, <strong>der</strong> verschiedenen Bewertung durch unterschiedliche<br />
Gruppen, <strong>der</strong> Vermischung <strong>der</strong> Qualitätsfrage mit <strong>der</strong> Erfolgs- und<br />
Evaluationsfrage). 3. Qualitätsmodelle - Input-Output-Modell – Bildungsproduktionsmodell<br />
(graf. Darstellung) und ihre Bewertung. 4. Qualitätsmanagement an<br />
Schulen (Hat bisher kaum stattgefunden; oft wird gegen eine ganzheitliche<br />
Qualittsbetrachtung /Total Quality Managements/ verstoßen.) Es werden Möglichkeiten<br />
und Grenzen des Qualitätsmanagement an Schulen aufgezeigt; drei Stellen für<br />
Gestaltungs- und Steuerungsmöglichkeiten werden explizit bezeichnet. Abschließend ist<br />
auf vorhandene Erkenntnisgrenzen in <strong>der</strong> Erziehungswissenschaft hingewiesen worden,<br />
insbes. im systematischen Zugang zu diesem Problem. (Fis Bildung nach DIPF/Ko.).<br />
� (57)<br />
AUTHOR<br />
Verband Bildung und Erziehung<br />
TITLE<br />
Deutscher Lehrertag. 1991. Schule und Stress. Bildung zwischen Leistungsdruck u.<br />
Muessiggang - Wie kann die Bildungspolitik das Schulklima verbessern? Veranstaltung<br />
d. Verbandes Bildung und Erziehung am 12. September 1991<br />
SOURCE<br />
Bonn (VBE), 100 S.<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1992<br />
DESCRIPTORS<br />
Konferenzschrift; Belastung ; Schule; Schulklima; Lehrer; Schueler;<br />
Ueberfor<strong>der</strong>ung (Fis Bildung)<br />
ohne ABSTRACT<br />
42
� (58)<br />
AUTHOR<br />
Wehr, Helmut<br />
TITLE<br />
Perspektiven schulischer Bildung heute für Erwachsene von morgen?<br />
SOURCE<br />
Lehren und lernen, 24 (1998) 7, S. 5-18<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1998<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulbildung; Didaktisches Material; Schulpaedagogik; Didaktische Eroerterung; Erziehungsziel; Sozialer<br />
Wandel; Jugendlicher; Individualisierung; Schluesselqualifikation; Qualifikation; Offene Schule; Bildung;<br />
Paedagogik; Konzeption; Zukunft; Muendigkeit; Schulklima; Schulkultur; Eltern; Lehrer; Beruf;<br />
Zufriedenheit; Qualitaet<br />
ABSTRACT<br />
Reflektiert werden die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen Jugendliche<br />
heranwachsen, sowie die Merkmale von mo<strong>der</strong>nen Bildungskonzepten bzw. "guten<br />
Schulen", die diese Bedingungen berücksichtigen. Dabei werden angesprochen u. v. a.:<br />
Öffnung von Schule, Erziehungsziel Mündigkeit, Schlüsselqualifikationen,<br />
Gesprächsregeln, Lern-Methoden, Schulklima, Schulkultur durch pädagogischen<br />
Konsens des Kollegiums, das Menschenbild <strong>der</strong> humanistischen Psychologie.<br />
Zusammenfassend wird über die wünschenswerte Schule <strong>der</strong> Zukunft gesagt: "Schule<br />
besinnt sich auf ihre sozioemotionalen und intellektuellen Stärken, konkurriert nicht mit<br />
Multimedia, (Bildungs-)Warenhaus und öffnet die 'beschützenden" Mauern in Richtung<br />
Umwelt und Lebenswelt. Sie verweigert sich aber <strong>der</strong> Instrumentalisierung durch<br />
einzelne gesellschaftliche Gruppen und tritt ein für die Rechte des einzelnen Schülers,<br />
<strong>der</strong> einzelnen Schülerin und ihres Lern-, Wissens- und Entwicklungsdranges in einem<br />
ganzheitlichen Lernzusammenhang: kognitive, emotionale und psychomotorische<br />
Weiterentwicklung ermöglichend in <strong>der</strong> Balance von Aktion und Muße. Projekte, Freiarbeit<br />
und lebensnahe Erlebnisse stärken die demokratische Eigentätigkeit und Mündigkeit.<br />
Konflikte sind eingebunden in Kommunikationsstrukturen, die Verantwortung,<br />
Vielfalt und Visionen ermöglichen." (Fis Bildung/HeLP/We).<br />
� (59)<br />
AUTHOR<br />
Zech, Rainer<br />
TITLE<br />
Wege, Umwege, Irrwege. Innere Schulentwicklung aus externer Sicht.<br />
SOURCE<br />
In: Pädagogik, 50 (1998) 2, S. 28-31<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1998<br />
43
DESCRIPTORS<br />
Schulprogramm; Schulentwicklung; Lehrerkollegium; Schulklima; Schulleitung;<br />
Schulinterne Lehrerfortbildung; Ro<strong>der</strong>bruch; Nie<strong>der</strong>sachsen<br />
ABSTRACT<br />
Der Weg <strong>zum</strong> Schulprogramm legt Uneindeutigkeiten und Blockaden offen. Der Weg zu<br />
eindeutigen Handlungskonsequenzen aber bleibt ein langer Weg. (Fis Bildung nach<br />
DIPF/Orig.)<br />
� (60)<br />
AUTHOR<br />
Ziesse, Jörg-Detlef<br />
TITLE<br />
Zukunftsvorstellungen verbessern das Schulklima.<br />
SOURCE<br />
In: Pädagogische Führung, 7 (1996) 4, S. 191-196<br />
Schulklima; Zukunftsorientierung; Motivation; Organisation
operationalisierbaren. Lernzielen werden Humor und Freude sowie die Wertschätzung<br />
des Schülers und die Liebe <strong>zum</strong> Menschen als Grundbedingung erzieherischen Handelns<br />
definiert. „Freude ist ... eine Grundhaltung des Erziehers, ein Fundament seiner<br />
Persönlichkeit und zugleich Grundlage für Erziehen und Unterrichten“. Eine wichtige<br />
Quelle <strong>der</strong> Freude im Schulleben sei die Lehrerpersönlichkeit als Mensch, „<strong>der</strong> sich <strong>zum</strong><br />
Erzieher berufen fühlt“, <strong>der</strong> für eine gute erzieherische Atmosphäre verantwortlich sei<br />
und für einen pädagogisch geformten Schulalltag sorge. Als weitere Prinzpien für ein<br />
freudvolles Schulleben werden genannt: Aktivitäten aller Beteiligten, Kindgemäßheit,<br />
pädagogischer Freiraum, Eingehen auf Schülerinteressen. (CP)<br />
45
1. 2 Empirisch orientierte Beiträge<br />
� (62)<br />
AUTHOR<br />
Bessoth, Richard<br />
TITLE<br />
Schulaufsicht als Klimafaktor. Die Sichtweise von PädF-Leserinnen und -Lesern.<br />
SOURCE<br />
In: Pädagogische Führung, 7 (1996) 4, S. 184-186<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1996<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulaufsicht; Qualitaet; Autonomie; Schule; Schulklima; Befragung; Deutschland<br />
ABSTRACT<br />
In Heft 3/95 hatte <strong>der</strong> Autor einen Fragebogen abdrucken lassen <strong>zum</strong> <strong>Thema</strong>: Verfügen<br />
bundesdeutsche Schulaufsichtsbeamte über Qualifikationen, die zur Übernahme einer<br />
dynamischen Rolle im kommenden Jahrzehnt notwendig sind? Hier werden die Ergebnisse<br />
<strong>der</strong> Befragung präsentiert, die auch durch an<strong>der</strong>e Studien, z. B. in Bayern belegt,<br />
zeigen, dass einzelne Schulaufsichtsbeamte durch ihr persönliches Auftreten anerkannt<br />
und innovativ sind. Die Schulaufsicht als System erscheint aber nicht als reformfreudig<br />
und verän<strong>der</strong>ungsfähig. "Nur wenn man die Schulaufsicht in ein mo<strong>der</strong>nes, dynamisches<br />
Management transformieren und die bürokratischen Elemente auf ein Minimum<br />
reduzieren würde, bestände die Hoffnung auf eine grundlegende Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong><br />
Situation." (Fis Bildung nach DIPF/Mar.).<br />
� (63)<br />
AUTHOR<br />
Böttcher, I.<br />
TITLE<br />
Außerunterrichtliche Angebote – Situation in Thüringen.<br />
SOURCE<br />
Aus: Möller, R.; Abel, J.; Neubauer, G.; Treumann, K.-P. (Hrsg.): Kindheit, Familie und Jugend.<br />
Münster/New York (Waxmann)<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1996<br />
DESCRIPTORS<br />
Befragung, Thüringen, Strukturwandel, Schulqualität, Unterricht, schulische Freizeitangebote, Eltern<br />
46
ABSTRACT<br />
Der Aufsatz stellt die Ergebnisse einer Befragung (im Rahmen <strong>der</strong> übergreifenden Untersuchung<br />
‚Schulstrukturwandel in Thüringen‘) <strong>zum</strong> Freizeitangebot an Thüringer Schulen dar. 2/3 <strong>der</strong> befragten<br />
Eltern und Schüler halten ein umfangreiches Freizeitangebot an den Schulen für sehr wichtig und 90% <strong>der</strong><br />
befragten Lehrer. Die Lehrer wollen damit Neigungen und Interessen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> und Jugendlichen<br />
wecken. Die Eltern präferieren Angebote mit <strong>der</strong> Rangfolge: Computerkurse, Sprachen, Mathematik,<br />
Naturwissenschaften, Umwelt, Sport, Theater, Gesang, Zeichnen. Nach den Erkenntnissen dieser Studie<br />
gibt es an den Thüringer Schulen vielfältige schulische Freizeitangebote (Schulfest, Schülerzeitung,<br />
Sportfest etc.) sowie Arbeitsgemeinschaften (mit Schwerpunkt im musikalischen, musischen und<br />
sprachlichen Bereich). Trotz des Wunsches nach schulischen Freizeitangeboten ist die Beteiligung an<br />
solchen Angeboten de facto eher niedrig. 10% <strong>der</strong> Schüler geben an, entsprechende Aktivitäten auszuüben,<br />
wobei <strong>der</strong> musikalische und <strong>der</strong> sportliche Bereich favorisiert wird. Die Autorin kommt zu dem Schluß,<br />
dass sich die Freizeitaktivitäten von Jugendlichen in <strong>der</strong> Tendenz aus <strong>der</strong> Schule heraus verlagert haben.<br />
(CP)<br />
� (64)<br />
AUTHOR<br />
Buhren, Claus, G. (Hrsg.) u.a.<br />
TITLE<br />
Fallstudien zur Schulentwicklung. Zum Verhältnis von innerer Schulentwicklung und<br />
externer Beratung<br />
SOURCE<br />
Weinheim und München (Juventa)<br />
PUBLISHING YEAR<br />
1996<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulentwicklung; Organisationsentwicklung; Berater; Schulerfolg; Schulleitung;<br />
Teamarbeit; Grundschule, Realschule; Gesamtschule; Schülermitverwaltung;<br />
Schulprofil; Lernmittel; Lernprozess; Autonomie; Hauptschule<br />
ABSTRACT<br />
Im Sammenband berichten Schulberater in Fallstudien aus ihrer Praxis. ‚Dreizehn unterschiedliche<br />
Schulberatungsfälle und Schulentwicklungsprozesse aus verschiedenen<br />
Schulformen werden beschrieben. Dabei wird beson<strong>der</strong>s auch die Binnenperspektive <strong>der</strong><br />
beteiligten Lehrer, Schüler und Eltern durch Interviews und schulinterne Dokumente in<br />
den Blick genommen. So unterschiedlich die einzelnen Fälle sein mögen, so basieren alle<br />
Fälle doch auf einem beraterorientierten Grundverständnis von<br />
Organisationsentwicklung. Die zentrale Absicht des Bandes liegt deshalb auch nicht in<br />
<strong>der</strong> Propagiereung eines spezifischen Konzepts von Organisationsentwicklung, son<strong>der</strong>n<br />
in <strong>der</strong> Bereitstellung von Material für eine Fortentwicklung des Verhältnisses von innerer<br />
Schulentwicklung und externer Beratung . (CD Bildung/DJI)<br />
47
� (65)<br />
AUTHOR<br />
Buhren, Claus G.; Sieber, Walter<br />
TITLE<br />
Schulentwicklung kann auch im Klassenraum beginnen. Ein Erfahrungsbericht.<br />
SOURCE<br />
In: Journal für Schulentwicklung, (1997) 1, S. 67-71<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1997<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulentwicklungsplanung; Klassenraumgestaltung; Schweiz (fis Bildung)<br />
ohne ABSTRACT<br />
� (66)<br />
AUTHOR<br />
Buhren, Claus G.<br />
TITLE<br />
Systematische Selbstreflexion. Ein Praxismodell zur Evaluation offenen Unterrichts.<br />
SOURCE<br />
In: Praxis Schule 5 - 10, 9 (1998) 3, S. 28-29<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1998<br />
DESCRIPTORS<br />
Nordrhein-Westfalen; Evaluation; Praxismodell, Offener Unterricht; Schulqualität;<br />
Qualitaetsentwicklung; Qualitaetssicherung; Selbstreflexion; Unterrichtsanalyse<br />
ABSTRACT<br />
Um die vor zwei Jahren eingeführten offenen Lernformen einer kritischen Bewertung zu<br />
unterziehen, hat eine Lehrergruppe des Albert-Einstein-Gymnasiums in Neumarkt ein<br />
Praxismodell zur Evaluation offener Lernformen in den Jahrgängen 07 und 08 in den<br />
Fächern Deutsch, Gesellschaftslehre und Mathematik entwickelt und erprobt. (Fis<br />
Bildung, teilw. Orig./Pl).<br />
� (67)<br />
AUTHOR<br />
Buhren, Claus G.; Killus, Dagmar; Möller, Sabine<br />
TITLE<br />
Wege und Methoden <strong>der</strong> Selbstevaluation. Ein praktischer Leitfaden für Schulen.<br />
SOURCE<br />
Dortmund: IFS (1998) 164 S.<br />
REIHE<br />
Beiträge zur Bildungsforschung und Schulentwicklung, 6<br />
48
PUBLICATION YEAR<br />
1998<br />
DESCRIPTORS<br />
Sachinformation; Paedagogik; Schulentwicklung; Grafische Darstellung; Evaluation;<br />
Interne Evaluation; Methode; Qualitaet; Qualitaetssicherung; Bund-Laen<strong>der</strong>-<br />
Kommission fuer Bildungsplanung<br />
ABSTRACT<br />
Über Selbstevaluation im Schulbereich ist in den vergangenen Jahren viel diskutiert<br />
worden, ohne dass es in Schulen nennenswerte praktische Erfahrungen dazu gibt. Mit<br />
dem BLK-Modellversuch "Selbstevaluation als Instrument einer höheren Selbständigkeit<br />
von Schule" wird versucht, <strong>der</strong> theoretischen Diskussion um Selbstevaluation im Schulbereich<br />
mehr "Bodenhaftung" zu verleihen. Im Rahmen dieses Modellversuchs sammelt<br />
eine Reihe von Schulen Erfahrungen mit systematischen Formen von Selbstevalution.<br />
Wir haben diese Erfahrungen im vorliegenden Buch zusammengefasst und durch<br />
theoretische Hintergrundinformationen um viele praktische Hinweise <strong>zum</strong> <strong>Thema</strong> angereichert.<br />
Dieser Praxisleitfaden soll dazu beitragen, Lehrerinnen und Lehrern den<br />
Einstieg in Selbstevaluation zu erleichtern. (Fis Bildung/Verlag).<br />
� (68)<br />
AUTHOR<br />
Carron, Gabriel; Chau, Ta N.<br />
TITLE<br />
The quality of primary schools in different development contexts.<br />
SOURCE<br />
Paris: Unesco (1996) XIV, 306 S.<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1996<br />
DESCRIPTORS<br />
Schule; Effizienz; Schulqualitaet; Qualitaet; Primarschule; Internationaler Vergleich;<br />
Grun<strong>der</strong>ziehung; Eltern; Schueler; Lehrmittel; Schulleitung; Lehrerkollegium; Soziale<br />
Lage; Arbeitszufriedenheit; Grundschullehrer; Grundschulpaedagogik;<br />
Grundschulunterricht; Unterricht; Unterrichtsprozess; Schuelerleistung; Empirische<br />
Untersuchung; Vergleichsuntersuchung; China; Guinea; Indien; Mexiko<br />
ABSTRACT<br />
Report of four country studies launched by the IIEP Interregional Research Project on the<br />
"Improvement of Basic Education Services". "The central component of this project was<br />
the design and implementation of a limited number of national case-studies on teaching /<br />
learning conditions im primary schools, the interaction between supply and demand at<br />
the local level, and the results achieved by schools in terms of pupils' acquisition of basic<br />
skills". After a description of methods, objectives and implementation of the project the<br />
principal results of the case studies are compared "with a view to providing more general<br />
insights into the different ways in which schools function in varying local settings. The<br />
first chapter deals with problems relating to the interactions between the school, parents<br />
49
and pupils... The following four chapters analyze the characteristics of the supply of<br />
educational facilities, notably ... in chapter II the material conditions of teaching; in<br />
chapter III, teachers' problems, including their living conditions and job satisfaction; in<br />
chapter IV, how schools operate, through an analysis of the relations between the<br />
principal and the teaching staff, between the teachers and the central administration, and<br />
between teachers and the community, and finally, in chapter V, the teaching/learning<br />
processes, that is to say, the way teachers prepare and organize their classroom lessons.<br />
Chapter VI contains an analysis of the communication and numeracy skills acquired by<br />
pupils in the fourth grade and the final grade of primary schooling, and an analysis of the<br />
differences between areas and schools in this respect". (Fis Bildung nach DIPF/orig.).<br />
� (69)<br />
AUTHOR<br />
E<strong>der</strong>, Ferdinand<br />
TITLE<br />
Schul- und Klassenklima. Ausprägung, Determinanten und Wirkungen des Klimas an<br />
höheren Schulen.<br />
SOURCE<br />
Innsbruck u.a. (Studien-Verlag), 272 S.<br />
REIHE<br />
Studien zur Bildungsforschung und Bildungspolitik. 8<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1996<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulforschung; Schulklima; Schulklasse; Schueler; Schuelerin; Schulsystem;<br />
Empirische Forschung; Oesterreich (Fis Bildung)<br />
ohne ABSTRACT<br />
� (70)<br />
AUTHOR<br />
E<strong>der</strong>, Ferdinand<br />
TITLE<br />
Was das (Unterrichts-)Klima ausmacht.<br />
SOURCE<br />
In: Pädagogische Führung, 7 (1996) 4, S. 180-183<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1996<br />
DESCRIPTORS<br />
Schuelerleistung ; Schule; Qualitaet; Schulklima; Unterrichtsklima; Definition;<br />
Schulklasse; Lernen; Hoehere Schule; Empirische Untersuchung; Verhalten;<br />
Persoenlichkeitsentwicklung; Bedingung; Schulorganisation; Oesterreich<br />
50
ABSTRACT<br />
Der Beitrag informiert über eine in Österreich durchgeführte Untersuchung <strong>zum</strong> Klima<br />
an höheren Schulen. Im Vor<strong>der</strong>grund stehen dabei Möglichkeiten <strong>der</strong><br />
Klimabeschreibung, Fragen nach den Auswirkungen des Klimas auf Leistungen,<br />
Befinden, Verhalten und Persönlichkeitsentwicklung sowie nach den Einflussfaktoren,<br />
die das Klima in den Schulen und Klassen bestimmen. (Fis Bildung nach DIPF/Text<br />
übernommen).<br />
� (71)<br />
AUTHOR<br />
Egger, R.<br />
TITLE<br />
Freiräume in Unterricht – Unterschätzt und Überfor<strong>der</strong>t?<br />
SOURCE<br />
Innsbruck/Wien (Studien-Verlag)<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1996<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulqualität; Lernumgebung; Kreatives Lernen; Individuelles Lernen<br />
ABSTRACT<br />
Der Band betont die Notwendigkeit, an den Schulen verstärkt auf die Unterschiedlichkeit<br />
<strong>der</strong> einzelnen Lernschicksale eingehen zu müssen. Im Rahmen eines Projektes an 5<br />
Schulen werden die Möglichkeiten einer Gestaltung einer kreativen Lernumgebung ausgelotet.<br />
Dazu werden von Schülern geschriebene Tagebücher über den Schulalltag herangezogen.<br />
Sie zeigen, daß sich kreative Dimensionen schulischen Lernens für Schüler<br />
vorwiegend in einer ansprechbaren Beziehungsrealität gestalten, wobei die Formen <strong>der</strong><br />
Beziehungen auch Umfeldorganisationen wie das Klassenzimmer und das Schulhaus<br />
beinhalten. Der Autor plädiert für eine Entgrenzung schulischen Lernens und meint, dass<br />
Schule in einer gewandelten Welt ihr Monopol auf Realitätserkennung nicht mehr in <strong>der</strong><br />
gewohnten Wiese beibehalten kann. (CP)<br />
� (72)<br />
AUTHOR<br />
Ekholm, Mats; Kull, Magnus<br />
TITLE<br />
School climate and educational change: stability and change in nine Swedish schools.<br />
SOURCE<br />
In: EERA-Bulletin, 2 (1996) 2, S. 3-11<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1996<br />
51
DESCRIPTORS<br />
Bildungssystem; Schulsystem; Grundschule; Schulreform; Schueler-Lehrer-Verhaeltnis;<br />
Arbeitsbedingungen; Empirische Untersuchung; Bildungsforschung; Schulklima;<br />
Schweden; Hausaufgabe<br />
ABSTRACT<br />
In a longitudinal study, (the authors) examine changes in teachers' and students' accounts<br />
of life in school. Their study illustrates that despite some dramatic social changes over<br />
the past 25 years which have affected students' and teachers' lives outside school,<br />
patterns of classroom interaction and the way in which teachers and students spend their<br />
time in school have remained quite stable. National curriculum initiatives and substantial<br />
in-service training programmes aimed to develop more collaborative work, active<br />
learning, and preparation for life and work in mo<strong>der</strong>n society appear to have had little<br />
impact. The authors speculate that one of the main reasons for this inertia is that teachers'<br />
practices are tightly constrained by organisational factors, and that the promotion of<br />
educational change requires more long-term planning, organisational development and<br />
support from others beyond the school. (Fis Bildung nach DIPF/abstract taken from the<br />
original).<br />
� (73)<br />
AUTHOR<br />
Fend, Helmut<br />
TITLE<br />
Schulkultur und Schulqualität<br />
SOURCE<br />
In: Zeitschrift für Pädagogik: Die Institutionalisierung von Lehrern und Lernen. Beiträge zu einer Theorie<br />
<strong>der</strong> Schule. 34. Beiheft. Weinheim und Basel (Beltz Verlag), S. 85 - 99<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1996<br />
DESCRIPTORS<br />
Fallstudie; Gesamtschule; Schulform; Schulkultur; Schulreform; Schulgestaltung; Alternativschulen<br />
ABSTRACT<br />
Ausgehend von <strong>der</strong> Erkenntnis, dass Systemmerkmale des Bildungssystems nur eine<br />
begrenzte Bedeutung bei <strong>der</strong> Beför<strong>der</strong>ung wünschenswerter pädagogischer Verhältnisse<br />
haben, plädiert <strong>der</strong> Autor für neue Handlungsperspektiven. Es stelle sich die Frage, worin<br />
die Varianzen zwischen Schulen gleicher Schulform begründet liegen. Aufgrund <strong>der</strong><br />
Evaluation von 180 Schulen hat sich beim Autor die Überzeugung gefestigt, dass die<br />
Schulebene selbst eine wichtige Rolle spielt. Die konkrete Erfahrung in und mit<br />
einzelnen Schulen gewann an Bedeutung: „Schulbesuche, Fallstudien, Studienreisen<br />
begleiten diesen Prozess“. Die Suche nach Leitbil<strong>der</strong>n gelungener schulischer Umwelt<br />
zeigt, dass es an vielen Orten Anstrengungen gab (gibt), die einzelnen Schulen zu<br />
gestalten, sie innerhalb <strong>der</strong> staatlichen Rahmenbedingungen zu entwickeln. Beson<strong>der</strong>s<br />
Gesamtschulen haben Formen <strong>der</strong> täglichen Schulgestaltung entwickelt, die viel<br />
pädagogische Erfahrungen des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts aufgenommen haben, so u. a.: Teams<br />
von Lehrern, die einen Jahrgang von <strong>der</strong> 5. bis <strong>zum</strong> 10. Schuljahr begleiten; gemeinsame<br />
52
freie Zeit über den Unterricht hinaus; freie Begegnungsräume; Öffnung <strong>der</strong> Schulen um<br />
7.30, um Zeit für Kommunikation einzuräumen. (CP)<br />
� (74)<br />
AUTHOR<br />
Fend, Helmut<br />
TITLE<br />
Qualität im Bildungswesen. Schulforschung zu Systembedingungen, Schulprofilen und Lehrerleistung.<br />
SOURCE<br />
Weinheim und München (Juventa)<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1998<br />
DESCRIPTORS<br />
Bildungsforschung; Schüler; Lehrer; Schulqualität; empirische Erhebung; Schulklima; Schultyp;<br />
Schulprofil; Belastung, Zufriedenheit; Lehrer-Schüler-Verhältnis; Schulfreude<br />
ABSTRACT<br />
Der Autor untersucht Schulqualität auf Basis einer systematischen Erhebung von Unterschieden<br />
zwischen Schulen und Klassen. Um die Wahrnehmung aller Betroffenen zu<br />
berücksichtigen, verwendet die Studie einen ‚multi-source‘-Ansatz (befragt werden<br />
Lehrer Schüler und Eltern). Die Ergebnisse werden zusammen mit zentralen Aussagen<br />
einer älteren Untersuchung <strong>zum</strong> Schulklima dokumentiert. Befragt zu diversen Schulmerkmalen,<br />
die das Schulklima beeinflussen, zeigen sich bei den Lehrern teils<br />
signifikante Unterschiede je nach Schultyp. Die Gesamtschullehrer geben die deutlich<br />
höchste soziale und organisatorische Belastung an, bedingt durch Erscheinungen wie:<br />
schwierige und/o<strong>der</strong> aggressive Schüler, Zerstörung, Lärm, Schülerstreitigkeiten, Unterrichtsausfall<br />
etc. Die Gymnasiallehrer kommen zu einer sehr viel günstigeren<br />
Einschätzung hinsichtlich vorhandener Belastungsfaktoren, beispielsweise bejahen nur<br />
9,5% die Aussage: Schülerstreitigkeiten stören den Unterricht, während es bei den<br />
Gesamtschullehrern 40,9% sind. Als Teil <strong>der</strong> Rahmenbedingungen, die ein positives<br />
(bzw. negative) Schulklima konstituieren, werden in <strong>der</strong> Studie auch die Mitbestimmungsregelungen<br />
unter den Lehrern berücksichtigt. Die Urteile <strong>der</strong> Lehrer (minimale<br />
Unterschieden zwischen den Schultypen) deuten auf Möglichkeiten <strong>der</strong> Mitbestimmung<br />
hin (vor allem bei <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Stundenpläne), aber auch auf eine relativ<br />
ausgeprägte Reglementierung. Gut 60% bejahen die Aussage: bei allem Schulleitung<br />
fragen. Starke Reglementierung, so die weitere Analyse, führt zu einem schlechteren<br />
Schulklima und steht im Zusammenhang mit <strong>der</strong> Unzufriedenheit <strong>der</strong> Lehrer an einer<br />
Schule. Die Beurteilung <strong>der</strong> Schule seitens <strong>der</strong> Schüler zeigen Antworten zu den Fragedimensionen:<br />
Leistungsdruck, Funktionale Disziplin, Kontrolle, Mitbestimmung, Lehrerengagement,<br />
Persönliches Vertrauen. Hier dominieren Werte im mittleren Bereich.<br />
Hoher Leistungsdruck in einer Klasse, notenbezogenen Kontrolle und strenge Reglementierungen<br />
führen zu reduziertem Selbstbewußtsein <strong>der</strong> Schüler und zu einer<br />
Atmosphäre <strong>der</strong> Angst und latenter Kämpfe zwischen Schülern und Lehrern, während<br />
das Vorhandensein einer Beziehungs- und Gesprächskultur an <strong>der</strong> Schule in deutlichem<br />
Zusammenhang mit <strong>der</strong> Schulfreude bzw. Schulverdrossenheit steht. Abschließend<br />
werden Ergebnisse einer in NRW durchgeführten Erhebung <strong>der</strong> ‚Bedürfnisse des Lehrers<br />
heute‘ dokumentiert. Demnach sind in <strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> Lehrer die Anfor<strong>der</strong>ungen an ihren<br />
53
Beruf deutlich gestiegen, während sich die Lernvoraussetzungen im Leistungsbereich<br />
und im motivationalen Bereich deutlich verschlechtert haben. Den größeren<br />
Erschwernissen stünden geringere Bewältigungsmechanismen gegenüber, da die<br />
Autorität des Lehrers zurückgegangen sei und sich die erzieherischen Möglichkeiten <strong>der</strong><br />
Schule verringert hätten. (CP)<br />
� (75)<br />
AUTHOR<br />
Hofstaetter, Maria (Mitarb.); Schoeberl, Susanne (Mitarb.); Stierl, Brigitte (Mitarb.);<br />
Wieser, Regina (Mitarb.)<br />
TITLE<br />
Schulklima - Schulimage. Eine qualitative Analyse - die Schule aus <strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong><br />
Betroffenen.<br />
SOURCE<br />
Wien: Oesterreichisches Institut fuer Berufsbildungsforschung (1992) 83, 28 S.<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1992<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulmilieu; Befragung; Lehrer; Schueler; Eltern; Zufriedenheit; Belastung; Schule;<br />
Partnerschaft; Volksschule; Interkulturelle Erziehung; Forschungsbericht; Schulleistung;<br />
Schulklima (Fis Bildung)<br />
ohne ABSTRACT<br />
� (76)<br />
AUTHOR<br />
Holtappels, Heinz G.; Meier, Ulrich<br />
TITLE<br />
Gewalt an Schulen. Erscheinungsformen von Schülergewalt und Einflüsse des<br />
Schulklimas.<br />
SOURCE<br />
In: Die Deutsche Schule, 89 (1997) 1, S. 50-62<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1997<br />
DESCRIPTORS<br />
Gewalt; Schule; Schueler; Befragung; Persoenlichkeitsmerkmal; Soziale Bedingung;<br />
Sekundarstufe I; Schulklima; Lernkultur; Hessen<br />
ABSTRACT<br />
Unsere Bielefel<strong>der</strong> Untersuchung erforscht Ausmaß und Formen von Gewalt bei Schüler/<br />
innen an Schulen in Abhängigkeit von Persönlichkeitsmerkmalen und sozialen<br />
Bedingungsfaktoren im schulischen und außerschulischen Umfeld. In <strong>der</strong> für das Land<br />
Hessen repräsentativen Untersuchung wurden im Herbst 1995 in verschiedenen<br />
54
Regionen insgesamt 3.540 Schüler/innen (jeweils ganze Schulklassen) im Alter von 11<br />
bis 17 Jahren ( Schuljahrgänge 6, 8 und 9 bzw. 10) und 448 Lehrer/innen aus 24 ausgewählten<br />
Schulen per Fragebogen befragt. Dabei wurden sämtliche Schulformen <strong>der</strong><br />
Sekundarstufe I entsprechend ihrem Schüleranteil im Land Hessen berücksichtigt. Diesen<br />
Befragungen ging 1994 eine Schulleitungsbefragung voraus. ... Im folgenden sollen neue<br />
Forschungsergebnisse über Ausmaß und Erscheinungsformen von Gewalt in Schulen<br />
vorgestellt werden, wobei wir in diesem Beitrag den schulischen Kontext, also das Lern-<br />
und Sozialklima <strong>der</strong> Schule, in das Zentrum <strong>der</strong> Analyse von Bedingungsfaktoren stellen.<br />
... Fazit: Die Resultate dieser ersten bivarianten Analysen verdeutlichen, daß es sehr wohl<br />
nachweisbare, empirisch gesicherte Befunde dafür gibt, daß sozial-ökologische Aspekte<br />
<strong>der</strong> innerschulischen Lern- und Erziehungsumwelt relevant für die Produktion und<br />
Stützung von Schülergewalt sein können. (Fis Bildung nach DIPF/Text übernommen)<br />
� (77)<br />
AUTHOR<br />
Hoy, Wayne K.; Hannum, John W.<br />
TITLE<br />
Middle school climate. An empirical assessment of organizational health and student<br />
achievement.<br />
SOURCE<br />
In: Educational administration quarterly, 33 (1997) 3, S. 290-311<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1997<br />
DESCRIPTORS<br />
Mittelschule; Schulklima; Schulorganisation; Schuelerleistung; Empirische<br />
Untersuchung; Vereinigte Staaten<br />
ABSTRACT<br />
Researchers and reformers have suggested that school climate is an important aspect of<br />
effective schools; however the notion of climate is defined in a myriad of ways, is<br />
frequently nebulous, and is often merely a slogan for better schools. The current analysis<br />
uses a health metaphor to conceptualize and measure important aspects of school climate<br />
and then examines retaionships between school health and student achievement in<br />
reading, writing, and mathematics in a sample of middle schools. As predicted,<br />
dimensions of organizational health were significantly related to student achievement<br />
even when the socioeconomic status of the school was controlled. (psyclit/abstract taken<br />
from the original)<br />
� (78)<br />
AUTHOR<br />
Landwehr, Norbert; Steiner, Peter<br />
TITLE<br />
NW EDK-Projekt "Qualitätsentwicklung auf <strong>der</strong> Sekundarstufe II"<br />
55
LITERATUR:<br />
ARBEITSPAPIER: Steiner, Peter: NW EDK-Projekt "Qualitaetsentwicklung auf <strong>der</strong><br />
Sekundarstufe II": Planungsunterlagen für die Bildungserwartung und für interessierte<br />
Schulen.<br />
SOURCE<br />
Schweizerischer Informations- und Daten-Archivdienst für die Sozialwissenschaften,<br />
Aarau (Sekretariat NW-EDK)<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1997<br />
DESCRIPTORS<br />
Sekundarstufe II; Schweiz; Gymnasium; Berufsschule; Schulentwicklung;<br />
Reformmodell; Bildungswesen; Lehrplan; Qualitaetssicherung; Organisation<br />
ABSTRACT<br />
Warum erhaelt die Qualitaetsentwicklung für Schulen oberste Bedeutung? Grundlegende<br />
Neuerungen konfrontieren die Schulen <strong>der</strong> Sekundarstufe II. Die Umsetzung des neuen<br />
Maturitätsreglementes an den Mittelschulen o<strong>der</strong> die Revision des allgemeinbildenden<br />
Unterrichtes an den Berufsschulen sind nur zwei Bereiche, die aufzeigen, dass von den<br />
Schulen verlangt wird, sich aktiv auf die Veraen<strong>der</strong>ungen im Bildungswesen<br />
einzustellen. Zudem ermöglicht die vorgesehene Verwirklichung teilautonom geleiteter<br />
Schulen eine vertiefte Diskussion zur Frage <strong>der</strong> Qualitätssicherung. Für die Schulen<br />
entstehen somit Situationen, wo Qualitätsentwicklung und Qualitätsevaluation<br />
zunehmend an Bedeutung gewinnen werden. In diesem schwierigen Umfeld wollen die<br />
am Projekt beteiligten Kantone die Initiative fuer die Weiterentwicklung <strong>der</strong> Qualitaet<br />
bewusst in den Schulen foer<strong>der</strong>n. Die NW EDK und die Kantone bieten mit fachlicher,<br />
interkantonaler Zusammenarbeit eine kompetente Unterstützung und Begleitung vor Ort<br />
an. Welche Zielsetzungen verfolgt das Projekt? Das Projekt ist in zwei Ebenen aufgeteilt:<br />
Projektebene 1: Lokale Schulentwicklung An den Projektschulen wird die Qualitätsentwicklung<br />
und -evaluation im Sinne von Schulentwicklung vor Ort geför<strong>der</strong>t.<br />
Projektebene 2: Entwicklung eines Qualitätssystems Verschiedene interkantonale<br />
Gruppierungen (Expertenteam, Fachgruppen) erarbeiten ein generalisierbares<br />
Basismodell und -instrumentarium fuer die Qualitätsentwicklung und -evaluation an den<br />
Schulen <strong>der</strong> Sekundarstufe II. Ziele von Projektebene 1: Qualitätsentwicklung soll auf<br />
lokaler Ebene an den Schulen in Gang gesetzt werden. Die bewusste Gestaltung einer<br />
lokalen Schulkultur bildet einen ersten Arbeitsschwerpunkt: Qualitätsentwicklung in den<br />
Bereichen Didaktik (z.B. Erweiterte Lernformen), Kooperation im Lehrerkollegium (z.B.<br />
Umsetzung <strong>der</strong> Rahmenlehrpläne in Schullehrpläne) und <strong>der</strong> Schulorganisation (z.B.<br />
Leitbildarbeit) unterstützen die lokalen Schulentwicklungsprozesse. Eine Fachperson<br />
(Schulbegleiterin o<strong>der</strong> Schulbegleiter) foer<strong>der</strong>t die Entwicklung <strong>der</strong> Schule als "lernende<br />
Organisation". Eingebettet in eine lokale Projektorganisation versucht die Fachperson,<br />
gemeinsam mit den beteiligten Lehrpersonen und <strong>der</strong> Schulleitung, die Qualitätsentwicklung<br />
in den angesprochenen Bereichen zu för<strong>der</strong>n und zu institutionalisieren. Ziele<br />
von Projektebene 2: die Zielsetzung liegt bei <strong>der</strong> Schaffung eines Basismodells und eines<br />
Basisinstrumentariums für Qualitätsentwicklung und -evaluation auf <strong>der</strong> Sekundarstufe<br />
II. Eine Expertengruppe und verschiedene Fachgruppen aus den lokalen<br />
Projektorganisationen erarbeiten die Grundlagen eines Qualitätssystems. Das Qualitätssystem<br />
wird an einzelnen Schulen im Sinne von Schulentwicklungsprojekten in <strong>der</strong><br />
56
Praxis erprobt und ueberprüft. Welche Fragen sollen im Verlaufe des Projektes beantwortet<br />
werden? Wie sieht ein generalisierbares Basismodell fuer Qualitaetsentwicklung<br />
und -evaluation an Schulen <strong>der</strong> Sekundarstufe II aus, das genügend Spielraum bei <strong>der</strong><br />
Ausgestaltung zulässt? Welches sind die Unterschiede, resp. Gemeinsamkeiten eines<br />
schulspezifischen Qualitätssystems fuer Berufsschulen und Gymnasien? Wie lauten die<br />
Verfahrensregeln für die Einfuehrung und Implementation eines schulspezifischen<br />
Qualitätssystems an Schulen <strong>der</strong> Sekundarstufe II? Gibt es übertragbare Entwicklungsmodelle?<br />
Wie kann ein Qualitaetssystem im Sinne von Schulentwicklung in einer Schule<br />
umgesetzt werden? Welche Instrumente für Selbst- und Fremdevaluation eignen sich fuer<br />
Berufsschulen, resp. für Gymnasien? Welche Rollen/Aufgaben/Kompetenzen haben die<br />
Schulleitung, die Schulaufsicht und die Trägerschaft in einem zukünftigen<br />
Qualitätssystem? Welches sind die Aufgaben <strong>der</strong> Schulbegleitung bei <strong>der</strong> Einfuehrung<br />
und Implementation eines schulspezifischen Qualitätssystems? Woran entzündet sich <strong>der</strong><br />
Wi<strong>der</strong>stand bei <strong>der</strong> Umsetzung? Wie sieht ein wirkungsvolles Umsetzungskonzept aus,<br />
das dem Wi<strong>der</strong>stand Rechnung trägt. (Foris)<br />
� (79)<br />
AUTHOR<br />
Lehmpfuhl, Uwe; Kakies, Ralf; Roesner, Ernst<br />
TITLE<br />
Schulentwicklungsplanung für das berufsbildende Schulwesen <strong>der</strong> Stadt Köln<br />
LITERATUR:<br />
Ratgeber Schulentwicklungsplanung. Bd. II: Berufsbildende Schulen (geplant).<br />
ARBEITSPAPIER: Lehmpfuhl, Uwe; Kakies, Ralf; Miethner, Johannes; Fischer, Kerstin; Olschewski,<br />
Kerstin: Schulentwicklungsplan für das berufsbildende Schulwesen <strong>der</strong> Stadt Koeln 1997-2010. Entwurf.<br />
Dortmund: Univ., IFS 1997<br />
SOURCE<br />
Universiäet Dortmund, FB Erziehungswissenschaften und Biologie/Institut für<br />
Schulentwicklungsforschung<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1997<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulentwicklung; Prognose ; Entwicklungsplanung; berufsbildendes Schulwesen; Schule; Nordrhein-<br />
Westfalen; Ausbildung; Bildungsplanung; Bundesrepublik Deutschland; Planung ; Berufsbildung;<br />
Angebot; Nachfrage; Jugendlicher; Qualifikation; Bedarf; Grossstadt<br />
ABSTRACT<br />
Bereitstellung eines beruflichen Bildungsangebotes, das sowohl den Bildungsbedürfnissen<br />
<strong>der</strong> nachfragenden Jugendlichen als auch dem Qualifikationsbedarf im<br />
Beschäftigungssystem am Standort Köln entspricht; Schaffung einer ausgeglichenen<br />
räumlichen Versorgung an allen Schulstandorten; Optimierung <strong>der</strong> vorhandenen<br />
Angebotsstrukturen an den 17 Schulen; Versorgung aller nachfragenden Jugendlichen<br />
mit beruflicher Bildung; konzeptionelle Vorbereitung <strong>der</strong> Errichtung einer<br />
Medienberufsschule. VORGEHENSWEISE: Dialogischer Planungsansatz unter<br />
Einbeziehung aller beteiligten Akteure; manpower requirement approach in Kombination<br />
mit social demand approach zur Ermittlung <strong>der</strong> künftigen Entwicklung von Angebot und<br />
Nachfrage nach beruflicher Bildung. Untersuchungsdesign: Trend, Zeitreihe<br />
DATENGEWINNUNG: Aktenanalyse, offen (Stichprobe: 250-300; Konzepte, Vorlagen,<br />
57
Beschreibungen, Verwaltungsakten etc.; Auswahlverfahren: Gruppendiskussion (Stichprobe:<br />
5-40; z.T. Schulleitungen, z.T. alle Beteiligten; Auswahlverfahren: je total).<br />
Qualitatives Interview (Stichprobe: 5; ausgewaehlte Experten; Auswahlverfahren:<br />
Planungsrelevanz). Halbstandardisierte Befragung, face to face (Stichprobe. 17;<br />
Schulleitungen; Auswahlverfahren: total). Standardisierte Befragung, schriftlich (Stichprobe:<br />
60; am Planungsprozess beteiligte Experten; Auswahlverfahren: total).<br />
Sekundäranalyse von Aggregatdaten (Stadt Köln Schulverwaltungsamt, Schuldaten LDS<br />
NRW, Bezirksregierung Köln; Auswahlverfahren: Planungsrelevanz). Schulbesuche und<br />
-begehungen (Stichprobe: 17; Berufsbildende Schulen; Auswahlverfahren: total).<br />
Feldarbeit durch Mitarbeiter/-innen des Projekts. (DB Foris)<br />
� (80)<br />
AUTHOR<br />
Risse, Erika<br />
TITLE<br />
Wirkungen: Was sich an Schulen verän<strong>der</strong>t.<br />
SOURCE<br />
In: Pädagogische Führung, 9 (1998) 2, S. 68-71<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1998<br />
DESCRIPTORS<br />
Schule; Qualitaet; Innovation; Schulreform; Modellversuch; Autonomie; Lehrer; Schulleitung;<br />
Schulprogramm; Selbstwirksamkeit; Deutschland<br />
ABSTRACT<br />
Nach 2 Jahren Modellversuch "Verbund Selbstwirksamer Schulen" bilanziert die Autorin<br />
die bisherigen Ergebnisse unter dem Blickwinkel <strong>der</strong> Innovationsfähigkeit <strong>der</strong><br />
Pilotschulen. Es werden Gründe für die Innovationsentwicklung benannt, das<br />
Engangement <strong>der</strong> Lehrer beleuchtet, die Rolle <strong>der</strong> Schulleitung beschrieben, die Schülerbezogenheit<br />
<strong>der</strong> Projekte betrachtet, Schulprogamm und Öffentlichkeitsarbeit <strong>der</strong><br />
Schulen problematisiert. (Fis Bildung nach DIPF/mi)<br />
� (81)<br />
AUTHOR<br />
Romer, Claudia<br />
TITLE<br />
Ein Zwischenbericht <strong>zum</strong> Schulversuch "Schule gestalten": Die "gute" Schule.<br />
SOURCE<br />
In: VLB-Akzente, 6 (1997) 12, S. 4-7<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1997<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulversuch; Schule; Gestaltung; Berufsbildendes Schulwesen; Qualitaet; Schulklima;<br />
Projekt; Autonomie; Schueler; Mitwirkung<br />
58
ABSTRACT<br />
Erfahrungsbericht aus dem Schulversuch "Schule gestalten" an den fünf beteiligten beruflichen<br />
Schulen. Die einzelnen Schulen setzten unterschiedliche Schwerpunkte und<br />
wählten verschiedene Projektthemen. (ISB).<br />
� (82)<br />
AUTHOR<br />
Schiessl, Otmar<br />
TITLE<br />
Schulische Entwicklungen im Urteil von Schülern, Eltern, Lehrern und Schulaufsicht.<br />
SOURCE<br />
Muenchen (ISB), 15 S.<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1996<br />
DESCRIPTORS<br />
Schule; Qualitaet; Schulqualität; Befragung; Schueler; Eltern; Lehrer; Schulaufsicht (Fis<br />
Bildung)<br />
ohne ABSTRACT<br />
� (83)<br />
AUTHOR<br />
Schrö<strong>der</strong>, Ingobert<br />
TITLE<br />
Schulevaluation als Kern einer Qualitätskultur. Erfahrungen im Tayside Regional<br />
Council, (Schottl.) und erste Schritte im Bezirk Detmold.<br />
SOURCE<br />
In: Schul-Management, 27 (1996) 5, S. 23-25<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1996<br />
DESCRIPTORS<br />
Schule; Qualitaet; Schulqualität; Evaluation; Selbsteinschaetzung; Schulaufsicht;<br />
Internationaler Vergleich; Empirische Untersuchung; Beratung; Schottland; Detmold;<br />
Nordrhein-Westfalen<br />
ABSTRACT<br />
Es werden Auffassungen und Praktiken zur Qualitätsentwicklung durch Selbstevaluation<br />
und Schularbeitspläne in einem Regierungsbezirk in Schottland vorgestellt. Dabei wird<br />
auch auf die Rolle <strong>der</strong> Bezirksschulbehörde eingegangen. Abschließend wird über<br />
Erfahrungen bei <strong>der</strong> Selbstevaluation und <strong>der</strong> Beratung durch Schulberatungsteams im<br />
Regierungsbezirk Detmold (NRW) berichtet. Diese Arbeit wird vom Dortmun<strong>der</strong> Institut<br />
für Schulentwicklungsforschung begleitet. (Fis Bildung nach DIPF/Mar.).<br />
59
� (84)<br />
AUTHOR<br />
Specht, Werner (Österreich. Bundesmin. für Unterricht und Kulturelle Angelegenheiten;<br />
Zentrum für Schulentwicklung)<br />
TITLE<br />
Autonomie und Innovationsklima an Schulen. Rezeption und Wirkungen <strong>der</strong><br />
Schulautonomie an Hauptschulen und allgemeinbildenden höheren Schulen.<br />
SOURCE<br />
Graz (BMUK), 230 S.<br />
REIHE<br />
Forschungsbericht / Zentrum für Schulentwicklung (Wien). 261997<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1995<br />
DESCRIPTORS<br />
Autonomie; Schule; Empirische Untersuchung; Forschungsbericht; Befragung;<br />
Sekundarstufe I; Schulleiter; Eltern; Lehrer; Schueler; Schulwesen; Schulreform;<br />
Hauptschule; Hoehere Schule; Qualitaet; Wahrnehmung; Motivation; Schulklima;<br />
Innovation; Zufriedenheit; Evaluation; Gesetzgebung; Oesterreich; Gesetz<br />
ABSTRACT<br />
Dies ist ein Teilbericht über eine <strong>der</strong> größten bislang in Österreich durchgeführten<br />
empirischen Untersuchungen zur Situation <strong>der</strong> Schule <strong>der</strong> 10-14jährigen. Er behandelt<br />
die Folgen <strong>der</strong> Autonomiereform (14. SchOG- Novelle) für das Schulwesen im zweiten<br />
Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes. Befragt wurden ca. 250 Schulleiter und jeweils etwa<br />
2000 Lehrer, Eltern und Schüler aus über 250 Hauptschulen und allgemeinbildenden<br />
höheren Schulen. Erhoben wurden nicht nur Einstellungen und Erfahrungen im<br />
Zusammenhang mit <strong>der</strong> erweiterten Schulautonomie, son<strong>der</strong>n auch allgemeine Wahrnehmungen<br />
<strong>der</strong> eigenen Schule - <strong>der</strong>en Stärken und Schwächen. Das Ergebnis ist ein<br />
recht umfassendes Bild über Situation, Entwicklungsstand und Probleme <strong>der</strong><br />
österreichischen Schule im Bereich <strong>der</strong> Sekundarstufe I, das über die<br />
Autonomieproblematik hinausreicht. Von Beginn an war es Ziel und Inhalt des<br />
Forschungskonzepts, Fragen <strong>der</strong> Schulautonomie mit solchen <strong>der</strong> Qualität von Schule<br />
und Schulwesen zu verbinden, die autonomiebezogenen Fragestellungen also in jenen<br />
Zusammenhang zu stellen, in den sie m. E. gehören - in den Kontext einer allgemeinen<br />
Diskussion über för<strong>der</strong>nde und hemmende Bedingungen <strong>der</strong> Sicherung und Erweiterung<br />
von Schulqualität. Qualität im Kontext <strong>der</strong> Schule aber meint im beson<strong>der</strong>en: Lernbereitschaft<br />
und Befindlichkeit von Schülern zu verbessern, die Identifikation <strong>der</strong> Eltern mit<br />
ihrer Schule zu erhöhen und die professionellen Tugenden und Kompetenzen von<br />
Schulleitern und Lehrern zu stärken. Der vorliegende Bericht allerdings legt den Fokus<br />
auf die Autonomiethematik in einem etwas engeren Sinne. Gefragt wird, welchen<br />
Nie<strong>der</strong>schlag die Reform des Jahres 1993 im Schulwesen <strong>der</strong> Sekundarstufe 1 gefunden<br />
hat, wie die erweiterten Freiräume an den Schulen aufgenommen und genutzt werden<br />
und welche Verän<strong>der</strong>ungen sich als Folge davon im Inneren <strong>der</strong> Schulen vollziehen und<br />
vollzogen haben. Mehr als alles an<strong>der</strong>e ist dies folglich ein Bericht darüber, wie die<br />
60
Auffor<strong>der</strong>ung des Gesetzgebers an die Schulen, Eigeninitiative zur inneren Erneuerung<br />
und Verän<strong>der</strong>ung zu ergreifen, von diesen interpretiert, umgesetzt, be- und verwertet<br />
wird. Es ist damit auch eine Arbeit über Bedarf und Bedürfnis nach Innovation an den<br />
Schulen und <strong>der</strong>en Umgang damit. (fis Bildung nach DIPF/Orig.).<br />
� (85)<br />
AUTHOR<br />
Spindler, Manfred<br />
TITLE<br />
Schritte zur Einschätzung des Klassenklimas<br />
SOURCE.<br />
Psychologie in Erziehung und Unterricht, 46 (1999) 2, S. 150-153<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1999<br />
DESCRIPTORS<br />
Paedagogische Psychologie; Psychologische Beratung; Soziales Klima; Schulklima<br />
ABSTRACT<br />
Der Artikel berichtet von einem Vorgehen, Dimensionen des sozialen Klimas mit den Schülern zu<br />
erarbeiten und einschätzen zu lassen. Die Ergebnisse können einer spezifischen Interventionsplanung<br />
dienen und den Dialog zwischen Schule und Elternhaus bereichern. (fis/Orig: Landesinstitut für Schule<br />
und Weiterbildung, Soest)<br />
� (86)<br />
AUTHOR<br />
Weishaupt, Horst<br />
TITLE<br />
Determinanten <strong>der</strong> Bewertung des schulstrukturellen Wandels in Thüringen durch Lehrer und Eltern<br />
61
SOURCE<br />
Aus: Möller, R.; Abel, J., Neubauer, G., Treumann, K.-P. (Hrsg.): Kindheit, Familie und Jugend.<br />
Münster/New York<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1996<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulsystem, DDR, Strukturwandel, Schulreform, Lehrer, Eltern<br />
ABSTRACT<br />
Der Aufsatz stellt die Ergebnisse einer in Erfurt durchgeführten Untersuchung dar, in <strong>der</strong><br />
Eltern und Lehrer im Sommer 1993 nach ihrer Bewertung des DDR-Schulsystems und<br />
nach ihren Reformerwartungen befragt wurden. Hinsichtlich <strong>der</strong> Vorteile und Nachteile<br />
des neuen Schulsystems betrachten die Lehrer den schulstrukturellen Wandel deutlich<br />
positiver als die Eltern, am positivsten die Gymnasiallehrer, die zu 70% Vorteile sehen.<br />
Von den Eltern bewerten nur 45% das neue System positiv, 18% sehen eher Nachteile.<br />
Sowohl Lehrer als auch Eltern betrachten als bewahrenswerte Elemente des alten<br />
Schulwesens: wohnortnahe Schulversorgung, Hort, Mittagsversorgung, Freizeitgestaltung.<br />
Die Untersuchungsergebnisse zeigen , dass diejenigen Lehrer und Eltern, die<br />
Verän<strong>der</strong>ungen des alten DDR-Schulsystems wünschten und reformoffen waren, das<br />
neue System positiver einschätzen als Befragte, die mit dem DDR-Schulwesen<br />
überwiegend zufrieden waren. Bewertet nach einer Notenskala von 1 bis 6 benoten 84%<br />
<strong>der</strong> Eltern die Unterstufe <strong>der</strong> POS mit ‚sehr gut‘ und ‚gut‘ im Vergleich zu 78%, die die<br />
jetzige Grundschule gleichermaßen bewerten. 72% benoten die Mittel- und Oberstufe <strong>der</strong><br />
POS mit ‚sehr gut‘ und ‚gut‘, aber nur 61% geben <strong>der</strong> Regelschule diese Noten. Bei den<br />
Lehrern fällt die Benotung <strong>der</strong> neuen Schularten insgesamt positiver aus. (CP)<br />
� (87)<br />
AUTHOR<br />
Weiß, Manfred<br />
TITLE<br />
Schulautonomie als theoretisches Problem und als Gegenstand empirischer Bildungsforschung.<br />
SOURCE<br />
Aus: Schulautonomie in Europa. Baden-Baden: (Nomos) S. 27-45PUBLICATION<br />
YEAR<br />
1997<br />
DESCRIPTORS<br />
Schule; Autonomie; Schulwesen; Bildungsforschung; Erziehung; Schulrecht;<br />
Gesellschaft; Demokratisierung; Freiheit; Schulverwaltung; Lehrer; Eltern; Schueler;<br />
Effektivitaet; Zufriedenheit; Empirische Forschung; Richter, Ingo; Deutschland;<br />
Vereinigte Staaten<br />
ABSTRACT<br />
Anknüpfend an Richter, "<strong>der</strong> sechs Theorien <strong>der</strong> Schulautonomie in Anlehnung an sechs<br />
Wissenschaftsdisziplinen (Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie,<br />
Rechtswissenschaft, Pädagogik, Ökonomie) unterscheidet", werden im ersten Teil diese<br />
Ansätze vor dem Hintergrund <strong>der</strong> gegenwärtigen Diskussion zur Schulautonomie, zur<br />
verstärkten Selbstbestimmung <strong>der</strong> einzelnen Schule diskutiert. In einem zweiten Teil<br />
62
geht es um eine Einschätzung <strong>der</strong> empirischen Befundlage. Dabei werden zunächst die<br />
Bewertungskriterien vorgestellt und dann u. a. empirische Befunde zu<br />
Autonomiewirkungen sowie die Studie von Chubb/ Moe dargestellt, die zu<br />
differenzierten Aussagen im Hinblick auf die Wirkungen, Ergebnisse auch <strong>der</strong> einzelnen<br />
Beteiligten an <strong>der</strong> Schulautonomie (Lehrer, Schüler, Eltern) führten. (Fis Bildung nach<br />
DIPF/Sch.).<br />
63
1. 3 Studien zu einzelnen Schulformen<br />
� (88)<br />
AUTHOR<br />
Aurin, Kurt; Beckmann, Hans-Karl; Wollenweber, Horst<br />
TITLE<br />
Die Realschule - ihr Auftrag im allgemeinbildenden Schulwesen.<br />
SOURCE<br />
In: Die Realschule, 96 (1988) 8, S. 307-313<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1988<br />
DESCRIPTORS<br />
Unterrichtsmaterial; Sekundarstufe I; Realschule; Sachinformation;<br />
Erziehungswissenschaft; Paedagogik; Schulpaedagogik; Schulwesen; Entwicklung;<br />
Deutschland-BRD; Staat; Schule; Schulorganisation; Bildungsbegriff; Begriff;<br />
Persoenlichkeitsbildung; Konzeption; Schulentwicklung; Curriculum; Bildungsgang;<br />
Faecherkanon; Wissenschaftlichkeit; Differenzierung; Didaktik; Methodik; Realschueler;<br />
Realschullehrer; Lehrerausbildung; Elternarbeit; Leistung<br />
ABSTRACT<br />
Dargestellt wird <strong>der</strong> Bildungsauftrag <strong>der</strong> Realschule im allgemeinbildenden Schulwesen.<br />
Zunaechst geht es allgemein um die Stellung <strong>der</strong> Schule im Prozess gesellschaftlicher<br />
Entwicklung und Veraen<strong>der</strong>ung sowie um die daraus resultierenden Bildungsziele innerhalb<br />
<strong>der</strong> demokratischen Gesellschaft. Der Schwerpunkt liegt hier auf einer Erziehung<br />
<strong>zum</strong> verantwortungsbewussten und selbstbestimmten Buerger und auf <strong>der</strong> Vermittlung<br />
einer moeglichst breit gefaecherten Allgemeinbildung, die den Bedingungen des<br />
pluralistischen Gesellschaftssystems Rechnung traegt. Diese Bildungsziele werden dann<br />
durch Erlaeuterung schulformuebergreifen<strong>der</strong> und schulformbezogener Aspekte weiter<br />
differenziert. Dabei wird auch auf das paedagogische Prinzip <strong>der</strong> Leistung eingegangen.<br />
Vor dem Hintergrund dieser allgemeinen Ueberlegungen wird dann das Idealbild einer<br />
"humanen" Schule, die auf die individuellen Interessen <strong>der</strong> Schueler und Lehrer zugeschnitten<br />
ist, skizziert. Zum Schluss werden ausfuehrlich die Beson<strong>der</strong>heiten <strong>der</strong> Realschule<br />
vorgestellt. Hier steht vor allen Dingen die Tatsache im Vor<strong>der</strong>grund, dass die<br />
Realschule darauf abzielt, den durchgehenden Lebensbezug unter Beruecksichtigung <strong>der</strong><br />
Anfor<strong>der</strong>ungen gehobener beruflicher Taetigkeit mit einer differenzierten<br />
Allgemeinbildung zu vermitteln. Dies wird am Faecherkanon und am Prinzip des<br />
"methodischen Realismus" weiter expliziert. (fis Bildung nach DIPF)<br />
� (89)<br />
AUTHOR<br />
Buhren, Claus G.; Rösner, Ernst<br />
TITLE<br />
Gesamtschule - Eine Zwischenbilanz.<br />
64
SOURCE<br />
In: Jahrbuch <strong>der</strong> Schulentwicklung, (1996) 9, S. 261-306<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1996<br />
DESCRIPTORS<br />
Gesamtschule; Schulentwicklung; Schulreform; Schulstandort; Bewertung; Schulsystem;<br />
Lernerfolg; Empirische Untersuchung; Deutschland<br />
ABSTRACT<br />
Die Autoren ziehen nach 25 Jahren Gesamtschulgeschichte eine Zwischenbilanz und<br />
zeigen an idealtypischen Fallbeispielen, dass die Entwicklungschancen von Gesamtschulen<br />
sehr differenziert beurteilt werden müssen. Zunächst wird konstatiert und in den<br />
Auswirkungen näher begründet: "Wo Gesamtschulen durch die Landespolitik nicht verhin<strong>der</strong>t,<br />
son<strong>der</strong>n <strong>zum</strong>indest in Annäherung an die Wünsche <strong>der</strong> Erziehungsberechtigten<br />
errichtet werden konnten, findet sich <strong>zum</strong>eist ein Parallelangebot von integrierten<br />
Gesamtschulen und Angeboten des tradierten Schulsystems, eine gespaltene Bildungslandschaft<br />
also". Von einer Normalität im postitiven Sinne (durchgängigen<br />
Gleichwertigkeit gegenüber den Schulen des traditionellen Schulsystems) sind Gesamtschulen<br />
weit entfernt. Im ersten Teil wird auf Grundmuster des aktuellen Erscheinungsbildes<br />
<strong>der</strong> Gesamtschule eingegangen. Der zweite Teil beleuchtet die Aktualität des Gesamtschulkonzeptes<br />
und die bildungsökonomischen, bildungstheoretischen,<br />
sozialstaatlichen und bildungssoziologischen sowie sozialpädagogischen Motive. Im<br />
dritten Teil geht es um die Gesamtschule heute - zwischen Vielfalt und Vielerlei. U. a.<br />
verzeichnet dazu eine Tabellenübersicht die Schüleranteile <strong>der</strong> Schulformen nach<br />
einzelnen Bundeslän<strong>der</strong>n im Zeitraum 1960/61 bis 1994/95 - Hamburg, Brandenburg,<br />
Saarland, Hessen und Nordrhein-Westfalen nehmen die vor<strong>der</strong>en Plätze ein. Im vierten<br />
Teil wird spezieller auf Gelingens- und Misslingensbedingungen von Gesamtschulen<br />
eingegangen. Äußere Bedingungen (Ausprägung <strong>der</strong> Schulkonkurrenz,<br />
Arbeitsbedingungen, administrative Vorgaben, Lehrerausbildung) und innere<br />
Bedingungen (Schulleitungspraxis im Team - Lehrer: Einzelkämpfer vs. Team -<br />
Lehrereinsatz: Klassenlehrer, Fachlehrer o<strong>der</strong> was? - Kommunikations- und Konferenzkultur<br />
- Entscheidungskompetenzen <strong>der</strong> Lehrer in unterschiedlich ausgeprägten<br />
Hierarchien - Umgang mit dem Differenzierungsangebot - Varianten des Ganztagsschul-<br />
Verständnisses) werden näher charakterisiert sowie das Verhältnis von inneren und<br />
äußeren Bedingungen. Diese Wechselwirkungen werden an vier Fallbeispielen<br />
veranschaulicht - Standortbedingungen und Lernkultur betreffend. Der fünfte Teil enthält<br />
Folgerungen. (Fis Bildung nach DIPF/Ko.).<br />
� (90)<br />
AUTHOR<br />
Holtappels, Heinz G.<br />
TITLE<br />
Lernkultur braucht Zeit und Raum. Pädagogische Perspektiven <strong>der</strong> Ganztagsschule.<br />
SOURCE<br />
In: Friedrich-Jahresheft, (1994) XII: Schule zwischen Routine und Reform, S. 22-24<br />
65
PUBLICATION YEAR<br />
1994<br />
Schulreform; Sachinformation; Erziehungswissenschaft; Schulpaedagogik; Lernen;<br />
Lernatmosphaere; Unterrichtsorganisation; Schulleben; Offene Schule; Ganztagsschule;<br />
Konzeption<br />
ABSTRACT<br />
Skizziert wird eine Konzeption von (Ganztags-)Schule, die nach Meinung des Autors den<br />
Erfor<strong>der</strong>nissen zukünftiger Bildung und Erziehung beson<strong>der</strong>s gut Rechnung tragen kann.<br />
Danach sollten ein erneuertes Bildungsverständnis und eine Stärkung <strong>der</strong> Erziehungsfunktion<br />
<strong>der</strong> Schule ineinan<strong>der</strong>greifen. Die Schule sollte den Schülerinnen und Schülern<br />
eine ihnen angemessene Lernkultur bieten. Nach Meinung des Autors sind die dazu<br />
nötigen Bedingungen (ein Wechsel von Konzentration und Zerstreuung, Ruhe und<br />
Bewegung, Lernarbeit und Freizeit, Gemeinschaftlichkeit und Individualiät) in <strong>der</strong><br />
Ganztagsschule beson<strong>der</strong>s günstig. (Fis Bildung nach HIBS/Pt).<br />
� (91)<br />
AUTHOR<br />
Holtappels, Heinz G.; Rösner, Ernst<br />
TITLE<br />
Schulsystem und Bildungsreform in Westdeutschland. Historischer Rückblick und<br />
Situationsanalyse.<br />
SOURCE<br />
Aus: Schulreform in <strong>der</strong> Mitte <strong>der</strong> 90er Jahre. Opladen, (Leske u. Budrich) S. 23-46<br />
(Monographiauszug)<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1996<br />
DESCRIPTORS<br />
Gesamtschule; Schulgeschichte; Gymnasium; Hauptschule; Realschule; Schulform;<br />
Schulreform; Schulsystem; Schulwesen; Schuelerzahl; Uebergang; Deutschland-BRD<br />
ABSTRACT<br />
Einleitend beschreiben die Autoren die verschiedenen Konzepte, die in <strong>der</strong> BRD zur<br />
Reform <strong>der</strong> Struktur des weiterführenden Schulwesens entwickelt wurden (Rahmenplan,<br />
Strukturplan, Bildungsgesamtplan). Dann werden die quantitativen Entwicklungen im<br />
Schulwahlverhalten von 1960 bis 1993 dargestellt, also die Verteilung <strong>der</strong> Schüler/innen<br />
auf die Schulformen. Im Hauptteil des Aufsatzes werden "die Auswirkungen <strong>der</strong><br />
Schulstrukturkrise auf einzelne Schulformen in Verbindung mit ihren<br />
Entwicklungsperspektiven diskutiert." (Fis Bildung nach DIPF/Bi.).<br />
66
� (92)<br />
AUTHOR<br />
Hurrelmann, Klaus<br />
TITLE<br />
Thesen zur strukturellen Entwicklung des Bildungssystems in den nächsten fünf bis zehn<br />
Jahren.<br />
SOURCE<br />
In: Die Deutsche Schule, 80 (1988) 4, S. 451-461<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1988<br />
DESCRIPTORS<br />
Bildungsexpansion; Bildungssystem; Entwicklung; Schulwesen; Schulentwicklung;<br />
Konzeption; Gymnasium; Gesamtschule; Bildungschancengleichheit; Sozialer Status;<br />
Sozialer Aufstieg<br />
ABSTRACT<br />
Forschungsmethode: beschreibend. "In <strong>der</strong> Bildungspolitik ist "Konsolidierung" angesagt,<br />
große Perspektiven scheinen nicht gefragt. Durchgesetzt hat sich das Motiv <strong>der</strong><br />
Bildungsreform, durch "Bildung" möglichst vielen möglichst gute Ausgangsbedingungen<br />
für den gesellschaftlichen Statuserwerb zu vermitteln. Unter dieser Perspektive hat sich<br />
das Gymnasium offenbar besser halten und sogar stärker ausbreiten können, als es vielen<br />
recht sein mag. Die Gesamtschule hat es da schwer. Der Autor zeigt einen Weg, auf dem<br />
die strukturelle Entwicklung unseres Schulsystems wie<strong>der</strong> in Gang kommen könnte."(Fis<br />
Bildung nach DIPF/Autorenreferat).<br />
� (93)<br />
AUTHOR<br />
Hurrelmann, Klaus<br />
TITLE<br />
Die Struktur des deutschen Schulwesens im Jahre 2020.<br />
SOURCE<br />
In: Pädagogik, 49 (1997) 6, S. 18-22<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1997<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulwesen; Struktur; Zukunft; Futurologie; Schulreform; Sekundarbereich;<br />
Gymnasium; Pluralismus; Autonomie; Privatschule; Hochschule; Berufsbildung;<br />
Schulform; Schulorganisation; Deutschland; Prognose; Allgemeinbildendes Schulwesen<br />
ABSTRACT<br />
Für die Zukunft erwartet <strong>der</strong> Autor eine wachsende Vielfalt an Schulen, wobei <strong>der</strong> Anteil<br />
<strong>der</strong> Gymnasien weiter steigen wird während an<strong>der</strong>e Sekundarschulformen stagnieren. Es<br />
wird eine größere Vielfalt an Schulen mit beruflichem Ausbildungsschwerpunkt geben<br />
und eine steigende Zahl an Schulen in privater Trägerschaft. Ferner sieht er mehr Autonomie<br />
für die Schulen und mehr Entscheidungsfreiheit für die Eltern. Die<br />
67
Übergangsregelungen zwischen den Schulstufen werden flexibler werden und das duale<br />
Ausbildungssystem verschwinden. Für die Hochschulen prognostiziert er chaotische<br />
Zustände und mehr private Anbieter. (Fis Bildung nach DIPF.)<br />
� (94)<br />
AUTHOR<br />
Ipfling, Heinz-Juergen<br />
TITLE<br />
Wege aus <strong>der</strong> Hauptschulkrise.<br />
SOURCE<br />
In: 5-bis-10-Schulmagazin, 9 (1994) 6, S. 75<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1994<br />
DESCRIPTORS<br />
Hauptschule; Schulreform; Schulpolitik; Struktur; Tagung<br />
ABSTRACT<br />
Resuemee des Symposiums "Wege aus <strong>der</strong> Hauptschulkrise", zu dem sich Anfang des<br />
Jahres fuenf Staatssekretaere, Bildungswissenschaftler und Schulpolitiker trafen, war: Es<br />
gibt Wege aus <strong>der</strong> Hauptschulkrise. Sie fuehren ueber mehr strukturelle Flexibilitaet.<br />
"Der Aufbau einer mo<strong>der</strong>nen Schulstruktur sollte nach keinem starren Plan erfolgen,<br />
son<strong>der</strong>n sich an regionalen Gegebenheiten orientieren. Neue Strukturen sind dort<br />
erfor<strong>der</strong>lich, wo mit den alten Modellen keine Problemloesungen erreichbar sind." (Fis<br />
Bildung nach DIPF/Sch.)<br />
� (95)<br />
AUTHOR<br />
Melzer, Wolfgang<br />
TITLE<br />
Zweigliedrig o<strong>der</strong> wie? Erfahrungen in Ostdeutschland - Konsequenzen für die gesamte<br />
Bundesrepublik?<br />
SOURCE<br />
In: Forum E, 50 (1997) 3, S. 14-16<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1997<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulform; Differenzierung; Schulsystem; Schulqualität; Fö<strong>der</strong>alismus;<br />
Schulentwicklung; Deutsche Integration; Mittelschule; Gymnasium; Empirische<br />
Untersuchung; Sekundarstufe II; Deutschland; Deutschland-Östliche Laen<strong>der</strong>; Sachsen<br />
ABSTRACT<br />
Der Autor geht zunächst auf die historisch entstandene Vielzahl von Modifikationen und<br />
Ergänzungen zur Grundstruktur des deutschen Schulsystems ein. Er hinterfragt 1. die<br />
68
Standardisierung <strong>der</strong> Schulsysteme - auch im Hinblick auf die unterschiedliche deutsche<br />
Nachkriegsentwicklung und die Vereinigung Deutschlands 1990 und Transformation <strong>der</strong><br />
DDR-Einheitsschule in neue differenzierte Schulformen. In diesem Zusammenhang<br />
kommt eine neue Differenzierung hinzu: in Sachsen wurde die "Mittelschule", in<br />
Thüringen "Regelschule" und in Sachsen-Anhalt "Sekundarschule" flächendeckend eingeführt.<br />
2. Das "Zwei-Säulen-Modell" (im Anschluss an schulformgebundene<br />
Orientierungsstufe bestehen ausschließich Mittelschulen und Gymnasien als<br />
Schulformen). Im Rahmen einer empirischen Bewährungskontrolle wurde diese<br />
Zweigliedrigkeit 1996 in Sachsen untersucht (Akzeptanz, Schulqualität, Leistungsprofile,<br />
Schulatmosphäre, Leistungsstatus), und es werden im Beitrag wesentliche Ergebnisse<br />
dargestellt. Unter dem Aspekt Mittelschule contra Gymnasium - eine falsche<br />
Konfrontation, sind aufschlussreiche vergleichende Angaben enthalten. Der Autor<br />
formuliert u. a. die Erkenntnis, dass sich in bezug auf die Schulqualität nur wenige Unterschiede<br />
zwischen Mittelschule und Gymnasium zeigten. Er warnt vor <strong>der</strong><br />
Pauschalisierung einer Schulform und empfiehlt, Leistungsprofile nicht für Schulformen,<br />
son<strong>der</strong>n stärker für einzelne Schulen zu entwickeln (Schulprofile). Die Einzelschule hat<br />
Zukunft! Der Beitrag enthält Ansatzpunkte für weitere Schulentwicklung. Abschließend<br />
wird langfristig auf eine plurale Bildungsstruktur (als Vision) orientiert. (Fis Bildung<br />
nach DIPF/Ko.)<br />
69
Teil 2: Rechercheergebnisse <strong>zum</strong> <strong>Thema</strong> Lehrerarbeit 2<br />
Wenn es einen Konsens gibt bei den mit Schulentwicklung und Schulqualität Befaßten,<br />
dann ist es die Einsicht, daß die Realität in den Schulen, in den Klassen und<br />
Lehrerzimmern entscheidend durch die dort arbeitenden Lehrkräfte geprägt wird, und<br />
daß insofern Reformvorhaben im Schulbereich nicht ohne o<strong>der</strong> gar gegen, son<strong>der</strong>n nur<br />
mit den Lehrkräften vollzogen werden können. Dies betrifft sowohl Reformen auf<br />
struktureller Ebene als auch Modifikationen <strong>der</strong> innerschulischen und unterrichtlichen<br />
Prozesse. Die zentrale Rolle <strong>der</strong> Lehrerschaft tritt um so mehr in den Vor<strong>der</strong>grund, wenn<br />
sich Reformprozesse im Schulbereich in den letzten Jahren eher auf die einzelne Schule<br />
als pädagogische Handlungseinheit konzentrieren und in diesem Zusammenhang dann<br />
als eine <strong>der</strong> zentralen Voraussetzungen für die Steigerung <strong>der</strong> Qualität von Schulen <strong>der</strong>en<br />
erweiterte Autonomie definiert wird. In „autonomeren“ Einzelschulen kommt den<br />
Lehrkräften notwendigerweise die Aufgabe zu, diesen erweiterten Gestaltungsspielraum<br />
zu nutzen. Wenn dieser erweiterte Handlungsspielraum als Chance genutzt werden soll,<br />
dann ist damit ein Anspruch verbunden, <strong>der</strong> auf die berufliche Kompetenz und die<br />
berufliche Tätigkeit des Lehrers abzielt. Es verwun<strong>der</strong>t deshalb nicht, daß mit <strong>der</strong><br />
thematischen Neuakzentuierung <strong>der</strong> Schulforschung ein verstärktes Interesse an<br />
Ergebnissen <strong>der</strong> Lehrerforschung konstatiert werden kann.<br />
In diesem Kontext stehen an erster Stelle Arbeiten, die sich mit <strong>der</strong> Eruierung <strong>der</strong><br />
Wahrnehmung und Beurteilung <strong>der</strong> Schule durch die Lehrenden , das heißt mit ihrer<br />
Sichtweise von Schule und mit ihrer Meinung über Schüler sowie mit <strong>der</strong> Einschätzung<br />
<strong>der</strong> eigenen pädagogischen Arbeit, <strong>der</strong> Rolle als Erziehenden bzw. <strong>der</strong> Funktion als<br />
Lehrer beschäftigen. (vgl. Randoll 1995 (109)). Diese Arbeiten, die <strong>zum</strong> Teil<br />
berufsbiographische Methoden zur Grundlage haben, kommen zu zwei Grundlegenden<br />
Ergebnissen. Erstens stellen diese Studien fest, dass die Arbeitssituation <strong>der</strong> Lehrer unter<br />
den gegebenen Bedingungen geprägt ist von Überlastung, Burnout, zweitens kommen<br />
Studien, die sich mit <strong>der</strong> Lehrerrolle auseinan<strong>der</strong>setzen zu dem Ergebnis, dass im<br />
Rahmen einer erhöhten Schulautonomie soziale Kompetenzen und extrafunktionale<br />
Qualifikationen fehlen für eine qualitätsorientierte Evaluierung schulischer Lern- und<br />
Unterrichtsprozesse. Die Rolle des Lehrers beschränkt sich zur Zeit noch auf die Rolle<br />
eines Wissen-Vermittlungs-Agenten, <strong>der</strong> sich an vorgegebene Lehrpläne und Curricula<br />
zu orientieren hat. Soll eine auf Basis einer erhöhten Schulautonomie basierende<br />
Optimierung von Lernprozessen im Sinne einer besseren Schule geleistet werden, muß<br />
von Seiten <strong>der</strong> Lehrerschaft erwartet werden können, ein Lernklima zu schaffen, in<br />
dessen Zentrum auch eine Partizipation und Mitbestimmung <strong>der</strong> Schüler steht. Dazu sind<br />
von Seiten des Lehrers sowohl hinsichtlich seiner Ausbildung und auch seiner eigenen<br />
Erwartungshaltung gegenüber seiner Berufsausübung, sozialen Kompetenzen und<br />
komunikativen Fähigkeiten ein höheres Gewicht einzuräumen.<br />
Ein weiterer Schwerpunkt <strong>der</strong> Lehrerforschung wendet sich den Belastungen und <strong>der</strong><br />
Problembewältigung im Beruf zu. Die methodische Zugriffsweise reicht hier von <strong>der</strong><br />
Einstellungsforschung bis hin zu arbeitsphysiologischen Messungen sowie<br />
2 Relevante Stichwörter: Lehrerarbeit, Lehrerzufriedenheit, Lehrerbelastung, Burnout-Syndrom<br />
70
Untersuchungen über die Wirkung von Beratung und Selbsthilfe in Lehrergruppen. Die<br />
Ergebnisse dieser Studien weisen aus, daß das Niveau <strong>der</strong> Belastungen vergleichsweise<br />
hoch ist (vgl. Buchen 1997 (133)). Weitere Untersuchungen thematisieren, daß<br />
Belastungen und Unzufriedenheit im Lehrerberuf die Möglichkeiten <strong>der</strong><br />
Wirksamkeitsevaluation und Qualitätsentwicklung in <strong>der</strong> Schule negativ beeinflussen.<br />
Ein weiteres Ergebnis dieser Studien ist, daß Schulentwicklungsprozesse für die<br />
betroffenen Lehrer einerseits eine größere Belastung bedeuten, daß es an<strong>der</strong>erseits durch<br />
die Erfahrung von neuer Sinnhaftigkeit <strong>der</strong> pädagogischen Arbeit aber auch zu einem<br />
Belastungsausgleich und zu größerer Arbeitszufriedenheit bei den Lehrern kommt (vgl.<br />
Carle/Buchen 1997 (135)).<br />
Wenn Schulqualität auf einer verständnisvollen, einfühlsamen zu den Schülern , in einem<br />
offenen und angstfreien Umgang mit ihnen beruht, dann hat auch die Schulleitung eher<br />
ihre Hauptaufgabe in <strong>der</strong> Herstellung eines pädagogisch gedeihlichen Schulklimas zu<br />
sehen und weniger in <strong>der</strong> reinen Verwaltungstätigkeit. Im Rahmen einer Hinwendung <strong>der</strong><br />
Schulleitung <strong>zum</strong> Unterrichtsprozeß und zur Entwicklung des „Schulklimas“ muß<br />
Schülern Gelegenheit gegeben werden, über die Bedingungen ihrer Lernprozesse<br />
mitzubestimmen und sollten auch Eltern als Erziehungspartner in einem an<strong>der</strong>en Sinne<br />
als bisher verstanden aufgefasst werden.<br />
71
2. 1 Zur Lehrerrolle/ Lehrerarbeit allgemein<br />
� (96)<br />
AUTHOR<br />
Aselmeier, Ulrich; Kron, Friedrich W.; Vogel, Günter (Hrsg.)<br />
TITLE<br />
Die pädagogische Herausfor<strong>der</strong>ung des Lehrers. Beiträge zu einer neuen Lernkultur<br />
SOURCE<br />
Rheinfelden/Berlin (Schäuble)<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1996<br />
DESCRIPTORS<br />
Unterricht; Schulklima, Lernkultur; Lehrerbildung; Lehrerrolle; Sozialkompetenz<br />
ABSTRACT<br />
Der Band enthält verschiedene Aufsätze, die um die Idee kreisen, dass es heute nicht mehr darum geht,<br />
Schule und Unterricht nach Ursache-Wirkung-Verhältnissen zu organisieren, son<strong>der</strong>n darum, Schule und<br />
Unterricht aus pädagogischer Sicht neu zu interpretieren, neue Lernkulturen zu entwickeln. Aus dem Inhalt<br />
im einzelnen: ULRICH STÖHR (Möglichkeiten des Aufbaus von Sozialkompetenz bei Lehrern) vertritt in<br />
seinem Beitrag die Meinung, dass nur ein Aufbau von Sozialkompetenz die Lehrer dazu befähigt, den<br />
Ansprüchen ihres Berufes, die über das Fachliche hinausghen, gerecht werden zu können. GERHARD<br />
VELTHAUS (Der Lehrer im Wi<strong>der</strong>streit <strong>der</strong> Ansprüche) beschreibt die Ansprüche, die an Lehrer in <strong>der</strong><br />
unterrichtlichen Situation herangetragen werden, wobei er die in den Mittelpunkt rückt, die von den<br />
Schülern ausgehen. Die Orientierung am Kind verlange, dass <strong>der</strong> Schüler im Unterricht die Möglichkeit<br />
hat, mit seinen Einfällen und persönlichen Vorstellungen <strong>zum</strong> Vorschein zu kommen und nicht durch<br />
abstrakte Lernzielformulierungen verleugnet werde. Wichtig sei es zu zeigen, dass sie Vertrauen in die<br />
Fähigkeit des Schülers haben. Als Fazit formuliert er, dass „es Schulen gibt, in denen man ein besserer<br />
Lehrer sein kann, weil das Schulklima entsprechend an<strong>der</strong>s ist, Schulen, in denen auch Schüler zu größeren<br />
Erfolgen gelangen, weil sich nachdrücklich vertretene Erziehungsvorstellungen sehr wohl mit <strong>der</strong><br />
intensiven Bemühung um die Einzelperson des Schülers verbinden, so dass dieser sich angenommen fühlt.“<br />
ULRICH ASELMEIER (Der Lehrer aus „Schüler- und unterrichtsorientierter Sicht“) stellt in seinem<br />
(zweiten) Beitrag die große Bedeutung heraus, die dem Lehrer im Unterricht zukommt. Lehrer realisieren<br />
im Unterricht nicht nur mehrere berufliche Aufgaben, sie realisieren diese auch über einer zweiten<br />
indirekten „Tiefebene“. Hier treffen sie die Persönlichkeit des Schülers im beson<strong>der</strong>en Maße. (CP)<br />
� (97)<br />
AUTHOR<br />
Bessoth, Richard<br />
TITLE<br />
Lehrerberatung – Lehrerbeurteilung<br />
SOURCE<br />
Neuwied/Kriftel/Berlin (Luchterhand)<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1994<br />
DESCRIPTORS<br />
Lehrer; Lehrerarbeit; Lehrerberatung; Lehrerbeurteilung; Leistungsbeurteilung; Evaluation; Schulaufsicht,<br />
Schulverwaltung; Qualität; Unterrichtsberatung; Beratungsbedarf; Beratungsmodelle; Schüler,<br />
Schülerbefragung<br />
ABSTRACT<br />
Erschienen in <strong>der</strong> Reihe ‚Praxishilfen Schule‘ versteht sich dieser Band als ein Beitrag zur<br />
Schulverbesserung. Der Aufgabenstellung Lehrerberatung und Lehrerbeurteilung wird in diesem<br />
72
Zusammenhang eine herausragende, aber bisher vernachlässigte Rolle zugeschrieben, wobei davon<br />
ausgegangen wird, dass sich die Zukunft <strong>der</strong> Lehrerevaluation erheblich von <strong>der</strong> <strong>der</strong> Vergangenheit<br />
(Objektivität entbehrende Urteile auf Basis von ein o<strong>der</strong> zwei Unterrichtsbesuchen) unterscheiden muss. In<br />
ersten Teil des Bandes werden die bisher gängigen Methoden und Verfahren <strong>der</strong> Lehrerbeurteilung erörtert<br />
und kritisiert, gleichzeitig wird betont, wie wichtig eine verbesserte Lehrerevaluation als Basis einer<br />
effektiven Lehr-/Unterrichtsberatung ist. Der zweite Teil beschäftigt sich mit Konzepten <strong>der</strong><br />
Lehrerberatung und Beurteilung sowie mit Praxisproblemen und Handlungsmöglichkeiten. Aufgrund einer<br />
empirischen Feststellung des Beratungsdedarfs anhand des Unterrichts-Klima-Modells wird ein großes<br />
Beratungsdefizit an den Schulen konstatiert (Vergleich Beratungsbedarf mit tatsächlichem<br />
Beratungsaufkommen). Dies wird einerseits mit dem Misstrauen <strong>der</strong> Lehrerschaft gegenüber <strong>der</strong><br />
konventionellen Beurteilung/Beratung erklärt, sowie an<strong>der</strong>erseits mit <strong>der</strong> Unsicherheit <strong>der</strong><br />
Schulverwaltung und <strong>der</strong>en Unlust/Inkompetenz, sich <strong>der</strong> anspruchsvollen Beratungsarbeit zu stellen.<br />
Zusammengefasst mündet die Darstellung <strong>der</strong> unterschiedlichen Konzepte <strong>der</strong> Personalbeurteilung in die<br />
dringende For<strong>der</strong>ung, Standards für die Personalevaluation im Schulwesen zu entwickeln. Danach sollte<br />
die Personalbeurteilung vier Eigenschaften besitzen: Nützlichkeit (Konstruktive Orientierung, festgelegter<br />
Gebrauch <strong>der</strong> Beurteilungen, Beurteilerglaubwürdigkeit, funktionelle Berichte, sichergestellte<br />
Konsequenzen) Durchführbarkeit, Rechtmäßigkeit (Dienstleistungsorientierung, Beurteilungsrichtlinien,<br />
Behandlung von Interessenkonflikten, Zugang zu den Berichten, Zusammenarbeit mit den Beurteilten),<br />
Richtigkeit (u. a. Rollendefinition, ausreichende Zahl von Stichproben, valide Messungen, zuverlässige<br />
Messungen). Nur so, zusammen mit weiteren flankierenden Maßnahmen (Qualifizierung etc.), ließe sich<br />
das Klima für die Lehrerbeurteilung grundsätzlich verän<strong>der</strong>n. Abschließend, im dritten Teil des Bandes,<br />
werden Hilfsmittel und Instrumente vorgestellt, um neue Konzepte <strong>der</strong> Beratung/Beurteilung umsetzen zu<br />
können. .Hier wird u. a. auf die Rolle <strong>der</strong> Schüler als Informationsträger eingegangen sowie auf die Art und<br />
Weise, wie Schülerbefragungen sinnvoll in den Aufbau einer neuen Evaluationskultur integriert werden<br />
können. (CP)<br />
� (98)<br />
AUTHOR<br />
Czerwenka, Kurt<br />
TITLE<br />
Lehrer und Schueler unter dem Druck wechselseitiger Erwartungen.<br />
SOURCE<br />
Bildung und Erziehung an <strong>der</strong> Schwelle <strong>zum</strong> dritten Jahrtausend. Muenchen (Pims), S. 906-946<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1994<br />
DESCRIPTORS<br />
Belastung; Einstellung; Gesellschaft; Lehrer; Lehrerrolle; Schule; Schueler; Schueler-Lehrer-Beziehung<br />
ABSTRACTS<br />
Diskutiert werden einerseits Tendenzen veraen<strong>der</strong>ter gesellschaftlicher Anfor<strong>der</strong>ungen an<br />
den Schueler (z. B. neue Erwartungen an seine berufliche Qualifikation; Erwartungen,<br />
dass die Schule am Demokratisierungsprozess <strong>der</strong> Gesellschaft mitwirkt) und die<br />
"Konflikte zwischen <strong>der</strong> Individualitaet des Schuelers und den gesellschaftlichen<br />
Anfor<strong>der</strong>ungen". An<strong>der</strong>erseits werden die veraen<strong>der</strong>ten Ansprueche an den Lehrer und<br />
die daraus resultierenden Belastungen diskutiert. Der Autor kommt zu dem Schluss: "In<br />
<strong>der</strong> Zusammenschau heutiger Schueler- und Lehrersituationen wird deutlich, dass von<br />
einer in <strong>der</strong> Regel harmonischen Lehrer-Schueler-Beziehung nicht ausgegangen werden<br />
kann. Zu haeufig treten Schueleraerger und Lehrerbelastungen nebeneinan<strong>der</strong> auf und<br />
verstaerken wechselseitig die Unlust an <strong>der</strong> Institution Schule." Abschliessend werden<br />
auch "Moeglichkeiten <strong>der</strong> Veraen<strong>der</strong>ung" gezeigt (Fis Bildung)<br />
73
� (99)<br />
AUTHOR<br />
Dannhäuser, Albin<br />
TITLE<br />
Unterrichtsversorgung und Lehrerbedarf, Klassen- und Gruppenbildung im Schuljahr<br />
1996/97. Eingabe des BLLV.<br />
SOURCE<br />
In: Bayerische Schule, 49 (1996) 3, S. 20-22<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1996<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulpolitik; Schulorganisation; Effizienz; Lehrerarbeit; Lehrerbedarf; Klassengroesse;<br />
Schulleistung; Unterrichtsplanung; D-Bayern<br />
ABSTRACT<br />
Aufgrund <strong>der</strong> verschlechterten Rahmenbedingungen für die Klassen- und<br />
Gruppenbildung und hohen beruflichen Belastung <strong>der</strong> Lehrkräfte im Grund-, Haupt- und<br />
För<strong>der</strong>schulbereich im Schuljahr 1995/96 sowie angesichts <strong>der</strong> neuen Aufgaben in den<br />
kommenden Schuljahren werden seitens des Bayerischen Lehrer- und<br />
Lehrerinnenverbandes (BLLV) elf vordringliche For<strong>der</strong>ungen fixiert, die zur<br />
Entspannung und Qualitätssicherung beitragen sollen. Die Anlage <strong>zum</strong> Schreiben des<br />
BLLV enthält Grundsätze für pädagogisch und organisatorisch erfor<strong>der</strong>liche Maßnahmen:<br />
1. Ausweisung des Lehrerbedarfs, 2. Senkung <strong>der</strong> Gruppenstärken in Grund-<br />
und Hauptschulen, 3. dgl. an För<strong>der</strong>schulen, 4. Kleine Klassen, zweisprachige Klassen<br />
und Übergangsklassen, 5. Beson<strong>der</strong>er Lehrerbedarf für den Unterricht mit Kin<strong>der</strong>n von<br />
Auslän<strong>der</strong>n und Aussiedlern, 6. Klassen- und Gruppenbildung unter Berücksichtigung<br />
<strong>der</strong> Rückkehrerquote (Realschulen, Gymnasien, Wirtschaftsschulen), 7. Erhöhung <strong>der</strong><br />
mobilen Lehrerreserve und <strong>der</strong> Aushilfen für Mutterschaftsurlaub. (Fis Bildung nach<br />
DIPF/Ko.)<br />
� (100)<br />
AUTHOR<br />
Eckert, Thomas<br />
TITLE<br />
Analysen <strong>zum</strong> potentiellen Konsens in Lehrerkollegien<br />
SOURCE<br />
In: Stolz, Gerd E.; Schwarz, Bernd (Hrsg.): Schule und Unterricht. Gegenwärtige Herausfor<strong>der</strong>ungen und<br />
Entwicklungsperspektiven. Festschrift <strong>zum</strong> 70. Geburtstag von Kurt Aurin. Frankfurt a. M. u.a., (Peter<br />
Lang).<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1994<br />
DESCRIPTORS<br />
Lehrer; Lehrerarbeit; Gymnasium; Lehrerkollegium; Konsens; symbolischer Interaktionismus<br />
ABSTRACT<br />
74
Der Aufsatz stellt Ergebnisse einer Analyse <strong>zum</strong> pädagogischen Konsens von Lehrern<br />
vor. Die Untersuchung wurde an 5 Gymnasien im baden-württembergischen Raum<br />
durchgeführt, von denen in Anlehnung an das Konzept <strong>der</strong> „multiple-case-study“ für die<br />
Auswertung die zwei ausgewählt wurden, die die größte Ähnlichkeit besaßen. Als<br />
Fundament <strong>der</strong> Analyse wurde die Theorie des Symbolischen Interaktionismus mit den<br />
vier Grundqualifikatinen: Empathie, Reflexionsdistanz, Spannungstoleranz, kommunikative<br />
Kompetenz herangezogen. Die Ergebnisse zeigen, dass an beiden Schulen eine Basis<br />
für die Entstehung von Konsens im Sinne reflexiver Koorientierung vorhanden ist. Als<br />
praktische Konsequenz ergibt sich nach Meinung des Autors die Empfehlung, Unterschiede<br />
zwischen Lehrern so weit wie möglich zuzulassen und sie als Antrieb für<br />
positive Verän<strong>der</strong>ungen zu nutzen. (CP)<br />
� (101)<br />
AUTHOR<br />
Flaake, Karin<br />
TITLE<br />
Berufliche Orientierungen von Lehrerinnen und Lehrern. Eine empirische Untersuchung.<br />
SOURCE<br />
Frankfurt, Main u.a. (Campus), 436 S.<br />
REIHE<br />
Forschungsberichte des Instituts fuer Sozialforschung Frankfurt<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1989<br />
DESCRIPTORS<br />
Untersuchung; Lehrer; Lehrerarbeit; Berufsproblem; Frau; Frauenarbeit; Geschlechterrolle; Berufswahl;<br />
Arbeitssituation; Berufszufriedenheit; Freizeit; Lebensplanung; Arbeitszeitverkuerzung; Berufliche<br />
Identitaet<br />
ABSTRACT<br />
Forschungsmethode: empirisch, rollentheoretisch, biographische Methode, Interview,<br />
qualitatives Interview, Life-Event-Analyse. "Im Mittelpunkt <strong>der</strong> Untersuchung steht die<br />
Bedeutung geschlechtsspezifischer Muster von Identitaet fuer die Arbeit in <strong>der</strong> Schule,<br />
die bei Lehrerinnen und Lehrern unterschiedliche Ausgestaltung beruflicher<br />
Anfor<strong>der</strong>ungen, die Differenzen in <strong>der</strong> subjektiven Bedeutung des Berufs, die<br />
Konstellationen im schulischen und ausserschulischen Alltag, in denen sich traditionelle<br />
Geschlechterarrangements wie<strong>der</strong>holen. Die Darstellung <strong>der</strong> Untersuchungsergebnisse<br />
orientiert sich zunaechst am Verlauf von berufsbiographischen Entwicklungen.<br />
Beschrieben werden die Wege <strong>zum</strong> Beruf, die ersten Erfahrungen in <strong>der</strong> Lehrtaetigkeit<br />
und die Wahrnehmung <strong>der</strong> aktuellen Berufs- und Arbeitssituation. Daran anschliessend<br />
ist die Bedeutung des Berufs im Lebenszusammenhang <strong>Thema</strong>: die Vereinbarkeit von<br />
Partnerschaft, Kin<strong>der</strong>n und beruflicher Arbeit, die Attraktivitaet an<strong>der</strong>er als um<br />
berufliche Arbeit zentrierter Formen <strong>der</strong> Lebensgestaltung, die Prioritaeten bei einer Arbeitszeitverkuerzung<br />
und die Gewichtung von Beruflichem und Nichtberuflichem in <strong>der</strong><br />
bisherigen sowie <strong>der</strong> aktuellen Lebensgestaltung. Dann erfolgt eine Zwischenbilanz, in<br />
<strong>der</strong> die wichtigsten Ergebnisse <strong>zum</strong> Verhaeltnis von Lehrerinnen und Lehrern zu ihrem<br />
Beruf - den unterschiedlichen Ausgestaltungen beruflicher Anfor<strong>der</strong>ungen und <strong>der</strong> Bedeutung<br />
des Berufs im Lebenszusammenhang - zusammenfassend dargestellt werden.<br />
Aussagen zu geschlechtsspezifischen Umgehensweisen mit schulischer Realitaet und<br />
75
eruflicher Arbeit werden durch die Ergebnisse <strong>der</strong> hermeneutischen Interpretation<br />
zweier Interviews - mit einem Lehrer und einer Lehrerin - vertieft. Ergebnisse <strong>der</strong> Studie<br />
insbeson<strong>der</strong>e im Zusammenhang mit psychoanalytisch orientierten Ansaetzen zu geschlechtsspezifischen<br />
Entwicklungsverlaeufen und Mustern von Identitaet werden zu<br />
interpretieren versucht." (Fis Bildung/Autorenreferat).<br />
� (102)<br />
AUTHOR<br />
Flaake, Karin<br />
TITLE<br />
Grenzenlose Wuensche - Beschraenkte Moeglichkeiten. Lehrerinnen und Entlastungsmoeglichkeiten.<br />
SOURCE<br />
In: Pädagogik, 42 (1990) 10, S. 34-37<br />
DESCRIPTORS<br />
Sachinformation; Lehrer; Lehrerarbeit, Verhalten; Geschlechtsunterschied; Belastung; Schueler-Lehrer-<br />
Beziehung; Lehrerin; Selbstbewusstsein; Supervision; Entlastungsstunde<br />
ABSTRACT<br />
Als Ergebnis eines Forschungsprojektes ueber das unterschiedliche Verhaeltnis von<br />
Lehrerinnen und Lehrern zu ihrem Beruf, das eine geschlechtsspezifische Differenzierung<br />
<strong>der</strong> Lehrerrolle - im Gegensatz zur ueblichen Praxis in <strong>der</strong> Literatur - noetig<br />
erscheinen laesst, werden als weiblich anzusehende Eigenschaften herausgearbeitet und<br />
in ihrer Konsequenz fuer Lehrerverhalten und Schulalltag beleuchtet. Als beson<strong>der</strong>s<br />
charakteristisch erscheinen u. a. Empathie und Beziehungsfaehigkeit, die eine auf<br />
persoenlichem Engagement und emotionaler Beteiligung beruhende Arbeitsweise nach<br />
sich ziehen. Es wird gezeigt, inwiefern diese Verhaltensweisen zu einer<br />
frauenspezifischen Belastung im Lehrerberuf fuehren. Als Loesungsansatz wird <strong>der</strong><br />
Erfahrungsaustausch in Diskussions-, Reflexions- o<strong>der</strong> auch Supervisionsgruppen<br />
genannt, da hierdurch Schwierigkeiten als berufs- und geschlechtsspezifische<br />
Konstellationen aufgedeckt werden koennen. (fis Bildung)<br />
� (103)<br />
AUTHOR<br />
Henke, Robin R.; and others<br />
TITLE<br />
America's Teachers: Profile of a Profession, 1993-94.<br />
SOURCE<br />
Berkeley, CA (MPR Associates).<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1997<br />
DESCRIPTORS<br />
Compensation (Remuneration); Educational Environment; Elementary Secondary Education; Faculty<br />
Workload; *Job Satisfaction; Preservice Teacher Education; Tables (Data); *Teacher Characteristics;<br />
Teaching; Teacher Salaries; *Teacher Supply and Demand; *Teachers; *Teaching Conditions; Teaching<br />
Methods<br />
ABSTRACT<br />
76
This report presents national data on teachers and teaching from the Schools and Staffing<br />
Survey (SASS) and other sources. Where data permit, the report compares findings from<br />
the early to mid-1990s with findings from the 1980s. The report addresses a wide range<br />
of topics related to teachers and teaching, including teachers' demographic characteristics<br />
and various characteristics of their schools and students, teachers' preparation and<br />
professional development experiences, teachers' workloads, teaching practices,<br />
compensation, perceptions of work environments and job satisfaction, and the supply and<br />
demand of teachers. Detailed tables, standard error tables, and technical notes are<br />
included in appendices. (Contains 108 references.) (ERIC/ND)<br />
� (104)<br />
Hurrelmann, Klaus<br />
TITLE<br />
Wie kann die Schule auf die veraen<strong>der</strong>ten Lebensbedingungen von Kin<strong>der</strong>n und Jugendlichen reagieren?<br />
SOURCE<br />
In: Grundschule, 23 (1991) 12, S. 51-54<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1991<br />
DESCRIPTORS<br />
Sachinformation; Schule; Qualitaet; Organisationssoziologie; Schulreform; Schulwesen; Bildungsplanung;<br />
Verbesserung; Schulleitung; Soziale Rolle; Lehrer; Lehrerarbeit, Lehrerrolle; Berufsanfor<strong>der</strong>ung<br />
ABSTRACT<br />
Der Autor for<strong>der</strong>t guenstige Arbeitsvoraussetzungen fuer Lehrer, um den zunehmenden<br />
Belastungen und dem "burn- out"-Syndrom vorzubeugen und die noetige Foer<strong>der</strong>ung<br />
fuer Schueler zu gewaehrleisten. Er formuliert fuenf Thesen zur Charakterisierung einer<br />
"guten" Schule. Eine wichtige Voraussetzung hierfuer ist die Freiheit im fachlichen<br />
Bereich, die ihre Grenzen und ihren Spielraum im kollegialen, fachlichen,<br />
paedagogischen und didaktischen Miteinan<strong>der</strong> findet. Eine zentrale Rolle wird hierbei<br />
dem Schulleiter/<strong>der</strong> Schulleiterin zugesprochen. Im folgenden gibt <strong>der</strong> Autor konkrete<br />
paedagogische Vorschlaege zur Erreichung eines Schulprofils, arbeitet Merkmale einer<br />
guten Unterrichtsgestaltung hersus und for<strong>der</strong>t ein gutes Beratungssystem, intensivere<br />
Kontakte zu ausserschulischen Einrichtungen, "Oeffnung" <strong>der</strong> Schule, Ganztagsangebot<br />
sowie Massnahmen <strong>der</strong> "aeusseren Schulreform" zur Angleichung <strong>der</strong> Bildungschancen.<br />
(Fis Bildung nach DIPF)<br />
� (105)<br />
AUTHOR<br />
Ipfling, Heinz-Juergen<br />
TITLE<br />
"Trotz schwieriger Schulsituation vom Lehrerberuf ueberzeugt".<br />
SOURCE<br />
In: Bayerische Schule, 47 (1994) 9, S. 5-8<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1994<br />
77
DESCRIPTORS<br />
Lehrer; Lehrerrolle; Lehrerarbeit, Schueler; Verhalten; Schulreform; Schulpolitik;<br />
Lehrerfortbildung; Befragung; Statistische Angaben<br />
ABSTRACT<br />
Es wird ueber die Ergebnisse einer Umfrage unter Lehrern berichtet zu folgenden<br />
Problemen: - zu Schulpolitik - zu Schulreform - zu ihrer eigenen Persoenlichkeit und<br />
ihrer beruflichen Taetigkeit - zu den Schuelern - zu den Eltern - zu ihrer eigenen<br />
Berufsentscheidung. (Fis Bildung nach DIPF/Sch.)<br />
� (106)<br />
AUTHOR<br />
Jehle, Peter<br />
TITLE<br />
Vorzeitige Pensionierung von Lehrerinnen und Lehrern – Eine Analyse amtlicher<br />
Materialien aus den alten Bundeslän<strong>der</strong>n<br />
SOURCE<br />
Frankuft a.M. (Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung)<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1996<br />
DESCRIPTORS<br />
Lehrer, Lehrerarbeit, Pensionierung, Pensionierungsgründe, Dienstunfähigkeit,<br />
Krankheit, Bundeslän<strong>der</strong>, statistische Daten<br />
ABSTRACT<br />
Der Band untersucht die drei Arten <strong>der</strong> Pensionierung (Erreichen <strong>der</strong> gesetzlichen<br />
Altersgrenze, Pensionierung auf Antrag, Dienst-, Erwerbs-und Berufsunfähigkeit) von<br />
Lehrkräften. Die Basis bildeten Daten des Statistischen Bundesamtes über 10 Bundeslän<strong>der</strong>.<br />
Der Autor stellt aufgrund <strong>der</strong> Befunde einen Trend zu vermehrter vorzeitiger<br />
Pensionierung wegen Dienstunfähigkeit in den meisten Bundeslän<strong>der</strong>n fest, <strong>der</strong> jedoch,<br />
wie er einschränkt, nicht so ausgeprägt ist wie es die <strong>zum</strong> Teil heftig geführte Diskussion<br />
in <strong>der</strong> Öffentlichkeit hätte vermuten lassen. Diesem Anstieg steht ein Rückgang <strong>der</strong><br />
an<strong>der</strong>en beiden Pensionierungsgründe entgegen (10% in den letzten 10 Jahren). Insgesamt<br />
sind die deutlichsten Unterschiede in den Anteilen <strong>der</strong> Pensionierungen von Lehrkräften<br />
in Verbindung mit dem Geschlecht festzustellen. Die Anteile <strong>der</strong> Zurruhesetzung<br />
wegen Dienstunfähigkeit ist bei Lehrerinnen höher als bei Lehrern. Das durchschnittliche<br />
Pensionierungsalter <strong>der</strong> Lehreinnen ist niedriger als das <strong>der</strong> männlichen Kollegen. (CP)<br />
78
� (107)<br />
AUTHOR<br />
Lissmann, Hans-Joachim; Gigerich, Ralf<br />
TITLE<br />
A Changed School and Educational Culture: Job Orientation and Teacher Satisfaction at<br />
Gesamtschulen in the State of Hessen, West Germany--Some International Comparisons.<br />
JOURNAL_CITATION (SOURCE)<br />
Comparative Education; v26 n2-3 p277-81 1990<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1990<br />
DESCRIPTORS<br />
Classroom Techniques; Comparative Education; Educational Change; *Educational<br />
Policy; Foreign Countries; Secondary Education; *Secondary School Teachers; *Teacher<br />
Attitudes; *Teaching Conditions; *Work Attitudes<br />
ABSTRACT<br />
Reports survey findings from 693 Hessian secondary teachers on job satisfaction and<br />
other work attitudes and their relationships to teaching conditions, classroom practices,<br />
and government educational policies. Compares results to U.S. and U.K. findings.<br />
Interprets results in light of the 1970s' failed educational reforms and consequent policy<br />
backlash. (eric/SV)<br />
� (108)<br />
AUTHOR<br />
Miller, Reinhold<br />
TITLE<br />
Die Aelteren sind gefragt. Vom Umgang mit Lebens- und Berufserfahrung in <strong>der</strong> Schule<br />
- Zehn Akzentverschiebungen. (Dealing with life experiences and job experiences at<br />
school - Ten shifts in emphasis)<br />
SOURCE<br />
Paedagogik, 46 (1994) 2, S. 31-34<br />
Ministerium fuer Kultus und Sport, Stuttgart, Germany; Referat Lehrerfortbildung<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1994<br />
DESCRIPTORS<br />
Teaching; Teachers-; *Professional-Development; *Job-Experience-Level;<br />
Occupational-Stress; Stress-Management; Teacher-Characteristics; Teacher-Attitudes.<br />
(Lehrerarbeit; Lehrer-; *Berufliche-Entwicklung-akademische-Berufe;<br />
*Berufserfahrung-; Beruflicher-Stress; Stressverarbeitung-; Lehrermerkmale-;<br />
Lehrereinstellungen)<br />
ABSTRACTS<br />
Anhand von zehn Akzentverschiebungen wird die berufliche Entwicklung von Lehrern<br />
unter <strong>der</strong> Perspektive des Erwerbs von Ressourcen <strong>zum</strong> Umgang mit Berufsmuedigkeit<br />
und Resignation beschrieben. Im einzelnen werden folgende Veraen<strong>der</strong>ungen skizziert:<br />
79
(1) vom Ideenreichtum <strong>zum</strong> Erfahrungsschatz; (2) von <strong>der</strong> Unsicherheit zur Sicherheit;<br />
(3) vom Unmoeglichen <strong>zum</strong> Moeglichen; (4) vom Presto <strong>zum</strong> Mo<strong>der</strong>ato; (5) von <strong>der</strong><br />
Konfrontation zur Kooperation; (6) vom Ziehen <strong>zum</strong> Fuehren; (7) von <strong>der</strong> Belehrung zur<br />
Lernhilfe; (8) von <strong>der</strong> Bewertung zur Beschreibung; (9) von <strong>der</strong> Ueberfor<strong>der</strong>ung zur<br />
Abgrenzung; (10) von <strong>der</strong> Abhaengigkeit zur Selbstaendigkeit. (Andreas Gerards -<br />
ZPID). KP: teachers' acquisition of resources for coping with burnout & resignation<br />
during professional development; 10 shifts in emphasis based on job experience & life<br />
experience.(psyndexplus)<br />
� (109)<br />
AUTHOR<br />
Randoll, Dirk<br />
TITLE<br />
Schule im Urteil von Lehrern. Ergebnisse einer Befragung von Oberstufenlehrern aus<br />
vier alten und einem neuen Bundesland zu ihrer Wahrnehmung von Schule.<br />
SOURCE<br />
Göttingen (Hogrefe)<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1995<br />
DESCRIPTORS<br />
Befragung; Einstellung; Gymnasium; Lehrer; Schule; Lehrerarbeit, Selbsteinschaetzung;<br />
Lehrerrolle; Persoenlichkeitsbildung; Soziales Lernen; Deutschland; Deutschland-<br />
Oestliche Laen<strong>der</strong>; D-Hamburg; D-Hessen; D-Rheinland-Pfalz; D-Saarland; D-<br />
Thueringen<br />
ABSTRACT<br />
Die Autoren hatten schon mit einer Fragebogenuntersuchung die Meinung <strong>der</strong> Schüler<br />
über die Schule erkundet (Graudenz / Randoll: Schule im Urteil von Abiturienten,<br />
Frankfurt a.M., DIPF 1992). "Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich vorwiegend mit <strong>der</strong><br />
Wahrnehmung und Beurteilung <strong>der</strong> Schule durch die Lehrenden, das heisst mit ihrer<br />
Sichtweise von Schule und mit ihrer Meinung über Schüler sowie mit <strong>der</strong> Einschätzung<br />
<strong>der</strong> eigenen pädagogischen Arbeit, <strong>der</strong> Rolle als Erziehen<strong>der</strong> bzw. <strong>der</strong> Funktion als<br />
Lehrer." Der in <strong>der</strong> Schülerbefragung verwendete Fragebogen wurde wie<strong>der</strong> verwendet,<br />
dieselben Inhalte thematisiert, aber die Fragen sprachlich an die Bedingungen des<br />
Lehrerberufs angepasst. "Die Befunde geben wichtige Hinweise darauf, was Schule nach<br />
Meinung <strong>der</strong> Lehrer über die reine Wissensvermittlung hinaus für die Orientierung und<br />
Persönlichkeitsentwicklung <strong>der</strong> Jugendlichen leistet, in welchem Verhältnis schulische<br />
Wissensvermittlung und <strong>der</strong> Leistungsanspruch von Schule zu emotionalen und sozialen<br />
Erfahrungen <strong>der</strong> Schüler und zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit stehen und was<br />
Schule dazu beiträgt, soziale Fähigkeiten <strong>der</strong> Schüler zu för<strong>der</strong>n und die Schüler als<br />
Einzelpersonen zu würdigen, nicht zuletzt ihr Selbstwertgefühl und ihr Selbstvertrauen<br />
zu stärken." (Fis Bildung nach DIPF/Text übernommen/Umschlagtext)<br />
80
� (110)<br />
AUTHOR<br />
Schellhase, Rolf (Hrsg.) u.a<br />
TITLE<br />
Die Lehrerfortbildung neu denken. Soziologische Ausflüge: Festschrift für Hans Jürgen<br />
Krysmanski <strong>zum</strong> 60. Geburtstag<br />
SOURCE<br />
Opladen (Westdt. Verl.) S. 276-283<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1997<br />
DESCRIPTORS<br />
Berufliche Weiterbildung; Lehrer; Lehrerarbeit; Lehrerrolle; Schule; Unterricht ;<br />
Organisation ; Didaktik; sozialer Wandel; Aktionsforschung; Handlungsorientierung;<br />
Forschungsergebnis; Schulentwicklung; Nordrhein-Westfalen; Bundesrepublik<br />
Deutschland<br />
ABSTRACT<br />
Der Autor weist auf die grosse Bedeutung <strong>der</strong> Lehrerfortbildung hin, da die sich rasch<br />
verän<strong>der</strong>nden fachlichen und sozialen Bedingungen neue Herausfor<strong>der</strong>ungen an die<br />
berufliche Qualifikation von Lehrern stellen. Um die inhaltlichen Schwerpunkte und<br />
Methoden einer verbesserten Lehrerfortbildung naeher bestimmen zu koennen, wurde<br />
1988/89 eine repräsentative Erhebung an 254 Schulen in Nordrhein-Westfalen durchgeführt.<br />
Der Autor stellt im folgenden einige Ergebnisse vor, die sich auf spezifische<br />
Probleme <strong>der</strong> Unterrichtsgestaltung, die allgemeinen Belastungen von Lehrerinnen und<br />
Lehrer sowie auf beson<strong>der</strong>e Fortbildungsinteressen beziehen. Insgesamt sollte die<br />
schulische Aktionsforschung und die Beteiligung von Lehrern an Inhalt und Gestaltung<br />
von Fortbildungsprogrammen stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. (DB Solis/ICI)<br />
� (111)<br />
AUTHOR<br />
Singer, Kurt<br />
TITLE<br />
Resignieren - o<strong>der</strong> Lebenswuensche aktivieren? Im paedagogischen Alltag das Selbstbild<br />
bewahren. (Resignation or activation of life goals? Maintaining one's self-concept in the<br />
everyday life of teachers)<br />
SOURCE<br />
Aus: Meyer Ernst: Burnout und Stress. Praxismodelle zur Bewaeltigung. (Schnei<strong>der</strong>-<br />
Verlag Hohengehren), Seiten 45-59<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1991<br />
DESCRIPTORS<br />
Occupational-Stress; *Stress-Management; *Teachers-; Coping-Behavior; Stress-<br />
Reactions; School-Environment; Teaching; Teacher-Personality; Professional-Identity.<br />
(Beruflicher-Stress; Stressverarbeitung-; *Lehrer-; Bewaeltigungsverhalten-;<br />
Stressreaktionen-; Schulumwelt-; Lehrerarbeit; Lehrerpersoenlichkeit-; Lehrerarbeit;<br />
81
Berufliche-Identitaet<br />
ABSTRACTS<br />
Es wird eroertert, wie Lehrer im paedagogischen Alltag ihr Selbstbild bewahren und ein<br />
Resignieren vor dem Berufsalltag verhin<strong>der</strong>n koennen. Dabei werden folgende Aspekte<br />
und Handlungsmoeglichkeiten besprochen: (1) Analyse <strong>der</strong> Resignationsursachen, (2)<br />
sich mit den persoenlichen Wuenschen zu erkennen geben, (3) <strong>der</strong> Angst vor dem Wi<strong>der</strong>spruch<br />
entgegenwirken, (4) mit <strong>der</strong> Ich-Identitaet aus den Machtstrukturen heraustreten,<br />
(5) positives Umgehen mit Disziplinproblemen, (6) Wachhalten des Interesses am<br />
eigenen Lernen, (7) Aufrechterhaltung des eigenen Gewissens und Begrenzung des<br />
Autoritaetsgehorsams, (8) sich als ganze Person mit eigenen Ueberzeugungen<br />
praesentieren, (9) das Gefuehl <strong>der</strong> Fruchtlosigkeit ueberwinden, sowie (10) dem<br />
begruendeten Pessimismus mit praktischem Optimismus begegnen. (psyndex /Rainer<br />
Neppl - ZPID).<br />
2. 1. 1 Rolle und Arbeit des Schulleiters<br />
� (112)<br />
AUTHOR<br />
Rosenbusch, Heinz S.<br />
TITLE<br />
Von einer demokratischen zu einer pädagogischen Schulaufsicht.<br />
SOURCE<br />
Schulverwaltung. Ausgabe Bayern, 19 (1996) 2, S. 65-71<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1996<br />
DESCRIPTORS<br />
Organisationspsychologie; Schule; Reform; Schulleitung; Schulaufsicht;<br />
Schulverwaltung; Deutschland-BRD<br />
ABSTRACT<br />
Nach einer Diskussion <strong>der</strong> bisher in Deutschland eingeleiteten Reformen von Schule und<br />
Schulaufsicht stellt <strong>der</strong> Autor fest, daß "die Handlungsweise von Schulaufsicht ebenso<br />
wie die <strong>der</strong> Schulleitung an pädagogischen Maximen zu orientieren" ist, da die<br />
Organisation von Schulaufsicht und -leitung "erzieherisch bedeutsame Wirklichkeit darstellellt."<br />
Es werden dann sieben "organisationspsychologische Aspekte" diskutiert, die<br />
auf das Führungspersonal in <strong>der</strong> Schulverwaltung angewandt werden müssen.<br />
Abschließend werden vier Modelle für eine "sorgfältige Rekrutierung und Qualifikation<br />
pädagogischen Führungspersonals als wichtigste Voraussetzung für das Gelingen von<br />
Reformvorhaben" vorgestellt. (Fis Bildung nach DIPF/Bi.)<br />
82
� (113)<br />
AUTHOR<br />
Rosenbusch, Heinz S.<br />
TITLE<br />
Konsolidierungsprozess eines eigenen Berufsbildes - Perspektiven für Schulleitung und Schulaufsicht.<br />
SOURCE<br />
Pädagogische Führung, (1997) 1, Beihefter "Schulleitung in Hessen", S. 6-9<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1997<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulleitung; Schulpolitik; Schulverwaltung; Schulaufsicht; Schulgeschichte; Deutschland<br />
ABSTRACT<br />
Nach einem kurzen Blick in die Geschichte zeigt <strong>der</strong> Autor, warum Schulleitungen dreifach<br />
vernachlässigt sind - in Politik, Öffentlichkeit und in <strong>der</strong> wissenschaftlichen<br />
Pädagogik. Sodann diskutiert er, welche Position Schulleiterinnen und Schulleiter<br />
innerhalb <strong>der</strong> Organisation von Schule einnehmen und endet mit <strong>der</strong> Feststellung: "Die<br />
wichtigsten Steuerleute im Bereich von Schule sind nicht Beamte <strong>der</strong> Schulaufsicht,<br />
son<strong>der</strong>n Schulleiterinnen und Schulleiter". (Fis Bildung nach DIPF/Mar.)<br />
� (114)<br />
AUTHOR<br />
Rosenbusch, Heinz S.; Schlemmer, Elisabeth<br />
TITLE<br />
Die Rolle <strong>der</strong> Schulaufsicht bei <strong>der</strong> pädagogischen Entwicklung von Einzelschulen.<br />
SOURCE<br />
Schul-Management, 28 (1997) 6, S. 9-17<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1997<br />
DESCRIPTORS<br />
Schule; Entwicklung; Schulentwicklung; Schulleitung; Schulaufsicht; Kooperation;<br />
Reform; Projekt; Baden-Wuerttemberg; Nordrhein-Westfalen; Bremen; Bayern<br />
ABSTRACT<br />
Ergebnisse <strong>der</strong> Projekte in den einzelnen Bundeslän<strong>der</strong>n sind ein höheres Maß an gegenseitiger<br />
Akzeptanz, Anregung von Schulentwicklungen mit wechselseitigen Lernprozessen<br />
durch Erfahrungsaustausch, was zu einer neuen Sicht von Schule als<br />
pädagogischer Handlungseinheit führte. (Fis Bildung/LSW).<br />
� (115)<br />
AUTHOR<br />
Storath, Roland<br />
TITLE<br />
Praxisschock bei Schulleitern. Eine Untersuchung zur Rollenfindung neu ernannter<br />
Schulleiter<br />
83
SOURCE<br />
Neuwied/Krieftel/Berlin (Luchterhand)<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1995<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulentwicklung; Autonomie; Schulleitung; Lehrerrolle; Schulleiter-Lehrer-Beziehung;<br />
Evaluation; Berufszufriedenheit; Belastung; empirische Forschung; Qualizifizierung;<br />
Rollenanalyse<br />
ABSTRACT<br />
Der Autor for<strong>der</strong>t in seinen einleitenden Gedanken eine sich eingenständig verän<strong>der</strong>nde<br />
Schule, die auch eine Neu-Orientierung bezüglich des schulischen Selbstverständnisses<br />
als „teil-autonome“ Institution anstrebt. Die sich vor Ort ergebenden Probleme seien<br />
nicht zentralistisch lösbar, son<strong>der</strong>n bedürften größerer Handlungspielräume und <strong>der</strong> vermehrten<br />
Delegation von Verantwortung an Schulleitung und Lehrer. Damit wandelt sich<br />
die Funktion des Schulleiters. Über die administrative Funktion hinaus nimmt er eine<br />
wesentliche pädagogische Rolle ein bezüglich <strong>der</strong> Umsetzung, Unterstützung und<br />
Evaluation innovativer Prozesse. Angesichts <strong>der</strong> Schlüsselrolle des Schulleiters im Anpassungsprozess<br />
<strong>der</strong> Schule an neue Herausfor<strong>der</strong>ungen und eine neue, gewandelte<br />
Schülergenaration stellt sich die Frage, inwieweit Rekrutierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen<br />
noch adequat sind. Die Erörterung <strong>der</strong> Arbeitsfel<strong>der</strong> von Lehrern und<br />
Schulleitern ergibt u.a. für Lehrer, dass die durch Rollenanalysen (Rollenanalyse nach<br />
Phillip; Rolff (1990): teaching as a lonely profession; ambivalenter sozialer Status;<br />
unklare Kompetenz; keine Routine) sichtbar werdende Überlastung ein Grund für den<br />
Wi<strong>der</strong>stand gegen Innovationen ist. Zitiert wird in diesem Zusammenhang die Rangreihe<br />
<strong>der</strong> Begründungen von Berufsunzufriedenheit bei Lehrern nach Peez (1991), nach <strong>der</strong><br />
das Verhalten <strong>der</strong> Schulaufsicht die Zufriedenheit wesentlich beeinflusst. Die Belastung<br />
von Schulleitern folgt vor allem aus <strong>der</strong> breiten Aufgabenpalette, dem hohen Anteil an<br />
Organisations- und Verwaltungsaufgaben und dem Rollenkonflikt, dem ein Schulleiter<br />
ausgesetzt ist (zwischen Schulaufsicht, den Eltern, den Schülern und dem<br />
Lehrerkollegium). Problematisch im Sinne <strong>der</strong> Bewätigung <strong>der</strong> Aufgaben ist zudem, dass<br />
potentielle Schulleiter vor ihrer Ernennung keine Möglichkeit haben, sich mit ihrem<br />
neuen Arbeitsfeld im Vorfeld auseinan<strong>der</strong>zusetzen. Dies führt den Autor zur zentralen<br />
Fragestellung <strong>der</strong> Untersuchung: die Beschreibung des Rollenwechsels vom Lehrer <strong>zum</strong><br />
Schulleiter und <strong>der</strong> (mittelbaren) Analyse, inwieweit die Ergebnisse für einen Praxisschock<br />
sprechen. Die Darlegung <strong>der</strong> Befunde <strong>der</strong> empirischen Erhebung (Fragebogen<br />
und Interwievs) spricht für Frustrationen bei Eintritt in die Praxis, für Unsicherheit, hohe<br />
Belastung und Ärger, jedoch nicht für einen Praxisschock im engen Sinne. Der letzte Teil<br />
des Bandes befasst sich mit den Konsequenzen, die aus den Befunden zu ziehen sind. Es<br />
werden Maßnahmen im Vorfeld <strong>der</strong> Ernennung, zur Rekrutierung und Qualifizierung<br />
diskutiert. (CP)<br />
� (116)<br />
AUTHOR<br />
Wenzel, Klaus; Ipfling, Heinz-Jürgen<br />
TITLE<br />
Schule - Schulaufsicht - dienstliche Beurteilung.<br />
SOURCE<br />
In: Bayerische Schule, 49 (1996) 1, S. 13<br />
84
PUBLICATION YEAR<br />
1996<br />
DESCRIPTORS<br />
Schule; Schulaufsicht; Beurteilung; Schulleiter; Lehrer; Lehrerrolle; Befragung; Empirische<br />
Untersuchung; Bayern<br />
ABSTRACT<br />
Im Beitrag werden Ergebnisse von Lehrer- und Schulleiterbefragungen zu Schule, zur<br />
Schulaufsicht und zur dienstlichen Beurteilung dargestellt (einschließlich Fragestellungen).<br />
(Fis Bildung nach DIPF/Sch.).<br />
� (117)<br />
AUTHOR<br />
Wirries, Ingeborg<br />
TITLE<br />
Schulleiter und Stress.<br />
SOURCE<br />
In: Schul-Management, 24 (1993) 6, S. 16-20<br />
PUBLICATION YEAR<br />
1993<br />
DESCRIPTORS<br />
Schulleitung; Schulleiter; Belastung; Stress; Schulklima<br />
ABSTRACT<br />
Behandelt werden Fragen wie: Stress bei Fuehrungskraeften - Ausloeser und Folgen;<br />
Stress und seine ambivalente Wirkung; Einstellung zu den stressausloesenden Faktoren;<br />
Stress in <strong>der</strong> Schule (u. a. mit Abb. zu Folgen fuer den einzelnen und <strong>der</strong>en Auswirkungen<br />
auf Leistungsvermoegen, soziales Klima und Effektivitaet von<br />
Organisationen); Gegenmassnahmen. (Fis Bildung nach DIPF/Ko.)<br />
85