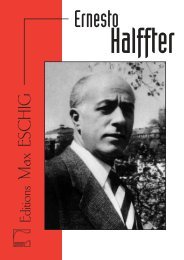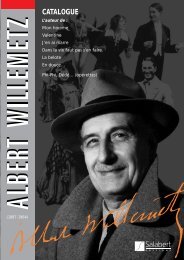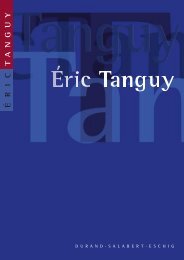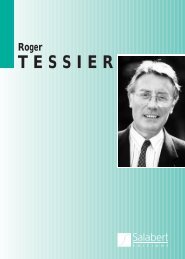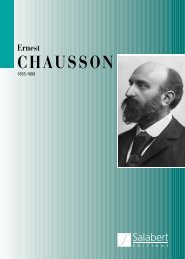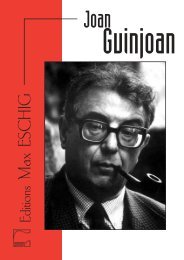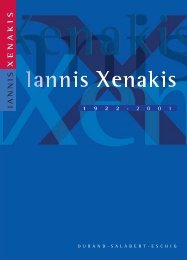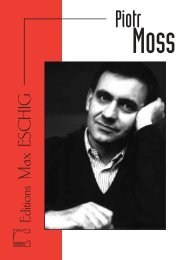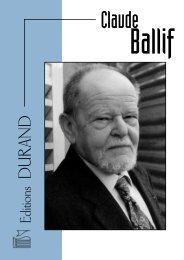Arthur Honegger - durand-salabert-eschig
Arthur Honegger - durand-salabert-eschig
Arthur Honegger - durand-salabert-eschig
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Prélude, Fugue,<br />
Postlude<br />
von Amphion<br />
(1948)<br />
Gemäß dem gewählten Thema und der Persönlichkeit seines<br />
Autors ist Amphion, die erste Zusammenarbeit von <strong>Honegger</strong><br />
mit Paul Valéry (Sémiramis wird die zweite und letzte sein),<br />
eine Partitur, die sich einer weitaus klassischeren, aber<br />
keinesfalls schwächeren Sprache bedient. Man müßte eines<br />
Tages die komplette Partitur wiederentdecken, die 1929 für<br />
Ida Rubinstein komponiert wurde. Sie verkörperte am 23.<br />
Juni 1932 die Titelrolle in der Pariser Oper: vierzig Minuten<br />
Musik für Sprecher, Solo Bariton, Solosänger, Chor und<br />
Orchester, die die gemeinsame Schöpfung von Musik und<br />
Baukunst durch Amphion nachzeichnen, zum Klang der<br />
Leier, die ihr Apollo übergeben hat.<br />
Ich möchte hier die Aufmerksamkeit auf den Triptychon für<br />
Orchester richten, den <strong>Honegger</strong> weitaus später, im Jahre<br />
1948, aus den drei letzten Szenen geschaffen hat und den<br />
er Prélude, Fugue, Postlude betitelte. Es handelt sich um<br />
eines seiner schönsten symphonischen Werke, ideal für die<br />
Eröffnung eines Konzerts und dennoch ist dieses nur ein<br />
zwei Mal (im Jahren 1952 und 1991) eingespielte Werk<br />
nie zu hören.<br />
Die Tonsprache ist hier tonal, doch mit einer modulierenden<br />
Bewegung, die ihresgleichen sucht und die die Dominanten<br />
mit Leichtigkeit und Frische verkettet. Das Präludium ist<br />
in zwei Teile geteilt: der erste Teil ist langsam, die großen<br />
«siderischen» Akkorde des Beginns weichen bald einer<br />
langen und ausdrucksvollen vom Saxophon vorgetragenen<br />
Melodie, der zweite Teil ist in der Art einer Toccata<br />
geschrieben, unaufhörlich von einfachen Tonleitern in<br />
verschiedenen Geschwindigkeiten variierter Kontrapunkt<br />
(die Schöpfung der Musik) und bald von der strahlenden<br />
Rückkehr der großen Melodie vom Beginn gekrönt. Ohne<br />
Unterbrechung fügt sich die Fuge an (die Schöpfung der<br />
Baukunst, bei der sich die Steine auf den Ruf der Musik<br />
ineinanderfügen), eine der mächtigsten und gelehrtesten<br />
der gesamten symphonischen Literatur, die den Vergleich<br />
mit derjenigen des Finales der Fünften Symphonie von<br />
Bruckner, an die sie gelegentlich erinnert, nicht zu scheuen<br />
braucht. Dem kraftvollen sieben Takte umfassenden und in<br />
große Intervallsprünge zerhackten Thema fügen sich zwei<br />
wundervoll melodiös abgerundete Gegenthemen an, die in<br />
der Folge getrennt entwickelt werden. Die Fuge endet in<br />
grandioser Breite und fließt unmerklich in das Postludium<br />
über, das von einer durchdringenden Melancholie geprägt<br />
ist (wieder die ausdrucksvolle Saxophonmelodie!) und<br />
in dem Amphion sich von einer mysteriös verhüllten<br />
Frauensilhouette fortziehen läßt: man weiß nicht, ist es der<br />
23