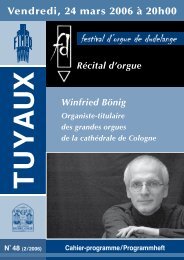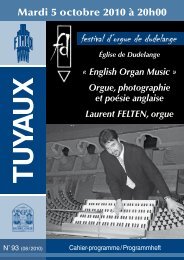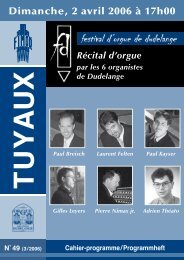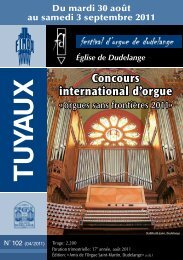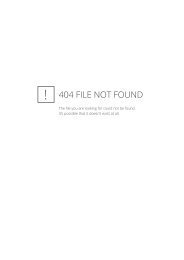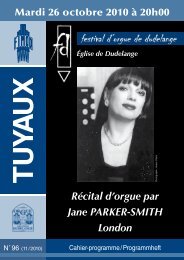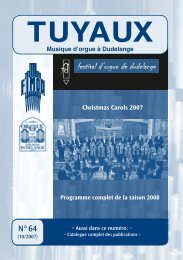points d' rgue à udelange - Orgue-dudelange.lu
points d' rgue à udelange - Orgue-dudelange.lu
points d' rgue à udelange - Orgue-dudelange.lu
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Johannes BRAhMS<br />
„EIN DEUTSChES REQUIEM“ op. 45<br />
„Wenn er seinen Zauberstab dahin senken wird, wo ihm die Mächte<br />
der Massen, im Chor und Orchester, ihre Kräfte verleihen, so stehen<br />
uns noch wunderbare Blicke in die Geisterwelt bevor.“<br />
Mit diesen prophetischen Worten huldigte Schumann 1853, nur wenige Monate vor<br />
seinem Selbstmordversuch, dem zwanzigjährigen Brahms. In dem unbekannten Komponisten<br />
aus dem provinziellen Hamburg glaubte er denjenigen erkannt zu haben,<br />
„der den höchsten Ausdruck der Zeit in idealerweise auszusprechen berufen wäre“.<br />
Doch sollte es noch viele Jahre dauern, bis Brahms die in ihn gesetzten Erwartungen<br />
erfüllte, legte er doch erst 1868 mit dem DEUTSCHEN REQUIEM ein größeres Werk für<br />
Chor und Orchester vor. Ohnehin ein selbstkritischer Komponist, näherte er sich den<br />
großen Gattungen ganz besonders vorsichtig.<br />
Tatsächlich lassen sich die Wurzeln der Komposition bis weit vor 1868 zurückverfolgen.<br />
Man weiß, dass der Trauermarsch des zweiten Satzes ursprünglich als Scherzo der<br />
d-moll-Sonate für zwei Klaviere diente, an der Brahms schon 1855 arbeitete. Dieses<br />
Werk gehört zu den zahlreichen frühen Stücken, die Brahms beträchtliche Mühe machten.<br />
Zeitweise als Symphonie gedacht, wurde es schließlich als Erstes Klavierkonzert<br />
op. 15 veröffentlicht. Diese Komposition entstand unter dem Eindruck von Schumanns<br />
Selbstmordversuch, und später gestand Brahms seinem Freund Joseph Joachim, auch<br />
das Requiem sei eng mit dem Gedenken an Schumann verbunden. Auch mit dem Tod<br />
von Brahms´ Mutter wird das Werk in Zusammenhang gebracht: die Auffassung, dass<br />
darin das auslösende Moment zu sehen sei, wies der Komponist allerdings zurück, und<br />
sie ist tatsächlich auch nicht haltbar, wenn man bedenkt, dass im Todesjahr 1865 die<br />
Vorarbeiten bereits weit fortgeschritten waren. Wahrscheinlich entstand lediglich der<br />
fünfte Satz, eine spätere Hinzufügung mit besonderem Bezug zu mütterlicher Liebe,<br />
unter dem Eindruck des Ver<strong>lu</strong>sts. In der Tat ist vermutlich jeder Versuch, das Requiem<br />
mit einem besonderen Todesfall in Verbindung zu bringen, zum Scheitern verurteilt:<br />
Brahms lebte stets im Wissen um die Sterblichkeit des Menschen und komponierte sein<br />
Leben lang Musik, die von Tod und Trauer handelt.<br />
Die Idee eines deutschen Requiems ist nicht gänzlich ohne Vorbilder. Schütz nannte<br />
seine MUSIKALISCHEN EXEQUIEN von 1636 ein „Concert in Form einer teutschen Begräbnis-Missa.“<br />
Mit diesem Werk teilt das Brahms-REQUIEM den Text des Satzes „Selig<br />
sind die Toten“, wenngleich Schütz seine Vertonung mit dem „Nunc dimittis“ verbindet.<br />
36<br />
Fortsetzung Seite 40