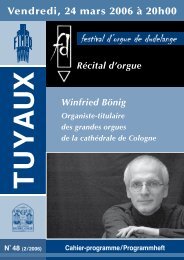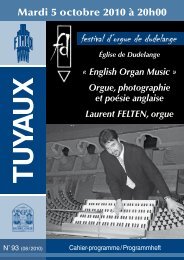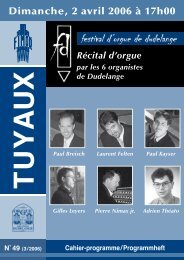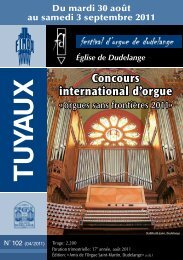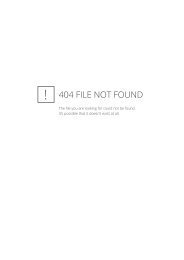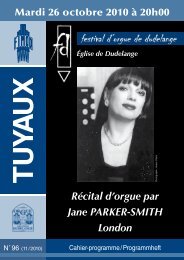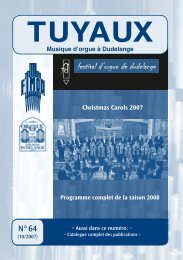points d' rgue à udelange - Orgue-dudelange.lu
points d' rgue à udelange - Orgue-dudelange.lu
points d' rgue à udelange - Orgue-dudelange.lu
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
und merkte erklärend an, dass er sich damals immer nur ein paar Bögen Papier auf<br />
einmal leisten konnte), dennoch ist die Gesamtanlage völlig zwingend. Die Abfolge<br />
der Sätze zeigt eine weitgespannte Symmetrie, die eine Art Spiegelform erkennen<br />
lässt. So entsprechen sich der erste und letzte Satz in der Tonart und der Parallelität<br />
der Texte. Ähnliches gilt für die Intentionen des zweiten, dritten und sechsten Satzes,<br />
insofern sie alle von Bildern des Todes und der Verzweif<strong>lu</strong>ng zu Hoffnung und Triumph<br />
voranschreiten. Die beiden Mittelsätze bilden den Aussagekern mit der Botschaft des<br />
Trostes als Zentralthema.<br />
Der erste Satz begründet die Haltung ruhigen Sich-Abfindens, die das gesamte Werk<br />
bestimmt. Der Chorsatz ist sehr verhalten, und das Fehlen der Violinen gibt dem<br />
Orchesterklang eine düstere Färbung, ähnlich der in Brahms´ früher A-Dur-Serenade<br />
op. 16. Mit dem schweren Schritt eines Trauermarsches beginnt der zweite Satz. Aus<br />
einem verhaltenen Beginn mit besonders reichem Klang der geteilten Streicher erhebt<br />
sich die Musik unerbittlich zu einem überwältigenden Höhepunkt. Vor der Wiederkehr<br />
des Trauermarsches ist ein leichterer Mittelteil eingeschoben. Der Satz endet strahlend<br />
nach einem ausgedehnten Durteil. Im dritten Satz tritt erstmals ein Gesangssolist in<br />
den Vordergrund. Anfangs wechselt sich das Baritonsolo mit dem Chor in düsterem<br />
Dialog ab, aber nach einem Überleitungsteil beschließt der Chor den Satz mit einer<br />
kraftvollen Fuge über einem einzigen Orgelpunkt.<br />
Wie die Intermezzi der Symphonien und Kammernmusikwerke diente der vierte Satz<br />
als Entspannung nach der Dramatik der vorhergegangenen Sätze. Ein kurzer belebterer<br />
Mittelteil hebt sich von den schwelgerisch süßen Außenteilen ab. Der Pastorale Ton<br />
setzt sich im fünften Satz fort, wo der Solosopran Worte des Trostes aus dem Johannes-<br />
Evangelium vorträgt. Dieser Satz zeichnet sich besonders durch die Eleganz seiner<br />
Bläserstimmen aus.<br />
Der sechste Satz ist nicht nur der längste, sondern auch der dramatische Kern des Werks.<br />
Nach einer Klage über die Vergänglichkeit des Lebens schlüpft der Bariton in die Rolle<br />
eines Sehers, der die Zukunft verkündet. Ein stürmischer Mittelteil bringt eine kurze,<br />
aber erschreckende apokalyptische Vision, ehe in einer großartigen, fast Händelschen<br />
Fuge sich wieder Zuversicht einstellt.<br />
Der Sch<strong>lu</strong>sssatz kehrt zum Geist des Anfangs zurück und betont, dass für Brahms der<br />
Trost die Hauptidee des DEUTSCHEN REQUIEMS ist. Brahms liebte das Bild des geschlossenen<br />
Kreises, und so ist es bezeichnend, dass der Chor den letzten Text „Selig sind<br />
die Toten“ auf das Thema singt, welches im ersten Satz die Worte „selig sind, die da<br />
Leid tragen“ trägt. Das Drama ist an seinem Ende angelangt; was bleibt, ist das Gefühl<br />
friedvoller Demut.<br />
42<br />
Text: Robert Scheingraber