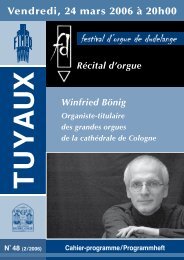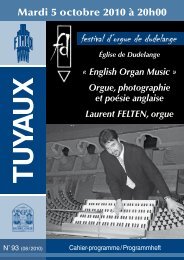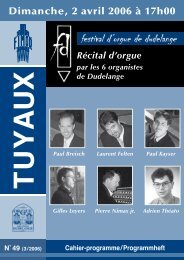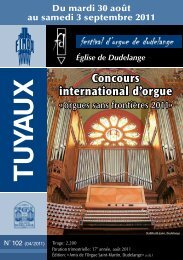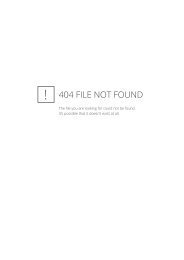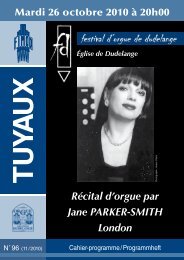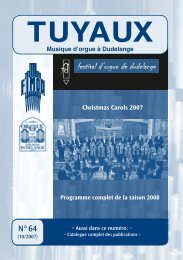points d' rgue à udelange - Orgue-dudelange.lu
points d' rgue à udelange - Orgue-dudelange.lu
points d' rgue à udelange - Orgue-dudelange.lu
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Bachs Kantate „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit BWV<br />
106, auch als ACTUS TRAGICUS bekannt, ist ein anderes<br />
Beispiel einer überzeugenden Auswahl von Bibeltexten<br />
zum Thema des menschlichen Sterbens. Auch Schumann<br />
hatte den Plan eines deutschen Requiems in sein „Projektbuch“<br />
eingetragen, allerdings – soviel uns bekannt<br />
ist – nie daran gearbeitet. Während seines Aufenthalts<br />
im Schumannschen Haushalt könnte Brahms den Band<br />
eingesehen haben, obwohl er dies später abstritt. Sicherlich<br />
war ihm aber Schumanns REQUIEM FÜR MIGNON<br />
vertraut, ein weltliches Werk über Texte aus Goethes<br />
WILHELM MEISTER, denn immerhin führte er es mit der<br />
Wiener Singakademie zu der Zeit auf, da sein eigenes<br />
Requiem heranreifte.<br />
Man würde freilich den Einf<strong>lu</strong>ss dieser Werke überschätzen, wollte man sie als Modelle<br />
auffassen. Zum einen ist nicht klar, ob Brahms Schütz und Bach kannte, als er sein Requiem<br />
schrieb; zum anderen macht die Textzusammenstel<strong>lu</strong>ng das Brahmssche Werk<br />
einmalig.<br />
Obwohl kein orthodox gläubiger Christ, studierte Brahms eifrig die Lutherbibel. Sein<br />
eigenes Bibelexemplar, das in einer Wiener Samm<strong>lu</strong>ng aufbewahrt wird, ist voll von<br />
Bleistiftanmerkungen. Darüber hinaus führte er ein Notizbuch mit Details von möglicherweise<br />
verwendbaren Texten. In seinem DEUTSCHEN REQUIEM vermeidet Brahms<br />
den liturgischen Text völlig und schafft dadurch ein Werk mit ganz anderem Blick auf<br />
den Tod. Während das herkömmliche lateinische Requiem den Seelenfrieden für die Verstorbenen<br />
erfleht, versucht Brahms, den Hinterbliebenen Trost zu bieten. Alec Robertson<br />
drückte es so aus: „Brahms betet nicht einmal, geschweige denn zweimal für die Toten.“<br />
Es gibt nur eine einzige kurze Entsprechung zum Dies irae mit seiner erschreckenden<br />
Darstel<strong>lu</strong>ng des Jüngsten Gerichts, aber wenn im Brahms-REQUIEM die Posaunen des<br />
Letzten Tags erschallen, dann rufen sie nicht die Toten vor den Richterstuhl, sondern<br />
sie verkünden die Hoffnung auf die Auferstehung und Vereinigung nach dem Tod. Dies<br />
deckt sich weitgehend mit der <strong>lu</strong>therischen Theologie, welche die Idee des Fegefeuers<br />
zusammen mit vielen anderen Elementen des Römischen Ritus ablehnt.<br />
Es ist bezeichnend für Brahms, dass in seiner Textauswahl kein einziges Mal von Christus<br />
die Rede ist, wenn auch bisweilen das Wort „Herr“ sich eindeutig auf den Messias des<br />
Neuen Testaments bezieht. Er setzte sich damit der Kritik Reinthalers aus, der eine Erweiterung<br />
des Werks vorsch<strong>lu</strong>g, um einen offenkundiger christlichen Ton einzuführen;<br />
aber Brahms lehnte eine Änderung ab und gab zu erkennen, dass er jeder dogmatischen<br />
Bindung abhold sei. Er betonte, „dass ich recht gern auch das „Deutsch“ fortließe und<br />
einfach den „Menschen“ setzte.“ Gleichwohl sträubte sich der Komponist nicht, als bei<br />
der Uraufführung am Karfreitag 1868 im Bremer Dom die Arie „Ich weiß, dass mein<br />
40