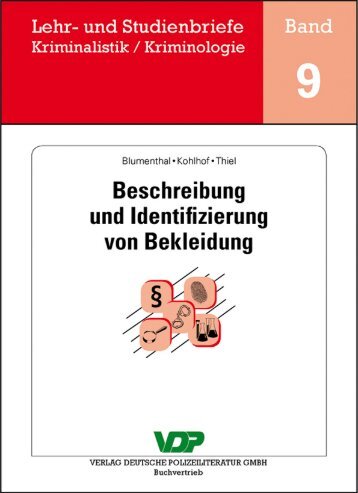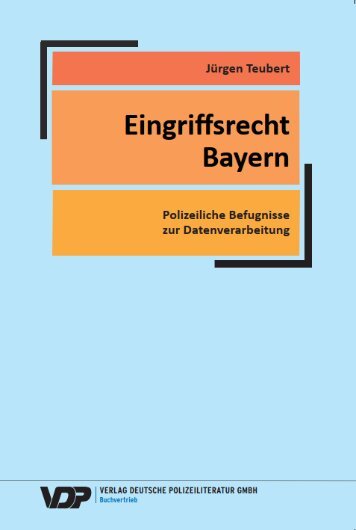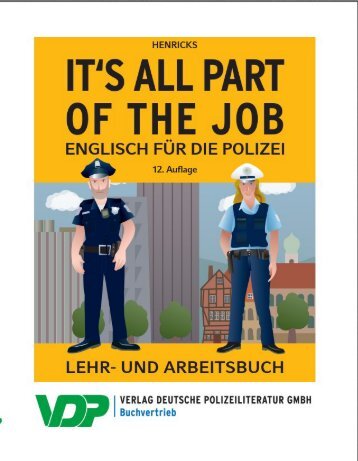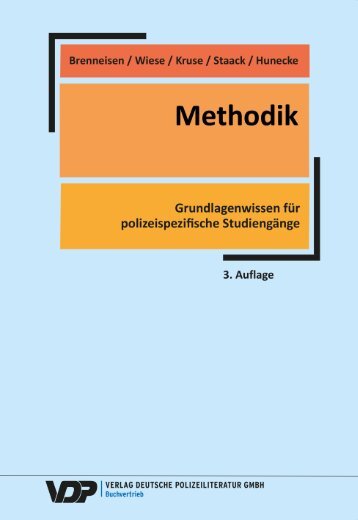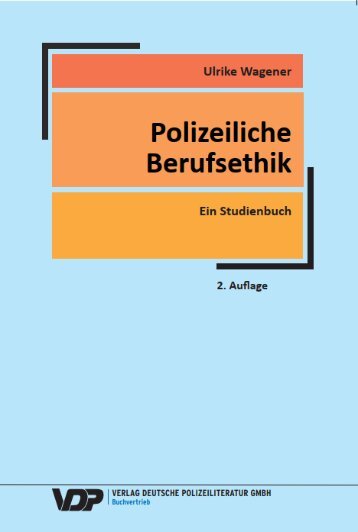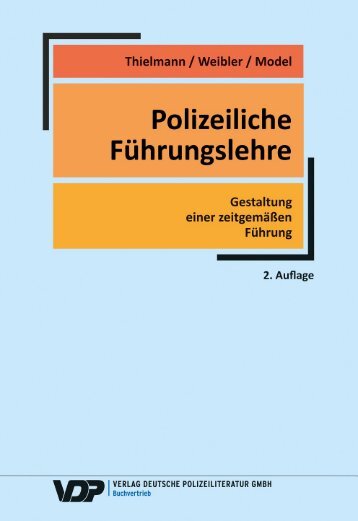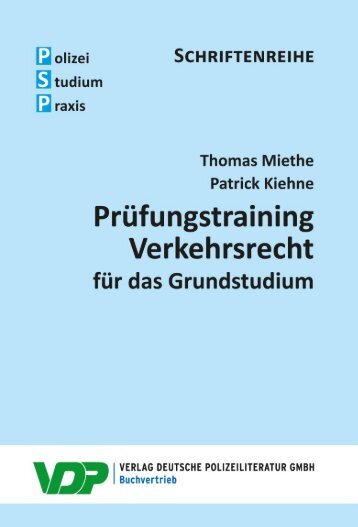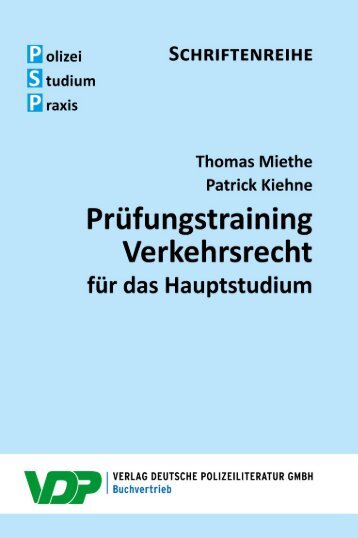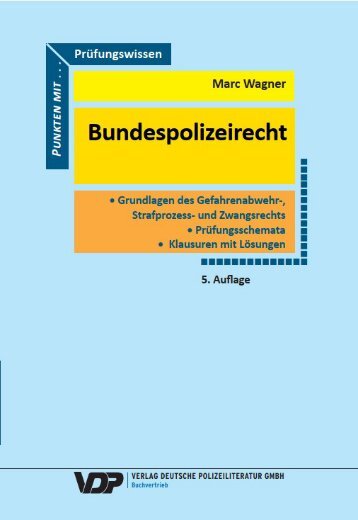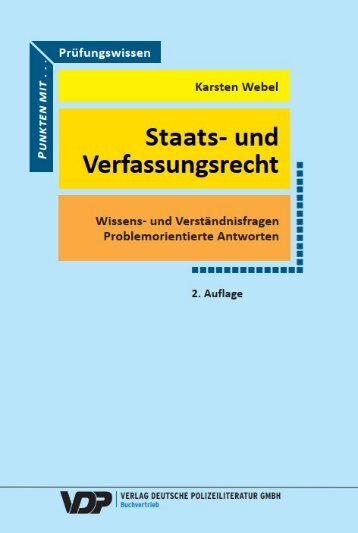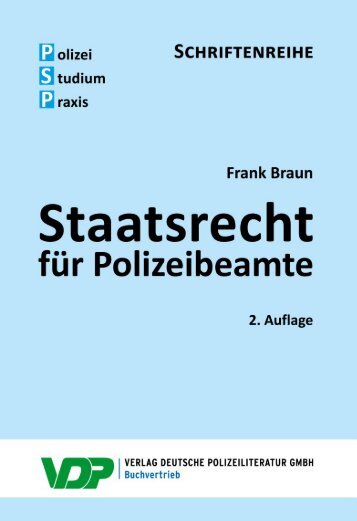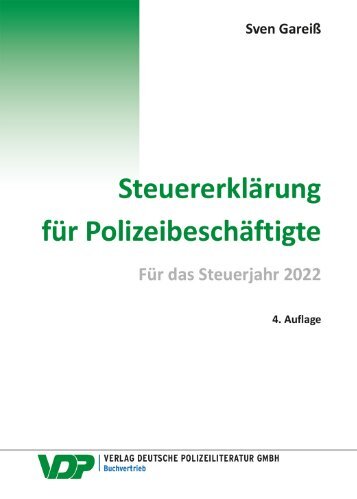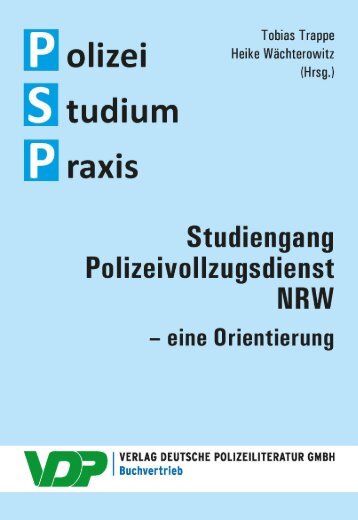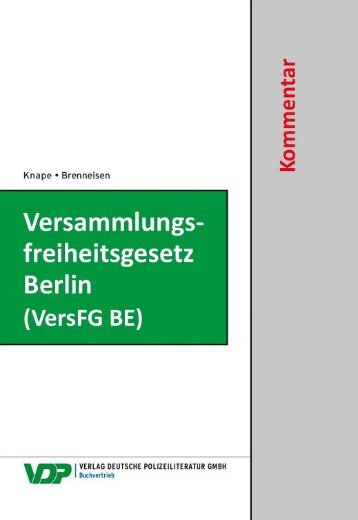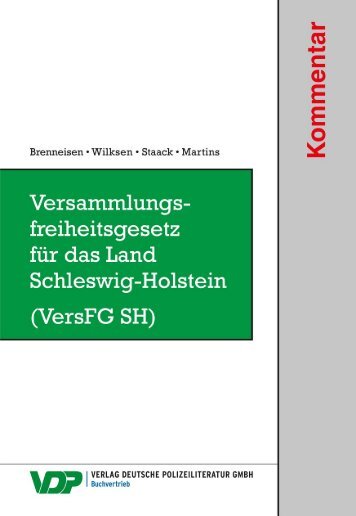VDP-BV Leseproben
Polizeiliche Führungslehre - Leseprobe
- Text
- Polizei
- Polizeiliche
- Polizeilichen
- Bedeutung
- Hintergrund
- Sicherheit
- Wissenschaftlicher
- Integration
- Organisation
- Deutschen
Zur Notwendigkeit einer
Zur Notwendigkeit einer polizeilichen Führungslehre schreibt dazu: „Man muss nicht von völliger Verschmelzung der Politikfelder sprechen, kann aber feststellen, dass Dynamiken der Sicherheit, dass Wahrnehmungen von Unsicherheit, Bedrohung und Gefahr dazu beitrugen, die Sphären von innen und außen, von Innen- und Außenpolitik, von äußerer, innerer und sozialer Sicherheit zumindest zu relativieren.“ 17 Diese zentrale Position der Polizei im bundesrepublikanischen und mittlerweile europäischen Sicherheitsgefüge verlangt nach Reflexion. 18 Da für die Art und Weise der polizeilichen Aufgabenerledigung vor allem die „Führung“ maßgeblich verantwortlich ist, konzentrieren wir uns hier im Folgenden auf eine polizeiliche Führungslehre. 19 Dass sich eine nähere Betrachtung lohnt, liegt aber auch an den festzustellenden und damit in mancher Hinsicht spannenden Auffälligkeiten von Polizeibehörden, wobei die Auffälligkeiten in ihrer spezifischen Kombination eine einzigartige Organisation formen. Zudem sind mehr als 310.000 Menschen, davon rund 267.800 Beamtinnen und -beamten 20 (Tendenz steigend) in Polizeibehörden beschäftigt. Damit besitzt dieser Sektor nach dem Bildungssektor den zweitgrößten Anteil beim Personal des öffentlichen Dienstes in Deutschland. 21 Dies nicht zu berücksichtigen wäre gesellschaftspolitisch fatal und wissenschaftsstrategisch unklug. Interessanterweise findet diese besondere Stellung der Polizei keinen angemessenen Niederschlag in der wissenschaftlichen Führungslehre. Generell ist festzustellen, dass doch sehr zurückhaltend über die Polizeien in Deutschland geforscht wird, 22 obgleich ermutigende Fortschritte in der Herausbildung einer Polizeiwissenschaft 23 und damit auch einer empirischen Polizeiforschung konstatiert werden können. 24 Woher diese Zurückhaltung rührt, werden wir nicht untersuchen. 25 Vielmehr sind wir zunächst darauf bedacht, auszuweisen, warum wir eine polizeiliche Führungslehre eigener Prägung benötigen. Dies gelingt durch die Betrachtung des Kontextes, in dem Polizeiarbeit stattfindet, und der Situation, wie sie sich Führungskräften und ihren Mitarbeitenden in der Organisation darstellt – letzteres kann man auch als Einbettung deklarieren. Beide zusammen prägen Möglichkeiten und Grenzen des Führungshandelns in der Polizeipraxis. 26 Warum muss sich „polizeiliche Führung“ nach unserer Auffassung neu orientieren? Nach 40 Jahren des kooperativen Führens hat sich das KFS überdauert. Es haben sich, bedingt durch neue bzw. sich schnell weiterentwickelnde Megatrends in der Gesellschaft, 27 die Rahmenbedingungen für Führung und die damit einhergehenden Anforderungen an Führungskräfte geändert. Sowohl Führung von Mitarbeitern in der Alltagsorganisation der Polizei als auch Führung in/von Besonderen Aufbauorganisationen muss sich intensiver mit weiteren Dimensionen in der Interaktion zwischen Führungskraft und Mitarbeiter auseinandersetzen, die in den bisherigen Betrachtungen zu kurz gekommen sind. In diesem Zusammenhang wird Leseprobe 17 Conze (2018), S. 42. 18 Als ein Beispiel: Temme (2013). 19 Vgl. auch Heidemann (2014). 20 Für die Anzahl der Gesamtbeschäftigten vgl. Antholz (2015); für die Anzahl der Beamten vgl. Statista (2020). https://de.statista. com/statistik/daten/studie/516101/umfrage/polizisten-in-deutschland-nach-bundeslaendern/ sowie Hinzurechnung der aktuellen Zahlen der Bundespolizei und des BKA (02/2020). 21 Vgl. Frevel (2008), S. 3. 22 Vgl. Wendekamm et al. (2018). 23 Vgl. Kersten & Burchard (2013); Kersten (2012a+b); Jaschke & Neidhardt (2004). 24 Vgl. Feltes (2007). 25 Für eine zusammenfassende Diskussion der Forschung über, mit und in der Polizei unter Aufzeigen der Historie siehe: Mokros (2011); außerdem Möllers (2011); Mokros (2010); Lautmann (2010); Feltes (2007). 26 Vgl. Thielmann (2012b). 27 Vgl. Wendekamm & Model (2018), S. 261 ff. 17
Zur Notwendigkeit einer polizeilichen Führungslehre von evolutionären Veränderungsprozessen 28 oder einem sich verändernden Berufsbild bzw. sich verändernden Berufsbildern der Polizei 29 gesprochen, die sich aus der zunehmenden Komplexität moderner Arbeitswelten sowie immer schneller werdender, gelegentlich sogar disruptive Veränderungsprozesse ergeben (vgl. Abb. 1). Politische Leitlinien Rahmenvorgaben Politische Mehrheiten Koalitionsabsprachen Wahlkampfphasen Info als Ware Manipulation Fake News Zielorientiert Teilöffentlichkeit Social Media Digitalisierung Medien Technische Weiterentwicklung Politik Organisationskultur Gesellschaft Arbeitskulturen Berufsbild Sinnerfüllte Arbeit Pflicht-, Akzeptanzwerte Polizei wirkt auf Gesellschaft Einstellungen Innere Sicherheit Recht Einstellung Arbeitszufriedenheit Überforderung Unterforderung Zeitgeist Kompetenz Abb. 1: Einflüsse auf das Berufsbild Polizei (Wendekamm/Model 2018, S. 276) Alles ist geregelt Bindung an Gesetz Epochen Minderheiten Piercing Mode Tätowierung Soziale, Fachliche, Personelle, Emotionale Kompetenz Warum bin ich Polizist? Bildungsniveau Zukunftsperspektiven Rollenverständnis Ob es der Umgang mit einer zunehmend von digitalen Prozessen geprägten Arbeitswelt ist, die flächendeckend geführte Diskussion um politische Einstellungen und Radikalisierungsgefahren sowie Werte- und Grundhaltungen von Polizeibediensteten, die Gestaltung von Vielfalt in der Organisation, die zunehmende Spezialisierung der Arbeitsbereiche, die veränderten Ansprüche an die Organisation oder wie man sich in der Arbeit einbringen möchte, all dies macht eine professionell neu ausgerichtete Führung notwendig. Dabei haben wir auch zu berücksichtigen, dass sich schon aus der aktuellen Zusammensetzung und der demografischen Entwicklung des Personalkörpers der Polizei sowie den damit einhergehenden, sehr unterschiedlichen Haltungen und Erwartungen der Generationen besondere Anforderungen 28 Vgl. schon früh Ringlstetter 1988. 29 Vgl. Wendekamm & Model (2018), S. 274 ff. Leseprobe 18
- Seite 2 und 3: Polizeiliche Führungslehre Gestalt
- Seite 4 und 5: Vorwort zur 2. Auflage Vorwort zur
- Seite 6 und 7: Zu den Autoren Zu den Autoren Gerd
- Seite 8 und 9: Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichn
- Seite 10 und 11: Inhaltsverzeichnis 12 Kommunikation
- Seite 12 und 13: Abbildungsverzeichnis Abbildungsver
- Seite 14 und 15: Zur Notwendigkeit einer polizeilich
- Seite 18: Zur Notwendigkeit einer polizeilich
Unangemessen
Laden...
Magazin per E-Mail verschicken
Laden...
Einbetten
Laden...