TiHo Diss Schwerhoff 2012-09-24 - Stiftung Tierärztliche ...
TiHo Diss Schwerhoff 2012-09-24 - Stiftung Tierärztliche ...
TiHo Diss Schwerhoff 2012-09-24 - Stiftung Tierärztliche ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Tierärztliche</strong> Hochschule Hannover<br />
______________________________________________________<br />
Fruchtbarkeit nach intravaginaler und intrazervikaler Applikation von Seminalplasma bei der<br />
artifiziellen Insemination des Rindes sowie bei Embryonenempfängertieren<br />
INAUGURAL-DISSERTATION<br />
Zur Erlangung des Grades einer<br />
Doktorin der Veterinärmedizin<br />
- Doctor medicinae veterinariae -<br />
(Dr. med. vet.)<br />
vorgelegt von<br />
Mona <strong>Schwerhoff</strong><br />
aus Borken<br />
Hannover <strong>2012</strong>
Wissenschaftliche Betreuung: Apl. Prof. Dr. Dr. S. Meinecke-Tillmann<br />
Institut für Reproduktionsbiologie<br />
1. Gutachterin: Apl. Prof. Dr. Dr. S. Meinecke-Tillmann<br />
2. Gutachterin: Apl. Prof. Dr. Dr. D. Waberski<br />
Tag der mündlichen Prüfung: 6. August <strong>2012</strong><br />
Eine Arbeit aus dem Virtuellen Zentrum für Reproduktionsmedizin Niedersachsen<br />
an der <strong>Tierärztliche</strong>n Hochschule Hannover<br />
gefördert durch:<br />
Förderverein Biotechnologieforschung e.V. (FBF)<br />
<strong>Stiftung</strong> der Deutschen Wirtschaft (sdw)
Meinen Eltern
INHALTSVERZEICHNIS<br />
INHALTSVERZEICHNIS<br />
VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN<br />
1 EINLEITUNG 13<br />
2 LITERATURÜBERSICHT 15<br />
2.1 Reproduktionsrelevante Grundlagen 15<br />
2.1.1 Reproduktionszyklus und Anatomie des weiblichen Rindes 15<br />
2.1.3 Das Ejakulat des Bullen 16<br />
2.1.4 Reproduktionszyklus und Anatomie der weiblichen Ziege 16<br />
2.1.5 Das Ejakulat des Ziegenbockes 17<br />
2.2 Mechanismen der Interaktion im weiblichen Genitale 17<br />
2.2.1 Blutgefäßsystem 18<br />
Arterielles System 18<br />
Venöses System 19<br />
Austausch nach dem Gegenstromprinzip 19<br />
2.2.2 Lokales Lymphsystem 21<br />
2.2.3 „First uterine pass effect“ 21<br />
2.2.4 Vaginale Clearance 23<br />
2.3 Seminalplasma <strong>24</strong><br />
2.3.1 Produktion von Seminalplasma <strong>24</strong><br />
2.3.2 Bestandteile des Seminalplasmas 25<br />
2.3.3 Methoden zur Seminalplasmagewinnung und -aufbewahrung 26<br />
2.4 Seminalplasmaeffekte auf das weibliche Genitale und die Fruchtbarkeit 27<br />
2.4.1 Überblick über die Funktionen im weiblichen Genitale 27<br />
2.4.2 Evolutionäre Aspekte 27<br />
2.4.3 Immunmodulatorische Effekte 28<br />
2.4.4 Systemische Effekte 30<br />
2.4.5 Effekte auf die Uterusmotilität und Samenretention 31<br />
2.4.6 Effekte auf das Ovar und den Gelbkörper 32<br />
2.4.7 Effekte auf Implantation, embryonale Mortalität und Trächtigkeit 34<br />
2.4.8 Psychobiologische Effekte 36<br />
2.4.9 Effekte nach Entfernung der akzessorischen Geschlechtsdrüsen 37<br />
2.5 Relevante reproduktionsmedizinische Techniken 38<br />
2.5.1 Artifizielle Insemination 38<br />
2.5.2 Embryotransfer 39<br />
2.5.3 Seminalplasma im Kontext der artifiziellen Insemination und des Embryotransfers 40
2.6 Zytologische Präparate des weiblichen Genitale 40<br />
2.6.1 Zytobrush-Methode 40<br />
2.6.2 Subklinische Endometritis 41<br />
2.6.3 Zytologieauswertung 42<br />
2.6.4 Einordnung von Zytologien des Genitaltraktes 43<br />
2.7 Szintigraphien des weiblichen Genitale 44<br />
2.7.1 Methode 44<br />
2.7.2 Radioaktiver Marker 45<br />
2.7.3 Lösungsmarkierung 45<br />
2.7.4 Radioaktivität und Einheiten 46<br />
2.7.5 Experimentelle Szintigraphie-Studien 47<br />
Zu genitalem Transport und Lösungsverbleib 47<br />
Zu Uteruskontraktion und Selbstreinigungsmechanismen 49<br />
3 MATERIAL UND METHODEN 51<br />
3.1 Feldstudien zur Seminalplasmaapplikation 51<br />
3.1.1 Studientiere 51<br />
3.1.2 Lösungsgewinnung und -herstellung 51<br />
3.1.3 Durchführung der Lösungsapplikation 52<br />
Lösungsapplikation begleitend zur artifiziellen Insemination 53<br />
Lösungsapplikation begleitend zum Embryotransfer 53<br />
3.1.4 Erfasste Parameter je Studientier (Feldstudien I + II) 54<br />
Lösungsapplikation 55<br />
Betriebliche Daten 55<br />
Tierdaten 55<br />
Brunstparameter und Besamung 55<br />
Trächtigkeit 56<br />
3.1.5 Zusätzliche Datenerfassung bei Embryonenempfängertieren 56<br />
Empfängertier 56<br />
Spendertiere 56<br />
Embryo 56<br />
3.1.6 Zervixzytologien 56<br />
3.1.7 Statistische Analyse 57<br />
3.2 Experimentelle Studie: Vaginohysteroszintigraphien 57<br />
3.2.1 Studientiere 57<br />
3.2.2 Versuchsdurchführung 58<br />
3.2.3 Bildauswertung 59<br />
4 ERGEBNISSE 61<br />
4.1 Inseminationsbegleitende SP-Applikation (Feldstudie I) 61<br />
4.1.1 Versuchsgruppen und Trächtigkeitsergebnisse 61<br />
4.1.2 Charakterisierung der Studientiere und ihre Verteilung hinsichtlich der erfassten Parameter 61<br />
Rassen 62<br />
Laktation 63<br />
Rastzeit 64<br />
Störungen post partum 65<br />
Milchmenge 67<br />
Milchprobe 68
Körperkondition 69<br />
Lahmheit 70<br />
Hygiene 72<br />
Letzte beobachtete Brunst 73<br />
Dauer der Brunst und Brunstfeststellung 73<br />
Brunstschleim 74<br />
Intensität der äußeren Brunstsymptomatik 74<br />
Kontraktion der Gebärmutter 76<br />
Zervixzytologiestatus 77<br />
Haltungssystem 79<br />
Betriebe und Betriebsgröße 79<br />
Gruppengröße und Liegeplätze 80<br />
Eingesetztes Sperma 81<br />
Untersuchungen auf Trächtigkeit 81<br />
4.1.3 Auswertung nach Besamungsbeauftragten 82<br />
Trächtigkeitsraten je Besamungsbeauftragten und Versuchsgruppe 82<br />
4.1.4 Weitere Auswertung nach Rassen 84<br />
Trächtigkeitsrate je Rasse und Versuchsgruppe 84<br />
4.1.5 Weitere Auswertung nach Zervixzytologiestatus 84<br />
Zervixzytologiestatus und Intensität der äußeren Brunstsymptome 84<br />
Zervixzytologiestatus und Brunstschleim 85<br />
Zervixzytologiestatus und Uteruskontraktion 85<br />
Zervixzytologiestatus und Laktation 85<br />
Zervixzytologiestatus und Lahmheit 85<br />
4.2 Transferbegleitende Seminalplasmaapplikation bei Embryonen-empfängertieren (Feldstudie II) 88<br />
4.2.1 Versuchsgruppen und Trächtigkeitsergebnisse 88<br />
4.2.2 Charakterisierung der Studientiere 89<br />
Rasse 90<br />
Laktationsnummer 90<br />
Haltungssystem und Betriebsgröße 90<br />
Zyklussynchronisation 90<br />
Brunstfeststellung und Intensität der äußeren Brunstsymptomatik 90<br />
Zervixzytologiestatus 92<br />
ET-Durchführung und Uterusgröße 93<br />
Embryoqualität und Art ihrer Lagerung 95<br />
4.2.3 Weitere Auswertung der Zervixzytologien 95<br />
4.3 Zusammengefasste Ergebnisse der Feldstudien I + II 98<br />
4.3.1 Signifikante Einflüsse in der KB-Studie 98<br />
Auf die Trächtigkeitsraten 98<br />
Weitere Signifikanzen 99<br />
4.3.2 Signifikante Einflüsse in der ET-Studie 99<br />
Auf die Trächtigkeitsraten 99<br />
Weitere Signifikanzen 99<br />
4.4 Vaginohysteroszintigraphien im Östrus (Experimentelle Studie) 99<br />
4.4.1 Szintigraphieserien im Vergleich 99<br />
4.4.2 Szintigraphieserien je Tier 100<br />
4.4.3 Szintigraphieserien des Seminalplasmas 107<br />
4.4.4 Szintigraphieserien des Ejakulates 108<br />
4.4.5 Szintigraphieserien des Placebos 108
5 DISKUSSION 110<br />
5.1 Feldstudien 110<br />
5.1.1 Überprüfung der Arbeitshypothese 110<br />
5.1.2 Allgemeine Einordnung der erzielten Trächtigkeitsraten 110<br />
5.1.3 Effekt der Seminalplasmaapplikation 110<br />
Resorption von Seminalplasma-Bestandteilen 112<br />
Veränderung der Uterusmotilität, Immunmodulation und Volumeneffekt 113<br />
Deponierungseffekt 114<br />
Zeitpunkt der Applikation 114<br />
5.1.4 Diskussion weiterer signifikanter Parameter 114<br />
KB-Studie 115<br />
ET-Studie 116<br />
5.1.5 Kritische Anmerkungen zu den Feldstudien 116<br />
Durchführung der Studien 116<br />
Verblindung der Daten 117<br />
Zeitraum der Studiendurchführung 117<br />
5.2 Zervixzytologien 117<br />
5.2.1 Überprüfung der Arbeitshypothese 117<br />
5.2.2 Allgemeine Einordnung der gewonnenen Zytologien 118<br />
5.2.3 Aussagekraft für die Reproduktion 120<br />
5.2.4 Effekt der Seminalplasmaapplikation 121<br />
5.2.5 Kritische Anmerkungen zum Einsatz der Zervixzytologie 122<br />
5.3 Experimentelle Studie 122<br />
5.3.1 Überprüfung der Arbeitshypothese 122<br />
5.3.2 Einordnung der Szintigramme 123<br />
5.3.3 Kritische Anmerkungen zur experimentellen Studie 125<br />
6 ZUSAMMENFASSUNG 127<br />
7 SUMMARY 131<br />
8 LITERATURVERZEICHNIS 135<br />
9 DANKSAGUNG 154
VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN<br />
A. = Arteria<br />
Acp = Accessory gland protein, Protein der akzessorischen Geschlechtsdrüsen<br />
AI = Artifizielle Insemination<br />
BCS = Body Condition Score (Skala 1 - 5)<br />
BDI = Beck depression inventory, Erfassung von Depressions-<br />
symptomen nach Beck<br />
BS1-5 = Intensität der Brunstsymptomatik (auf einer Skala von 1 - 5)<br />
bzw. = beziehungsweise<br />
°C = Grad Celsius<br />
COX-2 = Cyclooxygenase-2<br />
d = Tag/Tage<br />
d 0 = Tag 0, Brunst bzw. Zeitpunkt der künstlichen Besamung<br />
d 7 = Tag 7 des Zyklus, ausgehend von d 0/Brunstzeitpunkt<br />
ET = Embryotransfer<br />
FES = fecundity-enhancing substances, trächtigkeitsfördernde Substanzen<br />
FSH = Follikelstimulierendes Hormon<br />
FV = Deutsches Fleckvieh<br />
g = Erdbeschleunigung<br />
GM-CSF = Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor<br />
h = Stunde<br />
hCG = humanes Choriongonadotropin<br />
HSS/HSSG = Hysterosalpingoszintigraphie<br />
HYG = Hygiene-Score (Skala 1 - 4)<br />
ICSI = Intracytoplasmic sperm injection, intrazytoplasmatische<br />
Spermieninjektion<br />
IETS = International Embryo Transfer Society<br />
IL = Interleukin<br />
IL-2R = Rezeptor des Interleukin-2<br />
i.m. = intramuskulär<br />
i.v. = intravenös
IVF = in vitro Fertilisation<br />
K = Kontrollgruppe<br />
K1-3 = Uteruskontraktion (auf einer Skala von 1 - 3)<br />
KB = Künstliche Besamung<br />
kBq = Kilobecquerel<br />
kg = Kilogramm<br />
Lakt. = Laktation<br />
LH = Luteinisierendes Hormon<br />
LIF = Leukemia inhibitory factor<br />
LPS = Lipopolysaccharide<br />
LS = Lahmheits-Score (Skala 1 - 5)<br />
Lsg. = Lösung<br />
MBq = Megabecquerel<br />
min = Minute<br />
MHC = Major histocompatibility complex, Haupthistokompatibilitätskomplex<br />
Mio = Million<br />
mL = Milliliter<br />
µL = Microliter<br />
MS = Doktorandin M. <strong>Schwerhoff</strong><br />
n = Anzahl<br />
n GES = Gesamtanzahl<br />
NK- = Natürliche Killerzellen<br />
Nl, Nll. = Nodus lymphaticus, Lymphknoten<br />
n X = Anzahl in der Gruppe X<br />
OE = Östrus<br />
P = Probabilität, Irrtumswahrscheinlichkeit<br />
P = Placebo (-gruppe)<br />
PBS = Phosphate buffered saline, phosphatgepufferte Salzlösung<br />
p.c. = post coitum<br />
PG = Prostaglandin<br />
PGF2α = Prostaglandin F2alpha
PGE2 = Prostaglandin E2<br />
p.i. = post inseminationem<br />
PMN = Polymorphkernige neutrophile Granulozyten<br />
p.p. = post partum<br />
PR = Pregnancy rate<br />
R. = Ramus, Zweig<br />
RB = Deutsche Holstein Rotbunt<br />
ROI = Regions of interest, definierter Bereich des Interesses in der<br />
Auswertung von Szintigrammen<br />
s = Standardabweichung<br />
SB = Deutsche Holstein Schwarzbunt<br />
SP = Seminalplasma (-gruppe)<br />
Tc = Technetium<br />
TGF ß = Transforming growth factor ß<br />
TierSchG = Tierschutzgesetz<br />
TR = Trächtigkeitsrate<br />
u. = und<br />
V. = Vena, Vene<br />
z.B. = zum Beispiel<br />
Zykl.syn. = Zyklussynchronisation
1 EINLEITUNG<br />
Seminalplasma, produziert überwiegend von den akzessorischen Geschlechtsdrüsen des<br />
männlichen Tieres, macht ca. 90 % eines Ejakulates aus und dient unter anderem dem<br />
Transport und Schutz der Spermien. Für die weiblichen Individuen verschiedener Spezies<br />
sind darüber hinaus Seminalplasma-Effekte auf das Immunsystem, den Uterus und die<br />
Ovarien nachgewiesen. Auch systemische und psychobiologische Auswirkungen nach einer<br />
Seminalplasmaapplikation im weiblichen Genitale sind in diversen Untersuchungen<br />
beispielsweise an Insekten, Ratten, Trampeltieren und dem Menschen belegt. Sogar die<br />
Beeinflussung von Implantation und embryonaler Mortalität wird dem Seminalplasma unter<br />
anderem bei den Spezies Maus und Schwein zugeschrieben.<br />
Für das Rind liegen keine Untersuchungen zu den Auswirkungen einer<br />
Seminalplasmaapplikation in physiologischer Menge und Lokalisation vor und die Berichte<br />
über Seminalplasma-Effekte bei anderen Spezies führten zur Konzeption der vorliegenden<br />
Arbeit. Hat das Seminalplasma auch beim Rind eine trächtigkeitsfördernde Wirkung und,<br />
wenn ja, lässt sich diese unter Praxisbedingungen belegen?<br />
Im Hauptteil der Arbeit, zwei Feldstudien, sollte die Auswirkung einer<br />
Seminalplasmaapplikation auf die Fruchtbarkeit bei Rindern untersucht werden. Zugrunde lag<br />
die Hypothese, dass eine Seminalplasmaapplikation die Trächtigkeitsraten positiv beeinflusst.<br />
Die durchgeführten Feldstudien waren dreifachblind und mit randomisierter Zuordnung der<br />
Studientiere konzipiert. Umfangreiche Datenerhebungen je Studientier wurden<br />
vorgenommen, um Effekte anderer Einflussgrößen wie Körperkondition, Rasse und Alter auf<br />
die Fruchtbarkeit auszuschließen. Die durchgeführte Seminalplasmapplikation, orientiert an<br />
der Physiologie des Rindes, erfolgte in einem Umfang von 4 mL intrazervikal und<br />
intravaginal zum Zeitpunkt der künstlichen Besamung beziehungsweise brunstbegleitend bei<br />
Embryonenempfängertieren. Zur Auswertung wurden die Trächtigkeitsraten in den drei<br />
Versuchsgruppen „Seminalplasma“, „Placebo“ und „Kontrolle“ berechnet.<br />
Im Rahmen beider Feldstudien wurden exfoliative Zervixzytologien erstellt, um den<br />
zervikalen Zytologiestatus der Studientiere in der Brunst zu dokumentieren. Aufgrund der<br />
gewonnenen umfassenden Probenanzahl konnte daher eine weitere Hypothese überprüft<br />
13
werden: Hat der zervikale Zytologiestatus des Rindes, genauer gesagt ein Anteil von weniger<br />
als 10 % polymorphkernige Granulozyten, einen positiven Einfluss auf den<br />
Besamungserfolg? Eine Berechnung der Trächtigkeitsraten nach Zellstatus-Gruppe wurde zur<br />
Überprüfung dieser Hypothese durchgeführt. Zusätzlich konnte anhand der ET-Studie<br />
untersucht werden, ob sich die brunstbegleitende Applikation von Seminalplasma auf den<br />
Zervixzytologiestatus zum Transferzeitpunkt auswirkt.<br />
Weitere Fragenstellten sich bei der Betrachtung der vielfältigen Seminalplasma-Effekte im<br />
weiblichen Individuum: Was geschieht mit dem Seminalplasma nach der Applikation? Wie<br />
lange verbleibt das Seminalplasma im weiblichen Genitale? Und ist die Szintigraphie eine<br />
geeignete Methode zur visuellen Verfolgung applizierter Lösungen?<br />
Zur Beantwortung dieser Fragen wurde eine ergänzende, experimentelle Studie bei Ziegen,<br />
ebenfalls Scheidenbesamer wie das Rind, jedoch aufgrund der Größe besser zur Szintigraphie<br />
geeignet, konzipiert. Radioaktiv markiertes Seminalplasma wurde nach intravaginaler<br />
Applikation per Hysterovaginoszintigraphie über einen Zeitraum von 6 h verfolgt. Zur<br />
Auswertung wurden die Szintigramme in den drei Versuchsgruppen „Seminalplasma“,<br />
„Ejakulat“ und „Placebo“ verglichen.<br />
14
2 LITERATURÜBERSICHT<br />
2.1 Reproduktionsrelevante Grundlagen<br />
2.1.1 Reproduktionszyklus und Anatomie des weiblichen Rindes<br />
Das domestizierte europäische Rind ist asaisonal polyöstrisch, mit einem 21 (18 - <strong>24</strong>)-tägigen<br />
Zyklus (GRUNERT u. BERCHTOLD 1999). Die Brunst dauert in der Regel 18 (12 - <strong>24</strong>) h,<br />
wobei diese, mit steigender Milchleistung zunehmend kürzer beobachtet wird. So stellten<br />
DOBSON et al. (2008) in Großbritannien eine von 15 auf 5 h verkürzte Brunstdauer innerhalb<br />
der letzten 30 - 50 Jahre fest. Die spontane Ovulation findet in der Regel erst nach dem<br />
Abklingen der äußeren Brunstsymptome statt: 30 - 35 h nach Brunstbeginn und 7,3 (0 - 16) h<br />
nach Brunstende (GRUNERT u. BERCHTOLD 1999). Als optimaler Besamungszeitpunkt<br />
wird 12 - 18 h nach Brunstbeginn angesehen (GRUNERT u. BERCHTOLD 1999;<br />
BUSCH 2007).<br />
Das weibliche Genitale des Rindes wird unterschieden in Scham (Vulva), Scheide (Vagina),<br />
Gebärmutter (Uterus) mit Gebärmutterhals (Cervix uteri), -körper (Corpus uteri) und -hörnern<br />
(Cornua uteri), sowie Eileiter (Tubae uterinae) und Eierstöcke (Ovarii; siehe auch Abb. 4).<br />
Die weiblichen Genitalorgane unterliegen erheblichen zyklusabhängigen<br />
Strukturveränderungen und im Folgenden wird nun kurz auf Scheide und Zervix eingegangen.<br />
Die Scheide reicht vom äußeren Muttermund bis zur Harnröhrenmündung und weist mit<br />
einem pH von 6,2 - 6,9 ein saures Milieu auf (WEHREND et al. 2003). Sie stellt ein häutig-<br />
muskulöses, schlauchförmiges Organ dar, dessen Lumen, außer während der Begattung und<br />
der Austreibungsphase der Frucht, auf einen kapillaren Spaltraum verjüngt ist. Der Wandbau<br />
der Vagina besteht aus drei Schichten: einer mehrschichtigen Schleimhaut (Tunica mucosa),<br />
der kollagenelastischen Bindegewebsschicht (Lamina propria) und einer Muskelschicht<br />
(Tunica muscularis) aus glatten Muskelzellen (LIEBICH 2004). Der Autor berichtet<br />
außerdem beim Rind über hochprismatische, schleimproduzierende Zellen, die in den<br />
Schleimhautfalten, insbesondere in der Nähe der Zervix eingelagert sind. Der<br />
Gebärmutterhals bildet den Übergang zwischen Scheide und Gebärmutterkörper und kann<br />
aufgrund seiner derben Beschaffenheit beim Rind bei der transrektalen Untersuchung von<br />
diesen abgegrenzt werden. Die Cervix uteri ist in der Lage sich temporär<br />
15
(Östrus/Austreibungsphase) zu öffnen und zu schließen (LEISER 1999). Auch die Wand des<br />
Gebärmutterhalses ist in drei Schichten aufgebaut: Eine tierartlich unterschiedlich stark<br />
gefaltete, einschichtige, hochprismatische Tunica mucosa, die Lamina propria, welche unter<br />
Einfluss von Östrogenen stark ödematisiert wird und die Tunica muscularis mit zirkulären<br />
und longitudinalen Fasern (LIEBICH 2004).<br />
Die Schleimhautzellen der Zervix synthetisieren in Abhängigkeit vom Zyklus den aus sauren<br />
und neutralen Proteoglykanen bestehenden Schleim: dünnflüssigen Brunstschleim unter<br />
Östrogeneinfluss oder dickflüssigen Schleim zur Bildung eines Pfropfes, der die Zervix<br />
während der Gelbkörperphase verschließt (LEISER 1999; LIEBICH 2004). Ebenfalls<br />
abhängig vom Zyklus ist auch die Permeabilität der Vaginalschleimhaut. WINTERHAGER u.<br />
KÜHNEL (1985) resümierten aus ihren Versuchen an Meerschweinchen, dass die Zell-Zell-<br />
Verbindungen (tight junctions) ursächlich beteiligt sind an der Restriktion parazellulärer<br />
Diffusion durch die Vaginalschleimhaut in der Brunst. Im Metöstrus bemerkten die Autoren<br />
dagegen eine Durchlässigkeit für Markermoleküle, und führten dies auf veränderte Zell-Zell-<br />
Verbindungen zurück.<br />
2.1.3 Das Ejakulat des Bullen<br />
Mittlere Werte für frisches Bullenejakulat sind: 5 (2 - 8) mL Ejakulatvolumen, 1,2 x 10 6 /µL<br />
Spermienkonzentration, gute Massenbewegung und 65 % vorwärtsbewegliche Spermien<br />
(MANN u. LUTWAK-MANN 1981; GASSE 1999; SCHMIDT 2000).Die<br />
Mindestanforderungen der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinderzüchter (ADR 2006) für die<br />
Güte von Bullensperma für Zuchtbullen für den Einsatz in der KB und für Deckbullen lauten:<br />
Zwei bzw. 4 mL Ejakulatvolumen (altersabhängig für Bullen < 2 bzw. > 2 Jahre),<br />
Spermienkonzentration 0,6 x 10 6 /µL, ungestörte Massenbewegung und 70 %<br />
vorwärtsbewegliche Spermien.<br />
2.1.4 Reproduktionszyklus und Anatomie der weiblichen Ziege<br />
Die Ziege ist ein saisonal polyöstrischer Scheidenbesamer mit einem knapp 3-wöchigen<br />
Zyklus. Das Tag-Nacht-Lichtverhältnis ist der Regulator für den Beginn der Brunstsaison, die<br />
zyklische Aktivität wird von kürzer werdenden Tagen gefördert (KÜST u. SCHAETZ 1983).<br />
Die Brunst dauert 1-2 Tage und äußert sich in typischem Verhalten, wie Lebhaftigkeit,<br />
16
Unruhe, Neugierde und Duldung. Üblicherweise werden Suchböcke zur Erkennung brünstiger<br />
Tiere eingesetzt (KÜST KÜST u. SCHAETZ 1983 1983).<br />
Allein auf anatomische Auffälligkeit<br />
Auffälligkeiten en von Scheide und Gebärmutterhals der Ziege sei an<br />
dieser Stelle hingewiesen. Der äußere Muttermund (Ostium uteri externu externum) bzw. der in die<br />
Vagina hineinragende Teil der Zervix (Portio vaginalis cervicis) liegt bei der Ziege auf dem<br />
Boden der Scheide. Die Portio wird speziestypisch von dem kaudalsten der konzentrischen<br />
Faltenkränze, die die Verschlusseinrichtung der Zervix bbilden,<br />
ilden, umfasst (LEISER 1999 1999; Abb.<br />
1). Des Weiteren beschreibt LEISER (1999) bei der Ziege, ähnlich dem Schaf, eine<br />
querstehende Schleimhautfalte auf de dem m Scheidenboden, die der Portio vorgelagert ist und<br />
diese in eine Mulde einbettet. In der Literatur zur Anatomie des Rindes gibt es keinen<br />
Hinweis auf eine abgegrenzte Mulde unmittelbar vor der Portio.<br />
Abb. 1: : Cervix uteri der Ziege, dorsal eröffnet (aus: NICKEL et al. 1999)<br />
2.1.5 Das Ejakulat des Ziegenbockes<br />
Mittlere Werte für frisches Ziegenejakulat sind: 0,5 - 1 mL Ejakulatvolumen, 2,5 x 10 6 /µL<br />
Spermienkonzentration und 65 % vorwärtsbewegliche Spermien (GASSE 1999;<br />
SCHMIDT 2000).<br />
a Corpus uteri<br />
a´´ Ostium uteri internum<br />
b Cervix uteri<br />
b´´ Ostium uteri externum<br />
c Vagina<br />
2.2 Mechanismen der Interaktion im weiblichen Genitale<br />
Beim Scheidenbesamer Rind mit einer geringe geringen Ejakulatmenge von sehr großer Dichte kann<br />
davon ausgegangen gen werden, dass der Zervixmukus schon unmittelbar nach Insemination als<br />
physiologische Barriere im weiblichen Genital Genitale den Übergang von Seminalplasma in den<br />
Uterus, abgesehen von den direkt an die Spermien gebundenen Bestandteilen, verhindert<br />
17
(ROGDER 1975). Seminalplasma-Effekte, die lokal am Inseminationsort Vagina auftreten<br />
bzw. Mechanismen zur Weitervermittlung vom Inseminationsort aus sind also besonders in<br />
Betracht zu ziehen. ROBERTSON formulierte 2005, dass Effekte der Samenexposition über<br />
den unmittelbaren Deponierungsort hinausreichen und Veränderungen in anderen Organen<br />
und Systemen des weiblichen Körpers bewirken können.<br />
Verschiedene Transportwege können an der Effektvermittlung nach vaginaler<br />
Substanzapplikation im weiblichen Genitale beteiligt sein. CICINELLI u.<br />
DE ZIEGLER (1999) nennen bei der Frau: die Passage via Zervikalkanal (intrazervikale<br />
Aspiration), die Absorption in das venöse bzw. lymphatische Zirkulationssystem inklusive<br />
des Austausches von Substanzen nach dem Gegenstromprinzip und die direkte<br />
Gewebediffusion. Neben der vaskulären Versorgung sowie auf das lokale lymphatische<br />
System des weiblichen Genitale wird im Folgenden auch auf den sogenannten „first uterine<br />
pass effect“ kurz eingegangen. Des Weiteren finden in diesem Abschnitt die Mechanismen<br />
der physiologischen Selbstreinigung des Genitaltraktes (insbesondere die vaginale Clearance)<br />
Beachtung.<br />
2.2.1 Blutgefäßsystem<br />
Arterielles System<br />
Die arterielle Versorgung des weiblichen Genitale beim Rind ist in Abb. 2 veranschaulicht.<br />
Die arterielle Versorgung der Beckenhöhlenorgane erfolgt über die A. iliaca interna, die als<br />
paariges Endgefäß aus der Aorta abdominalis hervorgeht (WAIBL u. WILKENS 1996).<br />
Das Gefäßsystem des weiblichen Genitale ist komplex. So besteht beispielsweise eine<br />
Verbindung der A. vaginalis, die aus der A. iliaca interna zur Scheide zieht, über ihren<br />
R. uterinus mit der A. uterina im Bereich der Zervix (WAIBL u. WILKENS 1996). Die<br />
A. uterina versorgt den Uterus und anastomosiert mit ihren eigenen Ästen im Bereich der<br />
Uterushörner, um zusätzlich auch im Mesometrium mit der A. ovarica über deren R. uterinus<br />
in Verbindung zu stehen (WAIBL u. WILKENS 1996). Die vielfältigen Gefäßverbindungen<br />
gerade auf lokaler Ebene sind möglicherweise Voraussetzungen für Informationsaustausch<br />
und Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Abschnitten des Genitals.<br />
18
Venöses System<br />
Die venöse Blutgefäßversorgung des weiblichen Genitals beim Rind begleitet im<br />
Wesentlichen das arterielle System. Eine Besonderheit ist die venöse Versorgung des Uterus.<br />
Die Hauptvenen des Uterus sind die Rr. uterini der V. ovarica und der V. vaginalis sowie die<br />
V. vaginalis accessoria beim Rind, wohingegen die V. uterina, das Begleitgefäß der<br />
A. uterina, funktionell unbedeutend sein soll (WAIBL u. WILKENS 1996). Des Weiteren<br />
beschreiben WAIBL u. WILKENS (1996) beim Rind ein starkes längsgerichtetes<br />
Venengeflecht der genannten Gefäße an der Ventralwand des Geschlechtstraktes. Auch im<br />
Bereich des venösen Systems scheinen also physiologische Voraussetzungen zur lokalen<br />
Vermittlung von Stimuli im weiblichen Genitale gegeben.<br />
Abb. 2: Ausgewählte Arterien am weiblichen Genitale des Rindes (modifiziert nach Bild- und<br />
Textangaben aus: NICKEL et al. 1996)<br />
Austausch nach dem Gegenstromprinzip<br />
Im weiblichen Genitale ist ein lokaler, vaskulärer Austausch von Substanzen nach dem<br />
Gegenstromprinzip (“counter-current exchange”) möglich. So ist beispielsweise für das Schaf<br />
ein Übergang von biologisch wirksamen Substanzen wie PGF2α von der V. uterina in die<br />
19
A. ovarica bekannt (McCRACKEN 1980). Durch diesen Mechanismus kann PGF2α vom<br />
Uterus direkt zum Ovar geführt werden und dort einen luteolytischen Effekt ausüben<br />
(GINTHER 1974; BAIRD 1987). Über den Gegenstromaustausch verschiedener weiterer<br />
Substanzen wie Testosteron, Östradiol, Progesteron und Oxytozin wird bei Schwein und<br />
Schaf berichtet (KRZYMOWSKI et al. 1981; KOTWICA et al. 1982; SCHRAMM et<br />
al. 1986).<br />
Auch in Bezug auf die Effekte des Seminalplasmas wird dieser Gegenstromaustausch<br />
diskutiert. So vermutet ROBERTSON (2005) unter anderem die Vermittlung des counter-<br />
current Mechanismus bei einer, nach genitalem Seminalplasmastimulus beobachteten,<br />
erhöhten Makrophagenpopulation in den Corpora lutea der Maus (GANGNUSS et al. 2004)<br />
bzw. dem von WABERSKI et al. (1997) bei östrischen Sauen festgestellten verkürzten<br />
Intervall zwischen LH-Peak und Ovulation.<br />
Schematisch zeigt Abb. 3, wie die Exposition des Uterus mit Seminalplasma die Entwicklung<br />
des Corpus luteum am Ovar beeinflussen kann. Seminalplasma induziert über seinen<br />
Östrogenbestandteil die Prostaglandinsynthese des porcinen Endometriums (CLAUS 1990),<br />
welche gleichzeitig über eine erhöhte Transkription der Cyclooxygenase-2-mRNA gefördert<br />
wird (O´LEARY et al. 2004). Das synthetisierte PGF2α gelangt per Gegenstromaustausch<br />
zwischen den Gefäßen zum Ovar, ist in der Follikelflüssigkeit nachweisbar und beeinflusst<br />
dort den Gelbkörper (CLAUS 1990; ROBERTSON 2007).<br />
Abb. 3: Substanzaustausch nach dem Gegenstromprinzip am weiblichen Genitale nach Exposition mit<br />
Seminalplasma (COX-2 = Cyclooxygenase-2; PGE2 = Prostaglandin E2; Schematische<br />
Darstellungaus: ROBERTSON 2007)<br />
20
2.2.2 Lokales Lymphsystem<br />
Das Lymphgefäßsystem des weiblichen Genitale beim Rind ist in Abb. 4 dargestellt. Lymphe<br />
aus Uterus, Vagina und Vulva fließt zu den Nll. sacrales und Nll. hypogastrici, welche als<br />
Gruppe in den Anfangsabschnitten der Aa. iliacae internae lokalisiert sind. Auch gelangt<br />
Lymphe vom Uterus zum Nl. iliofemoralis, dem großen inneren Darmbeinlymphknoten, der<br />
am vorderen Rand der A. iliaca externa gelegen ist (VOLLMERHAUS 1996). Der weitere<br />
Lymphabfluss erfolgt vom Nl. iliofemoralis Richtung Nll. iliaci mediales und Truncus<br />
lumbalis. Zum Drainagegebiet der Nll. iliaci mediales, direkt vor der Aufteilung der Aorta in<br />
die Aa. iliacae externae, gehören unter anderem die Eierstöcke des Rindes. Die Nll. inguinales<br />
superficiales nehmen unter anderem Lymphzuflüsse aus dem Bereich Euter, Scham,<br />
Scheidenvorhof und Klitoris auf, welche dann Richtung Nl. iliofemoralis weitergeleitet wird<br />
(VOLLMERHAUS 1996).<br />
Die physiologischen Voraussetzungen zur lokalen Kommunikation über die Lymphgefäße im<br />
weiblichen Genitale sind gegeben und so vermuten CICINELLI u. DE ZIEGLER (1999) auch<br />
eine Beteiligung des humanen lymphatischen Systems als Transportweg für vaginal<br />
applizierte Substanzen. Konkreter hält ROBERTSON (2005) nach ihren Erkenntnissen beim<br />
Menschen und bei der Maus das lokale Lymphsystem mit wandernden inflammatorischen<br />
Zellen für eine mögliche Route zur Vermittlung von Seminalplasmaeffekten im weiblichen<br />
Genitale.<br />
2.2.3 „First uterine pass effect“<br />
Die in der Literatur als „first uterine pass effect“ beschriebene Beobachtung kennzeichnet<br />
eine selektive Anreicherung von vaginal applizierten Substanzen in der Gebärmutter. Ein<br />
lokaler und direkter Transportmechanismus von Vagina zu Uterus wird hinter diesem<br />
Phänomen der selektiven Anreicherung vermutet (DE ZIEGLER et al. 1997). Einen lokalen<br />
Kommunikationsweg zwischen Uterushorn und angrenzendem Ovar legen auch Studien mit<br />
unilateral ligiertem Uterushorn („Mariensee-Modell“) beim Schwein nahe (WABERSKI et<br />
al. 1995). Für das Rind liegen derzeit keine Untersuchungen zum „first uterine pass effect“<br />
vor, weshalb nachfolgend auf Untersuchungen aus der Humanmedizin eingegangen wird.<br />
Voraussetzung für einen lokalen Transportmechanismus im weiblichen Genitale ist die<br />
vaginale Absorption. In ihrem Übersichtsartikel nennen BENZINGER u. EDELSON (1983)<br />
21
diverse Substanzgruppen für die eine vaginale Absorption bei der Frau bekannt ist:<br />
Prostaglandine, Steroide, Antibiotika, Proteine, Antigene und auch anorganische<br />
Komponenten.<br />
Abb. 4: Übersicht der Lymphdrainage am weiblichen Genitale des Rindes (modifiziert nach Bild- und<br />
Textangaben aus: NICKEL et al. 1996)<br />
Konkreter verglichen CICINELLI et al. (1993) die Auswirkungen der vaginalen mit der<br />
nasalen (Spray) Administration von Progesteron bei Frauen. Beide Applikationsrouten führten<br />
zu vergleichbaren Serumleveln, die sekretorische Transformation des Endometriums war<br />
jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt. Nach vaginaler Applikation zeigte sich eine stärkere<br />
funktionelle Beeinflussung des Uterus. Ursache hierfür scheint eine erhöhte lokale<br />
Gewebekonzentration bestimmter Substanzen im Uterus nach vaginaler Applikation zu sein.<br />
Beispielsweise maßen DE ZIEGLER et al. (1997) zehnfach höhere Gewebskonzentrationen<br />
für Progesteron nach vaginaler Applikation im Vergleich zur systemischen Applikation.<br />
22
MILES et al. (1994) verglichen, ebenfalls bei Frauen, die vaginale mit der intramuskulären<br />
Progesterongabe und vermerkten dabei ebenfalls einen erheblichen Unterschied in der<br />
Gewebskonzentration im Endometrium (11,5 ± 2,6 ng/ml nach vaginaler und 1,4 ± 0,4 ng/ml<br />
nach i.m. Aplikation), während die Serumkonzentrationen sich gegenteilig verhielten (11,9 ±<br />
1,2 ng/ml nach vaginaler und 69,8 ± 5,9 ng/ml nach i.m. Applikation).<br />
Der „first uterine pass effect“ beim Menschen ist auch für andere Substanzen beschrieben. So<br />
untersuchten MIZUTANI et al. (1995) die orale und vaginale Gabe von Danazol, eines<br />
Testosteronderivats. Durch die vaginale Administration wurden zur vierfachen oralen Dosis<br />
(400 mg/Tag oral zu 100 mg/Tag) vergleichbare Uterusgewebskonzentrationen erreicht.<br />
2.2.4 Vaginale Clearance<br />
Über die (zeitlichen) Abläufe der physiologischen Selbstreinigung der Vagina, der<br />
sogenannten vaginalen Clearance, ist nicht viel bekannt. Es kommen allgemein verschiedene<br />
Eliminationswege für in der Vagina deponierte Substanzen beim Scheidenbesamer in Frage:<br />
Der Ausfluss bzw. die Ausstoßung über die Vulva, insbesondere im Zusammenhang mit der<br />
Miktion, macht vermutlich einen wesentlichen Anteil an der vaginalen Clearance aus.<br />
Abhängig vom Zyklusstadium und damit vom Öffnungsgrad der Zervix sowie der<br />
Myometriumsaktivität kann ein Teil der vaginal deponierten Substanz über den sich<br />
anschließenden Genitaltrakt bis in die Bauchhöhle (Cavum abdominis) gelangen<br />
(ITURRALDE u. VENTER 1981). Außerdem ist ein Übergang in das umliegende Gewebe<br />
der Vagina, je nach Permeabilität des Gewebes (siehe auch Kapitel 2.1.1.<br />
„Reproduktionszyklus und Anatomie des weiblichen Rindes) und den Eigenschaften der<br />
deponierten Substanz, möglich.<br />
Als beeinflussende Faktoren der uterinen Clearance werden die Aufweitung der Zervix, die<br />
Aktivität des Myometriums und die lymphatische Drainage beim Uterusbesamer Pferd<br />
identifiziert (KATILA 1996). Beim Scheidenbesamer Mensch konzentrieren sich<br />
Untersuchungen zur Persistenz von Ejakulatbestandteilen in der Scheide vor allem auf die<br />
forensischen Aspekte des Spermiennachweises (SILVERMAN u. SILVERMAN 1978;<br />
WILLOTT u. ALLARD 1982; HAIMOVICI u. ANDERSON 1995). Neben den<br />
Spermatozoen haben DAVIES u. WILSON (1974) aber auch die Nachweisbarkeit der Sauren<br />
Phosphatase (AP) sowie Blutgruppen-Antigene des Seminalplasmas in der humanen Vagina<br />
23
untersucht und konnten beide innerhalb von 48 h p.c. sicher nachweisen. Den Test auf Saure<br />
Phosphatase sehen HAIMOVICI u. ANDERSON (1995) allerdings als nur eingeschränkt<br />
aussagekräftig an, da diese auch in vaginalen Sekreten enthalten sein kann.<br />
Für das Rind ist ein Maximum an Spermatozoen in der Vagina 1 - 2 h p.i. bzw. p.c.<br />
(DOBROWOLSKI u. HAFEZ 1970; HAWK 1983) beschrieben. DOBROWOLSKI u.<br />
HAFEZ (1970) vermerken bei ihren Untersuchungen an geschlachteten Rindern zudem einen<br />
deutlichen Abfall der Spermienzahlen innerhalb von <strong>24</strong> h nach der künstlichen Insemination<br />
im Bereich der Vagina. HAWK (1983) hält in seinem Übersichtsartikel zum<br />
Spermientransport im weiblichen Genitale fest, dass, obgleich ein kleiner Teil des Spermien<br />
bereits innerhalb von Minuten die Ovidukte erreicht, ein Großteil des Inseminates bei<br />
Rindern, Schafen, Ziegen und Kaninchen zunächst benachbart zum Ort der Insemination<br />
(Vagina und Zervix) verbleibt. Der Autor benennt den Spermienrückfluss von der Zervix in<br />
die Vagina als wahrscheinlich größten Abgang des zervikalen Spermienpools.<br />
2.3 Seminalplasma<br />
2.3.1 Produktion von Seminalplasma<br />
Der Begriff Seminalplasma kennzeichnet die Sekrete der akzessorischen Geschlechtsdrüsen<br />
und damit die Flüssigphase des Ejakulats. Synonyme sind Samenplasma, Spermaplasma und<br />
Samenflüssigkeit (SCHMIDT 2000; LIEBICH 2004). Bei den akzessorischen<br />
Geschlechtsdrüsen (Glandulae genitales accessoriae) handelt es sich um eine Gruppe<br />
exokriner Drüsen, die ihr Sekret dorsal in das Beckenstück der Harnröhre abgeben<br />
(GASSE 1999).<br />
Der Bulle hat vier akzessorische Geschlechtsdrüsen, von kranial nach kaudal: die beiden<br />
Samenleiterampullen (Ampulla ductus deferentis), die paarige Samenblasendrüse (Glandula<br />
vesicularis), die Vorsteherdrüse (Prostata) und die paarige Harnröhrenzwiebeldrüse (Glandula<br />
bulbourethralis; GASSE 1999; BERG 2000; Abb. 5). Diese Geschlechtsdrüsen liefern die<br />
größte Komponente des Spermas, bestimmen das Volumen des Ejakulats und schaffen für die<br />
Spermien das optimale Stoffwechselmilieu (GASSE 1999).<br />
Scheidenbesamer, wie Bulle und Ziegenbock, haben kleinere Ejakulatvolumina als<br />
Uterusbesamer (MANN u. LUTWAK-MANN 1981; WABERSKI 2007). Die Sekretanteile<br />
<strong>24</strong>
der einzelnen Drüsen im Gesamtejakulat wechseln innerhalb der Ejakulatfraktionen und die<br />
Abgabe der akzessorischen Geschlechtsdrüsen verläuft nicht simultan (GASSE 1999). Für die<br />
Samenblasendrüse gibt BERG (2000) einen Sekretanteil am Gesamtejakulat von 25 - 30 %<br />
beim Bullen und 7 - 8 % beim Ziegenbock an.<br />
1 Vesica urinaria<br />
2 Ureter<br />
3 Plica genitalis<br />
4 Ductus deferens mit<br />
Ampulla ductus deferentis<br />
5 Glandula vesicularis<br />
6 Glandula prostatica (Corpus)<br />
7 M. urethralis<br />
8 Glandula bulbourethralis<br />
9 Bulbus penis<br />
Abb. 5: Akzessorische Geschlechtsdrüsen des männlichen Rindes (aus: NICKEL et al. 1999)<br />
2.3.2 Bestandteile des Seminalplasmas<br />
Das Seminalplasma zeigt sowohl im Volumen als auch in den Inhaltsstoffen, abhängig von<br />
der tierartlichen Ausprägung der akzessorischen Geschlechtsdrüsen, deutliche Unterschiede<br />
(WABERSKI 2007). MANN u. LUTWAK-MANN (1981) geben eine Übersicht von im<br />
Seminalplasma enthaltenen Substanzen, wovon Tab. 1 einen Auszug zeigt. Im<br />
Seminalplasma sind darüber hinaus Östrogene, Androgene, FSH, LH, Prolaktin, hCG und<br />
diverse Prostaglandine enthalten(VENTURA u. FREUND 1973; NEY 1986; WABERSKI<br />
2007).<br />
Wie es jedoch RODGER bereits 1975 formulierte: „The proceeding discussion suggests that<br />
in any approach to the question of the role of a seminal plasma constituent the answer<br />
probably lies within the female tract, for it is after all within this tract that the spermatozoa<br />
fulfill the function for which they were produced.” beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit<br />
den Auswirkungen einer Seminalplasmaapplikation im weiblichen Genitale auf die<br />
25
Fruchtbarkeit, so dass bezüglich der weiteren Bestandsaufnahme und Charakterisierung von<br />
Seminalplasmabestandteilen an dieser Stelle auf vorhandene Literatur (MANJUNATH u.<br />
SAIRAM 1987; WEHRLE 2000; CALVETE u. SANZ 2007; MANJUNATH et al. 2007;<br />
RODRIGUEZ-MARTINEZ et al. 2011) verwiesen wird.<br />
Tab. 1: Zusammensetzung des Seminalplasmas (Auszug aus: MANN u. LUTWAK-MANN 1981)<br />
Menge in mg/100ml Bulle Schafsbock<br />
Gesamt-Stickstoff 440 - 1170 900<br />
Natrium 150 - 370 180<br />
Kalium 50 - 380 90<br />
Kalzium <strong>24</strong> - 60 9<br />
Magnesium 8 6<br />
Chlorid 150 - 390 180<br />
Fruktose 300 - 1000 150 - 660<br />
Sorbitol 10 - 136 26 - 120<br />
Inositol <strong>24</strong> - 46 10 - 15<br />
Ergothionein Spuren Spuren<br />
Glycerylphosphorylcholin 110 - 500 1 600 - 2 000<br />
Zitronensäure 350 - 1 000 300 - 800<br />
Milchsäure 20 - 50 35<br />
Brenztraubensäure 5 10<br />
Ascorbinsäure 6 5<br />
Kreatin 12 15<br />
Bicarbonat(ml CO2/100ml) 16 16<br />
2.3.3 Methoden zur Seminalplasmagewinnung und -aufbewahrung<br />
Die Zentrifugation von Ejakulat ist das Mittel der Wahl um Seminalplasma zu gewinnen. Eine<br />
weitere Option zur Seminalplasmagewinnung ist die Nutzung vasektomierter Tiere, wie unter<br />
anderem von GARNER et al. (2001) und ODHIAMBO et al. (20<strong>09</strong>) für Bullen angeführt.<br />
Eine Übersicht durchgeführter Ejakulatzentrifugationen zur Seminalplasmagewinnung von<br />
Wiederkäuern sowie der genutzten Aufbewahrungstemperatur zeigt Tab. 2.<br />
Tab. 2: Übersicht zur Seminalplasmagewinnung und -aufbewahrung<br />
Tierart Beschleunigung<br />
(g)<br />
Dauer<br />
(min)<br />
26<br />
Aufbewahrung<br />
(°C)<br />
4<br />
Quelle<br />
Rind<br />
1000<br />
10.000<br />
20<br />
30 -20<br />
STRZEMIENSKI 1989<br />
Rind 10.000 30 -100 WOLFE et al. 1993<br />
Rind 3000 30 -70 GILBERT u. FALES 1996<br />
Rind 1000 10 -196 ODHIAMBO et al. 20<strong>09</strong><br />
Schaf 1400 10 -30 BELIBASAKI et al. 2000
2.4 Seminalplasmaeffekte auf das weibliche Genitale und die<br />
Fruchtbarkeit<br />
2.4.1 Überblick über die Funktionen im weiblichen Genitale<br />
Speziesübergreifend gehören zu den wesentlichen Funktionen des Seminalplasmas im<br />
weiblichen Genitale laut eines Übersichtsartikels von ROBERTSON (2005):<br />
• Die Förderung der Überlebensfähigkeit der Spermien,<br />
• die Induktion einer Immunantwort zur Ausbildung der Konzeptustoleranz und<br />
• das Organisieren der Endometriumsveränderungen zur Unterstützung der embryonalen<br />
Entwicklung und Implantation.<br />
Das Vorhandensein von Seminalplasma im weiblichen Genitale bei der Paarung scheint nach<br />
heutiger Sicht unmittelbar verknüpft mit dem Zustandekommen einer Trächtigkeit bei<br />
diversen Spezies. Seminalplasma ist nicht nur Transportmedium für Spermien, sondern wird<br />
als Kommunikationsmittel zwischen männlichem und weiblichem Reproduktionsgewebe<br />
gesehen. Es beeinflusst den weiblichen Genitaltrakt auf vielfältige Weise zur Bereitstellung<br />
eines optimalen Milieus für die nachfolgende Trächtigkeit (ROBERTSON 2005). Auf die<br />
Funktionen des Seminalplasmas wird in den folgenden Kapiteln im Detail eingegangen.<br />
Eingangs erfolgt eine Erörterung aus evolutionärer Sicht. Anschließend sind die<br />
Auswirkungen folgendermaßen gegliedert: immunmodulatorische, psychobiologische,<br />
systemische Effekte, Effekte auf Uterusmotilität und Samenretention, auf das Ovar, auf die<br />
Trächtigkeit und beobachtete Auswirkungen nach Entfernung der akzessorischen<br />
Geschlechtsdrüsen.<br />
2.4.2 Evolutionäre Aspekte<br />
Seminalplasma-Effekte auf das weibliche Tier können nicht nur bei Säugetieren, sondern<br />
auch bei Insekten beobachtet werden (GILLOTT 2003). Die bei vielen Spezies belegten<br />
Auswirkungen des Seminalplasmas sprechen dafür, dass dieses ein wichtiges Hilfsmittel bei<br />
der Interaktion zwischen männlichem und weiblichem Individuum darstellt (ROLDAN et<br />
al. 1992; ROBERTSON 2005).<br />
Das männliche Tier soll über die Applikation der Sekrete seiner akzessorischen<br />
Geschlechtsdrüsen im weiblichen Genitale weitreichende Effekte bei der Paarungspartnerin<br />
bewirken und so die Wahrscheinlichkeit des Zustandekommens einer Trächtigkeit nach<br />
27
erfolgter Paarung erhöhen (ROBERTSON 2005). Da unter den Säugetieren bei über 90 % der<br />
Spezies pro Männchen Paarungen mit mehreren Weibchen erfolgen, ist der Selektionsdruck<br />
hoch, jede Paarung mit größtmöglichem Erfolg zu versehen (ROLDAN et al. 1992). Eine<br />
Varianz seitens des männlichen Individuums in der Reaktionsauslösung im weiblichen<br />
Genital ist die Voraussetzung für postkopulatorische Fortpflanzungsstrategien (ZEH u.<br />
ZEH 2001).<br />
Das Sekret der akzessorischen Geschlechtsdrüsen kann vor diesem Hintergrund als äußerst<br />
erfolgreiche männliche postkopulatorische Reproduktionsstrategie gesehen werden<br />
(ROLDAN et al. 1992), da dieses durch Interaktion mit dem weiblichen Genitaltrakt die<br />
Trächtigkeit über den Zeitpunkt der Paarung hinaus beeinflussen kann. Gleichzeitig soll die<br />
Seminalplasmaapplikation dem weiblichen Organismus eine Abschätzung der Fitness und der<br />
Kompatibilität des Männchens mit den Entscheidungsmöglichkeiten Toleranz oder<br />
Abstoßung erlauben, bevor eigene Ressourcen eingesetzt werden (ZEH u. ZEH 2001).<br />
2.4.3 Immunmodulatorische Effekte<br />
Die immunmodulatorischen Effekte des Seminalplasmas lassen sich in stimulierende und<br />
supprimierende Effekte einteilen. Sie beruhen zum einen auf Mediatorsubstanzen, die im<br />
Seminalplasma enthalten sind und direkt und eigenständig immunmodulatorisch wirken<br />
sollen. Zum anderen induziert Seminalplasma lokal im weiblichen Genitale die Exprimierung<br />
immunmodulatorischer Mediatoren und beeinflusst so indirekt das weibliche Immunsystem.<br />
Immunmodulatorische Mediatorsubstanzen des Seminalplasmas, wie TGF-ß, Zytokine und<br />
Prostaglandine, interagieren mit Epithelzellen von Zervix und Uterus zur Induktion von<br />
zellulären und molekularen Veränderungen, die der klassischen Entzündungskaskade ähneln<br />
und benannt werden als „post-inseminationem inflammatory response“ (TROEDSSON et<br />
al. 2000; TÖPFER-PETERSEN 2007). Bei dieser immunologischen Signalkaskade handelt es<br />
sich um inflammatorische, nichtadaptive Reaktionen. Die Aktivierung der angeborenen<br />
Immunität führt bei Stuten, Sauen und Mäuseweibchen innerhalb von wenigen Stunden zu<br />
lokalem Leukozyteneinstrom, Ödematisierung und Hyperämie (TUNON et al. 2000;<br />
JOHANSSON et al. 2004; O´LEARY et al. 2004, 2006). So stimuliert seminaler TGFß1 die<br />
GM-CSF-Produktion des Mäuseuterus und die Infiltration mit inflammatorischen Zellen<br />
(TREMELLEN et al. 1998). Die postinseminatorische Entzündungsreaktion führt in der Regel<br />
28
nicht zur Embryoabstoßung, sondern scheint den Uterus sogar auf die Implantation des<br />
Embryos vorzubereiten und Voraussetzung für eine erfolgreiche Implantation zu sein<br />
(JOHANSSON et al. 2004; O´LEARY et al. 2004, 2006; TÖPFER-PETERSEN 2007).<br />
Seminalplasma hat neben den immunstimulierenden auch immunsuppressive Wirkungen,<br />
indem es die Funktionsfähigkeit einzelner Komponenten des Immunsystems hemmt.<br />
Supprimiert werden in ihrer Funktion T-Zellen, B-Zellen, NK-Zellen, Makrophagen und das<br />
Komplementsystem (LORD et al. 1977; JAMES u. HARGREAVE 1984; QUAYLE et<br />
al. 1987). So wurde beispielsweise von QUAYLE et al. (1987) an humanen T-Lymphozyten<br />
eine reduzierte Expression des IL-2R, welcher an der Aktivierung der ruhenden T-Zellen<br />
beteiligt ist, beobachtet. TROEDSSON et al. (2000) und ROZEBOOM et al. (2001) benennen<br />
und zeigten anhand von in vitro Experimenten eine durch Seminalplasma ausgelöste<br />
Suppression von Komplement-Aktivierung, PMN-Chemotaxis und Phagozytose für die<br />
Spezies Pferd und Schwein. Außerdem wurde ein durch Seminalplasma verkürzter, nicht<br />
jedoch reduzierter Leukozyteneinstrom in den Uterus registriert (TROEDSSON et al. 2001).<br />
ROBERTSON et al. (1997) beobachteten nach Seminalplasmaapplikation bei weiblichen<br />
Mäusen eine herabgesetzte Empfindlichkeit der Typ-1 Immunität gegenüber männlichem<br />
MHC-Antigen und sehen darin die Induktion einer Immuntoleranz gegenüber spezifischen<br />
männlichen Antigenen durch Seminalplasma.<br />
Die immunregulatorischen Wirkungen des Seminalplasmas gehen über eine direkte<br />
Stimulierung bzw. Supprimierung durch eigene Inhaltsstoffe hinaus. Aufgrund einer<br />
Seminalplasmaexposition werden auch die uterinen Epithelzellen selbst zur Expression von<br />
proinflammatorischen Zytokinen und Chemokinen wie IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, Interferon-γ,<br />
CXCL-8, LIF und GM-CSF anregt (Mensch: GUTSCHE et al. 2003; ROBERTSON et al.<br />
2003; Maus: JOHANSSON et al. 2004; Schwein: O´LEARY et al. 2004).ROBERTSON<br />
(2005) zeigt hierzu eine Übersicht der Signalwege (Abb. 6) und nennt neben der<br />
Immunregulierung auch die Modellierung des Endometriumgewebes als eine Auswirkung der<br />
Seminalplasmaexposition.<br />
Das Zytokin GM-CSF beispielsweise zählt zu den embryotropen Zytokinen und wirkt durch<br />
Inhibition der Apoptose sowie eine erleichterte Glukoseaufnahme der Blastomeren auf die<br />
Blastozystenformation des präimplantierten Mäuseembryos (ROBERTSON u. SHARKEY<br />
29
2001). Auch SJÖBLOM et al. (1999) berichten über positive Auswirkungen von GM-CSF auf<br />
die Entwicklung humaner Blastozysten in vitro. CLARKE (1984) nennt sogar<br />
immunmodulatorische Auswirkungen der Samenexposition auch außerhalb des<br />
Reproduktionstraktes am weiblichen Tier und stellt fest, dass diese von zentraler Bedeutung<br />
für den Ablauf der Thymusveränderungen ist, die mit einer Trächtigkeit einhergehen.<br />
Abb. 6: Signalwege im weiblichen Genital nach Seminalplasmaexposition (GM-CSF = Granulocyte-<br />
macrophage colony-stimulating factor; IL-6 = Interleukin 6; LIF = Leukemia inhibitory factor;<br />
aus: ROBERTSON 2005)<br />
2.4.4 Systemische Effekte<br />
Der Übergang von vaginal applizierten Substanzen bzw. Bestandteilen des Seminalplasmas in<br />
den peripheren Blutkreislauf ist bekannt (KELLER et al. 1981; BENZINGER u. EDELSON<br />
1983; JACOBSEN et al. 1984; NEY 1986; CLAUS 1990). Eine förderliche Rolle bei der<br />
Absorption von vaginal applizierten Substanzen spielen möglicherweise sogenannte<br />
Permeabilitätsenhancer, Substanzen zur Beeinflussung der Gewebedurchlässigkeit.<br />
Beispielsweise ist das im Seminalplasma enthaltene Citrat ein Permeabilitätsenhancer, der<br />
geeignet ist die Barriereeigenschaften von Zell-Zell-Verbindungen der Vaginalschleimhaut zu<br />
beeinflussen und parazelluläre Diffusion zu zulassen. (MANN u. LUTWAK-MANN 1981;<br />
OKADA et al. 1982, 1983;CHO et al. 1989). Die Voraussetzungen für systemische Effekte<br />
30
des Seminalplasmas sind gegeben und insbesondere sind die Auswirkungen auf die<br />
Hormonsekretion der Hypophyse untersucht.<br />
In einem Bioassay aus Hypophysenzellen der Ratte konnten PAOLICCHI et al. (1999) durch<br />
Zugabe von Seminalplasma des Alpakas eine signifikant gesteigerte LH-Sezernierung<br />
erzielen, was die Autoren als Hinweis sehen, dass Seminalplasmafaktoren an der LH-<br />
Sekretion und damit an der induzierten Ovulation des Alpaka beteiligt sind.LI et al. (2002)<br />
maßen die Konzentrationen von LH, FSH, Oestradiol-17ß und Progesteron im Blutplasma<br />
von Trampeltieren (Camelus bactrianus, induzierter Ovulator) vor und nach intramuskulärer<br />
Seminalplasmaapplikation. Fünf Stunden nach intramuskulärer Applikation waren die LH-<br />
Konzentrationen in der Seminalplasmagruppe signifikant erhöht, auf die anderen<br />
Hormonkonzentrationen zeigte sich kein Effekt.<br />
ADAMS et al. (2005) identifizierten einen ovulationsauslösenden Faktor (OIF) im<br />
Seminalplasma von Lama und Alpaka, welchen RATTO et al. (2006) auch für das<br />
Seminalplasma des Bullen belegten. Im Ejakulat des Lamas (Lama glama) sind circa 3 mg<br />
enthalten (TANCO 2008). Der OIF wirkt speziesübergreifend und ist sowohl bei Reflex- als<br />
auch Spontanovulatoren konserviert, wie RATTO et al. (2006) anhand der<br />
ovulationsauslösenden Wirkung einer intramuskulären Applikation von Bullen-<br />
Seminalplasma bei weiblichen Lamas beweisen konnten.<br />
2.4.5 Effekte auf die Uterusmotilität und Samenretention<br />
Aus Untersuchungen zur Uterusmotilität ist bekannt, dass diese nicht nur durch den Akt der<br />
Bedeckung sondern auch durch die Deponierung des Samens beeinflusst wird. Verschiedenen<br />
Bestandteilen des Seminalplasmas wird eine motilitätsstimulierende Wirkung zugeschrieben<br />
und die zyklusabhängige Richtung der Kontraktionswellen bestimmt Verweildauer und -ort<br />
des Ejakulates.<br />
Die Uterusmotilität des Rindes unterliegt, in Abhängigkeit vom Sexualzyklus,<br />
Schwankungen, deren Kontraktionskurven insbesondere für den Östrus weitestgehend typisch<br />
sind. Im Östrus und frühen Postöstrus verlaufen die Kontraktionswellen von der Zervix zu<br />
den Tuben (DÖCKE 1962). Neben kurzzeitigen Motilitätspeaks bereits bei Sichtkontakt mit<br />
dem Bullen sowie beim Beriechen der Vulva, beim Aufsprung und bei der Kopulation,<br />
31
konnten VAN DEMARK u. HAYS (1952) deutlich verstärkte Uteruskontraktionen bei der<br />
Ejakulation feststellen. Die Aktivierung der Uterusmotilität, mittels Ballonkymograph<br />
gemessen, war im Östrus stärker ausgeprägt als im Postöstrus. Der Deckakt bewirkt laut<br />
DÖCKE (1962) in allen Zyklusphasen beim weiblichen Rind eine wesentlich stärkere<br />
Uteruskontraktion als die Künstliche Besamung.<br />
In seinen Versuchen zur Reaktion des porcinen Uterus auf Infusion mit eberspermaähnlichen<br />
Östrogenmengen wies CLAUS (1990) eine erhöhte Myometriumsaktivität nach. Das im<br />
Seminalplasma enthaltene Prostaglandin hat einen stimulatorischen Effekt auf die uterinen<br />
glatten Muskelzellen bei Mensch und Schaf (EULER 1936, BYGDEMAN u.<br />
ELIASSON 1963). VENTURA (1969) wies eine Aktivierung der Uterusmuskulatur durch<br />
Samen bzw. Sekrete der seitlichen und hinteren Anteile der Prostata der Ratte in vitro nach. In<br />
einer weiteren Untersuchung des Autors am isolierten Rattenuterus zeigte sich 1 mL<br />
Rattenejakulat hinsichtlich der spasmogenen Eigenschaften äquivalent zu 200 ng PGE1<br />
(VENTURA u. FREUND 1973). Allerdings sehen VENTURA u. FREUND (1973) nicht<br />
allein die Prostaglandine als Urheber der Uterusaktivierung, sondern vielmehr spasmogene<br />
Substanzen, die chemisch und physikalisch den Gangliosiden ähneln.<br />
Die intrakorporale und endoskopisch intrauterine Besamung auf die Papille löst, im Vergleich<br />
zur unbesamten Kontrollgruppe, eine signifikant stärkere mittlere Kontraktionsaktivität der<br />
Gebärmutter aus, stellte KÖLLMANN (2004) in ihren ultrasonographischen Untersuchungen<br />
an Stuten fest. Ein Zusatz von 4 mL Verdünnermedium führte nicht zu einer, der Spermadosis<br />
vergleichbaren, Kontraktionsaktivität. Der Zusatz von 3,5 mL Seminalplasma zur<br />
Inseminationsdosis dagegen verursachte bei Stuten eine signifikant höhere<br />
Kontraktionsfrequenz, wie PORTUS et al. (2005) ebenfalls per Ultrasonographie 10 min und<br />
6 h post inseminationem ermittelten.<br />
2.4.6 Effekte auf das Ovar und den Gelbkörper<br />
Die beschriebenen Seminalplasmaeffekte am Ovar reichen von der Vorverlegung bzw.<br />
Auslösung der Ovulation über die Atresie des dominanten Follikels bzw. größeren<br />
präovulatorischen Follikeln bis hin zu erhöhter Progesteronproduktion und vergrößerter<br />
Makrophagenpopulation in den Corpora lutea.<br />
32
Vorangestellt einige Erkenntnisse bei Insekten: Bei Melanoplus sanguinipes (Grashüpferart)<br />
üben Komponenten der akzessorischen Geschlechtsdrüsen eine Triggerfunktion für die<br />
Oviposition aus. Dadurch sind die Weibchen der Spezies in der Lage, ovulierte Eier in den<br />
lateralen Eileitern für kurze Zeit aufzubewahren, bis die Umstände zur Eiablage günstig sind<br />
(YI u. GILLOTT 2000). Sogenannte „fecundity-enhancing substances“ (FES) der männlichen<br />
akzessorischen Geschlechtsdrüsen der Fruchtfliegen (Drosophila) stimulieren die Ovulation<br />
und/oder die Oviposition (Eileiterperistaltik zum Eitransport) und bewirken so eine Erhöhung<br />
der Fruchtbarkeit. Auch gibt es Hinweise zur beschleunigten Eientwicklung bei Anwesenheit<br />
der Drüsensekrete (GILLOTT u. FRIEDEL 1977, GILLOTT 2003).<br />
Bei Sauen fanden WABERSKI et al. (1997) ebenfalls eine Vorverlegung der Ovulation<br />
nachdem eine Seminalplasmainfusion in den Uterus (Modell Mariensee) durchgeführt wurde.<br />
Hier betrug die Vorverlegung durchschnittlich 10,7 (8 - 14) h. Außerdem konnte bei den<br />
östrischen Sauen dieser Studie ein verkürztes Intervall zwischen LH-Anstieg und Ovulation<br />
nach der Seminalplasmaapplikation festgestellt werden.<br />
In einer Studie beim Trampeltier (Camelus bactrianus) induzierte durch Zentrifugation<br />
gewonnenes, vaginal appliziertes Seminalplasma die Ovulation bei 75 % der Kamelstuten.<br />
Das Sekret vasektomierter Kamelhengste, teils mittels künstlicher Vagina gewonnen und teils<br />
durch natürliche Bedeckung appliziert, führte bei 100 % der Stuten zur Ovulation. Dagegen<br />
hatte die vaginale Applikation einer konzentrierten Spermiendosis keinen<br />
ovulationsinduzierenden Effekt (CHEN et al. 1985). Nach intramuskulärer Applikation von<br />
Seminalplasma, ebenfalls an Trampeltieren durchgeführt, erfolgt die Ovulation 30 - 40 h<br />
später, was demselben Zeitraum wie nach Koitus oder artifizieller Insemination entspricht (LI<br />
et al. 2002).<br />
Bei Koalas (Phascolarctos cinereus) wurde ein signifikanter Effekt der Samenexposition des<br />
weiblichen Genitals auf die Induktion der Lutealphase festgestellt (JOHNSTON et al. 2004).<br />
Die genitale Stimulation ohne Anwesenheit von Samen reichte nicht aus.<br />
Für das Rind beschrieb MARION (1950) eine signifikante Vorverlegung des<br />
Ovulationszeitpunktes um 2,2 h, wenn die Färsen innerhalb der ersten 6 - 8 h der klinischen<br />
Brunst durch einen vasektomierten Bullen gedeckt wurden. TANCO (2008) führte Studien zu<br />
33
Auswirkungen des ovulationsauslösenden Faktors (OIF) beim Rind sowie zur Beeinflussung<br />
der OIF-Dosis beim Lama durch. Die intramuskuläre Applikation von aufgereinigtem<br />
Ovulationsauslösenden Faktor aus dem Ejakulat von Lamas (Lama glama) induzierte beim<br />
Rind die Atresie des dominanten Follikels und eine Vorverlegung der nächsten Follikelwelle,<br />
jedoch keine Ovulation. Weiterhin stellte die Autorin eine dosisabhängige Beeinflussung der<br />
Ovulation durch den OIF bei Lamas fest: Je höher die OIF-Dosis (60 - 500 µg), desto höher<br />
Ovulationsinzidenz, desto größer der maximale Corpus luteum Durchmesser und desto höher<br />
die Progesteron- und LH-Konzentrationen im Plasma.<br />
Bei Sauen wurden die Auswirkungen einer transzervikalen, intrauterinen<br />
Seminalplasmaexposition auf die Ovarien anhand von Ovulationsrate, Anzahl und Größe der<br />
Corpora lutea, ovarieller Leukozytenpopulation und Progesteronproduktion untersucht. Hier<br />
fanden sich eine verstärkte Rekrutierung von Leukozyten (vornehmlich Makrophagen) im<br />
Eierstocksgewebe, Zunahmen der Gelbkörpergröße und erhöhte Progesteronkonzentrationen<br />
im Plasma, wohingegen die Anzahl der Ovulationen nicht beeinflusst war (O´LEARY et<br />
al. 2006). GANGNUSS et al. (2004) untersuchten den Makrophagenanteil in den Gelbkörpern<br />
von Mäusen nach Paarung der Weibchen mit vasektomierten Männchen. Die Autoren stellten<br />
bei Abwesenheit von Seminalplasma in den ersten vier Tagen nach der Paarung eine<br />
reduzierte Rekrutierung der Makrophagenpopulation fest, die nicht von Auswirkungen auf die<br />
Progesteronkonzentration im Serum der Weibchen begleitet wurde.<br />
2.4.7 Effekte auf Implantation, embryonale Mortalität und Trächtigkeit<br />
Untersuchungen an Schweinen zeigen, dass eine Seminalplasmaapplikation zu erhöhten<br />
Embryonenzahlen sowie verbesserten Konzeptions- und Abferkelraten führt. An Mäusen<br />
wurden nach Paarung mit Männchen ohne Seminalvesikel verminderte Implantationsraten<br />
festgestellt. In der Humanmedizin steht vor allem die Seminalplasmaapplikation zur<br />
Verbesserung der assistierten Reproduktion im Fokus der Untersuchungen. An Rindern wurde<br />
eine Studie durchgeführt, die eine geringe Menge von 0,5 mL Seminalplasma der<br />
Inseminationsdosis hinzufügte (ODHIAMBO et al. 20<strong>09</strong>).<br />
ROZEBOOM et al. (2000) erzielten bei Sauen nach vorangegangenem inflammatorischem<br />
Stimulus (tote Spermatozoen oder LPS, intrauterin) durch Zugabe von 100 mL<br />
Seminalplasma zur Inseminationsdosis signifikant höhere Konzeptions- und Abferkelraten im<br />
34
Vergleich zur Insemination mit Verdünnermedium. O´LEARY et al. (2004) beobachteten<br />
nach intrauteriner Infusion von 100 mL Seminalplasma bei Sauen signifikant erhöhte<br />
Embryonenzahlen und eine verbesserte Embryoentwicklung, gemessen anhand der mittleren<br />
Anzahl der Blastomeren bzw. des Embryonendurchmessers an den Tagen 5 bzw. 9 d p.i. im<br />
Vergleich zur Kontrollgruppe (Infusion mit PBS). Außerdem waren die 34 h post<br />
inseminationem isolierten Genitaltrakte nach Seminalplasmaexposition im Durchschnitt 68 %<br />
schwerer und die Autoren beurteilten die Organe subjektiv als stärker vaskularisiert<br />
(O´LEARY et al.2004).<br />
BROMFIELD (2006) führte Studien zur physiologischen Bedeutung der uterinen<br />
Seminalplasmaexposition mit männlichen Mäusen, deren Seminalvesikel entfernt worden<br />
waren, durch. Der Autor beschreibt eine reduzierte Implantation sowie Nachwuchs, der<br />
vermehrt übermäßiges Wachstum nach der Geburt bzw. Adipositas im ausgewachsenen<br />
Zustand zeigt, wenn keine Seminalplasmaexposition stattgefunden hat.<br />
Die Förderung der Implantation des Embryos erfolgt über Mediatoren, die im Rahmen der<br />
durch Seminalplasma ausgelösten, inflammatorischen Signalkaskade freigesetzt werden.<br />
Diese Mediatoren beeinflussen die Zelladhäsion der murinen uterinen Epithelzellen, welche<br />
zum Zeitpunkt der Implantation von entscheidender Bedeutung für die Verbindung von<br />
Blastozyste und Uterusepithel ist, hält ROBERTSON (2005) in ihrem Übersichtsartikel fest.<br />
Außerdem nennt die Autorinden Einfluss der Zytokine auf die Entwicklung des Embryos,<br />
nachdem Seminalplasma deren Abgabe aus dem Endometriumsepithel induziert hat (Abb. 6;<br />
ohne Speziesangabe; ROBERTSON 2007).<br />
Durch zusätzliche Deponierung von Sperma im kranialen Abschnitt der Vagina konnten<br />
BELLINGE et al. (1986) eine mehr als verdoppelte Implantationsrate, gemessen am Anstieg<br />
des humanen Gonadotropin (hCG), bei Frauen eines in vitro-Fertilisationsprogrammes<br />
erzielen. COULAM u. STERN (1995) setzten Seminalplasma in Form von Vaginalkapseln<br />
bei Frauen ein, die aus unbekannter Ursache infertil waren und/oder spontane Aborte erlitten<br />
hatten. Gesteigerte Implantationsraten von 80 % verglichen mit 67 % in der Placebogruppe<br />
wurden mittels Ultraschalluntersuchung in der sechsten Woche p.i. festgestellt. Ebenfalls am<br />
Menschen untersuchten TREMELLEN et al. (2000) die Auswirkungen von<br />
Geschlechtsverkehr auf die Schwangerschaftsrate nach assistierter Reproduktion (IVF, ET).<br />
35
Im Vergleich zur enthaltsamen Gruppe zeigte sich 6 - 8 Wochen nach dem Embryotransfer<br />
eine signifikant höhere Anzahl an lebensfähigen Embryonen bei den Frauen mit<br />
Ejakulatexposition. Die Schwangerschaftsraten unterschieden sich mit 23,6 und 21,2 % nicht<br />
signifikant. Die intravaginale und intrazervikale Seminalplasmaapplikation begleitend zu IVF<br />
und ICSI war Gegenstand einer Pilotstudie von WOLFF et al. (20<strong>09</strong>). Die Autoren nehmen<br />
die nicht signifikanten, verbesserten Schwangerschaftsraten durch Seminalplasma als<br />
Grundlage zur Kalkulation der Patientenzahlen einer weiteren Studie.<br />
ODHIAMBO et al. (20<strong>09</strong>) untersuchten die Konzeptionsraten von synchronisierten Fleisch-<br />
und Milchrindern nach einem Zusatz von 0,5 mL Seminalplasma, rekombinantem humanem<br />
transforming growth factor (40 ng rhTGF-ß1 in BSA) oder 0,5 mL bovinem Serumalbumin<br />
(BSA) zur Besamungsdosis. Die Applikation des Zusatzes erfolgte intrauterin 12 h vor der<br />
Insemination (bei den Tieren der Versuchsreihen in den Jahren 2003 und 2004, Fleischrinder)<br />
und unmittelbar vor der Insemination (bei den Tieren der Versuchsreihen in den Jahren 2005<br />
und 2006, Fleisch- und Milchrinder). Die Kontrollgruppe bestand teilweise aus BSA-<br />
behandelten Tieren (2003-2005, Fleischrinder) und teilweise aus unbehandelten Tieren (2005:<br />
Fleischrinder, 2005-2006: Milchrinder).Die Autoren bemerkten große Unterschieden<br />
innerhalb der Versuchsgruppen zwischen den Versuchsjahren, so variierten beispielsweise die<br />
Trächtigkeitsraten in der SP-Gruppe zwischen 37,8 % und 67 % (2003-2006, Fleisch- und<br />
Milchrinder). In den Versuchsjahren mit SP-Applikation unmittelbar vor der Insemination<br />
und unbehandelter Kontrollgruppe zeigte die Seminalplasmagruppe verbesserte<br />
Trächtigkeitsraten von 37,8 % (Milchrinder) bzw. 61,4 % (Fleischrinder) gegenüber 33,2 %<br />
bzw. 52,4 % in den Kontrollgruppen (2005-2006, nicht signifikant).<br />
2.4.8 Psychobiologische Effekte<br />
Unter psychobiologischen Seminalplasmaeffekten sind diejenigen aufgeführt, die<br />
Auswirkungen auf das Verhalten bzw. die Stimmung des weiblichen Individuums<br />
beschreiben. Hierzu gibt es in der Literatur vor allem Hinweise bei Insekten, aber auch aus<br />
dem Bereich der Humanmedizin.<br />
Das Sekret der männlichen akzessorischen Drüsen beeinflusst das Reproduktionsverhalten der<br />
weiblichen Fruchtfliegen (Drosophila). So schließt sich nach der Paarung bei einigen<br />
Drosophila-Arten für die Weibchen eine Phase ohne Paarungsbereitschaft an. Ob es sich um<br />
36
aktive Ablehnung oder um Abnahme der Attraktivität weiterer Paarungspartner handelt, ist<br />
ungeklärt (GILLOTT 2003). Neben einem Effekt auf die Paarungsbereitschaft der Weibchen<br />
berichtet WOLFNER (2007) bei Drosophila melanogaster über eine Beeinflussung des<br />
Fressverhaltens und der Lebensdauer durch Proteine der akzessorischen Geschlechtsdrüsen<br />
(Acp´s).<br />
Für den Menschen stellt NEY (1986) in seinem Übersichtsartikel zur vaginalen Absorption<br />
von Ejakulatsbestandteilen eine Hypothese zu neurologischen Auswirkungen der<br />
Samenexposition bei der Frau auf. Möglicherweise beeinflussen absorbierte Substanzen,<br />
insbesondere die Prostaglandine, die Stimmung der Frau. In einer Studie von GALLUP et<br />
al. (2002), die den Gebrauch von Kondomen als indirekten Indikator für eine<br />
Samenexposition im weiblichen Genitale der Frau nutzten, wurde der Zusammenhang<br />
zwischen Samenexposition, sexueller Aktivität und Depressionssymptomen untersucht.<br />
Frauen, deren Partner keine Kondome verwendeten, waren nach dem psychologischen<br />
Testverfahren nach Beck (BDI) seltener depressiv.<br />
2.4.9 Effekte nach Entfernung der akzessorischen Geschlechtsdrüsen<br />
Untersuchungen an männlichen Tieren nach Entfernung ihrer akzessorischen<br />
Geschlechtsdrüsen widmen sich vor allem der Analyse des Ejakulates bzw. den<br />
Auswirkungen auf die Spermien. Es sind jedoch auch Untersuchungen zu den Auswirkungen<br />
einer Paarung mit Männchen, deren Geschlechtsdrüsen entfernt worden waren, auf das<br />
Weibchen bzw. auf die nachfolgende Trächtigkeit gemacht worden.<br />
CHEN et al. (2002) testeten in einer Studie, ob die Sekrete der akzessorischen<br />
Geschlechtsdrüsen die DNA der Spermien gegen oxidativen Stress schützen. Hierzu<br />
entfernten sie die Geschlechtsdrüsen beim Goldhamster ganz oder teilweise. Anhand zweier<br />
Testverfahren stellten sie bei denjenigen Spermien, die keinem Sekret ausgesetzt gewesen<br />
waren, vermehrte DNA-Schädigung fest.<br />
Die Paarung weiblicher Mäuse mit Männchen, deren Seminalvesikel chirurgisch entfernt<br />
waren, führte zu einer halbierten Makrophagenpopulation in den Corpora lutea am Tag nach<br />
der Paarung, verglichen mit Tieren, die mit intakten oder vasektomierten Tieren angepaart<br />
waren (GANGNUSS et al. 2004). PEITZ u. OLDS-CLARKE (1986) untersuchten die<br />
37
Fruchtbarkeit nach Paarung mit Seminalvesikel-defizienten Mäusemännchen. Sie vermerkten<br />
eine reduzierte Trächtigkeitsrate und eine Verlängerung der Tragezeit, die durchschnittliche<br />
Wurfgröße blieb dabei unverändert. BROMFIELD (2006) beobachtete reduzierte<br />
Implantationsraten bei weiblichen Mäusen nach Paarung mit Männchen, deren<br />
Seminalvesikel entfernt worden waren. Die Fertilität von Ratten, deren akzessorische<br />
Geschlechtsdrüsen entfernt worden waren untersuchten QUEEN et al. (1981). Nach<br />
Entnahme der dorsolateralen Anteile der Prostata bzw. der Seminalvesikel zeigte sich<br />
Infertilität. Die Entnahme von ventralen Anteilen der Prostata blieb ohne Auswirkungen auf<br />
die Fertilität. Die Veränderungen von Eberejakulaten nach Entfernung der Samenblasendrüse<br />
untersuchten DAVIES et al. (1975). Die Autoren bemerkten eine deutliche<br />
Konsistenzänderung der Ejakulate, eine reduzierte Spermienkonzentration, jedoch gleichzeitig<br />
ein unverändertes Verhältnis der lebenden/toten Spermatozoen. Neben weiteren<br />
Auswirkungen auf einzelne Seminalplasmabestandteile berichteten die Autoren dieser Studie<br />
über keine signifikante Verschlechterung der Fruchtbarkeit nach Insemination von Sauen mit<br />
dem Ejakulat von Samenblasen-defizienten Ebern.<br />
An Rinderejakulaten untersuchten HESSA et al. (1960) diverse Parameter vor und nach der<br />
Entfernung der Samenblasendrüsen. Die Autoren vermerkten eine Halbierung des<br />
Ejakulatvolumens, eine signifikant höhere Spermiendichte, aber einen geringeren Anteil an<br />
motilen Spermien. Außerdem war der pH in postoperativen Ejakulaten signifikant erhöht und<br />
die Konzentrationen von Fruktose und Citrat extrem niedrig. Auch SHAH et al. (1968)<br />
analysierten das Sekret des Bullen vor und nach Entfernung der Samenblasendrüse. Neben<br />
einer Volumenverminderung führte die Exzision der Drüsen zu verminderten Fruktose-,<br />
Citrat-, Kaliumkonzentrationen sowie zur Reduktion der Aktivität der alkalischen<br />
Phosphatase in der spermienreichen Phase. Erhöhte Werte wurden dagegen für Chlorid,<br />
Glycerylphosphorylcholin und freie Aminosäuren gemessen. Unverändert blieben pH und<br />
Natriumkonzentration.<br />
2.5 Relevante reproduktionsmedizinische Techniken<br />
2.5.1 Artifizielle Insemination<br />
Die Artifizielle Insemination (AI), auch Künstliche Besamung (KB) genannt, spielt weltweit<br />
in der Rinderzucht, vor allem bei den Milch- und Zweinutzungsrindern, eine bedeutende<br />
38
Rolle. Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinderzüchter e.V. beziffert für Deutschland im<br />
Jahr 2010 insgesamt knapp 13 Mio Rinder, davon 4,2 Mio Milchkühe und insgesamt mehr<br />
als 4,3 Mio Erstbesamungen, betreut von 22 Besamungsstationen (ADR 2011). Durch die<br />
Nutzung der artifiziellen Insemination wird die flächendeckende, hochselektive Zucht<br />
insbesondere in Bezug auf bestimmte Merkmale wie Leistung, Tiergesundheit und<br />
Fruchtbarkeit vereinfacht. Die Kryokonservierung von Spermien ist dabei die Voraussetzung<br />
für den zeitlich und räumlich unbegrenzten Einsatz des Spermas im Rahmen der artifiziellen<br />
Insemination (ZELFEL u. MÜLLER 2007). Das Absetzen der Inseminationsportion erfolgt<br />
beim Rind intrazervikal, intrauterin (Standard) oder tief intracornual (BUSCH 2007). Das<br />
Besamungsergebnis liegt bei Erstbesamungen in Deutschland zwischen 51,3 und 72,9 %<br />
(BUSCH u. WABERSKI 2007). In einer vergleichenden Untersuchung zweier<br />
Inseminationsgeräte kamen VERBERCKMOES et al. (2005) auf 57,6 % Trächtigkeitsrate bei<br />
intrauteriner Besamung mit der Cassou-Pipette. STAUFENBIEL (2005) führt<br />
Konzeptionsergebnisse nach Erstbesamung zwischen 41,6 - 56,1 % an für Rinder in Betrieben<br />
mit Jahresmilchleistungen von über 10.000 kg Milch.<br />
2.5.2 Embryotransfer<br />
Der Embryotransfer (ET) stellt eine biotechnische Methode zur verbesserten Nutzung des<br />
genetischen Potentials weiblicher Tiere dar (ZEROBIN u. BINDER 20<strong>09</strong>). Vom Spendertier<br />
werden nach Superovulation und artifizieller Insemination Embryonen aus dem Uterus<br />
ausgespült und auf verschiedene, zyklussynchronisierte Empfängertiere übertragen. Im Jahr<br />
2010 sind in Deutschland bei der Spezies Rind 15.553 Embryonen übertragen worden und die<br />
durchschnittliche Anzahl an transfertauglichen Embryonen pro Spülung lag bei<br />
5,0 Embryonen (ADR 2011). Im Vergleich dazu lauten die europäischen ET-Daten:<br />
100.678 übertragene Embryonen und durchschnittlich 5,82 transfertaugliche Embryonen pro<br />
Spülung (MERTON 2011). Deutschland steht nach Anzahl der durchgeführten<br />
Embryotransfers innerhalb von <strong>24</strong> europäischen Ländern im Jahr 20<strong>09</strong> an dritter Stelle. Die<br />
Klassifizierung der Qualität der Embryonen erfolgt nach den Kriterien der International<br />
Embryo Transfer Society (IETS). Die Übertragung der Embryonen erfolgt entweder sofort im<br />
Anschluss an die Spülung (Frisch-Embryonen) oder nach Kryokonservierung (TG-<br />
Embryonen). Europaweit betrug der Anteil tiefgefrorener Embryonen an den<br />
Übertragungen 57 % (MERTON 2011). Bei optimalem Transferverlauf kann beim Rind laut<br />
39
WRENZYCKI u. NIEMANN (2007) mit Trächtigkeitsraten von etwa 55 - 65 % gerechnet<br />
werden.<br />
2.5.3 Seminalplasma im Kontext der artifiziellen Insemination und des<br />
Embryotransfers<br />
Die beim Milchrind in Deutschland üblicherweise im Rahmen der artifiziellen Insemination<br />
eingesetzten Besamungsportionen haben ein Volumen von 0,25 mL (feine Paillette;<br />
LEIDING 2007), was 1/20 des durchschnittlichen Ejakulatvolumens des Bullen entspricht<br />
(siehe Kapitel 2.1.3. „Das Ejakulat des Bullen“). Auch geht mit dem Einsatz von<br />
Verdünnermedium und der Portionierung auf 15 x 10 6 Spermatozoen/Besamungsportion bei<br />
Tiefgefriersperma (LEIDING 2007) eine weitgehende Verdünnung des Seminalplasmas<br />
einher. Das heutzutage übliche Prozedere der künstlichen Besamung stellt also, bezogen auf<br />
das Seminalplasma, sowohl eine Volumen- als auch eine Konzentrationsreduktion dar. Bei<br />
der Durchführung des Embryotransfers findet keine Exposition des Rezipienten mit<br />
Seminalplasma statt. Es kann vermutet werden, dass Seminalplasmaeffekte im weiblichen<br />
Genitale in diesen Fällen nicht erzielt werden und dass eine, durch das Seminalplasma<br />
bedingte, Milieuoptimierung für den Konzeptus im weiblichen Tier nicht erreicht wird.<br />
2.6 Zytologische Präparate des weiblichen Genitale<br />
2.6.1 Zytobrush-Methode<br />
Die Anfertigung zytologischer Präparate aus bestimmten Abschnitten des weiblichen<br />
Genitaltraktes ist ein Instrument zur Diagnose von subklinischen Endometritiden. Bei der<br />
Einordnung der Zytologie ist der Anteil polymorphkerniger Granulozyten (PMN)<br />
entscheidend und ein erhöhter Anteil an Neutrophilen im endometrialen Zytologiepräparat ist<br />
ein Zeichen für eine akute Inflammation, halten DASCANIO et al. 1997speziesübergreifend<br />
fest. Im Gegensatz zur Anfertigung histologischer Präparate, die eine Biopsie erfordern, ist<br />
die Durchführung einer exfoliativen Zytologie mittels Zytobrush minimal invasiv. Die<br />
Anwendung der Zytobrush-Methode (Gynobrush®) hat keinen Einfluss auf die<br />
Erstbesamungsergebnisse, wie KAUFMANN et al. (20<strong>09</strong>) in einem Vergleich mit einer<br />
unbehandelten Kontrollgruppe zeigte.<br />
Eine relativ einfache Probengewinnung, die schnelle Fixation vor Ort sowie die Möglichkeit<br />
zur Probensammlung undspäteren Auswertung im Labor sind weitere Vorteile der Zytologie<br />
40
gegenüber Lavage und Biopsie. Zudem sind Zytologieproben laut Paragraph 6 des<br />
Tierschutzgesetzes, im Gegensatz zu Biopsien keine Gewebeentnahmen (TierSchG 2006) und<br />
können auch von Besamungsbeauftragten gewonnen werden. BARLUND et al. (2008)<br />
verglichen fünf verschiedene Methoden zur Diagnose von Endometritiden bei Rindern und<br />
wählten die Zytobrush-Methode aufgrund der größten Wiederholbarkeit als Referenzmethode.<br />
Mit Hilfe der Vaginoskopie kann der Öffnungsgrad des Muttermundes und das<br />
Vorhandensein von Eiter in der Vagina beurteilt werden, laut LE BLANC et al. (2002) und<br />
SHELDON et al. (2006) die maßgeblichen Kriterien zur Diagnose einer klinischen<br />
Endometritis. Je nach Art der Probengewinnung bietet die Entnahme einer Zytologieprobe<br />
gleichzeitig auch die Möglichkeit zur Vaginoskopie, da sich ein Spekulum mit aufgesetzter<br />
Lichtquelle zur geschützten Einführung der Zytobrush eignet.<br />
Häufig erfolgt die Zellentnahme am Endometrium (Corpus oder Cornua uteri), ebenso lässt<br />
jedoch die Untersuchung von Zervixzellen den Rückschluss auf den Inflammationsstatus des<br />
Uterus zu. AHMADI et al. (2005, 2006) belegten dies in Studien am Rind, bei denen,<br />
unabhängig vom Zyklusstadium, im direkten Vergleich kein signifikanter Unterschied<br />
zwischen uterinen und zervikalen Zytologien zu finden war. Die Autoren sehen die<br />
Zervixzytologie als geeignet zum Screening des Reproduktionsstatus, insbesondere in der<br />
postpartalen Phase.<br />
2.6.2 Subklinische Endometritis<br />
Subklinische Endometritiden, d.h. die chronische Inflammation des Uterus ohne klinische<br />
Symptomatik, betreffen laut SHELDON et al. (20<strong>09</strong>) circa 30 % der Rinder post partum.<br />
GILBERT et al. (2005) gibt eine Inzidenz der subklinischen Endometritis von 37 - 74 %<br />
zwischen dem 14. und 60. d p.p. beim Rind an und HAMMON et al. (2006) nennen ein<br />
Vorkommen der subklinischen Endometritis von 51,8 % bei Rindern am 28. ± 3 d nach der<br />
Abkalbung. LE BLANC et al. (2002) stellten bei ihren Untersuchungen an 1865 Milchkühen<br />
(20 - 33 d p.p.) fest, dass 44 % der klinischen Endometritiden erst mittels Vaginoskopie<br />
diagnostiziert werden konnten. RAAB (2004) berichtet aus ihren Untersuchungen zur<br />
Evaluation der Zytobrush-Methode von 41,3 % (n = 407) Tieren mit subklinischer<br />
Endometritis im Zeitraum 21. - 27. d post partum. Die Angaben zur Inzidenz der<br />
41
subklinischen Endometritis sind maßgeblich abhängig vom verwendeten Grenzwert in der<br />
Zytologieauswertung sowie dem Zeitpunkt nach der Abkalbung.<br />
Subklinische Endometritiden beeinträchtigen die Reproduktivität der Rinder signifikant<br />
(SHELDON et al. 20<strong>09</strong>). BARLUND et al. (2008) stellten bei Milchrindern mit subklinischer<br />
Endometritis, ermittelt mittels Zytobrush-Methode zwischen dem 28. - 41. d p.p., ein 1,9-fach<br />
erhöhtes Risiko fest, am Tag 150 nicht tragend zu sein. Die Konzeptionsrate dieser Tiere nach<br />
Erstbesamung war im Vergleich zu den endometritis-negativen Tieren niedriger (14,2 zu<br />
32,1 %), die Anzahl ihrer Güsttage höher (Ø 25 Tage) und der Besamungsindex ebenfalls<br />
erhöht (2,9 zu 2,3). LE BLANC et al. (2002) berichten ebenfalls über einen Vergleich<br />
Endometritis-positiver Tiere gegenüber Endometritis-negativen Tieren. Die Autoren<br />
vermerken signifikant geringere Trächtigkeitsraten (29,8 zu 37,9 % nach Erstbesamung),<br />
längere Güstzeiten (150 zu 122 d) und häufigere Merzung der betroffenen Tiere (34,6 % zu<br />
<strong>24</strong>,9 %). SENOSY et al. (20<strong>09</strong>) stellten fest, dass höhere Anteile an polymorphkernigen<br />
Granulozyten, bestimmt durch Endometriumszytologie (Zytobrush), fünf Wochen p.p.<br />
assoziiert waren mit verspätetem Wiedereintritt in den Zyklus. Darüber hinaus nennen<br />
KAUFMANN et al. (20<strong>09</strong>) eine Vielzahl an Publikationen, die einen negativen Effekt<br />
subklinischer Endometritiden auf die Reproduktivität beim Milchrind belegen.<br />
2.6.3 Zytologieauswertung<br />
Allgemein kommen drei Vorgehensweisen zur Auswertung von Zytologien in Frage. Die<br />
erste ist eine semiquantitative Einschätzung der vorhandenen polymorphkernigen<br />
Granulozyten anhand eines subjektiven Scores (WAELCHLI et al. 1987; GILBERT et al.<br />
2005; SANTOS et al. 20<strong>09</strong>). Weitergehend ist die Auszählung der PMN pro Objektträger<br />
oder Gesichtsfeld (CARD 2005). Die höchste Aussagekraft hat die Differenzierung einer<br />
definierten Anzahl an Zellen (i.d.R. 100 oder 200 Zellen) in polymorphkernige Granulozyten<br />
und Epithelzellen, um den relativen Anteil an PMN zu bestimmen (KASIMANICKAM et<br />
al. 2004; SANTOS et al. 20<strong>09</strong>).Die Bestimmung dieses relativen Anteils von PMN anhand<br />
zytologischer Präparate ist geeignet zur Vorhersage der reproduktiven Performance der post<br />
partum Kuh (KASIMANICKAM et al. 2004; GILBERT et al. 2005; BARLUND et al. 2008).<br />
Außerdem vermerken DASCANIO et al. (1997), dass gerade bei Zytologiepräparaten mit<br />
geringer Zelldichte eine Auswertung anhand des Verhältnisses von PMN zu endometrialen<br />
42
Zellen angebracht ist (nicht nur PMN pro Gesichtsfeld), um keine falschen Diagnosen<br />
bezüglich einer vorliegenden Inflammation zu stellen.<br />
2.6.4 Einordnung von Zytologien des Genitaltraktes<br />
Kontinuierliche, wöchentliche Untersuchungen von Milchrindern post partum mittels<br />
Zytobrush zeigten einen abnehmenden mittleren PMN-Anteil von 36 % auf 3 % vom 21. -<br />
35. d (SENOSY et al. 20<strong>09</strong>). AHMADI et al. (2006) nennen Mittelwerte des<br />
Neutrophilenanteils von 8,44 ± 0,45 % am 25. - 30. d p.p. und 5,44 ± 0,37 % für den<br />
Zeitraum 55. - 60. d p.p. bei Untersuchungen des aspirierten Zervikalschleims von 50 klinisch<br />
gesunden Milchkühen. Ein definierter Grenzwert, ab welchem Anteil an polymorphkernigen<br />
Granulozyten im Zytologiepräparat die Diagnose einer subklinischen Endometritis<br />
gerechtfertigt ist, existiert aktuell nicht. Die in der Literatur angegebenen Grenzwerte liegen<br />
zwischen 5 - 25 % in Abhängigkeit vom Zeitraum post partum (Tab. 3).<br />
Tab. 3: Übersicht zur Zytologieprobenaufbereitung und -auswertung (* Zeitraum der Untersuchung in<br />
Tagen nach der Abkalbung; d. p.p. = Tage post partum)<br />
Spezies Probenort/<br />
Entnahme<br />
Rind<br />
Rind<br />
Rind<br />
Rind<br />
Rind<br />
Rind<br />
Rind<br />
Rind<br />
Rind<br />
Rind<br />
Uterus<br />
Zytobrush<br />
Uterus<br />
Zytobrush<br />
Uterus<br />
Lavage<br />
Zervix<br />
Aspiration<br />
Uterus<br />
Lavage<br />
Uterus<br />
Zytobrush<br />
Uterus<br />
Lavage/<br />
Zytobrush<br />
Uterus<br />
Zytobrush<br />
Uterus<br />
Zytobrush<br />
Uterus<br />
Zytobrush<br />
Fixation/<br />
Färbung<br />
Cytoprep/<br />
Giemsa<br />
43<br />
Grenzwert für<br />
polymorphkernige<br />
Granulozyten (PMN)*<br />
> 18 % (20. - 33. d p.p.)<br />
> 10 % (34. - 47. d p.p.)<br />
Quelle<br />
KASIMANICKAM<br />
et al. 2004<br />
Hemacolor® > 5 % (21. - 27. d p.p.) RAAB 2004<br />
DiffQuick<br />
Methanol/<br />
Giemsa<br />
Cytoprep/<br />
Giemsa<br />
LT-SYS®<br />
DiffQuick/<br />
Giemsa<br />
modifizierte<br />
Wright-Giemsa<br />
subjektive Bewertung<br />
ca. > 5 %<br />
(40. - 60. d p.p.)<br />
PMN-Anteil; kein Grenzwert<br />
(25. - 30. u. 55. - 60. d p.p.)<br />
> 25 % PMN (28 ± 3 d p.p.)<br />
subjektive Bewertung<br />
ca. > 5 %<br />
(21. - 27. u. 35. - 41. d p.p.)<br />
> 18 % (21. - 33. d p.p.)<br />
> 10 % (34. - 47. d p.p.)<br />
8 % (28. - 41. d p.p.)<br />
LT-SYS® > 15 % (ab 65. d p.p.)<br />
modifizierte<br />
Giemsa<br />
PMN-Anteil; kein Grenzwert<br />
(21. - 35. d p.p.)<br />
GILBERT et al.<br />
2005<br />
AHMADI et al.<br />
2006<br />
HAMMON et al.<br />
2006<br />
LINCKE 2006<br />
SHELDON et al.<br />
2006<br />
BARLUND et al.<br />
2008<br />
KAUFMANN et al.<br />
20<strong>09</strong><br />
SENOSY et al.<br />
20<strong>09</strong>
Spezies Probenort/<br />
Entnahme<br />
Rind<br />
Rind<br />
Uterus<br />
Lavage<br />
Zervix<br />
Zytobrush<br />
Fixation/<br />
Färbung<br />
modifizierte<br />
Wright-Giemsa<br />
Testsimplets®<br />
44<br />
Grenzwert für<br />
polymorphkernige<br />
Granulozyten (PMN)*<br />
subjektiver Score<br />
> 5,5 % (2. - 87. d p.p.)<br />
> 5 % bzw. > 10 %<br />
(42.-50. u. 74.-80. d p.p.)<br />
2.7 Szintigraphien des weiblichen Genitale<br />
Quelle<br />
SANTOS et al.<br />
20<strong>09</strong><br />
SCHULT 20<strong>09</strong><br />
2.7.1 Methode<br />
Die Szintigraphie ist ein bildgebendes nuklearmedizinisches Verfahren, welches die<br />
räumliche und zeitliche Verteilung von Radiopharmaka im Körper aufzeichnet. Aus dem<br />
Körper austretende Strahlung wird mittels Gammakamera erfasst und ihre<br />
Aktivitätsverteilung im Szintigramm dargestellt. Man unterscheidet statische Szintigramme<br />
zur Lokalisationsdiagnostik und dynamische Szintigramme zum Erfassen von<br />
Aktivitätsveränderungen. Szintigraphien des Genitaltraktes eignen sich im Gegensatz zu<br />
anderen diagnostischen Verfahren nach STECK et al. (1989b) nicht nur dazu, morphologische<br />
Veränderungen beispielsweise der Tuben zu erfassen, sondern sind auch geeignet,<br />
funktionelle Störungen wie eine verminderte Peristaltik zu dokumentieren.<br />
Die Auswertung der Szintigramme kann in ROI-Technik (regions of interest) erfolgen<br />
(BOCKISCH 1962). Abhängig von der Aktivitätsverteilung und deren zeitlichem Verhalten<br />
werden Regionen, beispielsweise in Vagina und Uterus, rechnergestützt eingezeichnet und<br />
deren Aktivität (Zählrate) gemessen. Ein festes Koordinatensystem durch äußere<br />
Markierungspunkte erachtet BOCKISCH (1962) nach seinen Versuchen als nicht sinnvoll.<br />
Zur exakten Berechnung der Aktivität in einem definierten Bereich (ROI) gehört die<br />
Einbeziehung der Hintergrundaktivität, der Gewebeabschwächung sowie zeitabhängig die<br />
Zerfallsrate des radioaktiven Markers. Eine vereinfachte Auswertung szintigraphischer<br />
Aufnahmen kann anhand der Aktivitätsverteilung innerhalb der untersuchten anatomischen<br />
Kompartimente erfolgen, wie beispielsweise von CHATDARONG et al. (2002) beschrieben.<br />
Das entscheidende Kriterium ihrer, zur Durchgängigkeit der feliden Zervix erstellten<br />
Szintigraphien, war der sichtbare zervikale Transport.<br />
Zur anatomischen Orientierung auf Szintigraphiebildern bediente man sich in<br />
wissenschaftlichen Studien diverser Methoden. Es wurden parallel Kontrastmittel-
Hysterosalpingographien (HSG), Laparoskopien und Chromopertubationen erstellt<br />
(ITURRALDE u. VENTER 1981; MC QUEEN et al. 1993; ÖZGÜR et al. 1997) oder<br />
ergänzend fluoroskopische Techniken und Röntgenaufnahmen genutzt (CHATDARONG et<br />
al. 2002). Radiopharmaka wurden im Flakon lateral am Tier angehalten, rektal eingeführt<br />
oder ergänzend per Follikelpunktion appliziert (KATILA et al. 2000). Auch eine begleitende<br />
szintigraphische Darstellung von Nieren und anderen abdominalen Organen nach vorheriger<br />
intravenöser Injektionen von radioaktiver Lösung diente der Orientierung (CHATDARONG<br />
et al. 2002).<br />
2.7.2 Radioaktiver Marker<br />
Technetium (Tc) ist ein künstliches chemisches Element mit 43 Protonen. Aktivitäten von2 -<br />
20 GBq können durch Elution eines Radionuklid-Generators mit isotonischer<br />
Natriumchlorid-Lösung gewonnen werden Der Generator enthält Natriummolybdat ( 99 Mo)<br />
mit dem Tochterisotop 99m Tc, adsorbiert an eine Aluminiumoxidsäule. Das auf diese Art<br />
gewonnene radioaktive Eluat ist laut Herstellerangaben eine klare, farblose Lösung, pH 5 – 7,<br />
und der Anteil an Pertechnetat ( 99m TcO4 - ) liegt bei über 95 % (ANON 2006a).<br />
Alle Isotope des Elementes Technetium sind radioaktiv, d.h. instabil und zerfallen. 99m Tc ist<br />
ein Isotop des Technetium mit der Massenzahl 99 (BOCKISCH 1962). Das Isotop ist ein<br />
Gammastrahler, d.h. der Zustand zerfällt unter Emission eines Gamma-Quants zu 99 Tc, das als<br />
nahezu stabil betrachtet werden kann. Die Halbwertszeit beträgt 6,02 h (BOCKISCH 1962;<br />
ANON. 2006B). Pertechnetat ist das Salz der Pertechnetiumsäure (BOCKISCH 1962) und hat<br />
Gemeinsamkeiten in seiner biologischen Verteilung mit Jod- und Perchlorat. Es reichert sich<br />
in den Speicheldrüsen, im Plexus choroideus, im Magen und zeitweise in der Schilddrüse an.<br />
Freies Pertechnetat durchquert nachweislich die Plazentaschranke. Seit 1960 wird es in der<br />
Nuklearmedizin verwandt. In der Klinik wird Tc-99m-Natriumpertechnetat laut Angabe des<br />
Herstellers zur Untersuchung von Gehirn, Schilddrüse, Speicheldrüsen, Lungen,<br />
Magentumoren und zur Arthrographie genutzt (ANON 2006a).<br />
2.7.3 Lösungsmarkierung<br />
Die Markierung von Lösungen erfolgt, indem der radioaktive Marker an Partikel gebunden<br />
wird. Üblicherweise werden hierzu kommerzielle Markierungskits genutzt, deren Grundlage<br />
45
oftmals humane Albuminpartikel sind. Je nach Anbieter ist die Nomenklatur unterschiedlich<br />
und im Folgenden sind einige Marker aufgeführt.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
99m Tc-HMPAO (Hexamethyl-Propylen-Amin-Oxim, C13H26N4O2) nutzte<br />
beispielsweise BOCKISCH (1962, 1993) zur Markierung von<br />
Kaninchenspermatozoen. Auch humane und canine Spermatozoen wurden mit 99m Tc-<br />
HMPAO markiert (ÖZGÜR et al. 1997; CHATDARONG et al. 2007) und<br />
SINNEMAA et al. (2005) markierte damit Hengstejakulat.<br />
99m Tc-HSA (Humanserum Albuminmikrosphären) wurden von CHATDARONG et al.<br />
(2002) zur Untersuchung der zervikalen Durchgängigkeit bei Katzen genutzt.<br />
99m Tc-HAM (Humanalbumin-Mikrosphären) und 99m Tc-HAMA (Humanalbumin-<br />
Makroaggregate) wurden von ITURRALDE u. VENTER 1981, STECK et al. 1989a<br />
und KUNZ et al. 1996, zur Durchführung von Hysterosalpingoszintigraphien bei<br />
Frauen verwendet.<br />
99m Tc-µAA (Albuminkolloide) nutzten die Forschungsgruppen NEUWIRTH et al.<br />
(1995) und LE BLANC et al. (1998) bei ihren Untersuchungen an Stuten.<br />
99m Tc-HYAFF (Hyaluronsäureester Mikrosphären) nutzten RICHARDSON et<br />
al. (1996) in ihren Studien zur Verteilung einer bioadhäsiven Substanz in der Vagina<br />
des Schafes.<br />
Nach Aussage von BOCKISCH (1993) bindet 99m Tc-HMPAO bei Spermatozoen zum<br />
Großteil an solide Zellstrukturen (Zellkern) und zu circa einem Drittel an das Zytosol. Ein<br />
Verlust von ungefähr 10 % an motilen Spermien im Vergleich zum unbehandelten Ejakulat<br />
erfolgt durch die Markierung. Die Spermienmotilität ist jedoch nicht signifikant beeinflusst<br />
und das in vivo Verhalten der markierten Spermatozoen ähnelt dem Verhalten nativer<br />
Spermien. Nach der Applikation von Albumin-markierten, radioaktiven Lösungen kann ein<br />
Zeitraum von 0 min bis zu <strong>24</strong> h in vivo (BOCKISCH 1993; CHATTERTON et al. 2004) zur<br />
Erstellung von Szintigrammen genutzt werden.<br />
2.7.4 Radioaktivität und Einheiten<br />
Die Maßeinheit für die Aktivität eines radioaktiven Stoffes ist das Becquerel (Bq). Sie gibt<br />
die Kernzerfälle pro Zeiteinheit an. Ein Becqerel bedeutet einen Kernzerfall pro Sekunde. Ein<br />
Kilobecquerel (1 kBq) sind 1000 Bq und ein Megabecquerel (1 MBq) entsprechen 10 6 Bq. Je<br />
nach Anwendungsgebiet wählt man laut Herstellerangaben Dosierungen von 25 - 1000 MBq<br />
46
für Erwachsene bei einmaliger i.v. Injektion (ANON 2006a). In der Veterinärmedizin in vivo<br />
verwandte Dosen liegen je nach Spezies zwischen 40 - 4000 MBq (Tab. 4).<br />
2.7.5 Experimentelle Szintigraphie-Studien<br />
Je nach Untersuchungsziel werden unterschiedliche Radioaktivitätsmengen verwendet. Im<br />
Allgemeinen kann festgestellt werden, dass die Radioaktivitätsdosis je Proband und<br />
Untersuchung im Laufe der Jahre abgenommen hat. Tab. 4 zeigt eine Übersicht von<br />
Veröffentlichungen zu Hysterosalpingoszintigraphien (HSS/HSSG) aus der Humanmedizin<br />
sowie, soweit vorhanden, aus der Tiermedizin. An der Spezies Ziege wurden bislang keine<br />
szintigraphischen Studien durchgeführt. Vorhandene Szintigraphie-Studien in der<br />
Veterinärmedizin hatten den Transport und Verbleib von scheidenaktiven Substanzen<br />
(Pharmaka zur lokalen Wirkung in der Scheide) und Spermatozoen sowie die Messung von<br />
uteriner Clearance, Uteruskontraktionen und -position zum Untersuchungsziel.<br />
Zu genitalem Transport und Lösungsverbleib<br />
Einen passiven Transport von chemisch inerten Substanzen von der Vagina über die Tuben<br />
hin zu den Ovarien belegten ITURRALDE u. VENTER (1981) sowie STECK et al. (1989a)<br />
mittels Hysterosalpingoszintigraphie. In beiden Fällen wurden radioaktiv markierte<br />
Humanalbuminpartikel ( 99m Tc-HAM bzw. -HAMA) vaginal bei Frauen deponiert. STECK et<br />
al. (1989a) geben als Partikelgröße 5 - 40 µm an und sahen anhand ihrer Szintigramme<br />
Aktivität in Zervix und Uterus. In beiden Untersuchungen wird über eine Darstellung der<br />
Tubenpassage innerhalb von 1 h (5 - 90 min) in den meisten Fällen berichtet. Freie<br />
Beckenaktivität wiesen STECK et al. (1989a) nach durchschnittlich 2 h nach. Allerdings<br />
vermerken ITURRALDE u. VENTER (1981) auch, dass der Großteil des radioaktiven<br />
Markers in der Vagina verbleibt und nur eine kleine Fraktion in Uterus und Tuben<br />
transportiert wird.<br />
KUNZ et al. (1996) berichten in ihrer ebenfalls an Frauen durchgeführten Studie über einen<br />
sehr schnellen Transport der 99m Tc-Humanalbuminpartikel in den Eileiter. Innerhalb von<br />
1 min nach intravaginaler Deposition war am Isthmus tubae uterinae Radioaktivität<br />
darstellbar. Die Autoren bemerken einen zyklusphasen-abhängigen Partikeltransport. In der<br />
frühen Follikelphase verblieben die meisten Partikel am Deponierungsort und nur wenige<br />
Partikel gelangten in den Uterus und in die Tuben. Mit Fortschreiten der Follikelphase war<br />
47
insbesondere der Anteil an Partikeln in der Gebärmutter erhöht und gegen Ende der<br />
Follikelphase wurde ein vermehrter Transport in die ipsilateral zum dominanten Follikel<br />
gelegene Tube festgestellt.<br />
Tab. 4: Übersicht zur Durchführung von Szintigraphien des weiblichen Genitale<br />
Spezies Applikation/<br />
Untersuchungsziel<br />
Kaninchen<br />
Katze<br />
Hund<br />
Pferd<br />
Pferd<br />
Pferd<br />
Pferd<br />
Mensch<br />
Mensch<br />
Mensch<br />
Mensch<br />
Mensch<br />
Mensch<br />
Mensch<br />
Schaf<br />
intravaginal/<br />
Spermientransport<br />
intravaginal/ zervikale<br />
Durchgängigkeit<br />
in vitro/<br />
Spermienmarkierung<br />
intrauterin/<br />
Uterine Clearance<br />
intrauterin/<br />
Uterusposition<br />
intrauterin/<br />
Spermientransport<br />
intrauterin/<br />
Uteruskontraktion u.<br />
Clearance<br />
intravaginal/ Hysterosalpingoszintigraphie<br />
intravaginal/ Hysterosalpingoszintigraphie<br />
intravaginal/ Hysterosalpingoszintigraphie<br />
intravaginal/<br />
Durchgängigkeit bei<br />
Endometriose<br />
intravaginal/<br />
Uteruskontraktion u.<br />
Partikeltransport<br />
intravaginal/ Hysterosalpingoszintigraphie<br />
intravaginal/<br />
Substanzverteilung<br />
intravaginal/<br />
Substanzverteilung<br />
Marker/<br />
Markierung 1<br />
48<br />
Eingesetzte<br />
Radioaktivität<br />
(Bq)<br />
Quelle<br />
99m Tc-HMPAO 75 MBq BOCKISCH 1993<br />
99m Tc-HSA 40 MBq<br />
99m Tc-HMPAO 0,2 - 10 kBq<br />
99m Tc-µAA<br />
370 MBq/<br />
1110 MBq<br />
99m Tc-µAA 370 MBq<br />
CHATDARONG et<br />
al. 2002<br />
CHATDARONG et<br />
al. 2007<br />
NEUWIRTH et al.<br />
1995<br />
LE BLANC et al.<br />
1998<br />
99m Tc-HMPAO 3000 MBq KATILA et al. 1998<br />
99m Tc-HMPAO 4000 MBq<br />
99m Tc-HAM 74/370 MBq<br />
99m Tc-HAMA 5 - 10 MBq<br />
99m Tc-HAMA 8 - 10 MBq<br />
99m Tc-HAM 21 MBq<br />
99m Tc-HAM 25 MBq<br />
SINNEMAA et al.<br />
2005<br />
ITURRALDE u.<br />
VENTER 1981<br />
BECKER et al.<br />
1988<br />
STECK et al.<br />
1989a<br />
Mc QUEEN et al.<br />
1993<br />
LEYENDECKER et<br />
al. 1996<br />
99m Tc-HAM 25 MBq KUNZ et al. 1996<br />
99m Tc-DTPA 4 MBq<br />
99m Tc-HYAFF 1 MBq<br />
CHATTERTON et<br />
al. 2004<br />
RICHARDSON et<br />
al. 1996<br />
199m<br />
Tc-HMPAO:<br />
99m<br />
Hexamethyl-Propylen-Amin-Oxim; Tc-DTPA:<br />
99m<br />
Diethylen-Triamin-Pentatat; Tc-HSA:<br />
Humanserum Albuminmikrosphären;<br />
99m<br />
Tc-HAM: Humanalbumin-Mikrosphären;<br />
99m<br />
Tc-HAMA:<br />
Humanalbumin-Makroaggregate;<br />
Mikrosphären<br />
99m<br />
Tc-µAA Albuminkolloide;<br />
99m<br />
Tc-HYAFF: Hyaluronsäureester
NEUWIRTH et al. (1995) erstellten latero-laterale Szintigraphien im Zeitraum 0 - 120 min<br />
nach intrauteriner Infusion der Stuten mit 99m Tc-Albuminkolloid am 3. Tag des Östrus bzw.<br />
48 h post ovulationem. Die als reproduktionsgesund eingestuften Stuten hatten nach 120 min<br />
circa 50 % des Radiokolloids ausgeschieden, bei den für Endometritis empfänglichen Tieren<br />
betrug der Anteil 15 %. Untersuchungen derselben Arbeitsgruppe zur Uterusposition<br />
basierten ebenfalls auf einer intrauterinen Infusion während des Östrus, mit anschließenden<br />
latero-lateralen Szintigraphien. Die Ergebnisse bestätigten eine 50 % ige Reduktion des<br />
Radiokolloids innerhalb von 2 h bei reproduktionsgesunden Stuten. Bei Stuten, von denen<br />
anamnestisch eine Endometritis bekannt war, betrug der Anteil der uterinen Selbstreinigung<br />
bis zu 30 % (LE BLANC et al. 1998).<br />
In ihrer Studie zum Spermientransport und -verbleib im weiblichen Reproduktionstrakt von<br />
Stuten deponierten KATILA et al. (1998) radioaktiv markierte Spermatozoen in einem<br />
Inseminationsvolumen von 5 mL im Corpus uteri. Statische, latero-laterale Aufnahmen<br />
wurden bis zu 4,5 h p.i. erstellt. Nach 1,5 h war Aktivität in der Vagina und an der Vulva<br />
messbar, nach 2,5 h lag das Aktivitätsmaximum in der Vagina bzw. an der Vulva. Viereinhalb<br />
Stunden nach der intrauterinen Besamung war in der Gebärmutter kaum noch und in der<br />
Scheide wenig Aktivität erkennbar.<br />
Für Kaninchen sind numerische Messungen der Spermatozoen im weiblichen<br />
Reproduktionstrakt mittels szintigraphischer Untersuchungen beschrieben. Nach<br />
Standardinsemination mit definierter Anzahl (100 x 10 6 ) an radioaktiv-markierten<br />
Spermatozoen in die Vagina erstellte BOCKISCH (1993) Szintigraphien von ventral im<br />
Zeitraum 1 min - 12 h post inseminationem. Nach vier Stunden befanden sich circa 25 % der<br />
Inseminationsdosis (25 x 10 6 Spermatozoen) in der Zervix bzw. deren näherer Umgebung.<br />
Nach zwölf Stunden konnte rund ein Viertel der noch im Kaninchen befindlichen<br />
Spermatozoen (200 x 10 3 ) intraabdominal lokalisiert werden.<br />
Zu Uteruskontraktion und Selbstreinigungsmechanismen<br />
In der bereits genannten Studie von KATILA et al. (1998) fiel die Frequenz der<br />
Uteruskontraktionen bei Stuten nach Insemination von 5 mL radioaktiv markierten<br />
Spermatozoen individuell sehr unterschiedlich aus. Die höchsten Kontraktionsfrequenzen<br />
wurden innerhalb von 30 min p.i. gemessen.<br />
49
SINNEMAA et al. (2005) führten Szintigraphien und ultrasonographische Untersuchungen<br />
bei Stuten zur Messung von Auswirkungen des Inseminatvolumens auf die Uteruskontraktion<br />
und die uterine Clearance durch. Volumina von 2 bzw. 100 mL wurden intrauterin appliziert<br />
und latero-laterale Aufnahmen 0, 30, 60, 120, 180 und <strong>24</strong>0 min nach der Insemination erstellt.<br />
Szintigraphisch zeigten sich keine Unterschiede in der Anzahl an Kontraktionen zwischen den<br />
Gruppen. Allein mittels Ultraschall konnten in der 100 mL-Gruppe 4 h post inseminationem<br />
vermehrte Kontraktionen im Vergleich zur 2 mL-Gruppe gemessen werden. Abgesehen von<br />
dieser Ausnahme konnten die Autoren keinen Einfluss des Inseminatvolumens auf die<br />
Uteruskontraktion und die Elimination des Inseminates feststellen.<br />
RICHARDSON et al. (1996) untersuchten am Modelltier Schaf die Verteilung einer<br />
Technetium-markierten bioadhäsiven Formulierung, dessen Grundlage Hyaluronsäureester-<br />
Partikel sind. Die Gruppe berichtet anhand von Szintigraphien nach vaginaler Applikation in<br />
Puder- oder Zäpfchenform über eine Verteilung der Mikrosphären in der Scheide. Es fand<br />
sich kein Hinweis auf einen Transport der Formulierung über die Scheide hinaus und die<br />
vaginale Aktivität lag 12 h nach der Applikation bei 60 - 80 %.<br />
Eine szintigraphische Studie zum Vergleich zweier verschiedener Applikationsformen<br />
(Vaginalcreme/-gel) hinsichtlich ihrer Verteilung und ihres Verbleibs im Genitaltrakt führten<br />
CHATTERTON et al. (2004) bei Frauen durch. Die Autoren bemerkten eine große<br />
interindividuelle Streuung in der Clearance. Zwischen 81 - 1 % der Formulierung verblieb<br />
<strong>24</strong> h nach der Applikation intravaginal und die höchsten Verluste wurden während der<br />
Miktion gemessen.<br />
50
3 MATERIAL UND METHODEN<br />
3.1 Feldstudien zur Seminalplasmaapplikation<br />
3.1.1 Studientiere<br />
In die Durchführung zweier Feldstudien wurden 514 (KB-Studie) und 68 (ET-Studie) Rinder<br />
der Rassen Deutsche Holstein Schwarzbunt (SB; n = 403), Deutsche Holstein Rotbunt (RB;<br />
n = 93) und Deutsches Fleckvieh (FV; n = 74) einbezogen. Elf Tiere fielen unter „sonstige<br />
Rassen“ bzw. es lag keine Angabe der Rasse vor. Sämtliche Studientiere standen in<br />
Deutschland im Betreuungsgebiet von vier Besamungsstationen für Rinder 2 . Sowohl die KB-<br />
als auch die ET-Studientiere verteilten sich zu jeweils ungefähr einem Drittel auf die drei<br />
Versuchsgruppen „Seminalplasma“ (SP; n = 197), „Placebo“ (P; n = 194) und „Kontrolle“ (K;<br />
n = 191). Ein großer Anteil an ET-Tieren (n = 53) konnte nicht ausgewertet werden, da sich<br />
diese Tiere in der Brunst als geeignete Rezipienten, zum Transferzeitpunkt jedoch als<br />
untauglich herausstellten. n die Studien einbezogen wurden nur besamungs- bzw.<br />
transfertaugliche Tiere, die sich dem Besamungsbeauftragten klinisch unauffällig<br />
präsentierten. Es handelte sich ausschließlich um Erstbesamungen mit Sperma geprüft fertiler<br />
Bullen (n = 168), welches von den beteiligten Stationen routinemäßig (Kryosperma in feinen<br />
Pailletten, intrauterine Insemination) eingesetzt wurde. Die KB-Tiere befanden sich zwischen<br />
der 0. und 11. Laktation, die ET-Tiere waren bis auf drei Tiere primipar. Die weitergehende<br />
Charakterisierung der Studientiere ist dem Ergebnisteil der Arbeit zu entnehmen.<br />
3.1.2 Lösungsgewinnung und -herstellung<br />
Der Begriff „Lösung“ steht nachfolgend in den beiden Feldstudien zusammenfassend für<br />
Seminalplasma und Placebo.<br />
Das Seminalplasma wurde an vier Besamungsstationen für Rinder durch Ejakulat-<br />
Zentrifugation (1000 - 1500 g, 20 min, Raumtemperatur) gewonnen, mikroskopisch<br />
(200-fache Vergrößerung) auf Spermienfreiheit untersucht, gepoolt und in Kryoröhrchen 3 je<br />
4 ml bis zur Applikation tiefgefroren bei -196 °C. Als Ausgangsmaterial dienten an den<br />
2 RUW: Rinder-Union West eG, Besamungsstation, Hamerter Berg, 54636 Fließem; WEU: Weser-Ems-Union<br />
eG, Besamungsstation Haselünne-Eltern, Feldstraße 22, 49740 Haselünne; VOST: Verein Ostfriesischer<br />
Stammviehzüchter, Besamungs- und ET-Station, Am Bahndamm 4, 266<strong>24</strong> Südbrookmerland; NBG:<br />
Niederbayerische Besamungsgenossenschaft Landshut-Pocking eG, Gut Altenbach, 84036 Landshut<br />
3 Kryoröhrchen, steril, 5 mL, Brand GmbH + Co KG, Otto-Schott Str. 25, 97877 Wertheim, Deutschland<br />
51
einzelnen Stationen mittels künstlicher Vagina im Zeitraum Januar - Juni 20<strong>09</strong>d 0 gewonnene<br />
Ejakulate. Ein Seminalplasmapool umfasste 200 - 400 mL und enthielt jeweils Seminalplasma<br />
20 - 40 geprüft fertiler Bullen.<br />
Die Placebo-Lösung wurde stationsübergreifend im Institut für Reproduktionsbiologie der<br />
<strong>Stiftung</strong> <strong>Tierärztliche</strong> Hochschule Hannover hergestellt. Es handelt sich um steril-<br />
filtrierte 4 phosphatgepufferte Salzlösung (Dulbecco´s PBS 5 ) mit 0,01 % Gelatine 6 . Auch die<br />
Placebo-Lösung wurde in Kryoröhrchen je 4 ml portioniert und bis zur Applikation bei -<br />
196 °C gelagert.<br />
3.1.3 Durchführung der Lösungsapplikation<br />
Die Durchführung der Dreifachblindstudie erfolgte parallel im Einzugsgebiet der vier<br />
Besamungsstationen in Deutschland im Zeitraum Mai bis September 20<strong>09</strong> (KB) bzw. Mai<br />
20<strong>09</strong> bis März 2011 (ET). Neun Besamungsbeauftragte sowie 5 ET-Beauftragte und ET-<br />
Tierärzte mit langjähriger Erfahrung wurden theoretisch und praktisch mit der Durchführung<br />
der Lösungsapplikation und Zytologieentnahme vertraut gemacht und erhielten eine<br />
Ausrüstung wie folgt: Protokollmappen, Kryoröhrchen mit je 4 ml Lösung (codiert), Einmal-<br />
Spekula 7 und aufsetzbare Lichtquelle 8 , Bürstchen zur Zytologieentnahme 9 , Einmal-<br />
Uteruskatheter 10 , Übersichten zu Durchführung und Scores (Body Condition Score 11 ,<br />
Lahmheitsscore 12 , Hygienescore 13 ), Objektträger 14 und Fixierspray 15 sowie Präparatekästen.<br />
Die Zuordnung zur jeweiligen Versuchsgruppe erfolgte randomisiert, indem eine vorgegebene<br />
Übersichtsliste der Versuchsgruppen (SP, P, K, SP, P, K, etc.) der Reihe nach bearbeitet<br />
wurde. Die Lösungen waren, je Station unterschiedlich, verblindet durch Zahlencodes. Die<br />
4 Millex GP Filter Unit, Millipore Express ® PES Membrane, 0,22µm, Millipore S.A., 67120 Molsheim, France<br />
5 Dulbecco´s Phosphate Buffered Saline, Sigma-Aldrich Chemie GmbH, P.O. 1120, 89552 Steinheim, Deutschl.<br />
6 Gelatine, from porcine skin, ~300 g Bloom, cell culture tested, Sigma-Aldrich Chemie GmbH, P.O. 1120,<br />
89552 Steinheim, Deutschland<br />
7 Stutengynäkologie, Ø 3,1 cm, ca. 43 cm lang, Minitüb GmbH, Hauptstraße 41, 84184 Tiefenbach, Deutschland<br />
8 Minitüb GmbH, Hauptstraße 41, 84184 Tiefenbach, Deutschland<br />
9 Gynobrush®: nicht steril, zur Entnahme endozervikaler Proben; Heinz Herenz Medizinalbedarf GmbH,<br />
Rudorffweg 10, 21031 Hamburg, Deutschland<br />
10 Bovivet Uterine Catheter, non-sterile, Kruuse, Havretoften 4, DK-5550 Langeskov, Dänemark<br />
11 Body Condition Score, BCS 1 - 5: nach WILDMAN et al. 1982<br />
12 Lahmheits-Score, LS 1 - 5: nach SPRECHER et al. 1997<br />
13 Hygiene-Score, HYG 1 - 4: nach RENEAU et al. 2005<br />
14 Carl Roth GmbH+Co.KG, Schoemperlenstr. 3-5, 76185 Karlsruhe, Deutschland<br />
15 Merckofix®: Fixationsspray für die Zytodiagnostik; Merck KGaA, 64271 Darmstadt, Deutschland<br />
52
Besamungsbeauftragten agierten somit während der gesamten Durchführung geblindet.<br />
Ebenso die Doktorandin (MS), welche erst nach der endgültigen statistischen Analyse die<br />
Aufschlüsselung erfuhr.<br />
Lösungsapplikation begleitend zur artifiziellen Insemination<br />
Die intrauterine Besamung der Studientiere führten erfahrene Besamungsbeauftragte nach<br />
gängiger Regel (Insemination 12 h nach Beobachtung erster klinischer Brunstsymptomatik<br />
durch den Tierbesitzer) durch. Direkt im Anschluss an die ausgeführte Besamung, deren<br />
Zeitpunkt im Folgenden als Tag 0 (d 0) definiert wird, erfolgte die standardisierte Entnahme<br />
(vorsichtige ¾-Drehung der Zytobrush) einer exfoliativen Zervixzytologieprobe aus dem<br />
kaudalen Drittel der Zervix unter Zuhilfenahme des Spekulums. Das genutzte Bürstchen<br />
wurde mit gleichmäßigem Druck auf einem Objektträger ausgerollt, das Zellmaterial mit<br />
Fixierspray fixiert und bis zur Färbung und Analyse in einem Präparatekasten aufbewahrt.<br />
Anschließend erfolgte die Lösungsapplikation (Abb. 7, Abb. 8). Die Lösung (SP oder P, je<br />
4 mL, 38°C) wurde mit Hilfe des Uteruskatheters zu einem Drittel in die kaudale Zervix<br />
unmittelbar kranial des äußeren Muttermundes und zu zwei Dritteln um den äußeren<br />
Muttermund appliziert. Bei den Kontrolltieren entfiel die Lösungsapplikation.<br />
Lösungsapplikation begleitend zum Embryotransfer<br />
Den Embryonenempfängertieren wurde in der Brunst, zum Zeitpunkt an dem üblicherweise<br />
die Besamung erfolgen würde (d0), eine erste Zervixzytologieprobe in bereits beschriebener<br />
Weise entnommen. Anschließend erfolgte die Lösungsapplikation (Abb. 7, Abb. 8). Die<br />
Lösung (SP oder P, je 4 mL, 38°C) wurde mit Hilfe des Einmal-Uteruskatheters zu einem<br />
Drittel in die kaudale Zervix unmittelbar kranial des äußeren Muttermundes und zu zwei<br />
Dritteln um den äußeren Muttermund appliziert. Bei den Kontrolltieren entfiel die<br />
Lösungsapplikation.<br />
53
Abb. 7: Zeitpunkte der Behandlungen und Datenerhebungen (Feldstudien)<br />
Zum Zeitpunkt des Embryotransfers (d 7) wurde unmittelbar dem Rezipienten im Anschluss<br />
an den Transfer (frische oder tiefgefrorene Embryonen der IETS-Klassen 1 oder 2) eine<br />
zweite Zervixzytologieprobe entnommen (Abb. 8). Auch hier unterlagen die Kontrolltiere<br />
abgesehen von der Lösungsapplikation demselben Prozedere.<br />
Abb. 8: Lösungsapplikation Feldstudien<br />
3.1.4 Erfasste Parameter je Studientier (Feldstudien I + II)<br />
Um die Tiere möglichst umfangreich zu charakterisieren wurde ein Fragebogen entwickelt,<br />
der an d 0 (KB- und ET-Tiere), d 7 (ET-Tiere) und zum Zeitpunkt der<br />
Trächtigkeitsuntersuchung (KB- und ET-Tiere) für jedes Studientier wichtige Parameter<br />
erhob (Abb. 7):<br />
54
Lösungsapplikation<br />
Die applizierte Lösung, je nach Station unterschiedlich codiert, wurde von den<br />
Besamungsbeauftragten festgehalten als Lösung 1 bzw. 2 bzw. keine Lösung<br />
(Kontrollgruppe).<br />
Betriebliche Daten<br />
Folgende Daten wurden nach Angaben der Betriebsleiter erfasst: Betriebsidentifikation,<br />
Haltungssystem (Laufstall, Anbindehaltung, Weidehaltung), Anzahl der Rinder im Betrieb,<br />
Gruppengröße, in der das Studientier steht und die Anzahl der Liegeplätze, die dieser<br />
Tiergruppe zur Verfügung stehen.<br />
Tierdaten<br />
Im Fragebogen festgehalten wurden nach Betriebsleiterangaben die Parameter:<br />
Identifikationsnummer, Rasse, Alter, Laktationszahl, Datum der letzten beobachteten Brunst,<br />
Datum der letzten Abkalbung, Störungen nach der Geburt (unterschieden nach Endometritis,<br />
Mastitis und Nachgeburtsverhaltung), Zellzahl (in Tausend) und Milchleistung (in kg) der<br />
letzten Milchkontrolle. Der Besamungsbeauftragte hielt des Weiteren eine Einschätzung der<br />
Studientiere hinsichtlich Körperkondition (BCS 1 - 5: nach WILDMAN et al. 1982; bzw.<br />
Fleckvieh-Score: BCS 2,5 - 4,5 mit Zwischenstufen), Lahmheits-Score (LS 1 - 5: nach<br />
SPRECHER et al. 1997) und Hygiene-Score (HYG 1 - 4: nach RENEAU et al. 2005) fest.<br />
Brunstparameter und Besamung<br />
Festgehalten wurde nach Betriebsleiterangaben: Die beobachtete Dauer der Brunst bis zum<br />
Besamungszeitpunkt, die Intensität der Brunstsymptome (BS 1 - 5: keine, gering, mittel,<br />
stark, sehr stark) und die Art der Brunstfeststellung (visuell, Pedometer, sonstige Verfahren).<br />
Der Besamungsbeauftragte dokumentierte die Identifikation des Spermadonors und beurteilte<br />
des Weiteren subjektiv: die Kontraktion des Uterus (K 1 - 3: schlecht kontrahiert, kontrahiert,<br />
stark kontrahiert), die Brunstschleimmenge (wenig, viel) und Beschaffenheit (klar, trüb-zäh)<br />
und Schleimbeimengungen (blutig, eitrig). Der Zervixzytologiestatus zum Zeitpunkt der<br />
Besamung wurde anhand der vom Besamungsbeauftragten gewonnenen Probe nachträglich<br />
im Labor des Instituts für Reproduktionsbiologie der <strong>Stiftung</strong> <strong>Tierärztliche</strong> Hochschule<br />
Hannover von der Doktorandin beurteilt.<br />
55
Trächtigkeit<br />
Erhoben wurden bei Durchführung der Trächtigkeitsuntersuchung vom<br />
Besamungsbeauftragten folgende Parameter: Datum der Trächtigkeitsuntersuchung, Ergebnis<br />
der Trächtigkeitsuntersuchung (tragend, nicht-tragend), Methode der<br />
Trächtigkeitsuntersuchung (transrektale Palpation, sonographische Untersuchung) und Datum<br />
der Wiederkehr in den Zyklus (Umrindern).<br />
3.1.5 Zusätzliche Datenerfassung bei Embryonenempfängertieren<br />
Empfängertier<br />
Im Fragebogen wurde vom ET-Beauftragten festgehalten: Abbluten (ja, nein),<br />
Synchronisation (ja, nein; Präparat), Datum des ET, subjektive Einschätzung der ET-<br />
Durchführung (leicht, mittel, schwer durchführbar), Vorhandensein von Blut bei der<br />
Durchführung (ohne, wenig, viel), festgestellte Gelbkörper und Uterusgröße (eher klein,<br />
normal, eher groß).<br />
Spendertiere<br />
Bezüglich der Spendertiere wurde vermerkt: Identifikationsnummer, Geburtsjahr, letzte<br />
Abkalbung des Spenders und Identifikation des Bullen.<br />
Embryo<br />
Hinsichtlich des Embryos wurde dokumentiert: Embryonummer, Entwicklungsstadium,<br />
Embryoqualität (IETS; Klasse 1, Klasse 2) und Art der Embryonenlagerung (frisch,<br />
tiefgefroren).<br />
3.1.6 Zervixzytologien<br />
Die fixierten Zytologieproben wurden im Labor des Instituts für Reproduktionsbiologie der<br />
<strong>Stiftung</strong> <strong>Tierärztliche</strong> Hochschule Hannover nach PAPANICOLAOU 16 gefärbt, eingedeckt,<br />
analysiert und archiviert 17 . Die Untersuchung der Zytologien erfolgte lichtmikroskopisch 18 ,<br />
zunächst bei 100-facher Vergrößerung und anschließend bei 200 - 400-facher Vergrößerung.<br />
Diese Vorgehensweise, zunächst einen Überblick über das Präparat vorzunehmen und<br />
16 Papanicolaou-Färbelösungen: Hämatoxylinlösung nach Harris, Papanicolaou-Orangelösung 2a,<br />
Papanicoulaou-Polychromlösung 3b, Carl Roth GmbH+Co.KG, Schoemperlenstr. 3-5, 76185 Karlsruhe,<br />
Deutschland<br />
17 Eukitt®: O. Kindler GmbHu.Co, Ziegelhofstr. 214, 79110 Freiburg, Deutschland<br />
18 Olympus BX60 Modell U-ULH Nr. 5A02802, Olympus Optical CO., LTD, Japan<br />
56
anschließend die Zelldifferenzierung in höherer Vergrößerung durchzuführen, entspricht dem<br />
üblichen Untersuchungsgang von Zytologien und wird von DASCANIO et al. (1997) in ihren<br />
Richtlinien zur Durchführung und Auswertung uteriner Zytologien hervorgehoben. Die<br />
angefertigten Zytologien wurden differenziert nach Zervixepithelzellen und<br />
polymorphkernigen neutrophilen Granulozyten (PMN). Anhand von mindestens 200 Zellen je<br />
Ausstrich wurde der Anteil der PMN an den Gesamtzellen ausgewertet. Der<br />
Auswertungsschlüssel orientierte sich an bereits veröffentlichten Grenzwerten für die Spezies<br />
Rind (siehe Tab. 3). Da die genannten Autoren größtenteils zeitnah post partum und häufig<br />
uterine Zytologien untersuchten, wurden zur Auswertung der vorliegenden Studies im<br />
Verhältnis zu den Angaben in der Literatur eher niedrige Grenzwerte angesetzt:<br />
• ≤ 10 % PMN: zytologisch unauffällig<br />
• > 10 % PMN: zytologisch auffällig<br />
3.1.7 Statistische Analyse<br />
Zur Datenerfassung und Berechnung von Anteilen, Mittelwerten und Standardabweichungen<br />
wurde Excel 19 genutzt. Die statistische Auswertung der geblindeten Daten erfolgte mit dem<br />
Programm SAS 20 . Angewendet wurde nach statistischer Beratung 21 der Chi-Quadrat-Test zur<br />
Überprüfung der Homogenität der Versuchsgruppen bezogen auf die erfassten Parameter. Des<br />
Weiteren wurde sowohl der Chi-Quadrat-Test als auch der Fisher´s Exact Test genutzt, um<br />
unter den dokumentierten Parametern signifikant beeinflussende Faktoren zu erkennen. Als<br />
Signifikanzniveau wurde P ≤ 0,05 festgelegt.<br />
3.2 Experimentelle Studie: Vaginohysteroszintigraphien<br />
3.2.1 Studientiere<br />
In der Brunstsaison 20<strong>09</strong> wurden jeweils drei aufeinanderfolgende Zyklen dreier gleich<br />
großer Ziegen der Rassen Toggenburger, Bunte Deutsche Edelziege und Bure x Bunte<br />
Deutsche Edelziege zur Versuchsdurchführung genutzt. Das Alter der geprüft fertilen<br />
Versuchstiere lag zwischen 4 und 7 Jahren.<br />
19 Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Cooperation, Redmond, Washington, USA<br />
20 SAS: SAS 9.2, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA<br />
21 Institut für Biometrie, Epidemiologie und Informationsverarbeitung, Hr. Dr. Karl Rohn, <strong>Stiftung</strong> <strong>Tierärztliche</strong><br />
Hochschule Hannover, Bünteweg 2, 30559 Hannover<br />
57
3.2.2 Versuchsdurchführung<br />
Die Durchführung der Szintigraphien erfolgte an der Klinik für Pferde 22 in Lüsche,<br />
Deutschland. Zum Zeitpunkt der Brunst wurden 1,5 mL radioaktiv markiertes Seminalplasma<br />
(SP), Ejakulat (E) oder Placebo (P) mittels Katheter 23 intravaginal appliziert. Anschließend<br />
wurden über einen Zeitraum von bis zu 6 h statische Szintigraphieaufnahmen des weiblichen<br />
Genitale erstellt. Der Begriff „Lösung“ steht nachfolgend in der experimentellen Studie<br />
zusammenfassend für Seminalplasma, Ejakulat und Placebo. Die Radioaktivität je<br />
Lösungsapplikation lag bei 30 - 50 Megabecquerel. Das Seminalplasma entstammte einem<br />
geprüft fertilen Bock (künstliche Vagina) und wurde, wie auch die Placebo-Lösung, im<br />
Vorhinein hergestellt (siehe Kapitel 3.1.2. „Lösungsgewinnung und -herstellung“) und<br />
eingefroren bei -18°Celsius. Die Ejakulate wurden von demselben Bock mit Hilfe einer<br />
künstlichen Scheide für kleine Wiederkäuer morgens am Tag der Versuchsdurchführung<br />
gewonnen und waren makroskopisch ohne besonderen Befund. Als Szintigraphie-<br />
Aufnahmezeitpunkte wurden 0, 1, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, <strong>24</strong>0, 360 min nach der<br />
Lösungsapplikation gewählt. Je Versuchsgruppe (SP, P, E) wurden drei Brunsten genutzt und<br />
somit drei Applikationen durchgeführt. Die Brunstinduktion erfolgte mit 0,6 ml<br />
Cloprostenol <strong>24</strong> subkutan. Zur Brunstfeststellung wurde ein Suchbock verwendet. Die<br />
Aufnahmen wurden in stehender, fixierter Position der Ziegen und in dorso-ventraler<br />
Aufnahmerichtung und 60 s/Bild mittels einer Gammakamera in einer 256 x 256 Matrix bzw.<br />
128 x 128 Matrix in Farbe erstellt 25 (Abb. 9). Während der Studiendurchführung konnte<br />
aufgrund der räumlichen und personellen Gegebenheiten keine Dokumentation des Kot- und<br />
Harnabsatzes der Ziegen erfolgen. Zur radioaktiven Markierung wurde das Kit Pulmocis® 26<br />
gemäß Anwendungsinstruktion mit Natrium ( 99m Tc) Pertechnetat-Lösung versetzt. Laut<br />
Herstellerangaben liegt die Größe der Humanalbumin-Makroaggregate (Macrosalb) zu 60 %<br />
zwischen 30 - 50 µm. Kein Partikel ist größer als 150 µm. Zur Markierung von 1 mL<br />
Versuchslösung (SP/P/E) wurden ca. 500.000 Partikel in 0,5 mL ( 99m Tc) Technetium-<br />
Macrosalb-Lösung verwendet.<br />
22 <strong>Tierärztliche</strong> Klinik für Pferde, Essener Straße 39a, 49456 Lüsche, Deutschland<br />
23 Angiocath ® , i.v. Catheter placement unit, sterile, 14 G/13,3 cm, Deseret Medical Inc., Utah 84070, USA<br />
<strong>24</strong> Cloprostenol: Estrumate® Essex Pharma GmbH, Thomas-Dehler-Str.27, 81737 München, Deutschland<br />
25 Scintron: MiE GmbH, Hauptstraße 12, 23845 Seth, Deutschland<br />
26 Pulmocis: CIS bio GmbH, Alt-Moabit 91d, 10559 Berlin, Deutschland<br />
58
3.2.3 Bildauswertung<br />
Die, je applizierter Lösung, erstellten statischen Szintigraphien wurden in ihrer zeitlichen<br />
Reihenfolge auf Veränderungen der Aktivitätsverteilung begutachtet. Die Klassifizierung der<br />
Aufnahmen erfolgte danach, ob ein transzervikaler bzw. retrograder Transport der jeweiligen<br />
applizierten Lösung sichtbar war oder nicht. Zusätzlich wurden die Einzelaufnahmen der<br />
verschiedenen Versuchslösungen zum jeweils gleichen Zeitpunkt zueinander ins Verhältnis<br />
gesetzt und erneut subjektiv beurteilt.<br />
Es erfolgte anhand des kameraeigenen Programmes eine Messung der Strahlungsintensität (in<br />
Counts) sowie der Abstände (in cm) zwischen markanten Lokalisationen mit hoher<br />
Strahlungsintensität und der Vulva. Eine exakte Aktivitätsberechnung mittels ROI-Technik<br />
unter Berücksichtigung von Hintergrundstrahlung und Gewebeabschwächung wurde aufgrund<br />
von fehlendem subjektiv feststellbarem, transzervikalem Transport nicht ausgeführt.<br />
Abb. 9: Erstellung der Szintigramme<br />
Zur anatomischen Orientierung wurden folgende Hilfsmittel und Hinweise genutzt:<br />
Lokalisation der Ovarien in situ in Bezug auf die Zervix während einer Laparotomie im<br />
Rahmen des klinischen Unterrichts an der <strong>Tierärztliche</strong>n Hochschule Hannover<br />
• Angaben im internationalen Schrifttum zu den Abmessungen der weiblichen<br />
Geschlechtsorgane bei der Ziege (Tab. 5)<br />
• Szintigramme mit radioaktiver Markierung an der Vulva (Abb. 10)<br />
59
• Szintigramme mit definiertem Maßstab von 10 cm (Abb. 11)<br />
• Kameraeigenes Bildprogramm zur Längenmessung<br />
Applikationsstelle<br />
(Fundus vaginae)<br />
kranial<br />
Abb. 10: Beispielansicht Szintigramm mit Vulvamarkierung<br />
Abb. 11: : Szintigramm zweier Strahlungsquellen im Abstand von 10 cm als Überprüfung der<br />
Größenmessung<br />
Tab. 5: Größenangaben zur Anatomie des weiblichen Ziegengenitale (CONSTANTINESCU CONSTANTINESCU 2007)<br />
Organ<br />
Vagina<br />
Zervix uteri 4<br />
Corpus uteri 2 - 3<br />
Corni uteri 12 - 15<br />
Ovarien<br />
60<br />
10 cm<br />
Größenangabe<br />
(in cm)<br />
10<br />
1,5 - 2 x 1 - 1,5<br />
kaudal<br />
Markierung<br />
(Vulva)
4 ERGEBNISSE<br />
4.1Inseminationsbegleitende SP-Applikation (Feldstudie I)<br />
4.1.1 Versuchsgruppen und Trächtigkeitsergebnisse<br />
Bei 514 Tieren wurde die Lösungsapplikation im Rahmen der Routine-KB durchgeführt und<br />
es liegt ein Ergebnis der Trächtigkeitsuntersuchung vor. Die Versuchsgruppen (SP, P, K)<br />
waren mit 167 (K), 172 (SP) und 175 (P) annähernd gleich groß (Tab. 6).<br />
Tab. 6: Übersicht Zahlen der Feldstudie I (inseminationsbegleitende Seminalplasmaapplikation)<br />
Versuchs- Anzahl<br />
Anzahl<br />
gruppe<br />
Tiere tragende Tiere<br />
Seminalplasma 172 99<br />
Placebo 175 102<br />
Kontrolle 167 77<br />
Gesamt 514 208<br />
In den Versuchsgruppen SP und P wurden mit jeweils 57,56 % (99/172) und<br />
58,29 % (102/175) signifikant bessere Trächtigkeitsergebnisse erreicht (P = 0,035 bzw.<br />
0,0<strong>24</strong>) als in der Kontrollgruppe mit 46,11 % (77/167; Abb. 12). Die Applikation von<br />
Seminalplasma oder Placebo führte zu einer Steigerung der Trächtigkeitsraten um 25 % bzw.<br />
26 % im Vergleich zur unbehandelten Kontrollgruppe. Die Trächtigkeitsraten zwischen der<br />
Seminalplasma- und der Placebogruppe unterschieden sich nicht signifikant (P > 0,05).<br />
4.1.2 Charakterisierung der Studientiere und ihre Verteilung hinsichtlich<br />
der erfassten Parameter<br />
Im Folgenden wird eine Charakterisierung der Studientiere hinsichtlich Rasse, Laktationszahl,<br />
Störungen post partum, Rastzeit, Milchmenge, Zellzahl, Körperkondition, Lahmheits- und<br />
Hygiene-Score, Methode zur Brunstfeststellung, Dauer der Brunst, äußere<br />
Brunstsymptomatik, Brunstschleimmenge und -konsistenz, Kontraktion der Gebärmutter,<br />
Zervixzytologiestatus, Haltungssystem, Anzahl der Betriebe und Betriebsgröße,<br />
Gruppengröße und Anzahl der vorhandenen Liegeplätze, eingesetzte Bullen und Methode und<br />
Zeitpunkt der Trächtigkeitsdiagnose vorgenommen.<br />
61
Abb. 12: Trächtigkeitsergebnisse in den Versuchsgruppen in Prozent (n SP = 172; n P = 175; n Kontrolle = 167;<br />
* = signifikant im Vergleich zur Kontrollgruppe: PSP = 0,035; PP = 0,0<strong>24</strong>)<br />
Die Verteilung der Tiere innerhalb der Versuchsgruppen ist für alle erfassten Parameter<br />
gleichmäßig und keiner der untersuchten Parameter unterschied sich in Bezug auf die<br />
Versuchsgruppen signifikant. (Im Folgenden ist die Verteilung auf die Versuchsgruppen<br />
deshalb nicht für jeden Parameter explizit aufgeführt.)<br />
Rassen<br />
Trächtigkeitsrate (%)<br />
Für 5<strong>09</strong> Tiere lagen Angaben zur Rasse vor (Abb. 13). Tiere der Rassen Deutsche Holstein<br />
Schwarzbunt (n = 345), Deutsche Holstein Rotbunt (n = 89) und Fleckvieh (n = 74) wurden in<br />
die Studie einbezogen. Unter „sonstige Rasseangaben“ fiel nur ein Tier der Kreuzung<br />
Fleckvieh x Jersey, welches in der weiteren Auswertung nach Rasse nicht berücksichtigt<br />
wurde. Die Verteilung der Studientiere nach Rassen innerhalb der Versuchsgruppen<br />
unterschied sich nicht signifikant (P > 0,05;Tab. 7). In der größten Rassegruppe<br />
(Schwarzbunte) lag die Trächtigkeitsrate mit 54,20 % zwischen denjenigen von Rotbunten<br />
und Fleckvieh. Es gab keinen signifikanten Einfluss der Rasse auf die Trächtigkeitsrate<br />
(P > 0,05).<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
* *<br />
57,56 58,29<br />
Seminalplasma<br />
(SP)<br />
62<br />
Placebo<br />
(P)<br />
46,11<br />
Kontrolle<br />
(K)
Rasse<br />
Abb. 13: Prozentuale Verteilung der Studientiere nach Rassen (Deutsche Holstein Schwarzbunt: n = 345;<br />
Deutsche Holstein Rotbunt: n = 89; Deutsches Fleckvieh: n = 74)<br />
Tab. 7: Verteilung der Studientiere nach Rassen innerhalb der Versuchsgruppen (Rasseangaben<br />
insgesamt: n = 5<strong>09</strong>; davon SB = Dt. Holstein Schwarzbunt: n = 345; RB = Dt. Holstein Rotbunt:<br />
n = 89; FV = Fleckvieh, n = 74; Sonstige = Fleckvieh x Jersey: n = 1; TR = Trächtigkeitsrate)<br />
Rasse<br />
Seminalplasma<br />
(n = 171)<br />
Placebo<br />
(n = 173)<br />
Kontrolle<br />
(n = 165)<br />
TR<br />
Anzahl % Anzahl % Anzahl % %<br />
SB 117 68,42 117 67,63 111 67,27 54,20<br />
RB 26 15,20 32 18,50 31 18,79 51,69<br />
FV 27 15,79 <strong>24</strong> 13,87 23 13,94 58,11<br />
Sonstige 1 0 0<br />
Laktation<br />
Dt. Holstein<br />
SB<br />
Dt. Holstein<br />
RB<br />
Dt.<br />
Fleckvieh<br />
17,49<br />
14,54<br />
Für 499 Tiere lagen Angaben zur Laktation vor. Davon waren 60 Tiere in der 0. Laktation,<br />
dies entspricht 12,02 % Färsen. Die meisten Tiere (343 = 68,74 %) befanden sich in der 1. - 3.<br />
Laktation, wovon wiederum die 1. Laktation mit 146 Tieren (= 29,26 %) den größten Anteil<br />
stellte (Abb. 14). Die Tiere mit Laktationsnummer 6. - 11. wurden aufgrund der geringen<br />
Tieranzahl in der weiteren Auswertung zusammengefasst unter ≥ 6. Der Laktationsmittelwert<br />
beträgt 2,2 ± s 1,69. Die Verteilung der Studientiere nach Laktation innerhalb der<br />
Versuchsgruppen unterscheidet sich nicht signifikant (P > 0,05; Tab. 8). Die<br />
Trächtigkeitsraten variieren zwischen 44,55 % in der 2. Laktation und 60,00 % bei den Färsen<br />
bzw. 61,90 % in der Gruppe mit ≥ 6 Laktationen. Es gab keinen signifikanten Einfluss der<br />
Laktationsnummer auf die Trächtigkeitsrate (P > 0,05).<br />
63<br />
67,78<br />
0 10 20 30 40 50 60 70<br />
Tiere (%)
Laktationsnummer<br />
Abb. 14: Prozentuale Verteilung der Studientiere nach Laktation (Anzahl der Tiere je Laktationsgruppe:<br />
n 0 = 60; n 1 = 146; n 2 = 101; n 3 = 96; n 4 = 49; n 5 = 26; n ≥ 6 = 21)<br />
Tab. 8: Verteilung der Studientiere nach Laktationsnummer innerhalb der Versuchsgruppen (Anzahl der<br />
Tiere je Laktationsgruppe: n 0 = 60; n 1 = 146; n 2 = 101; n 3 = 96; n 4 = 49; n 5 = 26; n ≥ 6 = 21;<br />
TR = Trächtigkeitsrate)<br />
Laktation<br />
Seminalplasma<br />
(n = 169)<br />
Placebo<br />
(n = 168)<br />
Kontrolle<br />
(n = 162)<br />
TR<br />
Anzahl % Anzahl % Anzahl % %<br />
0. 25 14,79 17 10,12 18 11,11 60,00<br />
1. 44 26,04 55 32,74 47 29,01 57,53<br />
2. 32 18,93 32 19,05 37 22,84 44,55<br />
3. 37 21,89 27 16,07 32 19,75 53,13<br />
4. 20 11,83 18 10,71 11 6,79 51,02<br />
5. 7 4,14 11 6,55 8 4,94 57,69<br />
≥ 6. 4 2,37 8 4,76 9 5,56 61,90<br />
Rastzeit<br />
0.<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
≥ 6.<br />
5,21<br />
4,21<br />
9,82<br />
12,02<br />
Von 439 Tieren, die zum Zeitpunkt der Studiendurchführung bereits eine Abkalbung hinter<br />
sich hatten, lagen 411 Angaben zum Abkalbedatum vor. Demnach befand sich die Hälfte im<br />
Zeitraum 50 - 99 dp.p., ein Drittel mindestens 100 d p.p. und ungefähr ein Achtel der Tiere<br />
weniger als 49 d p.p. (Abb. 15). Im Mittel befanden sich die Tiere 97 (21 - 465;<br />
± s 58,56) Tage post partum. Die Tiere der Gruppe ≤ 49 d p.p. zeigten eine signifikant<br />
niedrigere Trächtigkeitsrate als die Tiere der Gruppe ≥ 50 d p.p. (38,60 % zu 56,50 %; Abb.<br />
64<br />
20,<strong>24</strong><br />
19,<strong>24</strong><br />
29,26<br />
0 5 10 15 20 25 30<br />
Tiere (%)
16). Innerhalb der Rastzeitfenster und Versuchsgruppen waren die Tiere gleichmäßig verteilt<br />
(P > 0,05).<br />
Rastzeit in Tagen<br />
≤ 49 D<br />
50-99 D<br />
≥ 100 D<br />
Abb. 15: Prozentuale Verteilung der Studientiere nach Rastzeit (in Tagen; ≤ 49 d p.p.: n = 57;<br />
50 - 99 d p.p.: n = 214; ≥ 100 d p.p.: n = 140)<br />
Tab. 9: Verteilung der Studientiere nach Rastzeit (in Tagen) innerhalb der Versuchsgruppen<br />
(d = Tage; p.p. = post partum; Anzahl der Tiere je Gruppe: ≤ 49 dp.p.: n = 57;<br />
50 - 99 d p.p.: n = 214; ≥ 100 d p.p.: n = 140; TR = Trächtigkeitsrate)<br />
Tage<br />
p.p.<br />
Seminalplasma<br />
(n = 137)<br />
Anzahl %<br />
Placebo<br />
(n = 142)<br />
Anzahl %<br />
Kontrolle<br />
(n = 132)<br />
Anzahl %<br />
TR<br />
%<br />
≤ 49 21 15,33 20 14,08 16 12,12 38,60<br />
50 - 99 69 50,36 74 52,11 71 53,79 56,07<br />
≥ 100 47 34,31 48 33,80 45 34,<strong>09</strong> 57,14<br />
Störungen post partum<br />
13,87<br />
Zu Störungen nach der vorangegangenen Geburt wurden 417 Angaben gemacht. Auf einer<br />
Skalierung der Störungen von 1 (keine) bis 5 (sehr stark) hatte bei den meisten Tieren<br />
(n = 351) keine Störung post partum vorgelegen. Die Tiere mit überwundenen<br />
Geburtsstörungen (n = 66) zum Zeitpunkt der Studiendurchführung wurden überwiegend den<br />
Bereichen geringe (2) bis mittlere (3) Störungen zugeordnet (Abb. 17).<br />
65<br />
34,06<br />
52,07<br />
0 10 20 30 40 50 60<br />
Tiere (%)
Abb. 16: Trächtigkeitsraten in Prozent in Abhängigkeit von der Rastzeit (d = Tage; p.p. = post partum;<br />
n ≤ 49 d = 57; n ≥ 50 d = 354; *signifikant: P = 0,012)<br />
Störungen p.p.<br />
Trächtigkeitsrate (%)<br />
1 (keine)<br />
2 (geringe)<br />
3 (mittlere)<br />
4 (starke)<br />
5 (sehr starke)<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
0,<strong>24</strong><br />
4,32<br />
2,16<br />
38,60<br />
Abb. 17: Prozentuale Verteilung der Studientiere nach Störungen post partum (eingeteilt in Grad 1 - 5;<br />
Anzahl der Tiere je Gruppe: n 1 = 351; n 2 = 38; n 3 = 18; n 4 = 9; n 5 = 1)<br />
Die nach Nachgeburtsstörungen gruppierten Tiere waren gleichmäßig auf die drei<br />
Versuchsgruppen verteilt und unterschieden sich in ihrer Anzahl je Versuchsgruppe nicht<br />
signifikant (Tab. 10). Für die große Tiergruppe ohne Störungen post partum lagen die<br />
66<br />
56,60<br />
≤ 49 d p.p. ≥ 50 d p.p.<br />
9,11<br />
*<br />
Rastzeit in Tagen<br />
*<br />
84,17<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Tiere (%)
Trächtigkeitsraten mit 53,85 % höher als in der relativ kleinen Tiergruppe mit geringen,<br />
mittleren, starken und sehr starken Nachgeburtsstörungen mit insgesamt 51,52 %. Dieser<br />
Unterschied ist nicht signifikant (P > 0,05).<br />
Tab. 10: Verteilung der Studientiere nach Störungen post partum innerhalb der Versuchsgruppen<br />
(p.p. = post partum; Anzahl der Tiere je Gruppe: n 1 = 351; n 2 = 38; n 3 = 18; n 4 = 9;<br />
n 5 = 1; TR = Trächtigkeitsrate)<br />
Störung<br />
p.p.<br />
Seminalplasma<br />
(n = 137)<br />
Anzahl %<br />
Placebo<br />
(n = 143)<br />
Anzahl %<br />
Kontrolle<br />
(n = 137)<br />
Anzahl %<br />
TR<br />
%<br />
1 (keine) 121 88,32 122 85,31 108 78,83 53,85<br />
2 (gering) 7 5,11 11 7,69 20 14,60 57,89<br />
3 (mittel) 7 5,11 7 4,90 4 2,92 38,89<br />
4 (stark) 2 1,46 2 1,40 5 3,65 44,44<br />
5 (sehr stark) 0 1 0,70 0<br />
Milchmenge<br />
Von 439 laktierenden Studientieren sind für 398 die Milchmengen der dem Studienbeginn<br />
vorangegangenen, letzten Milchleistungsprüfung verzeichnet. Bei einer Einteilung in 10 kg-<br />
Schritten, fanden sich demnach mehr als zwei Drittel (75,63 %) der Studientiere in den<br />
Gruppen 20 - 29 und 30 - 39 kg tägliche Milchmenge. Ein Fünftel der Tiere gab mindestens<br />
40 kg, davon nur 9 Tiere mehr als 50 kg. Auch der Anteil der gering laktierenden Tiere mit<br />
einer täglichen Milchmenge von weniger als 19 kg war mit 17 Tieren verhältnismäßig<br />
klein (Abb. 18). Die Anzahl der Tiere je Milchmengen- und Versuchsgruppe unterschied sich<br />
nicht signifikant (P > 0,05). Eine Berechnung der Trächtigkeitsraten für die jeweilige<br />
Milchmengengruppe, unabhängig von den Versuchsgruppen, ergab Hinweise auf sinkende<br />
Trächtigkeitsraten bei steigender täglicher Milchmenge. In der Gruppe mit weniger als 19 kg<br />
betrug die Trächtigkeitsrate 64,71 %, in der Gruppe mit mehr als 50 kg 44,44 %. (Tab. 11).<br />
Ein Vergleich der annähernd gleich großen Tiergruppen≤ 29 kg mit ≥ 30 kg zeigte<br />
Trächtigkeitsraten von 40,38 % zu 31,35 % (P = 0,0612).<br />
67
Milchmenge<br />
Abb. 18: Prozentuale Verteilung der Studientiere nach Milchmenge (kg = Kilogramm; Anzahl Tiere<br />
je Gruppe: n ≤ 19 = 17; n 20 - 29 = 127; n 30 - 39 = 174; n 40 - 49 = 71; n ≥ 50 = 9)<br />
Milchprobe<br />
≤ 19 kg<br />
20-29 kg<br />
30-39 kg<br />
40-49 kg<br />
≥ 50 kg<br />
4,27<br />
2,26<br />
Für 379 der 439 laktierenden Studientiere lagen auch die Zellzahlen der für die letzte<br />
Milchleistungsprüfung untersuchten Milchprobe vor. Ein überwiegender Anteil von 91,82 %<br />
der laktierenden Rinder hatte weniger als 500.000 Zellen pro mL Milch. Bei einer Abstufung<br />
der Zellzahlgruppe mit weniger als 500.000 Zellen pro mL Milch in drei Untergruppen<br />
(≤ 49.000, 50. - 99.000 und 100. - 499.000 Zellen) lagen jeweils ungefähr knapp ein Drittel<br />
(33,51% respektive 26,39% und 31,93%) in jeder Untergruppe. Zellzahlen größer als 500.000<br />
Zellen pro mL Milch wurden bei nur 8,18 % der Studientiere gemessen (Abb. 19).<br />
Tab. 11: Verteilung der Studientiere nach Milchmenge (in kg) innerhalb der Versuchsgruppen (Anzahl<br />
Tiere je Gruppe: n ≤ 19 = 17; n 20 - 29 = 127; n 30 - 39 = 174; n 40 - 49 = 71; n ≥ 50 = 9; TR = Trächtigkeitsrate)<br />
Milchmenge<br />
Seminalplasma<br />
(n = 129)<br />
Placebo<br />
(n = 139)<br />
Kontrolle<br />
(n = 130)<br />
TR<br />
in kg Anzahl % Anzahl % Anzahl % %<br />
≤ 19 3 2,33 8 5,76 6 4,62 64,71<br />
20 - 29 53 41,<strong>09</strong> 36 25,90 38 29,23 59,06<br />
30 - 39 51 39,53 66 47,48 57 43,85 51,72<br />
40 - 49 20 15,50 <strong>24</strong> 17,27 27 20,77 46,48<br />
≥ 50 2 1,55 5 3,60 2 1,54 44,44<br />
68<br />
17,84<br />
31,91<br />
43,72<br />
0 10 20 30 40 50<br />
Tiere (%)
Zellzahl (in Tausend)<br />
≤ 49.<br />
50-99.<br />
100-499.<br />
≥ 500.<br />
Abb. 19: Prozentuale Verteilung der Studientiere nach Zellzahlgruppe (Zellzahl in Tausend;<br />
Anzahl Tiere je Gruppe: n ≤ 49. = 127; n 50 - 99. = 100; n 100 - 499. = 121; n ≥ 500. = 31)<br />
Die Tiere der einzelnen Zellzahlgruppen sind gleichmäßig auf die Versuchsgruppen verteilt<br />
ohne signifikante Unterschiede (Tab. 12). Die Trächtigkeitsrate innerhalb der Tiergruppe mit<br />
≤ 99.000 Zellen/mL beträgt 55,51 %, für diejenigen Tiere mit ≥ 100.000 Zellen/mL 51,32 %.<br />
Dieser Unterschied ist nicht signifikant (P > 0,05).<br />
Körperkondition<br />
8,18<br />
Für fast alle Studientiere (511) wurde eine Einschätzung nach einem Body Condition Score<br />
1 (mager) - 5 (fett) abgegeben. Der Fleckvieh-Score von 2,5 (mager) - 4,5 (fett) mit<br />
Zwischenstufen wurde zur Vereinheitlichung der Daten retrospektiv in den Holstein-Score<br />
eingerechnet, indem die Fleckviehrinder der entsprechenden Holstein-Score-Gruppe<br />
zugerechnet wurden. Beispielsweise wurden die Tiere der Fleckvieh-Gruppe 2,5 (mager) der<br />
Holstein-Gruppe 1 (mager) zugeordnet. Der mit Abstand größte Anteil von 460 Tieren ist im<br />
BCS 2 - 3, wovon die 266 Tiere des BCS 3 die größere Gruppe bilden. In der BCS 1-Gruppe<br />
befanden sich 18 Tiere, des Weiteren sind 33 Tiere in den BCS-Gruppen ≥ 4, wovon die<br />
9 Tiere mit BCS 5 ausschließlich der Rasse Fleckvieh angehörten (Abb. 20).<br />
69<br />
26,39<br />
31,93<br />
33,51<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40<br />
Tiere (%)
Tab. 12: Verteilung der Studientiere nach Zellzahlgruppe innerhalb der Versuchsgruppen<br />
(Zellzahl in Tausend; Anzahl Tiere je Gruppe: n ≤ 49. = 127; n 50 - 99. = 100; n 100 - 499. = 121;<br />
n ≥ 500. = 31; TR = Trächtigkeitsrate)<br />
Zellzahl<br />
Seminalplasma<br />
n = 1<strong>24</strong>)<br />
Placebo<br />
(n = 127)<br />
Kontrolle<br />
(n = 121)<br />
TR<br />
Anzahl % Anzahl % Anzahl % %<br />
≤ 49. 44 35,48 43 33,86 40 33,06 51,18<br />
50 - 99. 39 31,45 28 22,05 32 26,45 61,00<br />
100. - 499. 34 27,42 43 33,86 38 31,40 51,<strong>24</strong><br />
≥ 500. 7 5,65 13 10,<strong>24</strong> 11 9,<strong>09</strong> 51,61<br />
Body Condition Score<br />
Abb. 20: Prozentuale Verteilung der Studientiere nach Body Condition Score (BCS = Body Condition<br />
Score nach WILDMAN et al. 1982; Anzahl Tiere je Scoregruppe: n BCS 1 = 18; n BCS 2 = 194;<br />
n BCS 3 = 266; n BCS 4 = <strong>24</strong>; n BCS 5 = 9)<br />
Die Verteilung der Studientiere nach Körperkondition innerhalb der Versuchsgruppen<br />
unterscheidet sich nicht signifikant (P > 0,05; Tab. 13). Für die Tiere der BCS-<br />
Gruppen 2 und 3, die 90 % der Studientiere ausmachten, betrug die Trächtigkeitsrate 55 %.<br />
Diejenigen Tiere mit vermehrter bzw. reduzierter Körperkondition hatten geringere<br />
Trächtigkeitsraten (zusammengerechnet 45,10 %). Der Einfluss der Körperkondition auf die<br />
Trächtigkeitsrate ist in dieser Studie jedoch nicht signifikant (P > 0,05).<br />
Lahmheit<br />
BCS 1<br />
BCS 2<br />
BCS 3<br />
BCS 4<br />
BCS 5<br />
3,52<br />
4,7<br />
1,76<br />
Eine Einschätzung nach einem Lahmheitsscore LS 1 (nicht lahm) - LS 4 (hochgradig lahm)<br />
konnte für 431 Studientiere durchgeführt werden. Mehr als zwei Drittel (n = 316) dieser Tiere<br />
70<br />
37,96<br />
52,05<br />
0 10 20 30 40 50 60<br />
Tiere (%)
wurde als nicht lahm eingestuft. Unter den lahmen Tieren LS 2 - LS 4 (26,68 %) dominierten<br />
die geringgradig lahmen Tiere (LS 2). Nur 7 Tiere entfielen auf den Score LS 4 (Abb. 21).<br />
Tab. 13: Verteilung der Studientiere nach Body Condition Score innerhalb der Versuchsgruppen<br />
(BCS = Body Condition Score nach WILDMAN et al. 1982; Anzahl Tiere je Scoregruppe:<br />
n BCS 1 = 18; n BCS 2 = 194;n BCS 3 = 266; n BCS 4 = <strong>24</strong>; n BCS 5 = 9; TR = Trächtigkeitsrate)<br />
BCS<br />
Seminalplasma<br />
n = 170)<br />
Placebo<br />
(n = 174)<br />
Kontrolle<br />
(n = 167)<br />
TR<br />
Anzahl % Anzahl % Anzahl % %<br />
1 7 4,12 5 2,87 6 3,59 50,00<br />
2 60 35,29 69 39,66 65 38,92 55,67<br />
3 88 51,76 91 52,30 87 52,10 54,51<br />
4 9 5,29 4 2,30 6 3,59 37,50<br />
5 6 3,53 5 2,87 3 1,80 55,56<br />
Lahmheitsscore<br />
LS 1<br />
LS 2<br />
LS 3<br />
LS 4<br />
2,78<br />
1,62<br />
Abb. 21: Prozentuale Verteilung der Studientiere nach Lahmheits-Score (LS = Lahmheitsscore nach<br />
SPRECHER et al. 1997; Anzahl Tiere je Scoregruppe: n LS 1 = 316; n LS 2 = 96; n LS 3 = 12; n LS 4 = 7)<br />
Die Verteilung der Studientiere nach Lahmheits-Score innerhalb der Versuchsgruppen<br />
unterscheidet sich nicht signifikant (P > 0,05; Tab. 14). In den beiden großen Score-Gruppen<br />
LS 1 und 2 lag die Trächtigkeitsrate bei circa 55 %. Die Berechnung der Trächtigkeitsraten<br />
für LS 3 + 4 erfolgt auf der Basis geringer Tierzahlen. Die Gruppe der nichtlahmen Tiere der<br />
Gruppe der leicht bis hochgradig lahmen Tiere gegenübergestellt ergab Trächtigkeitsraten von<br />
54,11 % zu 56,52 % (P = 0,655)<br />
22,27<br />
71<br />
73,32<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80<br />
Tiere (%)
Tab. 14: Verteilung der Studientiere nach Lahmheits-Score innerhalb der Versuchsgruppen<br />
(LS = Lahmheitsscore nach SPRECHER et al. 1997; Anzahl Tiere je Scoregruppe:<br />
n LS 1 = 316; n LS 2 = 96; n LS 3 = 12; n LS 4 = 7; TR = Trächtigkeitsrate)<br />
Lahmheits-<br />
Score<br />
Seminalplasma<br />
(n = 143)<br />
Anzahl %<br />
Placebo<br />
(n = 146)<br />
Anzahl %<br />
Kontrolle<br />
(n = 142)<br />
Anzahl %<br />
TR<br />
%<br />
1 (nicht lahm) 102 71,33 110 75,34 104 73,<strong>24</strong> 54,11<br />
2 (ggr. lahm) 35 <strong>24</strong>,48 29 19,86 32 22,54 56,25<br />
3 (mgr. lahm) 5 3,50 5 3,42 2 1,41 66,67<br />
4 (hgr. lahm) 1 0,70 2 1,37 4 2,82 42,86<br />
Hygiene<br />
Eine Anzahl von 464 Studientieren wurde zusätzlich nach einem Hygiene-Score<br />
HYG 1 (sauber) - HYG 4 (stark verschmutzt) eingeschätzt. Fast die Hälfte der Tiere<br />
(46,55 %) wurde anhand des visuellen Eindrucks von Euter, Hintergliedmaßen und Schwanz<br />
sauber eingestuft. Von den <strong>24</strong>8 als HYG 2 - HYG 4 eingestuften Tieren waren 180 leicht<br />
verschmutzt und nur 4 Tiere fielen als stark verschmutzt auf (Abb. 22). Die Tiere der<br />
einzelnen Hygienescore-Gruppen verteilten sich gleichmäßig auf die drei Versuchsgruppen<br />
und es gab in dieser Feldstudie keinen signifikanten Einfluss der Hygiene auf die<br />
Trächtigkeitsrate (P > 0,05; Tab. 15).<br />
Hygienescore<br />
HYG 1<br />
HYG 2<br />
HYG 3<br />
HYG 4<br />
0,86<br />
13,79<br />
Abb. 22: Prozentuale Verteilung der Studientiere nach Hygiene-Score (HYG = Hygienescore nach<br />
RENEAU et al. 2003; Anzahl Tiere je Scoregruppe: n HYG 1 = 216; n HYG 2 = 180; n HYG 3 = 64;<br />
n HYG 4 = 4)<br />
72<br />
38,79<br />
46,55<br />
0 10 20 30 40 50<br />
Tiere (%)
Tab. 15: Verteilung der Studientiere nach Hygiene-Score innerhalb der Versuchsgruppen<br />
(HYG = Hygienescore nach RENEAU et al. 2003; vers. = verschmutzt; Anzahl Tiere je<br />
Scoregruppe: n HYG 1 = 216; n HYG 2 = 180; n HYG 3 = 64; n HYG 4 = 4; TR = Trächtigkeitsrate)<br />
Hygiene-Score<br />
Seminalplasma<br />
(n = 150)<br />
Placebo<br />
n = 160)<br />
Kontrolle<br />
(n = 154)<br />
TR<br />
Anzahl % Anzahl % Anzahl % %<br />
1 (sauber) 65 43,33 78 48,75 73 47,40 51,39<br />
2 (leicht vers.) 65 43,33 58 36,25 57 37,01 56,67<br />
3 (mäßig vers.) 19 12,67 21 13,13 <strong>24</strong> 15,58 51,56<br />
4 (stark vers.) 1 0,67 3 1,88 0 50,00<br />
Letzte beobachtete Brunst<br />
Zur Beobachtung einer der Insemination vorausgegangenen Brunst wurden nur 72 Angaben<br />
gemacht, dies entspricht 14,10 % der Gesamttierzahl in der Studie. Von diesen beobachteten<br />
Brunstäußerungen lagen 63 (87,5 %) im Zeitraum 18 - <strong>24</strong> Tage vor der Insemination, d.h. bei<br />
regelmäßigem Zyklus im zu erwartenden Zeitraum.<br />
Dauer der Brunst und Brunstfeststellung<br />
Die Brunstfeststellung, wozu 322 Angaben zur Auswertung vorlagen, erfolgte in 98,45 %<br />
(n = 317) visuell und bei 1,55 % (n = 5) der Tieren mittels Pedometer. Des Weiteren<br />
lagen 161 Angaben zur Dauer der Brunst bis zur Insemination vor. Demnach befanden sich<br />
95,03 % (n = 153) der vorgestellten Tiere seit 6 - 18 h in der Brunst. Bei sechs Tieren<br />
(3,73 %) wurde der Östrus seit weniger als sechs Stunden und bei zwei Tieren (1,<strong>24</strong> %) seit<br />
mehr als 19 h beobachtet.<br />
Brunstschleim<br />
viel<br />
wenig<br />
Abb. 23: Prozentuale Verteilung der Studientiere nach Menge des Brunstschleims<br />
(subjektive Einteilung in viel bzw. wenig Brunstschleim; n viel = 265; n wenig = <strong>24</strong>7)<br />
73<br />
51,76<br />
48,<strong>24</strong><br />
0 10 20 30 40 50 60<br />
Tiere (%)
Brunstschleim<br />
Für 512 Tiere wurden Angaben zur Menge des Brunstschleims gemacht: <strong>24</strong>7 Tiere zeigten<br />
viel, 265 Tiere zeigten wenig Brunstschleim zum Zeitpunkt der Studiendurchführung<br />
(Abb. 23). Die Tiere beider Gruppen verteilen sich ohne signifikanten Unterschied auf die<br />
Versuchsgruppen (P > 0,05) Die Berechnung der Trächtigkeitsraten innerhalb der beiden<br />
Gruppen ergibt 55,47 % (viel Brunstschleim) zu 52,63 % (wenig Brunstschleim; P > 0,05).<br />
Von den 501 Angaben zur Beschaffenheit des Brunstschleims wiesen alle Tiere klaren<br />
Brunstschleim auf. Beimengungen wurden zusätzlich bei sieben Tieren vermerkt, davon<br />
zeigte der Brunstschleim von drei Tieren blutige und von vier Tieren eitrige Beimengungen,<br />
die jedoch nicht zur Ablehnung der Besamung führten.<br />
Intensität der äußeren Brunstsymptomatik<br />
Für 489 Tiere wurde die Intensität der Brunstsymptome semiquantitativ auf einer Skala von<br />
BS 1 (keine Anzeichen) bis BS 5 (sehr starke Anzeichen) eingeschätzt. Davon befinden sich<br />
94,27 % der Tiere im Bereich BS ≥ 3, d.h. die Intensität ihrer Brunstsymptome wurde<br />
mindestens als mittel eingeschätzt. Bezogen auf die einzelnen Abstufungen zeigten die<br />
meisten Studientiere (n = 213) starke Brunstanzeichen (BS 4). Danach folgen 136 bzw. 112<br />
Tiere mit sehr starker (BS 5) bzw. mittlerer (BS 3) Brunstintensität. Des Weiteren zeigten <strong>24</strong><br />
Studientiere geringe (BS 2) und 4 Tiere keine (BS 1) Brunstsymptome (Abb. <strong>24</strong>).<br />
Intensität der Brunstsymptome<br />
BS 1<br />
BS 2<br />
BS 3<br />
BS 4<br />
BS 5<br />
0,82<br />
4,91<br />
Abb. <strong>24</strong>: Prozentuale Verteilung der Studientiere nach Intensität der Brunstsymptome (BS = Intensität<br />
der äußeren Brunstsymptome: BS 1 (keine) - BS 5 (sehr starke) Brunstsymptomatik; Anzahl<br />
Tiere je Gruppe: n BS 1 = 4; n BS 2 = <strong>24</strong>; n BS 3 = 112; n BS 4 = 213; n BS 5 = 136)<br />
74<br />
22,90<br />
27,81<br />
43,56<br />
0 10 20 30 40 50<br />
Tiere (%)
Die Tiere der einzelnen Gruppen verteilten sich ohne signifikanten Unterschied auf die drei<br />
Versuchsgruppen (P > 0,05; Tab. 16). Eine Berechnung der Trächtigkeitsraten verdeutlicht<br />
signifikant, dass mit stärkerer Brunstsymptomatik auch die Trächtigkeitsrate steigt. Ein<br />
Vergleich der Gruppen BS 1 - 3 zeigte 45,71 % Trächtigkeitsrate zu 55,59 % in der<br />
Tiergruppe mit stark ausgeprägten Brunstsymptomen (BS 4 + 5; P = 0,048; Abb. 25).<br />
Tab. 16: Verteilung der Studientiere nach Intensität der Brunstsymptomatik innerhalb der<br />
Versuchsgruppen (BS = Intensität der äußeren Brunstsymptome: BS 1 (keine) - BS 5 (sehr starke)<br />
Brunstsymptomatik;Anzahl Tiere je Gruppe:n BS 1 = 4; n BS 2 = <strong>24</strong>; n BS 3 = 112; n BS 4 = 213;<br />
n BS 5 = 136; TR = Trächtigkeitsrate)<br />
Brunstintensität<br />
Seminalplasma<br />
n = 165)<br />
Anzahl %<br />
Placebo<br />
(n = 168)<br />
Anzahl %<br />
Kontrolle<br />
(n = 156)<br />
Anzahl %<br />
TR<br />
%<br />
BS 1 2 1,21 0 0,00 2 1,28 25,00<br />
BS 2 9 5,45 9 5,36 6 3,85 29,17<br />
BS 3 35 21,21 42 25,00 35 22,44 50,00<br />
BS 4 72 43,64 75 44,64 66 42,31 54,46<br />
BS 5 47 28,48 42 25,00 47 30,13 57,35<br />
Tiere (%)<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
*<br />
45,71<br />
Abb. 25: Trächtigkeitsraten in Prozent in Abhängigkeit von der Intensität der äußeren Brunstsymptome<br />
(BS = Intensität der äußeren Brunstsymptome: BS 1 (keine) - BS 5 (sehr starke)<br />
Brunstsymptomatik n BS 1-3 = 140; n BS 4+5 = 349; * = signifikant: P = 0,048)<br />
75<br />
*<br />
55,59<br />
BS 1 - 3 BS 4 + 5<br />
Intensität der Brunstsymptome
Kontraktion der Gebärmutter<br />
Für 496 Studientiere lag eine semiquantitative Einschätzung der Uteruskontraktion<br />
(K1 = wenig kontrahiert bis K3 = stark kontrahiert) vor. Der überwiegende Anteil (n = 259)<br />
wurde als kontrahiert (K2) eingestuft, ein fast ebenso großer Anteil (n = 216) als stark<br />
kontrahiert (K3). Ein vergleichsweise geringer Anteil von 21 Studientieren wurde mit wenig<br />
kontrahierten Uterus (K1) zur Besamung vorgestellt (Abb. 26). Die Tiere der drei<br />
Kontraktionsklassen waren gleichmäßig auf die Versuchsgruppen verteilt (Tab. 17). Anhand<br />
der Berechnung der Trächtigkeitsraten für jede Kontraktionsklasse ergeben sich Hinweise auf<br />
eine erhöhte Trächtigkeitsrate bei stärkerer Gebärmutterkontraktion zum Zeitpunkt der<br />
Besamung. Einer Rate von 52,51 % bei denjenigen Tieren mit kontrahiertem stehen 56,94 %<br />
bei Tieren mit stark kontrahiertem Uterus gegenüber (P > 0,05). Die weitaus niedrigere<br />
Trächtigkeitsrate der Tiergruppe mit schlechter Uteruskontraktion unterscheidet sich ebenfalls<br />
nicht signifikant von den anderen Tiergruppen.<br />
Uteruskontraktion<br />
K 1<br />
K 2<br />
K 3<br />
4,23<br />
Abb. 26: Prozentuale Verteilung der Studientiere nach Kontraktionsgrad der Gebärmutter<br />
(K = subjektive Einteilung der Uteruskontraktion: K 1 = schlecht kontrahiert; K 2 = kontrahiert;<br />
K 3 = stark kontrahiert; n K 1 = 21; n K 2 = 259; n K 3 = 216)<br />
Tab. 17: Verteilung der Studientiere nach Kontraktionsgrad innerhalb der Versuchsgruppen<br />
(K= subjektiveEinteilung der Uterusontraktion: K 1 = wenig kontrahiert; K 2 = kontrahiert;<br />
K 3 = stark kontrahiert;n K 1 = 21; n K 2 = 259; n K 3 = 216; TR = Trächtigkeitsrate)<br />
Kontraktionsgrad<br />
Seminalplasma<br />
(n = 165)<br />
Anzahl %<br />
Placebo<br />
(n = 167)<br />
Anzahl %<br />
Kontrolle<br />
(n = 164)<br />
Anzahl %<br />
TR<br />
%<br />
K 1 5 3,03 9 5,39 7 4,27 38,10<br />
K 2 88 53,33 87 52,10 84 51,22 52,51<br />
K 3 72 43,64 71 42,51 73 44,51 56,94<br />
76<br />
43,55<br />
52,22<br />
0 10 20 30 40 50 60<br />
Tiere (%)
Zervixzytologiestatus<br />
Von den bei allen Studientieren gewonnenen exfoliativen Zervixzytologieproben enthielten<br />
nach Anfärbung 414 Proben mindestens 200 lichtmikroskopisch auszählbare Zellen und<br />
erfüllten damit das Kriterium zur Auswertung. Anhand eines Grenzwertes von 10 %<br />
polymorphkernigen Granulozyten (PMN) wurden 3<strong>24</strong> Proben der Kategorie „zytologisch<br />
unauffällig“ (PMN ≤ 10 %) zugeordnet. Die restlichen 90 Proben entfielen auf die Kategorie<br />
„zytologisch auffällig“ (PMN > 10 %; Abb. 27).<br />
Bei einer Verschiebung der Grenzwertkriterien ergaben sich nur geringfügig unterschiedliche<br />
Anteile in den Kategorien:<br />
• Mit einer kritischen Anzahl von mindestens 100 auszählbaren Zellen und einem<br />
Grenzwert von 10 % PMN sind 440 Proben auswertbar, wovon 346 (= 78,64 %)<br />
PMN ≤ 10 % und 94 (= 21,36 %) PMN > 10 % waren.<br />
• Bei einem Grenzwert von 5 % PMN und einer kritischen Anzahl von mindestens 200<br />
auszählbaren Zellen lagen 299 (= 72,22%) in der Kategorie PMN ≤ 10 % und<br />
115 (= 27,78 %) in der Kategorie PMN > 10 %.<br />
Die Verteilung der Studientiere nach Zervixzytologiestatus innerhalb der Versuchsgruppen<br />
unterschied sich nicht signifikant (P > 0,05; Tab. 18). Mit 54,32 % bzw. 50,00 %<br />
unterschieden sich die Trächtigkeitsraten zwischen den Zytologiestatus-Gruppen nicht<br />
signifikant (P > 0,05; Abb. 28).<br />
Zervixzytologie<br />
PMN ≤ 10 %<br />
PMN > 10 %<br />
21,74<br />
Abb. 27: Prozentuale Verteilung der Studientiere nach Zervixzytologiestatus (PMN = Polymorphkernige<br />
Granulozyten; Auswertung nach > 200 Zellen und 10 % Grenzwert; Tieranzahl je Gruppe:<br />
n PMN ≤ 10% = 3<strong>24</strong>; n PMN > 10% = 90)<br />
77<br />
78,26<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80 Tiere (%)
Tab. 18: Verteilung der Studientiere nach Zervixzytologiestatus innerhalb der Versuchsgruppen<br />
(PMN = Polymorphkernige Granulozyten; Tieranzahl je Gruppe: n PMN ≤ 10% = 3<strong>24</strong>;<br />
n PMN > 10% = 90)<br />
Zervix- Seminalplasma Placebo<br />
Kontrolle<br />
zytologie (n = 138)<br />
(n = 140)<br />
(n = 136)<br />
status Anzahl % Anzahl % Anzahl %<br />
PMN ≤ 10 % 110 79,71 111 79,29 103 75,74<br />
PMN > 10 % 28 20,29 29 20,71 33 <strong>24</strong>,26<br />
Abb. 28: Trächtigkeitsraten in Prozent nach Zervixzytologiestatus (PMN = Polymorphkernige<br />
Granulozyten; Tierzahl je Gruppe: n PMN ≤ 10% = 3<strong>24</strong>; n PMN > 10% = 90)<br />
Haltungssystem<br />
Tiere (%)<br />
Anbindung<br />
Laufstall<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
54,32<br />
Abb. 29: Prozentuale Verteilung der Studientiere nach Haltungssystem (L = Laufstall; A = Anbindung;<br />
Tierzahl je Gruppe: n L = 387; n A = 120)<br />
78<br />
50,00<br />
PMN ≤ 10 % PMN > 10 %<br />
Zervixzytologie<br />
23,58<br />
76,03<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80 Tiere (%)
Haltungssystem<br />
Für 5<strong>09</strong> Studientiere wurde das Haltungssystem miterfasst (Abb. 29). Beinahe vier Fünftel der<br />
Tiere (n = 387) wurde in Laufstallsystemen gehalten und gut ein Fünftel (n = 120) in<br />
Anbindehaltung. Nur 2 Tiere (= 0,39 %) waren zum Zeitpunkt der Lösungsapplikation auf der<br />
Weide. Auf die drei Versuchsgruppen waren die Tiere beider Haltungssysteme gleichmäßig<br />
verteilt ohne signifikanten Unterschied (P > 0,05; Tab. 19). Der Einfluss der Haltungsform<br />
auf die Trächtigkeitsrate, 55,04 % für die Laufstallgruppe zu 50,83 % für die Tiere in<br />
Anbindung, war in der Studie nicht signifikant (P > 0,05).<br />
Tab. 19: Verteilung der Studientiere nach Haltungssystem innerhalb der Versuchsgruppen (L = Laufstall;<br />
A = Anbindung; Tierzahl je Gruppe: n L = 387; n A = 120; TR = Trächtigkeitsrate)<br />
Haltungssystem<br />
Seminalplasma<br />
(n = 1<strong>24</strong>)<br />
Anzahl %<br />
Placebo<br />
(n = 127)<br />
Anzahl %<br />
Kontrolle<br />
(n = 121)<br />
Anzahl %<br />
TR<br />
%<br />
Laufstall 126 73,68 129 75,00 132 80,49 55,04<br />
Anbindung 45 26,32 43 25,00 32 19,51 50,83<br />
Betriebe und Betriebsgröße<br />
Insgesamt wurden Tiere von mehr als 200 verschiedenen Betrieben in die Studie einbezogen.<br />
Die Größe des Betriebes zu dem das Studientier gehörte, wurde in 393 Fällen angegeben,<br />
wobei eine Abstufung der Betriebsgröße in Schritten á 50 Tiere ausgewertet wurde (Abb. 30).<br />
Ungefähr ein Viertel der Tiere standen in Betrieben der Größenordnung 50 - 99 Tiere<br />
(n = 1<strong>09</strong>) bzw. 100 - 149 Tiere (n = 101). Danach folgten jeweils circa ein Fünftel der Tiere in<br />
Betrieben der Größenordnung 150 - 199 (n = 78) bzw. ≥ 200 (n = 83). Nur 22 Tiere gehörten<br />
zu Betrieben mit weniger als 49 Tieren. Im Anschluss an die Studiendurchführung stellte sich<br />
leider heraus, dass einige Angaben zur Betriebsgröße sich allein auf die laktierenden Tiere,<br />
einige sich auf die laktierenden und trockenstehenden Tiere und andere sich auf alle Rinder<br />
des Betriebes inklusive Kälber und Mastrinder bezogen.<br />
79
Betriebsgrößenklasse<br />
≤ 49<br />
50-99<br />
100-149<br />
150-199<br />
≥ 200<br />
5,60<br />
Abb. 30: Prozentuale Verteilung der Studientiere nach Größe des Herkunftsbetriebes (Tieranzahl je<br />
Betriebsgrößenklasse: n ≤ 49 = 22; n 50 - 99 = 1<strong>09</strong>; n 100 - 149 = 101; n 150 - 199 = 78; n ≥ 200 = 83)<br />
Wie in Tab. 20 dargestellt, verteilten sich die Studientiere, aufgeschlüsselt nach der Größe<br />
ihres Herkunftsbetriebes, gleichmäßig auf die Versuchsgruppen (P > 0,05). Die<br />
Trächtigkeitsrate für die Betriebsgrößenklassen ≤ 99 Tiere (n = 131) lag bei 51,15 %, die für<br />
die Betriebsgrößenklassen ≥ 100 Tiere (n = 262) lag bei 54,96 % (P > 0,05).<br />
Tab. 20: Verteilung der Studientiere nach Betriebsgröße innerhalb der Versuchsgruppen (Tieranzahl je<br />
Betriebsgrößenklasse: n ≤ 49 = 22; n 50 - 99 = 1<strong>09</strong>; n 100 - 149 = 101; n 150 - 199 = 78; n ≥ 200 = 83;<br />
TR = Trächtigkeitsrate)<br />
Betriebsgröße<br />
Seminalplasma<br />
(n = 131)<br />
Anzahl %<br />
Placebo<br />
(n = 134)<br />
Anzahl %<br />
Kontrolle<br />
(n = 128)<br />
Anzahl %<br />
TR<br />
%<br />
≤ 49 7 5,34 7 5,22 8 6,25 59,<strong>09</strong><br />
50 - 99 36 27,48 36 26,87 37 28,91 49,54<br />
100 - 149 34 25,95 35 26,12 32 25,00 64,36<br />
150 - 199 28 21,37 27 20,15 23 17,97 50,00<br />
≥ 200 26 19,85 29 21,64 28 21,88 48,19<br />
Gruppengröße und Liegeplätze<br />
Die Größe der Tiergruppe, in der sich das Studientier befand, und die Anzahl der verfügbaren<br />
Liegeplätze, die dem Studientier zum Zeitpunkt der Versuchsdurchführung zur Verfügung<br />
standen, konnten in 227 Fällen ermittelt werden. Anhand einer prozentualen Aufschlüsselung<br />
in Tierkategorien á 10 Tiere kann ein Mangel bzw. Überangebot an Liegeplätzen für die Tiere<br />
einer Kategorie veranschaulicht werden, wie Abb. 31 zeigt. Die Tiere der drei<br />
80<br />
19,85<br />
21,12<br />
25,70<br />
27,74<br />
0 10 20 30 40 50<br />
Tiere (%)
Versuchsgruppen verteilten sich jedoch relativ gleichmäßig und ohne signifikanten<br />
Unterschied auf die Kategorien (P > 0,05).<br />
Eingesetztes Sperma<br />
Für 512 der 514 Studientiere wurde die Identifikation des Spermadonors der verwendeten<br />
Besamungsportion festgehalten. Insgesamt ist Sperma von 168 verschiedenen, geprüft fertilen<br />
Bullen in der Studie eingesetzt worden. Das Sperma von 146 (86,90 %) Bullen wurde 1 - 5 x,<br />
von 17 (10,12 %) Bullen 5 - 14 x und von 5 (2,98 %) Bullen mehr als fünfzehnfach<br />
eingesetzt. Diese fünf mehrfach eingesetzten Bullen verteilten sich gleichmäßig und ohne<br />
signifikanten Unterschied auf die drei Versuchsgruppen.<br />
Untersuchungen auf Trächtigkeit<br />
Bei allen Studientieren wurden nach inseminationsbegleitender Seminalplasmaapplikation per<br />
transrektaler Palpation Trächtigkeitsdiagnosen durchgeführt. Zusätzlich konnte für 198 Tiere<br />
der zeitliche Abstand zwischen Insemination und Trächtigkeitsuntersuchung ermittelt werden,<br />
wonach diese Untersuchungen alle mindestens sechs Wochen p. i. durchgeführt wurden, in<br />
über 90 % der Fälle sogar mindestens acht Wochen post inseminationem.<br />
Gruppengröße/ Liegeplatzanzahl<br />
≤ 9<br />
10-19<br />
20-29<br />
30-39<br />
40-49<br />
50-59<br />
60-69<br />
70-79<br />
80-89<br />
90-99<br />
≥ 100<br />
0,88<br />
0,88<br />
2,20<br />
1,32<br />
2,20<br />
0,00<br />
2,64<br />
3,96<br />
3,08<br />
10,13<br />
7,93<br />
Abb. 31: Prozentuale Verteilung der Studientiere nach Gruppengröße (dunkelgrau) und Liegeplatzanzahl<br />
(hellgrau; Tieranzahl: n GES = 227)<br />
81<br />
7,05<br />
14,54<br />
13,22<br />
7,05<br />
18,50<br />
15,42<br />
17,18<br />
9,69<br />
17,18<br />
20,26<br />
<strong>24</strong>,67<br />
0 5 10 15 20 25 30<br />
Tiere (%)
4.1.3 Auswertung nach Besamungsbeauftragten<br />
Neun Besamungsbeauftragte unterstützten die Durchführung der inseminationsbegleitenden<br />
Lösungsapplikation. Die Anzahl der in die Studie aufgenommenen Tiere betrug im<br />
Durchschnitt 57 (11 - 107) Tiere pro Besamungsbeauftragten. Der jeweilige Anteil der<br />
Besamungsbeauftragten an der gesamten Studie ist in Abb. 32 prozentual dargestellt. Die<br />
randomisierte Zuordnung der Studientiere zu den Versuchsgruppen garantierte für jeden<br />
Besamungsbeauftragten eine gleichmäßige Verteilung zu den Versuchsgruppen, wie anhand<br />
von Tab. 21 nachzuvollziehen ist.<br />
Besamungsbeauftragte<br />
B 1<br />
B 2<br />
B 3<br />
B 4<br />
B 5<br />
B 6<br />
B 7<br />
B 8<br />
B 9<br />
2,14<br />
5,25<br />
6,81<br />
8,95<br />
9,92<br />
Abb. 32: Prozentuale Verteilung der Studientiere nach Besamungsbeauftragten (B 1 - 9 =<br />
Besamungsbeauftragte; Anzahl Tiere je Besamungsbeauftragter: n B1 = 11; n B2 = 51; n B3 = 46;<br />
n B4 = 35; n B5 = 94; n B6 = 69; n B7 = 74; n B8 = 107; n B9 = 27)<br />
Trächtigkeitsraten je Besamungsbeauftragten und Versuchsgruppe<br />
Eine Berechnung der Trächtigkeitsraten je Besamungsbeauftragten und Versuchsgruppe zeigt<br />
Abb. 33. Die Trächtigkeitsraten der Kontrollgruppen reichten von 11,11 % (B 9) bis<br />
66,67 % (B 1). Bei fünf von neun Besamungsbeauftragten erwies sich die<br />
Seminalplasmaapplikation als diejenige mit der höchsten Trächtigkeitsrate, bei jeweils zwei<br />
Besamungsbeauftragten erzielten die Placeboapplikation bzw. die Kontrollgruppe die<br />
höchsten Trächtigkeitsraten, wie anhand der Hervorhebung in Abb. 33 verdeutlicht. Die<br />
Unterschiede in den Trächtigkeitsraten zwischen den drei Versuchsgruppen waren bei den<br />
82<br />
13,42<br />
14,40<br />
18,29<br />
20,82<br />
0 5 10 15 20 25<br />
Tiere (%)
Technikern B1 und B3 - B9 nicht signifikant (P > 0,05). Lediglich die Trächtigkeitsrate der<br />
Kontrollgruppe des Technikers B2 unterschied sich signifikant zu den Trächtigkeitsraten der<br />
Seminalplasma- und Placebogruppe (P < 0,001).<br />
Tab. 21: Verteilung der Studientiere nach Besamungsbeauftragten innerhalb der Versuchsgruppen<br />
(B 1 - 9 = Besamungsbeauftragte; Anzahl Tiere je Besamungsbeauftragter: n B1 = 11; n B2 = 51;<br />
n B3 = 46; n B4 = 35; n B5 = 94; n B6 = 69; n B7 = 74; n B8 = 107; n B9 = 27)<br />
Besamungsbeauftragte<br />
Seminalplasma<br />
(n = 172)<br />
Anzahl %<br />
Placebo<br />
(n = 175)<br />
Anzahl %<br />
Kontrolle<br />
(n = 167)<br />
Anzahl %<br />
B 1 4 36,36 4 36,36 3 27,27<br />
B 2 18 35,29 16 31,37 17 33,33<br />
B 3 16 34,78 15 32,61 15 32,61<br />
B 4 12 34,29 12 34,29 11 31,43<br />
B 5 30 31,91 33 35,11 31 32,98<br />
B 6 23 33,33 23 33,33 23 33,33<br />
B 7 <strong>24</strong> 32,43 26 35,14 <strong>24</strong> 32,43<br />
B 8 36 33,64 37 34,58 34 31,78<br />
B 9 9 33,33 9 33,33 9 33,33<br />
Trächtigkeitsrate (%)<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
*<br />
*<br />
Placebo Seminalplasma Kontrolle<br />
B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9<br />
Besamungsbeauftragte<br />
Abb. 33: Trächtigkeitsraten je Besamungsbeauftragten aufgeschlüsselt nach Versuchsgruppen<br />
(B 1 - 9 = Besamungsbeauftragte; Anzahl Tiere je Besamungsbeauftragter: n B1 = 11; n B2 = 51;<br />
n B3 = 46; n B4 = 35; n B5 = 94; n B6 = 69; n B7 = 74; n B8 = 107; n B9 = 27; hervorgehoben mittels<br />
schwarzer Rahmenlinie ist die Versuchsgruppe mit jeweils höchster Trächtigkeitsrate (TR) pro<br />
Besamungsbeauftragten; keiner der Unterschiede ist signifikant, außer B2: TR (Kontrolle) ist<br />
signifikant niedriger als TR (SP-, P-Gruppe): *signifikant P < 0,001 )<br />
83
4.1.4 Weitere Auswertung nach Rassen<br />
Eine versuchsgruppenübergreifende Auswertung hinsichtlich der Rasse der Studientiere ergab<br />
Trächtigkeitsergebnisse von 54,20 % (Dt. Holstein Schwarzbunt), 51,69 % (Dt. Holstein<br />
Rotbunt) und 58,11 % (Dt. Fleckvieh; P > 0,05).<br />
Trächtigkeitsrate je Rasse und Versuchsgruppe<br />
Unter Einbeziehung der Versuchsgruppen ergaben sich Trächtigkeitsraten zwischen 51,35 -<br />
56,41 % (SB), 45,16 - 56,25 % (RB) und 26,<strong>09</strong> - 74,07 % (FV), wie Tab. 22 zu entnehmen<br />
ist. Für die Rasse Deutsche Holstein zeigten sich für beide Farbschläge (Schwarzbunt,<br />
Rotbunt) jeweils die besten Trächtigkeitsergebnisse in der Placebogruppe. Die<br />
Trächtigkeitsergebnisse der Rasse Fleckvieh fielen am besten in der Seminalplasmagruppe<br />
aus, wobei hier mit 26,<strong>09</strong> % gleichzeitig eine sehr niedrige Trächtigkeitsrate in der<br />
Kontrollgruppe zu vermerken war. Keiner dieser Unterschiede war signifikant (P > 0,05).<br />
Tab. 22: Anzahl der trächtigen Tiere und Trächtigkeitsrate je Versuchsgruppe und Rasse<br />
(TU + = trächtig; SB = Deutsche Holstein Schwarzbunt: n = 345; RB = Deutsche Holstein<br />
Rotbunt: n = 89; FV = Deutsches Fleckvieh: n = 74; TR = Trächtigkeitsrate)<br />
Seminalplasma<br />
Placebo<br />
Kontrolle<br />
Rasse<br />
(n = 170)<br />
Anzahl/<br />
TU +<br />
TR<br />
(n = 173)<br />
Anzahl/<br />
TR<br />
TU +<br />
(n = 165)<br />
Anzahl/<br />
TR<br />
TU +<br />
SB 117/64 54,70 117/66 56,41 111/57 51,35<br />
RB 26/14 53,83 32/18 56,25 31/14 45,16<br />
FV 27/20 74,07 <strong>24</strong>/17 70,83 23/6 26,<strong>09</strong><br />
4.1.5 Weitere Auswertung nach Zervixzytologiestatus<br />
Nachdem im Kapitel 4.1.2. „Charakterisierung der Studientiere und ihre Verteilung<br />
hinsichtlich der erfassten Parameter“ der Zervixzytologiestatus der Studientiere dokumentiert<br />
und in Bezug auf die Trächtigkeitsergebnisse ausgewertet wurde, werden nun einige weitere<br />
Parameter zum Zervixzytologiestatus in Bezug gesetzt.<br />
Zervixzytologiestatus und Intensität der äußeren Brunstsymptome<br />
In den beiden Gruppen mit starker Äußerung der Brunstsymptome (BS 4 + 5) fiel der Anteil<br />
an unauffälligen Zervixzytologien höher aus als in den Gruppen mit geringer<br />
Brunstsymptomatik (BS 1 - 3; Abb. 34; P = 0,068).<br />
84
Zervixzytologiestatus und Brunstschleim<br />
In Abb. 35 erfolgt eine vergleichende Darstellung der Anteile an unauffälligen<br />
Zervixzytologien in Abhängigkeit von der Menge des Brunstschleims. Einem Anteil von<br />
75,12 % in der Gruppe mit wenig Brunstschleim stand ein Anteil von 81,50 % unauffälligen<br />
Zytologien in der Gruppe mit viel Brunstschleim gegenüber. Dieser Unterschied war nicht<br />
signifikant (P > 0,05).<br />
Zervixzytologiestatus und Uteruskontraktion<br />
Mit zunehmender Stärke der Uteruskontraktion stieg der Anteil an unauffälligen<br />
Zervixzytologien: K 1: 66,67 %; K 2: 74,21 % und K 3: 82,72 % PMN ≤ 10 %. Ein Vergleich<br />
der ungefähr gleich großen Gruppen K 1 + 2 mit K 3 zeigte einen signifikanten<br />
Zusammenhang (P = 0,028; Abb. 36).<br />
Zervixzytologiestatus und Laktation<br />
Die Färsen zeigten mit 86,00 % den höchsten Anteil unauffälliger Zervixzytologien, der<br />
niedrigste Anteil von 69,88 % war in der Tiergruppe der 2. Laktation zu finden. Ein Vergleich<br />
der Laktationsgruppen ≤ 1. Laktation und > 1. Laktation zeigte einen signifikanten<br />
Unterschied in den Anteilen an unauffälligen Zytologien (83,93 % zu 74,37 %;<br />
P = 0,021; Abb. 37).<br />
Zervixzytologiestatus und Lahmheit<br />
Der Anteil der zytologisch unauffälligen Tiere unterschied sich in der Gruppe der nicht<br />
lahmen Tiere (LS 1) mit 81,01 % PMN ≤ 10 % signifikant gegenüber einem Anteil von<br />
69,32 % PMN ≤ 10 % in der Gruppe der Tiere mit Lahmheit (LS 2 - 4; P = 0,022; Abb. 38).<br />
85
Tiere mit unauffälliger<br />
Zervixzytologie (%)<br />
Abb. 34: Anteil Tiere mit unauffälliger Zervixzytologien (PMN ≤ 10 %) in Prozent in Abhängigkeit<br />
von der Intensität der äußeren Brunstsymptome (semiquantitative Einschätzung der Intensität in<br />
BS 1 - 5; n BS 1-3 = 140; n BS 4+5 = 349; P = 0,068)<br />
Tiere mit unauffälliger<br />
Zervixzytologie (%)<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
72,22<br />
Abb. 35: Anteil Tiere mit unauffälliger Zervixzytologien (PMN ≤ 10 %) in Prozent in Abhängigkeit<br />
von der Menge des Brunstschleims (PMN = Polymorphkernige Granulozyten; subjektive<br />
Einschätzung der Schleimmenge in wenig bzw. viel; n wenig = 213; n viel = 200; P > 0,05)<br />
86<br />
80,70<br />
BS 1-3 BS 4+5<br />
Intensität der Brunstsymptome<br />
75,12<br />
81,50<br />
wenig viel<br />
Brunstschleim
Tiere mit unauffälliger<br />
Zervixzytologie (%)<br />
Abb. 36: Anteil der Tiere mit unauffälliger Zervixzytologien (PMN ≤ 10 %) in Prozent innerhalb<br />
der Uterus-kontraktionsklassen (PMN = Polymorphkernige Granulozyten; semiquantitative<br />
Einschätzung der Uteruskontraktion in K 1 – 3; n K 1+2 = 208; n K 3 = 191; *signifikant: P = 0,028)<br />
Tiere mit unauffälliger<br />
Zervixzytologie (%)<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
*<br />
73,56<br />
Abb. 37: Anteil der Tiere mit unauffälliger Zervixzytologien (PMN ≤ 10 %) in Prozent in Abhängigkeit<br />
von der Lakationsnummer (n 0.+1.Lakt. = 168; n Lakt. > 1 = 238; PMN = Polymorphkernige<br />
Granulozyten; *signifikant: P = 0,021)<br />
87<br />
82,72<br />
K 1+2 K 3<br />
83,93<br />
*<br />
Uteruskontraktion<br />
74,37<br />
≤ 1. Laktation > 1. Laktation<br />
Laktationsnummer<br />
*<br />
*
Abb. 38: Anteil der Tiere mit unauffälliger Zervixzytologien (PMN ≤ 10 %) in Prozent in der lahmheits-<br />
freien und in der lahmen Tiergruppe (PMN = Polymorphkernige Granulozyten; semiquantitative<br />
Einschätzung der Lahmheit in LS 1 – 4; n LS 1 = 258; n LS 2-4 = 88; *signifikant: P = 0,022)<br />
4.2 Transferbegleitende Seminalplasmaapplikation bei Embryonenempfängertieren<br />
(Feldstudie II)<br />
4.2.1 Versuchsgruppen und Trächtigkeitsergebnisse<br />
Bei 121 Empfängertieren wurde eine Lösungsapplikation zum Zeitpunkt der Brunst<br />
durchgeführt. Davon erwiesen sich insgesamt 68 Tiere sieben Tage später als geeignet zur<br />
Embryonenübertragung und konnten im Rahmen als Ergebnisse der Feldstudie II ausgewertet<br />
werden. Die Gründe, warum Tiere als nicht geeignet für den Transfer eingestuft wurden,<br />
waren schlecht entwickelte Gelbkörper, nicht ovulierte Follikel und Ovarzysten. Die<br />
Empfängertiere befanden sich im Einzugsbereich von drei Besamungsstationen, die jeweils<br />
eine Anzahl von 14, 20 bzw. 34 Tiere in die Studie aufnahmen. Die Größe der einzelnen<br />
Versuchsgruppen (SP, P, K) lag bei 25 (SP), 19 (P) und <strong>24</strong> Tieren in der Kontrollgruppe (Tab.<br />
23).<br />
Tiere mit unauffälliger<br />
Zervixzytologie (%)<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
*<br />
81,01<br />
keine Lahmheit<br />
(LS 1)<br />
88<br />
*<br />
69,32<br />
Lahmheit<br />
(LS 2-4)
Tab. 23: Übersicht Zahlen der Feldstudie II (transferbegleitende Seminalplasmaapplikation)<br />
Versuchs- Anzahl<br />
Anzahl<br />
gruppe<br />
Tiere tragende Tiere<br />
Seminalplasma 25 15<br />
Placebo 19 11<br />
Kontrolle <strong>24</strong> 9<br />
Gesamt 68 35<br />
In den Versuchsgruppen SP und P wurden mit jeweils 60,00 % und 57,89 % bessere<br />
Trächtigkeitsergebnisse erreicht als in der Kontrollgruppe mit 37,50 % (Abb. 39). Die<br />
Applikation von Seminalplasma oder Placebo führte zu einer Steigerung der<br />
Trächtigkeitsraten um 60 % bzw. 54 %. Die Trächtigkeitsraten zwischen den Gruppen SP und<br />
P unterschieden sich nicht signifikant (P > 0,05). Verglich man die Tiergruppen „behandelt“<br />
(SP+P) mit „unbehandelt“ (K), so ergab sich P = 0,<strong>09</strong>.<br />
Trächtigkeitsrate (%)<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
60,00<br />
Seminalplasma<br />
(SP)<br />
Abb. 39: Trächtigkeitsergebnisse in den Versuchsgruppen in Prozent (n SP = 25; n P = 19;n K = <strong>24</strong>;<br />
Unterschiede nicht signifikant; Im Vergleich zur Kontrollgruppe: PSP = 0,12; PP = 0,18;<br />
PSP+P = 0,<strong>09</strong>)<br />
4.2.2 Charakterisierung der Studientiere<br />
Im Folgenden werden nun Rasse, Laktation, Haltungssystem und Betriebsgröße,<br />
Zyklussynchronisation, Brunstfeststellung und Intensität der äußeren Brunstsymptomatik,<br />
Zervixzytologiestatus (Brunst- und ET-Zeitpunkt) der Embryonenempfängertiere<br />
89<br />
57,89<br />
Placebo<br />
(P)<br />
37,50<br />
Kontrolle<br />
(K)
eschrieben. Des Weiteren wird die ET-Durchführung, die Uterusgröße des Empfängertieres<br />
zum Transferzeitpunkt sowie die Qualität und Art der Lagerung der übertragenen Embryonen<br />
klassifiziert.<br />
Rasse<br />
Für 62 Tiere lag eine Angabe der Rasse vor: Tiere der Rassen Deutsche Holstein Schwarzbunt<br />
(58 = 93,55 %) und Deutsche Holstein Rotbunt (4 = 6,45 %) wurden in die Studie<br />
einbezogen.<br />
Laktationsnummer<br />
Für ebenfalls 62 Tiere war die Laktationsnummer bekannt. In der 1. Laktation befanden sich<br />
drei Tiere (= 4,84 %), die restlichen 59 Tiere waren Färsen (= 95,16 %).<br />
Haltungssystem und Betriebsgröße<br />
Für alle 68 Tiere konnte das Haltungssystem erfasst werden. Der überwiegende Anteil<br />
(n = 63) wurde in Laufställen gehalten und nur fünf Tiere in Anbindung. Die Betriebsgröße<br />
lag in 15 Fällen bei ≤ 99 Tiere, in 47 Fällen bei ≥ 100 Tiere. Für sechs Tiere wurde die<br />
Betriebsgröße nicht erfasst.<br />
Zyklussynchronisation<br />
Für 67 Studientiere lag eine Aussage zur Zyklussynchronisation vor. Davon unterlagen<br />
36 Tiere (= 53,73 %) einer Synchronisationsbehandlung bevor der Embryo übertragen wurde.<br />
Bei 31 Tieren (= 46,27 %) ging dem Transfer eine natürliche Brunst voraus. Zur<br />
Zyklussynchronisation verwendete Präparate sind in Tab. <strong>24</strong> aufgeführt.<br />
Die 36 synchronisierten Tieren verteilten sich zu 11/11/14 auf die Versuchsgruppen P, SP und<br />
K, die nicht-synchronisierten Tiere (n = 31) entsprechend zu 8/13/10 (P > 0,05).<br />
Versuchsgruppenübergreifend waren in der Gruppe der synchronisierten Tiere 36,11 % nach<br />
erfolgtem Embryotransfer trächtig. In der Gruppe der nicht-synchronisierten Tiere lag die<br />
Trächtigkeitsrate mit 67,74 % signifikant höher (P = 0,01; Abb. 40).<br />
Brunstfeststellung und Intensität der äußeren Brunstsymptomatik<br />
Für 62 Tiere wurde eine Angabe zur Methode der Brunstfeststellung gemacht. Demnach<br />
wurde die Brunst in 23 Fällen visuell wahrgenommen und in 12 Fällen transrektal festgestellt.<br />
90
Bei 18 Tieren erfolgte eine Kombination aus visueller Wahrnehmung und transrektaler<br />
Palpation und in 9 Fällen kam das Heatime®-System zum Einsatz.<br />
Tab. <strong>24</strong>: Zur Zyklussynchronisation der Empfängertiere verwendete Präparate und Häufigkeit ihrer<br />
Anwendung bei den Studientieren (n GES = 67)<br />
Zyklussynchronisation Anzahl der Verwendungen<br />
Estrumate® (Cloprostenol; Prostaglandin F2α-Analogon) 30<br />
Dinolytic® (Dinoprost; Prostaglandin F2α) 1<br />
CIDR® (Progesteron) 3<br />
Synchronisation ohne Angabe des Präparates 2<br />
keine Synchronisation 31<br />
Trächtigkeitsrate (%)<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
67,74<br />
Abb. 40: Trächtigkeitsergebnisse nach Zyklussynchronisationsgruppen in Prozent<br />
(Zykl.syn. = Zyklussynchronisation; n nicht synchr. = 31; n synchr. = 36; P = 0,01)<br />
*<br />
keine<br />
Zykl.syn.<br />
Für 64 Tiere wurde die Intensität der Brunstsymptome semiquantitativ auf einer Skala von<br />
BS 1 (keine Anzeichen) bis BS 5 (sehr starke Anzeichen) eingeschätzt. Davon befanden sich<br />
84,38 % der Tiere im Bereich BS ≥ 3. Innerhalb der fünf Abstufungen zeigten die meisten<br />
Studientiere starke (BS 4: n = 23) bzw. mittlere Brunstanzeichen (BS 3: n = 21; Abb. 41).<br />
91<br />
*<br />
36,11<br />
Zykl.syn.
Intensität der Brunstsymptome<br />
BS 1<br />
BS 2<br />
BS 3<br />
BS 4<br />
BS 5<br />
Abb. 41: Prozentuale Verteilung der Studientiere nach Intensität der Brunstsymptome (BS 1 = keine bis<br />
BS 5 = sehr starke Brunstsymptomatik; Anzahl Tiere je Gruppe: n BS 1 = 4; n BS 2 = 6; n BS 3 = 21<br />
n BS 4 = 23; n BS 5 = 10)<br />
Zervixzytologiestatus<br />
6,25<br />
9,38<br />
15,63<br />
Von den bei allen Empfängertieren in der Brunst (OE, d 0) und zum Transfer (ET, d 7)<br />
gewonnenen exfoliativen Zervixzytologieproben enthielten die Proben von 35 Tieren zu<br />
beiden Entnahmezeitpunkten mindestens 200 lichtmikroskopisch auszählbare Zellen nach<br />
Anfärbung und erfüllten damit das Kriterium zur Auswertung. Die 35 Tiere verteilten sich<br />
13/12/10 auf die Versuchsgruppen SP, P und K. Von den 2 x 35 Proben wurden in der Brunst<br />
25, und zum Transferzeitpunkt 31, der Kategorie „zytologisch unauffällig“ (PMN ≤ 10 %)<br />
zugeordnet. Zehn (d 0) bzw. vier (d 7) Proben entfielen in die Kategorie „zytologisch<br />
auffällig“ (PMN > 10 %; Abb. 42). Der Unterschied in den Anteilen unauffälliger Zytologien<br />
zwischen beiden Zeitpunkten ist nicht signifikant (P = 0,073).Bei der mikroskopischen<br />
Auswertung der Zytologien fiel auf, dass die während des Östrus entnommenen Proben oft<br />
zu wenige Zellen für die Auswertung enthielten. Im Östrus waren 37 von 68 Zytologien mit<br />
mehr als 200 differenzierbaren Zellen auswertbar, zum Transferzeitpunkt 59 von 68 Proben.<br />
Unter diesen 59 Zytologien lag der Anteil der PMN ≤ 10 % bei 88,14 % (n = 52) und damit in<br />
vergleichbarer Größenordnung zu dem in Abb. 42 dargestellten. Die weitere Auswertung der<br />
Zervixzytologien ist in Kapitel 4.2.3. „Weitere Auswertung der Zervixzytologien“ dargestellt.<br />
92<br />
32,81<br />
35,94<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40<br />
Tiere (%)
Tiere mit unauffälliger<br />
Zervixzytologie (%)<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
Abb. 42: Prozentuale Verteilung der Studientiere mit unauffälliger Zervixzytologiestatus<br />
nach Zeitpunkten (OE = Östrus; ET = Transfertzeitpunkt; PMN = polymorphkernige Granulozyten;<br />
Auswertung nach ≥ 200 Zellen und 10 % Grenzwert; Anzahl Tiere je Gruppe: n OE/ET = 35;<br />
P = 0,073)<br />
ET-Durchführung und Uterusgröße<br />
0<br />
71,43<br />
Die subjektive Einschätzung der ET-Durchführung in Kategorien von leichte, mittlere und<br />
schwere Durchführbarkeit des Transfers ist für die Studientiere in Abb. 43 dargestellt. In der<br />
Tiergruppe, deren Transferdurchführung als leicht klassifiziert wurde, waren 10 von 23 Tieren<br />
(43,48 %), in der Kategorie mittlere Durchführbarkeit <strong>24</strong> von 39 Tieren (61,54 %) tragend.<br />
Von denjenigen Tieren, deren Transfer als schwer durchführbar bezeichnet wurde, war keines<br />
tragend (0 von 5 Tieren). Diese Unterschiede sind nicht signifikant (P > 0,05). Des Weiteren<br />
konnte in 67 Fällen festgehalten werden, ob keine, wenig oder viel Blut während des<br />
Transfers auftrat. Bei 62 (92,54 %) dieser Tiere erfolgte der Transfer ohne Blutung (Abb. 44).<br />
Eine subjektive Beurteilung der Gebärmuttergröße zum Transferzeitpunkt erfolgte in<br />
Kategorien von klein, normal, groß und konnte für 63 Tiere vermerkt werden. Die<br />
Gebärmuttergröße der meisten Tiere wurde als normal bezeichnet (n = 44), danach folgten 15<br />
Tiere mit eher kleinem Uterus und 5 Tiere mit eher großem Uterus (Abb. 46). Die<br />
Trächtigkeitsraten bezogen auf die einzelnen Größenkategorien lagen bei 26,67 % (klein),<br />
93<br />
88,57<br />
Östrus Transfer
56,82 % (normal) bzw. 40,00 % (groß). Eine von der normalen Größe abweichende<br />
Gebärmutter beeinflusste demnach die Trächtigkeitsrate signifikant (P = 0,047).<br />
Durchführbarkeit<br />
Abb. 43: Prozentuale Verteilung der Studientiere nach Durchführbarkeit des Transfer (subjektive<br />
Einschätzung der Durchführbarkeit; Anzahl Tiere je Gruppe: n leicht = 23; n mittel = 39; n schwer = 5)<br />
Blutung<br />
7,46<br />
Abb. 44: Prozentuale Verteilung der Studientiere nach Vorhandensein von Blut beim Transfer (subjektive<br />
Einschätzung in kein, wenig, viel Blut; Anzahl Tiere je Gruppe: n kein = 62; n wenig = 5; n viel = 0)<br />
Uterusgröße<br />
leicht<br />
mittel<br />
schwer<br />
ohne<br />
wenig<br />
viel<br />
klein<br />
normal<br />
groß<br />
Abb. 45: Prozentuale Verteilung der Studientiere nach Uterusgröße zum Transferzeitpunkt (subjektive<br />
Einschätzung in eher klein, normal, eher groß; Anzahl Tiere je Gruppe: n klein = 15; n normal = 44;<br />
n groß = 5)<br />
94<br />
34,33<br />
58,21<br />
0 10 20 30 40 50 60<br />
0,00<br />
7,46<br />
92,54<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100<br />
7,81<br />
23,44<br />
68,75<br />
Tiere (%)<br />
Tiere (%)<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80 Tiere (%)
Trächtigkeitsrate (%)<br />
Abb. 46: Trächtigkeitsergebnisse nach relativer Uterusgröße in Prozent (n normal = 44; n kleiner o. größer = 20;<br />
* signifikant P = 0,047)<br />
Embryoqualität und Art ihrer Lagerung<br />
Die im Rahmen der Studie übertragenen Embryonen wurden zu 78,85 % (n = 41) als IETS<br />
Klasse 1 und zu 21,15 % (n = 11) als IETS Klasse 2 eingestuft. Diese Anteile beruhen auf 52<br />
Embryonen, deren IETS-Klasse festgehalten wurde. Für 55 Transfers wurde vermerkt, ob es<br />
sich um eine Frischübertragung oder kryokonservierte Embryonen handelte. 30 (= 54,55 %)<br />
der Embryonen wurden direkt übertragen, 25 (= 45,45 %) waren tiefgefroren bis zu ihrem<br />
Transfer. Die frisch übertragenen Embryonen verteilten sich auf die Versuchsgruppen SP, P<br />
und K zu 12/7/11, die tiefgefrorenen Embryonen zu 9/9/7. Innerhalb der beiden Gruppen<br />
(frisch, tiefgefroren) unterschieden sich die Trächtigkeitsraten von 43,33 % bzw. 56,00 %<br />
nicht signifikant (P > 0,05).<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
56,82<br />
4.2.3 Weitere Auswertung der Zervixzytologien<br />
Eine Berechnung der Trächtigkeitsraten für die 35 vollständig auswertbaren Tiere nach<br />
Zervixzytologiestatus zu beiden Entnahmezeitpunkten (d 0 = Östrus, d 7 = Transfer) zeigen<br />
Tab. 25 und Abb. 47. In den zytologisch unauffälligen Gruppen liegen die Trächtigkeitsraten<br />
mit 56,00 bzw. 54,84 % höher als in den zytologisch auffälligen Gruppen mit 40,00 bzw.<br />
25,00 %, wobei keiner dieser Unterschiede signifikant ist (P > 0,05).<br />
*<br />
95<br />
*<br />
30,00<br />
normal kleiner o. größer<br />
Uterusgröße
Eine Differenzierung aller auswertbaren Zytologien nach Versuchsgruppen und<br />
Entnahmezeitpunkt zeigt Abb. 48. Zwischen den Versuchsgruppen gab es, bezogen auf den<br />
Anteil an unauffälligen Zytologien, weder an d 0 noch an d 7 signifikante Unterschiede. Auch<br />
ein Vergleich der Gruppen „behandelt“ (SP + P) mit „unbehandelt“ (K) zeigte bezogen auf<br />
einen Zeitpunkt keine signifikanten Unterschiede (P > 0,05). Ein Vergleich der Zytologien an<br />
d 0 und d 7 jeweils innerhalb der Versuchsgruppen zeigte einen signifikanten Einfluss der<br />
applizierten Lösung. Nach Seminalplasmaapplikation war der Anteil an unauffälligen<br />
Zytologien signifikant von 66,67 % im Östrus auf 94,74 % zum Zeitpunkt des<br />
Embryotransfers erhöht (P = 0,046). Nach Placeboapplikation bzw. in der unbehandelten<br />
Kontrollgruppe nahm der Anteil PMN ≤ 10 % zwischen d 0 und d 7 auch, jedoch<br />
insignifikant, zu (P > 0,05).<br />
Tab. 25: Anzahl tragender Tiere in Abhängigkeit vom Zervixzytologiestatus zum Östrus und<br />
Transferzeitpunkt (PMN = polymorphkernige Granulozyten; Anzahl Tiere<br />
je Gruppe: n OE/ET = 35)<br />
Zeitpunkt<br />
Zytologie-<br />
status<br />
96<br />
Anzahl<br />
Tiere<br />
Anzahl<br />
tragender<br />
Tiere<br />
Östrus PMN ≤ 10 % 25 14<br />
Östrus PMN ≥ 10 % 10 4<br />
Transfer PMN ≤ 10 % 31 17<br />
Transfer PMN ≥ 10 % 4 1<br />
Eine Auswertung der Zervixzytologien nach Synchronisation zeigte bezogen auf den Anteil<br />
unauffälliger Zytologien (PMN ≤ 10 %) keinen Unterschied zwischen der nicht-<br />
synchronisierten und der synchronisierten Tiergruppe an Tag 0 (78,57 % zu 66,67 %) bzw. an<br />
Tag 7 (92,86 % zu 85,71 %), wie Abb. 49 zeigt (P > 0,05). Ein Vergleich innerhalb der<br />
Synchronisationsgruppen zwischen d 0 und d 7 zeigte ebenfalls keinen signifikanten Effekt<br />
auf den Anteil PMN ≤ 10 % (P > 0,05).
Abb. 47: Trächtigkeitsraten in Abhängigkeit vom Zervixzytologiestatus zum Östrus und<br />
Transferzeitpunkt (OE = Östrus; ET = Transferzeitpunkt; PMN = polymorphkernige<br />
Granulozyten; Anzahl Tiere je Gruppe: n OE = 35; n ET = 35; P > 0,05)<br />
Tiere mit unauffälliger Zervixzytologie (%)<br />
Trächtigkeitsrate (%)<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
56,00<br />
OE:<br />
PMN ≤ 10 %<br />
66,67<br />
P<br />
Östrus<br />
82,35<br />
P<br />
Transfer<br />
40,00<br />
OE:<br />
PMN > 10 %<br />
*<br />
66,67<br />
SP<br />
Östrus<br />
Abb. 48: Prozentuale Verteilung der Studientiere nach Versuchsgruppe und Zytologieentnahmezeitpunkt<br />
(alle Zytologien ≥ 200 Zellen und PMN ≤ 10 %; SP = Seminalplasma; P = Placebo; K = Kontrolle;<br />
OE = Oestrus; ET = Transferzeitpunkt; Tieranzahl je Gruppe: P OE : n = 12; P ET : n = 17; SP OE :<br />
n = 15; SP ET : n = 19; K OE : n = 10; K ET : n = 23; *signifikant: P = 0,046; alle weiteren: P > 0,05)<br />
97<br />
54,84<br />
ET:<br />
PMN ≤ 10 %<br />
*<br />
94,74<br />
SP<br />
Transfer<br />
25,00<br />
ET:<br />
PMN > 10 %<br />
70,00<br />
K<br />
Östrus<br />
86,96<br />
K<br />
Transfer
Tiere mit unauffälliger Zervixzytologie (%)<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
78,57<br />
OE:<br />
nicht-synchr.<br />
Abb. 49: Anteil unauffälliger Zytologien d 0 und d 7 in Abhängigkeit von der Synchronisation<br />
(OE = Östrus; ET = Transferzeitpunkt; PMN = polymorphkernige Granulozyten;<br />
Anzahl Tiere je Gruppe: n OE = 35; n ET = 35; P > 0,05)<br />
4.3 Zusammengefasste Ergebnisse der Feldstudien I + II<br />
Die Verteilung der Tiere innerhalb der Versuchsgruppen (SP/P/K) war für alle erfassten<br />
Parameter gleichmäßig und keiner der untersuchten Parameter unterschied sich zwischen den<br />
Versuchsgruppen signifikant.<br />
4.3.1 Signifikante Einflüsse in der KB-Studie<br />
Auf die Trächtigkeitsraten<br />
92,86<br />
ET:<br />
nicht-synchr.<br />
In der Feldstudie zur inseminationbegleitenden Seminalplasmaapplikation zeigten folgende<br />
Parameter signifikanten Einfluss auf die Trächtigkeitsraten:<br />
• Versuchsgruppe (SP, P, K; P = 0,035 bzw. 0,0<strong>24</strong>)<br />
• Rastzeit (≤ 49 d, ≥ 50 d; P = 0,012)<br />
• Intensität der äußeren Brunstsymptome (BS 1 – 3, BS 4 + 5; P = 0,048)<br />
98<br />
66,67<br />
OE:<br />
synchr.<br />
85,71<br />
ET:<br />
synchr.
Weitere Signifikanzen<br />
Des Weiteren zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen:<br />
• Uteruskontraktion und Zervixzytologiestatus (K 1+2, K3; P = 0,028)<br />
• Laktationsnummer und Zervixzytologiestatus (≤ 1. Lakt., > 1. Lakt.; P = 0,021)<br />
• Lahmheit und Zervixzytologiestatus (LS 1; LS 2 – 4; P = 0,022)<br />
4.3.2 Signifikante Einflüsse in der ET-Studie<br />
In der Feldstudie zur Seminalplasmaapplikation bei Embryonenempfängertieren in der Brunst<br />
zeigten folgende Parameter signifikanten Einfluss auf die Trächtigkeitsraten:<br />
Auf die Trächtigkeitsraten<br />
• Zyklussynchronisation (nicht synchronisiert, synchronisiert; P = 0,01)<br />
• relative Uterusgröße (normal, abweichend; P = 0,047)<br />
Weitere Signifikanzen<br />
• Seminalplasmaapplikation und Zervixzytologiestatus (d 0, d 7; P = 0,046)<br />
4.4 Vaginohysteroszintigraphien im Östrus (Experimentelle Studie)<br />
Zunächst erfolgte eine lösungs- und tierübergreifende Betrachtung der Szintigraphieserien.<br />
Dann wurden die Szintigramme in ihrer zeitlichen Abfolge (0 - 360 min) ausgewertet nach<br />
Studientier und abschließend nach Art der applizierten Lösung (Seminalplasma, Ejakulat,<br />
Placebo). Entscheidendes Kriterium bei der Beurteilung war ein sichtbarer transzervikaler<br />
bzw. retrograder Transport der jeweiligen applizierten Lösung ausgehend vom<br />
Deponierungsort, dem Fundus vaginae der Ziegen.<br />
4.4.1 Szintigraphieserien im Vergleich<br />
In diesem Kapitel sind im Folgenden die Szintigraphie-Serien (SP, E und P jeweils zum<br />
selben Zeitpunkt nebeneinander gestellt) für die Ziegen A, B und C gezeigt, um einen<br />
Überblick über Verteilung und Verbleib der Lösungen zu geben. In den Einzelbildern weist<br />
die linke Seite eines jeden Bildes nach kranial, die rechte nach kaudal, bei stets dorsoventraler<br />
99
Aufnahmerichtung. Die verschiedenen Strahlungsintensitäten sind farblich differenziert<br />
dargestellt: weiß (hohe Radioaktivität) - rot - grün - blau - lila (niedrige Radioaktivität).<br />
Die Szintigramme zeigten insgesamt nur geringe Verteilungsunterschiede zwischen den<br />
Lösungen (Abb. 50, Abb. 51, Abb. 52). Auch die Dauer der Persistenz der drei Lösungen im<br />
weiblichen Genitale war vergleichbar. So zeigte sich bei allen drei Ziegen 360 min nach der<br />
Applikation sowohl radioaktiv markiertes Seminalplasma, als auch markiertes Ejakulat und<br />
Placebo an der Deponierungsstelle in der kranialen Vagina. Der auffälligste Befund in allen<br />
Szintigrammen war dieser Aktivitätsschwerpunkt im Fundus vaginae.<br />
Die retrograde Ausscheidung der applizierten Lösungen war je nach Tier unterschiedlich<br />
intensiv. Nach 360 min belegte erhöhte Strahlungsaktivität, die die teilweise vorher<br />
angebrachte Vulvamarkierung überlagert, im Bereich der Vulva die teilweise Ausscheidung<br />
von Seminalplasma (Ziege A, C), von Ejakulat (Ziege A) und Placebo (Ziege A, B, C). Am<br />
Ende des Untersuchungszeitraumes war keine Ausscheidung von Seminalplasma bei Ziege B<br />
und kaum bzw. keine Ausscheidung von Ejakulat bei den Ziegen B und C sichtbar. Das<br />
Placebo wurde gegen Ende der Untersuchungen bei allen drei Tieren in Teilen ausgeschieden.<br />
Der früheste Beleg für Ausscheidung über die Vulva fand sich für alle drei applizierten<br />
Lösungen und Tiere nach <strong>24</strong>0 min. Die Strahlungsaktivität war nach Applikation von<br />
Seminalplasma nach <strong>24</strong>0 min (Ziege A, C), von Ejakulat nach <strong>24</strong>0 min (Ziege B) und von<br />
Placebo nach <strong>24</strong>0 min (Ziege A, B) im Bereich der Vulva erhöht.<br />
4.4.2 Szintigraphieserien je Tier<br />
Die Szintigraphieserien der Ziege A (Abb. 50) zeigten in den ersten 120 min keine auffällige<br />
Aktivitätsänderung, d.h. die Strahlung konzentriert sich auf den Applikationsort Fundus<br />
vaginae. Nach 0 min wurde in der Seminalplasma-Serie und nach 90 min in der Ejakulatserie<br />
eine Vulvamarkierung gesetzt, welche erst gegen Ende des Untersuchungszeitraumes<br />
(<strong>24</strong>0 bzw. 360 min) von der beginnenden Ausscheidung von Seminalplasma und Ejakulat<br />
überlagert werden. Insgesamt zeigte das applizierte Placebo bei Ziege A nach <strong>24</strong>0 min die<br />
deutlichste Aktivitätsverschiebung hin zur Vulva.<br />
Die Szintigraphieserien der Ziege B (Abb. 51) zeigten die aktivste Verteilung für das<br />
radioaktiv markierte Ejakulat, welches sich ab der 0. min innerhalb eines Radius von 1 - 2 cm<br />
100
um die Deponierungsstelle verteilte. Nach 45 min wurde in dieser Serie eine<br />
Vulvamarkierung gesetzt, welche ab <strong>24</strong>0 min von der Ejakulatausscheidung überlagert wird.<br />
Das Placebo wurde ebenfalls ab der <strong>24</strong>0. min deutlich ausgeschieden. Für das applizierte<br />
Seminalplasma waren bei diesem Tier die geringsten Verteilungsaktivitäten zu beobachten<br />
und es fand bis zur 360. min keine Ausscheidung über die Vulva statt.<br />
Die Szintigraphieserien der Ziege C (Abb. 52) zeigten eine Aktivitätsverteilung in der nahen<br />
Umgebung (Radius circa 1 cm) der Applikationsstelle nach Applikation von Seminalplasma<br />
und Ejakulat. Für das Seminalplasma (schwache Vulvamarkierung ab der 15. min) war eine<br />
retrograde Ausscheidung ab der 45. min zu sehen, für das Placebo ab der 360. min. Die<br />
Ausscheidung von Ejakulat über die Vulva war bei diesem Tier innerhalb des Messzeitraumes<br />
nicht festzustellen.<br />
101
Abb. 50: Szintigraphieserien (SP, E, P) Ziege A zu verschiedenen Zeitpunkten (SP = Seminalplasma; E =<br />
Ejakulat; P = Placebo; dorsolaterale Aufnahmen;je Szintigramm: links = kranial; rechts =<br />
kaudal; Kreis = Vulvamarkierung in der SP-Serie ab 0 min, in der E-Serie ab 90 min)<br />
Fortsetzung nächste Seite<br />
102
Abb. 50, Fortsetzung: Szintigraphieserien (SP, E, P) Ziege A zu verschiedenen Zeitpunkten<br />
(SP = Seminalplasma; E = Ejakulat; P = Placebo; dorsolaterale Aufnahmen; je Szintigramm:<br />
links = kranial; rechts = kaudal; Kreis = Vulvamarkierung in der SP-Serie ab 0 min, in der E-<br />
Serie ab 90 min)<br />
103
Abb. 51: Szintigraphieserien (SP, E, P) Ziege B zu verschiedenen Zeitpunkten (SP = Seminalplasma;<br />
E = Ejakulat; P = Placebo; dorsolaterale Aufnahmen;je Szintigramm: links = kranial;<br />
rechts = kaudal; Kreis = Vulvamarkierung in E-Serie ab 45 min) Fortsetzung nächste Seite<br />
104
Abb.51, Fortsetzung: Szintigraphieserien (SP, E, P) Ziege B zu verschiedenen Zeitpunkten<br />
(SP = Seminalplasma; E = Ejakulat; P = Placebo; dorsolaterale Aufnahmen; je Szintigramm:<br />
links = kranial; rechts = kaudal; Kreis = Vulvamarkierung in E-Serie ab 45 min)<br />
105
Abb. 52: Szintigraphieserien (SP, E, P) Ziege C zu verschiedenen Zeitpunkten (SP = Seminalplasma;<br />
E = Ejakulat; P = Placebo; dorsolaterale Aufnahmen;je Szintigramm: links = kranial;<br />
rechts = kaudal;Kreis = Vulvamarkierung in der SP-Serie ab 15 min) Fortsetzung nächste Seite<br />
106
Abb. 52, Fortsetzung: Szintigraphieserien (SP, E, P) Ziege C zu verschiedenen Zeitpunkten<br />
(SP = Seminalplasma; E = Ejakulat; P = Placebo; dorsolaterale Aufnahmen;je Szintigramm: links<br />
= kranial; rechts = kaudal;Kreis = Vulvamarkierung in der SP-Serie ab 15 min)<br />
4.4.3 Szintigraphieserien des Seminalplasmas<br />
Die Applikationsstelle Fundus vaginae fällt zu jedem Zeitpunkt als Lokalisation der<br />
intensivsten Strahlung (Farbgebung: weiß-rot-grün) auf. Angrenzende, weniger<br />
strahlungsintensive Bereiche umgeben die Applikationsstelle (Farbdarstellung: blau-lila). In<br />
der Seminalplasma-Serie bei Ziege A (Abb. 50) ist von Beginn an eine Vulvamarkierung<br />
(schwach lila, markiert in Szintigramm „0 min“ durch Kreis) angebracht worden.<br />
Die Szintigramme, erstellt von 0 - 360 min nach der Seminalplasmaapplikation, zeigen eine<br />
zunehmende Vergrößerung des strahlenden Bereiches. Innerhalb der ersten Stunde nach der<br />
Applikation ist die Radioaktivität eng begrenzt auf den Bereich des Applikationsortes. Nach<br />
ungefähr 60 min (Ziege A) ist der Fundus vaginae umgeben von einem Ring schwacher<br />
Strahlung (Ø ca.2 cm). Dieser Strahlungsradius bleibt auf den nachfolgenden Aufnahmen<br />
ungefähr konstant. Nach vier Stunden ist vermehrt diffuse Strahlung im Bereich der Vulva zu<br />
beobachten, d.h. radioaktiv markiertes Seminalplasma wird ausgeschieden. Auf keinem<br />
Szintigramm der Seminalplasma-Serie ist eine kranial der Deponierungsstelle gelegene<br />
Strahlungslokalisation erkennbar. Auf den Szintigrammen der Seminalplasma-Serien von<br />
Ziege B (Abb. 51) ist so gut wie keine Verteilungsaktivität zu erkennen, auf denen von<br />
Ziege C (Abb. 52) zeigt sich vermehrte Ausscheidung ab der <strong>24</strong>0. min.<br />
107
4.4.4 Szintigraphieserien des Ejakulates<br />
Die Szintigramme nach Applikation von radioaktiv markiertem Ejakulat zeigten ebenfalls den<br />
Fundus vaginae über den gesamten Aufnahmezeitraum von 0 - 360 min die Lokalisation der<br />
stärksten Strahlung. In dieser Serie wurde bei Ziege A (Abb. 50) ab 90 min und Ziege B<br />
(Abb. 51) ab 45 min eine Vulvamarkierung angebracht. Die Strahlung konzentrierte sich bei<br />
Ziege A auf einen Radius von 1 - 2 cm um den Fundus vaginae. Ab 360 min intensivierte sich<br />
die Strahlungsaktivität im Bereich der Vulva, so dass von einem Austritt markierter<br />
Ejakulatteile ausgegangen werden konnte. Auf den Szintigrammen der Ejakulat-Serien der<br />
Ziegen B und C (Abb. 52) zeigten sich jeweils ab dem Zeitpunkt der Applikation1 - 2 cm<br />
lange Ausziehungen der Strahlungslokalisation im Bereich des Fundus vaginae. Eine<br />
Ausziehung war von der Lokalisationsstelle Richtung lateral bzw. laterokaudal orientiert<br />
(Ziege B) bzw. die beiden Ausziehungen waren laterokranial und laterokaudal gerichtet<br />
(Ziege C). Diese zusätzlichen Strahlungslokalisationen blieben mit der Deponierungsstelle<br />
verbunden. Aufgrund der direkten Verbindung sowie der unmittelbaren Nähe zur<br />
Applikationsstelle können diese Ausziehungen als weitere Verteilungsschwerpunkte des<br />
radioaktiv markierten Ejakulates in der kranialen Vagina gesehen werden. Es war keine<br />
kranial der Deponierungsstelle gelegene Strahlungslokalisation in den Szintigrammen der<br />
Ejakulat-Serien erkennbar.<br />
4.4.5 Szintigraphieserien des Placebos<br />
Nach Placeboapplikation ähnelte die Strahlungsverteilung bei Ziege A (Abb. 50) zunächst<br />
denen der beiden anderen Serien derselben Ziege, wobei der Strahlungsradius um den Fundus<br />
vaginae als strahlungsintensivste Region bis zur 120. min bei ca. 1 cm lag. Auffallend war in<br />
dieser Serie bei genauer Betrachtung das Szintigramm nach 90 min, an dem eine Ausziehung<br />
der bis dahin gleichmäßigen, fast kreisförmigen Strahlungslokalisation Richtung kranial<br />
sichtbar war. Des Weiteren waren ab <strong>24</strong>0 min in der Placebo-Serie von Ziege A drei<br />
strahlungsintensive Lokalisationen zu bemerken: zum einen in der Vulvaregion, was auf einen<br />
Austritt von radioaktiv markiertem Placebo schließen lies, zum anderen zwei, im Abstand von<br />
1 - 2 cm angeordnete, kraniale Strahlungslokalisationen, bei denen es sich um den<br />
Deponierungsort Fundus vaginae und einen in unmittelbarer Nähe gelegenen weiteren<br />
Aktivitätsschwerpunkt handelte. Die Szintigramme der Placebo-Serien der Ziegen B und C<br />
(Abb. 51, Abb. 52) zeigten geringe Verteilung in der Nähe des Fundus vaginae (< 1 cm)<br />
108
innerhalb des gesamten Aufnahmezeitraumes. Die Ausscheidung des Placebos begann bei<br />
Ziege B ab <strong>24</strong>0 min und bei Ziege C nach 360 Minuten.<br />
1<strong>09</strong>
5 DISKUSSION<br />
5.1 Feldstudien<br />
5.1.1 Überprüfung der Arbeitshypothese<br />
Die beiden Feldstudien zugrunde liegende Hypothese, dass eine Seminalplasmaapplikation im<br />
weiblichen Genitale die Trächtigkeitsraten positiv beeinflusst, wurde im Vergleich zur<br />
unbehandelten Kontrollgruppe bestätigt. Der Vergleich von Seminalplasma- und Placebo-<br />
Gruppe lässt jedoch nur die Ablehnung der Hypothese zu, da sich die Trächtigkeitsraten in<br />
diesen beiden Gruppen nur gering unterschieden. Nach Applikation einer physiologischen<br />
Seminalplasmamenge in der Brunst betrugen die Trächtigkeitsraten 57,56 % und 60,00 % bei<br />
artifiziell inseminierten Milchkühen (KB) und Embryonenempfängertieren (ET),im Vergleich<br />
zu 46,11 % (KB) und 37,50 % (ET) in den Kontrollgruppen und 58,29 % (KB) und<br />
57,89 % (ET) in den Placebogruppen. Die Unterschiede in den Trächtigkeitsraten in der KB-<br />
Studie (514 Studientiere) waren signifikant, in der ET-Studie (68 Studientiere) nicht.<br />
5.1.2 Allgemeine Einordnung der erzielten Trächtigkeitsraten<br />
Die in der KB-Studie in den Versuchsgruppen „Seminalplasma“ und „Placebo“ erzielten<br />
Trächtigkeitsraten lagen mit 57 - 58 % in dem in der Literatur (VERBERCKMOES et<br />
al. 2005; STAUFENBIEL 2005;BUSCH u. WABERSKI 2007) für Erstbesamungen<br />
genannten Rahmen, diejenigen der Kontrollgruppe liegen mit 46 % etwas niedriger. Auch die<br />
in der ET-Studie erzielten Trächtigkeitsraten lagen in der Seminalplasma- und Placebogruppe<br />
mit 58 - 60 % im zu erwartenden Bereich (WRENZYCKI u. NIEMANN 2007), die<br />
Trächtigkeitsrate der Kontrollgruppe lag mit 37 % deutlich darunter.<br />
5.1.3 Effekt der Seminalplasmaapplikation<br />
Die Seminalplasmaapplikation bewirkte eine Verbesserung der Trächtigkeitsraten bei Milch-<br />
und Zweinutzungsrindern um 25 % in der KB-Studie und um mehr als 55 % in der ET-Studie<br />
im Vergleich zur unbehandelten Kontrollgruppe. ODHIAMBO et al. (20<strong>09</strong>) dagegen konnten<br />
in ihrer ebenfalls umfangreichen Studie bei Milch- und Fleischrindern keinen signifikanten<br />
Effekt einer intrauterinen Seminalplasmaapplikation auf die Trächtigkeitsraten erzielen. Im<br />
Unterschied zu den vorliegenden Feldstudien setzten ODHIAMBO et al. (20<strong>09</strong>) jedoch nur<br />
0,5 mL Seminalplasma intrauterin, benachbart zum Ort der Insemination ein, was weder in<br />
110
der applizierten Menge noch im Deponierungsort der physiologischen Applikation während<br />
der Bedeckung entspricht.<br />
Weitere Unterschiede der Studie von ODHIAMBO et al. (20<strong>09</strong>) zu den vorliegenden Studien<br />
sind die Applikation nach Zyklussynchronisation und eine Kontrollgruppe, die in vier von<br />
sechs Versuchsreihen (969 Fleischrinder) Tiere beinhaltete, die eine BSA-Applikation<br />
(0,5 mL bovines Serumalbumin, intrauterin) erhalten hatten und somit nicht unbehandelt<br />
waren. Lediglich zwei der Versuchsreihen (167 Fleischrinder und 800 Milchrinder) umfassten<br />
Kontrollgruppen, die unbehandelt waren. In diesen beiden Versuchsreihen führte die<br />
Seminalplasmaapplikation verglichen mit der unbehandelten Kontrollgruppe tendenziell zu<br />
höheren Trächtigkeitsraten (61,4 zu 52,4 % bei Fleischrindern bzw. 37,8 zu 33,2 % bei<br />
Milchrindern), die jedoch nicht signifikant waren. Die Tiere der vorliegenden KB-Studie<br />
zeigten natürliche Östren ohne vorhergehende Synchronisation. In der ET-Studie erfolgte bei<br />
etwa der Hälfte der Rezipienten eine Zyklussynchronisation und es zeigte sich, unabhängig<br />
von der Versuchsgruppe, eine signifikant höhere Trächtigkeitsrate in der Gruppe der nicht-<br />
synchronisierten Tiere. Die Kontrollgruppen beider vorliegenden Studien bestanden<br />
einheitlich aus unbehandelten Tieren und zeigten, wie eingangs erwähnt, im Vergleich mit der<br />
Seminalplasmagruppe signifikant niedrigere Trächtigkeitsraten.<br />
ODHIAMBO et al. (20<strong>09</strong>) konzipierten nach eigenen Angaben fünf der sechs Versuchsreihen<br />
an insgesamt 1<strong>09</strong>0 Fleischrindern der Rassen Hereford und Angus und eine Versuchsreihe an<br />
800 Milchrindern der Rasse Holstein. Dies entsprach einem Milchrinder-Anteil von 42 %. Die<br />
Trächtigkeitsrate der Fleischrinder lag mit 54,2 % höher als bei den Milchrindern mit 36,6 %.<br />
Mit 434 bzw. 62 nach Rasse auswertbaren Tieren lag der Anteil der Milchrinder (Deutsche<br />
Holstein Schwarzbunt, Rotbunt) bei 85 % (KB-Studie) bzw. 100 % (ET-Studie) und die<br />
Trächtigkeitsrate der Zweinutzungsrasse Deutsches Fleckvieh lag mit 58,1 % höher als bei<br />
den Tieren der Rasse Deutsch Holstein mit 52,9 % (KB-Studie). Beide Studien zeigten eine<br />
Tendenz zur insgesamt besseren Fertilität der fleischbetonten Rassen, die jedoch keine<br />
Abhängigkeit zur Seminalplasmaapplikation zeigt.<br />
Ein weiterer bemerkenswerter Unterschied zur Studie von ODHIAMBO et al. (20<strong>09</strong>) ist die<br />
Herkunft des Seminalplasmas: Das bei Fleischrindern applizierte Seminalplasma stammte von<br />
einem einzigen vasektomierten Bullen, das der Milchrinder einem Pool, der Seminalplasma<br />
111
von sechs Holsteinbullen beinhaltete. In den vorliegenden Studien wurden pro<br />
Besamungsstation Seminalplasma-Pools aus Ejakulaten von jeweils 20 - 40 Bullen gebildet,<br />
um einen Bulleneffekt auszuschließen.<br />
QASIM et al. (1996) konzipierten eine Doppelblindstudie, die den Effekt einer<br />
Seminalplasmaapplikation (2 mL intravaginal) auf die Schwangerschaftsrate nach<br />
intrauteriner Insemination von Frauen untersuchte. Der Seminalplasmagruppe (n = 164) war<br />
eine Kontrollgruppe (n = 155) gegenübergestellt, die Kochsalzlösung in derselben Menge und<br />
Lokalisation erhielt. Die Schwangerschaftsraten unterschieden sich nicht signifikant (13,4 %<br />
zu 12,3 %). In den hier vorliegenden Studien zeigte ein Vergleich der beiden<br />
Versuchsgruppen mit Lösungsapplikation (SP, P) ebenfalls keine nennenswerten<br />
Unterschiede in den Trächtigkeitsraten. Allein der Vergleich mit der unbehandelten<br />
Kontrollgruppe zeigte den signifikanten Effekt der Applikation.<br />
Folgende Aspekte über mögliche Gründe für die in den beiden Feldstudien erzielten<br />
verbesserten Trächtigkeitsergebnisse nach Seminalplasma- und Placeboapplikation sind<br />
nachfolgend berücksichtigt: Eine mögliche Förderung der Fruchtbarkeit durch Resorption von<br />
Seminalplasmabestandteilen, eine veränderte Uterusmotilität oder Immunmodulation, ein<br />
Volumen- oder Deponierungseffekt und die Auswahl des Applikationszeitpunktes.<br />
Resorption von Seminalplasma-Bestandteilen<br />
Seminalplasma enthält eine Vielzahl von Komponenten mit biologischer Wirksamkeit<br />
(VENTURA u. FREUND 1973; MANJUNATH u. SAIRAM 1987; CALVETE u.<br />
SANZ 2007; RODRIGUEZ-MARTINEZ et al. 2011) und die Vagina ist zur Resorption<br />
verschiedenster Substanzen fähig, wie unter anderem BENZINGER u. EDELSON (1983)<br />
feststellten. Des Weiteren stellen der Substanzaustausch nach dem Gegenstromprinzip<br />
(counter-current exchange) und der „first uterine pass effect“ Routen dar, einzelne Substanzen<br />
lokal im Genitalgewebe auszutauschen, anzureichern und lokal oder systemisch zu wirken<br />
(MIZUTANI et al. 1995; ROBERTSON 2005). Das in den Feldstudien eingesetzte<br />
Seminalplasma entstammte SP-Pools geprüft fertiler Bullen ohne Zusatz von<br />
Verdünnermedien und enthielt somit SP-Komponenten in physiologischer Konzentration. Ein<br />
spezifischer Seminalplasmaeffekt konnte in der vorliegenden Studie nicht gezeigt werden, da<br />
sich die Trächtigkeitsraten zwischen Placebo- und Seminalplasmagruppe nicht unterschieden.<br />
112
Veränderung der Uterusmotilität, Immunmodulation und Volumeneffekt<br />
Eine Paarung bewirkt in allen Zyklusphasen beim weiblichen Rind wesentlich stärkere<br />
Uteruskontraktionen als die künstliche Besamung, stellte DÖCKE (1962) fest, und MILES et<br />
al. (1994) vermuteten, dass eine erhöhte Uterusperistaltik den Spermientransport Richtung<br />
Eileiter erleichtert. Verbesserte Trächtigkeitsergebnisse durch verstärkten Spermientransport<br />
zum Ort der Befruchtung sind denkbar. Das in den Studien im Vergleich zur<br />
Besamungsportion (0,25 mL) größere Ejakulatvolumen (Ø 5 mL) könnte, neben anderen<br />
Aspekten, wie der Stimulierung durch den Deckakt, ursächlich beteiligt sein, verstärkte<br />
Uteruskontraktionen hervorzurufen. Jedoch wiesen PORTUS et al. (2005) bei Stuten eine<br />
durch Seminalplasma signifikant erniedrigte Frequenz uteriner Kontraktionennach und<br />
PANSEGRAU et al. (2008) konnten bei der Stute im Vergleich mit der unbehandelten<br />
Kontrollgruppe keinen Effekt einer intrauterinen Seminalplasmaapplikation auf die<br />
Uteruskontraktilität feststellen. Des Weiteren fanden SINNEMAA et al. (2005), ebenfalls bei<br />
der Stute, mit Ausnahme eines einzigen Zeitpunktes post inseminationem, keinen Effekt des<br />
Inseminatvolumens auf die Uteruskontraktilität. Die von PORTUS et al. (2005) durch den<br />
Seminalplasma-Zusatz beobachtete Verminderung der Kontraktionsfrequenz bewirkte keine<br />
verbesserten Trächtigkeitsraten.<br />
ROBERTSON (2005) vermutet eine individuell verminderte Ausprägung der Zytokine im<br />
Seminalplasma und eine dadurch bedingte Kommunikationsstörung zwischen Seminalplasma<br />
und weiblichem Genitaltrakt als eine mögliche Ursache für mangelhafte Reproduktion<br />
zwischen zwei Individuen. QUAYLE et al. (1987) stellten in vitro eine Dosis- und<br />
Temperaturabhängigkeit des immunsuppressiven Effektes von Seminalplasma auf T-Zellen<br />
fest. Eine ausreichende Menge an Seminalplasma könnte demnach auch Voraussetzung sein<br />
für dessen immunmodulative Auswirkungen auf das weibliche Genitale. Eine<br />
trächtigkeitsfördernde Immunmodulation des weiblichen Genitales nach<br />
Seminalplasmaapplikation, beispielsweise durch Zytokine des Seminalplasmas, kommt<br />
aufgrund der ähnlich hohen Trächtigkeitsergebnisse in den Placebogruppen als<br />
Erklärungsansatz nicht in Frage. Das Placebo bestand aus sterilfiltrierter phosphatgepufferter<br />
Salzlösung mit Gelatine.<br />
113
Ein volumenvermittelter Effekt kommt als Erklärungsansatz für die verbesserten<br />
Trächtigkeitsergebnisse sowohl für die Seminalplasma- als auch für die Placebogruppen in<br />
Betracht. Beide Applikationen erfolgten in einem, der physiologischen Seminalplasmamenge<br />
entsprechenden, Volumen von 4 mL. Auf welchem Wege das applizierte Volumen einen<br />
fertilitätsfördernden Effekt bewirkt, darüber kann aufgrund der vorliegenden Studien keine<br />
Aussage getroffen werden.<br />
Deponierungseffekt<br />
Der Ort der Lösungsapplikation bzw. eine mechanische Stimulierung bei der Applikation sind<br />
ebenfalls als beeinflussende Parameter auf die Fruchtbarkeit zu berücksichtigen. Beim Rind<br />
ist die kraniale Vagina die physiologische Deponierungslokalisation des Ejakulates während<br />
der Bedeckung. Sowohl Seminalplasma als auch Placebo wurden dementsprechend in den<br />
Feldstudien in Nähe der Portio vaginalis cervicis appliziert. Zur möglichst effektiven<br />
Ausnutzung von Bullenejakulaten werden die Besamungsportionen heutzutage im Rahmen<br />
der Routine-KB näher an den Ort der Befruchtung gebracht und intrauterin abgesetzt.<br />
Möglicherweise erfolgt jedoch über die Ejakulatdeponierung in derVagina ein Stimulus, der<br />
positiven Einfluss auf die Trächtigkeit nimmt. Anhand des vorliegenden Studiendesigns ist es<br />
nicht möglich zwischen der Lösungsapplikation (SP, P) und der mechanischen Reizung<br />
(rektale Palpation, Uteruskatheter zur Applikation) des Genitales während der<br />
Applikationsdurchführung als Stimulus zu unterscheiden. Eine weiterführende Untersuchung<br />
sollte dies berücksichtigen und eine zusätzliche Kontrollgruppe mit ausschließlich<br />
mechanischer Stimulation einbeziehen.<br />
Zeitpunkt der Applikation<br />
In beiden Feldstudien wurde als Zeitpunkt der Lösungsapplikation die Brunst (d 0) gewählt.<br />
Die höheren Trächtigkeitsraten auch in den Rezipientengruppen, denen sieben Tage später ein<br />
Embryo eingesetzt wurde, sprechen für einen durch die Applikation in der Brunst vermittelten<br />
positiven Effekt.<br />
5.1.4 Diskussion weiterer signifikanter Parameter<br />
Die praktische Durchführung der Feldstudien durch erfahrene Besamungsbeauftragte und ET-<br />
Beauftragte erlaubte eine Vorselektion der Studientiere auf „besamungsgeeignete“ Tiere,<br />
vorgestellt zur Erstbesamung, und damit eine möglichst homogene Kohorte an Tieren unter<br />
114
Feldbedingungen. Die zufällige, randomisierte Gruppenzuweisung sowie die Codierung der<br />
applizierten Lösungen schloss eine bevorzugte Tierauswahl durch die durchführenden<br />
Personen aus, und jeder Besamungsbeauftragte bzw. ET-Beauftragte stellte seine eigene<br />
Kontrollgruppe. Die zusätzliche Erhebung und Auswertung umfangreicher Tierdaten<br />
ermöglichte es, diese Annahme zu überprüfen und beeinflussende Parameter retrospektiv zu<br />
analysieren. Tatsächlich waren die Studientiere gleichmäßig innerhalb der Versuchsgruppen<br />
bezüglich aller dokumentierten Parameter vertreten, so dass die erzielten Unterschiede in den<br />
Trächtigkeitsraten in erster Linie auf die Versuchsgruppen zurückgeführt werden können.<br />
KB-Studie<br />
In der inseminationsbegleitenden Studie stellten sich neben der Versuchsgruppe als weitere<br />
signifikante Einflüsse auf die Trächtigkeitsrate die Rastzeit und die Intensität der äußeren<br />
Brunstsymptome heraus.<br />
Frisch laktierende Tiere (≤ 49 d) post partum hatten in der Studie eine geringere Chance<br />
trächtig zu werden als diejenigen ≥ 50 d nach der Abkalbung. (38,60 % zu 56,50 %;<br />
P = 0,012). Da die Tiere der beiden Gruppen sich jeweils gleichmäßig auf die<br />
Versuchsgruppen aufteilten, konnte dieser Unterschied nicht auf einen Einfluss der<br />
Versuchsgruppe zurückgeführt werden. FONSECA et al. (1983) stellten erste Ovulationen bei<br />
Holsteinkühen frühestens drei Wochen post partum fest und GRUNERT u.<br />
BLESENKEMPER (1980) heben hervor, dass eine Rastzeit unter 60 Tagen nur bei wenigen<br />
Tieren der Rasse Schwarzbunt als biologisch anzusehen ist, so dass eine frühzeitige<br />
Besamung post partum nur selten erfolgreich ist. Die Zeit kurz nach der Abkalbung, gerade<br />
bei hochleistenden Rindern mit einem deutlichen Energiedefizit, ist assoziiert mit reduzierten<br />
Konzeptionsraten (BUTLER u. SMITH 1989, PUSHPAKUMARA et al. 2003).<br />
Die subjektiv erfasste Intensität der äußeren Brunstanzeichen erwies sich in der KB-Studie als<br />
aussagekräftiger Hinweis auf die nachfolgende Reproduktionsleistung. Ein Vergleich der<br />
Tiergruppen mit gering ausgeprägter Brunstsymptomatik (BS 1 - BS 3) und denen mit starker<br />
Äußerung von Brunstsymptomen (BS 4 + BS 5) zeigt signifikante Unterschiede in den<br />
Trächtigkeitsraten (45,71 bzw. 55,59 %; P = 0,048). Unklar ist, ob der Einfluss des<br />
Parameters Brunstintensität auf die Reproduktion direkt oder indirekt erfolgte. Die<br />
Ausprägung der Brunstsymptome beeinflusst maßgeblich die Brunsterkennung, eine der<br />
115
Hauptursachen für Fruchtbarkeitsstörungen in betroffenen Betrieben ist (BUSCH 2007).<br />
Besonders diejenigen Tiere mit wenig intensiver bzw. verkürzter Brunstsymptomatik werden<br />
weniger gut bei der Brunstbeobachtung bemerkt, und es ist schwierig, den optimalen<br />
Besamungszeitpunkt abzuschätzen (DOBSON et al. 2008).<br />
ET-Studie<br />
In der ET-Studie hatten die Zyklussynchronisation und die relative Uterusgröße einen<br />
signifikanten Einfluss auf die Trächtigkeitsraten. Die Gruppe der Empfängertiere, die vor dem<br />
Transfer einer Synchronisation unterlagen, zeigten mit 36,11 % schlechtere<br />
Trächtigkeitsergebnisse als die nichtsynchronisierte Empfängertiergruppe mit 67,74 %.Auch<br />
ODDE (1990) hält in seinem Übersichtsartikel zur Östrussynchronisation bei Rindern fest,<br />
dass die Fruchtbarkeit von Tieren nach Zyklussynchronisation subnormal ist.<br />
Als weiterer signifikanter Parameter stellte sich die relative Uterusgröße heraus. Eine von der<br />
normalen Größe nach oben oder unten abweichende Uterusgröße zum Zeitpunkt des Transfers<br />
führte zu geringeren Trächtigkeitsergebnissen (56,82 % zu 30,00 %). Wenn auch subjektiv<br />
beurteilt, scheint also unter anderem eine abnorme Gebärmuttergröße ein Indikator für<br />
nachfolgend verminderte Fruchtbarkeit zu sein. Bestätigt wird diese Erkenntnis von Studien,<br />
die ebenfalls einen Zusammenhang zwischen klinischen Abnormalitäten und verminderter<br />
Fruchtbarkeit bei Rindern post partum feststellten (FONSECA et al. 1983; SHELDON et<br />
al. 20<strong>09</strong>).<br />
5.1.5 Kritische Anmerkungen zu den Feldstudien<br />
Durchführung der Studien<br />
Dank kompetenter Partner an den beteiligten Besamungsstationen konnte eine erhebliche<br />
Anzahl an Studientieren, insbesondere in der KB-Studie, erreicht werden. Im ET-Bereich<br />
stellte die Lösungsapplikation bei den Embryonenempfängertieren zum Brunstzeitpunkt eine<br />
zusätzliche Arbeitsbelastung für die ET-Beauftragten dar, da diese den entsprechenden<br />
landwirtschaftlichen Betrieb üblicherweise erst zum Transfer besuchen. Die Durchführung<br />
der ET-Studie an einer Empfängertierherde, die gut zugänglich an einer Betriebsstelle<br />
versammelt ist, wäre deutlich einfacher und schneller umzusetzen.<br />
116
Verblindung der Daten<br />
Die dreifache Verblindung wurde für die Versuchsgruppen mit Lösungsapplikation (SP, P)<br />
bis nach der endgültigen statistischen Auswertung der Daten konsequent eingehalten. Da es in<br />
den unbehandelten Kontrollgruppen der Feldstudien nur die Standard-KB bzw. den Standard-<br />
ET und keine Lösungsapplikation gab, konnte diese Versuchsgruppe nicht geblindet<br />
durchgeführt werden. Die Kontrollgruppe gegenüber dem Besamungs- bzw. ET-Beauftragten<br />
zu verblinden, ist praktisch nicht umsetzbar, eine zusätzliche Verblindung der<br />
Kontrollgruppen für die auswertende Person wäre jedoch möglich gewesen.<br />
Zeitraum der Studiendurchführung<br />
Der Zeitraum der Durchführung der KB-Studie beschränkt sich auf weniger als sechs<br />
Monate(Ende Mai 20<strong>09</strong> - Anfang Oktober 20<strong>09</strong>). Saisonale Einflüsse auf die<br />
Trächtigkeitsraten, wie beispielsweise von ODHIAMBO et al. 20<strong>09</strong>, die in ihrer Studie beim<br />
Rind erhebliche Unterschiede zwischen den Studienjahren bemerken, können für die<br />
vorliegende KB-Studie somit weitestgehend ausgeschlossen werden. Die ET-Studie erstreckte<br />
sich aufgrund der arbeitsintensiven Durchführung über den Zeitraum Oktober 20<strong>09</strong> bis<br />
März 2011, so dass saisonale Einflüsse grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden können.<br />
Allerdings verteilen sich die Studientiere aufgrund der randomisierten Zuordnung über den<br />
gesamten Zeitraum gleichmäßig auf die Versuchsgruppen, was vergleichbare saisonale<br />
Einflüsse auf alle drei Versuchsgruppen garantiert.<br />
5.2 Zervixzytologien<br />
5.2.1 Überprüfung der Arbeitshypothese<br />
Aufgrund der im Rahmen beider Feldstudien erstellten exfoliativen Zervixzytologiensollte die<br />
Hypothese überprüft werden, dass sich ein Anteil von weniger als 10 % polymorphkernigen<br />
Granulozyten positiv auf das Zustandekommen einer Trächtigkeit auswirkt. Die<br />
Zugehörigkeit zur zytologisch unauffälligen Gruppe (≤ 10 % PMN) zeigte in beiden<br />
Feldstudien (ET, KB) und zu beiden Zeitpunkten (ET: d 0, d 7) Hinweise auf einen positiven<br />
Einflusses des unauffälligen zervikalen Zytologiestatus auf das Zustandekommen einer<br />
Trächtigkeit. Die Trächtigkeitsraten unterschieden sich zahlenmäßig zwischen zytologisch<br />
unauffälliger und auffälliger Tiergruppe mit: 54,32 % zu 50,00 % (KB), 56,00 % zu 40,00 %<br />
(ET, d 0) und 54,84 % zu 25,00 % (ET, d 7). Diese Unterschiede waren nicht signifikant.<br />
117
5.2.2 Allgemeine Einordnung der gewonnenen Zytologien<br />
Zahlreiche Autoren nutzten Zytologieproben von Uterus und Zervix zur Diagnose einer<br />
subklinischen Endometritis bzw. Zervicitis beim Rind (Uteruszytologien: KASIMANICKAM<br />
et al. 2004; GILBERT et al. 2005; SHELDON et al. 2006; BARLUND et al. 2008; SENOSY<br />
et al. 20<strong>09</strong>; Zervixzytologien: AHMADI et al. 2006; DEGUILLAUME et al. <strong>2012</strong>). Es<br />
existiert aktuell keine einheitliche Definition zur Auswertung der Zytologien mit Festlegung<br />
einer Mindestzellzahl sowie eines PMN-Grenzwertes, so dass sich die Auswertungskriterien<br />
der vorliegenden Studien an den in der internationalen Literatur publizierten Methoden<br />
orientierte (KASIMANICKAM et al. 2004; RAAB 2004; GILBERT et al. 2005; HAMMON<br />
et al. 2006; SHELDON et al. 2006; BARLUND et al. 2008; KAUFMANN et al. 20<strong>09</strong>;<br />
SANTOS et al. 20<strong>09</strong>). Als Auswertungskriterium wurde anhand dessen ein Grenzwert von<br />
10 % PMN bei mindestens 200 auswertbaren zervikalen Zellen/Tier festgelegt.<br />
KASIMANICKAM et al. (2004) und SHELDON et al. (2006) differenzierten zwischen dem<br />
20.-33. und 34.-47. Tag p.p. und legten somit in Abhängigkeit von Zeitraum nach der<br />
Abkalbung unterschiedliche Grenzwerte fest. Da die Tiere der vorliegenden Studien mit<br />
durchschnittlichen 97 Tagen p.p. weit über das unmittelbar postpartale Stadium hinaus waren,<br />
wurde in den vorliegenden Studien auf eine Differenzierung des PMN-Grenzwertes nach<br />
Tagen p.p. verzichtet. Was die Wahl des Grenzwertes selbst angeht, so liegen niedrige PMN-<br />
Grenzwerte im internationalen Schrifttum bei 5 - 10 % PMN (KASIMANICKAM et al. 2004;<br />
GILBERT et al. 2005; BARLUND et al. 2008; SANTOS et al. 20<strong>09</strong>, DEGUILLAUME et<br />
al. <strong>2012</strong>) und hohe Grenzwerte bei 15 - 25 % PMN (KASIMANICKAM et al. 2004;<br />
HAMMON et al. 2006; KAUFMANN et al. 20<strong>09</strong>). Der in den Studien gewählte Grenzwert<br />
von > 10 % PMN zur rein zytologischen Diagnose einer subklinischen Endometritis befindet<br />
sich also im vergleichsweise niedrigen Bereich. Laut AHMADI et al. (2005), die in ihrer<br />
Studie keinen signifikanten Unterschied zwischen zervikalen und uterinen Zytologien fanden,<br />
ist ein Rückschluss von der Zervixzytologie auf den Inflammationsstatus des Uterus zulässig.<br />
SCHULT (20<strong>09</strong>) stellte in ihren Untersuchungen beim Milchrind höhere PMN-Anteile in der<br />
Uterusschleimhaut im Vergleich zur Zervixschleimhaut fest, und fand ebenfalls eine positive<br />
Korrelation zwischen den PMN-Gehalten beider Lokalisationen. DEGUILLAUME et<br />
al. (<strong>2012</strong>) dagegen sehen anhand ihrer Studie, die sowohl endozervikale als auch endometriale<br />
118
Zytologien beinhaltete, keine Hinweise von einer Zervicitis auf eine Endometritis zu<br />
schließen.<br />
Eine Vaginoskopie zur Beurteilung des Muttermundes bzw. der Anwesenheit von vaginalem<br />
Eiter, wie beispielsweise von LE BLANC et al. (2002) und SHELDON et al. (2006) als<br />
maßgebliche Kriterien zur Beurteilung klinischer Endometritis gefordert, wurde nicht<br />
durchgeführt. Die Tiere der vorliegenden Studien wurden jedoch vom Besamungstechniker<br />
als besamungsgeeignet eingestuft (u.a. kein Ausfluss von Eiter aus der Vagina sichtbar) und<br />
zeigten klaren Brunstschleim ohne Beimengungen, beurteilt während der Durchführung der<br />
Besamung. SCHULT (20<strong>09</strong>), die Milchkühe anhand ihres Zervikalbefundes bei der<br />
Vaginoskopie in drei Gruppen (unauffällig, Zervicitis Grad 1, Grad 2) einteilte, fand keine<br />
Korrelation zwischen Zervicitis und erhöhtem zervikalem PMN-Anteil.<br />
Eine, allein auf der Auswertung der Zervixzytologien beruhende, mögliche Inzidenz<br />
subklinischer Endometritis lag in der inseminationsbegleitenden Studie bei 21,74 % und bei<br />
28,57 % (d 0) bzw. 11,43 % (d 7) in der transferbegleitenden Studie. HAMMON et al. (2006)<br />
erheben bei ihren Untersuchungen an 83 Rindern vier Wochen post partum einen Anteil von<br />
51,8 % mit subklinischer Endometritis (> 25 % PMN intrauterin). SHELDON et al. 20<strong>09</strong><br />
beziffert das30 %der Rinder circa fünf Wochen nach der Abkalbung von einer subklinischen<br />
Endometritis (> 10 % PMN intrauterin) betroffen sind. GILBERT et al. (2004) differenzieren<br />
die Prävalenz der subklinischen Endometritis (subjektive Einschätzung > circa 5 % PMN<br />
intrauterin)für Milchrinder nach dem Zeitpunkt post partum: 3 Wochen p.p.: 93 %,<br />
5 Wochen p.p.: 67 % und 7 Wochen p.p.: 51 %. SANTOS et al. (20<strong>09</strong>) unterscheiden bei<br />
135 Fleischrindern ebenfalls anhand einer subjektiven Einschätzung von > 5 % PMN<br />
intrauterin: Zwei Wochen nach der Abkalbung: 88 %, 2-7 Wochen p.p.: 77 % und<br />
> 7 Wochen p.p.: 17 % als Prävalenz subklinischer Endometritis und stellen fest, dass der<br />
Anteil an betroffenen Tieren nach Wiedereintritt in den Zyklus rapide abnimmt.<br />
DEGUILLAUME et al. (<strong>2012</strong>), die 168 Milchkühe mittels endozervikaler und endometrialer<br />
Zytobrushprobe untersuchten, ermittelten bei 11 % eine Zervicitis, bei 13 % eine Endometritis<br />
und bei 32 % der Tiere sowohl eine Zervicitis als auch Endometritis (≤ 5 % PMN<br />
intrazervikal bzw. ≤ 6 % PMN intrauterin; ≤ 35 d p.p.). Die Autoren bemerken des Weiteren<br />
einen signifikanten Einfluss des postpartalen Zeitraumes auf den Anteil an zervikalen<br />
119
Neutrophilen: Milchkühe ≤ 35 d p.p. hatten höhere Neutrophilenanteile (Median 3 %, 1-93 %)<br />
als Milchkühe > 35 d p.p. (Median 1 %, 0-89 %). Der Zeitpunkt nach der Abkalbung ist ein<br />
wichtiges Kriterium bei der Diagnose von Zervicitis und subklinischer Endometritis.<br />
Gleichzeitig ist wahrscheinlich das Zyklusstadium ein weiterer beeinflussender Parameter.<br />
Die genannten Publikationen zur zytologischen Diagnose von Zervicitis und subklinischer<br />
Endometritis beim Rind untersuchten jedoch den Zeitraum unmittelbar post partum<br />
(> 50 d p.p.). Die Autoren machen keine Angaben zum Zyklusstadium, abgesehen von<br />
DEGUILLAUME et al. (<strong>2012</strong>), die parallel zur Zytologie die Progesteronkonzentration (P4)<br />
im Blutplasma der Milchkühe bestimmten, jedoch keine Abhängigkeit zwischen dem Anteil<br />
endozervikaler Neutrophiler und der Progesteronkonzentration fanden. Die Tiere der<br />
Feldstudien befanden sich im Mittel 97 (21 - 465 d; s 58,6) Tage post partum und befanden<br />
sich - sie wurden zur Besamung vorgestellt - im Östrus.<br />
5.2.3 Aussagekraft für die Reproduktion<br />
Die Trächtigkeitsrate nach Besamung in der Tiergruppe mit zytologischen Hinweisen auf eine<br />
Zervicitis und möglicherweise eine subklinische Endometritis (> 10 % PMN intrazervikal im<br />
Östrus), lag circa 9 % niedriger als bei den Tieren, bei denen weniger als 10 % zervikale<br />
polymorphkernige Granulozyten ausgezählt wurden. Dies stellt keinen signifikanten<br />
Zusammenhang zwischen Zervixzytologie und Trächtigkeitsrate in der KB-Studie dar. Ein<br />
negativer Einfluss von Zervicitis und subklinische Endometritis auf die Reproduktion beim<br />
Milchrind wird von diversen anderen Autoren meist signifikant festgestellt (Subklinische<br />
Endometritis: LE BLANC et al. 2002; GILBERT et al. 2005; BARLUND et al. 2008;<br />
SHELDON et al. 20<strong>09</strong>; COUTO 20<strong>09</strong>; Zervicitis: SCHULT 20<strong>09</strong>; DEGUILLAUME et al.<br />
<strong>2012</strong>).Eine Differenzierung des Einflusses der endometrialen polymorphkernigen<br />
Granulozyten auf das Zustandekommen einer Trächtigkeit wird anhand der Studie von<br />
KAUFMANN et al. (20<strong>09</strong>) deutlich. Hier wurden 201 Milchkühen ab 65 d p. p. anhand ihres<br />
zytologischen Befundes4 h post inseminationem in drei Gruppen eingeteilt: 0 % PMN, 0 -<br />
15 % PMN und > 15 % PMN. Die signifikant höchste Trächtigkeitsrate kam in der mittleren<br />
Gruppe mit 0 -15 % PMN und nicht in der Gruppe mit dem geringsten Anteil an<br />
polymorphkernigen Granulozyten zustande. SANTOS et al. (20<strong>09</strong>), die bei<br />
135 synchronisierten Fleischrindern zwischen dem 2. und 87. Tag post partum<br />
Endometriumszytologien erstellten, sehen aufgrund ihrer Untersuchungen keine<br />
120
Vorhersagekraft der zytologischen Diagnostik bei Tieren > 50 d p.p. für die spätere<br />
Reproduktionsleistung. SCHULT (20<strong>09</strong>) wies eine verminderte Fruchtbarkeitsleistung bei<br />
Kühen mit > 5 % PMN im Uterus nach, ein erhöhter PMN-Gehalt in der Zervix ließ in ihren<br />
Untersuchungen keinen Rückschluss auf die Reproduktionsleistung zu. Auch eine<br />
vaginoskopisch diagnostizierte Zervicitis Grad 1 war in diese Studie ohne Aussagekraft für<br />
die Reproduktion, wohingegen eine Zervicitis Grad 2 einen mindernden Einfluss auf die<br />
Fruchtbarkeit hatte (SCHULT 20<strong>09</strong>). DEGUILLAUME et al. (<strong>2012</strong>), die die Zervicitis mittels<br />
Zytobrush diagnostizierten, stellten einen signifikanten Einfluss der Zervixzytologie auf das<br />
Zustandekommen einer Trächtigkeit fest (≥ 5 % intrazervikale PMN; Milchkühe ≤ 35 d p.p.).<br />
Aufgrund der ebenfalls in den vorliegenden Studien untersuchten Zusammenhänge zwischen<br />
Zervixzytologiestatus und Symptomatik der inneren und äußeren Brunstsymptome kann<br />
festgehalten werden, dass, mittels Zervixzytologie gewonnene Hinweise auf eine Zervicitis<br />
und möglicherweise eine subklinische Endometritis beim Rind, begleitet sind von geringer<br />
ausgeprägten Brunstsymptomen, weniger Brunstschleim und einer schwächeren<br />
Uteruskontraktion im Östrus.<br />
5.2.4 Effekt der Seminalplasmaapplikation<br />
Nach Seminalplasmaapplikation stieg der Anteil an unauffälligen Zytologien signifikant von<br />
66,67 % im Östrus auf 94,74 % zum Zeitpunkt des Embryotransfers. In der Placebo- bzw.<br />
Kontrollgruppe nahm der Anteil PMN ≤ 10 % zwischen d 0 und d 7 zahlenmäßig ebenfalls,<br />
jedoch nicht signifikant zu. Eine durch Seminalplasma verminderte Anzahl an<br />
polymorphkernigen Granulozyten ließ sich also in der ET-Studie anhand der zervikalen<br />
Zytologien feststellen. Berichte über immunsuppressive Effekte des Seminalplasmas nennen<br />
die Suppression von Chemotaxis und Phagozytose der polymorphkernigen Granulozyten (in<br />
vitro: TROEDSSON et al. 2000; ROZEBOOM et al. 2001) bzw. eine verkürzte, nicht jedoch<br />
reduzierte Infiltration des Pferdeuterus mit polymorphkernigen Granulozyten (TROEDSSON<br />
et al. 2001). Für die kurzfristige Auslösung einer, der klassischen Entzündungskaskade<br />
ähnelnden, inflammatorischen Reaktion durch Seminalplasma, wie von TREMELLEN et<br />
al. (1998) oder JOHANSSON et al. (2004) bei der Maus und TROEDSSON et al. (2001)<br />
beim Pferd berichtet, gibt es eine Woche nach der Applikation anhand der durchgeführten<br />
ET-Studie keine Hinweise. Weitere Studien, die einen stimulierenden Effekt des<br />
121
Seminalplasmas auf das weibliche Genitale feststellten, beziehen sich ebenfalls auf einen<br />
Zeitraum wenige Stunden nach der Seminalplasmaapplikation und nicht auf die Spezies Rind<br />
(O´LEARY et al. 2004, 2006, Schwein). Für den Zeitraum wenige Stunden nach der<br />
Seminalplasmaapplikation lagen für die Tiere der ET-Studie keine zytologischen Präparate<br />
vor.<br />
Seminalplasmaeffekte, die über die Paarung hinaus gehen, werden auch unter dem Aspekt<br />
einer erfolgsversprechenden postkopulatorischen Fortpflanzungsstrategie gesehen (ROLDAN<br />
et al. 1992).Ob die Reduktion der polymorphkernigen Granulozyten in der Zervix eine Woche<br />
nach der Exposition mit Seminalplasma physiologisch und möglicherweise sogar ein<br />
Indikator für die erforderliche maternale Immuntoleranz gegenüber dem Konzeptus ist, kann<br />
aufgrund der durchgeführten Studie und mangels vorhandener Literatur für das Rind nicht<br />
beurteilt werden. Es ist allerdings festzuhalten, dass die Tiergruppe mit ≤ 10 % PMN zum<br />
Zeitpunkt des Transfers keine signifikant erhöhte Trächtigkeitsrate gegenüber der Tiergruppe<br />
mit > 10 % PMN zeigte und sich die Trächtigkeitsraten zwischen Seminalplasma- und<br />
Placebogruppe der ET-Studie kaum unterschieden.<br />
5.2.5 Kritische Anmerkungen zum Einsatz der Zervixzytologie<br />
In der KB-Studie konnten 414 Zytologien ausgewertet werden und in der ET-Studie erfüllten<br />
35 Proben sowohl an d 0 als auch d 7 die Kriterien zur Auswertung. Eine verbesserte<br />
Ausbeute an auswertbaren Zytologien wäre wünschenswert gewesen. Die Annahme, dass es<br />
durch eine minimal invasive, exfoliative Zytologieentnahme keine Beeinflussung von KB und<br />
ET geben sollte, stand jedoch im Vordergrund und trug zur Akzeptanz seitens der beteiligten<br />
Landwirte bei. Außerdem sei in Bezug auf die Praxisrelevanz darauf hingewiesen, dass die<br />
Studientiere mit zytologischen Hinweisen auf eine subklinische Endometritis ohne Zytobrush<br />
nicht identifiziert worden wären und dementsprechend vor Ort als besamungs- bzw.<br />
transfergeeignet eingestuft wurden.<br />
5.3 Experimentelle Studie<br />
5.3.1 Überprüfung der Arbeitshypothese<br />
Untersucht werden sollte die Hypothese, dass sich die Methode der Szintigraphie eignet, den<br />
Verbleib einer vaginal applizierten, radioaktiv markierten Lösung über einen gewissen<br />
Zeitraum nachzuvollziehen. Des Weiteren sollte die Hypothese überprüft werden, dass es<br />
122
Unterschiede zwischen Seminalplasma, Ejakulat und Placebo in Bezug auf ihre Verteilung<br />
und ihren Verbleib im weiblichen Genitale von Scheidenbesamern gibt. Durch die Erstellung<br />
von Szintigraphien an Ziegen nach intravaginaler Applikation von radioaktiv markiertem<br />
Seminalplasma, Ejakulat oder Placebo war eine vergleichende Betrachtung aller drei<br />
eingesetzten Lösungen möglich. Die Hypothese über Unterschiede in der Verteilung bzw.<br />
dem Verbleib von Seminalplasma, Ejakulat oder Placebo im weiblichen Genitale der Ziegen<br />
bestätigte sich in den durchgeführten Untersuchungen nicht.<br />
5.3.2 Einordnung der Szintigramme<br />
Zahlreiche szintigraphische Studien (ITURRALDE u. VENTER 1981; STECK et al. 1989a;<br />
Mc QUEEN et al. 1993; LEYENDECKER et al. 1996; KUNZ et al. 1996) wurden mit<br />
kommerziell erhältlichen Humanalbuminpartikeln in vergleichbarer Größe, wie in dem in der<br />
vorliegenden Studie verwendeten Kit durchgeführt. Insgesamt beschränkte sich die Verteilung<br />
des Seminalplasmasin der eigenen Studie auf einen Bereich von 1 - 2 cm Radius um den<br />
Fundus vaginae. Die Vagina der Ziege erstreckt sich über eine Länge von 10 cm<br />
(CONSTANTINESCU 2007), und es kann davon ausgegangen werden, dass sich die auf den<br />
Szintigrammen visualisierte Verteilung des Seminalplasmas innerhalb der Vagina befindet.<br />
Hierfür sprechen auch die vorgenommenen Abstandsmessungen vom Fundus vaginae zur<br />
Vulva, die in einigen Serien durch Markierung sicher nachvollziehbar identifiziert wurde.<br />
Es gab auf den erstellten Szintigrammen keine Hinweise auf einen kranial-gerichteten<br />
Transport von Seminalplasma, Ejakulat oder Placebo nach intravaginaler Applikation.<br />
Demgegenüber gelang CHATDARONG et al. 2002 bei der Katze die Darstellung des<br />
Partikeltransportes aus der kranialen Vagina über den Gebärmutterhals bis in die<br />
Gebärmutterhörner mit einer der vorliegenden Studie vergleichbaren Radioaktivität. Auch<br />
beim Menschenist der Transport radioaktiver Partikel von der Vagina bis zu den Ovarien mit<br />
Hilfe von Hysterosalpingoszintigraphien belegt (ITURRALDE u. VENTER 1981; KUNZ et<br />
al. 1996).Gleichzeitig wird allerdings auch bei klinisch gesunden Individuen über keine<br />
sichtbare Partikelmigration in Richtung der Ovarien berichtet (ITURRALDE u.<br />
VENTER 1981). An Pferden durchgeführte Szintigraphien des Genitaltraktes beschränken<br />
sich auf die Untersuchung des Uterus nach Applikation von radioaktiver Lösung direkt in die<br />
Gebärmutter. Hier gibt es keine Berichte über radioaktive Partikel in den Tuben oder das<br />
123
Erreichen der Ovarien (NEUWIRTH et al. 1995; KATILA et al. 1998; LE BLANC et al.<br />
1998; SINNEMAA et al. 2005).<br />
Zu berücksichtigen sind anatomische Besonderheiten der Ziege, wie die spiralig gewundenen<br />
Cornua uteri. Eine eigene, laparoskopisch durchgeführte Messung ergab einen Abstand von<br />
nur ca. 3 cm zwischen Portio und Ovar im Östrus in situ. Unter Umständen ist bei der Ziege,<br />
aufgrund der großen Nähe der einzelnen Kompartimente des Genitaltraktes, ein weiterer<br />
Transport des Seminalplasmas per Szintigramm nicht abgrenzbar. Auch nach vaginaler<br />
Applikation markierten Ejakulats im Östrus gelang keine Darstellung eines kranial gerichteten<br />
Transportes. Eine Auftrennung von Seminalplasma bzw. Spermatozoen und radioaktiv-<br />
markierten Albuminpartikeln, und die dadurch bedingte Nicht-Darstellung von<br />
Lösungstransport, ist zudem denkbar. Dagegen sprechen die Veröffentlichungen zum<br />
Menschen, die sich vergleichbarer Methodik wie die vorliegende experimentelle Studie<br />
bedienen (BECKER et al. 1988; Mc QUEEN et al. 1993; LEYENDECKER et al. 1996) und<br />
explizit auch den Transport chemisch inerter Substanzen nach vaginaler Applikation nennen<br />
(ITURRALDE u. VENTER 1981; STECK et al. 1989a). Ein Studienansatz, um die<br />
Separierung von markierten Albuminpartikeln im Ejakulat zu überprüfen, ist die radioaktive<br />
Markierung von Spermatozoen, wie es BOCKISCH (1993) für Spermien des Kaninchen (in<br />
vitro und in vivo) und CHATDARONG et al. (2007) für canine Spermien in vitro berichten.<br />
Für Untersuchungen mit Seminalplasma ist dieser Ansatz nicht hilfreich.<br />
Die vaginale Retention von Teilen des Seminalplasmas nach dessen Deponierung im Fundus<br />
vaginae lag bei den Ziegen der Studie bei mehr als sechs Stunden. Eine Ausscheidung des<br />
applizierten Seminalplasmas zeigte sich frühestens nach <strong>24</strong>0 min, und auch nach 360 min war<br />
bei allen Tieren ein deutlicher intravaginaler Verbleib des Seminalplasmas festzustellen.<br />
Beim Kaninchen befinden sich 360 min nach vaginaler Applikation (Standard-Insemination)<br />
ca. 25 % der Inseminationsdosis in der Nähe der Zervix (BOCKISCH 1993). Bei<br />
reproduktionsgesunden Stuten werden innerhalb von 120 min ca. 50 % eines uterin<br />
infundierten Radiokolloids ausgeschieden (NEUWIRTH et al. 1995; LE BLANC et al. 1998).<br />
Laut einer, ebenfalls an Pferden durchgeführten Studie von KATILA et al. (1998) ist die<br />
meiste Radioaktivität nach 150 min ausgeschieden und nach 270 min keine bis wenig<br />
Aktivität in Uterus und Scheide erkennbar. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen,<br />
1<strong>24</strong>
dass vaginal appliziertes Seminalplasma bei Ziegen länger in der Scheide verbleibt, als dies<br />
für andere Spezies bekannt ist. Radioaktiv markiertes Ejakulat bzw. Placebo verhielten sich<br />
im weiblichen Genitaltrakt bezüglich Verteilung und Verbleib ähnlich wie das<br />
Seminalplasma. Es gab geringe individuelle, jedoch keine auffälligen Unterschiede in den<br />
Szintigrammen der drei Lösungen. Auch nach Ejakulat- bzw. Placeboapplikation gab es keine<br />
Hinweise auf einen Lösungstransport in die Gebärmutter. Die Retentionszeit von Ejakulat und<br />
Placebo lag ebenfalls bei mehr als vier Stunden und auch bei Ende des angesetzten<br />
Messzeitraums war intravaginal noch Ejakulat bzw. Placebo vorhanden. Zwischen den<br />
Studientieren gab es individuell leicht unterschiedliche Verteilungsmuster der applizierten<br />
Lösungen. So zeigt die räumliche Verteilung von Seminalplasma und Placebo bei Ziege A,<br />
von Ejakulat bei Ziege B und von Ejakulat und Seminalplasma bei Ziege C jeweils eine<br />
geringfügig größere Variabilität als die Verteilung der anderen Lösungen. Worauf diese<br />
kleinen Unterschiede beruhen, kann aufgrund der Studienergebnisse nicht geklärt werden.<br />
5.3.3 Kritische Anmerkungen zur experimentellen Studie<br />
Die Durchführung der experimentellen Studie beschränkte sich auf wenige Tiere und Zyklen,<br />
wobei jedoch jedes Tier seine eigene Kontrolle darstellte. Die Verwendung eines<br />
Seminalplasmapools bzw. Ejakulate mehrere Ziegenböcke - für die vorliegende Studie wurde<br />
ein Bock genutzt - wäre für weitere Untersuchungen zur Vermeidung eines Bockeffektes<br />
bedenkenswert. Eine direkte Markierung von Spermatozoen zusätzlich zur gesamten<br />
Lösungsmarkierung könnte in der Ejakulatserie zusätzliche Informationen liefern. Längere<br />
Aufnahmezeiten für die einzelnen Szintigramme, wie sie in der Humanmedizin durch aktive<br />
Mitarbeit des Patienten möglich sind, wären wünschenswert, hätten aber zu verstärkter<br />
Bildverfälschung durch Bewegung geführt. Eine Ruhigstellung der Studientiere durch<br />
Sedation wurde aufgrund der systemischen Beeinflussung und des langen<br />
Untersuchungsintervalls nicht angewendet.<br />
Die Differenzierung der einzelnen genitalen Kompartimente in Szintigrammen erweist sich<br />
stets als schwierig. Für BOCKISCH (1962) ist die Differenzierung der einzelnen genitalen<br />
Kompartimente beim Kaninchen schwierig und teilweise anhand der Szintigraphien nicht<br />
möglich. KATILA et al. (2000) nutzten als Hilfsmittel eine direkte radioaktive Markierung<br />
des präovulatorischen Follikels und konnten trotzdem im latero-lateralen Strahlengang die<br />
125
Ovarien der Stute nicht ausreichend lokalisieren. Studien in der Humanmedizin nutzen<br />
Hysterosalpingoszintigraphien in Kombination mit anderen diagnostischen Verfahren, was<br />
die Orientierung auf den Szintigrammen wesentlich erleichterte (ITURRALDE u.<br />
VENTER 1981; MC QUEEN et al. 1993; ÖZGÜR et al. 1997). Die in der vorliegenden<br />
Studie teilweise durchgeführte Vulvamarkierung ist sicherlich nicht optimal, da sie auf dem<br />
natürlichen Ausscheidungsweg liegt, stellte sich aber als sehr hilfreicher Orientierungs- und<br />
Bezugspunkt heraus und wurde bei tatsächlicher Ausscheidung der markierten Lösungen von<br />
dieser deutlich überlagert.<br />
126
6 ZUSAMMENFASSUNG<br />
Mona <strong>Schwerhoff</strong><br />
Fruchtbarkeit nach intravaginaler und intrazervikaler Applikation von Seminalplasma bei der<br />
artifiziellen Insemination des Rindes sowie bei Embryonenempfängertieren<br />
In zwei Dreifachblind-Feldstudien, durchgeführt im Einzugsgebiet von vier<br />
Besamungsstationen in Deutschland, wurden intrazervikale und intravaginale<br />
Seminalplasmaapplikationen bei Rindern der Rassen Deutsche Holstein Schwarzbunt und<br />
Rotbunt sowie Deutsches Fleckvieh vorgenommen. Die Applikation erfolgte in der einen<br />
Studie inseminationsbegleitend (KB-Studie) und in der anderen Studie brunstbegleitend bei<br />
Embryonenempfängertieren (ET-Studie). Eine Anzahl von 514 Tieren wurde in die KB-<br />
Studie einbezogen (nur Erstbesamungen) und nach dem Zufallsprinzip in drei Gruppen<br />
eingeteilt. Zusätzlich zur routinemäßig ausgeführten intrauterinen Samenübertragung mit<br />
Kryosperma geprüft fertiler Bullen wurden jeweils 4 ml Seminalplasma (SP) aus einem<br />
Seminalplasmapool (SP-Gruppe) bzw. eine entsprechende Menge Placebo-Flüssigkeit (P-<br />
Gruppe) in (1/3 der Gesamtmenge) und vor die Portio vaginalis cervicis (2/3 der<br />
Gesamtmenge) appliziert (je Gruppe ca. 170 Tiere). Probandinnen der Kontrollgruppe(K-<br />
Gruppe) blieben unbehandelt. In die ET-Studie, mit denselben Versuchsgruppen wie in der<br />
KB-Studie, wurden 68 Tiere einbezogen. Hier erfolgte die Lösungsapplikation, in gleicher<br />
Weise wie bereits beschrieben, in der Brunst (d 0 des Zyklus) bei<br />
Embryonenempfängertieren, denen am d 7 ein Embryo eingesetzt wurde. Von allen<br />
Studientieren wurden diverse Tier-, Brunst- und Haltungsparameter erhoben, wozu unter<br />
anderem die Gewinnung von Zervixzytologien im Östrus (KB-Studie) bzw. d 0 und d 7 (ET-<br />
Studie) zählte. Ergänzend wurden Vaginohysteroszintigraphien an Ziegen, wie das Rind ein<br />
Scheidenbesamer, durchgeführt. Radioaktiv markiertes Seminalplasma, Placebo oder Ejakulat<br />
(je 1 mL) wurde intravaginal im Östrus appliziert. Anschließend wurden statische<br />
Szintigramme in dem Zeitraum 0 - 360 min nach der Applikation erstellt.<br />
Ziel beider Feldstudien war die Überprüfung der Hypothese, dass eine<br />
Seminalplasmaapplikation in physiologischer Menge und Lokalisation sich positiv auf die<br />
Trächtigkeitsrate bei Rindern auswirkt. Die Erhebung diverser Parameter diente der<br />
127
Charakterisierung der Studientiere, sowie der Identifizierung möglicher signifikanter<br />
Einflüsse auf die Trächtigkeitsraten. Ziel der experimentellen Vaginohysteroszintigraphie-<br />
Studie war es, per Szintigramm die Verteilung und den Verbleib von markiertem<br />
Seminalplasma, Placebo und Ejakulat zu verfolgen.<br />
Der Hauptteil der Arbeit, zwei Dreifachblindstudien zur Untersuchung der Auswirkungen<br />
einer intrazervikalen und intravaginalen Seminalplasmaapplikation in der Brunst auf die<br />
Trächtigkeitsrate (TR)beim Rind, erbrachte folgende Ergebnisse:<br />
Die Verteilung der Studientiere bezogen auf die Versuchsgruppen (SP/P/K) war für alle<br />
erfassten Parameter gleichmäßig und keiner der untersuchten Parameter unterschied sich in<br />
Bezug auf die Versuchsgruppen signifikant.<br />
In der Studie zur inseminationsbegleitenden Applikation (KB-Studie, n = 514 Tiere):<br />
1. bewirkte die Seminalplasmaapplikation eine signifikante Steigerung der<br />
Trächtigkeitsrate um 25 % im Vergleich zur unbehandelten Kontrollgruppe (TR<br />
57,56 % zu 46,11 %; P = 0,035).<br />
2. bewirkte die Placeboapplikation eine signifikante Steigerung der Trächtigkeitsrate um<br />
26 % im Vergleich zur unbehandelten Kontrollgruppe (TR 58,29 % zu 46,11 %;<br />
P = 0,0<strong>24</strong>).<br />
3. zeigte sich kein Unterschied in den Trächtigkeitsraten der Seminalplasma- und der<br />
Placebogruppe (TR 57,56 % und 58,29 %; P > 0,05).<br />
4. beeinflusste ein unauffälliger Zervixzytologiestatus im Östrus die Trächtigkeitsraten<br />
nicht signifikant positiv (TR< 10 % PMN 54,32 % zu TR≥ 10 % PMN 50,00 %; P > 0,05).<br />
5. zeigte sich ein signifikanter Einfluss von Rastzeit und Brunstintensität auf die<br />
Trächtigkeitsraten (PRastzeit = 0,012; PBrunstintensität = 0,048).<br />
In der Studie zur brunstbegleitenden Applikation bei Embryonenempfängertieren<br />
(ET-Studie, n = 68 Tiere):<br />
1. bewirkte die Seminalplasmaapplikation eine nicht signifikante Steigerung der<br />
Trächtigkeitsrate um 60 % im Vergleich zur unbehandelten Kontrollgruppe (TR<br />
60,00 % zu 37,50 %; P = 0,12).<br />
128
2. bewirkte die Placeboapplikation eine nicht signifikante Steigerung der<br />
Trächtigkeitsrate um 54 % im Vergleich zur unbehandelten Kontrollgruppe (TR<br />
57,89 % zu 37,50 %; P = 0,18).<br />
3. zeigte sich kein Unterschied in den Trächtigkeitsraten der Seminalplasma- und der<br />
Placebogruppe (TR 60,00 % und 57,89 %; P > 0,05).<br />
4. beeinflusste ein unauffälliger Zervixzytologiestatus sowohl im Östrus (d 0) als auch<br />
zum Transferzeitpunkt (d 7) die Trächtigkeitsraten nicht signifikant positiv (d 0:<br />
TR< 10 % PMN 56,00 % zu TR≥ 10 % PMN 40,00 % bzw. d 7: TR< 10 % PMN 54,84 % zu<br />
TR≥ 10 % PMN 25,00 %; alle P > 0,05).<br />
5. bewirkte die Seminalplasmaapplikation im Östrus einen signifikanten Anstieg<br />
unauffälliger Zervixzytologien zum Transferzeitpunkt (< 10 % PMN: Östrus 66,67 % zu<br />
Transfer 94,74 %; P = 0,046).<br />
6. stieg zwischen d 0 und d 7 sowohl in der Placebogruppe als auch in der unbehandelten<br />
Kontrollgruppe der Anteil unauffälliger Zervixzytologien (< 10 % PMN: Östrus 66,67 %<br />
zu Transfer 82,35 % bzw. < 10 % PMN: Östrus 70,00 % zu Transfer 86,96 %; alle P > 0,05).<br />
7. zeigte sich ein signifikanter Einfluss von Zyklussynchronisation und Uterusgröße auf<br />
die Trächtigkeitsraten (PSynchronisation = 0,01; PUterusgröße = 0,047).<br />
Die ergänzende experimentelle Studie zur Untersuchung von Verteilung und Verbleib einer<br />
intravaginalen Seminalplasmaapplikation im Östrus anhand von Vaginohysteroszintigraphien<br />
bei Ziegen erbrachte folgende Ergebnisse:<br />
1. radioaktiv markiertes Seminalplasma, Ejakulat und Placebo verbleiben nach<br />
Applikation in den Fundus vaginae der Ziege mindestens sechs Stunden in der<br />
Scheide.<br />
2. die Szintigramme zeigen keinen Transport von radioaktiv markiertem Seminalplasma,<br />
Ejakulat oder Placebo aus der Scheide in die Gebärmutter der Ziege.<br />
3. die retrograde Ausscheidung von markiertem Seminalplasma, Ejakulat und Placebo<br />
aus der Vagina über die Vulva beginnt frühestens vier Stunden nach der Applikation.<br />
129
Zusammenfassend lässt sich anhand der vorliegenden Studien feststellen, dass Seminalplasma<br />
genauso wie Placebo, jeweils intrazervikal und intravaginal während der Brunst in einer<br />
Menge von 4 mL appliziert, eine Steigerung der Trächtigkeitsraten bei Rindern bewirkt.<br />
Offensichtlich spielen also beim Scheidenbesamer Rind Ort, Menge und/oder der Zeitpunkt<br />
der Applikation eine größere fruchtbarkeitsfördernde Rolle als die Art der Lösung selbst. Als<br />
Erklärungsansatz der durch die Lösungsapplikation verbesserten Fertilität stehen insbesondere<br />
ein Volumen- oder ein Deponierungseffekt zur Diskussion.<br />
Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass Seminalplasma, Ejakulat und auch Placebo mehr<br />
als sechs Stunden intravaginal bei Ziegen verbleibt, in vergleichbaren Zeiträumen über die<br />
Vulva ausgeschieden wird, und mittels Vaginohysteroszintigraphien kein Transport in den<br />
Uterus erkennbar ist. Auch für die vaginale Persistenz bzw. ihre Ausscheidung nach vaginaler<br />
Applikation scheint demnach die Art der Lösung beim Scheidenbesamer Ziege nicht von<br />
größerer Bedeutung zu sein.<br />
130
7 SUMMARY<br />
Mona <strong>Schwerhoff</strong><br />
Pregnancy rates in cattle after intravaginal and intracervical administration of seminal plasma<br />
concurrently with artificial insemination and in embryo transfer recipients<br />
In the area of four German artificial insemination centres two triple blind studies were<br />
designed to examine the effects of an intracervical and intravaginal seminal plasma<br />
application on dairy and dual purpose cattle under field condition. On the one hand the<br />
application was done concurrent with artificial insemination (AI-study), on the other hand at<br />
the time of standing oestrus in embryo transfer recipients (ET-study). An amount of<br />
514 animals was included in the AI-study (only cows for first service) and allocated randomly<br />
in equal shares into one of the three experimental groups.Immediately after artificial<br />
insemination (intrauterine) with deep-frozen semen derived from fertile bulls, 4 mL seminal<br />
plasma of a seminal plasma pool (experimental group SP) or sterile placebo (experimental<br />
group P) were administered into the caudal cervix canal (one-third of the total amount) as<br />
well as into the cranial vagina (two thirds of the total amount). The control group<br />
(experimental group K) was inseminated but otherwise left untreated. Each experimental<br />
group contained about 170 cows. The ET-study, with the same three experimental groups than<br />
the AI-study, consisted of 68 embryo transfer recipients, treated with seminal plasma or<br />
placebo in the same way as described above. The application took place at the time of<br />
standing oestrus (d 0) in recipients selected for embryo transfer on day seven (d 7). Animals<br />
of both studies were classified according to age, time post partum, BCS, lameness and further<br />
parameters, including cervix cytology on d 0 (AI-study) as well as d 0 and d 7 (ET-study). In<br />
a complementary third experimental study hysteroscintigraphic scans were performed with<br />
goats. Radio-labelled seminal plasma, ejaculate or placebo (1 mL) was administered<br />
intravaginally at the time of standing oestrus. Scintigraphic scans were performed 0 - 360 min<br />
after application of the fluid.<br />
The aim of both studies under field condition was to test the hypothesis that an application of<br />
seminal plasma, mimicking the presence of ejaculate during mating, would have a positive<br />
effect on the pregnancy rate of cattle. Possible other significant influences on the pregnancy<br />
131
ates were to be identified by means of a concurrent detailed classification of each animal<br />
included in the studies. The objective of the experimental hysteroscintigraphic study was to<br />
verify where and how long radio-labelled seminal plasma, ejaculate and placebo persisted in<br />
the female genital tract in goats.<br />
The main part of this thesis, two triple blind studies examinating the effects of an intracervical<br />
and intravaginal seminal plasma application during standing oestrus on the pregnancy rates<br />
(PR) of cows, has led to the following results:<br />
In the study investigating a seminal plasma application concurrent with artificial insemination<br />
(AI-Study; n = 514 animals):<br />
1. the application of seminal plasma resulted in a significant increase in the pregnancy<br />
rate of 25% in comparison to the untreated control group (PR 57.56 % as opposed to<br />
46.11 %; P = 0.035).<br />
2. the application of placebo led to a significant increase in the pregnancy rate of 26%<br />
compared to the untreated control group (PR 58.29 % versus 46.11 %; P = 0.0<strong>24</strong>).<br />
3. there was no difference in the pregnancy rates of seminal plasma group and placebo<br />
group (PR 57.56 % and 58.29 %; P > 0.05).<br />
4. an inconspicuous cytology status of the cervix during oestrus did not influence the<br />
pregnancy rates significant positively (PR< 10 % PMN54.32 % as opposed to PR≥ 10 % PMN<br />
50.00 %; P > 0.05).<br />
5. a significant influence of the interval between calving and artificial insemination (days<br />
to first service) and intensity of oestrus symptoms on the pregnancy rates was found<br />
(PIntervall = 0,012; PSymptoms = 0.048).<br />
In the study examining a seminal plasma application during standing oestrus in embryo<br />
recipients (ET-Study; n =68 animals):<br />
1. the application of seminal plasma resulted in an insignificant increase in the pregnancy<br />
rate of 60 % in comparison to the untreated control group (PR 60.00 % as opposed to<br />
37.50 %; P = 0.12).<br />
132
2. the application of placebo led to an insignificant increase in the pregnancy rate of<br />
54 % compared to the untreated control group (PR 57.89 % versus 37.50 %; P = 0.18).<br />
3. there was no difference in the pregnancy rates of seminal plasma and placebo group<br />
(PR 60.00 % as opposed to 57.89 %; P > 0.05).<br />
4. an inconspicuous cytology status of the cervix during standing oestrus (d 0) as well as<br />
at during transfer (d 7) did influence the pregnancy rates positively but not<br />
significantly (d 0: PR< 10 % PMN 56.00 % versus PR≥ 10 % PMN 40.00 % and d 7:<br />
PR< 10 % PMN 54.84 % versus PR≥ 10 % PMN 25.00 %, respectively; all P > 0.05).<br />
5. the application of seminal plasma led to a significant increase of inconspicuous cervix<br />
cytologies between d 0 and d 7 (< 10 % PMN: oestrus 66.67 % versus transfer 94.74 %;<br />
P = 0.046).<br />
6. the number of inconspicuous cervix cytologies rose between d 0 and d 7 not only in<br />
the placebo group but also in the untreated control group (< 10 % PMN: oestrus 66.67 %<br />
versus transfer 82.35 % and < 10 % PMN oestrus 70.00 % versus transfer 86.96 %,<br />
respectively; P > 0.05).<br />
7. a significant influence of cycle synchronization and uterus size on the pregnancy rates<br />
(PSynchronisation = 0.01; PSize = 0.047).<br />
The additional experimental study to investigate the distribution of an intravaginal application<br />
of seminal plasma in goats by means of scintigraphic scans led to the following results:<br />
1. radiolabelled seminal plasma, ejaculate and placebo stay at least six hours in the goat´s<br />
vagina after applying them in the fundus vaginae.<br />
2. the scintigraphic scans did not show any transportation of radiolabelled seminal<br />
plasma, ejaculate or placebo from the vagina into the uterus of the goats.<br />
3. the excretion of seminal plasma, ejaculate and placebo from the vagina through the<br />
vulva begins after four hours after application at the earliest.<br />
In summary, by means of these studies, one comes to the conclusion that seminal plasma as<br />
well as placebo has a considerable positive effect on the achievement of pregnancy in cows.<br />
Obviously the place (intravaginally and intracervically), the amount (4 mL) and/or the time of<br />
133
application (standing oestrus) play a more important role in the achievement of pregnancy in<br />
cows than the type of applicated fluid. As possible explanations for the improved pregnancy<br />
rates mainly a volume or a site depended effect are discussed.<br />
Apart from this it needs to be emphasized that seminal plasma, ejaculate and placebo as well<br />
remain intravaginally in goats more than six hours and vaginohysteroscintigraphy does not<br />
show any transportation into the uterus during that time. Neither distribution nor excretion<br />
after application into the fundus vaginae in goats seem to be seriously influenced by the type<br />
of fluid.<br />
134
8 LITERATURVERZEICHNIS<br />
ADAMS, G. P., M. H. RATTO, W. HUANCA, J. SINGH (2005):<br />
Ovulation-inducing factor in the seminal plasma of alpacas and llamas.<br />
Biol. Reprod. 72: 425-547<br />
ADR (2006):<br />
Empfehlung 8.2 Anforderungen an Zuchtbullen für den Einsatz in der KB und für<br />
Deckbullen.<br />
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinderzüchter e.V.<br />
http://www.adr-web.de/services/files/richtlinien_empfehlung/ADR-Empfehlung 8.2.pdf<br />
Abrufdatum: 08.04.2011<br />
ADR (2011):<br />
Jahresbericht 2010 -Das Wichtigste in Kürze.<br />
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinderzüchter e.V.<br />
http://www.adr-web.de/services/files/jahresbericht_2011/JB11 das Wichtigste in Kürze.pdf<br />
Abrufdatum: 04.02.<strong>2012</strong><br />
AHMADI, M. R., S. NAZIFI, H. R. GHAISARI, M. RADMEHR (2005):<br />
Evaluation of reproductive cycle with cervical and uterine cytology in Iranian dromedary<br />
camels.<br />
Comp. Clin. Path.14: 48-51<br />
AHMADI, M. R., S. NAZIFI, H. R. GHAISARI (2006):<br />
Comparative cervical cytology and conception rate in postpartum dairy cows.<br />
Veterinarski Arhiv 76: 323-332<br />
ANON. (2006a):<br />
Fachinformation Elumatic III Technetium-99m-Generator<br />
Stand 10/2006.<br />
Hersteller CIS bio international, B.P. 32, F-91192 GIF SUR YVETTE CEDEX , Frankreich<br />
ANON. (2006b):<br />
Fachinformation Pulmocis, Nuklearmedizinisches Diagnostikum nach Markierung<br />
Stand 12/2006<br />
Hersteller CIS bio international, B.P. 32, F-91192 GIF SUR YVETTE CEDEX , Frankreich<br />
BAIRD, D. T. (1987):<br />
The ovary.<br />
In: C. R. AUSTIN u. R. V. SHORT (Hrsg.) Reproduction in mammals. Book 3: Hormonal<br />
control of reproduction.<br />
2. Auflage; Cambridge University Press, Cambridge, S. 91-94.<br />
BARLUND, C. S., T. D. CARRUTHERS, C. L. WALDNER, C. W. PALMER (2008):<br />
A comparison of diagnostic techniques for postpartum endometritis in dairy cattle.<br />
Theriogenology 69, 714 - 723<br />
135
BECKER, W., T. STECK, P. ALBER, W. BORNE (1988):<br />
Hystero-salpingo-scintigraphy, a simple and accurate method of evaluating Fallopian tube<br />
patency.<br />
Nuklearmedizin 27 :252-257<br />
BELIBASAKI, S., G. S. AMIRIDIS, A. LYMBEROPOULOS, S. VARSAKELI, T.<br />
KOUSKOURA (2000):<br />
Ram seminal plasma and fertility: Results from an ongoing field study.<br />
Acta Veterinaria Hungarica 48: 335-341<br />
BELLINGE, B. S., S. M. COPELAND, T. D. THOMAS, R. E. MAZZUCCHELLI, G.,<br />
O'NEIL, M. J. COHEN (1986):<br />
The influence of patient insemination on the implantation rate in an in-vitro fertilization and<br />
embryo-transfer program.<br />
Fertil.Steril.46, 252 - 256<br />
BENZINGER, D.P., J. EDELSON (1983):<br />
Absorption from the vagina.<br />
Drug Metab. Rev. 14:137-168<br />
BERG, R. (2000):<br />
Glandula vesiculares.Glandulae genitales accessoriae.<br />
in: E. WIESNER u. R. RIBBECK (Hrsg.) Lexikon der Veterinärmedizin.<br />
4. Auflage; Enke im Hippokrates Verlag, Stuttgart, S. 567, 568<br />
BOCKISCH, A. (1962):<br />
Radionuklid-Markierung menschlicher und tierischer Spermatozoen und quantitative<br />
Szintigraphie der Spermatozoenkinetik im Genitaltrakt des weiblichen Kaninchens nach<br />
Insemination.<br />
Habilitationsschrift, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn<br />
BOCKISCH, A. (1993):<br />
Sperm cell dynamics in the female rabbit genital tract after insemination monitored by<br />
radiolabeled spermatozoa.<br />
J. Nucl. Medic.34: 1134-1139<br />
BROMFIELD, J.J. (2006):<br />
The physiological significance of insemination in programming pregnancy outcome.<br />
PhD thesis, University of Adelaide, Australia<br />
BUSCH, W. (2007):<br />
Insemination.<br />
in: BUSCH, W. u. D. WABERSKI (Hrsg.) Künstliche Besamung bei Haus- und Nutztieren.<br />
Schattauer GmbH, Stuttgart, 2007, S. 181, 186, 193<br />
136
BUSCH, W., u. D. WABERSKI (2007):<br />
Entwicklung der Künstlichen Besamung.<br />
in: Künstliche Besamung bei Haus- und Nutztieren.<br />
Schattauer GmbH, Stuttgart, S. 2-3<br />
BUTLER, W. R. u. R. D. SMITH (1989):<br />
Interrelationships between energy balance and postpartum reproductive function in dairy<br />
cattle.<br />
J. Dairy Sci. 72:767-783<br />
BYGDEMAN, M., u. R. ELIASSON (1963):<br />
The effect of prostaglandin from human seminal fluid on the motility of the non-pregnant<br />
human uterus in vitro.<br />
Acta Physiologica Scandinavia 59: 43-51<br />
CALVETE, J. J., u. L. SANZ (2007):<br />
Insights into structure-function correlations of ungulate seminal plasma proteins.<br />
Soc. Reprod.Fertil. Suppl. 65:201-215<br />
CARD, C. (2005):<br />
Post-breeding inflammation and endometrial cytology in mares.<br />
Theriogenology 64: 580-588<br />
CHATDARONG, K., N. KAMPA, E. AXNER, C. LINDE-FORSBERG (2002):<br />
Investigation of cervical patency and uterine appearance in domestic cats by fluoroscopy and<br />
scintigraphy.<br />
Reprod. Dom. Anim. 37: 275-281<br />
CHATDARONG, K., E. AXNER, B. JONES, C. LINDE-FORSBERG (2007):<br />
Dogs spermatozoa labelling with 99mTc-HMPAO.<br />
Thai J. Vet. Med.37: 25-32<br />
CHATTERTON, B. E., S. PENGLIS, J. C., KOVACS, B. PRESNELL, B. HUNT (2004):<br />
Retention and distribution of two 99mTc-DTPA labelled vaginal dosage forms. International<br />
J. Pharmaceutics 271: 137-143<br />
CHEN, B. X., M. P. L. CHEUNG, P. H. CHOW, A. L. M. CHEUNG, W. LIU, W. S. O<br />
(2002):<br />
Protection of sperm against oxidative stress in vivo by accessory sex gland secretions in male<br />
hamsters.<br />
Reproduction 1<strong>24</strong>: 491-499<br />
CHEN, B. X., Z. X. YUEN, G. W. PAN (1985):<br />
Semen-induced ovulation in the bactrian camel.<br />
J. Reprod. Fertil.74: 335-339<br />
137
CHO, M. J., J. F. SCIESZKA, P.S. BURTON (1989):<br />
Citric acid as an adjuvant for transepithelial transport.<br />
Int. J. Pharm. 52: 79-81<br />
CICINELLI, E., M. CIGNARELLI, L. RESTA, P. SCORCIA, D. PETRUZZI, G. SANTORO<br />
(1993):<br />
Effects of the repetitive administration of progesterone by nasal spray in postmenopausal<br />
women.<br />
Fertil. Steril. 60: 1020-10<strong>24</strong><br />
CICINELLI, E., u. D. DE ZIEGLER (1999):<br />
Transvaginal progesterone: Evidence for a new functional "portal system" flowing from the<br />
vagina to the uterus.<br />
Human Reproduction Update 5: 365-372<br />
CLARKE, A. G. (1984):<br />
Immunological studies on pregnancy in the mouse.<br />
in: D. B. CRIGHTON (Hrsg.)<br />
Immunological aspects of reproduction in mammals.<br />
Butterworths, London, 153-182<br />
CLAUS, R. (1990):<br />
Physiological role of seminal components in the reproductive tract of the female pig.<br />
J. Reprod. Fertil. Suppl. 40:117-131<br />
CONSTANTINESCU, G. M. (2007):<br />
The genital apparatus in the ruminant.<br />
in: H. SCHATTEN u. G. M. CONSTANTINESCU (Hrsg.) Comparative Reproductive<br />
Biology.<br />
Blackwell Publishing, Iowa, USA, S. 33-48<br />
COULAM, C. B., u. J. J. STERN (1995):<br />
Effects of seminal plasma on implantation rates.<br />
Early Pregnancy 1: 33-6<br />
COUTO, G. B. (20<strong>09</strong>):<br />
Comparison of a leukocyte esterase test with endometrial cytology for the diagnosis of<br />
subclinical endometritis and correlation with first service pregnancy rate in postpartum<br />
Holstein cows.<br />
PhD thesis, Universität Montreal 20<strong>09</strong><br />
DASCANIO, J., W. B. LEY, J. M. BOWEN (1997):<br />
How to perform and interpret uterine cytology.<br />
Ann. Convention of the AAEP Proc. 43: 182-186<br />
43th Annual Convention of the AAEP, Phoenix 7.-10.December 1997<br />
Nachdruck auf IVIS-Website: http://www.ivis.org/proceedings/aaep/1997/Dascanio.pdf<br />
138
DAVIES, A., u. E. WILSON (1974):<br />
The persistence of seminal constituents in the human vagina.<br />
Forensic Sci. 3: 45-55<br />
DAVIES, D. C., G. HALL, K. G. HIBBITT, H. D. MOORE (1975):<br />
The removal of the seminal vesicles from the boar and the effects on the semen<br />
characteristics.<br />
J. Reprod. Fertil. 43: 305-312.<br />
DE ZIEGLER, D., C. BULLETTI, B. DE MONSTIER, A.-S. JÄÄSKELAINEN (1997):<br />
The first uterine pass effect.<br />
Ann. New York Acad. Sci. 291-299<br />
DEGUILLAUME, L., A. GEFFRÉ, L. DESQUILBET, A. DIZIEN, S. THOUMIRE,<br />
C. VORNIÈRE, F. CONSTANT, R. FOURNIER, S. CHASTANT-MAILLARD (<strong>2012</strong>):<br />
Effect of endocervical inflammation on days to conception in dairy cows.<br />
J. Dairy Sci. 95: 1776-1783<br />
DOBROWOLSKI, W., u. E. S. E. HAFEZ (1970):<br />
Transport and distribution of spermatozoa in the reproductive tract of the cow.<br />
J. Anim. Sci. 31: 940-943<br />
DOBSON, H., S. L. WALKER, M. J. MORRIS, J. E. ROUTLY, R. F. SMITH (2008):<br />
Why is it getting more difficult to successfully artificially inseminate dairy cows?<br />
Animal 2: 1104-1111<br />
DÖCKE, F. (1962):<br />
Untersuchungen zur Uteruskontraktilität beim Rind.<br />
Habilitation, Universität Berlin 1962<br />
Sonderdruck aus Archiv für Experimentelle Veterinärmedizin<br />
S. Hirzel Verlag, Leipzig, Bd. XVI, H. 6/62<br />
EULER, U. S. (1936):<br />
On the specific vaso-dilating and plain muscle stimulating substances from accessory genital<br />
glands in man and certain animals (prostaglandin and vesiglandin).<br />
J. Physiol. Lond. 88: 213.<br />
FONSECA, F. A., J. H. BRITT, B. T. Mc DANIEL, J. C. WILK, A. H. RAKES (1983):<br />
Reproductive traits of Holsteins and Jerseys. Effects of age, milk yield, and clinical<br />
abnormalities on involution of cervix and uterus, ovulation, estrous cycles, detection of estrus,<br />
conception rate, and days open.<br />
J. Dairy Sci. 66: 1128-1147<br />
GALLUP, G. G. Jr., R. L. BURCH, S. M. PLATEK (2002):<br />
Does semen have antidepressant properties?<br />
Arch. Sex. Behav.31: 289-293<br />
139
GANGNUSS, S., M. L. SUTTON-MC DOWALL, S. A. ROBERTSON, D. T.<br />
ARMSTRONG (2004):<br />
Seminal plasma regulates corpora lutea macrophage populations during early pregnancy in<br />
mice.<br />
Biol. Reprod.71: 1135-1141<br />
GARNER, D. L., C. A. THOMAS, C. G. GRAVANCE, C. E. MARSHALL, J. M. DE<br />
JARNETTE, C. H. ALLEN (2001):<br />
Seminal plasma addition attenuates the dilution effect in bovine sperm.<br />
Theriogenology 56: 31-40<br />
GASSE, H. (1999):<br />
Akzessorische Geschlechtsdrüsen. Männliche Geschlechtsorgane Rind<br />
in: R. NICKEL, A. SCHUMMER, E. SEIFERLE (Hrsg.) Lehrbuch der Anatomie der<br />
Haustiere. Band 2 Eingeweide, 8. Auflage.<br />
Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin-Wien, S.352, 373<br />
GILBERT, R. O., u. M. H. FALES (1996):<br />
The effect of bovine seminal plasma on the function and integrity of bovine neutrophils.<br />
Theriogenology 46: 649-658<br />
GILBERT, R. O., S. T. SHIN, M. FRAJBLAT, C. L. GUARD, H. N. ERB, H. ROMAN<br />
(2004):<br />
The incidence of endometritis and its effect on reproductive performance of dairy cows.<br />
In: Proc. 12 th Int. Conf. Prof. Dis. Farm Anim. 12: 30<br />
GILBERT, R. O., S. T. SHIN, C. L. GUARD, H. N. ERB, M. FRAJBLAT (2005):<br />
Prevalence of endometritis and ist effects on reproductive performance of dairy cows.<br />
Theriogenology 64: 1879-1888<br />
GILLOT, C. (2003):<br />
Male accessory gland secretions: modulators of female reproductive physiology and<br />
behaviour.<br />
Ann. Rev. Entomol. 48: 163-184<br />
GILLOT, C. u. T. FRIEDEL (1977):<br />
Fecundity-enhancing and receptivity-inhibiting substances produced by male insects: a<br />
review.<br />
Adv. Invertebr. Reprod. 1: 199-218<br />
GINTHER, O. J. (1974):<br />
Internal regulation of physiological processes through local venoarterial pathways: a review.<br />
J. Anim. Sci. 39: 550-564<br />
GRUNERT, E. u. M. BERCHTOLD (1999):<br />
Fertilitätsstörungen beim weiblichen Rind. 3. Auflage<br />
Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin-Wien<br />
140
GRUNERT, E. u. E. BLESENKEMPER (1980):<br />
Untersuchungen über die mögliche Beeinflussung der Zwischenkalbezeit bei Rindern der<br />
Rasse „Deutsche Schwarzbunte“.<br />
Reprod. Dom. Anim. 15: 162-172<br />
GUTSCHE, S., M. VON WOLFF, T. STROWITZKI, C. J. THALER (2003):<br />
Seminal plasma induces mRNA expression of IL-1ß, IL-6 and LIF in endometrial epithelial<br />
cells in vitro.<br />
Molecular Human Reproduction 9: 785-791<br />
HAIMOVICI, F., u. D. J. ANDERSON (1995):<br />
Detection of semen in cervicovaginal secretions.<br />
Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes and Human Retrovirology 8: 236-238<br />
HAMMON, D. S., I. M. EVJEN, T. R. DHIMAN, J. P. GOFF, J. L. WALTERS (2006):<br />
Neutrophil function and energy status in Holstein cows with uterine health disorders.<br />
Vet. Immunol.Immunpathol.113: 21-29<br />
HAWK, H. W. (1983):<br />
Sperm survival and transport in the female reproductive tract.<br />
J. Dairy Sci. 66: 2645-2660<br />
HESSA, E. A., T. M. LUDWICKA, R. C. MARTIGA, F. ELYA (1960):<br />
Influence of seminal vesiculectomy on certain physical and biochemical properties of bovine<br />
semen.<br />
J. Dairy Sci. 43: 256-265<br />
ITURRALDE, M., u. P. F. VENTER (1981):<br />
Hysterosalpingo-radionuclide scintigraphy (HERS).<br />
Seminars in Nuclear Medicine 11: 301-314<br />
JACOBSEN, J. M., G. V. HANKINS, R. L. YOUNG, J. C. HAUTH (1984):<br />
Changes in thyroid function and serum iodine levels after pre-partum use of a povidoneiodine<br />
vaginal lubricant.<br />
J. Reprod. Med. 29: 98-100<br />
JAMES, K., u. T. B. HARGREAVE (1984):<br />
Immunosuppression by seminal plasma and its possible clinical significance.<br />
Immunol. Today 5: 357-363<br />
JOHANSSON, M., J. J. BROMFIELD, M. J. JASPER, S. A. ROBERTSON (2004):<br />
Semen activates the female immune response during early pregnancy in mice.<br />
Immunology 112: 290-300<br />
141
JOHNSTON, S. D., P. O´CALLAGHAN, K. NILSSON, G. TZIPORI, J. D. CURLEWIS<br />
(2004):<br />
Semen-induced luteal phase and identification of a LH surge in the koala (Phascolarctos<br />
cinereus).<br />
Reproduction 128: 629-634<br />
KASIMANICKAM, R., T. F. DUFFIELD, R. A. FOSTER, C. J. GARTLEY, K. E. LESLIE,<br />
J. S. WALTON, W. H. JOHNSON (2004):<br />
Endometrial cytology and ultrasonography for the detection of subclinical endometritis in<br />
postpartum dairy cows.<br />
Theriogenology 62 :9-23<br />
KATILA, T. (1996):<br />
Uterine defense mechanisms in the mare.<br />
Anim. Reprod.Sci.42: 197-204<br />
KATILA, T., S. SANKARI, O. MÄKELÄ (1998):<br />
Transport of spermatozoa in the mare´s genital tract studied by a scintigraphic method.<br />
Proc. Soc. Theriogenology 173-174<br />
KATILA, T., S. SANKARI, O. MÄKELÄ (2000):<br />
Transport of spermatozoa in the reproductive tracts of mares.<br />
J. Reprod. Fertil. Suppl. 56: 571-578<br />
KAUFMANN, T. B., M. DRILLICH, B.-A. TENHAGEN, D. FORDERUNG, W.<br />
HEUWIESER (20<strong>09</strong>):<br />
Prevalence of bovine subclinical endometritis 4 h after insemination and its effects on first<br />
service conception rate.<br />
Theriogenology 71: 385-391<br />
KELLER, P. J., R. RIEDMANN, M. FISCHER, C. GERBER (1981):<br />
Oestrogens, gonadotropins and prolactin after intra-vaginal administration of oestriol in postmenopausal<br />
women.<br />
Maturitas 3: 47-53<br />
KÖLLMANN, M. (2004):<br />
Ultrasonographischer Vergleich der uterinen Kontraktionsaktivität bei der Stute nach<br />
Insemination in den Uteruskörper oder auf die Eileiterpapille.<br />
<strong>Diss</strong>ertation, <strong>Tierärztliche</strong> Hochschule Hannover, 2004<br />
KOTWICA, J., G. L. WILLIAMS, M. J. MARCHELLO (1982):<br />
Countercurrent transfer of testosterone by the ovarian vascular pedicle of the cow:<br />
relationship to follicular steroidogenesis.<br />
Biol. Reprod. 27: 778-789<br />
142
KÜST, D. u. F. SCHAETZ (1983):<br />
Fortpflanzungsstörungen bei der Ziege.<br />
Fortpflanzungsstörungen bei den Haustieren. 6. Auflage<br />
Enke Verlag, Stuttgart, S. 350<br />
KRZYMOWSKI, T., J. KOTWICA, S. STEFANCZYK (1981):<br />
Venous-arterial counter-current transfer of [ 3 H] testosterone in the vascular pedicle of the sow<br />
ovary.<br />
J. Reprod. Fertil. 61: 317-323<br />
KUNZ, G., D. BEIL, H. DEININGER, L. WILDT, G. (1996):<br />
The dynamics of rapid sperm transport through the female genital tract: Evidence from<br />
vaginal sonography of uterine peristalsis and hysterosalpingoscintigraphy.<br />
Human Reproduction 11: 627-632<br />
LE BLANC, S. J., T. F. DUFFIELD, K. E. LESLIE, K. G. BATEMAN, G. P. KEEFE, J. S.<br />
WALTON, W. H. JOHNSON (2002):<br />
Defining and diagnosing postpartum clinical endometritis and its impact on reproductive<br />
performance in dairy cows.<br />
J. Dairy Sci. 85: 2223-2236<br />
LE BLANC, M. M., L. NEUWIRTH, L. JONES, C. CAGE, D. MAURAGIS (1998):<br />
Differences in uterine position of reproductively normal mares and those with delayed uterine<br />
clearance detected by scintigraphy.<br />
Theriogenology 50: 49-54<br />
LEIDING, C. (2007):<br />
Spermaverarbeitung und -konservierung.<br />
in: W. BUSCH u. D. WABERSKI (Hrsg.) Künstliche Besamung bei Haus- und Nutztieren.<br />
Schattauer GmbH, Stuttgart, New York, S. 156<br />
LEISER, R. (1999):<br />
Weibliche Geschlechtsorgane Rind.<br />
in: R. NICKEL, A. SCHUMMER, E. SEIFERLE (Hrsg.) Lehrbuch der Anatomie der<br />
Haustiere. Band 2: Eingeweide, 8. Auflage.<br />
Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin-Wien, S. 428<br />
LEYENDECKER, G., G. KUNZ, L. WILDT, D. BEIL, H. DEININGER (1996):<br />
Uterine hyperperistalsis and dysperistalsis as dysfunctions of the mechanisms of rapid sperm<br />
transport in patients with endometriosis and infertility.<br />
Human Reproduction 11: 1542-1551<br />
LI, X. L., Y. ZHANG, B. X. CHEN, X. X. ZHAO (2002):<br />
The concentrations of LH, FSH, oestradiol-17beta and progesterone in the blood plasma of<br />
the female Bactrian Camel (Camelus bactrianus) before and after intramuskular injection of<br />
seminal plasma.<br />
Vet. Res. Commun. 26: 571-576<br />
143
LIEBICH, H.-G. (2004):<br />
Weibliches Genitale<br />
in: H.-G. LIEBICH (Hrsg.) Funktionelle Histologie der Haussäugetiere. 4.Auflage.<br />
Schattauer GmbH Stuttgart, New York, S. 293-3<strong>09</strong><br />
LINCKE, A. (2006):<br />
Untersuchung zur Behandlung von subklinischen Endometritiden des Milchrindes mit<br />
proteolytischen Enzymen oder Prostaglandin PGF2alpha.<br />
<strong>Diss</strong>ertation. Freie Universität Berlin<br />
LORD, E. M., G. F. SENSABAUGH, D. P. STITES (1977):<br />
Immunosuppressive activity of human seminal plasma I. Inhibition of in vitro lymphocyte<br />
activation.<br />
J. Immunol. 118: 1704-1711<br />
MANJUNATH, P., A. BERGERON, J. LEFEBVRE, J. FAN (2007):<br />
Seminal plasma proteins: functions and interaction with protective agents during semen<br />
preservation.<br />
Soc. Reprod.Fertil. Suppl. 65:217-228<br />
MANJUNATH, P., u. M. R. SAIRAM (1987):<br />
Purification and biochemical characterization of three major acidic proteins (BSP-A1, BSP-<br />
A2 and BSP-A3) from bovine seminal plasma.<br />
Biochem. J. <strong>24</strong>1: 685-692<br />
MANN, T. u. C. LUTWAK-MANN (1981):<br />
Male reproductive function and semen.Themes and trends in physiology, biochemistry and<br />
investigative andrology.<br />
Springer Verlag, Berlin<br />
MARION, G. D. (1950):<br />
The effect of sterile copulation on time of ovulation in dairy heifers.<br />
J. Dairy Sci. 33: 885-889<br />
McCRACKEN, J. A. (1980):<br />
Hormone receptor control of prostaglandin F secretion by the ovine uterus.<br />
Adv. Prostaglandin Thromboxane Res. 8: 1329-1344<br />
McQUEEN, D., J. H. McKILLOP, H. W. GRAY, M. CALLAGHAN, C. MONAGHAN, R.<br />
G. BESSENT (1993):<br />
Radionuclide migration through the genital tract in infertile women with endometriosis.<br />
Human Reproduction 8: 1910-1914<br />
MERTON, S. (2011):<br />
European statistical data of bovine embryo transfer activity 20<strong>09</strong>.<br />
in: RIZOS, D. (Hrsg.) European Embryo Transfer Association Newsletter<br />
AETE Newsletter 34: 1, S. 11-13<br />
144
MILES, R. A., R. J. PAULSON, R. A. LOBO, M. F. PRESS, L. DAHMOUSH, M. V.<br />
SAUER (1994):<br />
Pharmacokinetics and endometrial tissue levels of progesterone after administration by<br />
intramuscular and vaginal routes: A comparative study.<br />
Fertil.Steril.62: 485-490<br />
MIZUTANI, T., S. NISHIYAMA, I. AMAKAWA, A. WATANABE, K. NAKAMURO, N.<br />
TERADA (1995):<br />
Danazol concentrations in ovary, uterus and serum and their effect on the hypothalamicpituitary-ovarian<br />
axis during vaginal administration of a danazol suppository.<br />
Fertil.Steril.63: 1184-1189<br />
NEUWIRTH, L., M. M. LE BLANC, D. MAURAGIS, E. KLAPSTEIN, T. TRAN (1995):<br />
Scintigraphic measurement of uterine clearance in mares.<br />
Vet. Radiol. Ultrasound 36: 64-68<br />
NEY, P. G. (1986):<br />
The intravaginal absorption of male generated hormones and their possible effect on female<br />
behaviour.<br />
Med. Hypotheses 20: 221-231<br />
NICKEL, R., A. SCHUMMER, E. SEIFERLE (1996):<br />
Eingeweidearterien der A. iliaca interna. Lymphknoten und Lymphsammelgänge des Rindes.<br />
in: K.-H. HABERMEHL, B. VOLLMERHAUS, H. WILKENS, H. WAIBL (Hrsg.) Lehrbuch<br />
der Anatomie der Haustiere. Band 3: Kreislaufsystem, Haut und Hautorgane, 3. Auflage.<br />
Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin-Wien, S. 182-189, 405-408<br />
NICKEL, R., A. SCHUMMER, E. SEIFERLE (1999):<br />
Harn- und Geschlechtsorgane im Bereich des Beckenbodens eines Bullen. Weibliche<br />
Geschlechtsorgane eines Rindes. Cervix uteri der Ziege.<br />
in: R. NICKEL, A. SCHUMMER, E. SEIFERLE (Hrsg.) Lehrbuch der Anatomie der<br />
Haustiere.Band 2: Eingeweide, 8. Auflage.<br />
Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin-Wien, S. 376, 426, 429<br />
ODDE, K. G. (1990):<br />
A review of synchronization of estrus in postpartum cattle.<br />
J. Anim. Sci. 68: 817-830<br />
ODHIAMBO, J. F., D. H. POOLE, L. HUGHES, J. M. DE JARNETTE, E. K. INSKEEP, R.<br />
A. DAILEY (20<strong>09</strong>):<br />
Pregnancy outcome in dairy and beef cattle after artificial insemination and treatment with<br />
seminal plasma or transforming growth factor beta-1.<br />
Theriogenology 72: 566-571<br />
145
OKADA, H., I. YAMAZAKI, Y. OGAWA, S. HIRAI, T. YASHIKI, H. MIMA (1982):<br />
Vaginal absorption of a potent luteinizing hormone-releasing hormone analogue (leuprolide)<br />
in rats I: Absorption by various routes and absorption enhancement.<br />
J. Pharm. Sci. 71: 1367-1371<br />
OKADA, H., I. YAMAZAKI, T. YASHIKI, H. MIMA (1983):<br />
Vaginal absorption of a potent luteinizing hormone-releasing hormone analogue (leuprolide)<br />
in rats II: Mechanism of absorption enhancement with organic acids.<br />
J. Pharm. Sci. 72: 75-78<br />
O´LEARY, S., M. J. JASPER, S. A. ROBERTSON, D. T. ARMSTRONG (2006):<br />
Seminal plasma regulates ovarian progesterone production, leukocyte recruitment and<br />
follicular cell responses in the pig.<br />
Reproduction 132: 147-158<br />
O´LEARY, S., M. J. JASPER, G. M. WARNES, D. T. ARMSTRONG, S. A. ROBERTSON<br />
(2004):<br />
Seminal plasma regulates endometrial cytokine expression, leukocyte recruitment and embryo<br />
development in the pig.<br />
Reproduction 128: 237-<strong>24</strong>7<br />
ÖZGÜR, K., A. YILDIZ, M. UNER, M. ERKILIC, B. TRAK, O. ERMAN (1997):<br />
Radionuclide hysterosalpingography with radiolabeled spermatozoa.<br />
Fertil. Steril. 67: 751-755<br />
PANSEGRAU, U., S. MEINECKE-TILLMANN, J.-H. SWAGEMAKERS, B. MEINECKE<br />
(2008):<br />
Effect of oxytocin and seminal plasma treatment on uterine contractile activity and pregnancy<br />
rates in subfertile mares.<br />
Pferdeheilkunde <strong>24</strong>: 227-235<br />
PAOLICCHI, F., B. URQUIETA, L. DEL VALLE, E. BUSTOS-OBREGÓN (1999):<br />
Biological activity of the seminal plasma of alpacas: stimulus for the production of LH by<br />
pituitary cells.<br />
Anim. Reprod. Sci. 54: 203-210<br />
PEITZ, B., u. P. OLDS-CLARKE (1986):<br />
Effects of seminal vesicle removal on fertility and uterine sperm motility in the house mouse.<br />
Biol. Reprod.35: 608-617<br />
PORTUS, B. J., T. REILAS, T. KATILA (2005):<br />
Effect of seminal plasma on uterine inflammation, contractility and pregnancy rates in<br />
mares.Equine Vet. J. 37: 515-519<br />
146
PUSHPAKUMARA, P. G. A., N. H. GARDNER, C. K. REYNOLDS, D. E. BEEVER, D. C.<br />
WATHES (2003):<br />
Relationships between transition period diet, metabolic parameters and fertility in lactating<br />
dairy cows.<br />
Theriog.60: 1165-1185<br />
QASIM, S. M., A. TRIAS, M. KARACAN, R. SHELDEN, E. KEMMANN (1996):<br />
Does the absence or presence of seminal fluid matter in patients undergoing ovulation<br />
induction with intrauterine insemination?<br />
Human Reprod.11: 1008-1010<br />
QUAYLE, A. J., S. SZYMANIEC, T. B. HARGREAVE, K. JAMES (1987):<br />
Studies on the immunosuppressive effect of seminal plasma.<br />
British Journal of Urology 60: 578-582<br />
QUEEN, K., C. B. DHABUWALA, C. G. PIERREPOINT (1981):<br />
The effect of the removal of the various accessory glands on the fertility of male rats.<br />
J. Reprod. Fertil.62: 423-426<br />
RAAB, D. (2004):<br />
Evaluierung der Cytobrush-Methode zur Diagnostik von subklinischen Endometritiden und<br />
Auswirkungen der Entzündung auf die folgende Fruchtbarkeitsleistung von Milchkühen.<br />
<strong>Diss</strong>ertation. Universität Berlin 2004<br />
RATTO, M. H., W. HUANCA, J. SINGH, G. P. ADAMS (2006):<br />
Comparison of the effect of ovulation-inducing factor (OIF) in the seminal plasma of llamas,<br />
alpacas, and bulls.<br />
Theriogenology 66: 1102-1106<br />
RENEAU, J. K., A. J. SEYKORA, B. J. HEINS, M. I. ENDRES, R. J. FARNSWORTH, R. F.<br />
BEY (2005):<br />
Association between hygiene scores and somatic cell scores in dairy cattle.<br />
JAVMA 227: 1297-1301<br />
RICHARDSON, J. L., J. WHETSTONE, A. N. FISHER, P. WATTS, N. F. FARRAJ, M.<br />
HINCHCLIFFE, L. BENEDETTI, L. ILLUM (1996):<br />
Gamma-scintigraphy as a novel method to study the distribution and retention of a<br />
bioadhesive vaginal delivery system in sheep.<br />
Journal of Controlled Release 42: 133-142<br />
ROBERTSON, S. A. (2005):<br />
Seminal plasma and male factor signalling in the female reproductive tract.<br />
Cell Tissue Res. 322: 43-52<br />
ROBERTSON, S. A. (2007):<br />
Seminal fluid signalling in the female reproductive tract: Lessons from rodents and pigs.<br />
J. Anim. Sci. 85: 36-44<br />
147
ROBERTSON, S. A., J. J. BROMFIELD, K. P. TREMELLEN (2003):<br />
Seminal "priming" for protection from pre-eclampsia - a unifying hypothesis.<br />
J. Reprod. Immun. 59: 253-265<br />
ROBERTSON, S. A., L. R. GUERIN, J. J. BROMFIELD, K. M. BRANSON, A. C.<br />
AHLSTRÖM, A. S. CARE (20<strong>09</strong>):<br />
Seminal fluid drives expansion of the CD4+ CD25+ T regulatory cell pool and induces<br />
tolerance to paternal alloantigens in mice.<br />
Biol. Reprod.80: 1036-1045<br />
ROBERTSON, S. A., V. J. MAU, S. A. HUDSON, K. P. TREMELLEN (1997):<br />
Cytokine-leucokyte networks and the establishment of pregnancy.<br />
Am. J. Reprod. Immunol.37: 438-442<br />
ROBERTSON, S. A. u. D. J. SHARKEY (2001):<br />
The role of semen in induction of maternal immune tolerance to pregnancy.<br />
Seminars in Immunology 13: <strong>24</strong>3-254<br />
RODGER, J. C. (1975):<br />
Seminal plasma, an unnecessary evil?<br />
Theriogenology 3: 237-<strong>24</strong>7<br />
RODRIGUEZ-MARTINEZ, H., U. KVIST, J. ERNERUDH, L. SANZ, J. J. CALVETE<br />
(2011):<br />
Seminal plasma proteins: What role do they play?<br />
Am. J. Reprod. Immun. 66 (Suppl 1) 11-22<br />
ROLDAN, E. R., M. GOMENDIO, A. D. VITULLO (1992):<br />
The evolution of eutherian spermatozoa and underlying selective forces: female selection and<br />
sperm competition.<br />
Biol. Rev. Camb. Philos. Soc. 67: 551-593<br />
ROZEBOOM, K. J., M. H. TROEDSSON, H. H. HODSON, G. C. SHURSON, B. G.<br />
CRABO (2000):<br />
The importance of seminal plasma on the fertility of subsequent artificial inseminations in<br />
swine.<br />
J. Anim. Sci. 78: 443-448<br />
ROZEBOOM, K. J., G. ROCHA-CHAVEZ, M. H. T. TROEDSSON (2001):<br />
Inhibition of neutrophil chemotaxis by pig seminal plasma in vitro: a potential method for<br />
modulating post-breeding inflammation in sows.<br />
Reproduction 121: 567-572<br />
SANTOS, N. R., G. C. LAMB, D. R. BROWN, R. O. GILBERT (20<strong>09</strong>):<br />
Postpartum endometrial cytology in beef cows.<br />
Theriogenology 71: 739-745<br />
148
SCHMIDT, D. (2000):<br />
Bullensperma. Seminalplasma.<br />
in: E. WIESNER u. R. RIBBECK (Hrsg.) Lexikon der Veterinärmedizin.<br />
4. Auflage; Enke im Hippokrates Verlag, Stuttgart, S. 225, 1327<br />
SCHRAMM, W., N. EINER-JENSEN, G. SCHRAMM, J. A. McCRACKEN (1986):<br />
Local exchange of oxytocin from the ovarian vein to the ovarian arteries in the sheep.<br />
Biol. Reprod. 34: 671-680<br />
SCHULT, J. (20<strong>09</strong>):<br />
Untersuchungen zum Einfluss der Zervizitis auf die Fruchtbarkeitsleistung von Milchkühen.<br />
<strong>Diss</strong>ertation, <strong>Tierärztliche</strong> Hochschule Hannover, 20<strong>09</strong><br />
SENOSY, W. S., M. UCHIZA, N. TAMEOKA, Y. IZAIKE, T. OSAWA (20<strong>09</strong>):<br />
Association between evaluation of the reproductive tract by various diagnostic tests and<br />
restoration of ovarian cyclicity in high-producing dairy cows.<br />
Theriogenology 72: 1153-1162<br />
SHAH, B. A., M. L. HOPWOOD, L. C. FAULKNER (1968):<br />
Seminal vesiculectomy in bulls. 1. Seminal biochemnistry.<br />
J. Reprod. Fertil.16: 171-177<br />
SHELDON, I. M., J. CRONIN, L. GOETZE, G. DONOFRIO, H.-J. SCHUBERTH (20<strong>09</strong>):<br />
Defining postpartum uterine disease and the mechanisms of infection and immunity in the<br />
female reproductive tract in cattle.<br />
Biol. Reprod.81: 1025-1032<br />
SHELDON, I. M., G. S. LEWIS, S. LE BLANC, R. O. GILBERT (2006):<br />
Defining postpartum uterine disease in cattle.<br />
Theriogenology 65: 1516-1530<br />
SILVERMAN, E. M., u. A. G. SILVERMAN (1978):<br />
Persistence of spermatozoa in the lower genital tracts of women.<br />
JAMA <strong>24</strong>0: 17<br />
SINNEMAA, L., T. JÄRVIMAA, N. LEHMONEN, O. MÄKELÄ, T. REILAS, S.<br />
SANKARI, T. KATILA (2005):<br />
Effect of insemination volume on uterine contractions and inflammatory response and on<br />
elimination of semen in the mare uterus - scintigraphic and ultrasonographic studies.<br />
J. Vet. Med. 52: 466-471<br />
SJÖBLOM, C., M. WIKLAND, S. A. ROBERTSON (1999):<br />
Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor promotes human blastocyst development<br />
in vitro.<br />
Human Reproduction 14: 3069-3076<br />
149
SPRECHER, D. J., D. E. HOSTETLER, J. B. KANEENE (1997):<br />
A lameness scoring system that uses posture and gait to predict dairy cattle reproductive<br />
performance.<br />
Theriogenology 47: 1179-1187<br />
STAUFENBIEL, R. (2005):<br />
Konzeptionsergebnisse von Rindern in Betrieben mit Jahresmilchleistungen von über<br />
10.000 kg Milch pro Jahr.<br />
in: W. BUSCH u. D. WABERSKI (Hrsg.) Künstliche Besamung bei Haus- und Nutztieren.<br />
Schattauer GmbH, Stuttgart 2007, S. 190<br />
STECK, T., W. BECKER, P. ALBERT, W. BÖRNER (1989a):<br />
Hystero-Salpingo-Szintigraphie (HSS): Eine Methode zur Untersuchung der Passage durch<br />
die weiblichen genitalen Wege.<br />
Archives of Gynecology and Obstetrics <strong>24</strong>5: 1-4<br />
STECK, T., W. BECKER, P. ALBERT, W. BÖRNER, W. WÜRFEL (1989b):<br />
Erste Erfahrungen mit der Hysterosalpingoszintigraphie (HSS) bei normaler und<br />
pathologischer Tubenpassage.<br />
Geburts- u. Frauenheilk. 49: 889-893<br />
STRZEMIENSKI, P. J. (1989):<br />
Effect of bovine seminal plasma on neutrophil phagocytosis of bull spermatozoa.<br />
J. Reprod. Fertil.87: 519-528<br />
TANCO, V. M. (2008):<br />
Biological characterization of ovulation-inducing factor (OIF) in llama seminal<br />
plasma.Thesis, University of Saskatchewan, Canada, 2008<br />
TIERSCHUTZGESETZ (2006):<br />
§ 6 des Tierschutzgesetzes der Bundesrepublik Deutschland<br />
Fassung vom 18.05.2006 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert <strong>09</strong>.12.2010 (BGBl. I S. 1934)<br />
TÖPFER-PETERSEN, E. (2007):<br />
Spermienreifung, Transport und Befruchtung.<br />
in: W. BUSCH u. D. WABERSKI (Hrsg.) Künstliche Besamung bei Haus- und Nutztieren.<br />
Schattauer GmbH, Stuttgart, S. 88<br />
TREMELLEN, K.P., SEAMARK, R.F., ROBERTSON, S.A. (1998):<br />
Seminal transforming growth factor ß1 stimulates granulocyte-macrophage colony-stimulating<br />
factor production and inflammatory cell recruitment in the murine uterus.<br />
Biol. Reprod.58: 1217-1225<br />
TREMELLEN, K. P., D. VALBUENA, J. LANDERAS, A. BALLESTEROS, J.<br />
MARTINEZ, S. MENDOZA, R. J. NORMAN, S. A. ROBERTSON, C. SIMÓN (2000):<br />
The effect of intercourse on pregnancy rates during assisted human reproduction.<br />
Human Reproduction 15: 2653-2658<br />
150
TROEDSSON, M. H. T., C. S. LEE, R. FRANKLIN, B. G. CRABO (2000):<br />
Post-breeding uterine inflammation: the role of seminal plasma.<br />
J. Reprod. Fertil. Suppl. 56: 341-349<br />
TROEDSSON, M. H. T., K. LOSET, A. M. ALGHAMDI, B. DAHMS, B. G. CRABO<br />
(2001):<br />
Interaction between equine semen and the endometrium: the inflammatory response to semen.<br />
Anim. Reprod. Sci. 68: 273-278<br />
TUNON, A.-M., T. KATILA, U. MAGNUSSON, A. NUMMIJÄRVI, H. RODRIGUEZ-<br />
MARTINEZ (2000):<br />
T-Cell distribution in two different segments of the equine endometrium 6 and 48 hours after<br />
insemination.<br />
Theriogenology 54: 835-841<br />
VAN DEMARK, N. L., u. R. L. HAYS (1952):<br />
Uterine motility responses to mating.<br />
Am. J. Physiol. 170: 518-521<br />
VENTURA, W. P. (1969):<br />
An in-vitro investigation of the effects of rat semen and male accessory gland secretions on<br />
the motility of the rat female tract.<br />
PhD thesis, New York Medical College, New York, 1969<br />
VENTURA, W. P., u. M. FREUND (1973):<br />
Evidence for a new class of uterine stimulants in rat semen and male accessory gland<br />
secretions.<br />
J. Reprod. Fertil.33: 507-511<br />
VERBERCKMOES, S., A. VAN SOOM, J. DEWULF, M. THYS, A. DE KRUIF (2005):<br />
Low dose insemination in cattle with the Ghent device.<br />
Theriogenology 64: 1716-1728<br />
VOLLMERHAUS, B. (1996):<br />
Lymphknoten und Lymphsammelgänge des Rindes.<br />
in: K.-H. HABERMEHL, B. VOLLMERHAUS, H. WILKENS, H. WAIBL (Hrsg.) Lehrbuch<br />
der Anatomie der Haustiere. Band 3: Kreislaufsystem, Haut und Hautorgane, 3. Auflage.<br />
Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin-Wien, S. 391-410<br />
WABERSKI, D. (2007):<br />
Spermien und Seminalplasma.<br />
in: W. BUSCH u. D. WABERSKI (Hrsg.) Künstliche Besamung bei Haus- und Nutztieren.<br />
Schattauer GmbH, Stuttgart, New York, S. 82<br />
151
WABERSKI, D., R. CLAASSEN, T. HAHN, P. W. JUNGBLUT, N. PARVIZI, E.<br />
KALLWEIT, K. F. WEITZE (1997):<br />
LH profile and advancement of ovulation after transcervical infusion of seminal plasma at<br />
different stages of oestrus in gilts.<br />
J. Reprod. Fertil. 1<strong>09</strong>: 29-34<br />
WABERSKI, D., H. SUDHOFF, T. HAHN, P. W. JUNGBLUT, E. KALLWEIT, J. J.<br />
CALVETE, M. ENSSLIN, H. O. HOPPEN, N. WINTERGALEN, K. F. WEITZE (1995):<br />
Advanced ovulation in gilts by the intrauterine application of a low molecular mass pronasesensitive<br />
fraction of boar seminal plasma.<br />
J. Reprod. Fertil.105: <strong>24</strong>7-252<br />
WAELCHLI, R. O., L. CORBOZ, N. C. WINDER (1987):<br />
Effect of intrauterin plasma infusion in the mare: Histological, bacteriological and cytological<br />
findings.<br />
Theriogenology 28: 861-869<br />
WAIBL, H. u. H. WILKENS (1996):<br />
Eingeweidearterien der A. iliaca interna.<br />
in: Lehrbuch der Anatomie der Haustiere. Band 3: Kreislaufsystem, Haut und Hautorgane, 3.<br />
Auflage.<br />
Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin-Wien, S. 182-189<br />
WEHREND, A., K. TRASCH, K. FAILING, H. BOSTEDT (2003):<br />
Untersuchungen zum regionalen pH-Wert in Vagina, Zervix und Uterus von Kühen im<br />
Interöstrus.<br />
Dtsch. tierärztl. Wochenschrift 110: 65-68<br />
WEHRLE, H. (2000):<br />
Überprüfung von Proteinen aus bovinem Seminalplasma und der Spermienmembran mit Hilfe<br />
der 2-D-Gelelektrophorese und ihre Beziehung zur Fruchtbarkeit.<br />
<strong>Diss</strong>ertation. Universität Berlin 2000<br />
WILDMAN, E. E., G. M. JONES, P. E. WAGNER, R. L. BOMAN, H. F. TROUTT, T. N.<br />
LESCH (1982):<br />
A dairy cow body condition scoring system and its relationship to selected production<br />
characteristics.<br />
J. Dairy Sci. 65: 495-501<br />
WILLOTT, G. M., u. J. E. ALLARD (1982):<br />
Spermatozoa - Their persistence after sexual intercourse.<br />
Forensic Sci. Internat. 19: 135-154<br />
WINTERHAGER, E. u. W. KÜHNEL (1985):<br />
Diffusion barriers in the vaginal epithelium during the estrous cycle in guinea pigs.<br />
Cell Tissue Res. <strong>24</strong>1: 325-31<br />
152
WOLFE, D. F., J. T. BRADLEY, M. G. RIDDELL (1993):<br />
Characterization of seminal plasma, proteins and sperm proteins in ejaculates from<br />
normospermic bulls and bulls with thermally-induced testicular degeneration.<br />
Theriogenology 40: 1083-1<strong>09</strong>1<br />
WOLFF, M., S. RÖSNER, C. THÖNE, R. M. PINHEIRO, J. JAUCKUS, T. BRUCKNER, V.<br />
BIOLCHI, A. ALIA, T. STROWITZKI (20<strong>09</strong>):<br />
Intravaginal and intracervical application of seminal plasma in in vitro fertilization or<br />
intracytoplasmic sperm injection treatment cycles - a double-blind placebo-controlled,<br />
randomized pilot study.<br />
Fertil. Steril. 91: 167-172<br />
WOLFNER, M. F. (2007):<br />
S.P.E.R.M. (Seminal Proteins are Essential Reproductive Modulators): the view from<br />
Drosophila.<br />
Soc. Reprod. Fertil. Suppl. 65: 183-199<br />
WRENZYCKI, C. u. H. NIEMANN (2007):<br />
Embryo-assoziierte Biotechniken.<br />
in: W. BUSCH u. D. WABERSKI (Hrsg.) Künstliche Besamung bei Haus- und Nutztieren.<br />
Schattauer GmbH, Stuttgart, S. 134<br />
YI, S.-X., u. C. GILLOTT (2000):<br />
Effects of tissue extracts on oviduct contraction in the migratory grasshopper, Melanoplus<br />
sanguinipes.<br />
J. Insect. Physiol. 46: 519-525<br />
ZEH, J. A., u. D. W. ZEH (2001):<br />
Reproductive mode and the genetic benefits of polyandry.<br />
Anim. Behav. 61: 1051-1063<br />
ZELFEL, S., u. U. MÜLLER (2007):<br />
Tierzüchterische und wirtschaftliche Bedeutung der Künstlichen Besamung.<br />
in: W. BUSCH u. D. WABERSKI (Hrsg.) Künstliche Besamung bei Haus- und Nutztieren.<br />
Schattauer GmbH, Stuttgart, S. 4<br />
ZEROBIN, K. u. H. BINDER (20<strong>09</strong>):<br />
Embryotransfer und assoziierte Techniken.<br />
in: W. BUSCH, J. SCHULZ, K. ZEROBIN (Hrsg.) Fruchtbarkeitskontrolle bei Groß- und<br />
Kleintieren, 1. Auflage.<br />
Enke Verlag Stuttgart 20<strong>09</strong>, S. 168<br />
153
9 DANKSAGUNG<br />
Meinen Eltern für die ideelle und finanzielle Unterstützung in allen Lebenslagen, für das beste<br />
Zuhause fernab der Arbeit und ihr großes Vertrauen in mich. Frau Prof. Dr. Dr. Meinecke-<br />
Tillmann für die Ideengebung zu den Studien, die Überlassung der Themen und der<br />
hilfreichen Kontakte. Den Stationstierärzten Hr. Hein Holzapfel, Hr. Dr. Helmut Melbaum,<br />
Hr. Dr. Jan Detterer und Hr. Dr. Heinrich Tenhumberg für die Unterstützung der Studien und<br />
die unkomplizierte und angenehme Zusammenarbeit. Den Besamungsbeauftragten Erich von<br />
der Heydt, Hermann Krämer, Richard Kaufmann, Matthias Diekamp, Tobias Lohe, Heiko<br />
Willms, Johann Kramer, Marco Teuchert und Xaver Ebenbeck für die Durchführung der KB-<br />
Studie, das stets freundliche Mitnehmen bei ihrer täglichen Arbeit und ihr eigenständiges<br />
Engagement. Den ET-Beauftragten Jörg Böning und Arnold Mittag sowie den Betrieben<br />
Gillessen und Hasbargen für die Durchführung und Mitarbeit an der ET-Studie. Den<br />
Mitarbeitern der Stationen RUW Fließem, WEU Haselünne, VOST Georgsheil und NBG<br />
Landshut für die freundliche Aufnahme und die entgegengebrachte Hilfsbereitschaft. Für<br />
zahlreiche Übernachtungen und ihre Gastfreundschaft während der Studiendurchführung den<br />
Familien Holzapfel und Melbaum, dem VOSt, der NBG, Katrin Ludlage und Birgit Brockers.<br />
Herr Dr. Jan-Hein Swagemakers und den Mitarbeitern der Klinik für Pferde in Lüsche für die<br />
Ermöglichung der Szintigraphien. Der <strong>Stiftung</strong> der Deutschen Wirtschaft für ihre langjährige<br />
Förderung meiner Person und Arbeit. Dem Förderverein Biotechnologieforschung e.V. für die<br />
Förderung der Projekte. Edita Podhajsky für ihre Betreuung und fröhlich-freundliche Art.<br />
Uma, der angenehmsten Bürokollegin und Mensatanzpartnerin, für Gespräche und asiatisches<br />
Catering in ungezählten Fällen. Kollege Alex für Spontanität und gute Gespräche. Petra,<br />
meiner Lieblingsnachbarin, für Köstlichkeiten, die Vermittlung der fröhlichen Fine sowie<br />
Leihgaben jeglicher Art. Meike und Susi für gute Laune, Frösche und Aktionen auf der Achse<br />
Hannover-Göttingen. Marco für seine Unterstützung und den herrlichen Arbeits-PC inklusive<br />
Einrichtung. Helen, eine von den Guten, für gemeinsame Bürotage und humorige Gespräche.<br />
Amelie für die „Golden Season“ 2010 und „Season d`Or“ 2011. Meinen Brüdern Malte und<br />
Simon für unsere schönen Familientage zu Hause und den guten Zusammenhalt.<br />
154
Teilergebnisse dieser Arbeit wurden bereits auf wissenschaftlichen Tagungen<br />
vorgestellt:<br />
SCHWERHOFF, M., H. HOLZAPFEL, H. MELBAUM, J. DETTERER, H.<br />
TENHUMBERG, S. MEINECKE-TILLMANN (2010):<br />
Pregnancy rates in cattle after intravaginal and intracervical administration of seminal plasma<br />
concurrently with artificial insemination.<br />
Reproduction in Domestic Animals 46, Supplement 1, S.39-40 (Abstract).<br />
44. Jahrestagung der Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, gleichzeitig 36.<br />
Veterinär-Humanmedizinische Gemeinschaftstagung, Hannover 16.-18. Februar 2011<br />
SCHWERHOFF, M., J. H. SWAGEMAKERS, S. MEINECKE-TILLMANN (2010):<br />
Distribution of radio-labelled seminal plasma in the genital tract of female goats.<br />
Reproduction in Domestic Animals 46, Supplement 1, S.40 (Abstract).<br />
44. Jahrestagung der Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, gleichzeitig 36.<br />
Veterinär-Humanmedizinische Gemeinschaftstagung, Hannover 16.-18. Februar 2011<br />
SCHWERHOFF, M., H. HOLZAPFEL, H. MELBAUM, J. DETTERER, S. MEINECKE-<br />
TILLMANN (2011):<br />
Pregnancy rates in cattle after intravaginal and intracervical administration of seminal plasma<br />
in embryo transfer recipients.<br />
A.E.T.E. 27: Suppl. S. 226 (Abstract).<br />
27 th Annual Meeting of the European Embryo Transfer Association, Chester 9.-10.September<br />
2011<br />
155






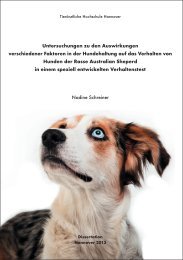



![Tmnsudation.] - TiHo Bibliothek elib](https://img.yumpu.com/23369022/1/174x260/tmnsudation-tiho-bibliothek-elib.jpg?quality=85)






