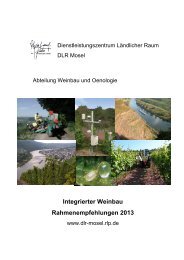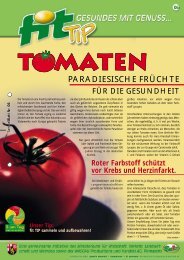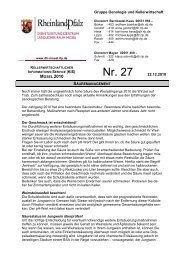Weinsteinstabilisierung notwendig? - (DLR) Mosel
Weinsteinstabilisierung notwendig? - (DLR) Mosel
Weinsteinstabilisierung notwendig? - (DLR) Mosel
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
und 16 °C: Der Wein ist instabil. Füllung mit<br />
Metaweinsäure ratsam.<br />
3. Weinsteinsättigungstemperatur zwischen<br />
16 und 20 °C: Der Wein ist bei normalem Kristallisationsverhalten<br />
sehr instabil.<br />
Trifft Punkt 1 zu, so erübrigt sich jede Maßnahme<br />
zur Stabilisierung. Weine ab einer Sättigungstemperatur<br />
von 12 °C aufwärts müssen<br />
nicht unbedingt instabil sein.<br />
Rotweine generell und Weißweine im Spätlese<br />
und Auslesebereich, bei denen die Kristallisation<br />
gehemmt ist, können auch bei diesen<br />
Temperaturen stabil sein. Es kann vorkommen,<br />
dass sogar bei<br />
Sättigungstemperaturen über 20 °C das Kontaktverfahren<br />
nicht zur Kristallbildung führt<br />
und scheinbar nicht zur Weinsteinstabilität.<br />
Das Prinzip<br />
Mit dieser Arbeit wird ein Kristallisationsfaktor<br />
vorgestellt. Dies ist ein Wert, der nunmehr<br />
eine zuverlässige Aussage zulässt, ob<br />
und wie der Wein behandelt werden muss,<br />
damit es auf der Flasche keine Kristallausscheidung<br />
gibt. Dabei wird die Ermittlung der<br />
Sättigungstemperatur mit dem Minikontaktverfahren<br />
kombiniert. Bisher war die technische<br />
Durchführung des Minikontaktverfahrens<br />
aufwändig, umständlich und nicht gerade<br />
billig, was die Gerätekombination betrifft.<br />
In dem hier beschriebenen Verfahren ist es<br />
möglich, mit einem Zeitaufwand von max. 2<br />
Stunden bei 10 Weinen sowohl die Sättigungstemperatur<br />
als auch das Kristallisationsverhalten<br />
(Kristallisationsfaktor) der zu<br />
untersuchenden Weine zu bestimmen. Die<br />
erforderliche Ausrüstung für die Bestimmung:<br />
• Krista-Test-Konduktometer<br />
• Regenzglasgestell für 10 Proben<br />
• 10 Reagenzgläser 50 ml Inhalt und 10 Reagenzgläser<br />
40 ml Inhalt<br />
• Weinstein<br />
• Verschließbare Plastikdose für 10 Reagenzgläser.<br />
Zur Bestimmung werden die Reagenzgläser<br />
mit ca. 45 ml Wein bei Raumtemperatur<br />
gefüllt. Die Anfangsleitfähigkeit wird<br />
bestimmt. Sodann werden 0,45 g Weinstein<br />
(2,5-fache der sonst üblichen Menge) abgewogen<br />
und zugegeben. Die Reagenzgläser<br />
werden verschlossen und 15 Minuten geschüttelt.<br />
Nach dem Absetzen des Weinsteins (nach<br />
15 Minuten) wird die Leitfähigkeit und die<br />
Temperatur notiert. (Wird die Messung sofort<br />
durchgeführt, so erhält man durch den in<br />
Schwebe befindlichen Weinstein etwas zu niedrige<br />
Leitfähigkeitswerte). Die Sättigungs-<br />
temperatur der Ausgangsprobe berechnet sich<br />
folgendermaßen:<br />
T(Sätt.) = Weintemperatur – (Leitfähigkeit<br />
nach Auflösung – Leitfähigkeit<br />
Ausgangswein) / 30<br />
Ohne den Weinstein abzutrennen werden<br />
die Reagenzgläser nach dem Notieren der<br />
Werte ca. 1 Stunde in eine Gefriertruhe<br />
gestellt. Der Vorteil des so gestalteten Verfahrens<br />
– Weinstein verbleibt nach dem Auflösen<br />
im Wein – ist, dass die Sättigungstemperaturen<br />
der zu untersuchenden Weine auf<br />
ca. 22 °C (Raumtemperatur) gebracht werden<br />
und somit vor dem Kristallisationsbeginn<br />
immer den gleichen Ausgangspunkt haben.<br />
Man kann so erkennen, welche Weine gut kristallisieren<br />
und welche gehemmt sind. Weine,<br />
die auf diesem Wege eine Sättigungstemperatur<br />
von 12 °C erreichen, enthalten wenig kristallisationshemmende<br />
Stoffe. Liegt die Leitfähigkeit<br />
des Weines nach Kristallisation über<br />
der Ausgangsleitfähigkeit, so besteht der Verdacht<br />
auf Metaweinsäurezusatz. Außerdem<br />
wird die Leitfähigkeit immer bei der gleichen<br />
Temperatur gemessen, was die Genauigkeit<br />
des Messverfahrens beträchtlich erhöht, weil<br />
der Temperaturkoeffizient nicht zum Tragen<br />
kommt.<br />
Die Weintemperatur sollte danach bei –5<br />
bis 0 °C liegen. Je nach Gefriertruhe ist die<br />
Standzeit zu ermitteln. Ist die Temperatur<br />
erreicht, so kommen die Gläser in die Plastikdose.<br />
Die Dose wird verschlossen und<br />
wiederum wird 15 Minuten geschüttelt. Die<br />
Temperatur der zu untersuchenden Proben<br />
sollte in dieser Zeit nicht über 4°C gestiegen<br />
sein. Nachdem die Zeit vorbei ist, kommen<br />
die Gläser in das Reagenzglasgestell zurück<br />
und werden über Nacht in einen Kühlschrank<br />
gestellt. Der Weinstein setzt sich ab und der<br />
klare Wein wird am nächsten Tag dekantiert<br />
und wieder auf Raumtemperatur (ca.<br />
22 °C) erwärmt und die Leitfähigkeit notiert.<br />
Bei Rotwein empfiehlt es sich, den kalten Wein<br />
zu filtrieren, weil es hier nicht möglich ist zu<br />
beurteilen, ob der Wein auch wirklich blank<br />
ist. Auch hier wird die Leitfähigkeit nach dem<br />
Erwärmen auf Raumtemperatur notiert. Die<br />
Sättigungstemperatur (ST) nach dem Kontaktverfahren<br />
(KV) berechnet sich wie folgt:<br />
ST nach KV = ST Ausgangswein – (LF Ausgangswein<br />
– LF nach KV) / 30<br />
Der Kristallisationsfaktor (KF) berechnet<br />
sich so:<br />
KF Wert = ST (Ausgangswein) – ST (nach<br />
Kristallisation)<br />
Der Deutsche Weinbau • 20.08.2004 • Nr. 16-17 23