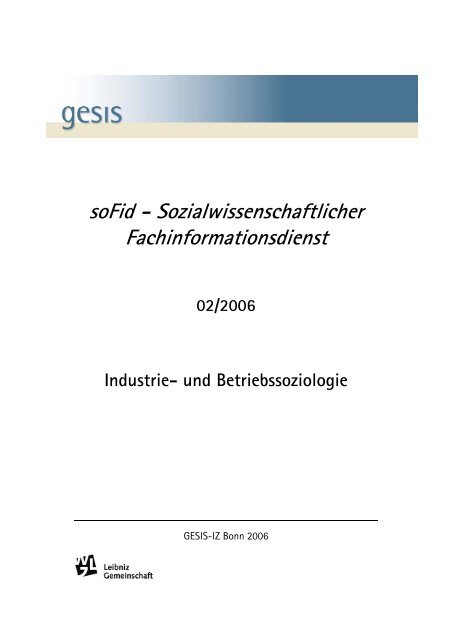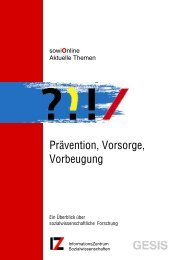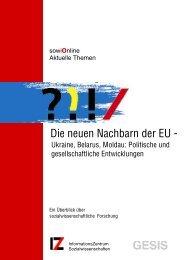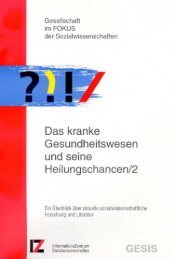Sozialwissenschaftlicher Fachinformationsdienst - soFid - Sowiport
Sozialwissenschaftlicher Fachinformationsdienst - soFid - Sowiport
Sozialwissenschaftlicher Fachinformationsdienst - soFid - Sowiport
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>soFid</strong> - <strong>Sozialwissenschaftlicher</strong><br />
<strong>Fachinformationsdienst</strong><br />
02/2006<br />
Industrie- und Betriebssoziologie<br />
GESIS-IZ Bonn 2006
<strong>Sozialwissenschaftlicher</strong> <strong>Fachinformationsdienst</strong><br />
<strong>soFid</strong>
Industrie- und Betriebssoziologie<br />
Band 2006/2<br />
bearbeitet von<br />
Wolfgang Mallock<br />
mit einem Beitrag von<br />
Ulrich Brinkmann, Institut für Soziologie,<br />
Lehrstuhl für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie,<br />
Friedrich-Schiller-Universität Jena<br />
Informationszentrum Sozialwissenschaften Bonn 2006
ISSN: 0176-4373<br />
Herausgeber Informationszentrum Sozialwissenschaften der Arbeitsgemeinschaft<br />
<strong>Sozialwissenschaftlicher</strong> Institute e.V., Bonn<br />
bearbeitet von: Wolfgang Mallock<br />
Programmierung: Udo Riege, Siegfried Schomisch<br />
Druck u. Vertrieb: Informationszentrum Sozialwissenschaften<br />
Lennéstr. 30, 53113 Bonn, Tel.: (0228)2281-0<br />
Printed in Germany<br />
Die Mittel für diese Veröffentlichung wurden im Rahmen der institutionellen Förderung der Gesellschaft<br />
<strong>Sozialwissenschaftlicher</strong> Infrastruktureinrichtungen e.V. (GESIS) vom Bund und den<br />
Ländern gemeinsam bereitgestellt. Das IZ ist Mitglied der Gesellschaft <strong>Sozialwissenschaftlicher</strong><br />
Infrastruktureinrichtungen e.V. (GESIS). Die GESIS ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft.<br />
© 2006 Informationszentrum Sozialwissenschaften, Bonn. Alle Rechte vorbehalten. Insbesondere<br />
ist die Überführung in maschinenlesbare Form sowie das Speichern in Informationssystemen, auch<br />
auszugsweise, nur mit schriftlicher Einwilligung des Herausgebers gestattet.
Inhalt<br />
Vorwort .............................................................................................................................................7<br />
Ulrich Brinkmann, Dr.<br />
„Shared Values“ oder „ shareholder value?“<br />
Die Untauglichkeit der „Unternehmenskultur“ als „Integrationstechnik“………………………...11<br />
Sachgebiete<br />
1 Industriegesellschaft, Theoriediskussion, Gesamtdarstellungen .........................................41<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung.............57<br />
3 Arbeit, Arbeitsorganisation, Rationalisierung, Kontrolle, Humanisierung, Technologie....86<br />
4 Management, Unternehmensführung, Personalwesen.......................................................101<br />
5 Qualifikation, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Arbeitszeit.......................................................119<br />
6 Arbeitssicherheit, Gesundheit, Arbeitsmedizin, Ökologie ................................................135<br />
7 Wirtschaftssoziologie........................................................................................................146<br />
Register<br />
Hinweise zur Registerbenutzung...................................................................................................173<br />
Personenregister ............................................................................................................................175<br />
Sachregister...................................................................................................................................181<br />
Institutionenregister.......................................................................................................................193<br />
Anhang<br />
Hinweise zur Originalbeschaffung von Literatur ..........................................................................203<br />
Zur Benutzung der Forschungsnachweise.....................................................................................203
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 7<br />
Vorwort<br />
Vorwort zum <strong>soFid</strong> „Industrie- und Betriebssoziologie“<br />
Das Informationszentrum Sozialwissenschaften (IZ) bietet mit dem „Sozialwissenschaftlichen<br />
<strong>Fachinformationsdienst</strong>“ (<strong>soFid</strong>) zweimal jährlich aktuelle Informationen zu einer großen Zahl<br />
spezieller Themenstellungen an. Jeder <strong>soFid</strong> hat sein eigenes, meist pragmatisch festgelegtes Profil.<br />
Gewisse Überschneidungen sind deshalb nicht zu vermeiden.<br />
Quelle der im jeweiligen <strong>soFid</strong> enthaltenen Informationen sind die vom IZ produzierten Datenbanken<br />
SOLIS (Sozialwissenschaftliches Literaturinformationssystem) sowie FORIS (Forschungsinformationssystem<br />
Sozialwissenschaften).<br />
Die Datenbank SOLIS stützt sich vorwiegend auf deutschsprachige Veröffentlichungen, d.h. Zeitschriftenaufsätze,<br />
Monographien, Beiträge in Sammelwerken sowie auf Graue Literatur in den<br />
zentralen sozialwissenschaftlichen Disziplinen. In SOLIS ist bei einigen Hinweisen unter „Standort“<br />
eine Internet-Adresse eingetragen. Wenn Sie mit dieser Adresse im Internet suchen, finden Sie<br />
hier den vollständigen Text des Dokuments.<br />
Wesentliche Quellen zur Informationsgewinnung für FORIS sind Erhebungen in den deutschsprachigen<br />
Ländern bei Institutionen, die sozialwissenschaftliche Forschung betreiben. Der Fragebogen<br />
zur Meldung neuer Projekte steht permanent im Internet unter http://www.gesis.org/IZ zur<br />
Verfügung.<br />
Literaturhinweise sind durch ein "-L" nach der laufenden Nummer gekennzeichnet, Forschungsnachweise<br />
durch ein "-F". Im Gegensatz zu Literaturhinweisen, die jeweils nur einmal gegeben<br />
werden, kann es vorkommen, dass ein Forschungsnachweis in mehreren aufeinander folgenden<br />
Diensten erscheint. Dies ist gerechtfertigt, weil Forschungsprojekte häufig ihren Zuschnitt verändern,<br />
sei es, dass das Projekt eingeengt, erweitert, auf ein anderes Thema verlagert oder ganz abgebrochen<br />
wird. Es handelt sich also bei einem erneuten Nachweis in jedem Falle um eine aktualisierte<br />
Fassung, die Rückschlüsse auf den Fortgang der Arbeiten an einem Projekt zulässt.<br />
* * *<br />
Die Industriesoziologie beschäftigt sich im Wesentlichen mit industriellen Institutionen, Verhaltensmustern<br />
und Einstellungen sowie ihren Beziehungen zu den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft<br />
und Betrieb. Forschungsgegenstand der Betriebssoziologie sind u.a. die Arbeitsbedingungen<br />
und deren objektive und subjektive Auswirkungen auf die Arbeitenden, Verhaltensweisen und<br />
Einstellungen (informelle Gruppen, Betriebsklima, Arbeitszufriedenheit) sowie die Probleme einzelner<br />
Positionen (Meister, Mitbestimmungsorgane) und Kategorien (Arbeiter, Management) im<br />
Betrieb.<br />
Der <strong>soFid</strong> zur Industrie- und Betriebssoziologie wurde ab Band 1997/1 um ein Kapitel Wirtschaftssoziologie<br />
ergänzt. Der bis dahin eigenständige Band Wirtschaftssoziologie wird nicht<br />
weiter publiziert, da die Auflage zu gering und der Umfang zu schmal war: außerdem bestanden
8 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
Vorwort<br />
inhaltliche Überschneidungen zu diesem <strong>soFid</strong>. Das neue Kapitel Wirtschaftssoziologie stellt andererseits<br />
eine gute Ergänzung zur Industrie- und Betriebssoziologie dar. Diese Integration entspricht<br />
auch der Tendenz zur Kooperation der entsprechenden Sektionen der Deutschen Gesellschaft<br />
für Soziologie (DGS). Obwohl sich die Sektion Industrie- und Betriebssoziologie der DGB<br />
in Arbeits- und Industriesoziologie umbenannt hat, sind wir bei dem bisherigen Titel dieses <strong>soFid</strong><br />
geblieben, um die bibliografische Kontinuität zu wahren. Die Schwerpunktverschiebungen in der<br />
aktuellen Forschung spiegeln sich in er jeweils unterschiedlichen Besetzung der einzelnen Kapitel<br />
wieder, deren Gliederung nach wie vor eine tragfähige Abbildung der Forschungsgebiete ermöglicht.<br />
Der <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie enthält im Rahmen seiner Sachgebietsgliederung<br />
Untersuchungen zu folgenden Themenbereichen:<br />
Kapitel 1 Industriegesellschaft, Theoriediskussion, Gesamtdarstellungen: arbeits- und industriesoziologische<br />
Probleme der Transformation von Wirtschaftssystemen, Technik, Arbeit und Betrieb<br />
in der arbeits- und industriesoziologischen Forschung, Wandel der Arbeitsgesellschaft, Übergang<br />
von der Industrie- zur Risikogesellschaft, Strukturwandel industrieller Krisenregionen im Vergleich,<br />
Technikgenese, Techniksoziologie, Zukunft der Arbeit.<br />
Kapitel 2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung, Kontinuität<br />
und Wandel betrieblicher Herrschaft in den neuen Bundesländern, Verhältnis Belegschaft<br />
und betriebliche Interessenvertretung, Arbeitspolitik, Tarifpolitik, Gewerkschaftspolitik, Wandel<br />
industrieller Beziehungen in Osteuropa; Lohn und Leistung.<br />
Kapitel 3 Arbeit, Arbeitsorganisation, Rationalisierung, Kontrolle, Humanisierung, Technologie:<br />
Expertensysteme und IuK-Technologien und ihre Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation, Kontrollsysteme<br />
und integrierte Produktionsverantwortung, flexible Arbeits- und Produktionssysteme,<br />
systemische Rationalisierung und Technikgestaltung (auch im öffentlichen Dienst).<br />
Kapitel 4 Management, Unternehmsführung, Personalwesen: Unternehmenskultur und Führungsstil,<br />
Konzepte mittelbarer und unmittelbarer Führung, Personalführung in unterschiedlichen Kulturen<br />
und Gesellschaften, Personalauswahl mit Assesment-Center, Qualitätsmanagement, Manager,<br />
Frauen in Führungspositionen.<br />
Kapitel 5 Qualifikation, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Arbeitszeit: Schichtarbeitsforschung, soziale,<br />
psychische und gesundheitliche Auswirkungen von flexiblen Arbeitszeiten, beruflich-betriebliche<br />
Weiterbildung, Teilzeitarbeit, Arbeitszeit und Arbeitsmarkt, Frauenerwerbstätigkeit, Übergang ins<br />
Rentenalter<br />
Kapitel 6 Arbeitssicherheit, Gesundheit, Arbeitsmedizin, Ökologie: Evaluation von Gesundheitsberichten<br />
und -zirkeln als Instrument betrieblicher Gesundheitsförderung, Sicherheit vernetzter<br />
informationstechnischer Systeme, betrieblicher Arbeits- und Umweltschutz, psychosoziale Arbeitsbelastung,<br />
Risikogruppen, betriebliches Öko-Auditing.<br />
Kapitel 7 Wirtschaftssoziologie: Soziologische Untersuchung zu den Akteuren und Institutionen<br />
der Wirtschaft wie Unternehmen und Staat, Geld und Konsum, Markt und Non-profit-Organisationen,<br />
Genossenschaftswesen, Marktwirtschaft und gesellschaftliche Entwicklung, Unternehmer<br />
und Konsumenten, wirtschaftliches Handeln.
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 9<br />
Vorwort<br />
In dieser Ausgabe veröffentlichen wir den Beitrag „Shared Values“ oder „shareholder value?“ Die<br />
Untauglichkeit der „Unternehmenskultur“ als „Integrationstechnik“ von Dr. Ulrich Brinkmann.<br />
Der Text des Beitrages stellt eine aktualisierte und erweiterte Fassung seiner Publikation „ Aufstieg<br />
und Niedergang der Unternehmenskultur“ in Helduser, U./Schwietring, T. (2002): „ Kultur<br />
und ihre Wissenschaft. Beiträge zu einem reflexiven Verhältnis“ (Konstanz: Universitätsverlag<br />
Konstanz): S. 203-230 dar.<br />
Dr. Ulrich Brinkmann ist an der Friedrich-Schiller-Universität Jena am Institut für Soziologie im<br />
Lehrstuhl für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie tätig.
„Shared values“ oder „shareholder value“?<br />
Die Untauglichkeit der „Unternehmenskultur“ als<br />
Integrationstechnik 1<br />
Ulrich Brinkmann<br />
Abstract<br />
Der Beitrag thematisiert, wie sich der Diskurs über die Unternehmenskultur von seinen Anfängen<br />
1980 über den Höhepunkt 1996-1998 bis zu seinem heutigen Niedergang entwickelt hat.<br />
Der Aufstieg des Konzeptes verknüpfte sich mit den zeitgenössischen sozioökonomischen Kontexten<br />
und Diskursen, aber auch mit den teilweise schon jahrzehntealten Traditionen. Unternehmenskulturansätze<br />
stellten sowohl eine Management-Modeerscheinung als auch einen Antwortversuch<br />
auf die Produktivitätskrisen der fordistischen Produktionsweise dar. Innerbetrieblich ermöglichten<br />
sie es dem Top-Management, die Machtposition aufgrund seiner strategischen Vorherrschaft zu sichern.<br />
Dies insbesondere dann, wenn es ihm gelang, eine temporäre Koalition mit der Belegschaft zu<br />
schließen, die ihrerseits auf eine erweiterte Partizipation an und Einbindung in unternehmensrelevante<br />
Entscheidungen hoffte. Die Popularität der „Kultur“-Kategorie in der Organisationsforschung<br />
wird zudem in den Kontext des vermehrten Rückgriffs auf kulturalistische Erklärungsmuster im Zuge<br />
des cultural turns vieler sozialwissenschaftlicher Disziplinen sowie des Aufstiegs der cultural studies<br />
gerückt. Es wird allerdings festgehalten, dass kulturzentrierte Ansätze – sieht man einmal von<br />
ihrer populären Variante der corporate culture ab – in den wirtschaftswissenschaftlichen Diskursen<br />
lediglich eine marginale Position besetzen. Und auch in der Organisationsforschung ist die „Kultur-Perspektive“<br />
nicht dominant geworden.<br />
Der Niedergang des Konzepts wird am Wechsel der Mode ebenso festgemacht wie am Versuch des<br />
Top-Managements, die betrieblichen Machtverhältnisse wieder zu seinen Gunsten zu verschieben.<br />
In der Beschäftigtenperspektive ist es vor allem der instrumentelle Gebrauch des Unternehmenskulturansatzes<br />
durch das Management, der eine vermehrte Skepsis und Angst vor Manipulation hervorrief.<br />
Überdies wird festgehalten, dass ambitionierte Unternehmenskulturansätze wie andere „weiche“<br />
Management-Konzepte Opfer eines ideologischen backlashs im Zuge der Formierung eines<br />
Neuen Produktionsmodells wurden, in dem sich die Dominanz der Orientierung am shareholder value<br />
und der short-run Ökonomie andeutet.<br />
Was ihre Tragfähigkeit als sozialwissenschaftliche Kategorie anbetrifft, so wird argumentiert, dass<br />
es zwar eine Reihe gewinnbringender Untersuchungen zur Unternehmenskultur gibt, die in Abgrenzung<br />
von mechanistischen Organisationsvorstellungen die Produktion symbolischer Bedeutungen<br />
der informalen Organisation betonen. Die Nähe zur Management-Beratungsliteratur birgt aber stets<br />
die Gefahr einer Aufweichung von Standards oder Vermischung von Kategorien. Es wird deshalb<br />
1 Dieser Text stellt eine aktualisierte und erweiterte Fassung meines Beitrags „Aufstieg und Niedergang der<br />
Unternehmenskultur“ in Helduser, U./Schwietring, T. (2002): „Kultur und ihre Wissenschaft. Beiträge zu<br />
einem reflexiven Verhältnis“ (Konstanz: Universitätsverlag Konstanz): S. 203-230 dar.
12 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
„Shared values“ oder „shareholder value“?<br />
gefragt, ob Unternehmenskultur als empirisch-analytisches Konzept dadurch „zu retten“ ist, dass<br />
man sie als spezifischen Baustein in Ansätze wie den der „Mikropolitik“ oder der „Betrieblichen Sozialordnung“<br />
integriert.<br />
Das Prinzip einer eher langfristiger Orientierung durchzog die Nachkriegsfordismen der westlichen<br />
Gesellschaften, insbesondere in Kontinentaleuropa in vielfacher Hinsicht. Für ein Arbeiten und Leben<br />
„in the long run“ waren weite Bereiche der Produktionsökonomie, viele hierarchische Organisationsmodelle,<br />
die ihr entsprechenden industriellen Beziehungen, aber auch die Berufsbiographien<br />
(zumindest ausgelegt, gleiches galt – und dies wurde oft vernachlässigt – auch für die sie abstützenden<br />
konzeptiven Modelle der Managementprinzipien und ihre ideologischen Überhöhungen.<br />
Mit dem Entstehen eines neuen „Marktkapitalismus“ (Aglietta 2000), der sich an den Maximen des<br />
Shareholder-Value-Gedankens ausrichtet und den Prämissen des Finanzmarktes (Dörre/Brinkmann<br />
2005) unterordnet erfuhr im vergangenen Jahrzehnt der Markt als Strukturprinzip in Gesellschaft,<br />
Organisation und Subjekt ein beachtliches Revival, was unter anderem eine unübersehbaren Dynamisierung<br />
kapitalistischer Vergesellschaftung einerseits und ihrer weltanschaulichen Absicherung<br />
andererseits nach sich zog. Mit dem Verschwinden vieler Gewissheiten des Nachkriegsfordismus<br />
hält die von Habermas einst prognostizierte neue Unübersichtlichkeit Einzug in ehedem eingehegte,<br />
vergleichsweise stabile – weil der Anarchie des Marktes entzogene – und befriedete Bereiche der<br />
Ökonomie. Weltanschauliche Überhöhungen und normative Handreichungen der Managementliteratur<br />
erfüllen in diesem zwei Funktionen: Sie sollen einem Management unter Handlungsdruck helfen,<br />
die permanente Reorganisation der Unternehmen mit Sinn zu unterfüttern. Abgesehen von dieser<br />
Bedeutungsinszenierung gibt es aber auch einen sehr praktischen Hintergrund. Die mit der Kommodifizierung,<br />
der „Verschiebung der Marktgrenzen“ in die Unternehmen (Brinkmann 2004), einsetzende<br />
Auflösung der tradierten Unternehmensstrukturen gefährdet die Kohäsion, das Zusammenspiel<br />
der Gesamtorganisation. Geradezu krampfhaft werden daher integrationsstiftende Konzepte<br />
gesucht, die den entfesselten zentrifugalen Kräften entgegenwirken.<br />
So erscheinen seit einiger Zeit in kürzer werdenden Abständen immer neue Management-Moden und<br />
best-practice-Programme auf dem Markt der wirtschaftswissenschaftlichen Theorieansätze. Im Angebot<br />
waren oder sind „lean management“, „total quality management“, „human resource management“,<br />
„employee involvement“, „customer relationship management“ etc. Zu den langlebigeren<br />
Konzepten schien bisher das der „Unternehmenskultur“ zu zählen. Mit dem Rekurs auf „Kultur“<br />
taucht mit einem Mal in den Wirtschafts- und Betriebswissenschaften ein Begriff auf, der bislang<br />
diesen „harten“ Wissenschaften eher irrelevant schien. Sein Erscheinen geht aber zeitlich einher mit<br />
einer disziplinübergreifenden Entwicklung des cultural turn in den Sozialwissenschaften.<br />
Dieser Text legt zunächst den Kontext und die Determinanten des Aufstiegs dieses Konzeptes seit<br />
den frühen 80er Jahren dar. Dabei wird der Frage nachgegangen, was sich konzeptionell hinter der<br />
Idee der Unternehmenskultur verbirgt. Hierzu sollen zum einen die fachspezifischen und unternehmenspraktischen<br />
Gründe für diesen Aufstieg aufgezeigt werden, zum anderen die Konjunktur der<br />
Unternehmenskultur-Idee auf disziplinübergreifende Entwicklungen des cultural turn in den Sozialwissenschaften<br />
bezogen werden.<br />
In der Folge werden empirische Belege und erklärende Argumentationslinien für die These aufgeführt,<br />
dass sich das Konzept seit einigen Jahren im Niedergang befindet.
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 13<br />
„Shared values“ oder „shareholder value“?<br />
1 Der Aufstieg der Unternehmenskultur: eine Idee im Kontext<br />
Mode, Materialität und Macht<br />
Die Wirtschaftswissenschaften – und hier insbesondere die Betriebswirtschaftslehre – halten sich<br />
zugute, dass ihre wissenschaftliche Produktion in der Regel eng an die ökonomische Praxis rückgekoppelt<br />
ist. Aus diesem Grunde partizipieren nicht nur außergewöhnlich viele AkteurInnen mit<br />
durchaus unterschiedlichen, wenn nicht sogar widersprüchlichen Interessen und Funktionen (BeraterInnen,<br />
Wirtschafts- und SozialwissenschaftlerInnen, ManagerInnen, GewerkschafterInnen, vgl.<br />
Ebers 1988) an aktuellen Diskursen; auch die relevante Literatur lässt sich oftmals nicht einem spezifischen<br />
Funktionsbereich zuordnen, da sie zu einem nicht geringen Teil in einen Graubereich von<br />
normativer Beratungsliteratur, empirischen Studien und Theorieproduktion fällt.<br />
Es stellt sich die Frage, warum Managementmoden trotz ihrer geringen Halbwertzeit eine so erstaunlich<br />
große diskursive Dominanz und – so scheint es zumindest – auch Praxisrelevanz entfalten können.<br />
Oder um mit der Verwunderung eines betroffenen Unternehmensberaters (Baille 1995: 47) zu<br />
fragen, der feststellt, dass diese Konzepte „were being preached with a gospel-like fervency“: „Why<br />
were we following them, and still are to some extent?“<br />
Kieser (1996: 27) macht den „enormen Wettbewerbsdruck“ heutiger Führungskräfte als eine zentrale<br />
Begründung dafür aus, dass diese „im rationalen Denken geschulten Manager“ den teilweise mythisch<br />
anmutenden Versprechungen immer neuer Moden Glauben schenken. Gleichzeitig rufen die<br />
jeweiligen Moden im geschichtlichen Verlauf wiederum spezifische Probleme hervor, auf die dann<br />
mit neuen Konzepten reagiert werden muss. Das Unternehmenskulturkonzept macht da keine Ausnahme<br />
und ist in diesem Sinne auch keine völlige theoriegeschichtliche Novität.<br />
Mit Blick auf Organisationskulturansätze verweist Deutschmann (1989: Teil 2) dazu beispielsweise<br />
auf den Vorläufer „Human Relations-Bewegung“ in der Zwischenkriegsperiode oder auch die Hinwendung<br />
zum Phänomen des Betriebsklimas in den 60er Jahren (z. B. Friedeburg 1963). Bei den<br />
VertreterInnen der Unternehmenskulturansätze vermutet Türk jedoch eine bewusste Tendenz, an<br />
weit zurückliegende Debatten nicht anzuknüpfen, „weil das dem modernistischen Image des Themas<br />
schaden könnte“ (1989: III.4). Er verweist beispielsweise auf Arnolds frühe Studie „The Folklore of<br />
Capitalism“ (1943 (1937)), die bereits viele der zentralen Topoi der späteren Unternehmenskulturforschung<br />
zum aufgreift, von dieser aber kaum rezipiert wird (für weitere Beispiele vgl. Ebers 1988).<br />
Für beide Positionen finden sich Belege: Im Unterschied zur wissenschaftlichen agiert die Beratungsliteratur<br />
zur Unternehmenskultur eher geschichtsvergessen – zumindest was die eigene<br />
Verortung innerhalb der Geschichte des Diskurses angeht.<br />
In der Entwicklung der Organisationstheorie kann man mit Scott (1992) drei elementare konkurrierende<br />
Paradigmen identifizieren. Während frühe Vorstellungen die Organisationen in einer mechanistischen<br />
Weise als „rational systems“, also als zielgerichtete, formalisierte soziale Strukturen definierten,<br />
eröffneten die Deutungen von Organisationen als „natural systems“ oder als „open systems“<br />
spezifische Horizonte, die auch für eine spätere Entwicklung von Unternehmenskulturansätzen bedeutend<br />
waren. Insbesondere die natural system-Perspektive, zu der auch jene human relations-Schule<br />
gezählt werden kann, mit ihrer Erweiterung des Blicks auf die „informale Organisation“<br />
trug dazu bei. Formale und informale Organisation – so könnte man analogisieren – verhalten sich in
14 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
„Shared values“ oder „shareholder value“?<br />
gewisser Weise wie Text und Subtext zueinander; letzterer bleibt unausgesprochen, eröffnet aber<br />
eine Möglichkeit für ein weiterreichendes Verständnis.<br />
Diese Entwicklung wird auch in der Metaphorik sichtbar, der sich das Fach bedient, um seinen Gegenstand<br />
zu umreißen und auszudifferenzieren. Morgan hat dies in seinem Standardwerk „Images of<br />
Organization“ (1986) aufgezeigt. Blickt man auf den geschichtlichen Prozess der Entwicklung der<br />
Metaphorik, so ist auffällig, dass sich in den frühen Jahren der Organisationstheorie ein starker Rückgriff<br />
auf Bilder aus der „physical world“ (Morgan 1980) findet: Die Vorstellung von Organisationen<br />
als „Maschinen“ betonte die Rationalität ihres (oftmals bürokratisch-hierarchischen) Aufbaus<br />
und die präzise Verortung jedes Beschäftigten innerhalb des gegebenen Rahmens – nicht unähnlich<br />
dem Zahnrädchen in einem Uhrwerk. Die „Organisation als Organismus“ betonte dagegen den Überlebenskampf<br />
des Gebildes innerhalb einer dynamischen Umwelt. Später findet man auch Rückgriffe<br />
auf soziale Metaphoriken, so die „Organisation als Theater“ im Anschluss an Goffman (1983 (1959))<br />
oder als „politische Arena“ (Crozier 1964). Unternehmenskultur repräsentiert in dieser Reihung<br />
lediglich eine weitere Vorstellung von „Organisation“ – mit allen Stärken und Schwächen, die einer<br />
metaphorischen Sichtweise notwendig inhärent sind.<br />
Dabei ist der Rückgriff auf die Kultur-Kategorie in einer wirtschaftswissenschaftlich orientierten Literatur<br />
an sich schon bemerkenswert, und die Organisationsforschung stellt eine seltene Ausnahme<br />
von der Regel dar: „Most modern economists do not worry much about culture“ (DiMaggio 1994:<br />
29). Der Ausnahmestatus der Organisationsforschung ist dabei sicherlich nicht nur ihrer starken Tradition<br />
empirischer Forschung und ihrer gleichsam zwangsläufigen Thematisierung informaler Prozesse<br />
geschuldet: Er wird auch augenfällig, wenn man beispielsweise auf die Differenz zu dominanten<br />
– fast „Kultur“-freien – neoklassischen Ansätzen und ihren abstrakten Ableitungsmodellen<br />
schaut: diese meiden die Kultur-Kategorie als Erklärungsvariable oft schon deshalb, weil sie diese<br />
aufgrund der ihr inhärenten Unschärfe nur sehr problematisch in ihr quantitatives Modell einbauen<br />
können; statt dessen findet sich bei ihnen oft ein Rückgriff auf die kognitive Psychologie.<br />
Mit der „Entdeckung“ der sozialen Seite von Organisationen gerieten in der Praxis zentrale Unternehmensbereiche<br />
in Bewegung. Die Personalpolitik zeigte auf, dass Beschäftigte nicht nur einen<br />
Kostenfaktor, sondern auch eine Ressource des Unternehmens darstellten. Neue Ansätze eines Human<br />
Resource Managements (Beer et al. 1985; Kochan/ Barocci 1985; Storey 1992; Legge 1995;<br />
Weitbrecht/Mehrwald 1998) zielten darauf ab, diese Ressource nutzbar zu machen. Im Zuge der Entdeckung<br />
der Spezifika der japanischen Produktionsweise (Ouchi 1981) lenkte sich der Blick der<br />
Zunft auf das Lean Management (Womack et al. 1992) und die damit verbundene Reorganisation der<br />
Hierarchie und Veränderung der Arbeitsorganisation, die sich vielleicht am deutlichsten in der<br />
Einführung von Gruppenarbeit festmachen lässt, sich aber keineswegs darin erschöpft.<br />
Diese Konzepte stellten auch Antwortversuche auf spezifische Herausforderungen der entwickelten<br />
kapitalistischen Formationen dar und waren insoweit mehr als nur Moden, die sich einander abwechselten<br />
und aufeinander bezogen.<br />
Dazu ist zunächst auf die materielle Seite der Entwicklungslogik kapitalistischen Wirtschaftens zu<br />
verweisen. Die schon von Marx im „Kapital“ (MEW 23 1983: Kap. 23) beschriebene Tendenz zur<br />
Zentralisation des Kapitals, also zur „Konzentration bereits gebildeter Kapitale, Aufhebung ihrer individuellen<br />
Selbständigkeit“ entwickelte sich in den letzten Jahrzehnten zu einer wahren Welle von<br />
Unternehmenszusammenschlüssen (Mergers & Acquisitions). PraktikerInnen wie TheoretikerInnen<br />
konfrontierte sie zwangsläufig mit der heiklen Frage nach der Vereinbarkeit unterschiedlicher orga-
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 15<br />
„Shared values“ oder „shareholder value“?<br />
nisationaler „Kulturen“ und nach dem Management von Akkulturation oder dem Umgang mit Friktionen,<br />
„Kultur-Schocks“ oder „cultural clashes“ (Veiga et al. 2000; am Beispiel der neuen Bundesländer<br />
vgl. Lang/Wald 1992).<br />
Zudem wurde seit den ökonomischen Krisen der 70er Jahre deutlich, dass die Perfektionierung des<br />
Wirtschaftens tayloristisch-fordistischer Manier an absolute Grenzen stieß (Hirsch/Roth 1986;<br />
Hirsch 1995). Die zurückgehenden Produktivitätszugewinne einer Wirtschaftsweise, die Effizienzsteigerungen<br />
primär über technologische Verbesserungen anstrebte, und die steigende organische<br />
Zusammensetzung des Kapitals verhagelten die Bilanzen der Unternehmen. Auf der Suche nach Produktivitätsreserven<br />
stieß das Management auf das brach liegende ProduzentInnenwissen, jenes<br />
„Gold in den Köpfen der Belegschaft“. Plötzlich stellten Beschäftigte bis hin zum shop floor einen<br />
umworben Produktionsfaktor dar, dessen Qualifikation man fördern und dessen Einbindung man<br />
gewährleisten musste – nicht zuletzt über die Initiierung von Unternehmenskulturkonzepten.<br />
Es nimmt nicht wunder, dass dieser Bruch auch Auswirkungen auf die betrieblichen Machtverhältnisse<br />
zeitigte. Wenn Beschäftigte sowohl in der Eigen- als auch in der Fremdwahrnehmung durch<br />
das Management von austauschbaren Appendizes des Produktionsprozesses zu dessen Produktivitätsmotoren<br />
avancieren, verbessert sich nicht nur ihre Machtposition, sondern es verbessern sich oftmals<br />
auch ihre Ansprüche an Teilhabe und Mitgestaltung. Schon die Labour Process Debate der 70er<br />
Jahre (Braverman 1977; Burawoy 1979; Hildebrandt/Seltz 1987) hatte verdeutlicht, dass betriebliche<br />
Herrschaft nicht ohne das Commitment der abhängig Beschäftigten funktionierte, und dieses<br />
wiederum auf deren partieller Einbindung basierte.<br />
Und ein weiterer Aspekt der Machtfrage ist evident. Innerorganisatorisch ist es vor allem das<br />
Top-Management, das eine strategische Neuorientierung beispielsweise in Richtung von Unternehmenskulturansätzen<br />
ausrufen darf und damit unter mikropolitischen Gesichtspunkten auch seine<br />
Machtposition gegenüber dem Mittelmanagement stärken kann (Kieser 1996). Für eine begrenzte<br />
Zeitspanne fand sich in den 80er Jahren eine Interessenkonvergenz von Top-Management einerseits<br />
und Beschäftigten und deren Vertretungen andererseits. Beide Fraktionen konnten sich für eine Einführung<br />
von „Unternehmenskulturstrategien“ aussprechen, weil sie sich davon eine Verbesserung<br />
ihrer Machtpositionen erhofften. Allerdings wird ebenso deutlich, dass sie jeweils unterschiedliche<br />
Motive damit verbanden und dass damit bereits Sollbruchstellen für diesen temporären Pakt<br />
vorgezeichnet waren.<br />
Der durchschlagende Erfolg der Literatur zur Unternehmenskultur, der sich schon an der Zahl der Titel<br />
und der Höhe ihrer Auflagen bemessen lässt, wäre kaum verständlich ohne das Wissen um diesen<br />
Kontext der ökonomischen Krisen der 70er Jahre oder der US-amerikanischen Furcht vor dem wirtschaftlichen<br />
Aufstieg Japans. Dieser begegnen insbesondere die klassischen amerikanischen Texte<br />
der Debatte mit einem optimistischen, geradezu begeisterten Tonfall über die Stärken bestimmter<br />
Unternehmen in den USA. Als entscheidend für die spezifische Rezeption der Kultur-Kategorie in<br />
der Managementliteratur aber auch in der wissenschaftlichen Organisationsforschung ist demnach<br />
der jeweilige sozioökonomische und diskursive Kontext zu sehen.<br />
In der Bundesrepublik fand eine solche Debatte vor der Folie der Besonderheiten des deutschen Modells<br />
der Industriellen Beziehungen und der spezifischen jüngeren Geschichte statt. So wurden beispielsweise<br />
seit Ende der 60er Jahre aus der außerparlamentarischen Bewegung und ihren Ausläufern<br />
(wie der Lehrlingsbewegung) ebenso wie aus den Gewerkschaften Demokratiebestrebungen in<br />
die Unternehmen getragen. Auf der legislativen Ebene mündeten diese unter anderem in die Reform
16 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
„Shared values“ oder „shareholder value“?<br />
der gesetzlichen Mitbestimmung von 1976. Betrieblich gab es die gewerkschaftlich unterstützten<br />
Versuche der „Humanisierung der Arbeit“, die nicht nur Veränderungen der Arbeitsorganisation,<br />
sondern auch eine Einlösung höherer Teilhabeforderungen zum Ziel hatten. Im Zuge der Orientierung<br />
auf die „Unternehmenskultur“ fand sich in „reformorientierten, betriebswirtschaftlichen Managementlehren“<br />
(vgl. für Beispiele: Kadritzke 1997: 9) deshalb schon bald auch eine Verbindung mit<br />
einem Anspruch auf Partizipation und Emanzipation. Krell (1994: Kap. 3-5) hat außerdem darauf<br />
verwiesen, dass sich auch deutsche Vorgängerkonzepte einer bewussten betrieblichen Vergemeinschaftung<br />
finden: von den Werksgemeinschaften der 20er Jahre, über die NS-Betriebsgemeinschaften<br />
zu sozialpartnerschaftlichen betrieblichen Gemeinschaften nach 1945.<br />
Im Aufstieg der Konzepts Unternehmenskultur konvergieren also unterschiedliche Entwicklungslinien:<br />
neben den „Modefragen“ auch der mikropolitische Aspekt innerbetrieblicher Machtverteilung<br />
sowie die Suche nach Lösungen für die materialen Probleme des fordistischen Entwicklungspfades.<br />
Und schließlich stellt sich die Frage, warum es gerade die Kategorie „Kultur“ ist, auf die seit Anfang<br />
der 80er Jahre zunehmend zurückgegriffen wird.<br />
„The way we do things around here“ oder: Was ist Unternehmenskultur?<br />
„Culture may be an idea whose time has come; but what exactly does a ›cultural perspective‹ on organizations<br />
mean?“ Diese von Smircich (1983: 339) aufgeworfene Frage lässt sich unterschiedlich<br />
auffächern. Zunächst kann man die Frage nach dem kategorialen Verhältnis von Kultur und Organisation<br />
aufwerfen. Smircich selbst führt fünf verschiedene Themenbereiche an – darunter „corporate<br />
culture“, aber auch „cross-cultural management“ oder „organizational symbolism“ (zur Abgrenzung<br />
des Unternehmenskultur- von verwandten Konzepten vgl. Jacobsen 1996: 1.4). In einem zweiten<br />
Schritt stellt sich die Schwierigkeit, wie man corporate culture, also Unternehmens- oder<br />
Organisationskultur, als Konzept rekonstruiert.<br />
Die frühen Autoren der Unternehmenskultur-Debatte wie Deal/Kennedy (1982) oder die McKinsey-Berater<br />
Peters/Waterman (1982) verschwendeten wenig Energie an ihre begriffsgeschichtliche<br />
Verortung innerhalb eines „kultur“-wissenschaftlichen Diskurses. Erstere beispielsweise leiteten ihr<br />
Standardwerk mit einer kurzen Kultur-Definition aus Webster’s New Collegiate Dictionary ein, um<br />
sich dann auf die „more informal“ Kultur-Definitionen wie die eines früheren McKinsey-Managers<br />
zu beziehen: „The way we do things around here“ (Deal/Kennedy 1982: 4). In dieser pragmatischen<br />
Definition deutet sich ein zentrales und durchgehendes Kennzeichen typischer Managementliteratur<br />
zur Unternehmenskultur an: Strukturzusammenhänge und Prozesse werden personifizierend dargestellt;<br />
dieses Mittel bietet dem avisierten Management-Publikum alle Möglichkeiten, unternehmerisches<br />
Reorganisationshandeln an machtvoll handelnden Einzelpersonen verdichtet zu rezipieren.<br />
Stets wird suggeriert: Unternehmenskultur ist machbar (Schreyögg 1991; Bate 1997; Collins 1998).<br />
Bei Deal/Kennedy findet sich auch der erste Versuch, die Kultur-Kategorie in diesem Zusammenhang<br />
systematisch auszudifferenzieren. Die fünf von ihnen angeführten Elemente von Unternehmenskulturen<br />
waren „business environment“, „values“, „heroes“, „rites and rituals“ sowie das „cultural<br />
network“; teilweise spielen sie auch in gegenwärtigen Analysen noch eine wichtige Rolle (vgl.<br />
unten). Auch bei Peters/Waterman war es schon der „esprit de corps“, also jene „shared values“, denen<br />
die Autoren eine zentrale Bedeutung im Konzept der Unternehmenskultur zumaßen. Allerdings<br />
blieben diese Elemente zunächst noch vergleichsweise vage. Und bis heute lässt sich als weiteres<br />
Merkmal festhalten, dass in der populären Management- und Beratungsliteratur zur Unternehmens-
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 17<br />
„Shared values“ oder „shareholder value“?<br />
kultur sowohl die konstatierten Problemlagen in Organisationen als auch die propagierten Leitbilder<br />
und Lösungswege sehr unkonkret bleiben. Die greifbare inhaltliche Ausfüllung, also das „putting<br />
cultures into practice“ (Deal/Kennedy), bleibt der Politik des Managements vor Ort bzw. der von ihr<br />
beauftragten Unternehmensberatung überlassen.<br />
Kieser (1996) beschreibt diese Mehrdeutigkeit der Konzepte nicht nur als Merkmal der Konvolute<br />
zur Unternehmenskultur, sondern der normativ ausgerichteten Managementliteratur insgesamt.<br />
Mit dem Problem der Definition von „Kultur“ allerdings stehen die Akteure der Unternehmenskultur-Diskurse<br />
keineswegs allein da. Generell ist auf das Problem der Sozial- und Geisteswissenschaften,<br />
sich auf einen konsistenten und theoretisch begründeten Begriff von Kultur zu verständigen,<br />
vielfach hingewiesen worden (vgl. bspw. Luhmann 1999: Kap. 2). Statt dessen herrscht eine Vielfalt<br />
der Definitionen des Kulturbegriffs vor (Billington et al. 1991: Kap. 1).<br />
Für die Unternehmenskulturdebatte lässt sich festhalten, dass es vergleichsweise wenig systematische<br />
Versuche gibt, den Kultur-Begriff wissenschaftlich präzise herzuleiten. Prabitz (1996: 130 f.)<br />
hat herausgearbeitet, dass es eine starke Orientierung an kulturanthropologischen Ansätzen gibt, hier<br />
nicht selten verkürzt auf bestimmte, oftmals amerikanische Autoren wie Clifford Geertz. Auch einige<br />
deutschsprachigen Beiträge nehmen in zentraler Weise Bezug auf diese kulturanthropologische<br />
Linie (Heinen 1987: Beitrag B; Neuberger/Kompa 1987: Kap. 2).<br />
In solchen Bezügen zur Kulturanthropologie und mit Geertz zu einem der Haupttheoretiker der kulturwissenschaftlichen<br />
Theoriedebatte (Böhme/Matussek/Müller 2000: 64/65) wird der sozial- und<br />
geisteswissenschaftliche cultural turn der 80er und 90er Jahre als begriffsgeschichtlicher Entstehungskontext<br />
deutlich.<br />
Von den ProtagonistInnen des Diskurses selber werden in der Regel zwei Grundverständnisse von<br />
Unternehmenskultur unterschieden (z. B. Allaire/Firsirotu 1984; Rowlinson/Procter 1999: 370):<br />
„Kultur als Variable“ oder „Kultur als Basis-Metapher“ („root metaphor“). Kultur im ersteren Verständnis<br />
findet sich vor allem in rationalistischen und funktionalistischen Ansätzen (z. B. Schein<br />
1997), die danach fragen, welche Funktion Kultur innerhalb eines Unternehmens/einer Organisation<br />
erfüllt; Kultur ist hier eine Dimension eines sozialen Systems. Das Konzept der Basis-Metapher, das<br />
sich insbesondere in symbolistischen Ansätzen (vgl. Pondy et al. 1983) findet, fokussiert dagegen die<br />
fundamentale Frage, was die Bedeutung der Organisation für ihre Mitglieder ist. Die Kultur-Kategorie<br />
rückt in diesen Konzepten tatsächlich in den Mittelpunkt der Analyse, d. h. das Unternehmen/die<br />
Organisation hat nicht nur, sondern es ist Kultur (dazu auch: Neuberger/Kompa 1987). Versteht man<br />
den cultural turn als Hinwendung der Sozialwissenschaften zu einer Vorstellung der sozialen Welt<br />
(und damit auch der Unternehmen) als „Produkt kollektiver Sinnsysteme“ (Reckwitz/Sievert 1999),<br />
die eine symbolische Organisation der „Wirklichkeit“ produzieren, und erklärt man in diesem Zuge<br />
den Kulturbegriff zur zentralen Erklärungsvariable, dann trifft dies im Kontext der Unternehmenskultur<br />
für die „root metaphor“-VertreterInnen am ehesten zu. Innerhalb des gesamten Diskurses über<br />
Unternehmenskultur konnte sich diese Strömung, die auch eine Nähe zu sozialkonstruktivistischen<br />
Ansätzen aufweist, allerdings keine dominante Position erkämpfen.<br />
Die Verbreitung des Kulturbegriffs in den Sozialwissenschaften ist zudem untrennbar mit dem Aufstieg<br />
der cultural studies verbunden. Der Kulturbegriff erfuhr hier seit Ende der 50er Jahre durch<br />
Williams, Hoggart und später auch Hall eine signifikante Transformation (vgl. die frühe Spurensuche<br />
von Shuttleworth 1971; Green 1975; Johnson 1983). Kultur wurde in dieser Tradition nicht länger<br />
mit der elitären Hochkultur bildungsbürgerlicher Prägung gleichgesetzt, sondern als heterogenes
18 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
„Shared values“ oder „shareholder value“?<br />
Phänomen, als Vielzahl bestehender Kommunikationsformen und Lebensweisen interpretiert. Diese<br />
Perspektiverweiterung auf populäre und Massenkultur eröffnete auch einer Kulturdefinition Raum,<br />
die auf die Demokratisierung ihrer Zentralkategorie abzielt (Hörning/Winter 1999; Lutter/Reisenleitner<br />
1999).<br />
Diese Abkehr vom Kultur-Elitarismus stellt als Veralltäglichung geradezu eine Säkularisierung dieser<br />
ehedem hoch aufgeladenen Kategorie dar. Eagleton (2001) spricht deshalb von einem „Übergang<br />
von KULTUR zu Kultur“, der auch eine Politisierung des Populären implizierte.<br />
Auch wenn es keine expliziten systematischen Bezugnahmen der Wirtschaftswissenschaften auf diese<br />
Tradition gibt, so dürfte doch der Siegeszug der cultural studies und ihres Kulturverständnisses<br />
insbesondere in den angelsächsischen Ländern auch die Durchsetzung eines Begriffs von Unternehmens-"Kultur"<br />
befördert haben. Gleiches gilt für die Debatte über einen „cultural turn“. Wie dargelegt<br />
kann zwar eine paradigmatische Wende dieser Art für die Wirtschaftswissenschaften in toto<br />
nicht konstatiert werden. Allerdings ist davon auszugehen, dass die wachsende Popularität von „Kultur“<br />
in den Nachbardisziplinen auch ihre Ausbreitung in der Organisationsforschung befördert hat.<br />
Wie definieren die Wirtschaftswissenschaften nun Unternehmenskultur? Blickt man in die Literatur,<br />
finden sich Dutzende von konkurrierenden Definitionen. An diesem Zustand hat sich seit den 80er<br />
Jahren wenig geändert, auch wenn es bereits früh vielversprechende Ansätze zur Systematisierung<br />
des Verhältnisses von Organisation/-Unternehmen und Kultur bei Smircich (1983) oder Allaire/Firsirotu<br />
(1984) oder zur Integration unterschiedlicher Konzepte gab (Sackmann 1983; 1991).<br />
Je nach theoretischer Schwerpunktsetzung finden sich unterschiedliche Perspektiven (vgl. Alvesson/Berg<br />
1992: Kap. 6):<br />
� funktionalistische (Unternehmenskultur als System von tieferen Basisannahmen),<br />
� kognitivistische (System von Kognitionen),<br />
� symbolistische (Symbolsystem),<br />
� konstruktivistische („shared meanings“),<br />
� ideologietheoretische/-kritische (Unternehmensideologie) oder auch<br />
� psychodynamische Perspektiven.<br />
Neuberger/Kompa (1987: 18) sprechen von der „gewohnten Unübersichtlichkeit“ und führen zahlreiche<br />
Beispiele für Begriffsbestimmungen an, denen man einige aktuelle Varianten hinzufügen<br />
kann.<br />
So definiert beispielsweise Schein (1995: 25) Unternehmenskultur als: „Ein Muster gemeinsamer<br />
Grundprämissen, das die Gruppe bei der Bewältigung ihrer Probleme externer Anpassung und interner<br />
Integration erlernt hat, das sich bewährt hat und somit als bindend gilt; und das daher an neue Mitglieder<br />
als rational und emotional korrekter Ansatz für den Umgang mit diesen Problemen<br />
weitergegeben wird.“<br />
Hofstedes (1997: 180) Kurzdefinition zielt primär auf den Aspekt der Abgrenzung spezifischer organisationaler<br />
Kulturen voneinander: Unternehmenskultur ist in dieser Perspektive das „collective programming<br />
of the mind which distinguishes the members of one organization from another“.
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 19<br />
„Shared values“ oder „shareholder value“?<br />
Dagegen heben Trompenaars/Hampden-Turner (1997: 7) in ihrer Definitionsvariante auf den explizite<br />
Ausdruck von Haltungen ab: „The way in which attitudes are expressed within a specific organization<br />
is described as a corporate or organizational culture“.<br />
Cartwright/Cooper (1996: 61) schließlich halten ihre Definition bewusst allgemein: „Organizational<br />
culture is the way in which things get done within an organization“.<br />
Weiter oben wurde darauf verwiesen, dass sich die einzelnen Ansätze normativer Unternehmenskulturliteratur<br />
durch interne Mehrdeutigkeiten wie die Verknüpfungen vager Problemschilderungen<br />
und Lösungswege auszeichnen. Es lässt sich nun festhalten, dass auch zwischen den einzelnen Anätzen<br />
vielfältige Unterschiede existieren, die eine Vergleichbarkeit stark verkomplizieren.<br />
Prabitz (1996: Kap. 6.3) hat die unterschiedlichen Sichtweisen in drei „grand narratives“ der Unternehmenskulturdebatte<br />
gebündelt. Dabei handelt es sich um<br />
1. „Japan, oder Kontrolle durch Sozialisation“. Dahinter steht die Debatte über die hohe Anpassungsfähigkeit<br />
japanischer Beschäftigter in den clan-ähnlich strukturierten Unternehmensgebilden,<br />
die vor allem auf deren sozialisatorisch-kulturelle Vorprägung zurückgeführt wird.<br />
2. „Das Geheimnis des weichen Managements“. Die Kritik mechanistischer Organisationsvorstellungen<br />
und rationalistischer Managementkonstruktionen mündet in eine Vorstellung von symbolischem,<br />
„weichem“ Management, einer „Führung über Motivation“ ein.<br />
3. „Die Riten und Rituale in Unternehmungen“. Diese Idee setzt dem Konzept des funktionierenden<br />
computerähnlich steuerbaren Beschäftigten die Einsicht entgegen, dass es sich bei ihm/ihr<br />
um Individuen handelt, deren Tun stark von sozialen Inszenierungen bestimmt ist, die über Riten<br />
und Rituale vermittelt werden. Die Rolle der Führungskraft besteht darin, dieses „Symbolic<br />
Management“ auf der Unternehmens-Bühne in Szene zu setzen.<br />
Gemeinsam ist sowohl empirisch-analytischen wie normativen Ansätzen die – gelegentlich nur implizite<br />
– Vorstellung, dass ein Verständnis und eine Veränderung organisationaler Abläufe und<br />
Strukturen ein Wissen um die soziale Konstruktion der Wirklichkeit, jene informelle Organisation<br />
voraussetzt. Von Beginn an zielten sie demnach auf eine grundlegende Kritik des alten Forschungsprogramms,<br />
das die symbolische Ebene vernachlässigt hatte (Ebers 1985: Teil I).<br />
Natürlich sind auch die Unternehmenskulturansätze keine fixen theoretische Gebäude, sondern reagieren<br />
im zeitlichen Verlauf auf interne Inkonsistenzen oder praktische Umsetzbarkeitsprobleme.<br />
Sehr bald entfernte man sich in der theoretischen Konzipierung beispielsweise von der Vorstellung<br />
einer vorherrschenden einheitlichen organisationalen Kultur, richtete den Blick damit auch auf das<br />
Zusammenspiel unterschiedlicher Subkulturen (Berthoin Antal et al. 1993).<br />
Auch viele normative Konzepte der Unternehmenskultur zielten als Managementtechnik auf eine<br />
kulturelle Homogenisierung zur Schaffung einer corporate identity ab. Wie bei allen Homogenisierungsstrategien<br />
stellte sich die Frage, welche (organisationalen) Sub-Gruppen und -Kulturen da über<br />
den Kamm der Vereinheitlichung geschoren werden sollen. Drastisch hatten schon die frühen Diskursbeiträge<br />
eine „starke“ und ungebrochene Unternehmenskultur postuliert (z. B. Deal/Kennedy<br />
1982: Kap. 1). Bei Peters/Waterman (1982: 75) zeichnen sich die „exzellenten Unternehmen“ durch<br />
diese Eigenschaft aus: „Without exception, the dominance and coherence of culture proved to be an<br />
essential quality of the excellent companies. Moreover, the stronger the culture and the more it was<br />
directed toward the marketplace, the less need was there for policy manuals, organization charts, or<br />
detailed procedures and rules.“ Eine starke Unternehmenskultur – ist daraus zu schließen – reduziert<br />
die betriebliche Komplexität und senkt die Transaktionskosten. Die Autoren formulieren weiter (77)
20 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
„Shared values“ oder „shareholder value“?<br />
formulierten: „The excellent companies are marked by very strong cultures, so strong that you either<br />
buy into their norms or get out. There is no halfway house for most people in the excellent companies“.<br />
Krell (1996) hat diese Strategien pointiert als potentiell rassistisch und sexistisch gekennzeichnet<br />
(vgl. auch Gherardi 1995; Carl/Krehnke 1997); einige UnternehmenskulturvertreterInnen haben<br />
auf diese Problematik mit dem Versuch einer Ausdifferenzierung als „managing diversity“ reagiert<br />
(so der Titel eines Standardwerks von Gardenswartz/Rowe: 1998; vgl. dazu auch: Loden/Rosener<br />
1991; Cox 1993; Chemers et al. 1995), die eine größere Toleranz betrieblichen Subkulturen gegenüber<br />
einfordert und diese sogar als produktivitätsfördernd interpretiert. Für bestehende Unternehmenskulturen<br />
bedeutet insbesondere das Auftauchen von Unternehmern im Unternehmen („Intrapreneuren“)<br />
eine besondere Herausforderung. Denn der Leitgedanke dieses Rollenvorbilds ist es etwa,<br />
den Wettbewerbsgedanken und die Einzelkämpfermentalität marktförmiger Komplexe zu forcieren<br />
und damit dem Motto der Stiftung von Kohäsion eher zuwider zu laufen. Von Vertretern der<br />
von Intrapreneurshipkonzepte wird daher seit Jahren der Anspruch nach einer dienlichen<br />
Unternehmenskultur (z.B. Duncan et al. 1988; Ellig 2001) vorgetragen, die beiden populären Managementdiskurse<br />
überschneiden sich zur Zeit mannigfach (vgl. Brinkmann/Dörre 2006).<br />
Anspruchsvolle empirische Studien, die quantitative und qualitative Erhebungsmethoden miteinander<br />
kombinieren, sind rar gesät. Hofstede (1997: Kap. 8) hat eine solche Untersuchung durchgeführt,<br />
die zudem international vergleichend angelegt ist und mit der Analyse von einzelnen Unternehmenseinheiten<br />
(„units“) der Überlegung Tribut zollt, dass sich deutliche Differenzen zwischen organisationalen<br />
Subkulturen festmachen lassen, welche sich beispielsweise auf hierarchische oder funktionale<br />
Unterschiede zurückführen lassen. Um „the whole (the Gestalt) of the unit’s culture“ der untersuchten<br />
organisationalen Einheiten zu eruieren, wurden die Organisationsangehörigen (ManagerInnen<br />
und Beschäftigte) nach organisationalen Symbolen, „Helden“ („heroes“), Ritualen und Werten<br />
befragt. Als zentrales Ergebnis dieser Befragung hielt die Forschergruppe fest, dass sich Unternehmenskultur<br />
in sechs Dimensionen unterteilen lässt.<br />
1. Process oriented vs. results oriented<br />
2. Employee oriented vs. job oriented<br />
3. Parochial vs. professional<br />
4. Open system vs. closed system<br />
5. Loose control vs. tight control<br />
6. Normative vs. pragmatic<br />
Die Anlage von Hofstedes Untersuchung unterscheidet sich von einem Gutteil der (Beratungs-) Literatur<br />
zur Unternehmenskultur, bei der empirische Verweise – sofern überhaupt vorhanden – oftmals<br />
nur Ornament sind oder als willkürliche Zitate oder Statistiken der Untermauerung normativer<br />
Aussagen dienen (vgl. unten).<br />
2 Unternehmenskultur im Diskurs: der Verlauf einer Debatte<br />
Spricht man VertreterInnen der Betriebswirtschaftslehre im Jahr 2002 auf das Konzept „Unternehmenskultur“<br />
an, so erhält man gemeinhin die Antwort, das Thema sei „abgegrast“, „nicht mehr angesagt“<br />
oder „irgendwie nicht mehr so aktuell“. Was steckt hinter diesen erfahrungsgesättigten Stellungnahmen?<br />
Wann war Unternehmenskultur „angesagt“, und seit wann ist dies nicht mehr der Fall?<br />
Nachdem ab Ende der 60er Jahre in den sozialwissenschaftlichen Debatten eine zunächst noch diffuse<br />
Vorstellung von einer kulturellen Dimension von Organisationen aufgekommen war, betrat ab
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 21<br />
„Shared values“ oder „shareholder value“?<br />
Anfang der 80er Jahre die Kategorie der Unternehmenskultur oder corporate culture die Diskursbühne<br />
– wahrscheinlich mit einer Titelgeschichte der Zeitschrift „Business Week“ (10/1980) – und<br />
nimmt ihren Weg in die Wissenschaft spätestens mit dem Erscheinen der angesprochenen Monographie<br />
von Deal und Kennedy (1982), die die Bezeichnung im Titel trägt, und der im gleichen Jahr erschienenen<br />
und bis heute in unzähligen Auflagen und Sprachen verbreiteten Schrift von Peters/Waterman:<br />
„In search of excellence“ (1982). Die deutsche Betriebswirtschaftslehre beschränkt sich in<br />
den ersten Jahren vor allem auf eine deskriptive Übernahme der enthusiastischen amerikanischen<br />
corporate culture-Debatte, bevor sie ab Mitte der 80er Jahre eigene kritische Herangehensweisen<br />
formuliert (für eine Übersicht dazu vgl. Schmidt 1995: 2.2).<br />
Um einen Überblick über die quantitative Entwicklung des Diskurses zu gewinnen, wurde in den internationalen<br />
Datenbanken ABI und Sociological Abstracts sowie in den deutschen Datenbanken<br />
WISO II und WISO III eine Fundstellenauszählung durchgeführt. Suchkriterium war stets die Kategorie<br />
„organizational culture“/„corporate culture“/„Unternehmenskultur“. Fand sich eines dieser<br />
Komposita in Überschrift oder Kurzzusammenfassung des Artikels, so wurde davon ausgegangen,<br />
dass der betroffene Beitrag die Unternehmenskulturthematik in relativ zentraler Weise thematisiert 2 .<br />
Die Ergebnisse dieser Analyse sind in Abbildung 1 und 2 dargestellt (vgl. Anhang 1). Die Kurvenverläufe<br />
verdeutlichen, dass der Diskurs spätestens ab Mitte der 80er Jahre einen rasanten Aufstieg<br />
verzeichnete. Seinen Höhepunkt fand er – je nach Datenbank – zwischen 1996 und 1998. Danach<br />
war durchweg eine Abnahme festzustellen, so dass im Jahr 2000 die Anzahl der Artikel im Vergleich<br />
zum Höchststand deutlich gesunken war. In den WISO-Datenbanken lag sie bei nur noch 110 Fundstellen,<br />
was einer Abnahme um 61% im Vergleich zum Höchststand von 1996 gleichkommt<br />
(ABI-Datenbank: 796, entspricht 41% Abnahme im Vergleich zu 1997; Sociological Abstracts: 134,<br />
entspricht einer Abnahme um 22% seit 1998).<br />
In Abbildung 2, der Aufzeichnung des Fundstellenverlaufs in der ABI-Datenbank, findet sich eine<br />
zusätzliche Differenzierung. Abgetragen ist der Anteil jener Beiträge an der jährlichen Gesamtsumme,<br />
die ein Begutachtungsverfahren („peer reviewed“) durchlaufen haben. Bei Zeitschriften mit einem<br />
peer review-Verfahren handelt es sich zumeist um wissenschaftliche Organe, die sich nicht primär<br />
an VertreterInnen der Management-Praxis richten. Die Entwicklung der Summe dieser begutachteten<br />
Artikel zeigt deutlich weniger Ausschläge im zeitlichen Verlauf als jene der nicht-begutachteten;<br />
ihr Anteil an allen unternehmenskulturrelevanten der ABI-Datenbank beträgt im Durchschnitt<br />
des Beobachtungszeitraumes 22,6%, sinkt aber in den Hochphasen des Diskurses auf bis zu 14,9%<br />
ab (1997). Daraus lässt sich die Tendenz ableiten, dass es vor allem die normative Beratungsliteratur<br />
2 Bei dieser Art einer Datenpräsentation ließe sich beanstanden, dass die Datenbanken selber in einer diachronen<br />
Perspektive keine fixe Grundgesamtheit darstellen. Wählte man, um diesen Einwand zu berücksichtigen,<br />
die alternative Darstellung einer Abbildung von Fundstellenanteilen an der jeweiligen jährlichen<br />
Gesamtzahl der Artikel, so ergibt sich daraus zwar eine geringfügige Abschwächung des Anstiegs. An den<br />
für diesen Kontext relevanten Grundfeststellungen der deutlichen und deutlich unterschiedlichen Kurvenverläufe<br />
ändert dies allerdings nichts – dies insbesondere, wenn man sich vergegenwärtigt, dass in den letzten<br />
Jahren mit einer wachsenden Grundgesamtheit eine deutlich sinkende Zahl von Fundstellen einhergeht.<br />
Lediglich zur besseren Anschaulichkeit wurde deshalb zur Darstellung der Entwicklung absolute Zahlen<br />
gewählt. Zur Kontrolle der Ergebnisse wurde auch der Kurvenverlauf für die Fundstellen im ILTIS- Informationssystem<br />
der Deutschen Bibliothek erstellt. In seinem Zentralkatalog findet man ca. 5. Millionen Titel<br />
der Deutschen Nationalbibliographie seit 1945. Auch hier findet sich ein paralleler Verlauf mit einem<br />
Maximum im Jahr 1997.
22 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
„Shared values“ oder „shareholder value“?<br />
ist, die den modischen Schwankungen unterliegt, während die wissenschaftliche Beschäftigung der<br />
Zunft mit der Thematik verglichen damit kontinuierlicher, aber auch weniger spektakulär verläuft.<br />
3 Aspekte des Niedergangs<br />
Einer der profiliertesten Forscher zur Unternehmenskultur hielt 1997 fest, dass auch dieses Konzept<br />
letztlich eine Modeerscheinung bleiben dürfte: „Fads pass, and this one, too, may be out of fashion<br />
one day, but not without having left its trace“ (Hofstede 1997: 179). Anhand der in (B) präsentierten<br />
Daten lässt sich sehr deutlich ablesen, dass diese Aussage ungefähr auf dem Höhepunkt des corporate<br />
culture-craze getroffen wurde. Es stellt sich deshalb abschließend die Frage, vor welchem Hintergrund<br />
dieser Niedergang stattfindet.<br />
Unternehmenskultur zwischen Normativität und Empirie<br />
Mit dem Aufkommen des Diskurses zur Unternehmenskultur verbanden sich eine Reihe von Hoffnungen<br />
auf neue theoretische Perspektiven. Namhafte OrganisationstheoretikerInnen hatten beispielsweise<br />
seit längerem eine verstärkte historische Betrachtung ihres Forschungsgegenstandes eingefordert<br />
(z. B. Kieser 1994), und eine Zeitlang ging man davon aus, dass Unternehmenskulturstudien<br />
genau diesen Aspekt in die Disziplin einbringen würden. Diese Hoffnung allerdings wurde<br />
kaum erfüllt, wie Rowlinson/Procter (1999) feststellen.<br />
Ein zentrales Problem vieler Veröffentlichungen zur Unternehmenskultur ist ihr ungeklärtes Verhältnis<br />
von Normativität und Empirie. Tiebler/Prätorius (1993: Teil 2) verweisen in ihrem Überblick<br />
zur Unternehmenskulturforschung auf die „intuitiven Ansätze“ und „vagen Gestaltungsvorschläge“<br />
der Literatur, die „einen starken Überhang auf Seiten der praxisorientierten Literatur“ zeige. Immer<br />
wieder findet sich eine fehlende Trennschärfe von einerseits normativen und andererseits empirisch-verhaltenswissenschaftlichen<br />
Herangehensweisen, es mangelt an methodischen Reflexionen<br />
und nicht selten bereits an präzisen Frage- und Problemstellungen (Osterloh 1988).<br />
In einer kürzlich veröffentlichten Studie zur „Unternehmenskultur in jungen Unternehmen der Multimedia-Branche“<br />
(Bertelsmann Stiftung 2000) beispielsweise hatten die Autoren 250 Unternehmen<br />
angeschrieben und von ca. 10% eine Antwort erhalten. In der Auswertung der Ergebnisse liest man:<br />
„Das Phänomen Unternehmenskultur ist für die deutliche Mehrheit junger Multimedia-Unternehmen<br />
kein Modethema. 75% sehen in diesem Bereich Handlungsbedarf, und 54% bemühen sich bereits<br />
um eine bewusste Gestaltung ihrer Kultur, da sie als wichtiger Wettbewerbsfaktor angesehen<br />
wird. In der Tat lässt sich eine Beziehung zwischen Unternehmenskultur und Unternehmenserfolg<br />
ausmachen: Sämtliche Unternehmen, die sich der Gruppe der aktiven ‘Kulturgestalter’ zuordnen,<br />
schätzen ihren Erfolg besser als den branchenüblichen Erfolg ein. Damit zeigt sich, dass Unternehmenskultur<br />
einerseits vom Management als Gestaltungsaufgabe wahrgenommen wird und dass andererseits<br />
jene Unternehmen, die dieser Aufgabe nachkommen, auch tendenziell erfolgreicher sind.“<br />
Der problematische Umgang mit empirischen Daten lässt sich hier exemplarisch aufzeigen: Auf der<br />
Basis eines vergleichsweise geringen und womöglich mit einem Bias behafteten Rücklaufs von 10%,<br />
also 25 Unternehmen, werden sehr weitreichende verallgemeinernde Schlussfolgerungen zum Zusammenhang<br />
von Unternehmenskultur und Unternehmensperformanz gezogen. Ferner scheint man<br />
sich bei der Einschätzung einer so komplexen Konstruktion wie des „Unternehmenserfolgs“ nicht<br />
auf unabhängig erhobene Variablen, sondern auf die Eigenwahrnehmung der Unternehmen im Ver-
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 23<br />
„Shared values“ oder „shareholder value“?<br />
gleich zur Gesamtbranche zu verlassen. Zahlreiche Fragen bleiben somit offen: Inwieweit repräsentieren<br />
die Untersuchungsbetriebe die Grundgesamtheit? Haben möglicherweise nur jene Unternehmen<br />
geantwortet, die „Unternehmenskultur“ zum Programm erhoben haben, wie sieht die Binnendifferenzierung<br />
und damit der Vergleichbarkeit der jeweiligen Unternehmenskulturkonzepte aus?<br />
Gab es möglicherweise vor allem Antworten von jenen Betrieben, die eine Öffentlichkeitsabteilung<br />
haben, welche Befragungen dieser Art professionell beantwortet? Dies würde darauf hinweisen, das<br />
vor allem große Unternehmen den Rücklauf ausmachen, was wiederum Rückschlüsse auf ihre gefestigte<br />
Marktposition und den daran anknüpfenden Unternehmenserfolg zuließe. In diesem Fall hätten<br />
wir es bei der behaupteten ceteris paribus-Beziehung zwischen Unternehmenskultur und Unternehmenserfolg<br />
möglicherweise mit einer Scheinkorrelation zu tun. Außerdem: Gesetzt den Fall, eine<br />
unabhängige Untersuchung des Unternehmenserfolgs ergäbe, dass ein Teil der 90% Nicht-Beantworter<br />
eine bessere Performanz (z.B. beim kurzfristigen return) zeitigt: Was bedeutet dies für das<br />
Konzept Unternehmenskultur?<br />
Kieser (1996: FN 15) führt einige Beispiele aus der Beratungsliteratur an, bei denen empirisch abgesicherte<br />
Studien in unzulässiger Weise verkürzt oder generalisiert wiedergegeben werden, so dass<br />
gar der Eindruck einer Manipulation der Daten entsteht. All dies führte dazu, dass viele empirisch<br />
ausgerichtete SozialwissenschaftlerInnen von der Begrifflichkeit bewusst keinen Gebrauch machen,<br />
obwohl sie den eigenen Forschungsansätzen, beispielsweise der Untersuchung einer „Betrieblichen<br />
Sozialordnung“ (Kotthoff 1994), potentiell nahe stünden.<br />
Zahlreiche Veröffentlichungen legen ihren Annahmen einen normativ hoch aufgeladenen Unternehmenskulturbegriff<br />
zugrunde. Es ist auch kein Zufall, dass sich diese Phänomene gehäuft im Kontext<br />
von Untersuchungen zur so genannten „new economy“ finden lassen, da die Berufung auf eine spezifische<br />
Unternehmenskultur hier lange zum „guten Ton“ gehörte – die Inszenierung innerbetrieblicher<br />
Gleichheit stellte hier gewissermaßen einen ihrer Gründungsmythen dar. In jüngster Zeit hat<br />
sich beispielsweise das Cluetrain-Manifest (vgl. Anhang 2) in dieser Hinsicht prominent platzieren<br />
können, ein Steinbruch aus Binsenweisheiten, Banalitäten, Pathos, Mythen, Schönfärbereien und<br />
(augenzwinkerndem?) Nonsense, der in teils krassem Gegensatz zu den ökonomischen Realitäten<br />
und Arbeitsbedingungen in den bejubelten Wirtschaftszweigen steht (dazu auch Müller 2002: Kap.<br />
13).<br />
Die Binnenperspektive von Organisationen: Zweifel und Enttäuschungen<br />
Auch in der Unternehmenskulturforschung hat sich die Perspektive verbreitet, dass die jeweilige hierarchische<br />
Position der Beschäftigten einen durchaus signifikanten Einfluss auf deren Haltung zur<br />
„Unternehmenskultur“ hat (Ogbonna/Harris 1998). Deshalb soll im folgenden zunächst ein Blick auf<br />
die lohnabhängig Beschäftigten, dann auf das Management und deren jeweils veränderte Haltung<br />
zum Unternehmenskulturkomplex geworfen werden.<br />
Unternehmenskultur wird zur UNTERNEMENSKULTUR:<br />
die Beschäftigtenperspektive<br />
Der Gebrauch der Kultur-Kategorie birgt Eagleton (2001: 96) zufolge im Kapitalismus stets „die Gefahr,<br />
die Aufmerksamkeit auf die groteske Kluft zwischen ihrer geistigen Rhetorik und der unschönen<br />
Prosa des kapitalistischen Alltags zu lenken“. Was Eagleton auf den Kapitalismus als Gesamt
24 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
„Shared values“ oder „shareholder value“?<br />
system bezieht, lässt sich auch auf das Phänomen einer Unternehmenskultur anwenden, die mit idealistischen<br />
Schönwetter-Konzepten auf der betrieblichen Ebene hantiert.<br />
Insbesondere in Krisenzeiten kann der instrumentelle Charakter der Unternehmenskultur deutlich<br />
hervortreten; erst kürzlich offenbarte auch die new economy, wie sie sich ihrer zelebrierten kulturellen<br />
Andersheit zum Trotz auf keineswegs neue Krisenbewältigungsstrategien besinnen musste. So<br />
verschwanden erst die Symbole eines „lockeren“, kulturell-egalitären Anspruchs wie Tischtennisplatten<br />
und Kicker-Automaten, später auch mehr und mehr die lohnabhängig Beschäftigten selbst<br />
aus den Großraumbüros. Beim Sinken des Gefährtes stellte sich heraus, dass man zwar gemeinsam in<br />
einem Boot vor dem Wind gesegelt war, dass aber im Notfall keineswegs für alle Beteiligten<br />
Rettungsboote vorhanden waren.<br />
Insbesondere wenn Unternehmenskulturkonzepte zur Krisenbewältigung und Entlassung genutzt<br />
werden sollen, wird deren potentiell instrumenteller Charakter deutlich. Solche „Downsizing-Prozesse“<br />
beschreiben De Vries/Balazs (1996). In den zusammenfassenden Bemerkungen zu ihrem<br />
Aufsatz „The human side of downsizing“ halten sie fest: „Individual reaction patterns to downsizing<br />
operations are explored in the victims, the survivors (those staying with a company after layoffs) and<br />
the ›executioners‹ (those responsible for the implementation of downsizing) involved in the process.<br />
[…] It is suggested that management should abandon the word ›downsizing‹ altogether and replace it<br />
with the term ›corporate transformation‹ – the process of continuously aligning the organization with<br />
its environment and the shaping of an organizational culture in which the enduring encouragement of<br />
new challenges stands central.“<br />
Sehr deutlich wird hier der angestrebte Etikettenschwindel. Den „executioners“ wird empfohlen, im<br />
Falle von Schließungs- und Entlassungsvorgängen den an sich schon euphemistischen Terminus<br />
„down-sizing“ mit „Unternehmenstransformation“ zu ersetzen, der eine „Unternehmensanpassung“<br />
an ihre Umgebung und die Formierung einer Unternehmenskultur impliziere, in der die andauernde<br />
Ermutigung zu neuen Herausforderungen einen zentralen Stellenwert besitzen solle. Zu glauben, die<br />
victims und survivors durchschauten diese Instrumentalisierung nicht, dürfte allerdings ein Trugschluss<br />
sein. Mit der Verbreitung solcher Strategien dürften Unternehmenskulturkonzepte an sich<br />
eine deutliche Desavouierung bei den Belegschaften erfahren.<br />
Beim angeführten Beitrag handelt es sich auch keineswegs um einen Ausnahmefall: „Nie zuvor hat<br />
der unternehmerische Diskurs so oft von Vertrauen, Zusammenarbeit, Verlässlichkeit von Unternehmenskultur<br />
gesprochen wie in einer Zeit, in der das kurzfristige Einvernehmen einer jeden Arbeitskraft<br />
durch die Austilgung aller Sicherheiten erreicht wird“, hält Bourdieu (1998: 113) fest. Eine ursprünglich<br />
angestrebte Stärkung von Loyalität, Commitment und Vertrauen der Beschäftigten wird<br />
damit eher untergraben (Sennett 2000; Seifert 2001), oder wie Wächter formuliert: „Wie kann ein<br />
Unternehmen von seinen Arbeitnehmern Initiative und eigenmotiviertes Handeln erwarten, wenn<br />
nicht als Gegenleistung bindende Versprechen, etwa bezüglich Beschäftigungssicherheit, abgegeben<br />
werden?“ (Wächter 1998). Es nimmt deshalb nicht wunder, wenn Belegschaften „Unternehmenskultur“<br />
und andere „weiche“ Managementkonzepte aufgrund der gesammelten Erfahrungen nicht selten<br />
als „Rationalisierungstrick“ (Dörre/Neubert), als „management by ideology“ (Cummings) interpretieren,<br />
das auf unkritische Affirmation abzielt. Zwar bedeutete die Führung kapitalistischer Unternehmungen<br />
immer schon ein Gutteil ideologischer Praxis. Das Neuartige der Unternehmenskulturkonzepte<br />
sieht Morgan (1986: 138) aber in „the not-so-subtle way in which ideological manipulation<br />
and control is being advocated as an essential managerial strategy“.
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 25<br />
„Shared values“ oder „shareholder value“?<br />
Wenn vermerkt wird, dass viele Unternehmenskulturkonzepte statt auf Information und Partizipation<br />
eher auf kritiklose Affirmation setzen, deutet sich damit bereits eine weitere Problemlage an.<br />
Oben war dargelegt worden, dass der Einzug der Kultur in die Sozialwissenschaften im Zuge der Rezeption<br />
der cultural studies eine Art Säkularisierung des KULTUR-Begriffs mit sich brachte, die zumindest<br />
in Teilen der Wirtschaftswissenschaften sowie bei Beschäftigten und Gewerkschaften auch<br />
mit der Hoffnung auf eine Demokratisierung und Humanisierung der Arbeitswelt verbunden war. Je<br />
deutlicher nun der instrumentelle Charakter dieser Konzepte in den Vordergrund tritt, um so offensichtlicher<br />
wird, dass es sich bei ihrer anti-elitaristischen Stoßrichtung oftmals eher um eine Pose als<br />
um eine ernstgemeinte Partizipationsofferte handelt. Aus der Perspektive des shop-floors mutiert<br />
Kultur als „Unternehmenskultur“ wieder zu einer elitären Top-Down-Strategie, denn es geht darum,<br />
„how founders as leaders create and develop culture“ (Schein 1997: Kap. 4).<br />
KULTUR hatte einen elitären Anspruch, als corporate culture erfährt sie auf diese Weise tendenziell<br />
eine Refeudalisierung und verkommt oftmals wieder zur elitären Veranstaltung eines Managements,<br />
das darauf bedacht ist, den „Herr-im-Hause“-Standpunkt nicht zu gefährden. Beschäftigte erleben<br />
diese Widersprüchlichkeit ihrer behaupteten, aber nur halbherzig praktizierten Einbeziehung als<br />
schleichende Entpolitisierung. Dies bedeutet für sie letztlich: Unternehmenskultur wird zur UNTER-<br />
NEMENSKULTUR.<br />
All dies deutet darauf hin, dass – wie auch nicht anders zu erwarten war – die traditionellen betrieblichen<br />
Herrschaftsverhältnisse von Unternehmenskulturkonzepten nicht grundlegend berührt werden.<br />
Um Kultur in der Perspektive der Beschäftigten zu einem verlässlichen Baustein der betrieblichen<br />
Sozialordnung werden zu lassen, bedürfte es deshalb einer Verstetigung im Sinne einer Institutionalisierung<br />
der Instrumente, ohne dass diese zwangsläufig in eine Bürokratisierung einmünden müsste.<br />
Das deutsche Modell der Industriellen Beziehungen bietet dazu mit seinen zahlreichen Informationsund<br />
Mitbestimmungsmöglichkeiten eine Reihe von betrieblichen Ansatzpunkten. Dies haben auch<br />
viele Beschäftigte in Unternehmen der new economy erkannt, in denen sich nach anfänglicher<br />
Ablehnung in Krisenzeiten Betriebsräte zur Verteidigung von Beschäftigteninteressen gebildet<br />
haben.<br />
Die Veralltäglichung des Kulturkonzeptes als Unternehmenskultur stellt sich in der Perspektive der<br />
lohnabhängig Beschäftigten demnach zweischneidig dar: Einerseits bietet sie die Chance zur Demokratisierung,<br />
andererseits die Gefahr der Instrumentalisierung.<br />
Die Perspektive des Managements: Macher und Machtverfall<br />
Auch der Blick auf das Management offenbart eine wachsende Skepsis diesen Konzepten gegenüber.<br />
Unternehmenskultur sei machbar, so lautet die Botschaft, die damit auch offensiv eine „Macher-Ideologie“<br />
und die damit verbundenen Ansprüche befördert (zur Kritik der „Machbarkeit“ von<br />
Unternehmenskultur vgl. Krell 1995). Das Konzept Unternehmenskultur war – wie angedeutet – unter<br />
anderem aus einer Oppositionshaltung dem hard-headed rationality-Management und seinen Allmachtsphantasien<br />
gegenüber entstanden. Aber auch das symbolische Management, das „Führen<br />
durch Motivation“, setzt den zuständigen Machertyp voraus, der alsbald an die Grenzen auch dieses<br />
weichen Managements stößt.<br />
Trifft nun ein oftmals noch tayloristisch sozialisiertes Management auf Implementierungsschwierigkeiten,<br />
so besteht die Gefahr einer frühzeitigen Desillusionierung der Akteure, die feststellen müs
26 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
„Shared values“ oder „shareholder value“?<br />
sen, dass sich Kultur schwerlich taylorisieren lässt. Als typische Problemfelder ergeben sich kulturelle<br />
Divergenzen innerhalb des Unternehmens, das Management von Subkulturen, der hohe Einfluss<br />
externer, unkontrollierbarer Faktoren auf das Unternehmen, Beschäftigtenfluktuation, aber<br />
auch der Verlust von Glaubwürdigkeit in Krisenzeiten. Der klassische Lösungsweg des Managements<br />
für Problemlagen dieser Art wäre seine Einbettung in einen Funktionszusammenhang, sprich<br />
der Aufbau einer „Kultur-Bürokratie“, die aber, wie angedeutet, dem Phänomen kaum angemessen<br />
ist.<br />
Zudem sieht sich das Management auch mit seinem potentiellen Machtverfall konfrontiert. Es bilden<br />
sich in der Regel effektive (Sub-) Kulturen des Widerstands, die nicht durch die VertreterInnen einer<br />
affirmativen Kultur kontrolliert werden können, da die Übernahme einer Kultur – soll sie tatsächlich<br />
verinnerlicht und nicht nur aufgesetzt werden – einen gewissen Spielraum der Freiwilligkeit voraussetzt.<br />
Dieser aber lässt Unsicherheitszonen entstehen, die vom Management nicht mehr durchgehend<br />
kontrolliert werden können. Von Kultur zu reden, impliziert deshalb auch immer eine Offenheit für<br />
die Nichtplanbarkeit organisationaler Prozesse, bedeutet die Akzeptanz von Subkulturen und des<br />
Kulturschaffens bottom-up. Und genau diese Akzeptanz scheint zu schwinden.<br />
Die skizzierte temporäre Übereinkunft von Top-Management und Beschäftigten(-Vertretungen) zur<br />
Betonung weicher, partizipativer Verfahren wie dem Konzept Unternehmenskultur muss deshalb oft<br />
dann zerbrechen, wenn das Top-Management den Beschäftigten gegenüber diesen Macht- und Kontrollverlust<br />
konstatieren muss. Historisch war es deshalb nahezu erwartbar, dass spätestens zu diesem<br />
Zeitpunkt wiederum Konzepte einer Re-Taylorisierung (Springer 1999) aufs Tapet gebracht<br />
wurden, wie dies Ende der 90er Jahre geschah. Denn die mit einer erweiterten Partizipationsmöglichkeit<br />
gewonnenen Dispositionsspielräume wurden von Beschäftigten natürlich auch für eigene Interessen<br />
genutzt. Aus Arbeitgeber- bzw. Management-Perspektive musste demnach die mit den<br />
Property Rights verbundene Dispositionsmacht immer stärker gefährdet erscheinen.<br />
Von den „shared values“ zum „shareholder-value“: industriepolitischer und<br />
ideologischer Backlash<br />
Der Wechsel der Managementmoden trifft irgendwann auch das Konzept Unternehmenskultur; der<br />
„industriepolitische Pendelschlag“ (Dörre 2001) zurück setzt einen ideologischen backlash hinsichtlich<br />
der „weichen Faktoren“ gleichsam voraus. Dazu zählt nicht nur die angesprochene Re-Taylorisierung,<br />
sondern auch die zunehmende Vermarktlichung organisationaler Beziehungen, Kurzfristigkeit<br />
im Denken und nicht zuletzt die Vernachlässigung positiver und negativer externer Effekte, zu<br />
denen auch solche zählen, die innerhalb von Unternehmenskulturkonzepten Relevanz entfalten (wie<br />
die Weiterbildung).<br />
In einem herrschaftlich stark vorstrukturierten Raum wie einem kapitalistischen Unternehmen existiert<br />
immer schon eine Schieflage hinsichtlich der Frage nach dem Ausgang des Kampfes um das<br />
herrschende Bewusstsein als kultureller Hegemonie; aber die Freiräume für oppositionelle Subkulturen<br />
reduzieren sich drastisch mit dem Aufkommen und der Verallgemeinerung des shareholder value-Denkens<br />
und dessen Geringschätzung des Humankapitals im Vergleich zum Aktienwert des<br />
Unternehmens.<br />
Wenn Unternehmenskulturkonzepte oben als Form eines „weichen“ Managements gekennzeichnet<br />
worden waren, so wird diese Bezeichnung insbesondere im Kontrast zum „harten“ shareholder va-
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 27<br />
„Shared values“ oder „shareholder value“?<br />
lue-Konzept deutlich. Mit dessen Verbreitung (Dörre 1997; Windolf 2001) droht nun auch der Stern<br />
der „Unternehmenskultur“ zu verglühen. Ein primär am aktuellen messbaren Unternehmenswert und<br />
seiner kurzfristigen Steigerung orientiertes Management wird die Finger von langfristigen und kaum<br />
quantifizierbaren Strategien lassen, denn Kultur muss sich dann wie jeder andere Produktionsfaktor<br />
kurzfristig „rechnen“. Und genau darin besteht das Problem, auch wenn es immer wieder Beiträge<br />
gibt, die auf Kostenvorteile durch die Umsetzung von Unternehmenskulturkonzepten verweisen:<br />
„Unawareness of culture can cost you“ (Bliss 1999). Lässt man einer bottom up-Kultur zu freie<br />
Hand, so erhöht man zwar möglicherweise langfristig das Commitment der Belegschaft, kurzfristig<br />
aber auch die Transaktionskosten und verschärft die Kontrollproblematik, was oft ein „Ende der<br />
Unternehmenskultur“ (Staute) als normatives Konzept einläutet.<br />
In einer frühen Kritik an Peters/Waterman schrieb Wächter (1985: 609), dass es gerade die von diesen<br />
Autoren hochgelobten „exzellenten Unternehmen“ waren, die sich in den Jahrzehnten zuvor<br />
nicht an die Ratschläge damaliger Berater gehalten hätten. Er fragte: „Könnte es sein, dass die erfolgreichen<br />
Unternehmen von morgen gerade diejenigen sind, die sich heute weniger exzellent verhalten?“<br />
Heutige shareholder value-Vertreter werden diese Frage zweifellos bejahen.<br />
Die Entfesselung der Marktkräfte zwischen, vor allem aber auch innerhalb von Unternehmen führt<br />
zu einer „Destruktion der internen betrieblichen Sozialintegration“, das Unternehmen wird „zu einem<br />
Inselmeer partikularer Subkulturen“, wie Kotthoffs Studien eindrucksvoll belegen (1997: 182<br />
f.). Gerade diese Ausbreitung von Partikularismus und Indifferenz bei den Beschäftigtengruppen<br />
stellt aber die Gestaltbarkeit von Unternehmenskultur weiter in Frage.<br />
Die relevante Literatur verdeutlicht: Immer öfter wird der Begriff „Unternehmenskultur“ heute gemieden,<br />
oder er mutiert zu einer reinen Formalkategorie ohne spezifische inhaltliche Aufladung bzw.<br />
zu einer Floskel (auch die shareholder value-Orientierung ist in dieser Logik eine spezifische Unternehmenskultur).<br />
Darauf verweist auch seine steigende Verbreitung in der Tagespresse. Während in<br />
der Beratungsliteratur und in den wissenschaftlichen Abhandlungen seit Mitte der 90er Jahre der beschriebene<br />
Rückgang zu beobachten ist, findet sich in der Tagespresse eine stetige Zunahme. So beispielsweise<br />
in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von 25 Fundstellen in 1994 auf 96 Fundstellen in<br />
2000.<br />
4 Schluss<br />
„Why is the organizational culture revolution not being openly suppressed?“ fragt Hummel (1994:<br />
493) augenzwinkernd mit Blick auf die staatliche Bekämpfung der Kultur-Revolte der 68er Bewegung.<br />
Dies sei besonders verwunderlich, da der Unternehmenskulturansatz einst mit „the promise of<br />
revolution“ angetreten sei. Die voranstehenden Ausführungen wollten zur Beantwortung dieser Frage<br />
beitragen. Sie sollten zeigen, wie sich der Diskurs über die Unternehmenskultur von seinen Anfängen<br />
1980 über den Höhepunkt 1996-1998 bis zu seiner heutigen Krise entwickelt hat.<br />
Der Aufstieg des Konzeptes verknüpfte sich mit den zeitgenössischen sozioökonomischen Kontexten<br />
und Diskursen, aber auch mit den teilweise schon jahrzehntealten Traditionen. Unternehmenskulturansätze<br />
stellten sowohl eine Management-Modeerscheinung als auch einen Antwortversuch<br />
auf die Produktivitätskrisen der fordistischen Produktionsweise dar. Zudem ermöglichten sie es dem<br />
Top-Management, die Machtposition aufgrund seiner strategischen Vorherrschaft zu sichern. Dies<br />
insbesondere dann, wenn es ihm gelang, eine temporäre Koalition mit der Belegschaft zu schließen,
28 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
„Shared values“ oder „shareholder value“?<br />
die ihrerseits auf eine erweiterte Teilhabe an und Einbindung in unternehmensrelevante Entscheidungen<br />
hoffte. Die Popularität der „Kultur“-Kategorie in der Organisationsforschung wurde schließlich<br />
in den Kontext des vermehrten Rückgriffs auf kulturalistische Erklärungsmuster im Zuge des<br />
cultural turns vieler sozialwissenschaftlicher Disziplinen sowie des Aufstiegs der cultural studies gerückt.<br />
Es wurde allerdings festgehalten, dass kulturzentrierte Ansätze – sieht man einmal von ihrer<br />
populären Variante der corporate culture ab – in den wirtschaftswissenschaftlichen Diskursen<br />
lediglich eine marginale Position besetzen. Und auch in der Organisationsforschung ist die „Kultur-<br />
Perspektive“ nicht dominant geworden.<br />
Der Niedergang des Konzepts wurde dementsprechend am Wechsel der Mode ebenso festgemacht<br />
wie am Versuch des Top-Managements, die betrieblichen Machtverhältnisse wieder zu seinen Gunsten<br />
zu verschieben. In der Beschäftigtenperspektive ist es vor allem sein instrumenteller Gebrauch<br />
durch das Management, der eine vermehrte Skepsis und Angst vor Manipulation hervorrief. Festzuhalten<br />
ist dazu, dass Unternehmenskultur als integrationsstiftende Konzeption kaum taugt, wenn sich<br />
Norm und Wirklichkeit nicht mit den Primärerfahrungen der „Angerufenen“ decken, wie dies für<br />
den Fall der Proklamierung von „shared values“ bei einer gleichzeitigen unternehmerischen<br />
Orientierung am „shareholder value“ zutrifft.<br />
Es kann also festgehalten werden, dass ambitionierte Unternehmenskulturansätze wie andere „weiche“<br />
Management-Konzepte Opfer eines ideologischen backlashs im Zuge der Formierung eines<br />
Neuen Produktionsmodells wurden, in dem sich die Dominanz der Orientierung am shareholder<br />
value und der short-run Ökonomie andeutet.<br />
Um Hummels Frage zu beantworten: Die „Revolution der Unternehmenskultur“ wird nicht offen bekämpft,<br />
weil sie sich als zahnlos erwiesen hat. Niemand, der sich um das Fortbestehen existierender<br />
betrieblicher Herrschaftsverhältnisse ängstigt, braucht die Unternehmenskultur, bzw. ihre verbleibenden<br />
Versatzstücke, zu fürchten. Mehr noch: als entleerte Beschwörungsformel lässt sie sich problemlos<br />
in regressive Arbeitspolitiken einbauen und trägt auf ihre Weise damit zur vordergründigen<br />
Inszenierung von Gleichheit und zur Verwischung ehedem präziser Vorstellung der Beschäftigtenpartizipation<br />
bei. Wenn das Konzept bislang nicht wieder in der Versenkung verschwunden ist, so<br />
sind die Ursachen dafür einerseits in dem vorgetragenen Wunsch zu suchen, dem realen Prozess des<br />
Zerfalls von Organisationsstrukturen in irgendeiner Weise kohäsionsstiftend entgegenwirken zu<br />
können: hier liegen die Hoffungen eines geneigten Managements auf der „geteilten Kultur“. Andererseits<br />
ist es gerade das amorphe Phänomen der Unternehmenskultur, das beide Seiten – Beschäftigte<br />
wie Management – von einem gemeinsamen Zusammenhang scheint sprechen zu lassen, der<br />
allerdings bei genauer Betrachtung fast vollständig auseinander fällt.<br />
Was ihre Tragfähigkeit als sozialwissenschaftliche Kategorie anbetrifft, so wurde dargelegt, dass es<br />
zwar eine Reihe gewinnbringender Untersuchungen zur Unternehmenskultur gibt, die in Abgrenzung<br />
von mechanistischen Organisationsvorstellungen die Produktion symbolischer Bedeutungen<br />
der informalen Organisation betonen. Die Nähe zur Management-Beratungsliteratur birgt aber stets<br />
die Gefahr einer Aufweichung von Standards oder Vermischung von Kategorien. Es wäre deshalb zu<br />
fragen, ob Unternehmenskultur als empirisch-analytisches Konzept dadurch „zu retten“ ist, dass man<br />
sie als spezifischen Baustein in Ansätze wie den der „Mikropolitik“ oder der „Betrieblichen Sozialordnung“<br />
integriert. Vielleicht sollte man aber auch zur Abgrenzung in diesem Kontext die<br />
Begrifflichkeit „Organisationskultur“ bevorzugen, um dem „Unbehagen“ (Krell) an der „Unternehmenskultur“<br />
zu begegnen.
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 29<br />
„Shared values“ oder „shareholder value“?<br />
5 Literatur<br />
Aglietta, Michel (2000): Ein neues Akkumulationsregime. Die Regulationstheorie auf dem Prüfstand.<br />
Hamburg: VSA.<br />
Allaire, Yvan/Mihaela E. Firsirotu (1984): Theories of Organizational Culture. In: Organization Studies<br />
5 (3): 193-226.<br />
Alvesson, Mats/Per Olof Berg (1992): Corporate culture and organizational symbolism : an overview.<br />
Berlin: de Gruyter.<br />
Arnold, Thurman Wesley (1943 (1937)): The Folklore of Capitalism. Garden City N.Y.: Blue Ribbon<br />
Books.<br />
Baille, John (1995): Exposing out-oft-date ideals that culture gurus hold dear. In: People Management<br />
(8): 47.<br />
Bate, Paul (1997): Cultural Change. Strategien zur Änderung der Unternehmenskultur. München:<br />
Gerling Akademie Verlag.<br />
Beer, Michael, Bert Spector, Paul R. Lawrence, D. Quinn Mills und Richard E. Walton (Hg.) (1985):<br />
Human Resource Management. A general manager’s perspective. Text and cases. New York/<br />
London: The Free Press.<br />
Bertelsmann Stiftung (2000): Unternehmenskultur in jungen Unternehmen der Multimedia-Branche<br />
(6.3.2000). Gütersloh: Bertelsmann Stiftung (http://www.bertelsmann-stiftung.de/documents/<br />
Auswertungstext.pdf).<br />
Berthoin Antal, Ariane, Meinolf Dierkes und Sabine Helmers (1993): Unternehmenskultur: eine<br />
Forschungsagenda aus Sicht der Handlungsperspektive. In: Meinolf Dierkes, Lutz von Rosenstiel<br />
und Ulrich Steger (Hg.): Unternehmenskultur in Theorie und Praxis. Konzepte aus Ökonomie,<br />
Psychologie und Ethnologie. Frankfurt a M: Campus: 200-218.<br />
Billington, Rosamund, Sheelagh Strawbridge, Lenore Greensides und Annette Fitzsimons (1991):<br />
Culture and Society. A Sociology of Culture. Basingstoke: Macmillan.<br />
Bliss, William G. (1999): Why is Corporate Culture important? In: Workforce (Supplement to the<br />
February 1999): 8-9.<br />
Bourdieu, Pierre (1998): Gegenfeuer. Wortmeldungen im Dienste des Widerstands gegen die neoliberale<br />
Invasion. Konstanz: UVK Universitätsverlag.<br />
Braverman, Harry (1977): Die Arbeit im modernen Produktionsprozeß. Frankfurt a M: Campus.<br />
Brinkmann, Ulrich (2004): Antinomien der Marktgrenzenverschiebung. In: FIAB (Hg.): Jahrbuch<br />
Arbeit, Bildung, Kultur, Bd. 21/22. Recklinghausen: FIAB-Verlag: 65-84.<br />
Brinkmann, Ulrich/Klaus Dörre (2006): Die neue Unternehmerkultur - Zum Leitbild des „Intrapreneurs“<br />
und seinen Implikationen. In: Ulrich Brinkmann, Karoline Krenn und Sebastian Schief<br />
(Hg.): Endspiel des Kooperativen Kapitalismus? - Institutioneller Wandel unter den Bedingungen<br />
des markzentrierten Paradigmas. Opladen: VS - Verlag für Sozialwissenschaften<br />
i. Ersch<br />
Burawoy, Michael (1979): Manufacturing consent. Changes in the labor process under monopoly<br />
capitalism. Chicago/London: University of Chicago Press.<br />
Carl, Andrea-Hilla/Anna Krehnke (1997): Der Gerechte Lohn und die Geschlechterfrage: ein<br />
‘Blinder Fleck’ in den Unternehmenskulturen. In: Ulf Kadritzke (Hg.): ‘Unternehmenskulturen’
30 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
„Shared values“ oder „shareholder value“?<br />
unter Druck. Neue Managementkonzepte zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Berlin: Edition<br />
Sigma: 185-107.<br />
Cartwright, Sue/Cary L. Cooper (1996): Managing Mergers, Acquisitions and Strategic Alliances:<br />
Integrating People and Cultures. Oxford/Auckland/Boston: Butterworth-Heinemann.<br />
Chemers, Martin M., Stuart Oskamp und Mark A. Costanzo (Hg.) (1995): Diversity in Organizations.<br />
New Perspectives for a Changing Workplace. Thousand Oaks: Sage Publications.<br />
Collins, David (1998): Organizational change. Sociological perspectives. London/New York: Routledge.<br />
Cox, Taylor jr. (1993): Cultural diversity in Organizations. Theory, Research & Practice. San Francisco:<br />
Berret-Koehler Publishers.<br />
Crozier, Michel (1964): The bureaucratic phenomenon. London: Tavistock.<br />
Cummings, Larry L. (1983): The Logics of Management. In: Academy of Management Review 8 (4):<br />
532-538.<br />
De Vries, Manfred/Katharina Balazs (1996): The human side of downsizing. In: European Managment<br />
Journal 14 (2): 111-121.<br />
Deal, Terrence E./Allan A. Kennedy (1982): Corporate cultures: the rites and rituals of corporate life.<br />
Reading, Mass.: Addison-Wesley.<br />
Deutschmann, Christoph (1989): Reflexive Verwissenschaftlichung und kultureller ‘Imperialismus’<br />
des Managements. In: Soziale Welt 40: 374-396.<br />
Dörre, Klaus (1997): Unternehmerische Globalstrategien, neue Managementkonzepte und die Zukunft<br />
der Industriellen Beziehungen. In: Ulf Kadritzke (Hg.): ‘Unternehmenskulturen’ unter<br />
Druck. Neue Managementkonzepte zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Berlin: Edition Sigma:<br />
15-44.<br />
Dörre, Klaus (1999): Global Players, Local Heroes. Internationalisierung und regionale Industriepolitik.<br />
In: Soziale Welt 50 (2): 187-206.<br />
Dörre, Klaus (2001): Das deutsche Produktionsmodell unter dem Druck des Shareholder Value. In:<br />
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 53: 675-704.<br />
Dörre, Klaus/Jürgen Neubert (1995): Neue Managementkonzepte und industrielle Beziehungen:<br />
Aushandlungsbedarf statt ‘Sachzwang Reorganisation’. In: Georg Schreyögg/Jörg Sydow (Hg.):<br />
Managementforschung 5. Empirische Studien. Berlin/New York: Walter de Gruyter: 167-213.<br />
Dörre, Klaus/Ulrich Brinkmann (2005): Finanzmarktkapitalismus - Triebkraft eines flexiblen Produktionsmodells?<br />
In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (Sonderheft: Finanzmarktkapitalismus.<br />
Analysen zum Wandel von Produktionsregimen): 85-116.<br />
Eagleton, Terry (2001): Was ist Kultur? Eine Einführung. München: C.H. Beck.<br />
Ebers, Mark (1985): Organisationskultur: ein neues Forschungsprogramm. Wiesbaden: Gabler.<br />
Ebers, Mark (1988): Der Aufstieg des Themas ‘Organisationskultur’ in problem- und disziplingeschichtlicher<br />
Perspektive. In: Eberhard Dülfer (Hg.): Organisationskultur. Phänomen - Philosophie<br />
- Technologie. Stuttgart: Poeschel: 23-48.<br />
Friedeburg, Ludwig von (1963): Soziologie des Betriebsklimas. Studien zur Deutung empirischer<br />
Untersuchungen in industriellen Großbetrieben. Frankfurt a M: Europäische Verlagsanstalt.<br />
Gardenswartz, Lee/Anita Rowe (1998): Managing Diversity: a complex desk reference and planning<br />
guide (rev. ed.). New York: McGraw-Hill.
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 31<br />
„Shared values“ oder „shareholder value“?<br />
Gherardi, Sylvia (1995): Gender, Symbolism and Organizational Cultures. London: Sage.<br />
Goffman, Erving (1983 (1959)): Wir spielen alle Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag. München:<br />
Piper.<br />
Green, Michael (1975): Raymond Williams and Cultural Studies. In: Working Papers in Cultural Studies<br />
(6): 31-48.<br />
Heinen, Edmund (Hg.) (1987): Unternehmenskultur. Perspektiven für Wissenschaft und Praxis.<br />
München/Wien: Oldenbourg.<br />
Hildebrandt, Eckart/Rüdiger Seltz (1987): Managementstrategien und Kontrolle. Eine Einführung<br />
in die Labour Process Debate. Berlin: Edition Sigma.<br />
Hirsch, Joachim (1995): Der nationale Wettbewerbsstaat. Staat, Demokratie und Politik im globalen<br />
Kapitalismus. Berlin/Amsterdam: Edition ID-Archiv.<br />
Hirsch, Joachim/Roland Roth (1986): Das neue Gesicht des Kapitalismus. Vom Fordismus zum<br />
Postfordismus. Hamburg: VSA.<br />
Hofstede, Geert (1997): Cultures and organizations: software of the mind. London: McGraw-Hill.<br />
Hörning, Karl H./Rainer Winter (Hg.) (1999): Widerspenstige Kulturen. Cultural Studies als Herausforderung.<br />
Frankfurt a M: Suhrkamp.<br />
Hummel, Ralph P. (1994): Organization Culture: Movement or Scandal. In: Public Administration<br />
Review 54 (5): 493-495.<br />
Jacobsen, Niels (1996): Unternehmenskultur: Entwicklung und Gestaltung aus interaktionistischer<br />
Sicht. Frankfurt a M: Peter Lang.<br />
Johnson, Richard (1983): What is Cultural Studies anyway? In: Department of Cultural Studies.<br />
Stencilled Occasional Papers (9/1983).<br />
Kadritzke, Ulf (1997): Edtorial. In: Ulf Kadritzke (Hg.): ‘Unternehmenskulturen’ unter Druck. Neue<br />
Managementkonzepte zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Berlin: Edition Sigma: 7-11.<br />
Kieser, Alfred (1994): Why organization theory needs historical analyses - and how these should be<br />
performed. In: Organization Studies (5): 608-620.<br />
Kieser, Alfred (1996): Moden & Mythen des Organisierens. In: Die Betriebswirtschaft 56: 21-39.<br />
Kochan, Thomas A./Thomas A. Barocci (1985): Human resource management and industrial relations:<br />
texts, readings, and cases. Boston: Little, Brown and Company.<br />
Kotthoff, Hermann (1994): Betriebsräte und Bürgerstatus. Wandel und Kontinuität betrieblicher<br />
Mitbestimmung. München/Mering: Rainer Hampp Verlag.<br />
Kotthoff, Hermann (1997): Hochqualifizierte Angestellte und betriebliche Umstrukturierung: Erosion<br />
von Sozialintegration und Loyalität im Großbetrieb. In: Ulf Kadritzke (Hg.):<br />
‘Unternehmenskulturen’ unter Druck. Neue Managementkonzepte zwischen Anspruch und<br />
Wirklichkeit. Berlin: Edition Sigma: 163-184.<br />
Krell, Gertraude (1994): Vergemeinschaftende Personalpolitik: normative Personallehren, Werksgemeinschaft,<br />
NS-Betriebsgemeinschaft, Japan, Unternehmenskultur. München/Mering: Rainer<br />
Hampp Verlag.<br />
Krell, Gertraude (1995): Neue Kochbücher, Alte Rezepte. ‘Unternehmenskultur’ in den 90er Jahren.<br />
In: Die Betriebswirtschaft 55 (2): 237-250.
32 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
„Shared values“ oder „shareholder value“?<br />
Krell, Gertraude (1996): Mono- oder multikulturelle Organisationen? ‘Managing Diversity’ auf dem<br />
Prüfstand. In: Industrielle Beziehungen. Zeitschrift für Arbeit, Organisation und Management 3<br />
(4): 334-350.<br />
Lang, Rainhart/Peter Wald (1992): Unternehmenskulturen in den fünf neuen Ländern. Ansatzpunkte<br />
für eine neue Industriekultur im Osten Deutschlands? In: Zeitschrift für Personalforschung 6 (1):<br />
19-35.<br />
Legge, Karen (1995): Human resource management: rhetorics and realities. Basingstoke: Macmillan.<br />
Loden, Marilyn/Judy B. Rosener (1991): Workforce America! Managing employee diversity as a vital<br />
resource. Homewood, Ill.: Business One Irwin.<br />
Luhmann, Niklas (1999): Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der<br />
modernen Gesellschaft. Frankfurt a M: Suhrkamp.<br />
Lutter, Christina/Markus Reisenleitner (1999): Cultural Studies. Eine Einführung. Wien: Turia und<br />
Kant.<br />
MEW 23 (1983): Marx-Engels Werke. Berlin: Dietz.<br />
Morgan, Gareth (1980): Paradigms, Metaphors, and Puzzle Solving in Organization Theory. In: Administrative<br />
Science Quaterly 25: 606-622.<br />
Morgan, Gareth (1986): Images of Organizations. London/New York: Sage.<br />
Müller, Wolfgang (2002): HighTech Report. Zur Situation und Zukunft der HighTech-Industrie.<br />
Darmstadt: S. Toeche-Mittler Verlag.<br />
Neuberger, Oswald/Ain Kompa (1987): Wir, die Firma. Der Kult um die Unternehmenskultur.<br />
Weinheim/Basel: Beltz.<br />
Ogbonna, Emmanuel/Lloyd C. Harris (1998): Organizational culture: It’s not what you think... In:<br />
Journal of General Management 23 (3): 35-48.<br />
Osterloh, Margit (1988): Methodische Probleme einer empirischen Erfassung von Organisationskulturen.<br />
In: Eberhard Dülfer (Hg.): Organisationskultur. Phänomen - Philosophie - Technologie.<br />
Stuttgart: Poeschel: 139-151.<br />
Ouchi, William G. (1981): Theory Z. How American Business Can Meet The Japanese Challenge.<br />
New York: Avon.<br />
Peters, Thomas J./Robert H. jr. Waterman (1982): In Search of Excellence. Lessons from America’s<br />
best-run Companies. New York: Harper & Row.<br />
Prabitz, Gerald (1996): Unternehmenskultur und Betriebswirtschaftslehre. Eine Untersuchung zur<br />
Kontinuität betriebswirtschaftlichen Denkens. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag.<br />
Reckwitz, Andreas/Holger Sievert (Hg.) (1999): Interpretation, Konstruktion, Kultur. Ein Paradigmenwechsel<br />
in den Sozialwissnschaften. Opladen: Westdeutscher Verlag.<br />
Rowlinson, Michael/Stephen Procter (1999): Organizational Culture and Business History. In: Organization<br />
Studies 20 (3): 369-396.<br />
Sackmann, Sonja A. (1983): Organisationskultur: Die unsichtbare Einflußgröße. In: Gruppendynamik<br />
(14): 393-406.<br />
Sackmann, Sonja A. (1991): Cultural knowledge in organizations : exploring the collective mind.<br />
Newbury Park : Sage.
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 33<br />
„Shared values“ oder „shareholder value“?<br />
Schein, Edgar H. (1995): Unternehmenskultur. Ein Handbuch für Führungskräfte. Frankfurt a<br />
M/New York: Campus.<br />
Schein, Edgar H. (1997): Organizational culture and leadership. 2nd edition. San Francisco: Jossey-Bass.<br />
Schmidt, Michael (1995): Unternehmenskultur: Integration des kulturtheoretischen Forschungsansatzes<br />
in die Betriebs- und Genossenschaftslehre. Wien: Service-Verlag.<br />
Schreyögg, Georg (1991): Kann und darf man Unternehmenskulturen ändern? In: Eberhard Dülfer<br />
(Hg.): Organisationskultur: Phänomen - Philosophie - Technologie. Stuttgart: Poeschel:<br />
201-214.<br />
Scott, William R. (1992): Organizations: rational, natural, and open systems. Englewood Cliffs, NJ:<br />
Prentice-Hall Internat.<br />
Seifert, Matthias (2001): Vertrauensmanagement in Unternehmen. München/Mering: Rainer<br />
Hampp Verlag.<br />
Sennet, Richard (2000): Wie Arbeit die soziale Zugehörigkeit zerstört. In: Jan Engelmann/Michael<br />
Wiedemeyer (Hg.): Kursbuch Arbeit. Frankfurt a M: DVA: 124-132.<br />
Shuttleworth, Alan (1971): People and Culture. In: Working Papers in Cultural Studies (1): 65-96.<br />
Smircich, Linda (1983): Concepts of Culture and Organizational Analysis. In: Administrative<br />
Science Quaterly 28: 339-358.<br />
Springer, Roland (1999): Rückkehr zum Taylorismus? Arbeitspolitik in der Automobilindustrie am<br />
Scheideweg. Frankfurt a M/New York: Campus.<br />
Staute, Jörg (1997): Das Ende der Unternehmenskultur. Firmenalltag im Turbokapitalismus. Frankfurt<br />
a M: Campus.<br />
Storey, John (1992): Management of Human resources. Oxford: Blackwell.<br />
Tiebler, Petra/Gerhard Prätorius (1993): Ökonomische Literatur zum Thema ‘Unternehmenskultur’.<br />
Ein Forschungsüberblick. In: Meinolf Dierkes, Lutz von Rosenstiel und Ulrich Steger (Hg.): Unternehmenskultur<br />
in Theorie und Praxis. Konzepte aus Ökonomie, Psychologie und Ethnologie.<br />
Frankfurt a M: Campus: 23-89.<br />
Trompenaars, Fons/Charles Hampden-Turner (1997): Riding The Waves of Culture: Understanding<br />
Diversity in Global Business (2nd edition). London: Nicholas Brealey Publishing.<br />
Türk, Klaus (1989): Neuere Entwicklungen in der Organisationsforschung: ein Trend-Report. Stuttgart:<br />
Ferdinand Enke Verlag.<br />
Veiga, John, Michael Lubatkin, Roland Calori und Philippe Very (2000): Measuring organizational<br />
culture clashes: A two-nation post-hoc analysis of a cultural compatibility index. In: Human Relations<br />
53 (4): 539-557.<br />
Wächter, Hartmut (1985): Zur Kritik an Peters und Waterman. In: Die Betriebswirtschaft 45:<br />
608-609.<br />
Wächter, Hartmut (1998): Krise der Verhandlungskultur. In: Die Mitbestimmung (9): 11-15.<br />
Weitbrecht, Hansjörg/Sylvana Mehrwald (1998): Mitbestimmung, Human Resource Management<br />
und neue Beteiligungskonzepte. Wissenschaftliche Expertenbericht für die Kommission Mitbestimmung.<br />
Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung.
34 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
„Shared values“ oder „shareholder value“?<br />
Windolf, Paul (2001): The Transformation of Rhenanian Capitalism. Beitrag auf der Konferenz<br />
„Shareholder Value and Globalisation“ (Mai 2001). Bad Homburg:<br />
http://www.uni-trier.de/uni/fb4/soziologie/apo/conference.htm.<br />
Womack, James P., Daniel T. Jones und Daniel Roos (1992): Die zweite Revolution in der Autoindustrie.<br />
Frankfurt a M: Campus.<br />
Zur Person<br />
Dr. Ulrich Brinkmann: 1988-1994 Studium der Politikwissenschaft, Volkswirtschaftslehre und<br />
Anglistik/Amerikanistik in Marburg, 1995-1997 wiss. Mitarbeiter im Projekt „Transformation der<br />
ostdeutschen Betriebe“ an der Uni Trier, 1997-1999 Promotionsstipendiat der Hans-Böckler-Stiftung,<br />
1999-2002 wiss. Mitarbeiter im Soziologie-Schwerpunkt „Arbeit- Personal- Organisation“ der<br />
Uni Trier, 2002-2004 Bereichsleitung am Forschungsinstitut Arbeit-Bildung-Partizipation an der<br />
Ruhr-Uni-Bochum. Seit 2004 Hochschulassistent an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Lehrstuhl<br />
Wirtschafts-, Industrie- und Arbeitssoziologie. 2006 Fellow am Institute for the Human Sciences,<br />
Wien.<br />
Kontakt<br />
Dr. Ulrich Brinkmann<br />
Friedrich-Schiller-Universität Jena<br />
Institut für Soziologie<br />
Carl-Zeiss-Str. 2<br />
07743 Jena<br />
+49 (0) 3641-945523
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 35<br />
„Shared values“ oder „shareholder value“?<br />
6 Anhang 1<br />
ABI-Datenbank: „The premier North American business periodical database. 800 sources provide<br />
information on advertising, economics, human resources, finance, marketing, computers and more.<br />
Plus information on over 60,000 companies.“ (Eigendarstellung)<br />
Sociological Abstracts: „This database covers the latest research in the fields of sociology, social<br />
sciences and related disciplines. Abstracts and enhanced citations are available for over 1,640 journals,<br />
monographs, conference papers and dissertations (1960 - present).“ (Eigendarstellung)<br />
WISO-Datenbanken: WISO II ermöglicht den Zugriff auf die Datenbanken ECONIS, HWWA und<br />
IFO; Umfang: ECONIS: ca. 400.000 Literaturhinweise; HWWA: ca. 110.000 Literaturhinweise;<br />
IFO: ca. 20.000 Literaturhinweise; Nachgewiesene Literaturformen: Fachzeitschriften; Forschungsberichte;<br />
Monographien; Wirtschaftspresse. WISO III ermöglicht den Zugriff auf die sozialwissenschaftlichen<br />
Datenbanken SOLIS und FORIS. (Eigendarstellung)<br />
Grafik 1<br />
Anzahl der Veröffentlichungen/Artikel pro Jahr<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Sociological Abstracts<br />
Summe WISO II & III<br />
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000<br />
Abb. 1: „Unternehmskultur“bzw. „Organizational/corporate culture“ als Thema der WISO-Datenbanken<br />
und der Sociological Abstracts
36 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
„Shared values“ oder „shareholder value“?<br />
Grafik 2<br />
Anzahl der Veröffentlichungen/Artikel pro Jahr<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
ABI periodicals, abstracts<br />
ABI periodicals, peer reviewed, abstracts<br />
0<br />
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000<br />
Abb. 2: „Organizational/corporate culture“ in den ABI-Datenbanken
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 37<br />
„Shared values“ oder „shareholder value“?<br />
Anhang 2<br />
The Cluetrain Manifesto (http://www.cluetrain.com/)<br />
95 Theses<br />
1. Markets are conversations.<br />
2. Markets consist of human beings, not demographic sectors.<br />
3. Conversations among human beings sound human. They are conducted in a human voice.<br />
4. Whether delivering information, opinions, perspectives, dissenting arguments or humorous asides,<br />
the human voice is typically open, natural, uncontrived.<br />
5. People recognize each other as such from the sound of this voice.<br />
6. The Internet is enabling conversations among human beings that were simply not possible in the<br />
era of mass media.<br />
7. Hyperlinks subvert hierarchy.<br />
8. In both internetworked markets and among intranetworked employees, people are speaking to<br />
each other in a powerful new way.<br />
9. These networked conversations are enabling powerful new forms of social organization and<br />
knowledge exchange to emerge.<br />
10. As a result, markets are getting smarter, more informed, more organized. Participation in a networked<br />
market changes people fundamentally.<br />
11. People in networked markets have figured out that they get far better information and support<br />
from one another than from vendors. So much for corporate rhetoric about adding value to commoditized<br />
products.<br />
12. There are no secrets. The networked market knows more than companies do about their own<br />
products. And whether the news is good or bad, they tell everyone.<br />
13. What’s happening to markets is also happening among employees. A metaphysical construct<br />
called „The Company“ is the only thing standing between the two.<br />
14. Corporations do not speak in the same voice as these new networked conversations. To their intended<br />
online audiences, companies sound hollow, flat, literally inhuman.<br />
15. In just a few more years, the current homogenized „voice“ of business—the sound of mission<br />
statements and brochures—will seem as contrived and artificial as the language of the 18th century<br />
French court.<br />
16. Already, companies that speak in the language of the pitch, the dog-and- pony show, are no longer<br />
speaking to anyone.<br />
17. Companies that assume online markets are the same markets that used to watch their ads on television<br />
are kidding themselves.<br />
18. Companies that don’t realize their markets are now networked person-to- person, getting smarter<br />
as a result and deeply joined in conversation are missing their best opportunity.<br />
19. Companies can now communicate with their markets directly. If they blow it, it could be their<br />
last chance.<br />
20. Companies need to realize their markets are often laughing. At them.<br />
21. Companies need to lighten up and take themselves less seriously. They need to get a sense of humor.<br />
22. Getting a sense of humor does not mean putting some jokes on the corporate web site. Rather, it<br />
requires big values, a little humility, straight talk, and a genuine point of view.
38 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
„Shared values“ oder „shareholder value“?<br />
23. Companies attempting to „position“ themselves need to take a position. Optimally, it should relate<br />
to something their market actually cares about.<br />
24. Bombastic boasts—"We are positioned to become the preeminent provider of XYZ"—do not<br />
constitute a position.<br />
25. Companies need to come down from their Ivory Towers and talk to the people with whom they<br />
hope to create relationships.<br />
26. Public Relations does not relate to the public. Companies are deeply afraid of their markets.<br />
27. By speaking in language that is distant, uninviting, arrogant, they build walls to keep markets at<br />
bay.<br />
28. Most marketing programs are based on the fear that the market might see what’s really going on<br />
inside the company.<br />
29. Elvis said it best: „We can’t go on together with suspicious minds.“<br />
30. Brand loyalty is the corporate version of going steady, but the breakup is inevitable—and coming<br />
fast. Because they are networked, smart markets are able to renegotiate relationships with<br />
blinding speed.<br />
31. Networked markets can change suppliers overnight. Networked knowledge workers can change<br />
employers over lunch. Your own „downsizing initiatives“ taught us to ask the question: „Loyalty?<br />
What’s that?“<br />
32. Smart markets will find suppliers who speak their own language.<br />
33. Learning to speak with a human voice is not a parlor trick. It can’t be „picked up“ at some tony<br />
conference.<br />
34. To speak with a human voice, companies must share the concerns of their communities.<br />
35. But first, they must belong to a community.<br />
36. Companies must ask themselves where their corporate cultures end.<br />
37. If their cultures end before the community begins, they will have no market.<br />
38. Human communities are based on discourse—on human speech about human concerns.<br />
39. The community of discourse is the market.<br />
40. Companies that do not belong to a community of discourse will die.<br />
41. Companies make a religion of security, but this is largely a red herring. Most are protecting less<br />
against competitors than against their own market and workforce.<br />
42. As with networked markets, people are also talking to each other directly inside the company—and<br />
not just about rules and regulations, boardroom directives, bottom lines.<br />
43. Such conversations are taking place today on corporate intranets. But only when the conditions<br />
are right.<br />
44. Companies typically install intranets top-down to distribute HR policies and other corporate information<br />
that workers are doing their best to ignore.<br />
45. Intranets naturally tend to route around boredom. The best are built bottom-up by engaged individuals<br />
cooperating to construct something far more valuable: an intranetworked corporate conversation.<br />
46. A healthy intranet organizes workers in many meanings of the word. Its effect is more radical<br />
than the agenda of any union.<br />
47. While this scares companies witless, they also depend heavily on open intranets to generate and<br />
share critical knowledge. They need to resist the urge to „improve“ or control these networked<br />
conversations.<br />
48. When corporate intranets are not constrained by fear and legalistic rules, the type of conversation<br />
they encourage sounds remarkably like the conversation of the networked marketplace.
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 39<br />
„Shared values“ oder „shareholder value“?<br />
49. Org charts worked in an older economy where plans could be fully understood from atop steep<br />
management pyramids and detailed work orders could be handed down from on high.<br />
50. Today, the org chart is hyperlinked, not hierarchical. Respect for hands-on knowledge wins<br />
over respect for abstract authority.<br />
51. Command-and-control management styles both derive from and reinforce bureaucracy, power<br />
tripping and an overall culture of paranoia.<br />
52. Paranoia kills conversation. That’s its point. But lack of open conversation kills companies.<br />
53. There are two conversations going on. One inside the company. One with the market.<br />
54. In most cases, neither conversation is going very well. Almost invariably, the cause of failure<br />
can be traced to obsolete notions of command and control.<br />
55. As policy, these notions are poisonous. As tools, they are broken. Command and control are met<br />
with hostility by intranetworked knowledge workers and generate distrust in internetworked<br />
markets.<br />
56. These two conversations want to talk to each other. They are speaking the same language. They<br />
recognize each other’s voices.<br />
57. Smart companies will get out of the way and help the inevitable to happen sooner.<br />
58. If willingness to get out of the way is taken as a measure of IQ, then very few companies have<br />
yet wised up.<br />
59. However subliminally at the moment, millions of people now online perceive companies as little<br />
more than quaint legal fictions that are actively preventing these conversations from intersecting.<br />
60. This is suicidal. Markets want to talk to companies.<br />
61. Sadly, the part of the company a networked market wants to talk to is usually hidden behind a<br />
smokescreen of hucksterism, of language that rings false—and often is.<br />
62. Markets do not want to talk to flacks and hucksters. They want to participate in the conversations<br />
going on behind the corporate firewall.<br />
63. De-cloaking, getting personal: We are those markets. We want to talk to you.<br />
64. We want access to your corporate information, to your plans and strategies, your best thinking,<br />
your genuine knowledge. We will not settle for the 4-color brochure, for web sites<br />
chock-a-block with eye candy but lacking any substance.<br />
65. We’re also the workers who make your companies go. We want to talk to customers directly in<br />
our own voices, not in platitudes written into a script.<br />
66. As markets, as workers, both of us are sick to death of getting our information by remote control.<br />
Why do we need faceless annual reports and third-hand market research studies to introduce us<br />
to each other?<br />
67. As markets, as workers, we wonder why you’re not listening. You seem to be speaking a different<br />
language.<br />
68. The inflated self-important jargon you sling around—in the press, at your conferences—what’s<br />
that got to do with us?<br />
69. Maybe you’re impressing your investors. Maybe you’re impressing Wall Street. You’re not impressing<br />
us.<br />
70. If you don’t impress us, your investors are going to take a bath. Don’t they understand this? If<br />
they did, they wouldn’t let you talk that way.<br />
71. Your tired notions of „the market“ make our eyes glaze over. We don’t recognize ourselves in<br />
your projections—perhaps because we know we’re already elsewhere.<br />
72. We like this new marketplace much better. In fact, we are creating it.
40 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
„Shared values“ oder „shareholder value“?<br />
73. You’re invited, but it’s our world. Take your shoes off at the door. If you want to barter with us,<br />
get down off that camel!<br />
74. We are immune to advertising. Just forget it.<br />
75. If you want us to talk to you, tell us something. Make it something interesting for a change.<br />
76. We’ve got some ideas for you too: some new tools we need, some better service. Stuff we’d be<br />
willing to pay for. Got a minute?<br />
77. You’re too busy „doing business“ to answer our email? Oh gosh, sorry, gee, we’ll come back later.<br />
Maybe.<br />
78. You want us to pay? We want you to pay attention.<br />
79. We want you to drop your trip, come out of your neurotic self-involvement, join the party.<br />
80. Don’t worry, you can still make money. That is, as long as it’s not the only thing on your mind.<br />
81. Have you noticed that, in itself, money is kind of one-dimensional and boring? What else can we<br />
talk about?<br />
82. Your product broke. Why? We’d like to ask the guy who made it. Your corporate strategy makes<br />
no sense. We’d like to have a chat with your CEO. What do you mean she’s not in?<br />
83. We want you to take 50 million of us as seriously as you take one reporter from The Wall Street<br />
Journal.<br />
84. We know some people from your company. They’re pretty cool online. Do you have any more<br />
like that you’re hiding? Can they come out and play?<br />
85. When we have questions we turn to each other for answers. If you didn’t have such a tight rein<br />
on „your people“ maybe they’d be among the people we’d turn to.<br />
86. When we’re not busy being your „target market,“ many of us are your people. We’d rather be<br />
talking to friends online than watching the clock. That would get your name around better than<br />
your entire million dollar web site. But you tell us speaking to the market is Marketing’s job.<br />
87. We’d like it if you got what’s going on here. That’d be real nice. But it would be a big mistake to<br />
think we’re holding our breath.<br />
88. We have better things to do than worry about whether you’ll change in time to get our business.<br />
Business is only a part of our lives. It seems to be all of yours. Think about it: who needs whom?<br />
89. We have real power and we know it. If you don’t quite see the light, some other outfit will come<br />
along that’s more attentive, more interesting, more fun to play with.<br />
90. Even at its worst, our newfound conversation is more interesting than most trade shows, more<br />
entertaining than any TV sitcom, and certainly more true-to-life than the corporate web sites<br />
we’ve been seeing.<br />
91. Our allegiance is to ourselves—our friends, our new allies and acquaintances, even our sparring<br />
partners. Companies that have no part in this world, also have no future.<br />
92. Companies are spending billions of dollars on Y2K. Why can’t they hear this market timebomb<br />
ticking? The stakes are even higher.<br />
93. We’re both inside companies and outside them. The boundaries that separate our conversations<br />
look like the Berlin Wall today, but they’re really just an annoyance. We know they’re coming<br />
down. We’re going to work from both sides to take them down.<br />
94. To traditional corporations, networked conversations may appear confused, may sound confusing.<br />
But we are organizing faster than they are. We have better tools, more new ideas, no rules<br />
to slow us down.<br />
95. We are waking up and linking to each other. We are watching. But we are not waiting.
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 41<br />
1 Industriegesellschaft, Theoriediskussion, Gesamtdarstellungen<br />
1 Industriegesellschaft, Theoriediskussion, Gesamtdarstellungen<br />
[1-L] Andriessen, J. H. Erik; Vartiainen, Matti (Hrsg.):<br />
Mobile virtual work: a new paradigm?, Berlin: Springer 2006, 392 S., ISBN: 3-540-28364-1<br />
INHALT: Das Buch befasst sich mit einer neuen Art des Arbeitsarrangements, nämlich der mobilen<br />
virtuellen Arbeit. Grundlage waren mehrere Workshops, auf denen Experten das Phänomen<br />
diskutierten. Die Beiträge behandeln ergonomische Aspekte, die Diffusion der mobilen<br />
Arbeitssysteme, Voraussetzungen der zwischenbetreblichen Kooperation und das Wissensmanagenments<br />
für mobil Beschäftigte. (IAB)<br />
[2-F] Beese, Birgit, Dipl.-Soz.; Röttger, Bernd, Dr. (Bearbeitung); Dörre, Klaus, Prof.Dr. (Leitung):<br />
Globalisierung, Industriepolitik und mikrosoziale Regulation. Die Akteure der industriellen<br />
Beziehungen als Kooperationspartner in regionalen Entwicklungskoalitionen<br />
INHALT: Im Gegensatz zu neueren Diskussionen, in denen Gewerkschaften als Blockierer vermeintlich<br />
notwendiger Reformen der Institutionen industrieller Beziehungen erscheinen, haben<br />
sich in vielen Regionen - von Gewerkschaften initiiert - regionale Entwicklungskoalitionen<br />
aus lokaler Politik, Gewerkschaften, Unternehmerverbänden, Kammern, Unternehmen,<br />
Arbeitsmarktakteuren und Wissenschaft gebildet, die versuchen, den Strukturwandel innovativ<br />
und kooperativ zu bewältigen. Das Forschungsprojekt hat die strukturpolitischen Konstellationen<br />
in drei altindustriellen Regionen unter die Lupe genommen. In Dortmund, Nürnberg,<br />
und Chemnitz sind - in beständig wechselnden Arrangements aus Konflikt, Kompromiss und<br />
Konsens - in den 1990er Jahren regionale Institutionensysteme 'von unten' geschaffen worden,<br />
die erhebliche Steuerungsleistungen bei der Krisenabfederung oder der Sanierung und<br />
Modernisierung ökonomischer Strukturen leisten. Dennoch stehen diese regionalen Koalitionen<br />
inzwischen am Scheideweg. Die in den 1990er Jahren gefundenen Kompromissgleichgewichte<br />
aus ökonomischer Modernisierung und sozialer Kohäsion laufen aus dem Ruder. Im<br />
'neuen Marktregime' werden den Regionen neue Handlungskorridore vorgegeben. Zudem<br />
entstehen im Wettbewerbsregionalismus technokratisch ausgerichtete Modernisierungsagenturen<br />
'von oben', in denen arbeitsorientierte Ziele nur noch schwer verankert werden können.<br />
Das Forschungsprojekt hat die Gründe für das neue 'Unbehagen in den Regionen' untersucht<br />
und einige Grundfragen gewerkschaftlicher Neuorientierung formuliert. Auf mehreren Konferenzen<br />
wurde die Forschungsergebnisse mit Gewerkschaftern und Wissenschaftlern debattiert.<br />
METHODE: keine Angaben DATENGEWINNUNG: Qualitatives Interview (Stichprobe: 160).<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: Dörre, K; Röttger, B.: Radikaler Strukturwandel - gewerkschaftliche<br />
Industriepolitik vor neuen Herausforderungen. in: Howaldt, J.; Kopp, R.; Flocken, P.<br />
(Hrsg.): Kooperationsverbünde und regionale Modernisierung. Theorie und Praxis der Netzwerkarbeit.<br />
Wiesbaden 2001, S. 61-77.+++Beese, B.; Dörre, K.; Röttger, B.: Im Schatten der<br />
Globalisierung. Strukturpolitik, Netzwerke und Gewerkschaften in altindustriellen Regionen.<br />
Endbericht. Recklinghausen: 2004.+++Beese, B.; Dörre, K.; Röttger, B.: Globalisierung und<br />
Regionalisierung. Eröffnen regionalpolitische Aktivitäten den Gewerkschaften neue Partizipationschancen?<br />
in: Scholz, D.; Glawe, H.; Martens, H. u.a. (Hrsg.): Arbeit in der neuen Zeit.<br />
Regulierung der Ökonomie, Gestaltung der Technik, Politik der Arbeit. Ein Tagungsband.
42 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
1 Industriegesellschaft, Theoriediskussion, Gesamtdarstellungen<br />
Dortmunder Beiträge zur Sozial- und Gesellschaftspolitik, Bd. 46. Münster: LiT-Verl. 2004,<br />
S. 127-162.+++Beese, B.; Dörre, K,; Röttger, B.: Globalisation and regionalisation. Will networking<br />
help trade unions to shape change in traditional industrial regions? in: Fricke, W.;<br />
Totterdill, P. (eds.): Action research in workplace innovation and regional development.<br />
Amsterdam, Philadelphia: John Benjamin's 2004, pp. 233-261.+++Dörre, K.: Ist regionale<br />
Strukturpolitik ein geeignetes Mittel für Wachstum? in: SPW - Sozialistische Politik und<br />
Wirtschaft, 2004, H. 140, S. 16-20.+++Röttger, Bernd: Regionale Regulationsprozesse im<br />
neuen Marktregime. Chancen und Restriktionen gewerkschaftlicher Regional- und Strukturpolitik.<br />
in: Juso-Argumente, 2004, H. 2, S. 69-78 (gekürzte Fassung des Beitrages aus Klaus<br />
Dörre, Bernd Röttger (Hrsg.): Das neue Marktregime, Hamburg 2003).+++Dörre, K; Beese,<br />
B.; Röttger, B.: The new economy - a new model for developement coalitions? in: Concepts<br />
and Transformation, 7, 2002, 1, pp. 57-71.+++Beese, B.; Dörre, K.; Röttger, B.: Regionale<br />
Regulationsprozesse im neuen Marktregime. Chancen und Restriktionen gewerkschaftlicher<br />
Regional- und Strukturpolitik. in: Dörre, K.; Röttger, B. (Hrsg.): Das neue Marktregime.<br />
Konturen eines nachfordistischen Produktionsmodells. Hamburg: VSA-Verl. 2003, S. 270-<br />
288.+++Beese, B.; Dörre, K. Röttger, B.: Die New Economy - industriepolitisches Leitbild<br />
für den Übergang zu einem nachfordistischen Produktionsmodell? in: Schneider, G.; Jelich,<br />
F.-J. (Hrsg): Netze und lose Fäden. Politische Bildung gegen gesellschaftliche Desintegration.<br />
Schwalbach 2002, S. 23-46. ARBEITSPAPIERE: Beese, B.; Dörre, K.; Röttger, B.: Unter<br />
dem Druck der Globalisierung. Industriepolitische Netzwerke vor neuen Herausforderungen.<br />
Ein Zwischenbericht. Ms. Recklinghausen: 2003.<br />
ART: Auftragsforschung BEGINN: 2001-08 ENDE: 2004-05 AUFTRAGGEBER: Hans-Böckler-<br />
Stiftung FINANZIERER: Auftraggeber<br />
INSTITUTION: Universität Jena, Fak. für Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Institut für<br />
Soziologie Lehrstuhl für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie (07737 Jena)<br />
KONTAKT: Leiter (Tel. 03641 945521, e-mail: Klaus.Doerre@uni-jena.de)<br />
[3-L] Boes, Andreas; Kämpf, Tobias; Marrs, Kira:<br />
Zukunft der Arbeitsbeziehungen: zwischen Atomisierung und neuer Solidarität, in: WSI Mitteilungen<br />
: Monatszeitschrift des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in der Hans-<br />
Böckler-Stiftung, Jg. 59/2006, H. 2, S. 98-103 (Standort: USB Köln(38)-Haa964; Kopie über den<br />
Literaturdienst erhältlich; URL: http://www.econdoc.de/_de/indexwsi.htm)<br />
INHALT: "Auf dem Höhepunkt des New-Economy-Hype schien es so, als würde sich das Thema<br />
Mitbestimmung in Deutschland von selbst erledigen. Vor dem Hintergrund der Durchsetzung<br />
neuer Unternehmenskonzepte und dem Vordringen hochqualifizierter, junger Beschäftigtengruppen<br />
erschien die verfasste Mitbestimmung gegenüber neuen Formen individualistischer<br />
Interessenvertretung als Auslaufmodell. Heute, vier Jahre nach dem Platzen der Börsenblase,<br />
ist dieser Befund zu hinterfragen. Gerade in jenen Wirtschaftsbereichen, die vormals in einer<br />
unzulässigen Verallgemeinerung unter dem Begriff der New Economy subsumiert wurden,<br />
zeichnet sich für die Zukunft der Arbeitsbeziehungen eine weitaus vielschichtigere und in ihrer<br />
Tendenz keineswegs eindeutige Entwicklungsrichtung ab. In zwei Branchen, die oftmals<br />
als paradigmatisch für neue post-fordistische Produktionsstrukturen und Arbeitsbeziehungen<br />
begriffen werden, konnten die Verfasser unterschiedliche empirische Ergebnisse hinsichtlich<br />
des Interessenhandelns von Beschäftigten identifizieren. Während im Bereich der AV-<br />
Medien eine 'neue Ökonomie der Unsicherheit' zu einer Atomisierung von Beschäftigten
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 43<br />
1 Industriegesellschaft, Theoriediskussion, Gesamtdarstellungen<br />
führt, konnten die Verfasser im Bereich Software-Entwicklung und IT-Dienstleistungen das<br />
Potenzial für eine neue Kultur der Solidarität entdecken." (Autorenreferat)<br />
[4-F] Bultemeier, Anja, Dipl.-Pol.; Götzelt, Ina, Dipl.-Soz.; Grotheer, Michael, M.A.; Schröder,<br />
Tim (Bearbeitung); Köhler, Christoph, Prof.Dr.; Struck, Olaf, Dr. (Leitung):<br />
Betrieb und Beschäftigung im Wandel: betriebliche Beschäftigungssysteme und Beschäftigungssicherheit<br />
im ost-westdeutschen Vergleich (Teilprojekt B2)<br />
INHALT: Der deutsche Arbeitsmarkt ist - im internationalen Vergleich - durch ein hohes Niveau<br />
an betrieblicher Beschäftigungssicherheit charakterisiert. Dabei werden der Strukturwandel<br />
und der Arbeitskräfteaustausch vorrangig intergenerational bewältigt. Nach Beendigung der<br />
Umbruchphase gilt dies aufgrund von transformationsspezifischen Gründen auch für Ostdeutschland.<br />
Vor dem Hintergrund der nachhaltig wirkenden Strukturveränderungen im Wirtschaftssystem<br />
ist es heute allerdings eine offene Frage, inwieweit sich das "Deutsche Modell"<br />
in Richtung flexibler Übergangsstrukturen verändert. Gerade auf dem ostdeutschen Arbeitsmarkt<br />
sind mit dem blockierten Generationenaustausch und dem verzögerten Strukturwandel<br />
historisch singuläre und weitreichende Problemkonstellationen zu bewältigen, wobei es hier<br />
zu einer besonders tiefgreifenden "Erosion des Normalarbeitsverhältnisses" und Beschäftigungsunsicherheit<br />
kommen könnte. Eine solche Entwicklung hätte weitreichende Folgen für<br />
die Formen der Nutzung von Arbeitskraft in Unternehmen und die Systeme der sozialen Sicherheit.<br />
Ziel des Teilprojektes ist es, sichere und unsichere Beschäftigungsverhältnisse aus<br />
der Perspektive betrieblicher Beschäftigungssysteme im ost-westdeutschen Vergleich zu untersuchen.<br />
Hierfür werden kontrastierende Typen betrieblicher Beschäftigungssysteme identifiziert<br />
und in ihrer Entwicklungsdynamik über einen längeren Zeitraum hinweg analysiert.<br />
Ziel der ersten Beantragungsphase ist die Ausarbeitung einer empirisch und theoretisch gesättigten<br />
Typologie und die Entwicklung eines analytischen Modells betrieblicher Beschäftigungssysteme,<br />
in dem die wesentlichen Einflussfaktoren zusammengefasst werden.<br />
METHODE: Im Untersuchungsdesign werden qualitative und quantitative Methoden kombiniert.<br />
Im ersten Schritt der Untersuchung werden mit Hilfe von Sekundäranalysen der west- und<br />
ostdeutschen IAB-Beschäftigtenstichprobe und des IAB-Betriebspanels für die Frage nach<br />
der Beschäftigungssicherheit relevante Branchen und Betriebstypen identifiziert. Parallel dazu<br />
sollen dreißig Betriebsfallstudien detaillierte Hinweise auf typische Beschäftigungssysteme<br />
ergeben. In einem zweiten Untersuchungsschritt sollen die so gewonnenen Unterscheidungen<br />
überprüft und weiterentwickelt werden. Zu diesem Zweck wurde ein Betriebspanel<br />
mit rund 800 Fällen gestartet. Das Betriebspanel ermöglicht es, die Entwicklung von Beschäftigungssystemen<br />
und die Zeitabhängigkeit von Einflussfaktoren auf die Entscheidungen betrieblicher<br />
Akteure zu analysieren. In einem dritten Schritt wird die Generalisierbarkeit der<br />
Ergebnisse anhand eines kombinierten IAB-Beschäftigten-Betriebsdatensatz überprüft.<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: Bultemeier, A.: Abschlussbericht der Evaluierung des Modellprojektes<br />
"Modellhafte arbeitsplatzbezogene Qualifizierung für wissensintensive Tätigkeiten mit<br />
Schwerpunkt Personal- und Weiterbildungsmanagement". Unveröff. Manuskript. Erfurt 2003.<br />
+++Bultemeier, A.; Deppe, F.: Arbeitslosigkeit und Sozialpolitik in der Europäischen Union.<br />
in: Europäische Integration und politische Regulierung - Aspekte, Dimensionen, Perspektiven.<br />
Forschungsgruppe Europäische Gemeinschaften (FEG) - Studie, Nr. 5. Marburg 1995, S.<br />
81-96.+++Bultemeier, A.; Neubert, J.: Arbeitsmarktentwicklung und Arbeitsmarktpolitik in<br />
Ostdeutschland. in: Lutz, R.; Zeng, M. (Hrsg.): Armutsforschung und Sozialberichterstattung<br />
in den neuen Bundesländern. Opladen 1998, S. 287-307.+++Dies.: Erwerbsorientierung ohne
44 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
1 Industriegesellschaft, Theoriediskussion, Gesamtdarstellungen<br />
Hoffnung. in: Lutz, R. (Hrsg.): Knappheitsmanagement. Münster 2000.+++Diebler, P.: Angebots-<br />
und nachfrageseitige Einflussfaktoren auf die Stabilität betrieblicher Beschäftigungsverhältnisse.<br />
in: Köhler, C.; Struck, O. (Hrsg.): Betriebliche Beschäftigungssysteme und Beschäftigungsstabilität<br />
in West- und Ostdeutschland. SFB 580-Mitteilungen. Jena, Halle 2004.<br />
+++Köhler, C.; Hinze, M.; Krause, M.; Papies, U.: Der Thüringer Arbeitsmarkt zwischen<br />
Strukturwandel, Arbeitskräftebedarf und Unterbeschäftigung. in: Jenaer Beiträge zu Soziologie,<br />
H. 12. Jena 2002.+++Köhler, C.; Struck, O.: Vorwort. in: Köhler, C. Struck, O.; (Hrsg.):<br />
Betriebliche Beschäftigungssysteme und Beschäftigungsstabilität in West- und Ostdeutschland.<br />
SFB 580-Mitteilungen. Jena, Halle 2004.+++Köhler, C.; Struck, O.: Betrieb und Beschäftigung<br />
im Wandel. Sonderforschungsbereich 580 der Universitäten Jena und Halle, Arbeits-<br />
und Ergebnisbericht. Jena 2004.+++Köhler, C.; Struck, O. u.a.: Schutzzone Organisation<br />
- Risikozone Markt? in: Kronauer, M.; Linne, G. (Hrsg.): Flexicurity. Berlin: Sigma Verl.<br />
2005, S. 295-316.+++Köhler, C.; Struck, O.: Arbeitsmärkte für Hochqualifizierte und Instrumente<br />
der Personalpolitik: eine Studie im Auftrag der Jenoptik AG. Jena: Univ., Inst. f. Soziologie<br />
2005.+++Struck, O. (Hrsg.): Beschäftigungsstabilität - empirische Befunde in West-<br />
und Ostdeutschland. SFB 580-Mitteilungen. Jena, Halle 2004.+++Ders.: Die "demographische<br />
Zeitbombe". Sie tickt seit langem doch explodieren muss sie nicht! in: SPW, 2004, H.<br />
135.+++Struck, O.; Köhler, C.: Beschäftigungsstabilität und -sicherheit: Forschungsperspektiven.<br />
in: Köhler, C.; Struck, O. (Hrsg.): Betriebliche Beschäftigungssysteme und Beschäftigungsstabilität<br />
in West- und Ostdeutschland. SFB 580-Mitteilungen. Jena, Halle 2004.+++<br />
Struck, O.: Soziale Gerechtigkeit zwischen Effizienz und Sicherheit. in: SPW, 2003, H. 133,<br />
S. 13-17.+++Ders.: Regulierung und Deregulierung - alte Debatte im neuen Gewand? Kommentar<br />
zu Friedrich Buttler. in: Gensior, Sabine u.a. (Hrsg.): Perspektiven sozialwissenschaftlicher<br />
Arbeitsmarktforschung. Berlin 2003.+++Ders.: Trajectories of coping strategies in<br />
Eastern Germany. in: Humphrey, R.; Miller, R.; Zdravomyslova, E. (eds.): Biographical research<br />
in Eastern Europe. Aldershot, Hampshire: Ashgate 2002, pp. 211-224.+++ Ders.: Demographie<br />
und Strukturbruch. in: Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.): Zukunft der Arbeit V: demographische<br />
Entwicklung. Dokumentation einer internationalen Konferenz der Heinrich-<br />
Böll-Stiftung in der Reihe "Zukunft der Arbeit". Berlin 2002, S. 59-65.+++Ders.: Trajectories<br />
of coping strategies in Eastern Germany. in: Miller, Robert (ed.): Biographical research<br />
methods (Four-Volume Set). Part One: Time and biographical research, Sage Publ. Thousand<br />
Oaks 2005, pp. 133-149.+++Ders.: Betrieb und Arbeitmarkt. in: Abraham, M.; Hinze T.<br />
(Hrsg.): Arbeitsmarktsoziologie: Probleme, Theorien. Wiesbaden: VS-Verl. f. Sozialwiss.<br />
2005, S. 169-198. ARBEITSPAPIERE: Schwiderrek, F.: internationalisation@soft-waredevelopment.kmu.eu.<br />
Eine empirische Studie über die Internationalisierung von Klein- und Mittelständischen<br />
Unternehmen der New Economy in fünf europäischen Staaten. Magisterarbeit.<br />
Jena 2002.+++Köhler, C.; Struck, O.: Arbeitnehmerorientierte Beratung, Qualifizierung und<br />
Forschung in Thüringen. Erfurt: Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur<br />
2001.<br />
ART: gefördert BEGINN: 2001-07 ENDE: 2008-12 AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER:<br />
Deutsche Forschungsgemeinschaft<br />
INSTITUTION: Universität Jena, Fak. für Sozial- und Verhaltenswissenschaften, SFB 580 Gesellschaftliche<br />
Entwicklungen nach dem Systemumbruch - Diskontinuität, Tradition und<br />
Strukturbildung (Carl-Zeiss-Str. 2, 07743 Jena); Universität Jena, Fak. für Sozial- und Verhaltenswissenschaften,<br />
Institut für Soziologie Professur für Wirtschafts- und Sozialstruktur<br />
(07737 Jena)<br />
KONTAKT: Köhler, Christoph (Prof.Dr. Tel. 03641-945561,<br />
e-mail: chkoehler@soziologie.uni-jena.de)
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 45<br />
1 Industriegesellschaft, Theoriediskussion, Gesamtdarstellungen<br />
[5-F] Curbach, Janina, Dipl.-Soz. (Bearbeitung):<br />
Corporate Social Responsibility als Trägerkonzept für transnationale soziale Integration<br />
INHALT: Die zunehmende Verdichtung transnationaler ökonomischer Verflechtungen im Zuge<br />
von Globalisierungsprozessen hat auf der internationalen Ebene ein viel diskutiertes Defizit<br />
an politischer Steuerungsmöglichkeit und sozialer Integration zur Folge. Die im nationalen<br />
Raum entstandenen Institutionen, Akteursnetzwerke und Diskurse werden unterhöhlt (was<br />
vor allem in den Bereichen der Sozial- und Umweltpolitik diskutiert wird), sie durchlaufen<br />
aber gleichzeitig Veränderungen und werden durch neue, transnationale Institutionen, Akteursnetzwerke<br />
und Diskurse abgelöst, ergänzt und überlagert. So hat im Spannungsfeld zwischen<br />
Marktakteuren, zivilgesellschaftlichen Organisationen und (zwischen-)staatlichen öffentlichen<br />
Akteuren in den letzten Jahren das Konzept der Corporate Social Responsibility<br />
(CSR) zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die Rolle von transnationalen Unternehmen beschränkt<br />
sich im Rahmen des Diskurses zu CSR nicht mehr auf die von Teilnehmern an einem<br />
globalen Markt, die wiederum staatliche Akteure in einen politischen Standortwettbewerb<br />
drängen. Unternehmen sind nicht ausschließlich ihren eigenen, ökonomisch rationalen<br />
Interessen verpflichtet, sondern sie werden vielmehr als in gesellschaftliche und politische<br />
Strukturen eingebettet verstanden und dementsprechend zunehmend aufgefordert, ihre soziale<br />
und ökologische Verantwortung als kollektive (Welt-)Bürger wahrzunehmen und ihr ökonomisches<br />
Handeln auf diese Weise zu legitimieren. Im Dissertationsprojekt soll untersucht<br />
werden, inwieweit sich mit der Verbreitung von CSR als Diskurs und Praxis das Akteursnetzwerk<br />
zwischen Unternehmen, öffentlichen Akteuren und zivilgesellschaftlichen Organisationen<br />
verändert. Hierzu sollen insbesondere Veränderungen in der Organisationsstruktur<br />
und Kommunikation von Unternehmen im Verhältnis zu den anderen am Diskurs beteiligten<br />
Akteuren analysiert werden. Die im Hintergrund stehende Forschungsfrage ist dabei, ob CSR<br />
als soziale und kulturelle Konstruktion zur sozialen Integration jenseits des Nationalstaats<br />
beiträgt. Für die Untersuchung wird unterstellt, dass CSR eine Veränderung von verschiedenen<br />
Konzepten bedingt, wie z.B. Reputation, Transparenz, Nachhaltigkeit, Wettbewerb und<br />
Stabilität.<br />
ART: Dissertation; gefördert BEGINN: 2004-02 AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER: Deutsche<br />
Forschungsgemeinschaft<br />
INSTITUTION: Universität Bamberg, Fak. Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Graduiertenkolleg<br />
"Märkte und Sozialräume in Europa" (Lichtenhaidestr. 11, 96052 Bamberg)<br />
KONTAKT: Bearbeiterin (Tel. 0951-863-3124, Fax: 0951-863-1183,<br />
e-mail: janina.curbach@gmx.de)<br />
[6-F] Güth, Werner, Prof.Dr.; Sutter, Matthias, Prof.Dr. (Bearbeitung):<br />
Strategische Interaktion, Reziprozität und Fairness - Bausteine zu einer Theorie der Beschäftigungsbeziehung<br />
(Teilprojekt B7)<br />
INHALT: Dieses Teilprojekt untersucht mit spieltheoretisch-experimentellen Methoden die Unterschiede<br />
in der Gestaltung von Arbeitsverträgen in Ost- und Westdeutschland im Hinblick<br />
auf Vertragsform, Dauer und Entlohnung. Seit Beginn der 80er Jahre in Westdeutschland und<br />
seit dem Systemumbruch 1989 in Ostdeutschland lässt sich eine Zunahme von Beschäftigungsverhältnissen<br />
mit zeitlich begrenzten Perspektiven und eine damit verbundene verminderte<br />
Aktivität der betriebsinternen Arbeitsmärkte verzeichnen, was als "Externalisierungsprozess"<br />
bezeichnet wird (z.B. vermehrter Einsatz befristeter Verträge, Leiharbeit und
46 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
1 Industriegesellschaft, Theoriediskussion, Gesamtdarstellungen<br />
outsourcing). In den Alten und Neuen Bundesländern lässt sich eine unterschiedliche Akzeptanz<br />
dieser verschiedenen Vertragsformen beobachten, die sich vor allem auf unterschiedliche<br />
Fairnessempfindungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, aber auch auf die unterschiedlichen<br />
sozialen und gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Ost und West zurückführen<br />
lässt. Dieser Zusammenhang zwischen sozialmoralischen Verhaltenskalkülen wie Fairness<br />
und Reziprozität und der Vertragsform ist Gegenstand dieses Teilprojekts. Ziel ist es,<br />
Theoriebausteine zu entwickeln, die einerseits einen Beitrag zur Erklärung der Varianz der<br />
Vertragsformen in Ost und West leisten und die es andererseits ermöglichen, die personalwirtschaftlichen,<br />
betriebswirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Folgen der Externalisierungsprozesse<br />
zu analysieren. Zwei maßgebliche Forschungsfragen sollen in diesem Teilprojekt<br />
beantwortet werden: erstens, die Frage nach der Funktion von sozialmoralischen Handlungsorientierungen<br />
in der Beschäftigungsbeziehung, insbesondere den wirtschaftlich relevanten<br />
Aspekten Investitions- und Leistungsbereitschaft und nach der Entwicklung dieser Orientierungen<br />
unter unterschiedlichen sozialen und gesamtwirtschaftlichen Bedingungen;<br />
zweitens die Frage, wie sozialmoralische Dispositionen im Zusammenspiel mit institutionellgesetzlichen,<br />
wirtschaftlichen und sozialen Faktoren die Vertragsgestaltung in der Beschäftigungsbeziehung<br />
beeinflussen. Um diese Fragen zu beantworten, wird die Beschäftigungsbeziehung<br />
mit Hilfe des Prinzipal-Agenten-Ansatzes modelliert, und die daraus abgeleiteten<br />
verhaltenstheoretischen Hypothesen mit Daten aus Labor- und Feldexperimenten überprüft.<br />
Mit der Beantwortung dieser Fragen leistet dieses Teilprojekt zum einen grundlagentheoretische<br />
Beiträge zur Erforschung der Beschäftigungsbeziehung, zum anderen ergänzt es sinnvoll<br />
die anderen Teilprojekte des B-Bereichs in der Analyse von Ursachen, Folgen und Problemen<br />
der anhaltenden Externalisierungsprozesse. Zu den grundlagentheoretischen Neuerungen zählen<br />
vor allem die Analyse des Zusammenhangs von Vertragsform und sozialmoralischen<br />
Verhaltenskalkülen sowie die Einbeziehung von Wettbewerb auf den Absatzmärkten. Des<br />
Weiteren wird ein Beitrag zur "interkulturellen experimentellen" Forschung geleistet. Die<br />
Entwicklung von sozialmoralischen Handlungsorientierungen in der Beschäftigungsbeziehung<br />
ist unseres Wissens ebenfalls nicht Gegenstand der bisherigen Forschung. Als Ergänzung<br />
zu den historisch-empirisch orientierten Projekten des B-Bereichs bietet das Projekt die<br />
Möglichkeit, die empirisch erhobenen Unterschiede formal aufzuarbeiten und zu erklären.<br />
Ergebnisse des Kooperationsprojektes Arbeit und Gerechtigkeit verfügbar (unter: http://www.<br />
sfb580.uni-halle.de/veroeffentlichungen/b2/arbeit_und_gerechtigkeit-sfb.ppt ). Zunehmende<br />
Entstandardisierung von Beschäftigung stellt neue Fragen an das Gerechtigkeitsempfinden<br />
und die Leistungsbereitschaft von Erwerbstätigen. Unter Beteiligung der Projekte B2 und B7<br />
des Sonderforschungsbereich 580 wurde die Frage untersucht: Unter welchen Umständen<br />
werden Entlassungen und Lohnkürzungen von der Bevölkerung in Ost- und West-<br />
Deutschlands als gerecht empfunden und wann widersprechen sie Gerechtigkeitsempfindungen?<br />
GEOGRAPHISCHER RAUM: Ost- und Westdeutschland<br />
METHODE: spieltheoretisch-experimentelle Methoden<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: Burda, M.; Güth, W.; Kirchsteiger, G.; Uhlig, H.: Employment<br />
duration and resistance to wage reductions: experimental evidence. in: Homo Oeconomicus,<br />
22, 2005, 2, pp. 169-189.<br />
ART: gefördert AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER: Deutsche Forschungsgemeinschaft<br />
INSTITUTION: Universität Jena, Fak. für Sozial- und Verhaltenswissenschaften, SFB 580 Gesellschaftliche<br />
Entwicklungen nach dem Systemumbruch - Diskontinuität, Tradition und<br />
Strukturbildung (Carl-Zeiss-Str. 2, 07743 Jena); Max-Planck-Institut für Ökonomik Abt. Strategische<br />
Interaktion (Kahlaische Str. 10, 07745 Jena)
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 47<br />
1 Industriegesellschaft, Theoriediskussion, Gesamtdarstellungen<br />
KONTAKT: Güth, Werner (Prof.Dr. Tel. 03641-686621, Fax: 03641-686667, e-mail: gueth@<br />
mpiew-jena.mpg.de); Sutter, Matthias (Prof.Dr. e-mail: msutter@uni-koeln.de)<br />
[7-L] Hirsch-Kreinsen, Hartmut:<br />
Wissensteilung und "transdisziplinäre" Innovationen, in: Hansjürgen Paul, Erich Latniak<br />
(Hrsg.): Perspektiven der Gestaltung von Arbeit und Technik : Festschrift für Peter Brödner:<br />
Hampp, 2004, S. 51-72, ISBN: 3-87988-885-X (Standort: UB Siegen(467)-33QAP2861)<br />
INHALT: Der Autor erörtert die Generierung und Nutzung von Chancen zur Innovation und<br />
knüpft bei seinen Überlegungen zur Wissensteilung in Netzwerken an die Arbeiten Peter<br />
Brödners zu diesem Thema an. Die in Netzwerken stattfindenden transdisziplinären Innovationsprozesse<br />
stehen demnach vor der Herausforderung, eine Wissensteilung und Koordination<br />
gleichermaßen sicher zu stellen, um eine gemeinsame Verständnis- und Handlungsbasis für<br />
aus unterschiedlichen Unternehmen stammende Mitarbeiter zu schaffen. Charakteristisch für<br />
diesen neuen Modus der Wissens- und Technologieproduktion ist, dass unterschiedlich qualifizierte<br />
Akteure für eine begrenzte Zeit gemeinsam an Problemen arbeiten, die projektbezogen<br />
nach bestimmten Anwendungen definiert werden. Der Autor diskutiert die mit diesem<br />
Innovationsmodus verbundenen Herausforderungen und Widersprüche unter den Stichworten<br />
"Vermittlung unterschiedlicher Wissensformen", "Vernetzung", "Kontextualisierung" und<br />
"Internationalisierung". Er geht aber letztlich davon aus, dass derartige netzwerkförmige Innovationsmuster<br />
eher ein Ausdruck spezifischer technologischer Schübe sind und keinen<br />
neuen Innovationsmodus darstellen. Insofern können die Innovationsnetzwerke als Aspekt einer<br />
generellen Pluralisierung ökonomischer Regulation angesehen werden. (ICI2)<br />
[8-L] Holtrup, André:<br />
Interessen und Interessenvertretung heute - aus der Perspektive von Beschäftigten: erste<br />
empirische Befunde aus dem Forschungsprojekt zur subjektiven Relevanz von Arbeitsregulierung,<br />
(IAW Arbeitspapier, 16), Bremen 2005, 27 S. (Standort: IAB-61423 BR 946; Graue Literatur;<br />
URL: http://www.iaw.uni-bremen.de/FeA/downloads/IAW-Arbeitspapier%2016%20I%<br />
202005.pdf)<br />
INHALT: "Dieses Arbeitspapier stellt die ersten zentralen empirischen Ergebnisse des Forschungsprojekts<br />
zur 'subjektiven Relevanz von Arbeitsregulierung' dar. Untersucht wurden<br />
die Fragen, welche Ansprüche Beschäftigte heute an ihre Erwerbsarbeit stellen, wie sie die<br />
Arbeit im Spannungsfeld von Kollektivvereinbarungen und Selbstaushandlung reguliert sehen<br />
wollen und welchen Stellenwert Betriebsräte und Gewerkschaften für die Beschäftigten<br />
haben. Es ist festzustellen, dass die Wandlungserscheinungen in der Lebens- und Arbeitswelt<br />
die Sicht von Beschäftigten auf die Regulierung von Arbeit verändern. Sie führen dazu, dass<br />
sich die inhaltlichen Prioritäten verschieben und andere Erwartungen an die Regulierungsakteure<br />
-Betriebsräte, Gewerkschaften aber auch die Arbeitgeberseite herangetragen werden.<br />
Sie führen insgesamt betrachtet jedoch nicht zu Bestrebungen nach einer völligen Individualisierung<br />
der Regulierung von Arbeit." (Autorenreferat)
48 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
1 Industriegesellschaft, Theoriediskussion, Gesamtdarstellungen<br />
[9-F] Kirschenhofer, Sabine, Mag.; Mairhuber, Ingrid, Dr.; Papouschek, Ulrike, Dr.; Wagner,<br />
Christine; Meyer, Malte-Henning, M.A.; Schultheis, Franz; Poglia Mileti, Francesca; Tandolo,<br />
Riccardo; Plomb, Fabrice; Krenn, Manfred (Bearbeitung); Butterwegge, Christoph, Prof.Dr.;<br />
Hentges, Gudrun, Dr.; Flecker, Jörg, Dr. (Leitung):<br />
Socio-economic changes, individual reactions and the appeal of the extreme right (SIREN)<br />
INHALT: Im letzten Jahrzehnt hat die Unterstützung für rechtsextreme und rechtspopulistische<br />
Parteien in Europa drastisch zugenommen. Vielfach wird dies mit den Reaktionen der 'ModernisierungsverliererInnen'<br />
auf den sozio-ökonomischen Wandel begründet. Mit dem SI-<br />
REN-Projekt wird dieser Zusammenhang erstmals umfassend empirisch untersucht. Dafür<br />
werden die subjektiven Wahrnehmungen und individuellen Reaktionen auf veränderte Beschäftigungs-<br />
und Arbeitsbedingungen in Europa analysiert, woraus neue Erkenntnisse für die<br />
Diskussion über Flexibilität und Sicherheit im europäischen Sozialmodell gewonnen werden<br />
sollen. Zugleich wird empirisch untersucht, ob und in welchem Ausmaß die Veränderungen<br />
in der Arbeitswelt die BürgerInnen empfänglicher für Rechtspopulismus und Rechtsextremismus<br />
machen. Die interdisziplinäre und vergleichende Untersuchung umfasst acht europäische<br />
Länder. Sie enthält Literaturanalysen, qualitative und quantitative Primärerhebungen<br />
sowie Workshops mit VertreterInnen politischer Institutionen. Projekt in Kooperation mit der<br />
Magyar Tudománoyos Akadémia Budapest (Ungarn), dem Centre for Alternative Social Analysis<br />
(CASA) Kopenhagen (Dänemark) und dem Centre d'Etudes de l'Emploi "Le Descartes<br />
I" Noisy le Grand (Frankreich). GEOGRAPHISCHER RAUM: Österreich, Bundesrepublik<br />
Deutschland, Dänemark, Belgien, Frankreich, Schweiz, Italien, Ungarn<br />
METHODE: problemzentrierte Intensivinterviews; Repräsentativerhebung<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: keine Angaben ARBEITSPAPIERE: Flecker, J.; Kirschenhofer, S.:<br />
Liasons Dangereuses. Wien 2001.+++Flecker, J.; Kirschenhofer, S.; Mairhuber, I.: Socioeconomic<br />
change and right-wing extremism in Austria. Wien 2002.<br />
ART: Auftragsforschung; gefördert BEGINN: 2001-09 ENDE: 2004-08 AUFTRAGGEBER: Europäische<br />
Kommission; Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur FINAN-<br />
ZIERER: Auftraggeber<br />
INSTITUTION: Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt -FORBA- (Aspernbrückengasse 4,<br />
5, 1020 Wien, Österreich); Universität Köln, Erziehungswissenschaftliche Fakultät, Seminar<br />
für Sozialwissenschaften Abt. für Politikwissenschaft (Gronewaldstr. 2, 50931 Köln); Catholic<br />
University of Louvain, Hoger Instituut voor de Arbeid (E. van Evenstraat 2E, 3000 Louvain,<br />
Belgien); Université de Neuchâtel, Faculté des sciences économiques et sociales, Institut<br />
de sociologie et de science politique (Pierre-à-Mazel 7, 2000 Neuchâtel, Schweiz); Università<br />
Cattolica del Sacro Cuore Milano (Largo A. Gemelli, 20123 Mailand, Italien)<br />
KONTAKT: Flecker, Jörg (Dr. Tel. 01-2124700-72, Fax: -77, e-mail: flecker@forbar.at)<br />
[10-L] Kluge, Norbert:<br />
Mitbestimmte Unternehmensführung: ein Leitbild für das Europäische Sozialmodell?, in:<br />
Industrielle Beziehungen : Zeitschrift für Arbeit, Organisation und Management, Jg. 13/2006, H.<br />
1, S. 43-56<br />
INHALT: "Die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen soll nicht allein am Börsengewinn<br />
für ihre Eigner abgelesen werden. Dieses - historische - europäische Verständnis spiegelt<br />
sich bis heute im nationalen Unternehmensrecht der meisten EU-Mitgliedsstaaten wider.<br />
In 18 EU-Ländern haben Arbeitnehmer das Recht, ihre Repräsentanten in die obersten Ent-
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 49<br />
1 Industriegesellschaft, Theoriediskussion, Gesamtdarstellungen<br />
scheidungsgremien zu entsenden. Die europäische Gesetzgebung zur Europäischen Aktiengesellschaft<br />
(SE) sieht dieses Recht standardmäßig vor. Obligatorische Arbeitnehmerbeteiligung<br />
ist mehr als europäische Sozialpolitik. Sie ist ein Teil von guter Unternehmensführung und<br />
keine störende Zumutung für Manager. Allerdings wird sie um ihren institutionellen zukünftigen<br />
Platz in einer Welt steigender internationaler Börsenfinanzierung von Unternehmen<br />
streiten müssen." (Autorenreferat)<br />
[11-L] Korunka, Christian; Hoffmann, Peter (Hrsg.):<br />
Change and quality in human service work: dedicatedt to the work of André Büssing, (Organizational<br />
Psychology and Health Care, Vol. 4), München: Hampp 2005, 336 S., ISBN: 3-<br />
87988-915-7 (Standort: USB Köln(38)-32A2689)<br />
INHALT: "In the last years, an acceleration of change processes is observable in the world of<br />
work. New types of work and changes in work organization appear in nearly all fields of<br />
work. Human service work is especially affected by these changes. Both, in public and private<br />
service organizations, are comprehensive changes processes carried out. Goals of these<br />
processes are typically the improvement of quality of services and cost reductions at the same<br />
time. Employees are often strongly affected by these changes. The conference series 'Organizational<br />
Psychology and Health Care', patronized by the ENOP (European Network of Organizational<br />
Psychology), focuses on human service work from a Work- and Organizational<br />
Psychology perspective. The VIII conference took place in October 2003 in Vienna, Austria.<br />
The specific topic of this conference was 'Change and Quality in Human Service Work'. This<br />
book presents selected papers from the Vienna conference. The range of the book chapters reflects<br />
the actual trends of organizational changes in human service work and their expression<br />
in research in organizational psychology. A strong focus on organizational change in human<br />
service work, design concepts of change management and studies of the effects of change on<br />
employees is shown by the number of chapters dealing with these subjects. Another group of<br />
papers is dealing with actual questions of burnout research. An additional focus is represented<br />
by chapters dealing with the optimization of working conditions in the field. Three chapters<br />
dealing with the development of new research instruments complete the book. The book is<br />
dedicated to the work of André Bussing (1950-2003)." (author's abstract). Content: Jürgen<br />
Glaser: Analysis and design of nursing work - A decade of research in different fields of<br />
health care (13-31); Denise M Rousseau: Improving health care work environments: The<br />
need for evidence-based management (33-46); Johnny Hellgren, Magnus Sverke, Helena Falkenberg<br />
and Stephan Baraldi: Physicians' work climate at three hospitals under different types<br />
of ownership (47-65); Teresia Andersson-Straberg, Magnus Sverke, Johnny Hellgren and<br />
Katharina Näswall: Attitudes toward individualized pay among human service workers in the<br />
public sector (67-82); Pádraig Mac Neela, Anne Scott, Anne Matthews, Melissa Corbally,<br />
Anne Walsh-Daneshmandi and Pamela Gallagher: From structures to attitudes: A process<br />
model of empowerment, job satisfaction and affective commitment (83-95); Peggy De Prins,<br />
Erik Henderickx, Ria Janvier and Ingrid Willems: The added value of innovative HRM and<br />
organisational practices for the quality of care and care work: An application in Flemish old<br />
age and nursing homes (97-115); Ilse Cornelis and Peter Vlerick: Employee well-being and<br />
customer satisfaction in the context of work environment Changes (117-129); Tobias Eklund<br />
and Per Tillman: Comparison of male and female manager's Assessment Center ratings (131-<br />
148); Agnes Juhász: Designing a Hungarian worksite health promotion program: Needs and<br />
purposes (149-161); Monica Nyström: Managers' subjective role projects during the initial
50 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
1 Industriegesellschaft, Theoriediskussion, Gesamtdarstellungen<br />
phase of an organizational change process (163-178); Holger Pfaff, Jürgen Lütticke, Nicole<br />
Ernstmann, Frank Pühlhofer and Peter Richter: Demands and organizational stress reactions<br />
in hospitals (179-191); Ronald J. Burke: Hospital restructuring and downsizing and psychological<br />
burnout among nursing staff: A longitudinal study (193-204); Wilmar Schaufeli,<br />
Vicente Gonzalez-Roma, José-Maria Peiró, Sabine Geurts and Inés Tomás: Withdrawal and<br />
burnout in health care: On the mediating role of lack of reciprocity (205-225); Julia Hickel<br />
and Christian Korunka: Job burnout among Austrian psychotherapists (227-240); Karin<br />
Proost, Karel De Witte, Hans De Witte and Georges Evers: Burnout of nurses working in<br />
three different medical fields (241-256); Pascale Carayon, Ayse P. Gurses, Ann Schoofs<br />
Hundt, Phillip Ayoub, and Carla J. Alvarado: Performance obstacles and facilitators of<br />
healthcare providers (257-276); Nik Chmiel: Promoting healthy work: Self-reported minor injuries,<br />
work characteristics, and safety behaviour (277-288); Cornelia Kleindienst and Markus<br />
Schöbel: Working together in the operating theatre: Determinants of trust-based decisions<br />
(289-297); Silke Pawils, Bernadette Klapper, Doris Schaeffer and Uwe Koch: Experiences in<br />
the German model project 'Interprofessional Communication in Hospitals' (299-309); Paulino<br />
Jiménez and K. Wolfgang Kallus: Stress and recovery of social care professionals: Development<br />
of a screening version of the Recovery-Stress-Questionnaire for work (311-323); Michael<br />
Trimmel and Gerlinde Rohrauer: A questionnaire for assessing ethical aspects and organizational<br />
quality of on-line counselling websites (325-336).<br />
[12-F] Lange, Knut (Bearbeitung):<br />
Strategien deutscher Biotech-Unternehmen: eine institutionentheoretische Analyse<br />
INHALT: Deutsche Biotech-Unternehmen sind in den letzten Jahren zunehmend in einem Marktsegment<br />
aktiv geworden, das als technologisch und finanziell hochriskant gilt. Diese Entwicklungen<br />
stehen der zur Analyse hochentwickelter Volkswirtschaften eingesetzten Institutionentheorie<br />
entgegen. Vertreter dieser Theorie nehmen an, dass solche Strategien zwar in<br />
liberalen Marktwirtschaften wie die der USA oder Großbritanniens möglich sind, in koordinierten<br />
Marktwirtschaften aber, zu denen auch die deutsche zählt, durch die institutionellen<br />
Rahmenbedingungen erschwert werden. Ziel dieses Dissertationsprojektes ist es, die Wirkung<br />
von nationalen institutionellen Rahmenbedingungen auf die Strategien von Unternehmen im<br />
deutschen Biotechnologiesektor zu analysieren. Die Ergebnisse sollen zur Überprüfung und<br />
Weiterentwicklung der Institutionentheorie beitragen. GEOGRAPHISCHER RAUM: Bundesrepublik<br />
Deutschland<br />
METHODE: Die Datenerhebung geschieht durch Auswertung öffentlich zugänglicher Daten<br />
(Homepages, Branchenreports) und halbstandardisierte Unternehmensinterviews.<br />
ART: Dissertation BEGINN: 2002-06 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine<br />
Angabe<br />
INSTITUTION: Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung (Paulstr. 3, 50676 Köln)<br />
KONTAKT: Institution (Tel. 0221-2767-0, Fax: 0221-2767-555,<br />
e-mail: info@mpi-fg-koeln.mpg.de)<br />
[13-F] Löser, Roland, Dipl.-Kfm. (Bearbeitung); Helten, Elmar, Prof.Dr. (Betreuung):<br />
Das Betriebsunterbrechungsrisiko aus systemtheoretischer Sicht
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 51<br />
1 Industriegesellschaft, Theoriediskussion, Gesamtdarstellungen<br />
INHALT: Strukturierung der Betriebsunterbrechungsanalyse durch Komplexitätsreduktion unter<br />
Berücksichtigung der Beziehungen zwischen den Elementen (Menschen, Maschinen) des<br />
Systems Unternehmen.<br />
METHODE: kybernetische Untersuchung auf systemtheoretischer Basis<br />
ART: Dissertation BEGINN: 2004-10 ENDE: 2007-03 AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER:<br />
Wissenschaftler<br />
INSTITUTION: Universität München, Fak. für Betriebswirtschaft, Institut für Risikoforschung<br />
und Versicherungswirtschaft -INRIVER- (Schackstr. 4, 80539 München)<br />
KONTAKT: Bearbeiter (Tel. 0931-2995397, e-mail: roland.loeser@arcor.de)<br />
[14-F] Mayer-Ahuja, Nicole, Dr.; Wolf, Harald, PD Dr.; Blanke, Thomas, Prof.; Gottschall, Karin,<br />
Prof.Dr.; Pries, Ludger, Prof.Dr.; Sydow, Jörg, Prof.Dr.; Volmerg, Birgit, Prof.Dr. (Bearbeitung);<br />
Schumann, Michael, Prof.Dr. (Leitung):<br />
Grenzen der Entgrenzung von Arbeit - Notwendigkeit einer Neuformierung der Arbeitsforschung<br />
INHALT: Ein neuer Typus netzwerkförmiger, empirisch-interdisziplinärer Arbeitsforschung soll<br />
exemplarisch erprobt werden. Es geht um forschungsprozessorientierte Interdisziplinarität im<br />
Zugriff auf einen zukunftsweisenden Gegenstand: Sechs eng koordinierte Teilprojekte untersuchen<br />
die Entwicklungstendenzen von Arbeit im Trendsektor Neue Medien und Kulturindustrie<br />
auf verschiedenen, in Wechselwirkung stehenden Ebenen (Unternehmensorganisation,<br />
Erwerbsformen und Geschlechterarrangements, Arbeitsrecht, Interessenregulierung, Arbeitsorganisation,<br />
Arbeitsidentität), orientiert an gemeinsamen Leithypothesen sowie an den Leitbegriffen<br />
"Grenzen der Entgrenzung", "Autonomie" und "Bindung".<br />
ART: keine Angabe BEGINN: 2002-01 ENDE: 2005-12 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FI-<br />
NANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Universität Göttingen, Sozialwissenschaftliche Fakultät, Institut für Soziologie<br />
(Platz der Göttinger Sieben 3, 37073 Göttingen); Universität Oldenburg, Fak. 02 Informatik,<br />
Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, Institut für Rechtswissenschaften Lehrstuhl Arbeitsrecht<br />
(Postfach 2503, 26111 Oldenburg); Universität Bremen, Zentrum für Sozialpolitik<br />
(Postfach 330440, 28334 Bremen); Universität Bochum, Fak. für Sozialwissenschaft, Sektion<br />
Soziologie Lehrstuhl Organisationssoziologie und Mitbestimmungsforschung (Universitätsstr.<br />
150, 44780 Bochum); Freie Universität Berlin, FB Wirtschaftswissenschaft, Institut<br />
für Management Lehrstuhl für Unternehmenskooperation (Boltzmannstr. 20, 14195 Berlin);<br />
Universität Bremen, FB 11 Human- und Gesundheitswissenschaften, Institut für Psychologie<br />
und Sozialforschung (Grazer Str. 2c, 28359 Bremen)<br />
KONTAKT: Leiter (Tel. 0551-522050, Fax: 0551-5220588,<br />
e-mail: mschuma@uni-goettingen.de)<br />
[15-L] Mayer-Ahuja, Nicole; Wolf, Harald (Hrsg.):<br />
Entfesselte Arbeit - neue Bindungen: Grenzen der Entgrenzung in der Medien- und Kulturindustrie,<br />
Berlin: Ed. Sigma 2005, 341 S., ISBN: 3-89404-535-3<br />
INHALT: "Liegt die Zukunft der Arbeit tatsächlich in ihrer allseitigen Entgrenzung, wie vielfach<br />
in Wissenschaft und Politik behauptet wird? Dieser Band zeigt, dass es 'entgrenzte Arbeit' in<br />
Reinform selbst bei hochqualifizierten, kreativen Tätigkeiten nicht gibt, denn stets gehen Feh-
52 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
1 Industriegesellschaft, Theoriediskussion, Gesamtdarstellungen<br />
len oder Wegfall von Regulierungsstrukturen und -mechanismen mit der Fortexistenz alter<br />
und der Herausbildung neuer sozialer Bindungen einher. Die Autorinnen und Autoren spüren<br />
solche Grenzen der Entgrenzung exemplarisch im Bereich der Medien- und Kulturindustrie<br />
auf - Branchen, die als Vorreiter einer 'entgrenzten' Arbeitswelt gelten. Eingeleitet von einer<br />
begrifflich-analytischen Reflexion über die Kategorien Selbst- und Fremdbindung werden<br />
empirische Ergebnisse eines Forschungsverbundes präsentiert, der sich aus unterschiedlichen<br />
Perspektiven (Arbeitssoziologie, Industrial-Relations-, Arbeitsmarkt- und Geschlechterforschung,<br />
Betriebswirtschaftslehre, Arbeitsrecht und Arbeitspsychologie) mit der Arbeit in Internet-<br />
und Multimediaunternehmen, Journalismus, TV-Produktion, öffentlichem und privatem<br />
Rundfunk sowie Museen befasst hat. Dabei kommen vielfältige Grenzen der Entgrenzung<br />
von Erwerbsarbeit und Organisation zur Sprache - neu entstehende, weiterhin bestehende<br />
und solche, die künftig aktiv gesetzt werden müssen." (Autorenreferat). Inhaltsverzeichnis:<br />
Nicole Mayer-Ahuja, Harald Wolf: Einleitung (11-23); Stephan Manning, Harald Wolf: Bindung<br />
von Arbeit und Arbeitskraft: Eine theoretische Perspektive auf Grenzen der Entgrenzung<br />
(25-57); Nicole Mayer-Ahuja, Harald Wolf: Arbeit am Netz: Formen der Selbst- und<br />
Fremdbindung bei Internetdienstleistern (61-108); Jörg Abel, Ludger Pries: Von der Stellvertretung<br />
zur Selbstvertretung? Interessenvertretung bei hochqualifizierter Wissensarbeit in<br />
Neue-Medien-Unternehmen (109-152); Karin Gottschall, Annette Henninger: Freelancer in<br />
den Kultur- und Medienberufen: freiberuflich, aber nicht frei schwebend (153-183); Stephan<br />
Manning, Jörg Sydow: Arbeitskräftebindung in Projektnetzwerken der Fernsehfilmproduktion:<br />
Die Rolle von Vertrauen, Reputation und Interdependenz (185-219); Peter Bleses: Unternehmerischer<br />
Autonomiebedarf: Die Entgeltgestaltung im Rundfunksektor (221-262); Birgit<br />
Volmerg, Sabine Mader, Just Mields: Mit Leib und Seele bei der Arbeit: Arbeitserfahrungen<br />
in Kultureinrichtungen (263-299); Annette Henninger, Peter Bleses: Die Grenzen markieren -<br />
und wie weiter? Zuspitzungen, Schlussfolgerungen, offene Fragen (301-319).<br />
[16-L] Pfeiffer, Sabine; Jäger, Wieland:<br />
Ende des Elends: Marxsche Reformulierung, handlungstheoretischer Beitrag und dialektische<br />
Reanimation der Arbeits- und Industriesoziologie, in: Soziologie : Forum der Deutschen<br />
Gesellschaft für Soziologie, Jg. 35/2006, H. 1, S. 7-25 (Standort: UuStB (Köln)38-XG0236; Kopie<br />
über den Literaturdienst erhältlich)<br />
INHALT: "In der aktuellsten Runde der Debatte um Elend und Krise der Arbeits- und Industriesoziologie<br />
fällt auf, dass scheinbar längst Vergessenes und in den letzten Jahren fast Tabuisiertes<br />
wieder in den Fokus zu rücken scheint: wenn auch mit unterschiedlicher Stoßrichtung<br />
- die Marxsche Theorie wird wieder als (eine) Teillösung in die endlos zwischen Elend und<br />
Ende oszillierende Debatte der Disziplin eingebracht. Der Beitrag knüpft an diese Debatte an<br />
und zeigt zunächst, dass die Forderung nach einer handlungstheoretischen Re-Interpretation<br />
der Marxschen Grundlagen auf fruchtbaren Boden fällt - hat doch die Arbeits- und Industriesoziologie<br />
mit dem Konzept des Subjektivierenden Arbeitshandeln längst einen spezifischen<br />
und genuinen Beitrag zur soziologischen Handlungstheorie geleistet. Zudem zeigen wir, dass<br />
die eingeklagte gesellschaftstheoretische Re-Fundierung der Arbeits- und Industriesoziologie<br />
mehr als das erfordert, nämlich eine dialektische Reanimation der Marxschen Grundlagen<br />
(vielleicht nicht nur) der Arbeits- und Industriesoziologie. Dies gelingt mit der Kategorie des<br />
Arbeitsvermögens, die gleichzeitig eine operationalisierbare Brücke zwischen Arbeits- und<br />
Lebenswelt und damit die Grundlage zu der ebenso alten wie jüngst wieder aufgelegten Forderung<br />
nach einem über die Erwerbsarbeit hinaus weisenden Arbeitsbegriff bildet. Der Arti-
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 53<br />
1 Industriegesellschaft, Theoriediskussion, Gesamtdarstellungen<br />
kel versteht sich partiell als Antwort auf die aktuelle Debatte und führt diese in kritischer<br />
Auseinandersetzung mit den vorgelegten Beiträgen weiter." (Autorenreferat)<br />
[17-L] Platzer, Hans-Wolfgang:<br />
Europäisches Sozialmodell und Arbeitsbeziehungen in der erweiterten EU: ein Problemaufriss,<br />
in: Alexandra Baum-Ceisig, Anne Faber (Hrsg.): Soziales Europa? : Perspektiven des Wohlfahrtsstaates<br />
im Kontext von Europäisierung und Globalisierung ; Festschrift für Klaus Busch,<br />
Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss., 2005, S. 153-182, ISBN: 3-531-14644-0<br />
INHALT: Die Diskussion um ein "europäisches Sozialmodell" weist zwei Dimensionen auf: das<br />
europäische Sozialmodell als historische Gesellschaftsformation einerseits, als integrationspolitisches<br />
Leitbild andererseits. Auf beiden Ebenen stellen sich mit der Integration der mittel-<br />
und osteuropäischen Staaten in die EU neue Fragen: Welcher Einfluss wird von den Arbeitsbeziehungen<br />
in den neuen Mitgliedstaaten einerseits auf diese Staaten selbst, andererseits<br />
auf die "alten" EU-Staaten und zum Dritten auf die transnationalen Entwicklungen im EU-<br />
Raum ausgehen? Der Verfasser zeigt, dass die sozialpolitische Entwicklung in der EU letztlich<br />
von gesellschaftlichen und politischen Kräfteverhältnissen abhängig ist. Mit Blick auf die<br />
schwach ausgebildeten Strukturen betrieblicher und überbetrieblicher Kollektivvertragspolitik<br />
in den neuen Mitgliedstaaten wird dabei deutlich, dass sich die Herausforderungen und Risiken<br />
für das europäische Sozialmodell im Zuge der Osterweiterung potenzieren. (ICE2)<br />
[18-L] Schroeder, Wolfgang; Weinert, Rainer:<br />
Arbeitsbeziehungen in Schweden und Deutschland: Differenzierung und Dezentralisierung<br />
als Herausforderung, in: Susanne Lütz, Roland Czada (Hrsg.): Wohlfahrtsstaat - Transformation<br />
und Perspektiven, Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss., 2004, S. 267-295, ISBN: 3-8100-3908-X<br />
INHALT: Lange Zeit galt Schweden als Prototyp des sozialdemokratisch-skandinavischen Modells<br />
und Deutschland als Prototyp des konservativ-korporatistischen Kapitalismusmodells.<br />
Seit Anfang der 1980er Jahre sind die Arbeitsbeziehungen in beiden Ländern unter Druck geraten.<br />
Die beiden Hauptkritikpunkte lauten: mangelnde Flexibilität in der innovativen Anpassung<br />
an veränderte technologische und wettbewerbliche Umweltbedingungen sowie unzureichende<br />
Antworten auf die Massenarbeitslosigkeit. Der vorliegende Beitrag geht vor diesem<br />
Hintergrund der Frage nach, welche Bedingungen und Einflussfaktoren für den Wandel der<br />
industriellen Beziehungen in beiden Ländern entscheidend waren, um Wandel zu ermöglichen<br />
bzw. zu blockieren. Der Beitrag gliedert sich in drei Hauptteile: im ersten werden zusammenfassend<br />
die alten Modelle der Arbeitsbeziehungen in Schweden und Deutschland<br />
skizziert, im zweiten wird der Wandel in den 1980er und 1990er Jahren betrachtet, um im<br />
dritten Teil die neuen Konturen der Arbeitsbeziehungen zu behandeln. Aus institutionenanalytischer<br />
Perspektive wird die Bedeutung der Triade Ideen-Interessen-Institutionen für den<br />
Wandel von Systemen der Arbeitsbeziehungen diskutiert. (ICA2)<br />
[19-F] Schulze, Tanja; Langhoff, Thomas (Bearbeitung); Volkholz, Volker, Dr. (Leitung):<br />
Humanressourcen-Reporting für eine sich wandelnde Arbeitswelt. Ein Grundlagenprojekt<br />
mit praktischem Tun
54 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
1 Industriegesellschaft, Theoriediskussion, Gesamtdarstellungen<br />
INHALT: Erörterung von Lern- und Kreativitätsanforderungen, könnendem Wissen, ungenutzten<br />
und überforderten Arbeitspotenzialen im Urteil der Arbeitnehmer. Kontext/ Problemlage: Die<br />
EU-Kommission betont zunehmend stärker Zusammenhänge zwischen Arbeitsqualität und -<br />
produktivität. Der demographische Wandel stellt gewaltige Anforderungen an die Arbeitsgestaltung.<br />
In Deutschland versuchen u.a. die INQA-Initiative (Initiative Neue Qualität der Arbeit)<br />
und das Forschungsprogramm "Innovative Arbeitsgestaltungen" und verschiedene HBS-<br />
Projekte diesen Anforderungen Rechnung zu tragen. Das Projekt will zeigen, dass eine Unterstützung<br />
dieser Bemühungen durch geeignete Humanindikatoren möglich ist. Fragestellung:<br />
Zunächst wissenschaftlich, später praktisch soll erdacht und erprobt werden, ob es möglich<br />
ist, derStimme der Arbeitnehmer durch die Neukonzeptionierung von Beschäftigungserhebungen<br />
ein zusätzliches Gewicht zu aktuellen Fragen zu geben.<br />
METHODE: a) Entwicklung und Erprobung neuer Auswertungsalgorithmen zur Steigerung der<br />
Aussagekraft von Beschäftigungserhebungen; b) Test-Datensätze der IAB/ BIBB-Beschäftigungserhebungen<br />
von 1985/86, 1991/92 und 1998/99; c) Versuch, Luhmanns Anregungen<br />
von 1960 zur äquivalenz-funktionalen Methode, operativ zu nutzen<br />
ART: gefördert AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: Hans-Böckler-Stiftung<br />
INSTITUTION: Gesellschaft für Arbeitsschutz und Humanisierungsforschung mbH -GfAH-<br />
Volkholz und Partner (Friedensplatz 6, 44135 Dortmund); Prospektiv - Gesellschaft für betriebliche<br />
Zukunftsgestaltungen mbH (Friedensplatz 6, 44135 Dortmund)<br />
KONTAKT: Leiter (e-mail: volkholz@gfah-do.de); Schulze, Tanja<br />
(e-mail: schulze@prospektiv.do.de)<br />
[20-L] Stock, Manfred:<br />
Arbeiter, Unternehmer, Professioneller: zur sozialen Konstruktion von Beschäftigung in der<br />
Moderne, Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss. 2005, 395 S., ISBN: 3-531-14475-8<br />
INHALT: "Die Arbeit untersucht die soziale Konstruktion von Beschäftigung in der Moderne in<br />
einer theorievergleichenden Perspektive. Der Autor bezieht sich dabei auf ausführliche Auseinandersetzungen<br />
mit den Gesellschaftstheorien von Marx, Weber, Durkheim und Parsons<br />
auf die aktuelle Debatte, die in der Arbeits- und Industriesoziologie, der Berufs- und Professionssoziologie<br />
sowie in der Organisationssoziologie zu diesem Thema geführt wird. Eine der<br />
zentralen Fragen ist dabei, ob in der gegenwärtigen Phase der Moderne die Rolle des Professionellen<br />
gegenüber der des Arbeiters und der des Unternehmers strukturell an Bedeutung -<br />
im Sinne einer Professionalisierung der Arbeit - gewinnt." (Autorenreferat)<br />
[21-F] Stoll, Bettina, Dipl.-Päd. Dipl.-Soz.Päd. (Bearbeitung); Hettlage, Robert, Prof.Dr.Dr.<br />
(Betreuung):<br />
Corporate Social Responsibility als holistisches Verständnis der Unternehmenstätigkeit kleiner<br />
und mittlerer Unternehmen. Theorie zu den konstituierenden Faktoren, der Typologie<br />
und funktionalen Bedingungen einer KMU-CSR (Arbeitstitel)<br />
INHALT: Forschungsfrage: Was sind konstituierende Bestimmungsfaktoren unternehmerischen<br />
sozialverantwortlichen Handelns in KMU und unter welcher Konstellation dieser verschiedene<br />
Bedingungen (subsumiert in einer KMU-CSR-Typologie) zeigen kleine und mittlere Unternehmen<br />
(KMU) bzw. deren Unternehmerinnen, in Abhängigkeit von ihrem jeweiligen<br />
Verantwortungskonzept, welche Art sozialverantwortlichen Handelns? Durch welche Hand-
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 55<br />
1 Industriegesellschaft, Theoriediskussion, Gesamtdarstellungen<br />
lungsempfehlungen kann die Umsetzung eines definierten erwünschten Typus der KMU-CSR<br />
unterstützt werden? Aus der Forschungsfrage ergeben sich wiederum folgende Inhalte und<br />
Aufbau der Arbeit: Zentraler Gegenstand dieser Arbeit ist die Corporate Social Responsibility.<br />
Daher gilt es sich der Definition, den relativen Auslegungsmöglichkeiten dieses Begriffes<br />
und seiner Abgrenzung zu nahe stehenden Begriffen zu widmen. Außerdem geht es um das<br />
Entdecken von Entwicklungen und Formulierungen, die in jüngerer Zeit dafür stehen, dass<br />
soziale Verantwortung von Unternehmen übernommen wird und werden soll. Zunächst wird<br />
dabei auf den generellen Begründungskontext der CSR Bezug genommen, im Anschluss daran<br />
auf den speziellen Begründungskontext der "CSR durch KMU". Im Weiteren widmet sich<br />
diese Arbeit zwei zentralen Wesensbeschreibungen der KMU-CSR. Es werden die Attribute<br />
der (inhabergeführten) kleinen und mittleren Unternehmen herausgearbeitet, wie auch die Bestimmungsmerkmale<br />
einer auf die Unternehmerinnenpersönlichkeiten, d.h. einer individuumsorientierten<br />
bezogenen Verantwortung, aufgezeigt bzw. entwickelt werden. Zur Beschreibung<br />
der KMU und ihres Bezuges zur CSR wird der Unternehmensbegriff, die quantitativen<br />
und qualitativen Merkmale der KMU und die Bedeutung der KMU-Inhaberinnen besonders<br />
fokussiert. Zur Legitimation und Verdeutlichung der Relevanz der KMU für die CSR<br />
(und umgekehrt), wird zudem die Bedeutung der KMU in der Gesellschaft unter ordnungspolitischen,<br />
sozialpolitischen und wirtschaftlichen Aspekten dargestellt. Die Wesensbeschreibung<br />
"der" Verantwortung des (soziologischen) Verantwortungsbegriffs erfolgt durch die<br />
Darstellung ausgewählter soziologischer Theorien und Konzepte zur Verantwortung.<br />
METHODE: Erhebung und Analyse der wissenschaftlichen und öffentlichen Auseinandersetzung<br />
zur unternehmerischen gesellschaftlichen Verantwortung. Zentraler Bezug zur Theorie der<br />
Verantwortung, Unternehmensethik, Handlungstheorie, Einbezug empirischer Ergebnisse, Erfahrungen<br />
und Einsichten als Content Development-Manager eines vorangehenden ESF 6-<br />
Praxisprojektes zum Thema Corporate Social Responsibility in Small and Medium Enterprises.<br />
DATENGEWINNUNG: Literaturanalyse (Rückgriff auf Ergebnisse und Daten eines empirischen<br />
ESF-Projektes zum Thema). Kritische Reflexion (bestehende Handlungsempfehlungen<br />
zur CSR).<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: Ferdinand, Niels; Stoll, Bettina u.a.: Corporate citizenship der<br />
Unternehmensstrategie. in: Dettling, Daniel (Hrsg.): Lust auf Zukunft - Kommunikation für<br />
eine nachhaltige Globalisierung. Hamburg 2004.+++Stoll, Bettina: Soziale Verantwortung in<br />
und durch kleine und mittlere Unternehmen: das Cosore-Konzept zur geschäftsintegrierten<br />
und nutzenorientierten Umsetzung. in: Stiftung und Sponsoring, 2004, 1.<br />
ART: Dissertation BEGINN: 2002-01 ENDE: 2005-12 AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER:<br />
Wissenschaftler<br />
INSTITUTION: Universität Regensburg, Philosophische Fakultät 03 - Geschichte, Gesellschaft<br />
und Geographie, Institut für Soziologie Lehrstuhl Soziologie (93040 Regensburg)<br />
KONTAKT: Bearbeiterin (Tel. 0941-9428022, e-mail: Bettina-Stoll@t-online.de)<br />
[22-F] Strasser, Hermann, Univ.-Prof.Dr.Ph.D. (Betreuung):<br />
Neue Wege zum Reichtum: Abfinden und Enthüllen<br />
INHALT: keine Angaben<br />
ART: Dissertation AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Universität Duisburg-Essen Campus Duisburg, FB Gesellschaftswissenschaften,<br />
Institut für Soziologie Professur für Soziologie II (Lotharstr. 65, 47048 Duisburg)
56 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
1 Industriegesellschaft, Theoriediskussion, Gesamtdarstellungen<br />
KONTAKT: Betreuer (Tel. 0203-379-2732, Fax: 0203-379-1424,<br />
e-mail: strasser@uni-duisburg.de)<br />
[23-L] Széll, György:<br />
Soziologie und industrielle Demokratie, in: Nikolai Genov (Hrsg.): Die Entwicklung des soziologischen<br />
Wissens : Ergebnisse eines halben Jahrhunderts, Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss.,<br />
2005, S. 397-419, ISBN: 3-8100-4121-1 (Standort: UuStB Köln(38)-32A3498)<br />
INHALT: Für den Bereich Arbeits- und Industriesoziologie klärt der vorliegende Beitrag, welche<br />
Rolle Soziologen im Hinblick auf die Erklärung und das Management der Prozesse in Betrieben<br />
und Organisationen spielen können. Die Antwort hängt sehr stark von der kritischen<br />
Selbstreflexion ihrer eigenen Vergangenheit im letzten halben Jahrhunderts ab. Der Beitrag<br />
will Selbstreflexionsprozess befördern, indem die Ausführungen anhand der folgenden neun<br />
Thesen strukturiert werden: (1) Der Einfluss der Soziologie auf die Organisationsdemokratie<br />
bestimmt sich durch ein dialektisches Verhältnis. (2) Soziologie ist ein Kind der Industriegesellschaft<br />
und der Aufklärung. 3) Daher ist das Streben nach Demokratie zuallererst ein Streben<br />
nach Organisationsdemokratie. (4) Die Ausbreitung der Organisationsdemokratie findet<br />
normalerweise parallel zur Ausbreitung der Soziologie und umgekehrt statt. (5) Die postindustrielle<br />
Gesellschaft, die als eine wissensbasierte verstanden wird, benötigt keine Organisationsdemokratie<br />
und fördert auch nicht soziologische Studien in diesem Bereich. (6) Kapitalismus<br />
im 21. Jahrhundert verlangt Good Governance und keine Demokratie. (7) Die Krise<br />
der Organisationsdemokratie und ihrer soziologischen Reflexion kann nur überwunden werden<br />
durch eine Redemokratisierung der ganzen Gesellschaft im globalen Maßstab. (8) Auf<br />
der globalen Ebene befinden wir uns ganz am Anfang im Hinblick auf Organisationsdemokratie,<br />
und wir benötigen eine kritische Reflexion der bisherigen Forschung zur Organisationsdemokratie.<br />
(9) "Phronesis" - die Suche nach der "Guten Gesellschaft" - ist dafür ein alter<br />
und neuer Ansatz. (ICA2)<br />
[24-F] Universität Lüneburg:<br />
Arbeit als soziale Beziehung<br />
INHALT: Was immer ein Arbeitsverhältnis sonst sein mag, es ist in jedem Fall und zuerst eine<br />
soziale Beziehung. Dies gilt für alle Beschäftigungsformen gleichermaßen, also für das so<br />
genannte Normalarbeitsverhältnis ebenso wie für die so genannten Neueren Beschäftigungsformen<br />
wie Leiharbeit, befristete Beschäftigung, geringfügige Beschäftigung, Teilzeitarbeit,<br />
Arbeit auf Abruf usw., ja sogar für das Verhältnis von Selbständigen zu ihren Auftraggebern.<br />
Eine Personalwirtschaftslehre, die diesen Namen verdient, muss sich mit der Frage beschäftigen,<br />
welche Kräfte für die Dynamik und Stabilität von Arbeitsbeziehungen verantwortlich<br />
sind. Zur Beantwortung dieser Frage kann auf eine reiche sozialtheoretische Diskussion zurückgegriffen<br />
werden. Diese kreist insbesondere um vier grundlegende Themen: um Fragen<br />
der Macht und Abhängigkeit, um die Nutzenkalküle der in der Arbeitsbeziehung betroffenen<br />
Akteure, um Fragen der sozialen Identität und Zugehörigkeit sowie um den Zeithorizont, auf<br />
den die soziale Beziehung hin angelegt ist. Eine Hypothese behauptet, dass bestimmte Merkmalsausprägungen<br />
eher zu einer Stabilisierung, andere dagegen zu einer Destabilisierung sozialer<br />
Systeme beitragen. So wird beispielsweise ein hohes Anreiz-Beitrags-Ungleichgewicht<br />
Kräfte freisetzen, die auf seine Beseitigung drängen. Daraus resultiert zwar nicht automatisch
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 57<br />
1 Industriegesellschaft, Theoriediskussion, Gesamtdarstellungen<br />
oder notwendigerweise ein neues Gleichgewicht. Denn tatsächlich findet man auch relativ<br />
stabile soziale Beziehungen mit deutlichen Anreiz-Beitrags-Ungleichgewichten. Derartige<br />
Beziehungen haben aber nur Bestand - so jedenfalls die hier vertretene Hypothese - wenn es<br />
stabilisierende Kräfte gibt, die dem aus der Ungleichgewichtssituation resultierenden Veränderungsdruck<br />
entgegenwirken. Das Forschungsprojekt "Arbeit als soziale Beziehung" untersucht<br />
nun, in welcher Weise die angeführten Kräfte zusammenwirken, wie sich bestimmte<br />
Kräftekonstellationen herausbilden und zu Konfigurationen der Personalpolitik gerinnen. Anknüpfend<br />
hieran wird unter anderem auch untersucht, wie unterschiedliche Formen der Beschäftigung<br />
in diesem Kräftefeld zu verorten sind. Das theoretische Fundament zur Beantwortung<br />
dieser Fragen liefern verschiedene sozialtheoretische Ansätze. Letztlich geht es diesen<br />
Ansätzen immer um die Identifikation von Regeln der "Sozialgrammatik" (um Institutionen,<br />
Rollen, Normen, Sinnorientierungen usw.), die dafür sorgen, dass die im Fluss der Ereignisse<br />
zumindest latent ständig gefährdete soziale Ordnung immer wieder neu entstehen<br />
kann. Neben der theoretischen Grundlagenarbeit wurden und werden empirische Studien<br />
durchgeführt, die die Qualität von Arbeitsbeziehungen beleuchten.<br />
ART: keine Angabe AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Universität Lüneburg, FB 02 Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Institut für<br />
BWL Abt. Personal und Führung (Scharnhorststr. 1, 21332 Lüneburg)<br />
[25-F] Verwiebe, Roland, Dr. (Bearbeitung):<br />
Die Flexibilisierung von Zeitstrukturen in der Arbeits- und Lebenswelt<br />
INHALT: keine Angaben<br />
ART: keine Angabe AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Universität Duisburg-Essen Campus Duisburg, FB Gesellschaftswissenschaften,<br />
Institut für Soziologie Professur Empirische Sozialstrukturanalyse (Lotharstr. 65, 47048<br />
Duisburg)<br />
KONTAKT: Bearbeiter (Tel. 0203-379-2451, e-mail: roland.verwiebe@uni-due.de)<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik,<br />
Mitbestimmung<br />
[26-L] Abel, Jörg; Pries, Ludger:<br />
Von der Stellvertretung zur Selbstvertretung?: Interessenvertretung bei hochqualifizierter<br />
Wissensarbeit in Neue-Medien-Unternehmen, in: Nicole Mayer-Ahuja, Harald Wolf (Hrsg.):<br />
Entfesselte Arbeit - neue Bindungen : Grenzen der Entgrenzung in der Medien- und Kulturindustrie,<br />
Berlin: Ed. Sigma, 2005, S. 109-152, ISBN: 3-89404-535-3<br />
INHALT: In dem Industrial-Relations-Teilprojekt wird untersucht, welche Formen betrieblicher<br />
Interessenvertretung sich im Feld der Neuen Medien herausbilden. Es wird eine qualitative<br />
Untersuchung auf der Basis von Fallstudien und Experteninterviews durchgeführt. Die Antwort<br />
auf die Frage, welche Entwicklungsrichtung die Formen und Mechanismen der Erwerbsregulierung<br />
in den Neuen Medien-Unternehmen zukünftig einschlagen werden, muss differenziert<br />
ausfallen. Einerseits ist eine Zunahme kollektiver Interessenvertretungen zu erken-
58 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung<br />
nen, es existieren sowohl Formen traditioneller betriebsrätlicher Strukturen als auch neue<br />
Formen alternativer kollektiver Interessenregulierungsgremien. Andererseits ist trotz dieser<br />
Formen der Interessenvertretung von einer Dominanz des Anspruchs auf Selbstvertretung der<br />
hochqualifizierten Beschäftigten auszugehen. Sogar in Betrieben mit betrieblicher Interessenvertretung<br />
wenden sich die Beschäftigten nur in Einzelfällen an ihre Vertreter. Die Gründe<br />
für diese Dominanz der Selbstvertretung liegen in der Arbeitsidentität und Beitragsorientierung<br />
der Beschäftigten, den Besonderheiten von Wissensarbeit sowie der spezifischen Organisationskultur<br />
in den Neue-Medien-Unternehmen, die sich in vielen Fällen als eine Vertrauenskultur<br />
charakterisieren lässt. (ICF)<br />
[27-F] Bancila, Ramona, M.A. (Bearbeitung):<br />
Arbeitsbeziehungen und Rolle der Gewerkschaften in Ungarn und Rumänien<br />
INHALT: Am Beispiel eines neuen mittelosteuropäischen EU-Mitgliedslandes (Ungarn) und<br />
eines Beitrittslandes (Rumänien) wird eine vergleichende Analyse der Arbeitsbeziehungen<br />
beider Länder durchgeführt. Ziel des Forschungsvorhabens ist es, in historisch-genetischer<br />
und systematisch vergleichender Perspektive die Strukturentscheidungen und die Institutionensysteme<br />
beider Länder zu analysieren. Auf Grundlage einer umfassenden Dokumentenanalyse<br />
und der Ergebnisse der qualitativ-empirischen Untersuchung sollen die folgenden<br />
Leitfragen beantwortet werden: 1. Sind die zentralen Strukturentscheidungen Resultat einer<br />
für die Entwicklung der Arbeitsbeziehungen spezifischen innerpolitischen und gesellschaftlichen<br />
Kräftekonstellation? 2. Werden die betrieblichen und sozialen Schutzfunktionen der<br />
Gewerkschaften durch ihre tripartistische Einbindung geschwächt? 3. Spiel(t)en die spezifischen<br />
EU-Heranführungsstrategien und die Übernahme des EU-Besitzstandes eine erkennbare<br />
Rolle in der Entwicklung der grundlegenden Strukturen? Der schwerpunktmäßige Zuschnitt<br />
der empirisch-qualitativen bzw. explorativen Gewinnung von (Perzeptions-)Daten<br />
liegt im Bereich der national repräsentativen Gewerkschaftsorganisationen. GEOGRAPHI-<br />
SCHER RAUM: Ungarn, Rumänien<br />
ART: Dissertation; gefördert AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER: Volkswagen Stiftung<br />
INSTITUTION: Fachhochschule Fulda, FB Sozial- und Kulturwissenschaften, Jean Monnet<br />
Chair of European Integration (Marquardstr. 35, 36039 Fulda)<br />
KONTAKT: Bearbeiterin (Tel. 0911-5692711, e-mail: ramonabancila@yahoo.com)<br />
[28-L] Bartels, Ralf; Ziegler, Astrid:<br />
Mitbestimmte Unternehmensförderung, in: WSI Mitteilungen : Monatszeitschrift des Wirtschafts-<br />
und Sozialwissenschaftlichen Instituts in der Hans-Böckler-Stiftung, Jg. 59/2006, H. 3, S.<br />
156-161 (Standort: USB Köln(38)-Haa964; Kopie über den Literaturdienst erhältlich; URL:<br />
http://www.econdoc.de/_de/indexwsi.htm)<br />
INHALT: "Der Beitrag befasst sich mit der Beteiligung von Gewerkschaften und Betriebsräten an<br />
den Investitionsförderinstrumenten - Gemeinschaftsaufgabe 'Verbesserung der regionalen<br />
Wirtschaftsstruktur' und Landesbürgschaften - in Nordrhein-Westfalen. Nach einer Bestandsaufnahme,<br />
bei der die beiden Maßnahmen in den Gesamtkanon der einzelbetrieblichen Förderung<br />
eingeordnet und in ihren Grundzügen diskutiert werden, wird das konkrete Beteiligungsverfahren<br />
in NRW skizziert und aufgezeigt, wie Gewerkschaften damit umgehen. Es<br />
folgt eine Bewertung nach betriebs- und beschäftigungspolitischen sowie gewerkschaftlichen
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 59<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung<br />
Gesichtspunkten. Abschließend werden aus den bisherigen Erfahrungen verallgemeinernde<br />
Empfehlungen abgeleitet: Das gewerkschaftliche Beteiligungsverfahren an staatlicher Unternehmensförderung<br />
sollte auf ganz Deutschland ausgedehnt werden und darüber hinaus in der<br />
EU gelten. Dabei sollten Innvoationsvereinbarungen abgeschlossen werden. Gefordert wird<br />
eine proaktive Wirtschaftsförderung. Erfolgsvoraussetzung für unternehmensbezogene Wirtschaftsförderung<br />
ist die Mitbestimmung von Gewerkschaften und Betriebsräten in diesem<br />
Prozess." (Autorenreferat)<br />
[29-L] Beerhorst, Joachim:<br />
Objekt und Subjekt - von den Möglichkeiten und Schwierigkeiten gewerkschaftlicher Arbeitspolitik,<br />
in: Ingrid Kurz-Scherf, Lena Correll, Stefanie Janczyk (Hrsg.): In Arbeit: Zukunft :<br />
die Zukunft der Arbeit und der Arbeitsforschung liegt in ihrem Wandel, Münster: Verl. Westfäl.<br />
Dampfboot, 2005, S. 156-171, ISBN: 3-89691-625-4<br />
INHALT: Der Autor untersucht vor dem Hintergrund der Diskussionen um die Subjektivierung<br />
von Arbeit die Frage, inwiefern sich die Transformationen von Arbeit auf das Verhältnis von<br />
Subjekt und Objekt auswirken. Er reflektiert zu Beginn die Bedeutung von Arbeit als unerledigte<br />
Vermittlungskategorie von Subjekt und Objekt nach der Philosophie Hegels und Hannah<br />
Arendts dreigeteiltem Konzept des "tätigen Lebens". Seine anschließenden theoretischen<br />
Überlegungen beziehen sich auf die Zurichtung und den Widerspruch des Subjekts, auf die<br />
Desiderate einer emanzipatorischen Arbeitspolitik sowie auf die Subjektivierung von Arbeit<br />
als Deutungsperspektive. Auf dieser Grundlage diskutiert er Konsequenzen und Herausforderungen<br />
für die gewerkschaftliche und betriebsrätliche Interessenvertretung und beschreibt<br />
die gegenwärtige Situation und die Ansätze einer gewerkschaftlichen Arbeitspolitik. Einige<br />
Überlegungen zu einem neuen Verhältnis von Subjekt und Objekt beschließen seinen Beitrag.<br />
(ICI)<br />
[30-F] Bister, Jacques (Bearbeitung):<br />
Europäische Betriebsräte und Arbeitsbeziehungen in Mittelosteuropa - Auswirkungen von<br />
EBR-Erweiterungen auf die Entwicklung betrieblicher Interessenvertretung am Beispiel<br />
Polens, Tschechiens und Ungarns<br />
INHALT: Gegenstand der Untersuchung ist die Analyse der Auswirkungen von EBR-Erweiterungen<br />
auf die "Arbeitnehmer - Arbeitgeber - Beziehungen" in den noch jungen Marktwirtschaften<br />
Mittelosteuropas. Erleichtern diese die Ausgestaltung nationaler Arbeitsbeziehungen<br />
und unterstützen sie eine Ausweitung betrieblicher Interessenvertretung? Neben dieser Fragestellung<br />
soll auch die konkrete Umsetzung der EBR-Erweiterung, d.h. die Integration der<br />
neuen Mitglieder und deren Einflussnahme auf die interne Organisation und Struktur der jeweiligen<br />
Gremien näher beleuchtet werden. Ziel ist es, einen Beleg dafür zu erbringen, dass<br />
transnationale Gremien der Interessenvertretung durchaus Einfluss auf die Ausgestaltung nationaler<br />
Arbeitsbeziehungen und betrieblicher Interessenvertretung haben können. Die Untersuchung<br />
der Auswirkungen von EBR-Erweiterungen auf nationale Arbeitsbeziehungen wird<br />
in Ländern erfolgen, die bereits heute mit einer ausreichend hohen Anzahl an Mitgliedern in<br />
EBR vertreten sind. Zu diesen zählen vor allem Polen, Tschechien und Ungarn. GEOGRA-<br />
PHISCHER RAUM: Polen, Tschechien, Ungarn<br />
ART: Dissertation; gefördert AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER: Volkswagen Stiftung
60 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung<br />
INSTITUTION: Fachhochschule Fulda, FB Sozial- und Kulturwissenschaften, Jean Monnet<br />
Chair of European Integration (Marquardstr. 35, 36039 Fulda)<br />
KONTAKT: Bearbeiter (Tel. 06130-949238, e-mail: Jacques.Bister@gmx.de)<br />
[31-F] Bitzan, Renate, Dr. (Bearbeitung):<br />
Gewerkschaftliche Interessenvertretung von Migrantinnen unter den Bedingungen verschiedener<br />
Arbeitsverhältnisse<br />
INHALT: Trotz gewachsener Aufmerksamkeit sowohl in der gewerkschaftlichen Politik als auch<br />
in der sozialwissenschaftlichen Forschung gegenüber den Belangen von (männlichen)<br />
Migranten einerseits und (deutschen) Frauen andererseits werden weibliche Migrantinnen bis<br />
auf wenige Ansätze bislang kaum als aktive Subjekte in der Arbeitswelt wahrgenommen. Ihre<br />
spezifischen Interessen und Situationen finden nur mühsam Eingang. Je nach Zeitpunkt und<br />
Modus der Einwanderung stellen diese sich zudem keineswegs homogen dar: Fanden Pionierinnen<br />
der Arbeitsmigration in der Anwerbephase häufig noch Arbeit in industriellen Großbetrieben,<br />
werden "nachgezogene" Ehefrauen und "neue" Zuwanderinnen zunehmend auf prekarisierte<br />
Jobs im unteren Segment des tertiären Arbeitsmarktsektors verwiesen, wenn sie<br />
nicht gerade als hoch qualifizierte IT-Spezialistinnen umworben werden. Die Bedingungen<br />
kollektiver Interessenvertretung lassen sich somit als extrem unterschiedlich bezeichnen, da<br />
die allgemeinen "Branchen-Traditionen" von sehr hohem bis sehr niedrigem gewerkschaftlichen<br />
Organisierungsgrad reichen. In dem Forschungsprojekt soll sowohl nach der Motiviertheit<br />
und den Strategien von Gewerkschaften gefragt werden, Migrantinnen in ihren jeweiligen<br />
Zuständigkeitsbereichen als Mitglieder zu rekrutieren und sich aktiv für ihre Interessen<br />
einzusetzen, als auch nach der Motiviertheit von Migrantinnen, sich in gewerkschaftlichem<br />
Rahmen organisieren zu wollen oder andere Strategien der Interessendurchsetzung zu wählen.<br />
Methodisch sind themenzentriert-narrative Interviews mit Migrantinnen in unterschiedlichen<br />
Arbeitsverhältnissen und Leitfaden-Interviews mit FunktionärInnen von Gewerkschaften vorgesehen.<br />
ART: Habilitation; gefördert BEGINN: 2001-06 ENDE: 2006-06 AUFTRAGGEBER: keine Angabe<br />
FINANZIERER: Land Niedersachsen<br />
INSTITUTION: Universität Göttingen, Sozialwissenschaftliche Fakultät, Seminar für Politikwissenschaft<br />
(Platz der Göttinger Sieben 3, 37073 Göttingen)<br />
KONTAKT: Bearbeiterin (Tel. 0551-393336, Fax: 0551-399788,<br />
e-mail: rbitzan@uni-goettingen.de)<br />
[32-L] Bödeker, Wolfgang; Dragano, Nico:<br />
Das IGA-Barometer 2005: Einschätzungen der Erwerbsbevölkerung zum Stellenwert der<br />
Arbeit, zu beruflichen Handlungsspielräumen und zu Gratifikationskrisen, (IGA-Report, 7),<br />
Essen 2005, 101 S. (Graue Literatur; URL: http://www.iga-info.de/pdf/reporte/iga_report_7.pdf)<br />
INHALT: "In einer Telefonaktion befragte die Initiative Gesundheit und Arbeit -IGA- ca. 2000<br />
repräsentativ ausgewählte Erwerbstätige zu allgemeinen Einschätzungen ihrer Arbeitssituation.<br />
Die Befragung diente der Beleuchtung von zwei besonders bedeutenden Belastungskonstellationen<br />
bei der Arbeit: den Handlungsspielräumen und den beruflichen Gratifikationskrisen.<br />
Das IGA-Barometer zeigt in seinen Ergebnissen, dass die Erwerbstätigen ihre Arbeitssituation<br />
überwiegend positiv sehen. Es zeigt sich aber auch, dass die Zufriedenheit nicht in al-
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 61<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung<br />
len Berufen gleich hoch ausgeprägt sind. Ca. ein Drittel der Befragten sind der Meinung, dass<br />
der Arbeit in ihrer Lebenssituation ein zu hoher Stellenwert zukommt. Insbesondere betrachten<br />
40 Prozent der Männer es als unbefriedigend, dass ihr Schwerpunkt auf der Arbeit liegt.<br />
Als besonders beachtenswert muss das Ergebnis gelten, dass annähernd die Hälfte der Befragten<br />
sich nicht oder nur eingeschränkt vorstellen kann, ihre Tätigkeit bis zur Altersrente auszuüben."<br />
(Autorenreferat)<br />
[33-F] Brinkmann, Ulrich, Dr. (Leitung):<br />
Umbruch von unten? Betriebliche Akteure in der ostdeutschen Transformation<br />
INHALT: Der vorliegende Band richtet den Blick auf das Innenleben der Betriebe im ostdeutschen<br />
Transformationsprozess. Er stellt die Prozesse der Konstituierung von betrieblichen<br />
Akteuren (Betriebsrat, Management) unter dem Einfluss von Rollen, Konflikten und Macht in<br />
das Zentrum der Analyse. Die Untersuchung stützt sich dabei auf Daten aus einem umfangreichen<br />
Forschungsprojekt, an dem der Verfasser mitgewirkt hat. Dabei wurden teilstrukturierte,<br />
themenzentrierte Leitfadeninterviews mit Geschäftsleitern, Betriebsräten und Personalleitern<br />
in 137 ostdeutschen Unternehmen geführt und zusätzlich Daten von 429 Führungskräften<br />
aus diesen Betrieben mit Hilfe von standardisierten Fragebögen erhoben. Auf dieser<br />
Grundlage zeichnet der Text die Entwicklung der innerbetrieblichen Machtverhältnisse von<br />
1989 bis über die Privatisierung hinaus nach. Die Konstituierung betrieblicher Akteure stellt<br />
er als einen Prozess dar, der vom mikropolitischen Handeln der Akteursgruppen geprägt und<br />
von Rollenkonflikten durchzogen ist. Am Beispiel der Betriebsräte verdeutlicht die vorliegende<br />
Studie, wie es betrieblichen Akteuren in einer Reihe von Fällen trotz ungünstiger Voraussetzungen<br />
gelang, für sich ein Mindestmaß an Handlungsfähigkeit zu gewährleisten.<br />
ZEITRAUM: 1989-1995 GEOGRAPHISCHER RAUM: Ostdeutschland<br />
METHODE: Mikropolitik; Transformation; Experteninterviews DATENGEWINNUNG: Qualitatives<br />
Interview (Stichprobe: 280; ostdeutsche Manager und Betriebsräte; Auswahlverfahren:<br />
Zufall).<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: Brinkmann, Ulrich: Von der Kaderabteilung zum Human Resource<br />
Management? (Irr-)Wege ostdeutscher Personalpolitik. in: Pawlowsky, Peter; Willkens,<br />
Uta (Hrsg.): Zehn Jahre Personalarbeit in den neuen Bundesländern. Transformation und<br />
Demographie. München, Mering: Hampp 2001, S. 73-106.+++Brinkmann, Ulrich: 'Zwischen<br />
Baum und Borke' - Rollenkonflikte betrieblicher Akteure in der ostdeutschen Transformation.<br />
in: Dawson, Stephen; Mistry, Jyoti; Schramme Thomas; Thurman, Michael D. (Hrsg.):<br />
Extraordinary times. Vol. 11. Wien: Institute for the Human Sciences 2001, S. 1-35.<br />
+++Brinkmann, Ulrich: Die Labormaus des Westens: Ostdeutschland als Vorwegnahme des<br />
Neuen Produktionsmodells? in: Dörre, Klaus; Röttger, Bernd (Hrsg.): Das neue Marktregime.<br />
Konturen eines nachfordistischen Produktionsmodells. Hamburg: VSA 2003, S. 250-269.<br />
ART: Dissertation; gefördert AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER: Forschungsinstitut für<br />
Arbeit, Bildung und Partizipation e.V. an der Universität Bochum; Hans-Böckler-Stiftung<br />
INSTITUTION: Universität Trier, FB 04, Fach Soziologie (Universitätsring 15, 54286 Trier)<br />
KONTAKT: Leiter (e-mail: ulrich.brinkmann@uni-jena.de)
62 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung<br />
[34-F] Brinkmann, Ulrich, Dr. (Leitung):<br />
Der neue Paragraph 80, Absatz 2, Satz 3 des BetrVG. Evaluation und wissenschaftliche Begleitung<br />
in sechs Fallbetrieben<br />
INHALT: keine Angaben<br />
METHODE: keine Angaben DATENGEWINNUNG: Qualitatives Interview (Stichprobe: 20;<br />
Betriebsräte; Auswahlverfahren: total).<br />
ART: Auftragsforschung; Gutachten BEGINN: 2003-07 ENDE: 2004-06 AUFTRAGGEBER:<br />
Industriegewerkschaft Metall FINANZIERER: Auftraggeber<br />
INSTITUTION: Forschungsinstitut für Arbeit, Bildung und Partizipation e.V. an der Universität<br />
Bochum (Münsterstr. 13-15, 45657 Recklinghausen)<br />
KONTAKT: Leiter (e-mail: ulrich.brinkmann@uni-jena.de)<br />
[35-L] Brinkmann, Ulrich; Speidel, Frederic:<br />
Hybride Beteiligungsformen am Beispiel sachkundiger Arbeitnehmer, in: WSI Mitteilungen :<br />
Monatszeitschrift des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in der Hans-Böckler-<br />
Stiftung, Jg. 59/2006, H. 2, S. 86-91 (Standort: USB Köln(38)-Haa964; Kopie über den Literaturdienst<br />
erhältlich; URL: http://www.econdoc.de/_de/indexwsi.htm)<br />
INHALT: "Der Beitrag behandelt zwischen repräsentativer Mitbestimmung und direkter Partizipation<br />
zu verortende Beteiligungsform, die unter Bezugnahme auf den novellierten Paragrafen<br />
80 Abs. 2 Satz 3 BetrVG durchgeführt werden. Neu an diesen Beteiligungsformen ist die<br />
formale Einbeziehung von Beschäftigten in die Arbeit des Betriebsrats, die diesem als betriebliche<br />
Auskunftspersonen zur Seite stehen. Von der rechtlich abgesicherten Kooperation<br />
zwischen Beschäftigten und Betriebsrat, so die bisherige Erfahrung mit dem neuen Paragrafen,<br />
profitieren beide Seiten: Die Beschäftigten vermögen auf diese Weise ihre Interessen<br />
besser durchzusetzen, während der Betriebsrat in seiner Arbeit entscheidend unterstützt wird<br />
und insgesamt an Akzeptanz gewinnt." (Autorenreferat)<br />
[36-L] Diefenbacher, Hans; Teichert, Volker:<br />
Mitbestimmung vor künftigen Herausforderungen in einer globalisierten Welt, in: Thomas<br />
Beschorner, Thomas Eger (Hrsg.): Das Ethische in der Ökonomie : Festschrift für Hans G. Nutzinger,<br />
Marburg: Metropolis-Verl., 2005, S. 359-372, ISBN: 3-89518-504-3 (Standort: USB<br />
Köln(38)-32A2853)<br />
INHALT: "Die Verfasser nehmen in ihrem Beitrag jüngste Forderungen von Industrie und Arbeitgeberverbänden<br />
zu einer Reform der Mitbestimmung zum Anlass, die von Hans G. Nutzinger<br />
zwischen Ende der siebziger und Anfang der neunziger Jahre initiierten Projekte zu<br />
Theorie und Praxis der Mitbestimmung auf ihre Implikationen für die gegenwärtige Diskussion<br />
zu überprüfen. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass die aktuellen Herausforderungen keinesfalls<br />
eine Einschränkung oder gar Abschaffung der Mitbestimmung erfordern, sondern<br />
dass die Mitbestimmung vielmehr in ihren Inhalten und Strukturen an die neuen Bedingungen<br />
angepasst werden sollte." (Autorenreferat)
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 63<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung<br />
[37-F] Dörre, Klaus, Prof.Dr. (Bearbeitung):<br />
Kampf um Beteiligung<br />
INHALT: Im Projekt wird die Buchfassung der Habilitationsschrift 'Kampf um Beteiligung' erarbeitet,<br />
die auf dem DFG-Projekt 'Neue Managementkonzepte und industrielle Beziehungen<br />
im Betrieb' fußt. Zusätzlich werden Teilergebnisse zusammengefasst, auf ihre arbeits- und<br />
bildungspolitischen Konsequenzen hin befragt und publiziert.<br />
METHODE: keine Angaben DATENGEWINNUNG: Qualitatives Interview (Stichprobe: 500;<br />
Auswahlverfahren: Zufall, Quota).<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: Röder, J.; Dörre, K. (Hrsg.): Lernchancen und Marktzwänge.<br />
Bildungsarbeit im flexiblen Kapitalismus. Münster: Verl. Westf. Dampfboot 2002.+++Dörre,<br />
K.: Politische Bildung im flexiblen Kapitalismus. Anregungen für die gewerkschaftliche Debatte.<br />
in: Röder; Dörre (Hrsg.): Lernchancen und Marktzwänge, a.a.O. 2002, S. 29-46.+++<br />
Dörre, K.: Entfesselter Markt, zerstörte Gesellschaft? Über die Zukunft politischer Bildung in<br />
den Zeiten intensivierter Globalisierung. in: Mathes, H. (Hrsg.): Priorität Politische Bildung.<br />
Hamburg: VSA 2002, S. 37-57.+++Dörre, K.: Kampf um Beteiligung. Arbeit, partizipatives<br />
Management und die Gewerkschaften. in: Kurswechsel, 2002, H. 1, S. 64-76.+++Dörre, K.:<br />
Partizipation im Arbeitsprozess - Alternative oder Ergänzung zur Mitbestimmung. in: Industriellen<br />
Beziehungen, 2001, H. 4, S. 379-407.+++Dörre, K.: Reaktiver Nationalismus in der<br />
Arbeitswelt. Rechtsextremismus - Ursachen und Thesen. in: Widerspruch, 2001, H. 42, S. 87-<br />
102.+++Dörre, K.: Gibt es ein nachfordistisches Produktionsmodell? Managementprinzipien,<br />
Firmenorganisation und Arbeitsbeziehungen. in: Candeias, M.; Deppe, F. (Hrsg.): Neuer Kapitalismus?<br />
Hamburg 2001, S. 83-107.+++Dörre, K.: Das Pendel schwingt zurück. Arbeit und<br />
Arbeitspolitik im flexiblen Kapitalismus. in: Ehlscheid, Ch.; Mathes, H.; Scherbaum, M.<br />
(Hrsg.): 'Das regelt schon der Markt!'. Marktsteuerung und Alternativkonzepte in der<br />
Leistungs- und Arbeitszeitpolitik. Hamburg: 2001, S. 37-58.<br />
ART: Eigenprojekt; gefördert BEGINN: 2001-01 ENDE: 2003-12 AUFTRAGGEBER: nein FI-<br />
NANZIERER: Deutsche Forschungsgemeinschaft<br />
INSTITUTION: Universität Jena, Fak. für Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Institut für<br />
Soziologie Lehrstuhl für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie (07737 Jena)<br />
KONTAKT: Leiter (Tel. 03641 945521, e-mail: Klaus.Doerre@uni-jena.de)<br />
[38-L] Eichmann, Hubert; Hofbauer, Ines:<br />
Zwischen Ausbalancierung und Asymmetrie: Arbeit und Partizipation in kleine(re)n Softwareunternehmen<br />
ohne Betriebsrat, in: Österreichische Zeitschrift für Soziologie : Vierteljahresschrift<br />
der Österreichischen Gesellschaft für Soziologie, Jg. 31/2006, H. 2, S. 77-90 (Standort:<br />
USB Köln(38)-XH02528; Kopie über den Literaturdienst erhältlich)<br />
INHALT: "In kleine(re)n Unternehmen der Softwarebranche findet sich parallel zur geringen<br />
Bedeutung der repräsentativen Interessenvertretung eine höhere Verbreitung von direkten Beteiligungsformen.<br />
Anhand von qualitativen Interviews bei betriebsratslosen Unternehmen in<br />
der österreichischen Softwarebranche bzw. über einen Fallstudienvergleich wird dargestellt,<br />
dass jedoch Arbeitsbedingungen und Arbeitsqualität deutlich variieren. Jenseits der (oft unproduktiven)<br />
Differenzierung zwischen 'mitbestimmten' und 'mitbestimmungsfreien' Zonen<br />
geht es darum, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Unternehmen einer Branche in<br />
ihrer empirischen Breite herauszuarbeiten." (Autorenreferat)
64 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung<br />
[39-F] Flecker, Jörg, Dr.; Papouschek, Ulrike, Dr.; Krenn, Manfred, Mag. (Bearbeitung):<br />
Entgrenzung von Arbeit und Chancen zur Partizipation (EAP/ NODE)<br />
INHALT: Atypische Beschäftigung, Arbeit in Kooperationsnetzen, flexible Arbeitszeiten und<br />
neue Formen der Arbeitsorganisation im Betrieb haben zu neuen Mustern der Erwerbsarbeit<br />
geführt. Unter den Bedingungen einer solchen "Entgrenzung" stellen sich die alten Fragen<br />
nach Partizipation, nach Interessenvertretung - kurz: nach Demokratie in der Wirtschaft - neu.<br />
Untersucht wird insbesondere, wie sich die Teilhabe- und Partizipationschancen verschiedener<br />
Gruppen von Arbeitskräften in expandierenden Dienstleistungsbranchen mit vielfach<br />
"entgrenzter" Arbeit entwickeln: Software-Entwicklung, Multimedia und andere IT-gestützte<br />
Dienstleistungen sowie soziale Dienste, insbesondere mobile Pflege.<br />
ART: Auftragsforschung BEGINN: 2003-06 ENDE: 2005-06 AUFTRAGGEBER: Bundesministerium<br />
für Bildung, Wissenschaft und Kultur FINANZIERER: Auftraggeber<br />
INSTITUTION: Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt -FORBA- (Aspernbrückengasse 4,<br />
5, 1020 Wien, Österreich); Zentrum für soziale Innovation (Linke Wienzeile 246, 1150 Wien,<br />
Österreich); Universität Bochum (44780 Bochum); Universität Bremen (Postfach 330440,<br />
28334 Bremen); Soziologisches Forschungsinstitut an der Universität Göttingen e.V. -SOFI-<br />
(Friedländer Weg 31, 37085 Göttingen); Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. -<br />
ISF- (Jakob-Klar-Str. 9, 80796 München); University of Manchester, Institute of Science and<br />
Technology -UMIST- (P.O. Box 88, M6O 1QD Manchester, Vereinigtes Königreich); Institut<br />
für interdisziplinäre Nonprofit-Forschung -NPO-Institut- an der Wirtschaftsuniversität Wien<br />
(Reithlegasse 16, 4, 1190 Wien, Österreich)<br />
KONTAKT: FOBRA (e-mail: office@fobra.at); ZSI (e-mail: institut@zsi.at)<br />
[40-F] Flecker, Jörg, Dr.; Vogt, Marion; Atzmüller, Roland (Bearbeitung):<br />
Grundlagen für die Struktur der Kollektivvertragsverhandlungen und die Kollektivvertragspolitik<br />
der Neuen Gewerkschaft<br />
INHALT: Ziel dieses Projektes ist es, in leitfadengestützten, qualitativen Interviews mit haupt-<br />
und ehrenamtlichen GewerkschafterInnen die unterschiedlichen Verhandlungskulturen von<br />
fünf Gewerkschaften zu erfassen. Als wissenschaftliche Grundlage für das Design von Kollektivvertragsverhandlungen<br />
der Gewerkschaft Neu werden dabei insbesondere die gegenwärtige<br />
Vielfalt sowie bewährte Strukturen und Vorgangsweisen beschrieben. Außerdem<br />
werden Bedrohungen, Herausforderungen und zukünftige Aufgaben für die Kollektivvertragsverhandlungen<br />
herausgearbeitet sowie Grundlagen für inhaltliche Schwerpunktsetzungen<br />
im Bereich des Entgelts und des Rahmenrechts sowie für die mögliche Regelung neuer Themen<br />
im Kollektivvertrag diskutiert. Die Ergebnisse sollen den Reflexions- und Entscheidungsprozess<br />
über die Kollektivvertragspolitik im Zusammenhang mit der Gründung der<br />
Gewerkschaft Neu unterstützen.<br />
ART: Auftragsforschung BEGINN: 2002-07 ENDE: 2002-11 AUFTRAGGEBER: Gewerkschaft<br />
der Privatangestellten; Gewerkschaft Metall - Textil; Gewerkschaft Druck, Journalismus, Papier;<br />
Gewerkschaft der Chemiearbeiter; Gewerkschaft Agrar-Nahrung-Genuss FINANZIE-<br />
RER: Auftraggeber<br />
INSTITUTION: Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt -FORBA- (Aspernbrückengasse 4,<br />
5, 1020 Wien, Österreich)<br />
KONTAKT: Institution (Tel. +43-1-2124700; Fax: +043-1-212470077, e-mail: office@fobra.at)
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 65<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung<br />
[41-L] Franzen, Martin:<br />
Standortverlagerung und Arbeitskampf, in: Zeitschrift für Arbeitsrecht, Jg. 36/2005, Nr. 3, S.<br />
315-352 (Standort: USB Köln(38)-XF175; Kopie über den Literaturdienst erhältlich)<br />
INHALT: "In den zurückliegenden Jahren spielte sich in deutschen Unternehmen vielfach folgendes<br />
Grundmuster eines Szenario ab, welches in den Details erhebliche Variationsbreite aufweist:<br />
Der Arbeitgeber tritt an die Arbeitnehmerseite, zumeist den Betriebsrat, unter Umständen<br />
aber auch die zuständige Gewerkschaft, heran mit der Bitte, die Arbeitskosten zu senken.<br />
Dabei lässt das Unternehmen mehr oder weniger deutlich durchblicken, dass ohne Entgegenkommen<br />
der Arbeitnehmerseite geprüft werden müsse, ob der Standort noch aufrechterhalten<br />
werden könnet. Die möglichen Reaktionen der Arbeitnehmerseite weisen ebenfalls eine erhebliche<br />
Bandbreite auf: Sofern Gewerkschaften in diesen Prozess einbezogen werden, verlangen<br />
diese häufig den Abschluss so genannter Standortsicherungstarifverträge, zum Teil unter<br />
Androhung und Durchführung entsprechender Streiks. Weiter kommen Maßnahmen des<br />
Betriebsrats sowie - wie etwa im Oktober 2004 bei Opel im Werk Bochum - Arbeitsniederlegungen<br />
der Arbeitnehmer ohne erkennbare Leitung durch eine Gewerkschaft oder den Betriebsrat<br />
in Betracht. Die arbeitskampfrechtliche Bewältigung dieses Szenarios steht noch<br />
weitgehend aus. Die Überlegungen sollen hierzu einen Beitrag leisten. Zunächst werden die<br />
Maßnahmen der Arbeitgeberseite untersucht. Dabei ist in erster Linie von Interesse, ob das<br />
Inaussichtstellen einer Standortverlagerung zum Zweck der Senkung von Arbeitskosten als<br />
Arbeitskampfmittel eingeordnet werden kann oder ob auf diese Maßnahme des Arbeitgebers<br />
die allgemeinen zivil- und strafrechtlichen Regeln Anwendung finden. Im Anschluss daran<br />
werden denkbare Reaktionen der Arbeitnehmerseite erörtert. Dabei geht es zunächst um die<br />
Arbeitsniederlegung unter gewerkschaftlicher Führung, um einen Tarifvertrag zur Standortsicherung<br />
abzuschließen. Daran schließen sich Überlegungen zu denkbaren Maßnahmen des<br />
Betriebsrats sowie Arbeitsniederlegungen der Arbeitnehmer an." (Autorenreferat)<br />
[42-F] Freye, Saskia (Bearbeitung):<br />
Wirtschaftsführer im organisierten Kapitalismus: unternehmerische Solidarität im Wandel<br />
INHALT: Die Auflösung der Deutschland AG beschreibt eine Reihe von Ereignissen und Tendenzen,<br />
welche seit Mitte der neunziger Jahre die Spielregeln der deutschen Wirtschaft in<br />
Kernbereichen verändert haben. Dies betrifft nicht zuletzt Veränderungen im Umgang der<br />
Wirtschaftsführer mit- und untereinander. Das Dissertationsprojekt untersucht die Entwicklung<br />
der unternehmerischen Solidarität seit Beginn der Bundesrepublik. Lässt sich ein Rückgang<br />
solidarischen Verhaltens zwischen Wirtschaftsführern dokumentieren? Wie war eine<br />
solche Solidarität zwischen Wettbewerbern möglich? Worauf beruht sie? Was hat zu ihrem<br />
Verlust beigetragen? Dabei sollen besonders soziokulturelle Phänomene hervorgehoben werden,<br />
die den Wandel begleiten. Als Grundlage dienen Auswertungen von Verbands- und Parteipublikationen,<br />
Presseberichten und Wirtschaftsjournalen sowie Gespräche mit verschiedenen<br />
Zeitzeugen aus fünf Jahrzehnten bundesdeutscher Wirtschaftsgeschichte. GEOGRAPHI-<br />
SCHER RAUM: Bundesrepublik Deutschland<br />
ART: Dissertation BEGINN: 2004-05 ENDE: 2007-06 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FI-<br />
NANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung (Paulstr. 3, 50676 Köln)<br />
KONTAKT: Institution (Tel. 0221-2767-0, Fax: 0221-2767-430, e-mail: info@mpifg.de)
66 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung<br />
[43-L] Göritz, Berthold; Hase, Detlef; Krehnke, Anna; Rupp, Rudi:<br />
Interessenausgleich und Sozialplan: Analyse und Handlungsempfehlungen, (Schriftenreihe<br />
der Hans-Böckler-Stiftung : Betriebs- und Dienstvereinbarungen), Frankfurt am Main: Bund-Verl.<br />
2005, 256 S., ISBN: 3-7663-3686-X<br />
INHALT: "Das Regulieren von Betriebsänderungen durch Interessenausgleiche und Sozialpläne<br />
ist seit vielen Jahren eine wichtige Aufgabe der Betriebsräte. Jedoch wandeln und verschärfen<br />
sich die Rahmenbedingungen, unter denen die Interessenvertretungen Nachteile ausgleichen<br />
oder mildern sollen. Diese Veränderungen schlagen sich in den Regelungsinhalten nieder:<br />
Beschäftigungsorientierte Lösungen gewinnen dabei an Bedeutung. Hierzu zählen die Vereinbarung<br />
von Transfermaßnahmen oder Möglichkeiten, Abfindungen in Beschäftigungszeit<br />
umzuwandeln. Die vorliegende Auswertung analysiert 472 Interessenausgleiche und Sozialpläne.<br />
Sie stellt die wesentlichen Inhalte beider Vereinbarungsarten vor und zeigt anhand<br />
zahlreicher Beispiele die Bandbreite der Regelungspraxis. Betriebsräte erkennen neue Trends<br />
im Handlungsfeld 'Betriebsänderung' und erhalten konkrete Hinweise und Empfehlungen."<br />
(Autorenreferat)<br />
[44-L] Haipeter, Thomas; Schilling, Gabi:<br />
Von der Einfluss- zur Mitgliedschaftslogik: die Arbeitgeberverbände und das System der industriellen<br />
Beziehungen in der Metallindustrie, in: Industrielle Beziehungen : Zeitschrift für<br />
Arbeit, Organisation und Management, Jg. 13/2006, H. 1, S. 21-42<br />
INHALT: "Unter dem Eindruck wachsender Mitgliederverluste und einer zunehmend kritischen<br />
Haltung kleiner und mittelgroßer Unternehmen haben die Arbeitgeberverbände der Metallindustrie<br />
seit einigen Jahren neue organisations- und tarifpolitische Strategien entwickelt. Organisationspolitisch<br />
setzen sie auf die Gründung von Arbeitgeberverbänden ohne Tarifbindung,<br />
tarifpolitisch steht die Dezentralisierung der Flächentarifverträge im Vordergrund. Die<br />
Autoren zeichnen diese Entwicklung empirisch nach und interpretieren sie als Übergang von<br />
einer Politik der Einflusslogik zu einer Politik der Mitgliedschaftslogik. Zwar ist diese Politik<br />
mit Blick auf die Mitgliederrekrutierung der Verbände bislang durchaus erfolgreich. Doch<br />
birgt sie zugleich ein erhebliches Erosionspotenzial für das System der industriellen Beziehungen.<br />
In der Konsequenz führt die Orientierung an der Mitgliedschaftslogik nämlich zu einer<br />
Infragestellung der traditionellen Konfliktpartnerschaft, die als tragende Säule des deutschen<br />
Systems der industriellen Beziehungen betrachtet werden kann." (Autorenreferat)<br />
[45-L] Haipeter, Thomas:<br />
Betriebsräte unter Handlungsdruck: Interessenvertretungspolitik im Zeichen der flexiblen<br />
Arbeitszeitregulierung, in: Steffen Lehndorff (Hrsg.): Das Politische in der Arbeitspolitik : Ansatzpunkte<br />
für eine nachhaltige Arbeits- und Arbeitszeitgestaltung, Berlin: Ed. Sigma, 2006, S.<br />
195-225, ISBN: 3-89404-534-5<br />
INHALT: Der Autor nimmt das Spannungsverhältnis von individuellen Interessen und arbeitspolitischen<br />
Institutionen und Akteuren zum Ausgangspunkt seines Beitrags. Er befasst sich weniger<br />
mit der Perspektive überbetrieblicher Regulierungen als mit den innerbetrieblichen Akteuren<br />
und Institutionen des Betriebsrats und der Mitbestimmung. Er bündelt die Ergebnisse<br />
seiner verschiedenen empirischen Studien zu einer Typologie der Interessenvertretungspolitik
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 67<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung<br />
unter den Bedingungen flexibler Arbeitszeitregulierung: Betriebsräte können als "ohnmächtige<br />
Kritiker" im Betrieb weitgehend wirkungslos bleiben, sie können als "stellvertretende Modernisierer"<br />
ein starkes "Co-Management" auf der Grundlage traditioneller Legitimationsmuster<br />
betreiben, oder sie können als "partizipationsorientierte Interessenmanager" einem -<br />
ebenfalls - Co-Management gegenüber dem Management dadurch neues Gewicht geben, dass<br />
sie als Verteidiger und Förderer der individuellen Beteiligungsrechte der Beschäftigten im<br />
Betrieb agieren. Dieser letzte Interessenvertretungstypus erscheint dem Autor als besonders<br />
Erfolg versprechend, weil er dem Betriebsrat neue Legitimationsgrundlagen jenseits seiner<br />
Beiträge zur einzelwirtschaftlichen Rentabilität des Betriebes verschafft. (ICA2)<br />
[46-F] Hauptmeier, Marco (Bearbeitung):<br />
Betriebs- und Unternehmensverhandlungen in der deutschen, spanischen und amerikanischen<br />
Automobilindustrie<br />
INHALT: Das Projekt untersucht kollektive Verhandlungen in multinationalen Unternehmen. In<br />
diesen verhandeln Arbeitnehmervertreter und Management über Entgelte, Arbeitszeiten, Beschäftigungssicherung<br />
und die Vergabe von Produktionskapazitäten. Die Untersuchung konzentriert<br />
sich auf vier multinationale Unternehmen (VW, DaimlerChrysler, General Motors,<br />
Ford) in drei Ländern (Deutschland, Spanien, USA). Kontext/ Problemlage: In den letzten<br />
drei Jahrzehnten hat die Bedeutung multinationaler Unternehmen enorm zugenommen. Sie<br />
werden häufig als wichtigste Triebfeder einer fortschreitenden wirtschaftlichen Globalisierung<br />
betrachtet. Eine häufige These ist, dass multinationale Unternehmen in der Lage sind,<br />
ihre Produktionsstätten in Billiglohnländer zu verlagern. Diese Ausstiegsoption erlaube es ihnen,<br />
die Arbeitsstandards immer weiter zu ungunsten von Arbeitnehmern zu verschlechtern.<br />
Solche eine Betrachtungsweise sieht Arbeitnehmer als Opfer der Globalisierung getrieben<br />
von Kräften jenseits der eigenen Kontrolle. Im Gegensatz dazu, untersucht dieses Projekt die<br />
Handlungsmöglichkeiten von Arbeitnehmervertretern und analysiert mit welchen Ressourcen<br />
und Strategien sie Beschäftigungsstandards in Verhandlungen mit dem Management multinationaler<br />
Unternehmen beeinflussen. Die Hauptfrage des Projektes ist folgende: Wie beeinflussen<br />
Arbeitnehmervertreter multinationaler Unternehmen die Beschäftigungsstandards in Verhandlungen<br />
mit dem Management? Diese Frage kann in verschiedene Unterfragen aufgeschlüsselt<br />
werden: Welche Ressourcen und Strategien haben Arbeitnehmervertreter, um Verhandlungen<br />
zu beeinflussen? Bei der Beantwortung dieser Frage, wird es zunächst darum gehen,<br />
alle Ressourcen von Arbeitnehmervertretern herauszuarbeiten. Hierzu gehören zum Beispiel:<br />
der Entzug der Kooperation (z.B. Verweigerung von Überstunden oder Zusatzschichten<br />
durch den Betriebsrat), Arbeitsniederlegungen, die Koordination und transnationale Zusammenarbeit<br />
im Europäischen Betriebsrat. Zudem ist eine wesentliche Frage, wie sich diese<br />
Ressourcen und Strategien im Kontext einer fortschreitenden Internationalisierung von Unternehmen<br />
verändern. GEOGRAPHISCHER RAUM: Bundesrepublik Deutschland, Spanien,<br />
USA<br />
METHODE: Das Projekt ist eine vergleichende Länderstudie, die auf einem gemischten Methodenansatz<br />
basiert und sowohl qualitative als auch quantitative Instrumente einbezieht. Im Bereich<br />
der quantitativen Methode werden deskriptive Statistiken verwendet, um zentrale Ergebnisse<br />
von kollektiven Verhandlungen wie Lohnhöhe, Arbeitszeit und Beschäftigtenzahlen<br />
darzustellen. Im Bereich der qualitativen Methode liegt ein Schwerpunkt auf Interviews mit<br />
Arbeitnehmervertretern, Managern und Oppositionsgruppen in den verschiedenen Unterneh-
68 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung<br />
men. Zudem werden mit Hilfe von Zeitungsrecherche und Archivarbeit die einzelnen Fallstudien<br />
rekonstruiert.<br />
ART: Dissertation; gefördert AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: Hans-Böckler-<br />
Stiftung<br />
INSTITUTION: Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung (Paulstr. 3, 50676 Köln)<br />
KONTAKT: Bearbeiter (e-mail: hauptmeier@mpifg.de)<br />
[47-F] Hermann, Christoph; Atzmüller, Roland (Bearbeitung):<br />
Auswirkungen der GATS-Liberalisierung öffentlicher Dienstleistungen aus ArbeitnehmerInnen-Sicht<br />
INHALT: Mit dem General Agreement on Trade and Services (GATS) wurde in den letzten Jahren<br />
die Liberalisierung des Handels mit Gütern durch den weltweiten Handel von Dienstleistungen<br />
erweitert. In einem nächsten Schritt sollen jetzt auch die öffentlichen Dienstleistungen<br />
für in- und ausländische AnbieterInnen geöffnet werden. Die Diskussion um die Pros und<br />
Kontras der Liberalisierung beschränken sich in der Regel auf die Qualität und Kosten öffentlicher<br />
Dienstleistungen, während die Situation der Beschäftigten in der Regel keine Rolle<br />
spielt. In dieser Studie geht es deshalb ausdrücklich um die Auswirkungen der Liberalisierung<br />
auf die Beschäftigten und hier insbesondere um die Themen Beschäftigungsvolumen, Einkommen,<br />
Arbeitsbedingungen und industrielle Beziehungen. Die ausgewählten Sektoren sind<br />
Post, Eisenbahnen, der öffentliche Personennahverkehr sowie die Elektrizitäts-, Gas- und<br />
Wasserversorgung. Neben Primärerhebungen in Österreich (Datenrecherche und Interviews)<br />
umfasst die Studie auch eine Zusammenfassung bestehender Studien und Literatur zu ausgewählten<br />
Sektoren in Deutschland, Großbritannien und Schweden.<br />
ART: Auftragsforschung BEGINN: 2003-01 ENDE: 2003-10 AUFTRAGGEBER: Kammer für<br />
Arbeiter und Angestellte für Wien FINANZIERER: Auftraggeber<br />
INSTITUTION: Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt -FORBA- (Aspernbrückengasse 4,<br />
5, 1020 Wien, Österreich)<br />
KONTAKT: Institution (Tel. +43-1-2124700; Fax: +043-1-212470077, e-mail: office@fobra.at)<br />
[48-F] Hinke, Robert, M.A. (Bearbeitung); Schmidt, Rudi, Prof.Dr.; Köhler, Christoph, Prof.Dr.;<br />
Dörre, Klaus, Prof.Dr. (Betreuung):<br />
Tarif-, Lohn- und Leistungspolitik in Ostdeutschland<br />
INHALT: Soziologisch-historische Rekonstruktion der Tarif-, Lohn- und Leistungspolitik im<br />
Systemvergleich. Aufarbeitung der Forschungslücke staatssozialistischer Tarif-, Lohn- und<br />
Leistungspolitik und Suche nach deren Bedeutung für das mikropolitische Unterleben transferierter<br />
Institutionen. ZEITRAUM: 1945-2004 GEOGRAPHISCHER RAUM: Ostdeutschland<br />
METHODE: Industriesoziologischer Forschungsansatz: Tarif-, Lohn- und Leistungspolitik im<br />
Spannungsfeld eines akteurtheoretisch erweiterten Institutionenansatzes, eines mikropolitischen<br />
Akteursansatzes 'betrieblichen Interessenhandelns' und des Transformationsproblems<br />
im Sinne der Labour Process Debate. Untersuchungsdesign: Trend, Zeitreihe; Querschnitt<br />
DATENGEWINNUNG: Standardisierte Befragung, telefonisch (Stichprobe: 364; Betriebe -<br />
364 Manager + 122 Betriebsräte-; Auswahlverfahren: Zufall). Dokumentenanalyse, offen<br />
(Bundesachviv -SAPMO-). Gruppendiskussion (Stichprobe: 1; ehemalige Akteure eines
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 69<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung<br />
VEB). Qualitatives Interview (Stichprobe: ca. 30; ehemalige Lohnexperten der DDR - Manager<br />
und Betriebsräte ostdeutscher Betriebe). Feldarbeit durch Mitarbeiter/-innen des Projekts.<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: Hinke, R.: Von der Krise des Fordismus zur Krise der Gewerkschaften.<br />
in: GMH, 2003, H. 8-9, S. 526-536.+++Hinke, R.: Der Flächentarifvertrag. Erinnerungsarbeit<br />
zu dessen Sinn und Zweck. in: Sozialismus, 2005, H. 7-8, S. 22-32.<br />
ART: Dissertation; gefördert BEGINN: 2002-10 ENDE: 2006-12 AUFTRAGGEBER: nein FI-<br />
NANZIERER: Hans-Böckler-Stiftung<br />
INSTITUTION: Universität Jena, Fak. für Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Institut für<br />
Soziologie (07737 Jena)<br />
KONTAKT: Hinke, Robert (Tel. 0951-203859, e-mail: robert.hinke@gmx.de)<br />
[49-F] Houben, Marion, Dipl.-Sozialwirt (Bearbeitung); Bierbaum, Heinz, Prof.Dr. (Leitung):<br />
Kosten und Nutzen der Mitbestimmung in KMU<br />
INHALT: 1. Beitrag zur Diskussion um die Kosten der betrieblichen Mitbestimmung in KMU. 2.<br />
Quantitative Berechnungen und differenzierte Kostenbetrachtungen. 3. Unterschiedlichkeit<br />
der Mitbestimmungspraxis veranschaulichen. GEOGRAPHISCHER RAUM: Bundesrepublik<br />
Deutschland<br />
METHODE: keine Angaben DATENGEWINNUNG: Gruppendiskussion; Standardisierte Befragung,<br />
schriftlich. Qualitatives Interview (Stichprobe: 79 Fälle; Betriebsräte, d.h. in der Regel<br />
Betriebsratvorsitzende; Auswahlverfahren: Zufall -in Zusammenarbeit mit IGM Verwaltungsstellen-).<br />
Feldarbeit durch Mitarbeiter/-innen des Projekts.<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: Download: http://www.info-institut.de (geplant).<br />
ART: Auftragsforschung BEGINN: 2005-05 ENDE: 2005-08 AUFTRAGGEBER: IGM Vorstand,<br />
Abt. Betriebspolitik KMU, Frankfurt a.M. FINANZIERER: Auftraggeber<br />
INSTITUTION: INFO-Institut Organisationsentwicklung und Unternehmenspolitik an der Hochschule<br />
für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (Pestelstr. 6, 66119 Saarbrücken)<br />
KONTAKT: Bearbeiterin (Tel. 0681-95413-14, e-mail: mhouben@info-institut.de)<br />
[50-F] ISA Consult GmbH Beratungsgesellschaft für Innovation:<br />
Der Betriebsrat und sein Beitrag zur Beschäftigungs- und Standortsicherung<br />
INHALT: Häufig werden Betriebsräte zurzeit mit Plänen der Arbeitgeber konfrontiert, die eine<br />
Schließung oder Verlagerung von Betriebsteilen oder eine unentgeltliche Verlängerung der<br />
Arbeitszeit vorsehen. In Verbindung damit geht es dann meist auch um den Abbau von Beschäftigung<br />
oder Tarif- und Sozialstandards. Welche Möglichkeit hat nun der Betriebsrat, abgesehen<br />
von den üblichen Verhandlungen um Schadensbegrenzungen, einen Kompromiss mit<br />
einer Investition in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu verbinden? Die ISA Consult<br />
GmbH hat ein Beratungskonzept entwickelt, mit dem 1. der Betriebsrat das Konzept des Arbeitgebers<br />
fundiert bewerten, 2. ein Alternativkonzept gemeinsam mit Betriebsrat und Beschäftigten<br />
erarbeiten, und 3. die damit verbundenen Chancen und Risiken fundiert und sicher<br />
beurteilen kann. Genau diese Entscheidungssicherheit ist wichtig, erfordert doch gerade die<br />
Verantwortung den Beschäftigten gegenüber das Hinzuziehen objektiver Kriterien bei der<br />
Bewertung der betriebswirtschaftlichen Konzepte. Alle Vorgänge bleiben vertraulich und<br />
werden nur in enger Absprache mit dem Betriebsrat durchgeführt.
70 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: keine Angaben ARBEITSPAPIERE: Beratungskonzept, Beschäftigungs-<br />
und Standortsicherung. Powerpoint-Präsentation.<br />
ART: keine Angabe AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: ISA Consult GmbH Beratungsgesellschaft für Innovation, Strukturpolitik und<br />
Arbeit (Westring 26a, 44787 Bochum)<br />
KONTAKT: Pfeifer, Stefan (Tel. 0234-9132-113)<br />
[51-F] Jirjahn, Uwe, PD Dr. (Leitung):<br />
Ökonomische Wirkungen der Mitbestimmung in Deutschland: Überblick über den Stand<br />
der Forschung und Perspektiven für zukünftige Studien<br />
INHALT: Es wird ein Überblick über aktuelle empirische Studien zu den ökonomischen Wirkungen<br />
der betrieblichen Mitbestimmung sowie der Unternehmensmitbestimmung gegeben. Kontext/<br />
Problemlage: Mitbestimmung ist zentraler Bestandteil einer Demokratisierung und Humanisierung<br />
der Arbeitswelt. Unter ökonomischen Gesichtspunkten stellt sich die Frage, unter<br />
welchen Bedingungen Mitbestimmung zu einer Steigerung der Leistungsfähigkeit von Betrieben<br />
und Unternehmen beiträgt und somit Kompatibilität mit marktwirtschaftlichen Prinzipien<br />
aufweist. Fragestellung: Mitbestimmung kann die Leistungsfähigkeit von Betrieben und<br />
Unternehmen auf vielfältige Art und Weise beeinflussen. Der Literaturüberblick stellt aktuelle<br />
Studien vor, die sich mit den Einflüssen von Mitbestimmung auf Produktivität, Löhne,<br />
Fluktuation, Arbeitsnachfrage, Weiterbildung, Arbeitszeitmodelle, Gruppenarbeit, Innovationen<br />
und betriebliche Maßnahmen des Umweltschutzes beschäftigen. Ergebnisse: Insgesamt<br />
kann festgehalten werden, dass Mitbestimmung ein erhebliches Potenzial zur Steigerung der<br />
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit hat. Dies wird besonders deutlich, wenn man Studien zu<br />
Betriebsräten betrachtet. Dabei zeigt sich auch, dass die Wirkungen entscheidend von den betrieblichen<br />
Rahmenbedingungen und hier besonders von der Tarifbindung abhängen. Studien<br />
zur Unternehmensmitbestimmung liegen in deutlich kleinerer Zahl vor, sodass insbesondere<br />
hier Forschungsbedarf besteht, um wirtschaftspolitische Handlungsempfehlungen geben zu<br />
können. Die wenigen aktuellen Studien deuten darauf hin, dass auch die Mitbestimmung im<br />
Aufsichtsrat positive Produktivitäts- und Innovationswirkungen entfalten kann, wobei allerdings<br />
ein negativer Einfluss auf den Shareholder Value bestehen könnte. Sowohl für Studien<br />
zur betrieblichen Mitbestimmung als auch für Untersuchungen zur Unternehmensmitbestimmung<br />
gilt, dass in Zukunft stärker auf Vergleichbarkeit geachtet werden sollte.<br />
METHODE: Im Mittelpunkt stehen empirische Untersuchungen, die sich ökonometrischer Methoden<br />
bedienen.<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: keine Angaben ARBEITSPAPIERE: Jirjahn, U.: Ökonomische<br />
Wirkungen der Mitbestimmung in Deutschland: Überblick über den Stand der Forschung und<br />
Perspektiven für zukünftige Studien. Abschlussbericht. Hannover, Nov. 2005, 34 S.<br />
ART: Auftragsforschung; Gutachten AUFTRAGGEBER: Hans-Böckler-Stiftung FINANZIERER:<br />
Auftraggeber<br />
INSTITUTION: Universität Hannover, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Institut für Empirische<br />
Wirtschaftsforschung (Königsworther Platz 1, 30167 Hannover)<br />
KONTAKT: Leiter (e-mail: jirjahn@mbox.iqw.uni-hannover.de)
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 71<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung<br />
[52-L] Keller, Berndt:<br />
Mitbestimmung: aktuelle Forderungen im Licht empirischer Daten, in: Sozialer Fortschritt :<br />
unabhängige Zeitschrift für Sozialpolitik, Jg. 55/2006, H. 2/3, S. 41-50 (Standort: USB Köln(38)-<br />
Haa1098; Kopie über den Literaturdienst erhältlich;<br />
URL: http://www.econdoc.de/_de/indexsofo.htm)<br />
INHALT: "In letzter Zeit haben verschiedene Kritiker Forderungen nach grundlegenden Änderungen<br />
der bestehenden Mitbestimmungsregelungen erhoben, die nicht nur die betriebliche<br />
sondern auch die Unternehmensebene betreffen. Der Beitrag stellt diesen Forderungen die<br />
Ergebnisse aktueller empirischer Studien über die tatsächlichen Auswirkungen der Mitbestimmung<br />
gegenüber. Dabei handelt es sich u.a. um Studien zu ökonomischen Folgen des<br />
Handelns von Betriebsräten, um betriebliche und sektorale Deckungsraten sowie um Entwicklungen<br />
auf europäischer Ebene. Insgesamt zeigt sich, dass die überwiegende Mehrzahl<br />
der vorgebrachten Begründungen auf rein subjektiven Voraussetzungen basieren und durch<br />
die Ergebnisse empirischer Studien nicht gestützt werden. Offensichtlich geht es den Kritikern<br />
nicht um Vorschläge zur sachgerechten Weiterentwicklung der bestehenden Mitbestimmung<br />
bzw. um die Behebung bestehender Probleme." (Autorenreferat)<br />
[53-F] Kotthoff, Hermann, Prof.Dr. (Leitung):<br />
EU-Osterweiterung: die aktuelle Herausforderung für den Europäischen Betriebsrat (EBR)<br />
INHALT: Die EU-Osterweiterung zum 1. Mai 2004 stellte die Europäischen Betriebsräte (EBR)<br />
aus multinationalen Unternehmen, die Niederlassungen in den Beitrittsländern haben, vor die<br />
Aufgabe, die Nominierung von Delegierten aus diesen Ländern in die Wege zu leiten. Im<br />
Vorfeld stellte sich heraus, dass dies mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein könnte.<br />
Kontext/ Problemlage: Die Schwierigkeit besteht darin, in den mittelosteuropäischen (MOE-<br />
)Niederlassungen einen konkreten Arbeitnehmervertreter als Ansprechpartner zu finden, der<br />
vor Ort die Nominierung organisiert. Bei dieser technisch-organisatorischen Angelegenheit<br />
geht es real aber um nicht weniger als um die Erkundung einer neuen Welt: um die erstmalige<br />
Kontaktaufnahme zwischen West und Ost auf lokaler, betrieblicher Ebene. Von ausschlaggebender<br />
Bedeutung ist die Fremdartigkeit und Unvergleichbarkeit der jeweiligen Interessenvertretungssysteme<br />
und -kulturen. Fragestellung: 1. Welche Wege der Kontaktaufnahme sind<br />
die EBR-Vorsitzenden gegangen, welche Erfahrungen haben sie dabei gemacht und wie erfolgreich<br />
waren sie? 2. Wie verliefen die ersten EBR-Sitzungen mit den neuen MOE-Delegierten?<br />
Welche Integrationsprobleme gibt es? 3. Wie wird mit der großen Unterschiedlichkeit<br />
der betrieblichen Interessenvertretungssysteme und -kulturen umgegangen? 4. Welche<br />
Interessen im EBR sind spezifisch westeuropäisch und welche mittelosteuropäisch? Ergebnisse:<br />
Das Finden eines Ansprechpartners an den MOE-Standorten gestaltete sich in der Mehrzahl<br />
der Fälle als äußerst schwierig. In vier der 14 Konzerne blieben die Bemühungen bis<br />
heute (März 2005) erfolglos. Es gibt vier "Nominierungswege": a) über die Gewerkschaft (realisiert<br />
in vier Fällen), b) über das lokale Standortmanagement (vier Fälle), c) über das zentrale<br />
Konzernmanagement (fünf Fälle), d) zweigleisig: über das zentrale Management und die<br />
Gewerkschaft (ein Fall). Jeder dieser Wege wird in einer Fallstudie beschrieben. c) ist der effektivste<br />
Nominierungsweg. Er wird aber nur in so genannten "Eurocompanies" praktiziert.<br />
Das sind Konzerne, die Europa als einheitliche Organisationsebene abgebildet haben, d.h. sie<br />
haben alle europäischen Länder "gleichgeschaltet". Das Faktum Niedriglohn ist eine Trennli-
72 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung<br />
nie im EBR, mit der aber beide Seiten psychologisch vorsichtig umgehen. GEOGRAPHI-<br />
SCHER RAUM: Tschechische Republik, Slowakische Republik, Bundesrepublik Deutschland<br />
METHODE: keine Angaben DATENGEWINNUNG: Interview (EBR-Vorsitzende von 14 multinationalen<br />
Konzernen -acht deutsche, sechs nicht deutsche- aus den Sektoren Metall, Chemie,<br />
Banken/ Versicherungen, Food Industry. EBR-Delegierte an vier slowakischen und zwei<br />
tschechischen Standorten).<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: keine Angaben ARBEITSPAPIERE: Kotthoff, H.: EU-Osterweiterung:<br />
die aktuelle Herausforderung für den Europäischen Betriebsrat. Erste Basiskontakte<br />
zwischen Ost und West. Abschlussbericht. Darmstadt, März 2005, 62 S.<br />
ART: gefördert AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: Hans-Böckler-Stiftung<br />
INSTITUTION: Technische Universität Darmstadt, FB 02 Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften,<br />
Institut für Soziologie (Residenzschloss, 64283 Darmstadt)<br />
KONTAKT: Leiter (e-mail: hermann.kotthoff@web.de)<br />
[54-F] Kratzer, Nick, Dr.; Marrs, Kira, Dipl.-Soz. (Bearbeitung); Döhl, Volker, Dr. (Leitung):<br />
Zur Wirksamkeit neuer Instrumente der Leistungsregulierung (Zielvereinbarungen) im<br />
Angestellten- bzw. Zeitlohnbereich. Projekt zur sozialwissenschaftlichen Begleitung der Umsetzung<br />
des Entgeltrahmenabkommens (ERA)<br />
INHALT: Zielvereinbarungen werden im Kontext neuer Formen der Unternehmens-, Arbeits- und<br />
Leistungssteuerung (Stichworte: Vermarktlichung, Selbstorganisation) zunehmend für die<br />
Durchsetzung betrieblicher Leistungsziele eingesetzt. Ob und unter welchen Bedingungen sie<br />
auch von den Beschäftigten genutzt werden können, ausufernde Leistungsanforderungen abzuwehren,<br />
ist die zentrale Frage des Projekts. Kontext/ Problemlage: Zielvereinbarungen<br />
(ZV) als Instrument der Leistungssteuerung finden vor allem im Zeitlohn- und Angestelltenbereich<br />
immer mehr Verbreitung. Über sie sollen die Anforderungen des Marktes mit der Arbeits-<br />
und Leistungsverausgabung des einzelnen Beschäftigten enger verkoppelt werden. Sie<br />
stehen damit prototypisch für den Versuch, einen ergebnis- und marktbezogenen Leistungsbegriff<br />
zu verankern. Im Zeitlohn-/ Angestelltenbereich ist die betriebliche Interessenvertretung<br />
bislang kaum in der Lage, der tendenziellen Maßlosigkeit der Leistungsverausgabung<br />
bei leistungsbezogenen Zielvereinbarungen wirksam zu begegnen. Erst mit den in Kraft tretenden<br />
Entgeltrahmentarifverträgen (ERA-TV) wird in der Metall- und Elektroindustrie eine<br />
tarifvertragliche Regulierung bestimmter Formen von Zielvereinbarungen (als leistungsbezogene<br />
Entgeltform) möglich. Damit verbindet sich die Hoffnung, maßlose Leistungsanforderungen<br />
besser regulieren zu können. Fragestellung: Das Projekt steht in einem engen Zusammenhang<br />
mit einer Reihe von Forschungsvorhaben, die den Prozess der Einführung und Umsetzung<br />
der ERA-TV in den Betrieben der Metall- und Elektroindustrie wissenschaftlich begleiten.<br />
Es fokussiert dabei auf den Prozess der Einführung bzw. Umgestaltung neuer Instrumente<br />
der Leistungssteuerung, insbesondere Zielvereinbarungen, und untersucht dessen<br />
Auswirkungen auf die Lage der Beschäftigten und die Handlungsmöglichkeiten und –notwendigkeiten<br />
der betrieblichen Interessenvertretung. Zugespitzt ist die Frage: Gelingt es, mit<br />
Zielvereinbarungen die wachsenden Leistungsanforderungen zu regulieren und zu begrenzen?<br />
Kann dieses personalpolitische Instrument demnach für die Bewältigung bzw. Begrenzung<br />
steigender Leistungsanforderungen (interessenpolitisch) instrumentalisiert werden oder<br />
kommt es - im Gegenteil - (auch) mit diesem Instrument zu einer Erhöhung des Leistungsdrucks?
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 73<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung<br />
METHODE: Im Zentrum der Untersuchung stehen Betriebsfallstudien in fünf Betrieben, die mit<br />
der Umsetzung von ERA und hier mit der Einführung bzw. Umgestaltung von Zielvereinbarungen<br />
befasst sind. Ausgangspunkt ist die Analyse der leistungspolitischen Strategien, Instrumente<br />
und Regularien in den Betrieben. Diese bilden die Hintergrundsfolie, vor der die<br />
Verhandlungen zur Umsetzung der ZV-Regelungen geführt werden. In Expertengesprächen<br />
(Management, Betriebsrat), Arbeitskräfteinterviews und Gruppendiskussionen wird zum einen<br />
nach dem Stellenwert von ZV im Handeln der Akteure, nach den strategischen Zielsetzungen<br />
bzw. nach den Erwartungen/ Befürchtungen von Beschäftigten gefragt; zum Zweiten<br />
wird der Prozess der Implementation der auf ZV gerichteten Regelungen (Betriebsvereinbarungen)<br />
rekonstruiert und zum Dritten werden die erreichten Effekte bezüglich der (Erweiterung<br />
von) Partizipationsmöglichkeiten sowie im Hinblick auf die Leistungssituation im Zeitlohn-/<br />
Angestelltenbereich analysiert. DATENGEWINNUNG: Betriebsfallstudie; Expertengespräch;<br />
Interview; Gruppendiskussion.<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: Kratzer, Nick: Zielvereinbarungen als Instrument der Leistungspolitik.<br />
in: Huber, Berthold; Burkhard, Oliver; Wagner, Hilde (Hrsg.): Perspektiven der Tarifpolitik<br />
- im Spannungsfeld von Fläche und Betrieb. Hamburg: VSA 2006, S. 146-159.+++ Kratzer,<br />
Nick; Sauer, Dieter: Zeit, Leistung, Beschäftigung - Anforderungen an eine erweiterte<br />
Arbeits(zeit)politik. in: Seifert, H. (Hrsg.): Flexible Zeiten in der Arbeitswelt. Frankfurt am<br />
Main: Campus Forschung 2005, S. 244-259.+++Sauer, Dieter; Döhl, Volker; Kratzer, Nick;<br />
Marrs, Kira: Arbeiten ohne (Zeit-)Maß? Ein neues Verhältnis von Arbeitszeit- und Leistungspolitik.<br />
in: Bsirske, F.; Mönig-Raane, M.; Sterkel, G.; Wiedemuth, J. (Hrsg.): Es ist Zeit<br />
- das Logbuch für die ver.di-Arbeitszeitinitiative. Hamburg: VSA 2004, S. 155-177. AR-<br />
BEITSPAPIERE: Marrs, Kira: Leistungsentgelt für Angestellte (Zielvereinbarungen). Referat<br />
zum Workshop "ERA und Zielvereinbarungen", Berlin, 23. Sept. 2005.+++Kratzer, Nick:<br />
Zielvereinbarungen als Instrument der Leistungspolitik. Referat im Forum 3 der Tarifpolitischen<br />
Konferenz der IG Metall, Mannheim, 21.10.2005.<br />
ART: gefördert BEGINN: 2005-10 ENDE: 2007-09 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINAN-<br />
ZIERER: Hans-Böckler-Stiftung<br />
INSTITUTION: Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. -ISF- (Jakob-Klar-Str. 9,<br />
80796 München)<br />
KONTAKT: Leiter (e-mail: volker.doehl@isf-muenchen.de); Marrs, Kira<br />
(e-mail: kira.marrs@isf-muenchen.de)<br />
[55-F] Kratzer, Nick, Dr.; Marrs, Kira (Bearbeitung); Sauer, Dieter, Prof.Dr.; Döhl, Volker, Dr.<br />
(Leitung):<br />
Arbeiten ohne (Zeit-)Maß? Ein neues Verhältnis von Arbeitszeit- und Leistungspolitik<br />
INHALT: Hat die Zeit als Maß der Arbeit ausgedient? Ausufernde Arbeitszeiten und der Ruf<br />
nach Arbeitszeitverlängerung scheinen dem zu widersprechen. Aber: Für die Steuerung und<br />
Beurteilung von "Leistung" verliert die "Zeit" als Bemessungsgröße immer mehr an Bedeutung.<br />
Damit greifen traditionelle Instrumente der Regulierung von Zeit und Leistung vielfach<br />
ins Leere. Neue Regulierungsansätze sind gefordert. Kontext/ Problemlage: In Unternehmen<br />
und Verwaltungen setzen sich zunehmend ergebnis- und markt(erfolgs)orientierte Formen der<br />
Steuerung von Arbeit durch. Wenn nur das Ergebnis bzw. der Markterfolg zählt, wird Leistung<br />
vom arbeitskraftbezogenen Aufwand gelöst. Die Arbeitszeit und traditionelle Leistungskriterien<br />
dienen dann zunehmend weniger als Maßstab der Bemessung und Bewertung von<br />
Arbeit und damit auch der legitimen Regulierung von Arbeits- und Leistungsbedingungen.
74 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung<br />
Eine tendenziell "entzeitlichte", vom individuellen Aufwand abstrahierende Leistungspolitik<br />
verlangt von den Beschäftigten, den Zusammenhang von Zeit und Leistung selbst herzustellen.<br />
Sie müssen für sich selbst ein Maß setzen, das einer ergebnis- und marktorientierten und<br />
im doppelten Sinne "maßlosen" Leistungspolitik entgegengesetzt werden kann. Dies setzt<br />
neue Bedingungen für individuelles und kollektives Interessenhandeln und verlangt einen<br />
Neuansatz in der betrieblichen und tariflichen Regulierung von Arbeit. Die Fragestellung zielt<br />
auf die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen den neuen Formen der Unternehmens-<br />
und Leistungssteuerung und den Folgen für die Beschäftigten, den individuellen Umgangs-<br />
und Reaktionsweisen und den darauf bezogenen interessenpolitischen Aktivitäten. Wie und<br />
mit welcher Dynamik setzen sich branchen- und betriebsspezifisch die neuen Steuerungsformen<br />
durch? Wie kommen die Beschäftigten, abhängig von bestimmten sozialen und strukturellen<br />
Merkmalen, damit zurecht? Oder konkreter: Was bedeutet es, wenn die Zeit, die für die<br />
Beschäftigten immer noch eine der zentralen Ressourcen bei der individuellen Steuerung ihrer<br />
Arbeit und Leistung ist, für die Unternehmen immer mehr als "Maß" der Arbeit zurücktritt<br />
und an ihre Stelle die Bewertung nach ihrem Ergebnis bzw. ihrem Erfolg rückt? Welche Konsequenzen<br />
ergeben sich daraus für die individuelle und kollektive Interessenvertretung?<br />
METHODE: Um ein möglichst breites Spektrum unternehmerischer Steuerungsformen von Arbeit<br />
zu erfassen, werden Unternehmen bzw. Unternehmensbereiche ausgewählt, die sich jeweils<br />
hinsichtlich des Grades ihrer Abhängigkeit von Marktanforderungen und hinsichtlich<br />
der Durchsetzung ergebnis- bzw. marktorientierter Steuerungsformen unterscheiden. Insbesondere<br />
geht es um Bereiche, in denen traditionell die Zeit zur Arbeits- und Leistungssteuerung<br />
eine zentrale Rolle spielt oder gespielt hat (Zeitlohn- und Angestelltenbereiche), in denen<br />
die Zeit als Maß jedoch zunehmend durch ergebnis- und marktorientierte Bemessungsgrößen<br />
überformt bzw. ersetzt wird. Die ausgewählten Bereiche sind: Servicebereich in der<br />
Telekommunikation, wissenschaftlich-technische Dienstleistung in der Automobilentwicklung,<br />
wissenschaftliche Forschung im öffentlichen Bereich, Pflege im Krankenhaus. DA-<br />
TENGEWINNUNG: Betriebsfallstudien; Expertengespräche; Beschäftigteninterviews; Gruppendiskussionen.<br />
ART: gefördert AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: Hans-Böckler-Stiftung<br />
INSTITUTION: Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. -ISF- (Jakob-Klar-Str. 9,<br />
80796 München)<br />
KONTAKT: Sauer, Dieter (Prof.Dr. e-mail: dieter.sauer@isf-muenchen.de); Döhl, Volker (Dr. email:<br />
volker.döhl@isf-muenchen.de)<br />
[56-L] Krenn, Manfred; Papouschek, Ulrike; Flecker, Jörg; Eichmann, Hubert:<br />
Partizipation in entgrenzten Arbeitsfeldern: IT-Dienstleistungen und Mobile Pflege, in: WSI<br />
Mitteilungen : Monatszeitschrift des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in der<br />
Hans-Böckler-Stiftung, Jg. 59/2006, H. 2, S. 92-97 (Standort: USB Köln(38)-Haa964; Kopie über<br />
den Literaturdienst erhältlich; URL: http://www.econdoc.de/_de/indexwsi.htm)<br />
INHALT: "Der Beitrag behandelt die Auswirkungen entgrenzter Arbeitsbedingungen auf die<br />
Partizipationschancen von Beschäftigten in zwei Dienstleistungsbranchen, den IT-Dienstleistungen<br />
und der mobilen Pflege. Dabei zeigt sich, dass die äußeren Rahmenbedingungen,<br />
wie knappe Budgets, verschärfte Konkurrenz oder häufige Umstrukturierungen, eine Durchsetzung<br />
von ArbeitnehmerInneninteressen erschweren. Diese Rahmenbedingungen bewirken<br />
auch, dass Chancen zur Selbstorganisation in der Arbeit häufig nicht zu einer Demokratisierung<br />
der Arbeitswelt beitragen, sondern eine Delegation von Unsicherheit oder Selbstorgani-
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 75<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung<br />
sation von Überlastung bedeuten. Unter der Bedingung räumlich und zeitlich 'entgrenzter'<br />
Arbeit nehmen die Partizipationschancen weiter ab, weil Kommunikationsmöglichkeiten und<br />
sozialer Zusammenhalt sowie Zeit und Energie für politisches Engagement fehlen." (Autorenreferat)<br />
[57-L] Kropf, Julia:<br />
Flexibilisierung - Subjektivierung - Anerkennung: Auswirkungen von Flexibilisierungsmaßnahmen<br />
auf die Anerkennungsbeziehungen in Unternehmen, München: Biblion Verl. 2005,<br />
253 S., ISBN: 3-932331-49-4 (Standort: UB Bochum(294)-DCB5355)<br />
INHALT: Die Verfasserin setzt sich im ersten Teil ihrer Untersuchung mit dem Strukturwandel<br />
der Erwerbsarbeit und der neuen Rolle des Subjekts in diesem Zusammenhang auseinander.<br />
Sie zeigt, dass die neuen Formen der Arbeitsorganisation und der Zusammenarbeit für die<br />
Mitarbeiter zwar neue Handlungsoptionen und Freiheiten in der Arbeitswelt schaffen, aber<br />
zugleich auch neue Zwänge hervorrufen. Auch die Subjekte selbst machen vermehrt auf<br />
Selbstverwirklichung orientierte Ansprüche an ihre Erwerbsarbeit geltend. Im Folgenden<br />
steht die identitätsbildende Funktion von Arbeit im Vordergrund. Der individuellen Selbstverwirklichung<br />
liegen bestimmte soziale Voraussetzungen zu Grunde. In Bezug auf Arbeitsverhältnisse<br />
spielt hier vor allem die soziale Wertschätzung mit ihrem Fokus auf individuelle<br />
Leistung eine Rolle. Im dritten Teil wird der makrosoziale Zusammenhang von Anerkennung<br />
und Arbeit im Anerkennungsverhältnis der sozialen Wertschätzung diskutiert. Die der sozialen<br />
Wertschätzung inhärente Ambivalenz und die daraus resultierende Komplexität von Anerkennungskämpfen<br />
führen schließlich zu einer Erweiterung der Honnethschen Verknüpfung<br />
von Anerkennung und Gerechtigkeit in Bezug auf die Erwerbsarbeit. Dass die Anerkennungsverhältnisse<br />
ungleich verteilt sind, zeigt insbesondere die eingehende Untersuchung der<br />
Unternehmensbeziehungen unter Berücksichtigung flexibler Arbeitszusammenhänge. (ICE2)<br />
[58-F] Kuhlmann, Martin, Dr.; Bahnmüller, Reinhard, Dr. (Bearbeitung); Sperling, Hans-<br />
Joachim, Dr. (Leitung):<br />
Begleitforschung zur Umsetzung des Entgelt-Rahmentarifvertrages (ERA-TV) für die Beschäftigten<br />
in der niedersächsischen Metallindustrie<br />
INHALT: Das Projekt will die Umsetzung des Entgeltrahmentarifvertrags für die Beschäftigten in<br />
der niedersächsischen Metallindustrie untersuchen. Mit dem tarifpolitischen Reformprojekt<br />
ERA ist ein weitreichender Innovationsanspruch der betrieblichen Entlohnungsbedingungen<br />
intendiert. Die Untersuchung der betrieblichen Umsetzungsprozesse wird die entgelt- und arbeitspolitischen<br />
Wirkungen herausarbeiten. Kontext/ Problemlage: Die Vereinbarung neuer<br />
Entgeltrahmentarifverträge in zentralen Tarifgebieten der Metall- und Elektroindustrie markiert<br />
einen Einschnitt in der tarifvertraglichen Regelung von Arbeitsbewertung und Entgeltsystemen.<br />
Mit der einheitlichen Behandlung von Arbeiter- und Angestelltentätigkeiten in<br />
Entgeltfragen ist ein tarifpolitisches Reformprojekt auf den Weg gebracht, das darüber hinaus<br />
von erheblicher gesellschaftspolitischer Bedeutung ist. Ob diese Reformperspektive einer<br />
Modernisierung tariflicher Regelungen zu Entgelt- und Leistungsbedingungen soziale Wirksamkeit<br />
entfalten wird, entscheidet sich wesentlich an den Voraussetzungen, Verläufen und<br />
Resultaten der Umsetzungsprozesse in den Betrieben. Diese Prozesse werden mit der Vorbereitung<br />
und Einführung über einen längeren Zeitraum die Akteure in den Betrieben ebenso
76 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung<br />
beschäftigen wie die Akteure auf der überbetrieblichen Verbandsebene, für die die Anpassungsfähigkeit<br />
des Systems der industriellen Beziehungen auf dem Prüfstand steht. Fragestellung:<br />
Das Forschungsprojekt wird die Umsetzung von ERA am Fall der niedersächsischen<br />
Metall- und Elektroindustrie untersuchen und dabei über eine direkte Kooperation mit dem<br />
F.A.T.K. Tübingen durch einen 'mixed team approach' und ein gemeinsames Untersuchungsdesign<br />
eine Vergleichsperspektive zur Umsetzung des ERA-Tarifwerks in der baden-württembergischen<br />
Metallindustrie verfolgen. Ziel des Forschungsprojektes ist die Klärung der<br />
Formen der Umsetzung und betrieblichen Ausgestaltung des ERA, der Wirkungen der ERA-<br />
Umsetzung und der arbeitspolitischen Implikationen von ERA. Dabei ist zu untersuchen, inwieweit<br />
die Verfahren einheitlicher Arbeitsbewertung zu Veränderungen der betrieblichen<br />
Entgeltstrukturen und dabei auch zu Veränderungen der betrieblichen Arbeits- und Organisationsstrukturen<br />
führen. Weiter ist zu analysieren, ob und unter welchen Bedingungen die Tarifinnovation<br />
in den Betrieben wirksame Impulse zur Einführung oder Forcierung innovativer<br />
Formen der Arbeitsgestaltung liefert. GEOGRAPHISCHER RAUM: Niedersachsen<br />
METHODE: Auf der Basis von Kurz- und Intensivfallstudien (d.h. Interviews, Bestandsaufnahmen<br />
von Arbeitsstrukturen, Gruppendiskussionen und schriftlichen Befragungen) in Betrieben<br />
der niedersächsischen Metall- und Elektroindustrie, Experteninterviews auf überbetrieblicher<br />
Verbandsebene, teilnehmender Beobachtungen an Projektgruppen und einer abschließenden<br />
Befragung eines größeren Betriebssamples werden die betrieblichen Ausgestaltungen<br />
und die Wirkungen von ERA sowie die Wahrnehmungen und Bewertungen der beteiligten<br />
Akteure und der Beschäftigten untersucht und analysiert. Durch eine Rückvermittlung von<br />
Untersuchungsergebnissen an die beteiligten Akteure ist ein zeitnaher und akteursbezogener<br />
Transfer der Untersuchungsergebnisse vorgesehen. Die vergleichende Untersuchungsperspektive<br />
in Bezug auf die ERA-Umsetzung in Baden-Württemberg wird dabei gewährleistet durch<br />
eine vergleichend angelegte Fallauswahl, die Auswahl gleicher Beschäftigtengruppen und die<br />
Verwendung einheitlicher Instrumente. DATENGEWINNUNG: Interview; Bestandsaufnahme<br />
von Arbeitsstrukturen; Gruppendiskussion; Befragung, schriftlich; Experteninterview; Beobachtung,<br />
teilnehmend.<br />
ART: gefördert AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: Hans-Böckler-Stiftung<br />
INSTITUTION: Soziologisches Forschungsinstitut an der Universität Göttingen e.V. -SOFI-<br />
(Friedländer Weg 31, 37085 Göttingen); FATK Forschungsinstitut für Arbeit, Technik und<br />
Kultur e.V. an der Universität Tübingen (Hausserstr. 43, 72076 Tübingen)<br />
KONTAKT: Leiter (e-mail: hsperli@gwdg.de); Kuhlmann, Martin (Dr. e-mail: mkuhlma1<br />
@gwdg.de); Bahnmüller, Reinhard (Dr. e-mail: reinhard.bahnmueller@uni-tuebingen.de)<br />
[59-L] Lengfeld, Holger; Krause, Alexandra:<br />
Wann gilt der Arbeitsmarkt als sozial gerecht?: der Einfluss des Unternehmenskontexts auf<br />
die Akzeptanz ertragsabhängiger Entlohnung, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie,<br />
Jg. 58/2006, H. 1, S. 98-116 (Standort: USB Köln(38)-Haa00277-b; Kopie über den<br />
Literaturdienst erhältlich)<br />
INHALT: "Im Zuge der Dezentralisierung der Tarifpolitik und der Ausweitung ertragsabhängiger<br />
Lohnkomponenten hat die Marktlage eines Unternehmens für die Entlohnungspraxis an Bedeutung<br />
gewonnen. Damit tritt ein neues Prinzip der Lohnfindung in den Vordergrund: das<br />
Prinzip der Marktgerechtigkeit. Ihm zufolge hängen Löhne und Gehälter von der Marktsituation<br />
des jeweiligen Unternehmens ab und nicht davon, welche individuellen Anstrengungen<br />
am Arbeitsplatz erbracht wurden. Fraglich ist, ob dieses Prinzip auch von den Beschäftigten
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 77<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung<br />
als gerecht angesehen wird. Anhand von machttheoretischen Überlegungen und Befunden der<br />
Umfrageforschung wird gezeigt, dass sich Beschäftigte erstens dann stärker für lohnbezogene<br />
Marktgerechtigkeit aussprechen, wenn in ihrem Unternehmen ein durchsetzungsstarker Betriebsrat<br />
existiert. Ursächlich dafür ist, dass ein starker Betriebsrat am ehesten imstande ist,<br />
die Ermittlung des unternehmerischen Markterfolgs und die daraus folgenden Verteilungsprozesse<br />
zu kontrollieren. Zweitens stimmen die Beschäftigten dem Prinzip der Marktgerechtigkeit<br />
zu, wenn sie sich in der Vergangenheit durch das Management fair behandelt fühlten.<br />
Unter diesen Umständen vertrauen sie darauf, zukünftig auch bei einer größeren Abhängigkeit<br />
der Entlohnung vom Markterfolg des Unternehmens gerecht behandelt zu werden. Empirische<br />
Basis dieser Untersuchung sind Umfragedaten aus einer in 21 deutschen Metallunternehmen<br />
durchgeführten standardisierten Beschäftigtenbefragung." (Autorenreferat)<br />
[60-F] Mairhuber, Ingrid, Dr.; Vogt, Marion (Bearbeitung):<br />
Minimum income as the social protection of last resort: safety net, trap and/ or springboard?<br />
INHALT: Vorrangige Aufgabe der nationalen ExpertInnen in diesem EU-Projekt ist die Erarbeitung<br />
von länderspezifischen Informationen zur Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen<br />
von bestehenden Mindestsicherungssystemen sowie Hintergrundinformationen zur<br />
Erklärung von Ein- und Ausschlussbewegungen. Weiters geht es um die Klärung der Repräsentativität<br />
der ECHP-Daten und um konzeptionelle Probleme bei der Definition von Mindesteinkommen<br />
im jeweiligen Land.<br />
ART: Auftragsforschung BEGINN: 2002-04 ENDE: 2003-11 AUFTRAGGEBER: Generaldirektion<br />
05 Beschäftigung, Arbeitsbeziehungen und soziale Angelegenheiten FINANZIERER: Auftraggeber<br />
INSTITUTION: Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt -FORBA- (Aspernbrückengasse 4,<br />
5, 1020 Wien, Österreich); Catholic University of Louvain, Hoger Instituut voor de Arbeid<br />
(E. van Evenstraat 2E, 3000 Louvain, Belgien)<br />
KONTAKT: FORBA (Tel. +43-1-2124700; Fax: +043-1-212470077, e-mail: office@fobra.at);<br />
HIVA (Tel. +32-16-323333, Fax: +32-16-323334, e-mail: hiva@uleuven.ac.be)<br />
[61-L] Martens, Helmut:<br />
Nach dem Ende des Hype - zwischen Interessenvertretungsarbeit und Arbeitspolitik: primäre<br />
Arbeitspolitik und Interessenvertretung in der informationalen Ökonomie, (Schriftenreihe<br />
der Hans-Böckler-Stiftung), Münster: Verl. Westfäl. Dampfboot 2005, 177 S., ISBN: 3-89691-<br />
626-2 (Standort: UB Wuppertal(468)-47PWZ417)<br />
INHALT: Die Studie basiert auf einer empirischen Untersuchung des arbeitspolitischen Handelns<br />
von Beschäftigten und der Interessenvertretungsarbeit von Betriebsräten in der New Economy.<br />
Anknüpfend an einen einleitenden Überblick über die Entwicklung der Branche werden<br />
Ansätze von Arbeitspolitik und Interessenvertretung identifiziert. Vor diesem Hintergrund<br />
werden gewerkschaftliche Modellprojekte in der New Economy vorgestellt, die auch Dimensionen<br />
von gewerkschaftlicher Organisationsentwicklung und Reform und die Debatte um<br />
Organisationslernen berühren. Der Verfasser wendet sich dann der professionellen Interessenvertretungsarbeit<br />
in der IT-Branche zu, um abschließend Perspektiven gewerkschaftlicher<br />
Arbeitspolitik zu formulieren, wie sie sich aus der Untersuchung ergeben. Ergänzt wird die
78 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung<br />
Untersuchung um ein Schlusskapitel, in dem der Verfasser sein eigenes Arbeitskraftunternehmertum<br />
reflektiert. (ICE2)<br />
[62-L] Minssen, Heiner; Riese, Christian:<br />
Qualifikation und Kommunikationsstrukturen des Co-Managers: zur Typologie von Betriebsräten,<br />
in: Arbeit : Zeitschrift für Arbeitsforschung, Arbeitsgestaltung und Arbeitspolitik, Jg.<br />
15/2006, H. 1, S. 43-59 (Standort: USB Köln(38)-XG07322; Kopie über den Literaturdienst erhältlich)<br />
INHALT: "Der Betriebsratstypus des Co-Managers zieht zunehmend Aufmerksamkeit auf sich.<br />
Wir untersuchen in diesem Artikel am Beispiel von Betriebsräten im Öffentlichen Personennahverkehr,<br />
ob dieser Betriebsratstypus sich von anderen (konventionellen, engagierten oder<br />
ambitionierten) Betriebsratstypen hinsichtlich seiner Qualifizierungsprozesse und seiner<br />
Kommunikationsstrukturen unterscheidet. Basierend auf einer schriftlichen Befragung aller<br />
Betriebsräte zeigt sich, dass der Co-Manager mehr Weiterbildungsangebote in Anspruch<br />
nimmt und die dadurch erworbenen Kompetenzen häufiger durch interne Wissensvermittlungsprozesse<br />
an andere Betriebsratsmitglieder weitergibt. Die Kontaktflächen zur Geschäftsleitung<br />
sind deutlich ausgeprägter, ohne dass dies mit einer Reduzierung der Kontakte zu<br />
Gewerkschaften einhergeht. Darüber hinaus wird ein Schwerpunkt im Kontakt zu Betriebsräten<br />
anderer Unternehmen gelegt; hier sind Co-Manager deutlich variantenreicher und differenzierter<br />
als ihre Kollegen aus den anderen Betriebsratstypen." (Autorenreferat)<br />
[63-F] Nehls, Sabine, M.A. (Bearbeitung); Kleinsteuber, Hans J., Prof.Dr. (Leitung):<br />
Mitbestimmte Medienpolitik - Zustand und Zukunft gewerkschaftlicher Medienpolitik. Eine<br />
Studie mit dem Schwerpunkt Hörfunk und Fernsehen<br />
INHALT: 1. Ausgangslage und Rahmenbedingungen gewerkschaftlicher Medienpolitik eruieren<br />
und darstellen. 2. Perspektiven entwickeln als Diskussionsgrundlage einer fundierten und engagierten<br />
arbeitnehmerorientierten Medienpolitik. 3. In mehreren Fallstudien die Brücke zwischen<br />
Wissenschaft und Praxis schlagen, vor allem mit dem Ziel, Anforderungen an und Informationsbedarfe<br />
von mitbestimmungspolitischen Akteuren in Aufsichtsgremien zu benennen.<br />
ZEITRAUM: 1999-2004, aber auch aktuelleres Material GEOGRAPHISCHER RAUM:<br />
Bundesrepublik Deutschland<br />
METHODE: akteurstheoretischer Ansatz; Konzept des Mehrebenensystems DATENGEWIN-<br />
NUNG: Aktenanalyse, offen; Beobachtung, teilnehmend; Gruppendiskussion; Qualitatives Interview;<br />
Standardisierte Befragung, schriftlich. Feldarbeit durch Mitarbeiter/-innen des Projekts.<br />
ART: gefördert BEGINN: 2005-10 ENDE: 2008-03 AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER:<br />
Hans-Böckler-Stiftung<br />
INSTITUTION: Universität Hamburg, Fak. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Department<br />
Sozialwissenschaften Institut für Politische Wissenschaft Arbeitsstelle Medien und Politik<br />
(Sedanstr. 19, 20146 Hamburg)<br />
KONTAKT: Bearbeiterin (Tel. 040-428386196, e-mail: SabineNehls@aol.com)
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 79<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung<br />
[64-F] Prott, Jürgen, Prof.Dr. (Leitung):<br />
Gewerkschaftliche Vertrauensleute im Spannungsfeld von Beruf und Funktion<br />
INHALT: Gestützt auf aktuelle Erkenntnisse der berufs- und organisationssoziologischen Forschung,<br />
wurden Rolle und Funktion gewerkschaftlicher Vertrauensleute am Beispiel der IG<br />
Metall und der IG BCE mit Hilfe von Intensivinterviews untersucht. Im Vordergrund standen<br />
Hintergründe der beruflichen wie der gewerkschaftlichen Biografie, Handlungsmotive und<br />
Verhaltenserwartungen wichtiger Bezugsgruppen. Kontext/ Problemlage: Vertrauensleute<br />
bilden das Rückgrat der Gewerkschaften im Betrieb. Als in der Regel gewählte Interessenvertreter<br />
erwerben sie Vertrauen auf Zeit. Sie sollen die Arbeit der Betriebsräte im gewerkschaftlichen<br />
Sinne unterstützen. Durch die Bedeutungszuwächse der Betriebsräte sowie die Professionalisierungsgewinne<br />
des gewerkschaftlichen Managements industrieller Konflikte geraten<br />
die Vertrauensleute als bereichsspezifische Akteure unter einen doppelten Druck, der sie auf<br />
die Funktion bloßer Erfüllungsgehilfen zurückzuwerfen droht. Ihre schwache Verankerung in<br />
den Satzungen der Gewerkschaften lässt ihnen formal geringe Einflusschancen. Gleichzeitig<br />
benötigen sie einen stabilen Rückhalt im Kreis der Kolleginnen und Kollegen ihres Arbeitsbereichs,<br />
den sie sich nicht zuletzt durch anerkannte fachliche Kompetenz erwerben können.<br />
Je erfolgreicher sie jedoch im Beruf sind, um so weniger mögen sie geneigt sein, sich als ehrenamtliche<br />
Funktionäre dauerhaft und verbindlich zu engagieren. Fragestellung: Unter den<br />
Bedingungen des industriellen wie des gewerkschaftlichen Wandels ergibt sich ein besonderes<br />
Spannungsfeld zwischen Beruf und ehrenamtlicher Funktion. Von dieser Vermutung ging<br />
das Projekt aus. Dieser in der bisherigen Forschung ausgeklammerte Aspekt gewinnt angesichts<br />
des fortgesetzten Mitgliederschwunds besondere Brisanz. Die zentrale Fragestellung<br />
lautete: In welcher Weise verarbeiten Vertrauensleute der IGM und der IGBCE die an ihre<br />
berufliche Position wie an ihre gewerkschaftliche Funktion von unterschiedlichen Bezugsgruppen<br />
(Arbeitskollegen, Vorgesetzte, Betriebsräte, hauptamtliche Gewerkschaftsfunktionäre<br />
etc.) gerichteten Erwartungen zu einer Handlungsstrategie, die gleichermaßen subjektiven<br />
Perspektiven wie strukturellen Rahmenbedingungen gerecht werden kann? In einzelnen Dimensionen<br />
soll dabei der Erwerb von Vertrauen sowie die Bewahrung und der Einsatz von<br />
Vertrauen im Prozess der Bildung sozialen Kapitals betrachtet werden. Ergebnisse: Es gelingt<br />
vielen Vertrauensleuten, ihre soziale Rolle zwischen den sanktionskräftigen Bezugsgruppen<br />
der Arbeitskollegen wie der Betriebsräte verhaltenssicher auszubalancieren. Sie riskieren aber<br />
Vertrauensverluste bei den Betriebsräten, wenn sie deren Erwartungen nach Absicherung ihrer<br />
Macht nicht nachkommen. Sofern sie selbst in die Position von Betriebsräten aufrücken<br />
und dort erfolgreich tätig werden wollen, was kaum die Hälfte der befragten Population anstrebt,<br />
benötigen sie komplexe politisch- moralische, sozial-kommunikative und organisatorische<br />
Kompetenzen. Erworbene berufliche Qualifikationen gelten den Vertrauensleuten zwar<br />
als nützliche Absicherungen ihrer Funktion nach unten, für ehrenamtliche Gewerkschaftskarrieren<br />
spielen sie jedoch nur eine untergeordnete Rolle. Das Spektrum der Einstellungen fächerte<br />
sich auf im Zusammenhang mit der Intensität der gewerkschaftlichen Bindung. Die<br />
Zugehörigkeit zu einer der beiden Organisationen spielte demgegenüber kaum eine Rolle.<br />
METHODE: Im Mittelpunkt des empirisch angelegten Projekts standen leitfadengesteuerte Intensivinterviews<br />
mit insgesamt 101 gewerkschaftlichen Vertrauensleuten, die sich gleichmäßig<br />
auf beide Organisationen verteilten. In der zufällig gewonnenen Stichprobe sind langjährige<br />
wie neue Funktionsinhaber, Frauen und Männer, Alte und Junge annähernd wie in der<br />
Grundgesamtheit vertreten. Große Unternehmen mit stabilen gewerkschaftlichen Strukturen<br />
sind gegenüber Kleinbetrieben, Arbeiter gegenüber Angestellten überrepräsentiert. Das so<br />
gewonnene Spektrum von Einstellungen und Erfahrungen kann sicher nicht die Generierung
80 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung<br />
bruchlos verallgemeinerungsfähiger Kenntnisse beanspruchen, wohl aber ist die Datenbasis<br />
breit genug, um die wichtigsten sozialen Typen gewerkschaftlicher Vertrauensleute herausschälen<br />
zu können. Die Intensivinterviews wurden vorbereitet, rückkoppelnd begleitet und<br />
ergänzt durch Expertengespräche mit für Vertrauensleutearbeit Verantwortlichen in beiden<br />
Gewerkschaften sowie beim DGB.<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: keine Angaben ARBEITSPAPIERE: Prott, J.: Vertrauensleute.<br />
Ehrenamtliche Gewerkschaftsfunktionäre zwischen Beruf und sozialer Rolle. Abschlussbericht.<br />
Hamburg, Febr. 2006, 260 S.<br />
ART: gefördert AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: Hans-Böckler-Stiftung<br />
INSTITUTION: Universität Hamburg, Fak. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Department<br />
Wirtschaft und Politik Fachgebiet Soziologie (Von-Melle-Park 9, 20146 Hamburg)<br />
KONTAKT: Leiter (e-mail: joprott@t-online.de)<br />
[65-F] Richter, Ulrike A. (Bearbeitung); Funder, Maria, Prof.Dr. (Betreuung):<br />
Arbeitskräfte, Leistungsträger, Human Resources. Eine Ethnographie betrieblicher Leistungspolitik<br />
INHALT: keine Angaben<br />
ART: Dissertation; gefördert AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER: Hans-Böckler-Stiftung<br />
INSTITUTION: Universität Marburg, FB 03 Gesellschaftswissenschaften und Philosophie, Graduiertenkolleg<br />
"Geschlechterverhältnisse im Spannungsfeld von Arbeit, Politik und Kultur"<br />
(Biegenstr. 9, 35037 Marburg)<br />
KONTAKT: Bearbeiterin (Tel. 06421-2824354, e-mail: richteru@staff.uni-rnarburg.de)<br />
[66-F] Röbenack, Silke, Dr.phil. (Bearbeitung):<br />
Betriebliche Mitbestimmung in Ostdeutschland - die institutionellen Logiken und habituellen<br />
Muster betriebsrätlichen Handelns<br />
INHALT: In der frühen Transformationsforschung zur betrieblichen Mitbestimmung sind einige<br />
Probleme offen geblieben: So hat man die Etablierung von Betriebsräten zwar häufig als 'Institutionentransfer'<br />
etikettiert, die institutionentheoretischen Grundannahmen wurden jedoch<br />
kaum expliziert. Auch wurde den Fragen, wer die ersten Betriebsräte waren und was sie motiviert<br />
hat, sich in einer Phase des gesellschaftlichen und betrieblichen Umbruchs als Interessenvertreter<br />
zu engagieren, selten detailliert nachgegangen. Zudem wurde das Phänomen ihrer,<br />
bereits sehr früh sichtbaren, unterschiedlichen Handlungsfähigkeit oft als kontextabhängig<br />
oder als defizitäres Anpassungsverhalten zu deuten versucht. Die komplexe Relation zwischen<br />
Institution und Akteur musste damit unterbelichtet bleiben. Die Arbeit widmet sich jenen<br />
Leerstellen. Der vielschichtige Aneignungsprozess durch die Akteure, so lässt sich anhand<br />
der Lebensgeschichten von Betriebsräten der 'ersten Stunde' exemplarisch zeigen, wird<br />
maßgeblich mitbestimmt durch unterschiedliche Grade der 'Vorangepasstheit' ihrer Habitus<br />
an die Institution. Die Grundlagen dafür wurden in der Primär- sowie beruflichen und politischen<br />
Sekundärsozialisation der Akteure gelegt. ZEITRAUM: 1989/90 bis 1995 GEOGRA-<br />
PHISCHER RAUM: Ostdeutschland<br />
METHODE: Mittels eines handlungstheoretischen Institutionenkonzepts, verknüpft mit sozialisations-<br />
und habitustheoretischen Überlegungen, sollte verdeutlicht werden, wie man sich die<br />
Institutionalisierung betriebsrätlichen Handelns in Ostdeutschland vorzustellen hat. Die Ar-
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 81<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung<br />
beit basiert auf 18 biographischen Interviews mit (ehemaligen) ostdeutschen Betriebsräten<br />
sowie auf Expertengespächen mit Gewerkschaftsvertretern. Untersuchungsdesign: Querschnitt<br />
DATENGEWINNUNG: Qualitatives Interview (Stichprobe: 18; Auswahlverfahren:<br />
Quota). Feldarbeit durch Mitarbeiter/-innen des Projekts.<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: Röbenack, Silke: "Aber meistens nur ein Kollege". Über die ersten<br />
Betriebsräte in Ostdeutschland. München, Mering: Hampp 2005.<br />
ART: Dissertation BEGINN: 2002-03 ENDE: 2003-10 AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER:<br />
Wissenschaftler<br />
INSTITUTION: Universität Jena, Fak. für Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Institut für<br />
Soziologie (07737 Jena)<br />
KONTAKT: Bearbeiterin (Tel. 03641-945524, e-mail: s.roebenack@uni-jena.de)<br />
[67-L] Röbenack, Silke:<br />
Aber meistens einfach nur ein Kollege: über die ersten Betriebsräte in Ostdeutschland, München:<br />
Hampp 2005, 325 S., ISBN: 3-87988-926-0 (Standort: USB Köln(38)-32A2956)<br />
INHALT: "In der frühen Transformationsforschung zur betrieblichen Mitbestimmung sind einige<br />
Probleme offen geblieben: So hat man die Etablierung von Betriebsräten zwar häufig als 'Institutionentransfer'<br />
etikettiert, die institutionentheoretischen Grundannahmen wurden jedoch<br />
kaum expliziert. Auch wurde den Fragen, wer die ersten Betriebsräte waren und was sie motiviert<br />
hat, sich in einer Phase des gesellschaftlichen und betrieblichen Umbruchs als Interessenvertreter<br />
zu engagieren, selten detailliert nachgegangen. Und das Phänomen ihrer, bereits<br />
sehr früh sichtbaren, unterschiedlichen Handlungsfähigkeit wurde oft als kontextabhängig<br />
oder als defizitäres Anpassungsverhalten zu deuten versucht. Die komplexe Relation zwischen<br />
Institution und Akteur musste damit unterbelichtet bleiben. Die Arbeit widmet sich jenen<br />
Leerstellen. Mittels eines handlungstheoretischen Institutionenkonzepts, verknüpft mit<br />
sozialisations- und habitustheoretischen Überlegungen, soll verdeutlicht werden, wie man<br />
sich die Institutionalisierung betriebsrätlichen Handelns in Ostdeutschland vorzustellen hat.<br />
Der vielschichtige Aneignungsprozess durch die Akteure, so lässt sich anhand der Lebensgeschichten<br />
von Betriebsräten der 'ersten Stunde' exemplarisch zeigen, wird maßgeblich mitbestimmt<br />
durch unterschiedliche Grade der 'Vorangepasstheit' ihrer Habitus an die Institution.<br />
Die Grundlagen dafür wurden in der Primär- sowie beruflichen und politischen Sekundärsozialisation<br />
der Akteure gelegt." (Autorenreferat)<br />
[68-F] Röttger, Bernd, Dr.; Candeias, Mario, Dr.; Brinkmann, Ulrich, Dr. (Bearbeitung); Dörre,<br />
Klaus, Prof.Dr. (Leitung):<br />
Global mitbestimmen - lokal gestalten? Bürgerschaftliches Engagement von Betriebsräten<br />
am Beispiel regionaler Strukturpolitik<br />
INHALT: Das deutsche System industrieller Beziehungen steht unter hohem Veränderungsdruck.<br />
Ob es in einer globalisierten Welt Überlebenschancen besitzt, entscheidet sich nicht zuletzt an<br />
der Nahtstelle von betrieblicher und unternehmensübergreifender Interessenvertretung. In vielen<br />
Sektoren lässt sich inzwischen ein Spannungsverhältnis zwischen betrieblicher und gewerkschaftlicher<br />
Interessenpolitik beobachten. Diese Entwicklung, die eher verharmlosend<br />
als 'Verbetrieblichung' der industriellen Beziehungen diskutiert wird, ist aber nicht schicksalhaft<br />
vorprogrammiert. Es gibt Betriebsräte, die ihr Engagement über die Grenzen des Unter-
82 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung<br />
nehmens hinaus auf neue gesellschaftliche Felder ausweiten. Das Forschungsprojekt untersucht<br />
vergleichend in den Untersuchungsregionen Braunschweig, Hannover, Kiel, Zwickau,<br />
Ostbrandenburg und Jena (eventuell auch Rostock), ob sich im bürgerschaftlichen Engagement<br />
von betrieblichen Interessenvertretern Keimformen einer neuen Identität entwickeln, deren<br />
gezielte Förderung ein Gegengewicht zur bloßen Betriebszentrierung schaffen könnte.<br />
METHODE: keine Angaben DATENGEWINNUNG: Qualitatives Interview (Stichprobe: 80).<br />
Standardisierte Befragung, telefonisch (Stichprobe: 300). Standardisierte Befragung, schriftlich<br />
(Stichprobe: 200).<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: Dörre, K.: Wiederkehr der Unsicherheit, Gewerkschaften und<br />
Tarifpolitik. Beitrag zur tarifpolitischen Konferenz der IG Metall, 20./21 Oktober, Mannheim.<br />
Erscheint im Konferenz-Reader. Hamburg: VSA-Verl. 2005.+++Dörre, K.: Gewerkschaften<br />
und Beteiligung. Mit aktivierender Mitgliederpolitik aus der Defensive? Beitrag zum Forum<br />
Küste im Rahmen der tarifpolitischen Konferenz der IG Metall in Mannheim. Hamburg:<br />
VSA-Verl. 2005.+++Röttger, Bernd: Gewerkschaftliche Suchstrategien aus der Defensive:<br />
zwischen Rekonstruktion des 'Modell Deutschland' und radikaler Erneuerung. Thesen zur<br />
gewerkschaftlichen politics of scale. Beitrag für die 3. Jahrestagung des 'Forums Neue Politik<br />
der Arbeit': 'Nach dem Epochenbruch: Übergänge zu einer neuen Politik der Arbeit und Menschenwürde<br />
in der Arbeitswelt. 4./5. März 2005, IG Metall Bildungsstätte Berlin-Pichelssee.<br />
Westf. Dampfboot 2006 (im Erscheinen). ARBEITSPAPIERE: Brinkmann, U.; Candeias, M.;<br />
Dörre, K.; Röttger, B.: Regionale Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement. Antworten<br />
auf die Erosion tariflicher Haltegriffe. Erste Forschungsergebnisse und weitere Forschungsperspektiven<br />
des Projekts 'Global mitbestimmen' lokal gestalten? MS. Jena: 2005.<br />
ART: gefördert BEGINN: 2004-12 ENDE: 2007-03 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINAN-<br />
ZIERER: Hans-Böckler-Stiftung; Otto-Brenner-Stiftung<br />
INSTITUTION: Universität Jena, Fak. für Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Institut für<br />
Soziologie Lehrstuhl für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie (07737 Jena)<br />
KONTAKT: Leiter (Tel. 03641-945521, e-mail: Klaus.Doerre@uni-jena.de)<br />
[69-F] Rudolph, Wolfgang, M.A. (Bearbeitung); Wassermann, Wolfram, Dr.rer.pol.; Kayser,<br />
Gunter, Dr. (Leitung):<br />
Mittelstand und Mitbestimmung - Unternehmensführung, Mitbestimmung und Beteiligung<br />
in mittelständischen Unternehmen<br />
INHALT: Ziele sind, Einstellungen und Verhaltensweisen mittelständischer Arbeitgeber gegenüber<br />
der betrieblichen Mitbestimmung sowie Erfahrungen aus der Mitbestimmungspraxis in<br />
mittelständischen Klein- und Mittelbetrieben zu untersuchen. Untersucht werden Betriebe des<br />
industriellen Mittelstands, des privaten Dienstleistungsgewerbes und des Handwerks mit<br />
mehr als 20 Beschäftigten in ausgewählten Branchen.<br />
METHODE: Arbeitgeber bzw. Geschäftsführer werden in einer qualitativen Befragung zur mittelstandstypischen<br />
Abwehr gegenüber der betrieblichen Mitbestimmung befragt. Dies wird<br />
ergänzt durch die Befragung mitbestimmungserfahrener Mittelständler. Dort existierende Betriebsräte<br />
werden einbezogen. Untersuchungsdesign: Querschnitt DATENGEWINNUNG:<br />
Qualitatives Interview (Stichprobe: ca. 60; 40 Betriebe). Feldarbeit durch Mitarbeiter/-innen<br />
des Projekts.<br />
ART: Auftragsforschung BEGINN: 2005-04 ENDE: 2006-11 AUFTRAGGEBER: Hans-Böckler-<br />
Stiftung FINANZIERER: Auftraggeber
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 83<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung<br />
INSTITUTION: Büro für Sozialforschung - Kasseler Verein für angewandte Sozialforschung<br />
e.V. (Friedrich-Ebert-Str. 71, 34119 Kassel); Institut für Mittelstandsforschung (Maximilianstr.<br />
20, 53111 Bonn)<br />
KONTAKT: Wassermann, Wolfram (Dr. Tel. 0561-103085-86,<br />
e-mail: wolfram.wassermann@bfs-kassel.de)<br />
[70-L] Schroeder, Wolfgang:<br />
Change and continuity of industrial relations in Central and Eastern Europe, in: Maurizio<br />
Bach, Christian Lahusen, Georg Vobruba (Eds.): Europe in motion : social dynamics and political<br />
institutions in an enlarging Europe, Berlin: Ed. Sigma, 2006, S. 97-117, ISBN: 3-89404-536-1<br />
(Standort: ULB Münster Zweigbibl. für Sozialwiss.(6A)-MK5100/564)<br />
INHALT: Obgleich der Gesamtprozess der europäischen Integration in den letzten zwei Jahrzehnten<br />
erheblich beschleunigt worden ist, bleiben erhebliche Differenzen bei den institutionellen<br />
Strukturen der industriellen Beziehungen. Diese haben sich unter spezifischen nationalen, regionalen<br />
und lokalen Bedingungen entwickelt und es ist daher ein Pfad zur Konvergenz kaum<br />
auszumachen. Weiterhin ist es wenig überraschend, dass sich auch in den mittel- und osteuropäischen<br />
Ländern nach dem Ende des Kommunismus und nach der Osterweiterung von<br />
2004 die unterschiedlichsten arbeitspolitischen Systeme und Formen des kollektiven Verhandelns<br />
entwickelt haben. Der vorliegende Beitrag arbeitet heraus, dass dieser Pluralismus in<br />
den postkommunistischen Ländern weiterhin durch Globalisierung und die Integration in den<br />
Weltmarkt beschleunigt wird. Die Entwicklung geht von einer moderaten Transformationsphase<br />
der sozialistischen Arbeitsbeziehungen über zum "freien Spiel der Kräfte" der Marktgesellschaft,<br />
einem "free collective bargaining" der industriellen Beziehungen und den damit<br />
verbundenen deregulierten Arbeitsbeziehungen. (ICA)<br />
[71-L] Tietel, Erhard:<br />
Wenn die Rolle ins Rollen kommt: Betriebsräte als Grenzgänger zwischen Beschäftigten,<br />
Geschäftsleitung und Gewerkschaft, in: Arbeit und Politik : Mitteilungsblätter der Akademie für<br />
Arbeit und Politik an der Universität Bremen, Jg. 18/2006, Nr. 31/32, S. 6-12<br />
INHALT: Die betrieblichen Arbeitsbeziehungen unterliegen einem umfassenden Wandel. In diesem<br />
Zusammenhang verändern sich auch Funktion, Bedeutung und Rolle des Betriebsrats.<br />
Der Verfasser stellt einen Ansatz vor, der den Betriebsrat in der Dynamik triadisch strukturierter<br />
Interaktionsverhältnisse und polarer Grenzlinien zwischen Geschäftsleitung, Belegschaft<br />
und Gewerkschaft verortet. Auf dieser Basis werden Veränderungstendenzen betrieblicher<br />
Arbeitsbeziehungen skizziert, die neue Managementstrategien, die "neue Selbständigkeit"<br />
in der Arbeit und eine zunehmende Verbetrieblichung der Betriebsratsarbeit betreffen.<br />
Im Zuge dieser Veränderungen rücken Betriebsrat und Belegschaft näher an den Pol der Geschäftsleitung<br />
heran. Der Interessengegensatz von Arbeit und Kapital verliert an Bedeutung<br />
und von den "Grenzgängern" der Betriebsräte wird eine "trianguläre Rollenkompetenz" verlangt.<br />
(ICE2)<br />
[72-F] Universität Osnabrück:<br />
Rüstungskonversion, Alternativproduktion und Gewerkschaften
84 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung<br />
INHALT: keine Angaben<br />
ART: keine Angabe AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Universität Osnabrück, FB Sozialwissenschaften (Seminarstr. 33, 49069 Osnabrück)<br />
KONTAKT: Institution (Tel. 0541-969-0)<br />
[73-F] Voskamp, Ulrich, M.A. (Bearbeitung); Wittke, Volker, Prof.Dr. (Leitung):<br />
Chancen für Hochlohnstandorte in globalen Produktions- und Innovationsnetzwerken der<br />
Elektronikindustrie - das Beispiel der Handy-Branche<br />
INHALT: Das Projekt will einen Beitrag leisten zur Beantwortung der Frage, welche strategischen<br />
Optionen bestehen, um die Zukunft von Fertigungsaktivitäten an Hochlohnstandorten<br />
in Westeuropa zu gestalten. Mit diesem Ziel werden Innovations- und Produktionsnetze europäischer<br />
Unternehmen der High-Tech-Elektronik im Hinblick auf ihre räumliche, organisatorische<br />
und soziale Einbettung untersucht. Produktionsstandorte in Deutschland und anderen<br />
Hochlohnländern stehen in bisher unbekanntem Ausmaß zur Disposition. Von Verlagerung<br />
bedroht sind nicht nur arbeitsintensive Fertigungen von Standardprodukten, sondern zunehmend<br />
auch qualifikatorisch und technologisch anspruchsvolle High-Tech-Fertigungen. Vielfach<br />
scheint es, als sei die Erosion der Fertigungsbasis führender Industrieländer kaum abwendbar,<br />
seit im Zuge der Globalisierung Niedriglohnregionen als Produktionsstandorte<br />
leichter zugänglich und in globale Produktions- und Innovationsnetzwerke integrierbar geworden<br />
sind. Träfe dies tatsächlich für breite Bereiche industrieller High-Tech-Fertigung zu,<br />
wären die einst für diese industriellen Aktivitäten privilegierten Standorte unmittelbar der<br />
Konkurrenz um Löhne, Beschäftigungsbedingungen und Sozialstandards ausgesetzt. Das Projekt<br />
startet mit der Hypothese, dass relevante Fertigungsaktivitäten an Hochlohn-Standorten<br />
eine Perspektive haben können, wenn ihre strategische Bedeutung für die Innovationsfähigkeit<br />
von Unternehmen zur Geltung gebracht wird. Die Innovations- und Produktionsnetze europäischer<br />
Hersteller von High-Tech-Elektronik werden unter folgenden Fragen untersucht:<br />
Wie weit werden Fertigungsaktivitäten "in-house" organisiert, wie ausgeprägt ist das "Outsourcing"<br />
an Kontraktfertiger? Wie weit werden Fertigungs- und Innovationsaktivitäten der<br />
Unternehmen und ihrer Zulieferer an den Heimatstandorten räumlich gebündelt; wie weit<br />
werden sie durch "Offshoring" räumlich entkoppelt? Wie gestalten die Unternehmen ihre<br />
Kooperations- und Kommunikationsbeziehungen über funktionale, Unternehmens- und nationale<br />
Grenzen hinweg? Wie ist die Strategiebildung eingebunden in politisch-institutionelle<br />
Gestaltungsprojekte auf regionaler oder nationaler Ebene? Das Projekt geht dieser Fragestellung<br />
mit Hilfe von kontrastierenden Fallstudien bei europäischen Markenherstellern und Zulieferern<br />
der Handy-Branche nach, wo Innovation und Produktion unter den Bedingungen<br />
kurzer Produktzyklen und "time-to-market", technologisch hoch dynamischer Produktkonzepte<br />
und zunehmend ausdifferenzierter, volatiler Produktmärkte bewältigt werden müssen. Diese<br />
Industrie ist als Untersuchungsfeld auch insofern sehr gut geeignet, weil zum einen in diesem<br />
Feld der High-Tech-Elektronik europäische Unternehmen eine starke Marktposition aufgebaut<br />
haben und zum zweiten konträre Strategien verfolgt werden. Damit lassen sich hier in<br />
einem komparativen Zugriff die Vorzüge und Nachteile sehr unterschiedlicher Gewichtungen<br />
von Fertigungsaktivitäten gut herausarbeiten. Das Projekt ist auf eine Laufzeit von zwei Jahren<br />
angelegt.<br />
ART: gefördert AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: Hans-Böckler-Stiftung
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 85<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung<br />
INSTITUTION: Universität Göttingen, Sozialwissenschaftliche Fakultät, Institut für Soziologie<br />
Lehrstuhl Prof.Dr. Wittke (Platz der Göttinger Sieben 3, 37073 Göttingen)<br />
KONTAKT: Leiter (Tel. 0551-39-7206, e-mail: vwittke@gwdg.de)<br />
[74-L] Weiss, Manfred:<br />
Arbeitnehmermitwirkung: Kernelement des Europäischen Sozialmodells, in: Industrielle<br />
Beziehungen : Zeitschrift für Arbeit, Organisation und Management, Jg. 13/2006, H. 1, S. 5-20<br />
INHALT: "Die Skizze gibt einen Überblick über den bisherigen Beitrag der Europäischen Gemeinschaft<br />
(EG) zur Arbeitnehmermitwirkung bei unternehmerischen Entscheidungen im nationalen<br />
und im transnationalen Bereich. Dabei zeigt sich, dass die EG sich auf ein kooperatives<br />
Modell der Arbeitsbeziehungen festgelegt und gleichzeitig rein antagonistisch-konfliktorisch<br />
ausgerichteten Modellen eine Absage erteilt hat. Die EG-Gesetzgebung zielt nicht auf<br />
institutionelle Uniformität, sondern favorisiert Verfahrensmodelle, die den jeweiligen Akteuren<br />
große Gestaltungsfreiheiten belassen. Arbeitnehmermitwirkung bei unternehmerischen<br />
Entscheidungen ist zu einem wesentlichen Element des europäischen Sozialmodells geworden."<br />
(Autorenreferat)<br />
[75-F] Zellhuber, Brigitte, Dr. (Bearbeitung); Zacher, Johannes, Prof.Dr. (Leitung):<br />
Veränderungsdruck auf tarifliche Beschäftigungsverhältnisse in der Sozialwirtschaft<br />
INHALT: Inhalt der Forschung ist eine explorative Studie zu den Wirkungen von Tarifdiffusion<br />
in der Sozialwirtschaft. Die Aufgabenstellung wird präzisiert in den folgenden Punkten zur<br />
Problemlage, zu den forschungsleitenden Fragestellungen und zum Vorgehen. Die Frage nach<br />
dem Zusammenhang zwischen Leistungsqualität und Einsparzwängen in der Sozialwirtschaft<br />
sind aktuell sehr virulent. Kontext/ Problemlage: Die überwiegende Anzahl der Träger und<br />
Einrichtungen in der Sozialwirtschaft bezahlen ihre Mitarbeiter nach dem BAT oder eng daran<br />
angelehnten Tarifwerken (z.B. AVR Caritas und Diakonie). In den Vergütungsvereinbarungen<br />
soll der Kostendruck der Öffentlichen Hand und der Kassen an die Leistungserbringer<br />
weitergegeben werden. Im Zuge von Entgeltgesprächen werden seitens der Kostenträger Erwartungen<br />
und Anforderungen eingebracht, die nur zu erfüllen sind, wenn von den Tarifverträgen<br />
abgewichen wird. Bei Kosteneinsparungen im Personalbereich wird den BATgebundenen<br />
Trägern der freien Wohlfahrt exemplarisch die Lohnpolitik privater Anbieter<br />
entgegengehalten und als vorteilhaft dargestellt. Aus der aktuellen Situation ergeben sich<br />
zwei Fragebereiche: 1. Worin liegen die wesentlichen Unterschiede zwischen den Entlohnungssystemen?<br />
Als Elemente des Vergleichs interessieren: Abweichungen im Lohnniveau,<br />
insbesondere nach Berufsgruppen, Berücksichtigungschemata von Alter, Familienstand und<br />
Betriebszugehörigkeit; Gestaltung von Regelungen für Zuschläge; soziale Absicherung durch<br />
Zusatzversorgungen, Modelle und Bemessung der Arbeitszeit. 2. Welche Folgewirkungen hat<br />
der Ausstieg aus den BAT-nahen Tarifsystemen? Von Interesse sind hierbei die Auswirkungen<br />
auf die Mitarbeiter, die Betriebsträger aber auch auf die Ausgestaltung und Qualität der<br />
Leistungen. Schlagworte für die Frageformulierungen sind: Motivation, Fluktuation, Qualitätsmanagement,<br />
Personalgewinnung, sozialer Betriebsfrieden, Outsourcing und Insourcing.<br />
GEOGRAPHISCHER RAUM: Ballungsraum München, städtische Region Augsburg, ländliches<br />
Gebiet um Kempten
86 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
2 Industrielle Beziehungen, Macht und Herrschaft, Arbeitspolitik, Mitbestimmung<br />
METHODE: Die Studie hat einen explorativen Charakter. Hierfür steht ein durchaus als repräsentativ<br />
zu bezeichnendes Sample privater Leistungsanbieter der Sozialwirtschaft zur Verfügung.<br />
Es umfasst sowohl Anbieter aus dem Ballungsraum München, aus der städtischen Region<br />
Augsburg als auch aus dem ländlichen Gebiet um Kempten. Die Entlohnungssysteme der privaten<br />
Träger werden vor Ort durch Expertengespräche und Dokumentenanalyse erhoben. Zur<br />
Ermittlung der wichtigsten Unterschiede zu den BAT-nahen Tarifverträgen erfolgt ein Vergleichsverfahren.<br />
Die Studie hat zur Frage der Folgewirkungen den Charakter einer ersten<br />
Problemaufnahme. Mit teilstandardisierten Fragebögen erfolgen Experteninterviews auf Träger-,<br />
Leitungs- und Mitarbeiterebene. Die gewonnenen Daten werden abgeglichen und bewertet.<br />
Aus der Analyse werden Anregungen erwartet, um zukünftige Argumentationen zur<br />
Wechselwirkung zwischen Tarifstruktur und Qualität der sozialen Lage aufzubereiten. DA-<br />
TENGEWINNUNG: Experteninterview, teilstandardisiert; Dokumentenanalyse.<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: keine Angaben ARBEITSPAPIERE: Zacher, J.; Zellhuber, B.:<br />
Veränderungsdruck auf tarifliche Beschäftigungsverhältnisse in der Sozialwirtschaft. Abschlussbericht.<br />
Mai 2005, 37 S.<br />
ART: gefördert AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: Hans-Böckler-Stiftung<br />
INSTITUTION: Fachhochschule Kempten, FB Allgemeinwissenschaften und Betriebswirtschaft<br />
(Postfach 1680, 87406 Kempten)<br />
KONTAKT: Leiter (e-mail: johannes.zacher@fh-kempten.de); Bearbeiterin<br />
(e-mail: gittezellhuber@compuserve.de)<br />
3 Arbeit, Arbeitsorganisation, Rationalisierung, Kontrolle, Humanisierung,<br />
Technologie<br />
[76-L] Baethge-Kinsky, Volker; Tullius, Knut:<br />
Produktionsarbeit und Kompetenzentwicklung in der Automobilindustrie: was geben flexibel<br />
standardisierte Produktionssysteme für den Einsatz qualifizierter Fachkräfte her?, in:<br />
SOFI-Mitteilungen : Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen, 2005, Nr. 33, S. 39-53 (Standort:<br />
USB Köln(38)-XG05472; Kopie über den Literaturdienst erhältlich)<br />
INHALT: Die jüngere Reorganisation der Automobilarbeit mit ihrem normativen Bezug auf flexibel-standardisierte<br />
Produktionssysteme verringert nicht das Niveau der Qualifikationsanforderungen,<br />
verändert die Anforderungsstruktur aber erheblich. Die Bewältigung dieses<br />
Qualifikationswandels gelingt nur dann, wenn neben der Modernisierung traditioneller Aus-<br />
und Weiterbildung die lernförderliche Gestaltung der Betriebs- und Arbeitsorganisation ganz<br />
oben auf der betrieblichen Agenda steht. Hierzu gehören eine Ganzheitlichkeit der Aufgabenstellung,<br />
soziale Einbindung in der Arbeit, Partizipationschancen und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten<br />
im Betrieb. Die Verfasser erläutern diese Thesen anhand von zwei Betriebsfallstudien<br />
aus der Kraftfahrzeugindustrie. Beide untersuchte Betriebe unterliegen in<br />
ähnlicher Weise einer Verschärfung der Markt- und Wettbewerbssituation und haben weitgehend<br />
gleiche Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet. Während ähnliche Veränderungen in<br />
den Anforderungen an Wissen und Kompetenz der Produktionsbeschäftigten auftreten, gibt es<br />
Unterschiede in der Bewertung der Arbeit und in Bezug auf die Möglichkeiten der Kompetenzentfaltung.<br />
In der Kompetenzentwicklung unterscheiden sich beide Betriebe vor allem bei<br />
der lernförderlichen Gestaltung des Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisses. Im Maße die-
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 87<br />
3 Arbeit, (-sorganisation), Rationalisierung, Kontrolle, Humanisierung, Technologie<br />
ser Unterschiede differiert auch das Ausmaß, in dem die Mitarbeiter ihre wesentlichen Ansprüche<br />
an Arbeit eingelöst sehen. (ICE2)<br />
[77-F] Bannert, Kurt (Bearbeitung); Stagel, Wolfgang, Dr. (Leitung):<br />
Atypische Beschäftigungsformen: DienstgeberInnen von geringfügig Beschäftigten und freie<br />
DienstnehmerInnen<br />
INHALT: Bewertung der in Österreich von 1996 bis 1998 durchgeführten sozialrechtlichen Reformen,<br />
die sich auf die Einbeziehung geringfügig Beschäftigter mit freien Dienstverträgen in<br />
die Sozialversicherung bezogen. Das Projekt bezieht sich insbesondere auf die Reaktionsweisen<br />
der Dienstgeber auf die genannten gesetzlichen Veränderungen. ZEITRAUM: 1996-1999<br />
GEOGRAPHISCHER RAUM: Österreich<br />
METHODE: sekundärstatistische Auswertung von Daten der Sozialversicherungsträger; eigene<br />
schriftliche und mündliche Erhebungen (Fragebogen/ Interviews) DATENGEWINNUNG:<br />
Qualitatives Interview (Stichprobe: 12; Betriebsräte in Betrieben mit freien Dienstverträgen;<br />
Auswahlverfahren: willkürlich). Standardisierte Befragung (Stichprobe: 10.000; Dienstgeber<br />
geringfügig Beschäftigter und freie DienstnehmerInnen; Auswahlverfahren: Quota). Sekundäranalyse<br />
von Individualdaten (Dienstgeber geringfügig Beschäftigter und freier DienstnehmerInnen<br />
in Österreich; Auswahlverfahren: total). Feldarbeit durch Mitarbeiter/-innen des<br />
Projekts.<br />
ART: Auftragsforschung BEGINN: 1999-12 ENDE: 2003-03 AUFTRAGGEBER: Bundesministerium<br />
für Wirtschaft und Arbeit FINANZIERER: Institution; Auftraggeber<br />
INSTITUTION: ISW - Institut für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (Weingartshofstr. 10,<br />
4020 Linz, Österreich)<br />
KONTAKT: Leiter (Tel. 0732-669273-3322, Fax. -2889, e-mail: stagel.w@ak-ooe.at)<br />
[78-F] Fachinger, Uwe, PD Dr. (Leitung):<br />
Struktureller Wandel der Erwerbstätigkeit und selbständige Erwerbsarbeit<br />
INHALT: In der Bundesrepublik Deutschland vollzieht sich ein erwerbstruktureller Wandel, der<br />
gekennzeichnet ist von einer Zunahme selbständig Erwerbstätiger und getragen wird von sich<br />
ändernden gesellschaftlichen, ökonomischen und sozialen Bedingungen. Um über die Entwicklung<br />
im Bereich der selbständigen Erwerbstätigkeit weitere Anhaltspunkte zu gewinnen,<br />
werden insbesondere anhand von Scientific Use Files der Mikrozensen aus den Jahren 1989,<br />
1991, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998 und 2000 Zeitverlaufsanalysen durchgeführt. Die Fragen,<br />
denen in dem Projekt nachgegangen wird, sind: In welchen Berufsbereichen bzw. Wirtschaftssektoren<br />
kam es zu signifikanten Veränderungen bei den selbständig Erwerbstätigen?<br />
Hat sich die Entwicklung selbständiger Erwerbstätigkeit in West- und Ostdeutschland anders<br />
vollzogen? Gab es eine geschlechtsspezifische Entwicklung? Ist es zu einer Veränderung der<br />
Zahl der abhängig Beschäftigten bei selbständig Erwerbstätigen gekommen? Ein Hauptaugenmerk<br />
gilt den geschlechtsspezifischen Differenzierungen hinsichtlich einer selbständigen<br />
Tätigkeit. Einige Indizien weisen daraufhin, dass Zahl und Anteil der selbständigen Frauen<br />
durch den Wandel in der Arbeitswelt und die dadurch neu entstehenden Formen und Felder<br />
der Erwerbstätigkeit zunehmen. Aus diesem Grunde werden diese Entwicklungen und speziell<br />
die Wirtschaftsbereiche, in denen Frauen selbständig werden, im Rahmen des Beitrags<br />
gesondert berücksichtigt. GEOGRAPHISCHER RAUM: Bundesrepublik Deutschland
88 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
3 Arbeit, (-sorganisation), Rationalisierung, Kontrolle, Humanisierung, Technologie<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: Bögenhold, Dieter; Fachinger, Uwe: Struktureller Wandel der<br />
Erwerbstätigkeit: Was ist Fakt, was ist Fiktion bei der Entwicklung selbständiger Erwerbsarbeit?<br />
Analysen auf der Grundlage der Scientific Use Files der Mikrozensen. Mannheim: Zentrum<br />
für Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA) 2003. Verfügbar über World Wide<br />
Web:<br />
http://www.gesis.org/Dauerbeobachtung/Mikrodaten/documents/Veranstaltungen/Nutzerkonf<br />
erenz2003/paper/text_boegenhold_fachinger.pdf .<br />
ART: Eigenprojekt BEGINN: 1999-01 AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER: nein<br />
INSTITUTION: Universität Bremen, Zentrum für Sozialpolitik (Postfach 330440, 28334 Bremen)<br />
[79-F] Flecker, Jörg, Dr.; Hermann, Christoph; Vogt, Marion (Bearbeitung):<br />
Arbeitsbedingungen im Straßengütertransport und im Hotel- und Gastgewerbe<br />
INHALT: Die Europäische Stiftung zur Verbesserung von Lebens- und Arbeitsbedingungen in<br />
Dublin führt seit 1990 europaweite Umfragen zu Arbeitsbedingungen in den EU-<br />
Mitgliedstaaten durch. Bei der letzten Umfrage im Jahr 2000 stachen die Bereiche Straßengütertransport<br />
und Hotel- und Gastgewerbe als Sektoren mit besonders ungünstigen Arbeitsbedingungen<br />
heraus. Um die Probleme in den Mitgliedsländern besser einschätzen zu können,<br />
hat die Stiftung weiterführende Studien über die jeweilige nationale Situation in Auftrag gegeben.<br />
FORBA hat den Österreichteil übernommen. Neben der Suche nach Datenmaterial<br />
und der Beschreibung der rechtlichen und kollektivvertraglichen Rahmenbedingungen wurden<br />
auch VertreterInnen der Sozialpartner und andere relevante Akteure interviewt und nach<br />
Verbesserungsvorschlägen gefragt. Die nationalen Berichte für die beiden Sektoren werden<br />
zu zwei europäischen Berichten (Straßengütertransport, Hotel- und Gastgewerbe) zusammengefasst<br />
und von der Stiftung publiziert. Weitere Kooperationspartner des Projekts: PREVENT<br />
vzw, Brüssel, Belgien; TNO Arbeid, Hoofddorp, Niederlande; Ergonomia SA, Nea Ionia,<br />
Griechenland; Oxford Research A/S, Kopenhagen, Dänemark. GEOGRAPHISCHER RAUM:<br />
Europa<br />
ART: Auftragsforschung BEGINN: 2002-07 ENDE: 2003-04 AUFTRAGGEBER: European<br />
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions FINANZIERER: Auftraggeber<br />
INSTITUTION: Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt -FORBA- (Aspernbrückengasse 4,<br />
5, 1020 Wien, Österreich); University of Manchester, Institute of Science and Technology -<br />
UMIST- (P.O. Box 88, M6O 1QD Manchester, Vereinigtes Königreich)<br />
KONTAKT: FORBA (Tel. +43-1-2124700; Fax: +043-1-212470077, e-mail: office@fobra.at)<br />
[80-F] Flecker, Jörg, Dr.; Krenn, Manfred, Mag. (Bearbeitung):<br />
Die Informationstechnische Revolution - Fortschritte und Rückschritte für die Arbeit. Zum<br />
Zusammenhang von Informations- und Kommunikationstechnologien und neuen Formen<br />
der Arbeitsorganisation<br />
INHALT: Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) sowie neue Formen der Arbeitsorganisation<br />
haben die Arbeitswelt in den letzten Jahrzehnten stark verändert. In dieser<br />
Arbeit wurde der Frage nachgegangen, wie sich diese beiden Hauptmotoren für Veränderungsprozesse<br />
gegenseitig verschränken und welche Auswirkungen sich daraus für die Ges-
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 89<br />
3 Arbeit, (-sorganisation), Rationalisierung, Kontrolle, Humanisierung, Technologie<br />
taltung von Arbeit ergeben. Diese zentrale Fragestellung wurde entlang der Themenfelder<br />
Arbeitsteilung, räumliche Aspekte, Kooperation und Arbeitszeit behandelt. Die Behandlung<br />
dieser quer liegenden Themenfelder wurde für bestimmte Sektoren konkretisiert, wobei sich<br />
die Arbeit auf die Branchen IT-Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen und industrielle<br />
Produktion konzentrierten. Die grundlegenden Tendenzen und inhaltlichen Aspekte wurden<br />
abschließend in Thesenform resümiert.<br />
ART: Auftragsforschung BEGINN: 2002-07 ENDE: 2003-02 AUFTRAGGEBER: Kammer für<br />
Arbeiter und Angestellte für Wien FINANZIERER: Auftraggeber<br />
INSTITUTION: Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt -FORBA- (Aspernbrückengasse 4,<br />
5, 1020 Wien, Österreich)<br />
KONTAKT: Institution (Tel. +43-1-2124700; Fax: +043-1-212470077, e-mail: office@fobra.at)<br />
[81-L] Fürstenberg, Friedrich:<br />
Kooperative Arbeitsorganisation: Innovationspotenziale und Zukunftsperspektiven, München:<br />
Hampp 2005, 224 S., ISBN: 3-87988-917-1 (Standort: UuStB Köln(38)-32A2687)<br />
INHALT: Ziel des Verfassers ist es, aufgrund vorliegender sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse<br />
ein Bild der Arbeitsorganisation zu vermitteln, das weder der hierarchischen Kommando- und<br />
Kontrollpyramide, noch der Vorstellung vom systemischen Regelkreis, noch der vernetzten<br />
Zweckallianz monomaner Profitjäger entspricht. Drei Thesen sind zentral: (1) Grundlage des<br />
Erfolgs von Arbeitsorganisationen ist die zielorientierte Zusammenarbeit. (2) Sie erfordert<br />
ständig einen wechselseitigen Ausgleich von Sacherfordernissen und Interessenlagen. (3) Zukunftsweisend<br />
hierbei ist die Förderung der Beteiligten durch Kompetenzvermittlung und<br />
verantwortungsvolle Mitwirkung. Nach Ansicht des Verfassers sind Arbeitsorganisationen<br />
nicht nur als selbstreferenzielle, beliebig optimierbare Systemwelten zu verstehen, sondern<br />
auch als kulturgebundene Sozialformen, die nicht allein Ergebnis zweckrationalen Kalküls<br />
sind. Der Verfasser entwickelt Grundlagen für eine die zielorientierte Zusammenarbeit sichernde<br />
Organisationsentwicklung, wobei die Strukturierung der Arbeitsorganisation als soziales<br />
Spannungsfeld den Ausgangspunkt bildet. Sacherfordernisse sind in Einklang mit Interessenlagen<br />
zu bringen, Flexibilisierungs- mit Netzwerkstrategien zu verknüpfen. Hauptthemen<br />
für die Entwicklung strategischer Konzepte sind die Sicherung der Leistungsmotivation,<br />
die Herstellung von Handlungskompetenz und die Förderung der Kooperation. Organisations-<br />
Modernisierung wird als kooperativer Lernprozess verstanden. (ICE2)<br />
[82-L] Götzenbrucker, Gerit:<br />
Soziale Netzwerke in Unternehmen: Potenziale computergestützter Kommunikation in Arbeitsprozessen,<br />
(DUV Kommunikationswissenschaft), Wiesbaden: Dt. Univ.-Verl. 2005, XVIII,<br />
303 S., ISBN: 3-8350-6009-0<br />
INHALT: "Kooperationen in Unternehmen sind maßgeblich an Kommunikationsprozesse gekoppelt.<br />
Soziale Netzwerke, eine nicht an die formale Organisation gebundene Form interner und<br />
externer Vernetzung, bieten eine potenzielle Basis zur Zusammenarbeit. Neue Informations-<br />
und Kommunikationstechnologien wie E-Mail haben sich in den vergangenen Jahren zu unentbehrlichen<br />
Koordinations- und Kommunikationsinstrumenten - insbesondere auch in<br />
Teamarbeitsprozessen - entwickelt. Anhand einer Strukturanalyse der elektronischen Kommunikation<br />
von vier Arbeitsteams in einem IT-Unternehmen untersucht der Autor die Poten-
90 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
3 Arbeit, (-sorganisation), Rationalisierung, Kontrolle, Humanisierung, Technologie<br />
ziale computergestützter sozialer Netzwerke. Sie zeigt, dass sich im elektronischen Raum alternative<br />
Kommunikationskulturen entwickeln und dass sich daraus Machtverschiebungen<br />
ergeben. Es wird außerdem deutlich, dass technisch vermittelte Kommunikation Sozialbeziehungen<br />
verändert bzw. kreiert, die wiederum auf die konkreten Ausprägungen des Mediums<br />
zurückwirken." (Autorenreferat)<br />
[83-L] Haipeter, Thomas; Lehndorff, Steffen:<br />
Flexibilisierung und Dezentralisierung der Arbeitszeitregulierung in der deutschen Automobilindustrie,<br />
in: Ludger Pries, Markus Hertwig (Hg.): Deutsche Autoproduktion im globalen<br />
Wandel : Altindustrie im Rückwärtsgang oder Hightech-Branche mit Zukunft?, Berlin: Ed. Sigma,<br />
2005, 105-123, ISBN: 3-89404-530-2<br />
INHALT: Die kostengünstige Flexibilisierung der Arbeitszeit spielt zunehmend eine besondere<br />
Rolle, da sie zum zentralen Faktor der Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens wird. Die<br />
Autoren untersuchen die Auswirkungen dieser Entwicklung auf die Arbeitszeitregulierungen<br />
in deutschen Automobilunternehmen und stellen dabei Fragen nach den Einflusschancen von<br />
Betriebsräten und Gewerkschaften: Tragen die Verbetrieblichung und Öffnung der kollektivvertraglichen<br />
Arbeitszeitregulierung zu einer Erosion der Tarifnormen bei? Oder erweisen<br />
sich diese Normen trotz oder vielleicht auch wegen des wachsenden Betriebsbezugs als stabil?<br />
Und welche Rolle spielen dabei die Betriebsräte als zentrale Akteure der Verbetrieblichung?<br />
Die Autoren führten zu diesen Fragen eine von der Tarifabteilung der IG Metall in<br />
Auftrag gegebene Untersuchung zu den Trends und Problemen der Arbeitszeitregulierung aller<br />
in Deutschland produzierenden Automobilunternehmen durch, deren Hauptergebnisse sie<br />
kurz vorstellen. Sie stellen insgesamt einen Paradigmenwechsel fest, denn die neuen Regulierungsformen<br />
enthalten Mitbestimmungsoptionen, die den Betriebsräten zusätzliche Einflusschancen<br />
eröffnen. Die bestehenden tarifvertraglichen Regelungen besitzen zwar weiterhin eine<br />
hohe Strukturierungskraft, aber es zeigen sich - durch die primär im Bereich der Verwaltung<br />
zu findenden Tendenzen einzelvertraglicher Arbeitszeitverlängerung - Ansätze zu einer<br />
Erosion tariflicher Arbeitszeitnormen. (ICI2)<br />
[84-L] Hennlein, Svenja; Jöns, Ingela:<br />
Kompetenzentwicklung von Arbeitsgruppen durch Teamfeedback, in: Arbeit : Zeitschrift für<br />
Arbeitsforschung, Arbeitsgestaltung und Arbeitspolitik, Jg. 15/2006, H. 1, S. 29-42 (Standort:<br />
USB Köln(38)-XG07322; Kopie über den Literaturdienst erhältlich)<br />
INHALT: "Auf Basis der Ergebnisse einer längsschnittlich angelegten Studie in einem Unternehmen<br />
der Stahlverarbeitung mit 71 Arbeitsgruppen werden Bedingungen der Entwicklung<br />
von Gruppenkompetenz durch Teamfeedback analysiert. Es wurde untersucht, ob Gruppen<br />
das Teamfeedback zum Ableiten von Maßnahmen nutzen und in welchen Fällen eine Kompetenzentwicklung<br />
daraus resultiert. Die Ergebnisse belegen, dass die von den Gruppen subjektiv<br />
wahrgenommene Übereinstimmung von aufgrund des Feedbacks getroffenen Maßnahmen<br />
und Problemfeldern der Gruppe von großer Bedeutung ist. Außerdem spielt gerade für Gruppen,<br />
die in ihrer Gruppenkompetenz nach eigener Einschätzung noch nicht weit entwickelt<br />
sind, die Überprüfung der Maßnahmenumsetzung eine bedeutende Rolle. Gleichfalls haben<br />
Gruppenmerkmale wie Rotation in der Ausführung der Tätigkeiten innerhalb der Gruppe und<br />
Bestandszeit der Gruppe Einfluss auf die Entwicklung der Gruppen." (Autorenreferat)
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 91<br />
3 Arbeit, (-sorganisation), Rationalisierung, Kontrolle, Humanisierung, Technologie<br />
[85-F] Kirschenhofer, Sabine, Mag.; Riesenecker-Caba, Thomas, Mag.; Stary, Christian, Univ.-<br />
Prof.Dr. (Bearbeitung); Flecker, Jörg, Dr. (Leitung):<br />
Verlagerung der Arbeit in der globalen Wirtschaft auf Basis neuer Kommunikationstechnologien<br />
INHALT: Zielsetzung des Projekts ist die Erfassung und Analyse von transnationaler Verlagerung<br />
von Arbeit auf der Grundlage von Informations- und Kommunikationstechnologien, der<br />
Beschäftigungswirkungen sowie der Auswirkungen auf bzw. Anforderungen an Betriebsstrukturen<br />
und ArbeitnehmerInnen. Es werden quantitative Erhebungen zur transnationalen<br />
Verlagerung wissensbasierter Arbeit sowie qualitative (Betriebs-)Fallstudien über Faktoren<br />
und Rahmenbedingungen der Ortswahl in 22 Ländern durchgeführt. Innerhalb des internationalen<br />
Konsortiums übernimmt FORBA die Koordination der Fallstudien in allen Ländern<br />
sowie die inhaltlichen Schwerpunkte Arbeitsbedingungen und -beziehungen, arbeitsmarktpolitische<br />
Aspekte, Qualifikationsanforderungen sowie neue Chancen bzw. Risiken (hinsichtlich<br />
Arbeitsteilung und Beschäftigung) für Frauen. Projekt in Zusammenarbeit mit dem Danish<br />
Technology Institute Aarhus (Dänemark), dem Institute for Management of Innovation and<br />
Technology Stockholm (Schweden) und der Edith Cowan University Pearth (Australien). (Information<br />
unter http://www.emergence.nu ).<br />
METHODE: Analyse von statistischem Material; quantitative Erhebung (Fragebogen) international;<br />
qualitative Betriebsfallstudien international<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: keine Angaben ARBEITSPAPIERE: Flecker, J.; Kirschenhofer, S.:<br />
The EMERGENCE company case studies report. 2001.<br />
ART: Auftragsforschung BEGINN: 2000-03 ENDE: 2003-03 AUFTRAGGEBER: Europäische<br />
Kommission; Europäische Union; Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur<br />
FINANZIERER: Auftraggeber; Programm "Information Society Technologies -IST-"<br />
INSTITUTION: Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt -FORBA- (Aspernbrückengasse 4,<br />
5, 1020 Wien, Österreich); Instituto di Ricerche Economiche e Sociali (Via di Santa Teresa,<br />
23, 00198 Rom, Italien); Simon Frazer University Vancouver (P.O., V5A1S6 Vancouver,<br />
Kanada)<br />
KONTAKT: Leiter (Tel. 01-2124700-72, Fax. -77, e-mail: flecker@forba.at)<br />
[86-L] Krenn, Manfred; Flecker, Jörg; Eichmann, Hubert; Hermann, Christoph; Papouschek,<br />
Ulrike:<br />
Partizipation oder Delegation von Unsicherheit?: Partizipationschancen in entgrenzten Arbeitsfeldern<br />
- IT-Dienstleistungen und mobile Pflege, (FORBA-Forschungsbericht, 4/2005),<br />
Wien 2005, 59 S. (Graue Literatur; URL:<br />
http://www.forba.at/files/download/download.php?_mmc=czo2OiJpZD0xNDYiOw==)<br />
INHALT: "Ziel des Forschungsprojekts war es, die Partizipationschancen verschiedener Gruppen<br />
von Beschäftigten unter den Bedingungen 'entgrenzter' Arbeit zu analysieren. Hintergrund der<br />
Fragestellung ist der Trend zu einer Entstandardisierung der Erwerbsarbeit: Zeitliche, räumliche,<br />
vertragliche und organisatorische Aspekte und Bezüge der Arbeit werden vielfach aus<br />
den industriegesellschaftlichen Normen bzw. Normvorstellungen herausgelöst. Damit verändern<br />
sich aber auch die Voraussetzungen für die Teilhabe an Entscheidungen über die Bedingungen<br />
der eigenen Arbeit. Partizipation bezieht sich dabei zum einen auf die im Rahmen<br />
neuer Managementkonzepte gewährte oder gewünschte Beteiligung der Arbeitskräfte, zum<br />
anderen auf den gesellschaftspolitischen Anspruch an Demokratisierung der Arbeitswelt. Un-
92 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
3 Arbeit, (-sorganisation), Rationalisierung, Kontrolle, Humanisierung, Technologie<br />
tersuchungsgegenstand waren Arbeitsformen in zwei Dienstleistungsbranchen: den IT-<br />
Dienstleistungen und den sozialen Diensten, insbesondere der mobilen Pflege. Diese Arbeitsfelder<br />
wurden nicht nur wegen ihrer quantitativen Bedeutung ausgewählt, sondern auch wegen<br />
der ausgeprägten Tendenzen zur Entgrenzung von Arbeit. Im Rahmen der Untersuchung<br />
wurden neun Fallstudien in Unternehmen bzw. Organisationen durchgeführt, die insgesamt<br />
über 70 problemzentrierte Interviews umfassten. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die<br />
Möglichkeit, die eigene Arbeit gestalten und sich als Person in die Arbeit einbringen zu können,<br />
für die PflegerInnen wie für die IT-Fachkräfte gleichermaßen eine wichtige Grundlage<br />
ihrer Arbeitsidentität und der Zufriedenheit mit ihrem Beruf darstellt. Allerdings können die<br />
Beschäftigten unter dem wachsenden Druck zur Kostensenkung, dem sie in beiden Branchen<br />
ausgesetzt sind, diese arbeitsinhaltlichen Ansprüche immer weniger realisieren. Methoden des<br />
partizipativen Management werden kaum systematisch angewandt. Im Rahmen einer solchen<br />
konsultativen Einbeziehung gibt es auch nur geringe Chancen für die Beschäftigten, Einfluss<br />
auf die zeitlichen, ökonomischen und organisatorischen Rahmenbedingungen ihrer Arbeit zu<br />
nehmen. Den mangelnden individuellen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen kann auch die<br />
Interessenvertretung durch den Betriebsrat nicht wettmachen, so ein solcher überhaupt eingerichtet<br />
ist. Die äußeren Rahmenbedingungen, wie knappe Budgets, verschärfte Konkurrenz<br />
oder häufige Umstrukturierungen, erschweren eine Durchsetzung von Arbeitnehmerinteressen.<br />
Diese Rahmenbedingungen bewirken auch, dass Chancen zur Selbstorganisation in der<br />
Arbeit häufig nicht zu einer Demokratisierung der Arbeitswelt beitragen, sondern bloß eine<br />
Delegation von Unsicherheit oder Selbstorganisation von Überlastung bedeuten. Unter der<br />
Bedingung räumlich und zeitlich 'entgrenzter' Arbeit nehmen die Partizipationschancen weiter<br />
ab, weil Kommunikationsmöglichkeiten und sozialer Zusammenhalt sowie Zeit und Energie<br />
für politisches Engagement fehlen. Betriebsräte können jedoch die Voraussetzungen für<br />
individuelle Partizipationschancen verbessern." (Autorenreferat)<br />
[87-L] Kurz-Scherf, Ingrid; Baatz, Dagmar; Correll, Lena; Janczyk, Stefanie; Lepperhoff, Julia;<br />
Lieb, Anja; Müller, Annette; Rudolph, Clarissa; Satilmis, Ayla; Scheele, Alexandra:<br />
Die Zukunft der Arbeit innovativ mitgestalten, (Discussion Papers / GendA - Netzwerk Feministische<br />
Arbeitsforschung, 18), Marburg 2005, 68 S. (Graue Literatur; URL: http://www.unimarburg.de/fb03/genda/publ/dispaps/dispap_18-2005.pdf)<br />
INHALT: "Seit geraumer Zeit beherrscht die grundlegende Transformation der Arbeit, des Arbeitssystems<br />
und der Arbeitsorganisation moderner Gesellschaften und ihrer Arbeitskultur<br />
zentrale wissenschaftliche und öffentliche Debatten. Diese Debatten zeichnen sich allerdings<br />
immer noch durch eine weitgehend fehlende geschlechtssensible Perspektive aus. Nach wie<br />
vor basieren die Forschungen oftmals auf androzentrischen Grundlagen, die unhinterfragt<br />
bleiben, oder aber die Geschlechterperspektive wird nur unzureichend integriert. Auf diese<br />
Weise wird jedoch der Blick auf bestimmte Probleme und Schieflagen des Wandels der Arbeit<br />
und damit auch der Weg für eine zukunftsfähige Arbeitsforschung verstellt. Das Projekt<br />
GendA - Netzwerk feministische Arbeitsforschung hat im Rahmen des BMBF-geförderten<br />
Projektsverbunds "Zukunftsfähige Arbeitsforschung" an der Konturierung genderkompetenter<br />
Perspektiven auf die Transformationsprozesse von Arbeit und ihre Folgen geforscht, vernetzt,<br />
diskutiert, weiterentwickelt und deren Integration in Arbeitsforschung, Arbeitspolitik und Arbeitsgestaltung<br />
vorangetrieben - und zwar in einem großen Netzwerk feministischer, genderorientierter<br />
WissenschaftlerInnen und PraktikerInnen und im Dialog mit VertreterInnen zukunftsorientierter<br />
Arbeitsforschung. Es sollte aufgezeigt werden, wo es einer grundlegenden
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 93<br />
3 Arbeit, (-sorganisation), Rationalisierung, Kontrolle, Humanisierung, Technologie<br />
Re-Konstruktion und einer Re-Vision des Gegenstandbereiches der Arbeitsforschung, des ihr<br />
zugrunde liegenden Arbeitsbegriffs, ihrer Fragestellungen und ihrer Methodologie bedarf und<br />
wie diese aussehen könnten. Ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit war der Transfer zwischen<br />
Wissenschaft und Öffentlichkeit und zwischen Wissenschaft und Praxis. In dem vorliegenden<br />
Discussion Paper werden nun nochmals die Anlage und Konzeption des Projekts, die<br />
Umsetzung der Ziele und Ideen und daraus resultierende Ergebnisse, die offenen Fragen und<br />
möglichen Perspektiven des Projekts zusammengefasst und vorgestellt." (Autorenreferat)<br />
[88-L] Latniak, Erich:<br />
Auf der Suche nach Verteilungs- und Gestaltungsspielräumen: eine Bilanz der Organisationsveränderungen<br />
seit den 90er Jahren, in: Steffen Lehndorff (Hrsg.): Das Politische in der<br />
Arbeitspolitik : Ansatzpunkte für eine nachhaltige Arbeits- und Arbeitszeitgestaltung, Berlin: Ed.<br />
Sigma, 2006, S. 33-70, ISBN: 3-89404-534-5<br />
INHALT: Gewohnte Annahmen und Leitbilder der Arbeitspolitik sind in Frage gestellt. Als dominierendes<br />
Modell der Organisationsänderung identifiziert der vorliegende Beitrag eine hybride<br />
deutsche Variante der "lean production" mit einer geschäftsprozessbezogenen Kundenorientierung<br />
und hohem Stellenwert der Qualitätssicherung. Im Zentrum der Erhöhung der internen<br />
Flexibilität stehen nicht so sehr avancierte organisatorische Maßnahmen, sondern eher<br />
die Nutzung individueller Kompetenz. Vor diesem Hintergrund führt Dezentralisierung in<br />
erster Linie zur Aufgabenverdichtung in den operativen Bereichen, ohne dass den Beschäftigten<br />
die für die Lösung der ihnen übertragenen Probleme erforderlichen Ressourcen in ausreichendem<br />
Maße zur Verfügung stehen. Nachhaltige Arbeitsgestaltung kann für den Autor am<br />
ehesten erreicht werden durch die Organisation von Selbstverständigungsprozessen unter den<br />
Beschäftigten, anknüpfend an den Konflikten im Arbeitsalltag der industriellen Beziehungen,<br />
da Arbeitspolitik stets auch Interessenhandeln ist. (ICA2)<br />
[89-L] Linne, Gundrun (Hrsg.):<br />
Flexibel arbeiten - flexibel leben?: die Auswirkungen flexibler Arbeitszeiten auf Erwerbschancen,<br />
Arbeits- und Lebensbedingungen, Düsseldorf 2002, 60 S. (Graue Literatur; URL:<br />
http://www.boeckler.de/pdf/p_flexibel_arbeiten.pdf)<br />
INHALT: Die von betrieblicher Seite forcierte Flexibilisierung der Arbeitszeiten zählt zu den<br />
wesentlichen Weichenstellungen der aktuellen Arbeitspolitik. Es wird ein Überblick über das<br />
für Arbeitswelt und Forschung gleichermaßen wichtige Thema 'Arbeitszeitflexibilisierung'<br />
gegeben. Zunächst werden die Motive geschildert, die hinter der Forderung nach Flexibilisierung<br />
der Arbeitszeiten stehen. Danach wird aufgezeigt, unter welchen Voraussetzungen flexible<br />
Arbeitszeiten beschäftigungssichernde oder -fördernde Wirkungen haben. Es wird beleuchtet,<br />
wie sich Arbeitsbedingungen, die Organisation der Arbeit und die Einflusschancen<br />
der Interessenvertretungen bei Einführung flexibler Arbeitszeitsysteme verändern können.<br />
Dabei wird deutlich, dass die Gestaltung der Arbeitszeit erhebliche Rückwirkungen auf die<br />
persönliche Lebensführung und auf Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens hat. Die<br />
Chancen auf eine Gleichstellung der Geschlechter, auf sozialen Zusammenhalt, auf ein<br />
selbstbestimmtes Leben und auf einen schonenden Umgang mit unserer Umwelt sind eng mit<br />
Fragen der zeitlichen Organisation der Erwerbsarbeit verknüpft. Die Arbeitszeitpolitik er-
94 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
3 Arbeit, (-sorganisation), Rationalisierung, Kontrolle, Humanisierung, Technologie<br />
weist sich somit als ein entscheidendes Scharnier zwischen Betriebs- und Gesellschaftspolitik.<br />
(IAB)<br />
[90-L] Mayer-Ahuja, Nicole; Wolf, Harald:<br />
Arbeit am Netz: Formen der Selbst- und Fremdbindung bei Internetdienstleistern, in: Nicole<br />
Mayer-Ahuja, Harald Wolf (Hrsg.): Entfesselte Arbeit - neue Bindungen : Grenzen der Entgrenzung<br />
in der Medien- und Kulturindustrie, Berlin: Ed. Sigma, 2005, S. 61-108, ISBN: 3-89404-535-<br />
3<br />
INHALT: Der Aufsatz befasst sich mit der empirischen Ausleuchtung des Bindungsbegriffs im<br />
Bereich der Arbeitswelt Neue Medien und Kulturindustrie. Es werden Ergebnisse des arbeitssoziologischen<br />
Teilprojekts "Varianten von Autonomie und Bindung bei Wissensarbeit" dargestellt,<br />
mit dem Schwerpunkt auf dem Wechselspiel und den Widersprüchen zwischen Formen<br />
der Fremd- und Selbstbindung, die sich in der betrieblichen Arbeitsorganisation bei Internetdienstleistern<br />
ergeben. Als Methode wird der Fallstudienansatz gewählt. Wesentliches<br />
Ergebnis ist, dass die Tätigkeit von Internetdienstleistern zunehmend Züge eines normalen<br />
Berufs annimmt, wobei fremdbestimmte Formen der Bindung von Arbeit und der Bindung an<br />
Arbeit gegenüber selbst bestimmten Bindungsformen an Bedeutung gewinnen. Es ist daher<br />
nicht verwunderlich, dass die Arbeitsidentität hoch qualifizierter Angestellter bei Internetdienstleistern<br />
stärker als früher durch eine Arbeitskraft-Mentalität geprägt ist, die vor allem<br />
auf den günstigen Verkauf und langfristigen Erhalt von Arbeitskraft setzt. (ICF)<br />
[91-F] Moers, Martin, Prof.Dr.phil. (Leitung):<br />
Strategien der Implemation von Innovationen in den Arbeitsprozess der Pflege in Krankenhäusern<br />
INHALT: keine Angaben<br />
ART: keine Angabe AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Fachhochschule Osnabrück, Fak. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Postfach<br />
1940, 49009 Osnabrück)<br />
KONTAKT: Leiter (Tel. 0541-969-3008, Fax: 0541-969-2989,<br />
e-mail: moers@wi.fh-osnabrück.de)<br />
[92-F] Nölle, Kerstin, Dipl.-Soz.Wiss.; Ciesinger, Kurt-Georg, Dipl.-Psych.; Hafkesbrink, Joachim,<br />
Dr. (Bearbeitung); Neuendorff, Hartmut, Prof.Dr.; Klatt, Rüdiger, Dr. (Leitung):<br />
NErVUM - Neue Erwerbsbiografien in virtuellen Unternehmen der Medienindustrie. Chancen<br />
für menschengerechte und beschäftigungswirksame Karrieren<br />
INHALT: Um die menschengerechte Gestaltung brüchiger Erwerbsbiografien zu unterstützen,<br />
fördert der Projektträger Arbeitsgestaltung und Dienstleistungen im Auftrag des BMBF das<br />
Projekt NErVUM ("Neue Erwerbsbiografien in virtuellen Unternehmen der Medienindustrie").<br />
Ziel von NErVUM ist es, menschengerechte und mitarbeiterorientierte Integrationsmodelle<br />
für externe Beschäftigte in virtuellen Unternehmen zu erarbeiten; verschiedene Erwerbsformen<br />
als sich ergänzende Optionen innerhalb des Erwerbslebens zu definieren; rechtzeitige<br />
Vorbereitung neuer Karriereoptionen; Antizipation biographisch bedingter Leistungs-
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 95<br />
3 Arbeit, (-sorganisation), Rationalisierung, Kontrolle, Humanisierung, Technologie<br />
wandlungen, Steuerung dieser durch vorbereitende Maßnahmen; Übernahme neuer Aufgabenkomplexe,<br />
Kombination von vorhandenen und neu zu erwerbender Kompetenzen: Erhaltung<br />
und Stabilisierung von Arbeitsverhältnissen.<br />
METHODE: Um dem selbst gesteckten Ziel eines hohen Praxisbezugs gerecht zu werden, kommt<br />
im Rahmen von NErVUM ein breiter Methodenmix zum Einsatz. Hierzu gehören narrative<br />
Interviews, Onlinebefragung, Entwicklung und Erprobung eines Frühwarnsystems sowie<br />
Transfer und Dialog. Untersuchungsdesign: Querschnitt DATENGEWINNUNG: Inhaltsanalyse,<br />
offen; Aktenanalyse, offen; Standardisierte Befragung, online. Sekundäranalyse von Individualdaten.<br />
Feldarbeit durch Mitarbeiter/-innen des Projekts.<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: Heinze, R.G.; Olimann, R.: Employability in diskontinuierlichen<br />
Erwerbsbiografien - Implikationen für die Arbeits- und Wirtschaftspolitik. in: Neuendorff, H.;<br />
Ott, B. (Hrsg.): Neue Erwerbsbiografie - berufsbiografische Diskontinuitat. Stuttgart: Schneider<br />
2006 (im Druck).+++Benikowski, B.: Diskontinuierliches Lernen. Die Bedeutung von<br />
Krisen für Weiterbildung und Qualifizierung. in: Neuendorff, H.; Ott, B. (Hrsg.): Neue Erwerbsbiografie<br />
- berufsbiografische Diskontinuität. Stuttgart: Schneider 2006 (im Druck).+++<br />
Benikowski, Bernd: Non vitae, sed scholae discimus - oder: Was kommt nach der Schule?<br />
Einführung in den Themenschwerpunkt. in: PÄD-Forum, Jg. 23, 2004, H. 4, S. 205-206.<br />
+++Urdze, Sigita: Probleme und Potenziale neuer Erwerbsbiografien. Ein Überblick über den<br />
Stand der Forschung. in: Ebd., S. 207-209.+++Ciesinger, Kurt-Georg: Interview mit Wolf<br />
Herbst, Geschäftsführer von radius digital works, Duisburg. in: Ebd., S. 210-211. +++ Siebecke,<br />
Dagmar; Pelka, Bastian: Flexible Erwerbsbiografien. Probleme des Selbstmanagements<br />
beruflicher Flexibilität. in: Ebd., S. 212-215.+++Benikowski, Bernd: Neue Erwerbsbiographien.<br />
Aufgaben und Herausforderungen für zukünftige Bildungsinstitutionen. in: Ebd., S.<br />
216-218.+++Klatt, Rüdiger: Die unentdeckten Potenziale nichtlinearer Erwerbsverläufe. in:<br />
Ebd., S. 219-222.+++Klatt, R.; Neuendorff, H.; Nölle, K.: Kompetenzprofile in diskontinuierlichen<br />
Erwerbsverläufen. in: Neuendorff, H.; Ott, B. (Hrsg.): Unternehmensübergreifende<br />
Prozesse und ganzheitliche Kompetenzentwicklung im Themenschwerpunkt "Gestaltung der<br />
Arbeit im virtuellen Unternehmen". Peter Lang 2006 (im Druck).+++Ciesinger, Kurt-Georg;<br />
Undze, S.: Kompetenzprofiling als Grundlage des Managements diskontinuierlicher Erwerbsbiographien.<br />
in: Ebd. (im Druck).+++Klatt, R.; Nölle, K.: Können Jobnomaden mehr?<br />
Kompetenzprofile von Beschäftigten mit diskontinuierlichen Erwerbsverläufen - Ergebnisse<br />
einer Onlinebefragung von Beschäftigten in der Medien- und IT-Wirtschaft. in: Neuendorff,<br />
H.; Ott, B. (Hrsg.): Neue Erwerbsbiographien - berufsbiographische Diskontinuität. 2006.<br />
ART: Auftragsforschung; gefördert BEGINN: 2003-06 ENDE: 2006-05 AUFTRAGGEBER:<br />
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. -DLR- Projektträger des Bundesministeriums<br />
für Bildung und Forschung Programm "Arbeitsgestaltung und Dienstleistungen" FI-<br />
NANZIERER: Auftraggeber<br />
INSTITUTION: Universität Dortmund, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Fachgebiet<br />
Soziologie Lehrstuhl Allgemeine Soziologie, insb. Arbeitssoziologie (Otto-Hahn-Str.<br />
4, 44221 Dortmund); gaus - medien bildung politikberatung GmbH (Stockholmer Allee 24,<br />
44269 Dortmund); ARÖW Gesellschaft für Arbeits-, Reorganisations- und ökologische Wirtschaftsberatung<br />
mbH (Mülheimer Str. 43, 27058 Duisburg)<br />
KONTAKT: Klatt, Rüdiger (Dr. Tel. 0231-477379-31, e-mail: ruediger.klatt@uni-dortmund.de)
96 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
3 Arbeit, (-sorganisation), Rationalisierung, Kontrolle, Humanisierung, Technologie<br />
[93-L] Pries, Ludger; Hertwig, Markus (Hrsg.):<br />
Deutsche Autoproduktion im globalen Wandel: Altindustrie im Rückwärtsgang oder Hightech-Branche<br />
mit Zukunft?, Berlin: Ed. Sigma 2005, 232 S., ISBN: 3-89404-530-2<br />
INHALT: "Die deutsche Automobilindustrie war in den letzten zehn Jahren äußerst erfolgreich -<br />
vielen düsteren Prognosen zu Beginn der 1990er Jahre zum Trotz. Ihr Anteil an Umsatz und<br />
Beschäftigung der Gesamtwirtschaft stieg, und sowohl die deutschen Hersteller wie auch viele<br />
Zulieferunternehmen konnten ihre Position in der Weltautomobilindustrie halten bzw. ausbauen.<br />
Warum und wie war diese Entwicklung möglich? Die Beiträge dieses Sammelbands<br />
versuchen aus unterschiedlichen Perspektiven Teilantworten auf diese Frage. In einer übergreifenden<br />
Perspektive werden die gegenwärtige Situation und wichtige Entwicklungstrends<br />
der internationalen und besonders der deutschen Automobilindustrie untersucht; aus sozialwissenschaftlicher<br />
Sicht greifen die Beiträge spezielle Aspekte und Problemfelder der Automobilproduktion<br />
auf, beispielsweise die Organisation von FuE-Prozessen und neue Formen<br />
Internet-gestützter zwischenbetrieblicher Kommunikation durch E-Business; der Analyse<br />
'weicher' Faktoren wie der Arbeitspolitik und der Arbeitsorganisation kommt dabei besonderes<br />
Augenmerk zu." (Autorenreferat). Inhaltsverzeichnis: Ludger Pries, Markus Hertwig: Einleitung:<br />
Die Automobilindustrie - Eine Hightech-Branche mit Zukunft in Deutschland und<br />
Europa? (7-13); Ludger Pries: Renaissance oder Agonie der deutschen und europäischen Automobilindustrie?<br />
(15-37); Peter Nunnenkamp: Der Automobilstandort Deutschland unter<br />
Wettbewerbsdruck. Eine deutsche Erfolgsgeschichte und wettbewerbsbedingte Risiken (39-<br />
58); Steffen Kinkel, Gunter Lay: Automobilzulieferer in der Klemme. Vom Spagat zwischen<br />
strategischer Ausrichtung und Auslandsorientierung (59-74); Gerd Kappelhoff: Automobilzulieferer<br />
im Wachstumsstress? Die entscheidenden Entwicklungen der Zukunft (75-84); Martina<br />
Fuchs: Globalisierung von F&E-Aktivitäten in der Automobilzulieferung? (85-103); Thomas<br />
Haipeter, Steffen Lehndorff: Flexibilisierung und Dezentralisierung der Arbeitszeitregulierung<br />
in der deutschen Automobilindustrie (105-123); Matthias Klemm, Michael Popp:<br />
Skoda als 'learning community'. Empirische Befunde zu kulturell-kommunikativen Bedingungen<br />
von Wissensaustausch im 'Tochter-Konzern-Verhältnis (125-145); Michael Schumann,<br />
Martin Kuhlmann, Franke Sanders, Hans Joachim Sperling: AUTO 5000 - Eine<br />
Kampfansage an veraltete Fabrikgestaltung (147-165); Gernot Mühge: E-Business und der<br />
organisatorische Wandel in der Automobilzulieferindustrie. Gibt es einen empirischen Zusammenhang?<br />
(167-185); Jürgen Schultze: Am 'Anfang' der Wertschöpfungskette. E-<br />
Business in KMU-Zulieferbetrieben (187-202); Markus Hertwig: Mitbestimmung und E-<br />
Business. Betriebsratshandeln bei der Einführung neuer IuK-Technik in Automobilzulieferbetrieben<br />
(203-226); Gert Schmidt: Ausblick: Am Ende des Booms? Zukunftsaussichten der<br />
deutschen Automobil- und Automobilzulieferindustrie (227-229).<br />
[94-F] Rosenbach, Inike (Bearbeitung); Schiffauer, Werner, Prof.Dr. (Betreuung):<br />
Bezahlte Hausarbeit im Kontext der internationalen Arbeitsteilung<br />
INHALT: In den letzten Jahren lässt sich in den westlichen Industrienationen eine steigende<br />
Nachfrage nach Haushaltsarbeiterinnen beobachten. Auch von deutschen Privathaushalten<br />
werden die klassischen Tätigkeiten einer Hausfrau und Mutter wie Putzen, Bügeln, Waschen,<br />
Einkaufen, die Betreuung von Kindern und Pflegebedürftigen zunehmend gegen Bezahlung<br />
an Dritte delegiert. Bei den Beschäftigten handelt es sich im allgemeinen um Frauen, oft Sozialhilfeempfängerinnen,<br />
Rentnerinnen, Studentinnen und Frauen in Krisensituationen. Auf-
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 97<br />
3 Arbeit, (-sorganisation), Rationalisierung, Kontrolle, Humanisierung, Technologie<br />
fällig ist zudem ein hoher Anteil an Migrantinnen unter den Haushaltsarbeiterinnen, nicht selten<br />
Frauen aus der "Dritten" Welt und Osteuropa, die in ihren Heimatländern für sich und ihre<br />
Familien kein Auskommen finden konnten oder sich aus anderen Gründen gezwungen sahen,<br />
ihre Heimat zu verlassen. Viele dieser modernen 'domestic workers' halten sich ohne Aufenthaltstitel<br />
oder Arbeitserlaubnis in Deutschland auf und sind allein aus diesem Grunde genötigt,<br />
in der Schattenwirtschaft zu arbeiten. Ziel des Dissertationsvorhabens ist es zu untersuchen,<br />
wie sich diese Beschäftigungsverhältnisse in deutschen Privathaushalten auf der Ebene<br />
der Individuen formal und emotional gestalten und inwiefern diese als Ausdruck oder Begleiterscheinung<br />
einer zunehmenden Internationalisierung und Globalisierung von Arbeitsmärkten<br />
verstanden werden können. Im empirischen Teil beschäftigt sich das Projekt unter Anwendung<br />
qualitativer Forschungsmethoden insbesondere mit den Beweggründen der Arbeitgeber-<br />
und -nehmerinnen für das Eingehen dieser Arbeitsverhältnisse, ihrem tatsächlichen<br />
Zustandekommen, dem Aushandeln der Löhne und Arbeitsbedingungen sowie der Praxis der<br />
Arbeitsbeziehungen. Besondere Aufmerksamkeit wird ferner der Frage gewidmet, welche<br />
qualifikationsunabhängigen Auswahlkriterien auf Seiten der ArbeitgeberInnen die Chancen<br />
der Arbeitnehmerinnen auf dem Arbeitsmarkt "Privathaushalt" strukturieren. Anders gefragt:<br />
Welche Rolle spielen der Aufenthaltsstatus, nationale, ethnische, religiöse und soziokulturelle<br />
Zugehörigkeiten, Geschlecht oder Sympathie bei der Entscheidung für eine Bewerberin? Und<br />
inwiefern beeinflussen etwaige Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Herkunft und<br />
rechtlichen Stellung der Akteure den Alltag der Arbeitsverhältnisse? Im theoretischen Teil<br />
der Arbeit soll auf Grundlage der empirischen Ergebnisse und Literaturarbeit Stellung zu aktuellen<br />
Debatten der Migrations-, Gender- und Globalisierungsforschung genommen werden.<br />
Inwiefern handelt es sich bei dem in Deutschland beobachteten Arbeitsmarkt "Privathaushalt"<br />
um einen internationalen Arbeitsmarkt für Niedriglohnjobs? Manifestiert sich in diesem Sektor<br />
eine "Feminisierung der Migration", die über einen rein zahlenmäßigen Anstieg wandernder<br />
Frauen in dem Sinne hinausgeht, dass diese unabhängig von männlichen Familienangehörigen<br />
ihre Heimat auf der Suche nach Arbeit und einem besseren Leben verlassen? Was bedeutet<br />
die Existenz dieses überwiegend informellen Arbeitsmarktes für die Souveränität des<br />
Nationalstaates, wenn sich ein nicht kleiner Teil der Beschäftigten ohne Papiere im Lande<br />
aufhält? Wie ist mit den neuen Ungleichheiten zwischen Frauen umzugehen, die sich durch<br />
den Aufstieg der einen "auf dem Rücken" der anderen im globalen Kontext offenbaren?<br />
ART: Dissertation ENDE: 2006-12 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine<br />
Angabe<br />
INSTITUTION: Europa-Universität Viadrina, Kulturwissenschaftliche Fakultät, Professur für<br />
vergleichende Kultur- und Sozialanthropologie (Postfach 1876, 15207 Frankfurt an der Oder)<br />
KONTAKT: Sekretariat (Tel. 0335-5534-2644, Fax: 0335-5534-2645,<br />
e-mail: anthro@euv-frankfurt-o.de)<br />
[95-F] Schneider, Nicole, Dipl.-Inform. (Bearbeitung); Schlick, Christopher, Univ.-Prof.Dr.-Ing.;<br />
Luczak, Holger, Univ.-Prof.em.Dr.-Ing. (Leitung):<br />
Altersdifferenzierte Adaption der Mensch-Rechner-Interaktion (im Rahmen des DFG-<br />
Schwerpunktprogramms "Altersdifferenzierte Arbeitssysteme")<br />
INHALT: In diesem Vorhaben werden technische Lösungen für aktuelle Herausforderungen und<br />
Problemfelder im Zuge des demographischen Wandels erarbeitet. Hierbei wird die Nutzung<br />
von Computern mittels einer modellgestützten, altersdifferenzierten Adaption der Schnittstelle<br />
erleichtert, indem implizit bzw. explizit erhobene Fähigkeitsprofile der Benutzer genutzt
98 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
3 Arbeit, (-sorganisation), Rationalisierung, Kontrolle, Humanisierung, Technologie<br />
werden. Es werden einerseits bereits bekannte psychophysiologische Zusammenhänge berücksichtigt,<br />
beispielsweise zur visuellen Wahrnehmung und zur Motorik. Ergänzt werden<br />
diese andererseits um individuelle und altersdifferenzierte Aufgabenbearbeitungsstrategien,<br />
welche aus unterschiedlichen kognitiven Fähigkeiten (z.B. Kurz-/ Langzeitgedächtnis) resultieren.<br />
Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der adaptiven Gestaltung der Aufgabenabläufe<br />
selbst, d.h. es wird mittels unterschiedlicher Granularitäten den jeweiligen Aufgabenbearbeitungsstrategien<br />
und besonders den Kenntnissen und Fähigkeiten auf kognitiver Basis Rechnung<br />
getragen.<br />
ART: gefördert BEGINN: 2006-01 ENDE: 2007-12 AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER:<br />
Deutsche Forschungsgemeinschaft<br />
INSTITUTION: Technische Hochschule Aachen, FB 04 Fak. für Maschinenwesen, Lehrstuhl<br />
und Institut für Arbeitswissenschaft (Bergdriesch 27, 52062 Aachen)<br />
KONTAKT: Schlick, Christopher (Prof.Dr. 0241-8099-440,<br />
e-mail: c.schlick@iaw.rwth-aachen.de)<br />
[96-L] Schönauer, Annika:<br />
Qualität der Arbeit in Callcentern: Fallstudie Österreich im "Global Call Center Industry<br />
Project", (FORBA-Forschungsbericht, 5/2005), Wien 2005, 79 S. (Graue Literatur;<br />
URL: http://www.forba.at/files/download/download.php?_mmc=czo2OiJpZD0xNDIiOw==)<br />
INHALT: "Ziel des Forschungsprojekts ist die Analyse der Qualität der Arbeit in Callcentern und<br />
ihrer Bedingtheit durch institutionelle Rahmenbedingungen und Geschäftsstrategien. FORBA<br />
ist mit dieser Studie Teil des Global Callcenter Research Projects. Es handelt sich dabei um<br />
ein internationales Projekt, dessen Ziel es ist, Vergleiche über die Qualität von Arbeit in Callcentern<br />
in Industrieländern und in Schwellen- bzw. Transformationsländern anzustellen. Ausgehend<br />
von einer US-amerikanischen Vorgängerstudie, die ergab, dass die Qualität von Arbeit<br />
in Callcentern wesentlich von Managementstrategien und dem institutionellen Kontext<br />
geprägt ist, sind Beschäftigungsstruktur, Arbeitsorganisation, strategische Ausrichtung, Managementpraxen,<br />
Personalpolitiken, Umsatz- und Leistungsdaten, Interessenvertretungsstrukturen<br />
sowie institutionelle Einbindung in Wirtschaftsförderungs- und Netzwerkstrukturen<br />
Gegenstand der Betrachtungen. Diese Merkmale werden mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens<br />
erhoben. Die Untersuchung der Callcenter wird im Sinne interessanter Vergleiche<br />
in allen fünf Kontinenten stattfinden. Die Qualität der Arbeit soll insgesamt in den Ländern<br />
Australien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Irland, Israel, Japan,<br />
Kanada, Korea, den Niederlanden, Österreich, Philippinen, Polen, Schweden, Südafrika und<br />
den USA untersucht werden. Vertreten sind somit Länder, die unterschiedliche Typen von industriellen<br />
Beziehungen verkörpern (Katz 1997): markt-orientiertes System (Australien, Kanada,<br />
UK, USA); Systeme mit institutionalisierten Verhandlungen zwischen den SozialpartnerInnen<br />
(Dänemark, Deutschland, Irland, die Niederlande, Österreich, Schweden, Japan);<br />
Schwellenländer/Transformationsländer (Indien, Korea, Philippinen, Polen, Südafrika). Die<br />
Auswahl der Länder anhand dieser Typologie erlaubt zusätzlich einen internationalen Vergleich<br />
der Prägung der Beschäftigungsbedingungen in Callcentern durch den institutionellen<br />
Kontext. Ausgehend von den Ergebnissen der US- amerikanischen Studie stellt das vorliegende<br />
Projekt die beiden folgenden Forschungsfragen: Welche Unterschiede gibt es in der<br />
Qualität der Arbeit in österreichischen Callcentern? Welche Faktoren können diese Unterschiede<br />
zwischen den Callcenter-Arbeitsplätzen erklären? Um diese Fragestellungen beantworten<br />
zu können, werden die bereits beschriebenen Merkmale in Callcentern erhoben und
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 99<br />
3 Arbeit, (-sorganisation), Rationalisierung, Kontrolle, Humanisierung, Technologie<br />
miteinander verglichen. Der vorliegende Bericht stellt die Ergebnisse der österreichischen Erhebung<br />
ausführlich dar und schafft ein detailliertes Bild der österreichischen Callcenter-<br />
Branche und deren Geschäftsstrategien und Rahmenbedingungen für Arbeit. Diese internationale<br />
Studie ist die erste systematisch empirische Untersuchung, die es ermöglicht, Faktoren,<br />
die die Qualität der Arbeit in Callcentern prägen, international zu vergleichen. Die vorliegenden<br />
Ergebnisse bilden die Basis für die international vergleichenden Analysen." (Textauszug)<br />
[97-L] Schumann, Michael; Kuhlmann, Martin; Sanders, Frauke; Sperling, Hans Joachim:<br />
AUTO 5000 - Eine Kampfansage an veraltete Fabrikgestaltung, in: Ludger Pries, Markus<br />
Hertwig (Hg.): Deutsche Autoproduktion im globalen Wandel : Altindustrie im Rückwärtsgang<br />
oder Hightech-Branche mit Zukunft?, Berlin: Ed. Sigma, 2005, S. 147-165, ISBN: 3-89404-530-2<br />
INHALT: Die Autoren gehen der Frage nach, inwiefern unter den Bedingungen verschärften<br />
Wettbewerbs und der anhaltenden Globalisierung überhaupt noch Gestaltungsspielräume für<br />
eine innovative Arbeitspolitik und speziell für neue Arbeitsgestaltungsmaßnahmen bestehen.<br />
Sie untersuchen dies am Beispiel des Volkswagen-Betriebs AUTO 5000 und stellen zentrale<br />
Befunde der im Herbst 2004 abgeschlossenen dritten Untersuchungsphase vor, in welcher<br />
erstmals breit die Arbeitserfahrungen in der Fabrik untersucht worden sind. Bei dem Projekt<br />
AUTO 5000 sind demnach hinsichtlich der Arbeits- und Betriebsgestaltung (z.B. ganzheitliche<br />
Arbeitsvollzüge, flache Hierarchien, relativ hohe Teamautonomie, erweiterte Meisterfunktion),<br />
der Qualifizierungspolitik (z.B. regelmäßige, zur Hälfte vom Unternehmen bezahlte<br />
Qualifizierungszeiten, Zertifizierung dieser Maßnahmen durch die Industrie- und Handelskammer),<br />
der vereinheitlichten Entlohnungspolitik sowie in Bezug auf die Wahrnehmung des<br />
Innovationsgrades dieses Projekts durch die Beschäftigten insgesamt wichtige Spielräume für<br />
positive Regulierungen der Arbeits-, Beschäftigungs- und Partizipationsbeziehungen entwickelt<br />
worden. Entgegen der These einer "Retaylorisierungstendenz" bei der Automobilproduktion<br />
zeigen die Befunde, dass selbst unter den Bedingungen zugespitzten globalen Wettbewerbs<br />
alternative Entwicklungswege denkbar sind, die für die beschäftigten Arbeitnehmer<br />
und auch für die Unternehmen durchaus Vorteile mit sich bringen können. (ICI2)<br />
[98-F] Treeck, Werner van, Prof.Dr. (Leitung):<br />
Rationalität und Emotionalität in der Arbeit<br />
INHALT: Sozialwissenschaftliche Untersuchungen von Erwerbsarbeit sind in der Regel von einem<br />
rationalistischen Vorurteil geprägt, demzufolge Gefühle hier keine Rolle spielen dürfen<br />
und unter Kontrolle zu halten sind. Ihre Abspaltung und Verdrängung findet in Konflikten ihre<br />
Grenze, die mitsamt ihren offiziellen Bearbeitungsformen wiederum Emotionalität zur<br />
Normalitätsabweichung stempeln. Wie lassen sich sozialverträgliche Bewegungsformen für<br />
Gefühle in Arbeitskontexten entwickeln? Die kritische Reflexion der Gefühlsbegriffe, die geschlechtsspezifischen<br />
Zuschreibungen von Gefühlen und ihre Verarbeitung, die Konstruktion<br />
von Arbeitsräumen als Gefühlsräume und die Ausprägung emotionalen Lebens darin stehen<br />
im Zentrum der Aufmerksamkeit.<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: Treeck, W.v.: Zur Entwicklung gesellschaftlicher Arbeit. in:<br />
Zimmer, Gerhard (Hrsg.): Kompetenzentwicklung und Reform der Berufsausbildung. Arbeit,<br />
Qualifikation und Ausbildung in der NetzWerkGesellschaft. Bielefeld: Bertelsmann KG<br />
2004, S. 37-48.
100 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
3 Arbeit, (-sorganisation), Rationalisierung, Kontrolle, Humanisierung, Technologie<br />
ART: Eigenprojekt BEGINN: 2000-10 ENDE: 2008-10 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FI-<br />
NANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Universität Kassel, FB 05 Gesellschaftswissenschaften, Fachgruppe Soziologie<br />
Fachgebiet Arbeits- und Sozialpolitik (Nora-Platiel-Str. 5, 34109 Kassel)<br />
KONTAKT: Sekretariat (Tel. 0561-804-3459, Fax: 0561-804-3068,<br />
e-mail: mwarnke@uni-kassel.de)<br />
[99-L] Voß, G. Günter; Weiß, Cornelia:<br />
Subjektivierung von Arbeit - Subjektivierung von Arbeitskraft, in: Ingrid Kurz-Scherf, Lena<br />
Correll, Stefanie Janczyk (Hrsg.): In Arbeit: Zukunft : die Zukunft der Arbeit und der Arbeitsforschung<br />
liegt in ihrem Wandel, Münster: Verl. Westfäl. Dampfboot, 2005, S. 139-153, ISBN: 3-<br />
89691-625-4<br />
INHALT: Die Autoren diskutieren zunächst, was in der deutschen Arbeits- und Industriesoziologie<br />
unter dem Begriff der "Entgrenzung von Arbeit" verstanden wird, wobei sie auch kurz auf<br />
die internationale Diskussion eingehen. Sie stellen anschließend einige konzeptionelle Überlegungen<br />
zum Begriff der "Subjektivierung" von Arbeit und Arbeitskraft an und weisen auf<br />
verschiedene Ambivalenzen und Paradoxien der betrieblichen Ziele der Subjektivierung von<br />
Arbeit hin, die ihrer Meinung nach gleichermaßen Prozesse einer gesellschaftlichen Restrukturierung<br />
und eine (geschlechter-) politische Herausforderung für die Zukunft darstellen. Ihrer<br />
These zu Folge steigen mit der Entgrenzung von Arbeit und Gesellschaft nicht nur die Anforderungen<br />
an die Betroffenen, auch die Gesellschaft insgesamt wird mit der existenziellen Basis<br />
des "Lebendigen" konfrontiert. Die Autoren erörtern vor diesem Hintergrund offene Fragen<br />
zur Gender-Dimension und zu einer nachhaltigen Gesellschaftspolitik. (ICI)<br />
[100-L] Voswinkel, Stephan; Kocyba, Hermann:<br />
Entgrenzung der Arbeit: von der Entpersönlichung zum permanenten Selbstmanagement,<br />
in: WestEnd : neue Zeitschrift für Sozialforschung, Jg. 2/2005, H. 2, S. 73-83<br />
INHALT: Der Beitrag zum Wandel der Arbeits- und Lebensbedingungen im Zuge der Entwicklung<br />
des Kapitalismus erörtert das Phänomen der Entgrenzung der Arbeit. Dabei schlagen die<br />
Autoren eine Differenzierung der Rede von 'Entgrenzung' vor und unterscheiden zwischen<br />
Ausgestaltungen zeitlicher, räumlicher, sachlicher, sozialer und sinnhafter Entgrenzung. In<br />
diesem Zusammenhang dient der Fordismus als Kontrastfolie, der wiederum selbst als Prozess<br />
der Entgrenzung beschrieben wird. Auf diese Weise wird daran erinnert, dass der Kapitalismus<br />
von Anbeginn eine sich beständig revolutionierende Wirtschaftsordnung verkörpert,<br />
die immer wieder Grenzen einreißt und neu errichtet. Zur Untermauerung dieser Feststellung<br />
werden folgende Aspekte beleuchtet: (1) die Grenzen normativer Kommunikationssysteme,<br />
(2) die Geschlechterordnung, (3) die mögliche Umkehr funktionaler Differenzierung von<br />
Wertsphären bzw. gesellschaftlichen Teilsystemen in Richtung auf eine Entdifferenzierung<br />
sowie (4) der Prozess der Subjektivierung als Zwang zu permanentem Selbstmanagement in<br />
der Arbeitswelt. (ICG2)
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 101<br />
3 Arbeit, (-sorganisation), Rationalisierung, Kontrolle, Humanisierung, Technologie<br />
[101-L] Weise, Peter:<br />
Unternehmungsinterne Organisation der Arbeitsbeziehungen, in: Thomas Beschorner, Thomas<br />
Eger (Hrsg.): Das Ethische in der Ökonomie : Festschrift für Hans G. Nutzinger, Marburg:<br />
Metropolis-Verl., 2005, S. 315-343, ISBN: 3-89518-504-3 (Standort: USB Köln(38)-32A2853)<br />
INHALT: "Anknüpfend an einen Aufsatz von Hans Nutzinger aus dem Jahre 1978 untersucht der<br />
Verfasserin seinem Beitrag die spezifischen Merkmale der unternehmensinternen Koordination<br />
von Produktionsaktivitäten. Er kommt zu dem Ergebnis, dass die unternehmensinternen<br />
Tätigkeiten durch ein Mixtum der Mechanismen Markt, Norm und Moral koordiniert werden<br />
und dass eine gewisse Stabilität der Löhne - und damit eine Beeinträchtigung ihrer<br />
Markträumungsfunktion - erforderlich ist, um die Funktionen der Information, Motivation<br />
und Distribution zu erfüllen." (Autorenreferat)<br />
4 Management, Unternehmensführung, Personalwesen<br />
[102-F] Apitzsch, Birgit, Dipl.-Soz.; Günther, Angelika, Dipl.-Kff.; Malzahn, Nils, Dipl.-Inform.;<br />
Tünte, Markus, Dipl.-Soz.Wiss.; Urspruch, Thekla, Dipl.-Kff.; Zeini, Sam, Dipl.-Soz.Wiss. (Bearbeitung);<br />
Shire, Karen A., Univ.-Prof.Ph.D.; Hoppe, Heinz Ulrich, Univ.-Prof.Dr.; Borchert,<br />
Margret, Univ.-Prof.Dr. (Leitung):<br />
Virtuelles Arbeiten und Lernen in projektartigen Netzwerken. Interdisziplinäre Lösungsansätze<br />
für die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und ein Mitarbeiter förderndes<br />
Personalmanagement (VIP-NET)<br />
INHALT: Das interdisziplinäre Forschungsprojekt zielt auf die soziale, technische und organisatorische<br />
Unterstützung wissensintensiver Kooperationsarbeit im Kontext dynamischer Netzwerke.<br />
Solche Arbeit wird vornehmlich im Kontext von Projekten zeitlich, sachlich und sozial<br />
strukturiert. Die beabsichtigte Forschung umfasst daher Organisationsnetzwerke, innerhalb<br />
derer sich Projekte als basale Untersuchungseinheit ausdifferenzieren, sowie Beschäftigte, die<br />
über die Einbindung in solche Projekte Teil einer netzwerkbasierten Kooperation werden.<br />
Fokussiert werden Beziehungen von kooperativer Zusammenarbeit, projektbezogener Organisationsentwicklung<br />
(Entstehung und Auflösung), der Entwicklung dauerhafter professioneller<br />
Netzwerke sowie der Bildung organisationaler Partnerschaften. Es sollen daher zum einen<br />
strukturelle Merkmale projektartiger Netzwerke beleuchtet werden, zum anderen aber auch<br />
Entwicklungen und Qualifikationen auf der mikrobiographischen Ebene dokumentiert werden.<br />
Ziel des Forschungsprojektes ist es, soziale, technische und managementbezogene Vorschläge<br />
zur Lösung von Problemen und Widersprüchlichkeiten in virtuellen Projekten anzubieten,<br />
deren Ursprünge zumeist in der zeitlichen Befristung der Zusammenarbeit vermutet<br />
werden. Daraus lassen sich drei Arbeitsziele ableiten: 1. Die Rekonstruktion von Bedingungen<br />
für die zeitliche, sachliche und soziale Strukturierung und Reproduktion projektbezogener<br />
Kooperationsarbeit. 2. Die Bereitstellung von Lösungsansätzen zur Verbesserung der<br />
technischen und sozialen Gestaltung virtuell organisierter Lernprozesse. 3. Die Auslotung<br />
personalwirtschaftlicher Konzepte, die es erlauben, Arbeit in projektartigen Netzwerken zu<br />
organisieren. Damit sollen Rahmenbedingungen für eine menschengerechte Arbeitsgestaltung<br />
und ein Mitarbeiter förderndes Personalmanagement in netzwerkartigen Kontexten formuliert<br />
werden.
102 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
4 Management, Unternehmensführung, Personalwesen<br />
METHODE: Durchgeführt werden detaillierte Analysen von mindestens acht virtuellen Projektorganisationen<br />
mit entsprechenden Netzwerkstrukturen. Die zur Anwendung kommenden<br />
Methoden und Instrumente entsprechen der Praxis der drei beteiligten Disziplinen - Soziologie<br />
(problemzentrierte Interviews, standardisierte Erhebungsinstrumente), Informatik (Logfile-Analysen,<br />
Modellierung des Werkzeuggebrauchs) und Personalmanagement (Experteninterviews,<br />
großzahlige quantitative Befragungen, multivariate Analysemethoden und standardisierte<br />
Erhebungsinstrumente). Die Ausrichtung des Projektes über vier Jahre wird ein panelartiges<br />
Design der Erhebung erlauben. Untersuchungsdesign: Panel DATENGEWINNUNG:<br />
Inhaltsanalyse, offen. Aktenanalyse, offen. Beobachtung, teilnehmend. Qualitatives Interview.<br />
Standardisierte Befragung, schriftlich. Standardisierte Befragung, online. Feldarbeit<br />
durch Mitarbeiter/-innen des Projekts.<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: Zeini, S.; Malzahn, N.; Hoppe, H.U.: Kooperationswerkzeuge im<br />
Kontext virtualisierter Arbeitsprozesse. in: Engelin, M.; Meißner, K. (Hrsg.): Virtuelle Organisationen<br />
und Neue Medien 2004. Workshop GeNeMe2004 Gemeinschaft in Neuen Medien,<br />
TU Dresden, 7 und 8 Oktober 2004. Lohmar, Köln: Eul 2004. S. 79-90.+++Malzahn, N.; Urspruch,<br />
T.; Tünte, M.; Hoppe, H.U.: Teams in virtuellen Unternehmen - Zusammenstellung,<br />
Kompetenzen, Technik. in: Engelin, M.; Meißner, K. (Hrsg.):Virtuelle Organisationen und<br />
Neue Medien 2005. Workshop GeNeMe2005 Gemeinschaft in Neuen Medien, TU Dresden,<br />
6. und 7. Oktober 2005. Vertrieb: TU Dresden, Fakultät Informatik, Institut für Software- und<br />
Multimediatechnik, 2005, S. 197-210.+++Malzahn, N.; Zeini, S.; Harrer, A.: Ontology facilitated<br />
community navigation - who is interesting for what I am interested in? in: Lecture Notes<br />
in Computer Science, Vol. 3554, 2005, pp. 292-303. ARBEITSPAPIERE: Borchert, M.; Urspruch,<br />
T.: Unternehmensnetzwerke. Diskussionsbeiträge der Fakultät Wirtschaftswissenschaft<br />
der Universität Duisburg-Essen, Standort Duisburg, Nr. 300. 2003.+++Borchert, M.;<br />
Günther, A.; Urspruch, T.; Goltz, Wanja von der: Projektmanagement als Gegenstand empirischer<br />
Forschung. Arbeitspapier am Fachbereich Betriebswirtschaft der Universität Duisburg-<br />
Essen, Standort Duisburg, Nr. 310. 2005.<br />
ART: Auftragsforschung BEGINN: 2003-07 ENDE: 2007-01 AUFTRAGGEBER: Deutsches<br />
Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. -DLR- Projektträger des Bundesministeriums für Bildung<br />
und Forschung Programm "Arbeitsgestaltung und Dienstleistungen" FINANZIERER:<br />
Auftraggeber<br />
INSTITUTION: Universität Duisburg-Essen Campus Duisburg, FB Gesellschaftswissenschaften,<br />
Institut für Soziologie Professorship Comparative Sociology and Japanese Society (Lotharstr.<br />
65, 47048 Duisburg); Universität Duisburg-Essen Campus Duisburg, FB Ingenieurwissenschaften,<br />
Institut für Informatik und Interaktive Systeme Fachgebiet Kooperative und Lernunterstützende<br />
Systeme (47048 Duisburg); Universität Duisburg-Essen Campus Duisburg, Mercator<br />
School of Management - FB Betriebswirtschaft, Department Management and Marketing<br />
Lehrstuhl für Personal und Unternehmensführung (Lotharstr. 65, 47048 Duisburg)<br />
KONTAKT: Shire, Karen A. (Prof. Tel. 0203-379-2626, e-mail: shire@vip-net.info)<br />
[103-F] Bartilla, Michael; Ollmann, Rainer; Tyschak, Britta; Jürgenhake, Uwe, Dr.; Schubert,<br />
André, Dipl.-Soz.Wiss. (Bearbeitung); Meier, Hans-Jürgen; Thieler, Heinz-Siegmund, Dr.jur.;<br />
Ciesinger, Kurt-Georg; Wingen, Sascha, Dipl.-Psych. (Leitung):<br />
Modellprojekt Beschäftigungsfähigkeit sichern - Potenziale alternder Belegschaften am Beispiel<br />
der Metall- und Elektroindustrie in der Region Dortmund/ Hamm/ Kreis Unna
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 103<br />
4 Management, Unternehmensführung, Personalwesen<br />
INHALT: Folgende Fragestellungen werden mit individuellen Schwerpunkten in mehreren Modellbetrieben<br />
thematisiert: Wie können die Potenziale älterer Mitarbeiter wie beispielsweise<br />
Erfahrungen aus der langjährigen Berufstätigkeit, Sozialkompetenzen, Schlüsselqualifikationen<br />
etc. verstärkt genutzt werden? Wie kann die Veränderungsbereitschaft von älteren Arbeitnehmern<br />
geweckt werden? Wie können die spezifischen Stärken älterer und jüngerer Mitarbeiter<br />
optimal kombiniert und genutzt werden? Wie sind Weiterbildungsmaßnahmen altersgerecht<br />
umzusetzen? Wie kann eine altersgerechte Arbeitszeitgestaltung definiert werden?<br />
Aus den hier nur angerissenen Fragestellungen ergeben sich insgesamt komplexe Anforderungen<br />
an das betriebliche Personalmanagement. Von Bedeutung wird es in den einzelnen<br />
Beratungsprozessen sein, die unterschiedlichen Gestaltungsinstrumente miteinander zu verknüpfen<br />
und mit den Unternehmen einen gesamten Lösungsansatz zu erarbeiten. Damit über<br />
die Projektlaufzeit hinaus eine nachhaltige Entwicklung in den Betrieben gewährleistet werden<br />
kann, sollen die Unternehmen in die Lage versetzt werden, die spezifischen betrieblichen<br />
Probleme, die durch demografische Veränderungen eingetreten sind oder eintreten werden, zu<br />
identifizieren, diese durch ein intelligentes Bündeln von arbeitsorganisatorischen Maßnahmen<br />
zu bearbeiten sowie den Analyse- und Gestaltungsprozess eigenständig und unter Beteiligung<br />
breiter Mitarbeitergruppen fortzuschreiben. Darüber hinaus ist es Ziel des Modellprojektes,<br />
die erarbeiteten innovativen Lösungskonzepte zur Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit alternder<br />
Belegschaften als Best-Practice Beispiele in die Metall- und Elektrobranche zu tragen.<br />
Der abschließende Transfer in die Branche erfolgt über eine breit angelegte regionale Kampagne,<br />
innerhalb derer die einzelnen Interessensvertretungen als Multiplikator fungieren. Nähere<br />
Informationen finden sich auf den Internetseiten des Unternehmensverbandes der Metallindustrie<br />
für Dortmund und Umgebung e.V.unter: http://www.uv-do.de . GEOGRAPHI-<br />
SCHER RAUM: Region Dortmund/ Hamm/ Kreis Unna<br />
METHODE: Das Projekt nimmt sich den Fragestellungen alternder Belegschaften und den damit<br />
verbundenen Herausforderungen an. Der Fokus des Projektes liegt auf der Metall- und Elektrobranche,<br />
da viele Unternehmen der Branche bereits heute durch gealterte Belegschaften geprägt<br />
sind. Wichtig ist hier vor allem, dass diese Altersstruktur bedingt durch einen Rückgang<br />
attraktiver Möglichkeiten der Frühverrentung und des voraussichtlich steigenden Verrentungszeitpunktes<br />
den Betrieben noch lange erhalten bleibt. Zu diesem Aspekt kommt das zunehmende<br />
Problem der Rekrutierung von qualifizierten jungen Mitarbeitern, sodass das betriebliche<br />
Durchschnittsalter sukzessive weiter steigt. Betriebe müssen sich also darauf einrichten,<br />
Personalprobleme nicht länger allein über das Arbeitsmarktangebot lösen zu können,<br />
sondern durch langfristig angelegte Maßnahmen das bestehende Potenzial der Belegschaften<br />
optimal zu nutzen, zu erhalten und auszubauen. Dazu gehört im Kern die Erhaltung der Beschäftigungsfähigkeit<br />
der älteren oder alternden Mitarbeiter im Betrieb, das heißt die Sicherstellung,<br />
dass die Mitarbeiter möglichst lange und möglichst effektiv im Betrieb eingesetzt<br />
werden können. Diese Entwicklung bedeutet auch für kleine und mittlere Unternehmen, sich<br />
mit Veränderungsprozessen auseinander zu setzen und insbesondere im Personalmanagement<br />
neue Wege einzuschlagen. Ein zentraler Bestandteil der aufeinander abgestimmten Maßnahmen<br />
besteht in der Einrichtung eines betrieblichen Profiling- und Monitoringsystems zur Unterstützung<br />
einer vorausschauenden Organisations- und Personalpolitik für alternde Belegschaften<br />
sowie der betrieblichen Umsetzung geeigneter Maßnahmen. Ein besonderer Fokus<br />
liegt dabei auf der systematischen Ausschöpfung der Kompetenzpotenziale älterer Beschäftigter<br />
und der Aktivierung von betrieblichen Strukturen, die die Eigeninitiative und Selbstverantwortlichkeit<br />
der Beschäftigten für alternsgerechte Reorganisations- und Qualifizierungsprozesse<br />
stärken. Das Vorgehen im Projekt umfasst folgende Schritte: 1. Kurz-Check: Bestandsaufnahme<br />
und betrieblicher Handlungsbedarf. 2. Altersstrukturanalysen und Kompe-
104 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
4 Management, Unternehmensführung, Personalwesen<br />
tenzprofiling in mehreren Modellbetrieben: a) Entwicklung eines integrierten Altersstrukturanalyse-<br />
und Profilingkonzeptes; b) Profiling bei 100 Beschäftigten; c) Etablierung des Profilings<br />
als PE-Instrument. 3. Analyse der betrieblichen Kompetenzanforderungen (aktuell und<br />
perspektivisch): a) Profiling der Anforderungen der Arbeitssysteme und Arbeitsplätze; b) Expertengespräche<br />
in der Branche. 4. Auswertung der Profilingdaten und Dokumentation: a)<br />
Kompetenzschwerpunkte, Kompetenzdefizite; b) Unterschiede der Alterskohorten, Employability-Analyse;<br />
c) Kompetenz-Benchmarking: Thesen für die Branche. 5. Entwicklung von<br />
Lösungskonzepten für Modellbetriebe: individuell passgenaue Umsetzungskonzepte für die<br />
einzelnen Betriebe. 6. Begleitung betrieblicher Umsetzungsprozesse, z.B.: a) innerbetriebliche<br />
Dialogstrukturen, Mentoren-Programme, b) betriebsspezifische Kampagnen, betriebsspezifische<br />
Marketingmodule, c) individuelle und gruppenbezogene Qualifizierungspläne (inhaltlich<br />
und organisatorisch; ggf. Nutzung des Job-Aqtiv-Gesetzes), d) Qualifizierungen, aktivierendes<br />
Lernen der älteren Beschäftigten, Wissenstransfers im Tandem, e) arbeitsorganisatorische<br />
Veränderungen, alternsgerechte Arbeitszeitsysteme, f) Nachwuchsgewinnung und -<br />
integration. 7. Dokumentation der Modellerfahrungen - Erhebung der Erfahrungen - Systematisierung<br />
und Bewertung - Medial aufbereitete Beispielsammlung, Handlungshilfe. 8. Transfer<br />
(innerhalb der Branche und Region): a) Kooperationsnetzwerke in der Branche, b) Dienstleistungsangebote<br />
Benchmarking/ Profiling, c) regionale Kampagne 'Potenziale älterer Beschäftigter'.<br />
Untersuchungsdesign: Querschnitt DATENGEWINNUNG: Standardisierte Befragung,<br />
face to face (Stichprobe: 100; Beschäftigte aus Modellbetrieben und die direkten Vorgesetzten).<br />
Standardisierte Befragung, schriftlich (Stichprobe: 12; Leitungsebene und Betriebsrat).<br />
Sekundäranalyse von Individualdaten (Stichprobe: 700; Personaldaten - Alter, Geschlecht,<br />
Tätigkeit, Qualifikation u.a. - für Altersstrukturanalysen). Feldarbeit durch Mitarbeiter/-innen<br />
des Projekts.<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH:<br />
Alter Hase oder altes Eisen? in: GIB info, 2005, 2, S. 29-31.<br />
ART: gefördert BEGINN: 2005-06 ENDE: 2007-05 AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER:<br />
Generaldirektion Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit -<br />
Europäischer Sozialfonds-; Land Nordrhein-Westfalen Ministerium für Arbeit, Gesundheit<br />
und Soziales<br />
INSTITUTION: Industriegewerkschaft Metall Verwaltungsstelle Dortmund (Ostwall 17-21,<br />
44135 Dortmund); Unternehmensverband der Metallindustrie für Dortmund und Umgebung<br />
e.V. (Prinz-Friedrich-Karl-Str. 14, 44135 Dortmund); gaus - medien bildung politikberatung<br />
GmbH (Stockholmer Allee 24, 44269 Dortmund); Soziale Innovation research & consult<br />
GmbH (Deutsche Str. 10, 44339 Dortmund)<br />
KONTAKT: Meier, Hans Jürgen (Tel. 0231-57706-0, e-mail: hans-juergen.meier@igmetall.de)<br />
[104-F] Borryss, Christine; Mütherich, Birgit (Bearbeitung); Bührmann, Andrea D., Prof.Dr.<br />
(Leitung):<br />
Führen in Teilzeit. Eine empirische Untersuchung der Chancen und Risiken der Einführung<br />
von Teilzeitarbeitsregelungen auch in Führungspositionen<br />
INHALT: Der Beginn des 21. Jahrhunderts ist von grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen<br />
geprägt: neben der Globalisierung der Wirtschaftsströme und den Veränderungen der Bevölkerungsstruktur<br />
ist vor allen Dingen der Übergang von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft<br />
zu konstatieren. Diese Trends konfrontieren sowohl Arbeitgeber/-innen als auch<br />
Arbeitnehmer-/innen mit Herausforderungen, die zwar einerseits Risiken, jedoch andererseits
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 105<br />
4 Management, Unternehmensführung, Personalwesen<br />
auch große und neue Chancen für Frauen und Männer beinhalten. Diese Chancen und Risiken<br />
werden seit nunmehr 20 Jahren intensiv in den Sozialwissenschaften unter den Stichworten<br />
Risikogesellschaft, Multioptionsgesellschaft oder auch Wissensgesellschaft diskutiert. Neuerdings<br />
rückt neben dem Netzwerkgedanken zunehmend und die Vorstellung einer Informationsgesellschaft<br />
in der Vordergrund der Diskussion. Dabei wird Flexibilität vielfach als besonders<br />
relevanter Erfolgsfaktor betrachtet, um auf die Konsequenzen der Globalisierung und<br />
des demografischen Wandels für den 'Standort Deutschland' adäquat reagieren zu können.<br />
Insbesondere die Flexibilisierung der Arbeitszeiten und deren Konsequenzen auch für das<br />
Selbstverständnis der Beschäftigten und deren Lebensplanung werden schon jetzt breit diskutiert.<br />
Das Spektrum der Debatten ist überaus weit: Es reicht u.a. vom Abschied des so genannten<br />
'Normalarbeitsverhältnisses' und dem Aufstieg des 'Arbeitskraftunternehmers als<br />
neuer Grundform der Arbeit' über Veränderungen in Bezug auf Work-Life-Balance sowie der<br />
kontrovers diskutierten Strategien des Gender-Mainstreaming und Managing-Diversity bis<br />
hin zur Frage des Teilzeitunternehmertums und einer möglichen Reduzierung der Arbeitszeiten<br />
auch in Führungspositionen. Alle diese Fragen, vielleicht abgesehen von der Diskussion<br />
um Gender-Mainstreaming, sind bisher kaum für den Bereich der öffentlichen Verwaltungen<br />
und vor allen Dingen der Führungskräfte und so genannten 'high potentials' erforscht. Dieses<br />
Forschungsdefizit gilt es angesichts des am 1. Januar 2001 in Kraft getretenen Teilzeit- und<br />
Befristungsgesetzes, mit dem die Bundesregierung zu einer größeren Flexibilität der Unternehmen,<br />
aber auch zu einer größeren Zeitsouveränität der Beschäftigten beitragen will, dringend<br />
zu schließen. Die Frage nach den Möglichkeiten zur Einführung von Teilzeitarbeit in<br />
Führungspositionen des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Wissenschaft und Forschung<br />
steht im Mittelpunkt des Forschungsprojektes 'Führen in Teilzeit' (FiTz). Ergänzend<br />
werden die Beschäftigten zweier ausgewählter nordrhein-westfälischer Hochschulverwaltungen<br />
zu diesem Thema befragt. Es handelt sich um die Hochschulverwaltungen der FH Dortmund<br />
und der Universität Köln.<br />
METHODE: Zur Erforschung dieser Fragestellung wird ein mehrphasiges, multimethodisches<br />
Verfahren angewandt. Dabei kommen neben einer Sekundäranalyse relevanter Daten über bereits<br />
vorhandene Möglichkeiten zur Teilzeitarbeit und einer teilstandardisierten Fragebogenerhebung<br />
auch qualitative Methoden, wie z.B. Expert/-innen-Interviews, zum Einsatz. Die<br />
Mehrphasigkeit des Verfahrens und der Einsatz unterschiedlicher quantitativer und qualitativer<br />
Methoden ermöglichen es, über den Einzelfall hinausgehend begründete Thesen zu entwickeln.<br />
Die Studie ist in organisationssoziologischer Perspektive angelegt. Sie fragt danach,<br />
wie sich das Konzept 'Führen in Teilzeit' in den Alltag von Ministerial- und Hochschulverwaltungen<br />
einfügen lässt. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Führungskräfte eine zentrale<br />
Akteursebene darstellen. Denn sie verfügen sowohl über konkrete Entscheidungsbefugnisse<br />
als auch über symbolische Machtressourcen. Deshalb sollen neben den Personalabteilungen,<br />
dem Personalrat und den Gleichstellungsbeauftragten insbesondere die 'Betroffenen'<br />
von 'Führen in Teilzeit' selbst, d.h. vor allen Führungskräfte, potenzielle Führungskräfte aber<br />
auch ihre Mitarbeiter/-innen befragt werden.<br />
ART: gefördert BEGINN: 2004-11 ENDE: 2006-06 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINAN-<br />
ZIERER: Land Nordrhein-Westfalen Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung<br />
und Technologie<br />
INSTITUTION: Universität Dortmund, FB 12 Erziehungswissenschaft und Soziologie, Institut<br />
für Soziologie Professur für Frauenforschung (44221 Dortmund)<br />
KONTAKT: Leiterin (Tel. 0231-755-6268, Fax: 0231-755-6509, e-mail: abuehrmann@fb12.unidortmund.de)
106 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
4 Management, Unternehmensführung, Personalwesen<br />
[105-F] Brinkmann, Johanna, Dipl.-Kulturwirtin; Pies, Ingo, Prof.Dr.habil. (Bearbeitung):<br />
Die bürgerschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Public- Private Partnerships als<br />
Investitionen in die globale Rahmenordnung<br />
INHALT: keine Angaben<br />
ART: Dissertation AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Universität Halle-Wittenberg, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Institut für<br />
VWL und Bevölkerungsökonomie Lehrstuhl für Wirtschaftsethik (Große Steinstr. 73, 06108<br />
Halle)<br />
KONTAKT: Betreuer (Tel. 0345-55-23420, Fax: 0345-55-27385,<br />
e-mail: pies@wiwi.uni-halle.de)<br />
[106-L] Dreher, Carsten; Lay, Gunter:<br />
Vom Großen zum Kleinen - und zurück, in: Hansjürgen Paul, Erich Latniak (Hrsg.): Perspektiven<br />
der Gestaltung von Arbeit und Technik : Festschrift für Peter Brödner: Hampp, 2004, S. 93-<br />
111, ISBN: 3-87988-885-X (Standort: UB Siegen(467)-33QAP2861)<br />
INHALT: Die Autoren berichten über die wesentlichen Ergebnisse des vom BMBF finanzierten<br />
Projekts zur "Identifizierung und Bilanzierung erfolgreicher Veränderungen in der Arbeitsgestaltung<br />
von Unternehmensorganisation", wobei sie folgende Fragen erörtern: Wie stellen<br />
sich aus Sicht des Projektes die Befunde zur tatsächlichen Praxis der Arbeitsgestaltung und<br />
ihrer Rahmenbedingungen dar? Ist diese Art der Arbeitsgestaltung und die damit verbundene<br />
Nutzung der Ressource Arbeit angesichts sich verändernder Rahmenbedingungen zukunftsfähig?<br />
Was kann von den Vorreitern innovativer Arbeitsgestaltung in diesem Zusammenhang<br />
gelernt werden und welche Schlussfolgerungen lassen sich daraus ziehen? Die Autoren weisen<br />
vor allem auf zwei Befunde hin: In der Industrie entwickeln sich zunehmend Arbeitssituationen,<br />
die zu einer gleichzeitigen Über- und Unterforderung von Beschäftigten führen. Dies<br />
kann im Kontext der gegenwärtigen "Teilung der Arbeit" zu einer erheblichen Belastung bei<br />
den Beschäftigten führen. Ein zweiter wichtiger Befund betrifft die Feststellung, dass es in<br />
den Unternehmen offensichtlich Engpässe beim organisatorischen Gestaltungswissen gibt, die<br />
durch eine externe Beratung kompensiert werden müssen. Dieses fehlende Know-How der<br />
Veränderung steht einer produktiveren Nutzung menschlichen Arbeitsvermögens und damit<br />
dem weiteren Wachstum der Kompetenzen der Individuen wie der Organisationen im Wertschöpfungsprozess<br />
insgesamt entgegen. (ICI2)<br />
[107-L] Heywood, John S.; Jirjahn, Uwe; Tsertsvadze, Georgi:<br />
Getting along with colleagues: does profit sharing help or hurt?, in: Kyklos : Internationale<br />
Zeitschrift für Sozialwissenschaften, Vol. 58/2005, No. 4, S. 557-573 (Standort: USB Köln(38)-<br />
Haa946; Kopie über den Literaturdienst erhältlich)<br />
INHALT: In der Theorie existieren zwei Kanäle, mit deren Hilfe Gewinnbeteiligung Arbeiter<br />
dazu bewegen kann, die Produktivität ihrer Kollegen zu steigern: größere Kooperation oder<br />
erhöhter Gruppendruck. Der Beitrag argumentiert dahingehend, dass diese beiden Alternativen<br />
gegenteilige Folgen für die Beziehungen unter den Kollegen zeitigen, und dass es von<br />
den Umständen und dem Arbeitskräfte-Typ abhängt, welche von beiden dominiert. Auf der<br />
Basis deutscher Daten wird gezeigt, dass bei Arbeitskräften, die keine aufsichtsführende
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 107<br />
4 Management, Unternehmensführung, Personalwesen<br />
Funktion haben, Gewinnbeteiligung die Kooperation stärkt, dass sie aber bei solchen, die hohen<br />
Wert auf den beruflichen Erfolg legen, keinen Einfluss auf die Kooperation hat und bei<br />
Vorgesetzten die Bereitschaft zur Kooperation schwächt. Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse<br />
bemerkenswerte geschlechtsspezifische Unterschiede in Bezug auf den Effekt von Gewinnbeteiligung.<br />
Aus diesen Verhaltensmustern wird der Schluss gezogen, dass sie den<br />
zugrunde liegenden theoretischen Erwartungen entsprechen. (IAB)<br />
[108-L] Horsmann, Claes S.; Nerdinger, Friedemann W.; Jahnke, Anne; Zschorlich, Christopher:<br />
Trend-Report 'Beteiligungsorientierte Unternehmenskultur': eine Inhaltsanalyse praxisorientierter<br />
Literatur, (Arbeitspapier aus dem Projekt "TiM - Transfer innovativer Unternehmensmilieus",<br />
Nr. 2), Rostock 2006, 35 S. (Graue Literatur; URL: http://www.wiwi.uni-rostock.de/<br />
~wipsy/tim/downloads/tim_arbeitspapier_02.pdf)<br />
INHALT: Die Forschung zum Konstrukt der 'beteiligungsorientierten Unternehmenskultur' hat<br />
sich als Ziel gesetzt, einen theoretischen Rahmen insbesondere für die wissenschaftliche Arbeit<br />
zu schaffen, die sich mit der Beteiligung von Mitarbeitern an Informationen, Entscheidungen,<br />
Kapital und Erfolg ihres Unternehmens und der daraus resultierenden Gestalt der Unternehmenskultur<br />
auseinandersetzt. Dem gemäß arbeitet die Studie die praxisorientierte Literatur<br />
so auf, dass ein Bezug zwischen den dort vorherrschenden Themen und Meinungen und<br />
der theoretischen Arbeit zur 'beteiligungsorientierten Unternehmenskultur' hergestellt werden<br />
kann. Dazu werden Buchpublikationen wie Ratgeber, Best-Practice-Reports und journalistische<br />
Studien herangezogen. In gleicher Weise werden überwiegend an Manager und Personalwirtschaftler<br />
gerichtete Fachzeitschriften gesichtet, wie z.B. 'Harvard Business Manager',<br />
'Handelsblatt Personal' und 'Personalführung'. Das einführende Kapitel legt zunächst die<br />
grundlegenden Erwägungen zur Relevanz der beteiligungsorientierten Unternehmenskultur<br />
im Praktikerdiskurs dar. Der zweite Abschnitt liefert sodann eine 'Landkarte' der Themengebiete,<br />
die als Auslöser für, als Maßnahmen der oder als Folge von verschiedenen Formen der<br />
Mitarbeiterbeteiligung gelten. Neben der inhaltlichen Charakterisierung der identifizierten<br />
Themenfelder wird dabei auch jeweils die Entwicklung der ihnen zugeordneten Literatur in<br />
den letzten zehn Jahren aufgezeigt. So zählen zu den Auslösern die gesellschaftliche Verantwortung<br />
und ethische Anforderungen sowie die soziodemographische Entwicklung der Arbeitnehmerschaft.<br />
Die Perspektivenwechsel umfassen die Veränderung des Bildes von und<br />
des Umganges mit den Mitarbeitern sowie die Entwicklung der Mitarbeiter zu Intrapreneuren.<br />
Als Maßnahmen werden (1) neue Formen der Arbeitsorganisation, (2) die Erschließung des<br />
Wissens der Mitarbeiter und (3) die materielle Beteiligung der Mitarbeiter herausgearbeitet.<br />
Das Ziel der 'beteiligungsorientierten Unternehmenskultur' liegt in der Bindung engagierter<br />
Mitarbeiter. Die Inhaltsanalyse anhand der Themenfelder zeigt, dass praxisorientierte Literatur<br />
häufig Bezüge zwischen den Themenfeldern herstellt, dies jedoch nur unsystematisch und<br />
ohne eine ausreichende Abgrenzung innerhalb der Felder geschieht. Das verdeutlicht, dass<br />
enge inhaltliche Bezüge der untersuchten Schlagworte untereinander vermutet, diese jedoch<br />
nicht zwangsläufig explizit zum Thema gemacht werden. Insofern erscheint es auch aus anwendungsorientierter<br />
Sicht sinnvoll, ein übergreifendes, integratives Konzept wie das einer<br />
'beteiligungsorientierten Unternehmenskultur' zu etablieren. (ICG2)<br />
[109-F] Kaiser, Yvonne; NN (Bearbeitung); Jung, Rüdiger H., Prof.Dr. (Leitung):<br />
Stärkung von Unternehmergeist in Integrationsprojekten/ Sozialunternehmen (Equal-EP)
108 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
4 Management, Unternehmensführung, Personalwesen<br />
INHALT: Die Entwicklungspartnerschaft (EP) 'RHEWIN - Rheinland/ Westerwald Integrationsnetzwerk'<br />
arbeitet an einem Strukturprogramm zur Verbesserung der Integrationsfähigkeit<br />
sowie zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen von Menschen mit Behinderungen.<br />
Zum Konzept der EP gehören einzel- wie überbetriebliche Aktivitäten in der Personal- und<br />
Organisationsentwicklung. Sie stehen unter den Leitprinzipien von Empowerment, Gleichberechtigung,<br />
arbeitsprozessorientierter Qualifikation und lernender Organisation. Die EP hat<br />
sechs Teilprojekte. Aufgabe der wissenschaftlichen Begleitung sind die projektprozessbegleitende<br />
Evaluation und die Aktionsbegleitung i.S. aktiver Rückkoppelung und Mitwirkung an<br />
der EP-Steuerung.<br />
ART: gefördert BEGINN: 2005-07 ENDE: 2007-12 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINAN-<br />
ZIERER: Generaldirektion Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit<br />
Gemeinschaftsinitiative EQUAL<br />
INSTITUTION: Fachhochschule Koblenz RheinAhrCampus Remagen, FB Betriebs- und Sozialwirtschaft<br />
(Südallee 2, 53424 Remagen)<br />
KONTAKT: Leiter (Tel. 02642-932-303, Fax: 02642-932-308,<br />
e-mail: Rhjung@RheinAhrCampus.de)<br />
[110-F] Kerlen, Christiane, Dr. (Bearbeitung); Wessels, Jan, Dr. (Leitung):<br />
WiPA - Wissenstransfer im Prozess der Arbeit<br />
INHALT: keine Angaben<br />
ART: Auftragsforschung; gefördert BEGINN: 2003-06 ENDE: 2006-05 AUFTRAGGEBER: Arbeitsgemeinschaft<br />
Betriebliche Weiterbildungsforschung e.V. -ABWF- Projekt Qualifikations-Entwicklungs-Management<br />
-QUEM- FINANZIERER: Bundesministerium für Bildung<br />
und Forschung<br />
INSTITUTION: VDI-VDE Innovation + Technik GmbH (Steinplatz 1, 10623 Berlin)<br />
KONTAKT: Leiter (e-mail: wessels@vdivde-it.de)<br />
[111-F] Keyl, Eberhard, M.A. (Bearbeitung):<br />
Berufs-/ Professionssoziologie: "Projektmanagement als Beruf?"<br />
INHALT: keine Angaben<br />
ART: Dissertation AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Universität Tübingen, Fak. für Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Institut für<br />
Soziologie Arbeitsschwerpunkt Industrielle Entwicklung (Wilhemstr. 36, 72074 Tübingen)<br />
KONTAKT: Bearbeiter (Tel. 07071-29-72948, e-mail: eberhard.keyl@uni-tuebingen.de)<br />
[112-L] Klemm, Matthias; Popp, Michael:<br />
Skoda als 'learning community': empirische Befunde zu kulturell-kommunikativen Bedingungen<br />
von Wissensaustausch im 'Tochter-Konzern-Verhältnis', in: Ludger Pries, Markus<br />
Hertwig (Hg.): Deutsche Autoproduktion im globalen Wandel : Altindustrie im Rückwärtsgang<br />
oder Hightech-Branche mit Zukunft?, Berlin: Ed. Sigma, 2005, S. 125-145, ISBN: 3-89404-530-2<br />
INHALT: Da der Transfer und das Management von Wissen für den Erfolg global agierender<br />
Automobilunternehmen von immer größerer Bedeutung werden, stellt sich auch die Frage
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 109<br />
4 Management, Unternehmensführung, Personalwesen<br />
nach deren kulturellen und kommunikativen Bedingungen im Verhältnis verschiedener<br />
Standorte, insbesondere im Verhältnis von "Konzernmutter" und "Auslandstochter". Die Autoren<br />
beleuchten einige Aspekte dieser für einen gelungenen Wissensaustausch notwendigen<br />
Voraussetzungen am Beispiel der Betriebe des tschechischen Skoda-Unternehmens und der<br />
deutschen Volkswagen-Zentrale in Wolfsburg. Ihre empirische Analyse auf der Grundlage<br />
von leitfadengestützten Interviews zeigt, dass eine alltäglich gelebte "Kultur des Austauschs"<br />
weder angeordnet werden kann, noch sich aus funktionalen Kooperationserfordernissen von<br />
selbst ergibt. Sie betrachten vor allem drei erfolgskritische Bereiche für Wissensaustauschprozesse<br />
im organisationalen Alltag: Die Bedeutung von Face-to-Face-Kommunikationen, die<br />
Einbettung in konzernweit verknüpfte Funktionsbereiche sowie die Art und Weise des unternehmenskulturellen<br />
Wandels selbst. Die Autoren ziehen daraus abschließend Konsequenzen<br />
zur Genese und Steuerbarkeit einer "Kultur des Austauschs" von Wissen. (ICI2)<br />
[113-F] Kloweit-Herrmann, Manfred, Dr.phil. (Bearbeitung); Klingemann, Carsten, apl.-Prof.Dr.;<br />
Schmieder, Arnold, apl.-Prof.Dr.phil.habil. (Betreuung):<br />
Gender Mainstreaming. Eine Untersuchung zur Geschlechtergerechtigkeit in der Polizei<br />
Niedersachsen<br />
INHALT: keine Angaben GEOGRAPHISCHER RAUM: Niedersachsen<br />
ART: Dissertation ENDE: 2004-06 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine<br />
Angabe<br />
INSTITUTION: Universität Osnabrück, FB Sozialwissenschaften, Fachgebiet Methodologische<br />
Grundlagen der Sozialwissenschaften (Seminarstr. 33, 49069 Osnabrück); Universität Osnabrück,<br />
FB Sozialwissenschaften, Fachgebiet Soziologie und Sozialpsychologie (Seminarstr.<br />
33, 49069 Osnabrück)<br />
[114-L] Kock, Klaus; Kutzner, Edelgard:<br />
Betriebsklima: Überlegungen zur Gestaltbarkeit eines unberechenbaren Phänomens, (Beiträge<br />
aus der Forschung / Sozialforschungsstelle Dortmund Landesinstitut -sfs-, Bd. 148), Dortmund<br />
2006, 28 S. (Graue Literatur;<br />
URL: http://www.sfs-dortmund.de/docs/aktuelles/kutzner_betriebsklima.pdf)<br />
INHALT: Der Beitrag erörtert die wichtigsten Merkmale des Phänomens Betriebsklima. Nach<br />
einer einführenden Begriffsbestimmung werden anschließend folgende Faktoren dargestellt,<br />
die das Betriebsklima entscheidend bestimmen: (1) Führung durch die Vorgesetzten, also<br />
Machtverhältnisse, (2) gegenseitiges Vertrauen sowie (3) Anerkennungs- und (4) Verständigungsverhältnisse.<br />
In einer Zusammenfassung merken die Autoren an, dass die Verbesserung<br />
des Betriebsklimas mehr als nur gute Stimmung durch Feste und Betriebsausflüge erfordert.<br />
Es müssen wirkliche Veränderungen in den Umgangsweisen, in betrieblichen Abläufen und<br />
Strukturen erfolgen. Die Schlussfolgerung lautet: Das Betriebsklima lässt sich nur im Dialog<br />
verbessern. Da Arbeit in soziale Zusammenhänge eingebettet ist, kann sie nur erfolgreich<br />
sein, wenn die zwischenmenschliche Ebene entsprechende Berücksichtigung findet. Auch unter<br />
dem Gesichtspunkt einer menschengerechten Arbeit spielt die Qualität der sozialen Beziehungen<br />
eine große Rolle. Ein gutes Betriebsklima und gute Arbeit bedingen sich gegenseitig.<br />
(ICG2)
110 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
4 Management, Unternehmensführung, Personalwesen<br />
[115-L] König, Susanne:<br />
Human-resource-Management, Personalauswahl und Theorien industrieller Beziehungen:<br />
Interaktionskulturen aus einer Negotiated-order-Perspektive, München: Hampp 2005, XII,<br />
329 S., ISBN: 3-87988-903-1 (Standort: UuStB Köln(38)-31A9493)<br />
INHALT: "In Zeiten eines schärfer werdenden Wettbewerbs propagieren die Unternehmen ein<br />
'Human Resource Management', in dessen Mittelpunkt eine kluge und strategisch vorausschauende<br />
Personalauswahl steht. Hierbei handelt es sich um wohl eines der wichtigsten Verhandlungsfelder<br />
für die betrieblichen Akteure der industriellen Beziehungen. Diesem Thema<br />
nähert sich die empirische Studie über einen interdisziplinären Zugang, der soziologische,<br />
personalwirtschaftliche und arbeitsrechtliche Aspekte kombiniert. Mithilfe des sog. Negotiated<br />
Order-Ansatzes wird die Personalauswahl in Unternehmen im Zusammenhang mit der Interaktionskultur<br />
der Akteure industrieller Beziehungen untersucht. Grundlage der Studie ist<br />
eine bundesweite schriftliche Erhebung in Unternehmen verschiedener Größenklassen mit anschließenden<br />
Expert(inn)en-Interviews. Im Wesentlichen zeigt sich, dass die Akteure das<br />
Verhandlungsfeld der Personalauswahl vor dem Hintergrund ihrer 'gewachsenen' Interaktionskulturen<br />
unterschiedlich ausgestalten. Grundlegende Beziehungsmuster zwischen Management<br />
und Betriebsrat zeigen ihren Einfluss auf die Nutzung von Mitwirkungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten<br />
der Interessenvertretungen bei Auswahlentscheidungen. Die gewonnenen<br />
Realtypen weisen deutliche Unterschiede hinsichtlich der Vorerfahrungen, des<br />
Strategieneinsatzes, der Komplexität der Verhandlungen und des Outcomes auf. Damit möchte<br />
die Arbeit einen Beitrag zur Diskussion um die weitere theoretische Fundierung der industriellen<br />
Beziehungen leisten." (Autorenreferat)<br />
[116-F] Lang, Rüdiger (Bearbeitung):<br />
Verbandsinterne Willensbildung. Eine empirische Studie zu Strukturen und Prozessen in<br />
Arbeitgeberverbänden<br />
INHALT: keine Angaben<br />
ART: Dissertation ENDE: 2004-05 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine<br />
Angabe<br />
INSTITUTION: Universität Regensburg, Philosophische Fakultät 03 - Geschichte, Gesellschaft<br />
und Geographie, Institut für Politikwissenschaft (93040 Regensburg)<br />
[117-L] Ledebur, Sidonia von:<br />
Bedingungen der Wissensweitergabe von neuen Mitarbeitern in Unternehmen: eine spieltheoretische<br />
Analyse, in: Wirtschaft im Wandel, Jg. 12/2006, H. 1, S. 27-32 (Standort: USB<br />
Köln(38)-MXG 07758; Kopie über den Literaturdienst erhältlich;<br />
URL: http://www.iwh-halle.de/d/publik/wiwa/1-06.pdf)<br />
INHALT: "Die Verfügbarkeit des Produktionsfaktors Wissen und die Innovationsfähigkeit stellen<br />
heute zentrale Erfolgsfaktoren von Volkswirtschaften dar. Die Produktion von neuem Wissen<br />
und seine wirtschaftliche Anwendung finden jedoch oft an verschiedenen Orten statt, so dass<br />
Wissenstransfer notwendig ist. Das ist beispielsweise der Fall, wenn Wissenschaftler, die an<br />
Hochschulen oder in öffentlichen Forschungseinrichtungen gearbeitet haben, in ein Unternehmen<br />
wechseln. Wie kann nun die Wissensweitergabe durch neue Mitarbeiter in Unter-
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 111<br />
4 Management, Unternehmensführung, Personalwesen<br />
nehmen optimal gestaltet werden? Eine spieltheoretische Modellierung gibt dafür eine Antwort:<br />
Effizienter Transfer findet dann statt, wenn die Mitarbeiter für den Wissenstransfer einen<br />
hohen zusätzlichen Lohn verglichen mit ihrem zusätzlichen Aufwand erhalten. Hierbei<br />
spielt nicht nur zeitlicher Aufwand und Beteiligung an höheren Einnahmen durch neue Produkte,<br />
sondern auch die Größe des Teams und soziale Faktoren (z.B. Arbeitsklima) eine Rolle.<br />
Um ein günstiges Verhältnis von zusätzlichem Lohn zu zusätzlichem Aufwand zu erhalten,<br />
kann entweder der Lohn erhöht oder aber die individuellen Kosten der Mitarbeiter für<br />
Wissenstransfer gesenkt werden. Dies verursacht selbst Kosten für das Unternehmen - z.B.<br />
durch Einführung eines Wissensmanagements -, ist aber effizient, solange der aus Wissenstransfer<br />
resultierende Gewinn diese Kosten übersteigt. Die Wirtschaftspolitik muss dafür aber<br />
den Unternehmen die Freiheit geben, die Personalpolitik anreizeffizient zu gestalten." (Autorenreferat)<br />
[118-L] Matuschek, Ingo; Arnold, Katrin; Voß, G. Günter:<br />
Subjektivierte Taylorisierung: Organisation und Praxis Informatisierter Kommunikationsarbeit<br />
in Call-Centern, in: Astrid Schütz, Stephan Habscheid, Werner Holly, Josef Krems, Günter<br />
Voß (Hrsg.): Neue Medien im Alltag : Befunde aus den Bereichen Arbeit, Lernen und Freizeit,<br />
Lengerich: Pabst, 2005, S. 120-132, ISBN: 3-89967-238-0 (Standort: Techn. UB Chemnitz(Ch1)-<br />
AP11800neu)<br />
INHALT: "Ergebnisse aus Fallstudien in Call-Centern zeigen eine Verschränkung von Elementen<br />
tayloristischer Betriebsführung mit notwendigen Formen individueller Selbstorganisation. Ein<br />
in diesem Sinne 'Subjektivierter Taylorismus' führt dazu, personenbezogene Dienstleistungsarbeit<br />
zu flexibilisieren, evoziert aber auch veränderte Erwartungen an die eigene Arbeit Das<br />
hat Folgen: Das Subjekt kann nur schwer wieder zum Objekt des Managements gemacht<br />
werden." (Autorenreferat)<br />
[119-F] Molter, Beate, Dipl.-Psych.; Noefer, Katrin, Dipl.-Psych. (Bearbeitung); Sonntag, Karlheinz,<br />
Prof.Dr.; Stegmaier, Ralf, Dr. (Leitung):<br />
Die Bedeutung von Arbeitsgestaltung und Personalentwicklung für Innovations- und Anpassungsfähigkeit<br />
älterer Arbeitnehmer (im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms "Altersdifferenzierte<br />
Arbeitssysteme")<br />
INHALT: Hintergrund: Demographischer Wandel und Frühverrentung ziehen Konsequenzen<br />
sowohl für den Arbeitsmarkt als auch für die sozialen Sicherungssysteme nach sich. Dies erfordert<br />
ein Umdenken gegenüber den Potenzialen älterer Beschäftigter. Insbesondere vor dem<br />
Hintergrund wachsender Wettbewerbsdynamik und der damit verbundenen Notwendigkeit,<br />
sich an neue Situationen anzupassen, stellt sich die zentrale Frage, wie durch die Gestaltung<br />
von Arbeitsbedingungen und Personalentwicklung die produktiven Potenziale (Anpassungsfähigkeit,<br />
Arbeitsleistung und Innovation) Älterer genutzt werden können. Ziele: Um Erkenntnisse<br />
über die Bedeutung von Arbeitsgestaltung und Personalentwicklung für die Erhaltung<br />
produktiver Potenziale älterer Arbeitnehmer zu gewinnen, sollen im Forschungsprojekt<br />
folgende Fragen untersucht werden: Wie verändern sich Merkmale der Arbeit und der Personalentwicklung<br />
mit dem Alter? Wie tragen Arbeitsgestaltung und Personalentwicklung gemeinsam<br />
zum Erhalt der Innovations- und Anpassungsfähigkeit älterer Arbeitnehmer bei?
112 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
4 Management, Unternehmensführung, Personalwesen<br />
Inwieweit unterscheiden sich Wirkungen von Arbeitsmerkmalen und Personalentwicklung<br />
bei älteren Arbeitnehmern mit mentalen und physischen Tätigkeiten?<br />
METHODE: Das Forschungsprojekt wird als Feldstudie in einer Kombination von Quer- und<br />
Längsschnittdesign durchgeführt. Um die Auswirkungen veränderter Arbeitsgestaltung und<br />
Personalentwicklung zu überprüfen, werden die Daten zu zwei Messzeitpunkten im Abstand<br />
von 12 Monaten erhoben. Die Untersuchungsteilnehmer werden entsprechend ihres Alters in<br />
zwei Kohorten aufgeteilt: 40-55jährige und 56-65jährige. Außerdem wird innerhalb jeder Alterskohorte<br />
zwischen mentalen und physischen Tätigkeiten unterschieden. In die Studie mit<br />
einbezogen werden auch Vorgesetzte und jüngere Arbeitskollegen.<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: keine Angaben ARBEITSPAPIERE: Projektflyer. Download unter:<br />
http://www.psychologie.uniheidelberg.de/ae/abo/forschung/projekte/laufende/arbeitssysteme/Flyer_DFG1184.pdf<br />
.<br />
ART: gefördert BEGINN: 2005-11 ENDE: 2007-10 AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER:<br />
Deutsche Forschungsgemeinschaft<br />
INSTITUTION: Universität Heidelberg, Fak. für Verhaltens- und Empirische Kulturwissenschaften,<br />
Psychologisches Institut AE Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie (Hauptstr.<br />
47-51, 69117 Heidelberg)<br />
KONTAKT: Stegmaier, Ralf (Dr. Tel. 06221-54-7358 od. -7379, Fax: 06221-54-7390,<br />
e-mail: Ralf.Stegmaier@psychologie.uni-heidelberg.de)<br />
[120-F] Mudra, Peter, Prof.Dr. (Bearbeitung):<br />
Personalentwicklung als Handlungsfeld des Betriebsrats<br />
INHALT: keine Angaben<br />
ART: keine Angabe AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Fachhochschule Ludwigshafen - Hochschule für Wirtschaft, FB II Marketing<br />
und Personalmanagement (Ernst-Boehe-Str. 4, 67059 Ludwigshafen)<br />
KONTAKT: Bearbeiter (Tel. 0621-5203-278, Fax: 0621-5203-112,<br />
e-mail: Peter.Mudra@fh-ludwigshafen.de)<br />
[121-L] Patzel-Mattern, Katja:<br />
"Eichfähig und kontrollierbar"?: der Beitrag der industriellen Psychotechnik zur Bürokratisierung<br />
moderner Unternehmenshierarchien, (Diskussionsbeiträge des Kulturwissenschaftlichen<br />
Forschungskollegs/ SFB 485 "Norm und Symbol - die kulturelle Dimension sozialer und<br />
politischer Integration" an der Universität Konstanz, Nr. 68), Konstanz 2005, 10 S. (Standort: USB<br />
Köln(38)-20060106538; Graue Literatur)<br />
INHALT: Im Spannungsfeld zwischen Arbeiterfähigkeiten und Unternehmensrentabilität angesiedelt,<br />
ist die Geschichte der industriellen Psychotechnik integraler Bestandteil einer Unternehmensgeschichte<br />
der Weimarer Republik. Sie steht einerseits für Normierung und Standardisierung<br />
in industriellen Verhältnissen, andererseits ist sie ein wesentlicher Katalysator von<br />
Individualisierungsprozessen in den Unternehmen. In Reflexion auf das Bürokratiemodell<br />
von M. Weber wird hier der Beitrag der Psychotechnik zur Bürokratisierung moderner Unternehmenshierarchien<br />
diskutiert. Dabei konzentriert sich die Analyse auf fünf wesentliche<br />
Merkmale bürokratischer Führung: (1) die sachliche und hierarchische Gliederung der Leitungsebenen,<br />
(2) eine feste Kompetenzzuordnung, (3) Beschäftigung aufgrund freier Auslese,
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 113<br />
4 Management, Unternehmensführung, Personalwesen<br />
(4) Entscheidungsfindung aufgrund definierter Regeln und (5) die schriftliche Fixierung von<br />
Kommunikationsakten. Anhand der Etablierung neuer psychotechnischer Abteilungen in den<br />
Unternehmen lässt sich exemplarisch die Durchsetzung des Weberschen Bürokratiemodells in<br />
der Wirtschaft nachvollziehen. Der Verlauf eines solchen Durchsetzungsprozesses wird am<br />
Beispiel der Osram-Werke verdeutlicht. (ICG2)<br />
[122-F] Remdisch, Sabine, Prof.Dr.; Utsch, Andreas, Dr.; Groß, Mathias, Prof.Dr.; Hülsbusch,<br />
Werner, Dipl.-Ing. (Bearbeitung):<br />
Distance Leadership. Führung auf Distanz<br />
INHALT: Das Projekt ist ein angewandtes Forschungsvorhaben. Ausgangspunkt des Forschungsvorhabens<br />
ist eine praxisrelevante Aufgabenstellung und die Zielsetzung ist es, fundierte Lösungen<br />
zu finden, die anwendbar und von praktischem Nutzen sind. Das Forschungsvorhaben<br />
beinhaltet dementsprechend praktische Zielsetzungen, die vor allem auch den Kooperationspartner<br />
zu gute kommen sollen, sowie wissenschaftliche Zielsetzung, um den Erkenntnisstand<br />
zu Distance Leading fundiert weiterzuentwickeln. 1. Wissenschaftliche Ziele: Entwicklung<br />
eines Verfahrens zur Messung der subjektiv wahrgenommenen Distanz zwischen Mitarbeiter<br />
und Führungskraft; empirische Überprüfung theoretischer Distanzmodelle; empirische Überprüfung<br />
der Unabhängigkeit, bzw. Interdependenzen der Distanzdimensionen; Definition von<br />
'Führung auf Distanz'; Erfassung der organisationalen Rahmenbedingungen, in denen auf Distanz<br />
geführt wird; Bestimmung von critical incidents im Führungsverhalten auf Distanz; Testung<br />
der Wirkung unterschiedlicher Einflussgrößen auf die Einführung, die Ausgestaltung<br />
und den Erfolg der 'Führung auf Distanz': informationstechnische Infrastruktur, personenbezogene<br />
Unterschiede bei Führungskräften (z.B. Persönlichkeit, Führungsstile, Kompetenzen,<br />
Geschlecht, Kultur, etc.), organisationale Kenngrößen; Erfassung förderlicher Bedingungen<br />
zur mitarbeiterorientierten 'Führung auf Distanz' und der Etablierung einer gemeinschaftlich<br />
akzeptierten Arbeitskultur. 2. Praktische Ziele: Systematische Analyse und Darstellung der<br />
'Führung auf Distanz' (auf Mitarbeiterebene, Führungsebene, organisationaler und datentechnischer/<br />
informationstechnischer Ebene): Definition, Boundaries, Schwachstellen und Probleme;<br />
Analyse der informationstechnischen Führungsinstrumente: Art der verarbeiteten Daten<br />
(Produktionsdaten, Personaldaten, Marktdaten etc.), Art und Frequenz der Datenübermittlung<br />
(Telefon, E-Mail, Intranet; täglich, wöchentlich, monatlich etc.), Form der Datenaufbereitung/<br />
Verdichtung (Tabellen, Grafiken, etc.), Art und Frequenz des Datenabrufs durch die Führungskraft<br />
(Papier, Online, Bürosoftware; täglich, wöchentlich, monatlich etc.); Identifizierung<br />
von 'best practice'-Lösungen in den Unternehmen; Identifizierung von Key Competencies<br />
auf Führungsebene für erfolgreiche 'Führung auf Distanz'; Entwicklung eines Handlungsleitfadens<br />
zur Gestaltung von ‚Führung auf Distanz'; Unterstützung der kooperierenden<br />
Unternehmen bei der Gestaltung und Optimierung der 'Führung auf Distanz' hinsichtlich<br />
der: Mediengestaltung der Kommunikation im Führungsprozess, Organisationalen Einbettung,<br />
Implementierung von 'Führung auf Distanz'; Verfassung von Praxisberichten mit den<br />
Kooperationspartnern. Kooperationspartner: Adam Opel AG, Rüsselsheim; Dräger Werke<br />
AG, Lübeck; HeLaBa, Landesbank Hessen Thüringen, Frankfurt; John Deere AG, Mannheim;<br />
Schott AG, Mainz; SIG AG, Schweiz; Sparkassen Informatik, Offenbach.<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: keine Angaben ARBEITSPAPIERE: Managing virtual teams - the<br />
importance of distance leadership. Führen auf Distanz. Präsentation, Neufassung vom<br />
08.04.05. Im Internet unter: http://www.fhnon.de/distanceleadership/download/dl_praesentation-uni.pdf<br />
abrufbar.+++Managing virtual teams - the importance of distance leadership.
114 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
4 Management, Unternehmensführung, Personalwesen<br />
Distance leadership. Presentation, English Version 07/05. Im Internet unter: http://www.<br />
fhnon.de/distanceleadership/download/dl-presentation-eng.pdf abrufbar.+++Literatur - Führung<br />
auf Distanz. Stand 01.02.05. Im Internet unter: http://www.fhnon.de/distanceleadership/literatur/dl_literaturverzeichnis_stand_01_02_05.pdf<br />
abrufbar.<br />
ART: gefördert BEGINN: 2004-10 ENDE: 2006-03 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINAN-<br />
ZIERER: Arbeitsgruppe Innovative Projekte -AGIP- beim Ministerium für Wissenschaft und<br />
Kultur des Landes Niedersachsen<br />
INSTITUTION: Universität Lüneburg, FB Wirtschaftspsychologie, Professur für Evaluation und<br />
Organisation (Wilschenbrucher Weg 84, 21335 Lüneburg); Universität Lüneburg, FB Wirtschaft,<br />
Institut für elektronische Geschäftsprozesse (Volgershall 1, 21339 Lüneburg)<br />
KONTAKT: Utsch, Andreas (Dr. Tel. 04131-6777-797, Fax: 04131-6777-935,<br />
e-mail: utsch@uni-lueneburg.de)<br />
[123-F] Rudert, Katrin; Schmeink, Martina; Schöttelndreier, Aira; NN (Bearbeitung); Bührmann,<br />
Andrea D., Prof.Dr.; Hansen, Katrin, Prof.Dr. (Leitung):<br />
Neue Vielfalt in der Unternehmerschaft: Facetten des Unternehmerinnenbildes. Eine empirische<br />
Analyse des Selbstbildes von Unternehmerinnen<br />
INHALT: Mittlerweile ist zwar die Frage, weshalb Menschen Unternehmen gründen, breit diskutiert<br />
worden: Die Positionen reichen hier von der Unternehmerpersönlichkeit Schumpeterscher<br />
Prägung, bei der eine Gegebenheit des Unternehmertums postuliert wird, über die These<br />
von der Leistungsmotivation bis hin zur so genannten 'Benachteiligungsthese'. Ein anderer<br />
Diskussionsstrang stellt die Untersuchung des Weges in die Selbstständigkeit selbst in den<br />
Mittelpunkt des Forschungsinteresses. Dabei wird in verschiedenen, allerdings zumeist quantitativ<br />
orientierten Untersuchungen deutlich, dass das Umfeld von Unternehmerfamilien und<br />
die Erwerbstätigkeit in Kleinunternehmen auf die unternehmerische Rolle und Funktion hinsozialisierend<br />
wirken. Darüber hinaus ist zum einen untersucht worden, weshalb Frauen weniger<br />
geneigt sind, Unternehmen zu gründen. Zum anderen aber sind auch die Motive erforscht<br />
worden, weshalb Frauen unternehmen gründen. Wie jedoch sehen sich Frauen selbst<br />
im Prozess zwischen dem Entschluss zur unternehmerischen Selbständigkeit bis zur Gründung,<br />
Übernahme oder Weiterführung eines Unternehmens? Welche Rolle spielen hier z.B.<br />
staatliche Programme, aber auch etwa Leitbilder aus der Personalentwicklung oder von beratenden<br />
Institutionen, Organisationen oder Expertinnen bzw. Experten? Ab welchem Zeitpunkt<br />
verstehen sich Frauen selbst z.B. als 'erfolgreiche' Unternehmerinnen? Und wie werden sie<br />
von anderen, an diesen Prozessen beteiligten Akteurinnen und Akteuren gesehen? Bisher<br />
mangelt es an Untersuchungen, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Deshalb werden<br />
diese Forschungsfragen in dem Projekt "Vielfalt in der Unternehmerschaft ..." untersucht:<br />
Dabei sollen empirisch fundierte Erkenntnisse über die Faktoren und Rahmenbedingungen<br />
gewonnen werden, die die Beteiligung von Frauen bei der Gründung, Weiterführung und Übernahme<br />
von Unternehmen in Deutschland fördern oder sie erschweren. Im Mittelpunkt<br />
steht freilich die Frage nach dem Selbstbild von Unternehmerinnen in Deutschland, ihrem<br />
Fremdbild und dem Zusammenspiel beider Perspektiven. Diese Fragestellung wird ausgehend<br />
von der folgenden zentralen Arbeitshypothese bearbeitet: Ein hegemoniales, einseitig männlich<br />
geprägtes Unternehmerbild verhindert, dass Frauen im gleichen Ausmaße wie Männer<br />
Unternehmen gründen, weiterführen und in wachsenden Unternehmen Arbeitgeberfunktionen<br />
übernehmen und damit Arbeitsplätze schaffen. Diese Hypothese wird zum einen über die Befragung<br />
von Unternehmerinnen (narrative Interviews) und ihrer Beratungs- bzw. Förderungs-
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 115<br />
4 Management, Unternehmensführung, Personalwesen<br />
infrastruktur (Experten/-innen-Interviews) sowie zum anderen über eine Diskurs- bzw. Dispositivanalyse<br />
derjenigen Institutionen bzw. Organen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft<br />
erforscht, in denen das Fremdbild von der Unternehmerin hervorgebracht wird. Weitere<br />
Informationen unter: http://www.geschlechterdynamik.uni-dortmund.de/unternehmerinnen<br />
. GEOGRAPHISCHER RAUM: Bundesrepublik Deutschland<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: keine Angaben ARBEITSPAPIERE: Bührmann, Andrea; Hansen,<br />
Katrin; Schmeink, Martina; Schöttelndreier, Aira (Hrsg.): Die Vielfalt des Unternehmerinnenbildes.<br />
Workshop. Münster: Lit-Verl. 2005.<br />
ART: gefördert BEGINN: 2005-01 ENDE: 2007-12 AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER:<br />
Land Nordrhein-Westfalen Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie<br />
INSTITUTION: Universität Dortmund, FB 12 Erziehungswissenschaft und Soziologie, Institut<br />
für Soziologie Professur für Frauenforschung (44221 Dortmund); Fachhochschule Gelsenkirchen<br />
Abt. Bocholt, FB Wirtschaft (Münsterstr. 265, 46397 Bocholt)<br />
KONTAKT: Bührmann, Andrea (Prof.Dr. Tel. 0231-755-6268, Fax: 0231-755-6509,<br />
e-mail: abuehrmann@fb12.uni-dortmund.de)<br />
[124-F] Rump, Jutta, Prof.Dr. (Leitung):<br />
Beschäftigungswirkungen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie - auch unter Berücksichtigung<br />
der demografischen Entwicklung<br />
INHALT: Zeitgemäße und anforderungsgerechte Beschäftigung zu schaffen, zu sichern und zu<br />
erhalten, sowie die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter zu fördern, wird vor dem Hintergrund<br />
der demografischen und wirtschaftlichen Entwicklung ein zentrales Handlungsfeld<br />
künftiger Unternehmensstrategien und staatlicher Wirtschaftspolitik sein müssen. Konzepte<br />
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind als eine der entscheidendsten Voraussetzungen<br />
für die Umsetzung dieser Forderung zu sehen, doch werden beide Themenkomplexe bislang<br />
noch nicht in einem direkten Zusammenhang untersucht. Diese Lücke zu schließen und einen<br />
differenzierten Beschäftigungsbegriff, der qualitative wie quantitative Aspekte berücksichtigt,<br />
einer detaillierten und praxisnahen Analyse zu unterziehen, ist zentrales Anliegen dieses Forschungsvorhabens.<br />
Ziel des Projektes ist es, 1. die quantitativen Beschäftigungswirkungen<br />
von familienbewussten Maßnahmen zu analysieren; 2. die qualitativen Beschäftigungseffekte<br />
von familienbewussten Maßnahmen zu beleuchten und 3. die volkswirtschaftlichen und sektoralen<br />
Beschäftigungswirkungen von familienbewussten Maßnahmen und einer familienorientierten<br />
Politik zu untersuchen.<br />
METHODE: Es werden zum einen die Beschäftigungswirkungen (quantitativ, qualitativ, volkswirtschaftlich/<br />
sektoral) der einzelnen familienbewussten Maßnahmen und Handlungsfelder<br />
(wie Arbeitszeit, Arbeitsablauf, Arbeitsort, Führung, Personalentwicklung, Information und<br />
Kommunikation, Entgelt- und Anreizsysteme, Services für die Familie, Kinderbetreuung ...)<br />
betrachtet. Zum anderen werden die vielfältigen Beschäftigungseffekte (quantitativ, qualitativ,<br />
volkswirtschaftlich/ sektoral) auch aus der interdependenten Perspektive beleuchtet. Interdependent<br />
heißt in diesem Zusammenhang, dass die Art und Weise der Beschäftigungswirkungen,<br />
die sich aus einem kominatorischen Einsatz von familienbewussten Maßnahmen<br />
und Handlungsfelder ergeben, analysiert werden. (So könnte zum Beispiel eine Forschungsfrage<br />
lauten: Welche Beschäftigungseffekte hat die Kombination von Vertrauensarbeitszeitmodell,<br />
alternierender Telearbeit sowie Kinderbetreuung von 8:00 h bis 17:00 h?). Neben<br />
dieser Analyse, die sowohl deskriptive Komponente beinhaltet als auch einen explikativen
116 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
4 Management, Unternehmensführung, Personalwesen<br />
Charakter hat, ergibt sich ein weiteres Ziel. So sollen auf der Basis der Untersuchung Handlungsempfehlungen<br />
für Unternehmen und zur Gestaltung von sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen<br />
abzuleiten. Dabei liegt der Fokus immer auf den Beschäftigungseffekten der<br />
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Partizipatives Design: Es wird angestrebt, das Forschungsvorhaben<br />
in Kooperation mit kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie mit<br />
Großunternehmen aus der Region durchzuführen.<br />
ART: keine Angabe AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Fachhochschule Ludwigshafen - Hochschule für Wirtschaft, Institut für Beschäftigung<br />
und Employability -IBE- (Ernst-Boehe-Str. 4, 67059 Ludwigshafen)<br />
KONTAKT: Leiterin (Tel. 0621-5203-238, e-mail: rump@fh-ludwigshafen.de)<br />
[125-F] Schloderer, Florian, Dr. (Bearbeitung); Marr, Rainer, Univ.-Prof.Dr. (Betreuung):<br />
Intellektuelles Kapital und Wissen: Implikationen der institutionellen Einbindungsform von<br />
Wissensarbeitern<br />
INHALT: Die Bemühungen von Unternehmen, ihre wissensorientierten Ressourcen, das Intellektuelle<br />
Kapital, zu managen, führen nicht immer zum gewünschten Erfolg. Eine der Ursachen<br />
ist, dass das Wissensmanagement zu sehr auf das Management von Daten reduziert wird und<br />
die Rolle der Mitarbeiter als Wissensträger nicht angemessen berücksichtigt wird. Florian<br />
Schloderer entwickelt ein System relevanter Einflussfaktoren für ein erfolgreiches Management<br />
der wissensorientierten Unternehmensressourcen. Dabei spielt die Form der institutionellen<br />
Einbindung der Wissensarbeiter in das Unternehmen durch den "psychologischen Vertrag"<br />
eine zentrale Rolle. Das Zusammenspiel dieser Einflussfaktoren und ihre Wirkungen auf<br />
ökonomische und soziale Effizienzziele von Unternehmen werden eingehend analysiert, und<br />
wichtige Konsequenzen für den Einsatz von Managementinstrumenten, z.B. wissensbezogene<br />
Leitbilder, Indikatorensysteme und IT-Systeme, werden diskutiert. Der Autor präsentiert fundierte<br />
Vorschläge für ein kompetentes innovationsorientiertes Personal- und Wissensmanagement,<br />
in dessen Zentrum der Mitarbeiter als Wissensträger steht. Das Buch wendet sich an<br />
Dozenten und Studenten der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Personalwirtschaft,<br />
Führung, Wissens- und Innovationsmanagement sowie an Führungskräfte und Unternehmensberater<br />
in diesen Bereichen.<br />
METHODE: theoretische Arbeit<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: Intellektuelles Kapital und Wissen: Implikationen der institutionellen<br />
Einbindungsform von Wissensarbeiten. Wiesbaden: Dt. Univ.-Verl. 2005. ISBN 3-<br />
8350-0173-6. Link zum Inhaltsverzeichnis: http://www.duv.de/freebook/3-8350-0173-6_i.pdf<br />
.<br />
ART: Dissertation ENDE: 2005-12 AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER: Wissenschaftler<br />
INSTITUTION: Universität der Bundeswehr München, Fak. für Wirtschafts- und Organisationswissenschaften,<br />
Institut für Personal- und Organisationsforschung Professur für Allgemeine<br />
BWL, Entscheidungs- und Organisationsforschung, Personalwirtschaft (85577 Neubiberg)<br />
KONTAKT: Bearbeiter (Tel. 089-2351-3124, e-mail: florian@schloderer.de)<br />
[126-L] Schumann, Michael:<br />
Mitbestimmung als Medium ressourcenorientierter, innovativer Unternehmenspolitik, in:<br />
SOFI-Mitteilungen : Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen, 2005, Nr. 33, S. 7-15 (Standort:<br />
USB Köln(38)-XG05472; Kopie über den Literaturdienst erhältlich)
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 117<br />
4 Management, Unternehmensführung, Personalwesen<br />
INHALT: Eine Unternehmenspolitik, die den Herausforderungen einer sich globalisierenden<br />
Wirtschaft und verschärften Konkurrenz gewachsen sein und dabei auf die Stärken der deutschen<br />
Ökonomie setzen will, innovatives und nachhaltiges Management sind nicht ohne Mitbestimmung<br />
zu haben. Vor dem Hintergrund der Geschichte der Mitbestimmung in Deutschland<br />
setzt sich der Verfasser zur Begründung dieser These kritisch mit dem in Deutschland<br />
angestrebten Paradigmenwechsel in der Unternehmensführung auseinander, der in Ignoranz<br />
aller positiven Erfahrungen das Heil in der Überwindung der betrieblichen Konsenspolitik<br />
und in der Reetablierung der Ungleichgewichtigkeit von Kapital und Arbeit sucht. Auf der<br />
Basis von Good Practice-Beispielen formuliert der Verfasser als Alternative Elemente und<br />
Prinzipien produktivitäts-, innovations-, qualitäts- und ressourcenorientierter Arbeits- und<br />
Organisationsformen. Dabei geht es vor allem um drei gewichtige arbeits- und betriebsorganisatorische<br />
Veränderungen: (1) Erweiterung der Handlungsspielräume bei Gruppenarbeit;<br />
(2) neues Profil für die Meisterposition; (3) Neukombination von Arbeit und Lernen. Ein Beispiel<br />
für eine ressourcenorientierte Unternehmensgestaltung ist das Projekt "Auto 5000" bei<br />
VW. Mit aktiver Beteiligung der Gewerkschaften müssen nachhaltige Unternehmensstrategien<br />
entwickelt werden, die der Wirtschaft und der Industrie am Standort Deutschland eine<br />
Zukunft sichern. (ICE2)<br />
[127-L] Speidel, Frederic:<br />
Mitbestimmte versus managementbestimmte Globalisierung in der Automobilindustrie: ein<br />
Vergleich der Internationalisierungsstrategien und ihrer Verarbeitungen durch die Akteure<br />
der industriellen Beziehungen am Beispiel VWs und Renaults, München: Hampp 2005, 318 S.,<br />
ISBN: 3-87988-925-2 (Standort: USB Köln(38)-32A4535)<br />
INHALT: "Rückblickend thematisiert die vorliegende Studie die Auswirkungen globalisierter<br />
Produktions- und Wettbewerbsbedingungen auf die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen<br />
in der europäischen Automobilindustrie während der neunziger Jahre unter besonderer Berücksichtigung<br />
der Unternehmen Volkswagen und Renault. Im Kern wird der Frage nachgegangen,<br />
ob unter Einfluss intensivierter ökonomischer Internationalisierung Konvergenzprozesse<br />
sowohl auf der Institutionenebene der industriellen Beziehungen als auch auf der Ebene<br />
der Problemverarbeitungsresultate einhergehen. Eines der zentralen Ergebnisse der Studie<br />
lautet, dass der Globalisierungsschub der jüngeren Vergangenheit keine Homogenisierung der<br />
Institutionen und Praktiken, geschweige denn die vollständige De-Institutionalisierung der<br />
industriellen Beziehungen nach sich gezogen hat, sondern stattdessen länder- und unternehmensspezifische<br />
Aushandlungs- und Regulierungssysteme fortbestehen und diese - wie die<br />
Gegenüberstellung der industriellen Beziehungen VWs und Renaults zeigt - zu unterschiedlichen<br />
Resultaten der Problemverarbeitung führen. Die im Falle VWs vorherrschende gestaltungsorientierte<br />
Einbindung der Arbeitnehmervertretung in strategische Unternehmensentscheidungen<br />
wird als mitbestimmte Globalisierung bezeichnet. Im Falle Renaults ist aufgrund<br />
des zumeist nur reaktiv-symbolischen, allenfalls schadenbegrenzenden Widerstands der Arbeitnehmervertretung<br />
gegen die internationalen Restrukturierungsprojekte des Unternehmens<br />
von managementbestimmter Globalisierung die Rede." (Autorenreferat)<br />
[128-F] Treeck, Werner van, Prof.Dr.; Beckenbach, Niels, Prof.Dr. (Bearbeitung):<br />
Entwicklung neuer betrieblicher Organisationsformen
118 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
4 Management, Unternehmensführung, Personalwesen<br />
INHALT: Projektmanagement in der Automobilindustrie: Untersuchung der Probleme, die aus<br />
der Einbettung projektförmiger Organisationsstrukturen in einer weitgehend durchbürokratisierte<br />
Organisationslandschaft entstehen (4 Automobilbetriebe).<br />
ART: keine Angabe AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Universität Kassel, FB 05 Gesellschaftswissenschaften, Fachgruppe Soziologie<br />
Fachgebiet Arbeits- und Sozialpolitik (Nora-Platiel-Str. 5, 34109 Kassel); Universität Kassel,<br />
FB 05 Gesellschaftswissenschaften, Fachgruppe Soziologie Fachgebiet Betriebs- und Industriesoziologie<br />
(Nora-Platiel-Str. 1, 34109 Kassel)<br />
KONTAKT: Sekretariat (Tel. 0561-804-3459, Fax: 0561-804-3068,<br />
e-mail: mwarnke@uni-kassel.de)<br />
[129-F] Wagner, Alexandra, Dr. (Bearbeitung); Kotthoff, Hermann, Prof.Dr. (Leitung):<br />
Führungskräfte und außertarifliche Angestellte im Wandel der Firmenkultur - eine Followup-Studie<br />
INHALT: Die vor zehn Jahren vom Antragsteller durchgeführte und von der Hans-Böckler-<br />
Stiftung geförderte qualitative Studie "Führungskräfte im Wandel der Firmenkultur" soll wiederholt<br />
werden, um einen Zeitreihenvergleich zu ermöglichen. Das Forschungsdesign wird<br />
um eine quantitative Untersuchung zur Erosion des Status von außertariflich bezahlten Beschäftigten<br />
erweitert. Kontext/ Problemlage: Die Mitte der neunziger Jahre durchgeführte<br />
Führungskräfteuntersuchung zeigte, dass sich der Status hoch qualifizierter Angestellter und<br />
der Führungskräfte im Umbruch befand. Erstmals war diese bis dahin privilegierte Gruppe<br />
von Personalabbau betroffen. Hinsichtlich Arbeitsorientierung und Firmenbezug waren sie<br />
beitragsorientierte Leistungsträger gewesen; ihr bis dahin hohes Maß an Loyalität mit dem<br />
Unternehmen und dem Top-Management erodierte. Das Tempo der Restrukturierungen hat<br />
sich in der Zwischenzeit noch erhöht. Sind die Hochqualifizierten inzwischen "Arbeitskraftunternehmer"<br />
geworden oder suchen sie weiterhin eine langfristige Bindung, Sicherheit und<br />
"commitment" unter dem Mantel der Firma? Für die Gewerkschaften ist dies von Bedeutung,<br />
weil die Reduzierung der Loyalität mit dem Unternehmen bei dieser Personengruppe mit einer<br />
größeren Offenheit für gewerkschaftliche Fragen verbunden sein könnte. Fragestellung:<br />
Gefragt wird nach: a) den Arbeitsbedingungen, der Arbeitsidentität, der Leistungsregulierung<br />
und dem Karriereverhalten von Führungskräften; b) der Arbeitskultur im sozialen Mikrobereich<br />
(Vorgesetzte und Kollegen); c) der Firmenkultur: Identifikation, Aufbau von Vertrauen<br />
in Zeiten hoher Flexibilisierung, Führungskräfteentwicklung; d) dem Interessenbewusstsein<br />
und -handeln, Präsenz und Wahrnehmung von Betriebsrat und Gewerkschaft. Über diese vier<br />
Dimensionen aus der Vorgängeruntersuchung hinaus werden auch: e) die gegenwärtigen Initiativen<br />
einzelner Firmen, durch eine nivellierende Statuspolitik bisherige Privilegien abzubauen<br />
- z.B. durch Verletzung des Abstandsgebots (Gehaltsabstand der Außertariflichen zur<br />
obersten Tarifgruppe) und durch befristete Einstellung -, untersucht: Werden Statusgrenzen<br />
abgebaut und die Hochqualifizierten zu "normalen" Arbeitnehmern? Wird aus der Führungskraft<br />
der Wissensarbeiter?<br />
METHODE: Die Untersuchung findet in den zehn Konzernen der Erstuntersuchung statt. In jedem<br />
Konzern werden strukturierte Leitfadeninterviews mit acht hoch qualifizierten Angestellten/<br />
Führungskräften aus unterschiedlichen Funktionsbereichen und Expertengespräche mit<br />
dem Personalmanagement und dem Betriebsrat geführt. Sofern sie noch im Unternehmen<br />
sind, werden die ehemaligen Interviewpartner erneut interviewt; andernfalls werden ihre<br />
Nachfolger befragt. Abweichend von der Methodik der Erstuntersuchung wird auch eine auf
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 119<br />
4 Management, Unternehmensführung, Personalwesen<br />
wenige Fragen begrenzte quantitative Erhebung durchgeführt, die sich auf Aspekte der Untersuchungsdimension<br />
e) bezieht. Dazu sollen im Betriebspanel des IAB einige Fragen zum AT-<br />
Status (Gehaltsabgrenzung, Arbeitszeitregelung) gestellt werden.<br />
ART: gefördert AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: Hans-Böckler-Stiftung<br />
INSTITUTION: Technische Universität Darmstadt, FB 02 Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften,<br />
Institut für Soziologie (Residenzschloss, 64283 Darmstadt); Forschungsteam Internationaler<br />
Arbeitsmarkt GmbH -FIA- (Jägerstr. 56, 10117 Berlin)<br />
KONTAKT: Leiter (e-mail: hermann.kotthoff@web.de); Bearbeiterin<br />
(e-mail: wagner@fia-institut.de)<br />
[130-F] Wieland, Josef, Prof.Dr. (Bearbeitung):<br />
Wertemanagement - der Faktor Moral in Risikomanagementsystemen<br />
INHALT: keine Angaben<br />
ART: keine Angabe AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Fachhochschule Konstanz, FB Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Postfach<br />
100543, 78405 Konstanz)<br />
KONTAKT: Bearbeiter (e-mail: wieland@fh-konstanz.de)<br />
5 Qualifikation, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Arbeitszeit<br />
[131-F] Brunswig, Susanne (Bearbeitung):<br />
Kernkompetenzen bei Dienstleistungsunternehmen<br />
INHALT: keine Angaben<br />
ART: Dissertation AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Universität Lüneburg, FB 02 Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Institut für<br />
BWL Abt. Strategisches Management und Tourismusmanagement (Scharnhorststr. 1, 21332<br />
Lüneburg)<br />
KONTAKT: Bearbeiterin (e-mail: brunswig@uni-lueneburg.de)<br />
[132-F] Geissler, Birgit, Prof.Dr. (Bearbeitung):<br />
Neustrukturierung der Relation öffentlich-privat: Wandel familialer Lebensformen und<br />
Entwicklung haushaltsbezogener Dienstleistungen<br />
INHALT: keine Angaben<br />
ART: keine Angabe AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Universität Bielefeld, Fak. für Soziologie, WE V Arbeit und Organisation Professur<br />
für Arbeitssoziologie und Sozialwissenschaften (Postfach 100131, 33501 Bielefeld)<br />
KONTAKT: Bearbeiter (Tel.: 0521-106-3870, e-mail: birgit.geissler@uni-bielefeld.de)
120 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
5 Qualifikation, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Arbeitszeit<br />
[133-F] Geissler, Birgit, Prof.Dr. (Bearbeitung):<br />
Arbeitsmarktintegration und Modernisierung der Lebenslage und Lebensplanung von Frauen:<br />
Diskontinuität und Flexibilität in weiblichen Berufsbiographien, Entstehung und 'Sinn'<br />
irregulärer Arbeitszeiten, gemischter Arbeitsformen und Einkommen (Teilzeitarbeit, selbständiger<br />
Tätigkeit, Eigenarbeit, soziale Transfers)<br />
INHALT: t, Eigenarbeit, soziale Transfers)<br />
ART: keine Angabe AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Universität Bielefeld, Fak. für Soziologie, WE V Arbeit und Organisation Professur<br />
für Arbeitssoziologie und Sozialwissenschaften (Postfach 100131, 33501 Bielefeld)<br />
KONTAKT: Bearbeiterin (Tel.: 0521-106-3870, e-mail: birgit.geissler@uni-bielefeld.de)<br />
[134-F] Geissler, Birgit, Prof.Dr. (Bearbeitung):<br />
Lebenslaufpolitik und Lebensplanung: Arbeitszeit und biographische Zeit als soziale Strukturierungsdimension<br />
von Lebensläufen - geschlechtsspezifisch ausgeprägte Wechselbeziehung<br />
von familialem Alltag, Arbeitszeit, Eigenzeit und 'time to care'<br />
INHALT: keine Angaben<br />
ART: keine Angabe AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Universität Bielefeld, Fak. für Soziologie, WE V Arbeit und Organisation Professur<br />
für Arbeitssoziologie und Sozialwissenschaften (Postfach 100131, 33501 Bielefeld)<br />
KONTAKT: Bearbeiterin (Tel.: 0521-106-3870, e-mail: birgit.geissler@uni-bielefeld.de)<br />
[135-F] Gürtzgen, Nicole, Dr.; Gernandt, Johannes; Pohlmeier, Winfried, Prof.Dr.; Kemnitz,<br />
Alexander, PD Dr.; Dustmann, Christian, Prof.Ph.D.; Autor, David, Prof.Ph.D. (Bearbeitung);<br />
Pfeiffer, Friedhelm, PD Dr. (Leitung):<br />
Bildung, Lohnungleichheit und Lohnsetzung<br />
INHALT: In diesem Projekt werden mit den Daten des SOEP 1984 bis 2004 die Entwicklung der<br />
Lohnverteilung und die Rolle der Bildung für die Zunahme der Lohnungleichheit (seit 1999)<br />
untersucht. Eine weitere zukünftige Fragestellung wird der Zusammenhang zwischen zunehmender<br />
Lohnungleichheit und (institutionellen) Lohnrigiditäten sein. Wie viel Lohnungleichheit<br />
wird benötigt, um den Teil der Lohnaufschwemmung zu eliminieren, der nicht durch Effizienzgründe<br />
begründet ist? Zu diesem Zweck wird der Einfluss von Flächen- und Firmentarifen<br />
auf die qualifikatorische Lohnstruktur mit den LIAB-Daten des IAB analysiert. ZEIT-<br />
RAUM: seit 1999<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: Ludwig, Volker; Pfeiffer, Friedhelm: Abschreibungsraten allgemeiner<br />
und beruflicher Ausbildungsinhalte - empirische Evidenz auf Basis subjektiver Einschätzungen.<br />
in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 2006 (im Druck).+++ Gernandt,<br />
Johannes; Pfeiffer, Friedhelm: Rising wage inequality in Germany. ZEW Discussion<br />
Paper, No. 06-019. Mannheim 2006.+++Dies.: Einstiegslöhne bei unvollkommenen Arbeitsmärkten.<br />
in: Perspektiven der Wirtschaftspolitik, 7, 2006, 2, S. 1-26.<br />
ART: Eigenprojekt BEGINN: 2005-08 ENDE: 2006-07 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FI-<br />
NANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH -ZEW- (Postfach<br />
103443, 68034 Mannheim)
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 121<br />
5 Qualifikation, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Arbeitszeit<br />
KONTAKT: Leiter (Tel. 0621-1235-150, Fax: 0621-1235-225, e-mail: pfeiffer@zew.de)<br />
[136-F] Hamburger, Joachim, Dipl.-Wirtsch.-Ing.; Langner, Matthias, Dipl.-Kfm.; Maser, Werner,<br />
Dipl.-Kfm. (Bearbeitung); Schule, Achim, Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Leitung):<br />
Qualifizierungskonzept für Unternehmer und Arbeitnehmer zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit<br />
- Bewältigung des demographischen Wandels am Beispiel des Bauhandwerks<br />
in Rheinland-Pfalz<br />
INHALT: Förderung der Beschäftigungsfähigkeit älterer und älter werdender Mitarbeiter in Bauhandwerksbetrieben.<br />
Qualifizierungskonzept für Unternehmer und Arbeitnehmer. GEOGRA-<br />
PHISCHER RAUM: Rheinhessen<br />
METHODE: Entwicklung, Durchführung und Evaluation des Konzeptes.<br />
ART: gefördert BEGINN: 2005-01 ENDE: 2006-12 AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER:<br />
Land Rheinland-Pfalz; Generaldirektion Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit<br />
-Europäischer Sozialfonds-<br />
INSTITUTION: Institut für Technik der Betriebsführung Forschungsstelle im Deutschen Handwerksinstitut<br />
e.V. (Postfach 3324, 76019 Karlsruhe)<br />
KONTAKT: Leiter (Tel. 0721-9310317, e-mail: schulte@itb.de)<br />
[137-F] Hammer, Eckart, Prof.Dr.; Bartjes, Heinz, Dr. (Bearbeitung):<br />
Mehr Männer in den Altenpflegeberuf<br />
INHALT: Problemstellung: Die Studie zur Personalsituation in der Altenhilfe in Baden-<br />
Württemberg (2003) hat erneut den Befund bestätigt, dass die meisten jungen Männer keinen<br />
Zugang zu direkter Pflegearbeit und damit verbundenen Ausbildungen haben. Jugendliche<br />
und Heranwachsende werten Pflege und Sorgearbeit häufig als "weibisch" ab und sehen<br />
durch einschlägige Ausbildungen ihre männliche Identität bedroht. Damit verstellen sich<br />
Männer einen Zugang und Berufsoptionen zu einem großen und zentralen Lebens- und Arbeitsbereich,<br />
der für die Entwicklung einer kritischen Männlichkeit und von Gendergerechtigkeit<br />
von hoher Bedeutung wäre. Entscheidend ist jedoch, dass Männer durch diese Abwertung<br />
von Pflege als "Nur-(Haus-)Frauenberuf" der nötigen Attraktivität und Aufwertung des<br />
Berufs, die für eine nachhaltige Verbesserung der Personalsituation in der Altenhilfe unabdingbar<br />
sind, schaden. Projektziele und Inhalte: Um die Männerquote in der Altenhilfe zu erhöhen,<br />
wird sich die Expertise insbesondere mit der Schlüsselsituation Berufswahl junger<br />
Männer beschäftigen. In Anbetracht der Kürze der Projektzeit und der beschränkten Projektzeit<br />
und der beschränkten Projektmittel wird die Studie insbesondere darauf abzielen, einige<br />
erfolgreiche Beispiele und hierbei erforderliche Rahmenbedingungen für eine Schienung der<br />
Berufsorientierung junger Männer in Richtung Sozialer Arbeit im Allgemeinen und Altenhilfe<br />
im Besonderen zu identifizieren. Ausgangspunkt werden ein eher kursorischer sekundäranalytischer<br />
Überblick über die aktuellen Ergebnisse der kritischen Männer- und Jungenforschung<br />
zur Berufswahl und den dahinter liegenden Rollenbildern und Wertvorstellungen sowie<br />
eine Sichtung geschlechtsbezogener berufssoziologischer Literatur sein. Im Zentrum der<br />
Expertise sollen bestehende Ausbildungs- und Berufswege junger Männer mit einer potentiellen<br />
Orientierung auf Pflege sowie einige exemplarische Erfolg versprechende einschlägige<br />
Best-Practise-Modelle in den Blick genommen werden. Dabei sollen vor allem die in diesen<br />
Einzelprojekten notwendigen Faktoren und Schlüsselsituationen identifiziert werden, die zu
122 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
5 Qualifikation, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Arbeitszeit<br />
einer gelingenden Einmündung in einen Pflegeberuf beitragen. So kann der erforderliche Praxisbezug<br />
nicht nur über exemplarische Einzelprojekte sondern vor allem auch über generalisierbare<br />
strukturelle und methodische Handlungsempfehlungen beschrieben werden. Insgesamt<br />
fokussieren die Projektbearbeiter die Perspektive, dass die hier zu bearbeitende Fragestellung<br />
nur als breit angelegter, den Rahmen der Altenhilfe überschreitender Ansatz verfolgt<br />
werden kann. Da das Thema der Expertise "Mehr Männer in die Altenhilfe" ähnlich auch in<br />
anderen Feldern der Sozialen Arbeit und im Gesundheitswesen diskutiert wird, sind diese<br />
Diskurse und die dort verfolgten Bemühungen systematisch mit zu berücksichtigen.<br />
METHODE: Folgende methodischen Zugänge sind für die Expertise geplant: Sichtung und Aufbereitung<br />
einschlägiger Literatur; Aufbereitung eigener Forschungs- und Projektergebnisse;<br />
Sichtung und Analyse von Best-Practise-Modellen; Expertengespräche. DATENGEWIN-<br />
NUNG: Aktenanalyse, offen. Dokumentenanalyse, offen. Qualitative Befragung, mündlich.<br />
Feldarbeit durch Mitarbeiter/-innen des Projekts.<br />
ART: Auftragsforschung; gefördert; Gutachten BEGINN: 2004-10 ENDE: 2005-05 AUFTRAG-<br />
GEBER: Caritasverband Diözese Rottenburg-Stuttgart FINANZIERER: Equal<br />
INSTITUTION: Evangelische Fachhochschule Reutlingen-Ludwigsburg, Institut für angewandte<br />
Forschung -IAF- (Auf der Karlshöhe 2, 71638 Ludwigsburg); Fachhochschule Esslingen<br />
Hochschule für Sozialwesen (Flandernstr. 101, 73732 Esslingen)<br />
KONTAKT: Hammer, Eckart (Prof.Dr. Tel. 07141-965-153,<br />
e-mail: e.hammer@efh-ludwigsburg.de)<br />
[138-F] Hülshoff, Theo, Prof.Dr. (Bearbeitung); Götz, Klaus, Prof.Dr. (Leitung):<br />
Das Wissen der Arbeiter<br />
INHALT: keine Angaben<br />
METHODE: keine Angaben DATENGEWINNUNG: Inhaltsanalyse, offen; Aktenanalyse, offen;<br />
Qualitatives Interview. Feldarbeit durch Mitarbeiter/-innen des Projekts.<br />
ART: Auftragsforschung BEGINN: 2002-09 ENDE: 2006-09 AUFTRAGGEBER: Bundesministerium<br />
für Bildung und Forschung FINANZIERER: Auftraggeber<br />
INSTITUTION: Universität Koblenz-Landau Campus Landau, Zentrum für Human Resource<br />
Management -ZHRM- (Bürgerstr. 23, 76829 Landau)<br />
KONTAKT: Leiter (Tel. 06341-906-403, e-mail: goetz@uni-landau.de)<br />
[139-L] Kocyba, Hermann:<br />
Selbstverwirklichung im Unternehmen - Chance oder Anerkennungsfalle?, in: Maria Funder,<br />
Steffen Dörhöfer, Christian Rauch (Hrsg.): Jenseits der Geschlechterdifferenz? : Geschlechterverhältnisse<br />
in der Informations- und Wissensgesellschaft: Hampp, 2005, S. 139-153, ISBN: 3-<br />
87988-960-0 (Standort: USB Köln(38)-32A5609)<br />
INHALT: Der Beitrag thematisiert die Karriereproblematik in Organisationen. Auf dem Hintergrund,<br />
dass Hierarchieabbau, Dezentralisierung, Aufgabenintegration und partizipative Arbeitsgestaltung<br />
für viele Beschäftigte Chancen zur Identifikation mit der eigenen Arbeit und<br />
zur Selbstverwirklichung in der Arbeit schaffen, geht es hier um konstitutive Merkmale neuer<br />
Managementkonzepte und den neuen normativen "Selbstverwirklichungsimperativ". Beleuchtet<br />
wird der "Zwang" zur professionellen Autonomie und Selbststeuerung. Zur Untersuchung<br />
der Auswirkungen dieser neuen Steuerungsformen auf Beschäftigungsmöglichkeiten und
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 123<br />
5 Qualifikation, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Arbeitszeit<br />
Karrierechancen von Frauen bezieht sich der Autor auf die empirischen Ergebnisse einer<br />
Fallstudie, die in einer Frankfurter Bank durchgeführt wurde. Hierbei kommt er zu dem Ergebnis,<br />
dass sich im Finanzsektor Frauen zunehmend in hoch qualifizierten, gut bezahlten Tätigkeiten<br />
positionieren können, sich aber im Gegensatz zu den aufstiegsorientierten Karrieremustern<br />
der Männer eher in einer "Fachkarriere" wieder finden. Abschließend geht es um<br />
Auswirkungen des performativ-zirkulären Charakters aktueller Selbstverwirklichungsrhetoriken.<br />
(ICH)<br />
[140-L] Kutzner, Edelgard:<br />
Arbeit in einem neuen Dienstleistungsbereich: Verändern Call Center traditionelle Arbeitsteilungen<br />
zwischen den Geschlechtern?, in: Maria Funder, Steffen Dörhöfer, Christian Rauch<br />
(Hrsg.): Jenseits der Geschlechterdifferenz? : Geschlechterverhältnisse in der Informations- und<br />
Wissensgesellschaft: Hampp, 2005, S. 233-257, ISBN: 3-87988-960-0 (Standort: USB Köln(38)-<br />
32A5609)<br />
INHALT: Der moderne Dienstleistungssektor besteht bekanntermaßen nicht nur aus dem Segment<br />
der hoch qualifizierten Arbeit. Vielmehr umfasst er auch eine Vielzahl von interaktiven<br />
Dienstleistungstätigkeiten, die als Grenzstellenarbeit definiert werden können. Hierzu gehört<br />
fraglos auch der in den letzten Jahren wachsende Bereich der Call-Center. Im Zentrum des<br />
Beitrages steht daher die zentrale Frage, ob sich in Call-Centern, als einem neuen Dienstleistungsbereich,<br />
die traditionellen Geschlechterarrangements fortschreiben oder ob sich in diesem<br />
Bereich geschlechtergerechte Strukturen herausbilden. Anhand empirischer Erhebungen<br />
in fünf Call-Centern wird auf die Heterogenität der vorgefundenen Ausprägungen von Geschlechterbeziehungen<br />
verwiesen, so dass auf der einen Seite die Ordnung der Geschlechter<br />
durchaus in "Un-Ordnung" gekommen ist, sich aber andererseits die traditionellen Arbeitsteilungen<br />
zwischen den Geschlechtern reproduzieren. Call-Center zeichnen sich jedoch dadurch<br />
aus, dass sie Geschlecht in einer für sie spezifischen Weise in ihre Strukturen und Prozesse<br />
flexibel einbinden. Es ist deshalb notwendig, die Entwicklungen zu verfolgen, um die Chancen<br />
dort für mehr Geschlechtergerechtigkeit im Betrieb zu nutzen. (ICH2)<br />
[141-L] Lehndorff, Steffen (Hrsg.):<br />
Das Politische in der Arbeitspolitik: Ansatzpunkte für eine nachhaltige Arbeits- und Arbeitszeitgestaltung,<br />
Berlin: Ed. Sigma 2006, 279 S., ISBN: 3-89404-534-5<br />
INHALT: Angesichts andauernder Massenarbeitslosigkeit haben Arbeitsforschung und Arbeitspolitik<br />
keine Konjunkur. Dem wird ein Verständnis von Arbeitsforschung entgegengesetzt,<br />
deren Analysen Ausdruck der Widersprüche in den praktischen Arbeitsprozessen sind, und<br />
die darauf zielt, Ansatzpunkte für eine nachhaltige Arbeits- und Arbeitszeitgestaltung herauszuarbeiten.<br />
Das Buch enthält Beträge aus dem Forschungsschwerpunkt "Arbeitszeit und Arbeitsorganisation"<br />
des Instituts für Arbeit und Technik in Gelsenkirchen. Der erste Teil "versammelt<br />
Befunde und Einschätzungen zu Problemen und Tendenzen betrieblicher Arbeitspolitik<br />
und zu den veränderten Rahmenbedingungen, unter denen diese heute stattfindet". Der<br />
zweite Teil präsentiert Beiträge, "die aus unterschiedlichen Perspektiven das Zusammenspiel<br />
von Akteuren und Institutionen sowie der Politik von Akteuren in verschiedenen Arenen betrachten".<br />
(IAB2). Inhaltsverzeichnis: Steffen Lehndorff: Einleitung: Das Politische in der<br />
Arbeitspolitik (7-29); Teil 1: Betriebliche Arbeitsgestaltung ohne Kompass und Ruder?: Erich
124 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
5 Qualifikation, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Arbeitszeit<br />
Latniak: Auf der Suche nach Verteilungs- und Gestaltungsspielräumen. Eine Bilanz der Organisationsveränderungen<br />
seit den 90er Jahren (33-70); Anja Gerlmaier: Nachhaltige Arbeitsgestaltung<br />
in der Wissensökonomie? Zum Verhältnis von Belastung und Autonomie in<br />
neuen Arbeitsformen (71-98); Gabi Schilling, Erich Latniak: Betriebliche Grenzen der 'Verbetrieblichung'<br />
- Erfahrungen bei der Einführung flexibler Arbeitszeitmodelle in kleinen und<br />
mittleren Unternehmen (99-126); Steffen Lehndorff, Dorothea Voss-Dahm: Kunden, Kennziffern<br />
und Konkurrenz: Markt und Organisation in der Dienstleistungsarbeit (127-153); Teil<br />
2: Institutionen zwischen Deregulierung und Neubegründung: Steffen Lehndorff: Sicherheit<br />
anbieten, Vielfalt ermöglichen - Über Krise und Reformen der Arbeitszeitregulierung (157-<br />
194); Thomas Haipeter: Betriebsräte unter Handlungsdruck - Interessenvertretungspolitik im<br />
Zeichen der flexiblen Arbeitszeitregulierung (195-225); Sebastian Schief: Nationale oder unternehmensspezifische<br />
Muster der Flexibilität? Eine empirische Untersuchung von Flexibiltätsmustern<br />
aus- und inländischer Unternehmen in fünf europäischen Ländern (227-248);<br />
Steffen Lehndorff: Motor der Entwicklung - oder fünftes Rad am Wagen? Soziale Dienstleistungen<br />
als gesellschaftliche Investitionen (249-277).<br />
[142-L] Mönig-Raane, Margret (Hrsg.):<br />
Zeitfragen sind Streitfragen: ein zeitpolitisches Projekt setzt Zeichen für die Praxis, Hamburg:<br />
VSA-Verl. 2005, 222 S., ISBN: 3-89965-106-5 (Standort: UB Bonn(5)-2006-764)<br />
INHALT: "Wenn im Dienstleistungsbereich Öffnungs- und Servicezeiten verändert oder sogar<br />
erweitert werden, hat dies Auswirkungen auf die Arbeitszeiten der dort Beschäftigten. Die<br />
Folge: Die Beschäftigten ihrerseits formulieren neue zeitliche Ansprüche an Dienstleister.<br />
Der Verkäuferin mit Arbeitszeiten bis 20 Uhr reichen Kita-Öffnungszeiten bis 18 Uhr nicht<br />
mehr aus. Erweiterte Öffnungszeiten der Kita in der Nähe des Kaufhofs führen dazu, dass die<br />
Erzieherin mit Dienst bis 20 Uhr nun selbst das Problem hat, ihre Kinder, gerade schulpflichtig,<br />
versorgt zu wissen... Wie kann es gelingen, die unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse<br />
unter einen Hut zu bringen? Die ver.di Bundesverwaltung, Abteilung Frauen- und<br />
Gleichstellungspolitik, nahm sich dieser Aufgabe an und förderte das Projekt 'Zeitfragen sind<br />
Streitfragen'. Für eine Projektteilnahme konnten in Berlin die Galena Kaufhof am Ostbahnhof,<br />
die Vivantes Gesundheitsnetzwerk GmbH und Fröbel e.V. (Kinderbetreuung) gewonnen<br />
werden. Hieraus entstand ein venetztes lokales Projekt. In Bremen beteiligte sich das Bürger-<br />
ServiceCenter, wobei die Bürgerinnen als Kundinnen intensiv in die Projektarbeit einbezogen<br />
wurden. Gemeinsam entwickelten Leitungskräfte, Mitarbeiterinnen, Betriebs-/Personalräte<br />
und Bürgerinnen vor Ort neue Formen der Zeitgestaltung." (Autorenreferat). Inhaltsverzeichnis:<br />
Margret Mönig-Raane: Emanzipatorische Arbeitszeitpolitik. Das Projekt, integriert in einer<br />
arbeitszeitpolitischen Initiative (7-12); Vera Morgenstern: Zeitfragen sind Streitfragen -<br />
ein gewerkschaftliches Handlungsfeld (13-19); Heidemarie Gerstle/Heike Werner: Das vernetzte<br />
Teilprojekt Friedrichshain/Kreuzberg in Berlin (20-27); Christoph Schilling: Personaleinsatzplanung<br />
im Team - bessere Bewältigung von Kunden-, Alltags- und Arbeitszeitinteressen.<br />
Das Projekt bei Kaufhof (Berlin-Ostbahnhof) aus der Sicht der Geschäftsführung (28-<br />
38); Frank Beyer: Verantwortung übernehmen und Arbeitszeitwünsche mitgestalten. Das Projekt<br />
bei Kaufhof (Berlin-Ostbahnhof) aus Sicht des Betriebsrates (39-46); Ernst-Otto Kock:<br />
Neue Zeiten für Stationen und Schnittstellen - Voraussetzung für eine bedarfsgerechte Zeitgestaltung.<br />
Das Projekt bei Vivantes aus Sicht der Geschäftsführung (47-53); Ina Colle/Ulrike<br />
Burchardt: Transparenz durch einen beteiligungsorientierten Ansatz. Das Projekt bei Vivantes<br />
aus Sicht der Interessenvertretung (54-58); Gabriele Scholz-Sikojev: Mit bedarfsgerechten
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 125<br />
5 Qualifikation, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Arbeitszeit<br />
Öffnungszeiten und innovativen Arbeitszeiten konkurrenzfähig für die Zukunft. Das Projekt<br />
bei Fröbel e.V. aus Sicht der Geschäftsführung (59-67); Kerstin Priebisch: Erweiterte Öffnungszeiten<br />
- Möglichkeiten und Grenzen. Das Projekt bei Fröbel e.V./'Kieke mal' aus Sicht<br />
des Betriebsrates (68-69); Hans-Jörg Wilkens: Bausteine für ein mitarbeiter- und bürgerorientiertes<br />
BürgerServiceCenter in Bremen. Das Projekt aus Sicht der Amtsleitung (70-90); Doris<br />
Hülsmeier/Peter Garrelmann/Marita Rosenow/Hildegard Piplak/Milko Neumann/Harm<br />
Dunkhase: Das BürgerServiceCenter Bremen aus personalrätlicher und gewerkschaftlicher<br />
Sicht (91-117); Ute Buggeln/Ulrich Mückenberger: Zeitpolitische Entdeckungsverfahren.<br />
Choice-Work, Bürgergutachten, Mediation (118-155); Barbara Dürk/Beate Herzog: Die Beteiligung<br />
der Betroffenen als Voraussetzung für den Projekterfolg. Inhalt, Struktur, Verfahren,<br />
Instrumente (156-168); Helga Hentschel: Warum Zeitfragen immer noch vor allem Frauenfragen<br />
sind (169-178).<br />
[143-F] Mücke, Anja, Dipl.-Psych.; Mäder, Ueli, Prof.Dr. (Bearbeitung); Töngi, Claudia, Dr.;<br />
Zölch, Martina, Prof.Dr. (Leitung):<br />
Balance - Teilzeitmodelle und Jobsharing für Dozierende<br />
INHALT: Wegweisend für die Ausarbeitung des Projekts waren Diskussionen und erste Forschungen<br />
zu Jobsharing- und Teilzeitmodellen für Führungskräfte in Wirtschaft und Verwaltung:<br />
Ob Führung tatsächlich teilbar ist, ob sich Aufgaben auf hohem Niveau auch mit einem<br />
reduzierten Pensum bewältigen lassen, ob Teilzeitmodelle nicht lediglich einen Lohnabbau<br />
bei faktisch gleicher Arbeitsbelastung bringen bzw. welches die Grenzen und Chancen sowohl<br />
für Arbeitgeber wie für StelleninhaberInnen sind, sind Fragen, die an den Universitäten<br />
noch kaum diskutiert werden. Da der Universitätsbetrieb in vieler Hinsicht nicht mit einem<br />
Unternehmen oder mit anderen Verwaltungen vergleichbar ist, können Forschungsergebnisse<br />
aus diesen Bereichen nicht ohne weiteres auf den akademischen Kontext übertragen werden.<br />
Allgemein wird Teilzeitarbeit in der Wissenschaft als eher schwierig eingeschätzt. Insbesondere<br />
die Forschung erfordere, soll sie sich auf höchstem Niveau halten und in der internationalen<br />
Konkurrenz bestehen, ein hundert- wenn nicht zweihundertprozentiges Engagement.<br />
Die Bedingungen einer Professur unterscheiden sich denn auch in vielen Aspekten von einer<br />
Kaderposition in Wirtschaft oder Verwaltung. Ihr Aufgabenprofil ist ausgesprochen vielfältig,<br />
was besondere Chancen, aber auch Probleme für die Umsetzung von Teilzeitmodellen bergen<br />
kann. Hinzu kommen Unterschiede zwischen den Fakultäten beispielsweise bezüglich Wissenschaftsverständnis,<br />
Institutsorganisation, Lehrformen oder Praxisbezug, wodurch die Bedingungen<br />
und Möglichkeiten auch inneruniversitär sehr verschieden sind. Modelle von Jobsharing-<br />
und Teilzeitprofessuren müssen also - unter Berücksichtigung der spezifischen Aufgaben,<br />
Arbeitsbedingungen, Laufbahnmuster und Interessenlagen der Dozierenden - erst auf<br />
ihre Umsetzbarkeit hin überprüft werden. Hier setzt das Projekt "Balance - Jobsharing und<br />
Teilzeitmodelle für Dozierende" an. In mehreren Einzelstudien versucht es, Bedürfnisse, Voraussetzungen,<br />
Möglichkeiten und Grenzen für die Umsetzung von Teilzeitmodellen bei Universitätsdozierenden<br />
zu klären. Die Hauptfragestellungen betreffen die generelle Beurteilung<br />
von Teilzeitmodellen auf Professuren sowie die persönliche Wünschbarkeit und Umsetzbarkeit<br />
solcher Stellen seitens der verschiedenen Beschäftigtengruppen der Universität Basel.<br />
Weiter möchte das Projekt mehr Klarheit über die Potenziale und Grenzen der Teilbarkeit<br />
bzw. Delegierbarkeit der vielfältigen Aufgabenbereiche von Professuren schaffen. Aus der<br />
Perspektive der strategischen Planung stellt sich unter anderem die Frage, ob solche Anstellungsmodelle<br />
innerhalb der bisherigen Stellenstrukturen im akademischen Lehrkörper eine
126 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
5 Qualifikation, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Arbeitszeit<br />
attraktive Ergänzung auch im Hinblick auf eine generelle Dynamisierung der Stellengestaltung<br />
darstellen können. Durch ein gutes Mischungsverhältnis von Voll- und Teilzeitprofessuren<br />
können Institute zudem ihre inhaltliche Vielfalt sowie den strategischen Gestaltungsspielraum<br />
bei der Stellenbesetzung erweitern. GEOGRAPHISCHER RAUM: Schweiz, Universität<br />
Basel<br />
METHODE: Im deutschsprachigen Raum gibt es bislang kaum empirische Studien, die Teilzeitmodelle<br />
und Jobsharing für ProfessorInnen thematisieren. Dies erstaunt insbesondere vor dem<br />
Hintergrund, dass in der Schweiz mit knapp 16% ein - etwa im Vergleich zu Deutschland -<br />
recht hoher Anteil an UniversitätsprofessorInnen in einem Teilzeitmodell arbeitet. Bislang<br />
fehlt es sowohl an einer Bestandesaufnahme der Erfahrungen und Einschätzungen dieser<br />
TeilzeitprofessorInnen als auch an den Einschätzungen von VoilzeitprofessorInnen sowie<br />
Nachwuchs wissenschaftlerInnen zu dieser Thematik. Die verschiedenen Teilstudien des Projekts<br />
Balance greifen diese Thematik auf und möchten anhand von vier Beschäftigtengruppen<br />
der Universität Basel einen Beitrag zur Schließung dieser Forschunglücken leisten. Realisiert<br />
wurden über einen Zeitraum von drei Jahren mehrere Teilstudien, die die Perspektiven von<br />
vier verschiedenen Gruppen des akademischen Personals der Universität Basel berücksichtigen,<br />
wobei für jede Gruppe sowohl Fragebogenerhebungen wie auch vertiefende Interviews<br />
durchgeführt wurden. Insgesamt wurden knapp 800 Angehörige der Universität Basel schriftlich<br />
und zum Teil zusätzlich mündlich befragt. Untersuchungsdesign: Querschnitt DATEN-<br />
GEWINNUNG: Qualitatives Interview (Stichprobe: 8, 15, 13, 22; Vollzeit- und TeilzeitprofessorInnen,<br />
PDs, Mittelbau; Auswahlverfahren: Quota). Standardisierte Befragung, schriftlich<br />
(Stichprobe: 84, 15; Vollzeit- sowie TeilzeitprofessorInnen der Universität Basel; Auswahlverfahren:<br />
total). Standardisierte Befragung, online (Stichprobe: 188, 543; Privatdozierende<br />
sowie Mittelbau der Universität Basel; Auswahlverfahren: total). ExpertInnengespräch<br />
(Stichprobe: 1; Personalleitung Universität Basel; Auswahlverfahren: total). Feldarbeit durch<br />
Mitarbeiter/-innen des Projekts.<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: Mücke, Anja; Töngi, Claudia; Zölch, Martina; Mäder, Ueli: Balance<br />
- Teilzeitmodelle und Jobsharing für Dozierende. Forschungsbericht. Basel: Geowip<br />
2006. ISBN: 3-906129-32-2.<br />
ART: Eigenprojekt BEGINN: 2003-01 ENDE: 2006-02 AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER:<br />
Institution<br />
INSTITUTION: Universität Basel, Philosophisch-Historische Fakultät, Institut für Soziologie<br />
(Petersgraben 27, 4051 Basel, Schweiz); Universität Basel, Ressort Chancengleichheit (Petersgraben<br />
35, 4003 Basel, Schweiz); Fachhochschule Solothurn Nordwestschweiz Technik -<br />
Wirtschaft - Soziales, Institut Mensch und Organisation -IMO- (Riggenbachstr. 16, 4600 Olten,<br />
Schweiz)<br />
KONTAKT: Töngi, Claudia (Dr. Tel. 041-61-26708-91, e-mail: claudia.toengi@unibas.ch)<br />
[144-L] Munz, Eva:<br />
Selbststeuerung der Arbeitszeiten aus Beschäftigtenperspektive: eine empirische Analyse<br />
von Einsatz und Wirkung selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung, Bremen 2005,<br />
347 S. (Graue Literatur; URL: http://elib.suub.uni-bremen.de/diss/docs/00010117.pdf; http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=979703883&dok_var=d1&dok_ext=pdf&filename=979703883.<br />
pdf)<br />
INHALT: Eine variable Verteilung der Arbeitszeit prägt für immer mehr Beschäftigte die Arbeitszeitrealität,<br />
was die wachsende Verbreitung von Arbeitszeitkonten zeigt. Sie dienen der
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 127<br />
5 Qualifikation, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Arbeitszeit<br />
Bewirtschaftung und Regulierung der variablen Arbeitszeitverteilung, wobei sich die Frage<br />
stellt, wer die Festlegung der konkreten Arbeitszeiten steuert. Diese können vom Betrieb bzw.<br />
den Vorgesetzten oder von den Beschäftigten selbst festgelegt werden. Die variable Verteilung<br />
der Arbeitszeit bewegt sich also zwischen den Polen der Fremd- und der Selbststeuerung.<br />
Von Juli bis September 2003 wurden zur Klärung dieses Problems ca. 4000 Interviews<br />
geführt. Die zentralen Fragestellungen, die für die empirische Analyse leitend waren, betrafen<br />
den betrieblichen Einsatz der Selbststeuerung der Arbeitszeiten und die Ausgestaltung der<br />
Selbststeuerung. Für die Analyse der Auswirkungen der Selbststeuerung aus Beschäftigtenperspektive<br />
wurde zum einen der Grad der Selbststeuerung bestimmt, und zum anderen zwischen<br />
Selbststeuerung mit und ohne formell reguliertem Zeitausgleich differenziert. Im einzelnen<br />
untersucht wurden die Auswirkungen der Selbststeuerung auf die Arbeitszeitsouveränität<br />
und die Arbeitszeitrealität der Beschäftigten, auf die arbeitsbedingten psychischen Beanspruchungen<br />
und die Belastungen an der Schnittstelle zwischen Erwerbsarbeit und außerberuflichem<br />
Leben. (IAB)<br />
[145-L] Papouschek, Ulrike:<br />
Work-Life-Balance in außeruniversitären Forschungsunternehmen: Grenzen und Möglichkeiten,<br />
(FORBA-Schriftenreihe, 3/2005), Wien 2005, 20 S. (Graue Literatur;<br />
URL: http://www.forba.at/files/download/download.php?_mmc=czo2OiJpZD0xNDMiOw==)<br />
INHALT: Der Beitrag beleuchtet Möglichkeiten der Work-Life-Balance für WissenschaftlerInnen<br />
in außeruniversitären Forschungsorganisationen. Wie versuchen ForscherInnen alltagspraktisch<br />
Arbeit und Leben zu vereinbaren? Wo finden sich Möglichkeiten, wo ergeben sich<br />
Grenzen? Die Ausführungen basieren auf der im Jahre 2000 fertiggestellten Studie 'Arbeitsmarkt,<br />
Arbeitsbedingungen und Berufsbiografien von Wissenschafterinnen in der außeruniversitären<br />
Forschung in Österreich'. Im Zentrum der Untersuchung steht die Arbeits- und Lebensrealität<br />
von Wissenschafterinnen, welche in nicht-universitären, rechtlich selbständigen<br />
Forschungsinstituten, in denen schwerpunktmäßig wissenschaftliche Tätigkeiten ausgeführt<br />
werden, ihren Lebensunterhalt verdienen. In das Thema einführend, werden zunächst Anmerkungen<br />
zur Formel 'Work-Life-Balance' und dem damit eng verknüpften Entgrenzungsdiskurs<br />
geliefert. Im zweiten Abschnitt erfolgt eine Darstellung von Strukturmerkmalen außeruniversitärer<br />
Forschungsorganisationen, welche gleichzeitig auch Rahmendingungen für Strategien<br />
von Work-Life-Balance darstellen. Der dritte Abschnitt beschreibt Studienergebnisse<br />
zu Arbeitszeit und Strategien von Vereinbarkeit von Beruf und Leben, mit besonderer Berücksichtigung<br />
der Vereinbarkeit von Beruf und Kindern. Abschließend illustrieren vier Fallbeispiele<br />
von Wissenschafterinnen den Umgang mit Work-Life-Balance aus der Laufbahnperspektive.<br />
Die Fallbeispiele stecken einen breiten Rahmen ab - vom distanziertem Umgang<br />
mit Arbeit bis zu 'kein Leben neben der Arbeit' sind alle Abstufungen vertreten. (ICG2)<br />
[146-F] Rhein-Ruhr-Institut für Sozialforschung und Politikberatung e.V. -RISP- an der Universität<br />
Duisburg-Essen Arbeitsbereich Arbeit und Wirtschaft Projektgruppe Logistik und Dienstleistung<br />
-Prolog-:<br />
Evaluation der EQUAL-EP "ALTERNativen im Betrieb - neue Modelle für Wirtschaft und<br />
Verwaltung mit älter werdenden Belegschaften"<br />
INHALT: keine Angaben
128 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
5 Qualifikation, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Arbeitszeit<br />
ART: gefördert AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: Kreis Lippe<br />
INSTITUTION: Rhein-Ruhr-Institut für Sozialforschung und Politikberatung e.V. -RISP- an der<br />
Universität Duisburg-Essen Arbeitsbereich Arbeit und Wirtschaft Projektgruppe Logistik und<br />
Dienstleistung -Prolog- (Heinrich-Lersch-Str. 15, 47057 Duisburg)<br />
KONTAKT: Institution (Tel. 0203-3630-330, Fax: 0203-3632-596)<br />
[147-F] Schier, Michaela, Dr.; Lange, Andreas, PD Dr. (Bearbeitung); Jurczyk, Karin, Dr. (Leitung):<br />
Entgrenzte Arbeit - entgrenzte Familie. Neue Formen der praktischen Auseinandersetzung<br />
mit dem Spannungsfeld Arbeit und Familie<br />
INHALT: Die Anforderungen an die Verbindungen von Familien- und Arbeitsleben verändern<br />
sich, wenn zeitlich, räumlich und berufsbiografisch flexible Arbeitsverhältnisse für immer<br />
mehr Männer und Frauen zur Norm werden. Ziel des Projektes ist, die praktischen Gestaltungsleistungen<br />
in Familien und Arbeitswelten und insbesondere ihre Wechselwirkungen unter<br />
Bedingungen von Entgrenzung empirisch zu untersuchen. Kontext/ Problemlage: Eine<br />
postindustrielle Gesellschaft ist, wegen der Anforderung an die Subjekte ihre Kompetenzen<br />
und ihr Arbeitsvermögen im gesamten Lebenslauf zu entfalten, in besonderer Weise existenziell<br />
auf anspruchsvolle familiale Leistungen angewiesen. Umgekehrt liefert der Erwerbsbereich<br />
wichtige materielle und ideelle Ressourcen für die familiale Lebensführung. Derzeit<br />
mehren sich jedoch die empirischen Indizien dafür, dass sich das Familienleben nicht nur in<br />
seiner Form ändert, sondern auch auf der Alltagsebene anforderungsreicher und komplexer<br />
wird. Parallel vollziehen sich einschneidende Umwälzungen in der Art des Wirtschaftens und<br />
Arbeitens - Stichworte sind Arbeitszeitflexibilisierung, eine zunehmende Subjektivierung und<br />
Intensivierung von Arbeit. Da Familie und Erwerbsbereich derzeit starken endogenen Wandlungsprozessen<br />
unterworfen sind, steht auch ihr gegenseitiges Verhältnis zur Disposition, das<br />
unter industriellen Verhältnissen als relativ stabil gelten konnte. Fragestellung: Vor der Folie<br />
dieses zweifachen sich gegenseitig steigernden Wandels der Arbeits- und Familienverhältnisse<br />
untersucht das Projekt einerseits den Familienalltag entgrenzt arbeitender Frauen und<br />
Männer mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit von Familie als Bereich von Emotionen, Fürsorge<br />
und Reproduktion. Andererseits wird gefragt, welche Konsequenzen familiale Lebensführung<br />
sowie Tendenzen der Entgrenzung von Familien für die Erbringungen der aktuellen Arbeitsleistungen<br />
sowie für die Nachhaltigkeit des zukünftigen Arbeitsvermögens in entgrenzten<br />
Arbeitsarrangements haben. In beiden Bereichen geht es um Perspektiven auf die Entwicklung<br />
der Geschlechterverhältnisse. Im Hinblick auf die politische Gestaltung eines nachhaltig<br />
tragfähigen Verhältnisses von Erwerbs- und Familienleben ist auch von Interesse, welche<br />
Anforderungen die betroffenen Frauen und Männer an politische und gesellschaftliche<br />
Akteure in Bezug auf die Unterstützung von Familien sowie die Gestaltung von Arbeit formulieren.<br />
METHODE: Mittels teilstrukturierter Leitfadeninterviews werden ca. 60 Erwerbstätige aus der<br />
Fernseh- und der Einzelhandelsbranche befragt. Beide Branchen repräsentieren wichtige, aber<br />
unterschiedliche aktuelle Neuformierungen von Erwerbsarbeit. Die Medienwirtschaft steht<br />
paradigmatisch für die Entgrenzung von "Arbeit und Leben" und für die zukünftige Organisation<br />
von Arbeit. Die weniger spektakuläre Handelsbranche unterliegt ebenso intensiven Veränderungen<br />
der Unternehmens- und Arbeitsorganisation (z.B. die Entstehung neuer Betriebstypen,<br />
die Zunahme von Minijobs). Innerhalb beider Branchen werden sozioökonomisch privilegierte<br />
und weniger privilegierte Familien befragt. Aufgrund unterschiedlicher erwerbs-
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 129<br />
5 Qualifikation, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Arbeitszeit<br />
und familienkultureller Traditionen und der je unterschiedlichen Infrastrukturen für die Kinderbetreuung<br />
werden Beschäftigte in den neuen sowie in den alten Bundesländern einbezogen.<br />
Die Auswertung erfolgt durch hermeneutisch orientierte Verfahren der qualitativen Sozialforschung.<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: S. http://www.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=359&<br />
Jump1=RECHTS&Jump2=L1&EXTRALIT=Literaturliste .<br />
ART: gefördert BEGINN: 2003-04 ENDE: 2007-08 AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER:<br />
Hans-Böckler-Stiftung<br />
INSTITUTION: Deutsches Jugendinstitut e.V. Abt. Familie und Familienpolitik (Postfach<br />
900352, 81503 München)<br />
KONTAKT: Schier, Michaela (Dr. e-mail: schier@dji.de, Tel. 089-62306-153, Fax: 089-62306-<br />
162)<br />
[148-L] Schilling, Gabi; Latniak, Erich:<br />
Betriebliche Grenzen der "Verbetrieblichung": Erfahrungen bei der Einführung flexibler<br />
Arbeitszeitmodelle in kleinen und mittleren Unternehmen, in: Steffen Lehndorff (Hrsg.): Das<br />
Politische in der Arbeitspolitik : Ansatzpunkte für eine nachhaltige Arbeits- und Arbeitszeitgestaltung,<br />
Berlin: Ed. Sigma, 2006, S. 99-126, ISBN: 3-89404-534-5<br />
INHALT: Der Beitrag zeigt am Beispiel kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), dass und<br />
warum die zunehmende Tendenz zur "Verbetrieblichung" der Arbeitszeitpolitik an betriebliche<br />
Grenzen stößt. Gerade in KMU werden traditionell nach wie vor viele Probleme mittels<br />
patriarchalischer Entscheidungen, gestützt auf Erfahrungswissen, teilweise auch mit Hilfe von<br />
informeller Verständigung gelöst. Am Beispiel der Einführung flexibler Arbeitszeitmodelle<br />
zeigen die beiden Autoren, dass alte Führungsstrukturen und ein informelles Ad-hoc-<br />
Management zur Gestaltung betrieblicher Flexibilität nicht mehr greifen. Kooperative und beteiligungsorientierte<br />
Führungsstrukturen müssen jedoch erst einmal etabliert werden. Gleichzeitig<br />
werden die Anforderungen der Außenwelt komplexer - die Flexibilitätsansprüche der<br />
Kunden steigen, Produktions- und Lieferstrukturen werden zu Netzen. Die Flexibilisierung<br />
der Arbeitszeit ist da nur ein Aspekt: Zeitliche Flexibilität des Betriebes ist nicht eins zu eins<br />
gleichzusetzen mit zeitlicher Flexibilität der einzelnen Beschäftigten. Die Notwendigkeit von<br />
Organisiertheit nimmt zu. Es bedarf transparenter und verbindlicher Aushandlungsstrukturen,<br />
die dem Maß an notwendiger Organisiertheit entsprechen. Da ist es von Vorteil, aber in kleinen<br />
Betrieben eher die Ausnahme, wenn ein Betriebsrat existiert. Auch die Zuhilfenahme externer<br />
Sachkompetenz in Form einer Arbeitszeitberatung, wie in den beschriebenen Unternehmensbeispielen<br />
der Fall, kann zwar bei der Einführung flexibler Arbeitszeitmodelle helfen,<br />
bleibt aber notwendig begrenzt und punktuell und führt erst dann zum Erfolg, wenn die<br />
betrieblichen Akteure zu kontinuierlich wirkenden Gestaltungssubjekten werden. (ICA2)<br />
[149-L] Shire, Karen A.:<br />
Keine Zeit?: Arbeiten und Leben in Deutschland und in den Vereinigten Staaten, in: Hermann<br />
Strasser, Gerd Nollmann (Hrsg.): Endstation Amerika? : sozialwissenschaftliche Innen- und<br />
Außenansichten, Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss., 2005, S. 93-102, ISBN: 3-531-14676-9<br />
(Standort: USB Köln(38)-32A8798)
130 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
5 Qualifikation, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Arbeitszeit<br />
INHALT: Der Beitrag befasst sich mit der Frage, ob der liberale Arbeitsmarkt Amerikas Frauen<br />
nicht nur eine Erwerbsbeteiligung ermöglicht (oder sie sogar erzwingt), sondern ihnen auch<br />
dadurch bessere Chancen bietet, sich im Erwerbsleben auf gleicher Stufe mit Männern zu integrieren.<br />
Wie sieht die Integration von Frauen im Erwerbsleben in Amerika im Vergleich zu<br />
Deutschland aus? Verursacht die Liberalisierung die länderbezogenen Unterschiede in der<br />
Chancengleichheit für Frauen? Welche Qualität hat das Erwerbsleben von Frauen in einer<br />
weitgehend liberalisierten Marktwirtschaft? Ist der amerikanische Arbeitsmarkt hinsichtlich<br />
der Gleichstellung von Mann und Frau als eine Endstation, als ein non plus ultra zu betrachten?<br />
Vor dem Hintergrund statistischen Datenmaterials zur Frauenbeschäftigung in Amerika<br />
und Deutschland für den Zeitraum 1990 bis 2005 werden insbesondere zwei Aspekte diskutiert:<br />
(1) deregulierte Arbeitsbeziehungen und regulierte Chancengleichheit sowie (2) die<br />
Dominanz der Arbeit über das Leben. Amerika ist zweifellos ein Vorbild, wenn man die vier<br />
Jahrzehnte Erfahrung mit der Regulierung von Chancengleichheit in der Privatwirtschaft in<br />
Betracht zieht. Durch diese Regulierungen haben amerikanische Frauen sich im Erwerbsleben<br />
weitgehend integriert - mit allen Nachteilen des amerikanischen Arbeitslebens. Die liberalisierten<br />
Arbeitsverhältnisse sowie die fehlenden gesetzlichen und tarifvertraglichen Regulierungen<br />
der Arbeitsbedingungen konfrontieren Frauen wie Männer mit der Notwendigkeit, ihre<br />
Erwerbstätigkeit vorrangig über andere Lebenssphären und Lebensziele zu setzen. Was die<br />
Gleichheit den Frauen an Chancen eröffnet, wird durch die liberalisierten Arbeitsverhältnisse<br />
in nicht unbeträchtlichem Maße wieder verloren. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf<br />
bleibt trotz familienfreundlicher Personalpolitik unerreichbar. Liberalisierte Arbeitsverhältnisse<br />
vergrößern aber auch die soziale Distanz zwischen qualifizierten Bereichen des Arbeitsmarktes<br />
und prekären Beschäftigungsformen im Niedriglohnbereich. In dieser Hinsicht<br />
ist Amerika alles andere als ein Vorbild. (ICG2)<br />
[150-F] Stock, Patricia, Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bearbeitung); Zülch, Gert, Prof.Dr. (Leitung):<br />
Prozessoptimierung und effizienter Personaleinsatz im Krankenhausbereich - Gestaltung<br />
flexibler Arbeitszeitmodelle mit Hilfe der personalorientierten Simulation<br />
INHALT: Aus den aktuellen arbeitsrechtlichen Entwicklungen, wonach z.B. der Bereitschaftsdienst<br />
als vollwertige Arbeitszeit zu betrachten ist (Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom<br />
9. September 2003), ergeben sich gravierende Konsequenzen für Krankenhäuser bei der Gestaltung<br />
von Arbeitszeiten des ärztlichen und pflegerischen Personals. Dies unterstreicht die<br />
Notwendigkeit, die Arbeitsabläufe und den Personaleinsatz effizienter zu gestalten. Gerade<br />
im Bereich der Arbeitszeitgestaltung besteht ein ausgeprägtes Missverhältnis zwischen Anspruch<br />
und Wirklichkeit, wenn von Prozessoptimierungen und Servicequalität der Patientenbehandlungen<br />
in Krankenhäusern gesprochen wird. Ziel dieses Vorhabens ist es, durch grundlagenorientierte<br />
Forschungsarbeiten die Vorteile und Möglichkeiten von flexiblen Arbeitszeitmodellen<br />
im Krankenhausbereich auszunutzen. Eine flexible Anpassung des personellen<br />
Kapazitätsbestandes an Behandlungspfade (angesichts der neuen Diagnostic-Related-Group-<br />
Abrechnungssysteme; kurz: DRG-Abrechnungssysteme) soll zur Sicherstellung und zum<br />
Ausbau des hohen patientenorientierten Servicegrades bei medizinischen Tätigkeiten ausgenutzt<br />
werden, um die im Krankenhaus zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten effizient<br />
zu planen und einzusetzen sowie gleichzeitig mitarbeiterorientierte Zielsetzungen zu realisieren.<br />
METHODE: Mit Hilfe der personalorientierten Simulation soll ein Werkzeug zur Generierung<br />
von flexiblen Einsatzzeitmodellen im Krankenhausbereich erstellt werden. Das Werkzeug
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 131<br />
5 Qualifikation, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Arbeitszeit<br />
soll dabei die derzeit gestalteten Arbeits- und Bereitschaftsmodelle, die in den verschiedenen<br />
Abteilungen eines Krankenhauses bestehen, verbessern.<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: Zülch, Gert; Börkircher, Mikko; Stock, Patricia: Forschungsziel:<br />
flexible Arbeitszeitmodelle. in: Deutsches Ärzteblatt, 37, 2005, S. 2100-2101.<br />
ART: gefördert BEGINN: 2004-12 ENDE: 2006-11 AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER:<br />
Deutsche Forschungsgemeinschaft<br />
INSTITUTION: Universität Karlsruhe, Fak. für Maschinenbau, Institut für Arbeitswissenschaft<br />
und Betriebsorganisation (Kaiserstr. 12, 76128 Karlsruhe)<br />
KONTAKT: Bearbeiterin (Tel. 0721-608-4839, e-mail: patricia.stock@ifab.uni-karlsruhe.de)<br />
[151-F] Szymenderski, Peggy (Bearbeitung):<br />
Alltägliche Lebensführung und Emotionen. Das alltägliche Emotions- und Grenzmanagement<br />
von PolizistInnen<br />
INHALT: Der dienstliche und familiale Alltag von Polizistinnen und Polizisten stellt den Fokus<br />
der Untersuchung dar. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Verbindung von Erwerbs-<br />
und Familientätigkeit und diesbezüglichen Interferenzen auf der emotionalen Dimension. Es<br />
werden besondere Anforderungen an die PolizistInnen herausgearbeitet, die vor allem die Bearbeitung<br />
von Emotionen im dienstlichen und familialen Alltag, das mentale Umschalten<br />
zwischen den unterschiedlichen Logiken und Erfordernissen sowie die Gestaltung der Grenze<br />
zwischen den Bereichen Erwerbsarbeit und Familienleben betreffen. Als erste Befunde kristallisieren<br />
sich heraus: 1. Emotionen sind wesentlicher Bestandteil der "Arbeit des Alltags"<br />
von PolizistInnen; 2. Innerdienstliche und arbeitsorganisatorische Aspekte spielen bezüglich<br />
emotionaler Wechselwirkungen zwischen Erwerbswelt und Familienleben eine genauso entscheidende<br />
Rolle wie die Arbeitsinhalte; 3. Der familiale Alltag erfordert nicht nur Kompetenzen<br />
in Hinblick auf die zeitliche Gestaltung, sondern auch emotionales Feingefühl, um<br />
insbesondere negative psychologische Konsequenzen nicht von einem in den anderen Lebensbereich<br />
zu übertragen und gestalterische Kompetenzen, um zunehmenden Vermischungen<br />
von Familienleben und Erwerbsarbeit zu begrenzen; 4. Gelingendes Emotions- und<br />
Grenzmanagement hängt davon ab, inwiefern es gelingt, seine eigenen Gefühle zu bearbeiten;<br />
5. Der emotionale Spillover von der Erwerbsarbeit auf die Familie ist höher als umgekehrt; 6.<br />
Der dienstliche Alltag ist geprägt durch ein ständiges Oszillieren zwischen Empathie und<br />
Menschlichkeit sowie einer Distanz zum Erlebten und Gefühlskälte.<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: Szymenderski, Peggy: Emotionen im familialen Alltag - ein Stiefkind<br />
der Familiensoziologie. in: Sozialarbeit, Internetzeitschrift, 1, 2005, 01, S. 4-5. Online<br />
unter: http://www.sozwork.de/#emotion abrufbar.+++Szymenderski, Peggy; Lange, Andreas:<br />
Jenseits der Vereinbarkeit. Familienwissenschaftliche Herausforderungen durch Entgrenzungen<br />
von Erwerbs- und Familienarbeit. in: Schweizerische Zeitschrift für Soziologie, 2006 (im<br />
Erscheinen).<br />
ART: Dissertation BEGINN: 2005-01 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine<br />
Angabe<br />
INSTITUTION: Technische Universität Chemnitz, Philosophische Fakultät, Institut für Soziologie<br />
Professur für Industrie- und Techniksoziologie (09107 Chemnitz)<br />
KONTAKT: Bearbeiterin (e-mail: Peggy.Szymenderski@s1997.tu-chemnitz.de)
132 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
5 Qualifikation, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Arbeitszeit<br />
[152-F] Trappmann, Vera, M.A.; Kruse, Wilfried, Dr. (Bearbeitung):<br />
Interkulturelle Kompetenz für den Betriebsalltag<br />
INHALT: Ausgangslage: Brandenburg ist als grenznahe Region von dem bevorstehenden Beitritt<br />
der mittelosteuropäischen Länder zur EU besonders betroffen. Zum einen eröffnen sich neue<br />
Möglichkeiten, z.B. im Außenhandel. Haben die Industrieunternehmen früh begonnen, ihre<br />
Unternehmenspolitik in Richtung Osten zu orientieren, zögern die KMUs noch. Als Gründe<br />
werden mangelnde Informationen, unzureichende Rechts- und Sprachkenntnisse sowie fehlende<br />
Fachkräfte und fehlende Kooperationspartner genannt. Und, die Erfahrung hat bisher<br />
gezeigt, eingegangene Joint Ventures scheitern in den meisten Fällen an kulturellen Faktoren.<br />
Es fehlt an interkulturellen Kompetenzen und Know-how. Zielsetzung: Das Ziel der 7. Innopunkt<br />
Kampagne als Teil der Landesstrategie Brandenburgs zur Vorbereitung auf die EU-<br />
Osterweiterung besteht in der Mobilisierung von Beschäftigungspotenzialen durch mehr interkulturelle<br />
Kompetenz in kleineren und mittleren Unternehmen. Das Projekt Interkulturelle<br />
Kompetenz für den Betriebsalltag setzt an vorhandenen Potentialen in den Unternehmen an,<br />
fördert diese und entwickelt sie weiter. Die Kompetenzförderung wird in ein regionales<br />
Netzwerk eingebunden, das die Unternehmen bei ihren Außenhandelsbeziehungen unterstützen<br />
soll. Das Projekt verfolgt im einzelnen folgende Ziele: Sensibilisierung von Klein- und<br />
Mittelbetrieben für Anforderungen an interkulturelle Kompetenz; Vorbereitung klein- und<br />
mittelständischer Unternehmen auf eine zu steigernde außenwirtschaftliche Tätigkeit; Aufbau<br />
eines regionalen Kompetenzzentrums für interkulturelle Kompetenz; Aufbau eines regionalen<br />
Netzwerks zur Steigerung der interkulturellen Kompetenz in KMUs; Verankerung interkultureller<br />
Kompetenz in den Betrieben als Querschnitts-Qualifikation. Zusammenarbeit mit: QualifizierungsCentrum<br />
der Wirtschaft GmbH Eisenhüttenstadt, Technische Fachhochschule<br />
Wildau, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). GEOGRAPHISCHER RAUM: Brandenburg,<br />
Mittel- und Osteuropa<br />
METHODE: Beratung, Qualifizierung, Coaching von Personalentwicklung, interkultureller Kompetenz,<br />
Landeskunde, polnischer Sprache und Verhandlungstechniken über Unternehmensfinanzierung;<br />
rechtliche Rahmenbedingungen MOE; wirtschaftliche Rahmenbedingungen<br />
MOE bis hin zu Markterschließung; Zielgruppenanalyse und Kontaktherstellung nach Polen.<br />
Die sfs ist federführend bei den Potenzialanalysen zur interkulturellen Kompetenz und der<br />
Entwicklung von Personalentwicklungsstrategien für die KMUs. Darüber hinaus übernimmt<br />
die sfs die wissenschaftliche Begleitung für das Projekt und führt 7 Fallstudien zur Verankerung<br />
interkultureller Kompetenz in den Betrieben durch.<br />
ART: gefördert BEGINN: 2003-05 ENDE: 2005-04 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINAN-<br />
ZIERER: Land Brandenburg Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie; Generaldirektion<br />
Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit -Europäischer<br />
Sozialfonds-<br />
INSTITUTION: Sozialforschungsstelle Dortmund Landesinstitut -sfs- (Evinger Platz 17, 44339<br />
Dortmund)<br />
KONTAKT: Kruse, Wilfried (Dr. Tel. 0231-8596-228, Fax: 0231-8596-100,<br />
e-mail: kruse@sfs-dortmund.de)<br />
[153-F] Treeck, Werner van, Prof.Dr.; Hengstenberg (Bearbeitung):<br />
Geschlechterverhältnisse in der Arbeit
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 133<br />
5 Qualifikation, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Arbeitszeit<br />
INHALT: Betriebliche Restriktionen und Flexibilitäten für Ingenieurinnen: Untersuchung organisatorischer<br />
Alternativen und individueller Handlungsmöglichkeiten für weibliche Ingenieure<br />
unter den heterogenen Anforderungen von Berufs- und Familienleben (mehrere Betriebe des<br />
Maschinenbaus, der Computerentwicklung und des Agraringenieurwesens).<br />
ART: keine Angabe AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Universität Kassel, FB 05 Gesellschaftswissenschaften, Fachgruppe Soziologie<br />
Fachgebiet Arbeits- und Sozialpolitik (Nora-Platiel-Str. 5, 34109 Kassel)<br />
KONTAKT: Sekretariat (Tel. 0561-804-3459, Fax: 0561-804-3068,<br />
e-mail: mwarnke@uni-kassel.de)<br />
[154-F] Wagels, Karen (Bearbeitung); Braun, Karl, Prof.Dr. (Betreuung):<br />
Body politics. Reinszenierungen von Geschlecht im Arbeitskontext<br />
INHALT: keine Angaben<br />
ART: Dissertation; gefördert AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER: Hans-Böckler-Stiftung<br />
INSTITUTION: Universität Marburg, FB 03 Gesellschaftswissenschaften und Philosophie, Graduiertenkolleg<br />
"Geschlechterverhältnisse im Spannungsfeld von Arbeit, Politik und Kultur"<br />
(Biegenstr. 9, 35037 Marburg)<br />
KONTAKT: Bearbeiterin (Tel. 06421-2824352, e-mail: wagels@staff.uni-marburg.de)<br />
[155-L] Westermayer, Till:<br />
Die Ich-AG im Walde: Arbeit in ländlichen Räumen der postindustriellen Gesellschaft am<br />
Beispiel forstlicher Dienstleistungsunternehmen, in: Berliner Journal für Soziologie, Bd.<br />
16/2006, H. 2, S. 211-225 (Standort: USB Köln(38)-XG07112; Kopie über den Literaturdienst<br />
erhältlich)<br />
INHALT: "Ausgehend von einer Darstellung postindustrieller Arbeit und ihres Echos in der Industriesoziologie,<br />
diskutiert der Artikel die Arbeits- und Organisationsformen forstlicher<br />
Dienstleistungsunternehmen. Dabei wird zum einen eine Makroperspektive eingenommen, in<br />
der das Aufkommen forstlicher Dienstleistungsunternehmen mit sinkenden Waldarbeiterzahlen<br />
und Outsourcing-Prozessen in den Forstverwaltungen in Beziehung gesetzt und mit dem<br />
historischen Kontext der Waldarbeit verknüpft wird. Zum anderen werden auf der Grundlage<br />
qualitativer Interviews mit forstlichen Dienstleistungsunternehmern Merkmale der dort stattfindenden<br />
Arbeit und der Organisationsform dieser Dienstleistungsunternehmen vor dem<br />
Hintergrund neuerer industriesoziologischer Ansätze dargestellt. Dabei wird deutlich, dass die<br />
Arbeit forstlicher Dienstleistungsunternehmen zwar viele Gemeinsamkeiten mit postindustrieller<br />
Arbeit aufweist, sich aber vieles auch mit Traditionslinien ländlicher Arbeit in<br />
Kleinstunternehmen erklären lässt. Die tatsächlich vorzufindenden Arbeitsweisen und Organisationsformen<br />
kombinieren die Reaktion auf einen globalen Markt mit Rückgriffen und Anschlüssen<br />
an Traditionslinien." (Autorenreferat)<br />
[156-F] Wittberg, Volker, Prof.Dr.; Johanning-Mammri, Renate (Bearbeitung):<br />
Der demografische Wandel und seine Auswirkungen auf das lippische Handwerk
134 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
5 Qualifikation, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Arbeitszeit<br />
INHALT: Der demografische Wandel steht derzeit vor allem unter dem Aspekt der Veränderung<br />
der Alterszusammensetzung unserer Gesellschaft im Mittelpunkt des Interesses. Die öffentliche<br />
Wahrnehmung des demografischen Wandels konzentriert sich bislang primär auf die sozialen<br />
Sicherungssysteme. Dies blendet wesentliche Aspekte des demografischen Wandels<br />
und wichtige Fragestellungen aus: Welche Folgen hat der demografische Wandel für Unternehmen<br />
und Erwerbstätige? Wie entwickelt sich die Altersstruktur der Belegschaften in den<br />
Unternehmen? Wie wirken sich alternde Belegschaften auf die Innovations- und Leistungsfähigkeit<br />
der Unternehmen aus? Studie erfolgt in Zusammenarbeit mit der Kreishandwerkerschaft<br />
Lippe. GEOGRAPHISCHER RAUM: Kreis Lippe<br />
METHODE: keine Angaben DATENGEWINNUNG: Standardisierte Befragung, schriftlich<br />
(Stichprobe: 450, davon 80 Rückläufe; Handwerksbetriebe, die der Anlage A unterliegen -<br />
zulassungspflichtige durch Eintrag in die Handwerksrolle- im Kreis Lippe). Feldarbeit durch<br />
Mitarbeiter/-innen des Projekts.<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: keine Angaben ARBEITSPAPIERE: Wittberg, Volker; Johanning-<br />
Mammri, Renate: Der demographische Wandel und seine Auswirkungen auf das lippische<br />
Handwerk. Download unter: http://iml.fhm-bielefeld.de/fileadmin/user_upload/PDF/IML/IM<br />
L-Projekte/Studie_Der_demographische_Wandel_und_seine_Auswirkungen_auf_das_lippische_Handwerk_Oktober2005.pdf<br />
.<br />
ART: keine Angabe BEGINN: 2005-08 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine<br />
Angabe<br />
INSTITUTION: Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld, Institut für den Mittelstand in Lippe<br />
-IML- (Bad Meinberger Str. 1, 32760 Detmold)<br />
[157-F] Wrage, Wiebke, MBA; Diendorf, Alexandra, B.A. (Bearbeitung); Resch, Marianne,<br />
Prof.Dr. (Leitung):<br />
SATellit: Wissenschaftliche Begleitung des Arbeitszeitprojektes "Selbstverantwortete Arbeitszeitplanung<br />
im Team" (SAT)<br />
INHALT: In dem Projekt SATellit sollen Bedingungen und Wirkungen kollektiver Arbeitszeitplanung<br />
im Rahmen eines Jahresarbeitszeitmodells untersucht werden. Als Alternative zu einer<br />
von der Unternehmensseite geplanten Verlängerung der Wochenarbeitszeit wurde zwischen<br />
den Tarifparteien ein zeitlich befristetes Pilotprojekt "SAT: Selbstverantwortete Arbeitszeitplanung<br />
im Team" vereinbart. Die SAT-Teams können die Arbeitszeiten ihrer Mitglieder<br />
auf Grundlage der geltenden Arbeitszeitbestimmungen eigenständig festlegen. Die<br />
Planungen umfassen auch Überlegungen zur Arbeitsorganisation in den Gruppen. Von dieser<br />
Regelung versprechen sich die Tarifparteien eine effizientere Zeitplanung - vor allem eine<br />
bedürfnisgerechte Regulierung der jahreszeitbedingten Schwankungen - sowie eine Verbesserung<br />
des Wohlbefindens bzw. der Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Im Projekt SATellit sollen<br />
die Effekte der kollektiven Arbeitszeitplanung im Rahmen eines Vorher-Nachher-Designs<br />
mit Vergleichsgruppen überprüft werden. Untersucht wird, ob die selbstverantwortete Arbeitszeitplanung<br />
positive Effekte auf die subjektive Bewertung der Arbeitssituation hat. Erwartet<br />
wird auch, dass sich - wenn auch in geringerem Umfang - Verbesserungen hinsichtlich<br />
der Beanspruchungsindikatoren sowie der Vereinbarkeit von Beruf und anderen Lebensbereichen<br />
zeigen. Erhoben werden zudem Veränderungen im Bereich der Überstunden und bezüglich<br />
der Identifikation und Beseitigung arbeitsorganisatorischer Mängel. Im Rahmen der Prozessbegleitung<br />
werden Planungsmaterialien erarbeitet sowie Grundlagen zur Arbeitszeit und<br />
zu Belastungsfaktoren, aber auch Hinweise für die zu treffenden Gruppenentscheidungen
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 135<br />
5 Qualifikation, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Arbeitszeit<br />
vermittelt. Zu Beginn soll der Einführungsprozess durch externe Moderation unterstützt werden.<br />
Die gewonnenen Erfahrungen - insbesondere im Hinblick auf die kollektive Aushandlung<br />
individueller Zeitbedürfnisse - sollen genutzt werden, einen Leitfaden (und ggf. Moderatorenschulung)<br />
auszuarbeiten, um zukünftig weitere Gruppen mit selbstverantworteter Arbeitszeitplanung<br />
auch ohne externe Begleitung einrichten zu können. Mit dem wissenschaftlichen<br />
Begleitprojekt SATellit wird das Ziel verfolgt, die Effekte einer dezentralen, in Arbeitsgruppen<br />
vorgenommenen Arbeitszeitplanung zu überprüfen. Diese Zielsetzung umfasst folgende<br />
Einzelfragen: 1. Können Veränderungen nach Einführung der neuen Arbeitszeitplanung<br />
im Hinblick auf verschiedene Faktoren psychosozialer Gesundheit ermittelt werden? a)<br />
Erwartet werden unmittelbare Wirkungen auf die subjektive Wahrnehmung der Arbeitssituation,<br />
insbesondere im Hinblick auf die Partizipationsmöglichkeiten, die soziale Unterstützung<br />
sowie den Gruppenzusammenhalt. b) Darüber hinaus soll geprüft werden, ob sich die Veränderungen<br />
auch in einer Verbesserung der psychosozialen Gesundheit niederschlagen. c) Nicht<br />
zuletzt ist danach zu fragen, ob sich durch die gestiegene Einflussnahme auf die Arbeitszeitplanung<br />
auch bessere Möglichkeiten der Balancierung zwischen beruflichen und anderen Lebensbereichen<br />
ergeben. 2. Geprüft werden soll, ob die kollektive Arbeitszeitplanung mit<br />
Möglichkeiten des Abbaus zeitbezogener psychischer Belastungen verbunden werden kann.<br />
3. Untersucht werden sollen darüber hinaus die Risiken der Einführung kollektiver Arbeitszeitplanung.<br />
Hierzu gehören die Frage nach den erforderlichen Qualifizierungsprozessen<br />
(bzgl. der Planungskompetenzen, der erforderlichen Planungsdaten, aber auch der Kompetenzen<br />
für die Entscheidungsfindung bei ggf. unterschiedlichen Zeitbedürfnissen), aber auch die<br />
Probleme der veränderten Rolle der Vorgesetzten bzw. der ehemaligen Dienstplaner.<br />
METHODE: Untersuchungsdesign: Trend, Zeitreihe DATENGEWINNUNG: Aktenanalyse, offen.<br />
Beobachtung, teilnehmend (Stichprobe: 10; Mitarbeitende an typischen Arbeitsplätzen).<br />
Qualitatives Interview (Personen in Schlüsselpositionen). Standardisierte Befragung, schriftlich<br />
(Stichprobe: 142; teilnehmende Bereiche/ Abteilungen und Vergleichsgruppen; Auswahlverfahren:<br />
total). Feldarbeit durch Mitarbeiter/-innen des Projekts.<br />
ART: Auftragsforschung; gefördert BEGINN: 2005-01 ENDE: 2006-04 AUFTRAGGEBER: Institution<br />
im Gesundheitswesen FINANZIERER: Hans-Böckler-Stiftung<br />
INSTITUTION: Universität Flensburg, Department II, Internationales Institut für Management<br />
Professur für Arbeits- und Organisationspsychologie (Auf dem Campus 1, 24943 Flensburg)<br />
KONTAKT: Wrage, Wiebke (Tel. 0461-805-2548, e-mail: wrage@uni-flensburg.de)<br />
6 Arbeitssicherheit, Gesundheit, Arbeitsmedizin, Ökologie<br />
[158-F] Becker, Marcel, Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bearbeitung); Zülch, Gert, Prof.Dr.-Ing. (Leitung):<br />
Auswirkungen einer alternden Belegschaft auf die Leistungsfähigkeit von Fertigungssystemen<br />
(im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms "Altersdifferenzierte Arbeitssysteme")<br />
INHALT: Vielfach verfolgen Produktionsbetriebe die Zielsetzung, ältere Mitarbeiter vorzeitig in<br />
den Ruhestand zu schicken, um Personal abzubauen oder gezielt ältere Mitarbeiter durch jüngere<br />
Mitarbeiter zu ersetzen. Aufgrund der demographischen Entwicklung in Deutschland<br />
wird dies nicht länger möglich sein. Bereits in naher Zukunft wird es daher von Bedeutung<br />
sein, die Auswirkungen einer immer älter werdenden Belegschaft auf die Leistungsfähigkeit<br />
von Fertigungssystemen zu erkennen und mit entsprechenden Maßnahmen darauf zu reagie-
136 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
6 Arbeitssicherheit, Gesundheit, Arbeitsmedizin, Ökologie<br />
ren. Ziel des Projektes ist es, ein rechnerunterstütztes Verfahren für die zielgerichtete und effiziente<br />
Anpassung von altersdifferenzierten Fertigungssystemen zu erarbeiten. Um die Auswirkungen<br />
einer sich verändernden Leistungsfähigkeit auf die produktionslogistischen, personalspezifischen<br />
aber auch qualitätsorientierten Zielsetzungen eines Fertigungssystems ermitteln<br />
zu können, sollen die Möglichkeiten der personalorientierten Simulation nutzbar gemacht<br />
werden. Mit dieser Vorgehensweise lassen sich bereits in frühen Planungsphasen Veränderungen<br />
des Leistungsangebotes modellieren und mit Hilfe der Simulation nach verschiedenen<br />
Aspekten bewerten. Auch können so personelle Engpässe, die sich aus einem veränderten<br />
Leistungsangebot ergeben können, ermittelt werden. Je nach Planungshorizont lassen sich<br />
die Auswirkungen einer alternden Belegschaft auf die Leistungsfähigkeit von Fertigungssystemen<br />
auf zwei Problembereiche eingrenzen. Setzt man einen langfristigen Planungshorizont<br />
voraus, so ist die Anpassung einer alternden Belegschaft, d.h. die Planung der Anzahl und<br />
Qualifikation der Fertigungsmitarbeiter geprägt durch die Vielzahl der Möglichkeiten, Personen<br />
zu qualifizieren (qualitative Personalbedarfsplanung). Bei einem kurzfristigen Planungshorizont<br />
beschränkt sich das Planungsproblem auf die altersdifferenzierte Zuordnung von<br />
Mitarbeitern zu den in einem Fertigungssystem angeforderten Arbeitsanforderungen (qualitative<br />
Personaleinsatzplanung), da die personellen Ressourcen fest vorgegeben sind und nicht<br />
verändert werden können. Die Zielsetzung im Rahmen der Gestaltung alterdifferenzierter Fertigungssysteme<br />
besteht nun darin, die Auswirkung eines sich verändernden Leistungsangebotes<br />
einer alternden Belegschaft auf die Leistungsfähigkeit von Fertigungssystemen rechtzeitig<br />
zu erkennen und aus dieser Erkenntnis heraus Kompensationsmaßnahmen zur Gestaltung alterdifferenzierter<br />
Fertigungssysteme geschaffen und für unterschiedliche Altersgruppen adäquate<br />
Arbeitsbedingungen geboten werden. Dabei soll die Belegschaft möglichst beibehalten<br />
und notwendige Veränderungsmaßnahmen auf ein Mindestmaß beschränkt werden, und dies<br />
unter Berücksichtigung der vorhandenen Qualifikationen und des im Zeitablauf veränderten<br />
Entwicklungspotenzials der Belegschaft.<br />
ART: gefördert BEGINN: 2006-01 ENDE: 2007-12 AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER:<br />
Deutsche Forschungsgemeinschaft<br />
INSTITUTION: Universität Karlsruhe, Fak. für Maschinenbau, Institut für Arbeitswissenschaft<br />
und Betriebsorganisation (Kaiserstr. 12, 76128 Karlsruhe)<br />
KONTAKT: Bearbeiter (e-mail: Marcel.Becker@ifab.uni-karlsruhe.de, Tel. 0721-608-4835, Fax:<br />
0721-608-7935)<br />
[159-L] Dragano, N.; Siegrist, J.:<br />
Arbeitsbedingter Stress als Folge von betrieblichen Rationalisierungsprozessen - die gesundheitlichen<br />
Konsequenzen, in: Bernhard Badura, Henner Schnellschmidt, Christian Vetter (Hrsg.):<br />
Fehlzeiten-Report 2005 : Arbeitsplatzunsicherheit und Gesundheit ; Zahlen, Daten, Analysen aus<br />
allen Branchen der Wirtschaft, Berlin: Springer, 2006, S. 167-182, ISBN: 3-540-27970-9<br />
INHALT: "Betriebliche Rationalisierungsprozesse wie Personalabbau, Outsourcing, flexibles<br />
Personalmanagement oder die Einführung neuer Produktionsmethoden prägen die moderne<br />
Wirtschaftswelt. Dass diese Strategien Auswirkungen auf das Arbeitsumfeld der davon betroffenen<br />
Erwerbstätigen haben, ist nahe liegend. Unklar ist jedoch, ob ihre Einflüsse soweit<br />
reichen, dass ein gesundheitliches Risiko entsteht. Der Beitrag geht dieser Frage nach, indem<br />
er psycho-soziale Arbeitsbelastungen, die Stress und stressbedingte Erkrankungen auslösen,<br />
in den Mittelpunkt stellt. Rationalisierungsmaßnahmen werden daraufhin überprüft, inwieweit<br />
sie der Entstehung dieser Belastungen Vorschub leisten und inwieweit gesundheitliche
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 137<br />
6 Arbeitssicherheit, Gesundheit, Arbeitsmedizin, Ökologie<br />
Beschwerden damit gehäuft auftreten. Besonderes Gewicht wird bei der Diskussion dieser<br />
Fragen auf eigene Ergebnisse aus einer umfangreichen Befragung einer Stichprobe der deutschen<br />
Erwerbsbevölkerung gelegt. In der Summe bestätigen die Ergebnisse, dass Rationalisierung<br />
mit negativen gesundheitlichen Folgen für die Belegschaft einhergehen kann, wenn<br />
sich Arbeitsbedingungen verändern, die mit dem Auftreten von Stress in Verbindung stehen."<br />
(Autorenreferat)<br />
[160-L] Hartmann, Ernst Andreas:<br />
Arbeitssysteme und Arbeitsprozesse, (Mensch, Technik, Organisation, Bd. 39), Zürich: vdF<br />
Hochschulverl. an der ETH Zürich 2005, 441 S., ISBN: 3-7281-3040-0 (Standort: ULB Münster(6)-3H89834)<br />
INHALT: "Arbeit ist ein zentraler Aspekt des menschlichen Lebens, aus der Perspektive des<br />
Individuums wie auch auf gesellschaftlicher Ebene. Durch Arbeit sichern wir - individuell<br />
und kollektiv - unsere Existenz, finden gesellschaftliche Einbindung und Möglichkeiten der<br />
persönlichen Weiterentwicklung - im günstigen Fall. In weniger günstigen Fällen erleben wir<br />
Arbeitsbedingungen, die soziale Strukturen verkümmern lassen und Menschen ihrer Entwicklungschancen<br />
berauben. Die enormen Potenziale einer solchen humanwissenschaftlichen Erforschung<br />
von Arbeit werden allerdings noch nicht ausgeschöpft, was sich unter Anderem<br />
darin äußert, dass 'grundlagenwissenschaftliche' Forschungsprojekte und 'anwendungsorientierte'<br />
Gestaltungsstrategien oftmals unverbunden nebeneinander stehen: Die Relevanz der<br />
Forschungsthemen für die praktische Arbeitsgestaltung bleibt unklar, und die Überführung<br />
des praktischen Gestaltungswissens in gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis findet nicht<br />
statt. Anliegen dieses Buches ist es, eine gestaltungswissenschaftliche Perspektive auf den<br />
Gegenstand 'Arbeit' zu eröffnen. 'Forschung' und 'Gestaltung' erscheinen dabei nicht als getrennte<br />
Welten, sondern als zwei Aspekte eines gegenstandsbezogenen Handlungs- und Erkenntnisprozesses.<br />
Dieser gestaltungswissenschaftliche Ansatz wird theoretisch hergeleitet<br />
und in insgesamt neun Fallstudien - industriellen Gestaltungsprojekten - angewandt und empirisch<br />
erprobt." (Autorenreferat)<br />
[161-F] Hecker, Dominik, Dipl.-Kfm. (Bearbeitung); Moser, Klaus, Prof.Dr.; Galais, Nathalie,<br />
Dr.rer.pol. (Leitung):<br />
Atypische Erwerbsverläufe und Arbeitsorganisationsformen und ihr Zusammenhang zu<br />
wahrgenommenen Fehlbelastungen<br />
INHALT: Im Mittelpunkt des Forschungsprojektes steht die Analyse der spezifischen Interaktion<br />
von atypischen Erwerbsverläufen, Arbeitsorganisationsformen und die wahrgenommene<br />
Fehlbelastung. Atypische Erwerbsverläufe im Sinne wechselnder Tätigkeitsbereiche über das<br />
Erwerbsleben hinaus werden für die Erwerbsfähigen zunehmend zur Normalität. Neben<br />
wechselnden Tätigkeiten und Arbeitsorten ist auch die vertragsrechtliche Absicherungen der<br />
Beschäftigten einem erheblichen Wandel unterworfen. Diese Art der Flexibilität stellt besondere<br />
Anforderungen im Sinne des Umgangs mit Unsicherheit. Insbesondere Beschäftigte, die<br />
in keiner dauerhaften Bindung zum Unternehmen stehen, sind besonders häufig belastenden<br />
Arbeitsbedingungen ausgesetzt bzw. nehmen die Arbeitsbedingungen als besonders belastend<br />
wahr. Im Rahmen des Projektes wird untersucht, welche spezifischen Belastungen sich aus<br />
der Unstetigkeit von Erwerbsverläufen ergeben, wie sich bestehende Unsicherheit im Bereich
138 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
6 Arbeitssicherheit, Gesundheit, Arbeitsmedizin, Ökologie<br />
der Arbeitsorganisationsform, wie z.B. die Zeitarbeit, auswirkt und welcher Zusammenhang<br />
zu wahrgenommenen Fehlbelastungen besteht. Ziel ist es, ein Methodeninventar zu erstellen,<br />
mit dem eine größere Anzahl Beschäftigter unterschiedlicher Beschäftigungsgruppen trennscharf<br />
erfasst werden kann.<br />
METHODE: Untersuchungsdesign: Querschnitt DATENGEWINNUNG: Qualitatives Interview<br />
(Stichprobe: 35). Standardisierte Befragung, schriftlich (Stichprobe: 165). Standardisierte Befragung,<br />
online (Stichprobe: 385). Feldarbeit durch Mitarbeiter/-innen des Projekts.<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: keine Angaben ARBEITSPAPIERE: Hecker, D.; Galais, N.; Moser,<br />
K.: Atypische Erwerbsverläufe und Arbeitsorganisationsformen und ihr Zusammenhang<br />
zu wahrgenommenen Fehlbelastungen. Projekt-Zwischenbericht für die Bundesanstalt für<br />
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Nürnberg 2005, 36 S.<br />
ART: Auftragsforschung BEGINN: 2005-01 ENDE: 2006-01 AUFTRAGGEBER: Bundesanstalt<br />
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin -BAuA- FINANZIERER: Auftraggeber<br />
INSTITUTION: Universität Erlangen-Nürnberg, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät,<br />
Sozialwissenschaftliches Institut Lehrstuhl für Psychologie, insb. Wirtschafts- und Sozialpsychologie<br />
(Postfach 3931, 90020 Nürnberg)<br />
KONTAKT: Bearbeiter (Tel. 0911-5302-248, e-mail: dominik.hecker@wiso.uni-erlangen.de)<br />
[162-F] Hecker, Dominik, Dipl.-Kfm. (Bearbeitung); Moser, Klaus, Prof.Dr. (Betreuung):<br />
Der psychologische Vertrag im Kontext neuer Beschäftigungsformen<br />
INHALT: keine Angaben<br />
METHODE: Untersuchungsdesign: Trend, Zeitreihe; Querschnitt DATENGEWINNUNG: Standardisierte<br />
Befragung, online (Stichprobe: 600; Gruppenvergleiche unterschiedlicher Beschäftigungsformen).<br />
Feldarbeit durch Mitarbeiter/-innen des Projekts.<br />
ART: Dissertation BEGINN: 2004-11 ENDE: 2006-12 AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER:<br />
Institution<br />
INSTITUTION: Universität Erlangen-Nürnberg, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät,<br />
Sozialwissenschaftliches Institut Lehrstuhl für Psychologie, insb. Wirtschafts- und Sozialpsychologie<br />
(Postfach 3931, 90020 Nürnberg)<br />
KONTAKT: Bearbeiter (Tel. 0911-5302-248, e-mail: dominik.hecker@wiso.uni-erlangen.de)<br />
[163-F] Hien, Wolfgang, Dr. (Leitung):<br />
Arbeit, Altern und Gesundheit - Arbeits- und Laufbahngestaltung bei älteren, gesundheitlich<br />
beeinträchtigten IT-Fachkräften<br />
INHALT: In diesem explorativen Projekt sollen die subjektiven Potentiale einer optimalen Arbeits-<br />
und Laufbahngestaltung bei älteren, gesundheitlich beeinträchtigten IT-Fachkräften untersucht<br />
werden. Kontext/ Problemlage: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels<br />
und der gleichzeitigen Zunahme psychomentaler und psychosozialer Belastungen wird die<br />
Frage dringlicher, wie Arbeitssysteme und Arbeitsbiographien gesundheits- und alternsgerecht<br />
gestaltet werden können. Die IT-Branche hat zu dieser Frage noch kein Verhältnis gefunden.<br />
Nach wie vor werden junge Kräfte rekrutiert, während ältere vorwiegend durch<br />
Selbstselektion vorzeitig ausscheiden. Die Gründe sind auch in den gesundheitlichen Gefährdungen<br />
zu suchen: Vielarbeit, Konkurrenzdruck, Versagensangst, psychische Erschöpfung.<br />
Fragestellung: Ausgehend von der Frage, wie sich die subjektiven biographischen Erfahrun-
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 139<br />
6 Arbeitssicherheit, Gesundheit, Arbeitsmedizin, Ökologie<br />
gen, Problemlagen, Entwürfe und Potentiale älterer Arbeitnehmer/innen strukturieren, soll der<br />
Frage nachgegangen werden, wie eine altersgerechte Aufrechterhaltung der Teilhabe am Arbeitsleben<br />
- sowohl innerhalb eines Betriebes wie auch betriebsübergreifend - aussehen kann.<br />
METHODE: Auf der Basis quantitativer und qualitativer Daten zur berufsbiographischen, gesundheitlichen<br />
und lebensweltlichen Situation älterer, gesundheitlich beeinträchtigter IT-<br />
Fachkräften sollen mittels ausgewählter biographisch-narrativer Interviews Bruchstellen,<br />
Kompetenzen, Ressourcen und Potentiale herausgearbeitet werden, welche für eine befriedigende<br />
und produktive Teilhabe am Arbeitsleben und an der Gesellschaft nutzbar gemacht<br />
werden können.<br />
ART: gefördert AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: Hans-Böckler-Stiftung<br />
INSTITUTION: Hien, W. (Contrescarpe 119, 28195 Bremen)<br />
KONTAKT: Leiter (e-mail: whien@gmx.de)<br />
[164-F] Hofer, Konrad, Dr. (Bearbeitung):<br />
Befindlichkeit von SozialarbeiterInnen<br />
INHALT: Einfluß der politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für Sozialarbeit;<br />
Karrieren von Sozialarbeitern; Einstellung zur Gesellschaft; Freizeitverhalten; Beziehung zu<br />
KlientInnen; Gründe für Jobwechsel; Zufriedenheit mit Arbeitsbedingungen; Faktoren für<br />
Arbeitszufriedenheit. ZEITRAUM: 2001 GEOGRAPHISCHER RAUM: Wien<br />
METHODE: teilnehmende Beobachtung; ero-epische Gespräche; Literaturstudium DATENGE-<br />
WINNUNG: Qualitatives Interview; Inhaltsanalyse, offen; Aktenanalyse, offen; Beobachtung,<br />
teilnehmend.<br />
ART: Auftragsforschung BEGINN: 2001-01 ENDE: 2001-12 AUFTRAGGEBER: Arbeiterkammer<br />
Wien; Gewerkschaft der Privatangestellten in Oberösterreich; Gewerkschaft der Gemeindebediensteten<br />
der Stadt Innsbruck FINANZIERER: Auftraggeber; Wissenschaftler<br />
INSTITUTION: Hofer, K. (Lindengasse 65/14, 1070 Wien, Österreich)<br />
[165-F] Kallert, Martina, Dipl.-Sozialwirt (Bearbeitung); Alberternst, Christiane, Dr. (Leitung);<br />
Moser, Klaus, Prof.Dr. (Betreuung):<br />
Arbeitssucht als Karriereideal? Empirische Untersuchungen unter Berücksichtigung des<br />
Geschlechtervergleichs<br />
INHALT: keine Angaben<br />
ART: gefördert BEGINN: 2004-12 ENDE: 2005-09 AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER:<br />
Institution; HWP Förderg. d. Chancengleichheit f. Frauen in Forschg., Lehre<br />
INSTITUTION: Universität Erlangen-Nürnberg, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät,<br />
Sozialwissenschaftliches Institut Lehrstuhl für Psychologie, insb. Wirtschafts- und Sozialpsychologie<br />
(Postfach 3931, 90020 Nürnberg)<br />
KONTAKT: Betreuer (e-mail: Klaus.Moser@wiso.uni-erlangen.de, Tel. 0911-5302-259)<br />
[166-F] Kern, Stefanie, Dipl.-Psych. (Bearbeitung); Deller, Jürgen, Prof.Dr. (Leitung):<br />
Demografischer Wandel - strategischer Umgang mit älteren Arbeitnehmern
140 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
6 Arbeitssicherheit, Gesundheit, Arbeitsmedizin, Ökologie<br />
INHALT: Motivation und Weiterbildung älterer Mitarbeiter; Weiterbildungsbeteiligung älterer<br />
Mitarbeiter in Kooperationsunternehmen; Arbeitsdesign und -inhalte älterer Mitarbeiter.<br />
METHODE: Untersuchungsdesign: Querschnitt DATENGEWINNUNG: Standardisierte Befragung,<br />
schriftlich (Stichprobe: 200; Mitarbeiter in Kooperationsunternehmen). Qualitatives Interview<br />
(Stichprobe: 60; Mitarbeiter und Experten in Kooperationsunternehmen). Feldarbeit<br />
durch Mitarbeiter/-innen des Projekts.<br />
ART: gefördert BEGINN: 2005-08 ENDE: 2007-07 AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER:<br />
Arbeitsgruppe Innovative Projekte -AGIP- beim Ministerium für Wissenschaft und Kultur<br />
des Landes Niedersachsen<br />
INSTITUTION: Universität Lüneburg, FB Wirtschaftspsychologie, Professur für Differenzielle<br />
Psychologie, Eignungsdiagnostik, Organisationspsychologie (Wilschenbrucher Weg 84,<br />
21335 Lüneburg)<br />
KONTAKT: Bearbeiterin (Tel. 04131-677-7763, e-mail: s.kern@uni-lueneburg.de)<br />
[167-F] Krenn, Manfred, Mag.; Papouschek, Ulrike, Dr. (Bearbeitung):<br />
Mobile Pflege und Betreuung als interaktive Arbeit: Anforderungen und Belastungen<br />
INHALT: Die mobile Pflege und Betreuung ist eines jener Arbeitsfelder, über die nur sehr spärliches<br />
Wissen, und dieses nur auf der Basis quantitativer Befragungen, vorliegt. Diese Studie<br />
versteht sich als ein erster Versuch, dieses Informationsdefizit zu verringern und damit<br />
gleichzeitig das Verständnis für die Besonderheiten und Charakteristika dieses Arbeitsfeldes<br />
zu erhöhen. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich im Kern mit Anforderungen und Belastungen<br />
der Arbeit in der mobilen Pflege und Betreuung. Dieser Fokus ergibt sich daraus, dass<br />
diese Erhebung im Rahmen eines größer angelegten Gesundheitsförderungsprojektes - betriebliche<br />
Gesundheitsförderung in der mobilen Pflege und Betreuung, Modul 6 der EQUAL-<br />
Entwicklungspartnerschaft "Arbeitsfähigkeit erhalten" - durchgeführt wurde. Die Studie wurde<br />
auf Basis des Ansatzes "interaktive Arbeit" durchgeführt. Das bedeutet im Wesentlichen,<br />
dass Pflege als ein Interaktionsprozess von PflegerIn und KlientIn begriffen wird, bei dem<br />
beide Seiten zum Ergebnis der Arbeit aktiv beitragen. Der/ die KlientIn ist somit sowohl<br />
EmpfängerIn als auch MitproduzentIn der Dienstleistung. Der Ansatz der "interaktiven Arbeit"<br />
erlaubt es, v.a. die emotionalen und kommunikativen Aspekte von Pflegearbeit angemessen<br />
zu erfassen, die daraus entstehenden Belastungen zu erheben und diese in den inhaltlichen<br />
und organisatorischen Gesamtzusammenhang der mobilen Pflege und Betreuung zu<br />
stellen. Die qualitative Studie basiert auf 21 Tiefeninterviews mit Pflegekräften in zwei Pflegeorganisationen.<br />
ART: Auftragsforschung BEGINN: 2002-09 ENDE: 2003-01 AUFTRAGGEBER: Forschungsinstitut<br />
des Wiener Roten Kreuzes FINANZIERER: Auftraggeber<br />
INSTITUTION: Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt -FORBA- (Aspernbrückengasse 4,<br />
5, 1020 Wien, Österreich)<br />
KONTAKT: Institution (Tel. +43-1-2124700; Fax: +043-1-212470077, e-mail: office@fobra.at)<br />
[168-F] Krenn, Manfred, Mag.; Vogt, Marion (Bearbeitung):<br />
Ältere Arbeitskräfte in belastungsintensiven Tätigkeitsbereichen. Probleme und Gestaltungsansätze
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 141<br />
6 Arbeitssicherheit, Gesundheit, Arbeitsmedizin, Ökologie<br />
INHALT: In der Studie werden anhand von zwei Bereichen, wobei die Bauwirtschaft für den<br />
Produktionsbereich und die Pflege für den Dienstleistungssektor steht, beispielhaft die Arbeitsbedingungen<br />
in besonders belastenden Tätigkeitsbereichen und ihre gesundheitlichen<br />
Auswirkungen auf die betroffenen Arbeitskräfte herausgearbeitet. Mit dem Begriff der "begrenzten<br />
Tätigkeitsdauer" werden Arbeitsplätze in den Blick genommen, die für die Mehrzahl<br />
der dort Beschäftigten eine Ausübung der Tätigkeit bis zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter<br />
verunmöglicht. Es werden aber auch Wege und Ansatzpunkte zur Lösung des Problems begrenzter<br />
Tätigkeitsdauer und damit zu einer alternsgerechten Gestaltung der Arbeitsbedingungen<br />
aufgezeigt. Die Darstellung der wichtigsten Handlungsfelder für ein gesundes Altern<br />
in der Arbeitswelt wird durch vielfältige betriebliche Umsetzungsbeispiele veranschaulicht,<br />
was gleichzeitig Wege und Möglichkeiten der Realisierung aufzeigt. Die Studie wird ergänzt<br />
durch eine internationale Recherche, in deren Rahmen wir gesetzliche und kollektivvertragliche<br />
Regelungen in europäischen Ländern zusammengetragen haben. abei waren v.a. solche<br />
von besonderem Interesse, die Maßnahmen für ältere ArbeitnehmerInnen, was zum Beispiel<br />
die Bezugsdauer von Leistungen betrifft, beinhalten, aber auch spezielle Regelungen für<br />
"SchwerarbeiterInnen" für den Übergang vom Erwerbsleben in die Pension.<br />
ART: Auftragsforschung BEGINN: 2003-09 ENDE: 2004-03 AUFTRAGGEBER: Kammer für<br />
Arbeiter und Angestellte für Wien FINANZIERER: Auftraggeber<br />
INSTITUTION: Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt -FORBA- (Aspernbrückengasse 4,<br />
5, 1020 Wien, Österreich); Gewerkschaft der Bau - Holz (Ebendorferstraße 7, 1010 Wien,<br />
Österreich)<br />
KONTAKT: Institution (Tel. +43-1-2124700; Fax: +043-1-212470077, e-mail: office@fobra.at)<br />
[169-F] Kruse, Oliver, Dr. (Bearbeitung):<br />
Gesundheitsschutz für die Ich-AG - Fit für den Beruf (im Rahmen der Initiative INQA -<br />
Initiative Neue Qualität der Arbeit)<br />
INHALT: Ziel des Projektes ist es, ein Instrumentarium zur Erhebung und Förderung des Bewusstseins<br />
für Sicherheit und Gesundheit bei Selbständigen (Existenzgründern in Form der<br />
Ich-AG) zu entwickeln. Der Stellenwert dieses Projektes geht daraus hervor, dass sich seit<br />
Anfang 2003 über 120.000 Personen aus der Arbeitslosigkeit als Ich-AG mit finanzieller Förderung<br />
des Arbeitsamtes selbständig gemacht haben. Es handelt sich somit um eines der erfolgreichen<br />
Instrumente der Arbeitsmarktreform. Bei der angepeilten Zielgruppe von selbständigen<br />
Erwerbstätigen ist damit zu rechnen, dass aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen<br />
insbesondere in der Startphase der Ich-AG (Kundengewinnung, finanzielle Lage, etc.)<br />
wichtige Aspekte von Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit tendenziell vernachlässigt<br />
werden. Insofern ist diesbezüglich ein erhöhter Handlungsbedarf gegeben, damit die<br />
erwünschte Arbeitsmarktdynamik nicht durch negative arbeits- und gesundheitsschutzbezogene<br />
Folgen konterkariert wird. Eine Projektorganisation unter Beteiligung von Arbeitsämtern<br />
und Handwerksinnungen wird den Know-How-Transfer und die breite Umsetzung der<br />
Ergebnisse sicherstellen. Die Ergebnisse werden im Kontext vorliegender Erkenntnisse und<br />
bestehender Kooperationen in diesem Bereich (z.B. das laufende Projekt zum Arbeits- und<br />
Gesundheitsschutz bei Freelancern im Medienbereich) u.a. dazu genutzt, die Empfehlung des<br />
Rates der Europäischen Union vom 18.2.2003 zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes und<br />
der Sicherheit Selbständiger am Arbeitsplatz in Deutschland weiter zu qualifizieren. Fit für<br />
den Beruf: Im Rahmen von INQA - Initiative Neue Qualität der Arbeit - hat sich die Fachhochschule<br />
des Mittelstands (FHM) mit ihrem Institut für den Mittelstand in Lippe (IML)
142 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
6 Arbeitssicherheit, Gesundheit, Arbeitsmedizin, Ökologie<br />
zum Ziel gesetzt, Ich-AGs bei der Gesundheitsvorsorge und im Arbeitsschutz zu unterstützen.<br />
Warum dieses Projekt? 1. Mit dem Instrument der Ich-AG wurde am 1. Januar 2003 eine<br />
neue Förderungsmöglichkeit für Existenzgründer geschaffen. Bisher existieren nur wenige<br />
fundierte Kenntnisse über das Gesundheits- und Arbeitsschutzverhalten dieser Gruppe von<br />
Selbstständigen. Auch die spezifischen Bedürfnisse von Existenzgründern sind noch nicht<br />
hinreichend ermittelt. 2. Gerade in der Phase der Existenzgründung stehen aufgrund von äußeren<br />
Zwängen bei den Ich-AGs häufig andere Themen (Businessplan, Kundengewinnung,<br />
finanzielle Lage etc.) im Vordergrund. Dennoch müssen sich die Ich-AGs ihrer (Eigen-<br />
)Verantwortung im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes bewusst werden. 3. Viele<br />
Gründer einer Ich-AG waren vor ihrer Selbstständigkeit nicht mit den Themen des Gesundheits-<br />
und Arbeitsschutzes konfrontiert. Die Verantwortung lag beim früheren Arbeitgeber.<br />
Insofern besteht eine Notwendigkeit, Ich-AGs mit den für Sie wichtigen, spezifischen Informationen<br />
zu versorgen.<br />
METHODE: Durch eine Befragung werden die Arbeitsbedingungen, die Gesundheitssituation<br />
sowie die Informations- und Unterstützungsbedürfnisse von Ich-AGs im Arbeits- und Gesundheitsschutz<br />
erhoben. Auf Grundlage dieser Ergebnisse sollen Selbstlernmodule für die<br />
Ich-AGs entwickelt werden. Mit Hilfe von Lernmodulen werden 1. die Ich-AGs bei ihren<br />
spezifischen Fragen und Problemen im Arbeits- und Gesundheitsschutz unterstützt; 2. wird<br />
den Ich-AGs die Möglichkeit eingeräumt, sich flexibel Wissen anzueignen und den Lernfortschritt<br />
selbst zu kontrollieren; 3. werden die Ich-AGs befähigt, ihr Gesundheitsbewusstsein zu<br />
stärken, potentielle Risiken zu erkennen und adäquat zu reagieren. Durch Vorträge und Veranstaltungen<br />
werden die breite Öffentlichkeit wie auch Existenzgründer zusätzlich für Themen<br />
des Gesundheits- und Arbeitsschutzes sensibilisiert.<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: keine Angaben ARBEITSPAPIERE: Gesundheitsschutz für die<br />
Ich-AG. Download unter: http://iml.fhm-bielefeld.de/fileadmin/user_upload/PDF/IML/IML-<br />
Projekte/inqa-fit-fuer-den-beruf.pdf .<br />
ART: Auftragsforschung BEGINN: 2003-11 AUFTRAGGEBER: Bundesanstalt für Arbeitsschutz<br />
und Arbeitsmedizin -BAuA- FINANZIERER: Auftraggeber<br />
INSTITUTION: Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld, Institut für den Mittelstand in Lippe<br />
-IML- (Bad Meinberger Str. 1, 32760 Detmold)<br />
KONTAKT: Bearbeiter (Tel. 05231-982323, e-mail: kruse@fhm-iml.de)<br />
[170-F] Martins, Erko, Dipl.-Kfm. (Bearbeitung); Nerdinger, Friedemann W., Prof.Dr. (Betreuung):<br />
Psychische Wirkungen von Formen der Mitarbeiterbeteiligung in Unternehmen<br />
INHALT: Die Mehrzahl von Unternehmen verfolgt mit der Einführung von Modellen der Mitarbeiterbeteiligung<br />
auch personalwirtschaftliche Ziele. Im Vordergrund steht die Bindung von<br />
qualifiziertem Personal sowie die Steigerung von Motivation und Arbeitszufriedenheit.<br />
Gleichzeitig sollen Engagement und unternehmerisches Denken der Mitarbeiter gefördert<br />
werden. Inwieweit diese personalwirtschaftlichen Ziele durch den Einsatz der Mitarbeiterbeteiligung<br />
erreicht werden können und welche Wirkungen auf Mitarbeiterbindung, Motivation,<br />
Arbeitszufriedenheit und unternehmerisches Denken tatsächlich bestehen, ist wissenschaftlich<br />
nach wie vor unklar. Es mangelt aus Sicht der Personalwirtschaft an adäquaten Theorien und<br />
methodisch überzeugenden Befunden für diese Zusammenhänge. Für einen optimalen Einsatz<br />
der Mitarbeiterbeteiligung als personalwirtschaftliches Instrument ist jedoch ein fundiertes<br />
Wissen über ihre Bedingungen und Effekte eine wichtige Voraussetzung. Die hier skizzierte
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 143<br />
6 Arbeitssicherheit, Gesundheit, Arbeitsmedizin, Ökologie<br />
Studie soll genau an diesem Punkt ansetzen und folgende Aspekte beleuchten: Welche personalwirtschaftlichen<br />
Wirkungen können durch den Einsatz der verschiedenen Formen der Mitarbeiterbeteiligung<br />
erzielt werden? Wie wirken diese Formen im kombinierten Einsatz? Wie<br />
können verschiedene Beteiligungsformen optimal kombiniert werden? Welche Wirkungszusammenhänge<br />
bestehen? Wie können diese Zusammenhänge zielgerichtet gesteuert werden?<br />
Welche Einflussfaktoren erweisen sich dabei als relevant? Welche Rolle spielt die Wahrnehmung<br />
des Beteiligungsmodells durch den Mitarbeiter? Welchen Einfluss auf die erzielbaren<br />
personalwirtschaftlichen Wirkungen hat die Einstellung des Mitarbeiters zum Beteiligungsmodell?<br />
METHODE: Trotz der Vielzahl publizierter Studien, die sich mit personalwirtschaftlichen Effekten<br />
der Mitarbeiterbeteiligung beschäftigen, ist für die hier zu untersuchende Fragenstellung<br />
ein defizitärer Forschungsstand zu konstatieren. Bislang liegen kaum konsistente und mit geeigneten<br />
Methoden ermittelte Befunde vor. Gleichzeitig ist zu erkennen, dass zur Erklärung<br />
der Effekte der Mitarbeiterbeteiligung sehr allgemeine Theorien der Personalwirtschaft herangezogen<br />
werden. Diese beachten nur unzureichend die Komplexität wichtiger Wirkungszusammenhänge<br />
und den Einfluss bedeutsamer Parameter und lassen damit nur wenig spezifische<br />
Aussagen über das Erzielen der angestrebten personalwirtschaftlichen Wirkungen zu.<br />
Vor diesem Hintergrund wird in der hier skizzierten Studie großer Wert darauf gelegt, dass<br />
ihr ein theoretischer Ansatz zugrunde liegt, der explizit und speziell auf den Forschungsgegenstand<br />
und seine besonderen Aspekte ausgerichtet ist und die Komplexität der Problemstellung<br />
angemessen berücksichtigt. Dieser Ansatz muss wissenschaftlich begründete Aussagen<br />
auf der Basis fundierter Theorien enthalten, in denen sich alle relevanten Variablen unter Beachtung<br />
vermuteter Kausalitäten widerspiegeln. Gleichzeitig ist eine methodische Erfassung<br />
dieser Variablen und Wirkungsbeziehungen sicherzustellen und damit eine empirische Prüfung<br />
des theoretischen Modells zu ermöglichen. Folglich sind im Erklärungsmodell der personalwirtschaftlichen<br />
Wirkungen zum einen materielle und immaterielle Formen der Mitarbeiterbeteiligung<br />
sowie ihre Gestaltungsparameter zu integrieren. Zum anderen ist die Berücksichtigung<br />
wesentlicher unternehmensinterner und -externer Kontextfaktoren geboten.<br />
Schließlich ist eine Erklärung der Wirkungen auf die zentralen Variablen Mitarbeiterbindung,<br />
Motivation, Arbeitszufriedenheit und unternehmerisches Denken notwendig. Diese wird nur<br />
mit Blick auf das Erleben und Verhalten der im Unternehmen agierenden Mitarbeiter und<br />
Führungskräfte effektiv möglich sein. Hier sind somit psychologische Prozesse bei den Individuen<br />
zu betrachten. Diese Prozesse können mit Hilfe praxisorientierter arbeits- und organisationspsychologischer<br />
Theorien modelliert werden. Die neuere Forschung bietet ein Konzept,<br />
das diese Anforderungen für einen theoretischen Ansatz erfüllt und als theoretischer<br />
Rahmen für die zu untersuchende Forschungsfrage in dieser Studie dienen soll: Die Theorie<br />
der psychologischen Eigentümerschaft. In diesem Erklärungsansatz steht das Gefühl der Miteigentümerschaft<br />
am Unternehmen im Mittelpunkt. Gemeint ist der Zustand, den ein Mitarbeiter<br />
erlebt, wenn er das Unternehmen als "sein eigenes" empfindet. Im Bewusstsein des<br />
Miteigentums sind Wahrnehmung, Gedanken, Verantwortungsbewusstsein und Handlungsabsichten<br />
ähnlich denen eines Unternehmers. Untersuchungsdesign: Querschnitt DATENGE-<br />
WINNUNG: Standardisierte Befragung, schriftlich; Standardisierte Befragung, online (Stichprobe:<br />
141 -und 200 geplant-; MitarbeiterInnen verschiedener Unternehmen/ Branchen).<br />
Feldarbeit durch Mitarbeiter/-innen des Projekts<br />
ART: Dissertation; gefördert BEGINN: 2004-04 ENDE: 2006-12 AUFTRAGGEBER: nein FI-<br />
NANZIERER: Wissenschaftler; Stipendium; Quistorp-Stiftung
144 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
6 Arbeitssicherheit, Gesundheit, Arbeitsmedizin, Ökologie<br />
INSTITUTION: Universität Rostock, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Institut<br />
für BWL Lehrstuhl für Allgemeine BWL, insb. Wirtschafts- und Organisationspsychologie<br />
(Ulmenstr. 69, 18051 Rostock)<br />
KONTAKT: Bearbeiter (e-mail: erko.martins@uni-rostock.de)<br />
[171-F] Strauß, Jürgen; Tech, Daniel; Mönnighoff, Lars (Bearbeitung); Lichte, Rainer, Dr. (Leitung):<br />
Generationenpolitik und Generationengerechtigkeit im Betrieb<br />
INHALT: In zwei Branchen und unterschiedlichen Arbeitsbereichen werden Fallstudien erarbeitet,<br />
Orientierungshilfen für Betriebs- und Tarifpolitik zu alterns- und generationengerechter<br />
Arbeit und ein Bildungskonzept zum Umgang mit Normen/ Werten (Gerechtigkeitsstandards)<br />
entwickelt. Die Ergebnisse werden mit Experten der Gewerkschaften und Arbeitgeber auf<br />
Verallgemeinerbarkeit überprüft. Kontext/ Problemlage: Es wird explorativ die Bedeutung<br />
von Generationenpolitik und -gerechtigkeit im Betrieb und für Betriebsräte erhoben. Die Forschung<br />
zu älter werdenden Belegschaften und alternsgerechter Arbeit hat industrielle Beziehungen<br />
wenig beleuchtet: Was halten Betriebsräte und Management für unterschiedliche Altersgruppen<br />
und Generationen im Betrieb für gerecht, an welchen Normen/ Werten orientieren<br />
sie sich, wandeln sich diese? Betriebsräte sind wichtige Akteure in betrieblicher Generationenpolitik,<br />
die Chancen und Risiken von Jungen und Alten mitbestimmt, und sie sind Handelnde<br />
in einem komplexen Gerechtigkeitsmanagement. Generationengerechtigkeit berührt<br />
zwei Beziehungsebenen, auf die Betriebsräte einwirken: 1. dass Arbeitgeber unterschiedlichen<br />
Erwerbs- und Lebenslagen von Jungen und Alten gerecht werden (Arbeitgeber-Arbeitnehmer);<br />
2. dass Ressourcen und Lasten/ Rechte und Pflichten zwischen Generationen gerecht<br />
verteilt werden (Arbeitnehmer-Arbeitnehmer). Fragestellung: Das Projekt hat zwei<br />
Hauptfragestellungen: 1. Was sind Generationen im Betrieb? 2. Was heißt Generationengerechtigkeit<br />
im Betrieb? Zu 1: Welche Bedeutungen hat der Begriff der Generation, wenn er in<br />
betrieblichem Zusammenhang gebraucht wird? Werden familiale und gesellschaftliche Bedeutungen<br />
von Generation in den Betrieb hineingetragen? Was bedeutet Generationenbeziehungen<br />
und Generationenverhältnissen im Betrieb? Wer sind die Autoren von betrieblichen<br />
Generationen-Deutungen? Zu 2: Ist mit dem Generationenbegriff in Betrieben eine Moralisierung<br />
betrieblicher Verhältnisse und Beziehungen verbunden? Was bedeutet generationengerecht<br />
und Generationengerechtigkeit im Hinblick auf unterschiedliche Generationen? Welches<br />
sind die wichtigsten Medien der Generationengerechtigkeit (Lohn/ Leistung, Macht, Anerkennung<br />
etc.)? In welchen Arbeits- und industriellen Beziehungen und auf welchen betrieblichen<br />
Ebenen wird über Generationengerechtigkeit verhandelt?<br />
METHODE: Dem Gegenstandsbereich und der explorativen Anlage der Untersuchung entsprechend<br />
sollen differenzierte Deutungen von Orientierungs- und Handlungsmustern herausgearbeitet<br />
werden. Deshalb stehen qualitativ angelegte Befragungen und Gruppendiskussionen<br />
im Zentrum des Vorgehens: focussierte Interviews mit Betriebsräten und Vertretern des Managements;<br />
narrative Interviews mit Beschäftigten; Experteninterviews mit Vertretern von<br />
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden; Gruppendiskussionen mit Betriebsräten und Beschäftigten.<br />
Die interpretierten Ergebnisse der Befragungen werden zu kontrastierenden Fallstudien<br />
in unterschiedlichen Branchen/ Arbeitsbereichen zusammengefasst. Die Fallstudien<br />
sind Gegenstand der Diskussion in unterschiedlichen Workshops mit überbetrieblichen Experten.
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 145<br />
6 Arbeitssicherheit, Gesundheit, Arbeitsmedizin, Ökologie<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: keine Angaben ARBEITSPAPIERE: Die richtige Balance: Jung<br />
und Alt im Betrieb. Projektinfo. S. http://www.sfs-dortmund.de/forsch/docs/kurzbeschreibung_p9005216.pdf<br />
.<br />
ART: gefördert BEGINN: 2006-01 ENDE: 2007-06 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINAN-<br />
ZIERER: Hans-Böckler-Stiftung<br />
INSTITUTION: Sozialforschungsstelle Dortmund Landesinstitut -sfs- (Evinger Platz 17, 44339<br />
Dortmund)<br />
KONTAKT: Leiter (e-mail: lichte@sfs-dortmund.de, Tel. 0231-8596-199)<br />
[172-F] Trimpop, Rüdiger, Univ.-Prof.Dr. (Bearbeitung); Kalveram, Andreas, Dipl.-Psych. (Leitung):<br />
WoLiBaX (Work-Life-Balance-Index)<br />
INHALT: Das Thema Work-Life-Balance hat Konjunktur. In einer sich permanent wandelnden<br />
Arbeitswelt fällt es vielen Menschen immer schwerer, sowohl ihre beruflichen Aufgaben als<br />
auch ihre familiären bzw. privaten Verpflichtungen zufriedenstellend miteinander zu verbinden.<br />
Eine verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und Familienleben ist erklärtes Ziel der Politik.<br />
Und zunehmend mehr Unternehmen entwickeln Lösungsansätze, die ihren Mitarbeitern<br />
eine bessere Verbindung von Arbeit, Familie und Freizeit ermöglichen sollen. Trotz zahlreicher<br />
guter Praxisbeispiele bedarf es noch systematischer wissenschaftlicher Analysen, um die<br />
Gestaltungsmöglichkeiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufzuzeigen sowie die Wirkungszusammenhänge<br />
zu ergründen, die eine gute Vereinbarkeit von Arbeit, Familie und<br />
Freizeit ermöglichen. Das WoLiBaX-Forschungsprojekt untersucht daher gezielt, wie betriebliche<br />
Rahmenbedingungen, familiäre Konstellationen und die individuelle Lebenssituation die<br />
Vereinbarkeit von Arbeit, Familie und Freizeit im Alltag von Erwerbstätigen beeinflussen.<br />
Die früher meist klaren Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben werden von zahlreichen<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnissen als immer<br />
durchlässiger erlebt: flexible Arbeitszeiten, Überstunden und hoher Termindruck sind in<br />
vielen Unternehmen heute ebenso der Normalfall wie eine permanente Erreichbarkeit (über<br />
Handy und E-Mail) oder mobile Arbeitsformen (z.B. Telearbeitsplätze). So weichen die<br />
Grenzen zwischen den Lebensbereichen immer mehr auf. Damit die Schnittstelle zwischen<br />
den Lebensbereichen Beruf und Familie jedoch als möglichst konfliktfrei und gewinnbringend<br />
erlebt werden kann, ist eine möglichst optimale Passung zwischen der individuellen und<br />
familiären Lebenssituation sowie den betrieblichen Gegebenheiten notwendig. Gelingt dies<br />
nicht, sind nicht selten Stress, Überlastungsreaktionen (Burnout), berufliche Leistungsminderungen<br />
und familiäre Krisen bis hin zu gesundheitlichen Beschwerden die unerwünschten,<br />
aber schwerwiegenden Konsequenzen. Neben der individuellen Lebenssituation haben auch<br />
die persönlichen Wünsche und Rollenbilder der Beschäftigten einen Effekt darauf, ob die Lebensbereiche<br />
eher als im Gleichgewicht oder eher als unvereinbar erlebt werden. Deshalb<br />
steht die Frage, inwieweit das eigene Rollenbild als Frau oder Mann die Work-Life-Balance<br />
beeinflusst, im Mittelpunkt der Untersuchung. Zusätzliche Schwerpunkte der Studie sind der<br />
Einfluss verschiedener Arbeitszeitregelungen sowie die Bedeutung einer familienfreundlichen<br />
Organisationskultur auf die Work-Life-Balance der Befragten. Die Studienergebnisse dienen<br />
nicht zuletzt der Entwicklung konkreter betrieblicher Lösungen, um Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeitern in Betrieben, Behörden und Organisationen Angebote zur besseren Vereinbarkeit<br />
von Arbeit, Familie und Freizeit anbieten zu können. GEOGRAPHISCHER RAUM:<br />
Bundesrepublik Deutschland
146 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
6 Arbeitssicherheit, Gesundheit, Arbeitsmedizin, Ökologie<br />
METHODE: Onlinebefragung unter: http://www.wolibax.de/<br />
ART: keine Angabe AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Universität Jena, Fak. für Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Institut für<br />
Psychologie Lehrstuhl für Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie (Humboldtstr.<br />
27, 07743 Jena)<br />
KONTAKT: Leiter (Tel. 03641-945134, Fax: 03641-945132,<br />
e-mail: bobby.kalveram@uni-jena.de)<br />
[173-F] Universität Kassel:<br />
Gestörte Arbeit<br />
INHALT: In diesem Projekt werden frühere und laufende Untersuchungen über Fehler und Störungen<br />
in der Arbeit systematisch zusammengefasst. Ergebnisse aus früheren Arbeiten über<br />
"Fehler und Störungen im Verwaltungshandeln" und "Das Jahr-2000-Problem" gehen darin<br />
ebenso ein wie Explorationen über "Zufall und Improvisation in der Arbeit". Die Systematisierung<br />
folgt einer Kategorienbildung von Schnittstellen-Spannungen und Sicherungs-<br />
Ausfällen im Zusammenspiel unterschiedlicher Material-, Maschinen- und Soziallogiken.<br />
ART: keine Angabe AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Universität Kassel, FB 05 Gesellschaftswissenschaften, Fachgruppe Soziologie<br />
Fachgebiet Arbeits- und Sozialpolitik (Nora-Platiel-Str. 5, 34109 Kassel)<br />
KONTAKT: Sekretariat (Tel. 0561-804-3459, Fax: 0561-804-3068,<br />
e-mail: mwarnke@uni-kassel.de)<br />
[174-F] Universität Marburg:<br />
The socio-economic performance of social-enterprises in the field of integration by work<br />
(PERSE)<br />
INHALT: keine Angaben<br />
ART: keine Angabe AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Universität Marburg, FB 21 Erziehungswissenschaften, Institut für Schulpädagogik<br />
(Wilhelm-Röpke-Str. 6B, 35032 Marburg)<br />
7 Wirtschaftssoziologie<br />
[175-F] Adams, Oliver (Bearbeitung):<br />
Auswirkungen tendenzieller Gesellschaftsveränderungen auf das Kommunikationsverhalten<br />
von Unternehmen<br />
INHALT: keine Angaben<br />
ART: Dissertation AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Universität Lüneburg, FB 02 Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Institut für<br />
BWL Abt. Strategisches Management und Tourismusmanagement (Scharnhorststr. 1, 21332<br />
Lüneburg)
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 147<br />
7 Wirtschaftssoziologie<br />
KONTAKT: Bearbeiter (e-mail: oliver99@gmx.net)<br />
[176-L] Backhaus, Jürgen G. (Hrsg.):<br />
Essays on fiscal sociology, (Finanzsoziologie, Bd. 1), Frankfurt am Main: P. Lang 2005, 277 S.,<br />
ISBN: 3-631-39967-7 (Standort: UuStB Köln(38)-33A728)<br />
INHALT: "Due to the widespread dissatisfaction with the way fiscal sociology is being neglected<br />
while benefiting by its ever-growing importance, the volume Essays on Fiscal Sociology aims<br />
to provide a source, reference, and teaching supplement for the field of fiscal sociology. The<br />
essays comprised in this book were originally prepared for and read at the Erfurt Conferences<br />
on Fiscal Sociology. Please note that this conference is open to all researchers in this field internationally<br />
and it is taking place in the second week of October, before the semester starts."<br />
(author's abstract). Content: Jürgen G. Backhaus: Introduction (1-3); Jürgen G. Backhaus:<br />
Fiscal Sociology: What For? (5-25); Richard E. Wagner: States and the Crafting of Souls:<br />
Mind, Society, and Fiscal Sociology (27-38); Michael McLure: Approaches to Fiscal Sociology<br />
(39-50); Giuseppe Eusepi: Public Finance and Welfare: From the Ignorance of the Veil to<br />
the Veil of Ignorance (51-76); Alexander Ebner: Institutions, Entrepreneurship, and the Rationale<br />
of Government: An Outline of the Schumpeterian Theory of the State (77-101); Richard<br />
E. Wagner: Polycentric Public Finance and the Organization of Governance (103-116);<br />
Francesco Forte: Fiscal and Monetary Illusion and the Maastricht Rules (117-135); Jürgen G.<br />
Backhaus: The Impact of Equity Driven Policy Measures on the Equity of the State (137-<br />
157); Norio Sasaki: German Fiscal Sociology's Influence on Japan (159-177); Norio Sasaki:<br />
Goldscheid's Menschenökonomie from a Modern Perspective (179-186); Enrico Schöbel: A<br />
Fiscal Sociological Theory of Tax Evasion on the Basis of Adam Smith and Otto Veit (187-<br />
210); Helge Peukert: Justi's Moral Economics and his System of Taxation (1766) (211-237);<br />
Helge Peukert: Fritz Karl Mann (1883-1979) (239-256); Helge Peukert: Critical Remarks on<br />
Joseph E. Stiglitz. (257-277).<br />
[177-F] Baecker, Dirk, Prof.Dr. (Leitung):<br />
Einführung in die Wirtschaftssoziologie<br />
INHALT: Da man die Soziologie mit Fug und Recht als ein Kind der Industriegesellschaft bezeichnen<br />
kann, gehört die Wirtschaftssoziologie zu den grundlegenden Fragestellungen des<br />
Faches. Soziologen wie Emile Durkheim, Georg Simmel, Max Weber und noch Talcott Parsons<br />
und Niklas Luhmann führen auf dem Feld der Wirtschaftssoziologie ihre Auseinandersetzung<br />
mit der von Karl Marx entwickelten These, dass die moderne Gesellschaft als 'kapitalistische'<br />
Gesellschaft durch die Wirtschaft dominiert sei. Über diese spezifisch modernen Interessen<br />
hinaus gehören wirtschaftssoziologische Fragestellungen jedoch zu den Grundzügen<br />
eines alteuropäischen Denkens, das seit Sokrates von einem Erschrecken über die zersetzende<br />
Wirkung des Geldes auf traditionelle Sozialbindungen geprägt ist. Die in diesem Forschungsvorhaben<br />
geplante Einführung in die Wirtschaftssoziologie greift diese Fragestellungen auf<br />
und entwirft einen Theorierahmen, in dem die Auseinandersetzungen um die Wirtschaft als<br />
Teil der gesellschaftlichen Selbstbeschreibung und damit als Teil der gesellschaftlichen<br />
Selbstgestaltung verstanden werden können.<br />
ART: keine Angabe BEGINN: 2002-08 ENDE: 2005-08 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FI-<br />
NANZIERER: keine Angabe
148 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
7 Wirtschaftssoziologie<br />
INSTITUTION: Universität Witten-Herdecke, Fak. für das Studium fundamentale, Lehrstuhl für<br />
Soziologie (Alfred-Herrhausen-Str. 50, 58448 Witten)<br />
KONTAKT: Leiter (e-mail: dbaecker@uni-wh.de)<br />
[178-F] Baethge, Martin, Prof.Dr. (Leitung):<br />
Forschungsverbund 'Berichterstattung zur sozio-ökonomischen Entwicklung der Bundesrepublik<br />
Deutschland: Arbeit und Lebensweisen'<br />
INHALT: Was kann Sozialberichterstattung zum Verständnis des Umbruchs beitragen, in dem<br />
sich die deutsche Gesellschaft befindet? Eine Antwort darauf versucht der neue Ansatz sozioökonomischer<br />
Berichterstattung, den ein Verbund sozialwissenschaftlicher Institute in Göttingen,<br />
Nürnberg, München und Augsburg verfolgt. Im Unterschied zu vielen spezialisierten<br />
Berichtsansätzen will dieser Beitrag zur sozialwissenschaftlichen Berichterstattung die Entwicklung<br />
der deutschen Gesellschaft im Zusammenhang beobachten. Im Mittelpunkt stehen<br />
die Wechselwirkungen zwischen Ökonomie, Lebensweisen und Institutionensystem in einer<br />
Situation, in der sich viele ökonomische und soziale Gegebenheiten gleichzeitig ändern.<br />
GEOGRAPHISCHER RAUM: Bundesrepublik Deutschland<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: Bartelheimer, Peter: Sozio-ökonomische Berichterstattung in der<br />
Diskussion. in: WSI-Mitteilungen, 2004, Nr. 6, S. 334-337.<br />
ART: gefördert BEGINN: 2000-01 ENDE: 2004-12 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINAN-<br />
ZIERER: Bundesministerium für Bildung und Forschung<br />
INSTITUTION: Universität Göttingen, Sozialwissenschaftliche Fakultät, Institut für Soziologie<br />
(Platz der Göttinger Sieben 3, 37073 Göttingen); Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung<br />
der Bundesagentur für Arbeit -IAB- (Regensburger Str. 104, 90478 Nürnberg); Institut<br />
für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. -ISF- (Jakob-Klar-Str. 9, 80796 München); Internationales<br />
Institut für Empirische Sozialökonomie gGmbH -INIFES- (Haldenweg 23,<br />
86391 Stadtbergen)<br />
KONTAKT: Leiter (Tel. 0551-39-7199, Fax: 0551-39-7692,<br />
e-mail: mbaethg1@uni-goettingen.de)<br />
[179-F] Bartelt, Andreas, Dr. (Bearbeitung); Meyer, Margit, Prof.Dr. (Betreuung):<br />
Vertrauen in Zuliefernetzwerken der Automobilindustrie<br />
INHALT: keine Angaben<br />
ART: Dissertation AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Universität Würzburg, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Betriebswirtschaftliches<br />
Institut Lehrstuhl für BWL und Marketing (Josef-Stangl-Platz 2, 97070 Würzburg)<br />
KONTAKT: Sekretariat (Tel. 0931-31-2919, Fax: 0931-31-2811,<br />
e-mail: karin.scheid@mail.uni-wuerzburg.de)<br />
[180-F] Beyer, Jürgen, Dr. (Bearbeitung):<br />
Verfestigte institutionelle Vielfalt? Die komparativen Vorteile koordinierter Ökonomien im<br />
internationalen Wettbewerb
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 149<br />
7 Wirtschaftssoziologie<br />
INHALT: Existenz und Fortbestand von verschiedenartigen marktwirtschaftlichen Systemen<br />
werden neuerdings mit komparativen Vorteilslagen begründet, die sich aus der Unterschiedlichkeit<br />
der jeweils zugrunde liegenden institutionellen Struktur ergeben. Die Internationalisierung<br />
von Unternehmen führt in dieser Sicht zu einer Verfestigung bestehender nationaler<br />
Differenzen, da die Unternehmen an der Sicherung von Wettbewerbsvorteilen interessiert<br />
sind und institutionelle Unterschiede mittels Arbitrage nutzbar machen können. Ziel des Projektes<br />
ist die Überprüfung dieser Annahmen am deutschen Beispiel. Die Analysen werden auf<br />
zwei Untersuchungsebenen durchgeführt: Zum einen wird anhand ausgewählter Finanz- und<br />
Produktionsunternehmen untersucht, welche organisatorischen Veränderungen im Zuge der<br />
Internationalisierung zu beobachten sind und ob sich diese im Sinne einer Adaption an vielfältige<br />
institutionelle Umwelten interpretieren lassen. Zum anderen wird auf Aggregatebene<br />
überprüft, ob sich die institutionellen Besonderheiten der deutschen Wirtschaftsordnung und<br />
die damit zusammenhängenden Spezialisierungen im Wettbewerbsprofil im letzten Jahrzehnt<br />
erhalten haben. GEOGRAPHISCHER RAUM: Bundesrepublik Deutschland<br />
METHODE: "Varieties of Capitalism"-Forschung<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: Beyer, Jürgen (Hrsg.): Vom Zukunfts- zum Auslaufmodell? Die<br />
deutsche Wirtschaftsordnung im Wandel. Wiesbaden: Westdt. Verl. 2003.+++Beyer, Jürgen:<br />
Deutschland AG a.D.: Deutsche Bank, Allianz und das Verflechtungszentrum des deutschen<br />
Kapitalismus. in: Streeck, Wolfgang; Höpner, Martin (Hrsg.): Alle Macht dem Markt? Fallstudien<br />
zur Abwicklung der Deutschland AG. Frankfurt: Campus 2003, S. 118-146.+++ Beyer,<br />
Jürgen: Unkoordinierte Modellpflege am koordinierten deutschen Modell. in: Beyer, Jürgen<br />
(Hrsg.): Vom Zukunfts- zum Auslaufmodell? Wiesbaden: Westdt. Verl. 2003, S. 7-35.<br />
+++Beyer, Jürgen; Hassel, Anke: Die Folgen von Konvergenz. Der Einfluss der Internationalisierung<br />
auf die Verteilung der Wertschöpfung in großen Unternehmen. in: Beyer, Jürgen<br />
(Hrsg.): Vom Zukunfts- zum Auslaufmodell? Wiesbaden: Westdt. Verl. 2003, S. 155-184.<br />
+++Beyer, Jürgen; Höpner, Martin: The disintegration of organised capitalism. German corporate<br />
governance in the 1990s. in: West European Politics, 26, 2003, 4, pp. 179-198. +++<br />
Beyer, Jürgen: Entflechtung der Deutschland AG. in: Allmendinger, Jutta (Hrsg.): Entstaatlichung<br />
und soziale Sicherheit. Verhandlungen des 31. Kongresses der Deutschen Gesellschaft<br />
für Soziologie in Leipzig. Opladen: Leske u. Budrich 2003 (im Erscheinen). +++Beyer, Jürgen:<br />
Leaving tradition behind. Deutsche Bank, Allianz and the dismantling of "Deutschland<br />
AG". in: Nollert, Michael; Scholtz, Hanno; Ziltener, Patrick (Hrsg.): Die Gesellschaft der<br />
Wirtschaft. Fribourg: Univ.-Verl. 2003, S. 195-210 (im Erscheinen).<br />
ART: gefördert BEGINN: 2002-01 ENDE: 2006-02 AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER:<br />
Deutsche Forschungsgemeinschaft<br />
INSTITUTION: Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung (Paulstr. 3, 50676 Köln)<br />
KONTAKT: Institution (Tel. 0221-2767-0, Fax: 0221-2767-430, e-mail: info@mpifg.de)<br />
[181-F] Biedermann, Annette, Dipl.-Kff. (Bearbeitung); Bresser, Rudi K.F., Univ.-Prof.Dr.<br />
(Betreuung):<br />
Die strategische Bedeutung sozialen Kapitals<br />
INHALT: 1. Ursprung und Entwicklung des Sozialkapitalkonzeptes; 2. Netzwerktheorien; 3.<br />
Einfluss sozialer Beziehungsnetzwerke auf den Unternehmenserfolg.<br />
METHODE: Soziale Netzwerkansätze; Forschungsperspektive Ökonomie; Forschungsperspektive<br />
strategisches Management
150 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
7 Wirtschaftssoziologie<br />
ART: Dissertation BEGINN: 2001-08 ENDE: 2006-08 AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER:<br />
Institution<br />
INSTITUTION: Freie Universität Berlin, FB Wirtschaftswissenschaft, Institut für Management<br />
Lehrstuhl für Strategisches Management (Garystr. 21, 14195 Berlin)<br />
[182-F] Bleher, Nadine (Bearbeitung); Götz, Klaus, Prof.Dr. (Leitung):<br />
Towards a transnationalization of (corporate) culture<br />
INHALT: keine Angaben<br />
METHODE: keine Angaben DATENGEWINNUNG: Inhaltsanalyse, offen; Aktenanalyse, offen;<br />
Qualitatives Interview. Feldarbeit durch Mitarbeiter/-innen des Projekts.<br />
ART: Auftragsforschung BEGINN: 2004-01 ENDE: 2006-01 AUFTRAGGEBER: University of<br />
Maryland at College Park FINANZIERER: Auftraggeber<br />
INSTITUTION: Universität Koblenz-Landau Campus Landau, Zentrum für Human Resource<br />
Management -ZHRM- (Bürgerstr. 23, 76829 Landau)<br />
KONTAKT: Leiter (Tel. 06341-906-403, e-mail: goetz@uni-landau.de)<br />
[183-L] Bohler, Karl Friedrich:<br />
Professionelle Unternehmensberatung im Spannungsfeld von Rationalisierungs- und Technokratisierungsprozessen,<br />
in: sozialer sinn : Zeitschrift für hermeneutische Sozialforschung,<br />
2002, H. 1, S. 99-124<br />
INHALT: "Untersuchungen zur Unternehmensberatung seit den 80er Jahren zeigten - nicht nur,<br />
aber besonders deutlich bei einer Kontrastierung der ost- und westdeutschen Situation - die<br />
Differenzierung der Beratungsprozesse nach zwei Stufen der ökonomischen Rationalisierungsproblematik,<br />
nämlich die Beratung zur Sicherung der Rentabilität und zur Entwicklung<br />
des Unternehmens. Kombiniert mit einem je spezifischen Schwerpunkt ergeben sich dann<br />
vier Topoi der Unternehmensberatung: Rationalisierung von Produktion und Verwaltung, Intensivierung<br />
der Vertriebs- und Marketingaktivitäten, Entwicklung der Unternehmensorganisation<br />
und Aufbau eines Konzepts der Personalentwicklung. Auf der neuen Stufe des Rationalisierungsprozesses<br />
verschieben sich die Grenzen von formaler und materialer Rationalität<br />
ökonomischen Handelns, in der neuen Phase der Technokratisierung die von instrumentellem<br />
und kommunikativem Handeln. Wie erfolgreich die wirtschaftlichen Probleme in den Betrieben<br />
bearbeitet werden können, hängt gemäß der Handlungslogik eines Arbeitsbündnisses neben<br />
der Adäquanz der Beraterkonzepte von der Einstellung und Kompetenz der Klienten ab.<br />
Symmetrische Beratungsbeziehungen sind gute strukturelle und soziale Voraussetzungen für<br />
ein Gelingen, asymmetrische dagegen schlechte. Denn in diesem letzten Fall wird die Beratungssituation<br />
durch Autonomieprobleme bei der Betriebsführung, Anerkennungsprobleme<br />
durch den Berater und besondere Probleme bei den durch Dritte erzwungenen Beratungsprozessen<br />
verkompliziert." (Autorenreferat)<br />
[184-F] Bouncken, Ricarda, Prof.Dr. (Bearbeitung):<br />
Kooperationen bei Medienunternehmen
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 151<br />
7 Wirtschaftssoziologie<br />
INHALT: Ziele des Forschungsprojektes: In diesem explorativen Forschungsprojekt soll untersucht<br />
werden, welche Arten der Zusammenarbeit bei Medienunternehmen existieren. Die<br />
zentralen Fragestellungen betreffen: 1. die Motive der Zusammenarbeit; 2. den zeitlichen Horizont<br />
der Kooperationen; 3. die beteiligten Funktionen in den Unternehmen; 4. die Strukturen<br />
der Zusammenarbeit; 5. die Qualität der Beziehungen zwischen den Unternehmen; 6. die<br />
Probleme und Chancen der Kooperationen und die Ergebnisse der Kooperation. Nutzen des<br />
Forschungsprojektes: Durch dieses Forschungsprojekt sollen Erkenntnisse darüber gewonnen<br />
werden, wie Medienagenturen ihre Kooperationsbeziehungen nutzen und wie sie in Zukunft<br />
ihre Kooperationen besser und zielgerichteter planen und gestalten können. Nutzen für die beteiligten<br />
Unternehmen: Nach Abschluss des Projektes erhalten alle beteiligten Unternehmen<br />
einen Ergebnisbericht und fortlaufend aktuelle Publikationen des Lehrstuhls zu diesem Thema.<br />
METHODE: keine Angaben DATENGEWINNUNG: Qualitatives Interview.<br />
ART: keine Angabe AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Technische Universität Cottbus, Fak. 03 Maschinenbau, Elektrotechnik und<br />
Wirtschaftsingenieurwesen, Institut für Wirtschaftswissenschaften (Postfach 101344, 03013<br />
Cottbus); Technische Universität Cottbus, Fak. 03 Maschinenbau, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen,<br />
Institut für Wirtschaftswissenschaften Lehrstuhl für Planung und Innovationsmanagement<br />
(Postfach 03013, 101344 Cottbus)<br />
KONTAKT: Lehrstuhl (Tel. 0355-69-2967, Fax: 0355-69-3009, e-mail: PI@tu-cottbus.de)<br />
[185-F] Bouncken, Ricarda, Prof.Dr. (Bearbeitung):<br />
Kooperationen bei Multimediaagenturen (New Medias)<br />
INHALT: Ziele des Forschungsprojektes: Es soll untersucht werden, welche Strukturen der Zusammenarbeit<br />
zwischen Multimediaagenturen existieren. Zentrale Fragestellung ist dabei, wie<br />
die Struktur der Zusammenarbeit und die Qualität der Zusammenarbeit auf den Erfolg der<br />
Kooperationen und ihre langfristige Struktur wirkt. Die Struktur der Zusammenarbeit betrifft<br />
beispielsweise wie viele Partner in einem Projekt zusammenarbeiten. Die Qualität der Zusammenarbeit<br />
umfasst zum Beispiel, ob die Beziehungen freundschaftlich-eng, freundschaftlich-lose<br />
oder eher kalkulativ-lose sind. Nutzen des Forschungsprojektes: Durch dieses Forschungsprojekt<br />
sollen Erkenntnisse darüber gewonnen werden, wie Multimediaagenturen ihre<br />
Kooperationsbeziehungen besser und zielgerichteter planen und gestalten können. Nutzen für<br />
die beteiligten Unternehmen: Die sich beteiligten Unternehmen erhalten für ihre Zusammenarbeit<br />
ein Dossier über Erfolgsmodelle von Kooperationen, sobald sie den Fragebogen eingesendet<br />
haben. Nach Abschluss des Projektes erhalten alle beteiligten Unternehmen einen Ergebnisbericht.<br />
METHODE: keine Angaben DATENGEWINNUNG: Qualitatives Interview (verschiedene Unternehmen).<br />
Standardisierte Befragung, schriftlich.<br />
ART: keine Angabe AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Technische Universität Cottbus, Fak. 03 Maschinenbau, Elektrotechnik und<br />
Wirtschaftsingenieurwesen, Institut für Wirtschaftswissenschaften (Postfach 101344, 03013<br />
Cottbus); Technische Universität Cottbus, Fak. 03 Maschinenbau, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen,<br />
Institut für Wirtschaftswissenschaften Lehrstuhl für Planung und Innovationsmanagement<br />
(Postfach 03013, 101344 Cottbus)<br />
KONTAKT: Lehrstuhl (Tel. 0355-69-2967, Fax: 0355-69-3009, e-mail: PI@tu-cottbus.de)
152 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
7 Wirtschaftssoziologie<br />
[186-F] Brensell, Ariane; Pühl, Katharina; Rudert, Katrin (Bearbeitung); Bührmann, Andrea D.,<br />
Prof.Dr. (Leitung):<br />
Die Geburt des unternehmerischen Selbst aus dem Geist des Neoliberalismus. Eine dispositivanalytische<br />
Untersuchung<br />
INHALT: Seit einiger Zeit wird in unterschiedlichen Debatten das Auftauchen des so genannten<br />
unternehmerischen Selbst ('enterprising self') konstatiert. Dieses Selbst zeichnet sich dadurch<br />
aus, dass es sein Handeln, Fühlen, Denken und Wollen an ökonomischen Effizienzkriterien<br />
und unternehmerischen Kalkülen ausrichtet. Für Richard Sennett etwa steht das unternehmerische<br />
Selbst 'als flexibler Mensch des Kapitalismus' in einer selbst-unternehmerischen Verantwortung.<br />
Es muss sich anpreisen und in der Lage sein, sich entsprechend zu präsentieren.<br />
Dieses unternehmerische Selbst wird in vielen Studien als aktuelle hegemoniale Subjektivierungsweise<br />
angesehen, also als die hegemoniale Weise, in der Menschen sich selbst und andere<br />
betrachten, wahrnehmen und erleben. Mit Blick auf diese Diagnose ergibt sich die folgende<br />
substanzielle - bisher allerdings nicht systematisch erforschte - Fragestellung: Über<br />
welche soziale Praktiken ist dieses unternehmerische Selbst hervorgebracht worden und welche<br />
Konsequenzen hat seine aktuelle Hegemonialität für das bestehende hierarchische Geschlechterverhältnis?<br />
Aufgrund der bisherigen Untersuchungen auf diesem Feld lässt sich die<br />
folgende Arbeitshypothese formulieren: Das unternehmerische Selbst taucht im Rahmen von<br />
vielfach diagnostizierten Individualisierungsprozessen verstärkt im letzten Drittel des 20.<br />
Jahrhunderts zugleich in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern, wie etwa in Diskursen<br />
zur Personalentwicklung aber auch in Emanzipationsdiskursen einzelner neuer sozialer<br />
Bewegungen auf. Das Auftauchen des unternehmerischen Selbst reflektiert auch einen<br />
Wandel vom Fordismus zum neoliberalen Projekt des Postfordismus. Hier nämlich braucht es<br />
nicht mehr den liberalen Unternehmer – wie ihn etwa Max Weber, aber auch implizit<br />
Theodor W. Adorno und Max Horkheimer so eindringlich beschrieben haben, - sondern eine<br />
Subjektivierungsweise, die Menschen dazu befähigt, sich selbst zu managen, und vor allem,<br />
sich selbst als Unternehmen zu begreifen und entsprechend zu führen. Von diesen Anforderungen<br />
scheinen nun am Beginn des 21. Jahrhunderts Menschen, insbesondere unabhängig<br />
von ihrem Geschlecht betroffen zu sein. Im Mittelpunkt des Forschungsprojektes stehen die<br />
folgenden Ziele: 1. Die dispositivanalytische Erforschung des Auftauchens des unternehmerischen<br />
Selbst im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts: Dabei soll es insbesondere um die Frage<br />
gehen, in welchen gesellschaftlichen Feldern, von wem und weshalb das Leitbild des unternehmerischen<br />
Selbst hervorgebracht worden ist und wie es hegemonial werden konnte. 2. Die<br />
Auslotung der Folgen einer Hegemonialisierung des unternehmerischen Selbst für 'Geschlecht'<br />
als Sozialstrukturkategorie: Hier sollen die Konsequenzen des Aufstiegs des unternehmerischen<br />
Selbst zum hegemonialen Leitbild moderner Subjektivierung für das Geschlechterverhältnis,<br />
insbesondere aber für die Ebene der geschlechtlichen Arbeitsteilung, erforscht<br />
werden. Zudem wird es auch darum gehen, das Verhältnis der Kategorie Geschlecht<br />
zu anderen Sozialstrukturkategorien, wie Klasse oder Ethnizität ('race'), mit Blick auf das gegenwärtige<br />
(Trans-)Formierungsgeschehen moderner Subjektivierungsweisen zu beleuchten.<br />
Zur Zeit wird, gefördert vom Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung, NRW<br />
eine Literaturrecherche zum Stand der Forschung erstellt.<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: keine Angaben ARBEITSPAPIERE: Bührmann, Andrea D.: The<br />
emerging of the entrepreneurial self and its contemporary hegemonic status: some fundamental<br />
observations for an analysis of the (trans-)formational process of modern forms of subjectivation,<br />
(49 paragraphes). Forum: Qualitative Social Research [Online Journal], 6, 1, Art. 16.<br />
Verfügbar über: http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/1-05/05-1-16-d.htm .+++ Bühr-
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 153<br />
7 Wirtschaftssoziologie<br />
mann, Andrea D.: Vom Programm zur individuellen Vermittlung von Subjektivierungsweisen<br />
- eine Einführung in einen Problemkreis. in: http://www.lrz-muenchen. de/~Diskursanalyse/doc/Vortrag_buehrmann.pdf<br />
.+++Bührmann, Andrea D.: Chancen und Risiken angewandter<br />
Diskursforschung. in: http://www.lrz-muenchen.de/~Diskursanalyse/ doc/Vortrag_<br />
buehrmann.pdf . April 2004.<br />
ART: Eigenprojekt BEGINN: 2004-03 ENDE: 2007-12 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FI-<br />
NANZIERER: Institution<br />
INSTITUTION: Universität Dortmund, FB 12 Erziehungswissenschaft und Soziologie, Institut<br />
für Soziologie Professur für Frauenforschung (44221 Dortmund)<br />
KONTAKT: Leiterin (Tel. 0231-755-6268, Fax: 0231-755-6509,<br />
e-mail: abuehrmann@fb12.uni-dortmund.de)<br />
[187-F] Brinkmann, Ulrich, Dr.; Candeias, Mario, Dr.; Röttger, Bernd, Dr. (Bearbeitung); Dörre,<br />
Klaus, Prof.Dr. (Leitung):<br />
Das neue Marktregime<br />
INHALT: Das Theorieprojekt fragt nach den Triebkräften eines Kapitalismus 'neuen Typs'. Die<br />
Analyse setzt am Produktionsmodell an und verortet es in einer makroökonomischen Konstellation,<br />
für die sich in der soziologischen Literatur der Begriff 'Finanzmarktkapitalismus'<br />
durchzusetzen beginnt. Ziel des Projekts ist es, die theoretischen Grundlagen empirisch ausgerichteter<br />
Arbeitsforschung zu reformulieren.<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: Dörre, K.: Intermediarität und gewerkschaftliche Identität. in: Industrielle<br />
Beziehungen, Jg. 12, H. 2, 207-212.+++Dörre, K.; Röttger, B.: Das neue Marktregime<br />
- Zwischenbilanz einer Debatte. in: Dörre; Röttger (Hrsg.): a.a.O. Hamburg: VSA 2003,<br />
S. 312-323.+++Dörre, K.: Du renouvellement des classes sociales. De l'actualité du concept<br />
de classes. in: Classes sociales: retour ou renouveau? Forum européen. Charactéritiques du<br />
capitalisme contemporain. Recherche d'alternatives. Paris: 2003, pp. 65-80.+++Ders.: Das<br />
flexibel-marktzentrierte Produktionsmodell - Gravitationszentrum eines neuen Kapitalismus?<br />
in: Dörre; Röttger (Hrsg.): Das neue Marktregime. Hamburg: VSA 2003, S. 7-34.+++ Ders.:<br />
Entsteht ein neues Produktionsmodell? Empirische Befunde, arbeitspolitische Konsequenzen,<br />
Forschungsperspektiven. in: Jahrbuch Arbeit, Bildung, Kultur 19/20, 2002, S. 9-34.+++Ders.:<br />
Neubildung von gesellschaftlichen Klassen? Zur Aktualität des Klassenbegriffs. in: Widerspruch,<br />
2002, H. 43, S. 79-90.+++Bieling, H.J. u.a. (Hrsg.): Flexibler Kapitalismus? Analysen,<br />
Kontroversen, Perspektiven. Hamburg: 2001.+++Bieling, H.J. u.a.: Am Beginn einer<br />
neuen Epoche? Anmerkungen zur Debatte über den 'flexiblen Kapitalismus'. in: Bieling, H. J.<br />
u.a. (Hrsg.): a.a.O.,2001, S. 8-35.+++Röttger, B.: Ökonomie und Hegemonie in der kapitalistischen<br />
Globalisierung. Die Kritik an mangelnden Regulierungen im globalen Kapitalismus<br />
setzt an der falschen Stelle an. in: Phase 2. Zeitschrift gegen die Realität, 2005, S. 26-30.<br />
+++Ders.: Die regionale Zukunft des Kapitalismus. New Regionalism, lokale Regulationsprozesse<br />
und die Reartikulation des regionalen Staates. in: Dörre, K.; Röttger, B. (Hrsg.): Die<br />
erschöpfte Region. Münster: Westf. Dampfboot 2005, S. 90-113.+++Röttger, B.; Wissen, M.:<br />
(Re)Regulationen des Lokalen. in: Kessl, F. u.a. (Hrsg.): Handbuch Sozialraum. Wiesbaden:<br />
Verl. f. Sozialwiss. 2005, S. 207-225.+++Röttger, B.: Integraler Staat. in: Historischkritisches<br />
Wörterbuch des Marxismus, Bd. 6.2. Hamburg: Argument-Verl. 2004,S. 1254-<br />
1266.+++Ders.: Staatlichkeit in der fortgeschrittenen Globalisierung. Der korporative Staat<br />
als Handlungskorridor politökonomischer Entwicklung, in: Demirovic, A.; Beerhorst, J.;<br />
Guggemos, M. (Hrsg.): Kritische Theorie im gesellschaftlichen Strukturwandel. Frankfurt am
154 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
7 Wirtschaftssoziologie<br />
Main: Suhrkamp 2004, S. 153-177.+++Ders.: Glanz und Elend der Regulationstheorie. Einige<br />
Reflexionen zum Begriff der Regulation. in: spw. Zeitschrift für sozialistische Politik und<br />
Wirtschaft, 1, 2004, H. 125, S. 17-21 (s.u.: http://www.spw.de/135/roettger_spw_135.pdf ).<br />
+++Ders.: Verlassene Gräber und neue Pilger an der Grabesstätte. Eine neo-regulationistische<br />
Perspektive. in: Brand, U.; Raza, W. (Hrsg.): Fit für den Postfordismus? Theoretischpolitische<br />
Perspektiven der Regulationstheorie. Münster: Westf. Dampfboot 2003, S. 18-<br />
42.+++Ders.: Produktionsmodell und Gesellschaftsformation. Fortgeschrittene Globalisierung<br />
und Korridore des Regulationsprozesses. in: Dörre, K.; Röttger, B. (Hrsg.): Das neue Marktregime.<br />
Konturen eines nachfordistischen Produktionsmodells. Hamburg: VSA 2003, S. 95-<br />
110.+++Ders.: Arbeit - Emanzipation - passive Revolution. Metamorphosen der Arbeitspolitik<br />
und die Zukunft der Gewerkschaften. in: Kurswechsel, 2003, H. 3, S. 8-21 (s.u.: http:<br />
//www.linksnet.de/artikel.php?id=1105 ).+++Brinkmann, U.: Von den "shared values" zum<br />
"shareholder value" - der Abschied von der "Unternehmenskultur". FIAB-Arbeitspapier, Nr.<br />
3. Recklinghausen: FIAB-Verl. 2002.+++Ders.: Die Labormaus des Westens: Ostdeutschland<br />
als Vorwegnahme des Neuen Produktionsmodells? in: Dörre, K.; Röttger, B. (Hrsg.): Das<br />
neue Marktregime. Konturen eines nachfordistischen Produktionsmodells. Hamburg: VSA<br />
2003, S. 250-269.+++Ders.: Rezension: Torsten Strulik, Nichtwissen und Vertrauen in der<br />
Wissensökonomie. in: Soziologische Revue, 2005, 28, S. 256-260.+++Brinkmann, U.; Meifert,<br />
M.: Vertrauen bei Internetauktionen. Eine kritische Stellungnahme. in: KZSS, 55, 2003,<br />
3, S. 557-565.<br />
ART: Eigenprojekt BEGINN: 2001-01 ENDE: 2006-12 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FI-<br />
NANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Universität Jena, Fak. für Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Institut für<br />
Soziologie Lehrstuhl für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie (07737 Jena)<br />
KONTAKT: Leiter (e-mail: Klaus.Doerre@uni-jena.de)<br />
[188-F] Bude, Heinz, Prof.Dr.phil. (Bearbeitung):<br />
Unternehmerisches Handeln<br />
INHALT: Der Begriff des Unternehmertums oder der Selbständigkeit gehört heute zum parteiübergreifenden<br />
Modernisierungsprogramm der bundesrepublikanischen Gesellschaft. Man ist<br />
auf der Suche nach den Trägern der Innovation, die aus den eingefahrenen Bahnen des "Modells<br />
Deutschland" ausbrechen und in Form von wissenschaftlichen Entdeckungen, wirtschaftlichen<br />
Produkten, künstlerischen Werken oder organisatorischen Formen etwas Neues<br />
in die Welt bringen. Das bleibt aber in der Regel mehr ein Aufruf und eine Aufforderung als<br />
eine begründete Vorstellung über die Stimulierung und Initiierung unternehmerischer Zusammenhänge.<br />
Das Projekt greift dieses gesellschaftspolitische Programm als eine Grundlagenproblematik<br />
der soziologischen Begriffsbildung auf. Es geht um die Entwicklung eines<br />
Begriffs des unternehmerischen Handelns, der in der Lage ist, die verschiedenen Aspekte des<br />
sozialen Unternehmertums zu umfassen. In der Soziologie werden ganz verschiedene Konzeptualisierungen<br />
sozialen Handelns angeboten, die etwa auf anthropologisch tief sitzende<br />
Unterscheidungen wie der zwischen Arbeit und Interaktion oder auf Vorstellungen verschiedener<br />
Praxisbereiche in unserer Gesellschaft wie Wissenschaft, Recht, Wirtschaft, Bildung<br />
oder Sport abheben. Was dabei auf der Strecke bleibt, ist die Hybridform entdeckerischen,<br />
verbindenden und energischen Handelns, die man gewöhnlich mit dem unternehmerischen<br />
Typ in den verschiedenen Lebensbereichen unserer Gesellschaft in Zusammenhang bringt.<br />
Sozialer Wandel und gesellschaftliche Innovation war zwar immer schon ein Thema des so-
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 155<br />
7 Wirtschaftssoziologie<br />
ziologischen Interesses, aber es fehlen bis heute grundlagentheoretische Vorstellungen über<br />
die Bedingungen der Möglichkeit gesellschaftlicher Veränderungen. Man muss schon bei den<br />
Wissenschaftstheoretikern oder den Ökonomen suchen, um Konzepte unternehmerischer<br />
Wandlungen zu finden. Gemeint ist beispielsweise Kuhns Idee des "Paradigmenwechsels"<br />
und Schumpeters Konzept des "unternehmerischen Unternehmers". Ihre theoretischen Impulse<br />
werden in diesem Projekt aufgegriffen und in eine genuin soziologische Konzeptbildung<br />
überführt. Die empirische Basis für diese konzeptuelle Arbeit sind intensive qualitative Studien<br />
über Gründerunternehmer in Baden-Württemberg. Hier hat sich gezeigt, dass die Befragten<br />
einen entscheidenden Unterschied zwischen einem bloßen Selbständigen in einer erweiterten<br />
Familienökonomie und einem innovativen Unternehmer, der Wachstum fördert und<br />
Arbeitsplätze schafft, machen. Während Selbständigkeit nur einen erweiterten Bereich der<br />
Selbstverwirklichung darstellt, scheint der Unternehmer zu einer Praxis der Selbstverausgabung<br />
zu neigen. Unternehmertum ist tatsächlich ein Wagnis, das nicht nur an ganz bestimmte<br />
persönliche Dispositionen, sondern auch an gewisse soziale Kontexte gebunden ist. Um ein<br />
gesellschaftlich wirkungsmächtiges Unternehmertum zu fördern, braucht es eine Aufmerksamkeitsbereitschaft<br />
für die entsprechenden persönlichen Typen wie auch Vorkehrungen zur<br />
Einrichtung unternehmerischer Milieus. Dies alles ist nicht auf das wirtschaftliche Unternehmertum<br />
beschränkt, sondern gilt genauso für unternehmerische Künstler, unternehmerische<br />
Wissenschaftler oder unternehmerische Sozialarbeiter. Das Ziel des Projekts besteht darin,<br />
Erkenntnisse und Einsichten in einer Grundlagenreflexion zusammenzufassen und zu einem<br />
Modell unternehmerischen Handelns auszuarbeiten.<br />
ART: keine Angabe AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Hamburger Institut für Sozialforschung (Mittelweg 36, 20148 Hamburg)<br />
KONTAKT: Institution (e-mail: his@his-online.de)<br />
[189-L] Buss, Klaus-Peter; Wittke, Volker:<br />
Varieties of German capitalism, in: SOFI-Mitteilungen : Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen,<br />
2005, Nr. 33, S. 81-85 (Standort: USB Köln(38)-XG05472; Kopie über den Literaturdienst<br />
erhältlich)<br />
INHALT: In Deutschland gibt es zumindest zwei Varianten des Kapitalismus, eine ostdeutsche<br />
und eine westdeutsche. Der Aufholprozess der neuen Bundesländer ist Mitte der 1990er Jahre<br />
abgebrochen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hat sich gezeigt, dass zentrale Elemente des<br />
westdeutschen kapitalistischen Systems (Gewerkschaften, Berufsbildung) im Osten nicht oder<br />
anders funktionieren als im Westen. Die Verfasser stellen Beispiele erfolgreicher Unternehmen<br />
aus den neuen Bundesländern vor und fragen nach den Gründen dieses Erfolgs. Sie zeigen,<br />
dass es diesen Unternehmen gelungen ist, sich vom Vorbild Westdeutschland zu befreien<br />
und eine kreative Antwort auf die veränderten institutionellen Rahmenbedingungen zu finden.<br />
Dabei wird nicht ein ostdeutsches Produktionsmodell sichtbar, es treten viele verschiedene<br />
Wege zu Tage, in denen Unternehmen vom westdeutschen Modell abweichen können, wobei<br />
sie zumeist Kompetenzen nutzen, die in den ehemaligen lokalen ostdeutschen Produktionsstrukturen<br />
verwurzelt sind. Die erfolgreichen Unternehmen in den neuen Bundesländern sind<br />
alle in einem spezifischen Sinne ostdeutsch. (ICE)<br />
[190-F] Center for Corporate Citizenship e.V.:<br />
Gesellschaftliches Engagement im Mittelstand
156 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
7 Wirtschaftssoziologie<br />
INHALT: Zusammen mit Partnern an der Brunel University in London führte das Center for Corporate<br />
Citizenship ein von der Deutsch-Britischen Stiftung gefördertes empirisches Forschungsprojekt<br />
zum Bürgerengagement kleiner und mittelgroßer Unternehmen im Raum<br />
London und München durch. An einem internationalen Workshop im Frühsommer 2002 in<br />
London nahmen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus über 10 Nationen teil. Die<br />
Ergebnisse wurden auf verschiedenen internationalen Fachtagungen und in englischsprachigen<br />
Fachzeitschriften veröffentlicht. GEOGRAPHISCHER RAUM: London, München<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: Spence, Laura J.; Habisch, André; Schmidpeter, René: Responsibility<br />
and social capital. The world of small and medium sized enterprises. Hampshire: Palgrave<br />
McMillan Ltd. 2005, 208 pp. ISBN 1-403-94315-X.<br />
ART: gefördert AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: Deutsch-Britische Stiftung<br />
INSTITUTION: Center for Corporate Citizenship e.V. (Marktplatz 4, 85072 Eichstätt)<br />
[191-L] Fehmel, Thilo:<br />
Staatshandeln zwischen betrieblicher Beschäftigungssicherung und Tarifautonomie: die<br />
adaptive Transformation der industriellen Beziehungen durch den Staat, (Arbeitsberichte des<br />
Instituts für Soziologie der Universität Leipzig, Nr. 42), Leipzig 2006, 30 S. (Graue Literatur;<br />
URL: http://www.uni-leipzig.de/~sozio/content/site/a_berichte/42.pdf)<br />
INHALT: "In demokratischen politischen Systemen haben staatliche Akteure darauf zu achten,<br />
die legitimatorische und die ökonomische Basis ihres Handelns stabil und miteinander vereinbar<br />
zu halten. Dieses Interesse des politischen Systems an sich selbst wird damit zur<br />
Grundlage all seiner Steuerungsbemühungen. Aufgrund der strukturellen Abhängigkeit des<br />
Staates von einer funktionsfähigen Ökonomie ist staatlichen Akteuren auch an der Steuerung<br />
der industriellen Beziehungen gelegen - zumindest dann, wenn sie in Rezessionsphasen das<br />
Handeln der Tarifverbände als dysfunktional bewerten. Unmittelbarer staatlicher Intervention<br />
und Steuerung steht aber das grundgesetzlich verankerte Konstrukt der Tarifautonomie entgegen.<br />
Das bedeutet jedoch nicht, dass dem Staat alle Steuerungsmöglichkeiten genommen<br />
sind. Am Beispiel der staatlichen Forcierung betrieblicher Bündnisse für Arbeit wird gezeigt,<br />
dass der Staat über den Umweg der indirekten, diskursiven Steuerung in der Lage ist, gesellschaftliche<br />
Akteure zur Selbststeuerung anzuregen. Im Ergebnis lässt sich eine Transformation<br />
der Strukturen der industriellen Beziehungen beobachten, die zu einem wesentlichen Teil<br />
nicht von den Tarifverbänden, sondern vom Staat ausgeht." (Autorenreferat)<br />
[192-F] Fox, Katja, Dipl.-Soz.Wiss.; Schalk, Christa, Dipl.-Gesundheitswiss. (Bearbeitung);<br />
Heinze, Rolf G., Prof.Dr.; Hilbert, Josef, PD Dr. (Leitung):<br />
Regionale Innovations- und Qualifizierungsstrategien in der Medizintechnik<br />
INHALT: Die Medizintechnik ist eine dynamische und hoch innovative Branche mit einem überdurchschnittlichen<br />
F&E-Anteil und kurzen Produktlebenszyklen. Ausgangshypothese ist, dass<br />
die derzeitigen Berufsbilder und Studiengänge den zukünftigen Anforderungen der Branchenentwicklung<br />
nicht genügen und die Qualifizierungsstandards eher eine "Innovationsbremse"<br />
bei Unternehmen und Anwendern sind. Ziel ist es, den Status quo der Aus- und Weiterbildung<br />
in der Branche und in Kliniken zu ermitteln, Defizite herauszuarbeiten und umsetzungsorientierte<br />
Lösungen vorzuschlagen. Zudem geht es um die Frage, wie sich Netzwerkaktivitäten<br />
im Bereich Qualifizierung effizient gestalten lassen, um ein regionales Standart-
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 157<br />
7 Wirtschaftssoziologie<br />
management voranzutreiben ("corporate universities" etc.). GEOGRAPHISCHER RAUM:<br />
Aachen; Ruhrgebiet; Nürnberg, Erlangen; München<br />
METHODE: Quantitative Erhebung gekoppelt mit qualitativen Interviews; policy-Analyse zur<br />
Qualifizierung. Untersuchungsdesign: Einmalbefragung DATENGEWINNUNG: Qualitatives<br />
Interview (Stichprobe: 12; vertiefende Experteninterviews nach der Befragung mit Herstellern,<br />
Anwendern und Verbänden/ Netzwerkakteuren). Standardisierte Befragung, schriftlich<br />
(Stichprobe: 1.500; Medizintechnikhersteller und Kliniken/ radiologische Praxen; Auswahlverfahren:<br />
total). Feldarbeit durch Mitarbeiter/-innen des Projekts.<br />
ART: Auftragsforschung BEGINN: 2005-04 ENDE: 2006-09 AUFTRAGGEBER: Hans-Böckler-<br />
Stiftung FINANZIERER: Auftraggeber<br />
INSTITUTION: Universität Bochum, Fak. für Sozialwissenschaft, Sektion Soziologie Lehrstuhl<br />
für Arbeits- und Wirtschaftssoziologie (44780 Bochum); Institut Arbeit und Technik im Wissenschaftszentrum<br />
Nordrhein-Westfalen (Munscheidstr. 14, 45886 Gelsenkirchen)<br />
KONTAKT: Fox, Katja (Tel. 0234-3225-422, e-mail: katja.fox@rub.de)<br />
[193-F] Goldberg, Isabell, Dipl.-Ökotroph. (Bearbeitung); Roosen, Jutta, Prof.Ph.D. (Betreuung):<br />
Qualitätssignale & Verbraucherwahrnehmung - welche Ansprüche hat der Verbraucher<br />
und wie reagiert der Ernährungssektor?<br />
INHALT: Die Dissertation befasst sich mit der ökonomischen Bewertung von Gesundheitsrisikoverringerungen<br />
durch Verbraucher. So kommen Choice Experimente, der kontingente Bewertungsansatz<br />
und eine Auktion zum Einsatz, um die Zahlungsbereitschaft für ein höheres Niveau<br />
an Lebensmittelsicherheit zu messen. In Fallstudien (geplant Sommer 2006) werden<br />
Entscheider der Ernährungswirtschaft zu einem speziellen Thema aus dem Bereich der Lebensmittelqualität<br />
und -sicherheit befragt, um Einblicke in das Problembewusstsein von Qualitäts-<br />
und Sicherheitsaspekten von Nahrungsmitteln zu erhalten. Als weiteres soll die Zusammenarbeit<br />
von Herstellern und Händlern untersucht, sowie Potentiale für eine Verbesserung<br />
der Zusammenarbeit aufgezeigt werden. Das Forschungsprojekt ist eingegliedert in die<br />
Forschungsgruppe "Lebensmittelqualität und -sicherheit" (QUASI) der Christian-Albrechts-<br />
Universität zu Kiel. ZEITRAUM: 2004-2007 GEOGRAPHISCHER RAUM: Schleswig-<br />
Holstein, Bundesrepublik Deutschland<br />
METHODE: Ziel dieses Forschungsvorhabens ist es, Einblicke in das Verbraucherverhalten zu<br />
erhalten. Die Methoden, die dabei zur Anwendung kommen sind Choice Experimente, der<br />
kontingente Bewertungsansatz, sowie Laborexperimente (experimentelle Ökonomik), mit deren<br />
Hilfe Zahlungsbereitschaften für Gesundheitsrisikoverringerungen gemessen werden.<br />
Fallstudien skizzieren darüber hinaus die Zusammenarbeit von Herstellern und Händlern und<br />
sollen Verbesserungspotentiale aufdecken helfen. Untersuchungsdesign: Querschnitt DATEN-<br />
GEWINNUNG: Standardisierte Befragung, face to face (Stichprobe: 240; fleischverzehrende<br />
Verbraucher; Auswahlverfahren: Zufall). Experiment (Stichprobe: 84; Mütter/ Väter, die Babymilchnahrung<br />
gefüttert haben; Auswahlverfahren: Zufall). Qualitatives Interview (Entscheider<br />
in der Ernährungswirtschaft). Feldarbeit durch Mitarbeiter/-innen des Projekts.<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: keine Angaben ARBEITSPAPIERE: Goldberg, I.; Roosen, J.:<br />
Measuring consumer willingness to pay for a health risk reduction of Salmonellosis and<br />
Campylobacteriosis. Contributed Paper. XIth Congress of the European Association of Agricultural<br />
Economists, EAAE, 24.-27.08.2005 in Kopenhagen/ Dänemark. Download:<br />
http://www.food-econ.uni-kiel.de/go/mitarbeiter/goldberg/eaae.pdf .
158 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
7 Wirtschaftssoziologie<br />
ART: Dissertation; gefördert BEGINN: 2004-05 ENDE: 2007-05 AUFTRAGGEBER: nein FI-<br />
NANZIERER: Arbeitsgruppe Lebensmittelqualität und -sicherheit -QUASI-<br />
INSTITUTION: Universität Kiel, Agrar- und Ernährungswissenschaftliche Fakultät, Institut für<br />
Ernährungswirtschaft und Verbrauchslehre Abt. Haushalts- und verbraucherorientierte Gesundheitsökonomik<br />
(Olshausenstr. 40, 24098 Kiel)<br />
KONTAKT: Bearbeiterin (Tel. 0431-880-4427, e-mail: igoldberg@food-econ.uni-kiel.de)<br />
[194-F] Griese, Hartmut M., Prof.Dr. (Bearbeitung):<br />
Wie Frauen Arbeitsplätze schaffen<br />
INHALT: keine Angaben<br />
ART: Auftragsforschung BEGINN: 2003-01 AUFTRAGGEBER: Verband Deutscher Unternehmerinnen<br />
-VDU- FINANZIERER: Auftraggeber<br />
INSTITUTION: Universität Hannover, Philosophische Fakultät, Institut für Soziologie und Sozialpsychologie<br />
Fach Soziologie Lehrstuhl für Soziologie Prof.Dr. Griese (Schneiderberg 50,<br />
30167 Hannover)<br />
KONTAKT: Bearbeiter (Tel. 762-8543, Fax: 762-8381, e-mail: griese@erz.uni-hannover.de)<br />
[195-F] Hafner, Sonja Johanna, M.A. (Leitung); Minssen, Heiner, Prof.Dr. (Betreuung):<br />
Sisyphus und Macchiavelli bei der Arbeit. Arbeitspolitik, Imitation und Desintegration in<br />
den Spannungsfeldern von Dezentralisierung, Globalisierung und neuer Komplexität. Eine<br />
Studie über Hintergründe, Begründungen, Verlauf und Folgen globaler Re-Standardisierungsprozesse,<br />
gezeigt an einem emp. Fall der Autoindustrie<br />
INHALT: Warum gewinnen "ganzheitliche" Produktions- und Managementsysteme an Bedeutung?<br />
Welche gesellschaftlichen Hintergründe lassen sich dafür ausmachen? ("Gesellschaftliche<br />
Einbettung" von Arbeitspolitik). Was passiert tatsächlich bei der Entwicklung und Umsetzung<br />
solcher Systeme? (unbeabsichtigte Folgen). Fokus: beschleunigter Wandel, Standardisierung<br />
in der Produktion, Best practices, Rolle von Führungskräften. ZEITRAUM: 1999-<br />
2004 (empirische Feldforschung)<br />
METHODE: Zusammenhänge zwischen kulturellen, soziologischen Gegenwartsdiagnosen, der<br />
Rolle des Kapitalismus und neueren neo-institutionalistischen Ansätzen sowie macht-/ alterszentrierten<br />
Theorien. Untersuchungsdesign: Mikropolitikanalyse/ Feldforschung über 4 Jahre<br />
DATENGEWINNUNG: Beobachtung, teilnehmend. Inhaltsanalyse, offen. Aktenanalyse, offen.<br />
Gruppendiskussion. Qualitatives Interview. Feldforschung/ beobachtende Teilnahme.<br />
Feldarbeit durch Bearbeiterin des Projekts.<br />
ART: Dissertation; Auftragsforschung BEGINN: 2000-01 ENDE: 2005-12 AUFTRAGGEBER:<br />
DaimlerChrysler AG FINANZIERER: Auftraggeber; Wissenschaftler<br />
INSTITUTION: Universität Duisburg-Essen Campus Essen, FB Bildungswissenschaften, Labor<br />
für Organisationsentwicklung -OrgLab- (Universitätsstr. 12, 45117 Essen)<br />
[196-F] Hagen, Kornelia, Dipl.-Volksw.; Swaminathan, Sushmita, M.A. (Bearbeitung):<br />
A study on measures to increase trust and confidence of consumers in the information society
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 159<br />
7 Wirtschaftssoziologie<br />
INHALT: Die Verbreitung und breite Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien<br />
(IKT) ist eine notwendige Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit von Volkswirtschaften<br />
und die Beschäftigungsfähigkeit der Bevölkerung. Der Anwendung neuer Medien<br />
für geschäftliche Aktionen von Verbrauchern werden vorrangig Vorteile zugesprochen, wie<br />
höhere Transparenz und leichterer Zugang zu Informationen über die Qualität und die Preise<br />
von Produkten sowie niedrigere Preise. Allerdings zeigen verschiedene empirische Befunde,<br />
dass viele Verbraucher E-Commerce nach wie vor nicht nutzen wollen, weil sie nicht das<br />
Vertrauen in die Anwendungssicherheit der neuen Medien haben. Politikmaßnahmen zur<br />
Steigerung des Vertrauens stehen im Fokus der Studie. Untersucht wird dafür in den 25 EU-<br />
Mitgliedsstaaten sowie vier Beitritts- und Kandidatenstaaten das Verbrauchervertrauen in Bezug<br />
auf die Nutzung von E-Commerce, eSecurity-Maßnahmen sowie Maßnahmen des wirtschaftlichen<br />
Verbraucherschutzes, dass in den einzelnen Ländern das Verbrauchervertrauen<br />
befördern soll. GEOGRAPHISCHER RAUM: Europa<br />
METHODE: Die Untersuchung umfasst Länderanalysen, eine Verbraucherumfrage, Fallstudien<br />
und Dialoge mit Stakeholdern der Verbraucherpolitik und des Politikfeldes Informationsgesellschaft<br />
sowie analysebasierte Handlungsempfehlungen für die EU-Politik.<br />
ART: Auftragsforschung AUFTRAGGEBER: Europäische Kommission FINANZIERER: Auftraggeber<br />
INSTITUTION: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung -DIW Berlin- Abt. Informationsgesellschaft<br />
und Wettbewerb (Königin-Luise-Str. 5, 14195 Berlin); empirica Gesellschaft für<br />
Kommunikations- und Technologieforschung mbH (Oxfordstr. 2, 53111 Bonn)<br />
KONTAKT: Hagen, Kornelia (Tel. 030-89789-668, e-mail: khagen@diw.de); Swaminathan,<br />
Sushmita (Tel. 030-89789-300, e-mail: sswaminathan@diw.de)<br />
[197-F] Heckelei, Thomas, Prof.Dr.; Britz, Wolfgang, Dr.; Adenäuer, Marcel, Dipl.-Ing.agr. (Bearbeitung):<br />
Development of a regionalized EU-wide operational model to assess the impact of common<br />
agricultural policy on farming sustainability (in the framework of "Common agricultural<br />
policy regional impact analysis" -CAPRI-)<br />
INHALT: The partial equilibrium agricultural sector model CAPRI matches the major requirements<br />
mentioned in the call for tender and therefore applied for the project: 1. It is Pan-<br />
European (currently covering EU 25, inclusion of Romania and Bulgaria is proposed in here)<br />
and regionalized at NUTS II level. 2. It combines regional programming models with a global<br />
multi-commodity model for main agricultural products, thus allowing for endogenous prices<br />
for agricultural outputs. 3. Special modules or parts of the regional programming models deal<br />
with pricing of young animals, own produced feed and organic fertilizer. 4. The model is<br />
linked to environmental indicators (N, P, K balances, output of CH4, NH3 and NOx, calculation<br />
of Global Warming Potentials in line with IPCC guideline, water scarcity indicator; a<br />
module to break down the NUTS II results to small homogenous mapping units, allowing a<br />
link to bio-physical models and landscape indicators is under development). 5. The model is<br />
realized in GAMS. 6. It is typically used for medium-term analysis (8-10 years from the current<br />
base period). The main work in the context of the project is the documentation of the<br />
enlarged system and training for IPTS staff. The structure of the individual aggregate supply<br />
models in CAPRI will continue to be identical across farm type models, differences will be<br />
expressed in farm type specific parameter sets. That requires that the model equations and<br />
variables are general enough to build a framework which captures the main interactions be-
160 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
7 Wirtschaftssoziologie<br />
tween activities on farm and between the farm, markets and the environment. Nevertheless,<br />
scarce resources plus the pan-European approach with endogenous prices define limits for the<br />
complexity of the single farm programming models, and will certainly lead to distinct differences<br />
to typical single farm models. The most obvious difference between the proposed farm<br />
type model and typical, well developed single farm type model will be the use of a non-linear<br />
cost function approach with adjustment costs whose parameters will be derived both from<br />
econometric estimations, literature reviews and engineering knowledge. The cost function<br />
approach serves multiple purposes: 1. it allows for perfect calibration of the model to given<br />
ex post data; 2. it allows for technically elegant and easy way to represent complex interactions<br />
between activities on farm where a primal representation by technological constraints<br />
would be too expensive or even impossible given missing data, and 3. it avoids the typical<br />
overspecialized corner solution in LP models with a limited number of constraints, and 4.<br />
perhaps most important, links model behaviour to observed behaviour of farmers. Partners:<br />
FAL, Braunschweig, Germany; EuroCARE. GEOGRAPHISCHER RAUM: Europäische Union<br />
ART: keine Angabe BEGINN: 2004-12 ENDE: 2006-06 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FI-<br />
NANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Universität Bonn, Landwirtschaftliche Fakultät, Institut für Agrarpolitik, Marktforschung<br />
und Wirtschaftssoziologie Abt. Wirtschafts- und Agrarpolitik (Nußallee 21, 53115<br />
Bonn); Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft -FAL- (Bundesallee 50, 38116 Braunschweig)<br />
KONTAKT: Heckelei, Thomas (Prof.Dr. Tel. 0228-73-2332, Fax: 0228-73-4693,<br />
e-mail: heckelei@agp.uni-bonn.de)<br />
[198-F] Hesse, Klaus, Prof.Dr. (Bearbeitung):<br />
Analyse des Verbraucherverhaltens bei Nahrungs- und Genußmitteln<br />
INHALT: keine Angaben<br />
ART: keine Angabe AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Universität Kiel, Agrar- und Ernährungswissenschaftliche Fakultät, Institut für<br />
Ernährungswirtschaft und Verbrauchslehre Abt. Haushalts- und verbraucherorientierte Gesundheitsökonomik<br />
(Olshausenstr. 40, 24098 Kiel)<br />
KONTAKT: Sekretariat (Tel. 0431-880-4466, Fax: 0431-880-7308,<br />
e-mail: tbittne@food-econ.uni-kiel.de)<br />
[199-F] Hoffmann, Jürgen, Prof.Dr.rer.pol.; Waddington, Jeremy (Bearbeitung):<br />
Trade union merger network<br />
INHALT: keine Angaben<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: keine Angaben ARBEITSPAPIERE: Vergleichende Analyse westeuropäischer<br />
gewerkschaftlicher Fusionen. Brüssel 2005.<br />
ART: gefördert AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Universität Hamburg, Fak. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Department<br />
Wirtschaft und Politik Fachgebiet Soziologie (Von-Melle-Park 9, 20146 Hamburg)<br />
KONTAKT: Hoffmann, Jürgen (Prof.Dr. Tel. 040-42838-2557, Fax: 040-428-38-4150,<br />
e-mail: Juergen.Hoffmann@wiso.uni-hamburg.de)
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 161<br />
7 Wirtschaftssoziologie<br />
[200-F] Höpner, Martin, Dr. (Bearbeitung):<br />
Organisierter Kapitalismus in Deutschland<br />
INHALT: Im Kontext der Debatte über unterschiedliche Spielarten des Kapitalismus werden in<br />
diesem Projekt Konstruktion und Transformation des organisierten Kapitalismus in der Bundesrepublik<br />
Deutschland untersucht. Im Mittelpunkt stehen die Wechselwirkung zwischen<br />
der institutionellen Beschaffenheit der Arbeitsbeziehungen und den Institutionen der Unternehmenskontrolle<br />
(Corporate Governance) sowie die Versuche staatlicher Steuerung der beiden<br />
Sphären. In theoretischer Hinsicht werden Rückschlüsse für die Diskussion über institutionelle<br />
Komplementarität und die Debatte über Dynamiken des institutionellen Wandels von<br />
Produktionsregimen angestrebt. GEOGRAPHISCHER RAUM: Bundesrepublik Deutschland<br />
METHODE: Das Projekt verwendet qualitativ-historische und quantitative Daten. Geplant sind<br />
zunächst laufende Veröffentlichungen von Teilergebnissen in Fachzeitschriften und Sammelbänden.<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: Höpner, M.: Der organisierte Kapitalismus in Deutschland und<br />
sein Niedergang. in: Czada, Roland (Hrsg.): PVS-Sonderheft 2003 "Staat und Markt". 2004<br />
(im Erscheinen).<br />
ART: keine Angabe BEGINN: 2003-04 ENDE: 2006-12 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FI-<br />
NANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung (Paulstr. 3, 50676 Köln)<br />
KONTAKT: Bearbeiter (Tel. 0221-2767-188, Fax: 0221-2767-555, e-mail: Hoepner@mpi-fgkoeln.mpg.de)<br />
[201-F] Huber, Joseph, Prof.Dr. (Bearbeitung):<br />
Neue Ordnungspolitik im vereinten Deutschland. Ein konstitutionelles Reformszenario<br />
INHALT: keine Angaben<br />
ART: Eigenprojekt BEGINN: 2000-01 ENDE: 2005-12 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FI-<br />
NANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Universität Halle-Wittenberg, Philosophische Fakultät, Institut für Soziologie<br />
Lehrstuhl für Wirtschafts- und Umweltsoziologie (06099 Halle)<br />
KONTAKT: Bearbeiter (Tel. 0345-55242-42, Fax: 0345-55271-49,<br />
e-mail: joseph.huber@soziologie.uni-halle.de)<br />
[202-F] Kerschke-Risch, Pamela, Dr.; Meinecke, Gunnar, Dr. (Bearbeitung); Scheerer, Sebastian,<br />
Prof.Dr. (Leitung):<br />
Eine kriminologische Analyse des Entscheidungsverhaltens in der Wertschöpfungskette<br />
"konventionelles Geflügel" und "Öko-Geflügel"<br />
INHALT: Das Ziel des Projektes ist es, Ursachen und Bedingungen des Entscheidungsverhaltens<br />
maßgeblicher Akteure auf den verschiedenen Stufen der Geflügelproduktion zu analysieren<br />
und konkrete Präventionsempfehlungen zur zukünftigen Vermeidung von Normbrüchen abzuleiten.<br />
GEOGRAPHISCHER RAUM: Bundesrepublik Deutschland<br />
METHODE: Handlungstheorie; methodischer Individualismus. Untersuchungsdesign: Querschnitt<br />
DATENGEWINNUNG: Aktenanalyse, offen; Qualitatives Interview. Feldarbeit durch<br />
Mitarbeiter/-innen des Projekts.
162 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
7 Wirtschaftssoziologie<br />
ART: Auftragsforschung BEGINN: 2005-04 ENDE: 2007-01 AUFTRAGGEBER: Bundesanstalt<br />
für Landwirtschaft und Ernährung -BLE-; Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Verbraucherschutz FINANZIERER: Auftraggeber<br />
INSTITUTION: Universität Hamburg, Fak. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Department<br />
Sozialwissenschaften Institut für Kriminologische Sozialforschung (Allende-Platz 1, 20146<br />
Hamburg)<br />
KONTAKT: Kerschke-Risch, Pamela (Dr. Tel. 040-42838-3329,<br />
e-mail: kerschke-risch@sozialwiss.uni-hamburg.de)<br />
[203-F] Koerfer, Armin, Dr.phil.; Herzig, Stefan, Prof.Dr.med. (Bearbeitung):<br />
Leitbilder vom "guten Arzt". Inhaltsanalytische Untersuchungen von Experten- und Laienbefragungen<br />
INHALT: keine Angaben<br />
METHODE: Ausgangspunkt einer inhaltsanalytischen Pilotstudie zu Leitbildern vom 'guten Arzt'<br />
sind Interviews, die mit prominenten Professionsvertretern in der Deutschen Medizinischen<br />
Wochenzeitschrift (DMW) geführt wurden. Die Inhaltsanalyse folgt den Prinzipien einer zirkulären,<br />
gegenstandsbezogenen Rekonstruktionsmethode im Sinne einer Grounded Theory<br />
(Glaser/ Strauss). Auf einer erweiterten Datenbasis sollen zudem komparative Studien durchgeführt<br />
werden, in denen die Arztbilder von Professionsvertretern, Patienten und Medizinstudierenden<br />
verglichen werden.<br />
ART: Eigenprojekt BEGINN: 2005-04 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine<br />
Angabe<br />
INSTITUTION: Universität Köln, Medizinische Fakultät, Klinik und Poliklinik für Psychosomatik<br />
und Psychotherapie (50924 Köln)<br />
KONTAKT: Koerfer, Armin (Dr. Tel. 0221-478-5859, e-mail: armin.koerfer@uk-koeln.de)<br />
[204-F] Kollmann, Karl, Univ.-Prof.Dr. (Bearbeitung):<br />
Konsumenten 2004<br />
INHALT: Mit diesem Projekt sollen Verbraucherverhalten, Verbrauchereinstellungen und Konsumprobleme<br />
erhoben werden. ZEITRAUM: 2004 GEOGRAPHISCHER RAUM: Österreich<br />
ART: keine Angabe BEGINN: 2003-06 ENDE: 2004-06 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FI-<br />
NANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien Abt. Konsumentenpolitik (Prinz<br />
Eugen-Straße 20-22, 1090 Wien, Österreich)<br />
KONTAKT: Bearbeiter (e-mail: karl.kollmann@akwien.at)<br />
[205-L] Leonardi, Salvo:<br />
Gewerkschaften und Wohlfahrtsstaat: das Gent-System, in: WSI Mitteilungen : Monatszeitschrift<br />
des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in der Hans-Böckler-Stiftung, Jg.<br />
59/2006, H. 2, S. 79-85 (Standort: USB Köln(38)-Haa964; Kopie über den Literaturdienst erhältlich;<br />
URL: http://www.econdoc.de/_de/indexwsi.htm)
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 163<br />
7 Wirtschaftssoziologie<br />
INHALT: "Die skandinavischen Länder (Schweden, Finnland und Dänemark) sowie Belgien<br />
verzeichnen einen relativ stabilen und hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad. Eine wesentliche<br />
Erklärung liegt im Gent-System, das auf einer gewerkschaftlichen Beteiligung an<br />
der Verwaltung der Arbeitslosenversicherung beruht. Vor dem systematisierten Hintergrund<br />
der sozialen Sicherungssysteme und industriellen Beziehungen in Europa werden die Spezifika<br />
des Gent-Systems und seine Auswirkungen auf den gewerkschaftlichen Organisationsgrad<br />
analysiert und bewertet: Zusammen mit der Stärke in Tarifverhandlungen und der wirkungsvollen<br />
Präsenz der Gewerkschaften in den Betrieben sowie der 'sozialdemokratischen Kultur'<br />
in den nordischen Ländern trägt das Gent-System zur sozialen Macht, zu hohem Organisationsgrad<br />
und zum Schutz der gefährdetsten Erwerbstätigen bei, die in anderen Ländern gewerkschaftlich<br />
kaum erreichbar sind." (Autorenreferat)<br />
[206-F] Lettke, Frank, Dr.phil. (Leitung):<br />
Konstanzer Erbschafts Survey (KES)<br />
INHALT: Umfassende und differenzierte Erhebung des Erbschaftsgeschehens in der Bundesrepublik<br />
Deutschland. Erfragt werden bisherige Erfahrungen mit Erbschaft, die Bedeutung des<br />
Themas sowie einzelner Vermögensbestandteile, erbschaftsbezogene Einstellungen und Gerechtigkeitsvorstellungen.<br />
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den eigenen Plänen und den<br />
damit in Verbindung stehenden Motiven und Präferenzen. Erwartet werden differenzierte Basisinformationen<br />
zum Erbschaftsgeschehen allgemein sowie zur unterschiedlichen Bedeutung<br />
des Erbens und Vererbens für "Normalfamilien" und "Stieffamilien". ZEITRAUM: 2003<br />
GEOGRAPHISCHER RAUM: Bundesrepublik Deutschland<br />
METHODE: Erbschaft wird im Spannungsfeld von individueller Beziehungsgestaltung und sozialen<br />
Regulationsmechanismen untersucht. Erbschaft ist ein häufiges, aber in der Familien-<br />
und Generationenforschung wenig untersuchtes soziales Phänomen. Dabei ist das Thema aus<br />
mehreren Gründen von großer Aktualität und Relevanz. Neben der enormen angehäuften Kapitalsumme<br />
spielen vor allem das Altern der Bevölkerung, der Geburtenrückgang und die zunehmende<br />
Komplexität von Familien- und Generationenbeziehungen im Rahmen vielfältiger<br />
privater Lebensformen eine gewichtige Rolle. Gerade letzteres bringt Widersprüchlichkeiten<br />
und Ambivalenzen mit sich, denen sowohl auf der Ebene von Individuen und Familien als<br />
auch auf der Ebene rechtlicher Regulation begegnet werden muss. Untersuchungsdesign:<br />
Querschnitt DATENGEWINNUNG: Standardisierte Befragung, telefonisch (Stichprobe: 990;<br />
deutsche Bevölkerung über 40 Jahre in Privathaushalten; Auswahlverfahren: Zufall. Stichprobe:<br />
265; Stiefeltern; Auswahlverfahren: Quota). Feldarbeit durch ein kommerzielles Umfrageinstitut.<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: Lettke, Frank: Vererbungspläne in unterschiedlichen Familienformen.<br />
in: Schweizerische Zeitschrift für Soziologie, Jg. 31, 2005, H. 2 (im Druck).+++<br />
Lettke, Frank: Vererbungsmuster in unterschiedlichen Familienformen. in: Rehberg, Karl<br />
Siegbert (Hrsg.): Soziale Ungleichheit - kulturelle Unterschiede. Verhandlungen des 32.<br />
Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in München 2004. Frankfurt u.a.:<br />
Campus 2005 (im Druck).<br />
ART: gefördert BEGINN: 2003-07 ENDE: 2006-12 AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER:<br />
Land Baden-Württemberg<br />
INSTITUTION: Universität Konstanz, Geisteswissenschaftliche Sektion, FB Geschichte und<br />
Soziologie Fach Soziologie Forschungsbereich Gesellschaft und Familie (D 33, 78457 Konstanz)
164 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
7 Wirtschaftssoziologie<br />
KONTAKT: Leiter (Tel. 07531-88-2887, Fax: 07531-88-3038,<br />
e-mail: frank.lettke@uni-konstanz.de)<br />
[207-F] Mai, Ulrich, Prof.Dr.; Federov, Gennady M., Prof.Dr.; Lukowski, Wojciech, Prof.Dr.<br />
(Bearbeitung); Wagner, Mathias, Dr. (Leitung):<br />
Grenze als Ressource: Kleinhandel in der Armutsökonomie an der neuen EU-Außengrenze<br />
zwischen Nordostpolen und dem Bezirk Kaliningrad<br />
INHALT: Vierzehn Jahre nach Einführung der Marktwirtschaft haben sich in Polen deutliche<br />
regionale Entwicklungsunterschiede herausgebildet. Während die Ballungsräume Warschau,<br />
Poznan, Gdansk usw. prosperieren, leiden periphere Regionen unter zunehmender Verarmung.<br />
Zu den am stärksten betroffenen Regionen gehört die im Nordosten Polens gelegene<br />
Wojewodschaft Warmia/ Mazury (Ermland/ Masuren) mit der Grenze zur russischen Exklave<br />
Kaliningrad. Im gesellschaftlichen Transformationsprozess reagieren soziale Gruppen mit eigenen<br />
Strategien auf die ökonomischen Probleme. Proportional mit dem Zuwachs der Arbeitslosigkeit<br />
steigerte sich die Relevanz des informellen Sektors. Neben bäuerlicher Subsistenzwirtschaft,<br />
staatlicher Sozialunterstützung und Arbeitsmigration stellt der Schmuggel<br />
von Zigaretten und Alkohol die wichtigste Überlebensstrategie der Bevölkerung dar. In der<br />
Region Kaliningrad produzierte Waren werden in Kleinstmengen für den Verkauf über die<br />
Grenze nach Polen gebracht. Als so genannte "mrowki" (dt. Ameisen) sind die Händler bekannt<br />
geworden. Nach Schätzungen polnischer Behördenvertreter leben auf beiden Seiten der<br />
Grenze nicht weniger als jeweils ca. 200.000 Personen vom Kleinhandel. Mit dem Beitritt Polens<br />
zur EU wird die polnische Nordgrenze zur Außengrenze der EU. Auch wenn vereinfachte<br />
Ausgabebedingungen zur Erlangung eines EU-Visums für Reisende aus Kaliningrad vereinbart<br />
werden, bedeuten Beantragungsverfahren und Verschärfung der Grenzkontrollen eine<br />
Erschwerung des grenzüberschreitenden Handels. So steht zu befürchten, dass die Einschränkung<br />
und Kontrolle der Handelswege zu wirtschaftlichen Einbrüchen führen, von denen die<br />
sozial und ökonomisch schwächsten Schichten am härtesten betroffen sein werden. Die mittelfristigen<br />
Folgen sind für die wirtschaftlich periphere Region beiderseits der Grenze zwischen<br />
Kaliningrad und Polen bisher nicht absehbar. Ziel der Forschung ist es, die milieuspezifische<br />
Aneignung der strukturellen Veränderungen nach dem EU-Beitritt Polens im grenznahen<br />
Bereich der Wojewodschaft Warmia/ Mazury, zu untersuchen. Der Fokus liegt auf den<br />
aktiven und reaktiven Strategien der grenzüberschreitenden Kleinhändler. Das Forschungsprojekt<br />
untersucht die soziale Herkunft und Situation der polnischen Kleinhändler. Zugleich<br />
wird der Kleinhandel mit seinen legalen und illegalen, sowie formalen und informellen Aspekten<br />
als Teil umfassender Überlebensstrategien einer regionalen Armutsökonomie verstanden.<br />
Bei den zu erwartenden Ergebnissen handelt es sich auch um elementare Erkenntnisse,<br />
die für die sozialökonomische Entwicklung der Region nach dem EU-Beitritt Polens nutzbar<br />
gemacht werden könnten, aber eben auch eine Einschätzung der ökonomischen und politischen<br />
Konfliktlage erleichtern, wobei die kulturellen, sozialen und ökonomischen Kompetenzen<br />
der Akteure als kreatives Potential für die regionale Entwicklung zu nutzen wären.<br />
GEOGRAPHISCHER RAUM: Warschau, Poznan, Gdansk, Wojewodschaft Warmia/ Mazury<br />
(Emland/ Masuren), Kaliningrad<br />
METHODE: Die Untersuchung basiert auf den Methoden der qualitativen Sozialforschung, mit<br />
einem Schwerpunkt auf ethnografischer Feldforschung. Ergänzend werden quantitative Erhebungen<br />
zur wirtschaftlichen und sozialen Situation durchgeführt. Ausgehend von dem Konzept<br />
der "grounded theory" findet eine Orientierung am Subjekt und dessen biographischen
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 165<br />
7 Wirtschaftssoziologie<br />
Hintergrund statt. In mehrmonatigen Feldforschungen, während derer die Wissenschaftlerinnen<br />
im Untersuchungsgebiet wohnen und weitgehend in die lokale Gesellschaft integriert sein<br />
sollen, werden die Daten vor allem mit Hilfe teilnehmender Beobachtung und ausführlicher<br />
Leitfadeninterviews gesammelt. Die gemeinsame bzw. vergleichende Forschungstätigkeit von<br />
polnischen, deutschen und russischen Wissenschaftlerinnen zielt darauf, kulturelle Interferenzen<br />
zu mindern und unterschiedliche Zugänge zu den häufig illegalen Strukturen zu erhalten.<br />
Die Auswertung der Interviewmaterialien geschieht zum einen vor dem Hintergrund des Kontextwissens<br />
aus der Feldforschung und zum anderen nach den Regeln der hermeneutischen<br />
Analyse.<br />
ART: keine Angabe AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Universität Bielefeld, Fak. für Soziologie, WE VIII Entwicklungssoziologie und<br />
Sozialanthropologie Arbeitsbereich Entwicklungssoziologie, Frauen- und Geschlechterforschung<br />
in Entwicklungsländern (Postfach 100131, 33501 Bielefeld)<br />
KONTAKT: Mai, Ulrich (Prof.Dr. Tel. 0521-106-3360, e-mail: ulrich.mai@uni-bielefeld.de)<br />
[208-L] Mako, Csaba; Csizmadia, Peter; Illessy, Miklos:<br />
Labour relations in comparative perspective: special focus on the SME sector, in: Journal for<br />
East European Management Studies, Vol. 11/2006, No. 2, S. 173-194<br />
INHALT: "Die Evolution der Ansicht und Anwendung von 'sozialen Partnerschaften' ist ein Basiselement<br />
in der Konstruktion der Europäischen Union. Der Aufsatz gibt einen Überblick<br />
über die Hauptakteure und Institutionen des Labour Relations System (LRS), mit dem Augenmerk<br />
auf kleine und mittelgroße Unternehmen (SME). Im ersten Abschnitt beschreibt der<br />
Autor die wichtigen sozialen Partner und Institutionen der LRS in den beteiligten Ländern an<br />
einem internationalen Forschungsprojekt in 2003-2006, unterstützt vom Leonardo Programm<br />
der EU (Annex 1). Der zweite Teil behandelt die spezifischen Eigenschaften des LRS im<br />
SME Sektor. Die ausgeprägte 'Informalität' des sozialen Dialogs ist ein wichtiges institutionelles<br />
Muster der LRS im SME Sektor." (Autorenreferat)<br />
[209-L] Marginson, Paul:<br />
Europeanisation and regime competition: industrial relations and EU enlargement, in: Industrielle<br />
Beziehungen : Zeitschrift für Arbeit, Organisation und Management, Jg. 13/2006, H. 2, S.<br />
97-117<br />
INHALT: "Ausgehend von der Annahme, dass die nationalen Systeme industrieller Beziehungen<br />
im konkurrierenden Verhältnis zwischen Regimewettbewerb und Europäisierung stehen, untersucht<br />
der Autor zunächst im Kontext der 15 alten Mitgliedsstaaten der Europäischen Union<br />
diese beiden Tendenzen. Dem folgt die Erörterung der Konsequenzen der Osterweiterung<br />
vom Mai 2004. Die Erweiterung hat eine größere Varianz nationaler Arbeitsmarktverfassungen<br />
sowie der Lohn- und Produktivitätsniveaus mit sich gebracht. Das Spektrum für Regimewettbewerb<br />
hat sich dadurch vergrößert und gefährdet den Prozess der Europäisierung<br />
industrieller Beziehungen. Die Aussichten für eine verstärkte soziale Dimension im Zuge der<br />
europäischen wirtschaftlichen Integration hängen nun von der Entstehung von Druck aus den<br />
neuen Mitgliedsstaaten in Mittel- und Osteuropa ebenso ab wie vom Erneuerungswillen der<br />
Gruppe der alten Mitgliedsstaaten hinsichtlich der sozialen Dimension." (Autorenreferat)
166 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
7 Wirtschaftssoziologie<br />
[210-L] McLure, Michael:<br />
Approaches to fiscal sociology, in: Jürgen G. Backhaus (Ed.): Essays on fiscal sociology, Frankfurt<br />
am Main: P. Lang, 2005, S. 39-50, ISBN: 3-631-39967-7 (Standort: UuStB Köln(38)-33A728)<br />
INHALT: "This paper reviews developments in Fiscal Sociology, commencing with the seminal<br />
Austrian studies by Rudolf Goldscheid and Joseph Schumpeter and the classic Italian studies<br />
by Gino Borgatta and Guido Sensini, and ending with a review of new approaches to fiscal<br />
sociology. It is suggested that a received view on the methodological and analytical framework<br />
of new fiscal sociology has not yet emerged. Although developments have been noteworthy,<br />
the challenge ahead is to define the sociological dimension in theoretical fiscal studies,<br />
so it can be clearly differentiated from more descriptive notions of fiscal 'politics'."<br />
(author's abstract)<br />
[211-F] Peren, Franz W., Prof.Dr. (Bearbeitung):<br />
Aktion Mensch: Market Research<br />
INHALT: keine Angaben<br />
ART: keine Angabe AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg, FB Wirtschaft 01 (53754 Sankt Augustin)<br />
KONTAKT: Bearbeiter (Tel. 02241-865-103, Fax: 02241-865-8013, e-mail: franz.peren@fhbrs.de)<br />
[212-L] Peukert, Helge:<br />
Fritz Karl Mann (1883-1979), in: Jürgen G. Backhaus (Ed.): Essays on fiscal sociology, Frankfurt<br />
am Main: P. Lang, 2005, S. 239-256, ISBN: 3-631-39967-7 (Standort: UuStB Köln(38)-<br />
33A728)<br />
INHALT: "The text deals with F. K. Mann's approach of fiscal sociology. First, his biography is<br />
presented. Second, his book on tax policy ideals is discussed critically. Third, three conceptual<br />
elements of his fiscal approach are extracted from major writings of Mann. Fourth, the<br />
relationship between fiscal theory and sociology is analyzed. Finally it is asked which of his<br />
writings, ideas and concepts stand the test of time." (author's abstract)<br />
[213-F] Pies, Ingo, Prof.Dr.; Leschke, Martin, Prof.Dr.; Beckmann, Klaus (Bearbeitung); Reese-<br />
Schäfer, Walter, Prof.Dr. (Leitung):<br />
Karl Marx und die Furcht vor der Anarchie des Marktes<br />
INHALT: Die Vorstellung, der Markt sei auf problematische Weise anarchisch, ist ein durchgehender<br />
Topos nicht nur im Werk von Marx, sondern auch der gegenwärtigen Globalisierungskritik.<br />
Untersucht werden die Ideengeschichte dieses Topos, dessen Hintergründe und<br />
vor allem die Gründe für die Überzeugungskraft dieser politischen Metaphorik, die in einem<br />
scheinbaren Automatismus ohne umständliche theoretische Konstruktionen die Notwendigkeit<br />
staatlicher oder gar suprastaatlicher Regulierung nahelegt.<br />
ART: keine Angabe BEGINN: 2004-01 ENDE: 2005-12 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FI-<br />
NANZIERER: keine Angabe
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 167<br />
7 Wirtschaftssoziologie<br />
INSTITUTION: Universität Göttingen, Sozialwissenschaftliche Fakultät, Seminar für Politikwissenschaft<br />
Professur für politische Theorie und Ideengeschichte (Platz der Göttinger Sieben 3,<br />
37073 Göttingen); Universität Halle-Wittenberg, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Institut<br />
für VWL und Bevölkerungsökonomie Lehrstuhl für Wirtschaftsethik (Große Steinstr. 73,<br />
06108 Halle)<br />
KONTAKT: Leiter (Tel. 0551-397212, Fax: 0551-397341, e-mail: reeseschaefer@hotmail.com)<br />
[214-F] Piotti, Geny, Dr. (Bearbeitung):<br />
Standortverlagerungen und das Problem der Entbettung: deutsche Unternehmen in China<br />
und in der Türkei<br />
INHALT: Das Projekt befasst sich mit der Problematik der Globalisierung und der Expansion der<br />
Märkte. Während sich die neoliberale Wirtschaftspolitik auf die Idee einer reibungslosen<br />
Konvergenz der globalen Märkte auf der Basis von ökonomischer Effizienz und einer Nivellierung<br />
der staatlichen Wirtschaftsintervention stützt, bietet die Perspektive der Soziologie<br />
des Marktes auf die Globalisierungsprozesse ein differenzierteres Bild. Aus dem besonderen<br />
Blickwinkel der Standortverlagerungen deutscher Unternehmen und ausgehend von der im<br />
Rahmen der Institutionsökonomie thematisierten "Principal-Agents"-Problematik, analysiert<br />
das Projekt die Kosten der Entbettung aus dem eigenen Land und der Einbettung der Unternehmen<br />
in andere kulturelle und institutionelle Kontexte, die nicht selten zur einer ineffizienten<br />
Betriebsführung und auch zu Rückverlagerungen führen können. Gefragt wird daher, inwieweit<br />
Ungewissheit und soziale Mechanismen - kognitive Strukturen, Kultur, Institutionen,<br />
Netzwerke - einen Einfluss auf die Effizienz und die Kontinuität des unternehmerischen Engagements<br />
im Zielland ausüben und inwieweit die oben genannten Kosten unabhängig vom<br />
institutionellen Kontext zu identifizieren sind. Die Antwort auf diese Fragen wird mit Hilfe<br />
einer vergleichenden Untersuchung von Standortverlagerungen deutscher Unternehmen nach<br />
China und in die Türkei, d.h. in zwei institutionell und kulturell verschiedene Schwellenländer,<br />
beziehungsweise deren Rückverlagerung nach Deutschland gesucht. GEOGRAPHI-<br />
SCHER RAUM: Deutschland, China, Türkei<br />
ART: Habilitation BEGINN: 2005-04 ENDE: 2010-03 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FI-<br />
NANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung (Paulstr. 3, 50676 Köln)<br />
KONTAKT: Institution (Tel. 0221-2767-0, Fax: 0221-2767-430, e-mail: info@mpifg.de)<br />
[215-F] Poggi, Gianfranco, Prof.Dr. (Bearbeitung); Bender, Christiane, Prof.Dr.; Graßl, Hans, Dr.<br />
(Leitung):<br />
Entwicklungspfade von Dienstleistungsstrukturen in der modernen Industrie- und Wohlfahrtsgesellschaft<br />
und in ihren Teilsystemen<br />
INHALT: Die Tertiarisierung von Wirtschaft und Gesellschaft bezeichnet ein hoffnungsvolles<br />
Zukunftsprojekt auch über das 20. Jahrhundert hinaus. Die vor allem von Jean Fourastié entwickelte<br />
Drei-Sektoren-Hypothese zur Unterscheidung wirtschaftlicher Prozesse erweist sich<br />
zunehmend als inadäquat. Die Forscher gehen in ihrer theoretisch angeleiteten empirischen<br />
Analyse von der These einer engen Verschränkung industrieller und tertiärer Mechanismen<br />
aus und rekonstruieren die zugrunde liegende und sich wandelnde Institutionenordnung. Der<br />
Aufbau des Projekts gliedert sich in vier Teile: 1. eine soziohistorische Rekonstruktion; 2. ei-
168 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
7 Wirtschaftssoziologie<br />
ne sozioökonomische Analyse zentraler Dienstleistungsfelder; 3. eine soziotechnische Studie<br />
der Veränderung der Prozesse der Erstellung konsumorientierter Dienstleistungen in den privaten<br />
Haushalten durch die Einführung von E-Commerce; und 4. eine Vergleichsanalyse des<br />
Tertialisierungsgrads zwischen Deutschland, der Schweiz, Österreich und Italien. GEOGRA-<br />
PHISCHER RAUM: Bundesrepublik Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: Graßl, Hans; Bender, Christiane; Schaal, Markus: Quo vadis,<br />
Schweiz? Soziologische Perspektiven zur Erforschung nationaler Arbeitsmärkte. in: Uniforschung,<br />
Forschungsmagazin der Helmut-Schmidt-Universität - Universität der Bundeswehr<br />
Hamburg, Jg. 15, Ausg. 2005, S. 50-54.<br />
ART: keine Angabe BEGINN: 2002-10 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine<br />
Angabe<br />
INSTITUTION: Universität der Bundeswehr Hamburg, FB Pädagogik, Professur für Soziologie<br />
(Postfach 700822, 22008 Hamburg); Universita degli studi di Trento (Via Belenzani 12,<br />
38100 Trento, Italien)<br />
KONTAKT: Bender, Christiane (Prof.Dr. Tel. 040-6541-2762, Fax: 040-6541-3746,<br />
e-mail: bender@hsu-hh.de)<br />
[216-L] Sasaki, Norio:<br />
German fiscal sociology's influence on Japan, in: Jürgen G. Backhaus (Ed.): Essays on fiscal<br />
sociology, Frankfurt am Main: P. Lang, 2005, S. 159-177, ISBN: 3-631-39967-7 (Standort: UuStB<br />
Köln(38)-33A728)<br />
INHALT: "It is meaningful to know how fiscal sociology has been taken up in Japan, which confronts<br />
with economic and fiscal crisis. Because of strong influence of German public finance,<br />
some literature about fiscal sociology appeared in Japan. But it received less attention than in<br />
Germany. The fundamental reasons are a strong influence of Marxism and the fact that there<br />
have not been serious fiscal crisis in Japan until recently. However, nowadays Japanese government<br />
has large public debt. Thus, some Japanese scholars pay attention to fiscal sociology.<br />
However it is not established social science. In order to develop persuasive discussion, it is<br />
necessary to arrange it theoretically." (author's abstract)<br />
[217-F] Scholl, Gerd, Dipl.-Volksw.; Hage, Maria (Bearbeitung):<br />
Lebensstile, Lebensführung und Nachhaltigkeit (LENA)<br />
INHALT: Ziel des Projektes war es, den Stand der Forschung zu Lebensstil- und verwandten<br />
Konzepten aufzuarbeiten. Im Zentrum stand dabei die Frage, wie diese Ansätze genutzt werden<br />
können, um nachhaltiges Konsumhandeln zu fördern. Eine solche Förderung durch politisch<br />
wie auch unternehmerische Akteure ist an vielen Stellen im IÖW Thema: im Forschungsfeld<br />
"Ökologischer Konsum" ebenso wie in den Projekten zur Entwicklung nachhaltiger<br />
Produkte und Dienstleistungen, zur partizipativen Produktentwicklung und zu IPP. Das<br />
Projekt LENA verzahnte diese Projekte über eine Theorie- und Mediendiskussion miteinander<br />
und regte eine Diskussion innerhalb des Instituts an.<br />
VERÖFFENTLICHUNGEN: Scholl, Gerd; Hage, Maria: Lebensstile, Lebensführung und<br />
Nachhaltigkeit. 2004.<br />
ART: Eigenprojekt BEGINN: 2003-06 ENDE: 2004-03 AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER:<br />
Institution
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 169<br />
7 Wirtschaftssoziologie<br />
INSTITUTION: Institut für ökologische Wirtschaftsforschung -IÖW- gGmbH Regionalbüro<br />
Nordrhein-Westfalen (Völklinger Str. 9, 42285 Wuppertal)<br />
KONTAKT: Hage, Maria (e-mail: Maria.Hage@ioew.de)<br />
[218-F] Schwarzer, J., Dipl.-Wirtsch.-Inf. (Bearbeitung); Lassmann, Wolfgang, Prof.Dr.Dr.h.c.<br />
(Leitung):<br />
Auswirkungen der BMW-Werksansiedlung in Leipzig<br />
INHALT: Das Forschungsprojekt untersucht die sozio-ökonomischen Auswirkungen der BMW-<br />
Werksansiedlung in Leipzig. Gegenstand der über mehrere Jahre andauernden Untersuchung<br />
sind soziale und demographische Veränderungen im Großraum Halle-Leipzig aufgrund der<br />
Entstehung des neuen Automobilwerkes der BMW AG. Das Institut für Wirtschaftsinformatik<br />
und Operations Research ist im Rahmen des Projektes für die Beschaffung und die Analyse<br />
von statistischen Daten sowie für die informationstechnische Unterstützung der Auswertung<br />
der Informationen verantwortlich. Weitere Kooperationspartner: BMW AG; inomic - research<br />
& coaching GmbH. GEOGRAPHISCHER RAUM: Leipzig<br />
ART: gefördert BEGINN: 2002-06 ENDE: 2006-12 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINAN-<br />
ZIERER: Industrie<br />
INSTITUTION: Institut für Unternehmensforschung und -führung an der Martin-Luther-<br />
Universität Halle-Wittenberg e.V. (Universitätsring 3, 06108 Halle); Universität Halle-<br />
Wittenberg, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Institut für Wirtschaftsinformatik und Operations<br />
Research (06099 Halle); Universität Leipzig, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät,<br />
Institut für Finanzen (Postfach 100920, 04009 Leipzig)<br />
KONTAKT: Leiter (Tel. 0345-55-23401, Fax: 0345-55-27194,<br />
e-mail: lassmann@mluwiws4.wiwi.uni-halle.de)<br />
[219-F] Speidel, Frederic, Dipl.-Soz. (Bearbeitung); Brinkmann, Ulrich, Dr. (Leitung):<br />
Change Management in der Region Emscher-Lippe. Evaluation und wissenschaftliche Begleitung<br />
INHALT: keine Angaben GEOGRAPHISCHER RAUM: Region Emscher-Lippe<br />
METHODE: responsive Evaluation DATENGEWINNUNG: Qualitatives Interview (Stichprobe:<br />
12; Akteure des regionalen Change-Managements; Auswahlverfahren: Quota).<br />
ART: Auftragsforschung BEGINN: 2003-07 ENDE: 2005-06 AUFTRAGGEBER: Land Nordrhein-Westfalen<br />
Ministerium für Wirtschaft und Arbeit FINANZIERER: Auftraggeber<br />
INSTITUTION: Forschungsinstitut für Arbeit, Bildung und Partizipation e.V. an der Universität<br />
Bochum (Münsterstr. 13-15, 45657 Recklinghausen)<br />
KONTAKT: Leiter (e-mail: ulrich.brinkmann@uni-jena.de)<br />
[220-F] Strasser, Hermann, Univ.-Prof.Dr.Ph.D. (Betreuung):<br />
Unternehmensbiografien zwischen Industriegeschichte, Wirklichkeitskonstruktion und<br />
Imagepflege<br />
INHALT: keine Angaben<br />
ART: Dissertation AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe
170 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
7 Wirtschaftssoziologie<br />
INSTITUTION: Universität Duisburg-Essen Campus Duisburg, FB Gesellschaftswissenschaften,<br />
Institut für Soziologie Professur für Soziologie II (Lotharstr. 65, 47048 Duisburg)<br />
KONTAKT: Betreuer (Tel. 0203-379-2732, Fax: 0203-379-1424,<br />
e-mail: strasser@uni-duisburg.de)<br />
[221-F] Thiele, Silke, Dr.; Drescher, Larissa, M.Sc. (Bearbeitung):<br />
Die Nachfrage nach Lebensmittelvielfalt: ökonomische und gesundheitliche Aspekte<br />
INHALT: Die Nachfrage nach einer hohen Lebensmittelvielfalt gilt als bedeutender Trend des<br />
Konsumentenverhaltens in Industriestaaten. Dem Studium der Nachfrage nach Vielfalt<br />
kommt damit aus ökonomischer Sicht eine zunehmende Bedeutung zu. Gleichzeitig dokumentieren<br />
ernährungswissenschaftliche Studien einen engen Zusammenhang zwischen einer<br />
vielfältigen Ernährung und einer höheren Ernährungsqualität. Während Analysen zur Produktvielfalt<br />
bislang in den beiden Forschungsgebieten (Ökonomie und Ernährungswissenschaft)<br />
unabhängig und isoliert betrieben wurden, soll in diesem Forschungsvorhaben eine<br />
Verknüpfung beider Bereiche vorgenommen werden. Ein erster Ansatzpunkt für die Interaktion<br />
ökonomischer und ernährungswissenschaftlicher Forschung ist in der Entwicklung verbesserter<br />
Produktvielfaltindizes zu sehen. Diese sollen zur ökonometrischen Analyse der<br />
Nachfrage der Konsumenten nach Lebensmittelvielfalt verwendet werden. Aufgabe ist es, sozioökonomische<br />
Personengruppen zu identifizieren, die eine hohe Lebensmittelvielfalt im<br />
Hinblick auf eine gesunde Ernährung nachfragen. Eine genauere Kenntnis dieser Zielgruppen<br />
ist sowohl für eine effiziente Ernährungsberatung und -information als auch für Unternehmen<br />
der Ernährungswirtschaft im Zusammenhang mit einer gezielten Produktinnovation wesentlich.<br />
ART: gefördert AUFTRAGGEBER: nein FINANZIERER: Deutsche Forschungsgemeinschaft<br />
INSTITUTION: Universität Kiel, Agrar- und Ernährungswissenschaftliche Fakultät, Institut für<br />
Ernährungswirtschaft und Verbrauchslehre Abt. Haushalts- und verbraucherorientierte Gesundheitsökonomik<br />
(Olshausenstr. 40, 24098 Kiel)<br />
KONTAKT: Thiele, Silke (Dr. Tel. 0431-880-1467, Fax: 0431-880-7308,<br />
e-mail: sthiele@food-econ.uni-kiel.de)<br />
[222-F] Thiele, Silke, Dr. (Bearbeitung):<br />
Determinanten der Nachfrage nach Ernährungsqualität<br />
INHALT: keine Angaben<br />
ART: keine Angabe AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Universität Kiel, Agrar- und Ernährungswissenschaftliche Fakultät, Institut für<br />
Ernährungswirtschaft und Verbrauchslehre Abt. Haushalts- und verbraucherorientierte Gesundheitsökonomik<br />
(Olshausenstr. 40, 24098 Kiel)<br />
KONTAKT: Bearbeiterin (Tel. 0431-880-1467, Fax: 0431-880-7308,<br />
e-mail: sthiele@food-econ.uni-kiel.de)<br />
[223-F] Tian, Miao (Bearbeitung); Gornas, Jürgen, Univ.-Prof.Dr.rer.pol. (Leitung):<br />
The arrangement of business development in emerging nations as a governmental responsibility
<strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2 171<br />
7 Wirtschaftssoziologie<br />
INHALT: keine Angaben<br />
ART: keine Angabe AUFTRAGGEBER: keine Angabe FINANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Universität der Bundeswehr Hamburg, FB Wirtschafts- und Organisationswissenschaften,<br />
Institut für Verwaltungswissenschaft (Holstenhofweg 85, 22043 Hamburg)<br />
[224-L] Wagner, Richard E.:<br />
States and the crafting of souls: mind, society, and fiscal sociology, in: Jürgen G. Backhaus<br />
(Ed.): Essays on fiscal sociology, Frankfurt am Main: P. Lang, 2005, S. 27-38, ISBN: 3-631-<br />
39967-7 (Standort: UuStB Köln(38)-33A728)<br />
INHALT: "For the most part, the theory of public finance follows economic theory in taking<br />
individual preferences as given. The resulting analytical agenda revolves around the ability of<br />
different fiscal institutions to reflect and aggregate those preferences into collective outcomes.<br />
This paper explores the possibility that to some extent fiscal institutions can influence<br />
and shape what are commonly referred to as preferences. Statecraft thus becomes necessarily<br />
a branch of soulcraft, in that the state is inescapably involved in shaping preferences through<br />
its impact on the moral imagination, and not just in reflecting or representing them. This paper<br />
first explores some general conceptual issues and then examines some particular illustrations."<br />
(author's abstract)<br />
[225-L] Winkler, Alfred:<br />
Wirtschaftssoziologische Aspekte bei Insolvenzen von österreichischen Klein- und Mittelbetrieben<br />
im Tourismus, (Goldegg Wissenschaft), Wien: Goldegg Verl. 2005, 95 S., ISBN: 3-<br />
901880-63-1 (Standort: UuStB Köln(38)-33A1509)<br />
INHALT: Der Verfasser gibt zunächst einen Einblick in den historischen Ansatz der Wirtschaftssoziologie<br />
und deren wichtigste Vertreter, Themen und Theorien. Vor diesem Hintergrund<br />
wird der Tourismus und dessen Entwicklung in Österreich dargestellt, wobei die Betriebsgrößenstruktur<br />
dieses Sektors und die speziellen Probleme der Klein- und Mittelbetriebe ebenso<br />
behandelt werden wie die Auswirkungen von Globalisierung und EU-Osterweiterung. So<br />
wird deutlich gemacht, welche Tourismusunternehmen in welcher Form und Intensität von<br />
der Krise betroffen sind. Krisen- und Insolvenzursachen von heimischen Tourismusunternehmen<br />
werden herausgearbeitet, wobei ein Schwerpunkt auf Finanzierungsinstrumenten und<br />
-modellen liegt. Zudem wird ein Leitfaden für krisengeschüttelte Unternehmen vorgelegt, der<br />
bei der Bewältigung einer Unternehmenskrise oder bevorstehender Insolvenz herangezogen<br />
werden kann. (ICE2)<br />
[226-F] Woll, Cornelia, Dr. (Bearbeitung):<br />
Beziehungen zwischen Unternehmen und Regierungen in der globalen Wirtschaft<br />
INHALT: Welche Rolle spielt das Lobbying von Unternehmen im Globalisierungsprozess? Dieses<br />
Projekt untersucht die Beziehungen zwischen Unternehmen und Regierungen in der Ausgestaltung<br />
internationaler Märkte. Insbesondere wird die Liberalisierung zweier Dienstleistungssektoren<br />
betrachtet: Telekommunikation und Luftfahrt. Die Fallstudien zeigen, dass sich<br />
Handelspolitik bei stark regulierten Sektoren nicht einfach auf einer Achse von Protektionis-
172 <strong>soFid</strong> Industrie- und Betriebssoziologie 2006/2<br />
7 Wirtschaftssoziologie<br />
mus oder Marktöffnung verorten lässt. Unternehmen fordern nicht einfach mehr oder weniger<br />
Liberalisierung, sie gehen vielmehr symbiotische Beziehungen mit ihren Regierungen ein, die<br />
vor allem durch gegenseitiges Lernen gekennzeichnet sind. Ein Vergleich des Lobbyingverhaltens<br />
in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union ermöglicht es, hierbei die<br />
Effekte unterschiedlicher politischer Institutionen auf Beziehungen zwischen Unternehmen<br />
und Regierungen zu untersuchen.<br />
ART: Eigenprojekt BEGINN: 2004-09 ENDE: 2006-08 AUFTRAGGEBER: keine Angabe FI-<br />
NANZIERER: keine Angabe<br />
INSTITUTION: Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung (Paulstr. 3, 50676 Köln)<br />
KONTAKT: Institution (Tel. 0221-2767-0, Fax: 0221-2767-430, email: info@mpifg.de)
Register 173<br />
Hinweise zur Registerbenutzung<br />
Sachregister<br />
Grundlage für das Sachregister sind die Schlagwörter, die zur gezielten Suche der Literatur- bzw.<br />
Forschungsnachweise in unseren Datenbanken FORIS und SOLIS vergeben wurden.<br />
Um eine differenzierte Suche zu ermöglichen, werden dabei nicht nur die Haupt-, sondern auch<br />
Nebenaspekte der Arbeiten verschlagwortet.<br />
• Bei einem maschinell erstellten Verzeichnis wie dem obigen Sachregister führt das zwangsläufig<br />
zu einem Nebeneinander von wesentlichen und eher marginalen Eintragungen.<br />
Manche Begriffe machen erst in Verbindung mit anderen Sinn oder wechseln ihren Sinn in Abhängigkeit<br />
vom jeweiligen Zusammenhang.<br />
• Solche Zusammenhänge gehen aber bei einem einstufigen Register typischerweise verloren.<br />
Vermeintliche Fehleintragungen gehen fast immer aufs Konto eines dieser beiden Effekte, die sich<br />
bei der maschinellen Registererstellung grundsätzlich nicht vermeiden lassen.<br />
Personenregister<br />
Aufgeführt sind<br />
• bei Literaturnachweisen: alle aktiv an dem Werk beteiligten Personen;<br />
• bei Forschungsnachweisen: alle als Leiter, Betreuer oder wissenschaftliche Mitarbeiter<br />
(„Autoren“) eines Projekts angegebenen Personen.<br />
Institutionenregister<br />
Aufgeführt sind nur die forschenden Institutionen. Institutionelle Auftraggeber, Finanzierer, Förderer<br />
oder dergleichen sind zwar in den Forschungsnachweisen selbst aufgeführt, nicht jedoch im<br />
Register.<br />
Sortierung<br />
Die Sortierung folgt den lexikalischen Regeln, d.h. Umlaute werden wie der Grundbuchstabe sortiert.<br />
Numerische Angaben (z.B. „19. Jahrhundert“) sind ganz ans Ende sortiert, also hinter Buchstabe<br />
Z.<br />
Nummerierung<br />
Alle in den Registern angegebenen Zahlen beziehen sich auf die laufenden Nummern der Literatur-<br />
und Forschungsnachweise.
Personenregister 175<br />
A<br />
Abel, Jörg 26<br />
Adams, Oliver 175<br />
Adenäuer, Marcel 197<br />
Alberternst, Christiane 165<br />
Andriessen, J. H. Erik 1<br />
Apitzsch, Birgit 102<br />
Arnold, Katrin 118<br />
Atzmüller, Roland 40, 47<br />
Autor, David 135<br />
B<br />
Baatz, Dagmar 87<br />
Backhaus, Jürgen G. 176<br />
Baecker, Dirk 177<br />
Baethge, Martin 178<br />
Baethge-Kinsky, Volker 76<br />
Bahnmüller, Reinhard 58<br />
Bancila, Ramona 27<br />
Bannert, Kurt 77<br />
Bartels, Ralf 28<br />
Bartelt, Andreas 179<br />
Bartilla, Michael 103<br />
Bartjes, Heinz 137<br />
Beckenbach, Niels 128<br />
Becker, Marcel 158<br />
Beckmann, Klaus 213<br />
Beerhorst, Joachim 29<br />
Beese, Birgit 2<br />
Bender, Christiane 215<br />
Beyer, Jürgen 180<br />
Biedermann, Annette 181<br />
Bierbaum, Heinz 49<br />
Bister, Jacques 30<br />
Bitzan, Renate 31<br />
Blanke, Thomas 14<br />
Bleher, Nadine 182<br />
Bödeker, Wolfgang 32<br />
Boes, Andreas 3<br />
Bohler, Karl Friedrich 183<br />
Borchert, Margret 102<br />
Borryss, Christine 104<br />
Bouncken, Ricarda 184, 185<br />
Braun, Karl 154<br />
Brensell, Ariane 186<br />
Personenregister<br />
Bresser, Rudi K.F. 181<br />
Brinkmann, Johanna 105<br />
Brinkmann, Ulrich 33, 34, 35, 68, 187,<br />
219<br />
Britz, Wolfgang 197<br />
Brunswig, Susanne 131<br />
Bude, Heinz 188<br />
Bührmann, Andrea D. 104, 123, 186<br />
Bultemeier, Anja 4<br />
Buss, Klaus-Peter 189<br />
Butterwegge, Christoph 9<br />
C<br />
Candeias, Mario 68, 187<br />
Ciesinger, Kurt-Georg 92, 103<br />
Correll, Lena 87<br />
Csizmadia, Peter 208<br />
Curbach, Janina 5<br />
D<br />
Deller, Jürgen 166<br />
Diefenbacher, Hans 36<br />
Diendorf, Alexandra 157<br />
Döhl, Volker 54, 55<br />
Dörre, Klaus 2, 37, 48, 68, 187<br />
Dragano, N. 159<br />
Dragano, Nico 32<br />
Dreher, Carsten 106<br />
Drescher, Larissa 221<br />
Dustmann, Christian 135<br />
E<br />
Eichmann, Hubert 38, 56, 86<br />
F<br />
Fachinger, Uwe 78<br />
Federov, Gennady M. 207<br />
Fehmel, Thilo 191<br />
Flecker, Jörg 9, 39, 40, 56, 79, 80, 85, 86<br />
Fox, Katja 192<br />
Franzen, Martin 41<br />
Freye, Saskia 42<br />
Funder, Maria 65<br />
Fürstenberg, Friedrich 81
176 Personenregister<br />
G<br />
Galais, Nathalie 161<br />
Geissler, Birgit 132, 133, 134<br />
Gernandt, Johannes 135<br />
Goldberg, Isabell 193<br />
Göritz, Berthold 43<br />
Gornas, Jürgen 223<br />
Gottschall, Karin 14<br />
Götz, Klaus 138, 182<br />
Götzelt, Ina 4<br />
Götzenbrucker, Gerit 82<br />
Graßl, Hans 215<br />
Griese, Hartmut M. 194<br />
Groß, Mathias 122<br />
Grotheer, Michael 4<br />
Günther, Angelika 102<br />
Gürtzgen, Nicole 135<br />
Güth, Werner 6<br />
H<br />
Hafkesbrink, Joachim 92<br />
Hafner, Sonja Johanna 195<br />
Hage, Maria 217<br />
Hagen, Kornelia 196<br />
Haipeter, Thomas 44, 45, 83<br />
Hamburger, Joachim 136<br />
Hammer, Eckart 137<br />
Hansen, Katrin 123<br />
Hartmann, Ernst Andreas 160<br />
Hase, Detlef 43<br />
Hauptmeier, Marco 46<br />
Heckelei, Thomas 197<br />
Hecker, Dominik 161, 162<br />
Heinze, Rolf G. 192<br />
Helten, Elmar 13<br />
Hengstenberg 153<br />
Hennlein, Svenja 84<br />
Hentges, Gudrun 9<br />
Hermann, Christoph 47, 79, 86<br />
Hertwig, Markus 93<br />
Herzig, Stefan 203<br />
Hesse, Klaus 198<br />
Hettlage, Robert 21<br />
Heywood, John S. 107<br />
Hien, Wolfgang 163<br />
Hilbert, Josef 192<br />
Hinke, Robert 48<br />
Hirsch-Kreinsen, Hartmut 7<br />
Hofbauer, Ines 38<br />
Hofer, Konrad 164<br />
Hoffmann, Jürgen 199<br />
Hoffmann, Peter 11<br />
Holtrup, André 8<br />
Höpner, Martin 200<br />
Hoppe, Heinz Ulrich 102<br />
Horsmann, Claes S. 108<br />
Houben, Marion 49<br />
Huber, Joseph 201<br />
Hülsbusch, Werner 122<br />
Hülshoff, Theo 138<br />
I<br />
Illessy, Miklos 208<br />
J<br />
Jäger, Wieland 16<br />
Jahnke, Anne 108<br />
Janczyk, Stefanie 87<br />
Jirjahn, Uwe 51, 107<br />
Johanning-Mammri, Renate 156<br />
Jöns, Ingela 84<br />
Jung, Rüdiger H. 109<br />
Jurczyk, Karin 147<br />
Jürgenhake, Uwe 103<br />
K<br />
Kaiser, Yvonne 109<br />
Kallert, Martina 165<br />
Kalveram, Andreas 172<br />
Kämpf, Tobias 3<br />
Kayser, Gunter 69<br />
Keller, Berndt 52<br />
Kemnitz, Alexander 135<br />
Kerlen, Christiane 110<br />
Kern, Stefanie 166<br />
Kerschke-Risch, Pamela 202<br />
Keyl, Eberhard 111<br />
Kirschenhofer, Sabine 9, 85<br />
Klatt, Rüdiger 92<br />
Kleinsteuber, Hans J. 63<br />
Klemm, Matthias 112<br />
Klingemann, Carsten 113<br />
Kloweit-Herrmann, Manfred 113<br />
Kluge, Norbert 10<br />
Kock, Klaus 114<br />
Kocyba, Hermann 100, 139<br />
Koerfer, Armin 203<br />
Köhler, Christoph 4, 48
Personenregister 177<br />
Kollmann, Karl 204<br />
König, Susanne 115<br />
Korunka, Christian 11<br />
Kotthoff, Hermann 53, 129<br />
Kratzer, Nick 54, 55<br />
Krause, Alexandra 59<br />
Krehnke, Anna 43<br />
Krenn, Manfred 9, 39, 56, 80, 86, 167, 168<br />
Kropf, Julia 57<br />
Kruse, Oliver 169<br />
Kruse, Wilfried 152<br />
Kuhlmann, Martin 58, 97<br />
Kurz-Scherf, Ingrid 87<br />
Kutzner, Edelgard 114, 140<br />
L<br />
Lang, Rüdiger 116<br />
Lange, Andreas 147<br />
Lange, Knut 12<br />
Langhoff, Thomas 19<br />
Langner, Matthias 136<br />
Lassmann, Wolfgang 218<br />
Latniak, Erich 88, 148<br />
Lay, Gunter 106<br />
Ledebur, Sidonia von 117<br />
Lehndorff, Steffen 83, 141<br />
Lengfeld, Holger 59<br />
Leonardi, Salvo 205<br />
Lepperhoff, Julia 87<br />
Leschke, Martin 213<br />
Lettke, Frank 206<br />
Lichte, Rainer 171<br />
Lieb, Anja 87<br />
Linne, Gundrun 89<br />
Löser, Roland 13<br />
Luczak, Holger 95<br />
Lukowski, Wojciech 207<br />
M<br />
Mäder, Ueli 143<br />
Mai, Ulrich 207<br />
Mairhuber, Ingrid 9, 60<br />
Mako, Csaba 208<br />
Malzahn, Nils 102<br />
Marginson, Paul 209<br />
Marr, Rainer 125<br />
Marrs, Kira 3, 54, 55<br />
Martens, Helmut 61<br />
Martins, Erko 170<br />
Maser, Werner 136<br />
Matuschek, Ingo 118<br />
Mayer-Ahuja, Nicole 14, 15, 90<br />
McLure, Michael 210<br />
Meier, Hans-Jürgen 103<br />
Meinecke, Gunnar 202<br />
Meyer, Malte-Henning 9<br />
Meyer, Margit 179<br />
Minssen, Heiner 62, 195<br />
Moers, Martin 91<br />
Molter, Beate 119<br />
Mönig-Raane, Margret 142<br />
Mönnighoff, Lars 171<br />
Moser, Klaus 161, 162, 165<br />
Mücke, Anja 143<br />
Mudra, Peter 120<br />
Müller, Annette 87<br />
Munz, Eva 144<br />
Mütherich, Birgit 104<br />
N<br />
Nehls, Sabine 63<br />
Nerdinger, Friedemann W. 108, 170<br />
Neuendorff, Hartmut 92<br />
Noefer, Katrin 119<br />
Nölle, Kerstin 92<br />
O<br />
Ollmann, Rainer 103<br />
P<br />
Papouschek, Ulrike 9, 39, 56, 86, 145, 167<br />
Patzel-Mattern, Katja 121<br />
Peren, Franz W. 211<br />
Peukert, Helge 212<br />
Pfeiffer, Friedhelm 135<br />
Pfeiffer, Sabine 16<br />
Pies, Ingo 105, 213<br />
Piotti, Geny 214<br />
Platzer, Hans-Wolfgang 17<br />
Plomb, Fabrice 9<br />
Poggi, Gianfranco 215<br />
Poglia Mileti, Francesca 9<br />
Pohlmeier, Winfried 135<br />
Popp, Michael 112<br />
Pries, Ludger 14, 26, 93<br />
Prott, Jürgen 64<br />
Pühl, Katharina 186
178 Personenregister<br />
R<br />
Reese-Schäfer, Walter 213<br />
Remdisch, Sabine 122<br />
Resch, Marianne 157<br />
Richter, Ulrike A. 65<br />
Riese, Christian 62<br />
Riesenecker-Caba, Thomas 85<br />
Röbenack, Silke 66, 67<br />
Roosen, Jutta 193<br />
Rosenbach, Inike 94<br />
Röttger, Bernd 2, 68, 187<br />
Rudert, Katrin 123, 186<br />
Rudolph, Clarissa 87<br />
Rudolph, Wolfgang 69<br />
Rump, Jutta 124<br />
Rupp, Rudi 43<br />
S<br />
Sanders, Frauke 97<br />
Sasaki, Norio 216<br />
Satilmis, Ayla 87<br />
Sauer, Dieter 55<br />
Schalk, Christa 192<br />
Scheele, Alexandra 87<br />
Scheerer, Sebastian 202<br />
Schier, Michaela 147<br />
Schiffauer, Werner 94<br />
Schilling, Gabi 44, 148<br />
Schlick, Christopher 95<br />
Schloderer, Florian 125<br />
Schmeink, Martina 123<br />
Schmidt, Rudi 48<br />
Schmieder, Arnold 113<br />
Schneider, Nicole 95<br />
Scholl, Gerd 217<br />
Schönauer, Annika 96<br />
Schöttelndreier, Aira 123<br />
Schröder, Tim 4<br />
Schroeder, Wolfgang 18, 70<br />
Schubert, André 103<br />
Schule, Achim 136<br />
Schultheis, Franz 9<br />
Schulze, Tanja 19<br />
Schumann, Michael 14, 97, 126<br />
Schwarzer, J. 218<br />
Shire, Karen A. 102, 149<br />
Siegrist, J. 159<br />
Sonntag, Karlheinz 119<br />
Speidel, Frederic 35, 127, 219<br />
Sperling, Hans Joachim 97<br />
Sperling, Hans-Joachim 58<br />
Stagel, Wolfgang 77<br />
Stary, Christian 85<br />
Stegmaier, Ralf 119<br />
Stock, Manfred 20<br />
Stock, Patricia 150<br />
Stoll, Bettina 21<br />
Strasser, Hermann 22, 220<br />
Strauß, Jürgen 171<br />
Struck, Olaf 4<br />
Sutter, Matthias 6<br />
Swaminathan, Sushmita 196<br />
Sydow, Jörg 14<br />
Széll, György 23<br />
Szymenderski, Peggy 151<br />
T<br />
Tandolo, Riccardo 9<br />
Tech, Daniel 171<br />
Teichert, Volker 36<br />
Thiele, Silke 221, 222<br />
Thieler, Heinz-Siegmund 103<br />
Tian, Miao 223<br />
Tietel, Erhard 71<br />
Töngi, Claudia 143<br />
Trappmann, Vera 152<br />
Treeck, Werner van 98, 128, 153<br />
Trimpop, Rüdiger 172<br />
Tsertsvadze, Georgi 107<br />
Tullius, Knut 76<br />
Tünte, Markus 102<br />
Tyschak, Britta 103<br />
U<br />
Urspruch, Thekla 102<br />
Utsch, Andreas 122<br />
V<br />
Vartiainen, Matti 1<br />
Verwiebe, Roland 25<br />
Vogt, Marion 40, 60, 79, 168<br />
Volkholz, Volker 19<br />
Volmerg, Birgit 14<br />
Voskamp, Ulrich 73<br />
Voß, G. Günter 99, 118<br />
Voswinkel, Stephan 100
Personenregister 179<br />
W<br />
Waddington, Jeremy 199<br />
Wagels, Karen 154<br />
Wagner, Alexandra 129<br />
Wagner, Christine 9<br />
Wagner, Mathias 207<br />
Wagner, Richard E. 224<br />
Wassermann, Wolfram 69<br />
Weinert, Rainer 18<br />
Weise, Peter 101<br />
Weiß, Cornelia 99<br />
Weiss, Manfred 74<br />
Wessels, Jan 110<br />
Westermayer, Till 155<br />
Wieland, Josef 130<br />
Wingen, Sascha 103<br />
Winkler, Alfred 225<br />
Wittberg, Volker 156<br />
Wittke, Volker 73, 189<br />
Wolf, Harald 14, 15, 90<br />
Woll, Cornelia 226<br />
Wrage, Wiebke 157<br />
Z<br />
Zacher, Johannes 75<br />
Zeini, Sam 102<br />
Zellhuber, Brigitte 75<br />
Ziegler, Astrid 28<br />
Zölch, Martina 143<br />
Zschorlich, Christopher 108<br />
Zülch, Gert 150, 158
Sachregister 181<br />
A<br />
Abfindung 22, 43<br />
abhängig Beschäftigter 161<br />
Abrüstung 72<br />
Agrarpolitik 197<br />
Agrarprodukt 202<br />
Agrarproduktion 202<br />
Akteur 2, 186<br />
Akzeptanz 6<br />
Alltag 134, 151<br />
alte Bundesländer 4, 6, 189<br />
Altenpfleger 137<br />
älterer Arbeitnehmer 103, 119, 136, 146,<br />
156, 158, 163, 166, 168, 171<br />
altersadäquater Arbeitsplatz 19, 103, 163,<br />
166, 168<br />
Altersgruppe 95<br />
altersspezifische Faktoren 158<br />
Altersstruktur 103, 156<br />
Altersteilzeit 43<br />
Ambivalenz 99<br />
ambulante Versorgung 1<br />
Anarchie 213<br />
Angestellter 54, 90, 129<br />
Anreizsystem 117<br />
Arbeiter 58, 138<br />
Arbeitertätigkeit 168<br />
Arbeitgeber 6, 18, 24, 30, 41, 50, 70, 96<br />
Arbeitgeberverband 44, 116, 208<br />
Arbeitnehmer 6, 8, 19, 24, 30, 46, 47, 63,<br />
94, 106, 136, 144, 161, 170<br />
Arbeitnehmerbeteiligung 10, 28, 35, 38,<br />
39, 56, 69, 74, 97, 127<br />
Arbeitnehmerinteresse 41, 61, 86, 96<br />
Arbeitnehmerorganisation 96<br />
Arbeitnehmervertretung 8, 26, 31, 50, 59,<br />
61, 66, 127<br />
Arbeitsablauf 121<br />
Arbeitsanforderung 144, 158, 167<br />
Arbeitsbedingungen 1, 6, 11, 19, 38, 47,<br />
56, 58, 70, 75, 79, 85, 86, 89, 94, 96,<br />
100, 108, 114, 118, 119, 124, 127,<br />
129, 143, 145, 148, 149, 158, 159,<br />
160, 161, 164, 168, 169<br />
Sachregister<br />
Arbeitsbelastung 32, 106, 141, 143, 144,<br />
161, 163, 167, 168, 172<br />
Arbeitsbewertung 58<br />
Arbeitsbeziehungen 1, 3, 6, 8, 17, 18, 24,<br />
27, 30, 33, 48, 66, 69, 70, 71, 85, 88,<br />
89, 94, 101, 149, 200, 208<br />
Arbeitserlaubnis 94<br />
Arbeitsförderung 43<br />
Arbeitsforschung 14, 87, 141<br />
Arbeitsgestaltung 19, 58, 87, 92, 97, 106,<br />
119, 127, 139, 141, 145, 160, 163, 172<br />
Arbeitsgruppe 84<br />
Arbeitsintensität 86<br />
Arbeitskampf 41<br />
Arbeitskosten 41, 86<br />
Arbeitskraftunternehmer 61, 129<br />
Arbeitskultur 87, 90, 122, 129<br />
Arbeitsleistung 32, 48, 55, 65, 75, 101<br />
Arbeitslosenversicherung 205<br />
Arbeitslosigkeit 207<br />
Arbeitsmarkt 4, 47, 59, 70, 85, 94, 133,<br />
149<br />
Arbeitsmarktpolitik 9, 43<br />
Arbeitsnachfrage 51<br />
Arbeitsorganisation 1, 7, 11, 23, 33, 38,<br />
39, 57, 58, 81, 87, 89, 90, 93, 96, 97,<br />
100, 101, 102, 103, 108, 118, 126,<br />
128, 139, 140, 141, 143, 144, 155,<br />
157, 161<br />
Arbeitsorientierung 129<br />
Arbeitsplanung 160<br />
Arbeitsplatz 96, 102, 103, 124, 166, 194<br />
Arbeitsplatzsicherung 4, 8, 32, 41, 43, 46,<br />
50, 109<br />
Arbeitsplatzwechsel 1, 43, 164<br />
Arbeitspolitik 29, 61, 87, 93, 141, 148,<br />
195<br />
Arbeitsprozess 82, 91, 110, 160<br />
Arbeitspsychologie 160<br />
Arbeitsrecht 1, 23<br />
Arbeitsschutz 1, 169<br />
Arbeitssituation 8, 32, 145, 149, 161, 172<br />
Arbeitssucht 165<br />
Arbeitssystem 87, 95, 160<br />
Arbeitsteilung 7, 80, 106, 140, 186
182 Sachregister<br />
Arbeitsverhalten 90<br />
Arbeitsverhältnis 4, 6, 24, 31, 75, 76, 92,<br />
94, 149<br />
Arbeitsvertrag 162<br />
Arbeitswelt 1, 19, 25, 86, 98, 100, 147,<br />
149, 153, 154<br />
Arbeitszeit 8, 25, 45, 51, 55, 56, 83, 86,<br />
89, 104, 133, 134, 142, 144, 148, 150,<br />
157, 172<br />
Arbeitszeitflexibilität 1, 39, 45, 83, 89,<br />
104, 141, 144, 148, 150, 172<br />
Arbeitszeitpolitik 45, 89, 141, 142, 148<br />
Arbeitszeitwunsch 142<br />
Arbeitszufriedenheit 8, 11, 32, 76, 86, 141,<br />
164, 170<br />
Armut 207<br />
Arzt 203<br />
Assessment-Center 11<br />
Aufsichtsrat 63<br />
ausländischer Arbeitnehmer 31<br />
Außenhandel 226<br />
außeruniversitäre Forschung 145<br />
B<br />
Bank 139<br />
Bankgewerbe 8<br />
Baugewerbe 136, 168<br />
befristetes Arbeitsverhältnis 6<br />
Begriffsbildung 188<br />
Behinderter 109<br />
Belegschaft 71, 103, 146, 156<br />
Belgien 9, 205<br />
Bereitschaft 117<br />
Beruf 8, 32, 64, 131, 136<br />
berufliche Integration 109, 149, 174<br />
beruflicher Aufstieg 104, 165<br />
berufliche Selbständigkeit 78, 133, 169<br />
berufliche Sozialisation 66<br />
berufliche Weiterbildung 76, 89, 97, 103,<br />
126, 166, 192<br />
Berufsbild 111, 192, 203<br />
Berufsbildung 109, 189, 192<br />
Berufsgruppe 32<br />
Berufsmobilität 1<br />
Berufspraxis 151<br />
Berufsrolle 20<br />
Berufssoziologie 20, 111<br />
berufstätige Frau 31, 124, 145, 149<br />
Berufstätigkeit 139<br />
Berufsverband 20<br />
Berufswahl 137<br />
Beschäftigtenstruktur 156<br />
Beschäftigung 92, 96<br />
Beschäftigungsbedingungen 4, 24, 47, 55,<br />
73, 75, 96, 124, 127<br />
Beschäftigungseffekt 47, 85, 89, 124<br />
Beschäftigungsfähigkeit 103, 136<br />
Beschäftigungsförderung 136, 191<br />
Beschäftigungsform 24, 31, 39, 77, 162<br />
Beschäftigungspolitik 9, 191<br />
Beschäftigungssystem 4<br />
Besteuerung 176, 210<br />
Best Practice 195<br />
betrieblicher Sozialplan 43<br />
betriebliche Sozialpolitik 124<br />
Betriebsansiedlung 218<br />
Betriebsgründung 169, 194<br />
Betriebsklima 107, 114, 117<br />
Betriebsrat 8, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35,<br />
36, 41, 43, 45, 46, 50, 52, 53, 56, 59,<br />
61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 83,<br />
86, 115, 120, 141, 142, 208<br />
Betriebsstillegung 13<br />
Betriebsverfassungsgesetz 34, 35, 43, 50,<br />
52<br />
Betriebsverlagerung 41, 46<br />
betriebswirtschaftliche Faktoren 50<br />
Betriebszugehörigkeit 125<br />
Betroffener 142<br />
Bevölkerungsentwicklung 19, 119, 136,<br />
156<br />
Beziehungsarbeit 134<br />
Bildung 135<br />
Bildungsbedarf 169<br />
Bildungsbeteiligung 166<br />
Bildungsniveau 135<br />
Bindung 15, 90, 125, 170<br />
Biotechnik 12<br />
Brandenburg 68, 152<br />
Bundesministerium 104<br />
Bündnis für Arbeit 191<br />
bürgerschaftliches Engagement 68, 105,<br />
190<br />
Burnout 11, 92, 172<br />
Bürokratie 20<br />
Bürokratisierung 121
Sachregister 183<br />
C<br />
Call Center 96, 140<br />
Chancengleichheit 140, 149<br />
China 214<br />
CNC-Technik 160<br />
Computer 173<br />
computervermittelte Kommunikation 82<br />
Corporate Citizenship 5, 105, 190<br />
Corporate Governance 10, 21, 126<br />
D<br />
Dänemark 9, 205<br />
Datenschutz 1<br />
DDR 48<br />
demographische Alterung 158<br />
demographische Faktoren 108, 218<br />
Demokratie 23, 191<br />
Demokratisierung 23<br />
Deregulierung 23, 70, 149<br />
Deutsches Reich 176, 212<br />
Dezentralisation 18, 44, 83, 195<br />
Dialog 114<br />
Dienstleistung 39, 55, 92, 132, 150, 215<br />
Dienstleistungsberuf 90, 140, 155<br />
Dienstleistungsunternehmen 69, 75, 131,<br />
155, 226<br />
Diversifikation 221<br />
Dritte Welt 94<br />
Durkheim, E. 20, 177<br />
E<br />
EG 74<br />
Ehrenamt 64<br />
Einfluss 83<br />
Einkommen 47, 133<br />
Einstellungsbildung 224<br />
Eisenbahn 47<br />
Eisen- und Stahlindustrie 84<br />
Electronic Business 93, 196, 215<br />
Elektrizitätswirtschaft 47<br />
Elektroindustrie 8, 54, 58, 103<br />
Elektronik 73<br />
Elite 65, 129<br />
Emotionalität 98, 151<br />
Empathie 151<br />
Empowerment 109<br />
Energiewirtschaft 47<br />
Entgrenzung 14, 39, 56, 86, 99, 100, 145,<br />
147<br />
Entlassung 6<br />
Entscheidungskriterium 121<br />
Entscheidungsprozess 116<br />
Entwicklungsland 214, 223<br />
Erbschaft 206<br />
Ernährung 221, 222<br />
Ernährungsberatung 221<br />
Erwerbsarbeit 15, 39, 57, 98, 151<br />
Erwerbsbeteiligung 9<br />
Erwerbsform 92<br />
Erwerbstätiger 32, 161<br />
Erwerbstätigkeit 78<br />
Erwerbsverlauf 92, 161<br />
EU 17, 27, 60, 79, 197, 226<br />
EU-Beitritt 207<br />
EU-Erweiterung 30, 53, 209<br />
EU-Politik 196, 197<br />
Europa 70, 73, 94, 196, 199<br />
europäische Integration 17, 209<br />
Europäischer Betriebsrat 53<br />
europäische Sozialpolitik 10, 53, 74, 209<br />
Europäisches Recht 74<br />
europäische Zusammenarbeit 46<br />
Europäisierung 10, 209<br />
EU-Staat 10, 74, 208<br />
F<br />
Facharbeiter 76<br />
Fachkraft 86<br />
Fachwissen 125<br />
Fairness 6<br />
Familie 132, 147, 151, 172, 206<br />
Familie-Beruf 8, 32, 89, 124, 132, 144,<br />
145, 149, 153<br />
Familienarbeit 134<br />
Fehler 173<br />
Feminismus 87<br />
Fernsehen 15, 63<br />
Fertigung 73, 76, 158, 160<br />
Fertigungsverfahren 106<br />
Fest 158<br />
Finanzkrise 225<br />
Finanzmarkt 187<br />
Finanzpolitik 176, 210, 224<br />
Finanzpsychologie 210<br />
Finanztheorie 212<br />
Finanzverfassung 224<br />
Finanzwissenschaft 176, 212<br />
Finnland 205
184 Sachregister<br />
Firmentarifvertrag 135<br />
Flächentarifvertrag 44, 135<br />
Flugzeugindustrie 226<br />
Fluktuation 51<br />
Förderungsmaßnahme 124<br />
Fordismus 100<br />
Forschungsansatz 29, 99<br />
Forschungsumsetzung 117<br />
Forschung und Entwicklung 55<br />
Forstarbeiter 155<br />
Forstberuf 155<br />
Forstwirtschaft 155<br />
Frankreich 9<br />
Frau 31, 94, 123, 133, 134, 139, 140, 145,<br />
153, 194<br />
Frauenbild 123<br />
Frauenerwerbstätigkeit 77, 87, 94, 123,<br />
124, 133, 141, 145, 149, 153<br />
Frauenforschung 87<br />
Frauenfrage 142<br />
freier Beruf 15, 61<br />
freier Mitarbeiter 92<br />
Freizeit 172<br />
Fremdbild 123<br />
Fremdenverkehr 225<br />
Führung 122<br />
Führungskraft 114, 122, 129, 143, 195<br />
Führungsposition 104<br />
Führungsstil 122<br />
Funktionalismus 20<br />
Fusion 199<br />
G<br />
ganzheitlicher Ansatz 195<br />
Gastgewerbe 79<br />
GATS 47<br />
Gefährdung 9, 163<br />
Gefühlsarbeit 134<br />
Gemeinschaftsaufgaben 28<br />
Gender Mainstreaming 113<br />
Generation 171<br />
Generationenverhältnis 171, 206<br />
Genussmittel 198<br />
Gerechtigkeit 6, 57, 113, 171<br />
geringfügige Beschäftigung 77<br />
Geschäftsführung 26<br />
Geschäftspolitik 96, 223<br />
Geschichtsbild 220<br />
Geschichtsschreibung 220<br />
Geschlecht 87, 140, 154<br />
Geschlechterforschung 87, 140<br />
Geschlechterpolitik 99, 154<br />
Geschlechterverhältnis 140, 153, 186<br />
Geschlechtsrolle 100, 140<br />
geschlechtsspezifische Faktoren 87, 98,<br />
107, 123, 134, 139, 140, 142, 165, 186<br />
Gesellschaftspolitik 89<br />
Gesellschaftstheorie 16, 20<br />
Gesetzesnovellierung 34, 35<br />
gesetzliche Regelung 4, 34, 77<br />
Gesundheit 1, 163, 193<br />
gesundheitliche Folgen 159, 168<br />
Gesundheitsberuf 1<br />
Gesundheitsverhalten 169, 221<br />
Gesundheitsvorsorge 11, 169<br />
Gesundheitswesen 150<br />
Gesundheitszustand 89<br />
Gewerkschaft 2, 8, 18, 27, 28, 29, 31, 34,<br />
40, 41, 45, 53, 61, 63, 64, 66, 68, 70,<br />
71, 83, 129, 142, 148, 199, 205, 208<br />
Gewerkschaftspolitik 29, 61, 72, 141<br />
Gewinnbeteiligung 107, 170<br />
Gleichbehandlung 1<br />
Gleichberechtigung 109, 140<br />
Gleichgewicht 24<br />
Gleichstellung 149<br />
Globalisierung 2, 23, 36, 46, 68, 73, 93,<br />
94, 127, 180, 195, 214, 226<br />
Governance 176<br />
Grenzgebiet 207<br />
Großbetrieb 180<br />
Großbritannien 47, 190<br />
Grundgesetz 191<br />
Gruppenarbeit 51, 82, 84, 126, 141, 160<br />
Gruppendynamik 107<br />
Güterverkehr 79<br />
H<br />
Habitus 66, 67<br />
Handel 193, 207<br />
Handelspolitik 226<br />
Handlung 21, 186, 188<br />
Handlungsorientierung 6, 21, 66<br />
Handlungsspielraum 32, 50, 57, 88, 153<br />
Handlungssystem 20, 167<br />
Handlungstheorie 16<br />
Handwerk 69, 136, 156<br />
Hausarbeit 94
Sachregister 185<br />
häusliche Pflege 56<br />
Hierarchie 139<br />
hoch Qualifizierter 26, 90, 117, 125, 129<br />
Hochschule 104, 143<br />
Hochschulverwaltung 104<br />
Hochtechnologie 73<br />
homo oeconomicus 186<br />
Hörfunk 63<br />
Humanisierung der Arbeit 81<br />
Humanität 151<br />
Humankapital 19, 65<br />
I<br />
Ich-AG 169<br />
Ideengeschichte 213<br />
Identifikation 26, 90, 129<br />
Identität 57, 68, 182<br />
Identitätsbildung 57<br />
Ideologie 18<br />
IG BCE 64<br />
IG Metall 64<br />
illegale Beschäftigung 94<br />
Image 220<br />
Industriegesellschaft 177, 215<br />
industrielle Beziehungen 2, 3, 10, 15, 17,<br />
18, 23, 37, 44, 46, 47, 48, 58, 68, 70,<br />
71, 74, 88, 93, 112, 115, 127, 128,<br />
148, 171, 189, 191, 205, 208, 209<br />
Industriepolitik 2<br />
Industrieproduktion 1, 80<br />
Informationsfluss 117<br />
Informationsgesellschaft 196<br />
Informationstechnik 1, 82, 122<br />
Informationstechnologie 80, 85, 196<br />
informelle Struktur 208<br />
Ingenieur 153<br />
Innovation 7, 51, 73, 87, 91, 93, 97, 106,<br />
117, 119, 188, 221<br />
Innovationsfähigkeit 73, 156<br />
Innovationspotential 81<br />
Insolvenz 225<br />
Institutionalisierung 67<br />
Institutionalismus 12<br />
institutionelle Faktoren 12, 66, 96, 141<br />
institutioneller Wandel 200<br />
Inszenierung 154<br />
Interdisziplinarität 7<br />
Interessenpolitik 68<br />
Interessenvertretung 8, 15, 26, 29, 30, 31,<br />
39, 43, 45, 55, 56, 61, 66, 68, 116,<br />
141, 142, 226<br />
interkulturelle Kompetenz 152<br />
internationale Anerkennung 32<br />
internationale Arbeitsteilung 85, 94<br />
internationale Politik 213<br />
internationaler Vergleich 9, 27, 127, 168,<br />
180, 190, 215, 226<br />
internationaler Wettbewerb 47, 180<br />
internationales Regime 209, 213<br />
internationale Wirtschaftsbeziehungen 226<br />
internationale Zusammenarbeit 1, 53<br />
Internationalisierung 7, 127, 180<br />
Internet 15, 90<br />
Italien 9, 215<br />
IT-Beruf 38, 56, 61, 86, 163<br />
IT-Branche 3, 38, 39, 61, 80, 82, 163, 185<br />
J<br />
Jahresarbeitszeit 157<br />
Japan 176, 216<br />
Job Rotation 84<br />
Job Sharing 143<br />
Journalismus 15<br />
K<br />
Kapitalismus 20, 23, 99, 100, 177, 187,<br />
189, 195, 213<br />
KAPOVAZ 144<br />
Karriere 92, 129, 139, 165<br />
Klassengesellschaft 20<br />
Kleinbetrieb 21, 38, 49, 69, 141, 148, 152,<br />
155, 190, 208, 225<br />
Klimaschutz 197<br />
Kollektiv 46<br />
Kollektivverhandlung 40<br />
Kommunalverwaltung 142<br />
Kommunikation 5, 62, 112, 114, 116, 121,<br />
122<br />
Kommunikationsmittel 82<br />
Kommunikationsraum 82<br />
Kommunikationssystem 100<br />
Kommunikationstechnologie 82, 85, 196<br />
Kommunikationsverhalten 175<br />
Kompetenzverteilung 121<br />
Komplexität 13<br />
Konsum 198, 204<br />
Konsumfunktion 215
186 Sachregister<br />
Konsumverhalten 193, 196, 198, 217, 221,<br />
222<br />
Kontinuität 133<br />
Konzern 53, 112<br />
Koordination 7, 180<br />
Körperlichkeit 154<br />
Kosten 49<br />
Kostensenkung 11, 41, 75, 86<br />
Kraftfahrzeugindustrie 46, 76, 83, 93, 97,<br />
112, 127, 128, 179, 195, 218<br />
Krankenhaus 11, 91, 150<br />
Krankenpflege 1, 55<br />
Krankenpfleger 11<br />
Krankenschwester 11<br />
Krisenmanagement 50, 225<br />
Kulturberuf 15<br />
kulturelle Faktoren 53, 152, 214<br />
Kulturindustrie 15<br />
Kundenorientierung 11<br />
Kündigung 43<br />
Kurzarbeit 43<br />
Kybernetik 13<br />
L<br />
Ladenöffnungszeit 142<br />
ländlicher Raum 155<br />
Landwirt 197<br />
Landwirtschaft 197<br />
Lean Management 88<br />
Lebensalter 146, 171<br />
Lebensbedingungen 100<br />
Lebenslauf 134, 212<br />
Lebensmittel 193, 198, 221, 222<br />
Lebensplanung 133, 134<br />
Lebenssituation 89, 133, 145, 172<br />
Lebensstil 217<br />
Lebensweise 132, 151, 178, 217<br />
Lebenswelt 25<br />
Lehrpersonal 143<br />
Leiharbeit 6<br />
Leistungsbewertung 54<br />
Leistungsdruck 54<br />
Leistungsfähigkeit 51, 65, 156, 158, 174<br />
Leistungsnorm 54<br />
Leistungsorientierung 65<br />
Leistungsverhalten 81<br />
Leitbild 10, 17, 165, 186, 203<br />
Lernen 102, 117, 160<br />
lernende Organisation 109, 112<br />
Lernort 76<br />
Lernprogramm 169<br />
Lernprozess 81, 160<br />
Liberalisierung 47, 149, 226<br />
Lobby 226<br />
Lohn 6, 15, 51, 54, 58, 135, 171<br />
Lohnarbeit 20<br />
Lohnfindung 59<br />
Lohnform 75<br />
Lohnhöhe 8, 32, 75, 117<br />
Lohnpolitik 48, 97<br />
Lohnunterschied 135<br />
Loyalität 129<br />
Luhmann, N. 177<br />
M<br />
Macht 46, 59, 114, 171<br />
Management 15, 33, 37, 46, 48, 96, 108,<br />
115, 118, 125, 127, 128, 129, 130, 195<br />
Manager 42, 104<br />
Mann 134, 137, 139<br />
Männerberuf 137, 153<br />
Marketing 183<br />
Markt 101, 187, 213<br />
Marktforschung 211<br />
Marktmechanismus 213<br />
Marktordnung 47, 213<br />
Marktversagen 213<br />
Marktwirtschaft 30, 70, 149, 180, 213<br />
Marx, K. 20, 177<br />
Marxismus 213<br />
marxistische Soziologie 16<br />
Maschine 13<br />
Medienberuf 15<br />
Medienpolitik 63<br />
Medienwirtschaft 3, 15, 92, 184<br />
Medizintechnik 192<br />
Meister 126<br />
Mensch 13, 211<br />
Menschenbild 186<br />
menschliches Versagen 173<br />
Mensch-Maschine-System 1, 13, 95<br />
Mentalität 90<br />
Metallindustrie 8, 44, 54, 58, 59, 103<br />
Migrant 31<br />
Mindesteinkommen 60<br />
Ministerium 104<br />
Mitarbeiter 88, 108, 122, 125, 131, 136,<br />
170
Sachregister 187<br />
Mitbestimmung 8, 10, 23, 28, 34, 35, 36,<br />
43, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 63, 66, 67,<br />
69, 74, 83, 93, 108, 115, 126<br />
Mitgliedschaft 44<br />
Mittelbetrieb 21, 49, 69, 141, 148, 152,<br />
190, 208, 225<br />
Mitteleuropa 70<br />
Mittelstand 69, 190<br />
Mobiltelefon 73<br />
Modellversuch 35<br />
Moderne 177<br />
Modernisierung 97<br />
Moral 101, 130, 224<br />
Motiv 184<br />
Motivation 31, 81, 90, 101, 102, 123, 164,<br />
166, 170, 186<br />
Multimedia 160, 185<br />
multinationales Unternehmen 46, 53, 74,<br />
182<br />
N<br />
nachhaltige Entwicklung 99<br />
Nachhaltigkeit 36, 197, 217<br />
Nahost 214<br />
Nahrungsmittel 193, 198<br />
Nahrungs- und Genussmittelgewerbe 193,<br />
221<br />
Neoliberalismus 23, 70, 186<br />
Netzwerk 1, 2, 5, 7, 81, 102, 152, 179,<br />
181, 192, 199<br />
neue Bundesländer 4, 6, 33, 48, 66, 67,<br />
189<br />
neue Medien 15, 26, 90, 196<br />
Neuordnung 99<br />
New Economy 3, 26, 61<br />
Niedriglohn 73, 94<br />
Norm 171<br />
Normierung 121<br />
Normverletzung 202<br />
O<br />
Objekt 29<br />
öffentliche Aufgaben 223<br />
öffentliche Dienstleistung 47<br />
öffentliche Förderung 28<br />
öffentliche Hand 176, 210, 216<br />
öffentlicher Haushalt 176, 210, 216<br />
Öffentlicher Personennahverkehr 47, 62<br />
öffentliche Verwaltung 104<br />
Öffentlichkeit 87<br />
Öffentlichkeitsarbeit 220<br />
Ökonomie 180<br />
ökonomische Entwicklung 93, 187<br />
ökonomische Faktoren 193<br />
ökonomischer Wandel 33, 48, 187, 195<br />
ökonomische Theorie 6, 13<br />
Ökonomisierung 186<br />
Ökoprodukt 202<br />
Online-Dienst 11<br />
Ordnungspolitik 201<br />
Organisationen 27, 30<br />
Organisationsentwicklung 81, 88, 109,<br />
160, 219<br />
Organisationsform 128<br />
Organisationsgrad 44, 205<br />
Organisationshandeln 88<br />
Organisationskultur 26, 88, 90<br />
Organisationspsychologie 160<br />
Organisationssoziologie 20<br />
Organisationsstruktur 1, 5, 58, 116, 121,<br />
128, 140, 180<br />
organisatorischer Wandel 11, 93, 97, 106,<br />
112, 141<br />
organisierter Kapitalismus 42, 200<br />
Österreich 9, 38, 47, 77, 79, 85, 96, 145,<br />
164, 168, 204, 215, 225<br />
Osterweiterung 17, 53, 152, 209<br />
Osteuropa 70, 94<br />
Outsourcing 6, 73, 159<br />
P<br />
Pareto, V. 210<br />
Parsons, T. 20, 177<br />
Partizipation 23, 37<br />
Patient 203<br />
Personal 156, 158<br />
Personalabbau 43, 129, 159<br />
Personalbeurteilung 121<br />
Personaleinsatz 55, 150<br />
Personaleinstellung 115, 121<br />
Personalentwicklung 103, 109, 119, 120,<br />
158, 160, 166, 183<br />
Personalführung 102, 125<br />
Personalplanung 103, 108, 150<br />
Personalpolitik 24, 26, 33, 55, 69, 96, 103,<br />
108, 121, 124, 149, 166, 174<br />
Personalwesen 115<br />
Personalwirtschaft 170
188 Sachregister<br />
personenbezogene Dienstleistung 11, 55,<br />
75<br />
Pflege 11, 91, 168<br />
Pflegeberuf 86, 167<br />
Pflegedienst 39, 86<br />
Pflegepersonal 150<br />
Polen 30, 207<br />
politische Einstellung 9<br />
politische Entwicklung 27<br />
politische Faktoren 196<br />
politische Partizipation 86<br />
politischer Akteur 63<br />
politischer Einfluss 226<br />
politischer Wandel 201<br />
politische Soziologie 224<br />
politisches System 191<br />
politische Steuerung 196<br />
Polizei 113<br />
Polizeibeamter 151<br />
Post 47<br />
Postfordismus 186<br />
postindustrielle Gesellschaft 23, 155<br />
postkommunistische Gesellschaft 70<br />
postsozialistisches Land 9, 27, 30, 53, 112,<br />
207<br />
Präferenzordnung 224<br />
Prävention 202<br />
Privathaushalt 94, 215<br />
Privatsphäre 172<br />
Privatunternehmen 75<br />
Problembewusstsein 193<br />
Produktgestaltung 36<br />
Produktionsumstellung 72<br />
Produktionsverhältnisse 33<br />
Produktionsweise 200<br />
Produktivität 19, 51<br />
Produzent 202<br />
Projektmanagement 102, 111, 128<br />
Prozess 7<br />
psychische Belastung 163<br />
psychische Faktoren 125, 144, 160, 170<br />
psychische Folgen 151<br />
Psychologe 162<br />
psychosoziale Faktoren 32, 157<br />
Psychotherapeut 11<br />
Public Private Partnership 105<br />
Q<br />
Qualifikation 43, 62, 76, 81, 109, 131,<br />
136, 138, 192<br />
Qualifikationsanforderungen 76, 103, 192<br />
Qualifikationserwerb 62, 84<br />
Qualifikationsniveau 108<br />
Qualifikationsstruktur 76<br />
Qualifikationsverwertung 103<br />
Qualifikationswandel 76<br />
Qualitätskontrolle 88<br />
Qualitätssicherung 11<br />
R<br />
Rahmenbedingung 12, 21, 63, 106, 112,<br />
172<br />
Rationalisierung 37, 76, 159, 183<br />
Rationalität 20, 98<br />
Realitätsbezug 220<br />
rechtliche Faktoren 60<br />
Rechtsradikalismus 9<br />
Reformpolitik 201<br />
Regelung 58, 172<br />
Regierung 226<br />
Region 2, 68, 103, 219<br />
regionale Entwicklung 207<br />
regionale Faktoren 192, 207<br />
regionaler Unterschied 189<br />
Regionalisierung 2<br />
Regulierung 4, 54, 83, 141, 213<br />
Reichtum 22<br />
Rezession 191<br />
Reziprozität 6<br />
Rheinland-Pfalz 136<br />
Risikoverhalten 169<br />
Rolle 5<br />
Rückkopplung 84<br />
Ruhrgebiet 103, 192<br />
Rumänien 27<br />
Rüstungskonversion 72<br />
S<br />
Sachsen 2, 35, 68<br />
Schattenwirtschaft 94<br />
schichtspezifische Faktoren 207<br />
Schleswig-Holstein 193<br />
Schlüsselqualifikation 131<br />
Schumpeter, J. 176, 210<br />
Schweden 47, 205<br />
Schweiz 9, 143, 215
Sachregister 189<br />
Schwerarbeit 168<br />
sektorale Verteilung 32<br />
Selbständiger 78, 169<br />
Selbstbestimmung 90, 139<br />
Selbstbild 123<br />
Selbstorganisation 54, 56, 86, 118<br />
Selbststeuerung 169, 191<br />
Selbstverantwortung 26, 144<br />
Selbstverwirklichung 57, 139<br />
Shareholder Value 126<br />
Sicherheit 193<br />
Simmel, G. 177<br />
Simulation 150, 160<br />
Slowakei 53<br />
SOEP 135<br />
Software 38<br />
Solidarität 3, 42<br />
Sozialarbeit 164<br />
Sozialarbeiter 164<br />
soziale Anerkennung 57, 114, 171<br />
soziale Beziehungen 15, 24, 82, 86, 89,<br />
181<br />
soziale Dienste 39, 141, 167<br />
soziale Faktoren 108, 195, 218<br />
soziale Gerechtigkeit 59<br />
soziale Integration 5<br />
soziale Kompetenz 84<br />
soziale Konstruktion 220<br />
soziale Lage 9<br />
soziale Norm 98, 101<br />
soziale Position 64<br />
sozialer Aufstieg 20<br />
sozialer Prozess 186<br />
sozialer Status 129<br />
sozialer Wandel 4, 7, 29, 71, 175, 188<br />
soziale Sicherung 205<br />
soziales Netzwerk 82, 181<br />
soziales Verhalten 107, 114<br />
soziale Ungleichheit 135<br />
soziale Verantwortung 5, 21, 108<br />
Sozialgesetzbuch 43<br />
Sozialisation 67<br />
Sozialkapital 64, 181<br />
Sozialordnung 17<br />
Sozialpartnerschaft 18<br />
Sozialverträglichkeit 43, 98, 144<br />
Sozialwirtschaft 75, 174<br />
soziokulturelle Faktoren 42, 81<br />
Soziologe 212<br />
soziologische Theorie 13, 16, 176, 177,<br />
188, 212<br />
sozioökonomische Entwicklung 9, 178<br />
sozioökonomische Faktoren 215, 218, 221<br />
sozioökonomische Lage 9<br />
Spanien 46<br />
Spieltheorie 117<br />
Sprachkenntnisse 152<br />
Staat 176, 224<br />
staatliche Einflussnahme 191<br />
staatliche Lenkung 191, 200, 213<br />
Staatsverschuldung 216<br />
Stadt 190<br />
Stadtteil 142<br />
Standardisierung 76, 121, 195<br />
Standort 50, 73<br />
Standortverlagerung 214<br />
Stellenbeschreibung 143<br />
Steuerhinterziehung 176<br />
Strafrecht 41<br />
strategisches Management 181<br />
Streik 41<br />
Streikrecht 41<br />
Stress 1, 144, 159, 172<br />
Strukturpolitik 2, 68<br />
Student 203<br />
Studiengang 192<br />
Subjekt 29<br />
Subjektivität 57, 99, 100<br />
Subsystem 215<br />
Systemtheorie 13<br />
T<br />
Tarif 50, 55, 58, 75<br />
Tarifautonomie 191<br />
Tariflohn 58, 75<br />
Tarifpartner 18, 44, 208<br />
Tarifpolitik 44, 48, 75, 116, 148, 208<br />
Tarifverhandlung 41, 208<br />
Tarifvertrag 15, 40, 41, 44, 54, 58, 83<br />
Tätigkeit 119, 143, 161, 166, 168<br />
Taylorismus 118<br />
Teamarbeit 82, 84, 102<br />
technischer Fortschritt 80<br />
technischer Wandel 80, 106<br />
Technokratie 183<br />
Technologie 7<br />
Teilzeitarbeit 104, 133, 143<br />
Telearbeit 1, 102
190 Sachregister<br />
Telekommunikation 55, 226<br />
tertiärer Sektor 39, 56, 141, 215<br />
Theorie-Praxis 63<br />
Tochtergesellschaft 112<br />
Tourismus 225<br />
Transferleistung 133<br />
Transformation 2, 33, 48, 66, 70, 207<br />
Tschechische Republik 30, 53, 112<br />
Türkei 214<br />
Typologie 45, 188, 197<br />
U<br />
überbetriebliche Ausbildung 109<br />
Überlebensstrategie 207<br />
Umsatz 96<br />
Umweltfaktoren 217<br />
Umweltschutz 51<br />
Ungarn 9, 27, 30<br />
Unternehmen 2, 5, 12, 13, 21, 34, 37, 45,<br />
46, 51, 57, 73, 82, 84, 88, 101, 105,<br />
106, 109, 112, 120, 121, 125, 127,<br />
139, 152, 156, 174, 175, 180, 181,<br />
182, 183, 184, 185, 214, 217, 218,<br />
220, 223<br />
Unternehmensberatung 183<br />
Unternehmensführung 10, 21, 33, 42, 46,<br />
48, 53, 69, 71, 72, 93, 97, 118, 121,<br />
126, 200, 214<br />
Unternehmensgründung 123, 188<br />
Unternehmenskultur 36, 96, 108, 112, 114,<br />
115, 129, 182<br />
Unternehmensplanung 50<br />
Unternehmenspolitik 12, 55, 96, 126, 146,<br />
152, 171, 223, 226<br />
Unternehmer 20, 21, 42, 69, 123, 136, 188,<br />
194<br />
Unternehmerverband 2<br />
USA 46, 149, 226<br />
V<br />
Verantwortung 21, 105<br />
Verantwortungsethik 21<br />
Verbandspolitik 116<br />
Verbraucher 193, 204, 221, 222<br />
Verbraucherschutz 196<br />
Verdrängung 98<br />
Verhaltensänderung 196, 217<br />
Verhandlung 46, 50, 226<br />
Versicherungsgewerbe 8<br />
Verteilung 144<br />
Vertrag 162<br />
Vertragsbedingungen 24<br />
Vertrauen 26, 64, 114, 179, 196<br />
Vertrauensleute 64<br />
Vertrieb 183<br />
Verwaltung 146, 183<br />
Verwaltungshandeln 173<br />
Virtualisierung 82, 160<br />
virtuelle Gemeinschaft 1, 122<br />
virtuelle Realität 102<br />
virtuelles Unternehmen 92<br />
Vorgesetzter 107<br />
Vorruhestand 43<br />
W<br />
Wahrnehmung 8, 161<br />
Wald 155<br />
Wasserwirtschaft 47<br />
Weber, M. 20, 121, 177<br />
Weimarer Republik 121<br />
Weiterbildung 8, 51, 62, 166<br />
Welthandel 226<br />
Wert 20, 130<br />
Wertorientierung 8, 100, 171<br />
Wertschöpfung 192<br />
Wertsystem 24<br />
Wettbewerb 75, 86, 107, 209<br />
Wettbewerbsbedingungen 127<br />
Wettbewerbsfähigkeit 83, 180<br />
Widerstand 127<br />
Wien 164<br />
Willensbildung 116<br />
Wirtschaft 42, 70, 146, 177, 226<br />
wirtschaftliche Folgen 51, 52<br />
wirtschaftliches Handeln 5, 179, 188, 191,<br />
202<br />
wirtschaftliche Zusammenarbeit 46<br />
Wirtschaftlichkeit 96<br />
Wirtschaftsethik 21<br />
Wirtschaftsförderung 28, 96<br />
Wirtschaftsgeschichte 220<br />
Wirtschaftsordnung 180<br />
Wirtschaftspolitik 213<br />
Wirtschaftszweig 12, 103<br />
Wissen 7, 106, 108, 110, 125, 138<br />
Wissenschaftler 145<br />
wissenschaftliche Arbeit 55, 117<br />
Wissensgesellschaft 141
Sachregister 191<br />
Wissensmanagement 1, 125<br />
Wissenstransfer 7, 110, 112, 117<br />
Wochenarbeitszeit 157<br />
Wohlfahrtsstaat 205<br />
Wohlfahrtsverband 75<br />
Work-life-balance 104, 145, 172<br />
Z<br />
Zeit 25<br />
Zeitaufwand 55<br />
Zeitbudget 89<br />
Zeitökonomie 157<br />
Zeitpolitik 134, 142<br />
Zeitsouveränität 104, 134, 144<br />
Zeitverwendung 89<br />
Zielvereinbarung 54<br />
Zivilgesellschaft 5<br />
Zivilrecht 41<br />
Zukunftsfähigkeit 106<br />
Zulieferer 73, 179<br />
Zweite Republik 38<br />
zwischenbetriebliche Kooperation 1, 102,<br />
184, 185
Institutionenregister 193<br />
Institutionenregister<br />
ARÖW Gesellschaft für Arbeits-, Reorganisations- und ökologische Wirtschaftsberatung mbH<br />
92<br />
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft -FAL- 197<br />
Büro für Sozialforschung - Kasseler Verein für angewandte Sozialforschung e.V. 69<br />
Catholic University of Louvain, Hoger Instituut voor de Arbeid 9, 60<br />
Center for Corporate Citizenship e.V. 190<br />
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung -DIW Berlin- Abt. Informationsgesellschaft und<br />
Wettbewerb 196<br />
Deutsches Jugendinstitut e.V. Abt. Familie und Familienpolitik 147<br />
empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbH 196<br />
Europa-Universität Viadrina, Kulturwissenschaftliche Fakultät, Professur für vergleichende Kultur-<br />
und Sozialanthropologie 94<br />
Evangelische Fachhochschule Reutlingen-Ludwigsburg, Institut für angewandte Forschung -IAF-<br />
137<br />
Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg, FB Wirtschaft 01 211<br />
Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld, Institut für den Mittelstand in Lippe -IML- 156, 169<br />
Fachhochschule Esslingen Hochschule für Sozialwesen 137<br />
Fachhochschule Fulda, FB Sozial- und Kulturwissenschaften, Jean Monnet Chair of European<br />
Integration 27, 30<br />
Fachhochschule Gelsenkirchen Abt. Bocholt, FB Wirtschaft 123<br />
Fachhochschule Kempten, FB Allgemeinwissenschaften und Betriebswirtschaft 75<br />
Fachhochschule Koblenz RheinAhrCampus Remagen, FB Betriebs- und Sozialwirtschaft 109<br />
Fachhochschule Konstanz, FB Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 130<br />
Fachhochschule Ludwigshafen - Hochschule für Wirtschaft, FB II Marketing und Personalmanagement<br />
120<br />
Fachhochschule Ludwigshafen - Hochschule für Wirtschaft, Institut für Beschäftigung und<br />
Employability -IBE- 124<br />
Fachhochschule Osnabrück, Fak. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 91<br />
Fachhochschule Solothurn Nordwestschweiz Technik - Wirtschaft - Soziales, Institut Mensch und<br />
Organisation -IMO- 143<br />
FATK Forschungsinstitut für Arbeit, Technik und Kultur e.V. an der Universität Tübingen 58<br />
Forschungsinstitut für Arbeit, Bildung und Partizipation e.V. an der Universität Bochum 34, 219
194 Institutionenregister<br />
Forschungsteam Internationaler Arbeitsmarkt GmbH -FIA- 129<br />
Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt -FORBA- 9, 39, 40, 47, 60, 79, 80, 85, 167, 168<br />
Freie Universität Berlin, FB Wirtschaftswissenschaft, Institut für Management Lehrstuhl für Strategisches<br />
Management 181<br />
Freie Universität Berlin, FB Wirtschaftswissenschaft, Institut für Management Lehrstuhl für Unternehmenskooperation<br />
14<br />
gaus - medien bildung politikberatung GmbH 92, 103<br />
Gesellschaft für Arbeitsschutz und Humanisierungsforschung mbH -GfAH- Volkholz und Partner<br />
19<br />
Gewerkschaft der Bau - Holz 168<br />
Hamburger Institut für Sozialforschung 188<br />
Industriegewerkschaft Metall Verwaltungsstelle Dortmund 103<br />
INFO-Institut Organisationsentwicklung und Unternehmenspolitik an der Hochschule für Technik<br />
und Wirtschaft des Saarlandes 49<br />
Institut Arbeit und Technik im Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen 192<br />
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit -IAB- 178<br />
Institut für interdisziplinäre Nonprofit-Forschung -NPO-Institut- an der Wirtschaftsuniversität<br />
Wien 39<br />
Institut für Mittelstandsforschung 69<br />
Institut für ökologische Wirtschaftsforschung -IÖW- gGmbH Regionalbüro Nordrhein-Westfalen<br />
217<br />
Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. -ISF- 39, 54, 55, 178<br />
Institut für Technik der Betriebsführung Forschungsstelle im Deutschen Handwerksinstitut e.V.<br />
136<br />
Institut für Unternehmensforschung und -führung an der Martin-Luther-Universität Halle-<br />
Wittenberg e.V. 218<br />
Instituto di Ricerche Economiche e Sociali 85<br />
Internationales Institut für Empirische Sozialökonomie gGmbH -INIFES- 178<br />
ISA Consult GmbH Beratungsgesellschaft für Innovation, Strukturpolitik und Arbeit 50<br />
ISW - Institut für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 77<br />
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien Abt. Konsumentenpolitik 204<br />
Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung 12, 42, 46, 180, 200, 214, 226<br />
Max-Planck-Institut für Ökonomik Abt. Strategische Interaktion 6<br />
Prospektiv - Gesellschaft für betriebliche Zukunftsgestaltungen mbH 19
Institutionenregister 195<br />
Rhein-Ruhr-Institut für Sozialforschung und Politikberatung e.V. -RISP- an der Universität Duisburg-Essen<br />
Arbeitsbereich Arbeit und Wirtschaft Projektgruppe Logistik und Dienstleistung<br />
-Prolog- 146<br />
Simon Frazer University Vancouver 85<br />
Soziale Innovation research & consult GmbH 103<br />
Sozialforschungsstelle Dortmund Landesinstitut -sfs- 152, 171<br />
Soziologisches Forschungsinstitut an der Universität Göttingen e.V. -SOFI- 39, 58<br />
Technische Hochschule Aachen, FB 04 Fak. für Maschinenwesen, Lehrstuhl und Institut für Arbeitswissenschaft<br />
95<br />
Technische Universität Chemnitz, Philosophische Fakultät, Institut für Soziologie Professur für<br />
Industrie- und Techniksoziologie 151<br />
Technische Universität Cottbus, Fak. 03 Maschinenbau, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen,<br />
Institut für Wirtschaftswissenschaften 184, 185<br />
Technische Universität Cottbus, Fak. 03 Maschinenbau, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen,<br />
Institut für Wirtschaftswissenschaften Lehrstuhl für Planung und Innovationsmanagement<br />
184, 185<br />
Technische Universität Darmstadt, FB 02 Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften, Institut<br />
für Soziologie 53, 129<br />
Università Cattolica del Sacro Cuore Milano 9<br />
Universita degli studi di Trento 215<br />
Universität Bamberg, Fak. Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Graduiertenkolleg "Märkte und<br />
Sozialräume in Europa" 5<br />
Universität Basel, Philosophisch-Historische Fakultät, Institut für Soziologie 143<br />
Universität Basel, Ressort Chancengleichheit 143<br />
Universität Bielefeld, Fak. für Soziologie, WE V Arbeit und Organisation Professur für Arbeitssoziologie<br />
und Sozialwissenschaften 132, 133, 134<br />
Universität Bielefeld, Fak. für Soziologie, WE VIII Entwicklungssoziologie und Sozialanthropologie<br />
Arbeitsbereich Entwicklungssoziologie, Frauen- und Geschlechterforschung in Entwicklungsländern<br />
207<br />
Universität Bochum 39<br />
Universität Bochum, Fak. für Sozialwissenschaft, Sektion Soziologie Lehrstuhl für Arbeits- und<br />
Wirtschaftssoziologie 192<br />
Universität Bochum, Fak. für Sozialwissenschaft, Sektion Soziologie Lehrstuhl Organisationssoziologie<br />
und Mitbestimmungsforschung 14<br />
Universität Bonn, Landwirtschaftliche Fakultät, Institut für Agrarpolitik, Marktforschung und<br />
Wirtschaftssoziologie Abt. Wirtschafts- und Agrarpolitik 197<br />
Universität Bremen 39
196 Institutionenregister<br />
Universität Bremen, FB 11 Human- und Gesundheitswissenschaften, Institut für Psychologie und<br />
Sozialforschung 14<br />
Universität Bremen, Zentrum für Sozialpolitik 14, 78<br />
Universität der Bundeswehr Hamburg, FB Pädagogik, Professur für Soziologie 215<br />
Universität der Bundeswehr Hamburg, FB Wirtschafts- und Organisationswissenschaften, Institut<br />
für Verwaltungswissenschaft 223<br />
Universität der Bundeswehr München, Fak. für Wirtschafts- und Organisationswissenschaften,<br />
Institut für Personal- und Organisationsforschung Professur für Allgemeine BWL, Entscheidungs-<br />
und Organisationsforschung, Personalwirtschaft 125<br />
Universität Dortmund, FB 12 Erziehungswissenschaft und Soziologie, Institut für Soziologie Professur<br />
für Frauenforschung 104, 123, 186<br />
Universität Dortmund, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Fachgebiet Soziologie<br />
Lehrstuhl Allgemeine Soziologie, insb. Arbeitssoziologie 92<br />
Universität Duisburg-Essen Campus Duisburg, FB Gesellschaftswissenschaften, Institut für Soziologie<br />
Professorship Comparative Sociology and Japanese Society 102<br />
Universität Duisburg-Essen Campus Duisburg, FB Gesellschaftswissenschaften, Institut für Soziologie<br />
Professur Empirische Sozialstrukturanalyse 25<br />
Universität Duisburg-Essen Campus Duisburg, FB Gesellschaftswissenschaften, Institut für Soziologie<br />
Professur für Soziologie II 22, 220<br />
Universität Duisburg-Essen Campus Duisburg, FB Ingenieurwissenschaften, Institut für Informatik<br />
und Interaktive Systeme Fachgebiet Kooperative und Lernunterstützende Systeme 102<br />
Universität Duisburg-Essen Campus Duisburg, Mercator School of Management - FB Betriebswirtschaft,<br />
Department Management and Marketing Lehrstuhl für Personal und Unternehmensführung<br />
102<br />
Universität Duisburg-Essen Campus Essen, FB Bildungswissenschaften, Labor für Organisationsentwicklung<br />
-OrgLab- 195<br />
Universität Erlangen-Nürnberg, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Sozialwissenschaftliches<br />
Institut Lehrstuhl für Psychologie, insb. Wirtschafts- und Sozialpsychologie<br />
161, 162, 165<br />
Universität Flensburg, Department II, Internationales Institut für Management Professur für Arbeits-<br />
und Organisationspsychologie 157<br />
Universität Göttingen, Sozialwissenschaftliche Fakultät, Institut für Soziologie 14, 178<br />
Universität Göttingen, Sozialwissenschaftliche Fakultät, Institut für Soziologie Lehrstuhl Prof.Dr.<br />
Wittke 73<br />
Universität Göttingen, Sozialwissenschaftliche Fakultät, Seminar für Politikwissenschaft 31<br />
Universität Göttingen, Sozialwissenschaftliche Fakultät, Seminar für Politikwissenschaft Professur<br />
für politische Theorie und Ideengeschichte 213<br />
Universität Halle-Wittenberg, Philosophische Fakultät, Institut für Soziologie Lehrstuhl für Wirtschafts-<br />
und Umweltsoziologie 201
Institutionenregister 197<br />
Universität Halle-Wittenberg, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Institut für VWL und Bevölkerungsökonomie<br />
Lehrstuhl für Wirtschaftsethik 105, 213<br />
Universität Halle-Wittenberg, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Institut für Wirtschaftsinformatik<br />
und Operations Research 218<br />
Universität Hamburg, Fak. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Department Sozialwissenschaften<br />
Institut für Kriminologische Sozialforschung 202<br />
Universität Hamburg, Fak. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Department Sozialwissenschaften<br />
Institut für Politische Wissenschaft Arbeitsstelle Medien und Politik 63<br />
Universität Hamburg, Fak. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Department Wirtschaft und<br />
Politik Fachgebiet Soziologie 64, 199<br />
Universität Hannover, Philosophische Fakultät, Institut für Soziologie und Sozialpsychologie Fach<br />
Soziologie Lehrstuhl für Soziologie Prof.Dr. Griese 194<br />
Universität Hannover, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Institut für Empirische Wirtschaftsforschung<br />
51<br />
Universität Heidelberg, Fak. für Verhaltens- und Empirische Kulturwissenschaften, Psychologisches<br />
Institut AE Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie 119<br />
Universität Jena, Fak. für Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Institut für Psychologie Lehrstuhl<br />
für Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie 172<br />
Universität Jena, Fak. für Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Institut für Soziologie 48, 66<br />
Universität Jena, Fak. für Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Institut für Soziologie Lehrstuhl<br />
für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie 2, 37, 68, 187<br />
Universität Jena, Fak. für Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Institut für Soziologie Professur<br />
für Wirtschafts- und Sozialstruktur 4<br />
Universität Jena, Fak. für Sozial- und Verhaltenswissenschaften, SFB 580 Gesellschaftliche Entwicklungen<br />
nach dem Systemumbruch - Diskontinuität, Tradition und Strukturbildung 4, 6<br />
Universität Karlsruhe, Fak. für Maschinenbau, Institut für Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation<br />
150, 158<br />
Universität Kassel, FB 05 Gesellschaftswissenschaften, Fachgruppe Soziologie Fachgebiet Arbeits-<br />
und Sozialpolitik 98, 128, 153, 173<br />
Universität Kassel, FB 05 Gesellschaftswissenschaften, Fachgruppe Soziologie Fachgebiet Betriebs-<br />
und Industriesoziologie 128<br />
Universität Kiel, Agrar- und Ernährungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Ernährungswirtschaft<br />
und Verbrauchslehre Abt. Haushalts- und verbraucherorientierte Gesundheitsökonomik<br />
193, 198, 221, 222<br />
Universität Koblenz-Landau Campus Landau, Zentrum für Human Resource Management -<br />
ZHRM- 138, 182<br />
Universität Köln, Erziehungswissenschaftliche Fakultät, Seminar für Sozialwissenschaften Abt.<br />
für Politikwissenschaft 9
198 Institutionenregister<br />
Universität Köln, Medizinische Fakultät, Klinik und Poliklinik für Psychosomatik und Psychotherapie<br />
203<br />
Universität Konstanz, Geisteswissenschaftliche Sektion, FB Geschichte und Soziologie Fach Soziologie<br />
Forschungsbereich Gesellschaft und Familie 206<br />
Universität Leipzig, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Institut für Finanzen 218<br />
Universität Lüneburg, FB 02 Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Institut für BWL Abt. Personal<br />
und Führung 24<br />
Universität Lüneburg, FB 02 Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Institut für BWL Abt. Strategisches<br />
Management und Tourismusmanagement 131, 175<br />
Universität Lüneburg, FB Wirtschaft, Institut für elektronische Geschäftsprozesse 122<br />
Universität Lüneburg, FB Wirtschaftspsychologie, Professur für Differenzielle Psychologie, Eignungsdiagnostik,<br />
Organisationspsychologie 166<br />
Universität Lüneburg, FB Wirtschaftspsychologie, Professur für Evaluation und Organisation<br />
122<br />
Universität Marburg, FB 03 Gesellschaftswissenschaften und Philosophie, Graduiertenkolleg "Geschlechterverhältnisse<br />
im Spannungsfeld von Arbeit, Politik und Kultur" 65, 154<br />
Universität Marburg, FB 21 Erziehungswissenschaften, Institut für Schulpädagogik 174<br />
Universität München, Fak. für Betriebswirtschaft, Institut für Risikoforschung und Versicherungswirtschaft<br />
-INRIVER- 13<br />
Universität Oldenburg, Fak. 02 Informatik, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, Institut für<br />
Rechtswissenschaften Lehrstuhl Arbeitsrecht 14<br />
Universität Osnabrück, FB Sozialwissenschaften 72<br />
Universität Osnabrück, FB Sozialwissenschaften, Fachgebiet Methodologische Grundlagen der<br />
Sozialwissenschaften 113<br />
Universität Osnabrück, FB Sozialwissenschaften, Fachgebiet Soziologie und Sozialpsychologie<br />
113<br />
Universität Regensburg, Philosophische Fakultät 03 - Geschichte, Gesellschaft und Geographie,<br />
Institut für Politikwissenschaft 116<br />
Universität Regensburg, Philosophische Fakultät 03 - Geschichte, Gesellschaft und Geographie,<br />
Institut für Soziologie Lehrstuhl Soziologie 21<br />
Universität Rostock, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Institut für BWL Lehrstuhl<br />
für Allgemeine BWL, insb. Wirtschafts- und Organisationspsychologie 170<br />
Universität Trier, FB 04, Fach Soziologie 33<br />
Universität Tübingen, Fak. für Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Institut für Soziologie Arbeitsschwerpunkt<br />
Industrielle Entwicklung 111<br />
Universität Witten-Herdecke, Fak. für das Studium fundamentale, Lehrstuhl für Soziologie 177<br />
Universität Würzburg, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Betriebswirtschaftliches Institut<br />
Lehrstuhl für BWL und Marketing 179
Institutionenregister 199<br />
Université de Neuchâtel, Faculté des sciences économiques et sociales, Institut de sociologie et de<br />
science politique 9<br />
University of Manchester, Institute of Science and Technology -UMIST- 39, 79<br />
Unternehmensverband der Metallindustrie für Dortmund und Umgebung e.V. 103<br />
VDI-VDE Innovation + Technik GmbH 110<br />
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH -ZEW- 135<br />
Zentrum für soziale Innovation 39
ANHANG
Hinweise 203<br />
Hinweise zur Originalbeschaffung von Literatur<br />
Die in der Datenbank SOLIS nachgewiesene Graue Literatur enthält nahezu vollständig einen<br />
Bibliotheksstandort zur Erleichterung der Ausleihe; dies gilt auch für einen Teil (40%) der nachgewiesenen<br />
Verlagsliteratur. In SOLIS nachgewiesene Zeitschriftenaufsätze sind zu über 60% mit<br />
einem Standortvermerk versehen.<br />
Beschaffung von Literatur über den Deutschen Leihverkehr<br />
Die Standortvermerke in SOLIS (Kürzel, Ort und Sigel der besitzenden Bibliothek sowie Signatur<br />
der Arbeit) beziehen sich auf Bibliotheken, die dem normalen Fernleihverkehr angeschlossen sind.<br />
Sollte die gewünschte Arbeit bei Ihrer örtlichen Bibliothek nicht vorhanden sein, ersparen Ihnen<br />
die Standortvermerke für die Fernleihe („Direktbestellung“) den u.U. sehr zeitraubenden Weg über<br />
das Bibliothekenleitsystem.<br />
Elektronische Bestellungen sind ebenfalls möglich, z.B. über subito - einen bundesweiten Dokumentlieferdienst<br />
der deutschen Bibliotheken für Aufsätze und Bücher.<br />
Literaturdienst der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln<br />
Aufsätze aus Zeitschriften, die für SOLIS ausgewertet werden und in der Universitäts- und Stadtbibliothek<br />
Köln vorhanden sind, können über den Kölner Literaturdienst (KÖLI) als Kopie bestellt<br />
werden. Diese Aufsätze enthalten den Standortvermerk „UuStB Koeln(38) - Signatur der Zeitschrift“<br />
sowie einen Hinweis auf den Kopierdienst. Die Bestellung kann mit gelber Post, per Fax<br />
oder elektronisch erfolgen.<br />
Kosten für den Postversand bis zu je 20 Kopien pro Aufsatz betragen 8,- Euro, für Hochschulangehörige<br />
4,- Euro (bei „Normalbestellung“ mit einer Lieferzeit von i.d.R. sieben Tagen); gegen<br />
Aufpreis ist eine „Eilbestellung“ (Bearbeitungszeit: ein Arbeitstag) oder auch eine Lieferung per<br />
Fax möglich.<br />
Zur Benutzung der Forschungsnachweise<br />
Die Inhalte der Forschungsnachweise beruhen auf den Angaben der Forscher selbst.<br />
Richten Sie deshalb bitte Anfragen jeglicher Art direkt an die genannte Forschungseinrichtung<br />
oder an den/die Wissenschaftler(in).<br />
Das gilt auch für Anfragen wegen veröffentlichter oder unveröffentlichter Literatur, die im Forschungsnachweis<br />
genannt ist.
Informations- und Dienstleistungsangebot des<br />
Informationszentrums Sozialwissenschaften<br />
Als Serviceeinrichtung für die Sozialwissenschaften erbringt das Informationszentrum Sozialwissenschaften<br />
(IZ) überregional und international grundlegende Dienste für Wissenschaft und Praxis.<br />
Seine Datenbanken zu Forschungsaktivitäten und Fachliteratur sowie der Zugang zu weiteren<br />
nationalen und internationalen Datenbanken sind die Basis eines umfassenden Angebotes an Informationsdiensten<br />
für Wissenschaft, Multiplikatoren und professionelle Nutzer von Forschungsergebnissen.<br />
Zu seinen zentralen Aktivitäten gehören:<br />
• Aufbau und Angebot von Datenbanken mit Forschungsprojektbeschreibungen (FORIS) und<br />
Literaturhinweisen (SOLIS)<br />
• Beratung bei der Informationsbeschaffung - Auftragsrecherchen in Datenbanken weltweit<br />
• Informationstransfer von und nach Osteuropa<br />
• Informationsdienste zu ausgewählten Themen<br />
• Informationswissenschaftliche und informationstechnologische Forschung & Entwicklung<br />
• Internet-Service<br />
Das Informationszentrum Sozialwissenschaften wurde 1969 von der Arbeitsgemeinschaft <strong>Sozialwissenschaftlicher</strong><br />
Institute e.V. (ASI) gegründet. Seit Dezember 1986 ist es mit dem Zentralarchiv<br />
für empirische Sozialforschung (ZA) an der Universität zu Köln und dem Zentrum für Umfragen,<br />
Methoden und Analysen e.V. (ZUMA), Mannheim in der Gesellschaft <strong>Sozialwissenschaftlicher</strong><br />
Infrastruktureinrichtungen e.V. (GESIS) zusammengeschlossen. GESIS ist Mitglied der<br />
Leibniz-Gemeinschaft und wird von Bund und Ländern gemeinsam gefördert.<br />
Im Januar 1992 wurde eine Außenstelle der GESIS (seit 2003 GESIS-Servicestelle Osteuropa) in<br />
Berlin eröffnet, in der die Abteilung des IZ zwei Aufgaben übernahm: Die Bestandssicherung<br />
unveröffentlichter sozialwissenschaftlicher Forschungsarbeiten der DDR und den Informationstransfer<br />
von und nach Osteuropa. Außerdem bietet das Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft<br />
und Forschung CEWS (http://www.cews.org/) als Abteilung des IZ zielgruppenadäquate Informations-<br />
und Beratungsleistungen zu Fragen der Chancengleichheit in Wissenschaft und Forschung.<br />
Die Datenbanken FORIS und SOLIS<br />
FORIS (Forschungsinformationssystem Sozialwissenschaften)<br />
Inhalt: FORIS informiert über laufende, geplante und abgeschlossene Forschungsarbeiten der<br />
letzten zehn Jahre aus der Bundesrepublik Deutschland, aus Österreich und der Schweiz.<br />
Die Datenbank enthält Angaben zum Inhalt, zum methodischen Vorgehen und zu Datengewinnungsverfahren<br />
sowie zu ersten Berichten und Veröffentlichungen. Die Namen der<br />
am Projekt beteiligten Forscher und die Institutsadresse erleichtern die Kontaktaufnahme.<br />
Fachgebiete: Soziologie, Politikwissenschaft, Sozialpolitik, Sozialpsychologie, Psychologie, Bildungsforschung,<br />
Erziehungswissenschaft, Kommunikationswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften,<br />
Demographie, Ethnologie, historische Sozialforschung, Sozialgeschichte,<br />
Methoden der Sozialforschung, Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sowie weitere interdisziplinäre<br />
Gebiete der Sozialwissenschaften wie Frauenforschung, Freizeitforschung,<br />
Gerontologie, Sozialwesen oder Kriminologie.<br />
Bestand der letzten 10 Jahre: rund 42.000 Forschungsprojektbeschreibungen<br />
Quellen: Erhebungen, die das IZ Sozialwissenschaften in der Bundesrepublik Deutschland, die<br />
Universitätsbibliothek der Wirtschaftsuniversität Wien in Österreich (bis 2001) und SI-
DOS (Schweizerischer Informations- und Daten-Archivdienst) in der Schweiz bei sozialwissenschaftlichen<br />
Forschungseinrichtungen durchführen. Die Ergebnisse der IZ-Erhebung<br />
werden ergänzt durch sozialwissenschaftliche Informationen fachlich spezialisierter<br />
IuD-Einrichtungen, z.B. des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt<br />
für Arbeit in Nürnberg sowie durch Auswertung von Internetquellen, Hochschulforschungsberichten<br />
sowie Jahresberichten zentraler Fördereinrichtungen und Stiftungen.<br />
SOLIS (Sozialwissenschaftliches Literaturinformationssystem)<br />
Inhalt: SOLIS informiert über die deutschsprachige fachwissenschaftliche Literatur ab 1945, d.h.<br />
Aufsätze in Zeitschriften, Beiträge in Sammelwerken, Monographien und Graue Literatur<br />
(Forschungsberichte, Kongressberichte), die in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich<br />
oder der Schweiz erscheinen. Bei Aufsätzen aus Online-Zeitschriften und bei Grauer<br />
Literatur ist im Standortvermerk zunehmend ein Link zum Volltext im Web vorhanden.<br />
Fachgebiete: Soziologie, Politikwissenschaft, Sozialpolitik, Sozialpsychologie, Bildungsforschung,<br />
Kommunikationswissenschaften, Demographie, Ethnologie, historische Sozialforschung,<br />
Methoden der Sozialforschung, Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sowie<br />
weitere interdisziplinäre Gebiete der Sozialwissenschaften wie Frauenforschung, Freizeitforschung,<br />
Gerontologie oder Sozialwesen.<br />
Bestand: Sommer 2006 ca. 335.000 Literaturnachweise<br />
Jährlicher Zuwachs: ca. 14.000<br />
Quellen: Zeitschriften, Monographien einschließlich Beiträgen in Sammelwerken sowie Graue<br />
Literatur. SOLIS wird vom IZ Sozialwissenschaften in Kooperation mit dem Bundesinstitut<br />
für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden, der Freien Universität Berlin - Fachinformationsstelle<br />
Publizistik, dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur<br />
für Arbeit in Nürnberg, den Herausgebern der Zeitschrift für Politikwissenschaft<br />
und dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung hergestellt. Weitere<br />
Absprachen bestehen mit der Zentralstelle für Psychologische Information und Dokumentation<br />
in Trier und mit dem Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung<br />
in Frankfurt/Main.<br />
Zugang zu den Datenbanken<br />
Der Abruf von Informationen aus den Datenbanken FORIS und SOLIS ist prinzipiell kostenpflichtig.<br />
Beide Datenbanken sind in jeweils unterschiedlichen fachlichen Umgebungen über folgende<br />
Hosts zugänglich:<br />
STN International GBI<br />
The Scientific & Technical Gesellschaft für Betriebswirt-<br />
Information Network schaftliche Information mbH<br />
Postfach 24 65 Postfach 81 03 60<br />
76012 Karlsruhe 81903 München<br />
Deutschland Deutschland<br />
Tel.:+49 (0)7247-80 85 55 Tel.:+49 (0)89-99 28 79-0<br />
www.stn-international.de www.gbi.de/_de<br />
An nahezu allen Hochschulstandorten sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der<br />
Schweiz sind beide Datenbanken auf der Basis von Pauschalabkommen mit den Hosts - z.B. für<br />
das GBI wiso-net - in der Bibliothek oder über Institutsrechner für die Hochschulangehörigen frei<br />
zugänglich.
infoconnex - der neue interdisziplinäre Informationsdienst bietet Individualkunden günstige Jahrespauschalpreise<br />
für den Zugang zu den Datenbanken SOLIS und FORIS. Zudem stehen in infoconnex<br />
seit Sommer 2006 im Rahmen von DFG-Nationallizenzen auch sechs Datenbanken des<br />
Herstellers Cambridge Scientific Abstracts (CSA) zur Recherche an Hochschulen und wissenschaftlichen<br />
Einrichtungen zur Verfügung. Das sind die Sociological Abstracts, Social Services<br />
Abstracts, PAIS International, Worldwide Political Science Abstracts, Applied Social Sciences<br />
Index and Abstracts (ASSIA) und der Physical Education Index. Darüber hinaus kann über infoconnex<br />
in der Literaturdatenbank DZI SoLit des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen und<br />
in Literaturdatenbanken zu Pädagogik und Psychologie recherchiert werden (www.infoconnex.de).<br />
Im Internetangebot des IZ bzw. der GESIS steht - neben weiteren kostenfrei zugänglichen Datenbanken<br />
- ein Ausschnitt aus der FORIS-Datenbank mit Projektbeschreibungen der letzten Jahre<br />
für inhaltliche und formale Suchen zur Verfügung; dadurch besteht darüber hinaus die Möglichkeit,<br />
bereits gemeldete Projekte auf Aktualität zu prüfen sowie jederzeit neue Projekte für eine<br />
Aufnahme in FORIS mitzuteilen.<br />
Beratung bei der Nutzung sozialwissenschaftlicher Datenbanken<br />
Zur Unterstützung Ihrer eigenen Suche in den Datenbanken FORIS und SOLIS bietet das IZ entsprechende<br />
Rechercheinstrumente an, z.B. den Thesaurus oder die Klassifikation Sozialwissenschaften.<br />
Selbstverständlich beraten wir Sie auch jederzeit bei der Umsetzung sozialwissenschaftlicher<br />
Fragestellungen in effektive Suchstrategien in unseren Datenbanken.<br />
Auftragsrecherchen<br />
In Ihrem Auftrag und nach Ihren Wünschen führt das IZ kostengünstig Recherchen in den Datenbanken<br />
FORIS und SOLIS durch. Darüber hinaus werden Informationen aus weiteren nationalen<br />
und internationalen Datenbanken zu sozialwissenschaftlichen und/oder fachübergreifenden Themengebieten<br />
zusammengestellt.<br />
Informationstransfer von und nach Osteuropa<br />
Die Abteilung Informationstransfer in der GESIS-Servicestelle Osteuropa fördert die Ost-West-<br />
Kommunikation in den Sozialwissenschaften. Sie unterstützt die internationale Wissenschaftskooperation<br />
mit einer Vielzahl von Informationsdiensten.<br />
Eine wichtige Informationsquelle für Kontakte, Publikationen oder Forschung bietet in diesem<br />
Zusammenhang auch der Newsletter „Sozialwissenschaften in Osteuropa“, der viermal jährlich in<br />
englischer Sprache erscheint.
<strong>Sozialwissenschaftlicher</strong> <strong>Fachinformationsdienst</strong> - <strong>soFid</strong><br />
Regelmäßige Informationen zu neuer Literatur und aktueller sozialwissenschaftlicher Forschung<br />
bietet das IZ mit diesem Abonnementdienst, der sowohl in gedruckter Form als auch auf CD-ROM<br />
bezogen werden kann. Er ist vor allem konzipiert für diejenigen, die sich kontinuierlich und längerfristig<br />
zu einem Themenbereich informieren wollen.<br />
<strong>soFid</strong> ist zu folgenden Themenbereichen erhältlich:<br />
• Allgemeine Soziologie<br />
• Berufssoziologie<br />
• Bevölkerungsforschung<br />
• Bildungsforschung<br />
• Familienforschung<br />
• Frauen- und Geschlechterforschung<br />
• Freizeit - Sport - Tourismus<br />
• Gesellschaftlicher Wandel in den<br />
neuen Bundesländern<br />
• Gesundheitsforschung<br />
• Industrie- und Betriebssoziologie<br />
• Internationale Beziehungen +<br />
Friedens- und Konfliktforschung<br />
• Jugendforschung<br />
• Kommunikationswissenschaft:<br />
Massenkommunikation - Medien -<br />
Sprache<br />
sowiNet - Aktuelle Themen im Internet<br />
• Kriminalsoziologie + Rechtssoziologie<br />
• Kultursoziologie + Kunstsoziologie<br />
• Methoden und Instrumente der<br />
Sozialwissenschaften<br />
• Migration und ethnische Minderheiten<br />
• Organisations- und Verwaltungsfor-<br />
schung<br />
• Osteuropaforschung<br />
• Politische Soziologie<br />
• Religionsforschung<br />
• Soziale Probleme<br />
• Sozialpolitik<br />
• Sozialpsychologie<br />
• Stadt- und Regionalforschung<br />
• Umweltforschung<br />
• Wissenschafts- und Technikforschung<br />
Zu gesellschaftlich relevanten Themen in der aktuellen Diskussion werden in der Reihe sowiOnline<br />
Informationen über sozialwissenschaftliche Forschungsprojekte und Veröffentlichungen auf<br />
Basis der Datenbanken FORIS und SOLIS zusammengestellt. In der Reihe sowiPlus werden solche<br />
Informationen darüber hinaus mit Internetquellen unterschiedlichster Art (aktuelle Meldungen,<br />
Dokumente, Analysen, Hintergrundmaterialien u.a.m.) angereichert. Alle Themen sind zu finden<br />
unter www.gesis.org/Information/sowiNet.<br />
Forschungsübersichten<br />
Dokumentationen zu speziellen sozialwissenschaftlichen Themengebieten, Ergebnisberichte von<br />
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten des IZ, Tagungsberichte und State-of-the-art-Reports werden<br />
in unregelmäßigen Abständen in verschiedenen Reihen herausgegeben.
Internet-Service<br />
Die Institute der GESIS (Gesellschaft <strong>Sozialwissenschaftlicher</strong> Infrastruktureinrichtungen e.V.)<br />
IZ (Informationszentrum Sozialwissenschaften, Bonn)<br />
ZA (Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung an der Universität zu Köln) und<br />
ZUMA (Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen, Mannheim)<br />
bieten unter<br />
www.gesis.org<br />
gemeinsam Informationen zum gesamten Spektrum ihrer Infrastrukturleistungen sowie Zugang zu<br />
Informations- und Datenbeständen.<br />
Unter dem Menü-Punkt „Literatur- & Forschungsinformation“ bietet das IZ nicht nur Zugang<br />
zu einem Ausschnitt aus der Forschungsprojektdatenbank FORIS, sondern zu einer Reihe weiterer<br />
Datenbanken und Informationssammlungen:<br />
• Die Datenbank SOFO - sozialwissenschaftliche Forschungseinrichtungen - enthält Angaben<br />
zu universitären und außeruniversitären Instituten in der Bundesrepublik Deutschland in den<br />
Bereichen Soziologie, Politikwissenschaft, Psychologie, Erziehungswissenschaft, Kommunikationswissenschaft,<br />
Wirtschaftswissenschaft, Bevölkerungswissenschaft, Geschichtswissenschaft<br />
sowie Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Gesucht werden kann nach Namen(steilen),<br />
Fachgebiet, Ort, Bundesland sowie organisatorischer Zuordnung (Hochschule, außeruniversitäre<br />
Forschung oder öffentlicher Bereich).<br />
Neben Adressen, herausgegebenen Schriftenreihen u.ä. verweisen Hyperlinks ggf. auf die jeweiligen<br />
Homepages der Institutionen. Darüber hinaus gelangt man über einen weiteren Hyperlink<br />
zu allen Projektbeschreibungen eines Instituts, die in den letzten drei Jahren in die Forschungsdatenbank<br />
FORIS aufgenommen wurden (www.gesis.org/information/SOFO).<br />
• Die Datenbank INEastE - Social Science Research INstitutions in Eastern Europe - bietet<br />
Tätigkeitsprofile zu sozialwissenschaftlichen Einrichtungen in vierzehn osteuropäischen Ländern.<br />
Ähnlich wie in SOFO, können auch hier die Institutionen durchsucht werden nach Namensteilen,<br />
Ort, Land, Personal, Fachgebiet, Tätigkeitsschwerpunkt und organisatorischer Zuordnung.<br />
Die zumeist ausführlichen Institutsbeschreibungen in englischer Sprache sind durch<br />
weiterführende Hyperlinks zu den Institutionen ergänzt<br />
(www.gesis.org/Information/Osteuropa/INEastE).<br />
• Sozialwissenschaftliche Zeitschriften in Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen in<br />
einer weiteren Datenbank für Suchen zur Verfügung. Es handelt sich dabei um Fachzeitschriften,<br />
die vom IZ in Kooperation mit weiteren fachlich spezialisierten Einrichtungen regelmäßig<br />
für die Literaturdatenbank SOLIS gesichtet und ausgewertet werden. Standardinformationen<br />
sind Zeitschriftentitel, Herausgeber, Verlag und ISSN - Redaktionsadresse und URL zur Homepage<br />
der Zeitschrift werden sukzessive ergänzt. Immer vorhanden ist ein Link zur Datenbank<br />
SOLIS, der automatisch eine Recherche beim GBI-Host durchführt und die in SOLIS gespeicherten<br />
Titel der Aufsätze aus der betreffenden Zeitschrift kostenfrei anzeigt; weitere Informationen<br />
zu den Aufsätzen wie Autoren oder Abstracts können gegen Entgelt direkt angefordert<br />
werden. Die Datenbank befindet sich noch im Aufbau; eine alphabetische Liste aller<br />
ausgewerteten Zeitschriften aus den deutschsprachigen Ländern kann jedoch im PDF-Format<br />
abgerufen werden.
Zu sozialwissenschaftlichen Zeitschriften in Osteuropa liegen ausführliche Profile vor, die in<br />
alphabetischer Reihenfolge für die einzelnen Länder ebenfalls abrufbar sind. Der Zugang erfolgt<br />
über www.gesis.org/Information/Zeitschriften.<br />
Über weitere Menü-Hauptpunkte werden u.a. erreicht:<br />
• die Linksammlung SocioGuide, die - gegliedert nach Ländern und Sachgebieten - Zugang zu<br />
Internetangeboten in den Sozialwissenschaften bietet (www.gesis.org/SocioGuide) sowie<br />
• der GESIS-Tagungskalender (www.gesis.org/Veranstaltungen) mit Angaben zu Thema/ Inhalt,<br />
Termin, Ort, Land, Kontaktadresse bzw. weiterführenden Links zu nationalen und internationalen<br />
Tagungen und Kongressen in den Sozialwissenschaften sowie zu Veranstaltungen in und<br />
zu Osteuropa im Bereich der Transformationsforschung.<br />
Elektronischer Service des IZ<br />
Das IZ-Telegramm, das vierteljährlich über Neuigkeiten und Wissenswertes aus dem IZ berichtet<br />
sowie der Newsletter „Social Science in Eastern Europe“ können auch in elektronischer Version<br />
bezogen werden. Ein E-mail-Abonnement des IZ-Telegramms erhalten Sie über<br />
listserv@listserv.bonn.iz-soz.de; Textfeld: subscribe iz-telegramm IhrVorname IhrNachname<br />
Der Betreff bleibt leer, statt IhrVorname IhrNachname können Sie auch anonymous eingeben.<br />
Für den Newsletter gilt:<br />
listserv@listserv.bonn.iz-soz.de; Text im Betreff: subscribe oenews<br />
***<br />
Umfassende und aktuelle Informationen zum Gesamtangebot der Serviceleistungen des IZ inklusive<br />
Preise, Download- und Bestellmöglichkeiten finden Sie im Internet - alles auf einen Blick unter:<br />
www.gesis.org/IZ/IZ-uebersicht.htm<br />
GESIS - Gesellschaft <strong>Sozialwissenschaftlicher</strong> Infrastruktureinrichtungen e.V.<br />
Informationszentrum<br />
Sozialwissenschaften<br />
Abteilung Informationstransfer<br />
Lennéstraße 30 in der GESIS-Servicestelle Osteuropa<br />
53113 Bonn Schiffbauerdamm 19 • 10117 Berlin<br />
Deutschland Deutschland<br />
Tel.:+49 (0)228-2281-0 Tel.:+49 (0)30-23 36 11-0<br />
Fax:+49 (0)228-2281-120 Fax:+49 (0)30-23 36 11-310<br />
E-mail:iz@bonn.iz-soz.de E-mail:iz@berlin.iz-soz.de