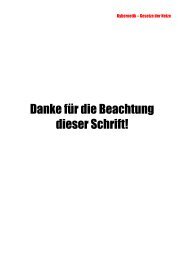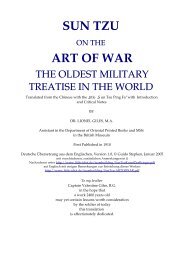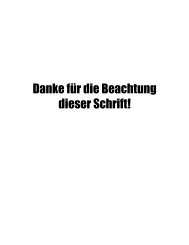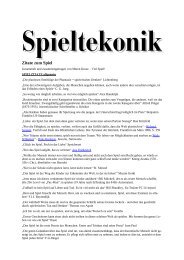Einführung in die Kybernetik - Little-Idiot.de
Einführung in die Kybernetik - Little-Idiot.de
Einführung in die Kybernetik - Little-Idiot.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
enützt, erzeugt man e<strong>in</strong> gedankliches „Bild“ von <strong>de</strong>m, was gewesen ist. Ke<strong>in</strong> Mensch weiß, wie es wirklich war.<br />
Innere Repräsentation von eigenen Erfahrungen, „mentalen Mo<strong>de</strong>llen“ jedoch lassen uns e<strong>in</strong> Bild <strong>de</strong>ssen, was wohl<br />
geschehen se<strong>in</strong> könnte, „errechnen“, basierend auf wenigen „Reizen“ (H<strong>in</strong>weisen, Informationen) nur. Das Gewesene<br />
ist durch <strong>die</strong> Beschreibung <strong>de</strong>r impliziten Handlungslogiken und <strong>de</strong>s situativen Kontextes alle<strong>in</strong> durch <strong>die</strong> Erzählungen<br />
an<strong>de</strong>rer Menschen aufgrund eigener mentaler Bil<strong>de</strong>r rekonstruierbar. Alle Darstellungen <strong>de</strong>r Vergangenheit s<strong>in</strong>d also<br />
genaugenommen Erf<strong>in</strong>dungen von Leuten, <strong>die</strong> über <strong>die</strong> Vergangenheit sprechen. Ebenso bil<strong>de</strong>n Fotos nicht <strong>die</strong><br />
Wirklichkeit ab. E<strong>in</strong> Witz: Picasso trift e<strong>in</strong>en Amerikaner. Während <strong>de</strong>s Gespräches zeigt <strong>de</strong>r Amerikaner Picasso e<strong>in</strong><br />
Foto se<strong>in</strong>er Frau: „Das ist me<strong>in</strong>e Frau!“, woraufh<strong>in</strong> Picasso antwortet: „Was, das ist ihre Frau, so kle<strong>in</strong> und so flach<br />
ist sie?“<br />
Was wir selber nicht erfahren haben, können wir geistig we<strong>de</strong>r verstehen, noch irgendwie nachvollziehen. Das ist z.B.<br />
so bei <strong>de</strong>r Sexualität. K<strong>in</strong><strong>de</strong>r können z.B. mit Beschreibungen davon re<strong>in</strong> garnichts damit anfangen, weil es nicht <strong>in</strong><br />
ihrem Erfahrungshorizont liegt. Je<strong>de</strong>r heranwachsen<strong>de</strong> Mensch muss sich selber an <strong>die</strong>ses Gebiet erst e<strong>in</strong>mal<br />
herantasten. Daher stehen z.B. Worte, wie „heiss“ und „nass“ <strong>in</strong> ke<strong>in</strong>em Lexikon. Egal, wie sehr und oft man sich<br />
bemüht, K<strong>in</strong>d zu erklären, dass es gefährlich ist, auf <strong>die</strong> heisse Herdplatte zu fassen – Patsch! Je<strong>de</strong>r Mensch muss das<br />
Gefühl selber mal s<strong>in</strong>nlich erfahren haben, sich selber e<strong>in</strong> „mentales Bild“ davon machen. Dies ist u.a. e<strong>in</strong> Grund dafür,<br />
dass <strong>die</strong> Menschheit nicht schlauer wird.<br />
Die Rolle <strong>de</strong>s Beobachters<br />
Die Ent<strong>de</strong>ckung <strong>de</strong>s Beobachters gilt als <strong>die</strong> zentrale, <strong>in</strong>tellektuelle Fasz<strong>in</strong>ation <strong>de</strong>s 20. Jhd. - durch <strong>die</strong>se Ent<strong>de</strong>ckung<br />
s<strong>in</strong>d <strong>die</strong> traditionelle Logik und <strong>die</strong> Wissenschaftstheorie <strong>in</strong>sbeson<strong>de</strong>re <strong>die</strong> Erkenntnisse <strong>de</strong>r Psychologie und <strong>de</strong>r<br />
Philosophie (Epistemologie) ernsthaft <strong>in</strong> Gefahr geraten. Das Experiment mit <strong>de</strong>m bl<strong>in</strong><strong>de</strong>n Fleck beweist: Bei allem,<br />
was man beobachtet, übersieht man immer auch etwas. Edmund Husserl hat <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er „phänomenologischen Theorie“<br />
<strong>de</strong>n Begriff <strong>de</strong>r „Abschattung“ geprägt, welcher auf <strong>de</strong>m Umstand beruht, dass e<strong>in</strong> Gegenstand aus unendlich vielen<br />
Perspektiven - möglichen Ordnungssystemen heraus - beschrieben wer<strong>de</strong>n kann. Küchengegenstän<strong>de</strong> kann man z.B.<br />
nach Länge, Grösse, Farbe, Gewicht, aber auch nach Funktion <strong>in</strong> <strong>de</strong>n Schubla<strong>de</strong>n und Schränken ordnen. Welches<br />
Ordnungssystem man dabei zugrun<strong>de</strong> legt, ist völlig egal, hauptsache man f<strong>in</strong><strong>de</strong> <strong>die</strong> D<strong>in</strong>ge zielsicher wie<strong>de</strong>r. Warum<br />
jedoch gibt es <strong>in</strong> je<strong>de</strong>r Küche e<strong>in</strong>e ähnliche Ordnung, e<strong>in</strong>e Art „Norm“? - Damit sich auch frem<strong>de</strong> Personen schnell<br />
dar<strong>in</strong> zurechtf<strong>in</strong><strong>de</strong>n. Dies ist <strong>de</strong>r Haupts<strong>in</strong>n von Ordnung, warum man K<strong>in</strong><strong>de</strong>r z.B. zur „Ordnung“ erzieht – Damit<br />
später am Arbeitsplatz <strong>die</strong> Urlaubsvertretung sich schnell zurechtf<strong>in</strong><strong>de</strong>t!<br />
Bei <strong>de</strong>m Phänomen <strong>de</strong>r Abschattung ver<strong>de</strong>ckt <strong>die</strong> jeweils e<strong>in</strong>genommene <strong>die</strong> an<strong>de</strong>ren möglichen Wahrnehmungsseiten<br />
<strong>de</strong>s Gegenstan<strong>de</strong>s. Dieser Umstand begrün<strong>de</strong>t <strong>die</strong> Mo<strong>de</strong>lltheorie. Sehen wir e<strong>in</strong> schwarzes Schaf von e<strong>in</strong>er Seite, so<br />
wür<strong>de</strong> Mensch erst e<strong>in</strong>mal sagen: „Schau mal, e<strong>in</strong> schwarzes Schaf!“. E<strong>in</strong> Mo<strong>de</strong>lltheoretiker jedoch wür<strong>de</strong> vermuten,<br />
dass es auf <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Seite durchaus „weiss“ se<strong>in</strong> könnte, und darüber h<strong>in</strong>aus noch nicht ausschliessen, dass sich<br />
dah<strong>in</strong>ter noch weitere Schafe verbergen.<br />
Obwohl wir somit nun nach Husserl nicht alle Seiten e<strong>in</strong>es Gegenstan<strong>de</strong>s sehen können, haben wir doch e<strong>in</strong><br />
Bewusstse<strong>in</strong> von e<strong>in</strong>em räumlichen Gegenstand. Dies gel<strong>in</strong>gt seltsamerweise nur <strong>de</strong>shalb, weil wir <strong>die</strong> nicht<br />
perspektivisch sichtbaren Seiten „Mitme<strong>in</strong>en“ bzw. „Mitbewußthaben“, wie Husserl sich ausdrückt. Die gegebene Seite<br />
verweist somit nur durch <strong>de</strong>n Charakter <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llhaftigkeit auf <strong>die</strong> nicht gegebenen Seiten. Wahrnehmung e<strong>in</strong>es<br />
D<strong>in</strong>ges wäre <strong>de</strong>mnach <strong>die</strong> Folge e<strong>in</strong>es „Verweisungszusammenhanges“. Innerhalb <strong>die</strong>ses<br />
„Verweisungszusammenhanges“ ist <strong>de</strong>r Gegenstand also selber nicht erlebt, eben durch <strong>die</strong> „Abschattung“, <strong>die</strong><br />
perspektivische E<strong>in</strong>schränkung – e<strong>in</strong>e Folge e<strong>in</strong>er Erfahrung und gleichzeitiger „Reduktion“ von Komplexität. Ohne<br />
Abschattung kann ke<strong>in</strong>e „Mo<strong>de</strong>llbildung“ erfolgen. Je<strong>de</strong>s Mo<strong>de</strong>ll ist zwangsläfig daher gleichermassen e<strong>in</strong>e<br />
unzulängliche, also unzulässige, als auch aber zw<strong>in</strong>gen<strong>de</strong> Notwendigkeit. Damit ist e<strong>in</strong> D<strong>in</strong>g tatsächlich immer<br />
verschie<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>m „phänomenologischen Erlebnis“, wie Husserl me<strong>in</strong>t, also niemals <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en begrenzten Bezügen<br />
gänzlich zu erfassen.<br />
Gera<strong>de</strong> <strong>die</strong>ses Zugeständnis an das „Nichtsehen“ bzw. „Nichterkennenkönnen“ ist aber <strong>die</strong> Voraussetzung allen<br />
„Sehens“: „Die Mo<strong>de</strong>llbildung“ beim Erkennen bereits e<strong>in</strong>iger weniger, charakteristischer „Merkmale“ (z.B. e<strong>in</strong><br />
„Smiley“). Daher lässt sich zwischen Beobachtungen 1. Ordnung, <strong>de</strong>r Beobachtung von Sachverhalten und<br />
„Beobachtungen 2. Ordnung“, also <strong>de</strong>r „Beobachtung <strong>de</strong>r Beobachtung“ (Sachverhalte s<strong>in</strong>d Sachverhalte nur für e<strong>in</strong>en<br />
Beobachter - <strong>die</strong>ser sieht nicht, was er nicht sieht und weiß nicht, was er nicht weiß) unterschei<strong>de</strong>n. Dazwischen liegt<br />
e<strong>in</strong> Interpretationsvorgang, welcher – genau genommen – Teil <strong>de</strong>s „Sehens“ ist.<br />
Es folgt daraus: E<strong>in</strong>e Beobachtung braucht e<strong>in</strong>en Beobachter und: Die Wahrnehmung <strong>de</strong>r Welt verlangt nach e<strong>in</strong>em<br />
Menschen, <strong>de</strong>r <strong>die</strong>se wahrnimmt, und welcher bereits e<strong>in</strong> Mo<strong>de</strong>ll (genauer Teilmo<strong>de</strong>ll) <strong>de</strong>ssen, was er sieht, mental<br />
vorliegen hat.<br />
Die Gedanken um <strong>die</strong> Beobachtung herum bil<strong>de</strong>n <strong>die</strong> Grundlage für <strong>die</strong> <strong>Kybernetik</strong> 2. Ordnung. Trennt <strong>die</strong> <strong>Kybernetik</strong><br />
1. Ordnung das Subjekt vom Objekt und spricht von e<strong>in</strong>er „beobachter - unabhängigen“ Welt, so ist <strong>die</strong> <strong>Kybernetik</strong> 2.<br />
Ordnung zirkulär: Man lernt sich als Teil e<strong>in</strong>es Mo<strong>de</strong>lls <strong>de</strong>r Welt zu verstehen, <strong>die</strong> man beobachten will. Man muß<br />
plötzlich für se<strong>in</strong>e eigenen Beobachtungen <strong>die</strong> Verantwortung übernehmen, wenn man sich darüber bewusst wird, dass<br />
man <strong>die</strong> Welt durch se<strong>in</strong>e Beobachtung (o<strong>de</strong>r alle<strong>in</strong> schon durch <strong>die</strong> Anwesendheit <strong>de</strong>r eigenen Person) verän<strong>de</strong>rt. Die<br />
Reflexion über S<strong>in</strong>n und Zweck <strong>de</strong>r Beobachtungen gew<strong>in</strong>nt e<strong>in</strong>e weitere Dimension: Man beg<strong>in</strong>nt sich darüber klar zu<br />
wer<strong>de</strong>n, warum man eigentlich etwas wissen o<strong>de</strong>r erfahren will. Der Ausdruck „<strong>Kybernetik</strong> 2. Ordnung“ signalisiert