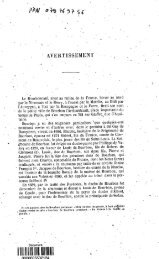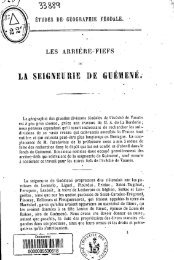Wirtschaftliche Beziehungen zwischen Nurnberg und Italien im ...
Wirtschaftliche Beziehungen zwischen Nurnberg und Italien im ...
Wirtschaftliche Beziehungen zwischen Nurnberg und Italien im ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1U.i4i ‚4O<br />
WIRTSCHAFTLICHE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN<br />
NÜRNBERG UND ITALIEN IM SPÄTMITTELALTER<br />
von Philippe Braunstein<br />
Man kann den wirtschaftlichen Aufschwung Nürnbergs zum Ende des<br />
Mittelalters nicht in Erinnerung bringen, ohne die Rolle ins Licht zu setzen, die<br />
die <strong>Beziehungen</strong> seiner Kaufleute <strong>und</strong> Handelsgesellschaften mit den italienischen<br />
Städten dabei gespielt haben. Soweit es die Einzelstudien bis jetzt gestatten,<br />
sind nur die Anfänge der Nürnberger Vermögen zu prüfen, um wahrzunehmen,<br />
daß das Gedeihen der Sozialgruppe, die die Reichsstadt regierte, auf<br />
den engen <strong>Beziehungen</strong> beruhte, welche Nürnberg mit den italienischen Märkten<br />
verband <strong>und</strong> in erster Linie mit Venedig. Der Zusammenhang <strong>zwischen</strong><br />
dem Anfang der italienischen Reisen der Nürnberger <strong>und</strong> ihrem ersten Reichstum<br />
ist frappant. Dieser Reichtum steigert sich während des ganzen 15. Jahrh<strong>und</strong>erts,<br />
während sich auf allen großen Plätzen die Anwesenheit der Nürnberger<br />
festigte.<br />
Der Versuch, den eigentlichen italienischen Sektor des Nürnberger Handels<br />
zu ermitteln, ist ein schwieriges Unterfangen, weil die Verbindungen <strong>zwischen</strong><br />
den von den Nürnbergern in <strong>Italien</strong> selbst geschlossenen Geschäften <strong>und</strong> denen<br />
auf anderen Gebieten ihrer Aktivität so eng sind. Andererseits bringen die<br />
venezianischen oder genuesischen Transaktionen der Handelsherren der Reichsstadt<br />
oft die Deutschen unter sich in Beziehung, ohne daß dabei <strong>Italien</strong> eine<br />
andere Rolle als die eines internationalen Marktes <strong>und</strong> eines Treffpunktes<br />
spielt. Es ist schließlich schwer den italienischen Handel der Nürnberger zu beschreiben,<br />
ohne versucht zu sein, den Ausgang der Geschäfte, die mit italienischen<br />
Erzeugnissen oder mit weither <strong>im</strong>portierten Waren getätigt worden sind, in<br />
Frankfurt/Main oder Krakau zu vermuten.<br />
Angesichts der Kompliziertheit <strong>und</strong> des Umfanges des Themas wollen wir<br />
be<strong>im</strong> gegenwärtigen Stand der Frage nichts besseres tun als eine Beschreibung<br />
auf der Basis von oft alten <strong>und</strong> zerstreuten Studien ) zu bringen <strong>und</strong>, soweit<br />
als möglich, den eigentlichen Nürnberger Aspekt der Geschäftsbeziehungen<br />
<strong>zwischen</strong> Oberdeutschland <strong>und</strong> <strong>Italien</strong> am Ende des Mittelalters darzustellen.<br />
Die zeitgenössischen Zeugnisse verkünden um die Wette das Gedeihen der<br />
in einer unfruchtbaren Gegend erbauten Stadt, die der Schwerpunkt des Reiches<br />
wird, <strong>und</strong> geben für diese Prosperität 3 Gründe an: die geographische Lage<br />
Nürnbergs, seinen industriellen Schwung <strong>und</strong> die Privilegien, die sie auf<br />
Gegenseitigkeit den ausländischen Kaufleuten zu gewähren verstanden hat.<br />
) Wegen des vollständi gen Titels der in den Anmerkungen abgekürzt verzeichneten Werke<br />
wird auf die Literaturübersicht verwiesen; besonders wegen der Werke von A. Schulte,<br />
H. S<strong>im</strong>onsfeld <strong>und</strong> G. M. Thomas, zitiert: A. Schulte, Handel <strong>und</strong> Verkehr... ; H. S<strong>im</strong>onsfeld,<br />
Fondaco ... ; G. M. Thomas, Capitolare...<br />
I III<br />
ID,>cur„e,t<br />
II ii1 II III<br />
0000005727025<br />
377
Der erste dieser Gründe ist sicherlich überzeugend: in den Schnittpunkt der<br />
großen Handelsachsen <strong>zwischen</strong> Ost <strong>und</strong> West gestellt, <strong>zwischen</strong> Ostsee <strong>und</strong><br />
dem Mittelländischen Meer, ist Nürnberg bei gleicher Entfernung von Wien,<br />
Hamburg, Brügge, Genf <strong>und</strong> Venedig <strong>im</strong> Mittelpunkt eines regelmäßigen Sechseckes.<br />
So konnte es sich die Funktion als Verteilungsmittelpunkt <strong>zwischen</strong> den<br />
verschiedenen Wirtschaftsgebieten sichern. Als ein vereinfachtes Schema, das für<br />
andere Städte Oberdeutschlands gültig wäre, wenn es alles erklärte, ließe sich<br />
feststellen: die Nürnberger Kaufleute verkauften in <strong>Italien</strong> die Metalle Mitteleuropas<br />
<strong>und</strong> führten die in <strong>Italien</strong> gekauften Gewürze <strong>und</strong> Luxusartikel ein,<br />
deren Nachfrage sich nicht auf die süddeutsche Abnehmerschaft beschränkte,<br />
sondern der Entwicklung des Reichtums <strong>und</strong> dem Lebensstandard <strong>im</strong> ganzen<br />
mittleren <strong>und</strong> nordischen Europa entsprach. Nürnberg hatte mit bezug auf<br />
andere Städte den Trumpf seiner relativen Nähe an die Erzgrubenzentren <strong>und</strong><br />
der sich ausweitenden Märkte Böhmens <strong>und</strong> Polens.<br />
Der zweite angegebene Gr<strong>und</strong>, der industrielle Schwung, stärkt den ersten:<br />
Nürnberg verdankt seinem zahlreichen, spezialisierten Handwerk <strong>und</strong> dessen<br />
mechanischer Ausstattung einen Ruf, der über die Grenzen hinausging. Die<br />
Handwerker der Stadt verstanden sich auf die Metallbearbeitung <strong>und</strong> zwar der<br />
gängisten bis zu den kostbarsten. Die Nachfrage danach in Südeuropa bis zum<br />
Mittleren Orient sicherte ersprießlichen <strong>und</strong> konstanten Absatz. In dieser Hinsicht<br />
muß man die Rolle, die der Rat der Stadt wegen der Entwicklung <strong>und</strong> des<br />
Schutzes der Nürnberger Industrie spielte, betonen. Nicht nur, daß er die Produktionsbedingungen<br />
bis in die kleinsten technischen Einzelheiten vorschrieb,<br />
sondern, wenn es die Verhältnisse mit sich brachten, sorgte er dafür, daß die<br />
Werkstätten reichlich mit Rohstoffen beliefert wurden. Er überwachte die<br />
Qualität durch einen Aufsichtsdienst, der die Stadt <strong>und</strong> nicht die Zünfte vertrat.<br />
So kam es, daß die großen Kaufherren, die seit Mitte des 14. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
mit fester Hand das politische <strong>und</strong> wirtschaftliche Geschick der Reichsstadt<br />
führten, es verstanden haben, die örtlichen Bedürfnisse den Bedingungen<br />
des internationalen Marktes anzupassen.<br />
Dritter Gr<strong>und</strong> des Nürnberger Aufschwunges waren die Privilegien, die<br />
sich Nürnberg in zahlreichen Städten auf Gegenseitigkeit zusprechen ließ. Die<br />
kaierliche Macht erweiterte das Feld der Nürnberger Freiheiten auf die meisten<br />
deutschen Reichsstädte. Man kann auch bei den Nürnberger Polizeiverordnungen<br />
2) die Entwicklung zur juristischen Gleichberechtigung des Ausländers<br />
mit den Bürgern der Stadt verfolgen, besonders von der 2. Hälfte des 15. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
ab, wo die Aufenthaltsgenehmigung „bis auf unser Absagen « gilt<br />
<strong>und</strong> das Kommissionsgeschäft ausdrücklich genehmigt ist.<br />
Diese liberale Politik war in Nürnberg nicht, wie in anderen Städten, durch<br />
die Widerstände der Handwerke oder durch die Abhängigkeit von der zentralen<br />
Macht gehemmt.<br />
Unter den Richtungen, die der Nürnberger Handel n<strong>im</strong>mt, ist gleich zu<br />
Anfang des 14. Jahrh<strong>und</strong>erts <strong>Italien</strong> ein wesentliches Ziel. Wir werden sehen,<br />
wie die Situation von Nürnberg <strong>und</strong> seine örtlichen Tätigkeiten ein Auf-<br />
2) J. Baader, Nürnberger Polizeiordnungen (XII.—XV. Jrhdt.), Bibliothek des Literarisdicn<br />
Vereins, Bd. 63, Stuttgart, 1861.<br />
378
lühen seiner Geschäftsbeziehungen mit den italienischen Städten begünstigen.<br />
Wir bemerken aber gleich von Anfang an das Fehlen von Venedig, Mailand,<br />
Florenz auf der Liste der ausländischen Städte, die reziproke Zoll- <strong>und</strong> Handelsfreiheit<br />
konzedieren. Mit den italienischen Städten rissen die Verhandlungen<br />
wegen des algemeinen Handelsverkehrs nicht ab, die Abmachungen wurden<br />
oft revidiert. So aufmerksam auch der Rat das Interesse seiner Bürger verfolgte,<br />
mußte es sich doch oft den anspruchsvollen Bedingungen der <strong>Italien</strong>er<br />
beugen, die die Deutchen <strong>und</strong> insbesondere die Nürnberger in die Lage von Bittstellern<br />
drängten.<br />
1. Vor der Schilderung der Tätigkeit der Nürnberger in <strong>Italien</strong> ist es<br />
wichtig, die Frage des italienischen Handels in Deutschland zu stellen. Die Anwesenheit<br />
der <strong>Italien</strong>er in den Ländern nördlich der Alpen ist gleich von allem<br />
Anfang an mit ihrer technischen Überlegenheit in den Geldgeschäften verb<strong>und</strong>en<br />
gewesen, ob es sich um Darlehen auf Pfänder seitens der Lombarden handelte<br />
oder um einen anderen Maßstab, um die Übermittlun g apostolischer<br />
R<strong>im</strong>essen, um die Schaffung von Münzanstalten oder um die Leitung öffentlicher<br />
Dienststellen wie der Zölle'). Obgleich zahlreiche Quellen auf die Anwesenheit<br />
italienischer Kaufleute in Deutschland <strong>im</strong> Lauf des Mittelalters)<br />
schließen lassen, überrascht es auf dem Gebiet des Handels doch, daß die<br />
italienischen Handelsbücher nicht einmal die Usanzen oder den Kurs der Gelder<br />
auf den deutschen Plätzen erwähnen.<br />
In Nürnberg selbst kann man die Abwesenheit von <strong>Italien</strong>ern in den von<br />
der Stadt abgeschlossenen Mietverträgen als ein Zeichen der Vitalität des lokalen<br />
Patriziats betrachten. Doch kann man einige Fälle venezianischer Kaufleute<br />
zitieren, die Jacientes viarn Alemanic bei Nürnberg ausgeraubt wurden<br />
6) Aber es bleibt, daß keine große italienische Gesellschaft einen Sitz<br />
in der Reichsstadt vor Ende des 15. Jahrh<strong>und</strong>erts errichtete. <strong>Italien</strong>ische Kaufleute<br />
<strong>und</strong> Nürnberger trafen sich in Deutschland nur auf den Messen in Frankfurt<br />
oder in Leipzig: die Nürnberger Messen zogen trotz ihres Glanzes die Ita-<br />
3) Wegen der Tätigkeit der <strong>Italien</strong>er in Deutsdiland vgl. A. Schulte, Handel <strong>und</strong> Verkehr<br />
. . .1, S. 289-335; über die Lombarden siehe z. B. H. von Voltelini, Die ältesten<br />
Pfandleihbanken <strong>und</strong> Lombardenprivilegien Tirols. Beiträge zur Rechtsgeschichte Tirol,.<br />
„Festschrift vom Ortsausschuß des 27. deutschen Juristentages « , Innsbruck, 1904; über die<br />
Rolle der <strong>Italien</strong>er bei der Transferierung der päpstlichen Gelder an die Kurie vgl.<br />
Kirsch, Die päpstlichen Kollektorien in Deutschland während des 14. Jahrh<strong>und</strong>erts.<br />
Quellen <strong>und</strong> Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte, hrsg. v. d. Görrcsgescllsdsaft,<br />
Bd. 3, Paderborn 1894; H. Hoberg, Taxae episcopacuum er abbatiarum pro scrvitiis<br />
communis solvendis. Ex libris nbligationum ab anno 1295 usque ad annum 1455 confectis,<br />
Pubblicazioni della Biblioteca Apostolica Vaticana, Studi e Testi 144, Rome 1949;<br />
über die <strong>Italien</strong>er in der Verwaltung von Zöllen <strong>und</strong> Münze <strong>im</strong> Deutschen Reich vgl.<br />
einen neuen Artikel von A. M. Nada Patrone, Uomini d'affari fiorentini in Tirolo nei<br />
secoli XIII e XIV, Archivio Storico Italiano, a. CXXXI, 1963.<br />
4) Warendiebstahl zum Schaden der Venezianer in Lindau 1309, in Basel 1348; Brief des<br />
Dogen A. Dandolo an Kaiser Ludwig den Bayern von 1346 mit der Bitte um Schutz für<br />
die Vencdigcr Kaufleute in Deutschland (H. S<strong>im</strong>onsfeld, Fondaco ... 1, Nr. 30, 32, 119,<br />
133); den Mailändern erteilte Geleitsprivilegien der Kaiser <strong>und</strong> deutscher Herren (A.<br />
Schulte, Handel <strong>und</strong> Verkehr. . .11, Nr. 1, 2, 3, 7, 9, 17, 21 ...<br />
5) fällt aus.<br />
6) H. S<strong>im</strong>onsfeld, Fondaco . . . 1, Nr. 121 (1346).<br />
379
liener niemals so sehr wie die rheinischen <strong>und</strong> flämischen Märkte wo die italienischen<br />
Gesellschaften ihre Niederlassungen haben oder, wie ab Beginn des<br />
16. Jahrh<strong>und</strong>erts, die Städte des europäischen Ostens, wohin sich die florentinischen<br />
Kaufleute in persona begaben. Zwar beginnt mit dem 16. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
eine neue Periode für die italienischen Unternehmen in Deutschland: die<br />
Medici gründen eine Nürnberger Filiale <strong>und</strong> man kennt die Namen <strong>und</strong> die<br />
Tätigkeiten der sich an der Pegnitz niederlassenden Kaufleute. Die Größe der<br />
Odescalchi, der Toresani, der Viatis, allein genügt schon, daß sie der Vergessenheit,<br />
in die ihre Landsleute gefallen sind, entgehen; sie sind die ersten<br />
<strong>Italien</strong>er, die sich dauernd in der Stadt niederlassen, durch die ihre Väter nur<br />
durchreisten. Wenn man ins 15. Jahrh<strong>und</strong>ert zurückgeht, werden die Erwähnungen<br />
<strong>im</strong>mer rarer: anno 1483 stirbt ein Kaufmann aus Pavia in Nürnberg<br />
<strong>und</strong> sein Sohn holt seine Erbschraft 7). Dies ist ein Vorfall, wie man<br />
noch andere zitieren könnte. Die dauerhafte Niederlassung von <strong>Italien</strong>ern<br />
wurde durch die Steuerliste von 1400 ) bezeugt: drei <strong>Italien</strong>er, Marco, Nardo<br />
<strong>und</strong> Juliano wohnen auf der Sebalder Seite; aber nichts beweist, daß sie Kaufleute<br />
oder Wechsler sind.<br />
Nach den bekannten Dokumenten ist es also berechtigt zuzugeben, daß die<br />
Handelsbeziehungen <strong>zwischen</strong> den Nürnbergern <strong>und</strong> <strong>Italien</strong>ern <strong>Italien</strong> als<br />
wesentliches Wirkungsfeld gehabt haben.<br />
Gleich zur Zeit der Hohenstaufen hatten die Römerzüge der deutschen<br />
Könige, die italienischen Gesandtschaften bei den kaiserlichen Reichstagen<br />
häufig politische <strong>Beziehungen</strong> <strong>zwischen</strong> dem Imperium <strong>und</strong> den Städten <strong>Italien</strong>s<br />
hergestellt. Sie nahmen alsbald genaue Formen auf dem wirtschaft!. Gebiet an.<br />
Friedrich I. gewährte 1178 den venezianischen Handelsleuten die Handelsfreiheit<br />
<strong>im</strong> Reich. Hohe Beamte <strong>und</strong> Bürger der süddeutschen Städte bekamen<br />
den ersten Kontakt mit einer fortgeschritteneren Handelswirtschaft als diejenige,<br />
die sie kannten 9). Zu Beginn des 13. Jahrh<strong>und</strong>erts hatten die Geschäftsbeziehungen<br />
<strong>zwischen</strong> Oberdeutschland <strong>und</strong> <strong>Italien</strong> entscheidende Formen angenommen,<br />
wie dies die ersten bekannten Dokumente über den Fondaco dei<br />
Tedeschi ausweisen 10).<br />
7) A. Schulte, Handel <strong>und</strong> Verkehr - . . II, Nr. 111.<br />
8) W. Biebinger <strong>und</strong> W. Ncukam, Quellen zur Handelsgeschichte der Stadt Nürnberg seit<br />
1400, Veröffentlichungen der Gesellschaft für fränkische Geschichte, X. Reihe, 2. Band,<br />
I. Lieferung, Erlangen 1934.<br />
9) Von dieser Epoche an wird dagegen der deutsche Vorsprung auf dem Gebiet der Minentechnik<br />
in den italienischen Alpen anerkannt. Vgl. das Statut von 1189 der Silberminen<br />
von Calisio, deren Belehnung von Kaiser Friedrich 1. dem Bischof von Trient zugestanden<br />
wurde; Veröffentlichung von B. Bonelli, Notizic istoricocritiche intorno al B. M.<br />
Adclpreto Vescovo di Trcnto, Trento 1781, S. 492 <strong>und</strong> folgende; Analyse von G. B.<br />
Trener, Le antiche miniere di Trento, Societä degli Alpinisti Trentini, T. XX, 1896-<br />
1898.<br />
10) G. B. Milesio, Archivar des Fondaco dci Tedeschi zu Beginn des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts, behauptete,<br />
der Fondaco wäre vor 1200 errichtet worden. Das älteste bekannte Dokument,<br />
das den Fondaco erwähnt, stammt vom 5. Dezember 1228. Die Privatarchive der Familie<br />
Zusto in Venedig, die viele Gr<strong>und</strong>stücke um den Fondaco herum besaß, können einen Beitrag<br />
zur Kenntnis des ersten Gebäudes leisten. Im Jahr 1252 spricht man noch ohne genauere<br />
Angaben vom „Fonticum Comuni Venecie. Die Bezeichnung Fontego dei Tedeschi"<br />
erscheint 1268 Archivo privato Zusto, Fondo Lazara Pisani Zusto, Perg., Busra 3).<br />
380
(o<br />
otN<br />
Lee<br />
Bekanntlich hat sich der deutsche Handel in <strong>Italien</strong> zunächst auf die <strong>im</strong>'\<br />
Norden der Apenninen liegenden Städe konzentriert. Die geographische Lage<br />
spielt dabei eine ausschlaggebende Rolle, aber vor allem das Vorhandensein von<br />
2 Anziehungspolen, Venedig auf der einen Seite, das Mailändische <strong>und</strong> Genua<br />
auf der anderen. In Venedig sind die Nürnberger nicht die ersten gewesen.<br />
Vor ihnen haben die Kaufleute aus den Donaustädten, von Augsburg <strong>und</strong> vor<br />
allem von Regensburg die Wege gebahnt, welche sie auszunützen verstanden.<br />
Aber in der 2. Hälfte des 14. Jahrh<strong>und</strong>erts übertrifft Nürnberg die von Regensburg<br />
eingenommene Stellung <strong>und</strong> ein langer Streit entspinnt sich <strong>zwischen</strong><br />
den beiden Städten über den Vorrang ihrer Kaufleute <strong>im</strong> venezianischen Fondaco<br />
11). Während des ganzen 15. Jahrh<strong>und</strong>erts halten die Nürnberger ihre<br />
führende Rolle <strong>im</strong> Wirtschaftsleben von Venedig aufrecht.<br />
Es ging aber nicht ebenso in Mailand, Como, Genua, wo sie weniger kräftig<br />
auftraten als die Schwaben <strong>und</strong> sich erst in der 2. Hälfte des 15. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
nach den Vorläufern des 14. Jahrh<strong>und</strong>erts behaupteten. Zwei Tätigkeitsbereiche,<br />
zwei Verbindungsnetze, zwei Arten des Handels die nicht dieselben Familien<strong>und</strong><br />
Gesellschaftsgruppen interessieren.<br />
Die <strong>Beziehungen</strong> Nürnbergs mit Venedig erzwingen zunächst unsere Aufmerksamkeit<br />
aufgr<strong>und</strong> ihres Ursprungs <strong>und</strong> ihrer Dauer.<br />
Die Geschäfte hatten als zwangsläufige Rahmen den Fondaco dci Tedeschi,<br />
der am Canale Grande, gegenüber dem Rialto lag <strong>und</strong> Eigentum des alle seine<br />
Tätigkeiten lenkenden Staate von Venedig war. Das Gebäude, seit seiner<br />
Zweckbest<strong>im</strong>mung mehrmals umgebaut, hatte nur 56 Z<strong>im</strong>mer <strong>und</strong> die Deutschen<br />
führten oft Beschwerde wegen des Platzmangels. Die Signoria verletzte<br />
ihre eigenen Gesetze zum Nachteil der Gleichheit unter allen Deutschen, indem<br />
sie zum doppelten Satz die auf ein Jahr verlängerte Miete gewährte, <strong>im</strong> Fall<br />
zahlreicher Nürnberger sogar auf Generationen. Die Kaufleute fanden sich<br />
schlecht <strong>und</strong> recht mit den sie einengenden Vorschriften, die ihnen aufoktroyiert<br />
wurden, ab: Zwangswohnaufenthalt; die Verpflichtung über einen „Sensal",<br />
einen Makler, der '12% Provision auf die Geschäfte kassierte, zu kaufen <strong>und</strong> zu<br />
verkaufen; verbotener Verkauf an Nichtvenezianer; Verpflichtung am Ort die<br />
bei den Verkäufen erzielten Erlöse in venezianischen oder orientalischen Erzeugnissen<br />
anzulegen.<br />
So drakonisch auch die Gesetzgebung hinsichtlich des deutschen Handels in<br />
Venedig scheinen mag, braucht man sich doch nicht vorstellen, daß die Politik<br />
der Signoria in diesen extremen Formulierungen unverrückbar gewesen wäre.<br />
Die <strong>Beziehungen</strong> Venedigs mit den deutschen Städten, insbesondere Nürnberg,<br />
beruhen auf einem dauernden Spiel von Spannungen: die Notwendigkeiten des<br />
Marktes <strong>und</strong> die Fluktuation von Angebot <strong>und</strong> Nachfrage wandeln die zuerst<br />
definierten Regeln so oft wie es nützlich erscheint. Man kann sich an einem<br />
Beispiel ein Urteil über den venezianischen Realismus machen, indem man die<br />
den Deutschen in der ersten Hälfte des 14. Jahrh<strong>und</strong>erts gemachten Konzessionen<br />
bei der steuerlichen Veranlagung von Gold verfolgt, das für Nürnberg<br />
von besonderem Interesse war. Ein Urteil des Maggior Consiglio von 1277<br />
nötigte die Deutschen zur Zahlung von 5% auf alle geprägten Geldarten, die<br />
1) H. S<strong>im</strong>onsfekl, Fondaco ... 11, S. 86-87.<br />
381
sie nach Venedig brachten. Diese Best<strong>im</strong>mung wurde 1332 widerrufen. In Notzeiten<br />
läßt man Geld unbehindert herein. Im Jahre 1337 n<strong>im</strong>mt ein Gesetz die<br />
Entscheidung von 1332 zurück. Auf einen Brief des Kaisers gestützt verlangt<br />
die Stadt Nürnberg dann in Venedig die Ermäßigung der Steuer auf gemünztes<br />
Geld auf den Satz, der auf Silber in Barren eingehoben wird. Im Jahre 1355<br />
wird den Deutschen Genugtuung").<br />
Man muß auch zahllosen „per gratiam" zuerkannten Ausnahmen erwähnen<br />
<strong>und</strong> die Nachsicht der Richter in den Prozessen, die Nürnberger gegen Venezianer<br />
anstrengten. Der Senat, der mit gutem Recht den Fondaco dei Tedeschi<br />
als die beste Einnahme des venezianischen Staates betrachtet 13), bemüht sich,<br />
den Ansprüchen der Deutschen, sooft als sein guter Wille nicht gegen seine<br />
eigenen Interessen verstieß, Gehör zu schenken. Den Deutschen war übrigens<br />
vollauf bewußt, welche Rolle sie in der Wirtschaft Venedigs spielten: der<br />
Fondaco dei Tedeschi erspart der Lagunerstadt das Vertuschen unter dem<br />
Zustrom von Waren die am Kai ankamen 14). So erklären sie die <strong>Beziehungen</strong><br />
der Stärke <strong>und</strong> der Achtung <strong>zwischen</strong> den Partnern, die wußten, daß der<br />
eine nicht ohne den andern sein kann. Die Versuche Genuas oder Mailands<br />
den Strom, der die Nürnberger nach Venedig zog, zu ihren Gunsten abzulenken<br />
oder zu verlangsamen, schlugen <strong>im</strong>mer fehl, trotz der politischen Unterstützungen,<br />
die ihre Pläne eine Zeit lang begünstigten").<br />
Wie Venedig, war Mailand, Drehscheibe Norditaliens, gleichzeitig Industriehauptstadt<br />
<strong>und</strong> ein Zentrum internationalen Handels, aber während<br />
Venedig den Ausländern eifersüchtig seine Seepforten verbot, spielte Mailand<br />
die Rolle eines Durchgangsplatzes, der nach dem Po <strong>und</strong> vor allem nach<br />
Genua, seinem natürlichen Hafen, <strong>und</strong> Süditalien weit geöffnet war. Die Schutzzollpolitik<br />
der Visconri <strong>und</strong> der Sforza war doch niemals prohibitiv. Da die<br />
Deutschen in allen Städten wie Mailänder behandelt wurden, konnten sie sich<br />
frei bewegen. Mailand hatte dadurch gewonnenes Spiel, seinen Liberalismus<br />
der engstirnigen Reglementierung Venedigs entgegenzusetzen, wo die Deutschen<br />
„in fontigo tamquam captivi" in einem Käfig wie Tiere (an<strong>im</strong>alia<br />
brutta) 16) gehalten wurden, Die Anwesenheit der Nürnberger ist bezeugt in<br />
Pavia, in Como, vor allem in Mailand, wo ein „deutsches Viertel" bei der<br />
Porta Romana existierte.<br />
Es waren die Deutschen selbst, die vom Herzog Filippo Maria die Schaffung<br />
eines Fondaco in Mailand erbaten, der die Vorteile eines Zollspeichers gehabt<br />
hätte, ohne die Unannehmlichkeit eines erzwungenen Wohnaufenthalts aufzu-<br />
12) G. M. Thomas, Capitolare . . . cap. 72; H. S<strong>im</strong>onsfeld, Fondaco.. . II, S.34; 1, Nr.91<br />
<strong>und</strong> 97.<br />
13) G. M. Thomas, Capitolare ... cap. 277 „Cognossendo ei Fontego di Tedeschi esser<br />
opt<strong>im</strong>o membro di questa Zita . . ."(1445).<br />
14) H. S<strong>im</strong>onsfcld, Fondaco... T, Nr. 300:.. . Hab<strong>und</strong>ando mercaiiones a via maris, ut fit,<br />
et non habendo exitus solitos de portendo ipsas ad alias partei nisi quasi viam fontici<br />
so/am . . . (Ardiivio di Stato Venezia, Senato, Misil 48, fol. 148; 18. Juni 1410).<br />
15) Über die italienische Politik des Kaisers Sigism<strong>und</strong> <strong>und</strong> den Versuch der wirtschaftlichen<br />
Sperre von Venedig vgl. H. S<strong>im</strong>onsfeld, Fondsco... 11, S. 74 <strong>und</strong> 1, Nr. 319, 335, 350,<br />
359; A. Schulte, Handel <strong>und</strong> Verkehr.. .1, S. 511-520; J . F. Roth, Geschichte des Nürnberger<br />
Handels ... 1, S. 51 <strong>und</strong> folgende; 0. Schiff, Kaiser Sigism<strong>und</strong>s italienische Politik<br />
bis zur Romfahrt (1410-1431), Frankfurter Historische Forschungen 1, 1909.<br />
16) A. Schulte, Handel <strong>und</strong> Verkehr . . . II, Nr. 381 (1419).<br />
382
wiesen. Der Plan, auf Betreibung der Fugger <strong>und</strong> von Heinrich <strong>und</strong> Georg Fütterer<br />
von Nürnberg 17), wieder unter dem Herzog Galeazzo Maria 1472 aufgegriffen,<br />
blieb, wie es scheint, ein toter Buchstabe, aber er beweist, daß das<br />
venezianische Beispiel <strong>im</strong> Gedankenkreis der Mailänder spukt. Alle Verhandlungen<br />
mit den Deutschen stellen mehr oder weniger ausdrücklich eine Parallele<br />
mit den Bedingungen des Handels in Venedig her, <strong>und</strong> die zur Zeit der<br />
Handelssperre durch Kaiser Sigism<strong>und</strong> ausgearbeiteten Verträge sind hierfür<br />
bezeichnend. Der seit 1419 diskutierte Privilcgiumsplan hatte einen eminent<br />
politischen Charakter") <strong>und</strong> sagte in denselben Ausdrücken das Gegenteil der<br />
venezianischen Maßnahmen: Verkaufsermächtigung zu jeder Zeit <strong>und</strong> zum<br />
gewollten Preis, ohne die Nötigung die einkassierten Gelder in Mailand wieder<br />
zu investieren. Es war vor allem den Deutschen möglich auf genuesischen<br />
Schiffen <strong>im</strong> ganzen Mittelmeer selbst oder über eingeschaltete Personen Handel<br />
zu treiben.<br />
Die Nürnberger, die die hartnäckigsten Gegner eines Bruches mit Venedig 19)<br />
waren, wurden aufmerksame Gesprächspartner, aber viel zurückhaltender als<br />
die Vertreter der schwäbischen Städte.<br />
Es ist auf Veranlassung Nürnbergs wahrscheinlich, daß sich die deutschen<br />
Kaufleute noch mehr konzedieren ließen, als man ihnen vorgeschlagen hatte.<br />
Das von Herzog Filippo Maria 1422 gewährte Privileg wurde durch seine<br />
Nachfolger <strong>im</strong> Laufe des 15. Jahrh<strong>und</strong>erts erneuert. Die Transitprivilegien für<br />
den Verkehr „a partibus inferioribus ad partes ultrarnonanas", bekannt unter<br />
dem Namen von „provisiones Janue" <strong>und</strong> von 1346 datierend, hatten eine all -<br />
gemeine Reichweite. Alle Zollsätze wurden 1469 ohne Anderung bestätigt,<br />
wenigstens für die schweren Waren.<br />
Aber der „Liber Datie" zeigt, daß die Deutschen <strong>im</strong> Mailändischen<br />
besondere Bedingungen genossen, die sie von allen anderen Kaufleuten unterschieden.<br />
20)<br />
Die Wirtschaftspolitik Mailands trennt sich schwer von den Bedingungen<br />
des genuesischen Handels, weil Genua der natürliche Hafen Mailands ist <strong>und</strong><br />
die wichtigsten den Deutschen konzedierte Privilegien waren diejenigen, die<br />
unter der Herrschaft Genuas von den Herzögen von Mailand <strong>zwischen</strong> 1420<br />
<strong>und</strong> 1470 erteilt wurden. In Genua, wo die Interessen der Nürnberger von<br />
denselben Gesellschaften wie <strong>im</strong> Mailändischen vertreten werden, ist es die<br />
den außeritalienischen Unternehmen günstige Lage, noch mehr als der Aufschwung<br />
auf dem Gebiet der Industrie, der Textilien <strong>und</strong> der Waffenschmiede,<br />
die die Deutschen anzieht. Wenn Ulman Stromer am Ende des 14. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
die Handelsusancen Genuas aufzeichnet, so ist es, weil Genua der Verlade-<br />
17) A. Schulte, Handel <strong>und</strong> Verkehr . . . II, Nr. 103 <strong>und</strong> 104.<br />
18) A. Schulte, Handel <strong>und</strong> Verkehr . . .11, Nr. 195: Antwort des Maestro delle Entrate<br />
von Mai]and auf die Frage nach genauen Angaben über die Anwendung des Zollprivilegs,<br />
die von Como eingegangen sind: ... pacta facra cum Theutonicis juerunt facta<br />
sorum st iter mercatorum Theutonicorum qui ire consueverant Venicias pro mercibus<br />
emendis et venendis diverteretur ... (1424, Dezember 14).<br />
19) H. Sirnonsfeld, Fondaco... 1, Nr. 319, 336, 350.<br />
20) A. Schulte, Handel <strong>und</strong> Verkehr.. .1, S. 560-561 <strong>und</strong> 11, Nr. 191; der Liber Datii<br />
Mercantie Coinunis Mediolani ist 1950 von A. Noro publiziert worden. Vgl. die Literaturübcrsichr.<br />
383
hafen nach Spanien ist; er mißt nur insoweit den genuesischen Zollbedingungen<br />
Bedeutung bei, als sie den Transithandel betreffen, Die Tendenz bestätigt sich<br />
gegen Ende des 15. Jahrh<strong>und</strong>erts, als der Kapitalismus in Oberdeutschland<br />
europäisch wird <strong>und</strong> Anlauf in bezug auf Venedig n<strong>im</strong>mt. Die Imhof <strong>und</strong> die<br />
Rummel, schon in Mailand ansäßig, gründen anfangs des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
Filialen in Genua, die ihnen für ihre transmarit<strong>im</strong>erl Geschäfte nach Süditalien<br />
<strong>und</strong> Katalonien unentbehrlich sind. In einer Stadt, wo die Staatsinstitutionen<br />
nicht wie in Venedig, die Käufe <strong>und</strong> Verkäufe reglementierten, hatten<br />
die Deutschen ebenso wie die Katalanier erreicht, durch die Errichtung eines<br />
Konsulats") gegen die extreme Freiheit der Transaktionen geschützt zu werden.<br />
Die Interventionen des von der Gemeinschaft der Kaufleute gewählten Konsuls<br />
beweist, daß eine große Anzahl Deutscher in Genua wohnhaft wie in<br />
Venedig <strong>und</strong> Mailand ansäßig war. Die Sonderstellung dieser Gemeinschaft<br />
tritt zu Tage bei den wie in Mailand gemachten vorteilhaften Bedingungen be<strong>im</strong><br />
Transitverkehr <strong>zwischen</strong> den Alpen <strong>und</strong> Katalonien; z. B. berührt die Zollerhöhung<br />
<strong>im</strong> Jahre 1425 nicht den deutschen Handel 22). Man kennt das Schicksal<br />
nicht, das Genua dem Antrag der deutschen Städte bereitete, die <strong>im</strong> Jahre<br />
1447 23) wünschten, die Begünstigungen deren sie für Catalonien teilhaftig<br />
waren, auf andere Strömungen <strong>und</strong> Austauschrichtungen ausgedehnt zu sehen.<br />
Die „Conventiones Alamanorum" von 1466 gewähren neue Privilegien 24), <strong>und</strong><br />
die Papiere der Paumgartner bestätigen, daß gegen 1490 die deutschen Transitwaren<br />
nach Spanien 'lYIo ad valorem wie <strong>im</strong> Jahre 1425 zahlen").<br />
Es wäre nützlich, die Übersicht der Handelsbedingungen in den anderen<br />
italienischen Städten festsetzen zu können, wo Dokumente die Anwesenheit<br />
Nürnberger Kauf herren bezeugen. Die <strong>Beziehungen</strong> <strong>zwischen</strong> Nürnbergern <strong>und</strong><br />
Florentinern sind sicher, aber die Frage ist für die Zeit vor dem 15. Jh. noch<br />
nicht angeschnitten worden. Handelsbeziehungen <strong>zwischen</strong> deutschen Städten<br />
<strong>und</strong> Rom existieren beinahe nicht bis zur Niederlassung der oberdeutschen<br />
Firmen <strong>und</strong> ihrer Einschaltung in den Geldgeschäften des Papsttums zum Ende<br />
des 15. Jh 26) In Mittel- <strong>und</strong> Süditalien waren etliche Städte von sek<strong>und</strong>ärer<br />
Bedeutung der Schauplatz bedeutender Nürnberger Geschäfte, vornehmlich ver-<br />
21) A. Schulte, Handel <strong>und</strong> Verkehr... II, Nr. 258, 270.<br />
22) A. Schulte, Handel <strong>und</strong> Verkehr.. .11, Nr. 255.<br />
23) A. Schulte, Handel <strong>und</strong> Verkehr. . . II, Nr. 264.<br />
24) A. Schulte, Handel <strong>und</strong> Verkehr. . . II, Nr. 272.<br />
25) K. 0. Müller, Welthandelsbräuche . . . 1, 118-120.<br />
26) Ober die deutsche Gemeinde von Rom <strong>im</strong> Mittelalter, vgl.: A. de Waal, Der Campo<br />
Santo der Deutschen zu Rom, Freiburg 1896; F. Noad,. Das Deutschtum in Rom, 1927;<br />
K. H. Schäfer, Die deutschen Mitglieder der Heiliggeist-Brüderschaft zu Rom am Ausgang<br />
des Mittelalters, Quellen <strong>und</strong> Forschungen aus italienischen Archiven <strong>und</strong> Bibliotheken<br />
XVI, Beilage: neben den Prälaten, den „curiales", den Notaren der Rota<br />
einerseits, den Handwerkern, den Wirten des Borge, den Humanisten, wie Johannes<br />
Pirkhc<strong>im</strong>er, andererseits, befanden sich in der deutschen Kolonie von Rom einige Kaufherren,<br />
meistens Flamen. K. 1-1. Schäfer hat dennoch <strong>im</strong> Bruderbuch der An<strong>im</strong>a, einer<br />
frommen Stiftung, die Namen von Nürnberger Wohltätern aufgef<strong>und</strong>en, die vermutlich<br />
geschäftlich nach Rom gekommen sind. So <strong>im</strong> Jahre 1478 Petrus Petz, Johannes Prawn,<br />
cives ei merca tores Nor<strong>im</strong>bergi.<br />
über die Einrichtung der Bankgesellschaften, vgl. A. Schulte, Die Fugger in Rom...;<br />
G. von Pölnitz, Jakob Fugger <strong>und</strong> der Streit um den Nachlaß Meldiiors von Brixen,<br />
384
f\t1sldt der Stadt Venedig mit dem ‚.'Ieutsdien Haus", Aushnttt aus einem Holzschnitt<br />
des 16. jh. (Museo Correr, Venedig)<br />
15
frt1L<br />
ULi.<br />
Rövensbui<br />
Lnau<br />
Bei.,i1 f1. (SeptL7fle,,<br />
^c^,oiio<br />
MAILAND<br />
14 i.) Rt4BERC<br />
JN8rdA<br />
Bresa<br />
m^ttew"t4<br />
n<br />
q,usbiuck<br />
7ota<br />
F.IQ.Ctaeo<br />
Veto -<br />
6e he\<br />
9Tohaco<br />
d. CGdoi-e.<br />
to 1buo<br />
Me<br />
D ie Verkehrswege von Nürnberg nwh <strong>Italien</strong><br />
(Entwurf: Braunstein)<br />
burg<br />
jyk\Vi1La<br />
16
<strong>und</strong>en mit dem Safranhandel, auf den wir zurückkommen; die Imhof waren<br />
in Aquila <strong>und</strong> in Lanciano in den Abruzzen sowie in Bari in Apulien vertreten.<br />
Aber es bleibt, daß das wesentliche Tätigkeitsfeld der Nürnberger bis zum<br />
14. <strong>und</strong> 15. Jahrh<strong>und</strong>ert in den' norditalienischen Städten liegt <strong>und</strong> vor allem<br />
in Venedig, das mit seinen Waren <strong>und</strong> Handelstechniken die Strömungen der<br />
Renaissance, von denen die Humanistcn <strong>und</strong> die Nürnberger Künstler beeinflußt<br />
wurden, nach Süddeutschland <strong>und</strong> durch dieses nach Mitteleuropa, gelangen<br />
läßt.<br />
Il. Das Studium der Art des Austausches <strong>zwischen</strong> Nürnberg <strong>und</strong> <strong>Italien</strong><br />
am Ende des Mittelalters führt uns dazu, eine Schau über die Waren zu halten,<br />
die Gegenstand des Nürnberger Handels waren, aber vor allem kurz die<br />
schwierigen Verhältnisse in Erinnerung zu bringen, denen der intensive Warenumschlag<br />
auf beiden Seiten der Alpen unterworfen war.<br />
Die Verbindungen <strong>zwischen</strong> Oberdeutschland <strong>und</strong> <strong>Italien</strong> hingen eng von<br />
den Alpenpässen ab; zwei Wegsysteme boten sich den Nürnbergern an, je nachdem<br />
sie sich nach Mailand <strong>und</strong> Genua einerseits oder nach Venedig andererseits<br />
begaben"). Gingen sie nach Mailand, so war der geradere Weg über Ulm,<br />
Ravensburg <strong>und</strong> Lindau; indem sie dann das Rheintal bis Chur hinaufstiegen,<br />
mußten sie sich dann <strong>zwischen</strong> der Route des Sept<strong>im</strong>er <strong>und</strong> der Route des<br />
Splügen entscheiden. Auf beiden Wegen kommt man nach Chiavenna am<br />
Comer See, aber die Route des Sept<strong>im</strong>er scheint die häufigere gewesen zu sein.<br />
Bei der Rückreise von <strong>Italien</strong> nach Deutschland mußte der von Venedig startende<br />
Kaufmann <strong>zwischen</strong> Verona <strong>und</strong> Belluno über die Alpen gehen, sofern er<br />
nicht das Tal des Tagliamento in Richtung auf den Tarvis durchschritt. Diese<br />
von den Wienern sehr benützte Route") wurde von den Nürnbergern eingeschlagen,<br />
die Interessen an den Minen von Kärnten, wie später die Beha<strong>im</strong>,<br />
hatten.<br />
Von Venedig weggehend hatte man die Wahl <strong>zwischen</strong> mehreren Wegen,<br />
aber nicht <strong>zwischen</strong> mehreren Pässen. Die einzige nicht den Brenner überschreitende<br />
Route muß den Reschenscheideck in 1500 in <strong>und</strong> wurde<br />
weniger in Anspruch als die beiden anderen genommen: die Route Verona-<br />
Trient—Innsbruck, die man über Bassano erreichte, oder die „Strada d'Alemagna",<br />
auch „Via Nor<strong>im</strong>bergi" genannt: über Mestre, Treviso <strong>und</strong> Serravalle<br />
kamen die deutschen Kaufleute nach Ampezzo, Toblach <strong>und</strong> durch Pustertal<br />
zum Brenner hinauf. Nach dem Krieg gegen den Herzog Sigm<strong>und</strong> von Tirol<br />
bemühte sich Venedig diese Strecke zum Nachteil der friaulisdien Städte zu begünstigen.<br />
Keine Schwierigkeit hat jemals die Kaufleute, die die Reise nach <strong>Italien</strong><br />
unternahmen, entmutigt. Sie mußten <strong>im</strong>mer darauf gefaßt sein, böse Begegnungen<br />
zu machen; die Hinterhalte be<strong>im</strong> Ausgang der italienischen Straßen<br />
Quellen <strong>und</strong> Forschungen aus italienischen Archiven <strong>und</strong> Bibliotheken, XXX, 1940: 1482,<br />
Melchior von Meckau, Koadjutor des Bischofs von Brixen, zahlte seine Annaten durch<br />
Vermittlung von Bernhard Hirschvogel <strong>und</strong> der venezianischen Bank de Salutatis.<br />
27) Siehe die beigegebene Skizze „Die Verkehrswege von Nürnberg nach <strong>Italien</strong>".<br />
28) K. Schalk, Rapporti commerciali fra Venezia c Vienna, Nuovo Ardiivio Veneto, n. s.,<br />
a. XII, T. XXIII, S. 52-95 <strong>und</strong> 284-317.<br />
385
waren häufig, besonders zur Zeit der Frankfurter <strong>und</strong> Leipziger Messe; die Umgebung<br />
des Bodensees waren häufig der Schauplatz der Tätigkeit der „Halbittcr".<br />
Zu der Unsicherheit auf den Straßen, die eine W<strong>und</strong>e des Zeitalters<br />
war, gesellten sich jr. den Alpen andere Schwierigkeiten. Die Erzählungen der<br />
Reisenden, Pilger <strong>und</strong> Kaufleute geben eine Vorstellung von den Strapazen,<br />
denen man sich auf den Gebirgspfaden aussetzte 29). Die örtlichen Landesherren,<br />
besorgt um ihre Zolleinnahmen, beschäftigten sich intensiv mit der Verbesserung<br />
der Straßen, wo der Verkehr nicht durch Schneefälle oder Glatteis unterbrochen<br />
war. So ließ Herzog Sigm<strong>und</strong> von Oesterreich entscheidende Arbeiten<br />
unternehmen <strong>und</strong> die Erzählung von Felix Fabri zeigt., daß man vor den<br />
energischen Maßnahmen nicht zuriickwich: man ließ die Porphyre von Brixen<br />
mit Pulver sprengen").<br />
AndereHernmnissc beeinflußten die Wahl eines Reiseweges, wenn die Wahl<br />
möglich war: die Vielzahl der Zollämter <strong>und</strong> die Bedingungen der Spediteure,<br />
denen man sich nicht entziehen konnte. Die Lehensherrschaften des Gebirges<br />
klammerten sich umso gieriger an die Einnahmen aus dem Transitverkehr, als<br />
sie ökonomischer weniger lebensfähig waren. Aber die Konkurrenz spielte sich<br />
<strong>zwischen</strong> den Pässen ab, vor allem in Graubünden, <strong>und</strong> es sind die Konföderationen<br />
der Täler, in vollem Auftrieb <strong>im</strong> 15. Jahrh<strong>und</strong>ert, die durch ihre örtlichen<br />
Transportgesellschaften <strong>im</strong>mer mehr die Vorteile oder die Verteuerung<br />
der Wege best<strong>im</strong>mten. Die Kaufleute mußten sich auf die „Porten « des Sept<strong>im</strong>r<br />
oder auf die „Rott" von Mittenwald verlassen, welche die Ballen <strong>und</strong> die<br />
Kisten von Umladeort zu Umladeort auf den Weg brachten.<br />
Mehr als die Vergütung der Transportagenten <strong>und</strong> die Einlagerungskosten<br />
waren es die Transitgebühren <strong>und</strong> vor allem die Speditionskosten, die das<br />
Budget der Gesellschaften belasteten. Es geht z. B. aus Tabellen des Jahres 1390<br />
hervor, die Sonderbeauftragte von Mailand auf der Route Konstanz gemacht<br />
hatten, daß die Zollkosten <strong>zwischen</strong> Konstanz <strong>und</strong> Bellinzona über den Lukmanier<br />
sich auf 23% oder 29% des Gesamtbetrages je nach der Ware beliefen.<br />
Die Einlagerungskosten an den 19 Umladestellen stellten 3-4% dar; die verbleibenden<br />
68-73% entfielen auf Transportkosten"). Diese Zahl gibt eine<br />
Größenordnung, die man wieder in den Rechnungen der Agenten der »Großen<br />
Ravensburger Gesellschaft" etwa 100 Jahre später vorfindet.<br />
Zu den allgemeinen Handelsverhältnissen <strong>zwischen</strong> Deutschland <strong>und</strong> <strong>Italien</strong><br />
gehört schließlich die Dauer der Reisen, das langsame Fortbewegen von Zollamt<br />
zu Zollamt, von Umladestelle zu Umladestelle, zu einer Zeit, wo die<br />
Neuigkeit die Basis der Spekulation wird. 12-15 Tage scheint <strong>im</strong> allgemeinen<br />
ein Reiter zur Bewältigung der Strecke Nürnberg—Venedig gebraucht zu haben.<br />
Was soll man dann von den Reisen <strong>im</strong> Rhythmus der schweren Fuhren oder <strong>im</strong><br />
Maaultierschritt auf schlechten <strong>und</strong> gefährlichen Wegen ausgesetzt sagen? Es<br />
29) Die Quellen sind zusammengestellt <strong>und</strong> beschrieben von H. Krüger, Des Nürnberger<br />
Meisters Erhard Etzlaub älteste Straßenkarte von Deutschland, Jahrbuch für fränkische<br />
Landesforschung Bg. 18, 1958, S. 49-60.<br />
30) F. Fabri, Evagatorium in terrae sarlctae peregrinationem, Bibliothek des Literarischen<br />
Vereins, Bd. 2 <strong>und</strong> 4, 1843, 1849; Bd. 2, S. 71: Nutze Dux fecit arte cum igrze et bornbardarum<br />
pulvere dividi petras et scopulos abradi ei saxa grandia removers ei multis<br />
expensis fecii aspera in vias planas<br />
31) A. Schulte, Handel <strong>und</strong> Verkehr II, Nr. 33 <strong>und</strong> 34.<br />
386
war am Platze diese Schwierigkeiten <strong>und</strong> diese Dienstbarkeiten hervorzuheben,<br />
um sich besser von dem Unternehmergeist der Nürnberger zu überzeugen.<br />
Diese, in <strong>Italien</strong> dklcedine questus angezogen, - wie der Chronist Sigm<strong>und</strong><br />
Meisterlein 32) sagt - haben sich als die aktiven Vermittler <strong>zwischen</strong> Nordeuropa<br />
<strong>und</strong> den Mittelmeerländern betätigt.<br />
Der Austausch <strong>zwischen</strong> Nürnberg <strong>und</strong> <strong>Italien</strong> erstreckte sich - man ahnt es<br />
wohl - auf die <strong>im</strong> internationalen Handel üblichen Waren. Die Nürnberger<br />
Situation unterscheidet sich in dieser Hinsicht von jener der anderen deutschen<br />
Städte nur durch die besondere Bedeutung gewisser Erzeugnisse, welche wir<br />
unterstreichen.<br />
Unter den Waren, welche die Raubritter an den Mündungen der italienischen<br />
Straßen festhalten <strong>und</strong> mit sich nehmen, findet man <strong>im</strong>mer wieder die Gewürze,<br />
die einen vorwiegenden Teil der deutschen Einkäufe ausmachten. Die<br />
Aufstellung, welche die Handbücher der kaufmännischen Praxis oder die Inventuraufnahme<br />
der Apotheker geben, wäre zweifelsohne länger als die, die<br />
man von den Haushaltsrechnungen 33) aufstellen kann. Diese letzteren gestatten<br />
die Verbreitung von gewissen unter ihnen <strong>und</strong> ihren beständigen Gebrauch<br />
wenigstens be<strong>im</strong> Bürgertum festzustellen. Die Ausgaben Anton Tuchers von<br />
Nürnberg enthielten eine regelmäßige Menge Gewürze, 3-5% an Wert seiner<br />
Verzehreinkäufe ); für die Hochzeit der Tochter von Michael VII Beha<strong>im</strong><br />
kauft man für einen ansehnlichen Betrag Pfeffer, Safran, Ingwer, Muskatnuß<br />
<strong>und</strong> Gewürznelken 35).<br />
Schwarzer Pfeffer kam von Ceylon oder von Indien oder von Arabien <strong>und</strong><br />
Agypten über Beirut oder Alexandrien <strong>und</strong> wurde in Venedig nach „carg", das<br />
heißt 4 Doppelzentner (Quintal) von Venedig, verkauft. Ingwer kam aus Indien,<br />
Arabien, Sansibar oder von Madagascar <strong>und</strong> wurde per Doppelzenter<br />
(Quintal) gehandelt; Muskat, Muskatblüte zum Würzen des Weines, Gewürznelken<br />
(„garofali" oder reine Nelken <strong>und</strong> » fusti « oder Stengelauszug) kamen<br />
aus Indien oder den Molukken <strong>und</strong> wegen ihres Preises wurden sie pf<strong>und</strong>weise<br />
verkauft. Man könnte noch andere Spezereien anführen, die <strong>im</strong> Mittelalter sehr<br />
geschätzt wurden, wie Z<strong>im</strong>t aus Ceylon, den „kubeben", die bittere Frucht<br />
eines Pfefferbaumes von den Molukken, die Paradisbeeren aus Westafrika. Dazu<br />
kommen noch die Parfums, wie Weihrauch, Balsamkraut, Sandelholz <strong>und</strong> die<br />
Medizinaldrogen wie Aloe oder der Theriak, der in Venedig hergestellt wurde.<br />
Man muß die Konten der italienischen oder deutschen Kaufleute durchlesen <strong>und</strong><br />
man n<strong>im</strong>mt bei diesen Geschäften ein klares Übergewicht des Pfeffers, als<br />
Gr<strong>und</strong>produkt des internationalen Handels wahr, dessen Kurse einen Index-<br />
Wert über die Marktlage hatten.<br />
Die Stelle, die Safran in Nürnberg dank dem Monopol einnahm, das sich<br />
die Nürnberger <strong>und</strong> Augsburger Kaufleute wegen seiner Verteilung gesichert<br />
32) Chroniken der deutschen Städte ... Bd. III, S. 220.<br />
33) B. di Pasi, Tariffa dci pesi e misure, corrispondentj dal Levante al Ponente - ..‚ Venezia<br />
1557, S. 188 (erste Ausgabe 1503), zählt 44 Sorten von Gewürzen auf; zitiert bei A.<br />
Schulte, Handel <strong>und</strong> Verkehr.. . 1, S.708.<br />
34) Anton Tuchers Haushaltsbuch, hrsg. von W. Loose, Bibliothek des Literarischen Vereins,<br />
CXXXIV, 1877.<br />
35) Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Beha<strong>im</strong>ardüv 102, 1/8 (1504).<br />
23<br />
387
hatten, ermächtigt uns, dem einzigen Gewürz, das man nicht <strong>im</strong> Orient suchte,<br />
eine Erörterung zu widmen ').<br />
Seit der Vorzeit <strong>im</strong> Westbecken des Mittelmeeres wachsend wurde Safran<br />
selbst zum Ende des Mittelalters nach den Häfen der Levante ausgeführt. Die<br />
Pflanzung des „crocus sativus" wurde überall versucht, wo die natürlichen Umstände<br />
es erlaubten; aber außerhalb <strong>Italien</strong>s konnte nur der katalonische oder<br />
„ortsafran" durch seine Qualität mit dem „tusdigan « oder toskanischen <strong>und</strong><br />
besonders mit dem „z<strong>im</strong>a" der Abruzzen konkurrieren. Man findet den Safran<br />
<strong>im</strong> Kontobuch der Holzschuher von Nürnberg; es ist aber wahrscheinlich, daß<br />
er schon zu Beginn der Geschäftsbeziehungen <strong>zwischen</strong> Oberdeutschland mit<br />
Venedig <strong>und</strong> Genua verwendet wurde. Die Möglichkeit auf die Kurse je nach<br />
den Varietäten <strong>und</strong> Ernten einzuwirken, das ungeheure zu beliefernde nordische<br />
Gebiet, veranlaßten <strong>im</strong> 15. Jahrh<strong>und</strong>ert die Kaufherren, in Massen <strong>und</strong> auch so<br />
direkt als möglich einzukaufen.<br />
Der Markt von Venedig bot alle Arten italienischen Safrans, die auf dem<br />
Land- oder Seeweg über die Häfen der adriatischen Küste gekommen waren. Die<br />
Deutschen kauften fast die gesamten Importe von Venedig auf, aber die Abgaben<br />
auf den Safran waren schwer, schwerer als in Genua auf dem spanischen<br />
Transitsafran. Ein Kapitular des Venezianer Fondaco konstatiert, daß die<br />
Transaktionen mit dem Safran, die noch vor ein paar Jahren 100 000 Dukaten<br />
<strong>im</strong> Jahr repräsentierten, in klarem Rückgang sind, weil ' sich die Deutschen in<br />
Wahrung ihrer Interessen dem Mailänder Markt zugewendet haben, <strong>und</strong> der<br />
Handel mit dem Safran Gefahr läuft, Venedig ganz zu entweichen. Daher beschloß<br />
der Senat den Transithandel zu erleichtern"). Der Safran strömte zwar<br />
weiter nach der Lagunenstadt, aber, - die Papiere der » Großen Ravensburgischen<br />
Gesellschaft « weisen es aus - Mailand war zum Ende des 15. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
der wichtigste Markt für lombardischen <strong>und</strong> toskanischen Safran geworden,<br />
aber auch für „z<strong>im</strong>a" <strong>und</strong> für » mark" (Safran der »Marken").<br />
Die Struktur dieses Handels änderte sich andererseits <strong>im</strong> Laufe der 2. Hälfte<br />
des 15. Jahrh<strong>und</strong>erts, insofern, als die großen deutschen Gesellschaften auf den<br />
lokalen Märkten Zentral- <strong>und</strong> Süditaliens direkt vertreten wurden. Die Nürnberger<br />
sind unter den aktivsten Käufern. Arnold de Zeeland, mit den Gebr.<br />
Oloferi von Verona assoziiert, die Fütterer, die in Aquila erscheinen, <strong>und</strong> auf<br />
den Messen von Lanciano, Otranto <strong>und</strong> Barletta kaufen; die Imhof, deren Anwesenheit<br />
anno 1490 in Bari bezeugt ist, wo sie ein Kontor eröffneten").<br />
Die Unternehmungen der Nürnberger hatten aus Nürnberg die Handelshauptstadt<br />
für Safran gemacht. Die Einsetzung einer »Schau" stärkte das<br />
Quas<strong>im</strong>onopol der Stadt, indem sie die Prüfung der Qualität unter die Autorität<br />
des Rates stellte. Durch ein bezeichnendes Zusammentreffen, erfolgte die<br />
„Schau" ab 1441 in dem Haus der Imhof ehe sie zum Ende des Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
nach der «Waage « verlegt wurde.<br />
36) Zur Geschichte des Safran, seines Anbaues <strong>und</strong> seines Handels <strong>im</strong> Mittelalter vergleiche<br />
man die Studie von L. Bardenhewer, Der Safranhandel <strong>im</strong> Mittelalter, 1914, <strong>und</strong> den<br />
wesentlichen Artikel von A. Petino, Lo zafferano... (zitiert in der Literaturübersicht),<br />
der alle vorherigen Arbeiten <strong>und</strong> die italienischen oder deutschen Quellen verwendet hat.<br />
37) CL M. Thomas, Capi tolare ... cap. 42, S. 277.<br />
8) Germanisches Nationalmuseum, Frhrl. v. Imhoffsches Familienarchiv, 28, 4.<br />
388
Der kontrollierte Safran war „Nürnbergisch gerecht geschaut gut" <strong>und</strong><br />
erhielt als unbestrittenes Gültigkeitszeichen für ganz Europa das Signum von<br />
Nürnberg. So schützte der Rat ein Importprodukt mit derselben Sorgfalt wie<br />
die geschätzteren Erzeugnisse des Handwerks, der Goldschmiede- oder der<br />
Waffenschmiedekunst. Da die Erzeugungsstädte wie Aquila nicht best<strong>im</strong>mt<br />
werden konnten, den häufigen Fälschungen den Kampf anzusagen, sorgte<br />
Nürnberg allein für die Reinheit des Safrans <strong>und</strong> die Sicherheit des Marktes.<br />
Die wachsenden Anträge auf Gutachten durch Städte des Ostens 9) bezeugt die<br />
Bedeutung der Safranverkäufe in diesen Gebieten, wo die Hirsvogel, die Imhof,<br />
die Stromer in dauernden <strong>Beziehungen</strong> mit den polnischen <strong>und</strong> ungarischen<br />
Kaufleuten waren. Nürnberg konnte als Ausgangspunkt der Kauffahrerzüge,<br />
als europäisches Lagerhaus <strong>und</strong> als Markt, als Zentrum der Reinigung <strong>und</strong> der<br />
Kontrolle der Gewürze <strong>im</strong> Jahre 1507 daran erinnern, daß vor der Weiterverteilung<br />
in den nordischen Königreichen der Safran von der ganzen Welt nach<br />
Nürnberg kam"').<br />
Der Gewürzbegriff, viel weiter <strong>im</strong> Mittelalter als heutzutage, umfaßte<br />
natürlich die Lebensmittel des Mittelmeerraums, die man auf dem Tisch der<br />
Nürnberger Bürger fand. Apulien reservierte für den venezianischen <strong>und</strong><br />
deutschen Markt seine erste Wahl des Olivenöls, der Mandeln <strong>und</strong> des Kümmels.<br />
Die »Große Ravensburgische Gesellschaft" <strong>im</strong>portierte Zucker aus Valencia<br />
über Genua <strong>und</strong> von Sizilien über Neapel. Die Hirsvogel kauften in Venedig<br />
Zuckerhüte <strong>und</strong> „polvere de zucchero" aus Cypern. Erwähnen wir auch die<br />
Südfrüchte, Korinthen, Feigen, Zitronen aus Zante <strong>und</strong> Cephalonien, Orangen<br />
aus Spanien, die in Genua in Kisten von 160 oder Ladungen von 1550 Stücken<br />
ankamen, die Konfitüren, die sich die Behajm <strong>und</strong> die Kress aus Venedig schicken<br />
ließen. Unter den Weinen, die am häufigsten bei den deutschen Käufen hervortreten,<br />
bemerkt man den Muskateller, den ‚.rainfal" <strong>und</strong> den Malvasicr41).<br />
Wenn die Geschäftsbriefe <strong>und</strong> die Privatrechnungen enthüllen, wie die<br />
Nürnberger Patrizier verstanden, ihre Hausmannskost zu verfeinern, so beweisen<br />
die Nachlaßinventare <strong>und</strong> die Polizeiverordnungen gegen den Luxus<br />
den italienischen Einfluß auf den Lebensstil <strong>und</strong> die Lebenshaltung. Venedig<br />
war mehr als jede andere Stadt der Markt für Korallen, Perlen, Edelsteine:<br />
Paul Mülich aus Nürnberg belieferte über seinen Bruder Mathis, der in Lübeck<br />
saß, den dänischen Hof mit „opera venetica". Ein Kapitel der „Welthandelsgebräuche"<br />
der Paumgartner ist dem Kauf der Perlen <strong>und</strong> Rubine in Venedig<br />
gewidmet 42)<br />
39) Gutachten verfaßt vom Rat der Stadt Nürnberg auf die Bitte der Stadt Leipzig 1469:<br />
Staatsarchiv Nürnberg, Briefbuch 33, fol. 151.<br />
40) Brief an den König von Neapel 1507 V... Cm major pars croci ex omni terrarum orbe<br />
huc tanquarn ad cornune tocius Gerrnanie emporium afferatur, hincque in omnia reg=<br />
septentrionalia avehatur.. Staatsarchiv Nürnberg, Briefbuch 59, fol. 232.<br />
41) Die venezianischen Archive sind eine F<strong>und</strong>grube von Nachrichten über den Handel mit<br />
Mittelmeerweinen. Die Konten von Michel Foscarj enthalten ca. 20 Schuldanerkenntnisse<br />
von Kaufleuten aus Bayern <strong>und</strong> Franken für den Kauf von Malvasierwein <strong>zwischen</strong><br />
1490 <strong>und</strong> 1501 (Ardsivio di Stato Venezia, Procuratori di San Marco, Misti 42, fasc.<br />
XVII).<br />
42) K. 0. Müller, Welthandlsbräudse ... V, 33-34.<br />
389
Man verläßt nicht das Gebiet der Luxusartikel mit den Exporten italienischer<br />
Textilien, weil es sich wesentlich um kostbare Seidenwaren handelt, die<br />
m Norditalien hergestellt oder vom Morgenland eingeführt wurden. In der<br />
Tat bestand ein bedeutender Teil der Nürnberger Importe aus feiner Seide, die<br />
mit Galeren der Romanie in Venedig ankam, Damasttücher, die stückweise<br />
verkauft wurden, <strong>und</strong> alle die Varietäten der mit Gold iibcrsponnenen Fäden,<br />
Samt, Brokat aus Venedig <strong>und</strong> Genua; teure Stoffe, de über Nürnberg nach<br />
Lübeck, Leipzig oder nach Prag gingen. Auf dem Gebiet der Textilien, erstreckten<br />
sich die Masseneinkäufe auf Rohbaumwolle aus Syrien <strong>und</strong> Armenien,<br />
welche die Barchentindustrie Oberdeutschlands <strong>und</strong> vor allem Augsburg versorgte<br />
43).<br />
Zu einer Zeit, wo die Färbung der Stoffe nicht ohne Einfluß auf ihren Preis<br />
war, lieferten Venedig <strong>und</strong> Genua alle vom Orient mit den anderen Gewürzen<br />
gekommene Färbererzeugnisse nach Deutschland <strong>und</strong> nach Europa. Der Niedergang<br />
der venezianischen Färberei ist korrelativ mit den Fortschritten anderer<br />
Städte auf diesem Gebiet, besonders in Nürnberg, wo die Leipziger Kaufläute<br />
Zittauer Stoffe <strong>und</strong> polnisches Linnen färben ließen. Die Deutschen führten aus<br />
<strong>Italien</strong> Brasilholz aus Sumatra für die Rotfärbung, auch Zinnoberrot, ein, <strong>und</strong><br />
ab 16. Jahrh<strong>und</strong>ert Indigo oder » Indisch", als er seine ersten Siege über den<br />
polnischen <strong>und</strong> deutschen Färberwaid davongetragen hatte.<br />
Ein interessantes Phänomen ist das Erscheinen italienischer Bücher <strong>und</strong><br />
Papiere unter Gewürzballen <strong>und</strong> Seidenwaren der Nürnbereer Kaufherren.<br />
Bei der Verrechnung von <strong>im</strong> Jahre 1426 drei Nürnbergern bei Prag beschlagnahmten<br />
Waren findet man 12 Ries Papier). Bezüglich der Bücher, ohne daß<br />
man von einem echten Handelsverkehr sprechen kann, muß man die Aufmerksamkeit<br />
beachten, die die Nürnberger Gelehrten zum Ende des 15. <strong>und</strong> Beginn<br />
des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts auf die Ausgaben der Mailänder <strong>und</strong> venezianischen<br />
Druckerpressen richten. Willibald Pirckhe<strong>im</strong>er erklärt sich in seinem Briefwechsel<br />
mit Anton Kress bereit, italienische Bücher um jeden Preis zu kaufen.<br />
Die Hofmann lassen ihm aus Mailand <strong>und</strong> die Imhof aus Venedig Aufträge zukommen,<br />
welche er bei Kress, der in Pavia studiert, bestellt.<br />
Mit dem Handel der Metalle <strong>und</strong> Erzeugnisse der metallverarbeitenden<br />
Gewerbe treten wir, trotz der Qualitätsproduktion der lombardischen Städte,<br />
ins Gebiet der deutschen Exporte. Nürnberg glich seine Käufe von Gewürzen,<br />
kostspieligen Rohstoffen <strong>und</strong> Luxuswaren dadurch aus, indem es den italienischen<br />
Markt über Venedig <strong>und</strong> Genua, ganz Südeuropa <strong>und</strong> bis zum Orient mit<br />
43) In den Geschäftsbüchern dci' Gesellschaft Soranzo bilden die Deutschen die Mehrzahl<br />
der Käufer von syrischer Baumwolle. Unter den Nürnbergern werden genannt: Eisvogel,<br />
Granetl, Imhof, Kolcr, Kress, Pirckheinier, Rummel, Stromer, Teufel, Waldstromer <strong>zwischen</strong><br />
1406 <strong>und</strong> 1434; vgl. H. Sieveking, Aus venezianischen Handlungsbüdiern...<br />
Bd. 26,S. 222-225.<br />
44) Die älteste Papiermühle, die man in Deutschland kannte, bestand in Nürnberg schon<br />
1390. Ulman Stromer, der Verfasser des berühmten „Püchel von mein gesledst, sicherte<br />
sich 1394 die Leitung des Bctriebes.Eine noch laufende Forschung über die Verbreitung<br />
von Wasserzeichen, welche die Firma verwendete, wird das Netz der europäischen Verbindungen<br />
der Fa. Stromer erkennen lassen. Vgl. W. von Stromer-Reichenbach <strong>und</strong> L.<br />
Sporhan-Krempel, Die erste deutsche Papiermühle, Papiergeschidite, Zeitschrift der<br />
Forschungsstelle Papiergeschichte in Mainz, Jahrg. 13, Heft 5/6, 1963.<br />
390
den Metallen belieferte; die es aus Minen Zentraleuropas gewann <strong>und</strong> dann die<br />
Metallwaren, deren Qualität dem he<strong>im</strong>ischen Handwerkstand Aufträge<br />
sicherte 45).<br />
Der Reichtum der Silber- <strong>und</strong> Kupferminen Tirols <strong>und</strong> die 1409 entdeckten<br />
Lager in Schwaz lösten eine gesteigerte Schürfung <strong>im</strong> 15. Jahrh<strong>und</strong>ert aus:<br />
auf dem italienischen Abhang versorgte sich die italienische Metallurgie von<br />
Brescia „l'arrnata", von Como, von Bergamo, mit den seit dem 13. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
aktiv ausgebeuteten alpinen Eisenbergwerken, mußten aber dennoch Importe<br />
von der Insel Elba <strong>und</strong> von Deutschland zusätzlich erhalten. Man brauchte oft<br />
deutsches Personal zur Sicherung der technischen Leitung der Betriebe, besonders<br />
Nürnberger, die sich in den Bergwerken Tirols, Sachsens, Böhmens <strong>und</strong> Ungarns<br />
einen Ruf als Spezialisten, den sie bis ins 18. Jahrh<strong>und</strong>ert beibehielten, erworben<br />
hatten 46), Es war der Bedarf seiner Industrie, der Nürnberg zum Betrieb der<br />
zentraleuropäischen Minen in dem Maße trieb, wie die Nachfrage stieg <strong>und</strong><br />
die nächsten Reserven aus dem Jura <strong>und</strong> Frankenwald sich erschöpften. Die<br />
Nürnberger Geschäftsleute sind in den Bergwerksgesellschaften von Mansfeld,<br />
Hersbruck, Eisfeld vertreten. Die Produktion der Silberminen Zentraleuropas<br />
versorgt, bis zur Entdeckung der amerikanischen Lager die ganze<br />
westliche Wirtschaft <strong>und</strong> die Nürnberger beuten Minen in Kuttenberg.!Böhnicn,<br />
<strong>im</strong> Harz, in Sachsen, in Ungarn, in Tirol, aus, wo in der zweiten Hälfte des<br />
15. Jahrh<strong>und</strong>erts die Beha<strong>im</strong> Silbererze scheiden, <strong>und</strong> in Goldkronadi (Fichtelgebirge),<br />
wo die Kupfer-, Silber- <strong>und</strong> Zinnminen <strong>im</strong> letzten Viertel des 15. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
dank den Kapitalien von Nürnberg einen neuen Aufschwung erfahren,<br />
Das sächsische Kupfer, dessen Qualität erstklassig war, wurde auf<br />
allen Handelsplätzen des Reiches verkauft, in Frankfurt, in Köln, der Etappe<br />
nach den Niederlanden, aber gleich von der Mitte des 14. Jahrh<strong>und</strong>erts an<br />
waren die Mittelmeerländer die hauptsächlichsten Kupferkäufer. Die Erzeugnisse<br />
wurden nach <strong>Italien</strong> in Barrenform, Platten oder Folien exportiert.<br />
Die Angaben von Ulman Stromer klären die Rolle, die der Genueser Hafen<br />
als Transitplatz spielte. Zum Beispiel ließ anno 1436 die „Große Ravensburger<br />
Gesellschaft" 8 Tonnen Platten <strong>und</strong> Messingdraht nach Barcelona auf einem<br />
45) Die Literatur über diesen Punkt ist sehr ausgedehnt. Genannt sei: K. I)cttling, Der<br />
Metallhandel Nürnbergs, Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg,<br />
27, 1928, S. 97-241; C. Johannsen, Geschichte des Eisens, Hamburg 1953; R. Klier,<br />
Nürnberg <strong>und</strong> Kuttenberg, Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg,<br />
48, 1958, S. 51-78; W. Möllenberg, Die Eroberung des Weltmarktes durch das Mansfeldische<br />
Kupfer, Gotha 1911; J . U. Nef, Silver Production in Central Europe (1450-<br />
1610), The Journal of political Economy 1941; W. Neukam, Das Gewerkenbuch von<br />
Goldkronadi; das Eindringen Nürnberger Kapitals <strong>im</strong> bayreuthischen Begbau, Mitteilungen<br />
des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 43, 1953; F. M. Ress, Geschichte <strong>und</strong><br />
wirtschaftliche Bedeutung der oberpfälzischen Eisenindustrie von den Anfingen bis zur<br />
Zeit des 30jährigen Krieges, Verhandlungen des historischen Vereins von Oberpfalz <strong>und</strong><br />
Regensburg Bd. 91, 1950.<br />
46) In Cadore <strong>und</strong> <strong>im</strong> Friaul ziehen sich die Mutungs- <strong>und</strong> Ausbeutungskonzessionen, die<br />
vom Senat oder vom Rat der X von Venedig den Deutschen gewährt wurden - die<br />
manchmal mit Venezianer assoziirt waren - durch das ganze 15. Jahrh<strong>und</strong>ert hin. Vgl.<br />
A. Alberti <strong>und</strong> R. Cessi, La politica mineraria della Repubblica Veneta, Rorna 1927;<br />
Ph. Braunstein, Les entreprises minires en Vntie au 15 0 sicle, Mlanges d'Ardiologie<br />
et dHistoire de l'Ecole Franaise de Rorne, 1965, S. 529-607.<br />
391
Genueser Schiff transportieren 47). Die Herkunft dieses Transportes läßt keinen<br />
Zweifel: die Gesellschaft kaufte in Nürnberg die größte Menge Kupfer <strong>und</strong><br />
Messing auf, mit der sie handelte.<br />
Unter den italienischen Städten stellte sich Venedig an die Spitze des Kupferverbrauches.<br />
Kupfer war ihm unentbehrlich für seine Handwerker, sein Arsenal,<br />
dem ersten auf der Welt 48), <strong>und</strong> für seine Gewürzkäufe <strong>im</strong> Orient. Dann<br />
folgte das Königreich Neapel, der einzige Staat Europas neben Portugal, der<br />
eine reine Kupfermünze prägte. Die jedes Jahr geprägten großen Mengen<br />
Kupferkleingeld entsprachen besonders <strong>im</strong> Produktionsgebiet des geschätzten<br />
Safrans einem gesteigerten Bedürfnis an Zahlungsmittel <strong>im</strong> 15. Jahrh<strong>und</strong>ert.<br />
Der Gold- <strong>und</strong> Silberhandel mit den italienischen Städten war das recht<br />
eigentliche Gebiet der Nürnberger. In Venedig, wo ein konstanter Prozentsatz<br />
des deutschen Importes von Edelmetall an die „Zecca" zur Prägung ging,<br />
wäre es leicht auf Gr<strong>und</strong> privater Konten der Lieferfirmen die klare Vorherrschaft<br />
der Nürnberger festzustellen. Man bemerkt sogar eine echte Spezialisierung<br />
in diesem Handel, wo <strong>im</strong>mer wieder am Anfang des 15. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
dieselben Namen auftauchen: Kress, Rummel, Pirckhe<strong>im</strong>er <strong>und</strong> Granetl 49).<br />
Dasselbe könnte man vom Eisengeschäft sagen, welches noch mehr als das<br />
Kupfer die Herstellung des » Nürnberger Tands", der „durch alle Land « ging,<br />
versorgte. Die Nürnberger investierten weniger Kapital in dieser Gr<strong>und</strong>-Industrie<br />
in der Oberpfalz oder in der Ambcrger Gegend an, als in der Verarbeitung<br />
an Ort <strong>und</strong> Stelle oder in Nürnberg selbst, wo der Rat seine eigenen<br />
Gießereien hatte. Die Produktion war unendlich abwechslungsreich von den<br />
Haushaltartikeln bis zur Waffenschmiedekunst. Unter den Waren die nach<br />
<strong>Italien</strong> gehen, findet man Erzeugnisse der Nagelschmiede oder Nadelmacher für<br />
den laufenden Gebrauch, Schuhwaren <strong>und</strong> Damenschneiderei. So schickte die<br />
» Große Ravensburgische Gesellschaft" durch ihren Nürnberger Sitz über Genua<br />
nach Barcelona von 1467-1480 8000 Schuhmachernägel, 980 000 Stecknadeln<br />
<strong>und</strong> über eine Million Nähnadeln. Nürnberg verkaufte außerdem in ganz<br />
Europa Sensen <strong>und</strong> Sicheln, Pflugscharen, Gebisse am Zaum, Ringe <strong>und</strong> Ketten,<br />
Schlösser <strong>und</strong> Schellen, Bratpfannen, Gußeisentöpfe, bronzene Kochkessel, Gewichte<br />
<strong>und</strong> Platten aus Messing, Bestecke <strong>und</strong> Geschirr aus Zinn. Zu Beginn<br />
des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts erzeugten die Nürnberger Werkstätten 100 000 Klingen<br />
pro Monat. Die Imhof verkauften in Venedig tonnenweise Eisendraht <strong>und</strong><br />
Kupferdraht 50) <strong>und</strong> verzinntes Blech, eine Erfindung der Nürnberger Technik,<br />
taucht in den Konten der venezianischen Filiale der Kress am Ende des 14. Jahr-<br />
47) A. Schulte, Handel <strong>und</strong> Verkehr. . . 11, Nr. 257<br />
48) G. 1.uzzato, Per Ja storia delle costruzioni navali a Venezia, „Miscellanea Manfroni",<br />
Venezia, 1925; wiederabgedruckt in: Studi di Storia Economica Veneziana, Padova<br />
1954, S. 37-51.<br />
49) Die Tatsache zeigt sich bei den Konten eines venezianischen Gold- <strong>und</strong> Silberhändlers,<br />
G. Condulmer (Archivio di Stato Venezia, Procuratori di San Marco, Misti 182). Er belieferte<br />
die Zecca von Venedig. Dies wird bestätigt durch viele Senatsbeschlüsse oder<br />
durch die folgende Best<strong>im</strong>mung vom 23. Januar 1442: ... Capta hsc parte mitti debeat<br />
pro quatuor aut quinque mercazoribus theosonicis ex principialibus qui soliti amt conducere<br />
argentum... (Archivio di Stato Venezia, Senato Terra, 1, fol. 115).<br />
50) Germanisches Nationalmuseum, Frhrl. v. Tmhoffsches Familienarchiv 28, 4 <strong>und</strong> 21, 7.<br />
392
h<strong>und</strong>erts auf 11 ). Es ist sicher, daß trotz einer Produktion von Metallwaren, die<br />
<strong>im</strong> Mailändischen entwickelt wurde, die fränkische Großstadt auf dem Gebiet<br />
der „Merzerie" wenig Konkurrenz fand. Auf dem Gebiet der Rüstungsproduktion<br />
ist es schwieriger den Warenverkehr <strong>zwischen</strong> Nürnberg <strong>und</strong> <strong>Italien</strong><br />
zu verfolgen. Die Neugestaltung der offensiven <strong>und</strong> defensiven Waffen <strong>und</strong><br />
ihre Serienproduktion <strong>im</strong> 15. Jahrh<strong>und</strong>ert machten das Glück der Nürnberger<br />
Metallurgie aus, aber man findet wenig Spuren von der Einfuhr deutscher Waffen<br />
in <strong>Italien</strong>: Mailand, Brescia, Belluno waren gleichfalls aktive <strong>und</strong> angesehene<br />
Zentren <strong>und</strong> die Konkurrenz scheint vor allem auf den Außenmärkten<br />
in Spanien, Afrika oder der Levante ausgeübt worden zu sein, während Osteuropa<br />
unbestritten Nürnbergs Interessensphäre war! Kündigen wir schließlich<br />
andere in <strong>Italien</strong> sehr geschätzte Produktionen eines in der Präzisionsarbeit<br />
hoch qualifizierten Handwerks an: Die Goldschmiede, die unter Kontrolle<br />
stehen <strong>und</strong> deren Wirken von den Meistern <strong>und</strong> der Stadt mit Marken gekennzeichnet<br />
wird, erhielt Aufträge auf Tafelgeschirr seitens der italienischen Fürsten.<br />
Konrad Pfinzing wird 1432 beauftragt in Nürnberg für den Bischof von<br />
Trient Teller, Leuchter, Salzfässer aus Silber <strong>und</strong> ein Kruzifix aus feuervergoldetem<br />
Silber zu kaufen"). Man weiß auch, daß Lienhart Beha<strong>im</strong> <strong>im</strong> Jahre<br />
1488 in <strong>Italien</strong> Messingkronleuchter verkaufte <strong>und</strong> die Blasinstrunientenmacher<br />
die fürstlichen Musikkapellen belieferten <strong>und</strong> hauptsächlich die Kapelle der<br />
Päpste. Schließlich erreichte auf dem Gebiet der Präzisionsinstrumente für<br />
Physik. Astronomie, Navigation die Nürnberger Fabrikation gegen Ende des<br />
15. Jahrh<strong>und</strong>erts eine unerreichte Perfektion. Man verkaufte in Genua <strong>und</strong> in<br />
Venedig Sternhöhenmesser <strong>und</strong> hier signierte Kompasse.<br />
Die Textilindustrie von Nürnberg exportierte wenig nach <strong>Italien</strong>. Die<br />
Nürnberger spielten eine wichtige Rolle <strong>im</strong> Transithandel <strong>und</strong> der Einfuhr nach<br />
<strong>Italien</strong> von französischen, flämischen <strong>und</strong> brabantischen Tüchern <strong>und</strong> Fäden.<br />
Im Handel mit spanischer oder englischer Rohwolle nahmen sie durch Vermittlung<br />
der »Große Ravensburgische Gesellschaft" oder rheinische Gesellschaften<br />
eine privilegierte Stellung ein. Philipp Gross läßt über Brügge englische<br />
Wolle kommen, die über Mailand geht <strong>und</strong> <strong>im</strong> Jahre 1383 in Venedig<br />
abgesetzt wird 54). Wilhelm Rummel <strong>und</strong> Konrad Pirckhe<strong>im</strong>er kaufen <strong>im</strong><br />
Jahre 1410 64 Sack englische Wolle auf, die die Schlatter über Straßburg nach<br />
Verona <strong>und</strong> Venedig expedieren 55). Georg Stromer <strong>und</strong> Hans Ortlieb reisen<br />
persönlich nach England <strong>im</strong> Jahre 1430 um Wolle aufzukaufen, die sie über<br />
Straßburg nach <strong>Italien</strong> schicken. Im Lederhandel spielt Nürnberg, das Fertig-<br />
51) Germanisches Nationalmuseum, Kressarchiv XXVIII A, 12.<br />
52) Vgl. E. Motta, Armaioli milanesi nel periodo Visconteo-Sforzesco, Archivio Storico Lombardo,<br />
S. V, a. XLI, fasc. 1, 1914, <strong>und</strong> die Artikel in den Zeitschriften L'Arcngo" <strong>und</strong><br />
vane Trompla", in Brescia herausgekommen. Waffenkäufe in Mailand sind <strong>im</strong> Laufe<br />
des 15. Jahrh<strong>und</strong>erts bezeugt: 1459 wird ein Gesandter des Herzogs von Bayern beauftragt<br />
„etlichen harnasch zu bestellen <strong>und</strong> machen zu lassen" (Archivio di Stato Milano, Archivio<br />
Vicontco-Sforzcsco Cart. Est., Alemagna, cart. 569, fasc. 2); 1499 läßt Max<strong>im</strong>ilian<br />
Waffen <strong>und</strong> Rüstungen für 25 000 Dukaten herstellen. Der Mailänder Faktor des Heinrich<br />
Wolf aus Nürnberg übern<strong>im</strong>mt die Waren (Ardsivio di Stato Milano, Ardiivio<br />
Viscontco-Sforzesco, Cart. Est., Akrnagna, cart. 1190).<br />
53) Staatsarchiv Nürnberg, Briefbuch 10, fol. 14 <strong>und</strong> 15.<br />
54) H. S<strong>im</strong>onsfeld, Fondaco.. . 1, Nr. 247.<br />
55) H. S<strong>im</strong>onsfeld, Fondaco... 1, Nr. 304.<br />
393
produkte exportierte, gleichfalls eine Vermittlerrolle, indem es mit Ledern<br />
aus dem Orient oder Spanien die Städte des Nordens beliefert <strong>und</strong> nach Venedig<br />
die in Leipzig oder Lübeck verarbeiteten Häute verkauft.<br />
Eine letzte Rubrik der deutschen Importe nach <strong>Italien</strong> könnte die „Gewürze<br />
des Nordens" heißen. Es handelt sich um Waren <strong>und</strong> Rohstoffe, die auf die italienischen<br />
Plätze von den weiteren europäischen Gebieten gekommen sind <strong>und</strong><br />
deren Preis <strong>und</strong> Rarität die Superiorität der Nürnberger <strong>im</strong> internationalen<br />
Luxushandel zum Ende des Mittelalters bestätigen. Nürnberg exportierte<br />
Honig aus Litauen <strong>und</strong> Rußland <strong>und</strong> Heringe von der Ostsee, die nach dem<br />
Süden über Lübeck, Strals<strong>und</strong>, <strong>und</strong> Stettin flossen. Bernstein, zu Schmuck <strong>und</strong><br />
Rosenkränzen verarbeitet, findet sich wieder in den meisten Inventaren nach<br />
Sterbefällen der italienischen Patrizier; erwähnen wir auch noch die Federn <strong>und</strong><br />
Roßhaare aus Böhmen mit denen die Imhof <strong>und</strong> die Beha<strong>im</strong> in Venedig handelten<br />
<strong>und</strong> vor allem die Rauchwaren, deren verschiedene Arten man en gros<br />
in Lübeck kaufte <strong>und</strong> deren Niederschlag sich in Nürnberger Zolltarifen finden.<br />
Gegen Ende des Mittelalters waren Pelze ein gängiger bürgerlicher Luxusartikel<br />
von der Ostsee bis zum Mittelmeer geworden.<br />
IIL Wir haben gesehen, wie sich das Tätigkeitsfeld der Nürnberger auf<br />
ganz Europa ausdehnt, denn es gibt keine Branche der internationalen Handdelstätigkeit,<br />
wo man sie nicht vertreten findet. <strong>Italien</strong> ist durch seine Erzeugnisse<br />
oder seine Märkte <strong>im</strong> Zentrum des Geschäftsnetzes, das ihr Unternehmungsgeist<br />
gebildet hat. Nachdem wir die allgemeinen Bedingungen dieses<br />
Handels <strong>und</strong> die Art des Austausches an uns vorbeiziehen haben lassen, versuchen<br />
wir, die Formen selbst <strong>und</strong> die Struktur der Geschäftsbeziehungen <strong>zwischen</strong><br />
Nürnbergern <strong>und</strong> <strong>Italien</strong>ern am Schluß des Mittelalters zu beschreiben.<br />
in den Formen der kommerziellen Betätigung behauptet sich dieselbe Verschiedenheit<br />
wie in der Natur des Austausches. In der diversen <strong>und</strong> sich bewgcnden<br />
Welt der Kaufleute heben sich einige große Gesellschaften, die in<br />
<strong>Italien</strong> fest etabliert sind, <strong>und</strong> einige seltene Einzelpersönlichkeiten von Geschäftsleuten<br />
ab. Nürnberg hatte wie andere deutsche Städte seine Handelsdynastien,<br />
die von Generation zu Generation <strong>im</strong> Rate sitzend zugleich ihre<br />
eigenen Geschäfte wie die Wirtschaftspolitik des Rates lenken. An ihren<br />
kommerziellen Techniken <strong>und</strong> an ihrer Verwaltung könnte man am besten die<br />
Bedeutung Nürnbergs in der europäischen Wirtschaft <strong>im</strong> 14. <strong>und</strong> 15. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
ermessen. Die Archivdokumente, oft noch verstreut <strong>und</strong> aufgr<strong>und</strong><br />
ihrer Menge noch unvollständig geprüft, gestatten die Arbeitsmethoden <strong>und</strong> die<br />
Gewinne dieser von der Geschichte privilegierten Kreise zu analysieren, aber<br />
die <strong>im</strong> Verborgenen stehenden Nürnberger unternehmen ebenfalls auf eigene<br />
Rechnung oder auf die großer Firmen die Reise nach <strong>Italien</strong>; sie sind ebenso<br />
arbeitsam <strong>und</strong> bestrebt sich zu bereichern, riskieren ebensoviel <strong>und</strong> verlieren<br />
mehr, wenn sie keinen Kredit <strong>und</strong> Geschäftsbeziehungen genießen.<br />
Ein beschränkte Anzahl von Namen erscheint <strong>im</strong>mer wieder in den öffentliken<br />
oder privaten Quellen der Nürnberger Wirtschaftsgeschichte. Einige Familiengesellschaften<br />
nehmen wechselnd die vorderste Stellung in Nürnberg wie<br />
in <strong>Italien</strong> ein, mit dieser Besonderheit, daß sich die schon bemerkte Teilung<br />
Norditaliens in 2 verschiedene Sektoren, Venedig einerseits, das Mailändische<br />
394
<strong>und</strong> Genua andererseits, in der Geschichte der Gesellschaften zeigt, die in <strong>Italien</strong><br />
Geschäfte machen.<br />
In Mailand, Como oder Genua sind die Namen, die <strong>im</strong> 15. Jahrh<strong>und</strong>ert am<br />
öftesten erscheinen, die der Hofman, Marchold, Wilant, Zenner, die nicht das<br />
Bekanntsein <strong>und</strong> den Kredit der großen in Venedig vertretenen Patrizicrfamilien<br />
haben. Im Gegenteil, alle die großen Namen von Nürnberg werden in<br />
den venezianischen Quellen genannt: zitieren wir unter denen, die am dauerhaftesten<br />
tätig waren: die Graneti, Gross, Haller, Hirsvogel, Imhoff, Koler,<br />
Kress, Paumgartner, Pfinzig, Pirckhe<strong>im</strong>er, Rummel, Schürstab <strong>und</strong> die Tucher.<br />
Aber man kann sich nicht <strong>im</strong>mer auf die Patriziernamen verlassen, um die<br />
Konturen des großen Handels einzukreisen, denn das Glück ändert das Gesicht<br />
rasch <strong>und</strong> ein Konkurs führt eine Familiengesellschaft auf das bescheidene<br />
Niveau zurück, von dem die Ahnen den Aufstieg machten. Andererseits<br />
können unzählige kleine Kaufleute, deren Namen man kaum kennt, indem<br />
sie ihr Glück versuchen, von einem Moment zum anderen die Faktoren, Kommissionäre,<br />
sogar die Strohmänner von solch bekannten Gesellschaften sein.<br />
Man muß z. B. wissen, daß ein gewisser Bernoldus, ein Nürnberger in Mailand,<br />
der <strong>im</strong> Jahre 1376 mit Ulrich Eisvogel <strong>und</strong> Konzman Stromer eine<br />
Schuld von 4000.— Pf<strong>und</strong> für Barchentlieferungen teilt, ein Faktor der Stromer<br />
ist 16). Wieviele Unbekannte in den Büchern der Soranzo von Venedig neben<br />
den Patriziern!<br />
Die mittleren Kreise sind am schwersten zu würdigen: Bernhardus, ein<br />
Gastwirt in der Nähe der Porta Romana in Mailand <strong>im</strong> Jahre 1470 machte<br />
mit Landsleuten in stark heterogenen Waren Abschlüsse: Schiefer <strong>und</strong> <strong>im</strong>portierte<br />
Steine, Schellen <strong>und</strong> Löffel aus Nürnberg, Kochenille, Baumwolle, Häute,<br />
Riemen, alles auf der Messe von Crema gekauft. Der Umfang seiner Geschäfte<br />
ist ansehnlich; man kann diesen Gastwirt nicht zu den Detaillisten zählen <strong>und</strong><br />
er genießt, ohne ein Großkaufmann zu sein, einen Kredit den ihm ohne Zweifel<br />
seine Profession verschafft 57)<br />
Im Rahmen der mittelalterlichen Wirtschaft geben weder die Natur noch<br />
der Umfang der Käufe <strong>und</strong> Verkäufe, deren verbriefte Unterlagen uns zufällig<br />
die Einzelheiten übermittelt haben, einen unwiderleglichen Beweis von<br />
Reichtum oder Mittelmäßigkeit, wenn die Kontobücher nicht gestatten, den<br />
fortgesetzten Gang eines Unternehmens zu verfolgen. Man kann aber den<br />
Anteil beurteilen, den die Deutschen <strong>und</strong> insbesondere die Nürnberger am<br />
italienischen Wirtschaftsleben hatten, indem man einige Zahlen <strong>und</strong> Unterlagen<br />
aufführt: massige Käufe <strong>und</strong> Verkäufe, Betrag der Schulden, Einnahmen des<br />
Zollamts nach den zeitzenössischen Schätzungen die bei weitem nicht die Zuverlässigkeit<br />
von Statistiken haben.<br />
Erinnern wir uns, daß der italienische Safran sich auf Venedig <strong>und</strong> Mailand<br />
konzentrierte, ehe er zum großen Teil nach Nürnberg verladen wurde,<br />
daß Kupfer <strong>und</strong> Silber von den Augsburgern <strong>und</strong> Nürnbergern in großen Massen<br />
nach dem italienischen Markt tranportiert wurde. Die Staatsaufträge erhöhten<br />
noch den Austausch. Die Gesellschaft Rummel-Hirsvogel befaßte sich<br />
56) A. Schulte, Handel <strong>und</strong> Verkehr ... II, Nr. 137, 146, 147; ich verdanke diesen Hinweis<br />
Herrn Dr. W. von Stromer.<br />
57) A. Schulte, Handel <strong>und</strong> Verkehr ... II, Nr. 170, 171, 184a, 185.<br />
395
anno 1444 mit Salpeterkäufen für Nürnberg"). Der Bankier Andrea de Garzoni<br />
verhandelte anno 1495 mit mehreren deutschen Gesellschaften über die<br />
Lieferung von Kupfer für das venezianische Arsenal 59). Seyfrid Schmelzing<br />
hinterließ anno 1432 5500 Gulden Schulden an Venedig, Konrad Kress 7000<br />
Dukaten 1431, Thomas Kurz fast ebensoviel 148260). Der Bankrott Garzoni<br />
schädigte die Deutschen anno 1499 um 30 000 Dukaten61).<br />
Bekanntlich ist der Gesamteinsatz der Deutschen mit Venedig von Paolo<br />
Morosini anno 1472 auf eine Million Dukaten geschätzt worden 61), <strong>und</strong> man<br />
hat Angaben über die ausländischen Investierungen bei der öffentlichen Schuld<br />
oder „<strong>im</strong>prestita". Schon 1422, wird ein Nürnberger mehrere Jahrzehnte vor<br />
den Augsburgern, der vielleicht nur ein Strohmann ist, Johannes Daga, ermächtigt<br />
um 10000 Dukaten „<strong>im</strong>prestita" zu kaufen 63).<br />
In einem besonderen Sektor der italienischen Wirtschaft haben die Nürnberger<br />
Geschäftsleute ihre kommerziellen Tätigkeiten durch eine direkte Kontrolle<br />
der Produktion verlängert. Die Wollindustrie des Gebietes von Como<br />
war von den deutschen Unternehmen wegen ihres Bedarfes an Rohstoffen<br />
ebenso wie für den Absatz ihrer Fertigerzeugnisse abhängig 64).<br />
Kurzum, es gibt wenig Sektoren der Wirtschaft, in denen sich der deutsche<br />
Einfluß nicht abzeichnet, <strong>und</strong> mit Ausnahme der Geldgeschäfte, bei denen die<br />
Nürnberger sich zurückhaltender gezeigt haben, ist es gewiß, daß die Nürnberger<br />
Anwesenheit in <strong>Italien</strong> ein Antrieb zur Expansion war.<br />
Die Praxis der Märkte <strong>und</strong> die Kenntnis der Kurse setzte ein Relaissystem<br />
<strong>und</strong> Beobachtungsposten für die Weitergabe der Gelder <strong>und</strong> Nachrichten voraus.<br />
In <strong>Italien</strong> wurde das Problem wie auf den anderen Plätzen durch die Bezahlung<br />
von Beauftragten, der Errichtung von Handelsniederlassungen oder<br />
der Gründung eines Korrespondenznetzes gelöst, das, je nach Bedeutung der<br />
Gesellschaft <strong>und</strong> Enge der Bindungen, von den Geschäften auf Kommission bis<br />
zur gemischten Gesellschaft ging.<br />
Die meisten Kaufmannssöhne begannen ihre Lehrzeit <strong>im</strong> Ausland, dann<br />
reisten sie nach Beendigung ihrer Schulung für Rechnung der Familiengesellschaft<br />
oder traten in den Dienst eines Geschäftsfre<strong>und</strong>es. Venedig war in jeder<br />
Beziehung die beste Schule, weil <strong>Italien</strong>isch die internationale Handelssprache<br />
war <strong>und</strong> schon 1342 hielten sich junge Deutsche <strong>im</strong> Fondaco dei Tedeschi ‚causa<br />
adiscendi linguam' 65) auf, Der Aufenthalt in Venedig wurde besonders empfohlen,<br />
um sich am Rialto mit der Tagespraxis der Geschäfte <strong>und</strong> der Buchführungstechnik<br />
vertraut zu machen.<br />
58) H. S<strong>im</strong>onsfcld, Fondaco... 1, Nr. 450.<br />
59) H. S<strong>im</strong>onsfeld, Fondaco ... 1, Nr. 597.<br />
60) H. S<strong>im</strong>onsfeld, Fondaco ... 1, Nr. 388; Nr. 373-382; Nr. 561.<br />
61) M. Sanudo, 1 Diarii ... Bd. 2, S. 736.<br />
62) Brief des Paolo Morosini an Gregor von Heymburg, „De rebus ac forma reipublice<br />
venete" (Bibl. S. Marci, Cod. lat. X, LXXVI, fol. 52), angeführt bei G. M. Thomas,<br />
Capitolare . . . S. VI.<br />
63) H. S<strong>im</strong>onsfeld, Fondaco ... 1, Nr. 329.<br />
64) Akten des Notars Ccrmenate von Como, mehrfad; vgl. A. Schulte, Handel <strong>und</strong> Verkehr<br />
II, Nr. 200-245.<br />
65) H. S<strong>im</strong>onsfcld, Fondaco... 1, Nr. 801.<br />
396
Vom Tagesleben der wandernden oder in einer Niederlassung installierten<br />
Angestellten geben die Papiere der Ravensburger Gesellschaft oder die Briefe<br />
der Familie Beha<strong>im</strong> ein präzises, farbiges <strong>und</strong> einzigartiges Bild: Finanzierungsprobleme,<br />
Verfolgung widerspenstiger Schuldner, Politik der Käufe werden<br />
aufgegriffen <strong>und</strong> dank der reichlichen Briefschaften, die <strong>zwischen</strong> der Direktion<br />
<strong>und</strong> den ausländischen Filialen hin <strong>und</strong> hergingen, entschieden.<br />
Aber die Inanspruchnahme der ausländischen Dienstleistungen gestattet<br />
den Geschäftsleuten ihre Tätigkeit zu entfalten, ohne den Rahmen ihrer Gesellschaft<br />
ausdehnen zu müssen. Seit dem 14. Jahrh<strong>und</strong>ert erwiesen sich die Nürnberger<br />
unter sich den Dienst des Kommissionsgeschäfts. Die neue Tatsache vom<br />
Beginn des 15. Jahrh<strong>und</strong>erts an ist die wachsende Zahl der Einkaufs- <strong>und</strong> Verkaufsvollmachten<br />
für das Geschäft mit <strong>Italien</strong> <strong>und</strong> das Eintreten der Nürnberger<br />
in mehr oder minder dauerhafte Assoziierungen mit Ausländern, <strong>Italien</strong>deutschen<br />
oder <strong>Italien</strong>ern.<br />
Die <strong>zwischen</strong> Nürnbergern <strong>und</strong> anderen Deutschen getroffenen Absprachen<br />
sind häufiger als direkt mit <strong>Italien</strong>ern geschlossene Verträge. Die Gesellschaften<br />
wurden meistens vor der Abreise aus Deutschland gegründet, weil man als<br />
ausländischen Sozius einen gewöhnlichen Korrespondenten zuließ oder einen<br />
oft in <strong>Italien</strong> oder auf den Frankfurter Messen getroffenen Geschäftsfre<strong>und</strong>.<br />
Ulrich Meyer schloß Geschäfte in Frankfurt für die Fa. Kress. Johannes Gep<br />
assozierte sich 1393 mit einem Ulmer, der in Mailand ansäßig war). Peter<br />
Wargner, in Venedig etabliert, wünscht dort <strong>im</strong> Jahre 1436 von seinen Partnern<br />
Koler zurückbezahlt zu werden, aber er wird in Nürnberg bezahlt, wohin<br />
er sich oft begibt 67). Doch die Tätigkeitsgebiete der großen Gesellschaften Überschneiden<br />
sich ziemlich oft, so daß <strong>Italien</strong>er <strong>und</strong> Nürnberger in direkten Kontakt<br />
auf dem einen oder anderen Platz treten, dank ihrer gemeinsamen <strong>Beziehungen</strong><br />
<strong>und</strong> der gegenseitigen Diensten, die sich ihre Faktoren oder Kommissionäre<br />
durch Transporte, die sie sich anvertrauen, oder Krediten, die sei sich gewähren,<br />
leisten.<br />
Diese Geschäftsverbindungen werden durch zahllose Texte bezeugt, die von<br />
öffentlichen Behörden <strong>und</strong> privaten Quellen stammen, deren Bestandsaufnahme<br />
weit davon entfernt ist, vollkommen zu sein. Bringen wir hier 2 Beispiele<br />
einer Geschäftssolidarität <strong>zwischen</strong> Nürnberger <strong>und</strong> <strong>Italien</strong>ern zur<br />
Sprache, die sich durch echte Fre<strong>und</strong>schaftsbande verdoppelt.<br />
Ein Dokument von 1408, das in den intakten Archiven von Francesco di<br />
Marco Datini aus Prato entdeckt worden ist, läßt den Kredit durchblicken, den<br />
bei diesem florentinischen Kaufmann ein Nürnberger Großkaufmann, Nicolas<br />
Rummel, genoß 68). Die 2 Geschäftsleute konnten miteinander in Kontakt treten,<br />
entweder auf den rheinischen Messen oder in Brügge, wo Datini seine deutschen<br />
Transaktionen durch die Gesellschaft Orlandini - Benizi regulieren ließ<br />
oder in Genua, wo Datini seit 1392 eine Vertretung auf der Straße von Avignon<br />
<strong>und</strong> von Spanien, hatte, oder in Venedig, wo die Rummel seit 1350 <strong>und</strong> Datini<br />
66) A. Schulte, Handel <strong>und</strong> Verkehr . . . II, Nr. 156.<br />
67) H. S<strong>im</strong>onsfeld, Fondaco... 1, Nr. 411.<br />
65) K. F. Gruber, „Nicholaio Romolo da Noribergho. Ein Beitrag zur Nürnberger Handelsgeschichte<br />
des 14115. Jahrh<strong>und</strong>erts aus dem Archivio Datini in Frato (Toscana), Mitteilungen<br />
des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 47, 1956, S. 416-425.<br />
397
mindestens seit 1380 auftraten. Von Brügge aus teilt 1408 ein Faktor von<br />
Datini der Filiale von Barcelona das baldige Vorbeikommen in St. Jacques de<br />
Compostella von „Nicholaio Romolo da Noribcrgho" <strong>und</strong> einem <strong>Italien</strong>er von<br />
Brügge mit <strong>und</strong> bittet ihn, eventuell Barvorschüsse zu ihrer Verfügung zu<br />
stellen, „percbe sono grandi nostri amici e persone da bene (weil sie wirklich<br />
große Fre<strong>und</strong>e von uns sind <strong>und</strong> hochanständige Leute)".<br />
Ein 2. Beispiel ist noch aufklärender, da verschiedene Nachrichten aus den<br />
Archiven Kress von Nürnberg gestatten, die engen <strong>Beziehungen</strong> zu verfolgen,<br />
die nicht bloß 2 Kaufleute, sondern ab Ende des 14. Jahrh<strong>und</strong>erts 2 Familien<br />
in ihren sukzessiven Gesellschaften verbanden"').<br />
Unter den Dokumenten der Gesellschaft der Söhne von Friedrich II. Kress,<br />
vor allem Konten der venezianischen Filiale <strong>zwischen</strong> 1389 <strong>und</strong> 1397, befinden<br />
sich 2 Briefe adressiert aus Venedig <strong>im</strong> Herbst 1392 an Hilpolt Kress<br />
von einem venezianischen Kaufmann, Amado de Amadi. Die Familie Amadi,<br />
die wiederholt in <strong>Beziehungen</strong> mit Deutschen von Konstanz <strong>und</strong> Leipzig<br />
erscheint, scheint besonders mit den Kress verb<strong>und</strong>en. Francesco Arnadi,<br />
Bruder des Amado, hält sich 1392 bei seinen Fre<strong>und</strong>en Kress auf. Fritz Kress,<br />
Sohn des Konrad <strong>und</strong> Neffe des Hilpolt, wohnt in Venedig anno 1424 bei<br />
dem Sohn von Francesco, Giovanni, <strong>und</strong> 4 Jahre später, reist Aluise, ein anderer<br />
Sohn von Francesco, nach Nürnberg, um sich bei den Kress aufzuhalten. Beachten<br />
wir noch, daß es bei dem Hausnotar der Amadi ist, daß Hieronymus,<br />
Sohn des Konrad Kress, zu Venedig anno 1430 sein Testament macht <strong>und</strong><br />
daß Hilpolt Kress in seinem Vermächtnis nicht die Armen von S. Marco vergißt.<br />
Der Ton der Briefe von 1392 <strong>und</strong> manche Ausdrücke lassen darauf schließen,<br />
daß diese Geschäftskorrespondenz normal war; reich an Informationen allgemeiner<br />
Art über den Stand des venezianischen Marktes <strong>und</strong> an besonderen<br />
Informationen über die von den Gebrüdern Amadi getätigten Geschäfte für<br />
Rechnung ihrer Nürnberger Fre<strong>und</strong>e, lassen uns diese Briefe durchblicken, auf<br />
welcher zerbrechlichen <strong>und</strong> kostbaren Basis, der Neuigkeit, die Einkaufs- <strong>und</strong><br />
Verkaufspolitik der Geschäftsleute des Mittelalters ruht. Es wäre gewagt, sich<br />
vorzustellen, daß die Amadi <strong>und</strong> die Kress unter sich Ende des 14. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
oder anfangs des 15. Jh. eine echte Vertragsgesellschaft gegründet hätten.<br />
Bekanntlich weist die Struktur selbst des venezianischen Handels einen betonten<br />
Vorzug für die Kommission <strong>und</strong> die elastischen Gesellschaften auf. Es genügt<br />
die Betrachtung, daß die Kress <strong>und</strong> die Amadi für einander der kostbare Rückhalt<br />
<strong>im</strong> Ausland waren, den jeder Kaufmann suchen mußte, um sein Unternehmungsnetz<br />
auf Auskünfte <strong>und</strong> geleistete Dienste <strong>im</strong> beiderseitigen Vertrauen<br />
aufzubauen.<br />
Die Politik der gegenseitigen Dienste führte mitunter Deutsche <strong>und</strong> <strong>Italien</strong>er<br />
zur Zusammenarbeit in ein <strong>und</strong> derselben Gesellschaft zusammen <strong>und</strong> die Tatsache<br />
ist vor allem <strong>im</strong> Mailändischcn bezeugt. Also nötigte das Produktionssystem<br />
diejenigen der Nürnberger, die nicht am Platze residierten, ihren permanenten<br />
Vertreter in <strong>Italien</strong> an ihren Gewinnen teilhaben zu lassen oder<br />
69) Ph. Braunstein, Relations d'affaires entre Wnitiens et Nurembergeois ä la fin du 140<br />
sicle. Mlanges d'Arcbtologie et d'Histoire de L'Ecole Franaise de Rome, 1964, S. 227<br />
bis 269.<br />
398
in einem italienischen Unternehmen zu investieren. Konrad Misner (Meichsner?)<br />
war <strong>im</strong> Jahre 1436 Sozius der Mailänder Gesellschaft Antonio Capra,<br />
der über Deutschland englische Wolle <strong>im</strong>portierte <strong>und</strong> die Barchente seiner<br />
Werkstätten verkaufte 70). Aber die Entfernung drohte diese gemischten Verbindungen<br />
zum Vorteil der <strong>Italien</strong>er zu brechen. Mit Hilfe der Einlage<br />
deutscher Kapitalien führten sie die Geschäfte nach ihrer Weise bis zu dem<br />
Tag, da der Nürnberger inne ward, daß seine Partner ihm Geld schuldeten<br />
oder zuallermindest Geschäftskonti. Im Jahre 1521 ließ Wolfgang Saurman,<br />
den seine Verbindung mit dem großen florentinischen Unternehmen der Gebr.<br />
La Palla nicht reich gemacht hatte, in Nürnberg das Vermögen seiner Partner<br />
pfänden <strong>und</strong> verlangte obendrein in Florenz die Zahlung von 444 rheinischen<br />
Gulden 71). Die Gesellschaft Seeland-Oloferi endigte sogar tragisch: nach<br />
gemeinsamen 30 Geschäftsjahren <strong>im</strong> Königreich Neapel kam der Nürnberger<br />
mit Sohn nach L'Aquila um 3000 Dukaten zu verlangen. Er wurde von den<br />
Gebr. Oloferi in ihr Haus in Affagnano gelockt <strong>und</strong> getötet").<br />
Die Mailänder Familie der Busti scheint bei der Festigung der wirtschaftlichen<br />
Bande <strong>zwischen</strong> Nürnberg <strong>und</strong> <strong>Italien</strong> eine bedeutsame Rolle gespielt<br />
zu haben <strong>und</strong> dauerhafte <strong>Beziehungen</strong> <strong>zwischen</strong> den Busti <strong>und</strong> den Hofman<br />
von Nürnberg sind bezeugt"). 1453 werden ihnen gemeinsam gekaufte Waren<br />
in Chur konfisziert. 1462 bestellt Paulus Hofmann durch Vollmacht Andrea de<br />
Busti als seinen Vertreter in Mailand. Das Jahr darauf ordnet der Herzog von<br />
Mailand ein Schnellverfahren gegen die Schuldner der Firma „C riacus <strong>und</strong><br />
Paulus Hofman, Peter Koler <strong>und</strong> Konrad de Ja Ecclesia" an, von der Andrea<br />
de Busti die Geschäfte führt (gerit negotia). 1499 verlegt Cyriacus den Sitz der<br />
Gesellschaft Hofman nach Mailand, an der u. a. ein Mitglied der Ravensburger,<br />
Peter de Watt, der in Krakau den Rauchwarenhandel betreibt, teiln<strong>im</strong>mt.<br />
Die Gesellschaft löst sich 1504 auf, aber man findet <strong>im</strong>mer noch Busti<br />
zu Beginn des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts in Geschäftsbeziehungen mit der mächtigen<br />
Gesellschaft Koler-Kress-Saronno.<br />
Ober die letztere Firma ist man besonders gut <strong>im</strong> Bilde durch den 1506<br />
geschlossenen Vertrag <strong>zwischen</strong> Jörg Koler <strong>und</strong> Jörg Kress von Nürnberg <strong>und</strong><br />
Ambrosius de Saronno von Mailand, dessen <strong>Beziehungen</strong> auf die Zeit zurückgehen,<br />
wo die Saronno in Mailand die Interessen der Ravensburger vertraten<br />
74) Dieser einzigartige Text, der eine Handelsgesellschaft <strong>zwischen</strong> Nürnberger<br />
<strong>und</strong> Mailänder Kaufleuten gründet oder vielmehr erneuert, ist allgemeines<br />
<strong>und</strong> bedeutsames Zeugnis über die Struktur der Unternehmen von Oberdeutschland<br />
ganz zum Anfang des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts.<br />
Die Gesellschaft verkaufte in Mailand <strong>und</strong> auf den Messen zu Crcma Rohmetalle<br />
oder solche die in Nürnberg bearbeitet wurden. In der Bilanz der Geschäfte<br />
standen die deutschen Importe günstiger als die italienischen Ausfuhren.<br />
Die Käufe in <strong>Italien</strong> erstreckten sich auf Barchent <strong>und</strong> Samt aus<br />
Mailand, Seidenwaren aus Genua oder Florenz, Schmuck, Seife <strong>und</strong> Reis.<br />
70) A. Schulte, Handel <strong>und</strong> Verkehr. . . 11, Nr. 244.<br />
71) A. Schulte, Handel <strong>und</strong> Verkehr.. .11, Nr. 277.<br />
72) A. Schulte, Handel <strong>und</strong> Verkehr. . . II, Nr. 100.<br />
73) A. Schulte, Handel <strong>und</strong> Verkehr . . . 1, S. 384; II, Nr. 51, 78, 166, 169.<br />
74) A. Schulte, Handel <strong>und</strong> Verkehr. . . II, Nr. 399.<br />
399
Neben den Mailändischen, wie die Busti, die auf den Konten am häufigsten<br />
erscheinenden Namen sind die der Florentiner, die Bethono, Villani,<br />
Turrisani, Della Pala, welche den Auftakt in <strong>Italien</strong> zur Eroberung der deutschen<br />
Märkte geben. Zu gleicher Zeit geschlossene Verträge auf entfernten<br />
Plätzen, Auskünfte von beiden Seiten der Alpen sichern den Deutschen wie den<br />
<strong>Italien</strong>ern den Absatz. Das Zusammenlegen der Kapitalien ermöglichte die Ausdehnung<br />
der Unternehmen. Der Kredit, den der eine oder andere Sozius genoß,<br />
erleichterte ihre Finanzoperationen durch ihre gegenseitige Empfehlung an ihre<br />
Geschäftsfre<strong>und</strong>e; ihr Einfluß bei den Behörden sicherte ihnen die Zahlung<br />
ihrer Außenstände <strong>und</strong> die Restitution beschlagnahmter Waren. Wenn sich<br />
gemischte Unternehmen dieser Art selten finden, trotz der <strong>im</strong> Handel der Ausländer<br />
in Nürnberg am Ende des Mittelalters eingeräumten wachsenden Erleichterungen,<br />
so ist dies ohne Zweifel deswegen geschehen, weil es schwierig war,<br />
die Struktureinheit von zwei <strong>im</strong> Raum getrennten Unternehmen zu wahren, sei<br />
es, daß die Unvorsichtigkeit einer der Partner die gemeinsamen Erfolgschancen<br />
gefährdete oder daß die Hintergedanken einer der Partner aus dem Vertrag<br />
einen Betrug machte. Die Persönlichkeit der Geschäftsleute <strong>und</strong> ihre Handelserfahrung<br />
in der Partnerschaft haben zum guten Gang der Gesellschaft Koler-<br />
Kress-Saronno beitragen müssen.<br />
Eine Studie der Techniken des 'Handels <strong>und</strong> die Führung der Unternehmen<br />
müßte die Beschreibung des Nürnberger Handels in <strong>Italien</strong> verlängern.<br />
In der Tat waren die Deutschen in dieser Hinsicht genötigt fortgeschrittenere<br />
Methoden anzunehmen als die, welche noch in der deutschen Welt bisher gang<br />
<strong>und</strong> gäbe waren. Andererseits würde man durch präzise Studien lieben, die traditionelle<br />
Behauptung prüfen zu können, nach welcher der italienische Handel<br />
die Hauptquelle der Nürnberger Bereicherung war.<br />
Was den ersten Punkt anbelangt, ist es gewiß, daß der italienische Vorsprung<br />
in Buchhaltungstechnik Ende des 15. Jahrh<strong>und</strong>erts in Süddeutchland<br />
noch nicht eingeholt ist. Die Fortschritte in der Klarheit sind langsam <strong>und</strong> oft<br />
zufällig. Der chronologische Chrakter der Konti ändert sich nach <strong>und</strong> nach, je<br />
nach der Ausdehnung der zu beachtenden Geschäfte. Sagen wir, daß der logischen<br />
Verteilung der Konten, die in <strong>Italien</strong> seit 14. Jahrh<strong>und</strong>ert gängig ist, in<br />
Deutschland eine chronologische Folge entspricht die nach <strong>und</strong> nach wegen der<br />
Bequemlichkeit geändert wurde. Die Nürnberger Kaufleute notierten ihre<br />
Familienkonti gesondert.<br />
Die venezianischen Konti der Gesellschaft Kress Ende des 14. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
bezeugen das Vorhandensein mehrerer unterschiedlicher Bücher mit arabischen<br />
Zahlen bei den Berechnungen, unterscheiden Warenkonti <strong>und</strong> Personenkonti 75),<br />
aber man kann nicht vor dem Ende des 15. Jahrh<strong>und</strong>erts von einer doppelten<br />
Buchführung sprechen. Es ist jedoch nicht die Unerfahrenheit oder Ignoranz<br />
der Deutschen, der man den Unterschied in der technischen Höhe mit den<br />
<strong>Italien</strong>ern zuschreiben muß, aber vielleicht geistigen Gewohnheiten <strong>und</strong> familiären<br />
Traditionen. Die Nürnberger waren in Venedig in einer guten Schule <strong>und</strong><br />
scheinen keine besonderen Schwierigkeiten empf<strong>und</strong>en zu haben, sich in <strong>Italien</strong><br />
den Handelsbräuchen anzupassen.<br />
75) Germanisches Nationalmuseum, Kressarchiv XXVIII A, Nr. 6, 9, 12, 14, 30.<br />
400
Eine detaillierte Studie der italienischen Geschäfte der Nürnberger würde<br />
rasch in eine allgemeine Studie des oberdeutschen Großhandels ausmünden, der<br />
aber nach unserem Sinn hier nicht angesprochen werden soll. Von der Politik der<br />
Käufe <strong>und</strong> Verkäufe <strong>und</strong> von dem Streben nach Gewinn liefern uns die Handelskorrespondenzen<br />
viele Zeugnisse, die die Geschichte der großen Gesellschaften<br />
aufklären würden. Nehmen wir das Beispiel der von den Faktoren von<br />
Salzburg <strong>und</strong> dem Korrespondenten in Venedig in der Mitte des 15. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
gerichteten Briefe an den Nürnberger Sitz der Gesellschaft Beha<strong>im</strong>: ein<br />
Faktor schreibt, daß er einen Wechsel zum Satz von 133 rhein. Gulden für<br />
100 Dukaten angenommen hat, ohne zu wissen, daß man in Venedig 135 Gulden<br />
gab 76); Lienhart Hirsvogel, der Schwager von Michel III. Beha<strong>im</strong>, drängt<br />
seinen Schwager sein Pfefferlager vor der Ankunft der Galeren abzustoßen,<br />
denn die Kurse würden in Kürze sinken"). Es ist die Gegenüberstellung von<br />
genauen Angaben dieser Ordnung, die gestatten würde, den Gang der Geschäfte<br />
einer großen Nürnberger Gesellschaft zu verfolgen.<br />
Die Gewinne sind schwer zu schätzen <strong>und</strong> man muß sich mit Schätzungen<br />
allgemeiner Art begnügen. Am Ende des 15. Jahrh<strong>und</strong>erts hat man die Zahl<br />
um 10% per annum bei der Firma Imhof vorgerückt. Ein Einzelgeschäft kann<br />
100 0/o <strong>und</strong> selbst mehr eintragen, aber auf eine kontinuierliche Zeit berechnet,<br />
würden die Gewinne <strong>im</strong> Warenhandel ohne Zweifel schwächer am Schluß als<br />
am Anfang des Jahrh<strong>und</strong>erts sein. Die Nürnberger werden am Schluß des<br />
15. Jh. angeregt, die Gestehungspreise der Speditionen, die den Handel mit<br />
<strong>Italien</strong> schwer belasten, zu senken, indem sie sich <strong>im</strong>mer mehr des Seeweges<br />
bedienen, d. h. über Antwerpen. Die Verschiedenheit ihrer Unternehmen gestartet<br />
übrigens gewissen Gesellschaften mehr <strong>im</strong> Bergwerksabenteuer zu riskieren.<br />
Kupfer begründet den Reichtum der Imhoff ebenso sehr wie Safran.<br />
Man möchte gern bei kontinuierlichen Reihen die parallel erzielten Gewinne<br />
bei den Gewürzen <strong>und</strong> Metallen in Nürnberg verfolgen <strong>und</strong> sehen, auf welche<br />
Weise die Nürnberger ihr Vermögen gegründet haben.<br />
Die wirtschaftlichen <strong>Beziehungen</strong> mit <strong>Italien</strong> haben großenteils zum Aufschwung<br />
Nürnbergs am Ende des Mittelalters beigetragen. Zunächst haben die<br />
deutschen Kaufleute ihr Vermögen mit dem Fernhandel in Venedig gemacht.<br />
Nach italienischem Muster haben sie ihre kommerziellen Techniken verbessert.<br />
Der Austausch <strong>zwischen</strong> Nürnberg <strong>und</strong> den italienischen Städten erstreckte sich<br />
vor allem auf Metalle, Spezereien <strong>und</strong> Luxusartikel. In seinen wesentlichen<br />
Linien schon in der Mitte des 14. Jahrh<strong>und</strong>erts skizziert, erweiterte sich dieser<br />
Handelsstrom <strong>im</strong> 15. Jahrh<strong>und</strong>ert, begünstigt durch die Lage Nürnbergs, das<br />
<strong>im</strong> Zentrum Europas verstand,die Waren des Südens auf den Ost- <strong>und</strong> Nordmärkten<br />
zu verteilen <strong>und</strong> nach <strong>Italien</strong> Kupfer <strong>und</strong> Silber sowie die nordischen<br />
Erzeugnisse zu liefern. Die Kaufleute, die ohne Hemmnisse die Wirtschaftspolitik<br />
der Stadt lenkten, orientierten die gewerbliche Produktion Nürnbergs<br />
76) Germanisches Nationalmuseum, Beha<strong>im</strong>ardiv 102, 1, 5 (Jörg Forstcr der Frau Michael<br />
Bcha<strong>im</strong>s, 1443, September 18).<br />
77) Germanisches Nationalmuseum, Beha<strong>im</strong>archiv 102, 1, 5 (Lienhart Hirschvogel an Michael<br />
Beha<strong>im</strong>, 1443, September 9 <strong>und</strong> 27); vgl. L. Veit, Handel <strong>und</strong> Wandel mit aller Welt,<br />
München 1960, S. 44.<br />
26<br />
401
L4<br />
nach einem Qualitätsexport <strong>und</strong> sicherten sich vorrangige Stellungen auf den<br />
italienischen Plätzen.<br />
Die Entdeckung der Neuen Welt <strong>und</strong> neuer Handelsstraßen kennzeichnet<br />
eine wichtige Etappe in der Bewegung, die seit mehreren Jahrh<strong>und</strong>erten den<br />
Wirtschaftsraum bis zu den Grenzen der bekannten Welt ausdehnte. Die Bildung<br />
von Monopolen <strong>und</strong> Kartellen <strong>im</strong> 16. Jahrh<strong>und</strong>ert beendigt nur durch<br />
den Umfang <strong>und</strong> das Volumen der Unternehmungen die Organisationsformen<br />
des vorhergehenden Jahrh<strong>und</strong>erts. An der Schwelle des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts stellt<br />
sich die Frage der Zukunft Nürnbergs <strong>und</strong> seiner BezieLunen mit <strong>Italien</strong>.<br />
Es ist gewiß, daß die großen Entdeckungen den Schwernunkt von Europa<br />
nach dem Westen verlegt haben. Die wachsende Rolle, die Antwerpen in der<br />
Weiterverteilung der Gewürze <strong>und</strong> Edelmetalle spielt, zieht schon Ende des<br />
15. Jahrh<strong>und</strong>erts die Nürnberger <strong>und</strong> Augsburger Kaufleute nach den Niederlanden.<br />
Aber während die Hansastädte ein Wiederaufleben ihrer Vitalität<br />
durch die Verschiebung der Kraftlinien finden, verlieren die süddeutschen<br />
Städte ihre Rolle als euro,,äisdier Vermittler.<br />
Die Nürnberger die <strong>im</strong> 15. Jahrh<strong>und</strong>ert am Entstehungsort russische Rauchwaren,<br />
böhmisches Kupfer, englische Wolle <strong>und</strong> Safran von Aquila aufkauften,<br />
versuchten den Portugiesen <strong>und</strong> Spaniern an die Quellen der Gewürze <strong>und</strong><br />
Edelmetalle Asiens <strong>und</strong> Amerikas zu folgen. Man sieht 1505 die Hirsvogel <strong>und</strong><br />
die Imhoff, die sich mit Geschäftsleuten von Augsburg liiert haben, nach Lissabon<br />
auf dem Seeweg <strong>und</strong> von dort weiter nach Indien zu reisen. Ebenso<br />
nehmen die Weiser Fuß in Venezuela. Die Deutschen stoßen aber bald auf die<br />
Fremdenpolitik der Portugiesen <strong>und</strong> Spanier. Die Tätigkeit der Städte paßt<br />
nicht mehr in die Staatsraison <strong>und</strong> die deutschen Geschäftsleute müssen vor den<br />
Toren eines engergewordenen Europas haltmachen.<br />
Mit <strong>Italien</strong> dauern die <strong>Beziehungen</strong> fort <strong>und</strong> die <strong>im</strong>portierten Waren aus<br />
<strong>Italien</strong> bleiben bis zum 18. Jahrh<strong>und</strong>ert der wichtigste Posten der Transit- <strong>und</strong><br />
Verbrauchsgüter in Nürnberg. Pess<strong>im</strong>istische Beobachter konnten zu Beginn<br />
des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts befürchten, daß die deutschen Kaufleute, von dem niedrigen<br />
Preis für Pfeffer in Antwerpen angezogen, den venezianischen Markt<br />
aufgäben, wie sie es <strong>im</strong> letzten Viertel des 15. Jahrh<strong>und</strong>erts vorgezogen hatten,<br />
den Safran in Mailand <strong>und</strong> in Aquila zu kaufen. Aber die Aufregung war<br />
kurz. Der Markt von Venedig war noch ziemlich reichhaltig <strong>und</strong> seine industrielle<br />
Produktion ziemlich blühend, sodaß die Nürnberger die Route zum<br />
adriatischen Meer <strong>und</strong> die alten Gewohnheiten weiter pflegten. Die Basis der<br />
venezianischen Wirtschaft <strong>und</strong> der Geschäfte der „deutschen Nation", der<br />
Fondaco, wurde am 28. Januar 1505 durch ein Schadenfeuer zerstört. Schon<br />
tags darauf beschloß der Senat den Bau eines größeren <strong>und</strong> schöneren Gebäudes<br />
als das vorhergehende. Dieses Vertrauen in die Zukunft war gerechtfertigt.<br />
Die Nürnberger Kaufleute haben niemals soviel als wie zu Beginn des<br />
16. Jahrh<strong>und</strong>erts die Kurse <strong>und</strong> Neuigkeiten verfolgt, die aus Venedig, Mailand<br />
oder Genua kamen. In der von dem Nürnberger Lorenz Meder 1558 verfaßten<br />
Abhandlung über Handelspraxis n<strong>im</strong>mt Venedig <strong>im</strong>mer noch den<br />
1. Platz unter den Großstädten <strong>Italien</strong>s <strong>und</strong> Europas ein.<br />
Aber Nürnberg wird nun von dem, was seine Stärke ausmachte, ein schlechter<br />
Dienst erwiesen. Seine Familengesellschaften sind bis auf einige Ausnahmen<br />
402
nicht genug mächtig, um mit gleichen Waffen gegen die Konkurrenz der Monopole<br />
anzukämpfen, welche sie aus den Bergwerken Zentraleuropas verdrängten,<br />
<strong>und</strong> zu den Gewinnen an den Waren den Nutzen wichtiger Kreditgeschäfte<br />
hinzufügen. Daß zu Beginn des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts in Nürnberg italienische<br />
Gesellschaften <strong>und</strong> vor allem florentinische Fuß faßten, beweist, daß Nürnberg<br />
aufgehört hat, die internationale Vermittlerrolle zu spielen welche es seit<br />
2 Jahrh<strong>und</strong>erten übernommen hatte.<br />
Literaturübersicht zur Geschichte der Handelsbeziehungen <strong>zwischen</strong> Nürnberg <strong>und</strong> <strong>Italien</strong><br />
am Ende des Mittelalters.<br />
1. VeräfJentljd,te Quellen:<br />
Zahlreiche Publikationen, namentlich in den großen nationalen Sammelwerken bieten Texte<br />
oder nützliche Regesten. Die folgende Aufstellung erhebt nicht den Anspruch erschöpfend zu<br />
sein.<br />
Chroniken:<br />
In der Serie Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis in's 16. Jahrh<strong>und</strong>ert, hrsg.<br />
von K. von Hegel, sei genannt (1. Bd. Leipzig 1862, S. 23-106, Nachdruck: Göttingen 1961):<br />
Stromeier, Ulman, Püchel von meins gesIecht vnd von abentewr. (1360—) 1385-1407. Die<br />
Denkschrift von U. S. enthält genaue Angaben über die Handelsbräuche in Genua <strong>und</strong> in<br />
Katalonien <strong>und</strong> Abrisse über die Tätigkeit in <strong>Italien</strong> einer der größten Nbger. Gesellschaften<br />
der Zeit.<br />
Die Biblioteca Marciana von Venedig besitzt noch zahlreiche, großenteils unveröffentlichte<br />
Chroniken des 15. Jahrh<strong>und</strong>erts, in denen wirtschaftliche Vorgänge beschrieben sind.<br />
Die Chronik des Antonio Morosini, deren Original die Wiener Nationalbibliothek verwahrt<br />
(Fonds Fosearini cl. VII. cod. 2048 <strong>und</strong> 2049) <strong>und</strong> wovon sich eine Abschrift des 19.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts in Venedig befindet, ist für die Zeit 1410-1433 redigiert worden, von den Dokumenten<br />
der herzoglichen Kanzlei ausgehend. Sie ist teilweise von Dorez <strong>und</strong> Lefivre-<br />
Pontalis, Extraits de la dironiquc Morosini relatifs ä l'histoire de France, 4 Bde., Paris 1898<br />
bis 1902, publiziert worden.<br />
Die Chronik von Giorgio Dolfin ist teilweise veröffentlicht: G. M. Thomas, Abhandlun -<br />
gen der K. bayr. Akademie der Wissenschaften, Hist. Klasse, 1868.<br />
Die Annales Veneti de Domenico Malipiero", veröffentlicht von A. Sagredo, Ardnvio<br />
Storico Itaiiano, Bd. VII, 1843, umfassen die Zeit von 1457-1500.<br />
Die Diarien von Gerolamo Priuli, veröffentlicht von A. Segre <strong>und</strong> R. Cessi, Rerum Italicarum<br />
Scriptorcs, nuova edizione curata da L. A. Muratori, T. XXIV, parte III, gehen von<br />
1494-1512 mit einer Lücke für die Jahre 1507-1508.<br />
Für das Ende des 15. Jahrh<strong>und</strong>erts ist eine der wichtigsten Quellen zur Geschichte Venedigs<br />
<strong>und</strong> Europas wegen der Vielfalt <strong>und</strong> des Reichtums seiner Angaben, die aus den zeitgenössisdien<br />
Archivbeständen der Republik Venedig herrühren:<br />
Sanudo, Mann, 1 Diarii (1496-1533), dall' autografo marciano pubbl. per cura di R.<br />
Fulin, F. Stefanj e N. Barozzi, 42 Bde., Venezia 1879-1902.<br />
Handelsbüd,er;<br />
Die germanischen Länder erscheinen in italienischen Handelsbüchern <strong>im</strong> 14. <strong>und</strong> 15. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
nur selten. Immerhin kann man wertvolle Auskünfte über die Gegenstände des<br />
deutsch-italienischen Handels finden, z. B. die Metalle in:<br />
Tarifa zoe notizia di pexi e mexure di luogi e tere die s'adovra marcadantia per ei rnondo<br />
(Ardiivio di Stato Venezia, Procuratori di San Marco, Ultra 145, fasc. 3, commissarla Zane<br />
Marcello) publ. von Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciale di Venezia,<br />
Venezia 1925.<br />
Für das Ende des 15. Jahrh<strong>und</strong>erts sinJ sehr reich an Angaben über den Handel in <strong>Italien</strong><br />
<strong>und</strong> besonders in Venedig die Papiere der Paumgärtner in Augsburg: Müller, Karl Otto,<br />
Welthandelsbräuche (1480-1540). Deutsche Handelsakten des Mittelalters <strong>und</strong> der Neuzeit,<br />
Bd. V, Stuttgart 1934.<br />
26 *<br />
403
Kontobüd,er <strong>und</strong> Geschäftsbriefe:<br />
Zu unserem Thema findet man wertvolle Angaben in:<br />
Bastian, Franz, Das Runtingerbuch (1380-1407) <strong>und</strong> verwandtes Material zum Regensburger<br />
südostdeutschen Handel <strong>und</strong> Münzwesen. Deutsche Handelsakten des Mittelalters <strong>und</strong> der<br />
Neuzeit Bde, 6-8, Regensburg, Bd. 1, 1944; Bd. 2, 1935; Bd. 3, 1943.<br />
Sassi, Salvatore, Lettere di commercio die Andrea Barbarigo mercante veneziano dcl '400<br />
Napoli 1951.<br />
Andrea Barbarigo, gut bekannt dank der bemerkenswerten Monographie, die ihm F. C.<br />
Lane gewidmet hat, Andreas Barbarigo merchant of Venice (1418-1449), Balt<strong>im</strong>ore 1944,<br />
stand in Venedig <strong>und</strong> in Brügge mit den Deutschen <strong>und</strong> vor allem mit Nürnbergern in Geschäftsbeziehungen.<br />
Notariatsard,ioe:<br />
H. von Voltelini <strong>und</strong> F. 1-luter, Die Südtiroler Notariats<strong>im</strong>breviaturcn des 13. Jahrh<strong>und</strong>erts,<br />
2 Bde., 1, Innsbruck 1899; II, Insbrudc 1951.<br />
Diese Publikation ist interessant u. a. deshalb, weil sie Material zur Frage der Prägung <strong>und</strong><br />
des Geldumlaufs in einem deutsch-italienischen Grenzgebiet liefert. Verwiesen sei auch auf A.<br />
Stella, Politica ed economia nel territorio trentino-tirolese da! XIII al XVII secolo, Padova,<br />
1958.<br />
Urk<strong>und</strong>en- <strong>und</strong> Statutenbüd,er:<br />
Predelli, Ricardo, 1 Libri Commemoriales della Repubblica di Venezia, Regesti, Monumenti<br />
Storiei publ. von der Deputazione Veneta di Storia Patria, T 1, 3, 7, 8, 10, 13, 17,<br />
Venezia 1876-1914.<br />
Verträge, Privilegien, Urteile <strong>und</strong> Verfügungen der höchsten Behörde des venezianischen<br />
Staates. Diese Publikation ist eine F<strong>und</strong>grube von Auskünften jeder Art.<br />
Thomas, Georg Martin, Capitolare dei Visdomini dcl Fontego dci Tedesdti in Venezia,<br />
Capitular des Deutschen Hauses in Venedig, Berlin 1874,<br />
Noto, Antonio, Liber Datil Mercantie Comuni Mediolani, publ. dell'Universita Cornmerciale<br />
L. Bocconi, Facolta di Storja Economica, Serie 1, Quellen, Bd. X, Milano 1950.<br />
Die besondere Bedeutung dieser Best<strong>im</strong>mungen besteht darin, daß sie sich nur auf den<br />
Handel mit Deutschland beziehen zum Unterschied der von A. Schulte veröffentlichten<br />
„Provisiones Janue. Der „Liber Dacie" wird aufbewahrt <strong>im</strong> Archiv der E. C. A. (Ente<br />
Comunale di Assistenza) in Mailand, wo er vom Verfasser aufgespürt wurde.<br />
Perorelli, Nicola, 1 Registri dell'Ufficio degli Statuti di Milano, Inventario e Regesti dcl<br />
Archivio di Stato di Milano, vol. III, 1920.<br />
Il. Darstellungen <strong>und</strong> Aufsätze:<br />
Hier ist zunächst das älteste Gesamtwerk zu zitieren, das der Handelsgeschichte Nürnbergs<br />
gewidmet ist. Es enthält zahlreiche Einzelangaben, die aus Chroniken <strong>und</strong> Archivquellen<br />
entnommen sind, Das Werk ist in seiner Konzeption überholt, jedoch noch nicht ersetzt<br />
worden:<br />
Roth, Johann Ferdinand, Geschichte des Nürnbergischen Handels, 4 Bde., Leipzig 1800-<br />
1802.<br />
Erwähnt sei ein Aufsatz neuer Zusammenschau-<br />
Schultheiß, Werner, Die wirtschaftliche Entwicklung Nürnbergs von 1040 bis 1960, Chronik<br />
der Stadtsparkasse Nürnberg, Nürnberg 1961.<br />
Zwei Werke sind für die Geschichte der wirtschaftlichen <strong>Beziehungen</strong> <strong>zwischen</strong> Nürnberg<br />
<strong>und</strong> <strong>Italien</strong> gr<strong>und</strong>legend:<br />
S<strong>im</strong>onsfeld, Henry, Der Fondaco dci Tedeschi in Venedig <strong>und</strong> die deutsch-venezianischen<br />
Handelsbeziehungen, 2 Bde., Stuttgart 1887.<br />
Schulte, Aloys, Geschichte des mittelalterlichen Handels <strong>und</strong> Verkehr <strong>zwischen</strong> Westdeutschland<br />
<strong>und</strong> <strong>Italien</strong> mit Ausschluß von Venedig, 2 Bde., Leipzig 1900. (Kritisch besprochen<br />
von G. von Below, Zur Geschichte der Handelsbeziehungen <strong>zwischen</strong> Südwestdeutschland<br />
<strong>und</strong> <strong>Italien</strong>, Historische Zeitschrift Bd 53, 1902.)<br />
Jedes dieser beiden 'Werke umfaßt den Abdruck von Quellen, Darstellung, verschiedene<br />
Listen <strong>und</strong> Verzeichnisse, Register <strong>und</strong> das letztgenannte auch eine eingehende Bibliographie.<br />
404
In der folgenden alphabetischen Liste sind nur Arbeiten erwähnt, die einen unmittelbaren<br />
Beitrag zu unserem Thema leisten:<br />
AMMANN, EL: Die Diesbads-Watt-Gesellschaft, Ein Beitrag zur Handelsgeschichte des 15.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts, Mitteilungen zur Vaterländischen Geschichte, hsg. v. Hist. Verein des Kantons<br />
St. Gallens 37, Heft 1, St. Gallen 1923.<br />
BAADER, J.: Chronik des Marktes Mittenwald, Nördlingen 1880.<br />
BASTIAN, F.; Oberdeutsche Kaufleute in den älteren Tiroler Raitbüchern (1288-1370)<br />
München 1931.<br />
BERGER, F.: Die Sept<strong>im</strong>erstraße, Jahrbuch für schweizerische Geschichte, Bd. 15, 1890.<br />
CANALI, G.: Attivitä commerciale in Alto Adige, „Alto Adige', Alcuni documenti del<br />
passato, vol. II, Bergamo 1942.<br />
CESSI, R.: Lc relazione comnsercialj tra Venezia e le Fiandre ne! secolo XIV, Nuovo<br />
Archivo Vcneco N. S., 27, 1914. Ripubbl. in Politica ed Econornia di Venezia nel Trecento,<br />
Saggi, Rom 1952.<br />
crP0LLA, C. M.: Le vie delle lane inglesi verso la Lombardia, Bollettino della Societs<br />
Pavese di Storia Patria N. S. a. 1, 1946.<br />
DOEHAERD, R.: Les relations commerciales entre Gnes, la Belgique et l'Outremont d'<br />
apres les ardiives notarialcs gnoises (1400-1440), Institut Historique Beige de Roine,<br />
Etucies d'hastoirc 4conomique et sociale, vol. 5, Bruxelles-Rome 1952.<br />
FINGER, R.: Bologna e 1 Tedeschi riet Medioevo, Scienza e Tecnica, Rivista generale di<br />
informazione Scicntifica 6, fasc. 2, 1942.<br />
FLEGLER: Die <strong>Beziehungen</strong> Nürnbergs zu Venedig, Anzeiger für K<strong>und</strong>e der deutschen Vorzeit<br />
Bd. 18, 1867.<br />
KLEIN, H.: Kaiser Sigm<strong>und</strong>s Handelssperre gegen Venedig <strong>und</strong> die Salzburger Alpenstraße,<br />
Aus Verfassungs- <strong>und</strong> Landesgeschichte, Festschrift zum 70. Geburtstag von Theodor<br />
Mayer, Konstanz 1955, Bd. II.<br />
KRÜGER, H.: Des Nürnberger Meisters Ehrhard Etzlaub älteste Straßenkarte Deutschlands,<br />
jahrbjicher für fränkische Landesk<strong>und</strong>e Bd. 18, 1958.<br />
KUMMER, R.: Aus der Geschichte des bayrischen Orienthandels, München 1927.<br />
LATTES, E.: Documenti e notizie per la Storia degli Ebrei: gli Ehrei di Nor<strong>im</strong>berga e la<br />
Repubblica di Venezia, Venezia 1872.<br />
von LIEBENAU, H.: Urk<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Regesten zur Geschichte des St. Gotthardsweges, vom<br />
Ursprung bis 1450, Archiv für schweizerische Geschichte Bd. 18, 19 <strong>und</strong> 20.<br />
MONIERT, G. B.: Le relazione dell'Aquila coi Veneziani e coi Tedeschi nel XIV e XV<br />
secolo, Rivista abruzzese di Scienze, Lettere ed Arti, 1918.<br />
MOTTA, E.: Tedeschi in Milano nel Quatrrocenco, Archivio Storico Lombardo, S. II, a.<br />
XIX, 1892.<br />
MÜLLER. J.: Das Rodwesen Bayerns <strong>und</strong> Tirols <strong>im</strong> Spätmittelalter <strong>und</strong> zu Beginn der Neuzeit,<br />
Viertel jahrsdirjft für Sozial- <strong>und</strong> Wirtschaftsgeschichte, Bd. 111, 1905.<br />
- Umfang <strong>und</strong> Hauptrouten des Nürnberger Handelsgebietes <strong>im</strong> Mittelalter, Vierteljahrschrift<br />
für Sozial- <strong>und</strong> Wirtschaftsgeschichte, Bd. VI, 1908.<br />
- Die Handelspolitik Nürnbergs <strong>im</strong> Spätmittelalter, Jahrbücher für Nationalökonomie <strong>und</strong><br />
Statistik, Bd. 38, 1909.<br />
MÜLLER, K. 0.: Quellen zur Handelsgeschichte der Paumgärener von Augsburg 1480-<br />
1570. Deutsche Handelsakten des Mittelalters <strong>und</strong> der Neuzeit Bd. IX, Wiesbaden 1955.<br />
MUSSONI, G.: L'antico commercio dclio zaffcrano nell'Aquila cd i capitolt relativi, Bollettino<br />
dclla Societä di Storia Patria Abruzzese, S. 2, a. XVIII, 1906-1907.<br />
PASCHIN!. P.: Le vic commerciali alpine de] Friuli nel Medievo, Memorte stonde forogiuliesi<br />
XX, 1924.<br />
PETINO, A.: Lo zafferano nell'economia de] medioevo, Studi di Economta e Statistica,<br />
Catana 1951,<br />
PEYER, H. K.: Leinwandeewerbe <strong>und</strong> Fernhandel der Stadt St. Gallen von den Anfangen<br />
bis 1520, 2 Bde., St. Galler wirtsdiaftgesdikhtfldie Forschungen Bd. 16, St. Gallen 1959.<br />
SCHULTE, A.: Die Fugger in Rom (1495-1523). Studien zur Geschichte des kirchlichen<br />
Finanzwesens dieser Zeit, 2 Bde., Leipzig 1904.<br />
- Die Gesdiiclste der Großen Ravensburgisc}sen Gesellschaft (1380-1530). Deutsche Handelsakten<br />
des Mittelalters <strong>und</strong> der Neuzeit Bde. 1-3, Stuttgart-Berlin 1923.<br />
- Pavia <strong>und</strong> Regensburg, Historisches Jahrbuch 52. Bd., 1932.<br />
405
SIEVEKING, H.: Aus venezianischen Handlungsbüchern, ein Beitrag zur Geschichte des<br />
Großhandels <strong>im</strong> 15. Jahrh<strong>und</strong>ert, Jahrbücher für Gesetzgebung, Verwaltung <strong>und</strong> Volkswirtschaft,<br />
Bd. 25, 1901; 26, 1902.<br />
STOLZ, 0.: Geschichte des Zollwesens, Verkehrs <strong>und</strong> Handels in Tirol <strong>und</strong> Vorarlberg,<br />
Schlern-schriften Bd. 108, 1953.<br />
- Quellen zur Geschichte des Zollwesens <strong>und</strong> Handelsverkehrs in Tirol <strong>und</strong> Vorarlberg<br />
vom 13. bis zum 18. Jahrh<strong>und</strong>ert. Deutsche Handelsakten des Mittelalters <strong>und</strong> der Neuzeit<br />
Bd. X, Wiesbaden 1955.<br />
THOMAS, G. M.: Beiträge zur Geschichte des Handelsverkehrs <strong>zwischen</strong> Venedig <strong>und</strong> der<br />
deutschen Nation, aus dem Ulmer Archiv, München 1869.<br />
- Zur Quellenk<strong>und</strong>e des venezianischen Handels <strong>und</strong> Verkehrs, mit<br />
Abhandlungen der KI. bayr. Akademie der Wissenschaften, Cl. 1,<br />
di TUCCI, R.: Genova e gli stranicri dal 12 al 17 secolo, Rivista di<br />
processuale privato, a. II, 1936.<br />
VANKA von RADLOW, 0.: Die Brcnnerstraße <strong>im</strong> Altertum <strong>und</strong><br />
Studien aus dem Gebiet der Geschichte, Prag 1900.<br />
406<br />
archivalischen Beilagen,<br />
Bd. 15, München 1879.<br />
diritto internazionale e<br />
<strong>im</strong> Mittelalter, Prager