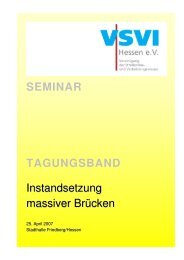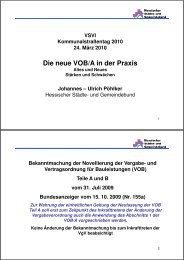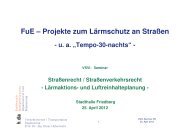Wirtschaftlichkeit von Verbundbrücken unter ... - VSVI Hessen
Wirtschaftlichkeit von Verbundbrücken unter ... - VSVI Hessen
Wirtschaftlichkeit von Verbundbrücken unter ... - VSVI Hessen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Universität Stuttgart<br />
Institut für Konstruktion und Entwurf<br />
Schwerpunkte: Stahlbau, Holzbau und Verbundbau<br />
Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann<br />
<strong>Wirtschaftlichkeit</strong> <strong>von</strong> <strong>Verbundbrücken</strong><br />
<strong>unter</strong> Berücksichtigung der Nutzungsdauer<br />
Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann<br />
Dipl.-Ing. G<strong>unter</strong> Hauf<br />
Institut für Konstruktion und Entwurf<br />
Universität Stuttgart<br />
Pfaffenwaldring 7<br />
70569 Stuttgart<br />
www.uni-stuttgart.de/ke<br />
<strong>Wirtschaftlichkeit</strong> <strong>von</strong> <strong>Verbundbrücken</strong> <strong>unter</strong> Berücksichtigung der Nutzungsdauer<br />
Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann, Dipl.-Ing. G<strong>unter</strong> Hauf, Institut für Konstruktion und Entwurf, Universität Stuttgart
Universität Stuttgart<br />
Institut für Konstruktion und Entwurf<br />
Schwerpunkte: Stahlbau, Holzbau und Verbundbau<br />
Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann<br />
1 Einführung<br />
1.1 Aufgabenstellung<br />
Unfälle und Baustellen sind die Hauptursachen für Staus. Um Staus zu vermeiden, sollte einerseits das<br />
Unfallrisiko vermieden werden, zum anderen die Beeinträchtigung durch Baustellen durch verkürzte Bauzeiten<br />
bzw. erhöhte Dauerhaftigkeit minimiert werden. Diese Kriterien spielen bisher bei der Beurteilung<br />
<strong>von</strong> Ausschreibungen <strong>von</strong> Brückenbauwerken keine Rolle. Ziel des Projekts war es, Methoden zu einer<br />
Kosten-Nutzen-Bewertung zu identifizieren, die solche Kriterien einbeziehen.<br />
Aufgabe des <strong>von</strong> der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung, Wiesbaden beauftragten Gutachtens<br />
war die Beurteilung und Untersuchung der <strong>Wirtschaftlichkeit</strong> <strong>von</strong> <strong>Verbundbrücken</strong> insbesondere <strong>unter</strong><br />
Berücksichtigung des Bauverfahrens und der Nutzungsdauer [1], [2]. Im Mittelpunkt der Untersuchung<br />
standen hierbei Überführungsbrücken (Ü-Bauwerke) und Autobahnbrücken (A-Bauwerke) im mittleren<br />
Spannweitenbereich <strong>von</strong> ca. 45m, an denen exemplarisch die verschiedenen Methoden der <strong>Wirtschaftlichkeit</strong>srechnung<br />
durchgeführt wurden.<br />
1.2 Ü-Bauwerke<br />
Während die Ü-Bauwerke aus Stahlbeton/Spannbeton üblicherweise als ein Zweifelträger (2 x 26m) ausgeführt<br />
werden, kann bei der Stahlverbundvariante die Brücke als Rahmenbauwerke (mit einer Stützweite<br />
<strong>von</strong> ca. 44m) hergestellt werden, siehe Bild 1 und 2. Der Vorteil hierin liegt im Wegfall eines Mittelpfeilers<br />
und somit in der Reduzierung des Unfallrisikos durch den räumlichen Eingriff in den Verkehr.<br />
Bild 1: Ü-Bauwerk: Spannbetonbrücke als Zweifeld-Träger<br />
Bild 2: Ü-Bauwerk: Rahmenbrücke als Stahlverbundkonstruktion<br />
Anhand umfangreicher Literaturrecherchen konnten die gesamten Baukosten der beiden Varianten ermittelt<br />
werden. Aufgrund der großen Spannweite ist die Verbundkonstruktion und um ca. 25% teurer als die<br />
2-feldrige Massivbrücke. Bei den Bauzeiten kann dagegen bei der Verwendung <strong>von</strong> Fertigteilen, z.B. mittels<br />
vorgefertigten Stahlbeton- bzw. Stahlbetonverbundträgern, durch den hohen Vorfertigungsgrad die<br />
Bauzeit und Montage vor Ort auf der Baustelle minimiert werden, was gleichzeitig zu einer reduzierten<br />
Störung des Straßenverkehrs führt.<br />
1.3 A-Bauwerke - Autobahnbrücken mit einer Stützweite <strong>von</strong> 45 m<br />
Für die Bemessung und die Ermittlung der Querschnitte wurde eine 5-Feld-Brücke mit einer Innenstützweite<br />
<strong>von</strong> 45m gewählt. Dabei wurden verschiedene Verbundquerschnittslösungen (siehe Bild 3) nach<br />
DIN-Fachbericht dimensioniert und mit einem Standard-Spannbetonhohlkasten verglichen.<br />
Auf Basis der ermittelten Massen wurden <strong>von</strong> Praktikern die Preiskalkulationen der verschiedenen Typen<br />
durchgeführt. Ein Vergleich der Baukosten zeigt hierbei, dass die Verbundvariante Typ 2, mit Stahlträgern<br />
und mittels Schalwagen hergestellte Ortbetonplatte die günstigste Variante darstellt.<br />
Vergleicht man die Bauzeiten, zeigt es sich, dass die Querschnittstypen 1 und 2 weit hinter der Variante<br />
3 und 4 liegen. Dies beruht auf dem notwendigen Einsatz eines Schalwagens. Bei den Varianten 3 und 4<br />
<strong>Wirtschaftlichkeit</strong> <strong>von</strong> <strong>Verbundbrücken</strong> <strong>unter</strong> Berücksichtigung der Nutzungsdauer<br />
Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann, Dipl.-Ing. G<strong>unter</strong> Hauf, Institut für Konstruktion und Entwurf, Universität Stuttgart
Fahrzeug<br />
Auto<br />
LKW – leicht<br />
LKW – schwer<br />
Sattelzug<br />
Bus<br />
Betriebskosten<br />
[€ / (100km · Fahrzeug)]<br />
8.7<br />
11.2<br />
15.8<br />
23.2<br />
43.6<br />
Typ<br />
Unfallrate<br />
Unfalkostenrate<br />
Kostenrate<br />
Schaden<br />
Universität Stuttgart<br />
Institut für Konstruktion und Entwurf<br />
Schwerpunkte: Stahlbau, Holzbau und Verbundbau<br />
Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann<br />
kann durch das Auflegen <strong>von</strong> Betonfertigteilen direkt aufbetoniert werden, durch die Verwendung <strong>von</strong><br />
Fertigteilverbundträger kann direkt auf die eingehobenen Träger betoniert werden, was zu einer Zeitreduzierung<br />
<strong>von</strong> ca. 30% führt.<br />
a) Typ 1: Fertigteilverbundträger mit Ortbetonplatte,<br />
Schlankheit l/h=20: 719 €/m²<br />
c) Typ 3: Stahlträger mit Betonfertigteilen und Ortbetonplatte,<br />
Schlankheit l/h=20: 671 €/m²<br />
b) Typ 2: Stahlträger mit Ortbetonplatte, Schlankheit<br />
l/h=20: 577 €/m²<br />
d) Typ 4: Fertigteilverbundträger mit Aufbetonplatte,<br />
Schlankheit l/h=20: 928 €/m²<br />
Bild 3: Varianten der <strong>unter</strong>suchten <strong>Verbundbrücken</strong>querschnitte – Brückenstützweite 45 m, Kosten für den<br />
Rohüberbau in €/m², Basis Jahr 2005<br />
2 Bewertungsmethoden für die Berechnung der Kosteneffizienz<br />
2.1 Empfehlungen für <strong>Wirtschaftlichkeit</strong>s<strong>unter</strong>suchungen an Straßen EWS [3]<br />
Die sog. EWS bildet eine Grundlage für eine volkswirtschaftliche Beurteilung und einen Variantenvergleich<br />
<strong>von</strong> Straßenbauinvestitionen nach einheitlichen Grundsätzen. Der Kern der Empfehlungen bildet<br />
hierbei die Bewertung und Untersuchung des Nutzens einer Maßnahme. Als Kosten werden die zusätzlichen<br />
Kosten der Baulast infolge einer Straßenbauinvestition definiert. Alle Maßnahmen, die nicht in den<br />
oben aufgeführten Kosten enthalten sind, werden als Nutzen bezeichnet. Sie können sowohl positiv (als<br />
Gewinn) wie auch negativ (als Verlust) mit in die Rechnung aufgenommen werden. In der EWS werden<br />
nur die Nutzen betrachtet, die quantifizierbar und monetär erfasst werden können, wie z.B.<br />
a) die Veränderung der Betriebskosten: Durch Investitionen und Änderungen des Straßenraums entstehen<br />
Veränderungen bei der Fahrtroute, -zeit und -geschwindigkeit. Wenn nun die gleichen Fahrten mit<br />
geringeren Kraftfahrzeugsbetriebskosten durchgeführt werden können, ergibt sich ein volkswirtschaftlicher<br />
Nutzen in Höhe der Betriebskosteneinsparung, siehe Tabelle 1a.<br />
b) die Veränderung des Unfallgeschehens: Der bauliche Zustand <strong>von</strong> Straßen beeinflusst ebenso wie die<br />
Verkehrssituation das Unfallgeschehen. Durch Verbesserungen der Situation nehmen die Unfallzahlen<br />
ab, die gleichzeitig zu einer Minderung der Personen- und Sachschäden führen, die wiederum quantifiziert<br />
werden können, siehe Tabelle 1b.<br />
Tabelle 1a und 1b: Angenommene Betriebskosten und Unfallkosten<br />
Sachschaden<br />
Personenschaden<br />
Sachschaden<br />
Personenschaden<br />
[Unfälle / 1 Mio. Fahrzeuge]<br />
[Unfälle / 1 Mio. Fahrzeuge]<br />
[1000 € / Unfall]<br />
[1000 € / Unfall]<br />
[€ / 1000 Fahrzeuge · km]<br />
<strong>Wirtschaftlichkeit</strong> <strong>von</strong> <strong>Verbundbrücken</strong> <strong>unter</strong> Berücksichtigung der Nutzungsdauer<br />
Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann, Dipl.-Ing. G<strong>unter</strong> Hauf, Institut für Konstruktion und Entwurf, Universität Stuttgart<br />
Wert<br />
0,619<br />
0,147<br />
8,1<br />
85<br />
17,5
Universität Stuttgart<br />
Institut für Konstruktion und Entwurf<br />
Schwerpunkte: Stahlbau, Holzbau und Verbundbau<br />
Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann<br />
2.2 Richtlinie zur Durchführung <strong>von</strong> <strong>Wirtschaftlichkeit</strong>s<strong>unter</strong>suchungen im Rahmen <strong>von</strong> Instandsetzungs-/Erneuerungsmaßnahmen<br />
bei Straßenbrücken Ri-Wi-Brü [4]<br />
Die „Richtlinie zur Durchführung <strong>von</strong> <strong>Wirtschaftlichkeit</strong>s<strong>unter</strong>suchungen im Rahmen <strong>von</strong> Instandsetzungs-/Erneuerungsmaßnahmen<br />
bei Straßenbrücken“ – nachfolgend als Ri-Wi-Brü bezeichnet - befasst<br />
sich mit der wirtschaftlichen Beurteilung <strong>von</strong> Erhaltungsmaßnahmen bei Straßenbrücken. Ziel der Richtlinie<br />
ist es, durch die Untersuchung der verschiedenen Varianten Entscheidungshilfen zu geben. Zur Bestimmung<br />
der <strong>Wirtschaftlichkeit</strong> der zu <strong>unter</strong>suchenden Varianten werden alle anfallenden Kosten zusammengerechnet.<br />
Die Baukosten einer Einzelmaßnahme setzen sich hierbei aus den reinen Baukosten<br />
(Instandsetzungs- oder Erneuerungskosten), den Kosten für Abbruch, Behelfe, Betriebserschwernisse<br />
und Verkehrsführung sowie den Verwaltungskosten zusammen. Unter der Berücksichtigung des Zeitpunktes<br />
der Maßnahmen und damit verbundenen Auszahlungen wird über eine Kapitalwertmethode die<br />
für einen festgelegten Bezugszeitpunkt (z.B. der Gegenwart) die erforderlichen Gesamtinvestitionskosten<br />
berechnet. Entsprechend werden Zahlungen, die infolge späterer Maßnahmen erst in der Zukunft getätigt<br />
werden, mittels eines Zinsfaktors abgezinst. Aus allen Zahlungen innerhalb des festgelegten Bewertungszeitraumes<br />
wird somit die Gesamtsumme gebildet, die für die verschiedenen Varianten verglichen<br />
wird.<br />
Bei der Auswahl der optimalen Variante sind das Ergebnis der <strong>Wirtschaftlichkeit</strong>s<strong>unter</strong>suchung und die<br />
Bewertung der sog. „nichtmonetären Aspekte“ gleichermaßen zu berücksichtigen. Somit sind für alle Varianten<br />
auch alle Faktoren mit einzubeziehen, die nicht durch Kostenansätze direkt ermittelt werden können,<br />
aber dennoch für die Varianten und deren Auswirkungen erheblich auf die Entscheidung Einfluss<br />
nehmen können. Diese „nichtmonetären Aspekte“ sind in [4] in einer Beurteilungsmatrix zusammengefasst<br />
und beinhalten folgende Kriterien:<br />
- Ingenieurbau (Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit und Gestaltung)<br />
- Verkehrsplanung (Beurteilung der Verkehrsführung, Leistungsfähigkeit, Lärm- und Umweltschutz)<br />
- Durchführbarkeit (Bau- und Planungsrecht, Grunderwerb, Haushalt und Bauzeit)<br />
3 Beispielrechnung für Brückenbewertung<br />
3.1 Ü-Bauwerk: EWS [3]<br />
Die hier vorgestellte und <strong>unter</strong>suchte Berechnung bezieht sich auf die BAB A 8 nördlich des Homburger<br />
Kreuzes im Rhein-Main-Gebiet (<strong>Hessen</strong>) [5]. Das Verkehrsaufkommen liegt hier bei ca. 100.00 Kfz/Tag<br />
mit einer durchschnittlichen Stauzeit <strong>von</strong> insgesamt 2 h pro Wochentag während der Berufsverkehrszeiten.<br />
Der Anteil der Kfz während des Berufsverkehrs kann mit ca. 20 % des gesamten Verkehrsaufkommens<br />
angenommen werden.<br />
Infolge der Berücksichtigung der Mehrkosten für Betrieb und dem erhöhten Unfallrisiko werden für das<br />
Untersuchungsgebiet die Herstellkosten mit den Zusatzkosten infolge der Baumaßnahme zusammengefasst<br />
und für die verschiedenen Varianten an Überführungsbauwerken miteinander verglichen, siehe Tabelle<br />
2.<br />
Durch das erhöhte Verkehrsaufkommen und vor allem die längeren Stauzeiten wirkt sich hier eine Bauzeitenverlängerung<br />
viel stärker bei den Mehrkosten durch Fahrt- und Betriebskosten aus, so dass die<br />
Betriebskosten durch die Zeitverzögerung mit fast 400 T€ pro Tag angesetzt werden können. Durch die<br />
erhöhte Unfallgefahr steigt der Anteil der Unfallkosten an den Herstellkosten der Brücke leicht an. Werden<br />
die Gesamtsummen miteinander verglichen, so erscheint die Verbundbrücke als die wirtschaftlichste<br />
Bauweise, da durch die verkürzte Bauzeit (Reduktion <strong>von</strong> 21 auf 14 Wochen) die sozio-ökonomischen<br />
Kosten am geringsten gehalten werden können. Bemerkenswert für diesen Berechnungsansatz ist, dass<br />
die entstandenen Mehrkosten ein Vielfaches der eigentlichen Herstellkosten ausmachen und damit die<br />
Baukosten an sich keinerlei entscheidende Rolle mehr bei diesem <strong>Wirtschaftlichkeit</strong>svergleich spielen.<br />
<strong>Wirtschaftlichkeit</strong> <strong>von</strong> <strong>Verbundbrücken</strong> <strong>unter</strong> Berücksichtigung der Nutzungsdauer<br />
Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann, Dipl.-Ing. G<strong>unter</strong> Hauf, Institut für Konstruktion und Entwurf, Universität Stuttgart
Tabelle 2: <strong>Wirtschaftlichkeit</strong>s<strong>unter</strong>suchung mittels EWS - Überführungsbauwerk<br />
Betonkonstuktion Betonkonstuktion<br />
(Ortbeton) (vorgefertigt)<br />
Baukosten<br />
[€] 780.000<br />
780.000<br />
Verhältnis Baukosten<br />
Betriebs-/Fahrtkosten<br />
Unfallkosten<br />
Gesamtkosten (incl. sozioökonomischer<br />
Kosten)<br />
Verhältnis der Gesamtkosten<br />
3.2 A-Bauwerk: Ri-Wi-Brü [4]<br />
[%]<br />
[€]<br />
[€]<br />
[€]<br />
[%]<br />
80<br />
41.990.025<br />
368.219<br />
43.138.244<br />
100<br />
Universität Stuttgart<br />
Institut für Konstruktion und Entwurf<br />
Schwerpunkte: Stahlbau, Holzbau und Verbundbau<br />
Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann<br />
<strong>Wirtschaftlichkeit</strong> <strong>von</strong> <strong>Verbundbrücken</strong> <strong>unter</strong> Berücksichtigung der Nutzungsdauer<br />
Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann, Dipl.-Ing. G<strong>unter</strong> Hauf, Institut für Konstruktion und Entwurf, Universität Stuttgart<br />
80<br />
29.992.875<br />
263.014<br />
31.035.889<br />
72<br />
Verbundkonstruktion<br />
976.800<br />
100<br />
27.993.360<br />
245.479<br />
29.215.639<br />
Das Beispiel ist für einen Berechnungszeitraum <strong>von</strong> 120 Jahren ausgeführt. Es werden nach der Hälfte<br />
des Zeitraums eine Sanierung der Fahrbahnplatte bei <strong>Verbundbrücken</strong> und eine Erneuerung des Brückenüberbaus<br />
bei Massivbrücken angesetzt. Eine Schwäche des Verfahrens ist zurzeit, dass für die Unterhaltskosten<br />
nur sehr pauschale Richtwerte vorliegen, so sind die Unterhaltskosten für Verbund- wie<br />
auch Massivbrücken mit 1,1 % /Jahr der Herstellkosten berechnet. Die kapitalisierten Restkosten sind<br />
infolge einer vollständigen Abschreibung über die Lebensdauer der Überbauten mit einem Wertansatz<br />
<strong>von</strong> Null nicht zu berücksichtigen.<br />
Die kapitalisierten Kosten weisen die Massivbrücke und den <strong>Verbundbrücken</strong>typ 2 als günstigste Varianten<br />
aus. Die restlichen <strong>Verbundbrücken</strong>varianten liegen mit 14 – 49 % deutlich darüber, siehe nachfolgende<br />
Abbildung.<br />
Bild 4: Kapitalisierte Kosten nach Ri-Wi-Brü [4]<br />
800.000 €<br />
700.000 €<br />
600.000 €<br />
500.000 €<br />
400.000 €<br />
300.000 €<br />
200.000 €<br />
100.000 €<br />
0 €<br />
Baukosten kapitalisierte Erstmaßnahme<br />
kapitalisierte Zweitmaßnahme kapitaliserte Unterhaltskosten<br />
kapitalisierter Restwert Summe<br />
Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Beton<br />
68
4 Zusammenfassung<br />
Universität Stuttgart<br />
Institut für Konstruktion und Entwurf<br />
Schwerpunkte: Stahlbau, Holzbau und Verbundbau<br />
Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann<br />
Anhand der Untersuchung zeigte sich, dass eine reine Berücksichtigung der Herstellkosten ohne Einbezug<br />
der Bauzeiten, Bauverfahren und Konstruktionsart nicht ausreichend für einen objektiven Vergleich<br />
der <strong>Wirtschaftlichkeit</strong> eines Brückenbauwerkes ist. Die Kosten sind über den gesamten Lebenszyklus<br />
einer Brücke zu ermitteln, um besser vergleichen zu können. Die Bewertung sollte berücksichtigen, dass<br />
in Abhängigkeit <strong>von</strong> der Verkehrsdichte durch Beschleunigung der Bauzeit erhebliche sozio-ökonomische<br />
Kosten eingespart werden können. Unter konsequenter Berücksichtigung dieser Kosten bei der Beurteilung<br />
können gerade bei Baumaßnahmen im Neubau teurere Bauverfahren und Bauweisen sich sehr<br />
schnell rechnen.<br />
Das vorliegende Gutachten zeigt, dass durch den Ansatz ganzheitlicher Betrachtungen <strong>von</strong> Bau- und<br />
Unterhaltskosten Verbundkonstruktionen im Brückenbau weitaus konkurrenzfähiger sind als bei alleiniger<br />
Betrachtung der Herstellkosten. Auch im Sinne der Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit sollte das<br />
Ziel somit sein, alle mit der Herstellung, Nutzung und Unterhalt einer Brücke verbundenen Kosten zu berücksichtigen<br />
und in eine Bewertung mit einzubeziehen.<br />
5 Literatur<br />
[1] Kuhlmann, U., Pelke, E., Hauf, G., Herrmann, T., Steiner, J., Aul, M.: Ganzheitliche <strong>Wirtschaftlichkeit</strong>sbetrachtungen<br />
bei <strong>Verbundbrücken</strong> <strong>unter</strong> Berücksichtigung des Bauverfahrens und der Nutzungsdauer,<br />
Stahlbau 76, Ausgabe 2, Seite 105-116, 2007.<br />
[2] Kuhlmann, U., Hauf, G., Steiner, J., Aul, M.: Bewertung <strong>von</strong> Bauverfahren für Stahlverbundbrücken,<br />
Gutachten für das Hessische Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen, Wiesbaden,<br />
2006.<br />
[3] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Empfehlungen für <strong>Wirtschaftlichkeit</strong>s<strong>unter</strong>suchungen<br />
an Straßen EWS (Entwurf) – Aktualisierung der RAS-W 86, Ausgabe 1997, FGSV<br />
Verlag, Köln, 1997.<br />
[4] Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen: Richtlinie zur Durchführung <strong>von</strong> <strong>Wirtschaftlichkeit</strong>s<strong>unter</strong>suchungen<br />
im Rahmen <strong>von</strong> Instandsetzungs-/Erneuerungsmaßnahmen bei<br />
Straßenbrücken, Ausgabe 2004.<br />
[5] Verkehrszentrale <strong>Hessen</strong>: Durchschnittlicher Täglicher Verkehr 2002 / 2003, Hessisches Landesamt<br />
für Straßen- und Verkehrswesen, Wiesbaden, Daten über Verkehrsstärken wurden uns<br />
vom HLSV zur Verfügung gestellt.<br />
[6] Bundesministerium für Verkehr: Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 7/1990, Sachgebiet<br />
17: Vertrags- und Verdingungswesen: „Vertretbare Mehrkosten“.<br />
[7] Bundesministerium für Verkehr: Richtlinien für die Berechung der Ablösebeträge der Erhaltungskosten<br />
für Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke, Ausgabe 1980.<br />
[8] Hauptverband der Deutschen Bauindustrie: Preisentwicklung ausgewählter Stahlprodukte in<br />
Deutschland (Stand: Januar 2005), URL: http://www.bauindustrie.de.<br />
[9] Doss, W., et al : VFT-Bauweise, Beton- und Stahlbetonbau 96 (2001), Heft 4, Verlag Ernst &<br />
Sohn, Berlin, Seite 171-180.<br />
[10] Allmeier, S., Frenzel, J., Schiefer, S., Seidl, G., Weber, J.: Innovationen im <strong>Verbundbrücken</strong>bau –<br />
Talbrücke Oberhartmannsreuth, Stahlbau 69 (2000), Heft 9, Verlag Ernst & Sohn, Berlin, Seite<br />
707-713.<br />
<strong>Wirtschaftlichkeit</strong> <strong>von</strong> <strong>Verbundbrücken</strong> <strong>unter</strong> Berücksichtigung der Nutzungsdauer<br />
Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann, Dipl.-Ing. G<strong>unter</strong> Hauf, Institut für Konstruktion und Entwurf, Universität Stuttgart