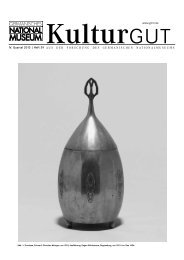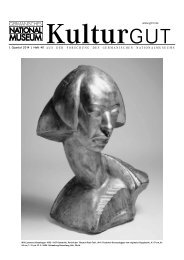Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums 2010
Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums 2010
Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums 2010
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Verena Kotonski<br />
Belederte Weidenkörbe <strong>des</strong> 19. Jahrhunderts aus Franken<br />
Untersuchungen zum technologischen Aufbau<br />
Zusammenfassung<br />
Besondere Merkmale belederter Körbe <strong>des</strong> 19. Jahrhunderts aus<br />
Franken sind der Bezug <strong>des</strong> Weidengeflechts mit verschiedenfarbigen<br />
Ledern und Pergament sowie ihre Auszier mit Metallfaden-,<br />
Zirm- und Federkielstickerei. Der Beitrag stellt die Ergebnisse<br />
der technologischen Untersuchungen von vier Armkörben<br />
aus der volkskundlichen Sammlung <strong>des</strong> <strong>Germanischen</strong> <strong>Nationalmuseums</strong><br />
in Nürnberg vor.<br />
Der Anlass zur technologischen Untersuchung von vier<br />
belederten Armkörben aus der Sammlung Volkskunde<br />
<strong>des</strong> <strong>Germanischen</strong> <strong>Nationalmuseums</strong> (Abb. 1–4) hatte<br />
zunächst konservatorische Gründe. Während der eingehenden<br />
Beschäftigung mit den Objekten im Rahmen<br />
einer Diplomarbeit am Institut für Restaurierungs- und<br />
Konservierungswissenschaft der Fachhochschule Köln<br />
(CICS –Cologne Institute of Conservation Sciences)<br />
wurde deutlich, dass die Körbe in der Forschung bisher<br />
wenig Beachtung gefunden hatten, ganz im Gegensatz<br />
zu den breiten Ledergürteln, die seit der ersten Hälfte<br />
<strong>des</strong> 18. Jahrhunderts zur männlichen Kleidung im südlichen<br />
Bayern und in Österreich gehörten. 1 Dieser Umstand<br />
ist bemerkenswert, weisen doch Körbe und<br />
Gürtel auffällige Gemeinsamkeiten hinsichtlich ihrer<br />
Herstellung auf. Ein Ziel <strong>des</strong> Beitrages ist, einen detaillierten<br />
Überblick über die verwendeten Materialien<br />
und angewandten Techniken der belederten Körbe zu<br />
geben. Es wird auf Parallelen in Gestaltung und Konstruktion<br />
zwischen den einzelnen Körben hingewiesen<br />
und versucht, die technologischen Beobachtungen in<br />
einen kulturhistorischen Kontext einzubetten. 2<br />
Beschreibung sowie zeitliche und regionale<br />
Einordnung der Körbe<br />
Der Rumpf der Weidenkörbe ist von ovaler, sich nach<br />
oben erweiternder Form, wobei die Wandung im unteren<br />
Drittel stark eingezogen ist. Ein Bügelhenkel ist in sie<br />
integriert und der gewölbte Deckel fällt in sie ein, d. h.<br />
211<br />
Abstract<br />
The unique feature of 19 th century leather-covered baskets from<br />
Franconia (Bavaria/Germany) is the combination of materials<br />
used in their manufacture: willow, leather and coloured parchment,<br />
along with decoration such as metal thread embroidery,<br />
thin leather straps and quills. This contribution presents the<br />
results of the technological examination of four of these baskets<br />
from the folk art collection of the Germanisches Nationalmuseum<br />
in Nuremberg.<br />
als Auflage für den letzteren dient ein innen in die Wandung<br />
eingearbeiteter Deckelfalz. Die Maße der Körbe<br />
sind sehr ähnlich: Ihre durchschnittliche Höhe und Breite<br />
beträgt jeweils 40,4 cm, die Tiefe 31,7 cm. Charakteristisch<br />
ist eine Belederung, die die Außenseiten komplett<br />
oder teilweise bedeckt. Sie setzt sich aus verschiedenfarbigen<br />
Leder-, Pergament- und Textilstücken zusammen<br />
und ist mit Zierstickerei auf der Korboberfläche befestigt.<br />
Zwei der vier untersuchten Körbe sind mit Jahreszahlen<br />
versehen: der teilbelederte Korb BA 1706 (Abb. 1)<br />
ist inschriftlich auf 1858 datiert, der mit Palmettenmotiv<br />
(BA 2239, Abb. 2) auf 1863. Der Korb mit Textilbesatz<br />
(BA 2234, Abb. 3) stammt wohl ebenfalls aus der Mitte<br />
<strong>des</strong> 19. Jahrhunderts. 3 Für den Korb mit Eichel- und<br />
Eichblattmotiv (BA 1894, Abb. 4) ist im Inventar eine<br />
Entstehung »um 1830/40« vermerkt. Die Herstellungsorte<br />
der Körbe sind unbekannt. Als Erwerbsorte nennen<br />
die Museumsinventare Franken bzw. Nürnberg, wobei<br />
der Korb von 1858 aus Hexenagger im Altmühltal nahe<br />
Kelheim stammt.<br />
Identifizierung der verwendeten Materialien<br />
und Techniken<br />
Der Weidenkorb<br />
Feinflechtarbeiten wie die Körbe sind überwiegend aus<br />
weißer Weide hergestellt, ein besonders hochwertiges<br />
und teures Material. Zunächst erfolgte das Zurichten<br />
der Weidenruten zu »Schienen«. 4 Eine Schiene ist eine