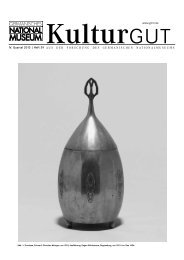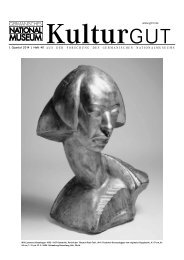Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums 2010
Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums 2010
Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums 2010
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Detlef Hoffmann<br />
Symbolische Repräsentationen neben stationären Narrationen<br />
Graphische Bildsequenzen*<br />
Zusammenfassung<br />
Der Aufsatz argumentiert gegen die Verabsolutierung der Anwendung<br />
von Narrationstheorien auf Bilder. Seine These ist,<br />
dass Bilder nicht erzählen können, sie vielmehr Situationen statuieren.<br />
Dabei wird herausgearbeitet, dass auch Sequenzen<br />
wie Dürers Apokalypse, die entlang eines Textes konzipiert<br />
sind, nicht erzählen sondern Phasen der Erzählung festhalten,<br />
sie in das verwandeln, was hier eine »Symbolische Repräsentation«<br />
genannt wird. Selbst für die Bildgeschichte, den Comic,<br />
die sich über die Erzählung definiert, kann gezeigt werden,<br />
dass die einzelnen Bilder einen über die Narration hinausgehenden<br />
Bedeutungsüberschuss produzieren.<br />
Da seit mehr als einem Jahrzehnt der Blick der Kunstgeschichte<br />
auf die Nützlichkeit von Erzähltheorien gelenkt<br />
wird, die die Literaturwissenschaften beschäftigen,<br />
1 scheint es sinnvoll, den Fokus auf die Spezifik<br />
bildlicher Konstruktionen zu richten. Diese besteht darin,<br />
dass Bilder nicht nur erzählen sondern auch statuieren,<br />
still stellen. Versteinerte Szenen, denen das Paradox<br />
der »Lebenden Bilder« zuzuordnen wäre,<br />
können nicht nur als erzählende Szenen angeschaut<br />
werden 2 sondern gleichermaßen als symbolische Gebilde,<br />
die sich nicht wie der Fluss der Erzählung immer<br />
wieder verändern und in ihrer gleich bleibenden Präsenz<br />
Bedeutung konstituieren. Das Wort statuieren<br />
stammt von Johann Wolfgang von Goethe (1749–<br />
1832), der in seiner Kritik von Karl Friedrich Lessings<br />
»Klosterhof im Schnee« aus dem Jahre 1830 schreibt:<br />
»Das sind ja lauter Negationen <strong>des</strong> Lebens, und der<br />
freundlichen Gewohnheiten <strong>des</strong> Daseins, um mich meiner<br />
eigenen Worte zu bedienen. Zuerst also die erstorbene<br />
Natur, Winterlandschaft; den Winter statuiere ich<br />
nicht; und zuletzt, nun vollends noch ein Toter, eine Leiche;<br />
den Tod aber statuiere ich nicht.« 3 Statuieren ist<br />
der Gegensatz zu Erzählen, es ist eine entscheidende<br />
Fähigkeit von Bildern, selbst in der Sequenz statuieren<br />
sie noch. Es gibt bedeutungskonstituierende Bildelemente,<br />
die mit dem symbolischen Haushalt eines Indivi-<br />
185<br />
Abstract<br />
The essay argues against absolutizing the use of narration<br />
theories for paintings. The author’s thesis is that pictures cannot<br />
tell stories but rather exemplify situations. It is elaborated, for<br />
example. that even sequences like Dürer’s Apocalypse, which<br />
are conceived parallel to a text, do not narrate but instead<br />
record phases of the narration, turning them into what is <strong>des</strong>cribed<br />
here as a »symbolic representation.« Even for picture<br />
stories, i.e. comic strips, which define themselves by way of the<br />
story, it can be shown that the individual pictures produce a<br />
surplus of meaning that goes beyond the story itself.<br />
duums oder einer Kultur funktionieren und unabhängig<br />
von <strong>des</strong>sen möglichem erzählerischen Aufbau zu Dominanten<br />
eines Bil<strong>des</strong> werden. An den beiden Extremen<br />
der Amplitude wären auf der einen Seite repräsentative<br />
Bilder zu sehen auf der anderen still gestellte<br />
Erzählungen. Der erste Fall sei an einigen Spielkarten<br />
vorgestellt, der letzte an der »Abdankung Karls V.« von<br />
Louis Gallait (1810–1887). Der narratologische Leitfaden<br />
dieses Textes sind zwei Bücher von Will Eisner<br />
(1917–2005): »Graphic Storytelling« von 1996 und<br />
»Comics and Sequential Art«, 1985 in der erste Auflage<br />
erschienen.<br />
Das erste Beispiel ist das so genannte Liechtensteinsche<br />
Spiel (Abb. 1), <strong>des</strong>sen Datierung in die Jahre 1440 bis<br />
1450 sich durchgesetzt hat. 4 Unter der vorliegenden<br />
Fragestellung sei auf den Unterschied zwischen den repräsentativ<br />
thronenden Königen und den restlichen Figuren<br />
verwiesen, die in eingefrorenen Bewegungen<br />
gezeigt werden. Sie beschäftigen sich demonstrativ mit<br />
ihren Farbzeichen Schwert, Stock, Becher und Münze.<br />
Wie im Tanz heben sie sie so hoch wie möglich in die<br />
Luft oder beugen sich zu den herab gefallenen Zeichen<br />
hinunter. Ähnliches ist in der Wappenreihe zu beobachten.<br />
Über die ersten 200 Jahre der europäischen<br />
Spielkartengeschichte ist augenscheinlich, wie diese