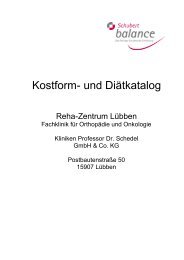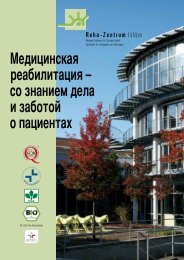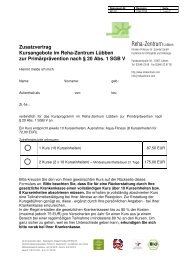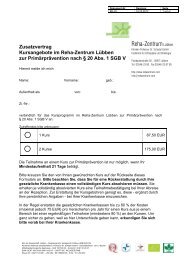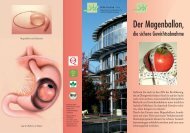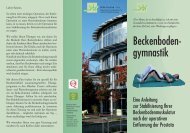Bedarfsanalyse zur Gesundheitsbildung und Gesundheitsförderung ...
Bedarfsanalyse zur Gesundheitsbildung und Gesundheitsförderung ...
Bedarfsanalyse zur Gesundheitsbildung und Gesundheitsförderung ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Hochschule Magdeburg-Stendal (FH)<br />
Fachbereich Sozial- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitswesen<br />
Studiengang Ges<strong>und</strong>heitsförderung/ -management<br />
Diplomarbeit<br />
<strong>zur</strong> Erlangung des akademischen Grades einer<br />
Diplom-Ges<strong>und</strong>heitswirtin (FH)<br />
<strong>Bedarfsanalyse</strong> <strong>zur</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>-<br />
heitsförderung im südlichen Landkreis<br />
Dahme-Spreewald als Ausgangspunkt der Arbeit im<br />
„Regionalen Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsförderung“<br />
- Initiierung eines Vernetzungsprozesses<br />
eingereicht von: Anja Janitz<br />
Matrikel 20002747<br />
Erstgutachter: Prof. Dr. Eberhard Göpel<br />
Zweitgutachterin: Ines Mula<br />
Lübbenau, im August 2005
Inhaltsverzeichnis<br />
1 Zusammenfassung.............................................................................................5<br />
2 Die Bedeutung von Vernetzung in der Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong><br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> ..........................................................................................8<br />
2.1 Die Organisationsform „Netzwerk“ ................................................................9<br />
2.2 Programmatische Gr<strong>und</strong>lagen ....................................................................11<br />
2.3 Gesetzliche Rahmenbedingungen für Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong><br />
Prävention <strong>zur</strong> Sicherung der Qualität von<br />
Ges<strong>und</strong>heitsdienstleistungen......................................................................16<br />
2.4 Akteure <strong>und</strong> Institutionen der Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong><br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> ....................................................................................20<br />
2.5 Prioritäre Handlungsfelder innerhalb der Ges<strong>und</strong>heitsförderung ................23<br />
2.5.1 Ges<strong>und</strong>heitsbezogenes Handeln ermöglichen ....................................23<br />
2.5.2 Gestaltung ges<strong>und</strong>heitsförderlicher Lebenswelten ..............................24<br />
2.5.3 Verringerung von Ungleichheiten im Ges<strong>und</strong>heitszustand ..................26<br />
2.6 Vernetzungsstrukturen für Ges<strong>und</strong>heitsförderung ......................................29<br />
2.6.1 Beispiele intersektoraler Kooperationsprogramme ..............................32<br />
2.6.1.1 europäische Netzwerke ...............................................................33<br />
2.6.1.2 deutschlandweite Netzwerke .......................................................33<br />
2.6.1.3 Netzwerke auf Länderebene........................................................39<br />
2.6.1.4 Kommunales Netzwerk................................................................40<br />
2.6.2 Vorteile <strong>und</strong> Gewinne von Netzwerkarbeit ...........................................40<br />
2.6.3 Initiierung eines Netzwerkprozesses – Auswahl <strong>und</strong> Einbindung<br />
von potentiellen Netzwerkpartnern ......................................................41<br />
2.6.4 Zielsetzungen von Netzwerken der Ges<strong>und</strong>heitsförderung/-bildung....42<br />
2.6.5 Strategien erfolgreicher Netzwerke......................................................45<br />
2.6.6 Herausforderungen <strong>und</strong> Schwierigkeiten .............................................47<br />
3 Netzwerkbildung im südlichen Teil des Landkreises Dahme-<br />
Spreewald .........................................................................................................52<br />
2
3.1 Zielgruppe ...................................................................................................52<br />
3.2 Die Vorbereitung <strong>und</strong> Initiierung des Vernetzungsprozesses......................53<br />
3.2.1 Auswahl der Netzwerkpartner..............................................................53<br />
3.2.2 Vorgehensweise ..................................................................................54<br />
3.2.3 Öffentlichkeitsarbeit .............................................................................57<br />
3.2.4 Finanzierung ........................................................................................60<br />
4 Die Untersuchung – Material <strong>und</strong> Methoden .................................................61<br />
4.1 Ausgangslage .............................................................................................65<br />
4.2 Zielstellung der Befragung ..........................................................................66<br />
4.3 Zielgruppe der Befragung ...........................................................................67<br />
4.4 Umfeld der Befragung.................................................................................67<br />
4.5 Durchführung der Befragung.......................................................................68<br />
4.6 Auswertung der Befragung .........................................................................72<br />
4.6.1 Die Beteiligung.....................................................................................73<br />
4.6.2 Die Interessenschwerpunkte der Menschen im Altkreis Lübben..........77<br />
4.6.3 Die Interessenschwerpunkte der Menschen im Altkreis Luckau ..........87<br />
4.6.4 Interessieren Sie sich für <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> <strong>und</strong> –förderung?..........96<br />
4.6.5 Haben Sie bereits an Kursen <strong>zur</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> <strong>und</strong> –<br />
förderung teilgenommen? Wenn nein, warum nicht?...........................97<br />
4.6.6 Ziehen Sie es in Erwägung in naher Zukunft an<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> <strong>und</strong> –förderung teilzunehmen? Wenn nein,<br />
warum nicht? .......................................................................................99<br />
4.6.7 Wie sollte <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> organisiert sein, um Ihr Interesse<br />
zu wecken?........................................................................................102<br />
4.6.8 Wo sollten Angebote <strong>zur</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> veröffentlicht<br />
werden, um Sie zu erreichen? ...........................................................103<br />
4.7 Diskussion der Ergebnisse........................................................................104<br />
4.7.1 Struktur der Teilnehmerschaft in der <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> .................104<br />
4.7.2 Erreichbarkeit der Teilnehmerschaft ..................................................107<br />
4.7.3 Themenbereiche der <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> -<br />
Interessenschwerpunkte....................................................................108<br />
3
5 Perspektiven <strong>und</strong> Entwicklungsmöglichkeiten ...........................................113<br />
6 Abbildungsverzeichnis..................................................................................118<br />
7 Tabellenverzeichnis .......................................................................................119<br />
8 Abkürzungsverzeichnis.................................................................................121<br />
9 Literatur...........................................................................................................123<br />
10 Anhang............................................................................................................128<br />
4
1 Zusammenfassung<br />
Um Gemeinwohl-Belange nicht an Ressort- <strong>und</strong> Zuständigkeitsgrenzen schei-<br />
tern zu lassen ist es von zunehmender Bedeutung, interstrukturelle <strong>und</strong> interor-<br />
ganisationale produktive Kooperationen aufzubauen <strong>und</strong> weiter zu entwickeln.<br />
Im Rahmen von Ges<strong>und</strong>heitsförderung wurde bereits in zahlreichen internatio-<br />
nalen Konferenzen der Handlungsschwerpunkt „vermitteln <strong>und</strong> vernetzen“ her-<br />
vorgehoben.<br />
Netzwerkarbeit <strong>und</strong> Vernetzung sind Begriffe, die personelle <strong>und</strong> strukturelle<br />
Verknüpfungen gleichermaßen bewirken. Durch Netzwerkarbeit sollen individu-<br />
elle Ressourcen aktiviert <strong>und</strong> gestärkt sowie Aktivitäten, Maßnahmen <strong>und</strong> Pro-<br />
gramme kommunaler Institutionen <strong>und</strong> Initiativen koordiniert werden. Koopera-<br />
tion <strong>und</strong> Koordination tragen <strong>zur</strong> Förderung des Individual- <strong>und</strong> Allgemeinwohls<br />
bei. Sie liefern damit einen wichtigen Beitrag <strong>zur</strong> Gestaltung zukunftsorientierter<br />
Lebenswelten.<br />
Der Fokus dieser Arbeit ist auf die Vernetzung von vermittelnden <strong>und</strong> anbieten-<br />
den Akteuren <strong>und</strong> Institutionen in der <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> im kommunalen <strong>und</strong><br />
regionalen Kontext gerichtet. Innerhalb der Arbeit werden zwei parallel durchge-<br />
führte Prozesse dokumentiert <strong>und</strong> analysiert:<br />
1. der Prozess der Vernetzung zwischen den relevanten Institutionen <strong>und</strong><br />
Organisationen sowie<br />
2. die Analyse des Bedarfs an Angeboten <strong>zur</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> in Form<br />
einer schriftlichen regionalen Bürgerbefragung als Gr<strong>und</strong>lage der Netz-<br />
werktätigkeiten.<br />
Um an die Thematik heran zu führen, wird nach der Erläuterung des Netzwerk-<br />
begriffs auf programmatische, politische <strong>und</strong> gesetzliche Gr<strong>und</strong>lagen von Ver-<br />
netzungen in der Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>zur</strong> Sicherstellung von Qualität <strong>und</strong><br />
Effizienz eingegangen. Auf der Basis dieser Rahmenbedingungen werden so-<br />
5
dann durch Literaturrecherche prioritäre Handlungsfelder ermittelt <strong>und</strong> mit der<br />
ersten Zielsetzung dieser Arbeit verknüpft, indem bereits bestehende Netzwer-<br />
ke beschrieben werden <strong>und</strong> der - im Rahmen dieser Diplomarbeit - initiierte<br />
Vernetzungsprozess dargestellt wird.<br />
Die zweite Zielsetzung ist die Analyse des Bedarfs an themenspezifischen Ge-<br />
s<strong>und</strong>heitsbildungsangeboten <strong>und</strong> der bisherigen <strong>und</strong> künftig geplanten Inan-<br />
spruchnahme von Kursen <strong>zur</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>. Hierzu wird eine regionale<br />
Bürgerbefragung durchgeführt. Die Aufbereitung dieser Analyse als Handlungs-<br />
empfehlung für die Anbieter <strong>und</strong> Vermittler von Angeboten <strong>zur</strong> Ges<strong>und</strong>heitsbil-<br />
dung ist ein wichtiges Instrument <strong>zur</strong> Entwicklung eines bedarfsgerechten, bür-<br />
gernahen <strong>und</strong> zugänglichen Angebotes in der Region des südlichen Landkrei-<br />
ses Dahme-Spreewald. Diese <strong>Bedarfsanalyse</strong> ist Ausgangspunkt für die Arbeit<br />
des „Regionalen Netzwerks Ges<strong>und</strong>heitsförderung“.<br />
Zu Beginn sei angefügt, dass die Begrifflichkeiten „Ges<strong>und</strong>heitsförderung“ <strong>und</strong><br />
„<strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>“ weitgehend parallel gebraucht werden. Dem ges<strong>und</strong>-<br />
heitswissenschaftlichen Sinn nach schließt der Begriff „Ges<strong>und</strong>heitsförderung“<br />
den der „<strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>“ ein. Die gleichwertige Behandlung beider Begriff-<br />
lichkeiten wird aber für notwendig erachtet, da das Wissen über Ges<strong>und</strong>heits-<br />
bildung in der Bevölkerung noch sehr gering ist <strong>und</strong> zumeist eine reine Wis-<br />
sensvermittlung, d.h. Schulungen <strong>und</strong> Vortragsreihen, ohne praktische Anteile,<br />
assoziiert werden (vgl.: Kap. 4.5). Die Vernetzungs- <strong>und</strong> Befragungsaktivitäten<br />
können hier <strong>zur</strong> Aufklärung beitragen.<br />
Zunächst werden beide Begriffe <strong>zur</strong> Abgrenzung definiert:<br />
„Ges<strong>und</strong>heitsförderung ist ähnlich wie der Begriff Prävention eine Bezeich-<br />
nung für Maßnahmen <strong>und</strong> Aktivitäten, mit denen die Stärkung der Ges<strong>und</strong>heits-<br />
ressourcen <strong>und</strong> -potentiale der Menschen erreicht werden soll. Während die<br />
Prävention unmittelbar auf den Erhalt der Ges<strong>und</strong>heit zielt <strong>und</strong> dabei z.B. Imp-<br />
fungen, ges<strong>und</strong>e Ernährung <strong>und</strong> ausreichende Bewegung propagiert, ist Ge-<br />
s<strong>und</strong>heitsförderung komplexer <strong>und</strong> will durch die Veränderung ökonomischer,<br />
6
sozialer, ökologischer <strong>und</strong> kultureller Faktoren bessere Bedingungen für gesun-<br />
des Leben schaffen.<br />
Ursprünglich wurde das Konzept der Ges<strong>und</strong>heitsförderung 1986 von der Welt-<br />
ges<strong>und</strong>heitsorganisation (WHO) entwickelt <strong>und</strong> in der Ottawa-Charta zusam-<br />
mengefasst.<br />
Weltweit gibt es verschiedene Netzwerke der Ges<strong>und</strong>heitsförderung, unter an-<br />
derem das „Netzwerk Ges<strong>und</strong>e Städte“, das „Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernder<br />
Krankenhäuser“, das „Deutsche Netzwerk betriebliche Ges<strong>und</strong>heitsförderung“<br />
oder „Schule & Ges<strong>und</strong>heit“.“ (vgl. Kap.:2.6.1) (Wikipedia, die freie Enzyklopä-<br />
die, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Ges<strong>und</strong>heitsf%C3%B6rderung, Zugriff:<br />
24.06.2005).<br />
„<strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> bezeichnet die Vermittlung von ges<strong>und</strong>heitsbezogenem<br />
Wissen <strong>und</strong> Fertigkeiten durch dafür ausgewiesene Fachkräfte. Der Begriff der<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> löste die alte Bezeichnung Ges<strong>und</strong>heitserziehung ab <strong>und</strong><br />
unterscheidet sich von ihr u.a. dadurch, dass sie auf Belehrungen <strong>und</strong> damit<br />
den "erhobenen Zeigefinger" verzichtet. <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>smaßnahmen wer-<br />
den u.a von Volkshochschulen aber auch von Krankenkassen <strong>und</strong> anderen Bil-<br />
dungseinrichtungen in Form von Vorträgen, Seminaren <strong>und</strong> Kursen angeboten.<br />
Die Bedeutung isolierter <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>smaßnahmen nimmt tendenziell<br />
aber ab, da man weiß, dass über Wissen (kognitive Fähigkeiten) kaum eine<br />
Änderung ges<strong>und</strong>heitsschädlichen Verhaltens zu erreichen ist. Erfolgreicher<br />
sind komplexere Ansätze, die in ihrem Konzept <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> als ein Mo-<br />
dul unter anderen nutzen. Durch das in Erarbeitung befindliche Präventionsge-<br />
setz des B<strong>und</strong>es werden sicherlich auch die Möglichkeiten der Durchführung<br />
<strong>und</strong> Finanzierung von <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>smaßnahmen verbessert werden.“<br />
(Wikipedia, die freie Enzyklopädie, unter:<br />
http://de.wikipedia.org/wiki/<strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>, Zugriff 24.06.2005).<br />
7
2 Die Bedeutung von Vernetzung in der Ges<strong>und</strong>-<br />
heitsförderung <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong><br />
Die Bedeutung von „<strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>“ wird vom B<strong>und</strong>esministerium für Bil-<br />
dung, Wissenschaft, Forschung <strong>und</strong> Technologie (1997) an Hand folgender<br />
Zahlen über die Teilnahmefälle <strong>und</strong> das Weiterbildungsvolumen belegt: In<br />
Deutschland entfielen im Jahr 1991 etwa 11% der insgesamt 14,6 Millionen<br />
Teilnahmefälle <strong>und</strong> etwa 9% des Weiterbildungsvolumens im Bereich allgemei-<br />
ne Weiterbildung auf das Themenfeld „Ges<strong>und</strong>heitsfragen“, damit nimmt dieser<br />
Bereich den zweiten Rang nach dem der „Sprachkenntnisse“ ein. Die Statisti-<br />
ken der Volkshochschulen bestätigen diesen Stellenwert nach Teilnahmefällen.<br />
Nach dem Unterrichtsvolumen nahm <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> bereits 1991 den<br />
drittgrößten Bereich ein (B<strong>und</strong>esministerium für Bildung, Wissenschaft, For-<br />
schung <strong>und</strong> Technologie 1997).<br />
Die Notwendigkeit <strong>zur</strong> Bildung regionaler Netzwerke ist in den letzten Jahren<br />
von steigender Bedeutung. Dies macht u.a. der Trend <strong>zur</strong> Globalisierung deut-<br />
lich, in dem die Vernetzung als logische Antwort <strong>und</strong> sogar als komplementäre<br />
Entwicklung gesehen werden kann (Bornhoff et al. 2003).<br />
Das Fehlen notwendiger Transparenz des Leistungsgeschehens im Ges<strong>und</strong>-<br />
heitswesen <strong>und</strong> in der Ges<strong>und</strong>heitsförderung für die Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger<br />
als Nutzende, aber auch für die Akteure selbst, ist ein weiterer der zahlreichen<br />
Erklärungsansätze zum steigenden Trend zu Vernetzungsaktivitäten. Hinzu<br />
kommen mangelnde Kommunikation <strong>und</strong> Abstimmung im System der ges<strong>und</strong>-<br />
heitlichen <strong>und</strong> sozialen Versorgung sowie bedingt durch die föderalistische<br />
Struktur der B<strong>und</strong>esrepublik <strong>und</strong> dem Korporatismus, also der Selbstverwaltung<br />
einzelner Organe, un<strong>zur</strong>eichende Integration <strong>und</strong> Verzahnung der ausdifferen-<br />
zierten Versorgungsstrukturen im Ges<strong>und</strong>heitswesen. Als hoffnungsvolle Ant-<br />
wort auf derartige Problemlagen kommt der Bildung von funktionierenden<br />
Netzwerken eine immense Bedeutung zu (ebenda).<br />
8
Die dezentrale <strong>und</strong> bürgernahe Struktur eines Netzwerks, macht es den Agie-<br />
renden möglich direkt <strong>und</strong> zeitnah auf die Bedürfnisse der Bürger zu reagieren<br />
<strong>und</strong> so schneller <strong>und</strong> effektiver gesellschaftlichen Problemstellungen gerecht zu<br />
werden. Auch aus der Sicht der Netzwerkpartner selbst ergeben sich Notwen-<br />
digkeiten, sich den aktuellen Vernetzungsaktivitäten nicht zu verschließen. Ein<br />
wichtiger Punkt ist die Anpassung an immer härter werdende wettbewerbliche<br />
Bedingungen durch Regionalentwicklung <strong>und</strong> –förderung. Dem Zwang zum ef-<br />
fektiveren Ressourceneinsatz in Zeiten immer knapper werdender öffentlicher<br />
Mittel im Ges<strong>und</strong>heitsbereich kann auf diese Weise ebenso Rechnung getragen<br />
werden. Synergieeffekte zwischen den kooperierenden Organisationen, die<br />
Vermeidung unsinniger Doppelangebote <strong>und</strong> unnötiger Konkurrenzen sind wei-<br />
tere Vorteile von Netzwerken (ebenda).<br />
Besonders wenn es um die Vermittlung von Ges<strong>und</strong>heitsressourcen geht, ist<br />
eine funktionierende Infrastruktur der Ges<strong>und</strong>heitsförderung von erheblicher<br />
Bedeutung, ein solidarisches Zusammenspiel unterschiedlicher Institutionen<br />
<strong>und</strong> Akteure ermöglichen eine zielgerechte Umsetzung ges<strong>und</strong>heitsförderlicher<br />
<strong>und</strong> präventiver Maßnahmen <strong>und</strong> Projekte.<br />
2.1 Die Organisationsform „Netzwerk“<br />
Ein Netzwerk ist eine spezifische, auf einen längeren Zeitraum hin angelegte<br />
Kooperation unter Beteiligung von Personen mehrerer Organisationen <strong>zur</strong> Er-<br />
reichung gemeinsam festgelegter Ziele <strong>und</strong> zum Gewinn von „Mehrwert“ für die<br />
einzelnen Organisationen (Bornhoff et al. 2003).<br />
Die WHO beschreibt Netzwerke in ihrem Glossar als eine Gruppierung von In-<br />
dividuen, Organisationen <strong>und</strong> Einrichtungen, die auf einer nichthierarchischen<br />
Basis um gemeinsame Themen <strong>und</strong> Angelegenheiten organisiert ist, welche<br />
aktiv <strong>und</strong> systematisch auf der Basis von Verantwortungsgefühl <strong>und</strong> Vertrauen<br />
verfolgt werden.<br />
9
Der Soziologe Manuell Castells bezeichnet das 21. Jahrh<strong>und</strong>ert als Netzwerk-<br />
gesellschaft, in der sich alle relevanten Prozesse in Gesellschaft <strong>und</strong> Wirtschaft<br />
um die Organisationsform „Netzwerk“ formieren (Castells 2000).<br />
Trojan unterscheidet in seinem Beitrag „Vernetzungsstrukturen für Ges<strong>und</strong>-<br />
heitsförderung“, in „Ges<strong>und</strong>heit gemeinsam gestalten – Allianz für Ges<strong>und</strong>heits-<br />
förderung“ (2001, S. 54ff.), verschiedene Strukturen, die vermitteln <strong>und</strong> vernet-<br />
zen oder selbst Netze darstellen <strong>und</strong> als „intermediäre Strukturen“ bzw. Zwi-<br />
schenstrukturen bezeichnet werden. Im Einzelnen benennt er Folgende:<br />
natürliche intermediäre Instanzen, zu denen die Familie, Nachbarschaft<br />
oder Religionsgemeinschaft gehören;<br />
intermediäre Kultur, die, abgegrenzt von der Mehrheitskultur, politische oder<br />
subkulturelle Interessen befriedigen <strong>und</strong> aus einer lockeren Vernetzung von<br />
Einzelpersonen, Zusammenschlüssen <strong>und</strong> Infrastruktureinrichtungen beste-<br />
hen;<br />
intermediäre Hilfe- <strong>und</strong> Dienstleistungsorganisationen, als unterschiedlich<br />
formell organisierte soziale Systeme, erbringen - ergänzend <strong>zur</strong> Markt-,<br />
Staat- <strong>und</strong> informellen Sphäre - ges<strong>und</strong>heitsbezogene <strong>und</strong> soziale Dienst-<br />
leistungen, sie gehören ihnen jedoch nicht an;<br />
intermediäre Interessenverbände als Gr<strong>und</strong>element der „pluralistischen<br />
Demokratie“ (z.B. berufliche Verbände);<br />
intermediäre Kooperations-Netze, -Foren, -Arbeitsgemeinschaften u.ä.; sie<br />
verknüpfen Staat, Markt <strong>und</strong> informelle Sphäre miteinander <strong>und</strong> arbeiten<br />
zielgruppen-, gebiets- oder problembezogen unterschiedlich stark formali-<br />
siert zusammen;<br />
intermediäre „Brücken-Einrichtungen“ gehören zu den vorstehend genann-<br />
ten Strukturen, sind aber räumlich, mit Sachmitteln <strong>und</strong> Personal ausgestat-<br />
tet <strong>und</strong> verfolgen in erster Linie unterstützende <strong>und</strong> vermittelnde Aufgaben;<br />
Die innerhalb dieser Arbeit anvisierte Netzwerkstruktur lässt sich primär den<br />
intermediären Kooperationsgemeinschaften zuordnen. Perspektivisch betrach-<br />
tet kann sich nach einer festen Etablierung des Netzwerks innerhalb der ge-<br />
10
s<strong>und</strong>heitsfördernden Infrastruktur in der Region aus dieser Einheit eine weitere<br />
Aufgabe <strong>und</strong> - damit verb<strong>und</strong>en - eine neue Struktur entwickeln. Aus der Ver-<br />
netzung bereits vorhandener Strukturen (vgl. Kap. 3.2.1) ergibt sich die Mög-<br />
lichkeit einer logischen Weiterentwicklung der Kooperationsgemeinschaft, in-<br />
dem eine neue Struktur in Form eines „Kooperationsbüros für Ges<strong>und</strong>heit“, mit<br />
eigener Sachmittel- <strong>und</strong> Finanzausstattung gebildet wird (vgl. Kap. 5).<br />
2.2 Programmatische Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Zur Verdeutlichung der Relevanz des Themas „Vernetzung“ werden im Folgen-<br />
den internationale <strong>und</strong> anerkannte Programmatiken bzw. Auszüge aus Pro-<br />
grammen <strong>und</strong> Dokumenten der WHO dargestellt, in denen Netzwerkbildung<br />
<strong>und</strong> verhaltensbezogene Ges<strong>und</strong>heitsförderung/ <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> Bestand-<br />
teile sind.<br />
Die WHO hat 1986 auf der ersten internationalen Konferenz <strong>zur</strong> Ges<strong>und</strong>heits-<br />
förderung in Kanada ein Dokument mit dem Namen „Ottawa-Charta“ verab-<br />
schiedet. Sie beinhaltet Strategien <strong>und</strong> Leitlinien <strong>zur</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong><br />
hat den Rang eines Gr<strong>und</strong>satzdokumentes für die Ges<strong>und</strong>heitsförderung. Maß-<br />
gebend für die vorliegende Arbeit ist die Leitlinie<br />
„Vermitteln <strong>und</strong> Vernetzen:<br />
Der Ges<strong>und</strong>heitssektor allein ist nicht in der Lage, die Voraussetzun-<br />
gen <strong>und</strong> guten Perspektiven für die Ges<strong>und</strong>heit zu garantieren. Ge-<br />
s<strong>und</strong>heitsförderung verlangt vielmehr ein koordiniertes Zusammenwir-<br />
ken unter Beteiligung der Verantwortlichen in Regierungen, im Ge-<br />
s<strong>und</strong>heits-, Sozial- <strong>und</strong> Wirtschaftssektor, in nichtstaatlichen <strong>und</strong><br />
selbst organisierten Verbänden <strong>und</strong> Initiativen sowie in lokalen Orga-<br />
nisationen, in der Industrie <strong>und</strong> in den Medien. Menschen in allen Le-<br />
bensbereichen sind daran zu beteiligen als Einzelne, als Familien <strong>und</strong><br />
als Gemeinschaften. Die Berufsgruppen <strong>und</strong> sozialen Gruppierungen<br />
sowie die Mitarbeiter des Ges<strong>und</strong>heitswesens tragen große Verant-<br />
wortung für eine ges<strong>und</strong>heitsorientierte Vermittlung zwischen den un-<br />
11
terschiedlichen Interessen in der Gesellschaft.“ (Göpel & Schubert-<br />
Lehnhardt 2004, S. 245f.)<br />
In den Bereichen <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> <strong>und</strong> individuenbezogener Ges<strong>und</strong>heits-<br />
förderung, die ebenfalls Bestandteil dieser Arbeit sind, finden zudem die beiden<br />
weiteren Leitlinien der Ottawa-Charta Berücksichtigung, diese lauten:<br />
Interessen vertreten,<br />
befähigen <strong>und</strong> ermöglichen.<br />
Beide Leitlinien sind nachlesbar in z.B. Göpel & Schubert-Lehnhardt (2004, S.<br />
244ff.).<br />
Innerhalb der Ottawa Charta <strong>zur</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung von 1986 sind außer-<br />
dem folgende, für diese Arbeit relevante, Zielebenen formuliert 1 :<br />
Ges<strong>und</strong>heitsförderliche Lebenswelten schaffen,<br />
Ges<strong>und</strong>heitsbezogene Gemeinschaftsaktionen unterstützen,<br />
Persönliche Kompetenzen entwickeln,<br />
Ges<strong>und</strong>heitsdienste neu orientieren.<br />
Ihr Zusammenhang mit der Thematik der <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> soll im Folgenden<br />
ausführlicher dargestellt werden.<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> kann in die Zielebene „Persönliche Kompetenzen entwi-<br />
ckeln“ eingeordnet werden. „Persönliche Kompetenzen entwickeln“ bedeutet im<br />
hier angesprochenen Kontext, eine Erweiterung des persönlichen Spektrums<br />
individueller Verhaltensmöglichkeiten <strong>und</strong> –modifikationen, woraufhin der<br />
Mensch befähigt wird, innerhalb seiner individuellen Rahmenbedingungen <strong>und</strong><br />
Möglichkeiten auf ein vergrößertes Repertoire an ges<strong>und</strong>heitsgerechten Verhal-<br />
tensweisen <strong>zur</strong>ückgreifen bzw. dieses situationsgemäß einsetzen zu können.<br />
Durch die Befähigung des Menschen, bewusst <strong>und</strong> reflexiv mit sich selbst <strong>und</strong><br />
1 Nicht berührt wird die Zielebene „Entwicklung einer ges<strong>und</strong>heitsfördernden Gesamtpolitik“.<br />
Hierin geht es um ges<strong>und</strong>heitsgerechte Entscheidungen auf allen Politiksektoren (vgl. z.B. Göpel<br />
& Schubert-Lehnhardt 2004, S. 246).<br />
12
seiner sozialen <strong>und</strong> ökologischen Umwelt umgehen zu können, ergibt sich für<br />
ihn die Chance innerhalb seiner persönlichen Umwelt regulierend einzugreifen.<br />
Die Erweiterung <strong>und</strong> Stärkung der persönlichen Ressourcen sind Vorausset-<br />
zungen für eine erfolgreiche Bewältigung belastender Alltagsbedingungen <strong>und</strong><br />
Lebensereignisse. Das Verständnis von sich Selbst in seiner individuellen so-<br />
zialen Rolle ist eine maßgebende Gestaltungsbedingung seiner sozialen <strong>und</strong><br />
ökologischen Umwelt. Hier zeigt sich, dass <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> die Vorausset-<br />
zungen <strong>zur</strong> Unterstützung <strong>und</strong> Mitwirkung innerhalb ges<strong>und</strong>heitsbezogener<br />
Gemeinschaftsaktionen zu schaffen sowie ein verändertes Bewusstsein <strong>und</strong><br />
erweitertes Wissen über die verschiedenen Lebensweisen zu vermitteln <strong>und</strong> zu<br />
erzeugen vermag. In einer umfassenderen Sichtweise trägt <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong><br />
also zu einer ges<strong>und</strong>heitsförderlichen Gestaltung des sozialen <strong>und</strong> ökologi-<br />
schen Umfelds bei, weil <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> die Menschen befähigt <strong>und</strong> moti-<br />
viert in ihrem eigenen Umfeld „ges<strong>und</strong>heitsförderliche Lebenswelten zu schaf-<br />
fen“, indem sie die Plattform <strong>und</strong> den Nährboden für ges<strong>und</strong>heitsförderliche<br />
Gemeinschaftsaktionen schafft bzw. bietet.<br />
„In diesem Sinne schließt sie [Anmerkung der Autorin: <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong><br />
als Teil der Ges<strong>und</strong>heitsförderung] sowohl Handlungen <strong>und</strong> Aktivitäten ein,<br />
die auf die Stärkung der Kenntnisse <strong>und</strong> Fähigkeiten der Individuen <strong>zur</strong><br />
Realisierung einer ges<strong>und</strong>en Lebensweise im Alltag gerichtet sind (Verhal-<br />
tensprävention) als auch solche, die darauf abzielen, Bewusstsein für so-<br />
ziale, ökonomische, politische sowie Umweltbedingungen zu entwickeln,<br />
diese kritisch zu analysieren <strong>und</strong> Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, sie<br />
derart zu verändern, dass sie positiv auf individuelle <strong>und</strong> öffentliche Ge-<br />
s<strong>und</strong>heit wirken (Verhältnisprävention)“ (Bornhoff et al. 2003, S. 40).<br />
Die Deklaration von Jakarta ist 1997 auf der 4. Internationalen Konferenz für<br />
Ges<strong>und</strong>heitsförderung der WHO entstanden <strong>und</strong> konzentriert sich thematisch<br />
auf „Neue Partnerschaften für Ges<strong>und</strong>heitsförderung“. Sie bietet einen Ausblick<br />
auf die Ges<strong>und</strong>heitsförderung im nächsten Jahrtausend. Im Abschnitt über die<br />
positiven Resultate bisheriger Ges<strong>und</strong>heitsförderung wird resümiert, „dass<br />
13
umfassende Ansätze der Ges<strong>und</strong>heitspolitik <strong>und</strong> –förderung am effek-<br />
tivsten sind. (...)<br />
organisatorische <strong>und</strong> geografische Einheiten praktische Gelegenheiten<br />
<strong>zur</strong> Implementierung umfassender Strategien bieten. (...)<br />
die Beteiligung der Bevölkerung wesentlich ist, um erfolgreich Ge-<br />
s<strong>und</strong>heitsförderung betreiben zu können. (...)<br />
frühzeitiges Lernen von ges<strong>und</strong>heitsförderndem Verhalten Menschen<br />
ermöglicht, sich aktiv in die Ges<strong>und</strong>heitsförderung einzumischen. (...)“<br />
In der Jakarta Deklaration ist eindeutig der Bedarf formuliert, „traditionelle<br />
Grenzen innerhalb von Politikressorts, zwischen staatlichen <strong>und</strong> nicht-<br />
staatlichen Organisationen <strong>und</strong> zwischen öffentlichem <strong>und</strong> privatem Sektor nie-<br />
der<strong>zur</strong>eißen. Ressortübergreifende Zusammenarbeit ist unverzichtbar. Neue<br />
Ges<strong>und</strong>heitskoalitionen zwischen allen sozialen Sektoren sind nötig. Sie müs-<br />
sen auf dem Prinzip der Gleichberechtigung <strong>und</strong> Gleichstellung aller Beteiligten<br />
gegründet sein.“ Vorrangige Ziele der Ges<strong>und</strong>heitsförderung im 21. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
sind, gemäß den Formulierungen der Jakarta-Deklaration, im Kontext der<br />
Netzwerkbildung im Bereich Ges<strong>und</strong>heitsförderung 2 :<br />
1. Soziale Verantwortung für Ges<strong>und</strong>heit fördern;<br />
2. Partnerschaften für Ges<strong>und</strong>heit konsolidieren <strong>und</strong> ausweiten;<br />
3. Kompetenzen in den Gemeinden <strong>und</strong> die Befähigung der Einzelnen för-<br />
dern;<br />
4. Infrastruktur für Ges<strong>und</strong>heitsförderung sichern (http://www.rhein-neckar-<br />
kreis.de/Gesunheitsfoerderung/WHOJakarta.htm, Zugriff: 14.06.2005).<br />
Eine Bekräftigung der Prinzipien der Ottawa-Charta <strong>zur</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung<br />
<strong>und</strong> die Verpflichtung <strong>zur</strong> Entwicklung landesweiter Aktionspläne erfolgte im<br />
Juni 2000 auf der 5. Weltkonferenz <strong>zur</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung der WHO in Me-<br />
xiko. Hier unterzeichneten über 80 Ges<strong>und</strong>heitsminister eine Erklärung, in der<br />
2 Der Vollständigkeit wegen, sei an dieser Stelle das Ziel „Ausgaben <strong>zur</strong> Verbesserung der<br />
Ges<strong>und</strong>heit steigern“ mit genannt. Diese Forderung wird jedoch innerhalb der bearbeiteten<br />
Thematik „Vernetzung in der <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>“ nur peripher tangiert.<br />
14
formuliert ist, dass innerhalb der nationalen Aktionspläne die „aktive Beteiligung<br />
aller Bereiche <strong>und</strong> der bürgerlichen Gesellschaft“ sichergestellt <strong>und</strong> „Partner-<br />
schaften für die Ges<strong>und</strong>heit“ gestärkt <strong>und</strong> erweitert werden sollen. Die Forde-<br />
rung nach dem Aufbau notwendiger infrastruktureller Bedingungen wird beson-<br />
ders hervorgehoben (Trojan, A. 2001, S.54ff.).<br />
Das Dokument der 5. Weltkonferenz <strong>zur</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung ist ein zentraler<br />
programmatischer Bestandteil der vorliegenden Arbeit, denn unter Pkt. F: Er-<br />
wartete Resultate heißt es hierzu: „Gemäß der Erklärung der Minister für Ge-<br />
s<strong>und</strong>heitsförderung auf der Konferenz von Mexiko werden folgende Maßnah-<br />
men ergriffen:<br />
Nationale, regionale <strong>und</strong> internationale Netzwerke <strong>zur</strong> Förderung der Ges<strong>und</strong>-<br />
heit einrichten oder stärken; (...)“ (Ges<strong>und</strong>heitsakademie e.V. 2001, S. 228).<br />
Die Aktivitäten <strong>zur</strong> Bildung des Netzwerks knüpfen sowohl an Handlungsstrate-<br />
gien <strong>zur</strong> Stärkung <strong>und</strong> Erweiterung von Partnerschaften für Ges<strong>und</strong>heit, als<br />
auch an Forderungen <strong>zur</strong> aktiven Einbeziehung der Bürger (hier: innerhalb der<br />
regionalen Befragung) an. Inhaltlich lassen sich drei Schwerpunkte, auf die sich<br />
die Mexiko-Erklärung bezieht, zusammenfassen:<br />
„Die Einflussfaktoren auf die Ges<strong>und</strong>heit der Bevölkerung (sozia-<br />
le, wirtschaftliche, Umweltfaktoren);<br />
Mechanismen der Zusammenarbeit quer durch Sektoren bzw.<br />
gesellschaftliche Gruppen <strong>und</strong> Ebenen;<br />
der Ausgleich ges<strong>und</strong>heitlicher Chancenungleichheit – in armen<br />
wie in reichen Ländern!“ (Brösskamp-Stone 2001, S. 19)<br />
„Ges<strong>und</strong>heit für Alle“ ist der Zielkatalog der WHO <strong>und</strong> enthält 38 Einzelziele.<br />
Hier fließen die, oben in ihren - für das Thema relevanten –Gr<strong>und</strong>zügen be-<br />
schriebenen, Dokumente der WHO ein. Die Dokumente der WHO gelten als<br />
richtungsweisend.<br />
Mit „Ges<strong>und</strong>heit 21“ legte die WHO 1998 eine überarbeitete Fassung der Stra-<br />
tegie „Ges<strong>und</strong>heit für Alle“ vor. Hier wurden die vormals 38 Ziele auf nunmehr<br />
21 konzentriert. Für die Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong> auch für die vorliegende Ar-<br />
15
eit ist besonders Kapitel 5: „Multisektoriale Strategien nachhaltiger Ges<strong>und</strong>-<br />
heit“ von Bedeutung. In diesem Kapitel ist das Ziel der Schaffung einer nachhal-<br />
tigen Ges<strong>und</strong>heit durch eine stärker ges<strong>und</strong>heitsfördernde natürliche, wirt-<br />
schaftliche, soziale <strong>und</strong> kulturelle Umwelt für die Menschen formuliert<br />
(http://www.sgw.hs-<br />
magde-<br />
burg.de/initiativen/akges<strong>und</strong>hs/HTML/B_Basiswissen_GF/B1_Historische_Entw<br />
icklung_<strong>und</strong>_gesetzliche_Gr<strong>und</strong>lagen.html, Zugriff: 24.06.2005).<br />
2.3 Gesetzliche Rahmenbedingungen für Ges<strong>und</strong>heitsförderung<br />
<strong>und</strong> Prävention <strong>zur</strong> Sicherung der Qualität von Ges<strong>und</strong>heits-<br />
dienstleistungen<br />
Die Leistungserbringung für die Gesetzliche Krankenversicherung ist im SGB V<br />
geregelt. In den §§ 1 <strong>und</strong> 20 werden als programmatische Zielsetzung der Vor-<br />
rang von Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong> Prävention festgelegt sowie die Eigenver-<br />
antwortung der Versicherten <strong>zur</strong> ges<strong>und</strong>heitsbewussten Lebensführung <strong>und</strong> der<br />
frühzeitigen Teilnahme an ges<strong>und</strong>heitlichen Vorsorgemaßnahmen, zu denen<br />
auch <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>skurse gehören dürften, erläutert.<br />
§ 1<br />
Solidarität <strong>und</strong> Eigenverantwortung<br />
Die Krankenversicherung als Solidargemeinschaft hat die Aufgabe, die Ges<strong>und</strong>heit der Versi-<br />
cherten zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren Ges<strong>und</strong>heitszustand zu bessern. Die Versi-<br />
cherten sind für ihre Ges<strong>und</strong>heit mitverantwortlich; sie sollen durch eine ges<strong>und</strong>heitsbewusste<br />
Lebensführung, durch frühzeitige Beteiligung an ges<strong>und</strong>heitlichen Vorsorgemaßnahmen sowie<br />
durch aktive Mitwirkung an Krankenbehandlung <strong>und</strong> Rehabilitation dazu beitragen, den Eintritt<br />
von Krankheit <strong>und</strong> Behinderung zu vermeiden oder ihre Folgen zu überwinden. Die Kranken-<br />
kassen haben den Versicherten dabei durch Aufklärung, Beratung <strong>und</strong> Leistungen zu helfen<br />
<strong>und</strong> auf ges<strong>und</strong>e Lebensverhältnisse hinzuwirken<br />
(http://www.bmgs.b<strong>und</strong>.de/download/gesetze_web/gesetze.htm#sgb05/sgb05x001.htm, Zugriff:<br />
30.06.2005).<br />
16
Besonders der letzte Satz beschreibt m. E. explizit, die Verpflichtung der Kran-<br />
kenkassen ein Ges<strong>und</strong>heitsförderungsangebot vor zu halten bzw. die Teilnah-<br />
me an derartigen Angeboten finanziell zu ermöglichen. Hier haben sie die Auf-<br />
gabe den Versicherten Aufklärung <strong>und</strong> Beratung anzubieten. Zu ges<strong>und</strong>heitsge-<br />
rechten Lebensverhältnissen zählt u.a. ein vielfältiges <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>san-<br />
gebot, das sich an den Kriterien der Bedarfsgerechtigkeit, Zugänglichkeit <strong>und</strong><br />
Bürgernähe orientiert.<br />
Im § 20 Abs. 1 SGB V werden die Leistungen <strong>zur</strong> Primärprävention, zu denen<br />
auch Maßnahmen <strong>zur</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> gehören, hinsichtlich ihrer Kriterien<br />
<strong>und</strong> Ziele näher festgelegt:<br />
§ 20 Abs. 1 SGB V<br />
Prävention <strong>und</strong> Selbsthilfe<br />
(1) Die Krankenkasse soll in der Satzung Leistungen <strong>zur</strong> primären Prävention vorsehen, die die<br />
in den Sätzen 2 <strong>und</strong> 3 genannten Anforderungen erfüllen. Leistungen <strong>zur</strong> Primärprävention<br />
sollen den allgemeinen Ges<strong>und</strong>heitszustand verbessern <strong>und</strong> insbesondere einen Beitrag <strong>zur</strong><br />
Verminderung sozial bedingter Ungleichheit von Ges<strong>und</strong>heitschancen erbringen. Die Spitzen-<br />
verbände der Krankenkassen beschließen gemeinsam <strong>und</strong> einheitlich unter Einbeziehung un-<br />
abhängigen Sachverstandes prioritäre Handlungsfelder <strong>und</strong> Kriterien für Leistungen nach Satz<br />
1, insbesondere hinsichtlich Bedarf, Zielgruppen, Zugangswegen, Inhalten <strong>und</strong> Methodik<br />
(http://b<strong>und</strong>esrecht.juris.de/b<strong>und</strong>esrecht/sgb_5/, Zugriff: 30.06.2005).<br />
Die Kooperation zwischen den verschiedenen Sozialversicherungsträgern re-<br />
gelt der Gesetzgeber lediglich bezogen auf betriebliche Ges<strong>und</strong>heitsförderung<br />
zwischen der Gesetzlichen Krankenversicherung <strong>und</strong> der Gesetzlichen Unfall-<br />
versicherung.<br />
Im § 20 Abs. 2 SGB V heißt es:<br />
(2)... Die Krankenkassen arbeiten bei der Verhütung arbeitsbedingter Ges<strong>und</strong>heitsgefahren mit<br />
den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung zusammen <strong>und</strong> unterrichten diese über die<br />
Erkenntnisse, die sie über Zusammenhänge zwischen Erkrankungen <strong>und</strong> Arbeitsbedingungen<br />
gewonnen haben. Ist anzunehmen, dass bei einem Versicherten eine berufsbedingte ges<strong>und</strong>-<br />
heitliche Gefährdung oder eine Berufskrankheit vorliegt, hat die Krankenkasse dies unverzüg-<br />
17
lich den für den Arbeitsschutz zuständigen Stellen <strong>und</strong> dem Unfallversicherungsträger mitzutei-<br />
len (http://b<strong>und</strong>esrecht.juris.de/b<strong>und</strong>esrecht/sgb_5/, Zugriff: 30.06.2005).<br />
Entsprechend heißt es im § 14 Abs. 2 SGB VII:<br />
(2) Bei der Verhütung arbeitsbedingter Ges<strong>und</strong>heitsgefahren arbeiten die Unfallversicherungs-<br />
träger mit den Krankenkassen zusammen (http://b<strong>und</strong>esrecht.juris.de/b<strong>und</strong>esrecht/sgb_7/,<br />
Zugriff: 30.06.2005).<br />
Bezogen auf das in dieser Arbeit anvisierte Thema, scheint auch § 63 Abs. 1<br />
<strong>und</strong> 2 SGB V (Gr<strong>und</strong>sätze <strong>zur</strong> Weiterentwicklung der Versorgung) von Re-<br />
levanz:<br />
(1) Die Krankenkasse <strong>und</strong> ihre Verbände können im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgabenstel-<br />
lung <strong>zur</strong> Verbesserung der Qualität <strong>und</strong> der Wirtschaftlichkeit der Versorgung Modellvorhaben<br />
<strong>zur</strong> Weiterentwicklung der Verfahrens-, Organisations-, Finanzierungs- <strong>und</strong> Vergütungsformen<br />
der Leistungserbringung durchführen oder nach § 64 vereinbaren.<br />
(2) Die Krankenkassen können Modellvorhaben zu Leistungen <strong>zur</strong> Verhütung <strong>und</strong> Früherken-<br />
nung von Krankheiten sowie <strong>zur</strong> Krankenbehandlung, die nach den Vorschriften dieses Buches<br />
oder auf Gr<strong>und</strong> hiernach getroffener Regelungen keine Leistungen der Krankenversicherung<br />
sind, durchführen oder nach § 64 vereinbaren (http://b<strong>und</strong>esrecht.juris.de/b<strong>und</strong>esrecht/sgb_5/,<br />
Zugriff: 30.06.2005).<br />
Das geplante Kooperationsprojekt zwischen den Akteuren <strong>und</strong> Institutionen für<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> hat in unserer Region durchaus Modellcharakter <strong>und</strong>, nach<br />
erfolgreicher Initiierung, Erweiterungs- <strong>und</strong> Übertragungspotenzial.<br />
Auch der Öffentliche Ges<strong>und</strong>heitsdienst (ÖGD) sollte in Vernetzungsprojekte für<br />
Ges<strong>und</strong>heitsförderung laut der Bestimmungen des Gesetzes über den Öffentli-<br />
chen Ges<strong>und</strong>heitsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Ges<strong>und</strong>-<br />
heitsdienstgesetz - BbgGDG) einbezogen werden:<br />
18
Abschnitt 1 Gr<strong>und</strong>sätze<br />
§ 1<br />
Ziele <strong>und</strong> Aufgaben<br />
(1) Der Öffentliche Ges<strong>und</strong>heitsdienst hat die ges<strong>und</strong>heitlichen Belange der Bevölkerung zu<br />
vertreten <strong>und</strong> die Ges<strong>und</strong>heit der Bevölkerung zu schützen <strong>und</strong> zu fördern. Er wirkt insofern an<br />
der bedarfsgerechten ges<strong>und</strong>heitlichen Versorgung der Bevölkerung mit.<br />
(2) Pflichtaufgaben des Öffentlichen Ges<strong>und</strong>heitsdienstes sind Ges<strong>und</strong>heitsvorsorge, Ges<strong>und</strong>-<br />
heitsförderung <strong>und</strong> Krankheitsverhütung unter Einschluss der Bewertung von Umwelteinflüssen<br />
auf die menschliche Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> der Mitwirkung am Verbraucherschutz, Ges<strong>und</strong>heitsbe-<br />
richterstattung <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsplanung auf Landes- <strong>und</strong> auf regionaler Ebene, Zulassung zu<br />
Berufen <strong>und</strong> von Einrichtungen des Ges<strong>und</strong>heitswesens sowie deren Überwachung.<br />
(3) Der Öffentliche Ges<strong>und</strong>heitsdienst arbeitet bei der Erfüllung seiner Aufgaben mit den ande-<br />
ren an der ges<strong>und</strong>heitlichen Versorgung Beteiligten sowie mit Verbänden <strong>und</strong> Selbsthilfegrup-<br />
pen zusammen. Er wirkt auf eine umfassende gegenseitige Information <strong>und</strong> auf die Koordinati-<br />
on ges<strong>und</strong>heitlicher Leistungen <strong>und</strong> Einrichtungen auf regionaler Ebene hin.<br />
(4) Die Träger des Öffentlichen Ges<strong>und</strong>heitsdienstes fördern im Interesse der Erreichbarkeit<br />
<strong>und</strong> der Verzahnung von Ges<strong>und</strong>heitsvorsorge, medizinischer Behandlung, Beratung <strong>und</strong><br />
Betreuung sowie wirksamer Nachsorge den engen räumlichen <strong>und</strong> funktionalen Verb<strong>und</strong> ge-<br />
s<strong>und</strong>heitlicher Leistungen <strong>und</strong> Einrichtungen auf regionaler Ebene, gegebenenfalls im Einver-<br />
nehmen mit den <strong>zur</strong> Vorhaltung derartiger Leistungen Verpflichteten.<br />
§ 6<br />
Ges<strong>und</strong>heitsförderung<br />
Die Träger des Öffentlichen Ges<strong>und</strong>heitsdienstes sollen mit anderen örtlichen <strong>und</strong> überörtlichen<br />
Trägern <strong>und</strong> Stellen unter Berücksichtigung der Ges<strong>und</strong>heitsberichterstattung <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>-<br />
heitsplanung bei Ges<strong>und</strong>heitsförderung, Ges<strong>und</strong>heitserziehung <strong>und</strong> Krankheitsverhütung eng<br />
zusammenarbeiten; sie wirken auf die Gründung örtlicher <strong>und</strong> überörtlicher Arbeitsgemein-<br />
schaften für Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong> den Abschluss gemeinsamer Rahmenvereinbarungen<br />
hin. Die Arbeitsgemeinschaften sollen die ges<strong>und</strong>heitsfördernden Maßnahmen koordinieren.<br />
Die Ges<strong>und</strong>heitsämter können örtlich spezifische Maßnahmen <strong>zur</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung für die<br />
Bevölkerung unter besonderer Berücksichtigung von ges<strong>und</strong>heitlichen Risikofaktoren <strong>und</strong> Risi-<br />
kogruppen durchführen. Sie können Kontaktstellen für Selbsthilfegruppen einrichten.<br />
(http://www.mdje.brandenburg.de/Landesrecht/gesetzblatt/texte/K50/500-02.htm, Zugriff:<br />
30.06.2005)<br />
19
2.4 Akteure <strong>und</strong> Institutionen der Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong> Ge-<br />
s<strong>und</strong>heitsbildung<br />
Im Rahmen des Projektes „Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Allgemeine Weiterbildung“ des<br />
BMBF wurden insgesamt 22 Organisationen <strong>und</strong> Verbände identifiziert, die in-<br />
nerhalb ihrer Arbeit <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> <strong>und</strong>/oder ges<strong>und</strong>heitsrelevante Weiter-<br />
bildung anbieten <strong>und</strong> auf B<strong>und</strong>esebene organisiert sind. Dazu werden ebenfalls<br />
Institutionen gezählt, die Inhalte aufgreifen, die heute als Determinanten von<br />
Ges<strong>und</strong>heit bekannt sind bzw. potentiell gute Anknüpfungspunkte für das Auf-<br />
greifen wichtiger Ges<strong>und</strong>heitsfragen bieten. Hierbei wurden „drei Gruppen von<br />
Trägern unterschieden:<br />
1. Träger Allgemeiner Weiterbildung (einschließlich solcher Träger Berufli-<br />
cher Weiterbildung, die auch Allgemeine Weiterbildung anbieten),<br />
2. soziale <strong>und</strong> ges<strong>und</strong>heitsbezogene Verbände <strong>und</strong><br />
3. die Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).“<br />
(B<strong>und</strong>esministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung <strong>und</strong> Technologie<br />
1997, S. 54).<br />
20
Abb. 1: „Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Allgemeine Weiterbildung“ – Strukturelle Verankerung der Ges<strong>und</strong>-<br />
heitsbildung in Deutschland - (B<strong>und</strong>esministerium für Bildung, Wissenschaft, For-<br />
schung <strong>und</strong> Technologie 1997, S. 56).<br />
Aus Abb. 1 <strong>und</strong> den bisherigen Ausführungen des Kapitels wird ersichtlich, dass<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> sowohl in Einrichtungen des Bildungswesens als auch des<br />
Sozial- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitswesens stattfindet. Im Bereich der ges<strong>und</strong>heitsfördern-<br />
den Aktivitäten kann „<strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>“ als Schnittstelle von Bildungs-, Ge-<br />
s<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Sozialwesen bezeichnet werden (vgl. Abb. 2).<br />
21
Abb. 2: <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> von Erwachsenen durch Einrichtungen des Bildungs-, Ges<strong>und</strong>-<br />
heits- <strong>und</strong> Sozialwesens – ein Beitrag <strong>zur</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Deutschland (Bun-<br />
desministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung <strong>und</strong> Technologie 1997, S. 57).<br />
22
2.5 Prioritäre Handlungsfelder innerhalb der Ges<strong>und</strong>heitsförde-<br />
rung<br />
2.5.1 Ges<strong>und</strong>heitsbezogenes Handeln ermöglichen<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> zielt u.a. darauf ab, die Menschen zu einem ges<strong>und</strong>heits-<br />
gerechten Handeln zu befähigen. Der Befähigung zu ges<strong>und</strong>heitsgerechtem<br />
Verhalten wird ges<strong>und</strong>heitsrelevantes Wissen vorausgesetzt. Ges<strong>und</strong>heitswis-<br />
sen bedeutet umfassende Kenntnisse über medizinisch-biologische, verhal-<br />
tenswissenschaftliche <strong>und</strong> sozialwissenschaftliche Prozesse <strong>und</strong> Bedingungen<br />
zu besitzen <strong>und</strong> daraus abgeleitet, Wissen über eine ges<strong>und</strong>e Persönlichkeits-<br />
entwicklung, seelische Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Wohlbefinden sowie Möglichkeiten ihrer<br />
Förderung <strong>und</strong> Beeinträchtigung. Im Sinne der <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>sstrategie<br />
werden unter dieser Prämisse Kenntnisse aus den „Bereichen Ernährung, Be-<br />
wegung, Entspannung, Stress- <strong>und</strong> Konfliktbewältigung, Abhängigkeit <strong>und</strong><br />
Sucht, Sexualität, Hygiene, Kenntnisse <strong>zur</strong> Vorbeugung von Unfällen <strong>und</strong><br />
Krankheiten (Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Haltungsschäden, AIDS etc.), <strong>zur</strong><br />
Selbstbehandlung banaler Krankheiten sowie zu den verschiedenen professio-<br />
nellen Angeboten der Vorbeugung, Beratung <strong>und</strong> Therapie“ (vgl.: B<strong>und</strong>esminis-<br />
terium für Bildung, Wissenschaft, Forschung <strong>und</strong> Technologie 1997, S.31) all-<br />
tagsnah <strong>und</strong> zielgruppenspezifisch vermittelt. Ges<strong>und</strong>heitsbezogenes Wissen<br />
sowie das Wissen eines Menschen über seine persönlichen Handlungskompe-<br />
tenzen, die Überzeugung selbstwirksam mit ihnen operieren zu können <strong>und</strong> das<br />
individuelle Hilfesuchverhalten <strong>und</strong> Hilfsangebote in Anspruch nehmen zu kön-<br />
nen sind Kompetenzen, die Voraussetzung für eine ges<strong>und</strong>heitsbewusste Le-<br />
bensweise sind. Gemeinsam mit der Überzeugung, dass eine Situation kontrol-<br />
lierbar <strong>und</strong> veränderbar ist <strong>und</strong> die Einschätzung inwieweit die Situation für sich<br />
persönlich als bedrohlich bzw. die eigene Anfälligkeit oder Verletzlichkeit wahr-<br />
genommen wird, ermöglichen die o.g. Kompetenzen einem Menschen, sich ge-<br />
s<strong>und</strong>heitsgerecht zu verhalten bzw. sein Verhalten in Richtung ges<strong>und</strong>heitlicher<br />
Zuträglichkeit zu verändern. Von besonderer Bedeutung sind zudem die subjek-<br />
tiv wahrgenommenen sowie die objektiven sozialen Barrieren, Ressourcen <strong>und</strong><br />
23
Gegebenheiten, d.h. der „soziale Rückhalt“ (B<strong>und</strong>esministerium für Bildung,<br />
Wissenschaft, Forschung <strong>und</strong> Technologie 1997).<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> hat also die Aufgabe den Menschen mit den nötigen Kom-<br />
petenzen, Kenntnissen <strong>und</strong> Überzeugungen auszustatten, um mit Unsicherhei-<br />
ten <strong>und</strong> Belastungen in allen Lebensbereichen angemessen umgehen zu kön-<br />
nen. Dies kann erreicht werden, indem ein ansprechendes, zielgruppenspezifi-<br />
sches, zugängliches <strong>und</strong> bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten wird (vgl. Kap.<br />
2.5.2).<br />
Ziele der <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> sind:<br />
- Ges<strong>und</strong>heit erfahrbar machen;<br />
- Vertrauen in die eigene Ges<strong>und</strong>heitskompetenz stärken;<br />
- Stärkung der natürlichen Selbstheilungskräfte;<br />
- Befähigung zu einem selbst bestimmten, mit- <strong>und</strong> eigenverantwortlichen<br />
Handeln für Ges<strong>und</strong>heit (vgl. Baumgarten o.J.).<br />
2.5.2 Gestaltung ges<strong>und</strong>heitsförderlicher Lebenswelten<br />
Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> ges<strong>und</strong>heitsrelevante Lebensweise des Einzelnen werden von<br />
komplex wirkenden physiologischen, psychologischen, sozialen, ökonomischen<br />
<strong>und</strong> ökologischen Faktoren weitreichend beeinflusst. Im Sinne einer Hilfe <strong>zur</strong><br />
Selbsthilfe hat eine moderne <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> von Erwachsenen zum Ziel,<br />
bei der Entwicklung <strong>und</strong> Aufrechterhaltung ges<strong>und</strong>heitsförderlicher Lebenswel-<br />
ten zu unterstützen. Die Menschen sollen befähigt werden, bei der Gestaltung<br />
ges<strong>und</strong>heitsförderlicher Lebens-, Lern- <strong>und</strong> Arbeitsbedingungen mitzuwirken<br />
(B<strong>und</strong>esministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung <strong>und</strong> Technologie<br />
1997). An dieser Stelle sei wiederum die Ottawa Charta <strong>zur</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförde-<br />
rung erwähnt, da innerhalb von <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> insbesondere die Zielebe-<br />
nen „Ges<strong>und</strong>heitsförderliche Lebenswelten schaffen“, „Ges<strong>und</strong>heitsbezogene<br />
Gemeinschaftsaktionen unterstützen“ <strong>und</strong> „Persönliche Kompetenzen entwi-<br />
ckeln“ angesprochen werden. Der Zielebene „Ges<strong>und</strong>heitsdienste neu orientie-<br />
24
en“ wird durch die Netzwerkbildung zwischen den ges<strong>und</strong>heitsrelevanten Ak-<br />
teuren <strong>und</strong> Institutionen entsprochen.<br />
Die angesprochene Lebenswelt, ist der Ort bzw. der soziale Kontext, in dem der<br />
Mensch seinen Alltagsaktivitäten nachgeht, „im Verlauf derer umweltbezogene,<br />
organisatorische <strong>und</strong> persönliche Faktoren zusammenwirken <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>und</strong> Wohlbefinden beeinflussen“ (http://www.sgw.hs-<br />
magde-<br />
burg.de/initiativen/akges<strong>und</strong>hs/HTML/B_Basiswissen_GF/B8_Glossar1.html,<br />
Zugriff: 30.06.2005).<br />
Ein Setting gibt den Menschen die Möglichkeit, ihre Umwelt durch deren aktive<br />
Nutzung zu gestalten <strong>und</strong> damit ges<strong>und</strong>heitsbezogene Probleme zu erzeugen<br />
oder zu lösen. Sie sind dadurch zu charakterisieren, dass sie im Allgemeinen<br />
physische Grenzen besitzen <strong>und</strong> dass es eine Reihe von Menschen mit defi-<br />
nierten Rollen sowie eine Organisationsstruktur gibt. Durch das Erreichen von<br />
Menschen, die im Setting leben, arbeiten, spielen etc. kann man ihre Ges<strong>und</strong>-<br />
heit stärken. Settings stehen aber auch in Wechselbeziehung zueinander, diese<br />
auszuloten <strong>und</strong> in produktive Kooperationsbeziehungen untereinander zu set-<br />
zen, bedeutet diese miteinander zu vernetzen. Beispiele für Settings sind Schu-<br />
len, Arbeitsstätten, Krankenhäuser, Dörfer <strong>und</strong> Städte (ebenda).<br />
Durch die, im Rahmen dieser Arbeit, fokussierte Vernetzung soll eine gut aus-<br />
gebaute Ges<strong>und</strong>heitsförderungsinfrastruktur entstehen bzw. verbessert werden.<br />
Angesichts dessen, dass <strong>zur</strong> Zeit nur ein Teil der Bevölkerung durch Ges<strong>und</strong>-<br />
heitsbildungsangebote erreicht wird (vgl.: Kap. 4.7.2), <strong>und</strong> dass sich unter den<br />
Nichtteilnehmenden viele ges<strong>und</strong>heitlich besonders belastete oder gefährdete<br />
Personen befinden, wird die Forderung bzw. Zielsetzung der vorliegenden Ar-<br />
beit <strong>zur</strong> Schaffung eines regionalen <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>sangebotes, das sich<br />
an Kriterien, wie Zugänglichkeit, Bedarfsgerechtigkeit <strong>und</strong> Bürgernähe orien-<br />
tiert, unterstrichen (vgl.: Kap. 4.1).<br />
25
2.5.3 Verringerung von Ungleichheiten im Ges<strong>und</strong>heitszustand<br />
In der Jakarta-Erklärung der WHO von 1997 wird Ges<strong>und</strong>heit als „gr<strong>und</strong>sätzli-<br />
ches Menschenrecht <strong>und</strong> wesentlich für die gesellschaftliche <strong>und</strong> wirtschaftliche<br />
Entwicklung“ bezeichnet. In diesem Sinne stellt Ges<strong>und</strong>heitsförderung eine<br />
Verwirklichung der Menschenrechte dar, sie hilft, die menschlichen Ressourcen<br />
der Gesellschaft weiter zu entwickeln <strong>und</strong> trägt somit <strong>zur</strong> Verringerung von Un-<br />
gleichheiten im Ges<strong>und</strong>heitszustand der Bevölkerung bei (http://www.rhein-<br />
neckar-kreis.de/Gesunheitsfoerderung/WHOJakarta.htm, Zugriff: 14.06.2005).<br />
Ungleichheiten im ges<strong>und</strong>heitlichen Zustand der Menschen können verschie-<br />
dene Ursachen haben. Faktoren, wie z.B. genetische Disposition, Geschlecht,<br />
Alter, Lebensumfeld <strong>und</strong> sozioökonomischer Status der Personen sind Deter-<br />
minanten ihrer Ges<strong>und</strong>heit.<br />
Studien zeigen, dass auch heute noch erhebliche ges<strong>und</strong>heitliche Unterschiede<br />
bei Menschen mit geringerem sozioökonomischen Status (geringe Schulbil-<br />
dung, weniger qualifizierte Berufe, geringeres Einkommen) gegenüber Perso-<br />
nen mit einem höheren sozioökonomischen Status in Ost- <strong>und</strong> Westdeutsch-<br />
land existieren (B<strong>und</strong>esministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung <strong>und</strong><br />
Technologie 1997).<br />
Das B<strong>und</strong>esministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung <strong>und</strong> Technologie<br />
ermittelte 1997 in seinen Untersuchungen <strong>zur</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> <strong>und</strong> allge-<br />
meiner Weiterbildung fünf Felder, in denen ges<strong>und</strong>heitliche Benachteiligungen<br />
besonders offenk<strong>und</strong>ig sind 3 :<br />
1. Arbeitslosigkeit;<br />
2. ernsthafte Wohnungsprobleme (z.B. drohende Obdachlosigkeit);<br />
3. Heimatlosigkeit gesellschaftlicher Randgruppen (z.B. Migranten);<br />
4. familiäre Situationen (z.B. Alleinerziehende, Mehrkindfamilien ohne Mög-<br />
lichkeiten der sozialen Entlastung);<br />
3 genauer nachzulesen in: B<strong>und</strong>esministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung <strong>und</strong> Tech-<br />
nologie 1997, S. 49ff.<br />
26
5. ges<strong>und</strong>heitsgefährdende, „gelebte Werte“ der sozialen Umgebung (z.B.<br />
Favorisierung ges<strong>und</strong>heitsbeeinträchtigender Verhaltensweisen, die<br />
gleichzeitig zu individueller Anerkennung <strong>und</strong> Steigerung des Selbst-<br />
wertgefühls führen).<br />
Nur wenn die zahlreichen strukturellen Ges<strong>und</strong>heitsbelastungen <strong>und</strong><br />
–gefährdungen sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen aktiv aufgegriffen<br />
werden, können Anreize <strong>zur</strong> Teilnahme an <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>sangeboten<br />
Aussicht auf Erfolg haben. D.h., dass bevor diese Zielgruppe die Veränderung<br />
bestimmter persönlicher, ges<strong>und</strong>heitsrelevanter Handlungsweisen, z.B. das<br />
Nichtrauchen, ges<strong>und</strong>es Ernähren, anstrebt, eine Unterstützung dieser Perso-<br />
nengruppe bei der Entwicklung zunächst einmal gr<strong>und</strong>legender Lebensbedin-<br />
gungen <strong>und</strong> Lebensweisen (z.B. Wohnbereich, Kinderbetreuung, Nahrungsmit-<br />
telkauf) Voraussetzung ist. Hier wird eine wichtige strukturelle Determinante von<br />
Ges<strong>und</strong>heit deutlich: eine <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>, die sich an den spezifischen<br />
Lebensweisen <strong>und</strong> –bedingungen sozial benachteiligter Menschen orientiert<br />
<strong>und</strong> Kenntnisse sowie Fähigkeiten <strong>und</strong> Fertigkeiten vermittelt, die unter den je-<br />
weils konkreten <strong>und</strong> ggf. besonderen Alltagsbedingungen umgesetzt werden<br />
können (ebenda).<br />
„Ges<strong>und</strong>heit für alle“ ist eine der zentralen Forderungen der WHO, um „Gerech-<br />
tigkeit in Bezug auf Ges<strong>und</strong>heit“ zu verwirklichen (WHO 1999). „Gerade sozial<br />
benachteiligte Zielgruppen sind in der Regel überfordert, aus eigener Kraft Ver-<br />
haltensänderungen in ihren Alltag zu integrieren. Sie sind besonders darauf<br />
angewiesen, dass ungünstige Bedingungen <strong>und</strong> Strukturen bzw. soziale Bezü-<br />
ge, in denen sie leben, mit Hilfe von außen verändert werden.“ (Arbeitsgemein-<br />
schaft der Spitzenverbände der Krankenkassen 2000).<br />
Nach Kaba-Schönstein (2002) fehlen als notwendige Reaktion auf die er-<br />
schwerte Erreichbarkeit bzw. als Gr<strong>und</strong>lagen <strong>zur</strong> Erreichbarkeit sozial Benach-<br />
teiligter folgende Bedingungen:<br />
- eine systematische Bestandsaufnahme der Probleme <strong>und</strong> Interventionen;<br />
27
- eine angemessene Berichterstattung;<br />
- eine systematische Prioritätensetzung;<br />
- eine abgestimmte <strong>und</strong> koordinierte Politik in diesem Bereich;<br />
- eine Finanzierung <strong>und</strong> Infrastruktur <strong>zur</strong> kontinuierlichen Umsetzung der Ent-<br />
schließungen <strong>und</strong> Programme.<br />
Netzwerkarbeit in der Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> erleichtert<br />
die Umsetzung der eben genannten Forderungen durch die Initiierung koopera-<br />
tiver, arbeitsteiliger Prozesse.<br />
Die Orientierung an den Kriterien der Zugänglichkeit, Erreichbarkeit <strong>und</strong> Bür-<br />
gernähe von <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>sangeboten leistet einen fast hinreichenden<br />
Beitrag zum Ausgleich regionaler Ungleichheiten bei der Möglichkeit der Inan-<br />
spruchnahme von Leistungen <strong>und</strong> Angeboten der <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> sowie<br />
der Ges<strong>und</strong>heitsvorsorge. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die monetäre Zu-<br />
gänglichkeit in Form von preiswerten bzw. kostenfreien Angeboten. D.h., ein<br />
Angebot sollte im Alltag leicht, ohne große Hemmnisse sowie preiswert erreich-<br />
bar sein.<br />
Bezogen auf die Thematik der vorliegenden Arbeit lässt sich zusammenfassend<br />
feststellen: Die dezentrale <strong>und</strong> bürgernahe Struktur eines Netzwerks erlaubt es<br />
den Verantwortlichen direkt <strong>und</strong> zeitnah auf die Bedürfnisse der Bürger zu rea-<br />
gieren <strong>und</strong> so schneller <strong>und</strong> effektiver gesellschaftlichen Problemstellungen ge-<br />
recht zu werden.<br />
Abschließend lässt sich für dieses Kapitel formulieren, dass sich Ges<strong>und</strong>heits-<br />
bildung an die gesamte Bevölkerung richtet. Sie schließt im Sinne der Definition<br />
der WHO Handlungen <strong>und</strong> Aktivitäten ein, die:<br />
- auf die Stärkung der Kenntnisse <strong>und</strong> Fähigkeiten der Individuen <strong>zur</strong> Reali-<br />
sierung einer ges<strong>und</strong>en Lebensweise im Alltag gerichtet sind (Persönlich-<br />
keitsentfaltung);<br />
28
- darauf abzielen die sozialen <strong>und</strong> ökonomischen Umweltbedingungen derart<br />
zu verändern, dass diese positiv auf die individuelle <strong>und</strong> die öffentliche Ge-<br />
s<strong>und</strong>heit wirken (ökosoziale Verantwortung);<br />
- die Menschen dazu befähigen, ihre Kontrolle über die Determinanten von<br />
Ges<strong>und</strong>heit zu erhöhen <strong>und</strong> dadurch ihre Ges<strong>und</strong>heit zu verbessern (Kaba-<br />
Schönstein 2002).<br />
2.6 Vernetzungsstrukturen für Ges<strong>und</strong>heitsförderung<br />
Bereits auf der ersten internationalen Konferenz der WHO <strong>zur</strong> Ges<strong>und</strong>heitsför-<br />
derung in Ottawa bestand Konsens darüber, dass „Vermitteln <strong>und</strong> Vernetzen“<br />
eine der wesentlichen Strategien für Ges<strong>und</strong>heitsförderung ist (vgl.: Kap. 2.2).<br />
Der Begriff „Vernetzung“ bezeichnet in der Regel den Prozess, der <strong>zur</strong> Bildung<br />
einer Netzwerkstruktur führt. Hier können zwei Akzente gesetzt werden:<br />
1. Die Vernetzung aufgr<strong>und</strong> einer initiierenden Tätigkeit von Akteuren, die<br />
zu einer „kommunikativen Verdichtung“ (Trojan & Legewie 2001, S. 277)<br />
mit dem Ziel einer späteren Netzwerkbildung stattfindet. Der Ansatz der<br />
Bildung von Verbünden, Allianzen, Kooperationen etc. wird in der Litera-<br />
tur vielfach als erfolgversprechend deklariert.<br />
2. Ein weiteres Begriffsverständnis beschreibt Vernetzung als Verstetigung<br />
<strong>und</strong> Intensivierung bereits punktuell existierender Kooperations- <strong>und</strong> Ko-<br />
ordinationsereignisse (ebenda).<br />
Vernetzung, in dem innerhalb der Aktivitäten <strong>zur</strong> geplanten Gründung des Re-<br />
gionalen Netzwerks Ges<strong>und</strong>heitsförderung verstandenen Sinne, greift den ers-<br />
ten Ansatz in stärkerem Maße auf, schließt jedoch die zweite Erklärung nicht<br />
vollends aus, da mit hoher Wahrscheinlichkeit bisher bereits Berührungspunkte<br />
zwischen den zu beteiligenden Akteuren vorhanden waren.<br />
Nach Trojan (2001) kann man das, in diesem Kontext, entstehende Netzwerk<br />
dem Bereich „intermediäre Kooperations- Netze, -Foren, -<br />
Arbeitsgemeinschaften u.ä.“ zuordnen (vgl. Kap. 2.1). Dieser Bereich umfasst<br />
29
„zielgruppen-, gebiets- oder problembezogene, unterschiedlich formell zusam-<br />
mengeschlossene Verb<strong>und</strong>systeme, die oft Staat, Markt <strong>und</strong> informelle Sphäre<br />
miteinander verknüpfen <strong>und</strong> auf diese Weise träger- <strong>und</strong> politikbereichsüber-<br />
greifende allgemeine gesellschaftliche Interessen bzw. Aufgaben vertreten (vgl.<br />
z.B. Bartelheimer & Freyberg 1997), u.a. auch Ges<strong>und</strong>heitsförderung (z.B. Gil-<br />
lies 1998)“ (Trojan A. 2001, S.55).<br />
Dieser Teilbereich des „Intermediären“ bezeichnet Strukturen, die vermitteln<br />
<strong>und</strong> vernetzen oder selbst Netze darstellen. Intermediäre Strukturen können<br />
auch als „Zwischenstrukturen“ bezeichnet werden (ebenda).<br />
"Vermittlung <strong>und</strong> Vernetzung bedeutet, horizontale <strong>und</strong> vertikale Kooperations-<br />
strukturen aufzubauen <strong>und</strong> weiterzuentwickeln" (Trojan 1999, S.119):<br />
Horizontal sind die verschiedenen<br />
Lebensbereiche der Menschen <strong>und</strong><br />
die entsprechenden Politiksektoren<br />
miteinander zu verknüpfen <strong>und</strong> für<br />
ges<strong>und</strong>heitsfördernde Aktivitäten zu<br />
gewinnen. Das kann beispielsweise<br />
ein „Aktionsbündnis gegen Armut“,<br />
eine „Stadtteilkonferenz“ oder eine<br />
Veranstaltung wie „Ges<strong>und</strong>heitsta-<br />
ge“.<br />
30<br />
Vertikale Kooperation bedeutet,<br />
dass die unterschiedlichen politi-<br />
schen Ebenen, von der internatio-<br />
nalen bis hin <strong>zur</strong> lokalen <strong>und</strong> Nach-<br />
barschaftsebene, miteinander ver-<br />
b<strong>und</strong>en werden müssen. Ziel dabei<br />
ist, dass die Interessenvertreter der<br />
verschiedenen Ebenen in einen<br />
gemeinsamen Arbeitszusammen-<br />
hang gebracht werden, in dem<br />
Konflikte ausgetragen <strong>und</strong> Kon-<br />
sensprozesse auf den Weg ge-<br />
bracht werden.<br />
Abb. 3: Horizontale <strong>und</strong> vertikale Vernetzung (nach Trojan 1999)
Vernetzungen im Bereich Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> bein-<br />
halten insbesondere folgende Zielebenen:<br />
die Förderung intersektoraler Verantwortung;<br />
das Wahrnehmen ökologischer <strong>und</strong> sozialer Verantwortung sowohl von Sei-<br />
ten der Bürgerschaft als auch von den Akteuren <strong>und</strong> Beteiligten im Ges<strong>und</strong>-<br />
heitsbereich, in der kommunalen Verwaltung <strong>und</strong> in der Politik;<br />
Vermittlung <strong>und</strong> Förderung ges<strong>und</strong>heitlicher Selbstregulation <strong>und</strong> Selbstbe-<br />
stimmung der Bürger;<br />
Förderung bürgerschaftlichen Engagements;<br />
Unterstützung der Neuorientierung der Ges<strong>und</strong>heitsdienste;<br />
Unterstützung nachhaltiger Entwicklungsperspektiven für die Ges<strong>und</strong>heit<br />
der Menschen;<br />
Entwicklung eines ökonomischen Umgangs mit den vorhandenen Ressour-<br />
cen im Dienste der Ges<strong>und</strong>heit (in Anlehnung an Göpel & Hölling 2001,<br />
S.8ff.).<br />
Die genannten Zielbereiche bedingen einander <strong>und</strong> stehen in Wechselwirkung<br />
zueinander. Eine Intervention auf der einen Ebene bewirkt auch eine Entwick-<br />
lung auf einer anderen Ebene. Sie dürfen nicht isoliert betrachtet werden.<br />
Die Arbeit in kooperativen Strukturen ermöglicht den Verantwortlichen, zeitnah<br />
<strong>und</strong> zielgerichtet auf bestimmte gesellschaftliche Problemlagen zu reagieren,<br />
aufgr<strong>und</strong> ihrer dezentralen <strong>und</strong> regionalen Verortung <strong>und</strong> Organisation. So<br />
macht es die breite heterogene <strong>und</strong> in ihrem Aufgabengebiet differenzierte<br />
Netzwerkmitgliederstruktur möglich, innerhalb ihrer Interessen auf die Bedarfs-<br />
lagen zu reagieren, indem sie ihre Leistungen aufeinander abstimmen <strong>und</strong> ko-<br />
ordinieren, ihre Leistungen transparent darstellen <strong>und</strong> die Zielgruppen entspre-<br />
chend erreichen. Ihre Angebote <strong>und</strong> Leistungen qualitativ zu verbessern <strong>und</strong> in<br />
ausreichender Quantität <strong>zur</strong> Verfügung zu stellen sowie - bei vermindertem Ri-<br />
siko, durch die Beteiligung mehrerer Institutionen <strong>und</strong> Organisationen - neue<br />
innovative Konzepte in Maßnahmen <strong>und</strong> Projekten zu entwickeln <strong>und</strong> zu erpro-<br />
ben, sind weitere Vorteile von Netzwerkstrukturen. Zudem können bereits be-<br />
31
stehende - in anderen Regionen <strong>und</strong> Ländern erfolgreich erprobte - Projekte auf<br />
die strukturellen <strong>und</strong> personellen Bedürfnisse <strong>und</strong> Verhältnisse adaptiert wer-<br />
den.<br />
Von den, auf Initiative des B<strong>und</strong>esministerium für Bildung, Wissenschaft, For-<br />
schung <strong>und</strong> Technologie (1997) – im Rahmen seiner Veröffentlichung „Ge-<br />
s<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> allgemeine Weiterbildung“, insgesamt 22 befragten Weiterbil-<br />
dungsträgern auf B<strong>und</strong>esebene stehen – laut Angaben der Befragten – zahlrei-<br />
che Träger in allgemeinen Kooperationsbezügen untereinander. Bezogen je-<br />
doch auf Kooperationen mit ges<strong>und</strong>heitsspezifischer Fragestellung innerhalb<br />
der Weiterbildung zeichnet sich ein nicht sehr dichtes Netz ab. Bei fast der Hälf-<br />
te der befragten Träger liegen derartige Kooperationen vor, bei 5 Trägern liegen<br />
keine Aussagen vor. Als häufigste Kooperationspartner wurden das Deutsche<br />
Institut für Erwachsenenbildung/Pädagogische Arbeitsstelle des Deutschen<br />
Volkshochschul-Verbandes (DIE/DVV), der deutsche Sportb<strong>und</strong> (DSB) sowie<br />
der Kneipp-B<strong>und</strong>, das Deutsche Rote Kreuz (DRK) <strong>und</strong> die Deutsche Arbeits-<br />
gemeinschaft Selbsthilfegruppen (DAG SHG) ermittelt (B<strong>und</strong>esministerium für<br />
Bildung, Wissenschaft, Forschung <strong>und</strong> Technologie 1997).<br />
Betrachtet man die Ebene der formellen Mitgliedschaften (<strong>und</strong> in diesem Zu-<br />
sammenhang vermutbare allgemeine Kooperationsbezüge), findet man kaum<br />
Vernetzungen zwischen dem traditionellen Kreis der Erwachsenenbildung so-<br />
wie dem Kreis der Wohlfahrtsverbände <strong>und</strong> ges<strong>und</strong>heitsbezogenen Verbänden<br />
einschließlich der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Die durch das<br />
BMBF untersuchten Kooperationsbezüge <strong>und</strong> Vernetzungen beziehen sich alle<br />
auf die Ebene des B<strong>und</strong>es.<br />
2.6.1 Beispiele intersektoraler Kooperationsprogramme<br />
Im Folgenden wird zunächst auf Netzwerke im europäischen Kontext eingegan-<br />
gen, dann auf die b<strong>und</strong>esweiten Netzwerkaktivitäten sowie eine Netzwerkstruk-<br />
tur in einem einzelnen B<strong>und</strong>esland <strong>und</strong> schließlich auch auf ein kommunales<br />
Netzwerk der <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>.<br />
32
2.6.1.1 europäische Netzwerke<br />
Europäisches Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Schulen (ENHPS)<br />
Das Konzept der Ges<strong>und</strong>heitsfördernden Schule wurde Anfang der 90er Jahre<br />
vom Regionalbüro der Weltges<strong>und</strong>heitsorganisation für Europa in Kopenhagen<br />
entwickelt <strong>und</strong> 1992 im Gemeinschaftsprojekt „Europäisches Netzwerk Ge-<br />
s<strong>und</strong>heitsfördernde Schulen" des WHO-Regionalbüros Europa, der Europäi-<br />
schen Kommission <strong>und</strong> des Europarates verankert.<br />
Es richtet sich an Primar, Mittel- <strong>und</strong> Berufsschulen, die aktiv Ges<strong>und</strong>heitsförde-<br />
rung betreiben (Unter:<br />
http://www.euro.who.int/eprise/main/WHO/Progs/ENHPS/Home, Zugriff:<br />
23.06.2005).<br />
European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP)<br />
Die Mitglieder des Europäischen Netzwerks Betriebliche Ges<strong>und</strong>heitsförderung<br />
arbeiten zusammen <strong>zur</strong> Verwirklichung der Vision „ges<strong>und</strong>e Beschäftigte in ge-<br />
s<strong>und</strong>en Unternehmen“. Mit seinen Aktivitäten möchte das Netzwerk eine gute<br />
Ges<strong>und</strong>heitsförderungspraxis in Unternehmen <strong>zur</strong> Gestaltung ges<strong>und</strong>heitsge-<br />
rechter Arbeitsplätze entwickeln <strong>und</strong> fördern. Das Ziel ist die Erreichung eines<br />
hohen Niveaus des Ges<strong>und</strong>heitsschutzes sowie die Förderung der wirtschaftli-<br />
chen <strong>und</strong> sozialen Entwicklung. Den Aktivitäten des europäischen Netzwerks<br />
liegen vier Dokumente zu Gr<strong>und</strong>e: Luxembourg Declaration, Cardiff Memoran-<br />
dum, Lissbon Statement, Barcelona Declaration<br />
(http://www.bkk.de/bkk/powerslave,id,413,nodeid,413.html?id=459, Zugriff:<br />
22.06.2005).<br />
2.6.1.2 deutschlandweite Netzwerke<br />
Allianz für Ges<strong>und</strong>heitsförderung<br />
Die Allianz für Ges<strong>und</strong>heitsförderung ist ein b<strong>und</strong>esweiter Zusammenschluss<br />
von Mitgliedern der Ges<strong>und</strong>heitsAkademie <strong>und</strong> des B<strong>und</strong>esministeriums für<br />
Ges<strong>und</strong>heit. Die Allianz für Ges<strong>und</strong>heitsförderung knüpft an das Programm der<br />
WHO „Ges<strong>und</strong>heit für Alle“ von 1976 <strong>und</strong> das Dokument der Ottawa Charta an<br />
33
<strong>und</strong> will mit ihren Aktivitäten dazu beitragen in Deutschland eine zielorientierte<br />
<strong>und</strong> wirkungsvolle Politik der Ges<strong>und</strong>heitsförderung voranzubringen. Die fol-<br />
genden 10 Zielsetzungen wurden formuliert:<br />
1. Nachhaltige Entwicklungsperspektiven für die Ges<strong>und</strong>heit der Menschen<br />
entwickeln.<br />
2. Biotechnische Einseitigkeit der Medizin überwinden.<br />
3. Eine Ökonomie im Dienste der Ges<strong>und</strong>heit entwickeln.<br />
4. Ges<strong>und</strong>heitswissenschaften fördern.<br />
5. Fähigkeiten <strong>zur</strong> ges<strong>und</strong>heitlichen Selbstregulation <strong>und</strong> Selbstbestimmung<br />
vermitteln.<br />
6. Ökologische <strong>und</strong> soziale Verantwortung übernehmen.<br />
7. Neuorientierung der Ges<strong>und</strong>heitsdienste unterstützen.<br />
8. Intersektorale Zusammenarbeit <strong>und</strong> Verantwortung fördern.<br />
9. Staatliche Rahmenverantwortung wahrnehmen.<br />
10. Bürgerschaftliches Engagement fördern (Göpel & Hölling 2001, S.8ff.).<br />
Die Allianz für Ges<strong>und</strong>heitsförderung ist derzeit nicht aktiv.<br />
Das Ges<strong>und</strong>e Städte-Netzwerk<br />
Das b<strong>und</strong>esdeutsche Ges<strong>und</strong>e Städte-Netzwerk wurde 1989 gegründet <strong>und</strong><br />
umfasst derzeit ca. 60 Mitgliedsstädte. Es ist ein freiwilliger Zusammenschluss<br />
von Kommunen, die sich <strong>zur</strong> Einhaltung eines 9-Punkte-Programms als Krite-<br />
rien für die Teilnahme am Ges<strong>und</strong>e Städte-Netzwerk verpflichtet haben. Das<br />
Netzwerk ist Teil der Ges<strong>und</strong>e Städte-Bewegung der WHO, mit der „Ottawa-<br />
Charta <strong>zur</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung“ von 1986 als Ausgangspunkt. Die Ges<strong>und</strong>e<br />
Städte-Bewegung versteht sich als Lern-, Aktions- <strong>und</strong> Diskussionsinstrument,<br />
mit dem die Mitgliedsstädte ihre eigene Arbeit im Sinne der Ges<strong>und</strong>e Städte-<br />
Konzeption unterstützen <strong>und</strong> bereichern können. Eine hohe Bedeutung kommt<br />
dem gegenseitigen Informations- <strong>und</strong> Erfahrungsaustausch zu. Das Ges<strong>und</strong>e<br />
Städte-Netzwerk spricht in fachlicher <strong>und</strong> fachpolitischer Hinsicht Mitarbei-<br />
ter/innen des Ges<strong>und</strong>heitsamtes, des Sozialamtes, des Wohnungsamtes, des<br />
Umweltamtes <strong>und</strong> der Stadtentwicklungsplanung ebenso an, wie Vertre-<br />
ter/innen der Ges<strong>und</strong>heitsinitiativen <strong>und</strong> Selbsthilfegruppen. Mitgliederver-<br />
34
sammlungen des deutschen Netzwerkes finden jährlich, Ges<strong>und</strong>e Städte-<br />
Symposien in der Regel alle zwei Jahre statt (http://www.ges<strong>und</strong>e-staedte-<br />
netzwerk.de/; Zugriff: 18.05.2005).<br />
Lokale Agenda 21<br />
Die Lokale Agenda 21 ist eines der Resultate der RIO-Konferenz 1992 <strong>und</strong> wird<br />
als Aktionsprogramm für das 21. Jahrh<strong>und</strong>ert bezeichnet. Sie gilt als gemein-<br />
same Strategie der internationalen Staatengemeinschaft <strong>zur</strong> Bewältigung der<br />
globalen sozialen <strong>und</strong> ökologischen Probleme des Jahrh<strong>und</strong>erts.<br />
Zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung ist die Mitwirkung der Kommu-<br />
nen, ihrer Bewohner <strong>und</strong> örtlichen Gemeinschaften eine wesentliche Voraus-<br />
setzung (http://www.umweltb<strong>und</strong>esamt.de/rup/lokale-agenda.html, Zugriff:<br />
23.06.2005).<br />
Soziale Stadt<br />
„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – soziale Stadt“ ist ein B<strong>und</strong>-<br />
Länder-Programm, das 1999 als Ergänzung <strong>zur</strong> Städtebauförderung eingeführt<br />
wurde. Die Gemeinschaftsinitiative stellt einen neuen integrativen Politikansatz<br />
der Stadtteilentwicklung dar <strong>und</strong> ist ausgelegt auf Partizipation <strong>und</strong> Kooperati-<br />
on. Das Programm will der sich verschärfenden sozialen <strong>und</strong> räumlichen Spal-<br />
tung von Stadtteilen entgegen steuern (http://www.sozialestadt.de/programm/,<br />
Zugriff: 24.06.2005).<br />
Netzwerk "Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Hochschule"<br />
Die Erste Internationale Konferenz <strong>zur</strong> Ges<strong>und</strong>heitsfördernden Hochschule,<br />
organisiert vom Europäischen Regionalbüro der WHO <strong>und</strong> der Universität Lan-<br />
caster, fand 1996 statt. Nachdem 1997 unter Einberufung eines R<strong>und</strong>en Ti-<br />
sches durch die WHO Kriterien <strong>und</strong> Strategien für ein neues Europäisches<br />
Netzwerk „Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Hochschulen“ diskutiert wurde, ist deren<br />
Gründung in Planung. Derzeit gehört es noch als Subprojekt dem „Ges<strong>und</strong>e-<br />
Städte-Projekt“ der WHO an.<br />
35
Die Ziele des Projektes Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Hochschule basieren auf der<br />
Philosophie <strong>und</strong> den Prinzipien des WHO-Programms "Ges<strong>und</strong>heit 21", der Ot-<br />
tawa-Charta <strong>und</strong> der lokalen Agenda 21. Dies sind u.a.:<br />
- die Bereitstellung ges<strong>und</strong>er Arbeits-, Lern- <strong>und</strong> Lebensbedingungen für alle<br />
Beteiligten einer Hochschule,<br />
- die nachhaltige Verankerung des Ges<strong>und</strong>heitsförderungskonzeptes in Lehre<br />
<strong>und</strong> Forschung,<br />
- die Entwicklung von Kooperationen der Ges<strong>und</strong>heitsförderung mit <strong>und</strong> die<br />
Unterstützung von ges<strong>und</strong>heitsförderlichen Entwicklungen in der Kommune<br />
(http://www.sgw.hs-<br />
magde-<br />
burg.de/initiativen/akges<strong>und</strong>hs/HTML/B_Basiswissen_GF/B3_Settings_Netz<br />
werke1.html, Zugriff: 30.06.2005).<br />
Netzwerk "Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Krankenhäuser"<br />
Das "Deutsche Netz Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser" (DNGfK) wurde<br />
1996 unter der Beteiligung von zwölf Krankenhäusern in Prien am Chiemsee<br />
als gemeinnütziger Verein gegründet. Das Netz umfasst 66 Mitglieder (2004)<br />
mit über 70 Einrichtungen <strong>und</strong> 9 assoziierten Mitgliedern, die Bettenzahl der<br />
Krankenhäuser beträgt ca. 32.500. Das DNGfK setzt sich aus Akut-, Reha- <strong>und</strong><br />
Universitätskliniken in öffentlich-rechtlicher, freigemeinnütziger <strong>und</strong> auch priva-<br />
ter Trägerschaft zusammen. Zur gegenseitigen Unterstützung bei der Umset-<br />
zung der Strategie <strong>und</strong> des Konzeptes Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser<br />
<strong>und</strong> zum intensiveren Erfahrungsaustausch haben sich Regionale Arbeitsge-<br />
meinschaften gebildet (http://www.dngfk.de/, Zugriff: 30.06.2005)).<br />
Dem 1990 vom Europabüro der WHO gegründeten Netzwerk „Ges<strong>und</strong>heitsför-<br />
dernder Krankenhäuser“ gehören heute 47 Länder an. Ziele der WHO-Initiative<br />
sind es, gute Praxisbeispiele zu fördern, in dem Konzepte, Strategien <strong>und</strong> Mo-<br />
dellprojekte entwickelt werden sowie, durch regelmäßige Konferenzen <strong>und</strong> Ver-<br />
öffentlichungen, einen Beitrag <strong>zur</strong> weiteren Vernetzung zu leisten.<br />
36
Die Aufgabe Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser ist es, <strong>zur</strong> Verbesserung<br />
der Ges<strong>und</strong>heit der Patienten, Mitarbeiter <strong>und</strong> des Versorgungsumfelds beizu-<br />
tragen. Die Ziele sind nach Naidoo J. & Wills, J. (2003):<br />
- Das Krankenhaus zu einem gesünderen Arbeits- <strong>und</strong> Lebensumfeld für die<br />
Vielzahl seiner Beschäftigten <strong>und</strong> Patienten zu machen,<br />
- Programme <strong>zur</strong> Wiedergenesung <strong>und</strong> Rehabilitation zu erweitern,<br />
- Informationen <strong>und</strong> Beratungen zu Fragen der Ges<strong>und</strong>heit bereit zu stellen,<br />
- Das Krankenhaus zu einem Setting zu entwickeln, das nicht nur Krankhei-<br />
ten behandelt, sondern auch entsprechenden Wert auf die Prävention <strong>und</strong><br />
den Ges<strong>und</strong>heitsgewinn legt <strong>und</strong> dies als Teil des Unternehmensziels an-<br />
sieht.<br />
Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Schulen / OPUS<br />
Deutschland beteiligte sich am europäischen Netzwerk ges<strong>und</strong>heitsfördernder<br />
Schulen (ENHPS) mit zwei Modellversuchen:<br />
1. „Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Schulen“:<br />
Das „Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Schulen“ existierte vom 1. Februar 1993 -<br />
31. Januar 1997 unter Aufsicht der B<strong>und</strong>-Länder-Kommission (BLK) für Bil-<br />
dungsplanung <strong>und</strong> Forschungsförderung <strong>und</strong> war ein gemeinsamer Modellver-<br />
such aller B<strong>und</strong>esländer (Ausnahme Bayern) der 29 Schulen einbezog (Jo-<br />
hannsen 2003).<br />
2. „OPUS - Offenes Partizipationsnetz <strong>und</strong> Schulges<strong>und</strong>heit“<br />
Vom 1. Juli 1997 - 30. Juni 2000 wurde von der B<strong>und</strong>-Länder-Kommission ein<br />
weiterer Modellversuch durchgeführt: „OPUS - Offenes Partizipationsnetz <strong>und</strong><br />
Schulges<strong>und</strong>heit“. Es knüpft an die Erfahrungen <strong>und</strong> Ergebnisse des Modell-<br />
versuchs „Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Schulen“ an <strong>und</strong> bezog mehr als<br />
500 Schulen aus 15 B<strong>und</strong>esländern ein (ebenda).<br />
37
Nachdem OPUS im Sommer 2000 offiziell abgeschlossen wurde, lebt die Idee<br />
in den Ländern <strong>und</strong> den beteiligten Schulen weiter, denn aufgr<strong>und</strong> der föderalis-<br />
tischen Zuständigkeit für Bildung in Deutschland wurden nach den BLK-<br />
Modellversuchen länderübergreifende Strukturen abgebaut. Derzeit existieren<br />
in einigen B<strong>und</strong>esländern Schulnetzwerke (z.B. OPUS NRW) die vornehmlich<br />
von den jeweiligen Landesvereinigungen koordiniert werden. Des Weiteren<br />
werden von verschiedenen Projektträgern Einzelprojekte, -maßnahmen <strong>und</strong><br />
Kampagnen für den Bereich Schule entwickelt <strong>und</strong> vorangetrieben (ebenda).<br />
Deutsches Netzwerk Betriebliche Ges<strong>und</strong>heitsförderung (DNBGF)<br />
Mit der Zielsetzung einen Beitrag <strong>zur</strong> besseren Verbreitung guter Praxis betrieb-<br />
licher Ges<strong>und</strong>heitsförderung (BGF) zu leisten, gründete sich im Juni 2002 das<br />
Deutsche Netzwerk Betriebliche Ges<strong>und</strong>heitsförderung (DNBGF). Es ist Teil der<br />
Initiative Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Arbeit (IGA), einem gemeinsamen Vorhaben vom<br />
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG) <strong>und</strong> dem<br />
B<strong>und</strong>esverband der Betriebskrankenkassen (BKK BV).<br />
Das DNBGF geht auf das Europäische Netzwerk für betriebliche Ges<strong>und</strong>heits-<br />
förderung (ENWHP) <strong>zur</strong>ück.<br />
Es unterhält zahlreiche Kooperationen sowohl mit der Initiative „Neue Qualität<br />
der Arbeit“ (INQA) als auch mit dem „Forum Prävention <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförde-<br />
rung“, einer vom B<strong>und</strong>esministerium für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziale Sicherung,<br />
Verbänden, Institutionen, Behörden <strong>und</strong> Körperschaften eingerichtete Plattform.<br />
Zudem unterstützt der „Kooperationskreis Betriebliche Ges<strong>und</strong>heitsförderung“<br />
beim B<strong>und</strong>esministerium für Wirtschaft <strong>und</strong> Arbeit den weiteren Aufbau des<br />
Netzwerks.<br />
Das Netzwerk arbeitet in einzelnen Foren, die eigenständig folgende sechs Set-<br />
tings bzw. Handlungsfelder der BGF abdecken:<br />
- Öffentlicher Dienst<br />
- Großunternehmen<br />
- Klein- <strong>und</strong> Mittelunternehmen<br />
- Ges<strong>und</strong>heitsversorgung <strong>und</strong> Wohlfahrtspflege<br />
- Erziehung <strong>und</strong> Ausbildung<br />
38
Deutsches Forum Prävention <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung<br />
Das gemeinsame Ziel der aktuell 71 Mitglieder ist die Stärkung von Prävention<br />
<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Deutschland. Dem Forum, das auf Initiative der<br />
B<strong>und</strong>esministerin für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziale Sicherung gegründet wurde, ge-<br />
hören nicht nur Spitzenverbände <strong>und</strong> Organisationen aus dem Ges<strong>und</strong>heitswe-<br />
sen an, sondern auch weitere Ministerien <strong>und</strong> Verbände, die einen Beitrag <strong>zur</strong><br />
Prävention leisten können. Es versteht sich als Koordinierungsstelle zwischen<br />
dem Plenum <strong>und</strong> der Geschäftsstelle <strong>und</strong> hat 4 Arbeitsgruppen eingerichtet:<br />
AG 1: „Ges<strong>und</strong>e Kindergärten <strong>und</strong> Schule“<br />
AG 2: „Betriebliche Ges<strong>und</strong>heitsförderung“<br />
AG 3: „Ges<strong>und</strong> altern“<br />
AG 4: „Organisation <strong>und</strong> Recht“<br />
Das Deutsche Forum Prävention <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung ist die Plattform<br />
auf der gemeinsame Ziele vereinbart, Inhalte <strong>und</strong> Instrumente festgelegt sowie<br />
Maßnahmen veranlasst werden.<br />
2.6.1.3 Netzwerke auf Länderebene<br />
Netzwerk Bildung <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit Nordrhein Westfalen (OPUS NRW)<br />
Als konzeptioneller Hintergr<strong>und</strong> steht die Ottawa-Charta <strong>zur</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförde-<br />
rung von 1986. Innerhalb der Netzwerkarbeit wird im Setting Schule das Salu-<br />
togenese-Prinzip verfolgt <strong>und</strong> Partizipation, Selbstbestimmung <strong>und</strong> Empower-<br />
ment als wesentliche Voraussetzungen für Schüler (mehr Lernfreude <strong>und</strong> Stei-<br />
gerung der Lernleistungen, Einsicht in Zusammenhänge von Lebensstil <strong>und</strong><br />
eigenem Ges<strong>und</strong>heitsstatus <strong>und</strong> Befähigung zu ges<strong>und</strong>heitsbewusstem Han-<br />
deln), Unterrichtende (ges<strong>und</strong>heitsförderliche Arbeitsplatzgestaltung durch<br />
Formen der betrieblichen Ges<strong>und</strong>heitsförderung, Einsicht in Zusammenhänge<br />
von Berufsbiografie <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsstatus <strong>und</strong> Befähigung zu ges<strong>und</strong>heitsbe-<br />
wusstem, professionellem Handeln) <strong>und</strong> Schulentwicklung (Integration systemi-<br />
scher <strong>und</strong> personenorientierter Entwicklungsperspektiven) gefördert.<br />
39
Auftrag, Zielsetzung <strong>und</strong> Selbstverständnis von OPUS-NRW ist die Mitwirkung<br />
an der ges<strong>und</strong>heitsförderlichen Schulentwicklung, die Unterstützung von Schu-<br />
len aller Schulformen mit Konzepten, Materialien, Beratungs- <strong>und</strong> Fortbildungs-<br />
angeboten <strong>und</strong> finanziellen Mitteln sowie Aufbau <strong>und</strong> Pflege von lokalen Netz-<br />
werken auf Schulamtsebene (http://www.learn-line.nrw.de/angebote/ges<strong>und</strong>ids/,<br />
Zugriff: 23.06.2005).<br />
2.6.1.4 Kommunales Netzwerk<br />
Netzwerk <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> Köln<br />
Das seit Herbst 1996 existierende Netzwerk <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> ist ein Ver-<br />
b<strong>und</strong> von insgesamt r<strong>und</strong> 40 Weiterbildungsträgern aus dem öffentlichen <strong>und</strong><br />
privaten Bereich, Sportvereinen, Krankenkassen, VertreterInnen der Ärzte-<br />
kammer, der Kassenärztlichen Vereinigung, der Stadt Köln sowie von Selbsthil-<br />
fegruppen, Beratungsstellen <strong>und</strong> Initiativen. Die Gründungsinitiative ging von<br />
der Volkshochschule (VHS) Köln aus, sie ist bis heute federführend, sie beglei-<br />
tet <strong>und</strong> moderiert. Innerhalb der Vernetzung arbeiten die Akteure informell, lo-<br />
gistisch-strategisch <strong>und</strong> inhaltlich-konzeptionell unter folgenden Zielsetzungen<br />
zusammen:<br />
- Erhebung <strong>und</strong> Analyse der Angebote im Bereich Prävention <strong>und</strong> Vorsorge<br />
in Köln;<br />
- interner Austausch <strong>und</strong> Förderung der Kooperation zwischen den Anbietern;<br />
- Gewährleistung eines umfassenden <strong>und</strong> flächendeckenden Angebotes;<br />
- Vermeidung unsinniger Konkurrenz;<br />
- Schaffung einer umfassenden Informationsmöglichkeit für die Bürgerinnen<br />
<strong>und</strong> Bürger der Stadt (http://www.stadt-koeln.de/vhs/projekte/artikel/00490/,<br />
Zugriff: 23.06.2005).<br />
2.6.2 Vorteile <strong>und</strong> Gewinne von Netzwerkarbeit<br />
An Hand der vorangegangenen Darstellung funktionierender Netzwerkbeispiele<br />
lassen sich in knapper Form folgende Vorteile <strong>und</strong> Gewinne für Beteiligte in ei-<br />
nem Netzwerkprozess zusammenfassen:<br />
40
- Steigerung der Qualität <strong>und</strong> Akzeptanz des Angebots,<br />
- Ressourcenbündelung <strong>und</strong> bessere Ressourcennutzung,<br />
- Erschließung neuer Finanzquellen <strong>und</strong><br />
- Optimierung der eigenen Arbeit durch das Lernen von anderen.<br />
Bei der Initiierung von Lern- <strong>und</strong> Erfahrungsprozessen ist es wichtig, vormals<br />
erlebte Frustrationen <strong>und</strong> Konflikte mit den konkurrierenden Organisationen, die<br />
sich jedoch innerhalb des Netzwerks partnerschaftlich engagieren, zu themati-<br />
sieren <strong>und</strong> in aktuelle Verstehensprozesse zu integrieren. Exemplarische Lern-<br />
prozesse können in der Vermittlung von Erfahrungen <strong>und</strong> institutionellen Ar-<br />
beitsweisen <strong>und</strong> Routinen liegen, es können im weiteren Prozess hemmende<br />
<strong>und</strong> fördernde Faktoren für gelungene Kooperationsbeziehungen <strong>und</strong> vertrau-<br />
ensvolle Zusammenarbeit gekennzeichnet werden <strong>und</strong> der weiteren produkti-<br />
ven Berücksichtigung <strong>zur</strong> Verfügung gestellt werden. Jeder Beteiligte sollte am<br />
Ende einen Zugewinn von persönlichen Schlüsselqualifikationen im Umgang<br />
mit Innovationsleistungen <strong>und</strong> zum Transfer der exemplarischen Lernprozesse<br />
für sich realisieren können (Bornhoff et al. 2003).<br />
2.6.3 Initiierung eines Netzwerkprozesses – Auswahl <strong>und</strong> Einbindung<br />
von potentiellen Netzwerkpartnern<br />
Ausschlaggebend für die Mitwirkung in Netzwerken ist für die potentiell Beteilig-<br />
ten die Wahrnehmung von Problemen, die sie nicht alleine lösen können bzw.<br />
deren Lösbarkeit außerhalb der eigenen dafür <strong>zur</strong> Verfügung stehenden Res-<br />
sourcen liegt. Aus der Sicht des Netzwerkinitiators stellt sich die Frage: „Wen<br />
brauche ich?“ oder auch „Wer braucht mich <strong>zur</strong> Lösung seiner Problemstellun-<br />
gen bzw. <strong>zur</strong> Realisierung seiner Ziele?“ Hier geht es nicht nur um das Ausloten<br />
<strong>und</strong> Abschätzen potentieller Zugewinnsituationen <strong>und</strong> Synergien, sondern auch<br />
darum, ob <strong>und</strong> welche gemeinsamen Netzwerkaktivitäten realisierbar sind<br />
(Freie Universität Berlin; Landesges<strong>und</strong>heitsamt Brandenburg 1999).<br />
Wichtig ist zudem, welche hierarchische Ebene der Mitgliedsinstitution im<br />
Netzwerk vertreten ist. Dominiert die Fach- <strong>und</strong> Arbeitsebene ist davon auszu-<br />
41
gehen, dass innerhalb der Netzwerkarbeit der Erfahrungs- <strong>und</strong> Informationsaus-<br />
tausch als Hauptaufgabe gesehen wird. Ist jedoch die Entscheidungsebene,<br />
das höhere Management der Organisation involviert, ist das Netzwerk in der<br />
Lage, verbindliche Entscheidungen gr<strong>und</strong>sätzlicher Art zu fällen. Die Einbin-<br />
dung der Entscheidungsebene erfolgt sinnvoller Weise in solchen Verbünden,<br />
wo die Arbeit von strategischen Überlegungen <strong>und</strong> Konzeptentwicklungen be-<br />
gleitet wird, Finanzverhandlungen zu führen <strong>und</strong>/oder symbolische <strong>und</strong> öffent-<br />
lichkeitswirksame Aktionen etc. geplant sind (ebenda).<br />
2.6.4 Zielsetzungen von Netzwerken der Ges<strong>und</strong>heitsförderung/-<br />
bildung<br />
In diesem Kapitel werden die Zielsetzungen in allgemeiner Weise formuliert, um<br />
eine Übertragbarkeit zu realisieren. Jedes Netzwerk schafft sich eigene, auf<br />
seine spezielle Tätigkeit ausgerichtete Zielsetzungen. Die Formulierung der Zie-<br />
le erfolgt, wie zuvor gemeinsam festgelegt, entweder durch Erzielung eines<br />
Konsens oder durch eine mehrheitliche Entscheidung, innerhalb von Aushand-<br />
lungsprozessen.<br />
Es können folgende Zielhierarchien unterschieden werden:<br />
1. Systemziel (Ziel des Netzwerks)<br />
2. Leistungsziele (Mit welchen konkreten Teilzielen wollen wir unser Sys-<br />
temziel erreichen?)<br />
3. Strukturziele (Wie soll die Zusammenarbeit im Netzwerk gestaltet wer-<br />
den? Welche Regeln der Zusammenarbeit sollen gelten?)<br />
Wie bereits erwähnt sollte der Kommunikations- <strong>und</strong> Verständigungsprozess<br />
mit Berücksichtigung der wechselseitigen Erwartungen <strong>und</strong> unterschiedlichen<br />
Vorstellungen der beteiligten Akteure erfolgen. Besonders die Formulierung der<br />
Leistungs- <strong>und</strong> Strukturziele sind Daueraufgabe, sie bedürfen im Verlaufe der<br />
Arbeit der Vergewisserung, ggf. der Neufassung <strong>und</strong> der Korrektur (Bornhoff et<br />
al. 2003).<br />
42
Die im Folgenden beschriebenen Zielstellungen zählen zu den Leistungszielen<br />
eines Netzwerks <strong>und</strong> besitzen lediglich Angebots- <strong>und</strong> Vorschlagscharakter.<br />
Jedem Partner muss die Möglichkeit eingeräumt werden, seine persönlichen<br />
bzw. die Ziele seiner Herkunftsorganisation in die Netzwerkarbeit einfließen zu<br />
lassen, denn nur so kann eine Zugewinnsituation für jeden Mitwirkenden ent-<br />
stehen <strong>und</strong> eine dauerhafte Motivation <strong>zur</strong> Beteiligung erzeugt <strong>und</strong> erhalten<br />
werden. Mögliche Zielsetzungen von Netzwerken der Ges<strong>und</strong>heitsförderung<br />
<strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> können nach Bornhoff et al. (2003) die Folgenden<br />
sein:<br />
a) Abstimmung <strong>und</strong> Koordination:<br />
Die Leistungen der Anbieter können innerhalb eines funktionierenden<br />
Netzwerks wirkungsvoll <strong>und</strong> effizient aufeinander abgestimmt <strong>und</strong> ko-<br />
ordiniert werden. So können sich ergänzende Maßnahmen, wie z.B.<br />
Aufbau- oder Weiterführungskurse, von verschiedenen Leistungserb-<br />
ringern (je nach verfügbaren Ressourcen <strong>und</strong> Kapazitäten), zeitlich<br />
<strong>und</strong> inhaltlich aufeinander abgestimmt – im Sinne der Kun-<br />
den/Patienten – angeboten werden. Hier können insbesondere Syner-<br />
gieeffekte geschaffen werden, Mehrfachangebote abgebaut <strong>und</strong> un-<br />
sinnige Konkurrenzen überw<strong>und</strong>en werden.<br />
b) mehr Transparenz <strong>und</strong> bessere Informationsmöglichkeiten:<br />
Innerhalb der Netzwerktätigkeit könnte ein weiterer Fokus auf die Her-<br />
stellung von Transparenz <strong>und</strong> besseren Informationsmöglichkeiten<br />
über die ges<strong>und</strong>heitliche Versorgung <strong>und</strong> zu Angeboten der Ges<strong>und</strong>-<br />
heitsförderung <strong>und</strong> –bildung für BürgerInnen <strong>und</strong> Patienten liegen.<br />
Konkrete Aufgabe könnte hier u.a. die gemeinsame Erstellung eines<br />
Ges<strong>und</strong>heitswegweisers sein.<br />
43
c) quantitative <strong>und</strong> qualitative Verbesserung der kommuna-<br />
len/regionalen Ges<strong>und</strong>heitsförderung:<br />
Dies kann u.a. realisiert werden, indem der Bevölkerung ein flächen-<br />
deckendes <strong>und</strong> differenziertes Angebot, das sich an Kriterien wie Be-<br />
darfsgerechtigkeit, Zugänglichkeit <strong>und</strong> Bürgernähe orientiert, vorgehal-<br />
ten wird.<br />
d) Stärkung der Ges<strong>und</strong>heitsförderung mit den Zielen der Ottawa<br />
Charta:<br />
Im Sinne der Ottawa Charta verfolgt die Ges<strong>und</strong>heitsförderung zwei<br />
allgemeine Ziele, <strong>und</strong> zwar die Verminderung von Risiken <strong>und</strong> die<br />
Vermehrung von Ressourcen für die Ges<strong>und</strong>heit in vielen verschiede-<br />
nen Bereichen. Zwei dieser Bereiche stellen z.B. ges<strong>und</strong>heitsfördern-<br />
de personale Faktoren <strong>und</strong> ges<strong>und</strong>heitsgerechte Lebensweisen dar,<br />
die den Menschen via <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> vermittelt werden können.<br />
e) Initiierung von Innovationen:<br />
Innerhalb einer institutions- <strong>und</strong> trägerübergreifenden Entwicklung <strong>und</strong><br />
Erprobung neuer, innovativer Konzepte in Maßnahmen <strong>und</strong> Projekten<br />
können, bei Verminderung finanzieller Risiken, gänzlich neue Wege<br />
beschritten oder bereits bestehende innovative <strong>und</strong> erfolgreiche Pro-<br />
jekte übertragen werden, indem sie an die Bedürfnisse <strong>und</strong> Verhältnis-<br />
se der jeweiligen Region angepasst werden.<br />
f) Ressourcenbündelung <strong>und</strong> bessere Ressourcennutzung herstel-<br />
len:<br />
Angesichts immer knapper werdender öffentlicher Gelder rückt inner-<br />
halb des Ges<strong>und</strong>heitswesens der Fokus immer weiter Richtung Identi-<br />
fizierung <strong>und</strong> Ausnutzung von Einsparpotentialen.<br />
g) Qualitätsmanagement:<br />
44
Eine weitere mögliche Zielstellung könnte in der gemeinsamen <strong>und</strong><br />
übergreifenden Formulierung <strong>und</strong> Überprüfung von Qualitätsstandards<br />
liegen.<br />
h) Informations- <strong>und</strong> Erfahrungsaustausch verbessern:<br />
Im Rahmen der Netzwerkarbeit existieren die besten Bedingungen<br />
zum gemeinsamen Informations- <strong>und</strong> Erfahrungsaustausch. Das Ler-<br />
nen voneinander kann einen entscheidenden Beitrag <strong>zur</strong> Weiterent-<br />
wicklung der eigenen Organisation leisten.<br />
i) Kommunale Ges<strong>und</strong>heitsberichterstattung:<br />
Das Zusammenführen der relevanten Daten aus den beteiligten Insti-<br />
tutionen mit dem Ziel der Erstellung eines kommunalen Ges<strong>und</strong>heits-<br />
berichts kann als Gr<strong>und</strong>lage für das Feststellen von Entwicklungsbe-<br />
darf, <strong>zur</strong> Erk<strong>und</strong>ung der Interessen der BürgerInnen <strong>und</strong> <strong>zur</strong> Überprü-<br />
fung der Erfolge innovativer Maßnahmen <strong>und</strong> Projekte dienen. Ferner<br />
wird hier ein wichtiges Evaluationsinstrument für die regionale Ge-<br />
s<strong>und</strong>heitsförderung geschaffen.<br />
Welche der beschriebenen Ziele konkret die Arbeit im Netzwerk bestimmen,<br />
entscheiden die Netzwerkpartner gemeinsam. In einem vorherigen Abstim-<br />
mungsprozess wird die Art der Entscheidungsfindung festgelegt. Eine Ent-<br />
scheidung kann, wie bereits oben erwähnt, durch Konsens- oder Mehrheitsbil-<br />
dung herbeigeführt werden.<br />
2.6.5 Strategien erfolgreicher Netzwerke<br />
Um eine funktionsfähige, ergebnisorientierte Netzwerkstruktur aufzubauen, be-<br />
darf es einiger vorheriger Reglementierungen bzw. Vereinbarungen, die im<br />
Konsens formuliert wurden. Diese sind gleichzusetzen mit den, im Kap. 2.6.4<br />
beschriebenen, Strukturzielen:<br />
Bildung einer geeigneten Organisationsstruktur<br />
45
Netzwerke können als relativ unverbindliche, lose Zusammenschlüsse<br />
oder als solche, die sich durch höhere Verbindlichkeit auszeichnen <strong>und</strong><br />
eine Rechtsform haben, funktionieren. Oftmals besitzen sie auch eine<br />
Geschäftsstelle.<br />
Vereinbarungen <strong>zur</strong> Herstellung von Verbindlichkeiten<br />
Dies stellt eine permanente Aufgabe dar, da sich Ziele <strong>und</strong> Anforderun-<br />
gen der Netzwerkarbeit im Prozess der Arbeit verändern.<br />
Einrichtung eines Steuerungskreises<br />
Die Einbeziehung einer intermediären Brückeneinrichtung, <strong>zur</strong> Koordina-<br />
tion <strong>und</strong> Bereitstellung eines Ansprechpartners, sowie den Aufgaben der<br />
Dokumentation, <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit etc. ist bedeutungsvoll, jedoch<br />
nicht zwingend notwendig.<br />
Entscheidend für den erfolgreichen Aufbau einer arbeitsfähigen Netzwerkstruk-<br />
tur ist eine hinreichende Planung vor <strong>und</strong> während der Vernetzung im Sinne<br />
eines Projektes. Im Idealfall entsteht aus dem zeitlich begrenzten Projekt „Ver-<br />
netzung“ eine unbefristete Kooperation. Damit das Projekt jedoch zum Laufen<br />
kommt, ist es wichtig, alle Beteiligten von Anfang an einzubinden, um so die<br />
Identifikation mit dem Netzwerk zu stärken (vgl. Kap. 2.6.6).<br />
Prümel-Philippsen erläutert im Vorwort der Veröffentlichung der Ges<strong>und</strong>heits-<br />
Akademie e.V. „Ges<strong>und</strong>heit gemeinsam gestalten“ 2001 zwei prioritäre Fragen,<br />
mit denen sich die Allianz für Ges<strong>und</strong>heitsförderung beschäftigt:<br />
1. Welche Maßnahmen/Aktionen/Programme der Ges<strong>und</strong>heitsförderung<br />
<strong>und</strong> Prävention sind für die Bevölkerung die wichtigsten <strong>und</strong><br />
2. wie kann man diese Maßnahmen/Aktionen/Programme qualitätsgesi-<br />
chert <strong>und</strong> flächendeckend verfügbar machen?<br />
Der Bearbeitung dieser Fragestellungen wird innerhalb der o.g. Publikation eine<br />
hohe Bedeutung, auch angesichts der letzten Reformbewegungen im Ges<strong>und</strong>-<br />
46
heitswesen, beigemessen. Besonders erfolgversprechend erscheint ein Aufgrei-<br />
fen der Fragen innerhalb von kooperierenden Strukturen.<br />
Die Prioritätensetzung <strong>und</strong> eine entsprechend genaue Auswahl der Inhalte der<br />
Maßnahmen/Aktionen/Programme kann mit dem Instrument einer schriftlichen<br />
Befragung der Zielgruppe erfolgen. Innerhalb der Befragung könnte ebenfalls<br />
die zweite Frage aufgegriffen werden <strong>und</strong> so zumindest der Bedarf an Angebo-<br />
ten in bestimmten Regionen in Erfahrung gebracht werden, um ein Über- oder<br />
Unterangebot zu vermeiden <strong>und</strong> damit eine ressourcenschonende aber be-<br />
darfsgerechte Arbeitsweise zu intensivieren bzw. zu ermöglichen. Zudem macht<br />
die zweite Frage deutlich, dass durch möglichst arbeitsteiliges Vorgehen prakti-<br />
kable <strong>und</strong> wirkungsvolle Maßnahmen/Aktionen/Programme entwickelt <strong>und</strong><br />
durchgeführt werden sollten. Eine geeignete Umsetzungsstruktur dieser prioritä-<br />
ren Anliegen wäre eine Netzwerkstruktur, die alle, an einem öffentlichen Ge-<br />
s<strong>und</strong>heitsförderungsprozess beteiligten Akteure <strong>und</strong> Institutionen einbezieht<br />
(Prümel-Philippsen 2001).<br />
2.6.6 Herausforderungen <strong>und</strong> Schwierigkeiten<br />
Bei der Betrachtung der Herausforderungen, die mit der Initiierung der Vernet-<br />
zung einhergehen, fällt zuerst die Schwierigkeit der Finanzierung einer solchen<br />
träger- <strong>und</strong> institutionsübergreifenden Kooperation ins Auge. Im Idealfall stände<br />
eine übergeordnete Instanz <strong>zur</strong> Verfügung, die eine Finanzierung aus öffentli-<br />
chen Geldern koordiniert <strong>und</strong> kontrolliert. Im Sinne der Verbesserung der kom-<br />
munalen Ges<strong>und</strong>heitsförderung wäre die Ausstattung des Projekts mit finanziel-<br />
len Ressourcen durch die Kommune denkbar. Eine weitere Möglichkeit wäre<br />
die Finanzierung der Netzwerkaktivitäten bzw. –produkte durch Mitgliedsbeiträ-<br />
ge innerhalb der Rechtsform eines eingetragenen Vereins (e.V.). Die Gewähr-<br />
leistung einer soliden finanziellen <strong>und</strong> personellen Gr<strong>und</strong>ausstattung ist für den<br />
Erfolg der Netzwerkarbeit unabdingbar. Nur so können Konzepte <strong>zur</strong> Neuerpro-<br />
bung <strong>und</strong> Innovation entstehen <strong>und</strong> genügend zeitlicher <strong>und</strong> finanzieller Frei-<br />
raum <strong>zur</strong> Erweiterung des Netzwerks <strong>und</strong> <strong>zur</strong> Koordination der Netzwerktätig-<br />
keiten geschaffen werden.<br />
47
Trojan <strong>und</strong> Legewie (2001, S.272f.) beschreiben im Kapitel über intermediäre<br />
Kooperationsstrukturen folgende Hemmnisse <strong>und</strong> Probleme:<br />
„Strukturprobleme des Ges<strong>und</strong>heitswesens: viele <strong>und</strong> z. T. unklare Zustän-<br />
digkeiten; Wettbewerb als Gegenströmung <strong>zur</strong> notwendigen Kooperation;<br />
mangelnde Möglichkeit, für Gemeinschaftsaufgaben auch eine gemeinsame<br />
Finanzierung zu erreichen;<br />
mangelnde Konkretheit: die Allzuständigkeit <strong>und</strong> Komplexität des Ansatzes<br />
der Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong> Schwierigkeiten der Schwerpunktsetzung;<br />
Konsensmaxime: deutliche Reduktion der möglichen Maßnahmen, vor al-<br />
lem sind Absichtserklärungen, Bestandsaufnahmen <strong>und</strong> Ansätze geringster<br />
Reichweite möglich, politische Aktionen hingegen ausgeschlossen;<br />
mangelnde Steuerungsmöglichkeiten: die sog. „Konsensfalle“ führt zu vor-<br />
auseilendem Kompromissdenken nach dem Muster der „Schere im Kopf“<br />
Der Mangel an finanziellen <strong>und</strong> personellen Ressourcen wird abschließend<br />
als eines der Hauptprobleme herausgestellt.“<br />
Trojan <strong>und</strong> Legewie (2001) geben zudem an, dass eine Evaluation der<br />
Struktur-, Prozess- <strong>und</strong> Ergebnisqualität derartiger Netzwerke noch nicht oder<br />
nur in Ausnahmefällen vorhanden ist. Dieser Aspekt muss in der Arbeit in<br />
Netzwerken aufgegriffen werden, vor allem, um sie auf einem qualitativ hohen<br />
Niveau anzusiedeln sowie <strong>zur</strong> Weiterentwicklung dieser Kooperationsstrukturen<br />
zu Steuerungsinstrumenten lokaler Ges<strong>und</strong>heitsförderungspolitik beizutragen<br />
(vgl.: Kap. 5).<br />
Die Bildung eines Netzwerks <strong>und</strong> die Arbeit innerhalb der Netzwerkstrukturen<br />
ist ein sehr komplexer <strong>und</strong> schwieriger Prozess, der eine sensible Herange-<br />
hensweise, unter Berücksichtigung zahlreicher sozialer Kompetenzen <strong>und</strong> Wir-<br />
kungsgefüge, verlangt. Für einen reibungsarmen Prozess der Netzwerkarbeit ist<br />
es wichtig bestimmte Reglements <strong>und</strong> Verhaltensgr<strong>und</strong>sätze bereits im Vorfeld<br />
auf zu stellen.<br />
48
Art <strong>und</strong> Weise der Entscheidungsfindung vereinbaren<br />
Entscheidungsfindungen beruhen auf einem Diskussionsprozess der Beteilig-<br />
ten, sie werden kollektiv gefällt. Voraussetzung hierfür stellen ausreichende<br />
Entscheidungsbefugnisse der Akteure von ihrer Organisation aus dar. Des Wei-<br />
teren muss im Vornherein geklärt sein, wie die Reaktion des Verb<strong>und</strong>s auf Re-<br />
gelverstöße <strong>und</strong> das Nichteinhalten von Vereinbarungen (z.B. unangekündigtes<br />
Fernbleiben von Sitzungen, Leistungsversprechen, die nicht eingelöst werden,<br />
Missbrauch interner – im Netzwerk - veröffentlichter Informationen) aussieht.<br />
Für kontinuierlichen Informationsfluss sorgen<br />
Der Aufbau einer dauerhaften <strong>und</strong> tragfähigen Kommunikations- <strong>und</strong> Informati-<br />
onsstruktur, <strong>zur</strong> Gewährleistung von Transparenz (z.B. Protokolle, R<strong>und</strong>briefe,<br />
die regelmäßig versandt werden, Mailing-Listen) innerhalb <strong>und</strong> außerhalb des<br />
Netzwerks ist von besonderer Bedeutung.<br />
Außendarstellung realisieren<br />
Wie stellen wir uns als Netzwerk bzw. die Leistungen unseres Netzwerks nach<br />
außen dar? Wie sind wir von Außenstehenden ansprechbar? Wichtige zu klä-<br />
rende Punkte wären hier: Kontaktadresse, Telefonanschluss, Fax, Homepage,<br />
gezielte Öffentlichkeitsarbeit über Flyer, Broschüren, ein stets aktueller Inter-<br />
netauftritt, Pressekontakte, persönliche Auftritte <strong>und</strong> Kontaktbesuche.<br />
Kommunikation <strong>und</strong> Vertrauensbildung fördern<br />
Vertrauen ist konstituierende Gr<strong>und</strong>lage jeder Netzwerkkooperation. Erzeugt<br />
werden kann Vertrauen z.B. durch persönliche Kontakte der Beteiligten, durch<br />
erfolgreiche gemeinsame Aktionen bzw. das Erreichen von gemeinsam gesetz-<br />
ten Zielen.<br />
Mit der Heterogenität der Beteiligten umgehen<br />
In einem Netzwerk treffen Personen mit unterschiedlichen organisationskulturel-<br />
len Hintergründen <strong>und</strong> Erfahrungen sowie Erwartungshaltungen aufeinander.<br />
Die Sicherung eines produktiven Umgangs mit Verschiedenheiten (Umgang mit<br />
49
gegenseitigen Vorurteilen, Animositäten <strong>und</strong> Abwertungen), die Organisationen<br />
nicht selten gegeneinander entwickelt haben, ist sehr wichtig, gestaltet sich je-<br />
doch oftmals schwierig.<br />
Für die Balance von Kooperation <strong>und</strong> Konkurrenz sorgen<br />
Konkurrenz <strong>und</strong> Wettbewerb werden nur bedingt <strong>und</strong> ausschnitthaft in der<br />
Netzwerkarbeit <strong>zur</strong>ückgestellt bzw. ausgeschaltet, damit ein gemeinsames<br />
Handeln überhaupt möglich wird. Die an Netzwerken beteiligten Organisationen<br />
schränken ihre Autonomie <strong>und</strong> ihre Eigeninteressen nur bezogen auf die Netz-<br />
werkarbeit/-zwecke ein. Das heißt für die Netzwerkarbeit, die bestehenden<br />
Konkurrenzen nicht zu verleugnen <strong>und</strong> als Einflussfaktoren für die Arbeit im Au-<br />
ge zu behalten.<br />
Die Zusammenarbeit als „win-win-Modell“ gestalten<br />
Eine längerfristige Motivation <strong>zur</strong> Mitarbeit im Netzwerk lässt sich nur durch ge-<br />
genseitige Austauschbeziehungen erreichen. D.h. die beteiligten Organisatio-<br />
nen investieren ihre Ressourcen nur, wenn sich auch Gewinne für ihre Organi-<br />
sation festmachen lassen.<br />
Mit Fluktuation umgehen<br />
Die Integration neuer Mitglieder stellt sich als permanente Aufgabe in Netzwer-<br />
ken dar. Damit eine Vernetzung sich nachhaltig etablieren kann, ist allerdings<br />
eine möglichst kontinuierliche personelle Beteiligung wünschenswert.<br />
Konflikte erkennen <strong>und</strong> bearbeiten können<br />
Typische Konfliktpotentiale in Netzwerken sind z.B. Eigeninteressen der Orga-<br />
nisationen, die in Konkurrenz zu den Netzwerkzielen <strong>und</strong> –zwecken stehen,<br />
Konkurrenz <strong>und</strong> Wettbewerb außerhalb des Verb<strong>und</strong>s <strong>und</strong> Vorurteile <strong>und</strong> Be-<br />
rührungsängste zwischen den Organisationen. Eine gekonnte <strong>und</strong> erfolgreiche<br />
Konflikt- <strong>und</strong> Problemlösung ist deshalb ein wichtiger <strong>und</strong> unerlässlicher Be-<br />
standteil von Netzwerkarbeit.<br />
50
Im Ergänzungsband 4 „Kommunale Strategien“ der Veröffentlichungen über die<br />
internationale Konferenz „Ges<strong>und</strong>heitsförderung – Eine Investition für die Zu-<br />
kunft“ in Bonn vom 17.-19. Dezember 1990 stellt Hartmut Naumann von der<br />
AOK Main-Kinzig explizit heraus, dass sich die Schaffung eines Kooperativen<br />
Netzwerks „in der Praxis als diffizile <strong>und</strong> komplexe Aufgabe“ erweist, wenn-<br />
gleich es auf dem Papier so logisch <strong>und</strong> einfach erscheint (WHO 1992, S.37).<br />
51
3 Netzwerkbildung im südlichen Teil des Landkrei-<br />
ses Dahme-Spreewald<br />
Wie sich aus Untersuchungen des B<strong>und</strong>esministeriums für Bildung, Wissen-<br />
schaft, Forschung <strong>und</strong> Technologie (1997) ergeben hat, existieren durchaus<br />
einzelne Vernetzungen bzw. Kooperationsbezüge unter ges<strong>und</strong>heitsbezogener<br />
Fragestellung zwischen den Weiterbildungsträgern sowie formelle Mitglied-<br />
schaften unter allgemeinen Gesichtspunkten (d.h. nicht explizit ges<strong>und</strong>heitsbe-<br />
zogen) zwischen traditionellen Erwachsenenbildungsträgern, Wohlfahrtsver-<br />
bänden <strong>und</strong> der Gesetzlichen Krankenversicherung auf B<strong>und</strong>esebene.<br />
Eine derartige Kooperationsstruktur ist - herunter gebrochen auf die Region des<br />
südlichen Landkreises Dahme-Spreewald - nach Aussagen der an der, hier fo-<br />
kussierten, Vernetzung beteiligten Partner nicht vorhanden bzw. innerhalb der<br />
„Geschäftsstellenarbeit“ nicht greifbar.<br />
Die Zielstellung der vorliegenden Diplomarbeit ist, wie bereits in Kap. 1 darge-<br />
stellt, zweigeteilt. Zum einen besteht diese aus einer <strong>Bedarfsanalyse</strong> <strong>zur</strong> Inan-<br />
spruchnahme von Angeboten der <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> <strong>und</strong> den diesbezüglichen<br />
Interessen innerhalb der Bevölkerung des südlichen Landkreises Dahme-<br />
Spreewald <strong>und</strong> zum anderen in der Entwicklung eines funktionierenden Koope-<br />
rationsb<strong>und</strong>es zwischen den verantwortlichen <strong>und</strong> vermittelnden Institutionen<br />
<strong>und</strong> Akteuren. Inhalt dieses Kapitels ist die Dokumentation der Planung <strong>und</strong><br />
Initiierung des Vernetzungsprozesses.<br />
3.1 Zielgruppe<br />
Die Konzentration der Bemühungen im Netzwerk bezieht sich auf die gesamte<br />
Bevölkerung des südlichen Teils des Landkreises Dahme-Spreewald. Differen-<br />
zierungen innerhalb der Zielgruppe werden sich je nach Netzwerkaktivität erge-<br />
ben. Für das entstehende Netzwerk gab es von Seiten der Kooperationspartner<br />
bereits zu Beginn Überlegungen, das Netzwerk auf den gesamten Landkreis<br />
52
Dahme-Spreewald aus zu dehnen. Wie die Handhabung <strong>und</strong> die Ausdehnung<br />
der Tätigkeiten jedoch letztendlich aussehen werden, liegt im Ermessen der<br />
Verb<strong>und</strong>partner.<br />
3.2 Die Vorbereitung <strong>und</strong> Initiierung des Vernetzungsprozesses<br />
In einem Vorgespräch mit dem Verantwortlichen für <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> der<br />
Kreisvolkshochschule, Herrn T., einigten wir uns im Dezember 2004 über die<br />
Eckpunkte des geplanten Vernetzungsprojekts (vgl. Anhang: Gesprächsproto-<br />
koll vom 02.12.2004).<br />
Thema <strong>und</strong> zentrale Aufgabe ist die Koordinierung eines flächendeckenden,<br />
bedarfsorientierten, regionalen <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>sangebotes durch die Ver-<br />
netzung interessierter, an Ges<strong>und</strong>heitsförderung/-bildung beteiligter, Akteure<br />
<strong>und</strong> Institutionen sowie die Bereitstellung einer ersten Arbeitsgr<strong>und</strong>lage in Form<br />
einer <strong>Bedarfsanalyse</strong>. Der vorläufige Arbeitstitel des Netzwerks lautet: „Regio-<br />
nales Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsförderung“. Hierbei sollen Vertreter von Kranken-<br />
kassen, Wohlfahrtsverbänden, von Einrichtungen der Erwachsenenbildung, der<br />
Stadtverwaltung, des Landkreises, von stationären Einrichtungen u. a. einbezo-<br />
gen werden.<br />
3.2.1 Auswahl der Netzwerkpartner<br />
Ausgehend von den im Kap. 2.4 dargestellten Akteuren <strong>und</strong> Institutionen der<br />
Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> einigten wir uns gemeinsam mit<br />
dem Beauftragten für <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> der Kreisvolkshochschule <strong>und</strong> invol-<br />
vierten Mitarbeiterin des Reha-Zentrums Lübben zunächst über die Einladung<br />
potentieller Netzwerkpartner. Um Synergieeffekte <strong>und</strong> produktive Kooperations-<br />
effekte erzielen zu können, war es besonders wichtig Institutionen zu beteiligen,<br />
die sich ebenfalls mit Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong> -bildung beschäftigen, außer-<br />
dem Einrichtungen <strong>und</strong> Personen, die in der Ges<strong>und</strong>heitsberatung tätig sind<br />
(z.B. Ärzte <strong>und</strong> stationäre Einrichtungen) sowie Organisationen <strong>und</strong> übergeord-<br />
nete kommunale Instanzen (z.B. Weiterbildungseinrichtungen, Stadtverwaltun-<br />
gen), die einen wichtigen Einfluss auf die öffentliche Ges<strong>und</strong>heit haben <strong>und</strong><br />
53
somit für das Aufgreifen relevanter Ges<strong>und</strong>heitsfragen wichtige Anknüpfpunkte<br />
bieten können. Es sind Einrichtungen <strong>und</strong> Instanzen, die in Zukunft von einem<br />
gut koordinierten <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>sangebot profitieren könnten.<br />
Dabei erschien es uns sinnvoll innerhalb des Netzwerks eine Steuerungsgruppe<br />
von 5-7 Personen zu bilden. Auswahlkriterien hierfür waren die Institution, in der<br />
die Person beschäftigt ist, die Tätigkeit <strong>und</strong> Stellung innerhalb dieser Organisa-<br />
tion <strong>und</strong> auch deren vermutbares, aus Erfahrungen begründetes Engagement<br />
<strong>und</strong> Interesse sich ein zu bringen (vgl. Anhang: Gesprächsprotokoll vom 27.<br />
01.2005).<br />
3.2.2 Vorgehensweise<br />
Im nächsten Schritt verschickte die Autorin Einladungen für die potentiellen Ko-<br />
operationspartner zu einem ersten Treffen (vgl. Anhang: Anschreiben für poten-<br />
tielle Kooperationspartner). Dieses erste Zusammentreffen hatte die Funktion<br />
eines Kennenlern- <strong>und</strong> Orientierungstreffens (vgl. Anhang Protokoll der Einfüh-<br />
rungsveranstaltung, 08.03.2005). In einem einführenden Impulsreferat, gehalten<br />
durch die Verfasserin, wurde ausführlich über die Projektidee aufgeklärt <strong>und</strong> auf<br />
die Vorteile sowie Herausforderungen von Netzwerkarbeit hingewiesen. Dar-<br />
aufhin entstand eine offene Diskussionsr<strong>und</strong>e, hierbei erhoffte sich die Autorin<br />
bereits konkrete Vorschläge <strong>und</strong> Vereinbarungen bezüglich der Konstituierung<br />
eines Netzwerkes <strong>und</strong> erste Signale von Organisationen <strong>und</strong> Akteuren <strong>zur</strong> Be-<br />
teiligung an der Netzwerkarbeit. Innerhalb der Diskussionsr<strong>und</strong>e sollte, <strong>zur</strong> Er-<br />
hebung der individuellen Ziele <strong>und</strong> Erwartungen, durch die Interessenten insbe-<br />
sondere auf folgende Fragen eingegangen werden:<br />
Was ist Ihr Anlass für eine Kooperations- <strong>und</strong> Vernetzungsbeteiligung?<br />
Welchen Nutzen erwarten Sie für Ihre Organisation von der Kooperation?<br />
Welche personellen <strong>und</strong> finanziellen Ressourcen werden mit der geplanten<br />
Kooperation realistisch verb<strong>und</strong>en sein?<br />
Sind Sie in der Lage diese Ressourcen einzubringen? Sehen Sie sich auch<br />
langfristig als verlässlicher Kooperationspartner?<br />
54
Vertreter folgender Institutionen nahmen an der ersten Orientierungsveranstal-<br />
tung teil:<br />
Landesklinik Lübben<br />
Barmer EK<br />
DAK<br />
ASB Kreisverband Lübben<br />
AWO KV Dahme-Spreewald e.V.<br />
Kompetenzzentrum in dünn besiedelten ländlichen Gebiete in den Regionen<br />
Lübben <strong>und</strong> Luckau (in Trägerschaft der DRK)<br />
Beigeordneter für Bildung <strong>und</strong> Soziales LDS<br />
Stadt Lübben<br />
Ges<strong>und</strong>heitsamt LDS<br />
Evangelisches Krankenhaus Luckau<br />
Seniorenbeauftragter LDS<br />
Bei fast allen Teilnehmenden klangen innerhalb des ersten Treffens bereits Ko-<br />
operationsinteressen an. Vorbehalte wurden jedoch geäußert in der Frage der<br />
Koordinierung der Netzwerktätigkeit, weil die Verfasserin für diese Tätigkeit<br />
nicht längerfristig <strong>zur</strong> Verfügung stehen kann.<br />
Ein weiteres Problem zeigte sich in der Uneinigkeit der Anwesenden über die<br />
Begrifflichkeiten bzw. Definitionen von „<strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>“ <strong>und</strong> „Ges<strong>und</strong>heits-<br />
förderung“ (vgl.: Kap.1). Die gesetzlichen Krankenkassen fassen ihr Kursange-<br />
bot traditionell unter den Begriffen „Ges<strong>und</strong>heitsförderung“ <strong>und</strong> „Prävention“<br />
zusammen <strong>und</strong> halten damit ein einheitliches Verständnis über die Inhalte die-<br />
ser Leistungen in der Bevölkerung. Die Volkshochschule (<strong>und</strong> aus ges<strong>und</strong>-<br />
heitswissenschaftlicher Sicht – richtig) wiederum bezeichnet die Selben, von<br />
ihnen angebotenen Kurse als „<strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>“, hierunter wird im Laienver-<br />
ständnis allerdings die pure Vermittlung von Wissen durch Vorträge <strong>und</strong> Schu-<br />
lungen (ohne praktische Anwendung) verstanden. Um dieser Problematik<br />
55
Rechnung zu tragen <strong>und</strong> beiden Verständnislagen gerecht zu werden, ent-<br />
schieden wir uns beide Begriffe parallel zu verwenden.<br />
Am 12. Mai 2005 gründete sich der Steuerungskreis des „Regionalen Netz-<br />
werks Ges<strong>und</strong>heitsförderung“ (vgl. Anhang: Protokoll der Gründungsveranstal-<br />
tung, 12.05.2005), er setzt sich aus einem heterogenen Personenkreis ver-<br />
schiedener Institutionen <strong>und</strong> Einrichtungen zusammen. Dieser weit gefächerte<br />
Kompetenzpool mit vielfältigen Voraussetzungen <strong>und</strong> Ressourcen eröffnet gro-<br />
ße Potenziale <strong>zur</strong> Bewältigung komplexer Probleme <strong>und</strong> Aufgaben unter Be-<br />
rücksichtigung der jeweiligen Zielgruppen. Unter Nutzung der einrichtungsspezi-<br />
fisch tradierten Zugangswege zum Klientel kann auch innerhalb der Netzwerk-<br />
arbeit eine bürgernahe Atmosphäre geschaffen werden. Ferner war es Zielstel-<br />
lung der Vernetzung staatliche <strong>und</strong> private sowie Profit <strong>und</strong> Non Profit Organi-<br />
sationen einzubinden, um weitestgehend alle Interessenlagen <strong>und</strong> Bedürfnisse<br />
zu vereinigen.<br />
Aufgr<strong>und</strong> dieser Konstellation sind natürlich vielfältige Probleme <strong>und</strong> Konflikte<br />
zu erwarten. Doch auch dieser Aspekt der Arbeit in einem Netzwerk muss in<br />
der Planung der Vernetzung <strong>und</strong> innerhalb der Netzwerkarbeit berücksichtigt<br />
<strong>und</strong> - falls möglich – konstruktiv genutzt werden. Das Netzwerk hat die Aufgabe<br />
keine Konkurrenzsituationen zu schaffen, stattdessen aber gegenseitige Zuge-<br />
winnsituationen zu ermöglichen (z.B. Vermittlung von K<strong>und</strong>en/Nutzern unter-<br />
einander, Zusammenführung von Interessenten, Bereitstellung von Räumlich-<br />
keiten <strong>und</strong> qualifizierten Kursleitern).<br />
Der Steuerungskreis trifft sich in einem zweimonatigen Rhythmus. Das gesamte<br />
Netzwerk findet sich einmal pro Jahr zusammen, einzelne Partner sollen jedoch<br />
die Möglichkeit haben, sich bei Interesse in die laufenden Aktivitäten des Steue-<br />
rungskreises einzubringen bzw. werden bei Bedarf gezielt angesprochen (vgl.:<br />
Kap. 3.2.3).<br />
56
Das erste Treffen der Steuerungsgruppe fand am 07. Juli 2005 statt. Inhalte<br />
dieser Veranstaltung waren unter anderem ein Vortrag über Netzwerkmanage-<br />
ment durch einen eingeladenen Experten, die Auswertung der derzeitigen Mit-<br />
gliederzahl <strong>und</strong> –struktur. Dazu wurden durch die Autorin Beitrittserklärungen<br />
(vgl. Anhang: Beitrittserklärung) an die Teilnehmer der Orientierungsveranstal-<br />
tung vom 08. März 2005 verschickt, mit der Bitte sich bezüglich der Mitarbeit im<br />
Netzwerk zu positionieren. Die derzeitige Mitgliederstruktur umfasst folgende<br />
Institutionen <strong>und</strong> Einrichtungen:<br />
DAK<br />
DRK (Kompetenzzentrum in dünn besiedelten ländlichen Gebiete in den<br />
Regionen Lübben <strong>und</strong> Luckau)<br />
Diakonie (Hospiz-Koordination)<br />
Stadt Lübben<br />
Kreisvolkshochschule Dahme-Spreewald<br />
Reha-Zentrum Lübben<br />
Wirtschaftskanzlei<br />
Landesklinik Lübben<br />
AWO KV Dahme-Spreewald e.V.<br />
Evangelisches Krankenhaus Luckau<br />
Ein weiterer Tagesordnungspunkt der Veranstaltung waren die Planungen be-<br />
züglich der Netzwerkaktivitäten, z.B. die Durchführung eines gemeinsamen Ge-<br />
s<strong>und</strong>heitstages (vgl.: Kap. 3.2.3). Zudem wurde den Netzwerkmitgliedern die<br />
endgültige Auswertung der Befragungsergebnisse mit den daraus abgeleiteten<br />
Perspektiven <strong>und</strong> Empfehlungen zugänglich gemacht <strong>und</strong> vorgestellt (vgl. An-<br />
hang: Protokoll der ersten Netzwerkveranstaltung, 07.07.2005).<br />
3.2.3 Öffentlichkeitsarbeit<br />
Öffentlichkeitsarbeit ist innerhalb der Ges<strong>und</strong>heitsförderung von nahezu exis-<br />
tentieller Bedeutung. Besonders wichtig <strong>zur</strong> Erreichung der Massen ist es, ver-<br />
schiedene regionale Zeitungen zu involvieren (Massenkommunikation). Zum<br />
57
einen kann so für die externe Öffentlichkeitsarbeit eine kontinuierliche Bericht-<br />
erstattung gewährleistet werden <strong>und</strong> zum anderen sind die regionalen Wochen-<br />
zeitungen wichtiger Bestandteil der kommunalen Befragung der Bürger des<br />
südlichen Landkreises zum Thema <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>.<br />
Innerhalb der Netzwerkpartner ist das Bewusstsein über die Notwendigkeit <strong>und</strong><br />
Bedeutung der öffentlichen Präsenz des Netzwerks bereits vorhanden, vor al-<br />
lem in Anbetracht der zu erwartenden eigenen Werbeeffekte für ihr Herkunfts-<br />
unternehmen. Zur Erreichung der Bevölkerung, auf dem Wege der personalen<br />
Kommunikation, werden die einrichtungsspezifischen Zugangswege genutzt.<br />
Auch im Rahmen der Sponsorensuche <strong>und</strong> der Werbung um neue Netzwerk-<br />
partner sowie Multiplikatoren wird die Bedeutung eines professionellen <strong>und</strong> kon-<br />
tinuierlichen Öffentlichkeitsarbeitsprozesses deutlich.<br />
Realisiert werden kann dies, wie bereits erwähnt, durch eine kontinuierliche<br />
Einbeziehung der regionalen Zeitungen, aber auch des regionalen Fernsehens<br />
sowie Radiostationen. Auch im Rahmen der regionalen Befragung wird auf die<br />
Frage, wie die Menschen am besten erreichbar sind, eingegangen (vgl.:<br />
Kap.4.6).<br />
Im Mai 2005 wurde ein Fernsehbeitrag im regionalen Sender OSR (Oberspree-<br />
wald Regional) über das entstehende „Regionale Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsförde-<br />
rung“ sowie die Befragungsaktivitäten ausgestrahlt. Hier wurden Sequenzen<br />
aus der Gründungsveranstaltung der Steuerungsgruppe des Netzwerks sowie<br />
ein Interview eines Netzwerksmitglieds <strong>und</strong> eine kurze Einschätzung über die<br />
Ergebnisse der Befragung durch die Verfasserin gesendet.<br />
Als eine der ersten Netzwerkaktionen ist ein Ges<strong>und</strong>heitstag des „Regionalen<br />
Netzwerks Ges<strong>und</strong>heitsförderung“ geplant. An diesem Tag wird das Netzwerk<br />
zum ersten Mal sich selbst, sowie seine Aufgaben <strong>und</strong> Ziele in der Öffentlichkeit<br />
präsentieren. Dieser soll im September 2005 auf dem Gelände des Reha-<br />
58
Zentrums Lübben stattfinden. Hierbei sind alle Netzwerkpartner eingeladen,<br />
sich vorzustellen <strong>und</strong> für die Gäste ein abwechslungsreiches <strong>und</strong> interessantes<br />
Programm zum Thema Ges<strong>und</strong>heit anzubieten. Der Fokus liegt auf den The-<br />
menfeldern „Bewegung <strong>und</strong> Fitness“ sowie „ges<strong>und</strong>e Ernährung“. Wichtig ist in<br />
der konkreten Themengestaltung, dass sich die Gebiete von Ges<strong>und</strong>heitsbil-<br />
dung aus dem Fragebogen wieder finden lassen, um so bei der Bevölkerung<br />
einen Bezug zwischen der Fragebogenaktion <strong>und</strong> den Netzwerkaktivitäten her-<br />
stellen zu können.<br />
Die interne Öffentlichkeitsarbeit kann realisiert werden durch die kontinuierliche<br />
Information der (punktuell nicht involvierten) Netzwerkpartner mittels Informati-<br />
ons- <strong>und</strong> Einladungsschreiben. So findet z.B. ein Steuerungsgruppentreffen im<br />
zweimonatigen Rhythmus statt. Zu den Inhalten des Treffens werden die regu-<br />
lären Netzwerkpartner informiert <strong>und</strong> erhalten – insofern ein Interesse besteht –<br />
eine fakultative Einladung gemeinsam mit der geplanten Tagesordnung. Um<br />
über die Ergebnisse <strong>und</strong> Entschließungen der Steuerungsgruppentreffen infor-<br />
miert zu sein, erhält zudem jedes Netzwerkmitglied ein Protokoll der jeweiligen<br />
Veranstaltung.<br />
Zukünftig ist <strong>und</strong> bleibt die Öffentlichkeit für das Netzwerk von besonderer Be-<br />
deutung, deshalb ist es wichtig, sie kontinuierlich in den Prozess der Netzwerk-<br />
bildung <strong>und</strong> in die Aktivitäten einzubinden, durch Information aber auch Partizi-<br />
pation. Öffentlichkeitsarbeit dient nicht zuletzt auch <strong>zur</strong> „Vermarktung der Netz-<br />
werkprodukte“, denn nur so kann die Bevölkerung an <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> betei-<br />
ligt werden, indem sie informiert <strong>und</strong> <strong>zur</strong> Teilnahme überzeugt wird.<br />
Eine weitere Aufgabe, <strong>zur</strong> Sicherstellung der öffentlichen Präsenz des Netz-<br />
werks, ist die Erstellung einer Internet-Website; ebenso befinden sich Vortrags-<br />
reihen zu ges<strong>und</strong>heitsbezogenen Themenstellungen in Planung.<br />
59
3.2.4 Finanzierung<br />
Um ein Netzwerk arbeitsfähig zu erhalten, benötigt es eine abgesicherte finan-<br />
zielle Basis. Nicht nur Projekte, sondern auch die Nebenkosten, wie z.B. für<br />
Porto, Telefon, Räumlichkeiten <strong>und</strong> Fahrten müssen aufgebracht werden. Zu-<br />
dem müssen die beteiligten Organisationen Mitarbeiter freistellen sowie Mittel<br />
für die Öffentlichkeitsarbeit <strong>zur</strong> Verfügung haben.<br />
Durch die Vielfalt der Beteiligten sind auch vielfältige Wege <strong>zur</strong> Finanzierung<br />
denkbar. Netzwerke können über Eigenmittel verfügen (z.B. aus ehrenamtlicher<br />
Tätigkeit) oder durch staatliche Zuschüsse (z.B. über Projektanträge) finanziert<br />
werden. Aber auch Mitgliedsbeiträge oder Spenden können <strong>zur</strong> Finanzierung<br />
beitragen. Ein wichtiges Instrument ist das Sponsoring.<br />
Die Finanzierung der ersten Bemühungen <strong>zur</strong> Initiierung der Netzwerkbildung<br />
im südlichen Landkreis Dahme-Spreewald wurde im Rahmen eines Sponsoring<br />
durch das Reha-Zentrum Lübben gewährleistet.<br />
Voraussetzung für weitere Aktivitäten in Richtung Vernetzung ist eine zufrieden<br />
stellende Klärung der weiteren Finanzierung der Netzwerkbildung <strong>und</strong> der<br />
Netzwerkaktivitäten. Dies sollte Zielsetzung eines der ersten Netzwerktreffen<br />
sein. Anvisiert wird hierbei eine Förderung durch öffentliche Gelder in Form ei-<br />
ner Projektunterstützung durch den Landkreis oder den B<strong>und</strong>.<br />
60
4 Die Untersuchung – Material <strong>und</strong> Methoden<br />
Für die empirische Untersuchung wurde das Instrument der schriftlichen Befra-<br />
gung genutzt.<br />
Unter http://medialine.focus.de/PM1D/PM1DB/PM1DBF/pm1dbf.htm?snr=730<br />
(Zugriff: 22.06.2005) findet man folgende Ausführungen bzw. Definition zum<br />
Begriff der Befragung:<br />
„Sie ist unbestritten neben der Beobachtung <strong>und</strong> dem Experiment das wich-<br />
tigste Erhebungsinstrument der empirischen Sozialforschung ebenso wie in<br />
der Markt-, Media- <strong>und</strong> Werbeforschung. (...) Erwin K. Scheuch definiert die<br />
Befragung als "ein planmäßiges Vorgehen mit wissenschaftlicher Zielset-<br />
zung, bei dem die Versuchspersonen durch eine Reihe gezielter Fragen<br />
oder mitgeteilter Stimuli zu verbalen Informationen veranlasst werden sol-<br />
len". Nach Jürgen van Koolwijk ist der Kern der Idee von einer Methode der<br />
Befragung "die Vorstellung, dass die Antworten auf eine geregelte Abfolge<br />
von Fragen – eine Fragenbatterie – Aufschluss über eine Realität geben<br />
können, die sich von den psychischen Vorgängen des Fragens <strong>und</strong> Antwor-<br />
tens, von der sozialen Situation des Fragenden <strong>und</strong> Antwortenden <strong>und</strong> von<br />
dem sprachlichen Inhalt der Frage <strong>und</strong> Antwort ablösen <strong>und</strong> in allgemeinen<br />
Regeln fixieren lässt. Aus der Kombination der Fragen <strong>und</strong> der Konstellation<br />
der tatsächlich gegebenen Antworten sollen Aussagen über die Konstruktion<br />
der sozialen Wirklichkeit erschlossen werden."<br />
Unter: http://medialine.focus.de/PM1D/PM1DB/PM1DBF/pm1dbf.htm?snr=5230<br />
(Zugriff: 22.06.2005) findet man folgende Definition für die standardisierte Be-<br />
fragung:<br />
„Je nach dem Grad der Strukturierung des Ablaufs einer Befragung <strong>und</strong> der<br />
Festlegung der alternativen Antwortvorgaben wird zwischen unstrukturierten<br />
61
Befragungen wie z.B. Gruppendiskussionen, teilstrukturierten Interviews wie<br />
z.B. halbstrukturierten Interviews, Intensivinterviews oder zentrierten Inter-<br />
views <strong>und</strong> den vollkommen strukturierten standardisierten Befragungen un-<br />
terschieden.“<br />
Der Grad der Standardisierung oder Strukturierung bezeichnet also im Einzel-<br />
nen das Maß der Festlegung des Wortlauts <strong>und</strong> der Reihenfolge der Fragen<br />
sowie der Vorgabe zulässiger <strong>und</strong> möglicher Antworten bzw. Antwortvorgaben,<br />
für die sich die Befragten entscheiden können. Mitunter wird dabei zwischen<br />
„Standardisierung“ als der Festlegung des Wortlauts <strong>und</strong> der Reihenfolge der<br />
Fragen <strong>und</strong> „Strukturierung“ als der Vorgabe der Antwortalternativen unter-<br />
schieden. Die Standardisierung <strong>und</strong> Strukturierung von Fragebögen ebenso wie<br />
von Tests oder Beobachtungen ist die wesentliche Gr<strong>und</strong>voraussetzung für die<br />
Vergleichbarkeit <strong>und</strong> Repräsentativität der mit ihrer Hilfe erhobenen Ergebnis-<br />
se.“<br />
Bei der Entwicklung des, in dieser Untersuchung benutzten, Fragebogens wur-<br />
de vom Allgemeinen zum Konkreten vorgegangen. Für die Gewinnung unver-<br />
zerrter Daten war es neben der geschickten Formulierung der Fragen beson-<br />
ders wichtig, dass die Abfolge in einem logischen Zusammenhang steht <strong>und</strong> die<br />
Fragen aufeinander abgestimmt sind.<br />
Indem auf eine Hypothesenstellung verzichtet wird, erfolgt die Untersuchung<br />
nach dem Prinzip der Offenheit, d.h., dass eine theoretische Strukturierung des<br />
Forschungsgegenstandes (Teilnahme <strong>und</strong> Interesse an <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>s-<br />
<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderungsangeboten) <strong>zur</strong>ückgestellt wird, bis sich der For-<br />
schungsgegenstand durch die Forschungssubjekte (befragte Bürger) selbst<br />
herausbildet (Flick et al. 1995). Als „vage Vorstrukturierung“ könnten die Aus-<br />
sagen, der in diesem Bereich tätigen Personen herangezogen werden (vgl.:<br />
Kap. 4.1).<br />
62
Die Beschreibung des hier gewählten Systems - die volljährige Bevölkerung der<br />
Altkreise Lübben <strong>und</strong> Luckau - in ihrem Wahrnehmungsverhalten von Ges<strong>und</strong>-<br />
heitsbildungsangeboten, erfolgt an Hand von vorher fest gelegten Merkmals-<br />
<strong>und</strong> Eigenschaftsdimensionen, die im Fragebogen (vgl. Anhang: Fragebogen<br />
<strong>zur</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung in Ihrem Umfeld) formuliert<br />
sind. Hirsig (1998) sagt aus, dass es im Gegensatz zu naturwissenschaftlichen<br />
Systembeschreibungen in sozialwissenschaftlichen Systemen keine abschlie-<br />
ßende „objektiv richtige“ Beschreibung geben kann. Er untermauert jene Aus-<br />
sage durch folgende zwei Erklärungsansätze: 1. Die Wahl der Merkmals- <strong>und</strong><br />
Eigenschaftsdimensionen richten sich nach der subjektiven Einschätzung ihrer<br />
Relevanz durch den Forscher <strong>und</strong> 2. In sozialwissenschaftlichen <strong>und</strong> psycholo-<br />
gischen Untersuchungen gibt es Merkmals- <strong>und</strong> Eigenschaftsdimensionen, die<br />
nicht selbstevident <strong>und</strong> nicht direkt beobachtbar sind. Als Beispiel gibt Hirsig<br />
(1998) die Merkmale „Teamfähigkeit“ <strong>und</strong> „Führungseigenschaften“ an.<br />
Im Rahmen der Untersuchung innerhalb dieser Arbeit werden die Fragen, im<br />
Hinblick auf die Verwertbarkeit der Ergebnisse, inhaltlich begründet ausgewählt,<br />
mit dem Versuch die Merkmale so objektiv als möglich abzubilden.<br />
Die Fragebogenstruktur besteht aus sowohl dichotomen nominalskalierten<br />
(„Geschlecht“) als auch mehrfach nominalskalierten Merkmalsdimensionen<br />
(„ja“, „unentschlossen“, „nein“, „keine Angabe“). Die Aussagen sind erschöpfend<br />
dargestellt. Sie schließen einander aus <strong>und</strong> lassen deshalb eindeutige Interpre-<br />
tationen zu. Das Alter der Befragten wird an Hand einer Intervallskala, mittels<br />
gebildeter Klassen, erfragt. Dies ermöglicht im Interpretationsprozess Rück-<br />
schlüsse darauf, wie z.B. die Interessengebiete auf die verschiedenen Alters-<br />
klassen verteilt sind.<br />
Die Klassenbildung des Merkmals „Alter“ erfolgt ab „31“ in 10-Jahres Schritten.<br />
Bei den „jungen Erwachsenen“ werden, um spezifischere Aussagen zu erhal-<br />
ten, kleinere Klassen gebildet. Da in der Altersspanne der 18-24-jährigen eine<br />
andere Ges<strong>und</strong>heitsorientierung als in der Gruppe der 25-30-jährigen erwartet<br />
63
wird (grobe Vorstrukturierung der erwarteten Ergebnisse). Zudem wird hier eine<br />
unterschiedliche Herangehensweise bei der Erreichung der beiden Altersklas-<br />
sen vermutet.<br />
Für die Erarbeitung des Fragebogens gilt das erste Treffen der potentiellen<br />
Netzwerkpartner als Fertigstellungstermin. Es erscheint der Autorin in diesem<br />
Zusammenhang als wichtig, den interessierten Teilnehmern <strong>und</strong> Teilnehmerin-<br />
nen bereits in der frühen Konstituierungsphase Vorschläge <strong>und</strong> Ideen der weite-<br />
ren Arbeitsweise im Sinne der Netzwerkziele vorzuhalten. So kann eine Weiter-<br />
entwicklung der Projektidee forciert <strong>und</strong> angestoßen werden. Ferner erscheint<br />
es von besonderer Bedeutung bereits zu Beginn den Grad der Informations-<br />
übermittlung so hoch wie möglich anzusetzen. Um von Anfang an eine transpa-<br />
rente Arbeitsweise innerhalb der Netzwerkstrukturen zu realisieren, besteht die<br />
Notwendigkeit einer frühzeitigen In-Kenntnis-Setzung der potentiellen Partner<br />
über die Inhalte der Befragung. Dies erscheint umso wichtiger, betrachtet man<br />
die Tatsache, dass die entsendenden Organisationen als Multiplikatoren dienen<br />
<strong>und</strong> sich damit auch mit den Inhalten identifizieren können sollten. Zudem ist es<br />
von Bedeutung, innerhalb der Untersuchung Daten zu erfragen, die für die Ar-<br />
beit der beteiligten Informationen relevant sind sowie innerhalb der Vorberei-<br />
tung <strong>und</strong> Durchführung der Untersuchung das Know-How <strong>und</strong> die Beziehungen<br />
zu den K<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Nicht-K<strong>und</strong>en von <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>s- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heits-<br />
förderungsangeboten (hier: Zielgruppe der Befragung) zu nutzen.<br />
Innerhalb des ersten Treffens, das vor allem <strong>zur</strong> Information, Orientierung <strong>und</strong><br />
Kontaktaufnahme dienen soll, sollte bereits über die Möglichkeit der Mitglied-<br />
schaft im anvisierten Netzwerk nachgedacht <strong>und</strong> offen reflektiert werden. Zu-<br />
dem wäre es von Vorteil bereits zu diesem frühen Zeitpunkt den Umfang <strong>und</strong><br />
die Bedingungen der aktiven Mitarbeit zu kommunizieren. So wird ein Gr<strong>und</strong>-<br />
stein für eine vertrauensvolle <strong>und</strong> effektive Zusammenarbeit gelegt.<br />
Nach Zusammenfindung eines Netzwerkteams <strong>und</strong> der Gründung einer arbeits-<br />
fähigen Steuerungsgruppe können in einem Konsensprozess oder durch Mehr-<br />
64
heitsentscheidung die Formulierung der Zielstellungen des Netzwerks <strong>und</strong> die<br />
Vereinbarung verbindlicher Aufgaben <strong>und</strong> Rollen der einzelnen Netzwerkpart-<br />
ner stattfinden (vgl.: Kap. 2.6.4).<br />
4.1 Ausgangslage<br />
Die Infrastruktur für <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung ist, laut<br />
Auskunft des im Bereich „<strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>“ tätigen Mitarbeiters, Herr T., der<br />
Kreisvolkshochschule (KVHS) des Landkreises Dahme-Spreewald, im südli-<br />
chen Teil des Landkreises Dahme-Spreewald un<strong>zur</strong>eichend entwickelt. Zu die-<br />
ser Kernaussage kam Herr Tautz zu unserem ersten Kontakt am 02.Dezember<br />
2005 (vgl. Anhang: Gesprächsprotokoll vom 02.12.2005). Dies bestätigen ihm<br />
Anfragen von interessierten Bürgern bezüglich bestimmter Kursangebote (z.B.<br />
Aqua-Jogging). Die KVHS kann diese Kurse aufgr<strong>und</strong> fehlender räumlicher Be-<br />
dingungen in der Region nicht anbieten. Das Reha-Zentrum Lübben hingegen<br />
bietet das o.g. Kursbeispiel in Kooperation mit den Gesetzlichen Krankenkas-<br />
sen im Rahmen ihres erweiterten Präventionsauftrags §20 SGB V an. Dies ist<br />
nur ein Beispiel für den Bedarf an Koordination der verschiedenen Ressourcen<br />
im Sinne der Bürger der Region (vgl.: Kap. 2.5).<br />
Die Koordination der entsprechenden Leistungsbestandteile kann jedoch nur<br />
bedarfsgerecht erfolgen, wenn die Bedarfslage der Zielgruppenbevölkerung<br />
bekannt ist.<br />
In der Veröffentlichung des B<strong>und</strong>esministeriums für Bildung, Wissenschaft, For-<br />
schung <strong>und</strong> Technologie (1997) „Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> allgemeinen Weiterbildung“ ist<br />
formuliert, dass <strong>zur</strong> Zeit nur ein Teil der Bevölkerung von <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>s-<br />
angeboten erreicht wird <strong>und</strong> dass sich unter denen, die die Angebote nicht<br />
wahrnehmen bzw. nicht wahrnehmen können, sich besonders ges<strong>und</strong>heitlich<br />
belastete <strong>und</strong> gefährdete Personen befinden. Innerhalb der hier durchgeführten<br />
Befragung wurde der sozioökonomische Status, als Determinant von Ges<strong>und</strong>-<br />
heit, nicht ermittelt.<br />
65
Außerdem ist, aufgr<strong>und</strong> der lückenhaften Informationen zu Zielgruppen <strong>und</strong><br />
Struktur der Teilnehmerschaft im Bereich „<strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>“, nicht zu be-<br />
antworten, ob derzeit in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland ein Ges<strong>und</strong>heitsbil-<br />
dungsangebot vorgehalten wird, dass sich am Lebensweisenkonzept orientiert<br />
<strong>und</strong> für alle Bevölkerungsgruppen flächendeckend vorhanden ist bzw. ob es<br />
besonders unterversorgte Bevölkerungsgruppen gibt (B<strong>und</strong>esministerium für<br />
Bildung, Wissenschaft, Forschung <strong>und</strong> Technologie 1997).<br />
4.2 Zielstellung der Befragung<br />
Die Zielstellung der vorliegenden Diplomarbeit ist, wie bereits in Kap. 3 darge-<br />
stellt, die Weichenstellung <strong>zur</strong> Bildung einer, sich selbst tragenden, verwalten-<br />
den <strong>und</strong> weiterentwickelnden Vernetzung der im Bereich <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong><br />
<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung tätigen Akteure <strong>und</strong> Institutionen. Geplant sind die<br />
praktische Initiierung der Auftaktsituation, die theoretische <strong>und</strong> wissenschaftli-<br />
che Begleitung der Kontaktphase sowie die Durchführung der ersten Bedarfs-<br />
analyse durch eine regionale Bürgerbefragung.<br />
In diesem Zusammenhang sollen die Interessen an <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>sange-<br />
boten, die Bedarfslage, ggf. Hemmnisse der bisherigen Nichtteilnahme an<br />
Maßnahmen <strong>und</strong> Wünsche zu Themen der <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> erfragt werden<br />
(vgl. Anhang: Fragebogen <strong>zur</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung<br />
in Ihrem Umfeld). Die Fragestellung, auf die die Befragung Antwort geben soll,<br />
ist multidimensional <strong>und</strong> sehr differenziert. Dies lässt sich bereits aus der Quan-<br />
tität der Fragen ableiten.<br />
Durch den Einsatz des Fragebogens sollen folgende Fragestellungen bearbeitet<br />
werden:<br />
Wo liegen die Interessen an Kursen <strong>zur</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> im südlichen<br />
Teil des Landkreises?<br />
Wie verteilen sich die Interessen auf die verschiedenen Altersklassen <strong>und</strong><br />
das Geschlecht?<br />
Welche Interessen sind allgemein am stärksten vorhanden?<br />
66
Wie könnte die Informationsverbreitung bezüglich der Angebote <strong>und</strong> Maß-<br />
nahmen der <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> effektiver gestaltet werden? Wie können<br />
die verschiedenen Zielgruppen am wirkungsvollsten erreicht werden.<br />
Ist es möglich eine repräsentative Ergebnissituation durch die hier gewählte<br />
Art der Verbreitung <strong>und</strong> des Rücklaufs zu erhalten?<br />
4.3 Zielgruppe der Befragung<br />
Im Mittelpunkt der Befragung stehen alle Bürger ab dem 18. Lebensjahr aus<br />
allen Bevölkerungsschichten <strong>und</strong> –gruppen. Sie sind die Zielgruppe für Maß-<br />
nahmen der Erwachsenenbildung, zu denen auch <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> zählt.<br />
Kinder <strong>und</strong> Jugendliche werden im Rahmen des Schulunterrichts <strong>und</strong> der<br />
Schuluntersuchungen durch den ÖGD <strong>und</strong> durch andere zielgruppenspezifi-<br />
sche Maßnahmen erreicht. Ebenso verlangen diese Altersgruppen eine auf ihre<br />
Bedürfnisse ausgerichtete, spezifischere Herangehensweise, sowohl innerhalb<br />
der Befragung als auch im Angebot <strong>und</strong> der Durchführung verhaltensorientier-<br />
ter, ges<strong>und</strong>heitsbildender <strong>und</strong> ges<strong>und</strong>heitsfördernder Leistungen.<br />
Heranwachsende <strong>und</strong> erwachsene Menschen bilden die „K<strong>und</strong>schaft“ der anvi-<br />
sierten Kooperations- <strong>und</strong> Netzwerkpartner.<br />
4.4 Umfeld der Befragung<br />
Die Befragung findet im südlichen Teil des Landkreises Dahme-Spreewald statt.<br />
Der Bedarf an Koordination der <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>s- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförde-<br />
rungsleistungen wurde bereits im Kap. 4.1 <strong>zur</strong> Ausgangslage der Befragung<br />
erläutert. Zusätzlich orientiert sich die Auswahl des Befragungsfeldes an der<br />
regionalen Lage des Reha-Zentrums. Aufgr<strong>und</strong> der Bereitschaft <strong>zur</strong> Unterstüt-<br />
zung <strong>und</strong> Finanzierung der Befragungs- <strong>und</strong> ersten Vernetzungsaktivitäten, ist<br />
hier auf einen Nutzen für die Organisation zum einen durch den Aufbau einer<br />
funktionierenden Netzwerkstruktur zu achten, <strong>und</strong> zum anderen soll mittels der<br />
Auswertungsergebnisse der Klinik die Möglichkeit gegeben werden, ihr ge-<br />
s<strong>und</strong>heitsförderliches <strong>und</strong> präventives Leistungsspektrum auf die Ergebnisse<br />
der <strong>Bedarfsanalyse</strong> aus<strong>zur</strong>ichten <strong>und</strong> somit ihre Klientenzahl zu erweitern. Nicht<br />
67
zuletzt wird durch eine gezielte Erreichung der Öffentlichkeit mittels der regiona-<br />
len Bürgerbefragung ein immenser Werbeeffekt auf zukünftige „K<strong>und</strong>en“ (auch<br />
bezogen auf Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation) sowie durch die<br />
Erreichung der in der Behandlungskette vorgeschalteten Institutionen als „Pati-<br />
enten- <strong>und</strong> K<strong>und</strong>enzulieferer“ im Rahmen der Kooperation <strong>und</strong> ihrer Multiplika-<br />
torenfunktion bei der Fragebogenverteilung, erzielt.<br />
Im Befragungsumfeld lebten am 30.09.2004 im Altkreis Lübben 32.949 Men-<br />
schen <strong>und</strong> im Altkreis Luckau 19.978 Einwohner 4 . Das bedeutet, dass bei einer<br />
Gr<strong>und</strong>gesamtheit von 52.927 Einwohnern in den Altkreisen Lübben <strong>und</strong> Luckau<br />
die Befragung ein Stichprobenumfang von 529 Personen berücksichtigen muss,<br />
um repräsentativ zu sein.<br />
4.5 Durchführung der Befragung<br />
Innerhalb der Befragung werden beide Termini, Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong> Ge-<br />
s<strong>und</strong>heitsbildung verwendet. Gründe hierfür liegen vor allem in dem noch im-<br />
mer nicht einheitlichen Verständnis von <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>. Während des ers-<br />
ten Orientierungstreffens aller interessierter Kooperationspartner, kam dies u.a.<br />
<strong>zur</strong> Sprache: die gesetzlichen Krankenkassen bieten ihre Leistungen <strong>zur</strong> Ge-<br />
s<strong>und</strong>heitsbildung (mit verhaltensbezogenem Fokus) unter dem umfassenderen<br />
Begriff „Ges<strong>und</strong>heitsförderung“ an, was aus der ges<strong>und</strong>heitswissenschaftlichen<br />
Sichtweise zwar nicht falsch, aber auch nicht sehr präzise ist. Um jedoch für die<br />
Befragung im Sinne des Verständnisses, dass die Krankenkassen bei der Be-<br />
völkerung hervorgerufen haben, eindeutig mit den Begrifflichkeiten zu arbeiten,<br />
werden sie im Fragebogen nebeneinander stehend verwandt. Da unter den<br />
Bürgern, laut Auffassung der Krankenkassen, unter <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> die<br />
reine Vermittlung von theoretischen Inhalten, in Form von Ges<strong>und</strong>heitsvorträ-<br />
gen, verstanden wird. Um innerhalb der Befragung auf das unterschiedliche<br />
Verständnis <strong>und</strong> Wissen bezüglich der Termini „Ges<strong>und</strong>heitsförderung“ <strong>und</strong><br />
„<strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>“ zu reagieren, entschied sich die Autorin diese Begriffe im<br />
4 Diese Zahlen wurden der Autorin durch das Büro des Kreistags des Landkreises Dahme-<br />
Spreewald zugänglich gemacht.<br />
68
Fußnotentext (vgl. Anhang: Fragebogen <strong>zur</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>-<br />
heitsförderung in Ihrem Umfeld) zu erläutern:<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> setzt am Menschen an, er soll zu einem selbstbestimm-<br />
ten, mit- <strong>und</strong> eigenverantwortlichen Handeln für seine Ges<strong>und</strong>heit befähigt wer-<br />
den. Das bedeutet, dass er im Rahmen der Ges<strong>und</strong>heitskurse neben den theo-<br />
retischen Zusammenhängen ebenfalls die praktische Ausführung ges<strong>und</strong>heits-<br />
gerechter Verhaltens- <strong>und</strong> Lebensweisen erlernt.<br />
Ges<strong>und</strong>heitsförderung hingegen ist ein weiterer Begriff, er beinhaltet Ge-<br />
s<strong>und</strong>heitsbildung als verhaltensorientierte Strategie <strong>und</strong> zusätzlich auch die ge-<br />
s<strong>und</strong>heitsförderliche Gestaltung der Lebenswelt der Menschen mit seiner öko-<br />
logischen <strong>und</strong> sozialen Umwelt, also der Verhältnisse in denen der Mensch lebt.<br />
In diesem Sinne wird <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> also als Beitrag <strong>zur</strong> Ges<strong>und</strong>heitsför-<br />
derung verstanden.<br />
Eine andere Definition der beiden Begriffe, entnommen aus der Wikipedia En-<br />
zyklopädie ist im Kap. 2 zu finden.<br />
Bei der Formulierung der Fragen werden im Vorfeld die folgenden drei Punkte<br />
geklärt:<br />
Warum wird die Frage gestellt?<br />
Welche Art von Frage (<strong>und</strong> Antwortmöglichkeit) ist angemessen?<br />
Wie ist die Frage zu formulieren?<br />
Der Fragebogen unterteilt sich in offene, als auch geschlossene Fragestellun-<br />
gen mit zwei bis neun Antwortvorgaben. Geschlossene Fragen bieten sich an,<br />
je größer das Vorwissen über Meinungen, ihre Strukturierung <strong>und</strong> Informations-<br />
stand der Befragten ist. Offene Fragen hingegen werden verwendet, wenn die<br />
Informationen über die Einstellungen von Personen zu einem gegebenen Prob-<br />
lem gering sind, der Bezugsrahmen des Befragten erk<strong>und</strong>et werden soll <strong>und</strong><br />
69
differenzierte Einstellungen <strong>zur</strong> Formulierung von Hypothesen ermittelt werden<br />
sollen (Swart 2003).<br />
Die Antwortmöglichkeiten bei geschlossenen Fragen sollten eindeutig <strong>und</strong> voll-<br />
ständig sein, d.h. mögliche Antworten sich nicht überschneiden <strong>und</strong> alle mögli-<br />
chen Antworten umfassen. In einigen Fällen ist es sinnvoll, sich als Befragter in<br />
mehreren Antwortkategorien wieder finden zu können. Gr<strong>und</strong>sätzlich gilt je-<br />
doch, dass sich jeder Befragte ohne Schwierigkeiten bei geschlossenen Fragen<br />
einordnen kann (ebenda).<br />
Bezogen auf die Reliabilität 5 lassen sich aus wissenschaftlichen Untersuchun-<br />
gen folgende hier zutreffende Regeln ableiten:<br />
Je weiter ein Ereignis <strong>zur</strong>ückliegt, desto ungenauer werden die Antworten<br />
(„Haben Sie bereits an Kursen <strong>zur</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> <strong>und</strong> –förderung teil-<br />
genommen?“).<br />
Je mehr sich eine Person für ein Thema interessiert, desto gültiger sind die<br />
Aussagen („Interessieren Sie sich für <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> <strong>und</strong> –förderung?“<br />
– Frage nach den persönlichen Interessen).<br />
Je eingehender jemand seine Gründe durchdacht hat, desto weniger wird<br />
die vorgegebene Liste bei einer geschlossenen Frage ausreichen (z.B.<br />
Gründe der Nichtteilnahme). Hier ist die Kopplung mit einer offenen Ant-<br />
wortkategorie „sonstiges“ sinnvoll.<br />
Je weniger jemand seine Gründe durchdacht hat, desto eher wird die Liste<br />
als Erleichterung angesehen werden. Bei sehr niedrigem Informations-<br />
<strong>und</strong>/oder Reflexionsstand besteht allerdings die Gefahr wahlloser Ankreu-<br />
zungen (Frage nach den persönlichen Interessen) (Swart 2003).<br />
Die Erreichung der Altersgruppe der 18–30-Jährigen stellt eine besondere<br />
Schwierigkeit dar. Hier wird der Weg über die Gymnasien <strong>und</strong> Oberstufenzent-<br />
ren gewählt. Eine Genehmigung <strong>zur</strong> Durchführung einer wissenschaftlichen<br />
Untersuchung an Schulen vom B<strong>und</strong>esministerium für Bildung, Jugend <strong>und</strong><br />
5 Zuverlässigkeit einer Messung<br />
70
Sport des Landes Brandenburg liegt vor (vgl. Anhang: Genehmigung des Minis-<br />
teriums für Bildung, Jugend <strong>und</strong> Sport des Landes Brandenburg <strong>zur</strong> Durchfüh-<br />
rung einer wissenschaftlichen Untersuchung an Schulen).<br />
Die Fragebögen werden in Wartezimmern kooperativer Ärzte, in Warteberei-<br />
chen stationärer Einrichtungen ausgelegt <strong>und</strong> über die verschiedenen Koopera-<br />
tionsinteressenten, als Profitierende, unter ihrer Klientel verbreitet.<br />
Die Gruppe der Senioren wird über die Seniorenbeauftragten der Städte <strong>und</strong><br />
Kreise erreicht sowie durch die Mitarbeiterin des Kompetenzzentrums in dünn<br />
besiedelten ländlichen Gebieten in den Regionen Lübben <strong>und</strong> Luckau.<br />
Die Stadt Lübben unterstützt die Befragungsaktivitäten in großzügiger Form.<br />
Durch das Versenden von 500 Fragebögen, unter Beifügung eines frankierten<br />
Rückumschlages, an Adressen, die mittels eines Matching-Auswahlverfahren<br />
aus den Daten des Einwohnermeldeamtes der Stadt Lübben gezogen wurden.<br />
Eine weitere Möglichkeit die Menschen der Region mit der Fragebogenaktion<br />
zu erreichen, ist die Ansprache der MitarbeiterInnen des Reha-Zentrums. Diese<br />
werden in der Ausgabe April 2005 der Mitarbeiterzeitung gebeten, einige Fra-<br />
gebögen in ihrem Familien- <strong>und</strong> Bekanntenkreis zu verteilen <strong>und</strong> diese dann<br />
ausgefüllt wieder <strong>zur</strong>ück zu führen.<br />
Der Befragungszeitraum wird auf drei Wochen begrenzt.<br />
Zur Sicherstellung der Akzeptanz der Befragung <strong>zur</strong> Erreichung einer Mindest-<br />
beteiligung wird vor, während <strong>und</strong> nach dem Befragungszeitraum eine intensive<br />
Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Hierfür werden in der regionalen Presse Artikel<br />
zum Hintergr<strong>und</strong> <strong>und</strong> dem Zweck der Befragung veröffentlicht. Zudem werden<br />
die potentiellen Netzwerkpartner dazu angehalten, ihre Kontakte <strong>zur</strong> Bevölke-<br />
rung im Alltagsgeschäft zu nutzen. Förderlich für die Beteiligung sind außerdem<br />
die beigefügten Freiumschläge durch die Stadtverwaltung.<br />
71
4.6 Auswertung der Befragung<br />
Insgesamt kamen 346 Fragebögen <strong>zur</strong> Auswertung <strong>zur</strong>ück.<br />
Die Befragung bzw. die Ergebnisse der Befragung können nicht als aussage-<br />
kräftig <strong>und</strong> repräsentativ bezeichnet werden, da die Stichprobe der Befragten<br />
zum einen nicht die erforderliche Menge von 1% der Gr<strong>und</strong>gesamtheit (vgl.<br />
Kap. 4.4) erreicht hat (Bedingung <strong>zur</strong> Aussagekräftigkeit einer Stichprobe über<br />
die zu beurteilenden Merkmale in der Gr<strong>und</strong>gesamtheit) <strong>und</strong> zum anderen we-<br />
der von einer Zufallsstichprobe, noch von einer geschichteten Stichprobe ge-<br />
sprochen werden kann (Bedingung <strong>zur</strong> Repräsentativität einer Stichprobe).<br />
Nach Hirsig 1998 liegt die entscheidende Voraussetzung dafür, dass von einer<br />
Zufallsstichprobe gesprochen werden kann in der Forderung, dass „jedes Ele-<br />
ment der Gr<strong>und</strong>gesamtheit mit gleicher Wahrscheinlichkeit als Element der<br />
Stichprobe gewählt werden kann“ (ebenda, S. 1.13). Dieser Fall ist in der hier<br />
beschriebenen Untersuchung nicht gegeben. denn die Autorin ist innerhalb der<br />
Untersuchung darauf beschränkt, die sich bietenden Wege der Zielgruppener-<br />
reichung zu nutzen (vgl. Kap. 4.5.). Der zweite Weg eine repräsentative Stich-<br />
probe zu erhalten ist der der geschichteten oder stratifizierten Stichprobe. Nach<br />
Hirsig (1998) spricht man von einer solchen Stichprobe, wenn die prozentuale<br />
Verteilung der für den Befragungsinhalt relevanten Merkmale (im Teilnahme-<br />
verhalten von Angeboten der <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> sind Merkmale wie Ge-<br />
schlecht <strong>und</strong> Alter erwiesenermaßen äußerst relevant) in etwa die Verteilung<br />
dieser Merkmale in der untersuchten Population abbildet.<br />
In dieser Denkweise ist es wichtig, innerhalb der Befragung eine Art „Modell“<br />
der Gesamtbevölkerung des ausgewählten Systems zu erhalten. Im Rahmen<br />
der hier durchgeführten Untersuchung muss sich darauf beschränkt werden,<br />
eine Tendenz der Interessengebiete bzw. des Wahrnehmungsverhaltens be-<br />
züglich Angeboten der <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> je Geschlechtszugehörigkeit <strong>und</strong><br />
Altersgruppe markieren zu können. Die Darstellung des Zusammenhangs zwi-<br />
72
schen dem Interesse an <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>, dem Geschlecht <strong>und</strong> dem Alter<br />
eines Menschen wird an Hand einer multivariaten Verteilung 6 deutlich gemacht.<br />
4.6.1 Die Beteiligung<br />
Tab. 1: Die Beteiligung an der Befragung, aufgeschlüsselt nach Geschlecht <strong>und</strong> Altersklasse<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
18-24 Jahre<br />
25-30 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
Altersklasse * Geschlecht Kreuztabelle<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
73<br />
Geschlecht<br />
weiblich männlich Gesamt<br />
65 48 113<br />
57,5% 42,5% 100,0%<br />
7 1 8<br />
87,5% 12,5% 100,0%<br />
36 12 48<br />
75,0% 25,0% 100,0%<br />
38 13 51<br />
74,5% 25,5% 100,0%<br />
17 13 30<br />
56,7% 43,3% 100,0%<br />
73 23 96<br />
76,0% 24,0% 100,0%<br />
236 110 346<br />
68,2% 31,8% 100,0%<br />
An der Befragung beteiligten sich insgesamt 346 Personen ab dem 18 Lebens-<br />
jahr aus den Altkreisen Lübben <strong>und</strong> Luckau.<br />
Die Mehrzahl, <strong>und</strong> zwar 32,7%, der Befragungsteilnehmer sind aus der Alters-<br />
gruppe der 18-24-Jährigen. Dies liegt darin begründet, dass dieser Personen-<br />
kreis über die Gymnasien Lübben <strong>und</strong> Luckau <strong>und</strong> über das Oberstufenzentrum<br />
Lübben angesprochen wurde. Zu 27,7% konnten die über 61-jährigen Bewoh-<br />
ner der Altkreise Lübben <strong>und</strong> Luckau erreicht werden. Hier liegt vermutlich ein<br />
ohnehin größeres Interesse am Thema Ges<strong>und</strong>heit vor. Des weiteren erhöhte<br />
sich die Beteiligung dieser Zielgruppe durch die Unterstützung der Seniorenbe-<br />
6 Die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung mehrerer Zufallsvariablen nennt man multivariate<br />
Verteilung oder auch mehrdimensionale Verteilung (aus Wikipedia, die freie Enzyklopädie).
auftragten der Altkreise <strong>und</strong> der Mitarbeiterin des Kompetenzzentrums in dünn<br />
besiedelten ländlichen Gebieten in den Altkreisen Lübben <strong>und</strong> Luckau. Zu ihrer<br />
Arbeit gehört es, persönlichen Kontakt zu Seniorenklubs der Region zu halten.<br />
Mit 14,7% <strong>und</strong> 13,9% folgen die Beteiligung der 41-50-Jährigen <strong>und</strong> die der 31-<br />
49-Jährigen. Die Gruppe der 51-60-Jährigen nahm zu 8,7% teil <strong>und</strong> die 25-30-<br />
Jährigen nehmen in der Befragung nur einen Anteil von 2,3% ein. Dies ist je-<br />
doch nicht über zu bewerten, da hier auch die Altersspanne niedriger gewählt<br />
wurde. Eine derartige Differenzierung wird für notwendig erachtet, weil die Inte-<br />
ressenschwerpunkte <strong>und</strong> die Beteiligungsrate an Kursen <strong>zur</strong> Ges<strong>und</strong>heitsbil-<br />
dung zwischen den angrenzenden Altersgruppen vermutlich stark auseinander<br />
gehen. Dennoch lässt sich allgemein für Personen zwischen 18 <strong>und</strong> 30 Jahren<br />
vermuten, dass in deren Leben der Aspekt „Ges<strong>und</strong>heit“ eine eher untergeord-<br />
nete Rolle spielt <strong>und</strong> in dieser Zeit eher Faktoren wie Identifikation, Persönlich-<br />
keitsfindung, Partner- <strong>und</strong> Berufswahl im Vordergr<strong>und</strong> stehen. In der vorliegen-<br />
den Untersuchung ist die Beteiligung der jüngsten Altersstufe jedoch besonders<br />
hoch, da, wie bereits erwähnt, dieser Personenkreis über den Schulunterricht<br />
angesprochen wurde.<br />
Es beteiligten sich keine Männer aus der Altersgruppe der 25-30-Jährigen.<br />
Wie ebenfalls zu erwarten war, ist die Beteiligung der weiblichen Bevölkerung in<br />
jeder Altersgruppe höher als die der Männer.<br />
74
Tab. 2: Beteiligung der Lübbener, aufgeschlüsselt nach Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
18-24 Jahre<br />
25-30 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
Altersklasse * Geschlecht Kreuztabelle<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
75<br />
Geschlecht<br />
weiblich männlich Gesamt<br />
49 30 79<br />
62,0% 38,0% 100,0%<br />
2 2<br />
100,0% 100,0%<br />
30 12 42<br />
71,4% 28,6% 100,0%<br />
25 10 35<br />
71,4% 28,6% 100,0%<br />
15 11 26<br />
57,7% 42,3% 100,0%<br />
27 16 43<br />
62,8% 37,2% 100,0%<br />
148 79 227<br />
65,2% 34,8% 100,0%<br />
Ein ähnliches Bild der Beteiligung ergibt sich, wenn man die Altersverteilung nur<br />
der Lübbener Bürger betrachtet. Auch hier nahmen in der Mehrzahl die 18-24-<br />
Jährigen, gefolgt von den über 61 <strong>und</strong> 31-40-Jährigen, teil. Der geringste Anteil<br />
entfällt auf die 25-30-Jährigen: es beteiligten sich lediglich 2 Frauen dieser Al-<br />
tersstufe <strong>und</strong> kein Mann. Um Fehlinterpretationen zu vermeiden, wird beim He-<br />
ranziehen der prozentualen Berechnungen im Folgenden stets darauf hinge-<br />
wiesen.
Tab. 3: Beteiligung der Luckauer, aufgeschlüsselt nach Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
18-24 Jahre<br />
25-30 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
Altersklasse * Geschlecht Kreuztabelle<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
76<br />
Geschlecht<br />
weiblich männlich Gesamt<br />
16 18 34<br />
47,1% 52,9% 100,0%<br />
5 1 6<br />
83,3% 16,7% 100,0%<br />
6 6<br />
100,0% 100,0%<br />
13 3 16<br />
81,3% 18,8% 100,0%<br />
2 2 4<br />
50,0% 50,0% 100,0%<br />
46 7 53<br />
86,8% 13,2% 100,0%<br />
88 31 119<br />
73,9% 26,1% 100,0%<br />
Unter den Luckauer Bürgern nahmen die über 61-Jährigen mit 44, 5%, also fast<br />
der Hälfte, am häufigsten an der Befragung teil. Gefolgt werden sie von den 18-<br />
24-Jährigen, mit 28,6%, <strong>und</strong> mit 13,4% von den 41-50-Jährigen. Die geringste<br />
Beteiligung (3,4%) geht von der Gruppe der 51-60-jährigen Menschen im Alt-<br />
kreis Luckau aus. Getrennt nach Geschlechtern betrachtet, zeigt sich hier das<br />
Problem der geringen Beteiligung noch stärker als bei den Lübbener Bürgern:<br />
von den 25-30-jährigen Männern beteiligte sich lediglich ein Mann sowie gar<br />
kein Mann aus der Altersklasse der 31-40-Jährigen, drei Männer mit 41-50 Jah-<br />
ren <strong>und</strong> zwei Männer aus der Gruppe der 51-60-Jährigen. Hier werden Aussa-<br />
gen <strong>zur</strong> Inanspruchnahme bzw. Interessenlage zu Angeboten der Ges<strong>und</strong>heits-<br />
bildung schwer auf die gesamte Menge der Männer der jeweiligen Altersstufe<br />
übertragbar. Bei den Frauen ist die Altergruppe der 51-60-Jährigen ebenfalls<br />
schwer interpretierbar, da sich hier nur zwei Frauen beteiligt haben. Eine Re-<br />
präsentativität der Ergebnisse kann für diese Fälle nicht gewährleistet werden.<br />
Der Vollständigkeit halber werden die Ergebnisse, mit Hinweis auf die relativen<br />
Zahlen, dennoch in der Auswertung mit herangezogen.
Insgesamt beantworteten 227 Lübbener <strong>und</strong> 119 Luckauer Bürger einen Frage-<br />
bogen.<br />
4.6.2 Die Interessenschwerpunkte der Menschen im Altkreis Lübben<br />
Tab. 4: Interesse an Angeboten zu Bewegung <strong>und</strong> Fitness (Altkreis Lübben), aufgeschlüsselt<br />
Geschlecht<br />
weiblich<br />
männlich<br />
nach Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Altersklasse * Bewegung, Fitness * Geschlecht Kreuztabelle<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
18-24 Jahre<br />
25-30 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
18-24 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
77<br />
Bewegung, Fitness<br />
ja keine Angabe Gesamt<br />
45 4 49<br />
91,8% 8,2% 100,0%<br />
2 2<br />
100,0% 100,0%<br />
24 6 30<br />
80,0% 20,0% 100,0%<br />
21 4 25<br />
84,0% 16,0% 100,0%<br />
7 8 15<br />
46,7% 53,3% 100,0%<br />
14 13 27<br />
51,9% 48,1% 100,0%<br />
113 35 148<br />
76,4% 23,6% 100,0%<br />
10 20 30<br />
33,3% 66,7% 100,0%<br />
8 4 12<br />
66,7% 33,3% 100,0%<br />
2 8 10<br />
20,0% 80,0% 100,0%<br />
3 8 11<br />
27,3% 72,7% 100,0%<br />
7 9 16<br />
43,8% 56,3% 100,0%<br />
30 49 79<br />
38,0% 62,0% 100,0%<br />
Der Themenschwerpunkt Bewegung <strong>und</strong> Fitness ist bei den Frauen von sehr<br />
großem Interesse. Besonders bei den 18-24-Jährigen, hier gaben 91,8% an,<br />
sich für Bewegung <strong>und</strong> Fitness zu interessieren. In der nächsthöheren Alters-<br />
klasse, der 25-30-Jährigen, sind 100% an der Thematik interessiert, einschrän-<br />
kend ist jedoch zu erwähnen, dass sich hier nur 2 Frauen beteiligt haben. Unter
den 31-40- sowie den 41-50-jährigen Frauen liegt das Interesse bei 80 bzw.<br />
84%. Bei den älteren Frauen bek<strong>und</strong>et immerhin noch etwa die Hälfte ein Inte-<br />
resse.<br />
Bei den Männern ist die Verteilung in der jüngsten befragten Altersklasse um-<br />
gedreht. Hier gibt ca. ein Drittel ein Interesse auf diesem Gebiet an. Dies könnte<br />
daran liegen, dass Männer dieser Altersklasse ohnehin in einem Verein oder<br />
privat sportlich aktiv sind, dies aber nicht als „<strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>“ betrachten.<br />
Hier könnte eine weitergehende Befragung Aufschluss bringen.<br />
Bei den 31-40-jährigen Männern dreht sich das Verhältnis wieder um. Hier inte-<br />
ressieren sich zwei Drittel für Bewegung <strong>und</strong> Fitness. Während die Verteilung in<br />
den Altersgruppen der 41-50- <strong>und</strong> 51-60-Jährigen genau umgedreht ist <strong>und</strong> sich<br />
auf 20 bzw. 27,3% beläuft, liegt bei den über 61 Jahre alten Männern eine hälf-<br />
tige Verteilung für ein Interesse an Angeboten zu Bewegung <strong>und</strong> Fitness vor.<br />
Insgesamt interessieren sich mit 76,4% mehr Frauen als Männer (38,0%) für<br />
Bewegung <strong>und</strong> Fitness.<br />
78
Tab. 5: Interesse an Angeboten zu Entspannung <strong>und</strong> Körpererfahrung (Altkreis Lübben), aufge-<br />
Geschlecht<br />
weiblich<br />
männlich<br />
schlüsselt nach Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Altersklasse * Entspannung, Körpererfahrung * Geschlecht Kreuztabelle<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
18-24 Jahre<br />
25-30 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
18-24 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
79<br />
Entspannung,<br />
Körpererfahrung<br />
ja keine Angabe Gesamt<br />
27 22 49<br />
55,1% 44,9% 100,0%<br />
2 2<br />
100,0% 100,0%<br />
20 10 30<br />
66,7% 33,3% 100,0%<br />
17 8 25<br />
68,0% 32,0% 100,0%<br />
10 5 15<br />
66,7% 33,3% 100,0%<br />
16 11 27<br />
59,3% 40,7% 100,0%<br />
92 56 148<br />
62,2% 37,8% 100,0%<br />
12 18 30<br />
40,0% 60,0% 100,0%<br />
5 7 12<br />
41,7% 58,3% 100,0%<br />
4 6 10<br />
40,0% 60,0% 100,0%<br />
2 9 11<br />
18,2% 81,8% 100,0%<br />
5 11 16<br />
31,3% 68,8% 100,0%<br />
28 51 79<br />
35,4% 64,6% 100,0%<br />
Zu diesem Bereich zählen z.B. Kurse <strong>zur</strong> Stressbewältigung, Yoga, Autogenes<br />
Training, Progressive Muskelentspannung u.a.m.<br />
Das Interesse an Kursen <strong>zur</strong> Entspannung <strong>und</strong> Körpererfahrung ist bei den<br />
Frauen in allen Altersstufen nahezu gleichmäßig, zwischen 55% <strong>und</strong> 68%, ver-<br />
teilt. In der Gruppe der 25-30-Jährigen liegt der Wert bei 100%, hier gilt wie<br />
oben: n=2.
Bei den Männern ist das Interesse eher geringer ausgeprägt: bei den drei unte-<br />
ren Altersklassen liegt es bei ca. 40%, bei den 51-60 Jahre alten Männern so-<br />
gar nur bei 18,2% <strong>und</strong> bei den über 61-Jährigen bei 31,3%.<br />
Insgesamt ist das Verhältnis bezüglich des Interesses an Entspannung <strong>und</strong><br />
Körpererfahrung zwischen Frauen <strong>und</strong> Männern 61,2% zu 35,4%.<br />
Tab. 6: Interesse an Angeboten zu Ernährung <strong>und</strong> Kochen (Altkreis Lübben), aufgeschlüsselt<br />
Geschlecht<br />
weiblich<br />
männlich<br />
nach Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Altersklasse * Ernährung, Kochen * Geschlecht Kreuztabelle<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
18-24 Jahre<br />
25-30 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
18-24 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
80<br />
Ernährung, Kochen<br />
ja keine Angabe Gesamt<br />
32 17 49<br />
65,3% 34,7% 100,0%<br />
1 1 2<br />
50,0% 50,0% 100,0%<br />
15 15 30<br />
50,0% 50,0% 100,0%<br />
13 12 25<br />
52,0% 48,0% 100,0%<br />
8 7 15<br />
53,3% 46,7% 100,0%<br />
14 13 27<br />
51,9% 48,1% 100,0%<br />
83 65 148<br />
56,1% 43,9% 100,0%<br />
14 16 30<br />
46,7% 53,3% 100,0%<br />
7 5 12<br />
58,3% 41,7% 100,0%<br />
4 6 10<br />
40,0% 60,0% 100,0%<br />
5 6 11<br />
45,5% 54,5% 100,0%<br />
7 9 16<br />
43,8% 56,3% 100,0%<br />
37 42 79<br />
46,8% 53,2% 100,0%<br />
Im Bereich Ernährung <strong>und</strong> Kochen ist bei den Frauen, außer bei den 18-24-<br />
Jährigen (65,3%), eine ca. 50%-ige Verteilung des vorhandenen Interesses er-<br />
sichtlich.
Unter den männlichen Lübbener Bürgern ist das Interesse nur wenig geringer,<br />
hier wurden Werte zwischen 40 <strong>und</strong> 46% erreicht. In der Altersklasse der 31-<br />
40-Jährigen bek<strong>und</strong>eten 58,3% ihr Interesse.<br />
Tab. 7: Interesse an Angeboten zu Erkrankungen <strong>und</strong> Heilmethoden (Altkreis Lübben), aufge-<br />
Geschlecht<br />
weiblich<br />
männlich<br />
schlüsselt nach Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Altersklasse * Erkrankungen, Heilmethoden * Geschlecht Kreuztabelle<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
18-24 Jahre<br />
25-30 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
18-24 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
81<br />
Erkrankungen,<br />
Heilmethoden<br />
ja keine Angabe Gesamt<br />
12 37 49<br />
24,5% 75,5% 100,0%<br />
2 2<br />
100,0% 100,0%<br />
18 12 30<br />
60,0% 40,0% 100,0%<br />
9 16 25<br />
36,0% 64,0% 100,0%<br />
9 6 15<br />
60,0% 40,0% 100,0%<br />
17 10 27<br />
63,0% 37,0% 100,0%<br />
67 81 148<br />
45,3% 54,7% 100,0%<br />
10 20 30<br />
33,3% 66,7% 100,0%<br />
3 9 12<br />
25,0% 75,0% 100,0%<br />
2 8 10<br />
20,0% 80,0% 100,0%<br />
4 7 11<br />
36,4% 63,6% 100,0%<br />
6 10 16<br />
37,5% 62,5% 100,0%<br />
25 54 79<br />
31,6% 68,4% 100,0%<br />
Auf Gr<strong>und</strong> der steigenden Relevanz der Thematik Erkrankungen in höheren<br />
Lebensphasen, ist der Wert aus der Befragung mit höherer Altergruppe tenden-<br />
ziell ansteigend. Besonders sichtbar wird das, vergleicht man die Altersgruppen<br />
der 18-24-jährigen (24,5%) <strong>und</strong> der 51-60- (60,0%) sowie über 60-jährigen
Frauen (63,0%). Die Frauen im Alter zwischen 41-50 Jahren interessieren sich<br />
jedoch nur zu 36,0% für Erkrankungen <strong>und</strong> Heilmethoden.<br />
Bei den Männern zeigt sich ein fast konstanter Wert um die 20-37%.<br />
Tab. 8: Interesse an Angeboten zu Psychische Stabilität <strong>und</strong> soziale Kompetenz (Altkreis Lüb-<br />
Geschlecht<br />
weiblich<br />
männlich<br />
ben), aufgeschlüsselt nach Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Altersklasse * Psychische Stabilität <strong>und</strong> soziale Kompetenz * Geschlecht Kreuztabelle<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
18-24 Jahre<br />
25-30 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
18-24 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
82<br />
Psychische Stabilität<br />
<strong>und</strong> soziale Kompetenz<br />
ja keine Angabe Gesamt<br />
15 34 49<br />
30,6% 69,4% 100,0%<br />
1 1 2<br />
50,0% 50,0% 100,0%<br />
4 26 30<br />
13,3% 86,7% 100,0%<br />
7 18 25<br />
28,0% 72,0% 100,0%<br />
2 13 15<br />
13,3% 86,7% 100,0%<br />
5 22 27<br />
18,5% 81,5% 100,0%<br />
34 114 148<br />
23,0% 77,0% 100,0%<br />
6 24 30<br />
20,0% 80,0% 100,0%<br />
3 9 12<br />
25,0% 75,0% 100,0%<br />
1 9 10<br />
10,0% 90,0% 100,0%<br />
3 8 11<br />
27,3% 72,7% 100,0%<br />
2 14 16<br />
12,5% 87,5% 100,0%<br />
15 64 79<br />
19,0% 81,0% 100,0%<br />
Zu dieser Thematik herrscht bei beiden Geschlechtern <strong>und</strong> allen Altersklassen<br />
ein eher geringeres Interesse vor (Frauen insgesamt=23,0%; Männer insge-<br />
samt=19,0%). Lediglich bei den 18-24-jährigen Frauen ist das Interesse bei<br />
30,6% der Befragten <strong>und</strong> bei den 25-30-Jährigen (n=2) zu 50% vorhanden. Un-<br />
ter den 41-50-jährigen Frauen wurde von 28,0%, also auch fast einem Drittel,
angegeben, sie würden sich für psychische Stabilität <strong>und</strong> soziale Kompetenz<br />
interessieren.<br />
Bei den Männern gaben die Altersgruppen der 31-40-Jährigen (25,0%) <strong>und</strong> der<br />
51-60-Jährigen (27,3%) höhere Werte an, als die der anderen Altersgruppen<br />
(zwischen 10 <strong>und</strong> 23%). 9 von 10 der 41-50-jährigen Männer würden nicht an<br />
Kursen <strong>zur</strong> psychischen Stabilität <strong>und</strong> sozialen Kompetenz teilnehmen.<br />
Tab. 9: Interesse an Angeboten zu Ges<strong>und</strong>heitspolitik <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitswesen (Altkreis Lüb-<br />
Geschlecht<br />
weiblich<br />
männlich<br />
ben), aufgeschlüsselt nach Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Altersklasse * Ges<strong>und</strong>heitspolitik <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitswesen * Geschlecht Kreuztabelle<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
18-24 Jahre<br />
25-30 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
18-24 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
83<br />
Ges<strong>und</strong>heitspolitik <strong>und</strong><br />
Ges<strong>und</strong>heitswesen<br />
ja keine Angabe Gesamt<br />
9 40 49<br />
18,4% 81,6% 100,0%<br />
2 2<br />
100,0% 100,0%<br />
8 22 30<br />
26,7% 73,3% 100,0%<br />
10 15 25<br />
40,0% 60,0% 100,0%<br />
4 11 15<br />
26,7% 73,3% 100,0%<br />
16 11 27<br />
59,3% 40,7% 100,0%<br />
49 99 148<br />
33,1% 66,9% 100,0%<br />
6 24 30<br />
20,0% 80,0% 100,0%<br />
4 8 12<br />
33,3% 66,7% 100,0%<br />
4 6 10<br />
40,0% 60,0% 100,0%<br />
3 8 11<br />
27,3% 72,7% 100,0%<br />
8 8 16<br />
50,0% 50,0% 100,0%<br />
25 54 79<br />
31,6% 68,4% 100,0%<br />
Auffällig ist hier, dass bei den höchsten Altersklasse, also den über 61-Jährigen<br />
<strong>und</strong> bei beiden Geschlechtern das Interesse für Ges<strong>und</strong>heitspolitik <strong>und</strong> Ge-
s<strong>und</strong>heitswesen am stärksten vertreten ist. Die Frauen erreichen hier fast 60%<br />
<strong>und</strong> die Männer 50%.<br />
Die niedrigsten Werte erreichen die 18-24-jährigen Frauen (18,4%) <strong>und</strong> Männer<br />
(20,0%).<br />
Tab. 10: Interesse an Angeboten zu Gesellschaft <strong>und</strong> Umwelt (Altkreis Lübben), aufgeschlüs-<br />
Geschlecht<br />
weiblich<br />
männlich<br />
selt nach Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Altersklasse * Gesellschaft <strong>und</strong> Umwelt * Geschlecht Kreuztabelle<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
18-24 Jahre<br />
25-30 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
18-24 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
84<br />
Gesellschaft <strong>und</strong><br />
Umwelt<br />
ja keine Angabe Gesamt<br />
10 39 49<br />
20,4% 79,6% 100,0%<br />
2 2<br />
100,0% 100,0%<br />
9 21 30<br />
30,0% 70,0% 100,0%<br />
8 17 25<br />
32,0% 68,0% 100,0%<br />
2 13 15<br />
13,3% 86,7% 100,0%<br />
6 21 27<br />
22,2% 77,8% 100,0%<br />
35 113 148<br />
23,6% 76,4% 100,0%<br />
7 23 30<br />
23,3% 76,7% 100,0%<br />
2 10 12<br />
16,7% 83,3% 100,0%<br />
5 5 10<br />
50,0% 50,0% 100,0%<br />
3 8 11<br />
27,3% 72,7% 100,0%<br />
5 11 16<br />
31,3% 68,8% 100,0%<br />
22 57 79<br />
27,8% 72,2% 100,0%<br />
Für Kurse zum Thema Gesellschaft <strong>und</strong> Umwelt interessieren sich insgesamt<br />
ca. ein Viertel aus beiden Geschlechtern.
Ein besonders niedriger Wert <strong>und</strong> folglich ein geringes Interesse wurde von den<br />
51-60-jährigen Frauen (13,3%) <strong>und</strong> von den 31-40-jährigen Männern angege-<br />
ben. Von den 41-50-jährigen Männern wünschen 50% der Befragten Kurse zu<br />
diesem Thema.<br />
Tab. 11: Interesse an Angeboten zu Sucht (Altkreis Lübben), aufgeschlüsselt nach Geschlecht<br />
<strong>und</strong> Alter<br />
Geschlecht<br />
weiblich<br />
männlich<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
Altersklasse * Sucht * Geschlecht Kreuztabelle<br />
18-24 Jahre<br />
25-30 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
18-24 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
85<br />
Sucht<br />
ja keine Angabe Gesamt<br />
21 28 49<br />
42,9% 57,1% 100,0%<br />
1 1 2<br />
50,0% 50,0% 100,0%<br />
7 23 30<br />
23,3% 76,7% 100,0%<br />
4 21 25<br />
16,0% 84,0% 100,0%<br />
2 13 15<br />
13,3% 86,7% 100,0%<br />
2 25 27<br />
7,4% 92,6% 100,0%<br />
37 111 148<br />
25,0% 75,0% 100,0%<br />
17 13 30<br />
56,7% 43,3% 100,0%<br />
2 10 12<br />
16,7% 83,3% 100,0%<br />
10 10<br />
100,0% 100,0%<br />
1 10 11<br />
9,1% 90,9% 100,0%<br />
2 14 16<br />
12,5% 87,5% 100,0%<br />
22 57 79<br />
27,8% 72,2% 100,0%<br />
Das Thema Sucht ist bei jeweils etwa einem Viertel der befragten Frauen <strong>und</strong><br />
Männer von Bedeutung. Besonders oft wurde dieser Bereich von den 18-24-<br />
jährigen Männern (56,7%) <strong>und</strong> Frauen desselben Alters (42,9%) sowie von den<br />
Frauen zwischen 25-30 Jahren (50%; n=2) genannt.<br />
Kaum relevant ist das Thema für die über 41-jährigen Menschen in Lübben.
Tab. 12: Interesse an Angeboten zu Ges<strong>und</strong>heitspflege (Altkreis Lübben), aufgeschlüsselt nach<br />
Geschlecht<br />
weiblich<br />
männlich<br />
Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Altersklasse * Ges<strong>und</strong>heitspflege * Geschlecht Kreuztabelle<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
18-24 Jahre<br />
25-30 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
18-24 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
86<br />
Ges<strong>und</strong>heitspflege<br />
ja keine Angabe Gesamt<br />
24 25 49<br />
49,0% 51,0% 100,0%<br />
1 1 2<br />
50,0% 50,0% 100,0%<br />
14 16 30<br />
46,7% 53,3% 100,0%<br />
5 20 25<br />
20,0% 80,0% 100,0%<br />
3 12 15<br />
20,0% 80,0% 100,0%<br />
10 17 27<br />
37,0% 63,0% 100,0%<br />
57 91 148<br />
38,5% 61,5% 100,0%<br />
9 21 30<br />
30,0% 70,0% 100,0%<br />
3 9 12<br />
25,0% 75,0% 100,0%<br />
1 9 10<br />
10,0% 90,0% 100,0%<br />
11 11<br />
100,0% 100,0%<br />
5 11 16<br />
31,3% 68,8% 100,0%<br />
18 61 79<br />
22,8% 77,2% 100,0%<br />
Unter den 18-40 Jahre alten Frauen ist Ges<strong>und</strong>heitspflege für etwa die Hälfte<br />
der Befragten von Interesse. Nach einem Absinken des Interesses in den nach-<br />
folgenden Altersklassen wird ab einem Alter von über 61 Jahren diese Thematik<br />
für Frauen wieder attraktiv (37%). Zwischen diesen Altersstufen finden es ledig-<br />
lich 20% von Interesse.<br />
Bei den Männern wird diese Thematik fast einheitlich von 25-31% der Befragten<br />
gewünscht. Jedoch in der Gruppe der 41-50-Jährigen gaben lediglich 10% ein<br />
Interesse an Ges<strong>und</strong>heitspflege an.
4.6.3 Die Interessenschwerpunkte der Menschen im Altkreis Luckau<br />
Tab. 13: Interesse an Angeboten zu Bewegung <strong>und</strong> Fitness (Altkreis Luckau), aufgeschlüsselt<br />
Geschlecht<br />
weiblich<br />
männlich<br />
nach Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Altersklasse * Bewegung, Fitness * Geschlecht Kreuztabelle<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
18-24 Jahre<br />
25-30 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
18-24 Jahre<br />
25-30 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
87<br />
Bewegung, Fitness<br />
ja keine Angabe Gesamt<br />
12 4 16<br />
75,0% 25,0% 100,0%<br />
4 1 5<br />
80,0% 20,0% 100,0%<br />
5 1 6<br />
83,3% 16,7% 100,0%<br />
11 2 13<br />
84,6% 15,4% 100,0%<br />
1 1 2<br />
50,0% 50,0% 100,0%<br />
17 29 46<br />
37,0% 63,0% 100,0%<br />
50 38 88<br />
56,8% 43,2% 100,0%<br />
7 11 18<br />
38,9% 61,1% 100,0%<br />
1 1<br />
100,0% 100,0%<br />
3 3<br />
100,0% 100,0%<br />
1 1 2<br />
50,0% 50,0% 100,0%<br />
3 4 7<br />
42,9% 57,1% 100,0%<br />
15 16 31<br />
48,4% 51,6% 100,0%<br />
Über drei Viertel (75-85%) der 18-50-jährigen Frauen interessieren sich für Kur-<br />
se zu Bewegung <strong>und</strong> Fitness. Ab einem Alter von 51 Jahren lässt das Interesse<br />
deutlich nach: von 50,0% (n=2) auf 37,0% für die über 61-jährigen Frauen.<br />
Dennoch ist eine mögliche Beteiligung an Kursen zu Bewegung <strong>und</strong> Fitness<br />
von 37% der über 61-Jährigen beachtlich.<br />
Die Männer der Alterstufe 18-24 zeigen weit weniger Interesse als die gleichalt-<br />
rigen Frauen an derartigen Kursen, <strong>und</strong> zwar lediglich zu 38,9%. Wie aber be-<br />
reits bei den Lübbenern hingewiesen wurde, liegt ein möglicher Gr<strong>und</strong> darin,
dass die Mehrzahl der Männer dieser Altersklasse ohnehin bereits in einem<br />
Sportverein organisiert oder anderweitig in ihrer Freizeit sportlich aktiv ist. Be-<br />
achtlich auch bei den über 61-jährigen Männern ist, dass hier ebenfalls eine<br />
Beteiligung von fast 43% zu erwarten ist. Aufgr<strong>und</strong> der geringen Beteiligung der<br />
Gruppen der 25-30-Jährigen (n=1), 31-40-Jährigen (n=0), 41-50-Jährigen (n=3)<br />
<strong>und</strong> der 51-60-Jährigen wird an dieser Stelle auf eine Interpretation der Ergeb-<br />
nisse verzichtet.<br />
Tab. 14: Interesse an Angeboten zu Entspannung <strong>und</strong> Körpererfahrung (Altkreis Luckau), auf-<br />
geschlüsselt nach Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Geschlecht<br />
weiblich<br />
männlich<br />
Altersklasse * Entspannung, Körpererfahrung * Geschlecht Kreuztabelle<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
18-24 Jahre<br />
25-30 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
18-24 Jahre<br />
25-30 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
88<br />
Entspannung,<br />
Körpererfahrung<br />
ja keine Angabe Gesamt<br />
9 7 16<br />
56,3% 43,8% 100,0%<br />
4 1 5<br />
80,0% 20,0% 100,0%<br />
4 2 6<br />
66,7% 33,3% 100,0%<br />
11 2 13<br />
84,6% 15,4% 100,0%<br />
2 2<br />
100,0% 100,0%<br />
16 30 46<br />
34,8% 65,2% 100,0%<br />
46 42 88<br />
52,3% 47,7% 100,0%<br />
5 13 18<br />
27,8% 72,2% 100,0%<br />
1 1<br />
100,0% 100,0%<br />
2 1 3<br />
66,7% 33,3% 100,0%<br />
1 1 2<br />
50,0% 50,0% 100,0%<br />
4 3 7<br />
57,1% 42,9% 100,0%<br />
12 19 31<br />
38,7% 61,3% 100,0%<br />
Dieses Thema scheint für Frauen vom 18.-60. Lebensjahr von hoher Relevanz.<br />
Über die Hälfte bzw. sogar über drei Viertel der Befragten gibt dies an. Ab dem
61.Lebensjahr sind es jedoch immerhin noch 34,8% der Frauen, die sich für<br />
Entspannung <strong>und</strong> Körpererfahrung interessieren.<br />
Unter den Männern ist das Interesse für diese Thematik zwar weniger präsent<br />
als bei den Frauen, vor allem bei den 18-24-Jährigen (27,8%), aber dennoch ab<br />
einem Alter von 41 Jahren bei über der Hälfte vorhanden.<br />
Tab. 15: Interesse an Angeboten zu Ernährung <strong>und</strong> Kochen (Altkreis Luckau), aufgeschlüsselt<br />
nach Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Geschlecht<br />
weiblich<br />
männlich<br />
Altersklasse * Ernährung, Kochen * Geschlecht Kreuztabelle<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
18-24 Jahre<br />
25-30 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
18-24 Jahre<br />
25-30 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
89<br />
Ernährung, Kochen<br />
ja keine Angabe Gesamt<br />
10 6 16<br />
62,5% 37,5% 100,0%<br />
4 1 5<br />
80,0% 20,0% 100,0%<br />
5 1 6<br />
83,3% 16,7% 100,0%<br />
11 2 13<br />
84,6% 15,4% 100,0%<br />
2 2<br />
100,0% 100,0%<br />
33 13 46<br />
71,7% 28,3% 100,0%<br />
65 23 88<br />
73,9% 26,1% 100,0%<br />
9 9 18<br />
50,0% 50,0% 100,0%<br />
1 1<br />
100,0% 100,0%<br />
1 2 3<br />
33,3% 66,7% 100,0%<br />
1 1 2<br />
50,0% 50,0% 100,0%<br />
3 4 7<br />
42,9% 57,1% 100,0%<br />
15 16 31<br />
48,4% 51,6% 100,0%<br />
Das Thema Ernährung <strong>und</strong> Kochen scheint für 73,9% der befragten Frauen <strong>und</strong><br />
bei 48,4% der befragten Männer aus Luckau von Bedeutung. Dabei entfallen<br />
die größten Anteile auf Frauen im Alter zwischen 25-50 Jahren (80,0-84,6%).
Bei den 51-60-Jährigen sind es sogar 100% (n=2). Auch über die Hälfte der<br />
Frauen der jüngsten Altersgruppe interessieren sich für Kurse im Bereich Er-<br />
nährung <strong>und</strong> Kochen sowie die der lebensältesten Gruppe (62,5% bzw. 71,7%).<br />
Unter den Männern ist das Interesse zwar etwas weniger verbreitet, befindet<br />
sich jedoch zwischen einem Drittel bei den 41-50-Jährigen (n=3) <strong>und</strong> der Hälfte<br />
bei den 18-24-Jährigen <strong>und</strong> den 51-60-Jährigen (n=2).<br />
Tab. 16: Interesse an Angeboten zu Erkrankungen <strong>und</strong> Heilmethoden (Altkreis Luckau), aufge-<br />
schlüsselt nach Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Geschlecht<br />
weiblich<br />
männlich<br />
Altersklasse * Erkrankungen, Heilmethoden * Geschlecht Kreuztabelle<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
18-24 Jahre<br />
25-30 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
18-24 Jahre<br />
25-30 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
90<br />
Erkrankungen,<br />
Heilmethoden<br />
ja keine Angabe Gesamt<br />
9 7 16<br />
56,3% 43,8% 100,0%<br />
3 2 5<br />
60,0% 40,0% 100,0%<br />
5 1 6<br />
83,3% 16,7% 100,0%<br />
9 4 13<br />
69,2% 30,8% 100,0%<br />
1 1 2<br />
50,0% 50,0% 100,0%<br />
22 24 46<br />
47,8% 52,2% 100,0%<br />
49 39 88<br />
55,7% 44,3% 100,0%<br />
7 11 18<br />
38,9% 61,1% 100,0%<br />
1 1<br />
100,0% 100,0%<br />
2 1 3<br />
66,7% 33,3% 100,0%<br />
2 2<br />
100,0% 100,0%<br />
3 4 7<br />
42,9% 57,1% 100,0%<br />
15 16 31<br />
48,4% 51,6% 100,0%<br />
Das Thema Erkrankungen <strong>und</strong> Heilmethoden ist in der mittleren Altersstufe be-<br />
sonders attraktiv: bei den 31-40-jährigen Frauen zu 83,3% <strong>und</strong> bei den 41-50-
jährigen Männern zu 66,7% sowie den 51-60-jährigen Männern zu 100% (n=2).<br />
Außerdem gaben über die Hälfte der 18-24-jährigen Frauen an, sich für Kurse<br />
zu Erkrankungen <strong>und</strong> Heilmethoden zu interessieren. Bei den über 61-jährigen<br />
Frauen <strong>und</strong> Männern wird ein Interesse bei weniger als der Hälfte der Befragten<br />
deutlich.<br />
Tab. 17: Interesse an Angeboten zu Psychische Stabilität <strong>und</strong> soziale Kompetenz (Altkreis Lu-<br />
ckau), aufgeschlüsselt nach Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Geschlecht<br />
weiblich<br />
männlich<br />
Altersklasse * Psychische Stabilität <strong>und</strong> soziale Kompetenz * Geschlecht Kreuztabelle<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
18-24 Jahre<br />
25-30 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
18-24 Jahre<br />
25-30 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
91<br />
Psychische Stabilität<br />
<strong>und</strong> soziale Kompetenz<br />
ja keine Angabe Gesamt<br />
8 8 16<br />
50,0% 50,0% 100,0%<br />
3 2 5<br />
60,0% 40,0% 100,0%<br />
3 3 6<br />
50,0% 50,0% 100,0%<br />
8 5 13<br />
61,5% 38,5% 100,0%<br />
1 1 2<br />
50,0% 50,0% 100,0%<br />
10 36 46<br />
21,7% 78,3% 100,0%<br />
33 55 88<br />
37,5% 62,5% 100,0%<br />
4 14 18<br />
22,2% 77,8% 100,0%<br />
1 1<br />
100,0% 100,0%<br />
1 2 3<br />
33,3% 66,7% 100,0%<br />
1 1 2<br />
50,0% 50,0% 100,0%<br />
1 6 7<br />
14,3% 85,7% 100,0%<br />
8 23 31<br />
25,8% 74,2% 100,0%<br />
Kurse <strong>zur</strong> Förderung der psychischen Stabilität <strong>und</strong> sozialen Kompetenz wer-<br />
den von insgesamt 37,5% der Frauen <strong>und</strong> 25,8% der Männer aus Luckau ge-<br />
wünscht. Besonders unter den über 61 Jahre alten Frauen (21,7%) sowie Män-<br />
nern (14,3%) <strong>und</strong> den 18-24-jährigen Männern ist der Bereich weniger attraktiv.
Das größte Interesse liegt bei den Frauen im Alter von 41-50 Jahren (61,5%)<br />
<strong>und</strong> von 25-30 Jahren (60,0%) vor.<br />
Tab. 18: Interesse an Angeboten zu Ges<strong>und</strong>heitspolitik <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitswesen (Altkreis Lu-<br />
ckau), aufgeschlüsselt nach Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Geschlecht<br />
weiblich<br />
männlich<br />
Altersklasse * Ges<strong>und</strong>heitspolitik <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitswesen * Geschlecht Kreuztabelle<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
18-24 Jahre<br />
25-30 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
18-24 Jahre<br />
25-30 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
92<br />
Ges<strong>und</strong>heitspolitik <strong>und</strong><br />
Ges<strong>und</strong>heitswesen<br />
ja keine Angabe Gesamt<br />
6 10 16<br />
37,5% 62,5% 100,0%<br />
3 2 5<br />
60,0% 40,0% 100,0%<br />
3 3 6<br />
50,0% 50,0% 100,0%<br />
8 5 13<br />
61,5% 38,5% 100,0%<br />
1 1 2<br />
50,0% 50,0% 100,0%<br />
21 25 46<br />
45,7% 54,3% 100,0%<br />
42 46 88<br />
47,7% 52,3% 100,0%<br />
4 14 18<br />
22,2% 77,8% 100,0%<br />
1 1<br />
100,0% 100,0%<br />
3 3<br />
100,0% 100,0%<br />
2 2<br />
100,0% 100,0%<br />
3 4 7<br />
42,9% 57,1% 100,0%<br />
13 18 31<br />
41,9% 58,1% 100,0%<br />
Ein Interesse an Kursen <strong>zur</strong> Ges<strong>und</strong>heitspolitik <strong>und</strong> zum Ges<strong>und</strong>heitswesen ist<br />
bei den Frauen <strong>und</strong> Männern aus Luckau bei fast der Hälfte vorhanden. Beson-<br />
ders ausgeprägt ist dies in den mittleren Altersklassen beider Geschlechter (50-<br />
60% Frauen bzw. 100% Männer). Kaum von Interesse scheint es bei den Män-<br />
nern von 18-24Jahren (22,2%) zu sein.
Tab. 19: Interesse an Angeboten zu Gesellschaft <strong>und</strong> Umwelt (Altkreis Luckau), aufgeschlüsselt<br />
nach Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Geschlecht<br />
weiblich<br />
männlich<br />
Altersklasse * Gesellschaft <strong>und</strong> Umwelt * Geschlecht Kreuztabelle<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
18-24 Jahre<br />
25-30 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
18-24 Jahre<br />
25-30 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
93<br />
Gesellschaft <strong>und</strong><br />
Umwelt<br />
ja keine Angabe Gesamt<br />
8 8 16<br />
50,0% 50,0% 100,0%<br />
3 2 5<br />
60,0% 40,0% 100,0%<br />
2 4 6<br />
33,3% 66,7% 100,0%<br />
9 4 13<br />
69,2% 30,8% 100,0%<br />
1 1 2<br />
50,0% 50,0% 100,0%<br />
15 31 46<br />
32,6% 67,4% 100,0%<br />
38 50 88<br />
43,2% 56,8% 100,0%<br />
4 14 18<br />
22,2% 77,8% 100,0%<br />
1 1<br />
100,0% 100,0%<br />
1 2 3<br />
33,3% 66,7% 100,0%<br />
1 1 2<br />
50,0% 50,0% 100,0%<br />
7 7<br />
100,0% 100,0%<br />
6 25 31<br />
19,4% 80,6% 100,0%<br />
Gesellschaft <strong>und</strong> Umwelt als Inhalt von <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>sangeboten ist vor<br />
allem für die Männer in Luckau eher unattraktiv. Insgesamt interessieren sich<br />
hierfür lediglich 19,4%, darunter befindet sich niemand aus der Altersklasse der<br />
über 61-Jährigen <strong>und</strong> der 25-30-Jährigen (n=1). Am stärksten ist das Interesse<br />
bei den 51-60 Jahre alten Männern (50% bei n=2).<br />
Für Frauen scheint die Thematik bei 43,2% Interesse hervor<strong>zur</strong>ufen. Darunter<br />
befinden sich zu 69,2% die 41-50-jährigen <strong>und</strong> als geringster Wert 32,6%, an-<br />
gegeben von über 61-jährigen Frauen.
Tab. 20: Interesse an Angeboten zu Sucht (Altkreis Luckau), aufgeschlüsselt nach Geschlecht<br />
<strong>und</strong> Alter<br />
Geschlecht<br />
weiblich<br />
männlich<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
Altersklasse * Sucht * Geschlecht Kreuztabelle<br />
18-24 Jahre<br />
25-30 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
18-24 Jahre<br />
25-30 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
94<br />
Sucht<br />
ja keine Angabe Gesamt<br />
12 4 16<br />
75,0% 25,0% 100,0%<br />
2 3 5<br />
40,0% 60,0% 100,0%<br />
3 3 6<br />
50,0% 50,0% 100,0%<br />
10 3 13<br />
76,9% 23,1% 100,0%<br />
1 1 2<br />
50,0% 50,0% 100,0%<br />
6 40 46<br />
13,0% 87,0% 100,0%<br />
34 54 88<br />
38,6% 61,4% 100,0%<br />
12 6 18<br />
66,7% 33,3% 100,0%<br />
1 1<br />
100,0% 100,0%<br />
1 2 3<br />
33,3% 66,7% 100,0%<br />
2 2<br />
100,0% 100,0%<br />
1 6 7<br />
14,3% 85,7% 100,0%<br />
17 14 31<br />
54,8% 45,2% 100,0%<br />
Insgesamt betrachtet wird das Thema Sucht stärker von Männern (54,8%) als<br />
von Frauen (38,6%) gewünscht. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass<br />
die beiden 100%-Werte der 25-30- <strong>und</strong> 51-60-jährigen Männern, die für das<br />
höhere Gesamtergebnis verantwortlich sind, aus einer Beteiligung von n=1 bzw.<br />
n=2 resultieren.<br />
Einzeln betrachtet interessieren sich drei Viertel der 18-24 sowie der 41-50 Jah-<br />
re alten Frauen. Von den Männern der Altersklasse 18-24 Jahre geben zwei<br />
Drittel ein Interesse an einem derartigen Kursangebot an. Ab einem Alter von
61 Jahren ist bei beiden Geschlechtern das Interesse kaum noch vorhanden<br />
(13 bzw. 14%).<br />
Tab. 21: Interesse an Angeboten zu Ges<strong>und</strong>heitspflege (Altkreis Luckau), aufgeschlüsselt nach<br />
Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Geschlecht<br />
weiblich<br />
männlich<br />
Altersklasse * Ges<strong>und</strong>heitspflege * Geschlecht Kreuztabelle<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
Altersklasse<br />
Gesamt<br />
18-24 Jahre<br />
25-30 Jahre<br />
31-40 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
18-24 Jahre<br />
25-30 Jahre<br />
41-50 Jahre<br />
51-60 Jahre<br />
über 61 Jahre<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
Anzahl<br />
% von Altersklasse<br />
95<br />
Ges<strong>und</strong>heitspflege<br />
ja keine Angabe Gesamt<br />
11 5 16<br />
68,8% 31,3% 100,0%<br />
3 2 5<br />
60,0% 40,0% 100,0%<br />
3 3 6<br />
50,0% 50,0% 100,0%<br />
11 2 13<br />
84,6% 15,4% 100,0%<br />
1 1 2<br />
50,0% 50,0% 100,0%<br />
20 26 46<br />
43,5% 56,5% 100,0%<br />
49 39 88<br />
55,7% 44,3% 100,0%<br />
5 13 18<br />
27,8% 72,2% 100,0%<br />
1 1<br />
100,0% 100,0%<br />
2 1 3<br />
66,7% 33,3% 100,0%<br />
1 1 2<br />
50,0% 50,0% 100,0%<br />
2 5 7<br />
28,6% 71,4% 100,0%<br />
10 21 31<br />
32,3% 67,7% 100,0%<br />
Ges<strong>und</strong>heitspflege ist unter den Männern für insgesamt 32,3% <strong>und</strong> bei den<br />
Frauen für insgesamt 55,7% von Bedeutung. Die Frauen zwischen 41-50Jahren<br />
haben das größte Interesse (84,6%) an Kursen <strong>zur</strong> Ges<strong>und</strong>heitspflege, ausge-<br />
nommen der Alterklasse der über 61-Jährigen interessiert sich mindestens die<br />
Hälfte für ein derartiges Kursangebot.
Bei den Männern ist, wie bereits erwähnt, ein geringeres Interesse für Ges<strong>und</strong>-<br />
heitspflegekurse vorhanden: lediglich bei den 41-50 bzw. 51-60Jahre alten<br />
Männern liegt bei mindestens der Hälfte der Wunsch nach derartigen Angebo-<br />
ten vor (n=3 bzw. n=2).<br />
4.6.4 Interessieren Sie sich für <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> <strong>und</strong> –förderung?<br />
Auf diese Frage gibt es die als Antwortmöglichkeiten „ja“, „unentschlossen“,<br />
„nein“ <strong>und</strong> „keine Angabe“.<br />
Weibliche Befragte:<br />
Unter den weiblichen Befragten ist das Interesse an Maßnahmen <strong>zur</strong> Ges<strong>und</strong>-<br />
heitsbildung/Ges<strong>und</strong>heitsförderung durchschnittlich weit verbreitet. 72,9% der<br />
Befragten gaben ein „ja“ an, 14,9% sind noch unentschlossen <strong>und</strong> lediglich<br />
5,9% finden <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>/Ges<strong>und</strong>heitsförderung für sich persönlich unin-<br />
teressant.<br />
Bei der jüngsten Altersklasse, den 18-24-Jährigen ist auffällig, dass die Nen-<br />
nungen für „ja“ <strong>und</strong> „unentschlossen“ fast gleich hoch sind. Mit zunehmendem<br />
Alter geben auch mehr befragte Frauen das Vorhandensein von Interesse an.<br />
Prozentual gesehen liegt in der Altersklasse der 51-60-Jährigen mit 94,1% das<br />
größte Interesse für <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> <strong>und</strong> –förderung vor. Von den 40-51-<br />
Jährigen geben 92,1% an, dass sie interessiert seien, bei den über 61-Jährigen<br />
<strong>und</strong> den 31-40-Jährigen sind dies immer noch 81%.<br />
Männliche Befragte:<br />
Bei den Männern fällt das Interesse an Ges<strong>und</strong>heitsbil-<br />
dung/Ges<strong>und</strong>heitsförderung deutlich geringer als bei den Frauen aus. Hier ge-<br />
ben 50,9% ein „ja“ an, 27,3% sind noch unentschlossen <strong>und</strong> 17,3% lehnen jed-<br />
wedes Interesse an dem Thema ab. Besonders in der Gruppe der 18-24-<br />
Jährigen sind fast die Hälfte unentschlossen <strong>und</strong> fast ein Drittel nicht für Ge-<br />
s<strong>und</strong>heitsbildung <strong>und</strong> –förderung zu interessieren. In den höheren Altersstufen<br />
ist das Interesse deutlich höher als Unentschlossenheit oder Ablehnung von<br />
96
<strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung. Das größte Interesse ist in den<br />
Altersklassen der 51-60-Jährigen <strong>und</strong> den über 61-Jährigen vorhanden.<br />
4.6.5 Haben Sie bereits an Kursen <strong>zur</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> <strong>und</strong> –<br />
förderung teilgenommen? Wenn nein, warum nicht?<br />
Wie bei der vorhergehenden Frage gibt es auch hier die Antwortmöglichkeiten<br />
„ja“, „unentschlossen“, „nein“ <strong>und</strong> „keine Angabe“. Wird auf die Frage mit „nein“<br />
geantwortet, wird nach den Gründen für die bisherige Nichtteilnahme an Kursen<br />
<strong>zur</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> gefragt. Hier sind mehrere Antwortmöglichkeiten zuläs-<br />
sig.<br />
Weibliche Befragte:<br />
Von den 41-50-jährigen Frauen haben 50% Erfahrungen mit Kursen <strong>zur</strong> Ge-<br />
s<strong>und</strong>heitsbildung, darauf folgen 46,6% der über 61-Jährigen, 44,4% der 31-40-<br />
Jährigen <strong>und</strong> 35,3% der 51-60-Jährigen. Die niedrigste bisherige Teilnahme<br />
zeigen die 25-30-jährigen (14,3%) <strong>und</strong> die 18-24-jährigen (20,0%) Frauen.<br />
Unentschlossenheit bewegt sich auf einstelligen Prozentwerten, ausgenommen<br />
der 25-30-Jährigen, hier wird ein Wert von 28,6% erreicht. Der Gr<strong>und</strong> ist aller-<br />
dings in der geringen Stichprobengröße dieser Altersklasse zu sehen, vor fal-<br />
schen Interpretationsergebnissen sei hier gewarnt.<br />
Fast 60% der weiblichen Befragten aus den Altkreisen Lübben <strong>und</strong> Luckau ha-<br />
ben laut ihren Angaben noch nie an einem <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>sangebot teilge-<br />
nommen. Der Anteil der 18-24-Jährigen unter ihnen ist mit 76,9% sehr hoch.<br />
Lediglich die Gruppen der 41-50-Jährigen <strong>und</strong> die der über 61 Jahre alten<br />
Frauen erreichen hier einen etwas geringeren Wert von unter 50%. Auf die<br />
Gründe wird weiter unten eingegangen.<br />
97
Männliche Befragte:<br />
Von den männlichen Befragten haben insgesamt 28,2% bereits Erfahrungen mit<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>. Dabei haben von den 31-40-, 41-50- sowie über 61-<br />
Jährigen z. T. weniger als ein Viertel bereits an Kursen <strong>zur</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong><br />
teilgenommen. Von den 18-24-jährigen Männern besuchten bereits über 30%<br />
einen Kurs <strong>und</strong> von den 51-60-jährigen Männern war es fast die Hälfte.<br />
Ganz unerfahren mit Angeboten der <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> sind 68,2% der Män-<br />
ner. Unter den befragten 31-40Jahre alten Männern befindet sich der größte<br />
Anteil (83,3%). Darauf folgen die über 61-Jährigen mit 78,3%, die 18-24-<br />
Jährigen mit 64,6% <strong>und</strong> die 41-50-Jährigen mit 61,5%.<br />
Von den weiblichen <strong>und</strong> männlichen Befragten, die auf diese Frage mit „Nein“<br />
geantwortet haben, werden folgende Gründe ihrer bisherigen Nichtteilnahme<br />
genannt 7 :<br />
Ich erhalte keine Informationen zu Kursangeboten: 56,7%<br />
Weiß nicht. 17,0%<br />
Der Kurs entsprach nicht meinen Interessen. 11,2%<br />
Der Kurs war zu teuer. 8,0%<br />
Der Anfahrtsweg war zu weit. 7,1%<br />
Die Prozentangaben sind auf die Häufigkeit der Nennung (insgesamt 224 Nen-<br />
nungen) bezogen. Im Durchschnitt hat jeder bisher nichtteilnehmende Befragte<br />
1,19 Antworten zu dieser Frage gegeben.<br />
7 Hier erscheint eine Differenzierung nach dem Merkmal „Geschlecht“ nicht notwendig.<br />
98
An dieser Stelle gibt es zusätzlich eine offene Antwortkategorie „Sonstiges“.<br />
Hier werden folgende, bereits in Gruppen gefasste, Antworten gegeben:<br />
99<br />
Häufigkeiten Prozent<br />
keine Zeit 6 24%<br />
noch nichts davon gehört 5 20%<br />
kein Interesse/kein Bedarf 5 20%<br />
treibe regelmäßig Sport 2 8%<br />
Kursbeginn zu spät für Auswärtige 2 8%<br />
keine ansprechenden Kurse dabei 1 4%<br />
Körperlich nicht in der Lage 1 4%<br />
Bilde mich selbst ges<strong>und</strong>heitlich 1 4%<br />
keine Möglichkeit 1 4%<br />
es kostet Überwindung 1 4%<br />
Gesamt: 25 100%<br />
4.6.6 Ziehen Sie es in Erwägung in naher Zukunft an Ges<strong>und</strong>heitsbil-<br />
dung <strong>und</strong> –förderung teilzunehmen? Wenn nein, warum nicht?<br />
Auch bei dieser Frage gibt es die Antwortmöglichkeiten „ja“, „unentschlossen“,<br />
„nein“ <strong>und</strong> „keine Angabe“. Wird auf die Frage mit „nein“ geantwortet, wird nach<br />
den Gründen dafür gefragt, warum auch in Zukunft nicht geplant ist, an Kursen<br />
<strong>zur</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> teilzunehmen. Hier sind mehrere Antwortmöglichkeiten<br />
zulässig.<br />
Weibliche Befragte:<br />
Bezogen auf die Frage, ob sie zukünftig an Angeboten <strong>zur</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong><br />
teilnehmen würden, antworten 39,8% der Frauen mit „ja“, 26,7% sind unent-<br />
schlossen <strong>und</strong> 25,4% möchten in naher Zukunft nicht an derartigen Kursen teil-<br />
nehmen. Die Entschlossenheit zukünftig an Kursen teilzunehmen ist ab einem<br />
Alter von 25 Jahren in allen Altersstufen recht gleichmäßig zwischen 41% <strong>und</strong><br />
57% verteilt. In der Gruppe der 18-24-Jährigen möchten sich jedoch lediglich<br />
13,8% der befragten Frauen in Zukunft beteiligen. Dafür ist in dieser Gruppe
fast die Hälfte unentschlossen. In den Altersgruppen zwischen 25 <strong>und</strong> 60 Jah-<br />
ren befinden sich ca. ein Viertel Unentschlossene unter den befragten Frauen.<br />
Definitiv „nein“ geben am häufigsten die über 61- sowie die 18-24-Jährigen an<br />
(35,6% bzw. 33,8%). Bei den 51-60 Jahre alten Frauen sind es noch 23,5% <strong>und</strong><br />
bei den restlichen Altersgruppen nur noch unter 15%.<br />
Auf die Gründe der zukünftigen Nichtteilnahme an Kursen <strong>zur</strong> Ges<strong>und</strong>heitsbil-<br />
dung wird weiter unten eingegangen.<br />
Männliche Befragte:<br />
Von den 51-60-jährigen Männern möchten 53,8% zukünftig an Ges<strong>und</strong>heitsbil-<br />
dung teilnehmen. Geringer fällt dieser Wert für alle anderen Altersgruppen aus:<br />
bei den Gruppen der 31-40-Jährigen, den 41-50-Jährigen sowie den über 61-<br />
Jährigen sind das zwischen 33 <strong>und</strong> 39%. In der jüngsten Altersgruppe fallen nur<br />
8,3% auf die der zukünftig Teilnehmenden. Unentschlossen sind in dieser<br />
Gruppe 37,5% <strong>und</strong> nicht teilnehmen werden voraussichtlich 50% der befragten<br />
18-24-jährigen Männer. Der Anteil der Unentschlossenen ist in der Gruppe der<br />
31-40-Jährigen mit 50% am Höchsten, dafür ist die Zahl der in Zukunft Nicht-<br />
teilnehmenden in dieser Gruppe mit 16,7% am Niedrigsten. In den oberen Al-<br />
tersklassen liegt der Prozentsatz derer, die voraussichtlich nicht an Ges<strong>und</strong>-<br />
heitsbildung teilnehmen werden zwischen 23 <strong>und</strong> 39%.<br />
Die angegebenen Gründe für die zukünftige Nichtteilnahme werden im Folgen-<br />
den aufgelistet:<br />
Dafür habe ich kein Geld. 35,6%<br />
Weiß nicht. 32,7%<br />
Interessiert mich nicht. 25,7%<br />
Ich sehe keinen Sinn in <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>. 5,9%<br />
100
Insgesamt wurden zu dieser Frage 101 Antworten gegeben. Jeder Befragte gab<br />
auf die Frage, warum er zukünftig nicht an <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> teilnehmen wür-<br />
de durchschnittlich 1,15 Antworten.<br />
Außerdem wurde ausgewertet, worin die Gründe für die Unentschlossenheit<br />
bezüglich zukünftiger Teilnahme an Kursen der <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> liegen:<br />
Dafür habe ich kein Geld. 44,8%<br />
Weiß nicht. 41,4%<br />
Interessiert mich nicht. 6,9%<br />
Ich sehe keinen Sinn in <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>. 6,9%<br />
Unter der hier möglichen offenen Antwortkategorie „Sonstiges“ wurden folgende<br />
Angaben gemacht:<br />
101<br />
Häufigkeiten Prozent<br />
wenig/keine Zeit 12 41,4%<br />
der allgemeine Ges<strong>und</strong>heitszustand<br />
lässt es nicht zu 6 20,7%<br />
sehe keinen Sinn in GB/ bin ges<strong>und</strong> 5 17,2%<br />
fühle mich ausreichend ges<strong>und</strong>heitlich<br />
gebildet / treibe viel Sport 3 10,3%<br />
Angebote nicht interessant genug 1 3,4%<br />
man hat keine Chance in die Kurse<br />
in die Kurse hineinzukommen 1 3,4%<br />
keine Fahrtmöglichkeit 1 3,4%<br />
Gesamt: 29 100%
4.6.7 Wie sollte <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> organisiert sein, um Ihr Interesse<br />
zu wecken?<br />
Tab.22: Wünsche der Befragten <strong>zur</strong> Organisation von Kursen <strong>zur</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong><br />
102<br />
Nennungen Prozent<br />
der Nen-<br />
nungen<br />
bezahlbar/kostengünstig 29 16,9%<br />
erreichbar, ortsnah 25 14,5%<br />
nicht zu streng, offen für Fragen, Teilnehmer mit einbe-<br />
ziehen, Spaß, ansprechend, jung, modern, nicht steril,<br />
aufregend, spannend, krass, abwechslungsreich 14 8,1%<br />
kostenfrei 12 7,0%<br />
mehr <strong>und</strong> rechtzeitige Information, Transparenz 12 7,0%<br />
nachmittags/abends, zeitlich machbar 11 6,4%<br />
praktische, anschauliche Vermittlung, aktive Teilnahme,<br />
lebensnah 11 6,4%<br />
wichtige, spezielle <strong>und</strong> interessante Themen, nicht all-<br />
gemein 9 5,2%<br />
immer nach neuestem Forschungsstand, fachlich kom-<br />
petent, Vortragsform, informativ 8 4,7%<br />
altersgerecht 7 4,1%<br />
Kostenübernahme bzw. –beteiligung durch Krankenkas-<br />
sen 7 4,1%<br />
in Kleingruppen 6 3,5%<br />
unkompliziert, für jeden verständlich, machbar 4 2,3%<br />
im Schul- <strong>und</strong> Klassenverband durchführen, Sportunter-<br />
richt 3 1,7%<br />
Sportverein, Gymnastikgruppe 3 1,7%<br />
großes Angebote vorhalten 3 1,7%
über Selbsthilfegruppe 2 1,2%<br />
über Hausarzt 2 1,2%<br />
über Seniorenklub 2 1,2%<br />
von Kindesalter/Schulalter an 2 1,2%<br />
Einmalige Nennungen sind nicht berücksichtigt.<br />
4.6.8 Wo sollten Angebote <strong>zur</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> veröffentlicht wer-<br />
den, um Sie zu erreichen?<br />
Tab. 23: Zugangswege <strong>zur</strong> Erreichung der Bevölkerung mit Informationen über Ges<strong>und</strong>heitsbil-<br />
dungsangebote<br />
103<br />
Nennungen Prozent<br />
der Nen-<br />
nungen<br />
Regionalpresse, Tagespresse, Zeitungen 129 38,4%<br />
öffentliche Einrichtungen, Krankenhäuser, Schulen 39 11,6%<br />
Krankenkassen (-broschüren, -zeitungen) 33 9,8%<br />
TV 24 7,1%<br />
Postwurfsendungen (persönlich) 22 6,5%<br />
Arztpraxen 22 6,5%<br />
Radio 19 5,7%<br />
schwarzes Brett, Informationstafeln 8 2,4%<br />
zentraler Ort (Rathaus etc.) 7 2,1%<br />
Flyer 7 2,1%<br />
Internet 6 1,8%<br />
Zeitschriften 6 1,8%<br />
Apotheken 5 1,5%<br />
Betriebe 4 1,2%<br />
Disko, Bar, Café, Zigarettenladen 3 0,9%<br />
Kaufhaus 2 0,6%<br />
Einmalige Nennungen sind nicht berücksichtigt.
4.7 Diskussion der Ergebnisse<br />
Aufgr<strong>und</strong> der geringen Beteiligung der Bevölkerung an der Befragung lässt sich<br />
ein verhältnismäßig geringes Interesse an <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> vermuten. Nicht<br />
auszuschließen ist als weiterer Gr<strong>und</strong> der geringe Informationsstand über Ge-<br />
s<strong>und</strong>heitsbildung <strong>und</strong> –förderung in der Bevölkerung. Deutlich kommt dies in<br />
den Antworten, vor allem in der Altersgruppe der 18-24-Jährigen, zum Ausdruck<br />
(„halte eine solche Ausbildung für überflüssig!“). <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> wird in-<br />
nerhalb der Bevölkerung zum Teil als unpersönliche Wissensvermittlung, ohne<br />
praktische Anteile, verstanden, dies belegen Äußerungen, wie z.B. „Angebot im<br />
TV ist ausreichend“. Gewünscht wurde von Seiten der Befragten mehr <strong>und</strong><br />
rechtzeitige Information <strong>und</strong> Transparenz.<br />
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden vorerst das Weiterbildungsvolumen<br />
<strong>und</strong> die Teilnahmefälle im Bereich <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> aus der Perspektive der<br />
Volkshochschulen beleuchtet, um so die allgemeine b<strong>und</strong>esweite Angebots-<br />
<strong>und</strong> Teilnahmesituation zu beschreiben <strong>und</strong> die steigende Relevanz der The-<br />
matik an Hand der steigenden Zahlen aufzuzeigen. Diesen statistischen Struk-<br />
turbeschreibungen auf B<strong>und</strong>esebene werden sodann die Ergebnisse der regio-<br />
nalen Bürgerbefragung in den Altkreisen Lübben <strong>und</strong> Luckau gegenüber ge-<br />
stellt.<br />
4.7.1 Struktur der Teilnehmerschaft in der <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong><br />
Im Bereich der <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> liegen b<strong>und</strong>esweite Strukturanalysen der<br />
Teilnehmenden nur vereinzelt vor. Lediglich die Volkshochschulen können nach<br />
Geschlecht <strong>und</strong> Alter differenzierte Daten <strong>und</strong> die gesetzlichen Krankenkassen<br />
– für „Maßnahmen der Ges<strong>und</strong>heitsförderung“ 8 – sogar zusätzlich Aussagen<br />
<strong>zur</strong> sozialen Schicht vorlegen. Ein Drittel der befragten Träger gaben für das<br />
Jahr 1994 hierzu Schätzwerte an. Demnach nehmen bei fünf Trägern überwie-<br />
gend Frauen an <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> teil (zwischen 70 <strong>und</strong> 85%) <strong>und</strong> nur bei<br />
8 Darunter befinden sich fast ausschließlich Veranstaltungen der <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>.<br />
104
einem Träger mehr Männer als Frauen (60% bzw. 40%) (B<strong>und</strong>esministerium für<br />
Bildung, Wissenschaft, Forschung <strong>und</strong> Technologie 1997).<br />
Bezogen auf die Altersstruktur der Teilnehmenden ergeben die Schätzungen,<br />
dass besonders die 35- bis 49-Jährigen an <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>sveranstaltun-<br />
gen teilnehmen. Bei den Volkshochschulen machen die 25- bis 34-Jährigen <strong>und</strong><br />
die 35- bis 49-Jährigen je 30% der Teilnehmerschaft aus. Auch bei den gesetz-<br />
lichen Krankenkassen bestätigt sich eine Teilnehmerschaft mittleren Alters, da-<br />
bei sind Frauen zwischen 30 <strong>und</strong> 49 <strong>und</strong> Männer ab 30, jedoch besonders im<br />
Alter von 60 bis 69 Jahren, vertreten (ebenda).<br />
Bezogen auf die Daten der GKV <strong>zur</strong> sozialen Schichtzugehörigkeit ist festzu-<br />
stellen, dass die Frauen der oberen sozialen Schicht anteilsmäßig fast doppelt<br />
so häufig vertreten sind, wie die der unteren Schicht. Bei den Männern sind alle<br />
Schichten gleichmäßig vertreten (ebenda).<br />
Innerhalb der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchung wurden<br />
hinsichtlich der sozialen Schichtzugehörigkeit der Teilnehmerschaft keine Erhe-<br />
bungen vorgenommen. Es wurde danach gefragt, ob man bereits an Kursen <strong>zur</strong><br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> teilgenommen hat. Bei negativer Antwort, wurde weiter ge-<br />
fragt, worin die Gründe liegen:<br />
Bisher am häufigsten teilgenommen haben Frauen der Altersklasse der 41-50-<br />
Jährigen mit 50%. Die höheren Altersklassen haben nur einen wenig geringeren<br />
Anteil an der bisherigen Teilnehmerschaft. Zu erreichen gilt es, mit speziellen<br />
Angeboten für diese Zielgruppen, vor allem die 18-24-jährigen sowie die 25-30-<br />
jährigen Frauen. Unter den männlichen Befragten erreichte die jüngste Alters-<br />
klasse – im Gegensatz zu den gleichaltrigen Frauen – gemessen an den restli-<br />
chen Männern höhere Beteiligungszahlen. Die höchste Beteiligung erreichte<br />
hier jedoch die Gruppe der 41-50-jährigen Männer. Bisher am seltensten teilge-<br />
nommen haben hingegen die 31-50-jährigen sowie die über 61-jährigen Män-<br />
ner.<br />
105
Der am häufigsten genannte Gr<strong>und</strong> für die Nichtteilnahme war mit Abstand, bei<br />
56% der Befragten, die fehlende Information zu entsprechenden Kursangebo-<br />
ten. Hier zeigt sich ein dringender Bedarf an der Erhöhung der Transparenz<br />
bezüglich <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> in den Altkreisen Lübben <strong>und</strong> Luckau.<br />
Die Struktur der, innerhalb der Untersuchung ermittelten, Teilnehmerschaft ist<br />
ähnlich der, in der durch das B<strong>und</strong>esministerium für Bildung, Wissenschaft,<br />
Forschung <strong>und</strong> Technologie (1997) herausgegebenen, Dokumentation zu Ge-<br />
s<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> allgemeiner Weiterbildung.<br />
Zudem ist es von Bedeutung auch die potentielle Teilnehmerschaft zu ermitteln<br />
sowie die Gründe für die zukünftige Nichtteilnahme bzw. für die Unentschlos-<br />
senheit über die zukünftige Teilnahme an Angeboten, Maßnahmen <strong>und</strong> Pro-<br />
grammen der <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> <strong>und</strong> –förderung in Erfahrung zu bringen. Um<br />
die Teilnehmerschaft an <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>skursen zu erhöhen, können <strong>und</strong><br />
müssen diese gewonnenen Erkenntnisse in den Planungen <strong>und</strong> Konzeptionen<br />
für derartige Angebote berücksichtigt werden.<br />
Entschlossen zukünftig nicht an Kursen <strong>zur</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> teilzunehmen<br />
sind, laut der Befragung, die jüngste sowie die älteste Altersklasse bei den<br />
Frauen <strong>und</strong> die höheren Altersklassen, jedoch bereits ab 31Jahren, bei den<br />
Männern. Unentschlossenheit zeigen vor allem die 18-24-jährigen Frauen (mit<br />
50% der Befragten dieser Altersklasse) sowie ca. ein Viertel der Frauen ab 25<br />
Jahren. Der Anteil der unentschlossenen Männer ist in der Gruppe der 31-40-<br />
Jährigen mit ca. der Hälfte am größten <strong>und</strong> unter den 18-24-jährigen Männern<br />
mit 37,5% am zweitgrößten. Die Hauptgründe für die zukünftige Nichtteilnahme<br />
bzw. die Unentschlossenheit über die zukünftige Teilnahme liegen - sofern<br />
Gründe benannt wurden - in der finanziellen Situation <strong>und</strong> am fehlenden Inte-<br />
resse.<br />
106
Außerdem wurde nach dem generellen Interesse an <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> ge-<br />
fragt: Unter den Frauen ist ein großes Interesse an <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> ables-<br />
bar. Tendenziell scheint mit steigendem Alter auch ein steigender Wert für ein<br />
Vorhandensein von diesbezüglichem Interesse verb<strong>und</strong>en. Unter den jüngsten<br />
befragten Frauen herrscht ein Gleichgewicht zwischen dem Vorhandensein von<br />
Interesse <strong>und</strong> der Unentschlossenheit darüber vor.<br />
Ein deutlich geringeres Interesse liegt bei den männlichen Befragten vor, den-<br />
noch sind die Verhältnisse zwischen den verschiedenen Altersklassen mit de-<br />
nen der Frauen vergleichbar.<br />
4.7.2 Erreichbarkeit der Teilnehmerschaft<br />
Dieses Kapitel nimmt auf die Ergebnisse der Fragestellungen zu den Wünschen<br />
bezüglich der Art der Organisation von Kursen der <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> (vgl.<br />
Kap. 4.6.7) sowie <strong>zur</strong> Frage der persönlichen Zugänglichkeit für Informationen<br />
(vgl. Kap. 4.6.8) zu <strong>und</strong> über <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>sangebote Bezug.<br />
Auf die offene Frage, wie <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> organisiert sein sollte, um das<br />
Interesse der Befragten zu wecken, wird an erster Stelle der Kostenfaktor ge-<br />
nannt. Hierauf entfallen 16,9% (29 Nennungen) der Antworten. 14,5% (25 Nen-<br />
nungen) der Angaben bekräftigen, dass die Erreichbarkeit eines Angebotes ein<br />
weiterer relevanter Faktor ist. An dritter Stelle, <strong>und</strong> zwar zu 8,1% (14 Nennun-<br />
gen), wird die Bedeutung eines interessanten, abwechslungsreichen, zeitge-<br />
mäßen Angebotes beschrieben. Ferner entfallen jeweils 7% (12 Nennungen)<br />
auf die Kriterien „Kostenfreiheit“ <strong>und</strong> „mehr <strong>und</strong> rechtzeitige Information, Trans-<br />
parenz“ (vgl.: Kap. 4.6.7).<br />
Eine Ausrichtung der Angebote an den Ergebnissen dieser Fragestellung führt<br />
zu einem Angebot, das bürgernah, zugänglich <strong>und</strong> bedarfsgerecht ist.<br />
Zur Frage, wie die Menschen mit Informationen über Angebote der Ges<strong>und</strong>-<br />
heitsbildung zu erreichen sind, gibt der folgende Abschnitt Auskunft: die Mehr-<br />
heit (38,4%) der Bevölkerung ist über die Regional- <strong>und</strong> Tagespresse zu errei-<br />
107
chen. Zu 11,6% wird angegeben, dass eine Ansprache der Bevölkerung über<br />
öffentliche Einrichtungen erfolgen sollte, hierbei werden vor allem Schulen,<br />
Krankenhäuser <strong>und</strong> das Rathaus genannt. Ein wichtiger Informationsweg wird<br />
außerdem über die Krankenkassen gesehen, fast 10% der Menschen möchten<br />
über Broschüren <strong>und</strong> Prospekte der Krankenkassen angesprochen werden.<br />
Weitere wichtige Informationsmedien sind in diesem Zusammenhang das Fern-<br />
sehen (Regionalfernsehen), das Radio sowie (persönliche) Postwurfsendungen.<br />
Auch der Weg über Arztpraxen wird von 6,5% der Befragten als effektiv ange-<br />
sehen (vgl.: Kap. 4.6.8).<br />
4.7.3 Themenbereiche der <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> - Interessenschwer-<br />
punkte<br />
Für die gesamte B<strong>und</strong>esrepublik liegen differenzierte Daten nach Themenbe-<br />
reichen der <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> ausschließlich von den Volkshochschulen vor.<br />
Im Folgenden werden das Weiterbildungsvolumen in Form von Unterrichtsstun-<br />
den sowie die Teilnahmefälle aus Statistiken der Volkshochschulen dargestellt<br />
<strong>und</strong> erläutert. Mit einem Anteil von 50% der Unterrichtsst<strong>und</strong>en <strong>und</strong> 56% der<br />
Teilnahmefälle ist der Bereich „Gymnastik, Bewegung“, gefolgt vom Bereich<br />
„Autogenes Training/Yoga“ mit 30% der Unterrichtsst<strong>und</strong>en <strong>und</strong> 26% der Teil-<br />
nahmefälle, der größte Bereich (B<strong>und</strong>esministerium für Bildung, Wissenschaft,<br />
Forschung <strong>und</strong> Technik 1997, S.60).<br />
Im Bereich „Ges<strong>und</strong>heitsrelevante Weiterbildung 9 “ entfielen 1991 ca. 15% des<br />
Weiterbildungsvolumens <strong>und</strong> 18% aller Teilnahmefälle der Allgemeinen Weiter-<br />
bildung auf die ges<strong>und</strong>heitsrelevanten Themenfelder „Umweltschutz/Ökologie“,<br />
„Kenntnisse für Sportarten“ <strong>und</strong> „Kindererziehung/Hilfe für Schule“ (ebenda).<br />
Mit 85% sind ges<strong>und</strong>heitsbildende Veranstaltungen, die auf das ges<strong>und</strong>heits-<br />
bezogene Handeln des Einzelnen bzw. auf die persönliche Ges<strong>und</strong>heit bezo-<br />
9 Als ges<strong>und</strong>heitsrelevant werden hier Angebote bezeichnet, die zwar nicht vordergründig unter<br />
den Oberbegriffen „Ges<strong>und</strong>heit“ bzw. „<strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>“ laufen, dennoch aber nach dem<br />
heutigen Verständnis von Ges<strong>und</strong>heit durchaus Determinanten von Ges<strong>und</strong>heit darstellen bzw.<br />
potentiell gute Anknüpfungspunkte für das Aufgreifen wichtiger Ges<strong>und</strong>heitsfragen bieten.<br />
108
gen sind im Bereich der Volkshochschulen der dominierende Teil. Im Gegen-<br />
satz hierzu erreichen Veranstaltungen, die eher krankheitsbezogene Themen<br />
aufgreifen (z.B. Fragen <strong>zur</strong> Abhängigkeit oder Psychosomatik, von Erkrankun-<br />
gen <strong>und</strong> Heilmethoden oder von Ges<strong>und</strong>heits- bzw. Krankheitspflege) insge-<br />
samt nur einen Anteil von 8% aller Unterrichtsst<strong>und</strong>en <strong>und</strong> 5,5% der Teilnahme-<br />
fälle. Der Anteil von Angeboten <strong>zur</strong> Ges<strong>und</strong>heitspolitik bzw. Ges<strong>und</strong>heitswesen<br />
ist verschwindend gering. Laut der statistischen Erhebungen des Deutschen<br />
Instituts für Erwachsenenbildung (DIE) (1994) zeigt der Bereich der Ges<strong>und</strong>-<br />
heitsbildung in den Volkshochschulen eine steigende Tendenz. Von 1992 auf<br />
1993 stieg das Weiterbildungsvolumen gemessen an Unterrichtst<strong>und</strong>en bun-<br />
desweit um 6%, in den neuen B<strong>und</strong>esländern um 40% (ebenda).<br />
Die Differenzierung der Themenfelder von <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> im Rahmen der<br />
in diesem Kontext durchgeführten regionalen Bürgerbefragung hat eine ähnli-<br />
che Struktur. Im Folgenden sei diese noch einmal aufgezeigt <strong>und</strong> mit den wich-<br />
tigsten Ergebnissen der Untersuchung diskutiert (vgl. Kap. 4.6.2; Kap. 4.6.3):<br />
Bewegung, Fitness (z.B. Aerobic, Aquajogging, Tanz, Nordic Walking)<br />
Kurse zu Bewegung <strong>und</strong> Fitness stehen sowohl bei den Lübbener Frauen als<br />
auch den Luckauer Frauen an sehr hoher Stelle. Vor allem zeigt sich dies bei<br />
den 18-50-Jährigen. Unter einer zielgruppenspezifischen Herangehensweise<br />
wäre auch ein entsprechendes Angebot für über 50-jährige Frauen denkbar.<br />
Bei den Männern ist laut der Befragung der Bedarf an Bewegungs- <strong>und</strong> Fit-<br />
nesskursen vor allem bei den 18-24-jährigen Lübbenern <strong>und</strong> Luckauern wei-<br />
testgehend niedrig. Wie bereits vermutet, könnte dies in der, zumeist vorhande-<br />
nen, sportlichen Betätigung in dieser Altersgruppe in ihrer Freizeit begründet<br />
sein. Bei den Männern ist ein entsprechendes Angebot für die Altersgruppe der<br />
31-40-Jährigen (zumindest für den Altkreis Lübben) sowie für die über 61-<br />
Jährigen erwünscht.<br />
109
Insgesamt interessieren sich jedoch in beiden Altkreisen durchgängig mehr<br />
Frauen als Männer für dieses Themenfeld.<br />
Entspannung, Körpererfahrung (z.B. Stressbewältigung, Yoga, Autogenes<br />
Training, Progressive Muskelentspannung)<br />
Für den Bereich Entspannung <strong>und</strong> Körpererfahrung interessieren sich erwar-<br />
tungsgemäß ebenfalls mehr Frauen als Männer, <strong>und</strong> zwar mit einem Anteil von<br />
über 50% der befragten Frauen, der Anteil der Luckauer Frauen ist hier beson-<br />
ders hoch. Unter den Männern befinden sich dennoch ca. 40% der unter 50-<br />
Jährigen, die ein derartiges Angebot in Anspruch nehmen würden. Bei den<br />
Männern des Altkreises Luckau ist der Anteil mit über 50% etwas höher.<br />
Ernährung, Kochen (z.B. ges<strong>und</strong>e Ernährung, Gewichtsreduktion, Heilfas-<br />
ten, Ernährung bei spezifischen Krankheiten)<br />
Bei den Lübbener Bürgern stoßen Kurse bei ca. 50% der Frauen <strong>und</strong> Männer<br />
auf Interesse. Bei den Luckauer Bürgern ist die Verteilung unter den Männern<br />
nahezu gleich, bei den Frauen jedoch sind die Luckauerinnen durchaus interes-<br />
sierter an diesem Themenbereich, fast drei Viertel der Befragten bek<strong>und</strong>en hier<br />
ihr Interesse.<br />
Erkrankungen <strong>und</strong> Heilmethoden (z.B. Homöopathie, Naturheilk<strong>und</strong>e, me-<br />
dizinische Einzelthemen, chronische Krankheiten)<br />
Auf Gr<strong>und</strong> der steigenden Relevanz der Thematik in höheren Lebensphasen,<br />
lässt sich hier auch ein steigendes Interesse aus den Angaben innerhalb der<br />
Befragung ablesen, zumindest im Altkreis Lübben. Das heißt, Kurse zu Erkran-<br />
kungen <strong>und</strong> Heilmethoden machen ab einem Alter von 50 Jahren größeren<br />
Sinn als bei der jüngeren Altersgruppe. Bei den Luckauer Bürgern liegt das<br />
größte Interesse innerhalb der mittleren Altersstufen, ab einem Alter von 61<br />
Jahren sinkt die Bereitschaft <strong>zur</strong> Teilnahme an derartigen Angeboten. Unter-<br />
schiede zeichnen sich auch in der jüngsten Altersklasse ab. Hier herrscht bei<br />
den Luckauer Frauen <strong>und</strong> Männern ein größeres Interesse als bei den gleichalt-<br />
rigen Bürgern aus Lübben vor.<br />
110
Psychische Stabilität <strong>und</strong> soziale Kompetenz (z.B. Selbsterfahrung, Le-<br />
benssituationen)<br />
Kurse <strong>zur</strong> psychischen Stabilität <strong>und</strong> sozialen Kompetenz sind für Frauen <strong>und</strong><br />
Männer aus dem Altkreis Luckau attraktiver als für die Lübbener Bürger, wobei<br />
die höchsten Werte von Frauen zwischen 18 <strong>und</strong> 60 Jahren angegeben wer-<br />
den. Männer interessieren sich laut den Untersuchungsergebnissen weniger für<br />
diesen Bereich.<br />
Ges<strong>und</strong>heitspolitik, Ges<strong>und</strong>heitswesen (z.B. Ges<strong>und</strong>heitswesen, Ges<strong>und</strong>-<br />
heitsversorgungssystem, Patientenaufklärung)<br />
In beiden Altkreisen ist ein weniger vorhandenes Interesse bei den 18-24-<br />
Jährigen ablesbar. Mit zunehmenden Lebensjahren steigt jedoch die Relevanz<br />
der Thematik unter den Befragten. Die höchsten Werte erreichen die über 61-<br />
jährigen Lübbener <strong>und</strong> bei den Luckauern die Menschen in der mittleren Le-<br />
bensphase. Zwischen den Geschlechtern herrscht hier weitestgehend Homo-<br />
genität innerhalb der Angaben.<br />
Gesellschaft <strong>und</strong> Umwelt (z.B. Klima/Wetter, Kleidung <strong>und</strong> Wohnen, Che-<br />
mie im Alltag, Arbeit <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit, Umweltbelastung)<br />
Bei den Lübbenern ist das Interesse für Themen zu Gesellschaft <strong>und</strong> Umwelt<br />
ziemlich gleichmäßig unter allen Befragten verteilt, <strong>und</strong> zwar zu durchschnittlich<br />
20-30%. Einen Wert von 50% wird lediglich von den 41-50-jährigen Männern<br />
erreicht.<br />
Zwischen den Frauen <strong>und</strong> Männern aus dem Altkreis Luckau herrschen größe-<br />
re Unterschiede. Hier interessiert sich nahezu die Hälfte aller Frauen <strong>und</strong>, im<br />
Vergleich dazu, nur jeder 5. Mann für das Themenfeld. Zwischen den Men-<br />
schen der verschiedenen Alterklassen aus Luckau herrscht - mit Ausnahme der<br />
über 61 <strong>und</strong> der 31-40 Jahre alten Frauen (zu ca. einem Drittel) - ein ähnlich<br />
hoher Wert (über 50%) für ein vorhandenes Interesse an dieser Thematik.<br />
111
Sucht (z.B. illegale Drogen, Alkohol, Nikotin, Medikamente, Essen)<br />
Von erhöhter Bedeutung ist das Thema Sucht vor allem in den jüngeren Alters-<br />
stufen, in beiden Altkreisen <strong>und</strong> beiden Geschlechtern. Unter den Luckauer<br />
Bürgern ist das Interesse mit zunehmendem Alter jedoch gegenüber den Lüb-<br />
bener Bürgern gleichbleibend hoch. Ab einem Alter von 51 Jahren bei den Lüb-<br />
bener Bürgern <strong>und</strong> ab 61 Jahren bei den Luckauer Bürgern verliert die Thema-<br />
tik ihre Bedeutung. Unterschiede gibt es auch zwischen den Luckauer Frauen<br />
<strong>und</strong> Männern, hier finden mehr Männer als Frauen das Thema Sucht für sich<br />
von Bedeutung.<br />
Ges<strong>und</strong>heitspflege (z.B. Körperpflege, Naturkosmetik, Säuglingspflege,<br />
Unfallverhütung, Erste Hilfe, private häusliche Krankenpflege)<br />
Das Thema Ges<strong>und</strong>heitspflege ist bei den Frauen, sowohl in der jüngeren Al-<br />
tersstufe als auch bei den Älteren erwünscht, in der mittleren Lebensphase un-<br />
ter den Lübbener Frauen jedoch weniger präsent. Bei den Luckauer Frauen ist<br />
gerade in dieser Altersstufe das Interesse am stärksten vertreten. Bei den Män-<br />
nern aus beiden Altkreisen ist der Wunsch nach Angeboten <strong>zur</strong> Ges<strong>und</strong>heits-<br />
pflege, gemessen an den Frauen, weitaus weniger vorhanden. Das relativ hohe<br />
Interesse bei den 18-24-Jährigen lässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit mit<br />
den, im Zusammenhang mit dem Erwerb des Fahrzeugführerscheins stehen-<br />
den, Kursen <strong>zur</strong> Ersten Hilfe erklären.<br />
Am Ende des Fragebogens wird den Befragten die Möglichkeit eingeräumt,<br />
sonstige Hinweise <strong>und</strong> Bemerkungen anzubringen. Dieser Rahmen wird vor<br />
allem genutzt, um spezielle Kurswünsche zu formulieren, aber auch um wieder-<br />
holt Kriterien der Inanspruchnahme bzw. Nichtteilnahme an Kursen der Ge-<br />
s<strong>und</strong>heitsbildung aus ihrer Sicht anzubringen. Auf eine Aufzählung der hier ge-<br />
machten Anmerkungen wird an dieser Stelle verzichtet. Die Rohliste der Be-<br />
merkungen <strong>und</strong> Hinweise ist im Anhang zu finden.<br />
112
5 Perspektiven <strong>und</strong> Entwicklungsmöglichkeiten<br />
Mit dem Fokus zukünftig noch mehr Menschen, ges<strong>und</strong>heitlich belastete bzw.<br />
gefährdete, bei der Entwicklung ges<strong>und</strong>heitsförderlicher Lebensweisen <strong>und</strong> Le-<br />
bensbedingungen zu unterstützen, rücken folgende allgemeine Handlungsemp-<br />
fehlungen für die Arbeit im “Regionalen Netzwerk Ges<strong>und</strong>heitsförderung“ in den<br />
Vordergr<strong>und</strong> (übernommen aus bzw. in Anlehnung an B<strong>und</strong>esministerium für<br />
Bildung, Wissenschaft, Forschung <strong>und</strong> Technologie 1997, S.112ff.):<br />
die Suche nach Inhalten <strong>und</strong> Methoden einer <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> für Men-<br />
schen in verschiedenen Lebenssituationen, z.B. in sozialer Benachteiligung<br />
oder in besonderer Belastungssituation, Berücksichtigung der unterschied-<br />
lichen individuellen Bildungsgewohnheiten <strong>und</strong> bezogen auf die unter-<br />
schiedlichen Bedürfnisse von Frauen <strong>und</strong> Männern;<br />
Entwicklung, Durchführung bzw. Unterstützung insbesondere solcher For-<br />
men ges<strong>und</strong>heitsbezogener Arbeit, die den Kontakt zu bzw. die Zusam-<br />
menarbeit mit bisher schwer erreichbaren Bevölkerungsteilen verbessern<br />
helfen, dabei Suche nach zusätzlichen Kooperationsmöglichkeiten mit Ein-<br />
richtungen bzw. Fachvertretern, die guten <strong>und</strong>/oder alltäglichen Kontakt mit<br />
den Zielgruppen haben sowie möglichst auch direkt mit den Zielpersonen;<br />
Schaffung förderlicher Rahmenbedingungen für eine wirksame Ges<strong>und</strong>-<br />
heitsbildungsarbeit, insbesondere für das ges<strong>und</strong>heitsrelevante Lernen vor<br />
Ort / in der Region;<br />
Schaffung eines geeigneten Verhältnisses von <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> in der<br />
Region bzw. im Lebensumfeld der Menschen, Integration in bestehende<br />
Betreuungs- <strong>und</strong> Versorgungsstrukturen sowie in die Arbeitswelt;<br />
Identifizierung <strong>und</strong> Schließung von Angebotslücken;<br />
aktives Aufgreifen aktueller ges<strong>und</strong>heitsbezogener Probleme oder The-<br />
menschwerpunkte in der Gemeinde/Region;<br />
Möglichkeit der gegenseitigen Impulsgabe <strong>und</strong> des systematischen Erfah-<br />
rungsaustausches innerhalb der Netzwerkakteure, aber auch anderer An-<br />
113
ieter von <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> <strong>und</strong> sonstiger ges<strong>und</strong>heitsrelevanter Initiati-<br />
ven vor Ort;<br />
Integration ges<strong>und</strong>heitsförderlicher Elemente in die Arbeit der Netzwerkan-<br />
gehörigen;<br />
Schaffung von Möglichkeiten „aufsuchender <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>sarbeit“,<br />
d.h. auf die Menschen in ihren alltäglichen Lebensbezügen (z.B. im Stadt-<br />
teil, am Arbeitsplatz, in der Bildungseinrichtung, in Begegnungsstätten etc.)<br />
zuzugehen;<br />
Aufbau eines Systems von <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>sangeboten für alle Le-<br />
bensphasen <strong>und</strong> -situationen (Kindergarten, Schule, Aus- <strong>und</strong> Weiterbil-<br />
dung, beruflicher Tätigkeit sowie im Rahmen von kurativen bzw. therapeuti-<br />
schen, rehabilitativen <strong>und</strong> Kurmaßnahmen;<br />
aktive Suche nach gemeinsamen Möglichkeiten einer weit reichenden, res-<br />
sort- bzw. fachbereichs- <strong>und</strong> träger- bzw. einrichtungsübergreifend abge-<br />
stimmten Weiterentwicklung für eine flächendeckende bzw. wohnortnahe<br />
Versorgung mit angemessenen <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>sangeboten, auch<br />
durch eine punktuelle Einbeziehung ges<strong>und</strong>heitsrelevanter, jedoch nicht<br />
primär an <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> beteiligter, Institutionen;<br />
Förderung eines aktiven <strong>und</strong> offenen Umgangs mit bestehenden oder ver-<br />
meintlichen Konkurrenten;<br />
Herausarbeitung <strong>und</strong> Umsetzung der eigenen Möglichkeiten, ges<strong>und</strong>heits-<br />
bezogene Entwicklungsziele für die Region sowie für bestimmte Zielgrup-<br />
pen zu erstellen – in Zusammenarbeit mit kommunalen Einrichtungen, Be-<br />
trieben, privaten Einrichtungen <strong>und</strong> anderen Bildungsanbietern;<br />
systematische <strong>und</strong> regelmäßige Dokumentation der eigenen Ges<strong>und</strong>heits-<br />
bildungsarbeit;<br />
regelmäßige Evaluation der <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>saktivitäten <strong>und</strong> sonstiger<br />
Maßnahmen durch die an der Planung <strong>und</strong> Durchführung Beteiligten;<br />
Schaffung bzw. Weiterentwicklung von Infrastrukturen <strong>zur</strong> systematischen<br />
Förderung <strong>und</strong> Unterstützung ihrer Mitgliedseinrichtungen, die Ges<strong>und</strong>-<br />
heitsbildung bzw. ges<strong>und</strong>heitsrelevante Weiterbildung anbieten, sowie der<br />
Selbsthilfearbeit insgesamt;<br />
114
Entwicklung von neuen <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>sstrukturen bzw. –angeboten in<br />
Kooperation mit (anderen) Einrichtungen des Bildungs-, Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong><br />
Sozialwesens sowie mit Selbsthilfegruppen, insbesondere Entwicklung von<br />
Strategien <strong>und</strong> Formen „aufsuchender“ <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>;<br />
Entwicklung von Formen <strong>und</strong> Strategien für die Integration von ges<strong>und</strong>-<br />
heitsbezogenen Inhalten <strong>und</strong> ges<strong>und</strong>heitsförderlichen Methoden in nicht-<br />
ges<strong>und</strong>heitsbezogene Weiterbildung <strong>und</strong> Ausbildung;<br />
qualifizierte Koordinierung innerhalb der einzelnen Träger bzw. Einrichtun-<br />
gen, insbesondere inhaltliche <strong>und</strong> zeitliche Abstimmung der Ges<strong>und</strong>heits-<br />
bildungsaktivitäten sowie der sonstigen ges<strong>und</strong>heitsrelevanten Weiterbil-<br />
dungsangebote sowie Ges<strong>und</strong>heitsförderungsmaßnahmen, d.h. u.a. Schaf-<br />
fung klarer Zuständigkeiten für diesen Bereich <strong>und</strong> strukturelle Verankerung<br />
der anfallenden Koordinierungs- <strong>und</strong> Entwicklungsarbeit;<br />
Ausnutzung aller Möglichkeiten, zusätzliche materielle oder personelle<br />
Ressourcen für besondere Ges<strong>und</strong>heitsförderungs- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsbil-<br />
dungsaktivitäten zu gewinnen, z.B. Suche nach Sponsoren, Gründung von<br />
Fördervereinen, im Falle der gemeinsamen Zielsetzung trägerübergreifen-<br />
de gemeinsame Erschließung (öffentlicher) Förderungen etc.;<br />
Nutzung aller Ressourcen für eine ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> umweltverträgliche<br />
Gestaltung sowie eine entsprechende materielle Ausstattung der Bildungs-<br />
stätten bzw. –einrichtungen;<br />
aktive Beteiligung an einrichtungsinternen Maßnahmen <strong>zur</strong> betrieblichen<br />
Ges<strong>und</strong>heitsförderung;<br />
Einführung von trägerübergreifenden Qualitätszirkeln.<br />
Als erste logische Entwicklungsschritte innerhalb der Vernetzung werden von<br />
der Allianz für Ges<strong>und</strong>heitsförderung zuerst die Gestaltung der Kommunikati-<br />
ons- <strong>und</strong> Organisationsprozesse, d.h. die Organisation des eigenen<br />
Selbstverständigungs- <strong>und</strong> Abstimmungsprozesses angegeben <strong>und</strong> erst in der<br />
zweiten Stufe geht es um die tatsächliche Umsetzung der im Konsens festge-<br />
legten prioritären Maßnahmen/Aktionen/Programme in den Alltag der Bevölke-<br />
rung (Prümel-Philippsen 2001).<br />
115
Bezogen auf die konkreten Ergebnisse der regionalen Bürgerbefragung ist an<br />
erster Stelle eine Intensivierung der Information der Bevölkerung über Angebo-<br />
te/Maßnahmen/Programme der <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> anzustreben. Verb<strong>und</strong>en<br />
mit diesen Bemühungen lässt sich zum einen eine Aufklärungssituation zum<br />
Thema <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> herstellen/fördern <strong>und</strong> zum anderen das ges<strong>und</strong>-<br />
heitliche Bewusstsein der Menschen sensibilisieren. Wichtig ist es zudem, die<br />
Angebote entweder gestaffelt nach sozialer Schicht, jedoch ohne Stigmatisie-<br />
rung derselben, <strong>und</strong> den damit verb<strong>und</strong>enen finanziellen Möglichkeiten des<br />
Einzelnen anzupassen oder sie generell kostenfrei anzubieten.<br />
Sinnvoller Weise wäre die Geschäftstellenfunktion von einem neutralen Akteur,<br />
der nicht in Wettbewerb zu anderen Einrichtungen steht, anzustreben. Bei-<br />
spielsweise könnte diese Aufgabe von der untersten Ges<strong>und</strong>heitsbehörde des<br />
Staates, dem Öffentlichen Ges<strong>und</strong>heitsdienst, übernommen werden. Zu den<br />
Aufgaben des ÖGD gehört es, ausdrücklich beschrieben im Gesetz über den<br />
Öffentlichen Ges<strong>und</strong>heitsdienst im Land Brandenburg §1 Abs. 4, räumliche <strong>und</strong><br />
funktionale Verb<strong>und</strong>e ges<strong>und</strong>heitlicher Dienstleistungen <strong>und</strong> Einrichtungen auf<br />
regionaler Ebene zu unterstützen (vgl.: Kap. 2.3). In diesem Zusammenhang<br />
werden von der Autorin noch große Potenziale <strong>zur</strong> Einbringung des ÖGD in die<br />
Netzwerkaktivitäten vermutet. Als eine der prioritären nächsten Aufgaben ist<br />
also, die Involvierung dieser Behörde in die Netzwerkprozesse zu sehen. Mit<br />
der Gewinnung des ÖGD als Netzwerkpartner ist auch der Landkreis vertreten.<br />
Deutlich hat die Auswertung der Befragung auch herausgestellt, dass gerade<br />
unter der jüngeren Bevölkerung (18-30-Jährige) das Wissen über Ges<strong>und</strong>heits-<br />
bildung sehr gering ist. Wichtig wäre hier eine systematische Aufklärungsarbeit,<br />
die den Menschen der Region die Methoden der <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> näher<br />
bringt <strong>und</strong> aufzeigt, was <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> für jeden Einzelnen zu leisten<br />
vermag. Da innerhalb der Befragung ebenfalls herausgestellt werden konnte,<br />
dass die männliche Bevölkerung der Altkreise Lübben <strong>und</strong> Luckau eine unter-<br />
repräsentierte Gruppe ist, wäre eine gezielte Ansprache der Männer, um sie <strong>zur</strong><br />
116
Teilnahme an ges<strong>und</strong>heitsrelevanten Kursen, Maßnahmen <strong>und</strong> Programmen zu<br />
bewegen, erforderlich.<br />
Um für die Öffentlichkeit ansprechbar zu sein, ist es wichtig als Netzwerk eine<br />
Kontaktadresse zu besitzen. Die Einrichtung eines sog. „Kooperationsbüros für<br />
Ges<strong>und</strong>heit“ wäre hier ein sinnvoller Schritt (vgl.: Kap. 2.6.7).<br />
Trojan <strong>und</strong> Legewie (2001) betonen die Bedeutung einer kontinuierlichen Eva-<br />
luation der Struktur-, Prozess- <strong>und</strong> Ergebnisqualität, die noch in den wenigsten<br />
Netzwerken realisiert ist (vgl.: Kap. 2.6.6). Für das „Regionale Netzwerk Ge-<br />
s<strong>und</strong>heitsförderung“, das sich als Zielstellung die bedarfsgerechte, zugängliche<br />
<strong>und</strong> bürgernahe Gestaltung der <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>sangebote gewählt hat, ist<br />
ein von Anfang an impliziertes Qualitätsmanagementsystem, nicht nur der An-<br />
gebote selbst, sondern auch der Netzwerkarbeit, von elementarer Bedeutung.<br />
Hier werden Chancen <strong>und</strong> Möglichkeiten <strong>zur</strong> Verbesserung der Effektivität <strong>und</strong><br />
Effizienz herausgestellt <strong>und</strong> für den Netzwerkprozess nutzbar gemacht. Die Er-<br />
stellung eines auf die Strukturen, Prozesse <strong>und</strong> Zielsetzungen des Netzwerks<br />
angepassten Systems von Wirksamkeitsindikatoren ist bereits in der Anfangs-<br />
phase zu realisieren (vgl. Anhang: Fragebogen <strong>zur</strong> Evaluation der kooperativen<br />
Arbeit im Netzwerk).<br />
Der Bedarf an Koordinierungsarbeit bezüglich der Angebote, Programme <strong>und</strong><br />
Maßnahmen der <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> wird an Hand der Auswertung der Frage-<br />
bögen ersichtlich, indem man die Interessen der befragten Menschen dem An-<br />
gebot an Kursen <strong>zur</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> gegenüberstellt. Dieser Soll-/Ist-<br />
Vergleich <strong>und</strong> auf dieser Basis die Anpassung des Angebotes an Kursen <strong>zur</strong><br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> ist eine wichtige Aufgabe der Netzwerkmitglieder, um stra-<br />
tegisch sinn- <strong>und</strong> planvoll innerhalb der zukünftigen Netzwerktätigkeit vorzuge-<br />
hen <strong>und</strong> das Ziel der Schaffung eines bedarfsgerechten, zugänglichen <strong>und</strong> bür-<br />
gernahen <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>sangebotes zu verwirklichen.<br />
117
6 Abbildungsverzeichnis<br />
Abb. 1: „Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Allgemeine Weiterbildung“ – Strukturelle Veran-<br />
kerung der <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> in Deutschland - (B<strong>und</strong>esministe-<br />
rium für Bildung, Wissenschaft, Forschung <strong>und</strong> Technologie 1997,<br />
S. 56).<br />
Abb. 2: <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> von Erwachsenen durch Einrichtungen des<br />
Bildungs-, Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Sozialwesens – ein Beitrag <strong>zur</strong> Ge-<br />
s<strong>und</strong>heitsförderung in Deutschland (B<strong>und</strong>esministerium für Bil-<br />
dung, Wissenschaft, Forschung <strong>und</strong> Technologie 1997, S. 57).<br />
Abb. 3: Horizontale <strong>und</strong> vertikale Vernetzung (nach Trojan 1999)<br />
118
7 Tabellenverzeichnis<br />
Tab. 1: Die Beteiligung an der Befragung, aufgeschlüsselt nach Ge-<br />
schlecht <strong>und</strong> Altersklasse<br />
Tab. 2: Beteiligung der Lübbener, aufgeschlüsselt nach Geschlecht <strong>und</strong><br />
Alter<br />
Tab. 3: Beteiligung der Luckauer, aufgeschlüsselt nach Geschlecht <strong>und</strong><br />
Alter<br />
Tab. 4: Interesse an Angeboten zu Bewegung <strong>und</strong> Fitness (Altkreis Lüb-<br />
ben), aufgeschlüsselt nach Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Tab. 5: Interesse an Angeboten zu Entspannung <strong>und</strong> Körpererfahrung<br />
(Altkreis Lübben), aufgeschlüsselt nach Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Tab. 6: Interesse an Angeboten zu Ernährung <strong>und</strong> Kochen (Altkreis Lüb-<br />
ben), aufgeschlüsselt nach Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Tab. 7: Interesse an Angeboten zu Erkrankungen <strong>und</strong> Heilmethoden (Alt-<br />
kreis Lübben), aufgeschlüsselt nach Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Tab. 8: Interesse an Angeboten zu Psychische Stabilität <strong>und</strong> soziale<br />
Kompetenz (Altkreis Lübben), aufgeschlüsselt nach Geschlecht<br />
<strong>und</strong> Alter<br />
Tab. 9: Interesse an Angeboten zu Ges<strong>und</strong>heitspolitik <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heits-<br />
wesen (Altkreis Lübben), aufgeschlüsselt nach Geschlecht <strong>und</strong> Al-<br />
ter<br />
Tab. 10: Interesse an Angeboten zu Gesellschaft <strong>und</strong> Umwelt (Altkreis<br />
Lübben), aufgeschlüsselt nach Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Tab. 11: Interesse an Angeboten zu Sucht (Altkreis Lübben), aufgeschlüs-<br />
selt nach Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Tab. 12: Interesse an Angeboten zu Ges<strong>und</strong>heitspflege (Altkreis Lübben),<br />
aufgeschlüsselt nach Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Tab. 13: Interesse an Angeboten zu Bewegung <strong>und</strong> Fitness (Altkreis Lu-<br />
ckau), aufgeschlüsselt nach Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
119
Tab. 14: Interesse an Angeboten zu Entspannung <strong>und</strong> Körpererfahrung<br />
(Altkreis Luckau), aufgeschlüsselt nach Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Tab. 15: Interesse an Angeboten zu Ernährung <strong>und</strong> Kochen (Altkreis Lu-<br />
ckau), aufgeschlüsselt nach Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Tab. 16: Interesse an Angeboten zu Erkrankungen <strong>und</strong> Heilmethoden (Alt-<br />
kreis Luckau), aufgeschlüsselt nach Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Tab. 17: Interesse an Angeboten zu Psychische Stabilität <strong>und</strong> soziale<br />
Kompetenz (Altkreis Luckau), aufgeschlüsselt nach Geschlecht<br />
<strong>und</strong> Alter<br />
Tab. 18: Interesse an Angeboten zu Ges<strong>und</strong>heitspolitik <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heits-<br />
wesen (Altkreis Luckau), aufgeschlüsselt nach Geschlecht <strong>und</strong> Al-<br />
ter<br />
Tab. 19: Interesse an Angeboten zu Gesellschaft <strong>und</strong> Umwelt (Altkreis Lu-<br />
ckau), aufgeschlüsselt nach Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Tab. 20: Interesse an Angeboten zu Sucht (Altkreis Luckau), aufgeschlüs-<br />
selt nach Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Tab. 21: Interesse an Angeboten zu Ges<strong>und</strong>heitspflege (Altkreis Luckau),<br />
aufgeschlüsselt nach Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
Tab. 22: Wünsche der Befragten <strong>zur</strong> Organisation von Kursen <strong>zur</strong> Ges<strong>und</strong>-<br />
heitsbildung<br />
Tab. 23: Zugangswege <strong>zur</strong> Erreichung der Bevölkerung mit Informationen<br />
über <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>sangebote<br />
120
8 Abkürzungsverzeichnis<br />
Abb. Abbildung<br />
ASB Arbeiter-Samariter-B<strong>und</strong><br />
AWO Arbeiterwohlfahrt<br />
Barmer EK Barmer Ersatzkasse<br />
BGF betriebliche Ges<strong>und</strong>heitsförderung<br />
BKK BV B<strong>und</strong>esverband der Betriebskrankenkassen<br />
BLK B<strong>und</strong>-Länder-Kommission für Bildungsplanung <strong>und</strong><br />
Forschungsförderung<br />
BMBF B<strong>und</strong>esministerium für Bildung, Wissenschaft, For-<br />
d. h. das heißt<br />
schung <strong>und</strong> Technologie<br />
DAK Deutsche Angestellten-Krankenkasse<br />
DNBGF Deutsches Netzwerk für betriebliche Ges<strong>und</strong>heitsför-<br />
derung<br />
ENWHP European Network for Workplace Health Promotion<br />
(dt.: europäisches Netzwerk für betriebliche Ges<strong>und</strong>-<br />
heitsförderung)<br />
etc. et cetera<br />
e.V. eingetragener Verein<br />
ggf. gegebenenfalls<br />
gGmbH gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haf-<br />
tung<br />
GKV Gesetzliche Krankenversicherung<br />
HVBG Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossen-<br />
schaften<br />
i. S. im Sinne<br />
IGA Initiative Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Arbeit<br />
INQA Initiative “Neue Qualität der Arbeit”<br />
Kap. Kapitel<br />
121
KV kassenärztliche Vereinigung<br />
LDS Landkreis Dahme-Spreewald<br />
m. E. meines Erachtens<br />
N Gr<strong>und</strong>gesamtheit der befragten Bevölkerung<br />
n Stichprobenanzahl<br />
o.g. oben genannte<br />
ÖGD Öffentlicher Ges<strong>und</strong>heitsdienst<br />
OPUS Offenes Partizipationsnetz <strong>und</strong> Schulges<strong>und</strong>heit<br />
Pkt. Punkt<br />
S. Seite<br />
sog. so genannte<br />
u.a. unter anderem<br />
u.a.m. <strong>und</strong> andere mehr<br />
u.ä. <strong>und</strong> ähnliches<br />
usw. <strong>und</strong> so weiter<br />
vgl. vergleiche<br />
VHS/ KVHS Volkshochschule/ Kreisvolkshochschule<br />
WHO World Health Organization<br />
z.B. zum Beispiel<br />
z.T. zum Teil<br />
(dt.: Weltges<strong>und</strong>heitsorganisation)<br />
122
9 Literatur<br />
Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Krankenkassen (Hrsg.):<br />
Gemeinsame <strong>und</strong> einheitliche Handlungsfelder <strong>und</strong> Kriterien der Spitzen-<br />
verbände der Krankenkassen <strong>zur</strong> Umsetzung von § 20 Abs. 1 <strong>und</strong> 2 SGB V<br />
vom 21. Juni 2000 in der Fassung vom 12. September 2003. Unter:<br />
http://www.vdak.de/download/leitfaden_20_sgbv_12_09_2003.pdf, Zugriff:<br />
14.02.2005.<br />
Arbeitskreis Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Hochschulen (Hrsg.): Historische Ent-<br />
wicklung <strong>und</strong> gesetzliche Gr<strong>und</strong>lagen der Ges<strong>und</strong>heitsförderung. Unter:<br />
http://www.sgw.hs-<br />
magde-<br />
burg.de/initiativen/akges<strong>und</strong>hs/HTML/B_Basiswissen_GF/B1_Historische_E<br />
ntwicklung_<strong>und</strong>_gesetzliche_Gr<strong>und</strong>lagen.html, Zugriff: 24.06.2005.<br />
Arbeitskreis Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Hochschulen: Glossar. Unter:<br />
http://www.sgw.hs-<br />
magde-<br />
burg.de/initiativen/akges<strong>und</strong>hs/HTML/B_Basiswissen_GF/B8_Glossar1.html<br />
, Zugriff: 30.06.2005.<br />
Baumgarten, K. (o.J): Skript zum Seminar: Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen der Ge-<br />
s<strong>und</strong>heitsbildung I. Hochschule Magdeburg-Stendal (FH). unveröffentlicht.<br />
BKK B<strong>und</strong>esverband (Hrsg.): European Network for Workplace Health Promo-<br />
tion (ENWHP). Unter:<br />
http://www.bkk.de/bkk/powerslave,id,413,nodeid,413.html?id=459, Zugriff:<br />
22.06.2005.<br />
Bornhoff, J. et al. (2003): Kooperation <strong>und</strong> Vernetzung in der kommunalen<br />
Ges<strong>und</strong>heitsförderung. Studientext: Weiterbildung Gemeindebezogene Ge-<br />
s<strong>und</strong>heitsförderung. Hochschule Magdeburg-Stendal (FH). unveröffentlicht.<br />
Brösskamp-Stone, U.: Die WHO Strategie „Landesweite Aktionspläne für Ge-<br />
s<strong>und</strong>heitsförderung“. In: Ges<strong>und</strong>heitsAkademie e.V. (Hrsg.) (2001): Ge-<br />
123
s<strong>und</strong>heit gemeinsam gestalten – Allianz für Ges<strong>und</strong>heitsförderung. 1. Aufla-<br />
ge. Frankfurt/Main: Mabuse-Verlag. S.17-22.<br />
B<strong>und</strong>esministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung <strong>und</strong> Technolo-<br />
gie (BMBF) (Hrsg.) (1997): Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> allgemeine Weiterbildung. Bei-<br />
trag zu einer neuen Perspektive der Ges<strong>und</strong>heitsförderung. Hof/Saale: Mint-<br />
zel-Druck.<br />
B<strong>und</strong>esministerium für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziale Sicherung: SGB V. Gesetz-<br />
liche Krankenversicherung. Unter:<br />
http://b<strong>und</strong>esrecht.juris.de/b<strong>und</strong>esrecht/sgb_5/, Zugriff: 30.06.2005.<br />
B<strong>und</strong>esministerium für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziale Sicherung: SGB V. Gesetz-<br />
liche Krankenversicherung. Unter:<br />
http://www.bmgs.b<strong>und</strong>.de/download/gesetze_web/gesetze.htm#sgb05/sgb0<br />
5x001.htm, Zugriff: 30.06.2005.<br />
B<strong>und</strong>estransferstelle Soziale Stadt (Hrsg.): B<strong>und</strong>-Länder-Programm Soziale<br />
Stadt. Unter: http://www.sozialestadt.de/programm/, Zugriff: 24.06.2005.<br />
Castells, M. (2000): The Rise of the Network Society, 2 nd edition. Volume 1 of<br />
‘The Information Age’. Malden, MA: Blackwell.<br />
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (DIE)/ Pädagogische Arbeits-<br />
stelle des Deutschen Volkshochschulverbandes (Hrsg.) (1994): Volks-<br />
hochschulstatistik Arbeitsjahr 1993. Tab. 9: Kursveranstaltungen nach Stoff-<br />
<strong>und</strong> Fachgebieten 1993 – B<strong>und</strong>esrepublik. Frankfurt. S. 36-37.<br />
Deutsches Netz Ges<strong>und</strong>heitsfördernder Krankenhäuser gem. e.V.: Die<br />
Entwicklung des DNGfK. Unter: http://www.dngfk.de/, Zugriff: 30.06.2005.<br />
European Network of Health Promoting Schools Technical Secretariat:<br />
European Network of Health Promoting Schools. Unter:<br />
http://www.euro.who.int/ENHPS, Zugriff: 23.06.2005.<br />
Flick et al. (Hrsg.) (1995): Handbuch qualitative Sozialforschung: Gr<strong>und</strong>lagen,<br />
Konzepte, Methoden <strong>und</strong> Anwendungen. Weinheim: Beltz, Psychologie-<br />
Verl.-Union.<br />
Focus-Lexikon: Befragung. Unter:<br />
http://medialine.focus.de/PM1D/PM1DB/PM1DBF/pm1dbf.htm?snr=730,<br />
Zugriff: 22.06.2005.<br />
124
Focus-Lexikon: standardisierte Befragung (strukturierte Befragung, strukturier-<br />
tes Interview). Unter:<br />
http://medialine.focus.de/PM1D/PM1DB/PM1DBF/pm1dbf.htm?snr=5230,<br />
Zugriff: 22.06.2005.<br />
Freie Universität Berlin & Landesges<strong>und</strong>heitsamt Brandenburg (Hrsg.)<br />
(1999): Vernetzung als Strategie der Ges<strong>und</strong>heitsförderung. Regionale<br />
Netzwerke Arbeit <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit – Bilanz <strong>und</strong> Perspektiven. Berlin: Zentra-<br />
le Universitätsdruckerei.<br />
Ges<strong>und</strong>heitsAkademie e.V. (Hrsg.) (2001): Ges<strong>und</strong>heit gemeinsam gestalten<br />
– Allianz für Ges<strong>und</strong>heitsförderung. 1. Auflage. Frankfurt/Main: Mabuse-<br />
Verlag.<br />
Göpel, E. & Schubert-Lehnhardt V. (Hrsg.) (2004): Ges<strong>und</strong>heit gemeinsam<br />
gestalten 2. Kommunale Ges<strong>und</strong>heitsförderung. Frankfurt/Main: Mabuse-<br />
Verlag.<br />
Göpel, E./ Hölling, G.: Einleitung. In: Ges<strong>und</strong>heitsAkademie e.V. (Hrsg.)<br />
(2001): Ges<strong>und</strong>heit gemeinsam gestalten – Allianz für Ges<strong>und</strong>heitsförde-<br />
rung. 1. Auflage. Frankfurt/Main: Mabuse-Verlag. S.8-12.<br />
Hirsig, R. (1998): Statistische Methoden in den Sozialwissenschaften. Eine Ein-<br />
führung im Hinblick auf computergestützte Datenanalysen mit SPSS für<br />
Windows. Band 1. 2., überarbeitete Auflage. Zürich: Seismo Verlag.<br />
Johannsen, U. (2003): Die Ges<strong>und</strong>heitsfördernde Schule. Möglichkeiten <strong>und</strong><br />
Grenzen von Ges<strong>und</strong>heitsförderung durch Organisations- <strong>und</strong> Schulentwick-<br />
lung. Inaugural-Dissertation <strong>zur</strong> Erlangung des Doktorgrades, Dr. oec.<br />
troph., Fachbereich Agrarwissenschaften, Ökotrophologie <strong>und</strong> Umweltma-<br />
nagement der Justus-Liebig-Universität Gießen. unveröffentlicht.<br />
Kastenbutt, B (2003): Lokale Infrastrukturen der Ges<strong>und</strong>heitsförderung. Stu-<br />
dientext: Weiterbildung Gemeindebezogene Ges<strong>und</strong>heitsförderung. Hoch-<br />
schule Magdeburg-Stendal (FH). unveröffentlicht.<br />
Landesinstitut für Schule Nordrhein Westfalen (Hrsg.): Netzwerk Bildung<br />
<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit. OPUS NRW. Unter: http://www.learn-<br />
line.nrw.de/angebote/ges<strong>und</strong>ids/, Zugriff: 23.06.2005.<br />
125
Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis: Jakarta-Erklärung <strong>zur</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförde-<br />
rung im 21. Jahrh<strong>und</strong>ert. Unter: http://www.rhein-neckar-<br />
kreis.de/Gesunheitsfoerderung/WHOJakarta.htm, Zugriff: 14.06.2005<br />
Ministerium der Justiz Brandenburg: Gesetz über den Öffentlichen Ges<strong>und</strong>-<br />
heitsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Ges<strong>und</strong>heitsdienst-<br />
gesetz - BbgGDG). Unter:<br />
http://www.mdje.brandenburg.de/Landesrecht/gesetzblatt/texte/K50/500-<br />
02.htm, Zugriff: 30.06.2005.<br />
Naidoo, J. & Wills, J. (2003): Lehrbuch der Ges<strong>und</strong>heitsförderung. Umfassend<br />
<strong>und</strong> anschaulich mit vielen Beispielen <strong>und</strong> Projekten aus der Praxis der Ge-<br />
s<strong>und</strong>heitsförderung. B<strong>und</strong>eszentrale für ges<strong>und</strong>heitliche Aufklärung (BZgA)<br />
(Hrsg. der dt. Ausgabe). Gamburg: Verlag für Ges<strong>und</strong>heitsförderung G.<br />
Conrad.<br />
Prümel-Philippsen U.: Vorwort. In: Ges<strong>und</strong>heitsAkademie e.V. (Hrsg.) (2001):<br />
Ges<strong>und</strong>heit gemeinsam gestalten – Allianz für Ges<strong>und</strong>heitsförderung. 1.<br />
Auflage. Frankfurt/Main: Mabuse-Verlag. S. 5/6.<br />
Swart, E. (2003): Skript <strong>zur</strong> Veranstaltung „Epidemiologische Methoden <strong>und</strong><br />
Anwendungen“. Version 2. Magdeburg. unveröffentlicht.<br />
Trojan, A. & Legewie, H. (2001): Nachhaltige Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Entwicklung.<br />
Leitbilder, Politik <strong>und</strong> Praxis der Gestaltung ges<strong>und</strong>heitsförderlicher Umwelt-<br />
<strong>und</strong> Lebensbedingungen. Frankfurt/Main: VAS.<br />
Trojan, A.: Vermitteln <strong>und</strong> Vernetzen. In: B<strong>und</strong>eszentrale für Ges<strong>und</strong>heitliche<br />
Aufklärung (BZgA) (Hrsg.) (1999): Leitbegriffe der Ges<strong>und</strong>heitsförderung.<br />
Glossar zu Konzepten, Strategien <strong>und</strong> Methoden der Ges<strong>und</strong>heitsförderung.<br />
2. Auflage. Schwabenheim an der Selz: Fachverlag Peter Sabo. S. 119-120.<br />
Trojan, A.: Vernetzungsstrukturen für Ges<strong>und</strong>heitsförderung. In: Ges<strong>und</strong>heits-<br />
Akademie e.V. (Hrsg.) (2001): Ges<strong>und</strong>heit gemeinsam gestalten – Allianz<br />
für Ges<strong>und</strong>heitsförderung. 1. Auflage. Frankfurt/Main: Mabuse-Verlag. S.54-<br />
69.<br />
Volkshochschule Köln: Netzwerk <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> Köln. Unter:<br />
http://www.stadt-koeln.de/vhs/projekte/artikel/00490/, Zugriff: 23.06.2005.<br />
126
Weltges<strong>und</strong>heitsorganisation (WHO) (Hrsg.) (1992): Ges<strong>und</strong>heitsförderung.<br />
Eine Investition für die Zukunft. Internationale Konferenz. Bonn, 17.-19. De-<br />
zember 1990. Kommunale Strategien. Ergänzungsband Nr. 4 zum Konfe-<br />
renzbericht. Fränkische Nachrichten Druck- <strong>und</strong> Verlags-GmbH: Tauberbi-<br />
schofsheim.<br />
Weltges<strong>und</strong>heitsorganisation (WHO) (Hrsg.) (1998): Glossar Ges<strong>und</strong>heits-<br />
förderung.<br />
Weltges<strong>und</strong>heitsorganisation (WHO) (Hrsg.) (1998): Glossar Ges<strong>und</strong>heits-<br />
förderung. Deutsche Übersetzung (DVGE) des Glossars von Don Nutbeam.<br />
Gamburg: Verlag für Ges<strong>und</strong>heitsförderung G. Conrad.<br />
Weltges<strong>und</strong>heitsorganisation (WHO), Regionalbüro für Europa (1999): Ge-<br />
s<strong>und</strong>heit 21: Das Rahmenkonzept „Ges<strong>und</strong>heit für Alle“ für die europäische<br />
Region der WHO. Kopenhagen. In: Kaba-Schönstein, L. (2002): Soziale Be-<br />
nachteiligung <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung – Stand <strong>und</strong> Perspektiven. In:<br />
Geene, R./ Gold, C./ Hans, C. (Hrsg.) (2003): Armut <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit. Ge-<br />
s<strong>und</strong>heitsziele gegen Armut: Netzwerke für Menschen in schwierigen Le-<br />
benslagen. 2. Aufl. Berlin:b_books. S. 89–102.<br />
Wikipedia, die freie Enzyklopädie: <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>. Unter<br />
http://de.wikipedia.org/wiki/Ges<strong>und</strong>heitsf%C3%B6rderung, Zugriff:<br />
24.06.2005.<br />
Wikipedia, die freie Enzyklopädie: Ges<strong>und</strong>heitsförderung. Unter:<br />
http://de.wikipedia.org/wiki/<strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong>, Zugriff: 24.06.2005.<br />
127
10 Anhang<br />
I. Gesprächsprotokoll vom 02.12.2004<br />
II. Gesprächsprotokoll vom 27.01.2005<br />
III. Anschreiben potentieller Kooperationspartner<br />
IV. Protokoll der Einführungsveranstaltung, 08.03.2005<br />
V. Protokoll der Gründungsveranstaltung, 12.05.2005<br />
VI. Protokoll der ersten Netzwerkveranstaltung, 07.07.2005<br />
VII. Beitrittserklärung<br />
VIII. Fragebogen <strong>zur</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heitsbildung</strong> <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsförderung in<br />
Ihrem Umfeld<br />
IX. Genehmigung des Ministeriums für Bildung, Jugend <strong>und</strong> Sport des<br />
Landes Brandenburg <strong>zur</strong> Durchführung einer wissenschaftlichen<br />
Untersuchung an Schulen<br />
X. Rohliste: zusätzliche Hinweise <strong>und</strong> Bemerkungen<br />
XI. Fragebogen <strong>zur</strong> Evaluation der kooperativen Arbeit im Netzwerk<br />
128