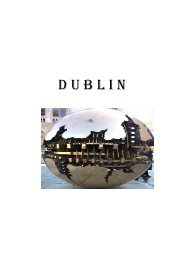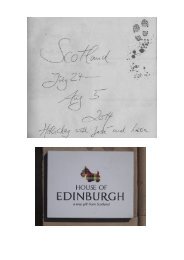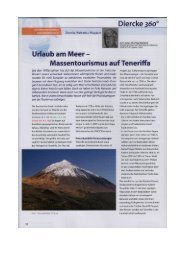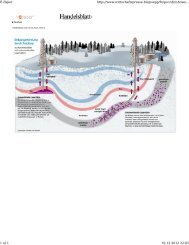1. Der Stadtbegriff Semester 5 Stadtgeographie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>1.</strong> <strong>Der</strong> <strong>Stadtbegriff</strong><br />
<strong>Semester</strong> 5 <strong>Stadtgeographie</strong><br />
"Die Stadt ist ein kompakter Siedlungskörper von hoher Wohn- und<br />
Arbeitsplatzdichte, mit vor allem durch Wanderungsgewinn wachsender Bevölkerung,<br />
mit breitem Berufsfächer bei überwiegend tertiär- und sekundärwirtschaftlichen<br />
Tätigkeiten, mit deutlicher innerer Differenzierung, mit relativ hoher<br />
Verkehrswertigkeit, mit einem Bedeutungsüberschuß an Waren und Dienstleistungen<br />
für einen erweiterten Versorgungsbereich bei weitgehend künstlicher<br />
Umweltgestaltung mit deren Folgen für ihre Bevölkerung." (HOFMEISTER 1993,<br />
S.237)<br />
Zusammenfassend lassen sich so folgende Kriterien für den Begriff der Stadt<br />
aufstellen:<br />
• Größe<br />
• Geschlossene Siedlung<br />
• Innere Differenzierung (Sozialer Raum und Funktion)<br />
• Wirtschaftliche Aktivität im II. und III. Sektor<br />
• Urbane Lebensform<br />
• Zentralität (s. Kap. I. 5)<br />
• Hohe Verkehrswertigkeit<br />
• Künstliche Umweltgestaltung<br />
2. Die Stadtentstehung erfolgte in bestimmten Phasen. Hierbei wird<br />
unterscheiden zwischen:<br />
• Ältesten Städten (ab 8 000 v. Chr.):<br />
- Jericho<br />
- Çatal Hüyük<br />
- Karthago<br />
• Griechischen Städten<br />
• Römischen Städten<br />
• Mittelalterlichen Städten<br />
- Frühmittelalterliche Wik- und Marktstädte ab dem 8. Jahrhundert um Bischofsitze und<br />
Königshöfe<br />
- Siedlungsgründungen des Hochadels im 12. Und 13. Jahrhundert, beispielsweise von<br />
Zähringern und Staufern<br />
- Klein-, Zwerg- und Minderstädten im 14. und 15. Jahrhundert<br />
• Frühneuzeitlichen Städten (16. - 18. Jhd.)<br />
- Kolonialistationsstädten<br />
- Bergbaustädten<br />
- Absolutistischen Fürstenstädten<br />
- Exulantenstädten<br />
• Städten des Industriezeitalters (ab 19. Jhd.)<br />
- Verwaltungsstädte, Vorhäfen<br />
- Industriestädte<br />
- Neue Städte der Nachkriegszeit<br />
Gegen Ende des Mittelalters existierten bereits 4.000 Städte in Deutschland. Seit 1450 erfolgt<br />
eine Abnahme der Städteneugründungen, die nur kurzfristig mit dem Einsetzen der<br />
Industrialisierung unterbrochen wurde.
3. Städtebauepochen in Deutschland<br />
Städtebauepoche<br />
Römische<br />
Stadtgründungen<br />
Mittelalter<br />
10. – 15. Jh.<br />
z. B. Bautzen<br />
Absolutismus<br />
16. – 16. Jh.<br />
z. B. Karlsruhe<br />
Industriestadt<br />
19. – 20. Jh.<br />
(ab 1871 Gründerzeit)<br />
Moderne Stadt<br />
20. Jh.<br />
<strong>Semester</strong> 5 <strong>Stadtgeographie</strong><br />
Siedlungsmittelpunkt Verkehrswege Wohnungen und Arbeitsstätten<br />
Forum nach Himmelsrichtungen ausgerichtete<br />
Straßen<br />
Pfarrkirche, Marktplatz, Rathaus Handelsstraßen für Fuhrwerke, Gassen<br />
für Tragetiere oder Karren<br />
Schloss Alleen für Karossen, radial<br />
verlaufendes Straßennetz<br />
Wohnung und Arbeitsplatz<br />
unter einem Dach<br />
Wohnung und Arbeitsplatz<br />
auf einem Grundstück, Manufakturen<br />
Fabrik, Bergwerk Eisenbahnanschluss (ab 1830) Fabriken mit Schornsteinen und Mietskasernen<br />
innerhalb eines Straßenblocks,<br />
Villengebiete<br />
Einkaufszentrum gestuftes Straßennetz: Wohnstraßen<br />
und Schnellstraßen für Kraftfahrzeuge,<br />
Massenverkehrsnetz<br />
Wohnungen und Arbeitsstätten<br />
räumlich klar<br />
getrennt (Pendlerverkehr)
<strong>Semester</strong> 5 <strong>Stadtgeographie</strong><br />
4. Hierarchie und räumliche Verteilung der Global Cities<br />
5. Hierarchisierung der Weltstädte (World Cities, Global Cities):<br />
(1) Die Globalization and World City Research Group (GaWC) an der University of<br />
Loughborough hat mithilfe einer umfangreichen quantitativen Methode die Daten von<br />
international tätigen Unternehmen aus den vier Dienstleistungssektoren Wirtschaftsprüfung,<br />
Bank- und Finanzwesen, Werbeagenturen und Rechtsberatung in 263 Städten ausgewertet<br />
und daraus ein Raster von 55 Weltstädten auf drei verschiedenen Ebenen abgeleitet. Dabei<br />
wurden die Daten quantifiziert und in ein Punkteschema umgerechnet. Jede der<br />
untersuchten Städte erzielte somit eine bestimmte Punktezahl, die dem Grad ihrer<br />
„Weltstadtheit“ entspricht. Anhand der erreichten Punktzahl wurden die untersuchten Städte<br />
in Klassen eingeteilt:
<strong>Semester</strong> 5 <strong>Stadtgeographie</strong><br />
- Städte mit einer Punktezahl von 12 – 10 wurden als Alpha-Weltstädte<br />
- Städte mit einer Punktezahl von 9 – 7 als Beta- Weltstädte und<br />
- Städte mit einer Punktezahl von 6 – 4 als Gamma-Weltstädte bezeichnet.<br />
(2) Dirk BRONGER entwickelte anhand von acht Indikatoren, für die international<br />
vergleichbare Werte vorliegen, eine Rangfolge<br />
der Global Cities. Die Indikatoren waren:<br />
1 Firmensitze der Zentralen der 500 größten transnationalen Unternehmen ‚ Umsatz dieser<br />
Unternehmen<br />
2 Hauptverwaltung der 500 weltweit umsatzstärksten Banken, „Sitz der weltweit größten<br />
(umsatzstärksten) Börsen<br />
3 bedeutendste internationale Flughäfen nach Anzahl der Passagiere<br />
4 bzw. nach Frachtaufkommen<br />
5 weltweit führende Seehäfen nach Umschlag<br />
6 Sitz bedeutender internationaler/weltwirtschaftlicher Institutionen.<br />
Ausgehend von diesen Indikatoren identifizierte BRONGER 42 Metropolen mit Weltstadt-<br />
Bedeutung, die er drei Kategorien zuordnete:<br />
<strong>1.</strong> Global Cities im engere Sinne (Kommandozentralen mit Weltgeltung)<br />
2. Städte mit teilweise globalen Kommandofunktionen<br />
3. Städte mit spezialisierter Kommandofunktion<br />
Quelle:<br />
DIRK BRONGER: Metropolen – Megastädte – Global Cities. Darmstadt: Wissenschaftliche<br />
Buchgesellschaft, 2004, S. 146 ff. und S. 19<strong>1.</strong><br />
A - ALPHA WORLD CITIES (full service world cities)<br />
12: London, New York, Paris, Tokyo<br />
10: Chicago, Frankfurt, Hong Kong, Los Angeles, Milan, Singapore<br />
B - BETA WORLD CITIES (major world cities)<br />
9: San Francisco, Sydney, Toronto, Zurich<br />
8: Brussels, Madrid, Mexico City, Sao Paulo<br />
7: Moscow, Seoul<br />
C - GAMMA WORLD CITIES (minor world cities)<br />
6: Amsterdam, Boston, Caracas, Dallas, Düsseldorf, Geneva, Houston,<br />
Jakarta, Johannesburg, Melbourne, Osaka, Prague, Santiago, Taipei,<br />
Washington<br />
5: Bangkok, Beijing, Montreal, Rome, Stockholm, Warsaw<br />
4: Atlanta, Barcelona, Berlin, Budapest, Buenos Aires, Copenhagen, Hamburg, Istanbul,<br />
Kuala Lumpur, Manila, Miami, Minneapolis, Munich, Shanghai
6.<br />
7. Millionenstädte<br />
<strong>Semester</strong> 5 <strong>Stadtgeographie</strong>
8. Zentrale Orte - Christaller<br />
<strong>Semester</strong> 5 <strong>Stadtgeographie</strong><br />
Theorie der Zentralen Orte:<br />
Die von W. CHRISTALLER 1933 geprägte Theorie der Zentralen Orte versucht, eine<br />
hierarchische Struktur der räumlichen Ordnung der Wirtschaft sowie der Hirarchie von<br />
Siedlungen aus dem Zusammenwirken ökonomischer Bestimmungsfaktoren zu erkennen.<br />
Die Zentralität eines Ortes wird hierbei von dessen Bedeutungsüberschuß an zentralen<br />
Gütern gegenüber des Umlandes bestimmt.<br />
Zentrale Güter sind nach CHRISTALLER:<br />
Einrichtungen der Verwaltung<br />
Sanitäre Einrichtungen (Arzt, Hospital,...)<br />
Gesellschaftlich - kulturelle Einrichtungen<br />
Organisationseinrichtungen des wirtschaftlich-sozialen Lebens<br />
Einrichtungen des Handels und Geldverkehrs<br />
Einrichtungen des Verkehrs.<br />
Entscheidend für diese Theorie ist die Reichweite dieser Güter. Sie entscheidet über die<br />
zentrale Wertigkeit eines Ortes. Bei optimaler Struktur von zentralen Orten läßt sich ein<br />
gleichseitiges Hexagon im Grundriß erkennen:
9. Funktionale Differenzierung<br />
<strong>Semester</strong> 5 <strong>Stadtgeographie</strong><br />
10. Innerstädtische Gliederung: Stadtstrukturmodelle<br />
In der sogenannten Chicagoer Schule, einem Forschungsansatz amerikanischer<br />
Sozialökologen, wird versucht, Regelhaftigkeiten der wechselseitigen Abhängigkeit des<br />
sozialen und wirtschaftlichen Lebens in der Stadt zu erfassen und darzustellen. Die<br />
wichtigsten grundlegenden Konzepte dieses Forschungsansatzes stellen der<br />
Privatkapitalismus und der Sozialdarwinismus dar. Im Hinblick auf diese Phänomene wurden<br />
von 1925 bis 1945 drei verschiedene Stadtstrukturmodelle entwickelt:<br />
- Das Ring-/Zonenmodell von Burgess<br />
Gliederung der Stadt in konzentrische Zonen mit Sozialer und funktionaler Segregation.<br />
Entwickelt am Bespiel Chikagos.<br />
- Das Sektorenmodell von Hoyt<br />
Gliederung anhand des o.g. Modells mit Ausbildung von Sektoren innerhalb der<br />
konzentrischen Zonen, die unterschiedliche Funktionen enthalten. Entwickelt anhand einer<br />
Untersuchung von 30 nordamerikanischen Städten und deren Entwicklung von 1900 bis<br />
1936.<br />
- Das multinukleare Modell von Harris und Ullman<br />
Erkennen von mehreren funktionalen Kernen (CBDs); in diesem Modell wird von den<br />
zentralörtlichen Theorien im Bezug auf das Umland ausgegangen.
<strong>Semester</strong> 5 <strong>Stadtgeographie</strong><br />
1<strong>1.</strong> New Towns, Cornelsen Oberstufenband: S. 272<br />
12. Die Gartenstädte: S. 274<br />
13. Die nachhaltige Stadt, Agenda 21: S. 318 f.<br />
14. Modell der nordamerikanischen Stadt: S. 326<br />
15. … der lateinamerikanischen Stadt: S. 331
16. Shrinking Cities - Prognose<br />
<strong>Semester</strong> 5 <strong>Stadtgeographie</strong><br />
Im 2<strong>1.</strong> Jahrhundert wird die historisch einmalige Wachstumsepoche, die mit der<br />
Industrialisierung vor 200 Jahren begann, zu Ende gehen. Vor allem Klimawandel,<br />
Verknappung fossiler Energien, demografische Alterung und Rationalisierungen im<br />
Dienstleistungssektor werden dabei zu neuen Formen der urbanen Schrumpfung und<br />
einer deutlichen Zunahme schrumpfender Städte führen. Hierzu hat das Projekt<br />
Schrumpfende Städte eine globale Zukunftsstudie mit 9 Weltkarten und einer<br />
umfangreichen Datensammlung erstellt, welche die Auswirkung dieser Phänomene<br />
auf die Stadtentwicklung in den verschiedenen Ländern aufzeigt und anschaulich<br />
macht.<br />
Bevölkerung 1950-2150 ///<br />
Quelle: http://shrinkingcities.com/prognose.0.html
Glossar:<br />
<strong>Semester</strong> 5 <strong>Stadtgeographie</strong><br />
a: Verstädterung:<br />
Unter dem Begriff der Verstädterung wird der quantitative Aspekt der Stadt erfaßt: Dieser<br />
gliedert sich wiederum im zwei Begriffe: Den Verstädterungsgrad (Verstädterungsquote), der<br />
den Anteil der Stadtbevölkerung darstellt, und die Verstädterungsrate, den Zuwachs des<br />
Anteil der Stadtbevölkerung an der Gesamtbevölkerung in einem bestimmten Zeitraum.<br />
<strong>Der</strong> Begriff der Urbanisierung, der oft synonym zu dem der Verstäderung verwendet wird,<br />
bedeutet hingegen die Ausbreitung städtischer Lebensformen, also den qualtitativen Aspekt.<br />
<strong>Der</strong> Begriff der Metropolisierung bedeutet die "Vergroßstädterung", sowohl quanitativ in<br />
Größe und Einwohnerzahl, als auch qualitativ in ihren Funktionen.<br />
b: Suburbanisierung<br />
Unter dem Begriff der Suburbanisierung versteht man die Expansion einer Stadt in ihr<br />
Umland. Es werden drei Arten von Suburbanisierung unterschieden:<br />
Bevölkerungssuburbanisierung<br />
Ursachen: Unzureichendes Wohnungsangebot, Mängel an der Bausubstanz,<br />
Wohnumwelt, ...<br />
Industriesuburbanisierung<br />
Ursachen: Steigender Flächenbedarf, Abnehmender Bedarf nach einem zentralen Standort,<br />
Neue Produkte, Erreichbarkeit, ...<br />
Tertiäre Suburbanisierung<br />
Ursachen: Sinkendes Kundenpotential, Agglomerationsvorteile, Erreichbarkeit, ...<br />
c: Desurbanisierung / Counterurbanization<br />
Dieser Begriff der Entstädterung bedeutet eine extreme Verlagerung der Wachstumsdynamik<br />
einer Region in den ländlichen Raum.<br />
d: Gentrification<br />
Diese "Reurbanisierung" der Kernstädte und die damit verbundene Aufwertung<br />
innenstadtnaher Wohngebiete, die z.B. durch Sanierungsmaßnahmen erreicht wird, kann<br />
sich aus verschiedensten Ursachen entwickeln.