DIE ZEIT 39/2012 - ElectronicsAndBooks
DIE ZEIT 39/2012 - ElectronicsAndBooks
DIE ZEIT 39/2012 - ElectronicsAndBooks
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Titelbild: Mediziner in Deutschland porträtiert von Benno Kraehahn für <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>/www.kraehahn.com; postproduction: px-group.de<br />
PREIS DEUTSCHLAND 4,20 €<br />
Paul Brandenburg,<br />
Facharzt<br />
für Allgemein-<br />
und Notfallmedizin<br />
Nur kein Verbot<br />
Den Schmähfi lm müssen wir ertragen. Er gefährdet den<br />
Frieden in Deutschland nicht VON ÖZLEM TOPÇU<br />
Aufgepasst: Der Prophet Mohammed<br />
hatte Sex! Wahrscheinlich hat<br />
er als Befehlshaber bei den frühisla<br />
mi schen Expansionskriegen<br />
auch einige Menschen eigenhändig<br />
getötet. Gläubige Muslime,<br />
die den Gesandten Gottes mit einer oft kindlichen,<br />
reinen Liebe betrachten, stellen sich das nicht gern<br />
vor. Aber Mohammed war nicht nur ein Prophet,<br />
er war auch ein Mensch aus Fleisch und Blut.<br />
Nun gibt es einen Filmtrailer im Internet, der<br />
den Propheten, an den mehr als eine Milliarde<br />
Menschen glauben, als lüsternen, blutrünstigen<br />
Vollidioten darstellt. Ein absurdes Machwerk,<br />
das nur ein Ziel verfolgt: jene, die sich provozieren<br />
lassen wollen, zu provozieren. Die Bilder aufgebrachter<br />
Muslime gehen gerade um die Welt,<br />
auch wenn noch nicht in jedem Fall ausgemacht<br />
ist, ob das Video allein der Grund für ihre Wut<br />
ist (Seite 6). Eine bedeutungslose<br />
rechte Splitterpartei hat<br />
jetzt angekündigt, den Film in<br />
voller Länge in Deutschland<br />
zeigen zu wollen. Aus Angst vor<br />
Ausschreitungen will die Bundesregierung<br />
diese Vorführung<br />
verbieten, die Kanzlerin sagt,<br />
dafür gebe es »gute Gründe«.<br />
Ein solches Verbot wäre ein<br />
Fehler, und die Verlierer dieses<br />
Verbots wären am Ende die<br />
deutschen Muslime.<br />
Warum?<br />
Zuallererst ist die Meinungsfreiheit<br />
natürlich existenziell<br />
wichtig für dieses Land – selbst wenn es sich hier<br />
ohne Zweifel um einen Drecksfilm handelt, der<br />
nur den Zweck hat, Menschen zu verletzen. Es ist<br />
anzunehmen, dass es den Rechten bei ihrem Plan,<br />
den Film öffentlich vorzuführen, nicht in erster<br />
Linie um die Freiheit der Kunst oder die freie<br />
Rede geht, sondern um die Abwertung des Fremden,<br />
das sie in Deutschland einfach nicht dulden<br />
wollen. Dennoch bleibt es dabei: Auch eine dumme,<br />
sogar eine böse Meinung ist eine Meinung.<br />
Gegen ein Verbot spricht ebenso, dass dafür<br />
das Bild des »irren Muslims« bedient werden<br />
muss. Denn die »guten Gründe« der Kanzlerin<br />
bestehen einfach in der Sorge, dass es zu Ausschreitungen<br />
kommt, wenn dieser Film gezeigt<br />
wird. Nur gibt es weder »den Muslim« noch<br />
»den irren Muslim«. Es gibt einige Irre, ja, und<br />
die werden von den Verfassungsschutzämtern<br />
beobachtet. Allein die Ansage, dass ein Verbot<br />
für die Wahrung des öffentlichen Friedens besser<br />
wäre, führt in die falsche Richtung. Denn sie<br />
suggeriert, dass die Muslime so sehr durchdrehen<br />
würden, dass die Sicherheitskräfte die Sache<br />
dann nicht mehr in den Griff kriegen können.<br />
Doch sind die Muslime nicht so verrückt,<br />
und die deutsche Polizei ist nicht so schwach.<br />
Der wichtigste Grund, der gegen ein Verbot<br />
spricht, besteht für die deutschen Muslime aber<br />
<strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong><br />
WOCHEN<strong>ZEIT</strong>UNG FÜR POLITIK WIRTSCHAFT WISSEN UND KULTUR<br />
Hassvideo gegen den Islam<br />
Ursula Stüwe,<br />
Chirurgin<br />
im darin mitschwingenden Paternalismus. Da<br />
die Regierung unbedingt verhindern will, dass<br />
eine Minderheit der Fundamentalisten durchdreht<br />
(was wahrscheinlich ist), nimmt sie den<br />
normalen Muslimen die Möglichkeit, sich selbst<br />
öffentlich mit dem Hass auseinanderzusetzen.<br />
Dabei wäre es befreiender, sich den Trailer anzuschauen<br />
und dem Hass laut zu widersprechen.<br />
Diejenigen, die die Möglichkeit haben, können<br />
das öffentlich tun: Politiker in Reden, Autoren in<br />
Artikeln, Büchern oder Blogs, Lehrer in Klassenzimmern;<br />
diejenigen, die keine Öffentlichkeit<br />
haben, müssen und werden lernen, gelassen mit<br />
dem Hass umzugehen und sich weder von den<br />
islamfeindlichen noch von den islamistischen<br />
Ideologen für ihre Sache vereinnahmen zu lassen.<br />
Das wäre ein Akt der Eman zi pa tion. Und<br />
eine gute Übung: auszuhalten, was in diesem<br />
Film zu sehen ist – es wird nicht die letzte<br />
Schmähung sein. Und es wäre<br />
eine De mons tra tion. Menschen<br />
funktionieren nicht so fremdgesteuert:<br />
Licht aus, Film an,<br />
Muslim dreht durch.<br />
Der deutsche Staat ist stark<br />
genug, um eine Vorführung zu<br />
ermöglichen. Ein Verbot würde<br />
zu Misstrauen führen. Man<br />
kann sich die Verschwörungstheorien<br />
schon vorstellen: Die<br />
da oben pampern die beleidigten<br />
Muslime; die Scharia ist<br />
weiter auf dem Vormarsch.<br />
Natürlich kann es zu Ausschreitungen<br />
kommen, wie bei<br />
jeder De mons tra tion. Wie in Bonn im Mai, als<br />
Fanatiker 29 Polizisten verletzten, nachdem rechte<br />
Extremisten Mohammed-Karikaturen vor einer<br />
Moschee ausgestellt hatten. Aber die Fanatiker<br />
sind nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit.<br />
Die Mehrheit verhält sich wie im August in Berlin,<br />
als die Rechten wieder Karikaturen zeigten.<br />
Verblüfft, ruhig, etwas des inte res siert.<br />
Dieser Mehrheit könnte die Bundesregierung<br />
ruhig ein wenig Vertrauen entgegenbringen.<br />
Nicht zuletzt ist da die religiöse Frage: Kann<br />
für einen Muslim, der an Allah und seinen Gesandten<br />
glaubt, oder für einen Christen, der an<br />
Gott und seinen Sohn glaubt, überhaupt etwas<br />
seinen Glauben beleidigen? Nein. Gott ist unbeleidigbar.<br />
Kein Katholik hat bei uns randaliert, als<br />
der Papst mit Urinfleck auf seiner Soutane auf<br />
dem Cover der Titanic gezeigt wurde – und der<br />
Papst hat nur geklagt. Niemand, der wirklich<br />
glaubt, kann von jemandem, der nicht glaubt, im<br />
Innersten gekränkt werden.<br />
Und für alle, die leicht zu erzürnen sind, gilt,<br />
hin und wieder ihr Vorbild nachzuahmen: Laut<br />
Überlieferung soll Mohammed geraten haben,<br />
auf Schmähungen mit Gelassenheit und Barmherzigkeit<br />
zu reagieren.<br />
www.zeit.de/audio<br />
Urban Wiesing,<br />
Arzt und<br />
Medizinethiker<br />
Topmanagement<br />
Michael Scheele,<br />
ehemaliger<br />
Chefarzt in der<br />
Geburtshilfe<br />
»Patienten sind wichtiger als Profit«<br />
Der Eid der Mediziner wird in Deutschlands Krankenhäusern jeden Tag tausendfach gebrochen.<br />
Ärzte und Pfl eger fordern deshalb eine moderne Standesethik. Ein Manifest<br />
WISSEN SEITE 31–33<br />
Zum Thema<br />
Was steckt wirklich hinter<br />
der Wut in der islamischen<br />
Welt? Politik S. 6/7<br />
Keine Kompromisse!<br />
Ein Gespräch mit Salman<br />
Rushdie Feuilleton S. 45<br />
Seyran Ateş: Wider das<br />
religiöse Eiferertum<br />
Glauben & Zweifeln S. 58<br />
Glücksfall Chefin<br />
So viele Frauen wie nie rücken in den Unternehmen nach oben.<br />
Jetzt können sie den Kapitalismus verändern VON UWE JEAN HEUSER<br />
Schlechte Nachrichten für die Frauenquote,<br />
gute für die Frauen – wie passt<br />
das zusammen? In Deutschland führen<br />
die Arbeitsministerin Ursula von<br />
der Leyen (pro) und die Familienministerin<br />
Kristina Schröder (kontra)<br />
eine lähmende Debatte. Und in Europa ist die<br />
Quote fürs Erste sogar gestoppt – zur Freude der<br />
Staaten, die sich mit der Frauenförderung weiter<br />
Zeit nehmen wollen.<br />
Gleichzeitig vollzieht sich in Deutschland<br />
eine historische Wende. Bislang ist unsere Wirtschaft<br />
in Frauenfragen zwar alles andere als ein<br />
Vorbild. Aber endlich kommen die Frauen auf<br />
dem Weg in die Führungsetagen voran, und die<br />
Bewegung erreicht gerade eine kritische Masse.<br />
Das deutsche Beispiel zeigt, dass schon die<br />
Androhung der Quote das Umdenken beschleunigt.<br />
Seit Jahren erklärt die Politik der Wirtschaft,<br />
wenn sie nicht weiblicher würde, dann käme ein<br />
Gesetz. Das hat geholfen, auch wenn es die Chefs<br />
nicht allein zum Einlenken bewegt – viele merken<br />
schlicht, dass sie mit einer reinen Männerpolitik<br />
selbst zum Auslaufmodell werden.<br />
In fortschrittlichen Unternehmen geht es<br />
nicht mehr um den bewussten und bemühten<br />
Versuch, mal eine Frau für die obere Etage zu<br />
finden. Das ist inzwischen Managementroutine,<br />
betriebliche Normalität.<br />
Daher müssen sich in der Deutschland AG<br />
auch nicht mehr diejenigen Manager rechtfertigen,<br />
die Frauen befördern. Am Rand stehen nun<br />
jene, die ihre Männerwelt verteidigen. Statistiken<br />
bestätigen, dass die deutsche Wirtschaft die Jahre<br />
der Abwehr und des Stillstands überwindet. Die<br />
Personalberatung Egon Zehnder hat untersucht,<br />
wie die europäischen Großunternehmen zuletzt<br />
bei Neubesetzungen in ihren Vorständen und<br />
Aufsichtsräten entschieden. In Deutschland gingen<br />
40 Prozent der Führungspositionen an Frauen,<br />
europaweit waren es 30 Prozent. Zwar wurden<br />
die meisten Frauen dabei »nur« Aufsichtsrätinnen,<br />
kontrollieren also Chefs, statt selbst zu<br />
führen, aber künftig werden sie die neuen Vorstände<br />
berufen.<br />
Eine positive Überraschung ist es auch, dass<br />
mehr als ein Fünftel der mittelständischen Unternehmen<br />
von Frauen geführt wird. Der Grund ist<br />
nicht, dass den Vätern die männlichen Erben<br />
fehlen. Oft sind die Töchter einfach besser – wie<br />
im Fall des Maschinenbauers Trumpf, dessen<br />
Chefin Nicola Leibinger-Kammüller nebenbei<br />
die Lufthansa und Siemens kontrolliert und die<br />
Bundesregierung berät. So kommt es, dass der<br />
Mittelstand sogar noch besser dasteht, wenn man<br />
nur die jungen Führungskräfte anschaut. Die<br />
sind schon zu fast 40 Prozent weiblich.<br />
Mehr Frauen rücken nach, und die Frage ist,<br />
ob sie sich der männlichen Wirtschaft anpassen<br />
– oder sie verbessern. Früher wurde die Debatte<br />
von Forschern bestimmt, die erklärten, mit mehr<br />
weiblichen Führungskräften würde alles besser,<br />
was denn sonst? Aber das war erst der Anfang.<br />
Eine aufsehenerregende Studie über Norwegen<br />
warnt jetzt, dass unerfahrene Quotenfrauen im<br />
Aufsichtsrat den Börsenwert mindern. Andere<br />
Kommentatoren erklären schon eine ganze Generation<br />
junger Männer für verloren. Das ist alles<br />
etwas abwegig, und doch zeigt es, dass wir vorangekommen<br />
sind und nicht mehr über das Ob diskutieren,<br />
sondern über die Folgen.<br />
Soll sich die Wirtschaft wirklich wandeln,<br />
dann reicht es nicht, dass die Frauen Führungsposten<br />
besetzen. Jetzt, da sie mehr werden und<br />
nicht allein unter Männern auf der Chefetage<br />
sitzen, können sie ihre Umgebung auch prägen<br />
– und den Kapitalismus nachhaltig verändern.<br />
Viel spricht dafür, dass mit mehr Frauen an<br />
der Spitze eine neue Wirtschaft entsteht. Heute<br />
dürfen weibliche – und sogar männliche – Autoren<br />
sagen, dass Frauen mit anderen Erwartungen<br />
und Verhaltensweisen in die Wirtschaft kommen.<br />
Hat die Familienforscherin und Unternehmerin<br />
Gisela Erler recht, dann sind Frauen weniger hierarchiebesessen<br />
und streben mehr nach einer<br />
sinnvollen Aufgabe als nach Macht, mal als Chefin,<br />
mal im Team. Sie kämpfen gerne, aber bitte<br />
gegen die Konkurrenz und nicht untereinander.<br />
So gesehen würde eine weiblichere Wirtschaft<br />
also eher fragen, wer was am besten kann, als, wer<br />
wen am schnellsten besiegt.<br />
Wäre eine weiblichere Wirtschaft auch<br />
krisenfester? Manches spricht dafür<br />
Familiengerechter könnte sie auch sein. Nicht so<br />
wichtig, wie lange jemand am Schreibtisch hockt,<br />
sagen viele Frauen, Hauptsache, die Leistung<br />
stimmt. Außerdem sind sie es oft, die ihre Arbeitszeiten<br />
je nach Lebensphase verändern müssen. Bei<br />
Trumpf können die Mitarbeiter jetzt alle zwei<br />
Jahre neu bestimmen, wie viele Stunden pro Woche<br />
sie arbeiten. »Standardarbeitsverträge werden der<br />
komplexen Lebenswirklichkeit nicht mehr gerecht«,<br />
sagt die Chefin. Punkt.<br />
Es gibt sogar Indizien, dass eine weiblichere<br />
Wirtschaft krisenfester wäre. Anlageexperten behaupten,<br />
Frauen ließen sich nicht so schnell vom<br />
Fieber übertriebener Begeisterung anstecken.<br />
Auch als Unternehmerinnen seien sie vorsichtiger,<br />
hat die Förderbank KfW herausgefunden.<br />
Deshalb wuchsen ihre Firmen vor der Finanzkrise<br />
zwar nicht so schnell wie die Unternehmen<br />
der Männer. Aber in der Krise schrumpften sie<br />
auch weniger und waren daher sicherer.<br />
Niemand soll glauben, dass in einer weiblicheren<br />
Wirtschaft alles besser läuft. Auch neue<br />
schlechte Eigenschaften werden sich ausprägen.<br />
Aber ein flexibleres, selbstbestimmteres und<br />
etwas weniger krisenanfälliges Wirtschaftsleben<br />
– das wäre ein Gewinn für alle. Die Chance dazu<br />
eröffnet sich jetzt, sofern die Frauen die Wirtschaft<br />
verändern können, bevor die Wirtschaft<br />
die Frauen verändert.<br />
www.zeit.de/audio<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong><br />
Promi-Bonus<br />
oder Promi-Malus?<br />
Doris Schröder-Köpf will in<br />
die Politik. Ihr Mann ist ihr<br />
dabei nicht immer eine Hilfe<br />
Dossier Seite 13–15<br />
Berlin gegen die<br />
Deutsche Bank<br />
Die SPD will den Bankern<br />
an den Kragen – bis hin zur<br />
Aufspaltung des Geldhauses<br />
Wirtschaft Seite 19/20<br />
Eine Liebe, so<br />
stark wie der Tod<br />
Michael Hanekes grandioser<br />
Film über die letzten Wochen<br />
eines alten Ehepaares in Paris<br />
Feuilleton Seite 46<br />
PROMINENT IGNORIERT<br />
Motte und Meise<br />
Die Miniermotte, die aus prächtigen<br />
Kastanien im Nu triste Ruinen<br />
macht, wird neuerdings von Meisen<br />
gemocht und verzehrt. Schon<br />
der Biologe Wilhelm Busch hat<br />
über sie lobend vermerkt: »Sie gucken<br />
scharf in alle Ritzen, / wo<br />
fette Mottenlarven sitzen, / und<br />
fangen sonst noch Myriaden / Insekten,<br />
die dem Menschen schaden;<br />
/ und hieran siehst du außerdem,<br />
/ wie weise das Natursystem.«<br />
Sein Wort in Gottes Ohr. GRN<br />
Kleine Bilder: Wolfgang Wilde; Frederik Jurk<br />
für <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>/sepia-online.com; X Verleih;<br />
Imago; Rouf Bhat/AFP (l.)<br />
<strong>ZEIT</strong> ONLINE GmbH: www.zeit.de;<br />
<strong>ZEIT</strong>-Stellenmarkt: www.jobs.zeit.de<br />
Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG,<br />
20079 Hamburg<br />
Telefon 040 / 32 80 - 0; E-Mail:<br />
DieZeit@zeit.de, Leserbriefe@zeit.de<br />
ABONNENTENSERVICE:<br />
Tel. 0180 - 52 52 909*,<br />
Fax 0180 - 52 52 908*,<br />
E-Mail: abo@zeit.de<br />
**) 0,14 € /Min. aus dem deutschen Festnetz,<br />
max. 0,42 €/Min. aus dem deutschen Mobilfunknetz<br />
PREISE IM AUSLAND:<br />
DKR 43,00/NOR 62,00/FIN 6,70/E 5,20/<br />
Kanaren 5,40/F 5,20/NL 4,50/A 4,30/<br />
CHF 7.30/I 5,20/GR 5,70/B 4,50/P 5,20/<br />
L 4,50/HUF 1690,00<br />
AUSGABE:<br />
<strong>39</strong><br />
67. JAHRGANG<br />
C 7451 C<br />
4 190745 104203 3 9
2 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong><br />
Worte der Woche<br />
»<br />
Damit gießen sie grob<br />
fahrlässig Öl ins Feuer. Dagegen<br />
muss man mit allen rechtlich<br />
zulässigen Mitteln vorgehen.«<br />
Hans-Peter Friedrich, Bundesinnenminister (CSU),<br />
über das Vorhaben der rechtsextremen<br />
Partei Pro Deutschland, den Film<br />
»Unschuld der Muslime« in Berlin zu zeigen<br />
»Tot oder lebendig.«<br />
Ahmed Hicazi, Offizier der Freien Syrischen<br />
Armee, über die 25 Millionen Dollar Prämie,<br />
die auf den Kopf von Präsident<br />
Baschar al-Assad ausgesetzt sind<br />
»Herr Rösler ist gerne Vizekanzler –<br />
und das kann ich gut verstehen.«<br />
Angela Merkel, Bundeskanzlerin (CDU),<br />
auf die Frage, ob Philipp Rösler, FDP,<br />
sie in ihrem Amt ablösen möchte<br />
<strong>DIE</strong> NACHRICHT<br />
«<br />
Grenzen für Google<br />
CDU will Einschränkung der<br />
Speicherdauer bei Suchmaschinen<br />
In der CDU wird erwogen, Suchmaschinen<br />
und Soziale Netzwerke stärker zu regulieren.<br />
So sei die maximale Speicherdauer für<br />
persönliche Suchanfragen bei Google von<br />
bislang 18 Monaten »auf ein weniger bedrohliches<br />
Maß zu reduzieren, beispielsweise<br />
eine Woche«, heißt es in einem Papier<br />
des CDU-Netzpolitikers Thomas Jarzombek.<br />
Der Suchverlauf könne einen Datenbestand<br />
mit einer »ungeheuren Macht« bilden,<br />
um Menschen zu kompromittieren, so<br />
die Begründung. Die Nutzung durch Suchmaschinen<br />
wie Soziale Netzwerke berge die<br />
»Gefahr einer geistigen Monokultur«, da<br />
die meisten Nutzer sich nicht über die eingesetzten<br />
Filterfunktion im Klaren seien.<br />
Deshalb sei es nötig, einen »Neutralitätsbutton«<br />
direkt auf der Homepage zu installieren.<br />
Bislang böten zwar einige Anbieter<br />
einen neutralen Zugang an, doch sei<br />
dies nur einer Minderheit der Nutzer bekannt<br />
und setze die Registrierung mit persönlichen<br />
Daten voraus. THI<br />
<strong>ZEIT</strong>SPIEGEL<br />
Ausgezeichnet<br />
Harald Martenstein ist für sein Dossier Der<br />
Sog der Masse (<strong>ZEIT</strong> Nr. 46/11) mit dem<br />
Theodor-Wolff-Preis in der Kategorie Essay<br />
ausgezeichnet worden. In seinem Text beschreibt<br />
Martenstein die erschreckende<br />
Macht des Mainstreams – und verteidigt das<br />
Schwimmen gegen den Strom. Der Theodor-<br />
Wolff-Preis ist einer der renommiertesten<br />
Journalistenpreise. Er wurde in diesem Jahr<br />
zum 50. Mal verliehen. DZ<br />
In Hanoi erhält Rösler<br />
die Ehren doktorwürde,<br />
mit Übersetzung<br />
Volksheld wider Willen<br />
Auf seiner Vietnamreise glauben alle zu wissen, wer Philipp Rösler ist. Und er selbst? VON KHUÊ PHAM<br />
Hanoi<br />
Obwohl Philipp Rösler niemandem<br />
auffiel, als er am Morgen nach<br />
seiner Ankunft um den Hoan-<br />
Kiem-See in Hanoi joggte, obwohl<br />
er schwarze Haare hat wie<br />
jeder hier und diesen typisch schmalen Körper, ist<br />
er nicht so vietnamesisch, wie er erst mal wirkt.<br />
Wenn er neben anderen vietnamesischen Männern<br />
steht, überragt er sie. Seine Haut ist heller<br />
und glatter als ihre, und wenn er spricht, kommen<br />
ziemlich deutsche Politikerworte aus seinem<br />
Mund: Vietnam, das ist für ihn ein Investitionsstandort,<br />
eine dynamische Bevölkerung, ein strategischer<br />
Partner. Und natürlich vergisst Rösler<br />
nicht, die Demokratie und die Menschenrechte<br />
anzumahnen. Das ist die Sicht des deutschen<br />
Wirt schafts minis ters auf dieses Land.<br />
Obwohl Philipp Rösler als neun Monate alter<br />
Waisenjunge aus Vietnam adoptiert wurde, obwohl<br />
er Udo Jürgens liebt und seine Heimat Niedersachsen,<br />
ist er nicht so deutsch, wie er gern wäre.<br />
Während er mit den Geschäftsleuten und Journalisten<br />
seiner Wirt schafts dele ga tion von Montag bis<br />
Mittwoch durch das Land reist, schauen sie ihn stets<br />
mit diesem erwartungsvollen Blick an: Wann wird<br />
er endlich zu geben, dass seine Wurzeln hier liegen?<br />
Seine andere Seite, seine besondere Geschichte<br />
machen ihn, den FDP-Chef in der Krise, interessant.<br />
Das ist die Sicht der Deutschen auf ihren Minister<br />
mit Migrationshintergrund.<br />
Und es gibt eine dritte Sicht auf Philipp Rösler<br />
auf dieser Reise. Sie spiegelt sich in den ehrfurchtsvollen<br />
Gesichtern der vietnamesischen Minister, die<br />
ihn mit großen Blumensträußen empfangen. Sie<br />
drückt sich aus in dem Juchzen der Souvenirverkäuferin<br />
im Literaturtempel, die den deutschen<br />
Minister aus dem Fernsehen kennt. In dem Wir-<br />
sind-Vizekanzler-Denken, das er bei so vielen Vietnamesen<br />
hervorruft, weil sie ihn als einen von ihnen<br />
ansehen. Die Vietnamesen denken in Familien, in<br />
Abstammung, und Rösler, das ehemalige Waisenkind,<br />
verkörpert für sie einen Traum: dass jeder<br />
Vietnamese alles erreichen kann, wenn er nur die<br />
Möglichkeiten für seine Selbstentfaltung bekommt.<br />
Sie sprechen ihn mit »Herr Vizekanzler, Minister<br />
für Wirtschaft und Technologie und Vorsitzender<br />
der FDP«, an, sie kennen seine Biografie genau.<br />
»Vietnam hat stolz jeden Erfolg von Philipp<br />
Rösler verfolgt«, sagt der Rektor der Wirtschaftsuniversität<br />
von Hanoi, als er ihm die Ehrendoktorwürde<br />
für seine Verdienste um die deutsch-vietnamesischen<br />
Beziehungen verleiht. Dabei hat sich Rösler<br />
bis zu dieser Reise gar nicht für Vietnam engagiert,<br />
und auch in seiner Dan kes rede spricht er ausdrücklich<br />
von »meinem Heimatland Deutschland«. Er<br />
referiert außerdem über Ludwig Erhard, Otto Graf<br />
Lambsdorff und die Prinzipien der freien Marktwirtschaft,<br />
so als sei er auf einem FDP-Parteitag und<br />
nicht in einem sozialistischen Land. Rösler versucht,<br />
sich zu wehren, er will kein vietnamesischer Volksheld<br />
sein. Als er nach der Zeremonie mit Talar und<br />
Hut ins Freie tritt, atmet er tief durch.<br />
Rösler hat die Frage nach seiner Herkunft oft<br />
gehört, und vielleicht hat er irgendwann angefangen,<br />
seine Antworten zu glauben. Nein, er wolle seine<br />
leiblichen Eltern nicht kennenlernen, er habe schon<br />
welche. Nein, er habe kein Bedürfnis, sein altes<br />
Waisenhaus zu besuchen, bei seinem letzten Besuch<br />
vor sechs Jahren nicht und jetzt auch nicht. Nein,<br />
ihm fehle nichts, schon gar nicht irgendwelche<br />
Wurzeln in Vietnam. Es muss anstrengend sein, die<br />
Herkunft, die er selbst nicht kennt, immer wieder<br />
erklären zu müssen. Vielleicht macht er deshalb<br />
manchmal diese Witze über Schlitz augen oder<br />
Asiaten, die von zu viel Alkohol rot werden. Viel-<br />
leicht will er sich dagegen wehren, dass jeder in ihm<br />
etwas sieht, was er selbst nicht fühlt.<br />
Es ist schwer für Rösler, auf dieser Reise den<br />
Bildern der anderen zu entgehen, die sie auf ihn<br />
projizieren. Der Vorstellung der Vietnamesen, er<br />
kehre zurück in seine Heimat. Der Vorstellung der<br />
Deutschen, er suche nach seinen Wurzeln. Seiner<br />
eigenen Vorstellung, er könne seine Abstammung<br />
einsetzen wie einen Joker, den er mal zückt und mal<br />
versteckt. »Um das Motto des deutschen Mittelstandes<br />
zu zitieren«, sagt er bei einem Empfang der<br />
deutschen Botschafterin in Hanoi: »Es ist egal, wo<br />
du herkommst. Entscheidend ist, wo du hinwillst.«<br />
Was das mit dem deutschen Mittelstand zu tun hat,<br />
bleibt unklar. Aber die Botschaft ist eindeutig.<br />
Was ihn berührt, kann man sehen, als er ein Dorf<br />
mit behinderten Kindern besucht. Es sind Enkel<br />
von Menschen, die im Vietnamkrieg dort lebten,<br />
wo das Giftgas Dioxin versprüht wurde, Agent<br />
Orange. Manche von ihnen können nicht sprechen,<br />
andere haben deformierte Körper. Rösler hat sie<br />
gesehen und an sein eigenes Schicksal gedacht, an<br />
das Glück, mitten im Krieg herausgekommen zu<br />
sein aus diesem Land. Betroffen läuft er durch die<br />
ärmlichen Häuser, in denen die Kinder schlafen,<br />
Krankengymnastik machen und sticken. Er denkt<br />
an seine Adop tion und sagt: »Man stellt sich schon<br />
die Frage, was gewesen wäre, wenn sich meine Eltern<br />
nicht dazu entschieden hätten.«<br />
»Man«, sagt er und meint sich selbst. Er redet<br />
in dieser unpersönlichen dritten Person, er versucht,<br />
das von sich fernzuhalten, was ihm nahegeht.<br />
Vielleicht geht es nicht anders, vielleicht will<br />
er nicht anders. Deutsche und Vietnamesen meinen<br />
zu wissen, wer er sei. Aber kann er das nicht<br />
selbst entscheiden?<br />
A www.zeit.de/audio<br />
Foto: Michael Gottschalk/dapd (Philipp Rösler nach Verleihung d. Ehrendoktorwürde; Hanoi/Vietnam; 17.09.<strong>2012</strong>)<br />
POLITIK<br />
Mail aus: TBILISSI<br />
Von: johannes.voswinkel@zeit.de<br />
Betreff: Gott hatte Pause<br />
Wer es als Beifahrer gefährlich mag, sollte bei<br />
Sasa einsteigen. Der Georgier liebt das Gaspedal<br />
und verachtet feiges Bremsen. Bei jeder<br />
Kirche, an der er vorbeibraust, schlägt er mit<br />
einer Hand das Kreuz vor seiner Brust. Doch<br />
heute ist Gott kurzzeitig verhindert. Beim gewagten<br />
Lückenhüpfen zwischen Tbilissi und<br />
Borschomi fährt Sasa auf das Auto vor ihm<br />
auf. Der Heckspoiler ist gebrochen. Sasa und<br />
der betroffene Fahrer betrachten den Schaden,<br />
einigen sich, und weiter geht es. »Eigentlich<br />
ist mein Vordermann schuld«, sagt Sasa.<br />
Vermutlich, weil er zu dicht vor ihm hergefahren<br />
war. Für einige Kilometer hat Sasa seinen<br />
Schwung verloren. Er flucht leise vor sich hin,<br />
meidet ehrfürchtig die Gegenfahrbahn und<br />
bremst seinen Landcruiser in Ortschaften auf<br />
80 Stundenkilometer herab. In einer schwachen<br />
Minute hält er sogar für einen Fußgänger<br />
am Zebrastreifen. Aber schon bald bricht<br />
der Abenteurertrieb wieder durch. Wenn eine<br />
kurvige Bergstraße zur Ideallinie einlädt, sind<br />
weder knochige Kühe noch qualmende Lastwagen<br />
auf der Fahrbahn ein Argument zur<br />
Vorsicht. Sasa gibt Gas.<br />
Später erzählt Sasa, er habe dem Fahrer des<br />
kaputten Autos großzügig angeboten, den<br />
Schaden zu reparieren. Und wenn der Mann<br />
Ärger gemacht hätte? »Dann hätte ich ihn verprügelt<br />
und wäre weitergefahren«, sagt Sasa,<br />
der früher bei der Spezialpolizei arbeitete und<br />
Kampfsport ohne Regeln trainiert. Da hat<br />
sein Vordermann noch richtig Glück gehabt<br />
mit dem Blechschaden.<br />
Mail aus: PEKING<br />
Von: angela.koeckritz@zeit.de<br />
Betreff: Schlafen bei Ikea<br />
Der Ikea-Laden in Peking ist eine Legende,<br />
nicht wegen der Rockbands, die am Wochenende<br />
im Familienrestaurant spielen. Meist<br />
handelt es sich um gestandene Rocker, denen<br />
die Scham, sich hier die Miete zu verdienen,<br />
deutlich anzusehen ist. Nein, der eigentliche<br />
Grund für die Berühmtheit des Ikea-Ladens<br />
sind die vielen schlafenden Menschen. Sie<br />
lümmeln auf Sofas, liegen auf Betten und<br />
dösen in Liegestühlen. Einige haben die Schuhe<br />
ausgezogen, andere Freund, Freundin, die<br />
ganze Familie mitgebracht.<br />
Immer wieder kreisten Pekinger Gespräche<br />
um die mysteriösen Schlafenden. Sind sie erschöpft<br />
über dem Ikea-Katalog zusammengebrochen?<br />
Wollen sie kein Möbelstück erwerben,<br />
das sie nicht mindestens fünf Stunden<br />
lang erfolgreich beschlafen haben? Nun hat<br />
das parteinahe Blatt Global Times einige<br />
Schlafende geweckt. Da ist etwa der 71-jährige<br />
Rentner Wang, der um sieben Uhr morgens<br />
aufsteht, um den Bus zu Ikea zu nehmen.<br />
»Wir verbringen gerne den ganzen Tag hier«,<br />
sagt er. »Meine Frau und ich haben es satt,<br />
immer zu Hause rumzuhängen oder in Parks<br />
zu gehen. Wir wollen nichts kaufen. Unsere<br />
Kinder leben im Ausland, und manchmal<br />
fühlen wir uns allein. Hier können wir uns<br />
ausruhen, reden, die Klimaanlage genießen<br />
und rausfinden, was es Neues gibt.« Gibt es<br />
eine schönere Bestätigung des Ikea-Slogans:<br />
»Wohnst du noch oder lebst du schon?«
POLITIK<br />
Im ersten Moment denkt man immer: Kann<br />
das gut gehen? Doch dann fällt einem ein,<br />
dass es schon so oft gut gegangen ist, wenn<br />
die CDU zusammen mit Helmut Kohl Helmut<br />
Kohl feiert: runde Geburtstage, Mauerfalljubiläen,<br />
Einheitsfeste und andere Gedenktage<br />
der Parteihistorie. Nächste Woche beispielsweise<br />
jährt sich zum dreißigsten Mal der Tag, an dem<br />
Helmut Kohl Kanzler wurde!<br />
Dass sich eine Partei mit ihrem bedeutendsten<br />
lebenden Repräsentanten schmücken will, um historische<br />
Kontinuität und Größe zu demonstrieren,<br />
ist eigentlich selbstverständlich. Doch wenn Helmut<br />
Kohl, Angela Merkel und Wolfgang Schäuble<br />
aufeinandertreffen, ist nichts selbstverständlich.<br />
Auch über ein Jahrzehnt nach dem Ende der Ära<br />
Kohl sind die Wunden nicht verheilt, die damals<br />
geschlagen wurden. Die gemeinsamen Feierstunden<br />
sind Versuche, Normalität zu zelebrieren, aber<br />
sie zeigen vor allem, dass Normalität sich nicht<br />
einstellen will. Wann immer die drei prägenden<br />
Gestalten der jüngeren CDU-Geschichte zusammenkommen,<br />
erinnern sie an das Drama, in das<br />
sich Politik im Extremfall verwandeln kann. Zu<br />
sehen sind dann die Spielarten der Macht, die offen<br />
brutale und die nüchtern berechnende, und<br />
die Fallen bedingungsloser Loyalität. Es lässt sich<br />
dann studieren, wie aus politischen Freunden<br />
Feinde werden oder wie einer seinen Nachruhm<br />
verdirbt, wenn er zu sehr an ihm interessiert ist.<br />
Und natürlich kann man beobachten, wie sich das<br />
alles mit nüchterner Entschlossenheit in einer Feierstunde<br />
auch wieder verhüllen lässt.<br />
Angela Merkel wird am kommenden Donnerstag<br />
die Laudatio auf Kohl halten. Sie hat darin inzwischen<br />
eine gewisse Übung. Zwar war sie es, die<br />
im Dezember 1999, auf dem Höhepunkt der<br />
CDU-Spendenaffäre, den Bruch mit dem Patriarchen<br />
vollzog; aber seither arbeitet sie an dessen<br />
kontrollierter Reintegration. Von Wolfgang<br />
Schäuble lässt sich das nicht behaupten. Er wird<br />
sich der Festveranstaltung im Deutschen Historischen<br />
Museum nicht entziehen. Aber der einst<br />
wichtigste Helfer Helmut Kohls will nicht Teil einer<br />
Inszenierung werden. Um Missverständnissen<br />
vorzubeugen, hat er gerade noch einmal klargestellt,<br />
wie er zu dem Mann steht, dem er über zwei<br />
Jahrzehnte loyal gedient hat: »Meine Beziehung zu<br />
Helmut Kohl ist beendet.«<br />
Den Altkanzler wird das wahrscheinlich nicht<br />
abhalten, auch diesmal wieder einen seiner demonstrativen<br />
Annäherungsversuche an den einstigen<br />
Freund zu starten. Schäuble wird es kühl<br />
über sich ergehen lassen. »Ich habe wohl schon zu<br />
viel meiner knapp bemessenen Lebenszeit mit dir<br />
verbracht«, mit diesen Worten hat Schäuble im<br />
Januar 2000 die Verbindung zu Kohl gekappt. In<br />
den letzten Jahren hat er sich angewöhnt, ganz<br />
ohne Groll, fast ein wenig gelangweilt über das<br />
Zerwürfnis zu sprechen. Das verstärkt den Eindruck,<br />
es sei endgültig.<br />
Kohl ließ nicht los, wollte noch<br />
einmal gewinnen – oder untergehen<br />
Auf den Fotos vom 1. Oktober 1982, auf denen<br />
Helmut Kohl nach seiner Wahl im Bundestag die<br />
Gratulationen entgegennimmt, steht Schäuble<br />
hinter ihm und applaudiert. Er ist gerade 40 geworden,<br />
ein schmächtiger, konzentriert wirkender<br />
Mann. Dass er einmal die wichtigste Stütze Kohls<br />
werden wird, weiß man da noch nicht. Auch nicht,<br />
dass er nach Jahren größter Loyalität mit ihm brechen<br />
wird. Dass zwei so prägende Politiker, die füreinander,<br />
für ihre Partei und die Republik so wichtig<br />
gewesen sind, sich offen verfeinden, hat es so<br />
noch nicht gegeben.<br />
»Wir sind Freunde«, hat Kohl 1997 einmal erklärt,<br />
»wer das nicht versteht, gehört auf die<br />
Couch.« Noch über die Jahre hinweg glaubt man<br />
den berstend-aggressiven Ton zu hören, den Kohl<br />
anschlug, wenn er Zweifel niederwalzen wollte.<br />
Doch Zweifel an dieser Freundschaft, vor allem<br />
daran, ob der Kanzler seinen treuesten Helfer<br />
wirklich als seinen Nachfolger sehen wollte, waren<br />
nur allzu begründet. Kohl ließ nicht los, wollte<br />
lieber noch einmal gewinnen oder untergehen und<br />
scheiterte dann bei den Wahlen 1998.<br />
Für Schäuble blieb danach nur ein Jahr als<br />
Übergangsvorsitzender und Oppositionsführer.<br />
Nicht er, sondern seine Generalsekretärin Angela<br />
Merkel drängte den Altkanzler in jenes politische<br />
Abseits, aus dem er sich nie mehr ganz herausgearbeitet<br />
hat. So laut kann Angela Merkel am<br />
kommenden Donnerstag ihren großen Vorgänger<br />
gar nicht loben, als dass er ihr diesen Schlag verzeihen<br />
würde.<br />
Wenn man fragt, warum Kohl trotz seiner historischen<br />
Leistungen im Ruhestand nie die vorbehaltlose<br />
Würdigung erfahren hat und warum er<br />
sich mit vielen seiner einstigen Weggefährten überwarf,<br />
stößt man immer auf die gleiche Ursache.<br />
Mehr noch als sein selbstherrliches Verhalten in<br />
der Spendenaffäre war es die rabiate Unduldsamkeit<br />
gegen jede Form von Kritik, mit der Kohl<br />
glaubte, seine Lebensleistung absichern zu müssen.<br />
Der beispiellose Erfolg seiner Kanzlerschaft hätte<br />
ihm eigentlich Generosität verleihen sollen. Doch<br />
Kohl, der wie kein anderer Kanzler seine Erfolge<br />
gegen Widerstand und Häme erkämpfen musste,<br />
ist diesem Modus auch treu geblieben, als selbst<br />
seine Kritiker ihm längst erlegen waren.<br />
Nie ist er dem Gefühl entwachsen, in einem<br />
immerwährenden Kampf seine Leistungen, ja sich<br />
selbst verteidigen zu müssen, nicht nur im Großen,<br />
sondern bis ins Detail; nicht nur gegenüber<br />
politischen Gegnern, sondern selbst gegenüber<br />
Freunden. Seine mehrere Tausend Seiten umfassenden<br />
Memoiren sind Dokumente der Rechthaberei,<br />
ja naiver Selbstverherrlichung. Warum der<br />
Kanzler der Einheit niemals zugestehen konnte,<br />
dass selbst er während seines langen politischen<br />
Wirkens nicht immerzu auf die Wiedervereinigung<br />
hingearbeitet hat, bleibt ein skurriles Rätsel.<br />
Viel mehr als der Starrsinn in der Parteispenden-<br />
affäre war es Kohls Hang, alles seinem Geschichtsbild<br />
zu unterwerfen, der seinen Nachruhm gefährdet.<br />
Er hat sich damit um die verdiente Rolle als<br />
Elder Statesman, als weiser politischer Ratgeber, als<br />
erfahrener Interpret des Zeitgeschehens gebracht.<br />
Die Popularität und Autorität, die ein Brandt, ein<br />
Weizsäcker oder Schmidt im Alter erreichten, ist<br />
ihm verwehrt geblieben. Stattdessen arbeitet er zusammen<br />
mit seiner zweiten Ehefrau am letzten<br />
Band seiner Erinnerungen.<br />
Fotos (Montage DZ): Samuel Kubani/AFP/Getty Images (l.); Marc-Steffen Unger (m.); Daniel Biskup/laif (r.)<br />
Kohls unrühmlicher Abgang in der Spendenaffäre<br />
und Merkels steiler Aufstieg berühren sich<br />
an einem entscheidenden Punkt. Indem sie Kohl<br />
aus dem Weg räumte, der Schäuble mit in den<br />
Abgrund riss, begründete sie ihre Karriere. Kohl<br />
hat gegen sie gewütet, hinter ihrem Rücken intrigiert,<br />
über ihre ostdeutsche Herkunft polemisiert,<br />
ihr die Fähigkeit zur Kanzlerschaft abgesprochen,<br />
nur um am Ende immer wieder erkennen<br />
zu müssen, dass sein Furor ihr nichts anhaben<br />
konnte. Noch im vergangenen Jahr lautete<br />
sein Verdikt: »Die macht mir mein Europa kaputt.«<br />
Und doch hat ihn das Ressentiment gegen<br />
seine ungeliebte Nachfolgerin nie daran gehindert,<br />
sich bei den passenden Anlässen von ihr<br />
hofieren zu lassen.<br />
In letzter Zeit hört man auch anderes: Er<br />
schimpfe nicht mehr so laut über die Kanzlerin wie<br />
früher. Seine harsche Kritik an Merkels Außenpolitik<br />
in einem Interview sei eher ein Versehen als ein<br />
bewusster Affront gewesen, streut ein Kohl-Vertrauter.<br />
Selbst im Kanzleramt wird inzwischen,<br />
halb ungläubig, halb ironisch, für nicht mehr ganz<br />
abwegig gehalten, der Alte taste sich langsam an<br />
die Vorstellung heran, dass die Frau aus Ostdeutschland,<br />
die er einst an seinen Kabinettstisch<br />
holte, vielleicht nicht ganz zu Unrecht Kanzlerin<br />
wurde. Zumindest ihrer machtpolitischen Verve,<br />
die unzweifelhaft an seine Schule erinnert, dürfte<br />
Kohl den Respekt nicht verweigert haben.<br />
Jüngere Berichte über milde Anwandlungen<br />
beim Altkanzler klingen plausibel. Dem 82-Jähri-<br />
In Feindschaft<br />
vereint<br />
Sie haben sich gestützt, bekämpft und gestürzt.<br />
Jetzt feiern sie gemeinsam Helmut Kohl – und teilen die<br />
Sorge um die Rettung Europas VON MATTHIAS GEIS<br />
gen geht es seit Jahren gesundheitlich nicht gut.<br />
Während er im Kopf wach und klar ist, kann er<br />
sich nur noch äußerst mühsam artikulieren. Er<br />
hat sich mit seinem immerwährenden Misstrauen<br />
verausgabt. Er hat mit dem Selbstmord seiner<br />
Frau und dem öffentlich zelebrierten Bruch seines<br />
Sohnes auch schwere private Schicksalsschläge erlitten.<br />
Es muss ihn besonders getroffen haben, wie<br />
sein Sohn Walter aus der familiären Erfahrung<br />
heraus das Bild eines berechnenden, brachialen,<br />
egomanischen Mannes entworfen hat, wie es sonst<br />
nur Kohls ärgste Gegner gezeichnet haben. Dass<br />
der Alte immer auch eine weiche, sentimentale<br />
Ader hat, ist unbestritten. Er weinte am Krankenbett<br />
Wolfgang Schäubles und auf CDU-Parteitagen.<br />
Es würde nicht überraschen, wenn ihn auch<br />
heute bisweilen Stimmungen überkommen, in<br />
denen er versöhnlicher auf seine Nachfolger<br />
blickt. Von Leuten, die ihn besuchen, wird berichtet,<br />
der 82-Jährige wolle in der Zeit, die ihm<br />
noch bleibt, das Verhältnis zu Wolfgang Schäuble<br />
»in Ordnung bringen«. Allerdings zweifeln selbst<br />
wohlwollende Beobachter daran, dass dieser<br />
Wunsch mit der Ahnung einhergehen könnte, er,<br />
Kohl, habe sich im Verhältnis zu seinem früheren<br />
Freund etwas vorzuwerfen. Eine passende Gelegenheit<br />
jedenfalls, die Lebensleistung Schäubles<br />
zu würdigen, hat Kohl gerade ausgeschlagen. Zur<br />
Feier von dessen 70. Geburtstag im Deutschen<br />
Theater, einen Tag vor der Kohl-Sause im Historischen<br />
Museum, war auch der Altkanzler geladen.<br />
Er ließ absagen.<br />
Die Wunden, die sie<br />
einander schlugen,<br />
sind noch<br />
nicht verheilt:<br />
Angela Merkel,<br />
Wolfgang Schäuble<br />
und Helmut Kohl<br />
Seit Schäuble im Januar 2000, nach einem<br />
letzten Versuch, Kohl zur Nennung der Spendernamen<br />
zu bewegen, die Beziehung beendet hat,<br />
lässt er an der Endgültigkeit dieser Entscheidung<br />
keinen Zweifel. Er lebt in dem Zerwürfnis mit<br />
Kohl das Ultimative aus, für das es in seiner politischen<br />
Biografie sonst keinen Ort gibt. Im Laufe<br />
seiner Karriere, besonders an ihren Bruchstellen,<br />
drängte sich immer wieder einmal die Frage auf,<br />
warum der Mann, der für die Politik sogar seine<br />
Gesundheit geopfert hat, von der Politik nicht<br />
lassen wollte. Das Attentat im Oktober 1990, sein<br />
Sturz als Parteivorsitzender im Januar 2000 oder<br />
Merkels Weigerung, ihn als Präsidentschaftskandidaten<br />
zu nominieren, wären jeweils Grund genug<br />
gewesen, sich zurückzuziehen. Aber fasziniert<br />
von der Politik und gefesselt an den Rollstuhl,<br />
blieb Schäuble in Wahrheit gar kein Spielraum für<br />
solche Konsequenz. Er konnte nicht hinschmeißen,<br />
und seine Widersacher wussten das. In den<br />
Machtkämpfen mit Kohl und Merkel hat ihn das<br />
entscheidend geschwächt.<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 3<br />
Wolfgang Schäuble hat sich trotz der schweren<br />
Behinderung mit seiner Disziplin, seinem Intellekt<br />
und seiner ungeheuren Erfahrung für beide politischen<br />
Spitzenämter der Republik empfohlen. Erkämpfen<br />
konnte er sie nicht. Kohl torpedierte seine<br />
Kanzlerschaft, Merkel die Präsidentschaftskandidatur.<br />
Doch nach jedem Rückschlag hat sich<br />
Wolfgang Schäuble auf die neue Lage eingestellt.<br />
Der Mann, der manchmal unduldsam erscheint,<br />
ist im Kern zur Duldsamkeit gezwungen. Nur bei<br />
Kohl, dem er quasi posthum die Freundschaft<br />
kündigte, war er am Ende zur äußersten Konsequenz<br />
bereit.<br />
Darin steckt natürlich auch ein Stück Bitterkeit<br />
über sich selbst, darüber, dass er all die Jahre so<br />
loyal gewesen ist. Und doch hat Wolfgang Schäuble<br />
seinen Dienst an Kohl einmal sehr fein und<br />
selbstbewusst differenziert: Er habe in all den Jahren<br />
nicht getan, was Kohl wollte, sondern, was gut<br />
für den Kanzler gewesen sei. Damit demonstriert<br />
Schäuble noch gegenüber dem Regierungschef das<br />
intellektuelle Überlegenheitsgefühl, das er immer<br />
wieder gerne einmal ausspielt. Und Kohl witterte<br />
wohl selbst bei seinem treuesten Mitarbeiter etwas<br />
von der intellektuellen Überheblichkeit, von der<br />
sich der Mann aus der Provinz sein Leben lang verfolgt<br />
sah.<br />
In dieser Hinsicht kann sich der Altkanzler<br />
über seine Nachfolgerin nicht beklagen. Angela<br />
Merkel ist so intelligent, dass sie es nicht einmal<br />
zeigen muss. Nichts deutet darauf hin, dass sie ihre<br />
Überlegenheit genießt. Demonstrationen der<br />
Macht sind ihr fremd. Wo sie straft, siegt, ins Abseits<br />
drängt, geschieht es berechnend, funktional<br />
und ohne erkennbare Emotion. Sie zieht keine Befriedigung<br />
daraus, andere einzuschüchtern, wie<br />
Kohl, oder daraus, ihnen zu zeigen, dass sie nicht<br />
mithalten können, wie Schäuble. Merkel spielt<br />
nicht mit der Macht. Sie ist allein an deren kalkuliertem<br />
Einsatz interessiert. Dass Kohl, der ein<br />
Machtberserker sein konnte, den Kampf gegen sie<br />
verlor, ist deshalb kein Zufall.<br />
Die Sorge um Europa kettet<br />
das tragische Trio aneinander<br />
Merkel hat Kohls realen Einfluss in der Partei radikal<br />
beschnitten, um ihn als Denkmal wieder<br />
aufzurichten. Und sie hat dem gestürzten Parteichef<br />
Schäuble bedeutet, dass er nur in dem Rahmen,<br />
den sie ihm gewährte, sein politisches Betätigungsfeld<br />
behalten würde. Sie wollte keinen intellektuellen<br />
Überkanzler im Präsidentenamt und<br />
keinen Nebenkanzler im Kabinett. Doch als<br />
Schäuble 2009 hinlänglich bewiesen hatte, dass er<br />
bereit war, die von ihr gesteckten Grenzen zu akzeptieren,<br />
machte ihn Merkel zum Finanzminister<br />
und gab ihm damit den Schlüsseljob in ihrem Kabinett.<br />
So ist Wolfgang Schäuble heute der höchst<br />
seltene Fall eines Politikers, der ganz im Zentrum<br />
der operativen Politik steht und zugleich über<br />
Aura und Autorität eines Elder Statesman verfügt.<br />
Als er im Jahr 2011 an seine gesundheitlichen<br />
Grenzen stieß, war es Angela Merkel, die ihm alle<br />
Zeit zur Genesung gewährte. Inzwischen gehen<br />
sie sogar zusammen ins Kino: Ziemlich beste<br />
Freunde!<br />
Angela Merkel ist eine unerbittliche Machtpolitikerin.<br />
Doch sobald sie gesiegt hat, geht sie dazu<br />
über, neue Arrangements zu suchen. Das ist<br />
machtpolitische Nachbereitung, und im besten<br />
Falle für beide Seiten nützlich. So ist es für die<br />
Vorsitzende einer Partei, die nach den Wenden<br />
und Modernisierungsschüben der letzten Jahre<br />
entkernt wirkt, durchaus sinnvoll, dem machtlos<br />
gewordenen Patriarchen einen symbolischen Wirkungsraum<br />
in der Partei einzuräumen. Ein Besuch<br />
beim Altkanzler mit Streuselkuchen auf der Terrasse<br />
in Oggersheim passt in jedes Wahljahr. Merkel<br />
weiß, dass man einen Helmut Kohl nicht aus<br />
der Geschichte der Union herausoperieren kann,<br />
ohne die Identität der CDU zu beschädigen. So<br />
entschieden sie einst den Altkanzler vorübergehend<br />
exkommunizierte, so entschieden hofiert sie<br />
ihn seither. Von irgendwelchen Emotionen lässt<br />
sie sich dabei nicht beirren.<br />
Nun werden Kohl, Merkel und Schäuble in der<br />
kommenden Woche zusammenkommen, um sich<br />
an den Anfang der Ära Kohl zu erinnern. Damals<br />
begann, mit der deutschen Einheit als Höhepunkt,<br />
die vielleicht erfolgreichste Phase in der<br />
Geschichte der Union. Das wird gefeiert. Mit einem<br />
Anflug jenes Glücksstolzes, den er auf den<br />
Gratulationsfotos von 1982 ausstrahlt, wird Kohl<br />
der Laudatio seiner Nachfolgerin lauschen. Sie<br />
wird seine historischen Verdienste so stark ausleuchten,<br />
dass alle Unstimmigkeiten verschwinden.<br />
Und Wolfgang Schäuble wird dazu mal milde,<br />
mal maliziös lächeln.<br />
Vielleicht gibt es ja wirklich Wichtigeres als die<br />
Wunden und Brüche von einst. Mit der europäischen<br />
Krise steht ein Thema auf der politischen<br />
Tagesordnung, das die drei nicht nur beim Blick in<br />
die Vergangenheit, sondern in Zukunft an ein ander<br />
kettet. Helmut Kohls historische Bilanz ist<br />
plötzlich von der Frage überschattet, ob die Einführung<br />
des Euro der späte Höhepunkt seiner<br />
Kanzlerschaft oder doch deren gefährlichste Weichenstellung<br />
markiert. Auch Wolfgang Schäuble<br />
sieht mit der europäischen Krise eine Leitlinie seiner<br />
politischen Biografie in Gefahr. Und selbst<br />
Angela Merkel, der man auch in europäischen<br />
Fragen am ehesten Nüchternheit zutraut, zeigt sich<br />
im kleinen Kreis von der Vorstellung erschüttert,<br />
der Euro und damit das europäische Einigungsprojekt<br />
könne ausgerechnet unter ihrer Verantwortung<br />
scheitern.<br />
Sie sind das tragische Trio der deutschen Politik.<br />
Sie haben sich gegenseitig bekämpft und verwünscht.<br />
Die Arrangements, die sie gefunden haben,<br />
bleiben prekär. Den Wunsch nach einem<br />
Ausweg aus der europäischen Krise haben sie gemeinsam.<br />
Siehe auch Geschichte, Seite 18
Heinz Buschkowski in<br />
seinem Büro im<br />
Rathaus von Neukölln<br />
Problem Neukölln<br />
Neukölln ist ein Berliner Stadtteil mit<br />
160 000 Einwohnern, er ist ein Teil<br />
des gleichnamigen im Süden der Bundeshauptstadt<br />
gelegenen Verwaltungsbezirks.<br />
Unter den Bewohnern Neuköllns<br />
sind zahlreiche Migranten<br />
überwiegend türkischer Herkunft,<br />
es leben aber auch viele arabischstämmige<br />
Einwanderer hier. Wegen der<br />
hohen Kriminalitätsrate gilt Neukölln<br />
als sozialer Brennpunkt, bundesweit<br />
machte der Stadtteil Schlagzeilen, als<br />
vor sechs Jahren Lehrer der damaligen<br />
Rütli-Schule deren Schließung verlangten,<br />
weil sie mit gewalttätigen<br />
Schülern nicht mehr zurechtkamen.<br />
Heinz Buschkowsky, Bezirksbürgermeister<br />
von Neukölln, hat jetzt ein<br />
Buch über den Bezirk und seine Arbeit<br />
geschrieben: Es heißt »Neukölln<br />
ist überall« und erscheint morgen. Er<br />
beschreibt die Probleme der Einwanderungsgesellschaft,<br />
wie er sie sieht:<br />
Jugendbanden, die Angst verbreiten,<br />
Kinderarmut, Burkas, Eltern, die ihre<br />
Kinder nicht in die Schule schicken,<br />
Arbeitslosigkeit, eine ignorante und<br />
beschönigende Integrationspolitik<br />
und Überfremdungsängste der deutschen<br />
Bevölkerung.<br />
4 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> POLITIK<br />
»Da helfe ich gerne<br />
beim Kofferpacken«<br />
Heinz Buschkowski, Bürgermeister von Neukölln, über<br />
Integrationsverweigerer, Rassisten zweier Sorten –<br />
und die Frage, warum es im Gefängnis kein Schweinefl eisch gibt<br />
<strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>: Herr Buschkowsky, was unterscheidet<br />
Sie von Thilo Sarrazin?<br />
Heinz Buschkowsky: Ich weiß, wovon ich rede. Was<br />
ich beschreibe, ist das wirkliche Leben, was mich<br />
täglich umgibt.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Sind Sie nicht eigentlich Sarrazin light – dieselben<br />
Thesen, nur ohne kruden Biologismus?<br />
Buschkowsky: Ich setze Menschen im Unterschied<br />
zu ihm nicht herab. Aber wieso dieselben Thesen?<br />
Ich fordere eine Integrationspolitik, die endlich<br />
Ernst macht mit Chancengerechtigkeit auch für<br />
Einwandererkinder, weil wir sie zum Fortbestand<br />
unserer Gesellschaft dringend brauchen. Eine Bildungspolitik,<br />
die endlich begreift, dass bildungsferne<br />
Elternhäuser ihren Kindern nicht helfen. Und<br />
ich fordere eine Gesellschaft, die nicht wegschaut<br />
von dem, was sich in unseren Städten tut.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Gibt es Rassismus in Neukölln?<br />
Buschkowsky: Es gab einige böse Einzelvorfälle.<br />
Trotzdem ist es kein dominantes Bezirksthema. In<br />
einem Ortsteil gibt es acht, neun polizeibekannte<br />
Neonazis, richtige Vollpfosten, die vor Ort ein ausgesprochenes<br />
Ärgernis sind. Aber im Gesamtbezirk<br />
hat die NPD im letzten Jahr bei den Wahlen 3500<br />
Stimmen, noch nicht einmal drei Prozent, erhalten.<br />
Gemessen daran, womit die Bürger in Neukölln<br />
täglich in Form von sozialen Verwerfungen, Arbeitslosigkeit,<br />
Armut, Bildungsferne und sonstigen<br />
Dingen, die die Welt nicht braucht, konfrontiert<br />
werden, ist dieses ver irrte Pro test poten zial doch<br />
recht bescheiden.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Gibt es einen umgekehrten Rassismus unter<br />
den Migranten gegen die Deutschen?<br />
Buschkowsky: Warum sollten sich Einwanderer<br />
anders verhalten als Eingeborene? Der Rassismus<br />
hält sich die Waage und liefert immer wieder das<br />
Alibi für die andere Seite. »Isst du Schwein, bist du<br />
Schwein«, das sind so die netten Sachen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Sind Sie schon einmal bedroht worden?<br />
Buschkowsky: Von Einwanderern? Nein, noch nie.<br />
Von Linksradikalen öfter.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Nie von Migranten?<br />
Buschkowsky: Null! Im Gegenteil. Sogar die Intensivtäter,<br />
die ich persönlich kenne, rufen über die<br />
Straße: Hallo, Bürgermeister, geht es dir gut? Was<br />
sie wollen, ist ein Foto machen. Die größte Zuneigung<br />
aus ihrer Sicht war die Ansprache: »Bürgermeister,<br />
hast du Feinde? Sag uns Bescheid, wir<br />
kämpfen für dich.«<br />
<strong>ZEIT</strong>: Was wollen Sie mit Ihrem Buch erreichen?<br />
Buschkowsky: Ich möchte denen, die sich im Alltag<br />
mit der In te gra tion aus ein an der-<br />
set zen, Mut machen. Erzieherinnen<br />
und Lehrerinnen sagen mir,<br />
wie alleingelassen sie sich fühlen.<br />
Was sie entmutigt, sind nicht die<br />
Probleme im Job. Sondern die klugen<br />
Sprüche von der Metaebene:<br />
»Was du erlebst, ist nur ein Einzelfall,<br />
vielleicht bist du es falsch angegangen,<br />
hast provoziert; du bist<br />
nicht kultursensibel; es ist alles nur<br />
gefühlt, oder du bist islamophob<br />
und denkst rassistisch.« Ich zumindest weiß, welchem<br />
täglichen Kampf eine Schulleiterin standhalten<br />
muss, wenn sie nur sagt, an meiner Grundstufe<br />
gibt es keine Kopftücher, und nach dem Sport wird<br />
geduscht. Jede Woche einem brüllenden, wild gewordenen<br />
arabischen Vater Paroli zu bieten, das<br />
schaffen auf Dauer nur wenige.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Die Bild-Zeitung druckt Textcollagen aus<br />
Ihrem Buch, in denen Migranten nur als aggressive<br />
Schläger vorkommen, die unsere Ordnung bedrohen<br />
und die Gesetze missachten.<br />
» Warum sollten sich<br />
Einwanderer anders<br />
verhalten als Eingeborene?<br />
Der Rassismus<br />
hält sich die Waage –<br />
›Isst du Schwein, bist<br />
du Schwein‹ «<br />
Buschkowsky: Ich kann Ihre Zusammenfassung aus<br />
dem Vorabdruck und meinem Buch nicht nachvollziehen.<br />
Das vollständige Manuskript liegt auch<br />
Ihnen seit Wochen vor. Ich äußere mich darin an<br />
vielen Stellen über gelungene Integrationen und<br />
Erfolge bei der Integrationspolitik.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Sie fokussieren sich auf die Probleme.<br />
Buschkowsky: Das sehe ich anders. Aber wenn mir<br />
die Verkehrssicherheit an einer Kreuzung Sorgen<br />
macht, dann zähle ich ja auch nicht die Autos, die<br />
unfallfrei rübergefahren sind, ich zähle die Unfälle.<br />
Bei der Bildung haben wir Unfälle. 60 Prozent der<br />
migrantischen Schulabgänger haben hier keinen<br />
Schulabschluss oder nur den Hauptschulabschluss.<br />
Die interessieren mich!<br />
<strong>ZEIT</strong>: Dass heute doppelt so viele Migranten Abitur<br />
machen wie noch vor zehn Jahren, das wischen<br />
Sie einfach weg.<br />
Buschkowsky: Das ist doch das Totschlagargument<br />
in jeder Dis kus sion. Ergänzt noch um den Hinweis,<br />
wir sollten uns an den positiven Beispielen orientieren.<br />
Das ist leider eine Minderheit. Wir müssen uns<br />
um die kümmern und uns auf diejenigen konzentrieren,<br />
die sonst Opfer des Milieus werden.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Die Erfolge der Integration in Neukölln sind<br />
Ihnen nicht der Rede wert?<br />
Buschkowsky: Doch, an einigen bin ich sogar nicht<br />
ganz unschuldig. Trotzdem muss ich beschreiben, wie<br />
die soziale Schieflage in bestimmten Stadtvierteln<br />
immer schlimmer wird. Der Anteil der Kinder, die in<br />
der Unterschicht aufwachsen, wird immer größer. In<br />
dem Gebiet, in dem wir gerade sitzen, leben 75 Prozent<br />
aller Kinder unter 14 Jahren von Hartz IV – 75<br />
Prozent! Alle diese Kinder werden sozialisiert, ohne<br />
dass sie je miterleben, dass Papa oder Mama morgens<br />
aufstehen und zur Arbeit gehen. Ich freue mich über<br />
die gut 300 Einwanderer-Abiturienten, die wir hier<br />
jedes Jahr hervorbringen, aber ihnen stehen auch über<br />
700 Schulabgänger ohne Abschluss oder mit Hauptschulabschluss<br />
gegenüber. Die mit den schlechten<br />
Noten bleiben, die Abiturienten ziehen fort.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Wie wollen Sie die halten?<br />
Buschkowsky: Wenn ich dafür ein Patentrezept<br />
hätte, müsste ich mein Geld nicht als Bezirksbürgermeister<br />
verdienen. Ich weiß aber, Neukölln-<br />
Nord wird sich zu einer Einwandererstadt entwickeln,<br />
und zwar nicht, weil ich Hellseher bin, sondern<br />
weil die Bürger von morgen heute schon da<br />
sind. In 10 bis 15 Jahren wird Neukölln-Nord mit<br />
seinen 160 000 Einwohnern einen Einwandereranteil<br />
von etwa 80 Prozent haben.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Sie fordern Toleranz.<br />
Buschkowsky: Ich fordere Toleranz<br />
und Akzeptanz. Toleranz<br />
der Gesellschaft für neue kulturelle<br />
Einflüsse. Aber auch Akzeptanz<br />
der Einwanderer gegenüber<br />
der Kultur, in die sie sich freiwillig<br />
begeben haben. Wer darauf<br />
besteht, dass seine Frau in der<br />
Burka herumläuft, der kann das<br />
gerne tun. Zum Beispiel in Afghanistan<br />
oder Pakistan.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Aber nicht hier?<br />
Buschkowsky: Aber nicht hier!<br />
<strong>ZEIT</strong>: Warum tolerieren wir es nicht, wenn eine<br />
Frau ganz selbstbestimmt die Burka tragen will?<br />
Buschkowsky: Ich toleriere das schon, aber es muss<br />
erlaubt sein, zu sagen, dass ich es weder schön finde<br />
noch in Mitteleuropa für angemessen halte. Ist es<br />
denn in Ordnung, dass jemand in einen anderen<br />
Kulturkreis kommt und sagt, die Lebensregeln dieser<br />
Gesellschaft sind mir völlig egal?<br />
<strong>ZEIT</strong>: Was ist Ihre Antwort?<br />
Buschkowsky: Wir müssen versuchen, dieses Aufwachsen<br />
von archaischen Lebensweisen und tradierten<br />
Strukturen zu verhindern. Das geht nur,<br />
wenn die Kinder von heute und Eltern von morgen<br />
das Gefühl entwickeln: Meine Kinder sollen einen<br />
besseren Start ins Leben finden. Sie sollen nicht das<br />
durchmachen, was ich durchgemacht habe. Mit<br />
dieser Botschaft bin auch ich groß geworden.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Sie sind in einer Kellerwohnung hier in Neukölln<br />
aufgewachsen ...<br />
Buschkowsky: In den fünfziger Jahren haben viele<br />
Menschen in Kellern gewohnt.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Sie sind ein richtiger Aufsteiger?<br />
Buschkowsky: Ja, und ich schäme mich dessen nicht.<br />
Ich liebe dieses Land. Ich sehe an mir selbst, dass es<br />
jedem Menschen die Möglichkeit bietet, den gesellschaftlichen<br />
Aufstieg zu schaffen, wenn er es denn<br />
will. Meine Eltern haben dafür gesorgt. Bei den Einwanderern<br />
ist es teilweise schon deswegen komplizierter,<br />
weil sie die Ankunft und das Leben in Deutschland<br />
selbst im Sozialsystem bereits als Aufstieg und<br />
das Erreichen des erträumten Wohl-<br />
stands empfinden. Sie beten dann:<br />
»Gott oder Allah, gib, dass sich<br />
nichts ändert.«<br />
<strong>ZEIT</strong>: Der Islam ist Ihnen nicht so<br />
richtig ans Herz gewachsen?<br />
Buschkowsky: Der Katholizismus<br />
auch nicht.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Für Sie sind alle Religionen<br />
...<br />
Buschkowsky: ... gleich fern. Ich<br />
führe ein re li gions frei es Leben. Ob<br />
jemand fünfmal gen Mekka oder zweimal zur Jungfrau<br />
Maria betet, ist mir völlig egal. Mir gehen nur<br />
die Aggressivität von Heilsbringern und die Selbsterhöhung<br />
zu besseren Menschen auf den Zünder.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Ist der Islam eine aggressive Religion?<br />
Buschkowsky: Zumindest hat er im Moment die<br />
aggressivsten Anhänger.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Nerven Sie die ständigen Forderungen, hier<br />
eine Moschee, da eine Moschee?<br />
Buschkowsky: Die Muslime können so viele Moscheen<br />
bauen, wie sie für ihre Religionsausübung<br />
benötigen. Mein Anspruch ist nur, dass man meine<br />
Distanz respektiert. Auch die Gesellschaft muss zur<br />
Wahrung des sozialen Friedens Wert darauf legen,<br />
dass sie nicht durch Minderheiten tyrannisiert<br />
wird. Wenn bei uns 70 Prozent der Insassen im Jugendarrest<br />
Muslime sind, gibt es eben für die anderen<br />
30 Prozent kein Schweinefleisch mehr.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Warum nicht? Im Arrest haben doch nicht<br />
die Muslime zu bestimmen, was gegessen wird.<br />
Buschkowsky: Da kommt die Verwaltung und sagt,<br />
es lohnt sich nicht, zwei Essen zu machen. Ich stelle<br />
mir einfach mal vor, wir haben umgedreht 70 Prozent<br />
Christen und 30 Prozent Muslime. Müssen<br />
dann alle Schweinekoteletts essen? Wohl kaum.<br />
Wäre auch nicht richtig.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Dann also mehr Christen in den Knast?<br />
Buschkowsky: Der Islam als Religion ist nicht mein<br />
Thema. Aber Überfrömmigkeit kann den Blick verstellen.<br />
Was mich stört, ist dieses ständige »Wir sind<br />
die reineren Menschen, wir führen ein gottesfürchtiges<br />
Leben, haben eine höhere Moral, befolgen den<br />
Koran und verachten Ungläubige«. Haben Sie solche<br />
Auftritte schon mal von Hindus erlebt? Von Juden?<br />
<strong>ZEIT</strong>: Das geht doch auch Muslimen auf die Nerven.<br />
Buschkowsky: Na klar. So wie es viele Katholiken<br />
gibt, denen die Familienpolitik des Vatikans auf die<br />
Nerven geht. Warum ziehen denn hier die integrierten<br />
und etwas besser situierten Einwanderer<br />
weg? Denen ist der Fundamentalismus und der<br />
Rücksturz um 200 Jahre zuwider. Wie formulierte<br />
» Auf Regelverletzungen<br />
müssen wir schnell<br />
und effektiv reagieren.<br />
Kommt das Kind<br />
nicht in die Schule,<br />
kommt das Kindergeld<br />
nicht aufs Konto «<br />
es eine türkische Sozialarbeiterin? Herr Buschkowsky,<br />
tun Sie etwas, damit diese Menschen nicht<br />
unser Land ruinieren! O-Ton!<br />
<strong>ZEIT</strong>: Und, wie schaffen Sie das?<br />
Buschkowsky: Wir müssen dort, wo alle Regeln für<br />
einen unverbindlichen Ulk gehalten werden, um<br />
den man sich nicht zu kümmern braucht, hin und<br />
wieder die Ohren lang ziehen. Auch Integrationspolitik<br />
kommt ohne Sanktionen nicht aus. Falschparken<br />
wiegt bei uns schwerer als Schulschwänzen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Wie wollen Sie das ändern?<br />
Buschkowsky: Wir brauchen ein gesellschaftliches<br />
System, das schnell und effektiv auf Regelverletzungen<br />
reagiert. Wie in den Niederlanden. Dort<br />
stehen staatliche Unterstützung und Hilfe zum regelkonformen<br />
Verhalten in einem direkten Verhältnis.<br />
Die Ansage ist klar: Wenn du nicht mitspielst,<br />
ist die Sozialhilfe perdu. Das kennen wir bei<br />
uns so nicht. Klaus Wowereit geht sogar so weit, zu<br />
sagen: »Wenn Bußgelder aus der So zial hil fe bezahlt<br />
werden, kommen wir an den Punkt, wo die Kinder<br />
verhungern.« Wo sind wir denn,<br />
dass ein Länderchef so einen<br />
Stuss schreibt?<br />
<strong>ZEIT</strong>: Wo fehlen klare Regeln?<br />
Buschkowsky: Ich möchte, dass<br />
die Einwanderer die Kul tur riten<br />
und die Regeln des Zusammenlebens<br />
dieses Landes respektieren.<br />
Dazu gehört, dass jeder die<br />
gleiche Chance erhält, ein selbstbestimmtes<br />
Leben zu führen.<br />
Darauf haben als Allererstes die<br />
Eltern hinzuwirken. Wenn sie selbst nicht über die<br />
Kompetenzen verfügen, erwarte ich, dass sie ihre<br />
Kinder so früh wie möglich in den Kindergarten<br />
bringen und dafür sorgen, dass sie regelmäßig zur<br />
Schule gehen und die Sprache des Landes lernen, in<br />
dem sie leben. Ich bin für Kindergartenpflicht und<br />
Ganztagsschulen als Regelangebot. Wo Staat dransteht,<br />
muss auch Staat drin sein. Kommt das Kind<br />
nicht in die Schule, kommt das Kindergeld nicht auf<br />
das Konto. Klarer Fall. Die Gesellschaft muss dafür<br />
die Infrastruktur bereitstellen. Aber auch die Einwanderer<br />
müssen sich bewegen. In der Stadtbücherei<br />
bekommen die Kinder die Bücher umsonst. Man<br />
braucht kein Geld, um zu lernen. Wer nicht vormachen<br />
kann, muss wenigstens motivieren. Ich habe da<br />
eine klare Linie. Familien, die Jahrzehnte hier leben<br />
und ihren Kindern den Weg in die Gesellschaft versperren,<br />
würde ich gern beim Kofferpacken helfen,<br />
ehrlich, weil, so wird das nichts.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Die ehemalige Berliner Ausländerbeauftragte<br />
Barbara John hat mal gesagt, das Haupt inte grations<br />
hin der nis in Deutschland sei der deutsche Sozial<br />
staat. Stimmt das?<br />
Buschkowsky: Wir verfolgen ein Prinzip des gesellschaftlichen<br />
Ablasshandels: Auf jedes Problem einen<br />
Geldschein, und gut ist. Wir sagen, hier hast<br />
du deinen Scheck, hol dir ein Sixpack, geh nach<br />
Hause, und halt den Mund. Wir erkaufen uns sozialen<br />
Frieden, wir fordern die Menschen aber nicht<br />
auf, zu zeigen, was sie können.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Sie sind in Neukölln geboren und aufgewachsen,<br />
Sie haben Ihr ganzes Leben hier verbracht.<br />
Werden Sie Neukölln je verlassen?<br />
Buschkowsky: Ob ich als stark vorgealterter Mann<br />
einmal Lust verspüre, beim Frühstück auf die Ostsee<br />
zu schauen, weiß ich noch nicht. Im Moment<br />
habe ich hier noch genug zu tun. Den Kili mandscharo<br />
zu besteigen oder gegrillte Heuschrecken in<br />
Asien zu essen, darauf habe ich keinen Bock.<br />
Die Fragen stellten ÖZLEM TOPÇU und HEINRICH WEFING<br />
Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky in seinem Amtszimmer in Neukölln/Berlin (24.08.<strong>2012</strong>); gesehen von Anatol Kotte für <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>
POLITIK<br />
NSU – warum<br />
mauern<br />
die Behörden?<br />
Wird Ilse Aigner<br />
Regierungschefin<br />
in Bayern?<br />
ANALYSEN<br />
Nach fast einem Jahr NSU-Untersuchungsausschuss<br />
hat die Republik bereits einen<br />
guten Eindruck davon, warum es den Sicherheitsbehörden<br />
beinahe 14 Jahre lang nicht gelungen<br />
ist, das Trio der zehnfachen Mörder aus<br />
Zwickau auch nur zu erkennen, geschweige denn zu<br />
fassen. Im Zentrum des Versagens steht eine Kultur<br />
des Misstrauens: Landesämter gegen Bund, Polizei<br />
gegen Verfassungsschutz, bei Letzterem die Kölner<br />
Abteilung für Rechtsextremismus und -terrorismus<br />
gegen die Zentrale in Berlin.<br />
Die jüngsten Nachrichten gehen über diesen<br />
Befund hinaus. Die Verbindung zwischen Verfassungsschutz<br />
und Tätermilieu ist eben doch enger als<br />
bislang bekannt. Das Berliner Landeskriminalamt<br />
hat jahrelang einen V-Mann beschäftigt, der dem<br />
Zwickauer Trio Sprengstoff besorgt hatte und noch<br />
2005 wegen Volksverhetzung verurteilt worden<br />
war. Und die Hinweise, die dieser V-Mann aufgrund<br />
seiner ideologischen Nähe zu den Tätern lieferte,<br />
sind nicht einmal verwendet worden. So unglaublich<br />
es scheint: Womöglich ging der Quellenschutz<br />
in diesem Fall so weit, dass selbst die Verfolgung<br />
von Mordtaten dahinter zurückstehen sollte.<br />
Der Fall des Mordes an dem hessischen Internetcafé-Betreiber<br />
Halit Yozgat deutet in dieselbe Rich-<br />
Ilse Aigners Entscheidung, für den bayerischen<br />
Landtag zu kandidieren, ist eine Vorentscheidung<br />
und die wichtigste Personalie der CSU in<br />
jüngster Zeit: Wenn die Bundeslandwirtschaftsministerin<br />
gesund bleibt und sie kein Lebensmittel-<br />
oder sonstiger Skandal ereilt, dann hat die 47-Jährige<br />
beste Aussichten, die Nachfolge des Parteivorsitzenden<br />
und Ministerpräsidenten Horst Seehofer<br />
anzutreten. Der bayerische Finanzminister Markus<br />
Söder und seine Kollegin Sozialministerin Christine<br />
Haderthauer, denen ebenfalls Ambitionen nachgesagt<br />
werden, rücken damit auf die hinteren Plätze<br />
der bayerischen Erbfolge. Söder freute sich denn<br />
auch über die »Verstärkung«, Haderthauer erkannte<br />
eine interessante Ergänzung: Sie selbst sei eine Frau<br />
mit Familie, Aigner dagegen kinderlos und alleinstehend.<br />
So klingt es, wenn man eine Spitze in ein<br />
vermeintliches Lob verpacken will.<br />
In der Partei ist die gelernte Radio- und Fernsehtechnikerin<br />
Aigner beliebt, als Vorsitzende des mitgliederstarken<br />
Bezirks Oberbayern ist sie mächtig<br />
und wichtig. Dort, in München und Umgebung,<br />
hat die CSU ihre meisten Wähler, hier fuhr sie bei<br />
der letzten Landtagswahl auch die größten Verluste<br />
ein, rund 20 Prozent, so viel, wie keine Volkspartei<br />
tung. Hier hatte der Verfassungsschutz eine Anfrage<br />
der Mordkommission auf Vernehmung zweier<br />
V-Leute ganz offiziell mit dem Hinweis angelehnt,<br />
das »Wohl des Landes Hessen« stehe über der Verfolgung<br />
einer Mordtat. Der damalige Innenminister<br />
und heutige Ministerpräsident Volker Bouffier<br />
(CDU) verteidigte diese Sicht der Dinge.<br />
In beiden Vorgängen deutet sich ein brisanter<br />
politischer Befund an: Weil man nicht an organisierten<br />
rechten Terror glaubte, hat man nicht gesehen,<br />
mit wem man sich da einließ, vor allem bei den<br />
V-Leuten aus der Nazi-Szene um die Organisation<br />
von »Blood and Honour«. Der Berliner Innensenator<br />
Frank Henkel (CDU) hielt es nicht für nötig,<br />
dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss<br />
Akten über einen Informanten der Polizei zukommen<br />
zu lassen, was im günstigsten Fall ein neuerlicher<br />
Beleg für die miserable Zusammenarbeit der<br />
Sicherheitsbehörden sein könnte, aber auch ein<br />
Hinweis, dass es da etwas zu verbergen gab.<br />
Der Ausschussvorsitzende Sebastian Edathy<br />
(SPD) ist sicher, dass die Behörden im Kampf gegen<br />
den rechten Terror versagt haben, weil sie nicht<br />
gewinnen wollten. Weil die Opfer Migranten waren.<br />
Weil man nach dem 11. September 2001 alle<br />
Kraft auf die Verfolgung des islamistischen Terrors<br />
in den vergangenen Jahren irgendwo in Europa.<br />
Die Folge war der Verlust der absoluten Mehrheit<br />
und die Koalition mit der FDP, ein Trauma für die<br />
selbstbewussten Christsozialen. Bei der nächsten<br />
Landtagswahl, der »Mutter aller Schlachten«, wie<br />
Parteichef Seehofer gerne sagt, kommt es deshalb<br />
besonders auf die Oberbayern an.<br />
Die Beliebtheit der 47-Jährigen rührt daher, dass<br />
sie sich aus innerparteilichen Konflikten meist heraushält<br />
und eher hinter den Kulissen vermittelt, als<br />
sich über Interviews zu positionieren. Beim letzten<br />
Parteitag der CSU etwa kandidierte der Parteirebell<br />
Peter Gauweiler überraschend für einen der Vizepos<br />
ten, Verkehrsminister Peter Ramsauer drohte,<br />
düpiert zu werden. Aigner sei es gewesen, die Ramsauer<br />
gerettet habe, hieß es, nachdem der sich<br />
durchgesetzt hatte.<br />
Nun hat sie zum zweiten Mal in eigener Sache<br />
eine Machtentscheidung getroffen. Die erste traf<br />
sie, als sie vor gut einem Jahr für den Vorsitz des<br />
Bezirks Oberbayern kandidierte. Damals riskierte<br />
sie die Freundschaft zum damaligen Finanzminister<br />
Georg Fahrenschon, der neben Karl-Theodor zu<br />
Guttenberg lange als Kronprinz galt. Als sie den<br />
Bezirk Oberbayern übernahm, wurde Aigner qua<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 5<br />
konzentrierte und so für die braunen Netzwerke<br />
keine Kapazitäten mehr hatte.<br />
In Wahrheit ist es wohl etwas komplizierter. Der<br />
Verfassungsschutz entstand nach dem Krieg auf<br />
Anregung der Alliierten, die der deutschen Demokratiefestigkeit<br />
noch nicht recht über den Weg trauten.<br />
Auch die Fragmentierung des Dienstes ist historisch<br />
begründet: Aus Angst vor einer Geheimen<br />
Staatspolizei, die sowohl überwachen als auch strafen<br />
darf, operieren die Behörden dezentral, teilweise<br />
in Parallelwelten, die eifersüchtig zuallererst an ihrer<br />
Selbstlegitimation arbeiten. So ergänzt sich eine<br />
untaugliche Organisationsform mit einer Kultur<br />
der Nicht-Zusammenarbeit und einem politischen<br />
Fehlurteil zu einer fatalen Mischung. Zehn Einwanderer<br />
sind deshalb gestorben.<br />
In dieser Lage hat der Bundesinnenminister ein<br />
paar richtungsweisende Reformen in Gang gesetzt.<br />
Die Dienste sollen sich auf reale Gefahren konzen-<br />
trieren, nicht auf Ideen. Sie sollen zur Zusammenarbeit<br />
gezwungen werden, in den Abwehrzentren gegen<br />
Terror und Rechtsextremismus, die Bund-Länder-<br />
Kommissionen sind, obwohl sie niemand so nennen<br />
darf. Und schließlich soll das Parlament mehr Einblick<br />
bekommen. Wo, wenn nicht dort, sollte eine Erfolgskontrolle<br />
stattfinden? MARIAM LAU<br />
Amt die designierte Nachfolgerin Seehofers. Ihr<br />
Schritt jetzt ist die logische Konsequenz daraus.<br />
Aigner wird nachgesagt, sie habe ein gutes Gespür<br />
für die Stimmung in der Partei und »ein unglaublich<br />
dickes Telefonbuch«. In 14 Jahren Bundestag<br />
hat sie sich ein dichtes Netzwerk geschaffen.<br />
Aus öffentlichen ideologischen und machtpolitischen<br />
Debatten hält Aigner sich heraus. Beim Betreuungsgeld<br />
etwa vertritt sie nach außen die offizielle<br />
Parteilinie; was sie wirklich darüber denkt,<br />
wissen selbst Parteifreunde nicht. Gerda Hasselfeldt,<br />
die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im<br />
Bundestag, und Innenminister Hans-Peter Friedrich,<br />
die beide ebenfalls eher nüchtern und pragmatisch<br />
daherkommen, gehören zu ihren engsten<br />
Vertrauten in Berlin. Als Landwirtschaftsministerin<br />
gilt Aigner als schwache Besetzung. Sollte es<br />
2013 in Berlin zu einer Großen Koalition kommen,<br />
hätte sie als Nichtjuristin kaum Chancen auf<br />
ein Verfassungs- oder anderes starkes Ressort. Auch<br />
das dürfte bei ihrer Entscheidung für Bayern eine<br />
Rolle gespielt haben: In Berlin sind ihre Karriereaussichten<br />
begrenzt, in München kann Ilse Aigner<br />
als erste Frau an der Spitze des Freistaats noch Geschichte<br />
schreiben. TINA HILDEBRANDT<br />
Fotos [M]: Frank Doebert/Ostthueringer Zeitung/dapd (o.); Uwe Lein/dapd
6 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> POLITIK<br />
Eine Frage der Perspektive: Blick auf den Volkszorn gegen den Mohammed-Film in Sanaa, Jemen<br />
Die Legende vom Flächenbrand<br />
Gewalttätige Proteste gegen einen verrückten Film – das ist nicht das Ergebnis des Arabischen Frühlings. Hier randalieren die Verlierer der Revolution<br />
Das hat der Westen, denken jetzt viele,<br />
von der Befreiung der Muslime: Ein<br />
lächerlicher Film über ihren Propheten<br />
genügt, um sie Botschaften<br />
in Brand stecken und Unschuldige<br />
lynchen zu lassen. Ausgerechnet in Libyen, in Bengasi,<br />
der Wiege der Anti-Gaddafi-Revolution, kam<br />
der amerikanische Botschafter bei einem Angriff<br />
von Islamisten ums Leben. Sichtlich geschockt,<br />
fragte Hillary Clinton: »Wie konnte<br />
das in einem Land passieren, das wir<br />
geholfen haben zu befreien, in einer<br />
Stadt, die wir von der Zerstörung bewahrt<br />
haben?« Warum sind sie so undankbar?<br />
Sind die arabischen Revolutionen<br />
gescheitert, die Hoffnungen<br />
auf sie widerlegt?<br />
Auch im Sudan brannte eine Botschaft,<br />
die deutsche. Das allerdings konnte mit<br />
dem Arabischen Frühling nichts zu tun haben – im<br />
Sudan gab es gar keine Freiheitsbewegung. Die Ursache<br />
für die Attacke war auch nicht das Mohammed-Video.<br />
Hinter dem Aufruhr, das lässt sich<br />
mittlerweile rekonstruieren, standen hier ganz andere,<br />
viel politischere Motive. Man muss also genau<br />
hinsehen. Und daran fehlt es oft. Der westliche<br />
Blick auf die arabische Welt ist offenbar noch im-<br />
VON<br />
MOHAMED AMJAHID,<br />
JOCHEN BITTNER,<br />
ANDREA BÖHM,<br />
JULIA GERLACH,<br />
GERO VON RANDOW<br />
UND MICHAEL THUMANN<br />
mer getrübt von einer altklugen Überheblichkeit<br />
– und vom Interesse vieler Medien an einer eingängigen<br />
Story.<br />
Je sorgfältiger man die einzelnen Schauplätze der<br />
Ausschreitungen untersucht, desto falscher erweist<br />
sich die Vorstellung von einer weiten Wüstenfläche<br />
voller zorniger Menschen, die nur darauf warten, dass<br />
jemand ihre Religion beleidigt. »Sie«, die gewalttätigen<br />
Akteure dieser Tage, sind viel eher die Verlierer<br />
der Emanzipationswelle. Viel spricht<br />
dafür, dass die Botschaftserstürmungen<br />
und Brandstiftungen von Bengasi bis<br />
Jakarta kein Ausdruck der neuer Freiheit<br />
sind, sondern im Gegenteil Ansichtskarten<br />
aus einer Vergangenheit<br />
der Diktatur und der Entmündigung.<br />
Beginnen wir in Libyen. Das<br />
Land ist nach dem Sturz des Gaddafi-Regimes<br />
keineswegs in die Hände von islamistischen<br />
Eiferern gefallen. Bei den Parlamentswahlen<br />
im Juli gewannen die Muslimbrüder nur 17<br />
von 80 Sitzen. Die islamistische Partei von Abdel<br />
Hakim Belhadsch, den westliche Diplomaten zuvor<br />
als echte Gefahr beschrieben hatten, errang<br />
nicht ein einziges Mandat. Der neue Premierminister<br />
des Landes ist ein säkular denkender Ingenieur,<br />
der als Akademiker in den Vereinigten Staaten<br />
Karriere gemacht hat und nach seiner Wahl zuerst<br />
versprach, zupackender als bisher die Zigtausenden<br />
Waffen einsammeln zu lassen, die seit dem Bürgerkrieg<br />
im Land verteilt sind.<br />
Es gibt noch immer mächtige Milizen und verfeindete<br />
Clans im Land – doch ob es überhaupt Libyer<br />
waren, die den Anschlag auf das US-Konsulat in<br />
Bengasi verübten, ist keineswegs sicher. Die Amerikaner<br />
gehen davon aus, dass es Mitglieder des Al-Kaida-<br />
Zweigs Omar-Abdul-Rahman-Brigade waren, die am<br />
Jahrestag des 11. September mit Schnellfeuergewehren<br />
und Granaten die US-Vertretung sturmreif schossen.<br />
Nur einen Tag zuvor hatte der Al-Kaida-Chef Aiman<br />
al-Sawahiri in einer Videobotschaft regelrecht den<br />
Befehl dazu erteilt. Im Juni war sein libyscher Stellvertreter<br />
im Jemen von einer amerikanischen Drohne<br />
getötet worden; Sawahiri rief dazu auf, ihn zu rächen,<br />
und zwar am besten durch Angriffe auf Amerikaner<br />
in Libyen. Nach dem Tod des Botschafters versammelten<br />
sich viele Bürger spontan zu einer Sympathiekundgebung<br />
in Bengasi. »Nein zu Al-Kaida, Nein zum<br />
Terrorismus«, stand auf dem Plakat, das ein kleiner<br />
Junge trug. Und: »Sorry, Amerika. Das ist nicht das<br />
Verhalten des Islam und des Propheten!«<br />
Natürlich ist die Wut über das Schundvideo<br />
eines amerikanischen Islamhassers echt und weitverbreitet.<br />
Aber es gibt einen Unterschied zu ähn-<br />
Vielleicht tobt doch nicht die ganze Stadt? Einzelkämpfer in Sanaa<br />
lichen Krisen, etwa zu der um die dänischen<br />
Mohammed-Karikaturen 2006. Gerade jene<br />
Muslime, die sich in den vergangenen Jahren<br />
Emanzipation und Bürgerrechte erkämpft haben,<br />
wollen nicht wieder in die Falle tappen, die<br />
ihnen, so glauben sie, bestimmte Akteure stellen.<br />
Vor allem in Ägypten wurde noch nie so viel<br />
diskutiert, kritisiert und die Frage gestellt, warum<br />
gerade jetzt eine solche Empörung aufbrandet.<br />
Der bekannte Journalist Hani Shukrallah schrieb<br />
in einem Kommentar für die Zeitung Al-Ahram<br />
Weekly: »Was die Salafisten, Dschihadisten und<br />
Co. angeht, war der Film wohl die Antwort auf<br />
viele Gebete: Nicht nur geben ihnen die Proteste<br />
die Möglichkeit, gegen die Werte der Revolutionäre<br />
zu agitieren, die aus ihrer Sicht atheistisch und<br />
aus dem Westen importiert sind. Mit den Protesten<br />
bahnen sie sich auch den Weg zurück auf die<br />
politische Bühne.«<br />
Tatsächlich haben die Fundamentalisten in<br />
Ägypten in den vergangenen Monaten stark an<br />
Ansehen verloren. Dabei hatte alles gut für sie<br />
begonnen: Nach anfänglichem Zögern schlossen<br />
sie sich der Revolution 2011 an und mobilisierten<br />
viele neue Anhänger. Unter dem alten Regime<br />
als staatsfeindlich verfolgt, profitierten sie<br />
nun von der neuen Freiheit: Männer durften sich<br />
endlich die Bärte fransig wachsen lassen, Frauen<br />
das Gesicht verschleiern, und niemand hinderte<br />
Prediger daran, ihren Hass auf Andersgläubige zu<br />
verbreiten. Die Al-Gamaa al-Islamija, (Islamische<br />
Gruppe), die in den neunziger Jahren mit dem<br />
Ziel eines islamischen Staates gegen die Regierung<br />
Mubarak kämpfte, gründete eine Partei.<br />
»Ägypten wird islamisch!«, unter dieser Parole<br />
versammelten sich im Sommer 2011 Zigtausende<br />
auf dem Kairoer Tahrir-Platz. Bei den Parlamentswahlen<br />
gewannen die Islamisten ein Drittel<br />
der Sitze.<br />
»Die Welt muss die Wut in euren<br />
Fäusten sehen!«, sagt der Hisbollah-Chef<br />
Mit dem Eintritt in die Realpolitik begann jedoch<br />
ihr Stern zu sinken. Die wirtschaftlichen<br />
Sorgen vieler verschlimmerten sich, während die<br />
salafistischen Parlamentarier von einem Skandal<br />
in den nächsten schlitterten. Das größte Problem<br />
haben die Salafisten allerdings mit ihrem Präsidenten:<br />
Mohammed Mursi von der Muslimbruderschaft<br />
ist ihnen nicht islamisch genug. Außer<br />
einigen symbolischen Veränderungen – etwa,<br />
dass die Wetterfee im Staatsfernsehen nun Kopftuch<br />
tragen darf – ist wenig Islamisierung zu sehen.<br />
Den Radikalen gefällt auch nicht, dass Mursi<br />
sich bei den Amerikanern anbiederte. Die Al-<br />
Gamaa al-Islamija fordert, dass der Präsident seine<br />
für Sonntag geplante Reise in die USA absagt:<br />
aus Protest gegen den Anti-Islam-Film.<br />
Das beleidigende Video bietet den Salafisten also<br />
einen willkommenen Anlass, sich wichtig zu machen.<br />
Die Demonstranten sind zwar nicht viele – in<br />
Ägypten sollen laut verschiedenen Quellen etwa<br />
2500 Zornige zusammengekommen sein – ,kulturell<br />
aber scheinen die Radikalen einige Erfolge zu<br />
verbuchen. Die gezielte Beleidigung durch den<br />
Anti-Islam-Film weckt die religiösen Gefühle der<br />
Mehrheit der Muslime. Facebook-Einträge mit Aufforderungen<br />
zu einem frommeren Leben sind bis<br />
weit hinein ins liberale Lager plötzlich höchst beliebt.<br />
Zwischen Muslimbruderschaft und Salafisten<br />
ist ein Konkurrenzkampf entbrannt, wer den Propheten<br />
besser schützen kann. Neu und hoffnungsvoll<br />
ist allerdings, dass die Motive beider Lager offen<br />
diskutiert werden. Die Revolution hat eine streitfreudige<br />
Zivilgesellschaft in Ägypten zum Leben<br />
erweckt – und die lässt sich nicht mehr so einfach<br />
mundtot machen.<br />
Ganz ähnlichen Anwürfen wie Mursi in<br />
Ägypten sieht sich der Präsident des Jemen ausgesetzt.<br />
Nicht nur Salafisten, sondern auch Revolutionäre<br />
werfen ihm vor, die Bedrohung<br />
durch militante Islamisten zu nutzen, um sich<br />
die Unterstützung der USA zu sichern. Die versuchte<br />
Erstürmung der amerikanischen Botschaft<br />
in Sanaa ist deshalb auch als Protest gegen<br />
eine als schwach empfundene Regierung zu werten.<br />
Radikale Prediger, von denen einige Al-Kaida<br />
nahestehen, hatten zum Sturm auf die Vertretung<br />
aufgerufen. Ihnen folgten allerdings<br />
nicht etwa die religiösen Massen, sondern jene<br />
Verlierer, die der harte jemenitische Alltag ohnehin<br />
an den Rand gedrängt hat: Arbeitslose, Gelegenheitsjobber,<br />
Krakeelend auf den Außenmauern<br />
der US-Botschaft sitzend, dürften viele von<br />
ihnen zum ersten Mal das Gefühl gehabt haben,<br />
aufgestiegen zu sein.<br />
Kein Verlierer, sondern ein großer Gewinner<br />
der religiösen Wut scheint auf den ersten Blick<br />
die radikalschiitische Hisbollah im Libanon zu<br />
sein. Mindestens zehntausend ihrer Anhänger<br />
versammelten sich am Montag zu einem der seltenen<br />
Auftritte des Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah<br />
in Beirut. Kaum war der Papst aus dem Libanon<br />
abgeflogen, erklärte Nasrallah, der Mohammed-Film<br />
sei der »schlimmste jemals unternommene<br />
Angriff auf den Islam (…) Die ganze Welt<br />
muss die Wut in euren Gesichtern, euren Fäusten<br />
und euren Schreien sehen!« Aber warum schließt<br />
sich die Hisbollah dem Anti-Video-Geschrei an?<br />
Weil es in Wahrheit schlecht um sie steht. Ihr<br />
wichtigster Verbündeter neben Iran, Baschar al-<br />
Assad in Syrien, ist bedrängt. Fällt er, brechen die<br />
Nachschublinien für die Hisbollah zusammen.<br />
Zugleich ist ihr Ansehen erschüttert, seit bekannt<br />
wurde, dass vier ihrer Mitglieder für den Mord an<br />
dem Ex-Premier Rafik Hariri verantwortlich gewesen<br />
sein sollen. Der Lärm soll über diese<br />
Schande und den drohenden Bedeutungsschwund<br />
hinwegtäuschen.<br />
So viel zu den Wut-Motiven entlang des Revolutionsbogens<br />
am Mittelmeer. Welche Geschichte<br />
steckt nun hinter dem Angriff auf die deutsche<br />
Botschaft im Sudan? Der Zorn, der sich hier Bahn<br />
brach, war gesteuert von politischen Interessen.<br />
Ihm ging eine lang anhaltende antideutsche Kampagne<br />
voraus. Hauptverantwortlich für sie ist ein<br />
Mann namens Mustafa al-Tayyib, Herausgeber<br />
der einflussreichen Tageszeitung Al-Intibaha. Das<br />
Blatt verortet bereits seit gut einem Jahr Deutschland<br />
neben den USA und Israel auf einer Achse<br />
des Bösen. Tayyib ist ein Onkel des sudanesischen<br />
Präsidenten Omar al-Baschir.<br />
»Der wahre Feind ist nicht der Teufel«, schrieb<br />
Al-Intibaha schon im September 2011, »sondern<br />
Israel, die USA (…) und Deutschland.« Danach<br />
erschienen immer wieder Artikel in diesem Sinne.<br />
Tayyib und andere Autoren empören sich nicht nur<br />
über die vermeintliche Unterdrückung von Muslimen<br />
in Deutschland, sondern auch über die deutsche<br />
Unterstützung für den abtrünnigen Südsudan.<br />
Dessen Sezession ist für Tayyib nichts als eine internationale<br />
Verschwörung gegen das arabische<br />
Khartoum.<br />
Deutschland geriet offenbar in sein Visier, weil<br />
die Bundesrepublik mehrere Projekte zur Förderung<br />
der Zivilgesellschaft unterstützte – aus Tayyibs Sicht<br />
eine Unterwanderung des Sudan. In den vergangenen
POLITIK<br />
Monaten beschuldigte er wiederholt deutsche kirchliche<br />
NGOs, sich zu einer Verschwörung gegen<br />
Khartoum zusammengeschlossen zu haben. Die<br />
CDU nennt Tayyib »böse«, weil sie die christliche<br />
politische Kaste gegen den Islam aufwiegele.<br />
In den Tagen und Wochen vor dem Sturm der<br />
deutschen Botschaft steigerte sich die antideutsche<br />
Berichterstattung dann zu einem Stakkato.<br />
Am vergangenen Freitag erschien Al-Intibaha mit<br />
einem Aufruf zur Demonstration vor der deutschen<br />
und amerikanischen Botschaft, »weil das<br />
christliche Deutschland (…) schon öfter diffamierende<br />
Bilder, Filme und Texte über unseren<br />
Propheten verbreitet hat«. Der Deutschland-Hass<br />
gilt zwar in Khartoumer Regierungskreisen vor<br />
allem als Tayyibs persönlicher Feldzug. Doch<br />
kommt er auch dem Präsidenten gelegen, drängt<br />
er doch die sozialen Proteste der vergangenen<br />
Monate gegen Armut und Preissteigerungen ins<br />
Abseits.<br />
In Tunesien sind die Fanatiker<br />
ein Risiko erster Ordnung<br />
Heißt all das nun, dass die Zornesausbrüche der<br />
vergangenen Tage wenig relevant und die Errungenschaften<br />
des Arabischen Frühlings stabil und<br />
unumkehrbar sind? Das heißt es nicht. Es mögen<br />
nur weniger Eiferer sein, die versuchen, alte<br />
Konfliktmuster wiederzubeleben. Doch auch<br />
kleine Gruppen können große Wirkungen entfalten.<br />
Die letzte weltpolitische Zäsur haben am<br />
11. September 2001 gerade einmal zwei Dutzend<br />
Fanatiker ausgelöst. Und noch ist keineswegs<br />
entschieden, welches Gesellschaftsmodell<br />
sich in den islamischen Revolutionsländern<br />
durchsetzen wird.<br />
In Tunesien, dem Land, in dem im Dezember<br />
2010 alles anfing, ist der Salafismus mittlerweile kein<br />
Randphänomen mehr, sondern ein Risiko erster<br />
Ordnung. Es gibt Kleinstädte, in denen Fundamentalisten<br />
seit Monaten diktieren, was erlaubt ist und<br />
was nicht. Seit Monaten attackieren sie vielerorts<br />
Kulturzentren, Kinos, Galerien, Hotelbars, Universitäten.<br />
Eine im Land verbreitete Stimmung sieht in<br />
den Salafisten die Verteidiger des Heiligen. In der<br />
europäisch beeinflussten Mittelschicht der Küstenregionen<br />
hingegen geht die Furcht vor Gegenaufklärung<br />
und Dunkelmännertum um. In einem<br />
Monat läuft die Frist ab, in der die verfassunggebende<br />
Versammlung ein Grundgesetz beschließen sollte.<br />
Man wird sie nicht einhalten. Der Streit um die<br />
Artikel, die aus dem Land einen Gottesstaat ohne<br />
echte Gewaltenteilung machen würden, erweist sich<br />
als unlösbar.<br />
Diese Entwicklung zeigt, was auf dem Spiel steht.<br />
Schaffen die muslimischen Länder den Übergang<br />
in die Demokratie – oder nimmt die Abwehrhaltung<br />
zu säkularen Modellen gefährliche Züge an? Die<br />
Chancen für die aufgeklärte Variante stehen trotz<br />
vieler Hindernisse günstig wie nie. Dieselben arabischen<br />
Medien, die vor sechs Jahren mit dem Karikaturenstreit<br />
noch reißerisch Quote machten,<br />
berichten jetzt über die Unfähigkeit der Polizei, einen<br />
»kleinen Mob« zu kontrollieren und Botschaften<br />
zu schützen. Sie erklären die amerikanische Sicht<br />
auf die Meinungsfreiheit und thematisieren die<br />
schwierige Lage der islamistischen Regierungen<br />
zwischen Pragmatismus und Ideologie. Höchste Zeit<br />
für den Westen, seine Sicht auf die Region genauso<br />
zu schärfen.<br />
Siehe auch Feuilleton, Seiten 43 und 45;<br />
Glauben & Zweifeln, Seite 58<br />
»Gläubige<br />
müssen den Film<br />
boykottieren«<br />
Halb so wild, alles im Griff: Ordnungskräfte im Rücken der Demonstration<br />
Der ägyptische<br />
Islam-Minister<br />
Scheich Afi fi verteidigt<br />
die Meinungsfreiheit –<br />
bis zu einem<br />
gewissen Punkt<br />
<strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>: Scheich Afifi, haben Sie den Schmähfilm<br />
gegen den Propheten Mohammed gesehen?<br />
Scheich Talaat Afifi: Nein, ich habe ihn nicht gesehen<br />
und rate niemandem dazu, sich so etwas anzutun.<br />
Das bloße Ansehen ist eine Sünde.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Das müssen Sie erklären.<br />
Afifi: Es ist verboten, dass ein Muslim etwas sieht<br />
oder hört, das seinem Glauben widerspricht.<br />
Wenn man weiß, dass der Inhalt eines Videos oder<br />
einer Karikatur sich gegen Gott und seinen Propheten<br />
richtet, darf man sich nicht damit befassen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Auch wenn Sie das Video nicht gesehen haben,<br />
haben Sie wahrscheinlich eine Meinung dazu.<br />
Afifi: Das ist ein Anti-Islam-Film. Er beleidigt alle<br />
Muslime – und deswegen rufe ich alle Gläubigen<br />
auf, ihn zu boykottieren. Mehr kann ich dazu<br />
nicht sagen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Ein Boykott ist aber schwierig in den Zeiten<br />
von Internet und Satellitenfernsehen.<br />
Afifi: Gott sagt im Koran: »Böse Menschen sind in<br />
der Gesellschaft von bösen Menschen gut aufgehoben.«<br />
Die Macher dieses Films wollen Hass und<br />
Gewalt verbreiten. Doch sie haben das Gegenteil<br />
erreicht: Wir lieben unseren Propheten, wir verehren<br />
ihn jeden Tag ein bisschen mehr. Er lebt in<br />
unseren Herzen, und wir werden ihn mit jeder<br />
Faser davon verteidigen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Manche Radikale verstehen unter Verteidigung<br />
Gewalt gegen westliche Botschaften.<br />
Afifi: Kein Mensch sollte solch eine Beleidigung<br />
seines Propheten hören und dazu schweigen. Wir<br />
sollten unsere Religion verteidigen, aber ohne<br />
Mord, ohne Gewalt. Ich frage mich, was es bringt,<br />
einen Botschafter zu töten? Ein<br />
Gebäude in Brand zu setzen? Eine<br />
Fahne zu verbrennen?<br />
<strong>ZEIT</strong>: Wer ruft da zur Gewalt auf?<br />
Afifi: Diejenigen, die schon festgenommen<br />
wurden und ihre gerechte<br />
Strafe bekommen werden,<br />
das sind alles Leute mit eigenen<br />
Interessen. Sie wollen Kapital aus<br />
der ganzen Geschichte schlagen.<br />
Es sind immer wieder die Gleichen,<br />
die Probleme machen. Das<br />
sind keine Repräsentanten des Islams.<br />
Es sind Extremisten mit einer<br />
eindeutigen Agenda, die das<br />
Land destabilisieren wollen, sodass<br />
wir nie zu einem guten Leben kommen können.<br />
Das ärgert mich.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Wen meinen Sie damit?<br />
Afifi: Die Kader des alten Regimes haben ein<br />
großes Interesse daran, uns Probleme zu berei-<br />
Scheich Talaat Afifi ist<br />
Minister für islamische<br />
Angelegenheiten in der<br />
Regierung des<br />
Präsidenten Mursi<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 7<br />
ten. Und dann sind auch noch die selbst ernannten<br />
Dschihadisten am Werk, die im Namen<br />
des Islams willkürlich Menschen töten.<br />
Im letzten Jahr starben dadurch vor allem viele<br />
unschuldige Muslime in Ägypten.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Einige dieser Extremisten fühlen sich<br />
den Salafisten zugehörig. Die<br />
salafistische Al-Nur-Partei hat<br />
vor sechs Wochen durchgesetzt,<br />
dass Sie Minister wurden.<br />
Afifi: Ich gehöre keiner Partei<br />
an. Der salafistische Islam ruft<br />
nicht zu Krawallen auf; das sind<br />
Leute, mit denen wir nichts zu<br />
tun haben und nichts zu tun<br />
haben wollen. Nirgendwo in<br />
der Scharia steht, dass wir Botschafter<br />
töten, Fahnen verbrennen<br />
oder Gebäude stürmen<br />
sollen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Schützt der ägyptische<br />
Staat westliche Botschaften ausreichend?<br />
Afifi: Der Schutz von Botschaften und Botschaftspersonal<br />
ist eine Verantwortung, die<br />
wir übernommen haben. Wenn wir Botschaften<br />
auf unserem Boden nicht schützen, werden<br />
morgen unsere Botschaften im Ausland<br />
angegriffen. Wir geben uns also Mühe, dieser<br />
Verpflichtung nachzukommen. Ich habe<br />
heute bei meiner Fahrt durch die Stadt gesehen,<br />
dass Polizei und Militär eine Mauer<br />
rund um die US-Botschaft errichtet haben;<br />
das ist ein Anfang. Dennoch muss ich sagen:<br />
Ich verstehe nicht, warum Menschen in den<br />
Vereinigten Staaten einen solchen Film drehen.<br />
Wir Muslime beleidigen ja auch keinen<br />
Propheten. Mose, Jesus, Noah – das sind alles<br />
Heilige für uns. Das kann man unserer Religion<br />
nicht nehmen: Wir respektieren andere<br />
Religionen, auch wenn wir denken, dass sie<br />
falsch sind.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Das koptische Christentum ist eine dieser<br />
anderen Religionen. Hat Ägypten nicht ein<br />
Problem mit der Diskriminierung von Kopten?<br />
Afifi: Wir haben mit den Christen kein Problem.<br />
Sie leben hier friedlich und harmonisch<br />
seit 1400 Jahren, seit es den Islam gibt. Wir<br />
sind Brüder und Schwestern, und in Ägypten<br />
gibt es genügend Platz für alle. Wir verstehen<br />
uns gut.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Sind Sie sicher? Der Macher des Films<br />
führt diese Diskriminierung als seine Hauptmotivation<br />
an.<br />
Afifi: Ich bin sehr sicher. Dieser Typ will unsere<br />
Gesellschaft nur spalten.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Sie waren mehrmals in den Vereinigten<br />
Staaten. Wie sehen Sie die Idee der Rede- und<br />
Meinungsfreiheit, die dort herrscht?<br />
Afifi: Die Wahrheit ist, dass ich dort die meiste<br />
Zeit in Moscheen verbracht habe, vor allem<br />
weil ich immer zum Ramadan in die Staaten<br />
geflogen bin. Dennoch kann ich dieses amerikanische<br />
Prinzip der absoluten Redefreiheit<br />
verstehen. Der Respekt für Ansichten, die einem<br />
nicht passen, ist ein zutiefst islamisches<br />
Prinzip.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Tatsächlich?<br />
Afifi: Gott sagt: »Beleidigt nie diejenigen, die<br />
Gott beleidigen, denn am Ende wird sie Gott<br />
bestrafen.« Das bedeutet für mich nichts anderes<br />
als absolute Redefreiheit. Aber ohne Grenzen<br />
geht das auch wieder nicht: Ich darf dabei<br />
nicht die Rechte anderer verletzen, vor allem<br />
darf ich nicht ihre Propheten und ihre heiligen<br />
Schriften in den Dreck ziehen. Ich rufe deswegen<br />
zu einer islamisch disziplinierten Redefreiheit<br />
auf.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Also doch keine absolute Meinungsfreiheit?<br />
Afifi: Solch ein Verständnis grenzenloser Freiheiten<br />
führt zu Problemen, wie wir sie jetzt<br />
wieder haben. Gott, sein Prophet und der Islam<br />
bleiben für mich unantastbar.<br />
Die Fragen stellte MOHAMED AMJAHID<br />
Fotos (S.6 - 7): Mohammed Huwais/AFP/Getty Images (l.); Yahya Arhar/EPA/dpa (m.); Mohammed Huwais/AFP/Getty Images (r.); Middle East News Agency (kl., u.)
Fotos (v.o.n.u.): Aurora/laif (2); Nina Berman/Noor/laif; Aurora/laif<br />
8 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> POLITIK<br />
Schau mir in die Wumme, Kleines: Selbstverteidigungsübung in Texas<br />
»Billiger als Dreck«: Waffenladen in einem Vorort von Dallas<br />
Muskeln und Stahl: Treffen der Waffenlobby NRA<br />
Mein Haus, mein Baum, meine Kalaschnikow: Amerikanisches Idyll<br />
Amerika<br />
und seine<br />
Waffen<br />
4,3 Mio<br />
Mitglieder<br />
hat die<br />
National<br />
Rifle Association<br />
120 Schuss für 210 Dollar<br />
Trotz aller Amokläufe wollen die Amerikaner nicht von ihren Waff en lassen. Was ist bloß dran<br />
an der Lust am Schießen? Ein Selbstversuch mit Schnellfeuergewehr VON ANDREA BÖHM<br />
Cortlandt Manor, New York<br />
Meinen Waffentrainer hatte<br />
ich mir anders vorgestellt:<br />
kurz geschorene Haare,<br />
Stiefel, Cargohosen, zackiger<br />
Ton, Geländewagen.<br />
Stattdessen kommt Joe: Ein<br />
bisschen verschlurft, mit<br />
ausgebeulten Jeans, zotteligem Bart, Cloggs an den<br />
Füßen und zwei Kindersitzen auf der Rückbank<br />
seines Autos. Es ist Sonntag Morgen im Blue Mountain<br />
Naturpark, Gemeinde Westchester, Bundesstaat<br />
New York, eine Idylle mit Hügeln, Seen, Vogelgezwitscher.<br />
Und einem gun range, einem Schießstand.<br />
Der öffnet in einer Stunde. »Schön hier«, sagt<br />
Joe und holt drei Gewehre aus dem Kofferraum.<br />
Auf Joes T-Shirt ist ein Fadenkreuz gedruckt, darüber<br />
steht: »NRA certified instructor«, »NRA-geprüfter<br />
Ausbilder«. Amerikas National Rifle Association<br />
hat einen legendären Ruf als Waffenlobby, mit der sich<br />
kein Politiker anzulegen wagt. Weniger bekannt ist<br />
ihre Rolle als Schießlehrer der Nation. Der Mensch,<br />
so sieht es die NRA, ist ein freies Wesen, ausgestattet<br />
mit der Fähigkeit zu verantwortungsbewusstem Handeln<br />
und unveräußerlichen Rechten, darunter dem<br />
Recht auf uneingeschränkten Besitz von Schusswaffen.<br />
Die NRA sieht sich nicht nur für den Schutz der Verfassung,<br />
sondern auch für die Erziehung zum verantwortungsvollen<br />
Umgang mit der Waffe zuständig. Der<br />
macht nach ihrer Überzeugung Gesetze zur Waffenkontrolle<br />
überflüssig. Woche für Woche bietet sie im<br />
ganzen Land Hunderte von Kursen an. Anmeldung<br />
im Internet genügt. Ich habe bei Joe den »Basic Rifle<br />
Course« belegt, »Gewehr für Anfänger«. 210 Dollar<br />
für fünf Stunden – inklusive 120 Schuss Munition,<br />
Multiple-Choice-Test und Urkunde. Joe weiß, mit<br />
wem er es zu tun hat: mit einer deutschen Reporterin,<br />
die Amerikas Waffenkult für aberwitzig hält – und jetzt<br />
wissen möchte, was denn so toll sein soll am Schießen.<br />
Mein Tischnachbar beim Theorieteil im Blockhaus<br />
der Parkverwaltung ist ein ausgestopftes Gürteltier.<br />
Sonst ist keiner da. Langes Wochenende, erklärt Joe,<br />
»und schönes Wetter. Da gehen die Leute lieber raus<br />
in die Natur.« Er packt seine Gewehre und mehrere<br />
Schachteln Patronen auf den Tisch.<br />
»Erklär mir, was du da siehst«, sagt er.<br />
»Ziemlich gefährliche Dinger, vor allem das da«,<br />
sage ich und deute auf das halb automatische Gewehr<br />
mit Magazinstutzen.<br />
Joe schüttelt den Kopf. Typisch Europäerin, die<br />
nicht zu würdigen weiß, was da vor ihr liegt: drei<br />
wunderbare Exemplare des menschlichen Erfindungsgeistes.<br />
Eine Stunde dauert sein Crashkurs über die<br />
Geschichte der Schusswaffe, über Musketen, Repetierbüchsen<br />
und das »voll ergonomische« halb automatische<br />
AR-15, mit dem auch die amerikanische<br />
Armee ausgestattet wird. Joe referiert über Abzug,<br />
Schlagbolzen und immer bessere Visieroptik, über<br />
Patronenhülsen, Zündhütchen, Projektile und über<br />
die Sicherheitsgebote der NRA: Erstens, den Lauf der<br />
Waffe immer in eine sichere Richtung halten – »also<br />
dahin, wo keiner steht«. Es sei denn, man muss auf<br />
ihn schießen. Zweitens: Finger weg vom Abzug. Es sei<br />
denn, man will schießen. Drittens: Waffe immer ungeladen<br />
aufbewahren. Es sei denn, man will schießen.<br />
Freie Waffen für freie Bürger – für viele<br />
Amerikaner klingt das plausibel<br />
Joe hadert mit Regel Nummer drei, obwohl er das als<br />
NRA-Ausbilder eigentlich nicht darf. »Es gibt da noch<br />
eine andere Denkschule«, sagt er. Wenn der Angreifer<br />
erst einmal im Haus sei, könne man ja nicht erst mit<br />
der Munition herumfummeln. Da sei es von Vorteil,<br />
eine geladene Waffe zur Hand zu haben.<br />
Bleiben noch optionale Vorsichtsmaßnahmen wie<br />
kindersichere Waffenschränke, feuergeschützte Patronenschachteln<br />
oder die Partyregel: »Wenn gefeiert<br />
wird«, sagt Joe, »immer einen Gast bestimmen, der<br />
keinen Alkohol trinkt und auf die Waffen aufpasst.«<br />
»Ganz schön aufwendig«, sage ich. Und nervenaufreibend.<br />
Als würde man eine Pythonschlange als<br />
Haustier halten. Joe sieht mich missbilligend an. »Wir<br />
gehen jetzt schießen«, sagt er.<br />
Joe ist 38, Vater von vier Kindern und heißt mit<br />
Nachnamen so ähnlich wie das Land, aus dem er<br />
stammt: Izrael. Von dort ist er 2001 in die USA ausgewandert.<br />
Nicht aus Angst vor Terroranschlägen<br />
militanter Palästinenser, sondern weil ihm Israels<br />
Waffengesetze zu strikt waren. Okay, sagt er, ein Mädchen<br />
habe auch eine Rolle gespielt. »Die habe ich dann<br />
geheiratet. Aber die amerikanische Waffenkultur war<br />
definitiv eine Verlockung.«<br />
Die Waffenkultur in Westchester County ist vergleichsweise<br />
moderat. Der gun range gehört der Ge-<br />
In den USA sterben jedes<br />
Jahr durchschnittlich<br />
Menschen durch den Einsatz<br />
von Schusswaffen<br />
meinde, also werden hier keine Bilder von vermummten<br />
Al-Kaida-Kämpfern als Zielscheiben aufgehängt.<br />
Es werden auch keine mahnenden Flugblätter mit dem<br />
Bild von Adolf Hitler und der Parole »Wer für Waffenkontrolle<br />
ist, hebe den rechten Arm« verteilt. Was auf<br />
Schießplätzen der NRA durchaus vorkommt.<br />
Joe kennt den Slogan natürlich – und versteht<br />
nicht, was ich daran empörend finde. Ich lebe in einer<br />
Welt, in der das staatliche Gewaltmonopol als Errungenschaft<br />
gilt. Er lebt in einer Welt, in der bewaffnete<br />
Bürger die einzige Garantie gegen Machtmissbrauch<br />
des Staates sind. Und gegen Tyrannei, Versklavung<br />
und Völkermord.<br />
»Wie hat man früher die Schwarzen in Amerika<br />
unterdrückt?«, fragt Joe. »Wie haben die Türken den<br />
Genozid an den Armeniern eingeleitet? Wie haben<br />
die Nazis den Holocaust vorbereitet? Indem man den<br />
Opfern per Gesetz den Waffenbesitz verboten hat.«<br />
Bevor wir jetzt ernsthaft in Streit geraten, ziehen<br />
wir unsere faustgroßen Ohrenschützer über. Keine<br />
zehn Meter von einem Ehepaar entfernt, das abwechselnd<br />
einen Vorderlader abfeuert. »Vorderlader sind<br />
verdammt laut«, hatte Joe gewarnt, der jetzt mit drei<br />
Gewehren im Arm Georgie begrüßt.<br />
Georgie ist zuständig für Sicherheit und Disziplin<br />
auf dem Schießstand. Georgie trägt keinen Hörschutz,<br />
er hört ohnehin schlecht. Er spricht auch nicht mehr<br />
allzu deutlich. Sein wichtigstes Kommando – Feuer<br />
einstellen! – ist oft nur schwer zu verstehen, aber unbedingt<br />
zu befolgen. Sonst kann keiner nach vorne<br />
laufen und neue Zielscheiben aufhängen.<br />
Joe reicht mir als Erstes ein Jagdgewehr vom Typ<br />
Marlin 56, das offenbar Sammlerwert hat. Ich verschieße<br />
etwas zögerlich ein erstes Magazin. Joe, dem<br />
gebürtigen Israeli, geht die amerikanische Kultur des<br />
positiven Feedbacks völlig ab. Statt nach jedem Schuss<br />
Hey, great shot! zu rufen, grummelt er: »Was ist los? Du<br />
bist zu verkrampft.« Ich schieße, verdammt noch mal.<br />
Wie soll ich da nicht verkrampft sein?<br />
Neben mir stehen zwei College-Kids mit ihrer<br />
Pumpgun. Zwei Tische weiter sitzt ein missmutig<br />
wirkender Mittfünfziger, der sein Gewehr mit Kissen<br />
und Kästchen so abgestützt hat, dass er mit der einen<br />
Hand abdrücken, mit der anderen rauchen kann.<br />
Dann das Ehepaar mit dem Vorderlader. Es herrscht<br />
ein reges Kommen und Gehen, manche schleppen<br />
ihre Gewehre wie Holzscheite im Bündel an, andere<br />
heben ein teures Einzelstück aus dem Hartschalenkoffer<br />
wie ein Solist seine Geige.<br />
Wenn Georgie zwischendurch dann »cease fire!«<br />
ruft, trabt man, den Hörschutz um den Nacken gelegt,<br />
mitten in der Schusslinie nach vorn, legt neue Zielscheiben<br />
auf, fachsimpelt über die neuesten Smith-&<br />
-Wesson-Modelle oder über die Football-Saison.<br />
Meine Papierzielscheibe ist unversehrt, ich habe nicht<br />
getroffen. »Das kommt noch«, tröstet Joe.<br />
Die Schützen sind überwiegend weiß, männlich<br />
und englischsprachig, aber an einigen Tischen hört<br />
man Spanisch, Koreanisch oder Russisch. Frauen sind<br />
längst als stabile Minderheit präsent. Amerikas Waffenbesitzer<br />
haben sich ebenso ausdifferenziert wie ihre<br />
Gesellschaft: Es gibt die »Juden für den Erhalt des<br />
Waffenbesitzes«, die Frauen haben die Second<br />
Amendment Sisters, die Schwulen und Lesben die<br />
Pink Pistols. So gut wie alle tragen den NRA-Mitgliedsausweis<br />
in der Tasche. Wen man nicht sieht,<br />
sind Afroamerikaner.<br />
Dabei ist ja durchaus etwas dran an Joes These von<br />
der emanzipierenden Wirkung des Waffenbesitzes.<br />
Die NRA ist ein Produkt des amerikanischen Bürgerkriegs,<br />
gegründet 1871 von zwei Armeeoffizieren, die<br />
über die erbärmlichen Schießkünste der Unionssoldaten<br />
erschrocken waren. Die Amerikaner waren eben<br />
kein Volk von Revolverhelden, die meisten konnten,<br />
so klagte damals ein General, »nicht mal eine Scheune<br />
treffen«. Das sollte sich nach Kriegsende durch<br />
Schützenkurse ändern. Nicht nur für Weiße, sondern<br />
auch für ehemalige Sklaven – eine Horrorvorstellung<br />
vor allem für weiße Südstaatler.<br />
Womöglich würden die frühen NRA-Mitglieder<br />
ihrem eigenen Verein heute nicht mehr beitreten. Ein<br />
knappes Jahrhundert blieb die NRA ein patriotischer<br />
Interessenverband für Sportschützen und Jäger, der<br />
dem Staat durchaus zugestand, den Waffenbesitz<br />
seiner Bürger zu kontrollieren. »Staat« war damals, bei<br />
aller amerikanischen Skepsis gegenüber jeder Form<br />
von Zentralismus, noch kein Schimpfwort.<br />
Dann kamen die sechziger Jahre: Die Morde an<br />
den Kennedy-Brüdern, an Martin Luther King und<br />
Malcolm X, Massendemonstrationen gegen Rassentrennung<br />
und Vietnamkrieg, Aufruhr in den Städten,<br />
Fernsehbilder von bewaffneten Black Panthers. Dem<br />
Sturm auf soziale und politische Barrieren folgte in<br />
den siebziger Jahren der Sturm der weißen Mittelschicht<br />
auf die Waffengeschäfte. In der NRA gab eine<br />
30000<br />
neue Führung die Parole aus: Jeder Versuch der Waffenkontrolle<br />
ist ein Angriff auf die Freiheit rechtschaffener<br />
Bürger. Die Mitgliederzahl stieg auf drei<br />
Millionen an, heute sind es nach Angaben der NRA<br />
über vier Millionen, viele organisiert in einer der über<br />
10 000 lokalen Gruppen, dazu ein schlagkräftiges<br />
Lobbyinstitut in Washington ,das nicht nur erfolgreich<br />
den amerikanischen Kongress bearbeitet, sondern<br />
als registrierte NGO bei den Vereinten Nationen<br />
gegen internationale Verträge zur Kontrolle von<br />
Kleinwaffen arbeitet.<br />
»Die UN? Wer braucht die denn«, sagt Joe und<br />
reicht mir das zweite Gewehr, Modell »Savage Mark<br />
2«, mit dem ich plötzlich treffe. Fünfmal hintereinander.<br />
Ich hätte einen ruhigen Finger am Abzug, lobt<br />
Joe. Noch ein Treffer. Die Nachbarn nicken anerkennend.<br />
Ich muss leider zugeben, dass Schießen Spaß<br />
machen kann. Auch wenn mir umgehend ein kapitaler<br />
Anfängerfehler unterläuft. Ich bücke mich nach<br />
heruntergefallenen Patronen, das Gewehr in der<br />
Hand, dessen Lauf plötzlich eher in Richtung Georgie<br />
zeigt. »Hey«, ruft Joe, »Regel Nummer eins! Schon<br />
vergessen?«<br />
Joe hat da noch ein besonderes Angebot:<br />
Bau Dir Dein eigenes Sturmgewehr!<br />
Wir kommen zum Höhepunkt des Kurses: dem<br />
halb automatischen AR-15, der »voll ergonomischen<br />
Waffe«, wie Joe nicht müde wird zu betonen.<br />
Das »Ergonomische« an solchen Gewehren besteht<br />
darin, dass man nach dem Schuss keinen Unterhebel<br />
oder Kammerstängel (den Unterschied kenne<br />
ich jetzt!) betätigen muss, um die leere Patrone aus<br />
der Kammer zu befördern. Man drückt einfach<br />
immer wieder ab, bis das Magazin leer ist.<br />
Als der offensichtlich geistesgestörte Student James<br />
Elgon Holmes am 20. Juli diesen Jahres in ein Kino<br />
in Aurora im Bundesstaat Colorado eindrang, eröffnete<br />
er das Feuer auf die Zuschauer mit einem AR-<br />
15-Modell der Firma Smith & Wesson. Geladen<br />
hatte er ein Magazin mit 100 Patronen. Beides ist in<br />
den USA legal zu erwerben. Irgendwann klemmte<br />
Holmes Magazin. Es starben »nur« zwölf Menschen.<br />
»Der Faktor Tödlichkeit ist das Nikotin der Waffenindustrie«,<br />
hat der amerikanische Journalist Tom<br />
Diaz in einem Buch über die Branche und ihre Lobby,<br />
die NRA, geschrieben. Es trägt den bösen Titel Making<br />
a Killing – The Business of Guns in America. Angesichts<br />
von rund 300 Millionen Schusswaffen in<br />
privatem Besitz könnte man meinen, der Waffenmarkt<br />
in den USA sei gesättigt. Aber die Devise »Immer mehr<br />
Feuerkraft« garantiert weiteres Wachstum.<br />
Wenn Feuerkraft das Nikotin der Waffenindustrie<br />
ist, dann benehme ich mich jetzt wie ein Nichtraucher.<br />
Mir wird leicht schlecht. Nach dem ersten Schuss mit<br />
dem AR-15 kommt mir nur ein Wort in den Sinn:<br />
zerfetzen. Irgendetwas muss ich gerade zerfetzt haben.<br />
Die Zielscheibe steht aber noch. »Du hast nicht getroffen«,<br />
sagt Joe. Will ich auch nicht mehr. Ich finde<br />
diese Waffe abscheulich, Joe findet mich jetzt europäisch-wehleidig<br />
und gibt mir, wie zur Beruhigung, noch<br />
einmal das Savage-Gewehr.<br />
Hey Joe, wäre ein wenig mehr Waffenkontrolle<br />
nicht doch sinnvoll? Nach dem Massaker in Aurora?<br />
Nach dem Anschlag eines Armeeveteranen zwei Wochen<br />
später in Wisconsin, der in einem Sikh-Tempel<br />
sechs Menschen erschoss? Nach den zwei Toten im<br />
New Yorker Empire State Building, wo am 25. August<br />
ein entlassener Modedesigner mit einer Schusswaffe<br />
durchdrehte? Nach dem Amoklauf drei Tage später<br />
eines Ex-Marines mit einer legal erworbenen Kalaschnikow,<br />
der in einem Supermarkt in New Jersey zwei<br />
Kollegen und dann sich selbst mit einer legal erworbenen<br />
Kalaschnikow tötete? »Du verstehst es einfach<br />
nicht«, sagt Joe. »Die Irren mit Waffen sind nicht das<br />
Problem der Waffenbesitzer.« Sondern? »Sie sind das<br />
Problem der Polizei.«<br />
Dann holt Joe noch ein AR-15-Modell aus dem<br />
Kofferraum. »Verbessertes Modell«, sagt er, »eigene<br />
Konstruktion.« Er hat das Gewehr mit einem Pump-<br />
Action-Mechanismus ausgestattet und möchte seine<br />
Erfindung jetzt in einem Videofilm auf YouTube vorstellen.<br />
Ob ich vielleicht die Kamera halten könnte?<br />
Das hat gerade noch gefehlt: <strong>ZEIT</strong>-Reporterin dreht<br />
Werbefilm für Sturmgewehr. Zum Glück klemmt das<br />
Ding, die Aufnahmen müssen verschoben werden.<br />
Schade, findet Joe. aber er hätte da noch was für<br />
mich, vorausgesetzt, ich könnte mich an das AR-15<br />
gewöhnen: ein zweitägiger Workshop, in dem man<br />
seine eigene AR-15 zusammenbauen kann. 300<br />
Dollar Gebühr plus Materialkosten, »mit 700 bis<br />
1000 Dollar musst du rechnen«. Aber dafür, sagt Joe,<br />
habe man dann sein persönliches Sturmgewehr. Etwas<br />
ganz Eigenes.<br />
Schusswaffen im<br />
Privatbesitz:<br />
300 Mio<br />
Quelle: NRI/Violence Policy Center
POLITIK<br />
Peking<br />
Es ist, als habe man dem Volkszorn einen<br />
Zoo gebaut, mit Zäunen und mit<br />
vielen Wärtern. Die Wutbürger marschieren<br />
in abgesteckten Bahnen vor<br />
der japanischen Botschaft auf und ab,<br />
beobachtet von Polizisten und Sondereinsatztruppen,<br />
am Himmel kreist ein Helikopter. Tausende<br />
protestieren hier, das Spektrum reicht vom<br />
Wanderarbeiter mit gelbem Bauhelm bis zur wie<br />
für einen Auftritt geschminkten Studentin.<br />
Es ist Dienstag, der 18. September, Jahrestag<br />
der japanischen Invasion Chinas 1931. Immer<br />
schon ein bitteres Datum, aber heute geht es<br />
um die Gegenwart, um einige winzige Inseln im<br />
Ostchinesischen Meer, wegen derer sich China<br />
und Japan gerade am Rand eines militärischen<br />
Konfliktes bewegen.<br />
»Die Diaoyu-Inseln sind unser«, rufen die<br />
Demonstranten. »Erklärt Japan den Krieg!« –<br />
»Nur mit den Gedanken des Großen Vorsitzenden<br />
werden wir Japan schlagen können«, steht<br />
auf einem Mao-Poster. »Massakriert Tokio!«,<br />
heißt es auf einem anderen Plakat. »Boykottiert<br />
japanische Waren!« Andere appellieren weniger<br />
martialisch an den »rationalen Patriotismus«.<br />
So heißt die offizielle Protesthaltung, ausgegeben<br />
von der chinesischen Regierung, nachdem<br />
es am Wochenende bei Demonstrationen in 85<br />
Städten zu Ausschreitungen gekommen war.<br />
Japaner wurden verprügelt, japanische Autos<br />
und Geschäfte demoliert, eine Toyota-Niederlassung<br />
in Tsingtao ging in Flammen auf. Die<br />
neue Praxis der staatlichen Zornkontrolle beobachtete<br />
die Hongkonger Zeitung Ming Pao<br />
am Wochenende, als Zivilpolizisten dem Demonstrationsvolk<br />
die Regeln erklärten: »Wir<br />
wissen, dass ihr sehr wütend seid, doch da draußen<br />
warten eine Menge ausländischer Journalisten.<br />
Zeigt die Qualität chinesischer Bürger.<br />
Singt die Nationalhymne. Lacht nicht, wenn<br />
ihr nicht lachen solltet. Und spielt nicht mit<br />
euren Handys.«<br />
Es sind die heftigsten antijapanischen Proteste,<br />
seit beide Länder im Jahr 1972 ihre Beziehungen<br />
normalisierten. Selbst die USA, die<br />
Chinas Streitigkeiten mit Nachbarn gern für<br />
ihre Zwecke nutzen, rufen zur Mäßigung<br />
auf. All das wegen einiger unbewohnter<br />
Inseln im Ostchinesischen Meer, die noch<br />
nicht einmal dem japanischen Staat, sondern<br />
einer Familie gehören?<br />
Senkaku nennen die Japaner die Inseln,<br />
Diaoyu heißen sie in China. Kontrolliert werden<br />
sie von Japan, was weder Peking noch Taiwan<br />
anerkennen. Die Chinesen bemühen Dokumente<br />
aus der Ming-Zeit, um ihre Ansprüche<br />
zu untermauern. Japan behauptet, sie 1884 entdeckt<br />
und keinerlei Spuren chinesischer Präsenz<br />
vorgefunden zu haben. Doch erst 1895, während<br />
des Ersten Japanisch-Chinesischen Krieges,<br />
verleibte sich Japan die Inseln ein. Nach der<br />
japanischen Kapitulation 1945 wurden sie von<br />
den USA kontrolliert, die sie 1972 an Japan zurückgaben<br />
– ohne dass die Souveränitätsfrage<br />
endgültig geklärt gewesen wäre. Ein heikler<br />
Schritt, zumal Öl- und Gasvorkommen in der<br />
Region vermutet werden.<br />
Doch Tokio und Peking verständigten sich<br />
prompt, dass der ungelöste Inselkonflikt die<br />
Beziehungen nicht belasten dürfte. Beide Seiten<br />
hielten sich daran – bis im Jahr 2010 ein chinesischer<br />
Fischer nahe der Inseln zwei japanische<br />
Patrouillenboote rammte. Wie betrunken der<br />
Mann war, ist bis heute umstritten. Jedenfalls<br />
löste seine Karambolage eine diplomatische Eskalation<br />
sondergleichen aus. Japan verhaftete<br />
den Seemann und weigerte sich, ihn auf Gesuch<br />
Chinas zu entlassen. Peking brach daraufhin<br />
die politischen Kontakte ab und stoppte<br />
den Export seltener Erden, welche der japanische<br />
Hightech-Sektor dringend benötigt. Eine<br />
Provokation gab die andere. Vergangene Woche<br />
schließlich kaufte die japanische Regierung der<br />
Familie die Inseln für 26 Millionen US-Dollar<br />
ab. Eigentlich eine Maßnahme der De es ka lation,<br />
denn die Regierung kam damit dem ultrarechten<br />
Gouverneur von Tokio als Käufer zuvor.<br />
Doch Peking und die chinesische Presse<br />
waren nicht mehr zu besänftigen.<br />
Sie wollen sich derzeit auch gar nicht besänftigen<br />
lassen. Die nationalistische Aufwallung<br />
kommt einer von Skandalen und Krisen geplagten<br />
Parteiführung durchaus gelegen, die zudem<br />
Winken von der Brücke<br />
Silvio Berlsuconi droht Italien mit einem Comeback. Vorher will er noch<br />
rasch den letzten unabhängigen Fernsehsender kaufen VON BIRGIT SCHÖNAU<br />
Rom<br />
Während seines Jurastudiums hatte Silvio<br />
Berlusconi auf Kreuzfahrtschiffen als<br />
Sänger gearbeitet, ein halbes Jahrhundert<br />
ist das her. Dass er jetzt nach Monaten in der<br />
politischen Versenkung auf der schneeweißen<br />
Divina (»die Göttliche«) sein Comeback verkünden<br />
wollte, erschien fast wie eine nostalgische<br />
Anwandlung: Mit 76 Jahren noch einmal dahin,<br />
wo alles begann, zu einem neuen Anfang. Daraus<br />
wurde nichts, was nicht nur daran lag, dass das<br />
Kreuzen auf dem Mittelmeer seit dem unrühmlichen<br />
Ende der Costa Concordia seinen Nimbus<br />
verloren hat. Auf der Divina reisten Leser des<br />
Berlusconi-Kampfblatts Il Giornale, die Kabine<br />
gab’s ab 980 Euro die Woche, den Ex-Premier als<br />
Stargast gratis dazu. Berlusconi schiffte sich in<br />
Venedig als Verheißung ein und ging in Bari als<br />
unerfülltes Versprechen von Bord. Denn selbst<br />
vor kleinem Publikum im Schiffstheater hatte er<br />
sich nicht durchringen können, seine Kandidatur<br />
für die Wahl im April 2013 anzukündigen.<br />
Halbherzig klang das Bekenntnis: »Ich fühle<br />
die Pflicht, zu verhindern, dass Italien der Linken<br />
anheimfällt.« Schal tönten die üblichen Wahlversprechen:<br />
Steuern senken, die neue Immobiliensteuer<br />
ganz abschaffen, »denn das Eigenheim ist<br />
das Fundament der italienischen Familie«. Montis<br />
Sparpolitik aber verhindere Wachstum und<br />
treibe Italien in die Rezession. Schuld daran seien<br />
jene Deutschen, die verhindern, dass die EZB<br />
»endlich Geld drucken kann«. Die deutsche<br />
Sparsucht laste auf Italien »wie ein Stein«.<br />
Während der Patriarch des »Freiheitsvolkes«<br />
gegen den Fiskalpakt wettert, haben seine Parlamentarier<br />
noch jedes Spargesetz der Regierung<br />
verabschiedet. Seit Berlusconis Rücktritt vor<br />
zehn Monaten unterstützt Parteisekretär Angelino<br />
Alfano den parteilosen Mario Monti im Verein<br />
mit dem Demokraten-Chef Pierluigi Bersani,<br />
einem Ex-Kommunisten.<br />
Alfano sei »der beste Politiker Italiens«, lobte<br />
Berlusconi vom Kreuzfahrtschiff. »Ich liebe ihn wie<br />
ein Vater seinen Sohn, und er bringt mir die Liebe<br />
eines Sohnes entgegen.« Demütig verharrt der<br />
41-Jährige Sizilianer in Wartestellung, bis sein Chef<br />
über die Kandidatur entscheidet. Wenn die Umfragewerte<br />
weiter im Keller bleiben, ist der getreue<br />
Vasall Alfano dran. Oder wenn das Mitte-Links-<br />
Bündnis tatsächlich Matteo Renzi, den jungen<br />
populären Bürgermeister von Florenz, als Kandidaten<br />
aufstellen würde: Gegen einen 37-jährigen<br />
würde Berlusconi wohl kaum antreten.<br />
Renzi tourt derzeit im Vorwahlkampf mit einem<br />
Wohnmobil durchs Land, Berlusconi<br />
kommt gerade aus dem gemeinsamen Urlaub in<br />
Kenia mit seinem Freund Flavio Briatore, einem<br />
Sportmanager, der zwischen Glamour und Halbwelt<br />
zu Hause ist und nach einer Sperre durch<br />
den Formel-1-Dachverband FIA ebenfalls an<br />
seinem Comeback feilt.<br />
Berlusconi und Briatore, das war das Italien<br />
der unaufhaltsamen Aufstiege, der zwielichtigen<br />
Geschäfte und schillernden Partys. Ein Italien,<br />
das jetzt hinter den grauen Kulissen der Rezession<br />
verblasst. Briatore hat seinen Klub Billionaire an<br />
der Costa Smeralda auf Sardinien geschlossen,<br />
gerade noch rechtzeitig, bevor die sardischen<br />
Kohle- und Metallarbeiter aus Angst um ihre Arbeitsplätze<br />
vergangene Woche in Rom Krawall<br />
schlugen. Berlusconi wurde am vergangenen Freitag<br />
ebenfalls in der Hauptstadt zum Fest der<br />
rechtskonservativen Jugendorganisation Giovane<br />
Italia erwartet. Im letzten Moment sagte er ab,<br />
vielleicht um lästigen Fragen auszuweichen. In<br />
Latium, der Region um Rom, versinkt das dort<br />
mit Rechtsextremen regierende »Freiheitsvolk« in<br />
einem Skandal um veruntreute Millionen aus der<br />
Parteikasse. Berlusconi schweigt dazu. Er konzentriert<br />
sich im Moment auf eigene Geschäfte.<br />
Sein Fernsehunternehmen Mediaset will von<br />
Telecom Italia den Sender La 7 übernehmen, das<br />
letzte landesweite unabhängige Fernsehen in Italien.<br />
Zu La 7 sind viele kritische Journalisten abgewandert,<br />
die sich nun entsetzt sind angescihts einer<br />
möglichen Übernahme durch Berlusconi. Selbst der<br />
erzkonservative Austroamerikaner Rupert Murdoch<br />
wäre der Belegschaft von La 7 als neuer Besitzer<br />
lieber. Die Schlacht um den Sender wird zeigen, wie<br />
weit Silvio Berlusconis Macht in Italien noch reicht.<br />
Felsen der<br />
Schande<br />
Droht ein Krieg? China und Japan streiten sich um<br />
fünf unbewohnte Inseln. Der<br />
Führung in Peking kommt das sehr gelegen<br />
CHINA<br />
VON ANGELA KÖCKRITZ<br />
JAPAN<br />
noch den internen Machtwechsel vorbereiten<br />
muss. Bloß lassen sich solche Aufwallungen<br />
nicht einfach wieder abstellen –<br />
schon gar nicht, wenn es gegen Japan geht.<br />
Japan ist der Hauptaggressor im chinesischen<br />
Narrativ von den hundert Jahren nationaler<br />
Erniedrigung. Die Kriege, die es beschreibt,<br />
sind nicht erfunden, das Trauma, das diese auslösten,<br />
ebenso wenig. Da waren zunächst die verlorenen<br />
Opiumkriege gegen die Briten, die das<br />
Kaiserreich Mitte des 19. Jahrhunderts bezwangen<br />
und Chinas jahrtausendealtes Selbstbild, die<br />
einzige wirkliche Großmacht auf Erden zu sein,<br />
zerstörten. Dann besiegte Japan, ehemals Tributstaat,<br />
das Kaiserreich im Ersten Japanisch-chinesischen<br />
Krieg von 1894 bis 1895 – und marschierte<br />
einige Jahrzehnte später auch noch in<br />
China ein. Der antijapanische Widerstandskampf<br />
während des Zweiten Weltkriegs war in<br />
gewisser Weise die Geburtsstunde der Volksrepublik.<br />
Erst durch den Widerstand konnten die<br />
Kommunisten die Sympathie der Massen gewinnen,<br />
die sie später zum Sieg gegen die Kuomintang<br />
tragen sollte. »Die Japaner besiegen und die<br />
Nation retten« wurde zum Gründungsmythos<br />
des jungen kommunistischen Staates. Mao befreite<br />
die Na tion aus den Ketten fremder Unterdrücker,<br />
er beendete das »Jahrhundert nationaler<br />
Erniedrigung« – auch wenn später Millionen im<br />
Zuge ihrer »Befreiung« ihr Leben lassen sollten.<br />
Den Nationalismus anzufächeln, hat sich für<br />
die Partei immer wieder als nützliche Strategie<br />
erwiesen. Nach dem Massaker 1989 auf dem<br />
Tiananmen-Platz bekämpfte die KP den öffentlichen<br />
Schock erfolgreich mit einem Trauerverbot<br />
für die erschossenen Demonstranten – und<br />
mit verordnetem Gedenken an die Opfer der<br />
Opiumkriege und der japanischen Invasion.<br />
Nun also der Kampf um Diaoyu mit den Mitteln<br />
des »rationalen Patriotismus«. Zu denen zählen<br />
offenbar auch sechs chinesische Patrouillenboote,<br />
die mit 1000 Fischkuttern im Schlepptau<br />
auf dem Weg zu den umstrittenen Inseln sind.<br />
Das zieht Aufmerksamkeit ab von dem immer<br />
noch nicht ausgestandenen Politskandal um den<br />
ehrgeizigen Provinzfürsten Bo Xilai, dessen Frau<br />
gerade wegen Mordes an einem britischen Ge-<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 9<br />
schäftsmann verurteilt wurde. Und vom Sohn<br />
eines Spitzenpolitikers, der kürzlich unbekleidet<br />
im Sportwagen und in Begleitung zweier halbnackter<br />
Frauen in den Tod raste. Schließlich verschwand<br />
auch noch der designierte Präsident Xi<br />
Jinping zwei Wochen lang von der Bildfläche.<br />
Das patriotische Theater lenkt nicht nur das Volk<br />
ab, es soll auch die Armee beschäftigt halten. Einige<br />
hochrangige Militärs gelten als Verbündete<br />
des gefallenen Provinzfürsten Bo, da kann es<br />
nicht schaden, etwaige unzufriedene Gemüter<br />
mit ein wenig Säbelrasseln zu beruhigen.<br />
Und doch hat der Nationalismus längst eine<br />
eigene Dynamik entwickelt, in der die Partei<br />
nicht mehr nur Antreiber, sondern manchmal<br />
auch Getriebener ist. Inzwischen hat sich ein patriotischer<br />
Diskurs gebildet sowie eine nationalistische<br />
Gemeinde, die Websites betreibt, politischen<br />
Druck ausübt und bisweilen der Regierung<br />
ihren Willen aufzwingt.<br />
Genau das macht das nationale Motiv der<br />
kollektiven Erniedrigung so gefährlich. Japan<br />
gibt den Chinesen dabei reichlich Anlass, sich zu<br />
empören. Die japanische Regierung entschuldigte<br />
sich nur zögerlich für die Gräueltaten während<br />
der Besatzung, die japanische Rechte bohrt bis<br />
heute gern in den chinesischen Wunden. Aber<br />
die ewige chinesische Propaganda von der historischen<br />
»Erniedrigung« provoziert gefährliche<br />
Rachebedürfnisse. »Sollte es einen neuen Krieg<br />
zwischen China und Japan geben«, schrieb unlängst<br />
die parteinahe Global Times, »muss es ein<br />
Krieg sein, durch den das chinesische Volk die<br />
Schande des vergangenen Jahrhunderts psychologisch<br />
reinwaschen kann.« Territoriale Kompromisse<br />
zugunsten Japans, so die Zeitung, würden<br />
China »doppelte Schande bringen«.<br />
Weder Peking noch Tokio wollen Krieg. Aber<br />
beide Seiten haben den Konflikt so weit eskalieren<br />
lassen, dass ein ungeplanter Zwischenfall –<br />
und sei es nur wieder ein betrunkener Fischer –<br />
unkontrollierbare Folgen haben könnte. Eine<br />
Demonstration kann man einzäunen. Den geballten<br />
Volkszorn eines ganzen Landes womöglich<br />
nicht.<br />
A www.zeit.de/audio
Foto: Vera Tammen für <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong><br />
10 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong><br />
<strong>ZEIT</strong>GEIST<br />
Botschaftsterror<br />
JOSEF JOFFE: Wenn es doch nur um<br />
verletzte religiöse Ehre ginge<br />
Früher entsandten Großmächte die Flotte, um<br />
ihre Botschaften zu schützen – etwa während des<br />
Boxeraufstandes anno 1900. Heute twittern die<br />
belagerten Diplomaten Entschuldigungen an ihre<br />
Peiniger – so geschehen in Kairo, wo der Mob die<br />
US-Vertretung wegen eines boshaften Mohammed-Films<br />
attackierte. In Bengasi trugen die Filmkritiker<br />
den Tod ins US-Konsulat.<br />
Die Abbitten zeigten, dass die Berufsaußenpolitiker<br />
den Kern der Sache nicht verstanden<br />
hatten. Es geht nicht um verletzte Gefühle, sondern<br />
um die kalte Macht, und zwar sowohl im<br />
Zivilisationskrieg gegen den Westen als auch im<br />
Binnenkrieg gegen eine stockende demokratische<br />
Revolution. In ihrer Panik waren die Twitter-<br />
Diplo ma ten in eine vertraute Falle gelaufen, die<br />
zuerst von Ajatollah Chomeini 1989 aufgestellt<br />
worden war. Der hatte die Todesfatwa gegen Salman<br />
Rushdie ein Jahr (!) nach Erscheinen der<br />
Sata ni schen Verse verhängt. Der »spontane« Wutausbruch<br />
war zynisch kalkulierte Machtpolitik.<br />
Der sterbende Chomeini wollte eine ermüdete islamische<br />
Revolution nach einem blutigen, aber<br />
unentschiedenen Acht-Jahre-Krieg gegen den Irak<br />
wiederbeleben.<br />
Auch die nächsten Etappen im Kampf der Kulturen<br />
waren organisiert. Der mörderische Aufruhr<br />
von 2005 gegen die Mohammed-Karikaturen in<br />
der dänischen Jyllands-Posten brach Monate nach<br />
deren Veröffentlichung aus. »Unschuld der Muslime«<br />
wurde zu Jahresbeginn in Hollywood gezeigt;<br />
schon im Juli erschien der Trailer im Netz. Allein<br />
das Datum der Wutkampagne – der Jahrestag von<br />
9/11 – ließ erkennen, dass die verletzte Religionsehre<br />
bloß ein Mittel zum Zweck war. Die deutsche<br />
Botschaft im Sudan? Die Attacke wurde als »spontane«<br />
Bestrafung der Kanzlerin verbrämt, die vor<br />
zwei Jahren die Zivilcourage des dänischen Karikaturisten<br />
Westergaard gelobt hatte.<br />
Ein jedes Mal bricht hernach der Gewissenskampf<br />
im Westen aus: Wiegt nicht der Respekt<br />
vor religiösen Empfindlichkeiten schwerer als die<br />
Josef Joffe ist<br />
Herausgeber der <strong>ZEIT</strong><br />
Meinungsfreiheit? Vielleicht, wenn es doch nur<br />
um Rücksicht ginge. Bedenkt man allerdings, wie<br />
viel Hass und Gemeinheit im Netz stehen, und<br />
zwar nicht nur gegen den Islam, wäre ein weltweiter<br />
Kontrollmechanismus vonnöten, der die<br />
Totalitären des 20. Jahrhunderts vor Neid erblassen<br />
ließe. Die Flotte zu entsenden geht auch nicht,<br />
weil der Kulturkampf just jene demokratischen<br />
Kräfte bedroht, die unser Wohlwollen verdienen.<br />
Die Schwäche dieser Regime ist die Stärke des<br />
Terrorismus. Und dennoch können wir die Mursis<br />
dieser Welt nicht aus ihrer Pflicht entlassen: Die<br />
Sicherheit von Botschaften ist heilig, sonst ist es<br />
vorbei mit dem zivilen Umgang der Staaten. Der<br />
ägyptische Präsident hat schändlich lange gezögert,<br />
bevor er die Polizei mobilisierte. Dito die libysche<br />
Staatsmacht. Human Rights Watch hat die richtige<br />
Frage gestellt: Diese Regierungen »müssen sich<br />
entscheiden. Wollen sie mit der Außenwelt verbunden<br />
bleiben oder einer Minderheit im eigenen<br />
Land erlauben, das zu vereiteln?«<br />
Wenn die Wut Programm ist, helfen Entschuldigungen<br />
nicht. Mursi und Kollegen haben eine<br />
Bringschuld, die so schwer nicht zu begleichen ist,<br />
weil die dem eigenen Interesse dient.<br />
DURCHSCHAUEN SIE JEDEN TAG.<br />
Foto: Youssef Boudlal/Reuters<br />
BÜRGERKRIEG<br />
Syriens schwieriges Erbe<br />
Syrien-Schwerpunkt auf <strong>ZEIT</strong> ONLINE:<br />
Wie das Assad-Regime Syriens zersplitterte<br />
Gesellschaft kontrolliert. Außerdem: Ein<br />
Gastbeitrag der Ex-Star-Moderatorin Honey<br />
Al-Sayed, die fürchtet, dass der Krieg ihr<br />
Land spaltet<br />
www.zeit.de/ausland<br />
MEINUNG<br />
Foto: Vincent Kessler/Reuters<br />
Foto: Scott Houston/Polaris/StudioX (der episkupale Bischof George Packard nimmt am Jahrestag der »Occupy Wall Street« teil; NYC; 17.09.<strong>2012</strong>)<br />
Sieht links aus, ist aber nur gerecht<br />
In der Koalition wehren sich viele gegen den Rentenzuschuss. Zu Unrecht VON ELISABETH NIEJAHR<br />
Diese Rechnung schaffen schon Grundschulkinder:<br />
Wer monatlich 2000 Euro brutto verdient<br />
und fest angestellt ist, muss knapp 200<br />
Euro in die Rentenversicherung einbezahlen.<br />
Wer 1500 bekommt, gibt etwa 150 Euro ab.<br />
Früher einmal mussten Bürger den sprichwörtlichen<br />
»Zehnten« ihres Einkommens an<br />
Fürsten oder Lehensherren abgeben. Heute<br />
bekommt die Rentenversicherung in etwa so<br />
viel. Jedenfalls, solange der Beitragssatz bei<br />
19,6 Prozent liegt und die Hälfte der Kosten<br />
der Arbeitgeber trägt.<br />
200 Euro pro Monat – das lässt sich leicht<br />
in Urlaubsreisen, in neue Autos oder Möbel<br />
umrechnen, und viele Beschäftigte haben<br />
Grund, solche Rechnungen mit Wut, manchmal<br />
sogar mit Verzweiflung anzustellen. Für<br />
ganze Bevölkerungsgruppen ist der größte<br />
und wichtigste Zweig des Sozialstaats eine Zumutung.<br />
Wer heute eine sozialversicherungspflichtige<br />
2000-Euro-Stelle hat, bekommt<br />
nach vierzig Berufsjahren weniger Rente, als<br />
ein Sozialhilfeempfänger vom Staat erhält.<br />
Die alte Arbeiterversicherung versagt ausgerechnet<br />
beim Schutz der kleinen Leute, bei<br />
der Klientel also, für die sie einst erfunden<br />
wurde. Für Millionen von Geringverdienern,<br />
für Friseurinnen oder Supermarkt-Kassiererinnen,<br />
für Wachdienstler oder Floristen ist<br />
die gesetzliche Rentenversicherung ein extrem<br />
schlechtes Geschäft.<br />
Trotzdem gibt es in den Regierungsparteien<br />
große Vorbehalte gegen alle Vorschläge,<br />
wonach die Rente von Geringverdienern vom<br />
Staat aufgestockt werden könnte. Leistung soll<br />
sich lohnen – das ist das wichtigste Argument<br />
MICHAEL HANEKE<br />
Wie weit kann Liebe gehen?<br />
Der Partner wird zum Pflegefall. Man<br />
sieht ihn leiden und leidet mit. Diesem<br />
Thema widmet sich Regisseur Michael<br />
Haneke in seinem neuen Film »Liebe«. Im<br />
Interview erzählt er, wie er sich einmal in<br />
einer ähnlichen Situation entschieden hat<br />
www.zeit.de/film<br />
Foto: Revolver Promotion<br />
der Skeptiker. Wer viel einzahlt, soll im Alter<br />
mehr bekommen als jemand, der nur wenig<br />
Geld überweisen kann.<br />
Nur: Was eigentlich ist mit der Leistung<br />
derer, die für wenig Geld hart arbeiten und<br />
trotzdem nichts zu erwarten haben? Sie erleben<br />
den Sozialstaat als unfaire Umverteilungsmaschine,<br />
die unten nimmt und oben gibt.<br />
Der Staat zwingt sie in ein unattraktives System.<br />
Eigentlich müssten sich gerade die liberalen<br />
Kritiker, die das Prinzip von Leistung und<br />
Gegenleistung hochhalten, darüber aufregen.<br />
Mit staatlichen Rentenzuschüssen für Geringverdiener,<br />
egal, ob man sie Zuschussrente<br />
(CDU) oder Solidarrente (SPD) nennt, verhält<br />
es sich ähnlich wie mit gesetzlichen Mindestlöhnen:<br />
klingt links, passt aber bei genauerem<br />
Hinsehen hervorragend zum Gedankengut<br />
klassischer Ordnungspolitiker. Beide Instrumente,<br />
Mindestlöhne und Zuschussrenten,<br />
sollen dafür sorgen, dass Anstrengung<br />
honoriert wird, wer sie einführt, ist ein Freund<br />
der Fleißigen. Nur wenn man es übertreibt,<br />
wenn Mindestlöhne und Rentenzuschüsse zu<br />
hoch sind, ist der eigentliche Zweck in Gefahr.<br />
Die Prinzipien der Rentenversicherung,<br />
wonach die Rentenhöhe exakt dem Beitrag<br />
folgt, dürften nicht erschüttert werden, warnen<br />
Kritiker. Als hätten diese Regeln jemals in<br />
Reinform gegolten! Im deutschen Rentensystem<br />
wurde immer kräftig ergänzt und aufgestockt,<br />
zugunsten von Kriegsopfern, Müttern<br />
oder eben, zwanzig Jahre lang, von Geringverdienern.<br />
»Rente nach Mindesteinkommen«<br />
nannte man das früher. 1992 wurde diese Regelung<br />
für Einkommensschwache abgeschafft.<br />
Die Sozialpolitiker von CDU und SPD wollen<br />
sie seit Jahren wiederbeleben, weil sie sehen,<br />
wie stark die Zahl der Niedriglöhner<br />
neuerdings steigt. Für sie müsse der Staat am<br />
Ende vermutlich ohnehin zahlen, heißt es,<br />
weil die Rente nicht zum Leben reiche.<br />
Lange galt das Problem der Altersarmut in<br />
Deutschland als gelöst. Vor allem die Wohlhabenden<br />
und die Jungen protestierten gegen<br />
das gesetzliche Rentensystem. Die einen wollten<br />
höhere Renditen für ihre Ersparnisse, die<br />
anderen sahen sich als Verlierer einer alternden<br />
Gesellschaft, die viel zahlen mussten und wenig<br />
zu erwarten hatten.<br />
Darauf reagierten die Rentenreformer der<br />
Regierung Schröder, sie führten die private<br />
Riester-Rente ein und senkten die Beiträge –<br />
aber auch die Leistungen. Im Jahr 2030 wird<br />
das Rentenniveau in Deutschland niedriger<br />
sein als in den meisten anderen Industrieländern,<br />
Deutschland gehört dann zum unteren<br />
Drittel. Die Geringverdiener von heute sind<br />
die neuen Verlierer des Rentensystems.<br />
Natürlich kann sich noch einiges zum Besseren<br />
ändern. Weil die Konjunktur zuletzt so<br />
gut lief, sind die Renten im vergangenen Jahr<br />
sogar stärker gestiegen als die Löhne. Es wird<br />
bald mehr Erben und mehr Rentnerhaushalte<br />
mit zwei Einkommen geben. All das wird in<br />
vielen Fällen gegen Notlagen helfen – es ändert<br />
aber nichts an der Ungerechtigkeit des<br />
größten staatlichen Versicherungssystems.<br />
Ganz unabhängig davon, wie schlimm die Altersarmut<br />
am Ende ausfällt: Der Sozialstaat<br />
muss faire Bedingungen bieten für alle, die er<br />
zum Mitmachen zwingt.<br />
HEUTE: 17.9.<strong>2012</strong><br />
Gottes Macht<br />
BERLINER BÜHNE<br />
POLITIK<br />
George Packard sieht aus, als sei er<br />
gerade vom Himmel in die Niederungen<br />
der Menschheit, des Kapitalismus<br />
und des New Yorker<br />
Bankenviertels herabgestiegen.<br />
Sein Gesicht leuchtet, die Hochhäuser<br />
Manhattans verschwinden<br />
grau und klein im Hintergrund.<br />
Packard ist Bischof im Ruhestand<br />
und Occupy-Anhänger, der seinen<br />
eigenen Blog betreibt.<br />
Als junger Mann kämpfte<br />
Packard in Vietnam, später war er<br />
Militärpfarrer im Irak. Demonstrationen<br />
mit viel Polizei können<br />
ihn nicht schrecken. Zweimal<br />
schon wurde er bei Occupy-Protesten<br />
festgenommen. Am Abend<br />
dieses ersten Jahrestags der Bewegung<br />
wird es einmal mehr sein.<br />
Occupy-Button und Kreuz gehören<br />
für Packard zusammen.<br />
Sein Blick schweift sorgenvoll in<br />
die Ferne, sorgenvoll, als habe er<br />
am Horizont einen Banker erspäht,<br />
den er zur Umkehr aufrufen<br />
muss. MEI<br />
Shitstopp ohne SPD<br />
Piraten wollen sich besser benehmen,<br />
Sozialdemokraten schleichen weiter<br />
Johannes Ponader, der Pirat, der stets mit gezücktem<br />
Smartphone und in abgewetzten Jesuslatschen<br />
die TV-Plauderstunden der Republik heimsucht,<br />
möchte eine Shitstopp-Kultur im Internet etablieren.<br />
Wir begrüßen das sehr, wenngleich wir uns<br />
auch eine Ponader-Stopp-Kultur im TV gut vorstellen<br />
könnten. Oder gar eine Plauderstunden-<br />
Stopp-Kultur in der TV-Republik, ein sogenanntes<br />
Jauch-out.<br />
Mit seinem Shitstopp will Ponada die unablässig<br />
tobenden Shitstorms beenden, mit denen Piraten<br />
und andere, die nicht wissen, wo man sich<br />
verbal die Nase pudert, die virtuellen Räume des<br />
Anstands sprachlich verunreinigen. Wir haben bereits<br />
einen ersten Stopp-Tipp: Sobald der gemeine<br />
User seinen Computer einschaltet, taucht umgehend<br />
ein Warnhinweis auf: »Verlassen Sie das Internet<br />
bitte so, wie Sie es vorgefunden haben.«<br />
Die Sozialdemokraten, um zu einem Shitstopp<br />
der anderen Art zu kommen, verlassen im Herbst<br />
2013 den Wahlkampf wohl auch so, wie sie ihn im<br />
Sommer vorfinden werden: SPD-Kanzler-frei. Im<br />
Kandidatenrennen, so hieß es zu Wochenbeginn<br />
in Berlin, sei Sigmar Gabriel ausgestiegen, Frank-<br />
Walter Steinmeier und Peer Steinbrück würden bis<br />
zu einem Parteitag im Dezember freundschaftlich<br />
entscheiden, wer gegen Angela Merkel antritt.<br />
Hier sind gleich vier Fehler versteckt: Es gibt keinen<br />
Parteitag im Dezember, es gibt keine Freundschaft,<br />
Gabriel bleibt dabei. Und die Kandidaten<br />
rennen nicht: Sie schleichen. Shitstopp? Im Gegenteil.<br />
The shit must go on. PETER DAUSEND<br />
POLITIK WIRTSCHAFT MEINUNG GESELLSCHAFT KULTUR WISSEN DIGITAL STUDIUM KARRIERE LEBENSART REISEN AUTO SPORT<br />
VIDEO<br />
Musique pop acoustique<br />
Lippen so rot und Sommerwind unterm<br />
Rock: Das Pariser Popduo Brigitte hat aus<br />
den schönsten Frankreichklischees ein<br />
tolles Debütalbum gemacht. Wir luden<br />
die Damen ein zur Akustiksession vor<br />
dem Rekorder. La vie est belle!<br />
www.zeit.de/musik<br />
Foto: dpa<br />
PRIVATUNIS<br />
EBS unter Beschuss<br />
Das Land Hessen fördert die European<br />
Business School mit Millionensummen.<br />
Trotzdem muss sich die Privatuni gegen<br />
Gerüchte wehren, sie stehe vor der Pleite.<br />
Nun wird der Ruf nach einem parlamentarischen<br />
Untersuchungsausschuss laut<br />
www.zeit.de/studium<br />
www.zeit.de<br />
Wohndesign-Blog<br />
»Freunde von Freunden« gewährt Einblick in<br />
die Wohnzimmer von Kreativen. Wir zeigen<br />
jede Woche eine exklusive Auswahl<br />
www.zeit.de/freunde-von-freunden<br />
<strong>ZEIT</strong> ONLINE auf Facebook<br />
Werden Sie einer von über 106.000 Fans von<br />
<strong>ZEIT</strong> ONLINE auf Facebook und diskutieren<br />
Sie aktuelle Themen mit uns<br />
www.facebook.com/zeitonline<br />
<strong>ZEIT</strong> ONLINE twittert<br />
Folgen Sie <strong>ZEIT</strong> ONLINE auf twitter.com,<br />
so wie schon mehr als 182.000 Follower. Sie<br />
erhalten ausgewählte Hinweise aus dem Netz<br />
www.twitter.com/zeitonline<br />
Briefkasten-Zertifikat<br />
SHA1-Fingerprint: 8F A6 19 69 0E 7E D5<br />
3B 9F 75 4B 09 6A 4E 35 4A 8C 54 CE 2F<br />
Wie Sie diesen Fingerprint nutzen, lesen Sie<br />
hier www.zeit.de/briefkasten
POLITIK<br />
DAMALS: 18.11.2011<br />
Staatsmacht<br />
Die Occupy-Bewegung ist gerade<br />
zwei Monate alt, als die Staatsmacht<br />
ausholt. An der Universität<br />
von Davis, Kalifornien, demonstrieren<br />
Studenten mit einer Sitzblockade<br />
gegen höhere Studiengebühren.<br />
Da kommt ein Polizist<br />
mit einer Dose Pfefferspray. Er<br />
schreitet die Reihe ab und sprüht<br />
in die Gesichter – so lässig, als<br />
gieße er den Rasen oder das Gemüsebeet.<br />
Der Polizist trägt Schutzhelm<br />
und Pistole, er schaut runter auf<br />
ein Häuflein Jeanshosen, eilig<br />
über den Kopf gezogener Kapuzen<br />
und nackte Fußknöchel. Einen<br />
Brillenträger trifft er mitten<br />
ins Gesicht. Die Studenten am<br />
Rand filmen ihn. Und so geht<br />
das Bild des brutalen Polizisten<br />
um die Welt, schließlich verliert<br />
er seinen Job. Im Internet tauchen<br />
Tausende Karikaturen auf,<br />
die den »Pfefferspray-Cop« verhöhnen.<br />
Von da an gehen die<br />
Proteste erst richtig los. MEI<br />
Sparen ruiniert uns alle<br />
Die deutsche Politik führt Europa in die Katastrophe VON LAURENT JOFFRIN<br />
Die öffentliche Meinung in Deutschland fordert<br />
von allen europäischen Ländern harte<br />
Budgetdisziplin. Das ist vollkommen verständlich.<br />
Die Bundesrepublik hat zehn Jahre lang<br />
schmerzhafte Reformen umgesetzt, die soziale<br />
Errungenschaften infrage stellten und für einen<br />
bedeutenden Teil der Bevölkerung Einkommensverluste<br />
mit sich brachten. Und tatsächlich,<br />
nach dieser spektakulären Anstrengung<br />
fasste die deutsche Wirtschaft wieder<br />
Tritt. Die Finanzen gesundeten, die Arbeitslosenrate<br />
sank.<br />
Angesichts dieses Erfolgs, für den sie hart<br />
gearbeitet haben, verstehen die Deutschen<br />
nicht, wieso sie jetzt Länder subventionieren<br />
sollten, die vergleichbare Anstrengungen verweigert<br />
hatten und stattdessen den leichteren<br />
Weg gingen: den in die Verschuldung. Mit<br />
größtem Misstrauen blicken die Deutschen<br />
jetzt auf Europas Süden und seine Forderungen,<br />
von denen sie fürchten, dass sie die Geldstabilität<br />
der Union gefährden könnten. Sie erinnern<br />
sich auch gut an die feierlich auf EU-<br />
Gipfeln gegebenen Versprechen einiger europäischer<br />
Spitzenpolitiker: Kaum<br />
waren die Regierungsvertreter<br />
wieder in ihre Länder zurückgekehrt,<br />
war alles vergessen.<br />
Und doch: Diese logische,<br />
rationale, gerechtfertigte Haltung<br />
führt geradewegs in die<br />
Katastrophe.<br />
Die in Europa praktizierte<br />
Sparpolitik wirkt zerstörerisch.<br />
Simultan – und oft brutal – umgesetzt,<br />
drosselt sie auf dem gesamten<br />
Kontinent die Nachfrage.<br />
Die wirtschaftliche Aktivität<br />
erliegt, die Zahl der Pleiten<br />
nimmt zu, die Gewinne<br />
schrumpfen, und währenddessen<br />
wächst die Arbeitslosigkeit:<br />
Es gibt Länder, in denen sie<br />
mehr als 20 Prozent der Bevölkerung<br />
erfasst hat. In einigen Südländern ist die<br />
Hälfte der Jugendlichen im arbeitsfähigen Alter<br />
beschäftigungslos. Die wirtschaftliche Paralyse<br />
reduziert wiederum die Einnahmen aus Steuern<br />
und Sozialabgaben. Und das in einem Maße,<br />
dass die Sparpolitik just die gegenteilige Wirkung<br />
erzielt als die angestrebte: Anstatt die Defizite<br />
zu verringern, vergrößert sie diese.<br />
Das deutlichste Beispiel für den perversen<br />
Effekt der Austeritätspolitik bietet Portugal.<br />
Nachdem das Land mit Eifer die europäischen<br />
Empfehlungen umgesetzt und alle geforderten<br />
Strukturreformen verwirklicht hatte, auch die<br />
schmerzlichsten, musste die Regierung in Lissabon<br />
feststellen, dass ihr Budgetdefizit sogar noch<br />
gewachsen war und ihre Verschuldung eine atemberaubende<br />
Höhe erreicht hatte.<br />
Mit anderen Worten: Austeritätspolitik<br />
bringt die Gefahr mit sich, dass die europäischen<br />
Patienten geheilt sterben.<br />
Die Rezession, die sich auf dem Kontinent<br />
auszubreiten beginnt, wird überdies politische<br />
Auswirkungen haben. Schon jetzt wenden sich<br />
die Völker mehr und mehr von einer Politik ab,<br />
von der sie meinen, dass sie ihnen von Brüssel<br />
oder Berlin aufgezwungen wird. Jeder weiß,<br />
dass der derzeit diskutierte Fiskalpakt, der von<br />
den Unterzeichnern eine Schuldenbremse verlangt<br />
und europäische Kontrollmechanismen<br />
LAURENT JOFFRIN,<br />
geboren 1952, ist<br />
Chefredakteur der<br />
führenden französischen<br />
Wochenzeitschrift »Le<br />
Nouvel Observateur«<br />
und Verfasser mehrerer<br />
Romane und Sachbücher<br />
für die Budgetdisziplin vorsieht, in etlichen<br />
Ländern abgelehnt werden würde, legte man<br />
ihn zur Ratifizierung den Bürgern und nicht<br />
den Parlamenten vor. Wahrscheinlich geben die<br />
Antieuropäer bereits die Mehrheitsstimmung in<br />
diesen Zeiten der Krise wieder. Extreme Parteien<br />
sehen sich ermutigt. In Frankreich streifte<br />
der nationalistische Front National in den<br />
jüngsten Präsidentschaftswahlen die 20 Prozent,<br />
während die extreme Linke auf mehr als<br />
zehn Prozent kam; der Anteil der Franzosen, die<br />
das europäische System in seiner jetzigen Form<br />
radikal ablehnen, beträgt mithin ein Drittel der<br />
Bevölkerung. Vergleichbare Phänomene werden<br />
in zahlreichen Ländern der Europäischen<br />
Union beobachtet.<br />
Deshalb stehen die Deutschen vor einer<br />
doppelten Bedrohung. Erstens wird ihre Wirtschaft,<br />
die vom Export in den europäischen<br />
Raum abhängt, direkt von der europaweiten<br />
Rezession bedroht. Indem sie von sparunwilligen<br />
Ländern Austeritätspolitik verlangt, bestraft<br />
sich die Bundesrepublik also selbst. Ein<br />
erfolgreiches Deutschland inmitten eines ruinierten<br />
Europas? Das wäre<br />
nicht möglich. Zweitens aber<br />
droht auch politische Gefahr.<br />
Die Existenz des Euro wäre infrage<br />
gestellt, würde er für die<br />
Bevölkerung der Südländer<br />
zum Symbol der sozialen Opfer<br />
und Leiden; der Auftrieb nationalistischer<br />
Parteien würde<br />
dann jene politische Union gefährden,<br />
die mehrere europäische<br />
Generationen, namentlich<br />
Deutsche und Franzosen, mit<br />
so viel Mühe aufgebaut hatten.<br />
Doch es gibt einen Ausgang<br />
aus diesem vertrackten Labyrinth.<br />
Europa kann und muss<br />
auf die Rezession reagieren:<br />
Wachstumspolitik ist jetzt das<br />
dringendste Gebot, mehr als<br />
Sparpolitik. Nicht dass auf seriöse Budgetpolitik<br />
verzichtet werden soll, nein, das Vertrauen<br />
der Märkte in die europäischen Regierungen<br />
muss wiederhergestellt werden. Eine machtvolle<br />
Konjunkturpolitik ist notwendig, und es<br />
liegt an Brüssel, sie zu beschließen. Nur sofortiges,<br />
gemeinsames Handeln auf kontinentaler<br />
Ebene kann eine dramatische Rezession verhindern,<br />
die Europa in den Ruin treibt.<br />
Wie das bezahlt werden soll? Durch Kredite<br />
der Zentralbank für die EU und nicht bloß<br />
für die Banken. In einer schrumpfenden Wirtschaft<br />
gibt es schließlich kein Inflationsrisiko.<br />
Es ist an der Zeit, dass die Europäische Zentralbank<br />
ihre Verantwortung für das Wachstum<br />
so wahrnimmt, wie es alle Zentralbanken<br />
der Welt tun – und wie es ja auch Mario Draghi<br />
zu tun beginnt, indem er Staatsanleihen<br />
gefährdeter Länder auf dem Sekundärmarkt<br />
kauft. Eine solche Politik der monetären Expansion,<br />
gewiss gesteuert und kontrolliert, ist<br />
der einzige Rettungsanker für einen Kontinent,<br />
der von einer Krise wie im Jahr 1929 bedroht<br />
wird. Muss man dafür Dogmen opfern?<br />
Unbedingt. Außergewöhnliche Probleme lassen<br />
sich nun einmal nie mit gewöhnlichen<br />
Mitteln lösen.<br />
Aus dem Französischen von GERO VON RANDOW<br />
15, die Kanzler werden wollen<br />
Revolte bei den Grünen: Die Männer wollen wieder wer sein<br />
Dass das Verdrängte unerledigt wiederkehrt, ist<br />
ein aus der Psychoanalyse bekannter Phänomen,<br />
das nun auch bei den Grünen auftritt. Die Grünen<br />
halten sich viel zugute auf ihre Kultur der<br />
Frauenförderung: KandidatInnen-, ja selbst RednerInnenlisten<br />
sind quotiert, wichtige Parteiämter<br />
werden traditionell doppelt besetzt, nur Joschka<br />
Fischer war sozusagen eine übergeschlechtliche<br />
Notwendigkeit.<br />
Das konnte auf die Dauer nicht gut gehen.<br />
Nun kehrt das Verdrängte zurück – in Gestalt von<br />
Thomas Austermann, Patrick Held, Nico Hybbeneth,<br />
Roger Jörg Kuchenreuther, Alfred Mayer,<br />
Markus Meister, Friedrich Wilhelm Merck, Hans-<br />
Jörg Schaller, Franz Spitzenberger, Werner Wink-<br />
MEINUNG<br />
ler und Peter Zimmer. Elf grüne Männer, die alle<br />
Spitzenkandidaten der Grünen werden, also die<br />
Rolle einnehmen wollen, die darin besteht, nach<br />
der Bundestagswahl 2013 nicht Kanzler zu werden,<br />
es vorher aber rein theoretisch werden zu<br />
können.<br />
Gäbe es nicht Claudia Roth, Renate Künast<br />
und Katrin Göring-Eckardt, dann könnte man<br />
sagen: Keine Frau ist dumm genug, einen solchen<br />
Job zu wollen. Da es die drei aber gibt, und da<br />
Jürgen Trittin keine übergeschlechtliche Notwendigkeit<br />
ist, und da es sich hier um die Partei<br />
der Grünen handelt, kann man davon ausgehen,<br />
dass es am Ende eine von ihnen werden wird.<br />
Oder auch zwei. FRANK DRIESCHNER<br />
Fotos: Wayne Ticock/AP/ddp (Pfefferspray gegen Demonstranten d. Occupy Bewegung; University of California; 18.11.2011); Olivier Roller/StudioX (u.)<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 11<br />
Stimmvieh, grasend<br />
Mitt Romney beleidigt die<br />
amerikanischen Wähler<br />
Mitt Romney ist Herausforderer von Barack<br />
Obama, außerdem ist er Mormone,<br />
mithin eine Art Christ. Trotzdem hat er,<br />
wie nun mittels versteckter Kamera bekannt<br />
wurde, ein radikal materialistisches<br />
Menschenbild. Romney hat nämlich im<br />
Kreise reicher Freunde erklärt, dass 47 Prozent<br />
der Amerikaner sowieso Obama wählten,<br />
weil 47 Prozent keine Steuern zahlten,<br />
folglich vom Staat abhängig seien und<br />
Obama als dem Mann des Staates ihre<br />
Stimme geben müssten. Es lohne sich für<br />
ihn, Romney, also nicht, sich um dieses sozialstaatsblöde<br />
Stimmvieh zu kümmern.<br />
Nun wollen wir hier gar nicht auf der<br />
Frage herumreiten, ob nach dieser Logik<br />
Romneys reiche Freunde, die vermutlich<br />
auch keine Steuern zahlen, nicht gerade deshalb<br />
Romney wählen, damit sie auch in Zukunft<br />
keine Steuern zahlen müssen. Nein, es<br />
geht um etwas anderes: um die ebenso obszöne<br />
wie verbreitete wie falsche Auffassung,<br />
dass der Mensch strikt nach seinen ökonomischen<br />
Interessen handelt und auch wählt.<br />
Man kennt all die Weisheiten: Erst<br />
kommt das Fressen, dann die Moral, das<br />
Sein bestimmt das Bewusstsein, mit Speck<br />
fängt man Mäuse. Tatsächlich stürzt der<br />
Mensch sich ins Unglück für die Liebe, oder<br />
er gibt sein Leben für die Freiheit, oder er<br />
verlässt Haus und Hof für den Glauben,<br />
oder er setzt seinen Familienfrieden aufs<br />
Spiel für die Fußballbundesliga.<br />
So ist der Mensch.<br />
Auch der amerikanische natürlich, auch<br />
der, der zu arm ist, um Steuern zu zahlen.<br />
Beispielsweise hat dieser arme Amerikaner<br />
zweimal hintereinander millionenfach<br />
George W. Bush und die Republikaner gewählt,<br />
obwohl er wusste, dass die eine Politik<br />
für die Reichen machen. Warum? Aus<br />
religiösen und patriotischen Gründen, jedenfalls<br />
hat er das fest geglaubt.<br />
Mitt Romney hat nun das Rätsel gelöst,<br />
warum ein Mann, der behauptet, so sehr<br />
christlich zu sein, so kalt rüberkommt. Weil<br />
er als Politiker offenbar kalt denkt, weil<br />
Christentum bei ihm eine Lebensform<br />
meint, das Vater-Mutter-Ehe-Kirchgang-<br />
Christentum, nicht jenes, das niemanden<br />
zurücklässt, das den Menschen frei machen<br />
kann vom schnöden Mammon, fähig, zu<br />
lieben und den anderen mit Liebe zu sehen.<br />
Nun sagen in den USA viele professionelle<br />
Beobachter des Wahlkampfes, dass<br />
Romney sich mit seinem Auftritt selbst versenkt<br />
habe. Wenn das stimmt, dann deshalb,<br />
weil sich zu viele Wähler in ihrer Ehre<br />
gekränkt fühlen, sie wollen kein grasendes<br />
Stimmvieh sein. Ehre ist eben auch wichtiger<br />
als keine Steuern. BERND ULRICH
Foto: Wolfgang Wilde für <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong><br />
Montagen DZ: AFP/Getty; Unger; laif (o.); ullstein; Getty (u.)<br />
Ein Kieferbruch für die Ewigkeit<br />
Foto: Christian Grund Foto: Db Alfred-Wegener-Institut/picture-alliance/dpa<br />
IN DER <strong>ZEIT</strong><br />
nah<br />
Die Doris-Show<br />
Tanja Stelzer, Redakteurin im Dossier, hat Doris<br />
Schröder-Köpf (rechts) begleitet, die in den Niedersächsischen<br />
Landtag einziehen will. Ihr Mann,<br />
Ex-Kanzler Gerhard Schröder, soll öfter die Kinder<br />
hüten. Die Recherche über die neue Rollenverteilung<br />
führte unsere Autorin mit der Kandidatin auf den<br />
höchsten Gipfel von Hannover und mit dem Vortragsreisenden<br />
nach Peking. Wenn deren Handy klingelte,<br />
und er war dran, bat sie die Autorin: »Könnten Sie mal<br />
kurz auf den Jungen aufpassen?« DOSSIER SEITE 13–15<br />
Ein tragisches Trio<br />
VON MATTHIAS GEIS<br />
Nächste Woche feiert die<br />
CDU Helmut Kohl, der<br />
vor 30 Jahren Kanzler<br />
wurde. Das Zusammentreffen<br />
der drei prägenden<br />
Figuren der jüngeren<br />
CDU-Geschichte, Kohl,<br />
Merkel und Schäuble,<br />
erinnert an das Drama,<br />
in das sich Politik verwandeln<br />
kann POLITIK S. 3<br />
Ein Kieferbruch für die Ewigkeit<br />
Der deutsche Fußball bekommt ein Museum. Wie sieht<br />
das d aus, was gehört hö hinein? hi i ? Moritz M i Müller-Wirth Müll Wi h und d<br />
Christof Siemes ließen sich von legendären Bällen, dem<br />
letzten Wort zum Wembley-Tor und ausstellungswürdigen<br />
Verletzungen berichten WOCHENSCHAU SEITE 16<br />
NÄCHSTE WOCHE IN DER <strong>ZEIT</strong><br />
Vier Wochen auf der »Polarstern«<br />
Auf Deutschlands größtem Forschungsschiff wird der Arktis<br />
der Puls gefühlt. Wie verlaufen die Meeresströmungen am<br />
Polarkreis? Wie wirkt sich der Klimawandel aus? Neben<br />
45 Wissenschaftlern war unsere Autorin Stefanie Schramm<br />
an Bord. Bericht von einer Reise durchs Eismeer WISSEN<br />
Wetten, dass ...<br />
... es gutes Fernsehen gibt?<br />
Wir haben uns auf die Suche<br />
gemacht und festgestellt: Das<br />
deutsche Fernsehen ist besser<br />
als sein Ruf MAGAZIN<br />
POLITIK<br />
2 FDP Philipp Rösler in<br />
Vietnam – ein Volksheld wider<br />
Willen VON KHUÊ PHAM<br />
3 CDU Ein tragisches Trio:<br />
Helmut Kohl, Wolfgang Schäuble<br />
und Angela Merkel<br />
4 Integration Ein Gespräch mit<br />
Heinz Buschkowsky, Bürgermeister<br />
von Berlin-Neukölln<br />
5 Analysen<br />
6 Mohammed-Film<br />
Was steckt hinter den Protesten<br />
in muslimischen Ländern?/Ein<br />
Gespräch mit dem ägyptischen<br />
Islamminister über Religion und<br />
Provokation<br />
8 USA Zum Schießkurs<br />
bei der National Rifle Association<br />
VON ANDREA BÖHM<br />
9 Asien Der Streit zwischen China<br />
und Japan um eine Inselgruppe<br />
eskaliert VON ANGELA KÖCKRITZ<br />
Italien Wie Silvio Berlusconi sich<br />
an seinem Comeback abmüht<br />
VON BIRGIT SCHÖNAU<br />
10 Zeitgeist VON JOSEF JOFFE<br />
Altersarmut Die Renten für<br />
Gering verdiener müssen erhöht<br />
werden VON ELISABETH NIEJAHR<br />
Berliner Bühne VON P. DAUSEND<br />
11 Europa Deutschlands Sparpolitik<br />
ruiniert uns alle<br />
VON LAURENT JOFFRIN<br />
12 Wahlen Der Bürger ist kein<br />
Stimmvieh VON BERND ULRICH<br />
DOSSIER<br />
13 Die Doris-Show Die Geschichte<br />
einer Emanzipation<br />
16 WOCHENSCHAU<br />
Dortmund Der DFB baut ein<br />
Fußballmuseum.<br />
Ein Gespräch mit dem Spieler<br />
Sven Bender und den Betreibern<br />
GESCHICHTE<br />
17 Ein Grab in Thüringen<br />
Das Geheimnis der Dunkelgräfin<br />
VON CAROLIN PHILIPPS<br />
18 Ein Tag in Bonn Am 1. Oktober<br />
1982 wählte der Bundestag<br />
Helmut Kohl zum Bundeskanzler<br />
VON GUNTER HOFMANN<br />
WIRTSCHAFT<br />
19 Bankenregulierung<br />
Berlin kommt in Fahrt<br />
VON PETER DAUSEND UND<br />
MARK SCHIERITZ<br />
Verteilung Dumm sein macht<br />
arm VON PETRA PINZLER<br />
20 Smartphones Daten gehen<br />
schnell verloren. Ein Interview<br />
21 Konjunktur Überraschung:<br />
Der Aufschwung kann weitergehen<br />
VON KOLJA RUDZIO<br />
22 Autos Die Koreaner lehren die<br />
Konkurrenz das Fürchten<br />
VON <strong>DIE</strong>TMAR H. LAMPARTER<br />
23 Weltbank Der neue Präsident<br />
Jim Yong Kim im Gespräch<br />
24 Telekommunikation Lobbykampf<br />
gegen Google und andere<br />
VON NIKLAS WIRMINGHAUS<br />
25 Rüstung Die Fusion von<br />
EADS und BAE ist ein Politikum<br />
VON JOHN F. JUNGCLAUSSEN<br />
26 Mongolei Die Tücken des Rohstoffbooms<br />
VON ANGELA KÖCKRITZ<br />
28 Börse Sind die Kurssprünge<br />
nachhaltig? VON ARNE STORN<br />
Geld und Leben<br />
29 Verlage Ein Pro und Contra zum<br />
Leistungsschutz im Internet<br />
Arbeiten im Netz Zu viel Druck<br />
auf Arbeitnehmer?<br />
VON MARCUS ROHWETTER<br />
Euro Darf die Politik die<br />
Bundesbank kritisieren?<br />
30 Was bewegt ... den britischen<br />
Milliardär Richard Branson?<br />
VON UWE JEAN HEUSER<br />
WISSEN<br />
31 Aufklärung Wie eine Gesundheitskampagne<br />
nach hinten losging<br />
VON LAURA HENNEMANN<br />
Medizin Der Kampf zwischen<br />
Profit und Patientenwohl<br />
VON HEIKE FALLER<br />
UND CHRISTIANE GREFE<br />
32 Ein Gespräch über den<br />
Medizinbetrieb<br />
33 Manifest für eine menschliche<br />
Medizin<br />
34 Archäologie Wie sich deutsche<br />
Wissenschaftler in Palermo zu<br />
Mumien forschern machten<br />
VON URS WILLMANN<br />
35 Grafikseite Tee<br />
38 Umwelt Ist das Jakobskreuzkraut<br />
für Menschen gefährlich?<br />
VON <strong>DIE</strong>TRICH VON RICHTHOFEN<br />
41 KINDER<strong>ZEIT</strong><br />
Seifenkisten Zu Besuch bei zwei<br />
Piloten VON HAUKE FRIEDERICHS<br />
42 Zum (Vor-)Lesen (10) »Vorsicht,<br />
die Herdmanns schon wieder«<br />
VON BARBARA ROBINSON<br />
FEUILLETON<br />
43 Internet Die Piratin Julia<br />
Schramm verfängt sich im Netz<br />
VON JENS JESSEN<br />
Mohammed-Film Ein Verbot<br />
nützt nichts VON KATJA NICODEMUS<br />
44 USA Ry Cooder über die<br />
Abgründe der amerikanischen<br />
Politik – ein Gespräch<br />
Bettina Wulff Eine hysterische<br />
Debatte VON URSULA MÄRZ<br />
45 Literatur Eine Begegnung<br />
mit Salman Rushdie<br />
VON SUSANNE MAYER<br />
46 Kino Michael Hanekes Film<br />
»Liebe« VON IRIS RADISCH<br />
47 Roman Ulf Erdmann Ziegler<br />
»Nichts Weißes« VON H. WINKELS<br />
48 Sachbuch Kai Vogelsang<br />
»Geschichte Chinas«<br />
VON MATTHIAS NASS<br />
Roman Stefan aus dem Siepen<br />
»Das Seil« VON GABRIELE VON ARNIM<br />
49 Philosophie Daniel Heller-<br />
Roazen »Der innere Sinn«<br />
VON GISELA VON WYSOCKI<br />
50 Porträt Karl Heinz Bohrer<br />
zum 80. Geburtstag<br />
VON IJOMA MANGOLD<br />
TITEL<br />
Medizin: »Patienten sind<br />
wichtiger als Profit«<br />
51 Theater »Faust I und II« in<br />
Frankfurt VON THOMAS E. SCHMIDT<br />
52 Fernsehen Ein Film über den Fall<br />
Jakob von Metzler<br />
VON HEINRICH WEFING<br />
53 Klassik Berlin – alle drei<br />
Monteverdi-Opern an einem Tag<br />
VON VOLKER HAGEDORN<br />
54 Kunstmarkt Die Pariser Biennale<br />
des Antiquaires VON TOBIAS TIMM<br />
55 Neuer Traumjob: Galerist VON<br />
DOMINIKUS MÜLLER UND KITO NEDO<br />
57 Erfahrungsbericht Wie steht’s<br />
um um die Kunst der Gegenwart?<br />
VON HANNO RAUTERBERG<br />
58 GLAUBEN & ZWEIFELN<br />
Blasphemie Ein Gespräch<br />
mit der muslimischen Juristin<br />
Seyran Ateş/Und was sagen die<br />
christlichen Kirchen zum Thema<br />
Gottes lästerung? VON E. FINGER<br />
REISEN<br />
59 Tempelhof Auf dem<br />
stillgelegten Flughafen leben die<br />
Berliner ein bisschen Anarchie<br />
VON HANS W. KORFMANN<br />
60 Luftfahrt Cliff Muskiet sammelt<br />
Stewardessenuniformen. Ein<br />
Gespräch über Rocklängen und<br />
den Traum vom Fliegen<br />
61 Arosa Zu Besuch im letzten<br />
koscheren Hotel der Schweizer<br />
Alpen VON PAULA SCHEIDT<br />
63 Italien Auf den Spuren der<br />
Inquisition durch die umbrische<br />
Stadt Narni VON JULIA REICHARDT<br />
64 Camping Bücher über das Leben<br />
im Freien VON BJØRN ERIK SASS<br />
CHANCEN<br />
69 Bildung Paul Schwarz filmt,<br />
was in Klassenzimmern passiert<br />
VON FRIEDERIKE LÜBKE<br />
70 Lobbyismus Wirtschaftsverbände<br />
versorgen Lehrer mit Unterrichtsmaterial<br />
VON SEBASTIAN KRETZ<br />
71 Medizin alternativ In Traunstein<br />
soll die erste Hochschule für<br />
Homöopathie eröffnen<br />
VON BERND KRAMER<br />
73 Spezial Ingenieure<br />
Wie der Open-Source-Gedanke<br />
die Welt der Erfinder<br />
revolutioniert VON MALTE BUHSE<br />
74 Ingenieure wie Gunnar Schönherr<br />
wissen genau, wie lange eine Brücke<br />
noch hält VON C. BÖHRINGER<br />
75 Offshore-Plattformen: Arbeit für<br />
Werften VON ALEXANDRA WERDES<br />
76 Besuch im DIN-Institut<br />
88 <strong>ZEIT</strong> DER LESER<br />
RUBRIKEN<br />
2 Worte der Woche<br />
20 Macher und Märkte<br />
34 Stimmt’s?/Erforscht & erfunden<br />
47 Wir raten zu und ab/Gedicht<br />
48 Impressum/Hörbuch<br />
54 Neues vom Markt<br />
55 Mein Traumstück<br />
57 Finis/Berliner Canapés<br />
87 LESERBRIEFE<br />
12<br />
AUSGABE:<br />
<strong>39</strong><br />
20. SEPTEMBER <strong>2012</strong><br />
Ein Porträt des Basketballers<br />
Dirk Nowitzki, der in den USA<br />
mehr ist als ein Superstar<br />
Für die Entwicklungspsychologin<br />
Alison Gopnik sind Kinder<br />
Genies und Vorbilder<br />
Im »Wochenmarkt« gibt’s Kürbis<br />
Fashion Week<br />
Die Frühjahrskollektionen<br />
sind auf den ersten Blick<br />
ein Wiedersehen mit bekannten<br />
Trends. Aber sie wurden<br />
von Designern in London<br />
und New York kräftig<br />
durchgemischt<br />
www.zeit.de/mode<br />
Die so gekennzeichneten<br />
Artikel finden Sie als Audiodatei<br />
im »Premiumbereich«<br />
unter www.zeit.de/audio<br />
Anzeigen in dieser Ausgabe<br />
Link-Tipps (Seite 24), Museen<br />
und Galerien (Seite 38), Spielpläne<br />
(Seite 53), Bildungsangebote<br />
und Stellenmarkt (ab Seite 72)<br />
Früher informiert!<br />
Die aktuellen Themen der <strong>ZEIT</strong><br />
schon am Mittwoch im <strong>ZEIT</strong>-Brief,<br />
dem kostenlosen Newsletter<br />
www.zeit.de/brief<br />
»Patienten sind<br />
wichtiger als Profit«<br />
Der Der Eid Eid der der Mediziner Mediziner wird wird in in Deutschlands<br />
Deutschlands<br />
Krankenhäusern Krankenhäusern jeden jeden Tag Tag tausendfach tausendfach gebrochen. gebrochen.<br />
Ärzte Ärzte und und Pfl Pfl eger eger fordern fordern deshalb deshalb eine eine neue neue<br />
Standesethik. Standesethik. Ein Ein Manifest Manifest<br />
WISSEN WISSEN SEITE SEITE 31-33 31-33<br />
Die <strong>ZEIT</strong>-App<br />
Interview mit dem Schriftsteller<br />
Régis Jauffret, der aus dem Fall<br />
Fritzl einen Roman gemacht hat.<br />
Außerdem: »Sense of Place« – eine<br />
Bildergalerie mit Höhepunkten der<br />
europäischen Landschaftsfotografie<br />
: Pari Dukovic<br />
[M]: Lucas Jackson/Reuters
DOSSIER<br />
WOCHENSCHAU<br />
Dortmund: Ein Gespräch über das<br />
DFB-Fußballmuseum S. 16<br />
Die Doris-Show<br />
Gerd ist immer da. Und<br />
Gerd ist nie da. Beides<br />
ist ein Problem für<br />
Doris Schröder-Köpf.<br />
Aber welches Problem<br />
ist schwieriger zu lösen?<br />
Heute ist es das Gerd-ist-da-Problem.<br />
Am Morgen hatte die Politikerin Doris<br />
Schröder-Köpf ihren ersten Parteitag. Sie ist<br />
mit dem VW-Bulli, der seit Kurzem mit ihrem<br />
gigantischen Porträt beklebt ist, beim<br />
Freizeitheim Ricklingen vorgefahren, einer<br />
Halle in Hannover. Dort haben sie den SPD-<br />
Oberbürgermeisterkandidaten für Han no ver<br />
gekürt und eine Re so lu tion verabschiedet, zu<br />
der Doris Schröder-Köpf vier Zeilen über<br />
Frauenförderung beigetragen hat.<br />
Jetzt sitzt sie bei einer Kugel Eis im Mövenpick-Café:<br />
die SPD-Kandidatin für den Niedersächsischen<br />
Landtag im Wahlkreis 24. Sie<br />
erzählt, wie es sich anlässt in der Politik. Sie<br />
sagt gerade, dass es ihr unangenehm sei, wie<br />
alle ihren Bus anstarren, in dem man weit oben<br />
sitzt und auf die Leute runterguckt, als auf<br />
einmal ihr Mann zwischen den Bistrotischen<br />
auftaucht: Gerhard Schröder, Bundeskanzler<br />
a. D., jetzt Vater i. D. Dunkelblaue Barbourjacke,<br />
in der rechten Außentasche steckt eine<br />
Zigarrenkiste. Er war mit Gregor im Zoo.<br />
Gregor ist sechs und hat eine neue Base cap auf,<br />
»wir ham die Mütze vergessen, und weil ich<br />
nicht ohne was ankommen wollte ...«, sagt<br />
Schröder und hebt entschuldigend die Schultern.<br />
In der Hand hält er eine Plastiktüte, ein<br />
neues Playmobil-Spielzeug.<br />
»Wie war der Parteitach?«, fragt er.<br />
Sie strahlt. »Super! 96 Prozent!«<br />
»96 Prozent?«<br />
»Na, für Stefan! Den haben wir doch<br />
nominiert!«<br />
»Stefan?«<br />
»Na, Stefan Schostok! Als Oberbürgermeisterkandidat!«<br />
In Hannovers Politik ist Gerhard Schröder<br />
schon lange nicht mehr drin. Er ist am<br />
Morgen aus dem slowakischen Bratislava zurückgekommen,<br />
da haben sie einen neuen<br />
Ministerpräsidenten. In der nächsten Zeit<br />
stehen in seinem Kalender: Istanbul, Seoul,<br />
Peking. Das ist die Welt, die ihn interessiert.<br />
Doris Schröder-Köpf zieht Gregor erst<br />
mal eine Jacke über.<br />
»Will er nicht«, sagt Schröder.<br />
»Egal«, sagt sie.<br />
Er setzt sich dazu, und irgendwie schafft<br />
er es innerhalb von zwei Minuten, das Gespräch<br />
zur Agenda 2010 zu lenken, zum<br />
Umbau der Sozialsysteme, den er als Kanzler<br />
startete – ein großer Schritt in die Moderne,<br />
findet er. »Wir mussten den Reform-<br />
stau überwinden. Wir haben das früher<br />
gemacht als andere europäische Parteien«,<br />
sagt er und hört gar nicht mehr auf vor Begeisterung<br />
über seine eigenen Leistungen.<br />
»Meinen Mann können Sie mitten in der<br />
Nacht wecken, und er hält Ihnen einen Vortrag<br />
über die Agenda!«, sagt Schröder-Köpf. Das<br />
Gespräch geht nicht in die Richtung, die sie<br />
sich vorgestellt hat. In ihrem Gesicht stehen<br />
alle Signale auf verdrehte Augen, doch wenn<br />
man genau hinguckt, sieht man: Die Augen<br />
schauen geradeaus. Volle Kontrolle.<br />
Gerhard Schröder doziert weiter. Zwischendrin<br />
kommt Gregor an und zupft an<br />
der Barbourjacke. Aber der Vater hat jetzt<br />
Wichtigeres zu tun. »Was willst du, Junge?<br />
Frag Mama.«<br />
Er fährt fort: Woher sollen die zukünftigen<br />
Facharbeiter kommen? Schaffen wir es,<br />
Kinder aus Migrantenfamilien zu qualifizieren?<br />
Wie gehen wir mit der Alterung der<br />
Gesellschaft um?<br />
Doris Schröder-Köpf wird es langsam zu<br />
viel, und Gregor auch. Er will ein Eis.<br />
Ihre Strategie: Sich kleinmachen.<br />
Wer unten ist, fällt nicht tief<br />
Es ist klar, dass ihr Mann ihr Zugpferd ist. Sie<br />
wäre nicht da, wo sie jetzt ist, ohne ihn. Niemals<br />
hätte man eine Frau Ende vierzig und mit<br />
null Polit erfah rung einfach so aufgestellt,<br />
schon gar nicht in einem Wahlkreis, in dem<br />
man erst noch eine altgediente Kandidatin<br />
loswerden musste. Gerhard Schröder ist aber<br />
auch ein Risiko für seine Frau. Dieses Themas<br />
wegen hat sie sich viele Jahre nicht in ihrem<br />
Ortsverein blicken lassen. Alle wollten von ihr<br />
eine Rechtfertigung für seine Politik hören.<br />
Viele in der Partei hassten die Agenda, heute<br />
noch ist das Reformpapier, das Hartz IV installierte<br />
und für das sich Doris Schröder-Köpf<br />
einst die Überschrift ausgedacht hat, in der<br />
SPD eine Demarkationslinie. Auf der einen<br />
Seite stehen die Linken in der SPD, Schröders<br />
Kritiker, auf der anderen die Rechten.<br />
Gregor will jetzt doch kein Eis, sondern<br />
lieber an der Theke ein Stück Kuchen aussuchen.<br />
Mama sagt: »Ehemann, jetzt bist du<br />
dran.« Schröder schlurft mürrisch zum Kuchentresen.<br />
Doris Schröder-Köpf war Journalistin,<br />
alleinerziehende Mutter, Kanzlergattin,<br />
Hausfrau und Adoptivmutter. Sie hat alle<br />
Lebensmodelle durch. Nach all den Jahren,<br />
in denen sie zurückgesteckt hat, will sie mit<br />
49 Jahren etwas Neues anfangen. Politikerin.<br />
Am 20. Januar will sie sich in den Niedersächsischen<br />
Landtag wählen lassen. Sie wagt<br />
sich auf das Terrain, das schon durch einen<br />
Star aus der Familie besetzt ist. Es ist ein gefährliches<br />
Experiment. Für sie, für ihre Ehe.<br />
In einer Kampfkandidatur ist sie Anfang<br />
des Jahres gegen die bisherige Landtagskandidatin<br />
Sigrid Leusch ner angetreten. Gegen<br />
eine Gewerkschaftsfrau links der Schröder-<br />
Linie und kurz vor der Rente. Es gab harte<br />
Aus ein an der set zun gen um diesen Karrierestart,<br />
der Ton war schnell gereizt. »Gott sei<br />
Dank gibt es in der Partei immer noch genug<br />
Leute, für die es nicht ausreicht, die Frau von<br />
jemandem zu sein. Doris Schröder-Köpf hat<br />
nicht den Stallgeruch der Partei«, verkündete<br />
der alte Ver.di-Mann Wolfgang Denia in der<br />
Bild am Sonntag. Da war es wieder, das Vorurteil:<br />
bloß eine »Frau von« zu sein. Es hat<br />
dann trotzdem geklappt, aber knapp.<br />
Jetzt muss sie zeigen: Wenn sie nicht<br />
bloß eine »Frau von« ist, wer ist sie dann?<br />
Der erste öffentliche Termin der frisch<br />
gekürten Landtagskandidatin war eine Müllsammelaktion,<br />
zu der mehr Journalisten als<br />
Müllsammler kamen. Früher verkehrte sie<br />
mit Bill Clinton und Wladimir Putin, zuletzt<br />
war sie Aufsichtsrätin bei Karstadt, auf Vorschlag<br />
des Investors Nicolas Berggruen, mit<br />
dem sie und ihr Mann befreundet sind. Jetzt<br />
tingelt sie durch Altersheime und Kindergärten,<br />
um ihren Wahlkreis kennenzulernen.<br />
Man könnte erwarten, dass es anbiedernd<br />
wirkt, wenn sie im Business-Hosenanzug mit<br />
Rentnern redet, die Unterhemd tragen, aber<br />
kurioserweise passt es sehr gut, man hat nicht<br />
das Gefühl, sie sei nicht mehr sie selbst. Sie<br />
gibt den Bürgern das Gefühl, ihre Anliegen<br />
ernst zu nehmen. Sie interessiert sich für den<br />
TÜV Nord. Sie kurvt mit Mitarbeitern vom<br />
Abfallverband im Geländewagen<br />
über den »Monte Müllo«, der gerade<br />
mal 122 Meter hoch ist. Höher geht<br />
es nicht in Hannover. Aber je flacher,<br />
desto besser. Weil alles, was unten ist,<br />
ihr, die nach oben will, eine Art<br />
Gütesiegel verleiht. Der Besuch auf<br />
der Mülldeponie bedeutet: Ich erarbeite<br />
mir alles selbst. Ich werde<br />
nicht protegiert.<br />
Die Strategie, sich kleinzumachen,<br />
ist auch ein Schutz. Wer unten ist,<br />
kann nicht tief fallen. Deshalb auch Landes-,<br />
nicht Bundespolitik.<br />
Doris Schröder-Köpf ist, wie natürlich<br />
auch die SPD weiß, weitaus bekannter als<br />
der Spitzenkandidat Stephan Weil. In Hannover<br />
hat sie richtig Glamour. In ihrer Partei<br />
fällt sie auf, bei SPD-Veranstaltungen ist sie<br />
die mit Abstand bestangezogene Person. Die<br />
blonden Haare: immer perfekt. Die Blazer:<br />
tailliert. Der Schmuck: dezent. Bei ihr fällt<br />
einem nicht das Wort Schminke ein, son-<br />
Doris Schröder-<br />
Köpf kandidiert<br />
für den<br />
Niedersächsischen<br />
Landtag. Gerhard<br />
Schröder hilft ihr im<br />
Wahlkampf. Der<br />
Familienbus ist jetzt<br />
Werbefläche<br />
GESCHICHTE<br />
Ein Grab im Wald: Das Geheimnis<br />
der »Dunkelgräfin« S. 17<br />
teikollegen sind sehr aufgeregt, wenn sie ihr<br />
begegnen. Die Doris ist da! Danach verkünden<br />
sie beseelt: »Sie ist ja ganz normal!«<br />
Ein so hoher Bekanntheitsgrad ist ein vergiftetes<br />
Geschenk. Sie darf sich keine Fehler<br />
erlauben. Sie steht unter Beobachtung. »Mal<br />
sehen, ob ich es bis zur Wahl unfallfrei schaffe«,<br />
schreibt sie in einer ihrer E-Mails, die sie<br />
oft morgens um fünf verschickt oder nachts<br />
um halb eins.<br />
Für jeden ihrer Termine legt Doris Schröder-<br />
Köpf einen weißen Schnellhefter mit Fact-<br />
Sheets an, tagelang bereitet sie sich auf ihre<br />
Besuche im Wahlkreis vor. Sie weiß immer<br />
schon alles. Als die Chefin des Abfallverbands<br />
sagt, man habe im letzten Jahr 43, äh 34 Auszubildende<br />
gehabt, kann Doris Schröder-Köpf<br />
es sich nicht verkneifen, zu korrigieren: 35! In<br />
der Schule hätte man sie eine Streberin genannt.<br />
Für eine Rede, die sie vor einem Jahr in ihrem<br />
bayerischen Heimatdorf hielt, weil der Pfarrhof<br />
renoviert worden war – da war sie noch nicht<br />
mal Kandidatin –, engagierte sie einen Medienberater:<br />
Thomas Steg, ehemals stellvertretender<br />
Regierungssprecher ihres Mannes.<br />
»Die Doris ist ganz anders als ich. Die hat<br />
ein Detailwissen!«, sagt ihr Mann im Café.<br />
»Ich hab ja anders Politik gemacht.«<br />
Doris Schröder-Köpf: »Ich mach das<br />
Klein-Klein.«<br />
Kanzlerlachen.<br />
Er lacht, sie nicht. Es ist ernst.<br />
Doris Schröder-Köpf will sich von Gerhard<br />
Schröder emanzipieren, und dafür<br />
wählt sie dieselbe Strategie wie die meisten<br />
Frauen, die es in einer Männerwelt zu etwas<br />
bringen wollen: die Fleiß-Methode. Die<br />
Fleiß-Methode kann einen weit<br />
bringen, aber Nummer eins wird<br />
man damit nicht. Das hier ist Emanzi<br />
pa tion unter erschwerten Bedingungen:<br />
Zwischen diesen beiden<br />
Partnern gibt es ein Bedeutungsgefälle<br />
wie nur in wenigen Ehen. Und<br />
der Mensch, von dem Doris Schröder-Köpf<br />
sich emanzipieren will, ist<br />
so ziemlich der härteste und selbstgefälligste<br />
Testosteron-Brocken, den<br />
man sich vorstellen kann. Im Grunde muss<br />
sich Doris Schröder-Köpf sogar gleich von<br />
zwei Männern emanzipieren: von ihrem Ehemann<br />
und von dem Agenda-Politiker.<br />
Es ist ein gigantischer Schatten, aus dem<br />
sie heraustreten will, aber sie hat sich diesen<br />
dunklen Platz einst selbst ausgesucht. Als die<br />
beiden sich kennenlernten, war er Ministerpräsident<br />
in Niedersachsen. Sie wusste, sie<br />
würde ein Leben in der Öffentlichkeit führen,<br />
und sie wusste, dass er den Platz im Licht<br />
beanspruchen würde. Dass er den Platz nie<br />
mehr räumen würde, konnte sie sich denken.<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 13<br />
Doris Schröder-Köpf kämpft um ein Abgeordnetenmandat. Ziemlich schwierig, sich vom Ehemann, Ex-Kanzler und Agendapolitiker zu emanzipieren VON TANJA STELZER<br />
Man kann das, was sie vorhat, für ein besonders<br />
mutiges Experiment halten. Oder für<br />
ein besonders naives.<br />
Wie ein zweiter Film laufen die Bilder<br />
seiner Auftritte mit, ganz gleich, wo sie sich<br />
öffentlich bewegt. Meist haben die Leute mal<br />
ein Bier mit ihm getrunken, oft mehr als<br />
eins. Sie haben das dringende Bedürfnis, ihr<br />
davon zu erzählen, als könnte sie sich gar<br />
nicht vorstellen, wie das ist, mit ihrem Mann<br />
ein Bier zu trinken. Gern fragen die Leute<br />
auch: »Wo ist Ihr Mann, wechselt der jetzt<br />
die Windeln?« Obwohl schon lange keine<br />
Windeln mehr zu wechseln sind im Haus<br />
Schröder, antwortet sie fröhlich-spitz: »Dazu<br />
müsste er da sein, oder?«<br />
Sie tritt in Hannover-Bemerode<br />
auf, er gibt in China den Popstar<br />
Doris Schröder-Köpf macht eine für Frauen<br />
ihrer Altersklasse sehr typische Erfahrung: Sie<br />
hat lange zurückgesteckt für ihren Mann, für<br />
dessen Karriere, und für ihre Kinder. Jetzt<br />
aber will sie selbst wer sein, und ihr Mann<br />
verspricht, sie zu unterstützen. Er tut das<br />
auch. Wenn es in den Kalender passt.<br />
Andere Frauen in Schröder-Köpfs Alter<br />
eröffnen eine Boutique, und wenn die Boutique<br />
schlecht läuft, dann gleicht der Mann<br />
das Minus aus. Doris Schröder-Köpf hat sich<br />
eine anspruchsvollere Aufgabe ausgesucht.<br />
Ob ihr Mann darin mehr als ein Hobby<br />
sieht, ist noch nicht klar.<br />
Im Juni dieses Jahres, nach drei Monaten<br />
Politikerinnenleben, steht sie auf einem Marktplatz<br />
in Hannover-Bemerode, wo ihr Team in<br />
glühender Hitze einen Infostand aufgebaut hat.<br />
Autogrammkarten, noch aus Kanzlergattinnenzeiten,<br />
liegen bereit, Buntstiftboxen, Kugelschreiber,<br />
die sie beim SPD-Imageshop bestellt<br />
hat. Doris Schröder-Köpf hat ihren Gregor mitgebracht,<br />
weil sie auf die Schnelle niemanden<br />
gefunden hat, der auf ihn aufpasst. Ihr Mann ist<br />
mal wieder irgendwo zwischen Seoul, Berlin und<br />
Wien unterwegs. Am Morgen musste sie deshalb<br />
auch eine SPD-Veranstaltung absagen, bei der<br />
das Wirtschaftsprogramm für Niedersachsen<br />
vorgestellt wurde. Ein Briefing für die Kandidaten.<br />
Sollte Doris Schröder-Köpf jetzt nicht<br />
wissen, was sie wirtschaftspolitisch denken soll,<br />
ist also ihr Mann schuld. Nichts hasst sie mehr,<br />
als etwas nicht zu wissen. Etwas erschöpft sagt<br />
sie: »Ich frag ihn jetzt nicht mehr, wann er weg<br />
ist, sondern wann er da ist.« Dann dreht sie sich<br />
um, und da ist die Imbissbude, die »Deutsche<br />
Kanzlerplatte nach Schröder-Art« und »Curry-<br />
Bratwurst Doris-Art« anbietet. »Doris-Art« ist<br />
die kleinere Portion und kostet 1,30 Euro we-<br />
dern das Wort Make-up. Sogar manche Par-<br />
Dieses Foto aus<br />
dem Jahr 1996<br />
machte die<br />
Beziehung von<br />
Gerhard Schröder<br />
und Doris Köpf<br />
öffentlich. Sie war<br />
Journalistin beim<br />
»Focus« und<br />
begleitete ihn, den<br />
Ministerpräsidenten<br />
von Niedersachsen,<br />
auf eine Bohrinsel<br />
Fortsetzung auf S. 14<br />
Foto: Wolfgang Wilde für <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>/www.wolfgangwilde.de; kl. Foto: Db Haz/picture-alliance/dpa
14 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> DOSSIER<br />
Die Doris-Show<br />
Fortsetzung von S. 13<br />
niger. Sie zögert einen Moment, als müsse sie<br />
erst überlegen, ob sie solche unaufgeforderten<br />
Liebesbeweise zurückweisen soll. Sagen sie doch<br />
nichts anderes, als dass ihre Popularität bloß<br />
geliehen ist. Dann aber setzt sie ihr Doris-Lächeln<br />
auf und gibt den Männern, die bei der<br />
Bude ein Bier trinken, Autogramme. »Endlich<br />
ist es mal nützlich, einen bekannten Namen zu<br />
haben«, sagt sie.<br />
Die Wahrheit ist: Das Etikett »Kanzlergattin«<br />
klebt an ihr wie ein Preisschild an einem<br />
neuen Glas, auch mit viel Spülmittel<br />
und heißem Wasser lässt es sich nicht abwaschen.<br />
Also lässt sie das Etikett eben dran,<br />
sieht immer noch besser aus. So schnell wird<br />
sie Gerd nicht los.<br />
Peking liegt unter einer Dunstglocke. Es<br />
ist halb neun an einem Julimorgen <strong>2012</strong>,<br />
gerade ist der Airbus der Lufthansa gelandet,<br />
auf dem Rollfeld wartet im VIP-Bus schon<br />
der ehemalige chinesische Botschafter in<br />
Deutschland auf Gerhard Schröder. Der Ex-<br />
Botschafter begleitet den Ex-Kanzler zur<br />
Wagenkolonne. Auf dem Weg in die Stadt:<br />
Blaulicht, gesperrte Autobahnen, strammstehen<br />
de Polizisten. So war das früher auch<br />
bei Schröders Staatsbesuchen.<br />
Schröder forcierte in seiner Amtszeit die<br />
deutsche Chinapolitik und förderte Wirtschaftskontakte<br />
zwischen den beiden Ländern.<br />
Dafür liebt ihn die chinesische Regierung.<br />
Und auch dafür, dass er nicht in jedem<br />
dritten Satz mit den Menschenrechten daherkommt,<br />
jedenfalls nicht so, dass es gleich<br />
in der Zeitung steht.<br />
Drei-, viermal im Jahr fliegt er nach China.<br />
Diesmal hat ihn der Softwarehersteller SAP für<br />
eine Rede bei seiner Asien-Hausmesse engagiert.<br />
Für die Hausmesse in Madrid hat SAP<br />
Supertramp gebucht. In Deutschland ist Gerhard<br />
Schröder Verräter, Absahner, Lobbyist.<br />
Seine Bodyguards sagen: Würde er auf Personenschutz<br />
verzichten, ginge das keine zwei Tage<br />
gut. In China ist er immer noch ein Popstar.<br />
Ihn erwarten: 4500 Zuhörer, ein Kamerakran,<br />
eine Lightshow, der größte LED-Bildschirm<br />
Asiens. Er hat ein Redemanuskript im<br />
Koffer mit großen Sätzen über globale Herausforderungen<br />
und ein erfolgreiches China.<br />
Es wird um den Klimawandel gehen und<br />
um die Nichtweiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen.<br />
Schröder wird den<br />
deutsch-chinesischen Rechtsstaatsdialog loben,<br />
der in seiner Amtszeit begonnen wurde,<br />
und sich für die Einführung von Eurobonds<br />
starkmachen. Die Rede hätte er auch als<br />
Kanzler halten können. Nur dass er dafür<br />
weit weniger gut bezahlt worden wäre.<br />
Sie gab ihm Ratschläge,<br />
sie war seine Gefühlsministerin<br />
Gerhard Schröder gehört, neben Bill Clinton,<br />
Arnold Schwarzenegger und Steve Forbes, zu<br />
den Top-Acts der internationalen Redneragentur<br />
Harry Walker. Es ist viel geschrieben<br />
worden über die Höhe der Honorare, die<br />
Harry Walker bezahlt. 250 000 Dollar für einen<br />
Vortrag, diese Größenordnung. Ach was,<br />
sagt Schröder, und »von Clinton sind wir weit<br />
entfernt«. »Wir« bedeutet: ich und Doris. Die<br />
Maschine Schröder.<br />
Gibt es ein niedersächsisches Bill-und-<br />
Hillary-Projekt? Arbeiten sie nach dem Aufstieg<br />
des Charismatikers am Aufstieg der<br />
Frau im Hintergrund? Oder ist das »wir« eher<br />
ein Pluralis Majestatis?<br />
Wenn man Doris Schröder-Köpf fragt,<br />
wie man ihre Beziehung zu ihrem Ehemann<br />
am besten beschreiben könnte, antwortet sie:<br />
»Wir sind eine Kampfgemeinschaft.« Sie haben<br />
einiges miteinander durchgestanden,<br />
Wahlkämpfe, Niederlagen, Anfeindungen,<br />
Gerüchte über angebliche Risse in der Ehe,<br />
seinen erzwungenen Abschied aus der Poli-<br />
tik. Jetzt könnte sich die Kampfgemeinschaft<br />
neu formieren. Zu ihren Gunsten diesmal.<br />
Nur dass sich die Zahnräder der Schröder-<br />
Maschinerie nicht einfach in die andere<br />
Richtung drehen lassen. »Ich kann bei einer<br />
Veranstaltung des Spitzenkandidaten auftreten,<br />
aber nicht bei ihr«, sagt Gerhard Schröder,<br />
und dann: »Obwohl da ja vielleicht auch<br />
ein paar Leute kommen würden.«<br />
Gerhard Schröder sitzt in der Lobby des<br />
Interconti-Hotels im Pekinger Olympiaviertel.<br />
Eine klimatisierte Kunstwelt, die er in den folgenden<br />
zweieinhalb Tagen zweimal verlassen<br />
wird, einmal für ein Dinner mit dem deutschen<br />
Botschafter und einmal, weil der FC Bayern<br />
auch gerade in Peking ist und Schröder sehen<br />
will, wie elf Bayern elf Chinesen 6 : 0 vom Platz<br />
fegen. Danach ist Bar abend mit Uli Hoeneß,<br />
Karl-Heinz Rummenigge und Matthias Sammer.<br />
Doris Schröder-Köpf ist nicht dabei in<br />
Peking. Sie hat ihn schon zu Kanzlerzeiten selten<br />
begleitet, sie mochte rote Teppiche nie. Sie war<br />
schon damals lieber die Frau hinter ihm als die<br />
an seiner Seite. Auch diesmal zieht sie es<br />
vor, in Hannover »Akten zu studieren«.<br />
Er denkt in Kontinenten, sie in<br />
Stadtteilen – aber was in Peking passiert,<br />
ist von Hannover aus betrachtet<br />
genauso unwichtig wie umgekehrt.<br />
So sieht es Doris.<br />
Für den Kanzler Gerhard Schröder<br />
war Doris Schröder-Köpf neben der<br />
Büroleiterin Sigrid Krampitz die eine<br />
Person, der er vertrauen konnte. Sie<br />
war sein Gradmesser, seine Rückkopplung zum<br />
Volk. (»Das Verbraucherschutzministerium war<br />
ihre Idee! In der BSE-Krise hat sie gesagt: Die<br />
Mütter wollen gesunde Lebensmittel für ihre<br />
Kinder. Ihr müsst unbedingt ein Verbraucherschutzministerium<br />
machen!«) Sie las seine<br />
Reden gegen, vor allem wenn es um Emotionales<br />
ging, Trauerreden, solche Sachen. Sie<br />
sorgte dafür, dass er den Ton traf. Sie war Gerds<br />
Gefühlsministerin.<br />
Jetzt gibt es kein Volk mehr, zu dem er einen<br />
Draht haben müsste, es gibt bloß brave Zuhörer,<br />
auf Einladung von SAP. Doris muss nicht<br />
dabei sein, wenn er hier um seine eigene Vergangenheit<br />
kreist, wenn ein nicht abreißender<br />
Strom von Chinesen ihn um Erinnerungsfotos<br />
bittet und er mit gespielter Verlegenheit sagt:<br />
»Das grenzt ja an Ver ehrung hier!«<br />
Damals eilte sie sofort von Hannover nach<br />
Berlin, wenn es um etwas Wichtiges ging. Die<br />
Vertrauensfrage oder so. Ständig war alles existenziell.<br />
Heute hat er Druck nur noch bei der<br />
Frage, ob es bei seinen Reden mit dem Englisch<br />
klappt. Technological, for de cades, internationalization<br />
– manchmal revoltieren die Worte in<br />
seinem Mund. Er stellt sich trotzdem vor 4500<br />
Zuhörer. Er ist das Gegenteil von ihr. Sie spielt<br />
nicht auf Risiko. Sie tut nur, was sie kann. Und<br />
vielleicht tut sie nicht mal das.<br />
Er rüttelte an den Gitterstäben des Kanzleramts.<br />
Um den Landtag in Hannover gibt<br />
es nicht mal ein Gitter.<br />
Sie sagt, sie wolle den Wahlkreis erobern,<br />
mehr nicht. Ein Ministeramt,<br />
böte man es ihr an, würde sie zurückweisen.<br />
»Die ist so wahnsinnig und<br />
macht das wirklich«, sagt Schröder 7500<br />
Kilometer von ihr entfernt. Unverhohlen<br />
gibt er zu, dass er jetzt, in dieser<br />
Krisenzeit, wieder gern regieren würde.<br />
Es kann ihm nicht schwierig genug sein,<br />
er hätte so richtig Lust drauf.<br />
Sie vergibt bei Face book ein<br />
»Like« für einen Spiegel-Artikel über Aufstiegsverweigerer,<br />
Titel: Karriere? Ohne mich!<br />
Warum nur? Doris Schröder-Köpf wollte<br />
doch immer nach oben. Ihr Ziel, als Jugendliche<br />
schon, war: raus aus Tagmersheim, ihrem bayerischen<br />
Dorf. Ein Kaff im Altmühltal, weitgehend<br />
abgeschnitten von der Umwelt, der Vater<br />
Arbeiter bei einem Containerhersteller, die<br />
Mutter Hausfrau. Die Tochter wollte unbedingt<br />
aufs Gymnasium. Sie wurde Journalistin und<br />
heuerte bei Bild an, obwohl sie gar nicht zum<br />
Boulevard wollte. Aber Bild hatte eine Re dak-<br />
Landtagskandidatin<br />
Schröder-Köpf<br />
beim Bürgerfrühstück.<br />
Auf das<br />
Klein-Klein der<br />
Wahlkreisarbeit<br />
bereitet sie sich vor<br />
wie auf einen<br />
Staatsbesuch<br />
Einst war sie auf<br />
internationalem<br />
Parkett unterwegs<br />
– wie hier im Jahr<br />
2002 beim Besuch<br />
des US-Präsidenten<br />
Bill Clinton in Berlin<br />
Doris Schröder-<br />
Köpf 2005 im<br />
Gespräch mit<br />
Russlands Präsident<br />
Wladimir Putin.<br />
Der Kontakt der<br />
Schröders zu Putin<br />
blieb auch nach<br />
dem Ende der rotgrünen<br />
Regierung<br />
herzlich<br />
tion in der Hauptstadt, damals noch Bonn.<br />
Doris Köpf zog es zu den Wichtigen, sie wollte<br />
im Zentrum sein. Und sie fühlte sich angezogen<br />
von Männern, die sich wichtig nahmen,<br />
Männern, die im Zentrum standen, Männern<br />
mit einer Agenda.<br />
Sven Kuntze ist der Vater von Doris Schröder-Köpfs<br />
Tochter Klara, die heute erwachsen<br />
ist. Kuntze war früher Fernsehkorrespondent<br />
der ARD in New York, er hat das ARD-Morgenmagazin<br />
geleitet und als Rentner ein Buch<br />
übers Altwerden geschrieben: Altern wie ein<br />
Gentleman. Jetzt ist er 70, Gerhard Schröders<br />
Altersklasse, und der Star der Seniorenresidenzen.<br />
Auch er ein Kerl, der die große Geste<br />
draufhat, wie der Ex-Kanzler. Schnoddrig,<br />
breitbeinig, selbstbewusst. Doris Schröder-<br />
Köpf wird er im Wahlkampf unterstützen mit<br />
gemeinsamen Auftritten – in Altersheimen.<br />
Der Gentleman, als den er sich im Buchtitel<br />
bezeichnet, war er ihr gegenüber nicht. Sie<br />
lebten zusammen in New York und hatten ein<br />
Baby, als er sie sitzen ließ. Dass sie nicht zerstritten<br />
sind, liege an ihr, sagt er in<br />
seiner Penthousewohnung über den<br />
Dächern von Berlin. Sie, Pragmatikerin,<br />
fand, dass es wichtig fürs Kind sei,<br />
seinen leiblichen Vater zu sehen. »Ich<br />
bin ihr dankbar«, sagt Sven Kuntze.<br />
»Sie hält lange Strecken durch.«<br />
Für ihn ist sie »einer der politischsten<br />
Köpfe«, die er kennt. Viele sagen<br />
das von ihr: dass sie ein politisch denkender<br />
Mensch sei, nicht mit der<br />
großen Idee, wohl aber mit dem Talent, Entwicklungen<br />
vorauszusehen. Sven Kuntze und<br />
sie lernten sich in Bonn kennen. »Doris war<br />
die Einzige, die er ahnt hat, dass Scharping<br />
Spitzenkandidat wird! Ihre Prognosen haben<br />
immer gestimmt, auch wenn sie nicht so gut<br />
reden konnte wie ich.«<br />
Doris Köpf war damals 23, die jüngste<br />
Parla ments kor res pon den tin in Bonn. »Schneeflocken<br />
haft« nennt sie Sven Kuntze. Klein,<br />
schmal, kapriziös, es herrschte eine große Aufregung<br />
unter den wenigen Journalistinnen, die<br />
es in Bonn gab. Sie machten es ihr nicht leicht.<br />
Der Frauen-Hintergrundkreis »Lila Karte«<br />
verweigerte ihr, der Quoten-Anhängerin,<br />
die Aufnahme. Es hieß, sie arbeite mit Körpereinsatz.<br />
Zahllose Affären wurden ihr angedichtet.<br />
Sie war zu klein, zu blond, und sie<br />
trug zu hohe Absätze. Noch dazu war sie bei<br />
der falschen Zeitung. Das, wogegen sie noch<br />
heute kämpft, schlug ihr schon damals entgegen:<br />
Nicht-ernst-genommen-Werden. So<br />
wie sie heute zur SPD Hannover dazugehören<br />
will, wollte sie damals dazugehören. So<br />
wie heute manche glauben, sie tue nur, als<br />
ob, unterstellte man es ihr damals.<br />
In Sven Kuntzes Kielwasser kam sie endlich<br />
an den Ort, der die maximale Distanz zu Tagmersheim<br />
hatte: New York. Sie liebte die Stadt.<br />
Aber sie war bloß mitgegangen. Sie hatte ein<br />
Baby und keinen Job, und dann wollte der<br />
Mann sie nicht mehr. Sie kehrte zurück nach<br />
Deutschland. Ihr amerikanischer<br />
Traum war geplatzt.<br />
Fünf Jahre später lernte sie Gerhard<br />
Schröder kennen. Auf den<br />
ersten Blick würde man sagen:<br />
Schon wieder derselbe Typ, dieselbe<br />
Rollenverteilung. Hat sie nicht gelernt?<br />
Ist sie die klassische Trophäe<br />
für den Jäger? Brauchte sie einen<br />
Versorger für ihr Kind?<br />
Es ist einfach, fast billig, eine<br />
Frau wie sie so zu sehen.<br />
Ein Mann an ihrer Seite hat einiges auszuhalten.<br />
»Sie ist eine dominante Person,<br />
sie hat eine autoritäre Seite«, sagt Sven<br />
Kuntze. Eine Perfektionistin auch im Privaten,<br />
»die hat mir ja nicht mal zugetraut,<br />
einen Kinderwagen zu schieben«. Und Gerhard<br />
Schröder sagt: Wer seine Frau und ihn<br />
privat kenne, wisse, dass eher sie die Dominante<br />
in der Beziehung sei. Er stöhnt über<br />
ihre Prinzipientreue: »Was sie echt nicht<br />
kann, ist: auch mal Fünfe gerade sein zu<br />
lassen. Das habe ich in meiner Ehe oft zu<br />
spüren bekommen. Aber was soll ich machen,<br />
ich hab sie mir ausgesucht.« Sie selbst<br />
sagt: »Mein Selbstbewusstsein grenzt<br />
manchmal an Rechthaberei.«<br />
Warum löst Doris Schröder-Köpf bei so<br />
vielen Menschen Abwehrreflexe aus? Sie musste<br />
sich dafür rechtfertigen, dass sie einen Doppelnamen<br />
trägt. Dafür, dass sie ihren Beruf<br />
aufgab (also zu unemanzipiert war), und dafür,<br />
dass sie ein Büro im Kanzleramt hatte (also zu<br />
emanzipiert war). Dafür, dass sie Gerd die<br />
Hemden bügelte. Letzteres lag daran, dass sie<br />
zwar einen mächtigen, aber keinen reichen<br />
Mann geheiratet hatte. Er war mehrfach geschieden,<br />
und das ist teuer. Schon allein deshalb<br />
kann der Versorger-Vorwurf nicht so<br />
richtig stimmen. Es gab böse Kommentare<br />
darüber, wie dünn sie sei. Kleidergröße 32, eine<br />
Pro vo ka tion! Die taz schrieb 2002: Barbie<br />
wohnt im Kanzleramt. Man sah in ihr eine<br />
Kindfrau – klein und unterlegen. Ein Kind,<br />
das entweder zu lieb oder zu frech war. Das<br />
entweder zu viel sagte oder zu wenig. Und<br />
dann, als sie daheim blieb bei den Kindern, die<br />
die Schröders adoptiert haben, war sie auch<br />
noch das Hausmütterchen. Dass diese Kinder<br />
sie ungleich mehr brauchten als unbeschwerte<br />
leibliche Kinder, wollte niemand sehen. Und<br />
sie erzählt es keinem – zum Schutz der Kinder.<br />
Immer wieder geriet Doris Schröder-Köpf<br />
in eine Rolle, die gerade nicht ihrem Le bensalter<br />
und ebenso wenig dem Zeitgeist entsprach.<br />
Sie war al lein erzie hend, als das noch<br />
ein Problem war. Sie trat hinter ihrem Mann<br />
zurück, als das ein Problem war. Immer passte<br />
alles nicht zu ein an der. Vielleicht liegt es<br />
daran, dass sie die Menschen oft irritiert hat.<br />
In ihr konnte sich niemand wiederfinden.<br />
Jetzt aber ist etwas neu in ihrem Leben:<br />
Zum ersten Mal könnte sie ein role model<br />
sein. Das ist das Kalkül ihrer Partei. Mit der<br />
Emanzipationsfrage, ihrem Lebensthema,<br />
soll Doris Schröder-Köpf Wähler gewinnen.<br />
»Sehr viele Frauen in meiner Ge ne ra tion<br />
waren der Ansicht, dass man die Quote nicht<br />
braucht, dass man es mit Willenskraft und<br />
einer guten Ausbildung alleine schafft«, sagt<br />
Doris Schröder-Köpf. »Diese Frauen haben<br />
ihre Töchter auf die besten Schulen geschickt,<br />
für viel Geld an Spitzenuniversitäten im Ausland<br />
studieren lassen. Dann bekommen die<br />
Töchter Kinder, und alles ist wie vor dreißig<br />
Jahren.« Die Gegend, in der sie wohnt, ist von<br />
diesen ungelebten Leben erfüllt. Da könnte<br />
sie was rausholen für ihre Partei. Aber erst<br />
einmal musste sie Kandidatin werden, und<br />
das war ein Problem: Es gab schon eine.<br />
Sigrid Leusch ner, 61, ist seit 43 Jahren<br />
in der Partei, Sprecherin ihrer Frak tion für<br />
das Thema Verwaltungsreform, seit 18 Jahren<br />
im Niedersächsischen Landtag. Eine<br />
Gewerkschafterin, jener Typ Politikerin, die<br />
Freunde »verdient« nennen und Feinde eine<br />
»Hinterbänklerin«. Doris Schröder-Köpfs<br />
Einstieg in die Politik bedeutet Sigrid<br />
Leusch ners Ausstieg. Man hat sie abgesägt.<br />
Für die letzten Jahre ihres Berufslebens werden<br />
sie bei ver.di irgendeinen Versorgungsposten<br />
für sie finden müssen.<br />
Das Kandidatinnen-Duell war eine Miniaturversion<br />
der amerikanischen Vorwahlen. In<br />
jedem Ortsverein warben die Alte und die<br />
Neue um Zustimmung. Die bekannte Front,<br />
Schröder-Kritiker gegen Schröder-Ehefrau.<br />
Am Ende stimmten die Ortsvereine ab und<br />
gaben ihren Delegierten ein Votum mit auf<br />
den Weg. Hätten sich die Delegierten daran<br />
gehalten, wäre die Karriere von Doris Schröder-Köpf<br />
be endet gewesen, aber einige hielten<br />
sich nicht dran.<br />
Dieser par tei inter ne Wahlkampf war für<br />
die Neu-Politikerin Doris Schröder-Köpf eine<br />
Art Initiationsritus. Nicht angenehm, auch<br />
demütigend. Aber sie konnte zeigen, dass sie<br />
taktieren kann. Dass sie Kritik aushält. Dass<br />
sie mehr ist als dem Gerd seine Doris. Es war<br />
für sie ein Glücksfall, dass sie zu Beginn ihrer<br />
politischen Karriere diesen kleinen Mord<br />
unter Freunden begehen musste. In der Partei<br />
müssen sie sie jetzt ernst nehmen.<br />
An einem Augustabend sitzt Doris Schröder-Köpf<br />
auf der Terrasse ihres Stammgriechen.<br />
Gegenüber, auf der anderen Straßenseite,<br />
liegt ihr Wahlkreisbüro. Randalierer<br />
haben die Scheibe eingeworfen, das wird ihr<br />
in den nächsten Wochen noch zweimal passieren.<br />
Die Partei wird darüber nachdenken,<br />
das Büro schützen zu lassen. Den Stein hat<br />
Schröder-Köpf vor dem Fenster gefunden, sie<br />
hat ihn in eine Plastiktüte gesteckt und ins<br />
Auto gelegt. Beweismaterial. Die Steinewerfer<br />
könnten irgendwelche militanten Agenda-<br />
Hasser sein, denen sie zu bürgerlich ist, oder<br />
vielleicht eine Neonazigruppe, die sich in<br />
Hannover herumtreibt. Der Glaser ist gerade<br />
dabei, die Scheibe provisorisch zusammenzukleben.<br />
Doris Schröder-Köpf sagt, dass ihr<br />
das nicht viel ausmacht, aber sie sieht dabei<br />
aus, als ob es ihr sehr viel ausmacht.<br />
Streit bei den Schröders: Er findet,<br />
sie ist viel zu zurückhaltend<br />
Sie ist an diesem Tag aus dem Urlaub zurück<br />
und hat Hunderte von Mails zu lesen. Sie<br />
bekommt Interviewanfragen zu Sigmar Gabriels<br />
Bankenpapier und wird gebeten, eine<br />
Petition zur Begnadigung der Pussy-Riot-<br />
Frauen zu unterzeichnen. Es sind Themen,<br />
in denen sie sich nicht auskennt, an denen<br />
sie sich verbrennen kann. Sie würde lieber<br />
darüber reden, dass man keine jungen Ärztinnen<br />
für das Leben in einer niedersächsischen<br />
Kleinstadt begeistern wird, wenn es<br />
dort keine Kinderbetreuung gibt. Darüber,<br />
dass das Land Niedersachsen Aufträge nur<br />
an Unternehmen vergeben sollte, die eine<br />
akzeptable Frauenquote vorzuweisen haben.<br />
Meist reagiert sie gar nicht auf die Anfragen,<br />
in denen es sich um Russland dreht und die<br />
sich in Wirklichkeit an ihn richten, weil er<br />
mal gesagt hat, Putin sei ein lupenreiner<br />
Demokrat. Sollen sie doch ihn selbst fragen.<br />
Aber wenn sie nichts sagt, ist das auch<br />
schlecht. Das bedeutet: Ich habe keine Meinung.<br />
Oder: Ich bin seiner Meinung. Ist sie<br />
aber nicht immer. Ihr Mann ist der Geostratege,<br />
Anwalt der Stabilität. Sie: Verfechterin<br />
der Bürgerrechte, ihre Positionen seien<br />
»Mainstream«, aber »etwas links von ihm«.<br />
Einmal gibt sie Pussy Riot auf ihrer Facebook-Seite<br />
ein »Like«. Sie muss nicht befürchten,<br />
dass sie da Ärger mit ihm bekommt.<br />
Er hat keinen Face book- Account.<br />
Trotzdem gibt es jetzt manchmal Streit<br />
bei den Schröders. Er findet nämlich, dass<br />
sie langsam mal in den Vordergrund treten<br />
müsste, dass sie unter ihren Möglichkeiten<br />
bleibt. Von wem sie alles In ter view anfra gen<br />
hatte, als sie um ihre Kandidatur kämpfte!<br />
Sie hätte mit allen reden können. Sie hätte<br />
in der Gala sein können und in Talkshows<br />
von Markus Lanz bis Günther Jauch. Er an<br />
ihrer Stelle hätte alles abgeräumt. Er findet<br />
auch die Fleiß-Methode falsch. Fleiß ist was<br />
für die unteren Chargen.<br />
Sie sagt: »Ich finde es manchmal ungerecht,<br />
dass ihm Sachen, die für mich jetzt<br />
wichtig sind, nicht so wichtig sind.« Gerhard<br />
Schröder hatte schon größere Sorgen als ein<br />
paar Feinde im Ortsverein, er sagte Nein zum<br />
Irakkrieg und hatte Weltmächte gegen sich.<br />
»Ab und zu hat es was Beruhigendes, wenn er<br />
sagt: Das ist doch alles nicht so schlimm.<br />
Dann wieder denke ich, jetzt könnte er aber<br />
etwas sensibler sein.«<br />
Hat Gerds Sensibilität sie beeindruckt, als<br />
sie ihm begegnete? Wohl eher das Gegenteil:<br />
dass es ihn nicht scherte, was die anderen<br />
dachten. Vierte Ehe? Egal. Auch in der Politik<br />
war das Mitfühlen nicht sein Spe zial ge biet.<br />
Medienkanzler. Genosse der Bosse. Basta-<br />
Kanzler. All diese Namen hatte er, weil er vor<br />
Kraft nur so strotzte. Es ist eine Art, Politik zu<br />
machen, die in Deutschland heute nicht mehr<br />
funktioniert. Sie wurde beerdigt in der Elefantenrunde<br />
am Wahl abend 2005, als ihm<br />
Foto: Wolfgang Wilde für <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>/www.wolfgangwilde.de; kl. Fotos: Michael Kappeler/ddp (o.); David Hecker/ddp
DOSSIER<br />
nicht in den Kopf ging, dass er abgewählt war.<br />
Ausgerechnet Angela Merkel sollte ihn ersetzen!<br />
Jemand, der keine Sprüche klopfen kann. Noch<br />
dazu: eine Frau.<br />
»Ich bin ja Instinktpolitiker, die werden nicht<br />
mehr gebraucht«, sagt er betont gleichgültig. Heute<br />
gewinnen Typen wie Olaf Scholz die Wahl.<br />
Olaf Scholz, der unter Schröder Generalsekretär<br />
war. Braver Mann, findet der Ex-Kanzler. Er könnte<br />
auch sagen: was für ein Langweiler. Stephan<br />
Weil, der Spitzenkandidat der niedersächsischen<br />
SPD, ist auch so einer. Es ist eine Ge ne ration<br />
von Politikern, die still die Arbeit erledigt,<br />
die zu tun ist. Doris Schröder-Köpf<br />
gehört auch dazu.<br />
Wäre sie Bundestagsabgeordnete und<br />
hätte über den Griechenland-Hilfsfonds zu<br />
entscheiden, sie wäre keine von denen, die<br />
die 726-seitige Vorlage vor der Abstimmung<br />
nicht gelesen haben. Wäre sie nicht<br />
seine Frau, würde Gerhard Schröder sagen:<br />
eine Langweilerin.<br />
Jetzt geht der Wahlkampf los. Doris<br />
Schröder-Köpfs Zwischenbilanz: In der<br />
Partei hat sie Freunde, und die Feinde respektieren<br />
sie. Sie hat einen guten Listenplatz,<br />
und für ihr Wahlkreisbüro hat sie<br />
eine »durchwurfhemmende Verglasung« in<br />
Auftrag gegeben. Gerd hat versprochen,<br />
dass jetzt mal ihre Termine vorgehen. Er<br />
gibt ihr Ratschläge, und sie schlägt sie aus.<br />
Für den Anfang läuft es nicht schlecht.<br />
Auf die Frage, wofür sie ihren Mann<br />
braucht, antwortet sie: »Für das konkrete<br />
praktische Leben.« Geburtstagsgeschenke für<br />
die Kinder kaufen, zum Elternabend gehen.<br />
»Er arbeitet sich da ein, es klappt schon ganz<br />
gut.« Sie redet ihren Mann auf Hannover-<br />
Format runter. Das ist der kleine Sieg in<br />
ihrem persönlichen Emanzipationskampf,<br />
ihrer »Befreiung aus dem Gattinnenkerker«,<br />
wie sie es nennt. Vielleicht kann man mehr<br />
in diesem Kampf zwischen so ungleichen<br />
Gegnern auch gar nicht erwarten.<br />
In China hat Gerhard Schröder, nachdem<br />
er ausgiebig ihre Geradlinigkeit gelobt<br />
hatte, gesagt: »Es gibt keine Konkurrenz<br />
zwischen uns, auch wenn sie das vielleicht<br />
anders sieht.« Danach hat er von der Kamera<br />
scheu seiner Frau erzählt. Er glaubt,<br />
dass sie nicht gern im Fernsehen ist, weil<br />
man im Fernsehen spontan reagieren muss.<br />
Er er innert sich an eine Livesendung, bei<br />
Erster Auftritt<br />
der Kandidatin<br />
Doris Schröder-<br />
Köpf in ihrem<br />
Wahlkreis: Sie<br />
sammelte Müll –<br />
eine wenig<br />
glamouröse<br />
Aufgabe<br />
der sie vor längerer Zeit zu Gast war. »Da<br />
hat sie sich vorbereitet bis zum Gehtnichtmehr,<br />
tagelang, und dann ...«, Kunstpause,<br />
»... dann kamen die erwarteten Fragen<br />
nicht!« Sie war fixiert auf das, was sie sich<br />
zurechtgelegt hatte. Sie war nicht locker.<br />
Eine Katastrophe. »Die Leute müssen doch<br />
unterhalten werden«, sagt Schröder, »selbst<br />
in ernsten politischen Sendungen. Wir<br />
müssen da mal ein Späßchen machen und<br />
dann wieder ernst werden.« Späßchen – so<br />
was kann sie nicht, noch weniger als Merkel.<br />
Und sie will es auch nicht.<br />
Diesmal sollen es bloß 90 Sekunden<br />
werden. Ein Videodreh. In der Kleinstadt<br />
Springe hält die SPD ihren Kandidatenkonvent<br />
ab. Ein Treffen der 87 Landtagsanwärter,<br />
bei dem auch Fotos für die Wahlplakate<br />
und You Tube-Clips gemacht werden.<br />
»Mein Name ist Doris Schröder-Köpf«,<br />
sagt sie im Studio, »ich bin 49 Jahre alt, ver-<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 15<br />
heiratet, habe drei Kinder mit 21, elf und<br />
sieben Jahren.« Bei »Ich lebe in Hannover-<br />
Waldhausen« verhaspelt sie sich zum ersten<br />
Mal. Die helle Stimme wird dünn, die Farbe<br />
weicht aus dem Gesicht. Noch mal. Und<br />
dann noch mal. Anderthalb Minuten.<br />
Name, Alter, Beruf, politische Schwerpunkte.<br />
Fünf Anläufe braucht sie. Es ist so<br />
einfach. Es ist so schwer. Aber irgendwann<br />
ist es gut. Ihr Mann kommt nicht vor, außer<br />
in dem Wort »verheiratet«.<br />
Irgendwo in Hannover kümmert sich<br />
zur selben Zeit Gerhard Schröder um die<br />
Kinder. Er weiß, wie man in Peking Vertreter<br />
der chinesischen Nomenklatura umgarnt<br />
und wie man es mit einer Weltmacht<br />
aufnimmt, aber er weiß nicht, wie er zu<br />
Hause reinkommen soll. Er hat den Hausschlüssel<br />
vergessen. Und so wartet Gerhard<br />
Schröder auf seine Frau, damit sie ihm eine<br />
Tür öffnet.<br />
Foto: Frank Wilde
Fotos: ullstein (Rahmen); PR (u.); bildstelle (o.); David Price/Arsenal FC/Getty Images; Montage: DZ<br />
WOCHENSCHAU<br />
Ökologische<br />
Bürgerwehr<br />
<strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>: Herr Bender, Sie sind zwar noch jung,<br />
aber sammeln Sie schon Karriere-Erinnerungsstücke,<br />
die ins neue Fußballmuseum passen könnten?<br />
Sven Bender: Ich habe ein paar Trikots zu Hause.<br />
Die von vor sechs, sieben Jahren sehen schon richtig<br />
alt aus; gerade in der Trikotbranche tut sich ja viel.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Hängen die bei Ihnen an der Wand?<br />
Bender: Dann wären da jetzt schon drei Schichten!<br />
Ich habe sie alle nebeneinander auf einem Kleiderständer<br />
aufgehängt.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Gewaschen?<br />
Bender: Ja, die werden einmal gewaschen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Was ist Ihr wertvollstes Sammlerstück?<br />
Bender: Das weiß ich gar nicht ... Vom DFB gibt<br />
es bei der Meisterschaft und beim Pokalsieg für<br />
jeden Spieler eine Medaille. Manche lassen sich<br />
sogar von der Meisterschale oder vom Pokal ihr<br />
eigenes Exemplar nachmachen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: In klein?<br />
Bender: Auch im Originalformat. Ich hab das gemacht.<br />
Das sind doch Er inne run gen! Ich eröffne<br />
dann mein eigenes Museum.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Herr Neukirchner, Herr Engelke, da haben<br />
Sie einen harten Konkurrenten zu Ihrem Projekt!<br />
Lutz Engelke: Wir planen ja keine klassische Vitrinenausstellung.<br />
Es wird keine In fla tion von Wimpeln<br />
und Trikots geben, sondern eine szenische,<br />
fast theaterhafte Inszenierung zum Thema Fußball.<br />
Eine der Kernfragen ist: Wie schafft man es, die<br />
Bewegung, die Sta dion atmo sphä re, die ganzen<br />
Emo tio nen lebendig zu machen? Ein Museum<br />
scheint ja immer rückwärtsgewandt, stillgestellt zu<br />
sein. Aber wir wollen die Leute mit der Euphorie<br />
des Fußballs anstecken und emotionalisieren.<br />
Manuel Neukirchner: Ein Haus, das eine Art kollektives<br />
Gedächtnis des Fußballs ist, gibt es bislang<br />
nicht. Genau das wollen wir schaffen. Man soll die<br />
WM 1954 oder die WM 2006 richtig erleben<br />
können. Wir wollen zwar die historische Entwicklung<br />
des deutschen Fußballs zeigen, aber auch die<br />
Gegenwart des Fußballs ins Haus holen. Wir werden<br />
immer wieder aktuelle Ereignisse einbinden.<br />
Das müssen natürlich die Highlights sein, die sich<br />
auch in der Rückschau noch bewähren.<br />
Engelke: Diese magischen Momente wollen wir so<br />
inszenieren, dass die Besucher sie von überall sehen<br />
können. Das Haus wird ein Verwandlungshaus, in<br />
dem man sich für Momente fühlt wie im Sta dion<br />
– der Sound ändert sich, das Licht. Wir wollen Geschichte<br />
nicht linear erzählen, wir deuten sie.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Gibt es Vorbilder für solch ein Haus? Borussia<br />
Dortmund hat ja auch ein Museum.<br />
Bender: Das kann ich sehr empfehlen! Aufgrund<br />
unserer Erfolge in den letzten Jahren muss das<br />
auch immer wieder aktualisiert werden.<br />
Engelke: Vorbilder sind alle modernen Mu seen, die<br />
nicht einfach eine lineare Geschichte erzählen, sondern<br />
in der Lage sind, über crossmediale Inszenierungen<br />
Besucher ganz anders zu faszinieren. Im<br />
Bereich Fußball gibt es das bisher nicht. Wir haben<br />
uns alles angesehen, von Barcelona bis Madrid und<br />
München. Die haben respektable eigenständige<br />
Konzepte, aber wir gehen einen Schritt weiter. Wir<br />
nähern uns dem Fußball von zwei Seiten: einmal<br />
über die Nationalmannschaft, zum anderen über<br />
die Entwicklung des Vereinssports seit 112 Jahren.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Der DFB wurde im Jahr 1900 gegründet.<br />
Warum entsteht das Museum erst jetzt? Weil sich<br />
der Verband mit seiner Vergangenheit schwertut?<br />
Neukirchner: Weil sich erst nach einer gewissen<br />
Zeit ein historisches Bewusstsein entwickelt hat.<br />
Zuerst kam dieser Gedanke im Jahr 2000 zum<br />
100-jährigen Bestehen auf. Da gab es in Oberhausen<br />
die große Ausstellung Der Ball ist rund<br />
und die Idee, daraus etwas Dauerhaftes zu machen.<br />
Aber dafür braucht man auch Mittel. Aufgabe<br />
des DFB ist die Förderung des Fußballs und<br />
nicht, ein Mu seum zu errichten. Dann kam die<br />
tolle WM 2006, die dem DFB auch einen wirtschaftlichen<br />
Gewinn beschert hat, und der Verband<br />
beschloss: Wir wollen den Menschen im<br />
Land, die mit ihrer Begeisterung zum »Sommermärchen«<br />
beigetragen haben, etwas Nachhaltiges<br />
zurückgeben. Das ist das Fußballmuseum.<br />
Süßlich fies riecht es, und der meterweite Auswurf<br />
seiner platzenden Samenkapseln lässt gestandene<br />
Männer erschrecken: Impatiens glandulifera, das<br />
aus dem Himalaya als Indisches Springkraut zu uns<br />
gelangte und seither Uferstreifen zu Keimstätten<br />
<strong>ZEIT</strong>: Hat der DFB denn eine eigene Sammlung?<br />
Neukirchner: Ein Archiv. Das Sammelbewusstsein<br />
jedes Präsidenten war anders ausgeprägt. Für manche<br />
Epochen hat man mehr, für manche weniger.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Was werden Ihre »Meisterwerke« sein?<br />
Neukirchner: Für mich ist das Highlight der Endspielball<br />
von 1954. Es gab Gerüchte, wir besäßen<br />
nicht das Original. Lassen Sie sich davon nicht irritieren:<br />
Wir besitzen ihn! Sepp Herberger hat ihn<br />
nach dem Spiel mitgenommen. Wenn man sich<br />
den Ball anguckt, bekommt man eine Gänsehaut.<br />
Engelke: Ein Freund von mir hat ein Interview mit<br />
jemandem geführt, der beim Spiel hinter Toni<br />
Tureks Tor stand, kurz vor Schluss den Ball fing<br />
und ihn zehn Sekunden festhielt, sodass Puskás<br />
mit der Ecke warten musste – der Mann behauptet,<br />
eigentlich habe er damit verhindert, dass Ungarn<br />
doch noch Weltmeister wurde.<br />
Neukirchner: Ein weiteres Highlight ist das Endspieltrikot<br />
von Gerd Müller von 1974. Wir haben<br />
es über Wim Rijsbergen bekommen, Müllers damaligen<br />
Gegenspieler, der jetzt Entwicklungshelfer<br />
in Somalia ist. Aber viele denkbare Exponate<br />
sind schon weg. Deshalb gehen wir an die Spieler<br />
selber heran, die Fußballgeschichte geschrieben<br />
haben. Raúl zum Beispiel hat uns sein 400. Profitor<br />
mit seinem Matchtrikot und seinem Matchball<br />
gewidmet. Das ist auch etwas Besonderes.<br />
Engelke: Wir bauen ja kein Museum um Objekte<br />
herum – es ist genau umgekehrt! Wir entwickeln<br />
ein Konzept um Geschichten herum. Wenn authentische<br />
Objekte gut dazu passen, ist es wunderbar.<br />
Aber wenn wir keine haben, brauchen wir sie<br />
zum Teil gar nicht, weil wir ganz anders erzählen.<br />
Wir sind keine Devotionaliensammlung.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Bei aller Bedeutung der Inszenierung werden<br />
Sie dennoch Objekte mit Aura brauchen.<br />
Neukirchner: Die haben wir! Wir werden 500 bis<br />
600 Exponate haben, symbolträchtige Dinge, ein<br />
Trikot von Charly Mai aus dem 54er Endspiel, einen<br />
Trenchcoat von Herberger oder die Schreib-<br />
seiner völlig hemmungslosen Vermehrung macht.<br />
Besorgte Gärtner erheben mutig die Stimme<br />
gegen die »undurchdringlichen Massenbestände«,<br />
sie sehen »die einheimische Flora und Fauna<br />
bedroht«. Vielerorts bilden sich ökologische<br />
Bürgerwehren, die den Eindringling in<br />
Sondereinsätzen einen Kopf kürzer machen oder<br />
ihn rauschhaft niedertrampeln. In Murnau, hat<br />
der Münchner Merkur kürzlich auf seiner<br />
Internet-Seite berichtet, seien 30 Freiwillige vom<br />
Ein Kieferbruch für die Ewigkeit<br />
Der deutsche Fußball<br />
bekommt ein Museum.<br />
Wie sieht das aus, was<br />
gehört hinein? Ein Gespräch<br />
über legendäre Bälle, das<br />
letzte Wort zum Wembley-<br />
Tor und ausstellungswürdige<br />
Verletzungen<br />
Museumsreif? Im Spiel gegen Arsenal<br />
London erleidet Sven Bender von<br />
Borussia Dortmund einen doppelten<br />
Kieferbruch, November 2011<br />
Das Ballhaus<br />
An diesem Donnerstag wird vor<br />
dem Dortmunder Hauptbahnhof der<br />
Grundstein gelegt für das Fußballmuseum<br />
des DFB. Eröffnet werden<br />
soll es im Herbst 2014. Zum Gespräch<br />
über den zukünftigen Gedächtnisort<br />
des deutschen Fußballs<br />
trafen sich auf dem Trainingsgelände<br />
von Borussia Dortmund zwei der<br />
Verantwortlichen und ein Profi: Manuel<br />
Neukirchner, Geschäftsführer<br />
der Stiftung DFB Fußballmuseum,<br />
Ausstellungsmacher Lutz Engelke,<br />
mit seiner Firma Triad zuständig für<br />
die Inszenierung der Museumsinhalte,<br />
sowie Sven Bender, Spieler bei<br />
Dortmund und in der Nationalelf.<br />
maschine, auf der er seine Notizen geschrieben hat.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Was hätten Sie gerne, was schon weg ist?<br />
Engelke: Den Ball vom WM-Finale 1966 mit dem<br />
legendären Wembley-Tor! Aber der ist natürlich in<br />
England. Helmut Haller hat ihn nach dem Spiel<br />
mit nach Italien genommen, doch der englische<br />
Fußballverband hat ihn wieder eingefordert und<br />
einige Jahre später auch bekommen. Von dort<br />
kriegen wir ihn natürlich nicht zurück, denn am<br />
Ende verrät ein Abdruck der Torlinie auf dem Leder<br />
noch, was wir in Deutschland alle wissen: Der<br />
Ball war nicht drin! Aber wir haben dazu eine spezielle<br />
Inszenierung im Museum: Das Ganze wird<br />
aussehen wie eine Szene aus dem Tatort. Und natürlich<br />
wird es auch eine Hall of Fame geben.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Wie kommt man da hinein? Steht Sven<br />
Bender schon auf der Warteliste?<br />
Neukirchner: Ein junger Spieler wie er braucht<br />
dafür sicherlich noch ein paar Jahre. Den Modus<br />
müssen wir noch festlegen: Bezieht man in eine<br />
solche Wahl die Besucher mit ein? Macht man das<br />
mit einer Fachjury?<br />
<strong>ZEIT</strong>: Herr Bender, wäre es für Sie ein Ziel, da hineinzukommen?<br />
Bender: Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, dass jeder<br />
Spieler das Ziel hat, nach seiner aktiven Zeit nicht<br />
vergessen zu werden.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Welche Spieler fallen Ihnen sofort ein, die<br />
dort hineinmüssten?<br />
Bender: Gerd Müller, Sepp Maier, Beckenbauer ...<br />
<strong>ZEIT</strong>: Lauter Bayern! Und das aus dem Munde<br />
eines Dortmunders ...<br />
Bender: Was soll ich denn machen? Die waren nun<br />
mal historische Figuren. Man kann da sehr viele<br />
Spieler aufzählen, ganze Mannschaften, die Weltmeister<br />
von 1990, von 1974 ... Ich bin gespannt,<br />
wie ihr das hinkriegt.<br />
Neukirchner: Das ist wirklich kompliziert. Außerdem<br />
stellen sich Fragen wie: Nimmt man die Trainer<br />
mit dazu? Und Frauen?<br />
<strong>ZEIT</strong>: Herr Bender: Frauen – ja oder nein?<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 16<br />
Krieger- und Soldatenverein, von Murnau<br />
Miteinander sowie vom Verschönerungsverein<br />
gemeinsam in »steiles Gelände« ausgerückt,<br />
um »den Vormarsch« zu stoppen. Ungebetene<br />
Gastpflanzen – raus aus deutschen Auen!<br />
Bender: Fangfrage! Aber nach all den Erfolgen gehören<br />
sie wohl hinein, alles andere wäre Quatsch.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Herr Engelke, wie werden Sie es mit den<br />
weniger rühmlichen Momenten des deutschen<br />
Fußballs halten? Wird ein Satz wie der von Berti<br />
Vogts, dass er in Argentinien bei der WM 1978<br />
von der Diktatur nichts mitbekommen haben will,<br />
auch seinen Platz finden?<br />
Engelke: Ja, sicher, wir blenden nichts aus. Die gesamte<br />
Geschichte des DFB wird entlang von 114<br />
Objekten erzählt, für jedes Jahr eins. Es wird auch<br />
eine eigene Inszenierung zum Nationalsozialismus<br />
geben. Da werden wir zum Beispiel über Fußball<br />
in Konzentrationslagern berichten.<br />
Neukirchner: Es gibt einen Pokal, der von Inhaftierten<br />
des Konzentrationslagers Dachau aus Holz<br />
geschnitzt worden ist. Dort wurde ja auch Fußball<br />
gespielt, zur Belustigung des Wachpersonals. Die<br />
Gefangenen aus dem Küchentrakt traten an gegen<br />
Gefangene aus einem anderen Trakt. Es existiert<br />
sogar eine Urkunde: »Sieger Küchentrakt«. Um<br />
den Pokal haben wir uns bemüht, aber den möchte<br />
die Stiftung in Dachau selber ausstellen. Auch<br />
eine Figur wie Tull Harder, der in den zwanziger<br />
Jahren Nationalspieler war und später KZ-Aufseher<br />
wurde, muss bei uns ein Thema sein.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Wie werden Sie die Inszenierung der magischen<br />
Momente mit dem Er innern an die dunklen<br />
Seiten des Fußballs zusammenbringen?<br />
Neukirchner: Wir haben viel darüber diskutiert.<br />
Wie geht man damit um, dass sich ein Besucher<br />
gerade mit Harder beschäftigt und auf der großen<br />
Medienfläche plötzlich Gerd Müller das Siegtor<br />
von 1974 schießt? Ich habe gesagt: Das kann man<br />
nicht machen, wir müssen einen geschlosseneren<br />
Raum schaffen, was ein bisschen gegen die Grunddramaturgie<br />
des Hauses geht. Claudia Roth von<br />
den Grünen, mit der wir unser Ausstellungskonzept<br />
diskutiert haben, meinte dagegen: Ein Pokal<br />
aus dem KZ gehört zwischen alle anderen Pokale!<br />
Das sind Dinge, die uns sehr beschäftigen. Aber<br />
wir haben ja noch Zeit bis 2014.<br />
Engelke: Eine Sache, die ich zum Beispiel gerne<br />
verifizieren würde, ist eine Aussage des russischen<br />
Linienrichters Tofik Bachramow, der beim Wembley-Tor<br />
der Engländer gegen die Deutschen im<br />
WM-Finale 1966 der entscheidende Mann war.<br />
Als er auf dem Sterbebett lag, 1993, hat ihn sein<br />
Sohn gefragt: »Warum hast du das Tor eigentlich<br />
gegeben?« Da soll er angeblich nur ein Wort gesagt<br />
haben: »Stalingrad.«<br />
<strong>ZEIT</strong>: Zurück in die Gegenwart. Herr Bender, gab<br />
es in Ihrer Karriere auch schon Momente, von denen<br />
Sie sagen würden: Das ist museumsreif?<br />
Bender: Ich hatte in den letzten Jahren mit zwei<br />
Meisterschaften und dem Pokalsieg einige sehr,<br />
sehr große Momente. Aber einer der schönsten<br />
war der EM-Titel mit der U 19. Wir hatten damals<br />
enormen Druck, weil es schon lange keinen<br />
Jugendtitel mehr für den DFB gegeben hatte. Als<br />
dann mein Zwillingsbruder Lars das 1 : 0 gemacht<br />
hat – das war wirklich ein genialer Moment.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Bleiben auch die unschönen Momente in<br />
Er inne rung? Wir zitieren mal aus Ihrer Krankenakte:<br />
Rippenprellung; Sprunggelenk, Hüfte, Schulter<br />
verletzt; Innenbanddehnung; Kieferbruch.<br />
Bender: Ja, mein Gott, das gehört halt dazu.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Vielleicht sollten Sie dem Museum Ihre<br />
Krankenakte zur Verfügung stellen!<br />
Bender: Oder vielleicht die Platten, mit denen<br />
mein Kiefer geflickt wurde ... Wie ich das hinbekommen<br />
habe, ist natürlich auch ein historisches<br />
Highlight: Da fällt einer über mein Knie und verpasst<br />
mir mit dem Hacken von seinem Schuh einen<br />
doppelten Kieferbruch. So was hat es bislang<br />
nur beim Boxen gegeben.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Würde eine Röntgenaufnahme vom Kieferbruch<br />
ins Museumskonzept passen?<br />
Neukirchner: Klar!<br />
Bender: Oder ich stelle mich live hin! Das gibt so<br />
ein Gänsehaut-Feeling – Geschichte zum Anfassen.<br />
Das Gespräch führten MORITZ MÜLLER-WIRTH und<br />
CHRISTOF SIEMES
Abb.(Ausschnitt): Roger Viollet/StudioX; Fotos: M. Reichel/picture-alliace/dpa (l.); K. Kollwitz Museum, Köln (r.)<br />
17 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> No Drama im Bundestag:<br />
GESCHICHTE<br />
Am 1. Oktober 1982 wurde<br />
Helmut Kohl Kanzler S. 18<br />
<strong>39</strong><br />
Das Grab soll ausgehoben<br />
werden. So<br />
hat es der Stadtrat<br />
zu Hildburghausen<br />
im Thüringer<br />
Wald am 27. Juni dieses<br />
Jahres beschlossen, um endlich<br />
Gewissheit zu haben,<br />
um wen genau es sich bei<br />
der »Dunkelgräfin« handelt,<br />
die seit 1837 auf<br />
dem Stadtberg begraben<br />
liegt. Doch während<br />
die einen schon<br />
die Touristenbusse anrollen<br />
sehen und die<br />
Kassen klingeln hören,<br />
formieren sich andere<br />
zum Widerstand und<br />
fordern: Lasst sie ruhen!<br />
Wer nur war die geheimnisvolle<br />
Frau, die<br />
wegen ihrer grünen Brille<br />
und des Schleiers, der stets<br />
ihr Gesicht bedeckte, als<br />
»Dunkelgräfin« in die Geschichte<br />
eingegangen ist?<br />
Die Spur führt ins Paris der<br />
Revolution, ins Jahr 1795: Seit<br />
vier Jahren wird Marie Thérèse<br />
Charlotte de Bourbon, die 16-jährige<br />
Tochter des französischen Königs<br />
Ludwig XVI. und seiner Frau Marie<br />
Antoinette, im Temple gefangen gehalten.<br />
Sie hat hier die Hinrichtung ihrer Eltern und<br />
den Tod ihres Bruders miterleben müssen. Sie<br />
hat ein Jahr Einzelhaft hinter sich, umgeben<br />
von Soldaten, die, wie sie in ihrem Tagebuch<br />
schreibt, meist betrunken waren. Ob sie<br />
tatsächlich vergewaltigt wurde, lässt<br />
sich nicht sicher sagen. Aber es besteht<br />
kein Zweifel, dass die Haft<br />
dem jungen Mädchen schwere<br />
psychische Schäden zugefügt hat.<br />
Da die Prinzessin mehr und<br />
mehr zu einer Kultfigur der erstarkenden<br />
royalistischen Opposition<br />
wird, will die Revolutionsregierung<br />
sie so schnell<br />
wie möglich nach Österreich,<br />
in das Heimatland ihrer Mutter,<br />
abschieben. Andererseits<br />
befürchtet man, dass die Österreicher,<br />
mit denen sich die Franzosen<br />
damals noch im Krieg befinden,<br />
Marie Thérèse mit Erzherzog<br />
Karl, einem jüngeren Bruder<br />
des Kaisers, verheiraten könnten, um<br />
sich den Anspruch auf das Erbe der Prinzessin<br />
und auf den französischen Thron zu<br />
sichern. Ein Dilemma, aus dem es zunächst<br />
keinen Ausweg zu geben scheint.<br />
Offiziell wird die Prinzessin am 26. Dezember<br />
1795 in Basel an die österreichischen Behörden<br />
übergeben. Aber wie sagte Victor Hugo? »Es gibt<br />
zwei Arten von Geschichte: die offizielle, lügenhafte<br />
Geschichte und dann die geheime, wo die<br />
wahren Ursachen der Ereignisse liegen.« Die Geschichte<br />
der Tochter Marie Antoinettes ist dafür<br />
ein vollendetes Beispiel.<br />
Nach der offiziellen Geschichtsschreibung trifft<br />
sie Anfang Januar 1796 am Wiener Hof ein, wird<br />
freundlich aufgenommen und wie eine Tochter<br />
des Kaisers behandelt. 1799 heiratet sie ihren<br />
Cousin und lebt als Herzogin von Angou lême in<br />
Litauen und England – am Hof ihres Onkels,<br />
eines Bruders Ludwigs XVI. Nach der Vertreibung<br />
Napoleons kehrt dieser 1815 – als Ludwig XVIII.<br />
– mithilfe der Alliierten auf den wiedererrichteten<br />
französischen Königsthron zurück. Im Juli 1830<br />
aber kommt es zu einer erneuten Revolution in<br />
Paris und zur endgültigen Vertreibung der Bourbonen.<br />
Die Herzogin stirbt 1851 einsam und verbittert<br />
in Frohsdorf bei Wien.<br />
Die inoffizielle Version ist spektakulärer, nach<br />
neuesten Erkenntnissen aber die plausiblere.<br />
Das Grab<br />
im Wald<br />
Wer war die geheimnisvolle<br />
»Dunkelgräfi n« von<br />
Hildburghausen? Jetzt soll ihr<br />
Leichnam exhumiert werden<br />
VON CAROLIN PHILIPPS<br />
Schon im Januar 1796 schreibt Maria Karolina,<br />
Königin von Neapel und Schwester Marie Antoinettes:<br />
»Ich bin krank vor Angst, dass diese Bestien<br />
sich erlauben, ein anderes Mädchen anstelle meiner<br />
Nichte nach Wien zu schicken.« Und auch der englische<br />
Geheimagent Lord Wickham erhält von<br />
seinen Informanten beunruhigende Berichte von<br />
einer geplanten Flucht oder Entführung der Königstochter<br />
während ihres Aufenthalts in Basel. In<br />
den Archives nationales in Paris liegen zudem die<br />
Erpresserbriefe, die – Jahrzehnte später – eine ehemalige<br />
Untergouvernante an die Herzogin von<br />
Angoulême schreibt. In diesen Briefen droht sie<br />
damit, das Geheimnis der Vertauschung zu lüften.<br />
Bis zu ihrem Tod zahlt die Herzogin ein Vermögen<br />
an Schweigegeld.<br />
Die Korrespondenz belegt eindeutig, dass nicht<br />
die Tochter Marie Antoinettes in Wien angekommen<br />
ist, sondern ihre Halbschwester Marie<br />
Philippine, genannt Ernestine, eine uneheliche<br />
Tochter Ludwigs XVI. (Die Mutter ist eine seiner<br />
Kammerfrauen). Zusammen mit Marie Thérèse<br />
Marie Thérèse mit<br />
Bruder Louis<br />
Joseph, gemalt von<br />
Élisabeth Vigée-<br />
Lebrun 1787.<br />
Unten: Das Grab bei<br />
Hildburghausen<br />
wurde<br />
sie am Hof zu<br />
Versailles erzogen.<br />
Die Briefe, die Maria<br />
Karolina von Neapel zwischen 1796<br />
und 1799 an ihre Tochter, die österreichische<br />
Kaiserin, schickt, zeigen,<br />
dass man den Betrug in Wien<br />
schon sehr bald bemerkte. Das aber<br />
mochte niemand zugeben. Schließlich<br />
hatte der österreichische Unterhändler<br />
Dengelmann die Auslieferung<br />
der »richtigen« Königstochter<br />
offiziell quittiert – allerdings<br />
ohne sie jemals vorher gesehen zu<br />
haben. Es galt, das Gesicht zu wahren,<br />
wie Maria Karolina schrieb.<br />
Auch auf französischer Seite bemühte<br />
man sich um Geheimhaltung: An der Vertauschung<br />
beteiligt waren unter anderem Paul<br />
de Barras, der als Mitglied des Direktoriums für<br />
das Polizeiwesen zuständig war, und der Innenminister<br />
Pierre Bénézech. Sie gingen damit ein<br />
hohes Risiko ein. Wenn die Sache zum falschen<br />
Zeitpunkt aufflog, konnte dies nicht nur die<br />
Karriere der Beteiligten ruinieren, sondern auch<br />
die Beziehungen der französischen Regierung<br />
zum Hause Habsburg und zu anderen Herrscherhäusern.<br />
Immerhin war der Austausch ein<br />
offizieller Akt zwischen zwei Regierungen; das<br />
noch zweifelhafte Ansehen der Französischen<br />
Republik als Verhandlungspartner wäre auf lange<br />
Sicht zerstört worden.<br />
Als eines der größten Probleme erwies sich<br />
dabei die Unterbringung der echten Prinzessin.<br />
Niemand wusste, wie lange sie untertauchen musste.<br />
Und wann und ob man sich ihrer dereinst als<br />
Trumpfkarte bedienen würde – in dem Fall etwa,<br />
dass die Habsburger tatsächlich versuchen sollten,<br />
über eine Heirat Ansprüche auf den französischen<br />
Thron geltend zu machen.<br />
In diesen Zeiten der nachrevolutionären Kriege,<br />
die ganz Europa überzogen, gab es nur eine<br />
Institution, die überregional, politisch unabhängig<br />
und frei von gesellschaftlichen und religiösen<br />
Schranken agierte: die der Freimaurer. Es geht hier<br />
nicht um irgendeine der vielen Verschwörungstheorien,<br />
die den Freimaurern gerade in Zusammenhang<br />
mit der Französischen Revolution<br />
fälschlicherweise angehängt wurden<br />
und werden. Es geht hier allein um ihr<br />
Netzwerk, das einzigartig war – um 1790<br />
existierte beiderseits des Rheins in fast<br />
jeder größeren Stadt mindestens eine<br />
Freimaurerloge. Zudem waren alle an<br />
der Vertauschung Beteiligten Freimaurer,<br />
von den Regierungsmitgliedern<br />
Barras und Bénézech bis<br />
zu den französischen Gesandten<br />
in Basel.<br />
In den Jahren nach 1796 wird die<br />
echte Marie Thérèse immer wieder<br />
an verschiedenen Orten gesehen,<br />
mal in Straßburg, mal im<br />
schwäbischen Ingelfingen. Wegen<br />
der großen Ähnlichkeit zwischen<br />
ihr und ihrer Halbschwester<br />
glauben die Menschen, sie hätten<br />
die Herzogin von Angoulême vor<br />
sich. Die aber lebt zu dieser Zeit<br />
längst viele Tausend Kilometer entfernt<br />
in Litauen.<br />
Von 1799 an sorgt Leonardus Corne<br />
lius van der Valck, vormals<br />
holländischer Gesandter in<br />
Paris, für den Schutz der<br />
Prinzessin – vermutlich im<br />
Auftrag des französischen<br />
Innenministers Talleyrand<br />
(der ebenfalls den<br />
Freimaurern angehört).<br />
1807 erscheinen van der<br />
Valck und Marie Thérèse<br />
schließlich im thüringischenHildburghausen,<br />
wo Herzog Karl von<br />
Mecklen burg-Strelitz Meister<br />
vom Stuhl der Freimaurerloge<br />
»Karl zum Rautenkranze« ist<br />
und seine Tochter Charlotte amtierende<br />
Herzogin. Zwischen der Herzogsfamilie und Marie<br />
Antoinette hat zu deren Lebzeiten eine intensive<br />
Freundschaft bestanden.<br />
Hier findet Marie Thérèse endlich ihren Frieden,<br />
so wie sie es sich gewünscht hat, als sie noch<br />
im Gefängnis saß: »Ich schließe manchmal meine<br />
Augen und denke mir, dass ich in einem einsamen<br />
Schlosse wohne, umgeben nur von einigen treuen<br />
Menschen, die mich ebenso lieben wie ich sie [...],<br />
und dass die Menschen, denen ich begegne, gar<br />
nicht ahnen, wer ich bin.« Die Gerüchteküche<br />
allerdings brodelt schon damals, aber van der Valck<br />
besitzt genügend Geld, um die Anonymität seiner<br />
Begleiterin zu wahren. 1837 stirbt die »Dunkelgräfin«<br />
und wird auf dem Stadtberg oberhalb von<br />
Hildburghausen begraben.<br />
Da alle, die von der Vertauschung wussten, es<br />
tunlichst vermieden, schriftliche Spuren zu hinterlassen,<br />
bleiben für Skeptiker bis heute Fragen<br />
offen. Deshalb soll jetzt, 175 Jahre später, eine<br />
DNA-Analyse klären, ob die »Dunkelgräfin« tatsächlich<br />
die Tochter Ludwigs XVI. war. Eine Bürgerinitiative<br />
hat erreicht, dass die Hildburghausener<br />
zuvor abstimmen dürfen, ob die Leiche der Gräfin<br />
ans Licht gezerrt werden soll. Doch abgesehen von<br />
der ethischen Frage, ob neue Erkenntnisse um den<br />
Preis der Totenruhe gewonnen werden sollten, ist<br />
es auch zweifelhaft, ob dies überhaupt Klarheit<br />
bringen würde. Der Stadtberg war zwischen 1967<br />
und 1991 Sperrgebiet der sowjetischen Armee.<br />
Ältere Hildburghausener berichten, dass das Grab<br />
in dieser Zeit geöffnet worden sei – womöglich<br />
suchte man nach wertvollen Beigaben. Die Untersu<br />
chung eines bereits unkontrolliert geöffneten<br />
Gra bes kann aber kaum den Ansprüchen der Wissenschaft<br />
genügen. So wird, wie immer die Bürger<br />
entscheiden, der Schatten eines Zweifels bleiben,<br />
wer die geheimnisvolle »Dunkelgräfin« wirklich war.<br />
Die Autorin ist Historikerin und lebt in Hamburg.<br />
Mehr zum Thema in ihrem Buch »Die Dunkelgräfin.<br />
Das Geheimnis um die Tochter Marie Antoinettes«,<br />
das im April erschienen ist (Piper Verlag; <strong>39</strong>3 S., 10,99 €)<br />
Porträt der Epoche<br />
In Köln sind die faszinierenden Fotos<br />
der Lotte Jacobi zu sehen<br />
Was für eine gloriose Reihe: Marianne Breslauer, Ilse<br />
Bing, Yva, Gisèle Freund, Ger maine Krull, Aenne<br />
Biermann, Ruth Hallensleben, Frieda Riess, Suse<br />
Byk, Lucia Moholy ... und so viele Fotografinnen<br />
mehr, die als junge Frauen in der Weimarer Republik<br />
Furore und Fotogeschichte machten. Zu dieser Generation<br />
gehört auch Lotte Jacobi, Tochter einer<br />
Fotografenfamilie, 1896 in Thorn an der Weichsel<br />
geboren. Eigentlich wollte sie weg vom Gewerbe der<br />
Alten, wollte Imkerin werden und alles Mögliche<br />
andere. Aber dann erlag sie doch dem angeborenen<br />
Talent, stieg in das väterliche Unternehmen ein, das<br />
nach dem Ersten Weltkrieg nach Berlin umgezogen<br />
war – und wurde eine der Großen ihrer Zunft.<br />
Das Käthe Kollwitz Museum in Köln zeigt jetzt<br />
mehr als 100 Bilder Jacobis, in denen sich die Geschichte<br />
des 20. Jahrhunderts spiegelt. Im Mittelpunkt<br />
die Porträts aus dem Deutschland der Zwanzi<br />
ger, sowohl Auftragswerke als auch Pressefotos.<br />
Ikonen der Fotokunst sind darunter wie ihre Bildnisse<br />
von Lotte Lenya, Karl Valentin, Käthe Kollwitz,<br />
Klaus und Erika Mann oder der Tänzerin<br />
Niura Nor skaya von 1929 (unser Bild oben). Daneben<br />
stehen ihre Reportagen aus der Sow jet union<br />
der frühen drei ßiger Jahre, ihre Arbeiten aus dem<br />
amerikanischen Exil (Thomas Mann und Albert<br />
Einstein in Prince ton, 1938) und aus ihren späteren<br />
Jahren in den USA, wo sie 1990 auch gestorben ist.<br />
»Mein Stil ist der Stil der Menschen, die ich photographiere«,<br />
hieß eine ihrer Maximen – ein Bekenntnis<br />
zum Individualismus in einer brutalen Epoche,<br />
die auf den Einzelnen keine Rücksicht nahm.<br />
Käthe Kollwitz Museum, bis zum 25. November;<br />
Köln, Neumarkt 18–24; Tel. 0221/227 28 99<br />
<strong>ZEIT</strong>LÄUFTE<br />
SCHAUPLATZ: KÖLN<br />
onfession macht kitzelig. Ein böser Zank<br />
K<br />
um archaische Riten, ein zotiges Filmchen<br />
im Internet, die hämische Erinnerung an<br />
die Niederlage auf irgendeinem irischen<br />
Schlachtfeld vor 300 oder 500 oder 10 000 Jahren<br />
– schon ist der Fromme entflammt, schon rast der<br />
beleidigte Glaube, das religiöse Gefühl.<br />
Ganz anders hingegen das demokratische Staatsbürgertum!<br />
Da werden unsere Par lamen ta rier in<br />
den Untersuchungsausschüssen zum Naziterror des<br />
NSU, da wird die ganze Republik seit einem Jahr<br />
von sogenannten Verfassungsschützern, von Innenministerien,<br />
von Bundeswehrstellen und Polizeibehörden<br />
nach Strich und Faden verhöhnt und zum<br />
Narren gehalten – aber alles bleibt gleichmütig und<br />
sanft, und selbst in unseren unbestechlichen Medien<br />
flötet es nur fröhlich von »Pannen«. Da wurde<br />
»vergessen« und »verlegt«, da werden, so scheint es,<br />
mutmaßliche Mordkumpane aus den Amtsstuben<br />
heraus gedeckt, doch niemand fühlt sich beleidigt,<br />
niemand demonstriert.<br />
Wie gut, dass Demokratie nur irgendeine Staatsform<br />
ist, dass sie keine religiösen Gefühle weckt.<br />
Und dass niemand an sie glaubt. B.E.
Es wurde ein<br />
langer Weg<br />
zur Macht für<br />
Helmut Kohl.<br />
Doch am<br />
1. Oktober 1982<br />
war es so weit:<br />
Der Bundestag<br />
wählte ihn<br />
zum Kanzler<br />
VON<br />
GUNTER HOFMANN<br />
GESCHICHTE<br />
»Total unfähig«,<br />
aber<br />
am Ziel<br />
Am 1. Oktober 1982 um<br />
15.12 Uhr geht im Plenarsaal<br />
des Deutschen<br />
Bundestags in Bonn am<br />
Rhein ein Traum in Erfüllung:<br />
»Herr Präsident,<br />
ich nehme die Wahl an.«<br />
Der Abgeordnete Helmut Kohl, ehemals Ministerpräsident<br />
in Mainz, Vorsitzender der<br />
CDU seit 1973, seit 1976 auch Op po si tionsfüh<br />
rer in Bonn, ist mit 52 Jahren zum sechsten<br />
Kanzler der Bundesrepublik Deutschland<br />
gewählt, der Jüngste in diesem Amt.<br />
256 Abgeordnete von CDU/CSU und FDP<br />
votierten für Kohl, die absolute Mehrheit –<br />
aber es waren nur sieben Stimmen ȟber den<br />
Durst«. Rasch rechneten Journalisten nach,<br />
dass insgesamt 19 Freidemokraten sich geweigert<br />
haben mussten, der Frak tions spit ze so wie<br />
Hans-Dietrich Genscher und Otto Graf<br />
Lambsdorff zu folgen. Diese 19 Getreuen, von<br />
denen viele später die FDP verließen, hatten<br />
Per Misstrauensvotum<br />
wird SPD-Kanzler Helmut Schmidt gestürzt.<br />
Da die FDP bereits zuvor an die<br />
Seite der CDU gewechselt ist, steht Helmut<br />
Kohl der Weg ins Kanzleramt offen<br />
keinen Grund gesehen, den hochrespektierten<br />
und populären SPD-Regierungschef Helmut<br />
Schmidt mittels eines konstruktiven Misstrauensvotums<br />
aus dem Amt zu katapultieren.<br />
Ein Regierungswechsel in dieser Form war<br />
ein Novum. Zehn Jahre zuvor, 1972, hatte es<br />
schon einmal ein konstruktives Misstrauensvotum<br />
gegeben. Damals war CDU-Chef Rainer<br />
Barzel bei dem Versuch gescheitert, den SPD-<br />
Kanzler Willy Brandt auf dem Höhepunkt seines<br />
An sehens zu stürzen und sich an seiner Stelle<br />
in das Amt wählen zu lassen. Entsprechend<br />
lange hatte Kohl gezögert, den Machtwechsel<br />
auf diese Weise zu wagen, nie ging ihm das Deba<br />
kel von 1972 aus dem Sinn. Aber im entscheidenden<br />
Moment hatte er mehr Glück als Barzel.<br />
In der Parlamentsdebatte an jenem 1. Oktober<br />
1982 spiegelte sich wider, wie fragmentiert<br />
die Bundesrepublik war, wie in sich zerrissen die<br />
Volksparteien dastanden, vor allem die So zialdemo<br />
kra ten. Viele Genossen zogen die Rückkehr<br />
in die Op po si tion vor. Im Land brodelte<br />
es. Die Friedensbewegung mobilisierte Hunderttausende<br />
im Widerstand gegen Schmidts<br />
»Nachrüstungs«-Pläne; es waren die größten<br />
De mons tra tio nen, die Bonn je erlebt hatte.<br />
Schmidt hatte Not, den Deckel daraufzuhalten.<br />
Das Land sollte berechenbar bleiben und<br />
die Politik reserviert für die demokratischen<br />
In sti tu tio nen. Für einen Aufbruch in Neues,<br />
für die Öffnung nach unten und die Integration<br />
der Jungen, Bürgerbewegten und Grünen<br />
stand der So zial demo krat aus Hamburg nicht.<br />
Trotz der zunehmend erodierenden SPD<br />
hat te Kohl unendlich lange, zuletzt geradezu<br />
verbissen auf seine Stunde hinarbeiten müssen.<br />
Alles musste er sich erkämpfen, zum Schluss sah<br />
er sich von versteckten Gegnern umstellt, die<br />
ihn demontieren oder vorzeitig be erben wollten.<br />
Vor allem »die Medien« hielt er für verschworene<br />
Widersacher. Ihre oft polemische Häme über<br />
den tumben Hünen aus der pfälzischen Provinz<br />
traf ihn tief. Und tatsächlich klebte das Bild an<br />
ihm fest, verbreitete sich über die Landes grenzen<br />
hinaus. »Exit a great man, enter a large one«,<br />
titel te der Guar dian am Tag nach der Wahl.<br />
Ende 1969, beim ersten großen Machtwechsel<br />
der Republik, hatte sich die allgemeine<br />
Seelenlage noch ganz anders ausgenommen.<br />
Bonn vibrierte geradezu vor Neuanfangslust.<br />
Zum ersten Mal eine Regierung ohne CDU –<br />
noch in der Wahlnacht hatte Willy Brandt der<br />
bisher regierenden Großen Koa li tion unter<br />
CDU-Kanzler Kurt Georg Kiesinger eine Absage<br />
erteilt. Brandts Parteigenossen Herbert<br />
Wehner und Helmut Schmidt waren düpiert,<br />
während FDP-Chef Walter Scheel sich mit ihm<br />
verbündete, um trotz knapper Mehrheit das<br />
sozialliberale Koa li tions-Experiment zu wagen.<br />
Um die Ostpolitik ging es, und irgendwie auch<br />
um den Aufbruch in die »Moderne«.<br />
Wie anders jetzt! Das bisschen sollte ein<br />
Anfang sein? Okay, Kohl hatte es geschafft,<br />
hatte seinen alten CSU-Rivalen aus Bayern,<br />
Franz Josef Strauß, ausgesessen und abgeschüttelt,<br />
hatte Schmidt bezwungen. Die alte<br />
Koa li tion war verschlissen, die FDP ging von<br />
der Fahne. Aber was wies nach vorne? Eine<br />
»konservative Revolution« war kaum in Sicht,<br />
Strauß’ brachial autokratische Politik war außerhalb<br />
Bayerns nicht mehrheitsfähig, auch<br />
wenn er selber es immer noch<br />
nicht glauben wollte. Hans-<br />
Dietrich Genscher hatte den<br />
Wechsel betrieben – und stand<br />
dennoch eher für Kontinuität.<br />
Kohl, CDU-Parteimensch seit<br />
Jugendtagen, präsentierte sich<br />
gern als Volkes Stimme und<br />
Anwalt der kleinen Leute, als<br />
Mann der »Mitte« und »Antityp<br />
des Zeitgeistes«. Einen Wechsel bedeutete<br />
all das kaum. Denn für »Mitte« hatte<br />
schon Helmut Schmidt gestanden.<br />
Dessen Entscheidung für die nukleare<br />
»Nachrüstung« hielt das Gros der eigenen Anhänger<br />
(samt Willy Brandt, der es nicht offen<br />
aussprechen wollte) für einen versteckten Abschied<br />
von der Entspannungspolitik. Auch<br />
Schmidts Überzeugung, dass der Staat angesichts<br />
knapper Kassenlage und bei wachsender<br />
Arbeitslosigkeit nicht länger als Garant für alle<br />
Lebenseventualitäten auftreten könne, fand<br />
in der CDU gewiss mehr Zuspruch als unter<br />
den eigenen Genossen. Am So zial staat wollte<br />
Schmidt sparen, um ihn überlebensfähig zu<br />
halten, verabschieden wollte er ihn nicht. Aber<br />
das galt ganz ähnlich auch für die Christdemokraten;<br />
Kohls Leute Heiner Geißler und Norbert<br />
Blüm wachten darüber. Die Grünen hingegen,<br />
die sich allmählich als Partei formierten,<br />
wie das ganze gigantische Thema der Ökologie<br />
blieben dem Ökonomen Schmidt ebenso<br />
fremd wie seinem Nachfolger Kohl.<br />
Was diesen Abschied und Anfang vom<br />
1. Oktober 1982 dennoch mit starken Emotionen<br />
auflud, war etwas anderes: Die so zial libe rale<br />
Koa li tion galt vielen ihrer Verteidiger – nicht<br />
Schmidt – als ein politisch-kulturelles Projekt,<br />
die historischen Wurzeln verfolgten manche<br />
zurück bis zum Hambacher Fest. Diese Koa lition,<br />
von Brandt und Scheel begründet, hatte<br />
wirklich einen Neu anfang versucht, um »mehr<br />
Demokratie zu wagen«. Das Wort des Potsdamer<br />
Historikers Manfred Görtemaker von der<br />
»Umgründung« der Republik trifft es recht gut.<br />
Und das sollte nun vorbei sein und die Republik<br />
wieder in die Hände der Christdemokraten<br />
über gehen, die sich nach wie vor als die einzig<br />
wahre Staatspartei verstanden? Nicht einmal<br />
eine ostpolitische Wende hatte die CDU bisher<br />
gewagt, entsprechend der Wende hin zur Westpolitik,<br />
welche die SPD 1960 vollzogen hatte ...<br />
So war es nicht nur die geradlinige Liberale<br />
Hildegard Hamm-Brücher, die während der<br />
Parlamentsdebatte die »moralisch-sittliche Qualität<br />
des Machtwechsels« bezweifelte. Vielen<br />
erging es ähnlich – aber die Mehrheit war weg.<br />
Erbost verbat sich Kohl-Freund und CDU-General<br />
Geißler jeden Gedanken, mit dem Kanz-<br />
lersturz liege Verfassungswidriges in der Luft.<br />
»Verrat« nannte Klaus Bölling, Schmidts eloquenter<br />
Sprecher, wenig später im Spiegel das<br />
Verhalten der FDP. Schmidt selbst hatte es so<br />
scharf nicht formuliert. Altersmilde blickt er<br />
heute auf das Ende seiner Kanzlerschaft zurück:<br />
Zwar habe die FDP noch im Wahlkampf mit<br />
seinem Porträt geworben, aber schließlich sei es<br />
ja, so fügt er gern hinzu, die Leistung der Regierung<br />
Kohl ge wesen, seine Politik ohne großen<br />
Bruch fortgesetzt zu haben. Außerdem, nicht<br />
zu vergessen: Nach über acht Jahren im Kanzleramt<br />
sei man ohnehin am Ende der Kräfte.<br />
Kohl sah seinen Triumph über die »Sozen«<br />
naturgemäß ein bisschen anders. Gleich nach<br />
dem 1. Oktober blähte er ihn zur »geistig-moralischen<br />
Herausforderung« auf, eine Hyperwende<br />
versprach er, darunter tat er es nicht. Beeindrucken<br />
und ver einen sollte das vor allem die<br />
eigene Gefolgschaft, die an ihm zweifelte oder<br />
Strauß’ Linie nach wie vor überzeugender fand.<br />
Es blieb der Makel, vorerst, nicht vom Volk<br />
gewählt worden zu sein. 1976 hatte der Kandidat<br />
Kohl die Wahl verloren, trotz der 48,6<br />
Prozent, die er für die Unions par tei en geholt<br />
hatte. CDU/CSU waren daraufhin in die größte<br />
Krise ihrer Geschichte geraten. Damals hatte<br />
Kohl zunächst noch geschwankt, ob er zusätzlich<br />
zum Parteivorsitz die Frak tion übernehmen<br />
und als Op po si tions füh rer nach Bonn gehen<br />
solle. Franz Josef Strauß aber begnügte sich<br />
nicht mit solchen Quisquilien. Er dröhnte, die<br />
CDU habe im Norden mit ihrem Wischiwaschi-Kurs<br />
gegen Schmidt und vor allem gegen<br />
die »Sozialisten« die Wahlen verloren. Im<br />
No vember drohte er, die CSU werde eine eigene<br />
Frak tion bilden – obwohl Strauß wusste, dass<br />
Kohl dann mit der CDU in Bayern einmarschieren<br />
wollte. Er habe, so wütete Strauß, Kohl um<br />
des lieben Friedens willen unterstützt, aber der<br />
werde »nie Kanzler« werden: »Er ist total unfähig,<br />
ihm fehlen die charakterlichen, die geistigen<br />
und die politischen Voraussetzungen – der wird<br />
mit neunzig Jahren die Memoiren schreiben:<br />
›Ich war vierzig Jahre Kanzlerkandidat. Lehren<br />
und Erfahrungen aus einer bitteren Epoche‹.«<br />
Schmidt wie Strauß würden<br />
die FDP gern unter Wasser drücken<br />
Trotz dieser krachenden Kanonenschüsse verließ<br />
Kohl Mainz und ging nach Bonn. »Fast<br />
selbstmörderisch«, urteilt der Historiker Hans-<br />
Peter Schwarz in seiner gerade erschienenen<br />
Kohl-Biografie, sei dieser Entschluss gewesen,<br />
sich ohne große Absicherung aufs glatte Bonner<br />
Parkett zu begeben. Tatsächlich seien sechs<br />
kritische Jahre gefolgt, auch wenn die spätere<br />
Erfolgsstory das überstrahle. Wenig habe Kohl<br />
bewegen können, oft habe er vor dem »politischen<br />
Aus« gestanden. Dem ist nicht zu widersprechen.<br />
Die Leidens- und Schüttelstrecke war<br />
noch nicht zu Ende: Bei der folgenden Wahl,<br />
1980, musste der Pfälzer tatsächlich Strauß den<br />
Vortritt als Kanzlerkandidat lassen.<br />
Zur stillen Freude von Schmidt und Brandt.<br />
Denn beide wussten: Wenn Kohl wieder angetreten<br />
wäre, dann hätte er es geschafft. Dem<br />
völlig unberechenbaren Strauß aber zogen<br />
selbst viele Unions wäh ler Schmidt vor. Dabei<br />
hatten Schmidt und Strauß durchaus einiges<br />
gemein. So hätten sie zum Beispiel lie ber mitein<br />
an der als mit den Liberalen regiert.<br />
Kohl hingegen hatte immer auf die FDP<br />
als Partner geschworen. Entsprechend hielt er<br />
auch nichts von einer Wahl rechts ände rung,<br />
um die FDP unter Wasser zu drücken. Strauß<br />
wie Schmidt plädierten dafür, sie waren für<br />
klare Mehrheiten.<br />
Nach Strauß’ Niederlage begann Teil zwei<br />
der Geduldsprobe. In der FDP hatte Kohl gute<br />
Karten. In den Unions par tei en hingegen flackerte<br />
erneut die Dis kus sion auf. Jetzt unterstützte<br />
zwar Strauß die Kandidatur des »total<br />
Unfähigen«, dafür aber hegten nun Schleswig-<br />
Holsteins Ministerpräsident Gerhard Stoltenberg<br />
und sein niedersächsischer Kollege Ernst<br />
Albrecht Zweifel an Kohls Eignung. Der Pfälzer<br />
argwöhnte, was er stets argwöhnte: Sie wollten<br />
ihm die Kandidatur streitig machen und da mit<br />
das Amt, das er seit jungen Jahren anstrebte.<br />
Im Herbst 1981 verfasste Außenminister<br />
Genscher seinen berühmten »Wende-Brief«,<br />
der klarmachen sollte, dass von den Gemeinsamkeiten<br />
zwischen SPD und FDP nichts geblieben<br />
war. Eine heiße Debatte folgte – zunächst<br />
weiter nichts. Vieldeutig prophezeite<br />
Genscher dann im Frühjahr 1982, das Schicksal<br />
der Koa li tion hänge davon ab, ob sie sich auf<br />
die notwendigen Einsparungen im Etat 1983<br />
verständige und ob die CDU im Herbst die<br />
Landtagswahl in Hessen gewinne, denn damit<br />
winkte ihr eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat.<br />
Zugleich beteuerte er gegenüber dem<br />
<strong>ZEIT</strong>-Korrespondenten Rolf Zundel: »Glauben<br />
Sie mir, wir wollen den Erfolg dieser Koa li tion.«<br />
Das Ende war in Sicht. Dass Schmidt der<br />
Verlierer sein würde, zeichnete sich ab. Aber wie<br />
er dennoch das Heft in der Hand behielt, das<br />
machte ihm so leicht keiner nach. Auf 120<br />
Seiten formulierte er eine Gardinenpredigt an<br />
seine Partei, die glaube, zwei Jahrzehnte der Oppo<br />
si tion täten ihr gut, tatsächlich aber nur den<br />
»Kutschbock« für die Herren Strauß oder Kohl<br />
oder Albrecht oder Dregger frei mache. Zugleich<br />
entschloss er sich, der FDP, die ihre Karten<br />
partout nicht aufdecken wollte, den Kampf anzusagen.<br />
Seit Mai 1982 trafen sich die SPD-<br />
Minister vor den Kabinettssitzungen gesondert,<br />
so wie das die FDP schon immer pflegte. Solange<br />
er an der Regierung beteiligt sei, »so lange<br />
wird das Prinzip des sozialen Netzes, das Prinzip<br />
des Sozialstaats nicht gefährdet werden«, blaffte<br />
Schmidt Wirtschaftsminister Lambsdorff entgegen.<br />
»Über die Richtlinien bestimme ich!«<br />
Der Aussprache mit Genscher, zu der sich<br />
die beiden im Sommer in Hamburg trafen, gab<br />
ein verärgerter Schmidt hinterher schlicht die<br />
Note »Fototermin«. Sogar das 34-seitige Lambsdorff-Papier,<br />
das bald als »Scheidepapier« bezeichnet<br />
wurde, ging auf seine Initiative zurück:<br />
Ausdrücklich sollte der Minister seine Vorstellungen<br />
schriftlich fixieren, damit man sich<br />
damit rational auseinandersetzen könne.<br />
In der Union wurde inzwischen ein konstruktives<br />
Misstrauen erwogen – wäre da nicht<br />
das Drama von 1972 gewesen, Barzel versus<br />
Brandt. Zudem ging selbst Strauß die Lambsdorffsche<br />
Sparattacke auf den So zial staat entschieden<br />
zu weit, das sei »brutale Medizin«.<br />
Schmidt machte den nächsten Schachzug,<br />
nicht Kohl: Am 8. September sprach er von 21<br />
bis 22 Uhr in seinem Büro mit Genscher. Der<br />
Kanzler erklärte seinem Vize, er werde Kohl auffordern,<br />
ein konstruktives Misstrauensvotum<br />
zu wagen. Er selber werde dann Neuwahlen verlangen.<br />
Am Morgen darauf rief er der FDP im<br />
Plenum zu, Reisende solle man nicht aufhalten.<br />
In dieser Kampfeslogik entschloss er sich eine<br />
gute Woche später, die FDP-Minister zu entlassen.<br />
Als sie davon Wind bekamen, kündigten<br />
sie von sich aus den Auszug aus der Regierung<br />
an. Kohl: Man dürfe Genscher nicht hängen<br />
lassen. Wenn die Freidemokraten ihn, Kohl,<br />
jetzt zum Kanzler wählen wollten, solle es so<br />
sein. Eine Bedingung jedoch seien Neuwahlen<br />
– allerdings nicht sofort, erst im Frühjahr.<br />
Zu Schmidt war Genscher nicht offen. Aber<br />
auch zwischen Genscher und Kohl gab es offiziell<br />
kein klärendes Gespräch. Die Duzfreunde<br />
aus den Zeiten des ZDF-Verwaltungsrates tuschelten<br />
trotz aller Vertrautheit nicht konspira-<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 18<br />
Nach seiner Wahl nimmt Helmut Kohl auf der Regierungsbank im Bonner Plenarsaal Platz<br />
tiv mit ein an der – weniger aus Rücksicht auf<br />
Schmidt denn in Sorge vor dem Zorn des<br />
Herrn, vor Strauß. Wenn er Beweise frei Haus<br />
erhalten hätte, Kohl wolle ihn ausbooten, sichere<br />
Genscher das Au ßen ministerium zu,<br />
Stoltenberg die Finanzen und dem CSU-Kämpen<br />
Friedrich Zimmermann das Innenressort<br />
– wer weiß, welchen Torpedo der Mann aus<br />
München dann auf Kohl abgefeuert hätte.<br />
»Ich traue es mir zu«, gestand der frisch<br />
Gewählte am 1. Oktober 1982 in aller Bescheidenheit<br />
dem Reporter der Süddeutschen Zeitung,<br />
Hans Ulrich Kempski. Optimistisch sei er, mit<br />
»Freude« sehe er der Arbeit entgegen. Was Kohl<br />
nicht sagte, aber in diesem Moment schon wusste:<br />
Strauß blieb nichts anderes übrig, als sich<br />
endgültig mit seinem Bayern zu bescheiden.<br />
Als Schmidt Ende Oktober erklärte, in den<br />
für März 1983 anvisierten Wahlen nicht mehr<br />
antreten zu wollen, dürfte Kohl und Genscher<br />
eine Zentnerlast von den Schultern gefallen<br />
sein. Ohne Schmidt hatten die So zial demokra<br />
ten keinerlei Chance mehr, den Machtwechsel<br />
noch einmal rückgängig zu machen.<br />
Als Kohl bei der Nachrüstung zögert,<br />
intervenieren die Amerikaner<br />
Auch die »Hamburger Medien«, die Kohl für<br />
blind und voreingenommen hielt, waren gar<br />
so realitätsfern nicht und begriffen bald, dass<br />
der Wechsel keinen grundlegenden Wandel<br />
befürchten ließ. Kohl achte durchaus auf Kontinuität,<br />
erkannte <strong>ZEIT</strong>-Chefredakteur Theo<br />
Sommer an, und seinem Leit arti kel in der<br />
Silvesterausgabe 1983 gab er, in Anspielung<br />
auf den gerade erschienenen Bestseller-Roman<br />
von Sten Nadolny, die Überschrift Die Entdeckung<br />
der Langsamkeit. Motto: Es werde<br />
lange brauchen bis zur nächsten Zäsur, und<br />
auch Kohl werde die Republik schon nicht auf<br />
den Kopf stellen.<br />
Wohl wahr. So wäre es dem neuen Kanzler<br />
zum Beispiel am liebsten gewesen, die Atomrake<br />
ten würden nicht stationiert. Insgeheim<br />
suchte er Auswege. Eine halbe Million Protestierende<br />
auf der Bonner Hofgartenwiese hatten<br />
auch ihn beeindruckt. In Washington reagierte<br />
die Regierung Reagan alarmiert und schickte<br />
Kohl-Berater Horst Teltschik das Großkaliber<br />
Arthur Burns auf den Hals, um den Neuen in<br />
Bonn die Meinung zu geigen. Und die kuschten.<br />
Dass der Machtwechsel vom 1. Oktober<br />
1982 16 Jahre Kohl bedeuten würde – damit<br />
rechnete damals niemand, am wenigsten die<br />
CDU selbst. Am Vor abend fehlten beim »Zählappell«<br />
in der Frak tion 27 Abgeordnete, sogar<br />
am Morgen noch trat sie nicht vollständig an.<br />
Man empfand es irgendwie nicht als historisches<br />
Datum, was da auf der Tagesordnung stand.<br />
Wirklich, nichts war normal.<br />
Für Helmut Schmidt stand der Ausgang der<br />
Abstimmung fest, Kohl war sich da nicht so<br />
sicher. Die Ȁra Kohl begann als Zitterpartie,<br />
und als Zitterpartie geht sie weiter«, konstatiert<br />
Hans-Peter Schwarz lakonisch.<br />
Bloß: Die Schlappe einst, bei der Abstimmung<br />
1972, hatte für Barzel das Aus bedeutet<br />
– »komm, Puppe, wir gehen über die Steine«,<br />
soll er nach der Trauersitzung des Parteipräsidiums<br />
seiner Frau zugeraunt haben. Ob Stehauf<br />
riese Kohl die gleiche Nie der lage am 1. Oktober<br />
verwunden hätte? Vermutlich schon.<br />
Keiner hatte mehr Nehmerqualitäten bewiesen<br />
als er, keiner war zäher, war so bereit, sich immer<br />
in eine neue Mitte zu bewegen. Nur war<br />
ihm auf dem Weg an die Spitze der rote Faden,<br />
die ursprüngliche konservative Agenda abhandengekommen.<br />
Man wusste, dass er es irgendwann<br />
schaffen würde, aber schon an jenem<br />
1. Oktober wusste man nicht mehr, wozu.<br />
Fotos: Peter Strack/bpk (o.); J.H. Darchinger/darchinger.com (Ausschnitt)
WIRTSCHAFT Autos:<br />
Illustration: Frederik Jurk/sepia-online.com für <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong><br />
Die Peer-Steinbrück-Festspiele<br />
beginnen am kommenden<br />
Dienstagnachmittag um 15<br />
Uhr an einem geschichtsträchtigen<br />
Ort: im Sitzungssaal der<br />
SPD-Bundestagsfraktion. Hier kämpfte Gerhard<br />
Schröder für seine Sozialreformen, setzte<br />
er den ersten Kriegseinsatz der Bundeswehr<br />
durch. Mit einem knapp 20-seitigen Papier in<br />
der Hand wird Steinbrück vor die 146 Abgeordneten<br />
treten und erläutern, wie die deutsche<br />
Sozialdemokratie die internationalen Finanzmärkte<br />
regulieren will. Am Tag danach präsentiert<br />
der Ex-Finanzminister sein Konzept dann<br />
der Öffentlichkeit. Allein. So steht es im Drehbuch.<br />
Ohne den Fraktionsvorsitzenden Frank-<br />
Walter Steinmeier. Ohne Parteichef Sigmar<br />
Gabriel. Ohne die Last der Troika.<br />
Die Banken an die Kette legen – das ist jetzt<br />
Steinbrücks Thema. Es soll die Genossen mobilisieren<br />
und die Partei, die einfach kein Rezept<br />
gegen die populäre Kanzlerin findet, auf<br />
Augenhöhe mit der CDU heben. Denn im<br />
fünften Jahr der Krise ist unter den Deutschen<br />
das Gefühl verbreitet, dass die Banken ungestört<br />
weiterzocken und die Steuerzahler die<br />
Rechnung präsentiert bekommen. Dass die<br />
Banker bestimmen – und die Politik kuscht.<br />
Dass sich nichts geändert hat.<br />
Die kommende Woche wird darüber entscheiden,<br />
wie die Sozialdemokraten ins Wahljahr<br />
2013 marschieren: mit neuer Zuversicht<br />
oder dem Schicksal ergeben. Sie könnte den<br />
Ausschlag geben, wer gegen Angela Merkel antritt.<br />
Und sie markiert den Startpunkt für einen<br />
Angriff auf die Deutsche Bank.<br />
In diesen Tagen ist das Schicksal des größten<br />
deutschen Kreditinstituts mit dem der ältesten<br />
deutschen Partei aufs Engste verwoben. Die So-<br />
zialdemokraten wollen mit ihrer Attacke auf die<br />
internationalen Finanzmärkte die Sehnsucht nach<br />
Gerechtigkeit stillen. Die Deutsche Bank ist das<br />
einzig verbliebene deutsche Kreditinstitut von<br />
Weltrang. Damit ist jeder Angriff auf die Finanz-<br />
märkte ist ein Angriff auf den letzten Global<br />
Player unter Deutschlands Banken.<br />
Das Unbehagen reicht bis in die<br />
Spitzen der deutschen Wirtschaft<br />
Will man die Geschichte dieses Angriffs erzählen,<br />
kann man beim Zusammenbruch der Investmentbank<br />
Lehman Brothers im Jahr 2008<br />
beginnen. Oder bei der großen Deregulierung<br />
der achtziger Jahre, als die Regierungen, beseelt<br />
vom Glauben an die segensreiche Wirkung der<br />
internationalen Finanzmärkte, eine Bankenvorschrift<br />
nach der anderen lockerten.<br />
Man kann aber auch die Akademie der Küns-<br />
te am Brandenburger Tor besuchen.<br />
Sein Name steht auf einem Buchcover zwischen<br />
Christa Wolfs Stadt der Engel und Cees<br />
Notebooms Schiffstagebuch in dem kleinen Li-<br />
teraturladen gleich am Eingang. Er selbst sitzt im<br />
Restaurant. Strubbelige Locken, Nickelbrille, aus-<br />
gebleichtes Poloshirt, Jeans, Sandalen. Ingo<br />
Schulze, der Schriftsteller (Adam und Evelyn), ist<br />
der Mann, der die Wut der Bürger in ein Buch<br />
gegossen hat: Unsere schönen neuen Kleider –<br />
Gegen die marktkonforme ktkonforme Demokratie. Demokratie.<br />
Es basiert auf auf 13 »Thesen »Thesen gegen gegen<br />
die Ausplünderung erung der der GesellGesellschaft«, die Schulze hulze zu zu JahresbeJahresbe- ginn in der Süddeutschen ddeutschen Zeitung Zeitung<br />
veröffentlicht hat. hat. »Auf »Auf nichts, nichts,<br />
was ich je geschrieben hrieben habe, habe, bebe- kam ich so viele le Reaktionen Reaktionen wie wie<br />
auf diesen Artikel«, Artikel«, erzählt erzählt<br />
Schulze. Der Schriftsteller Schriftsteller ist ein ein<br />
Seismograf des es Unmuts. Unmuts. »Wenn »Wenn die die<br />
Volksvertreter meinen, meinen, das das Vertrauen Vertrauen der der<br />
Märkte wiedergewinnen rgewinnen zu müssen, müssen, dann dann stellen stellen<br />
sie die demokratische ratische Welt Welt auf auf den den Kopf, Kopf, dann dann<br />
unterwerfen sie ie das das Gemeinwesen Gemeinwesen nicht nicht nur nur gegenau jenen, die e es es um um Milliarden Milliarden geprellt geprellt haben, haben,<br />
sondern geben auch das Primat der d Politik l k preis.«<br />
Es ist etwas durcheinandergeraten in der<br />
Gesellschaft, so sieht es Schulze, und so sehen es<br />
die Deutschen mehrheitlich. Das Unbehagen<br />
reicht bis in die Spitzen der Wirtschaft. Die Ban-<br />
ken »zerstören all unsere materiellen Grund-<br />
lagen«, sagt Klaus Engel, Vorstandschef des Che-<br />
mieriesen Evonik. Und Nikolaus von Bomhard,<br />
Chef der Münchener Rück, fordert »fundamen-<br />
tale Änderungen am Finanzmarkt«.<br />
Dabei ist einiges passiert, seit die Staats- und<br />
Regierungschefs der G 20 vor drei Jahren auf<br />
ihrem Gipfeltreffen in Pittsburgh beschlossen<br />
haben, die Finanzmärkte in die Schranken zu<br />
weisen. Die Banken müssen heute mehr eigene<br />
Geldmittel vorhalten, um bei Verlusten nicht<br />
gleich auf Unterstützung der Steuerzahler angewiesen<br />
zu sein. Die Aufsichtsbehörden kontrollieren<br />
strenger als früher. Die Bonuszahlungen<br />
sind gesunken. In Deutschland wurden die gesetzlichen<br />
Voraussetzungen geschaffen, um ma-<br />
rode Institute abzuwickeln. Sogar aus dem linken<br />
Lager gibt es dafür Applaus: Nach einer Studie<br />
Angriff auf die<br />
Deutsche Bank<br />
Die SPD marschiert vorweg, und die Kanzlerin<br />
folgt – dem Branchenprimus droht die Aufspaltung<br />
VON PETER DAUSEND UND MARK SCHIERITZ<br />
Hyundai und Kia –<br />
die Herausforderer aus<br />
Korea trumpfen auf S. 22<br />
der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung<br />
wurde »sowohl in den USA wie auch in der EU<br />
ein Großteil der 2009 im Rahmen der G 20 ge-<br />
machten Versprechungen tatsächlich umgesetzt«.<br />
Doch noch immer beläuft sich der Gesamtwert<br />
der im Umlauf befindlichen Derivate auf<br />
mehr als das Zehnfache der weltweiten Wirtschaftsleistung<br />
– vor gut zehn Jahren war es nur<br />
das Dreifache. Noch immer verdienen Spitzenkräfte<br />
im Finanzgewerbe erheblich mehr als in<br />
anderen Branchen – mit dem Ergebnis, dass es<br />
die klügsten Köpfe an die Wall Street zieht, wo<br />
sie über Finanzalgorithmen brüten, die wenige<br />
reich und viele arm machen.<br />
Und noch immer sind viele Banken so groß,<br />
dass niemand eine Pleite riskieren will, weil dies<br />
die gesamte Volkswirtschaft mit in den Abgrund<br />
reißen könnte. Das Financial Stability Board, die<br />
oberste globale Regulierungsstelle, hat weltweit<br />
29 systemrelevante Häuser identifiziert, darunter<br />
die Deutsche Bank. Ein Platz auf der Liste ist<br />
bares Geld wert. Denn weil klar ist, dass der Staat<br />
im Zweifel einspringt, kommen die Großbanken<br />
günstig an Kredite. Der Internationale Wäh-<br />
rungsfonds beziffert den Finanzierungsvorteil auf<br />
0,8 Prozentpunkte – die Deutsche Bank erspart<br />
sich so Schätzungen zufolge eine bis zwei Milliarden<br />
Euro pro Jahr. Das Ziel, »nie wieder in<br />
Geiselhaft durch den Finanzsektor genommen<br />
zu werden«, sei nicht erreicht worden, schreibt<br />
der Sachverständigenrat zur Begutachtung der<br />
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.<br />
Sigmar Gabriel hat als einer der Ersten die<br />
politische Brisanz dieser Entwicklung erkannt.<br />
Im Juli dieses Jahres berichteten die Zeitungen,<br />
dass bis zu 14 internationale Großbanken, darun-<br />
ter die Deutsche Bank, den Zinssatz Libor mani-<br />
puliert hätten. Zur selben Zeit empörten sich<br />
Bankkunden über die Rekordzinsen auf Dispokredite,<br />
während die Kreditinstitute sich bei der<br />
Zentralbank fast umsonst Geld leihen konnten.<br />
Und dann beschloss der Bundestag auch noch,<br />
dass mit deutschen Steuergeldern spanische Ban-<br />
ken gerettet werden sollen.<br />
Manipulation, Abzocke und Steuersubventio-<br />
nen verdichten sich zur Dreifaltigkeit des Ban-<br />
ken unwe sens. Die Zeit war gekommen, die Wut<br />
herauszuschreien. Das war schon immer Gabriels<br />
Stärke. Der SPD-Chef veröffentlicht am 21. Juli<br />
ein Thesenpapier zur Regulierung der Finanz-<br />
märkte. Die Banken, so schreibt er, »erpressen die<br />
Staaten«, »diktieren die Politik«, »zahlen unan-<br />
ständige Gehälter« und »zocken ihre Kunden ab«.<br />
Die SPD setzt auf die<br />
Fachkenntnisse der Bundesbank<br />
Steinbrück liefert nun die Details nach. Intensiv<br />
wurde an seinem Konzept gearbeitet. Gleich zwei<br />
Gremien Gremien waren waren damit da befasst. Eine der Arbeits-<br />
gruppen, grup rund 25 Mann stark,<br />
wwurde<br />
vom SPD-Vorstand<br />
eeingesetzt,<br />
tagt in Frankfurt<br />
und wird vom hessischen<br />
Parteichef Thorsten Schäfer-<br />
Gümbel geleitet. Ihr gehören<br />
hochrangige Banker und<br />
Wissenschaftler W<br />
an – darunter<br />
der de ehemalige Bundesbankvor-<br />
stand sta Hans-Helmut Kotz und<br />
sein sein Nac Nachfolger Joachim Nagel.<br />
Die Die zweite, zweite, entscheidende Runde ist bei<br />
Steinbrück Steinbrück ang angesiedelt, der ebenfalls auf die<br />
Kompetenz K<br />
eines Bundesbankers vertraut:<br />
Sein engster Berater ist Rainer Stollhoff, der als<br />
Bankenaufseher für die Währungsbehörde gearbeitet<br />
hat. Steinbrück selbst hat sich mit in-<br />
ternationalen Finanzgrößen wie dem ehemaligen<br />
amerikanischen Notenbankchef Paul Volcker und<br />
Mitgliedern der britischen Vickers-Kommission<br />
getroffen, die die Pläne zur Reform der Banken<br />
im Vereinigten Königreich ausgearbeitet hat.<br />
Steinbrücks Vorschläge sollen die Lücken in<br />
der Finanzregulierung schließen – und den Mega-<br />
banken ihr Drohpotenzial nehmen. Er fordert<br />
einen von den Kredithäusern finanzierten europäischen<br />
Abwicklungsfonds, der es ermöglicht,<br />
auch große Banken kontrolliert zu schließen,<br />
wenn sie in Schieflage geraten. Vor allem aber<br />
sollen die Banken gezwungen werden, Kreditgeschäft<br />
und Handelsaktivitäten zu trennen.<br />
Wenn sich die Händler verzocken, so die Hoff-<br />
nung, muss der Staat nicht eingreifen, weil Spar-<br />
einlagen und Kreditversorgung abgeschirmt sind.<br />
Steinbrück schwebt dabei keine Zerschlagung<br />
vor, sondern eine organisatorische Spaltung:<br />
Die Banken müssten unterschiedliche<br />
Tochtergesellschaften unter einem gemeinsamen<br />
Dach gründen. Das hat den Vorteil, dass<br />
sie ihren Kunden trotzdem noch alle Dienstleistungen<br />
aus einer Hand anbieten können.<br />
Gerade große Unternehmen wollen nicht nur<br />
Kredite, sondern auch komplexe Finanzprodukte<br />
wie Währungsabsicherungen, die in den<br />
Fortsetzung auf S. 20<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 19<br />
GERECHTIGKEIT<br />
Dumm macht arm<br />
Wer das soziale Gefälle verkleinern<br />
will, muss in Bildung investieren<br />
Deutschland wird ungerechter. An diesem<br />
Urteil führt nach den neuesten Zahlen des<br />
Armutsberichtes der Bundesregierung kein<br />
Weg vorbei. Denn der Bericht dokumentiert:<br />
Die Reichen werden auch in der Krise<br />
reicher, die Armen ärmer. Bei den einen<br />
wächst das private Vermögen. Die anderen<br />
können mitunter sogar durch einen Vollzeitjob<br />
ihre Familie nicht mehr ohne staatliche<br />
Hilfe ernähren. Kurz: Deutschland verteilt<br />
um, und zwar von unten nach oben.<br />
Das ist politischer Sprengstoff. Zumal in<br />
diesem Land ja sowieso das Gefühl zunimmt,<br />
für die Finanzkrise bluteten immer<br />
die Falschen.<br />
Trotzdem würde man es sich mit der<br />
puren Wiederbelebung klassischer Umverteilungspolitik<br />
zu leicht machen. Höhere<br />
Einkommens- und Erbschaftsteuern für<br />
die Wohlhabenden, endlich eine Transaktionssteuer<br />
gegen die Spekulation oder<br />
Mindestlöhne zur Unterstützung von Geringverdienern<br />
wären ja nicht falsch. Aber<br />
sie änderten nichts an einer entscheidenden<br />
Ursache des Problems: der mangelnden<br />
Bildung der Armen.<br />
Der Bericht der Bundesregierung wie<br />
auch eine Reihe anderer Studien belegen:<br />
Ob jemand arm bleibt oder reich wird,<br />
liegt ganz entscheidend an seiner Ausbildung.<br />
Wer sich bildet, dem geht es in diesem<br />
Land ganz gut. Wer aber als Kind<br />
nichts gelernt hat, der holt das später nur<br />
schwer auf und bleibt arm bis ins Rentenalter.<br />
Die Ungelernten mit den einfachen<br />
Jobs leiden unter der globalen Konkurrenz,<br />
ihre Löhne stagnieren. Dieses Schicksal<br />
trifft überproportional oft Migranten<br />
und Schulabbrecher, aber auch Mütter, die<br />
lange nicht gearbeitet haben.<br />
Wer das ändern will, wer Chancen gerechter<br />
verteilen und mehr Menschen in<br />
diesem Land ein gutes Leben ermöglichen<br />
will, der muss in Ausbildung investieren,<br />
und zwar großzügig. Er muss Geld in die<br />
Kitas stecken, die Sprachausbildung für<br />
Migrantenkinder ausbauen, die Weiterbildung<br />
im Job erleichtern, den Wiedereinstieg<br />
der Mütter fördern.<br />
Ein bisschen von alledem geschieht schon.<br />
Und man kann sogar die ersten, zarten Erfolge<br />
dokumentieren: Die Zahl der Schulabbrecher<br />
sinkt, Migranten mittleren Alters sind<br />
gebildeter als ihre Eltern, und die Beschäftigung<br />
liegt auf einem Höchststand. Das alles<br />
reicht bei Weitem nicht, zumal das augenblickliche<br />
Jobwunder auch viel mit der deutschen<br />
Sonderkonjunktur zu tun hat. Doch noch<br />
etwas anderes stimmt vorsichtig optimistisch:<br />
Die Kanzlerin redet heute oft und gern über<br />
Bildungsfragen, die Sozialdemokraten haben<br />
das Thema für ihren Wahlkampf entdeckt.<br />
Auf einem Kongress ließen sie am vergangenen<br />
Wochenende über Gerechtigkeit zunächst<br />
Bildungsexperten reden. Und das ist gut: Einen<br />
interessanten politischen Streit über den<br />
besten Weg in die Bildungsrepublik, den<br />
brauchen wir jetzt. PETRA PINZLER<br />
60 SEKUNDEN FÜR<br />
Komasaufen<br />
Da hat die Bundeszentrale für gesundheitliche<br />
Aufklärung aber ein fettes Ding gedreht: Die<br />
Anzahl der Jugendlichen, die sich ins Koma<br />
saufen, ist um rund fünf Prozent gesunken.<br />
Verantwortlich dafür soll die fetzige Kampagne<br />
»Alkohol? Kenn dein Limit« sein, die<br />
zum dreijährigen Jubiläum mit neuen Motiven<br />
aufwartet, jetzt in noch anbiedernderer Pseudojugendsprache<br />
(»anflirten oder abstürzen«<br />
– Echt jetzt?). Allerdings, so zeigt die Studie,<br />
trinken bloß Mädchen und ganz Junge weniger,<br />
männliche Teenager saufen weiter.<br />
Tatsächlich weiß jeder, der ab und zu das<br />
Haus respektive Amt verlässt, dass die wirklich<br />
coolen und schönen Mädchen keinen Tropfen<br />
anrühren, immer cooler, immer schöner werden<br />
und mit zunehmender Verachtung auf<br />
den gemeinen Komasäufer blicken.<br />
Und hier zeigt sich das viel größere Problem:<br />
das Auseinanderdriften der Geschlechter.<br />
Wer soll denn noch Kinder kriegen in<br />
diesem Land, wenn nicht mal mehr die Jungen<br />
zueinanderfinden?<br />
Die Ämter, wenn sie uns schon ins Leben<br />
regieren, wären gut beraten, Jungen zu anderen<br />
Hobbys zu zwingen. Risikosportarten ziehen<br />
gut bei Mädels. Auf Partys könnten die Jungs<br />
von ihren wilden Erlebnissen erzählen, den<br />
Kriegen des modernen Menschen. Und den<br />
dann überflüssig gewordenen Alkohol über die<br />
aufgeschürften Knie schütten. ANNE KUNZE
20 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> WIRTSCHAFT<br />
MACHER UND MÄRKTE<br />
Kik: Erklärungsnot<br />
Es war nur eine Frage der Zeit, schließlich<br />
kam es heraus: Das Unternehmen Ali Enterprises<br />
in Pakistan, bei dessen Brand vergangene<br />
Woche fast 260 Menschen starben,<br />
hat Jeans für den deutschen Textildiscounter<br />
KiK produziert. Das enthüllte am<br />
Dienstag dieser Woche die Kampagne für<br />
Saubere Kleidung, eine Organisation, die<br />
sich um Arbeitsbedingungen bei den Zulieferbetrieben<br />
deutscher Unternehmen kümmert.<br />
Während das Feuer wütete, sollen<br />
Notausgänge verschlossen und Fenster vergittert<br />
gewesen sein. Die Eigentümer der<br />
Fabrik, so heißt es, seien<br />
inzwischen des Mordes<br />
angeklagt.<br />
Das alles wirft kein<br />
gutes Licht auf den deutschen<br />
Billiganbieter, der<br />
zur Tengelmann-Gruppe<br />
gehört und sich seit<br />
geraumer Zeit bemüht,<br />
Tengelmann-Chef sein Image zu verbessern.<br />
Karl-Erivan W. »Wir sind zutiefst betrof-<br />
Haub<br />
fen über dieses schreckliche<br />
Unglück«, lässt eine<br />
Unternehmenssprecherin auf Anfrage wissen.<br />
Im August hatte sich KiK noch mit Vertretern<br />
der Kampagne für Saubere Kleidung zu einem<br />
Erfahrungsaustausch getroffen. Dabei ging es<br />
um Zulieferer in Bangladesch. Der Fall Pakistan<br />
ist noch ungeklärt. Laut KiK gab es Prüfungen<br />
des Lieferanten durch externe Kontrolleure.<br />
Umso mehr stellt sich die Frage, wie<br />
es zu der Katastrophe kommen konnte. Jetzt<br />
wartet KiK auf einen Untersuchungsbericht<br />
der pakistanischen Regierung. LÜT<br />
Sparsame Laster<br />
Lastkraftwagen gehen schon heute – im<br />
Vergleich zu Pkw – relativ effizient mit<br />
Treibstoff um. Und es könnte noch deutlich<br />
15<br />
besser werden, sagt<br />
Bernd Bohr, Chef<br />
der Kfz-Technik bei<br />
Bosch: Um weitere<br />
15 Prozent wolle<br />
man den Kraftstoffverbrauch<br />
bei Lastwagen<br />
bis 2020<br />
senken. Unter an-<br />
Prozent weniger Sprit derem ist beim<br />
sollen Lkw künftig weltgrößten Auto-<br />
verbrauchen<br />
mobilzuliefererbereits ein Hybridantrieb,<br />
die Kombination aus Diesel- und<br />
Elektromotor, in der Entwicklung. Mitte<br />
des Jahrzehnts soll er verfügbar sein. DHL<br />
Fotos: action press (l.); Thomas Schmidtke/WAZ FotoPool<br />
»Es gibt immer Schwachstellen«<br />
Der Computer-Sicherheitsexperte Norbert Pohlmann warnt: Der naive Einsatz von Smartphones gefährdet deutsche Unternehmen<br />
<strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>: Das Bundeskriminalamt meldet in<br />
dieser Woche, dass Daten auf Smartphones immer<br />
mehr ins Visier von Hackern und Kriminellen<br />
geraten – wie groß ist diese Gefahr für deutsche<br />
Unternehmen?<br />
Norbert Pohlmann: Sehr groß. Mehr als 90 Prozent<br />
der Mitarbeiter bringen heute ihr privates<br />
Mobiltelefon oder ihren Tablet-Computer mit<br />
ins Unternehmen und setzen sie auch für ihre Arbeit<br />
ein. Das ist problematisch, denn dadurch gelangen<br />
vertrauliche oder datenschutzrelevante<br />
E-Mails und Unterlagen auf Geräte, die in der<br />
Regel schlecht gesichert sind.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Firmen könnten das verbieten.<br />
Pohlmann: Das ist kaum bei den Mitarbeitern<br />
durchsetzbar. Die Vorteile sind ja enorm. Denken<br />
Sie allein an die einfache Art und Weise,<br />
überall E-Mails zu lesen, im Internet zu surfen<br />
und Musik zu hören.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Welche Erkenntnisse gibt es, dass wirklich<br />
Daten abhanden kommen?<br />
Pohlmann: Das ist ein sehr großes und vor allem<br />
ein rasch wachsendes Problem. Handys werden<br />
von Taschendieben gestohlen, am Flughafen liegen<br />
gelassen, im Sportstudio vergessen und so<br />
weiter. Es gibt eine Statistik, derzufolge allein in<br />
Londoner Taxis jährlich mehr als 60 000 Smartphones<br />
liegen blieben. Dieben gelingt es in aller<br />
Regel, auf die Daten gestohlener Smartphones<br />
zuzugreifen, wenn sie es wollen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Aber so genau weiß man es nicht ...<br />
Pohlmann: Unternehmen und Mitarbeiter zeigen<br />
Fälle von Daten- beziehungsweise Smartphone-Diebstahl<br />
ja meistens nicht an. Wenn mir<br />
jemand ein privates Handy klaut, dann werde ich<br />
sicher nicht zu meinem Chef gehen und sagen:<br />
Tut mir leid, da waren berufliche, vertrauliche<br />
E-Mails drauf, es gibt ein Datenschutzproblem!<br />
<strong>ZEIT</strong>: Warum werden die Geräte nicht von vorneherein<br />
sicherer ausgeliefert – zum Beispiel mit<br />
einer Passwort-Sperre, die Daten verlässlich<br />
schützt, wenn ein Smartphone geklaut wird?<br />
Pohlmann: Weil die Geräte zuallererst für private<br />
Konsumenten entwickelt werden. Da geht man<br />
immer vom dümmsten anzunehmenden Benutzer<br />
aus. Alles ist so eingerichtet, dass es erst mal<br />
funktioniert – und wenn Sie mehr Sicherheit<br />
haben wollen, müssen Sie die Einstellungen entsprechend<br />
ändern. Das ist leider so, als würde<br />
mir jemand ein Auto verkaufen und sagen: Pohlmann,<br />
du kannst sofort losfahren, aber wenn du<br />
mal Zeit hast, schraub dir den Airbag rein und<br />
einen Sicherheitsgurt.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Warum geben Unternehmen nicht einfach<br />
Smartphones an ihre Mitarbeiter aus, die entsprechend<br />
gesichert sind?<br />
Pohlmann: Oft ist das gar nicht so leicht. Manche<br />
Smartphone-Anbieter wollen gar nicht den<br />
Norbert Pohlmann ist<br />
Informatikprofessor und<br />
leitet das Institut für In-<br />
ternet-Sicherheit an der<br />
Westfälischen Hoch- Hoch-<br />
schule in Gelsenkirchen<br />
relativ kleinen Markt für Geschäftskunden bedienen,<br />
entsprechende Sicherheitsdienstleistungen<br />
anbieten und eine Haftung übernehmen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Der Anbieter Blackberry tut es aber ...<br />
Pohlmann: Schon, aber kürzlich saß zum Beispiel<br />
der Geschäftsführer eines wichtigen Telekommunikationsanbieters<br />
vor mir und sagte:<br />
»Ich habe alle anderen Geräte und sogar mein<br />
Notebook abgeschafft, ich trage nur noch mein<br />
iPhone von Apple mit mir herum. Da habe ich<br />
alle meine Finanzdaten und E-Mails drauf, und<br />
wenn mal was Wichtiges fehlt, kann ich ja immer<br />
noch meine Sekretärin anrufen.« Wenn alle Geschäftsführer<br />
in Deutschland sagen würden: Wir<br />
kaufen keine Apple-Geräte, wir brauchen sicherere<br />
Geräte, würde sich vielleicht etwas ändern.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Das tut aber keiner.<br />
Pohlmann: Nein, und solange bei jedem neuen<br />
iPhone Schlangen begeisterter Käufer vor den<br />
Läden stehen, hat Apple auch die Macht, zu sagen:<br />
Diese Funktionen sind drin, jene nicht, also<br />
kauft es bitte.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Und Sicherheitsfunktionen kommen dabei<br />
zu kurz.<br />
» Das ist leider so, als<br />
Das ist leider so, als<br />
würde mir jemand ein<br />
Auto verkaufen und<br />
sagen: Pohlmann, du<br />
kannst sofort losfah-<br />
ren, aber wenn du mal<br />
Zeit hast, schraub dir<br />
den Airbag rein «<br />
Pohlmann: Insbesondere bei den Herstellern aus<br />
den USA, die nicht die Verantwortung für diese<br />
Sicherheitsprobleme übernehmen wollen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Weil sie es nicht wollen, oder weil sie es<br />
nicht können?<br />
Pohlmann: Vor etwa einer Woche, kurz bevor das<br />
neue iPhone auf den Markt kam, war in Sicherheitskreisen<br />
ein neuer Hackerangriff bekannt<br />
und sogar in der WDR-Fernsehsendung Markt<br />
veröffentlicht worden: Wenn man sich mit einem<br />
iPhone bei einem WLAN-Hotspot anmeldet,<br />
der heimlich von einem Hacker kontrolliert<br />
wird, kann dieser Angreifer das iPhone knacken,<br />
aus der Ferne ein eigenes Schadprogramm aufspielen<br />
und fortan das Handy manipulieren. Der<br />
Einbrecher konnte kostenpflichtige SMS verschicken,<br />
Daten auslesen und ständig feststellen,<br />
wo sich der Benutzer aufhält.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Apple-Geräte gelten doch als sehr sicher.<br />
Pohlmann: Das stimmt, aber wir haben bei uns<br />
im Institut überprüft, dass dieser Hackertrick<br />
wirklich funktioniert. Die Reaktion von Apple<br />
war interessanterweise nicht: Wir weisen auf ein<br />
neues Problem hin und schließen diese Lücke.<br />
Wichtiger war dort offenbar, sich abzusichern.<br />
Die haben eher bezweifelt, dass der Angriff echt<br />
war, und haben auf Zeit gespielt. Apple hat gerade<br />
das neue iPhone 5 vorgestellt, und wenn es negative<br />
Schlagzeilen gibt, verkauft es sich schlechter.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Im August hat in den USA der Fall des<br />
Technikjournalisten Mat Honan Schlagzeilen<br />
gemacht, der Hackern zum Opfer gefallen war –<br />
und dem sämtliche Daten auf seinen Apple-<br />
Rechnern gelöscht wurden, dessen Google-E-<br />
Mail und dessen Nutzerkonto beim Kurznachrichtendienst<br />
Twitter gekapert wurden. War das<br />
mehr als eine Ausnahme?<br />
Pohlmann: Man hört von solchen Dingen selten,<br />
weil der, dem es passiert, als Depp dasteht.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Lange hieß es, die Smartphones und Tablets<br />
seien sicherer als jeder PC, weil alle Program-<br />
Angriff auf die ...<br />
Fortsetzung von S. 19<br />
Handelsabteilungen konzipiert werden. Von<br />
Leuten wie Anshu Jain.<br />
Jain war lange Jahre der oberste Investmentbanker<br />
der Deutschen Bank. Man nannte ihn in<br />
der Londoner City wegen seines Gespürs für die<br />
Finanzmärkte einen »Halbgott«. Seit Neuestem ist<br />
Jain Chef der Bank. An einem Donnerstagnachmittag<br />
im August sitzt er mit Außenminister Guido<br />
Westerwelle auf einer Holzbühne im Weltsaal des<br />
Auswärtigen Amts in Berlin. Sie sprechen über die<br />
Konjunktur, den Euro – und die Finanzbranche.<br />
Jain sagt, dass der »Vertrag« zwischen Bürgern und<br />
Banken gebrochen worden sei. Dass die Deutsche<br />
Bank Vertrauen zurückge-<br />
winnen wolle. Und einen<br />
»Kulturwandel« brauche.<br />
In diesen Tagen klingt<br />
Anshu Jain nicht wie ein<br />
Halbgott, sondern wie ein<br />
Büßer. Die Deutsche Bank<br />
lernt aus der Krise, das ist<br />
seine Botschaft. Josef Ackermanns<br />
ambitionierte Rendite<br />
zie le wurden einkassiert,<br />
im Investmentbanking werden<br />
Stellen gestrichen, Bonuszahlungen<br />
gestreckt. Die<br />
neue Bescheidenheit hat<br />
nicht nur mit einer neuen<br />
Kultur zu tun – viele Trans-<br />
Weit vorn<br />
Bilanzsumme deutscher Banken<br />
in Milliarden Euro<br />
Deutsche Bank<br />
Commerzbank<br />
DZ-Bank<br />
HypoVereinsbank<br />
Landesbank<br />
Baden-Württemberg<br />
aktionen im Investmentbanking sind wegen der<br />
Vielzahl neuer Regeln schlicht nicht mehr rentabel.<br />
Spezialisten in den Frankfurter Doppeltürmen<br />
haben auch schon ausgerechnet, was eine Trennung<br />
der Geschäftsbereiche für die Bank bedeuten würde.<br />
Ergebnis: nichts Gutes. Zu gewichtig sind aus<br />
Sicht der Deutschbanker die Vorteile einer Vollbank.<br />
Schwächephasen in einzelnen Geschäftsfeldern<br />
können ausgeglichen werden. Die Einlagen<br />
der Kunden sorgen für eine stabile Finanzierung,<br />
weil Kleinsparer ihrer Bank in der Regel auch in<br />
schlechten Zeiten die Treue halten. Und die Kosten<br />
sinken, weil einheitliche Computersysteme verwendet<br />
werden können. In Zukunft wollen Anshu<br />
Jain und sein Co-Chef Jürgen Fitschen die Zentralisierung<br />
deshalb sogar vorantreiben.<br />
Ein Trennbankensystem würde ihre Pläne<br />
durchkreuzen – und vielen Sozialdemokraten geht<br />
es genau darum. »Wir brauchen eine Redimensionierung<br />
der Deutschen Bank. Sie muss wieder zurückkehren<br />
zu ihrer eigentlichen Aufgabe: Dienst-<br />
me über einen App Store erworben werden müssen.<br />
Was dort verkauft werden darf, wird von<br />
Firmen wie Apple erst überprüft.<br />
Pohlmann: Es gibt nun mal keine fehlerfreie<br />
Software, und es gibt immer Schwachstellen –<br />
egal, um welches Betriebssystem oder Anwendungsprogramm<br />
es sich handelt. Es stimmt, dass<br />
vor allem Apple viele Kontrollen macht. Aber so<br />
richtig tief gehen die leider nicht. Da wird beispielsweise<br />
geprüft, auf welche Daten im Telefon<br />
ein Programm zugreift und ob es sofort abstürzt.<br />
Alles andere wäre bei diesen Hunderttausenden<br />
von Apps zu aufwendig, zu teuer.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Also können darunter durchaus Spionageprogramme<br />
sein.<br />
Pohlmann: Auf jeden Fall. Ich könnte mir allerdings<br />
vorstellen, dass eine Firma ihren Mitarbeitern<br />
vorschreibt oder empfiehlt, welche Apps sie<br />
auf ihre Smartphones laden dürfen und welche<br />
besser nicht. Eine Firma wie Siemens könnte beispielsweise<br />
die Bahn-App oder eine Taxi-App für<br />
seine Mitarbeiter auswählen und diese Programme<br />
selbst noch mal überprüfen und freigeben.<br />
Oder Branchenverbände könnten das tun.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Und dann ist es sicher?<br />
Pohlmann: Es wäre sicherer, aber niemals ganz<br />
sicher. Es bleiben stets Möglichkeiten, ein solches<br />
Gerät als Hacker von außen »zu erobern«.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Verraten Sie uns eine?<br />
Pohlmann: Ja, aber das ist dann ein wenig technisch.<br />
Die wenigsten Leute wissen, dass Smartphones<br />
ständig ein Signal aussenden: Es sucht<br />
beispielsweise nach einem WLAN mit dem Namen<br />
»Ponyhof« oder »Firma1445«! Das sind die<br />
Netzwerke, in die sich jemand üblicherweise<br />
einloggt. Diese Signale kann man abfangen,<br />
und dann können Sie als Hacker ein WLAN-<br />
Netzwerk erstellen, das genauso heißt. Und siehe<br />
da: Das Smartphone wird sich mit dem<br />
Netzwerk des Hackers verbinden. Ohne dass<br />
der Benutzer irgendetwas tut oder merkt, kann<br />
ich dann E-Mails und Daten mitlesen und noch<br />
viel mehr.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Also sind wir bis auf Weiteres der Entwicklung<br />
ausgeliefert?<br />
Pohlmann: Technisch kann ich mir eine Sicherheitslösung<br />
für das Problem vorstellen, die im<br />
Augenblick zumindest schon entworfen wird –<br />
die sich aber erst am Markt durchsetzen muss,<br />
das sogenannte Trusted Computing. Dann gäbe<br />
es auf den Geräten beispielsweise einen beruflichen<br />
und einen privaten Bereich, streng voneinander<br />
getrennt. Damit könnte man zumindest<br />
das Problem lösen, dass viele Leute nicht mit<br />
zwei Geräten herumlaufen wollen.<br />
Die Fragen stellte THOMAS FISCHERMANN<br />
leister zu sein für die Realwirtschaft«, sagt Schäfer-<br />
Gümbel, der Beauftragte Gabriels. »Die Risiken<br />
großer Banken können den Wohlstand gefährden.«<br />
Es gibt in Deutschland aber nur noch eine international<br />
tätige private Großbank. Die Dresdner<br />
Bank – wurde aufgekauft. Die WestLB – ist vom<br />
Markt verschwunden. Die Commerzbank – gehört<br />
dem Staat. So dreht sich bei der Regulierung alles<br />
um die Deutsche Bank. Und die stemmt sich gegen<br />
die Spaltungspläne. In der vergangenen Woche<br />
stellten Jain und Fitschen auf einer Investorenkonferenz<br />
die Vorteile ihres Modells einer »global<br />
führenden Universalbank« heraus. Ein breit aufgestelltes<br />
Haus sei stabiler als ein Spezialinstitut. Als<br />
Kronzeugen kamen Unternehmensgrößen wie<br />
Wolfgang Reitzle, Vorstandsvorsitzender des Gaskonzerns<br />
Linde, oder Hans Dieter Pötsch, Finanzchef<br />
von Volkswagen, zu<br />
Wort, die den integrierten<br />
Ansatz lobten.<br />
661<br />
405<br />
<strong>39</strong>5<br />
373<br />
<strong>ZEIT</strong>-GRAFIK/Quelle: Ernst & Young, Daten für 2011<br />
2164<br />
Die Zahl der Verbündeten<br />
schrumpft indes. Eine<br />
Abschirmung des Kundengeschäfts<br />
könne »Teil einer<br />
Strategie sein, die Finanzmärkte<br />
sicherer zu machen«,<br />
sagt Markus Kerber, Hauptgeschäftsführer<br />
beim Bundesverband<br />
der Deutschen<br />
Industrie. Auch Angela Merkel<br />
hat die Popularität des<br />
Bankenthemas erkannt –<br />
und hat nicht vor, das Feld<br />
der SPD zu überlassen.<br />
Finanzminister Wolfgang Schäuble will die<br />
Bonuszahlungen deckeln und den Hochfrequenzhandel<br />
regulieren. Konkrete Vorschläge zum Thema<br />
Trennbanken sind geplant, wenn im Herbst die<br />
Ergebnisse einer vom finnischen Zentralbankchef<br />
Erkki Liikanen geleiteten EU-Expertengruppe vorliegen,<br />
weil Schäuble einen nationalen Alleingang<br />
vermeiden möchte. Doch auch in Brüssel hat die<br />
Idee Anhänger – und in einem Positionspapier von<br />
Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk heißt es<br />
bereits, man stehe »der Diskussion um eine Abschirmung<br />
des klassischen Bankgeschäfts vom Investmentbankgeschäft<br />
offen gegenüber«.<br />
Steinbrück mag in der kommenden Woche die<br />
Schlagzeilen dominieren, die Kanzlerin aber hält<br />
schon dagegen. Wie so oft in den vergangenen vier<br />
Jahren hebt sie bei populären sozialdemokratischen<br />
Themen, von der Energiewende bis zum Mindestlohn,<br />
den Finger und sagt: Das mach ich jetzt auch.<br />
Selbst wenn die SPD am Ende verliert, könnte<br />
das Land also gewinnen.
Foto: Thomas Ernsting/laif<br />
WIRTSCHAFT<br />
Boom voraus!<br />
Die Krise erreicht Deutschland? Kann sein – viele Experten sehen trotzdem einen Aufschwung kommen VON KOLJA RUDZIO<br />
Die Krise, heißt es, frisst sich in die<br />
deutsche Wirtschaft. Sie ist jetzt<br />
angekommen. Wir können ihr<br />
nicht entgehen. Das hört man im<br />
Augenblick allenthalben.<br />
Doch stimmt es wirklich? Joachim Möller redet<br />
nicht so. Er spricht vom Aufschwung.<br />
Es ist Anfang September, der Direktor des<br />
Forschungsinstituts der Bundesagentur für Arbeit<br />
in Nürnberg hält einen Vortrag zur aktuellen<br />
Lage. Seine Zuhörer erwarten Düsteres. Aber der<br />
Professor erklärt, die deutsche Wirtschaft sei im<br />
Grunde kerngesund. Alle Voraussetzungen für<br />
eine »sehr positive Dynamik« seien da. Nur gebe<br />
es diese große Angst: die lähmende Sorge um den<br />
Euro. Gelänge es, diese Angst zu bändigen, sagt<br />
Möller, würden »starke Auftriebskräfte« frei. Eine<br />
Blockade löse sich – und der nächste Aufschwung<br />
könnte beginnen.<br />
Genau das geschieht womöglich gerade.<br />
Ausgerechnet in diesen Tagen könnte der<br />
Wendepunkt auf dem Weg zu einem neuen<br />
Boom erreicht sein. Die Euro-Krise ist zwar nicht<br />
vorüber, aber die akuten Sorgen um die Währung<br />
sind deutlich kleiner geworden.<br />
Erst beschloss die Europäische Zentralbank<br />
(EZB), sie werde alles tun, um die Zinslast notleidender,<br />
reformbereiter Euro-Staaten zu senken.<br />
Wenn nötig, werde sie mit allen Mitteln<br />
Anleihen dieser Staaten kaufen – und die Mittel<br />
der EZB sind bekanntlich unbegrenzt, es handelt<br />
sich um das von ihr selbst geschaffene Geld.<br />
Dann gab das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe<br />
den Weg für ein gigantisches Rettungsinstrument<br />
frei, den Europäischen Stabilitätsmechanismus<br />
(ESM). Er verspricht krisengeschüttelten<br />
Staaten weitere Milliardenhilfen.<br />
Damit erreichen die Rettungsmaßnahmen<br />
eine neue Dimension. Etliche Male schon versuchte<br />
die Politik, mit Gipfelbeschlüssen, Hilfsprogrammen<br />
und einem Schuldenschnitt für<br />
Griechenland die Krise einzudämmen. Doch die<br />
Euro-Ängste blieben. Dieses Mal, glauben viele<br />
Experten, könnte es tatsächlich anders laufen.<br />
»Die Sorge, dass die Euro-Zone kurzfristig auseinanderfliegt,<br />
ist erst einmal weg«, urteilt Kai<br />
Carstensen, Konjunkturchef des ifo-Instituts in<br />
München. »Die Rettungspolitik«, bestätigt Jörg<br />
Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, »hat<br />
eine andere Qualität erreicht.« Der September<br />
<strong>2012</strong>, mutmaßen Konjunkturbeobachter der italienischen<br />
Großbank UniCredit, könne zum<br />
»Wendepunkt« werden. Der Beschluss der EZB<br />
sei ein game changer, eine Entscheidung, die die<br />
Lage komplett verändere.<br />
Wenn die Ökonomen einer italienischen Bank<br />
sich über neue Hilfsmilliarden freuen, mag man<br />
das als interessengeleitet abtun. Aber Carstensen<br />
und Krämer sind Volkswirte, die dieser Rettungspolitik<br />
eigentlich sehr kritisch gegenüberstehen. Ihr<br />
Urteil als Konjunkturforscher ist klar: Die Angst<br />
um den Euro sei nicht verschwunden, aber kleiner<br />
geworden, und damit sei der Weg für einen Aufschwung<br />
frei. Das Szenario, das der Arbeitsmarktforscher<br />
Joachim Möller vor zwei Wochen in Nürnberg<br />
präsentierte, entspricht ziemlich präzise ihrem<br />
Bild der Lage.<br />
»Etliche Studien«, sagt Carstensen, »zeigen,<br />
wie stark Unsicherheit die Konjunktur belastet.«<br />
Viele Unternehmer würden bei unklarer Lage Investitionen<br />
aufschieben und erst einmal abwarten.<br />
Dabei sorgt die Euro-Krise für eine beson-<br />
ders extreme Form der Verunsicherung. Es geht<br />
ja immerhin um den möglichen Zerfall eines<br />
ganzen Währungssystems. »Wer von uns hat<br />
das schon mal erlebt?«, fragt Commerzbank-<br />
Ökonom Krämer. »Das ist nicht die normale<br />
Unsicherheit, die man kennt. Das gehört zu<br />
dem wirklich Unbekannten, zu den unknown<br />
unknowns«.<br />
Erste Anzeichen, dass die daraus resultierende<br />
Verunsicherung nun nachlässt, gibt es bereits. Die<br />
Zinsaufschläge der Risikoländer sind gesunken, die<br />
Aktienkurse schnellten zuletzt nach oben (siehe<br />
Seite 28). Finanzexperten zeigen sich weniger pessimistisch:<br />
Das zeigt die jüngste Umfrage des Zentrums<br />
für Europäische Wirtschaftsforschung in<br />
Mannheim, das solche Leute regelmäßig befragt<br />
und seine Ergebnisse Anfang dieser Woche veröffentlichte<br />
(siehe Grafik).<br />
So weit die Stimmungen. Bevor sich eine<br />
Wende in den richtig harten Wirtschaftsdaten<br />
zeigen kann, dauert es allerdings länger. Der entscheidende<br />
Treiber für die Konjunktur sind Investitionen,<br />
sie sorgen für das Auf und Ab im<br />
Wirtschaftszyklus. Seit fast einem Jahr gehen sie<br />
in Deutschland zurück, jetzt müsste sich der entstandene<br />
Investitionsstau lösen, wenn die These<br />
von der Trendwende stimmt. Bis Unternehmen<br />
neue Investitionsentscheidungen fällen oder frühere<br />
Beschlüsse dazu revidieren, braucht es aber<br />
einige Zeit. Aus den Plänen müssen dann konkrete<br />
Aufträge werden und aus denen wiederum<br />
die reale Produktion oder Dienstleistung eines<br />
Bauunternehmers oder Lieferanten. Schließlich<br />
vergeht noch mal eine Weile, bis alle diese Aktivitäten<br />
von Statistikern erfasst, addiert und publiziert<br />
werden.<br />
Bei vielen Wirtschaftsdaten ist es wie bei einem<br />
alten Fotoapparat: Man kann nicht einfach<br />
auf ein Knöpfchen drücken und sofort sehen,<br />
was man gerade geknipst hat. Nein, das Bild<br />
muss erst langwierig entwickelt werden. Es zeigt<br />
erst nach Wochen oder gar Monaten der Verzögerung,<br />
was einmal war.<br />
Es kann also durchaus sein, dass es in den<br />
nächsten Wochen erst einmal weitergeht mit<br />
den schlechten Nachrichten – ein Rückgang im<br />
Einzelhandel hier, ungünstigere Arbeitsmarktdaten<br />
da. Die breite Öffentlichkeit nimmt meist<br />
nur von den Arbeitslosenzahlen wirklich Notiz.<br />
Und das ist ausgerechnet die Größe, die der<br />
Konjunktur am weitesten hinterherläuft, an der<br />
sich zuallerletzt ablesen lässt: Es geht bergauf<br />
oder bergab.<br />
Deshalb tröpfelt auch jetzt erst langsam ins<br />
allgemeine Bewusstsein, dass die Krise in der<br />
deutschen Wirtschaft ankommt, obwohl Aufträge<br />
und Investitionen schon Ende 2011 zu<br />
sinken begannen – und obwohl sich etliche Experten<br />
schon wieder mit der nächsten Trendwende<br />
beschäftigen, nämlich mit der zum nächsten<br />
Aufschwung.<br />
Die meisten Prognosen sehen für die zweite<br />
Hälfte dieses Jahres ein schwaches Wachstum<br />
oder sogar ein kleines Minus voraus, danach soll<br />
die Wirtschaft dann Zug um Zug wieder stärker<br />
expandieren (siehe Grafik). Einen Riesen-Boom<br />
erwartet niemand, im Jahresdurchschnitt soll<br />
sich das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland<br />
nur um rund ein Prozent erhöhen. Doch immerhin,<br />
es wäre Wachstum, nicht Schrumpfung oder<br />
Stagnation. Und die Zahl der Erwerbstätigen<br />
würde ebenfalls wieder leicht steigen.<br />
Es sind ja auch nicht gleich alle Aussichten rosig.<br />
Allen Prognosen zufolge bleiben die Sparprogramme<br />
in Südeuropa eine Belastung. Gustav Horn, Chef des<br />
gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und<br />
Konjunkturforschung, mag die Aufschwungeuphorie<br />
seiner Kollegen aus diesem Grund auch überhaupt<br />
nicht teilen. »Die Krisenländer müssen mehr Zeit bekommen,<br />
sonst findet der Euro-Raum nicht aus der<br />
Rezession«, warnt der Ökonom. Dann bliebe auch die<br />
deutsche Wirtschaft am Boden.<br />
Ob Horn nun recht hat oder seine optimistischeren<br />
Kollegen: In jedem Fall betreffen alle diese Voraussagen<br />
nur die nahe Zukunft, die kommenden Quartale, das<br />
nächste Jahr. Was auf lange Sicht wird, ist schwer ab-<br />
zusehen. Commerzbank-Volkswirt Krämer zum Beispiel<br />
sieht die fernere Zukunft schon wieder eher<br />
skeptisch: Kurzfristig, meint er, werde sich die lockere<br />
Geldpolitik in Deutschland »sehr gut anfühlen« – aber<br />
langfristig berge diese Politik große Gefahren, die irgendwann<br />
alles nach unten ziehen könnten. Aber das<br />
wird man möglicherweise erst in fünf oder zehn Jahren<br />
erkennen können. Erst, so scheint es, kommt jetzt mal<br />
ein Aufschwung.<br />
I<br />
Weitere Informationen im Internet:<br />
www.zeit.de/konjunktur<br />
www.zeit.de/audio<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 21<br />
Produktion von<br />
Getrieben bei der<br />
Firma Bosch Rexroth<br />
in Witten<br />
Die Stimmung ändert sich<br />
Index der Konjunkturerwartungen<br />
von Finanzexperten<br />
25<br />
Deutschland<br />
20<br />
EU<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
–5<br />
–10<br />
–15<br />
–20<br />
–25<br />
–30<br />
–35<br />
<strong>2012</strong><br />
Jan. Febr. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept.<br />
Quelle: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung<br />
Das Wachstum soll steigen<br />
Wirtschaftswachstum in Deutschland<br />
gegenüber dem Vorquartal in Prozent<br />
(Jahresrate)<br />
Prognose<br />
2,0<br />
1,5<br />
1,0<br />
0,5<br />
0<br />
<strong>2012</strong> 2013<br />
1. Quartal 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.<br />
<strong>ZEIT</strong>-GRAFIK/Quelle: Institut für Weltwirtschaft
22 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong><br />
Tristesse herrscht in den Fabriken von<br />
Opel, Fiat und Peugeot. Tausende Mitarbeiter<br />
fürchten um ihre Jobs, weil der<br />
Verkauf von Neuwagen in der Europäischen<br />
Union bis Ende August um<br />
gut sieben Prozent einbrach. Einzelne europäische<br />
Autohersteller mussten sogar weitaus stärkere Rückgänge<br />
melden. Und Besserung ist nicht in Sicht.<br />
Bei der Konkurrenz aus Korea herrscht derweil<br />
beste Stimmung: Hyundai konnte in den ersten<br />
acht Monaten europaweit gut zehn Prozent mehr<br />
Kunden gewinnen als im Vorjahr, Kia sogar 23<br />
Prozent. Vor allem Kunden aus Deutschland<br />
wechselten scharenweise von Opel, Ford, Renault<br />
und Fiat zu den Asiaten.<br />
Dort bleibt der Erfolg in der Familie. Hyundai<br />
und Kia gehören zur Hyundai Motor Group mit Sitz<br />
in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Von dort<br />
aus regiert der 74-jährige Patriarch Chung Mong-Koo<br />
das Imperium, das zuletzt nicht nur in Europa erfolgreich<br />
war. Auch in China, Indien und den Vereinigten<br />
Staaten haben die Koreaner der etablierten Konkurrenz<br />
beträchtliche Marktanteile abgenommen. »Hyundai<br />
hat es in wenigen Jahren weltweit zur Nummer<br />
fünf in der Branche gebracht«, sagt Stefan Bratzel,<br />
Direktor des Center of Automotive Management in<br />
Bergisch Gladbach. »Das ist beeindruckend.«<br />
Das erkennen mittlerweile auch europäische<br />
Branchengrößen an – VW-Konzernchef Martin<br />
Winterkorn zum Beispiel. Der setzte sich im vergangenen<br />
Jahr während der Automobilmesse IAA in<br />
Frankfurt in den neuen Hyundai i30, das Konkurrenzmodell<br />
zum Golf. Kritisch prüfte er, wie sich das<br />
Lenkrad verstellen ließ. »Da scheppert nichts«, befand<br />
der Manager beim Aus- und Einrasten der Verstellung,<br />
zitierte den VW-Designchef herbei und fragte:<br />
»BMW kann’s nicht, wir können’s nicht. Warum<br />
kann’s der?« Winterkorn hat Hyundai/Kia als den<br />
bedeutendsten Rivalen identifiziert. Ausgerechnet die<br />
Koreaner, die vor nicht allzu langer Zeit noch wegen<br />
ihrer billigen Blechkisten belächelt wurden.<br />
Was aber ist das Erfolgsgeheimnis der Aufsteiger<br />
aus Seoul?<br />
Um das herauszufinden, brauchen die europäischen<br />
Wettbewerber gar nicht weit zu reisen. Von<br />
Frankfurt und Rüsselsheim aus, also aus der Mitte<br />
Deutschlands, lehren die Koreaner ihren Konkurrenten<br />
das Fürchten. Nicht zuletzt, weil Hyundai und<br />
Kia dort kluge Köpfe abgeworben haben.<br />
Erfolgsfaktor Design. Peter Schreyer braucht nur<br />
hinauszuschauen, wenn er Anregungen sucht. Von<br />
seinem bis zum Boden verglasten Eckbüro im Kia-<br />
Büropalast neben der Frankfurter Messe kann er den<br />
dichten Verkehr auf sechs Fahrspuren von oben betrachten.<br />
»Nirgendwo auf der Welt gibt es so viele<br />
Modellvarianten und Marken zu sehen wie in<br />
Deutschland«, sagt der Designer.<br />
Schreyer trägt ein schwarzes Hemd und eine<br />
markante Brille. Beim Sprechen rollt er das R. Er<br />
stammt aus Oberbayern, ist aber längst zum Kosmopoliten<br />
geworden. Erst am Abend zuvor ist der Kia-<br />
Chefdesigner aus Seoul eingeflogen, am selben Tag<br />
noch geht es weiter nach Salzburg, anschließend zur<br />
Automesse nach Moskau, dann vielleicht ins kalifornische<br />
Designstudio, bevor er Ende September wieder<br />
in Europa auf dem Pariser Automobilsalon auftaucht.<br />
Peter Schreyer ist ein klangvoller Name in der<br />
Autoszene. Das berühmte Royal College of Art in<br />
London hat ihm den Ehrendoktor für seinen Beitrag<br />
zum Automobildesign verliehen. Schreyer ist<br />
die Ikone Audi TT zu verdanken, in den Neunzigern<br />
prägte er in Ingolstadt das neue Gesicht der<br />
Marke mit den vier Ringen, anschließend gab er<br />
VW-Modellen Gestalt. Insgesamt 26 Jahre lang<br />
arbeitete er für den VW-Konzern, zuletzt als Chefdesigner<br />
in Wolfsburg, und war »zutiefst mit VW<br />
und Audi verbunden«.<br />
Und warum dann zu den Koreanern? »Mich hat<br />
das Abenteuer gereizt«, sagt Schreyer. Im Jahr 2006<br />
nahm er das Angebot von Kia an, weltweit das Design<br />
der aufstrebenden Marke zu verantworten.<br />
Der Reiz des Unbekannten, des Neuen, eine völlig<br />
andere Kultur habe ihn zum Wechsel bewogen,<br />
Die haben verstanden<br />
Warum Hyundai und Kia der europäischen Absatzkrise trotzen und viele Konkurrenten alt aussehen lassen VON <strong>DIE</strong>TMAR H. LAMPARTER<br />
sagt er. Natürlich sei das ein Risiko gewesen, andererseits<br />
habe er hier »eine sehr freie Hand«. In Seoul, Los<br />
Angeles und Frankfurt leitet er seitdem rund 250<br />
Kreative an, die Karosserien zeichnen, Modelle aus<br />
Ton modellieren und das Interieur gestalten. Seine<br />
drei Studiochefs – ein Koreaner, ein Amerikaner, ein<br />
Franzose – und er treffen sich jeden Monat mit den<br />
Kia-Topmanagern. »Ich habe eine völlig andere Welt<br />
kennengelernt, erfahren, dass es noch anderes außerhalb<br />
von Wolfsburg und Ingolstadt gibt«, sagt Schreyer,<br />
der spürbar stolz ist auf seine Leistung. »Der Erfolg<br />
ist richtig sichtbar, wenn man unsere Autos auf der<br />
Straße sieht«, sagt der Designer. Das sei längst nicht<br />
mehr nur in Korea so, wo die Kia und Hyundai<br />
neunzig Prozent des Straßenbilds beherrschen, sondern<br />
immer mehr auch in den USA, in Deutschland,<br />
in Österreich.<br />
Natürlich gab es auch vor Schreyer schon Kia, und<br />
einige Modelle haben ihn beeindruckt. »Ich wollte<br />
wissen, wer dahintersteckt«, sagt er. Seine Aufgabe<br />
war es, der Marke ein Gesicht zu geben, eine gewisse<br />
Familienähnlichkeit herzustellen, zugleich aber dabei<br />
nicht langweilig zu sein. Es gehe darum, eine weltweite<br />
Identität herzustellen, eine Marke aufzubauen,<br />
erklärt Schreyer. Idealerweise müsse man »einen Kia<br />
erkennen, ohne dass der Markenname draufsteht«.<br />
Seit 2008 sind die ersten Modelle mit seiner<br />
Handschrift auf dem Markt zu sehen, das typische<br />
Markengesicht nennt er »Tiger Nose«, Tigernase. Das<br />
Tier sei in der koreanischen Kultur sehr positiv besetzt.<br />
Als »sportlich straff« charakterisiert Schreyer die<br />
klare Linienführung, die bei Käufern und Kritikern<br />
gleichermaßen ankommt. Kia spielt im Konzern die<br />
Rolle der eher jüngeren, sportlicheren Marke neben<br />
der eher klassisch orientierten Schwester Hyundai.<br />
Mittlerweile wurde praktisch die gesamte Modell-<br />
In den Top Five<br />
Die größten Autohersteller der Welt 2011 nach<br />
verkauften Fahrzeugen in Millionen<br />
General Motors<br />
Volkswagen<br />
Nissan-Renault<br />
Toyota<br />
Hyundai<br />
Tendenz aufwärts<br />
Absatz der Marken Hyundai und Kia in Europa*<br />
und weltweit von 2002 bis 2011 in Tausend<br />
Europa<br />
2002 2004 2006 2008 2010<br />
Kia<br />
Welt<br />
Hyundai<br />
2002 2004 2006 2008 2010<br />
<strong>ZEIT</strong>-GRAFIK/Quelle: Unternehmensangaben, *EU und EFTA<br />
9,03<br />
8,36<br />
8,29<br />
7,95<br />
6,60<br />
<strong>ZEIT</strong>-GRAFIK/Quelle: Unternehmensangaben; jeweils Konzerne, bzw.<br />
Allianz bei Nissan-Renault, Pkw und Nutzfahrzeuge<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
0<br />
palette von Kia Motors unter seiner Regie neu eingekleidet<br />
– vom Kleinwagen über die beliebten Geländemobile<br />
bis zur großen Limousine. Die Optik der<br />
gerade aufgelegten zweiten Generation des Golf-<br />
Rivalen Kia Cee’d wurde in Blättern wie Brigitte,<br />
stern oder auto motor und sport unisono mit wahren<br />
Elogen gefeiert.<br />
»Das Design von Peter Schreyer spielt eine entscheidende<br />
Rolle bei den jüngsten Erfolgen der<br />
Marke Kia«, sagt Ralf Kalmbach, Chefberater in<br />
Sachen Automobil bei Roland Berger in München.<br />
Die Führung in Korea lasse Schreyer viel Freiraum,<br />
weil sie das erkannt habe.<br />
Derartiges Lob macht den Kia-Chefdesigner<br />
ein bisschen verlegen. »Design spielt heute bei allen<br />
Marken eine stärkere Rolle«, stellt er fest, »aber<br />
das Design allein kann es nicht machen.«<br />
Europäischer Geschmack. »Wir müssen den Geschmack<br />
der europäischen Kunden treffen«, sagt sein<br />
Kollege Thomas Bürkle im nahen Rüsselsheim. Er<br />
leitet das europäische Designteam der großen Schwester<br />
Hyundai. Auch er ein bekannter Name in der<br />
Szene. Bevor der 51-jährige Hesse 2005 zu Hyundai<br />
stieß, hatte er Erfahrung bei Mercedes, Toyota und<br />
VW gesammelt, zuletzt war er für die Gestaltung<br />
wichtiger BMW-Modelle wie der 3er-Reihe verantwortlich.<br />
Dann kam das Angebot zum Wechsel.<br />
Chung Mong-Koo und seine Strategen in Seoul<br />
hatten beschlossen, den europäischen Markt mit einer<br />
völlig eigenen Modellpalette zu erobern.<br />
Bei Marken wie BMW müsse man Rücksicht auf<br />
die Tradition nehmen, der Charakter sei im Kern<br />
festgelegt, schickt Bürkle voraus, wenn er sein Wechselmotiv<br />
erklärt. Frühere Hyundai-Modelle hätten<br />
alle unterschiedliche Gesichter gehabt. Jetzt bekam<br />
er die einmalige Chance einer jungen Marke ein<br />
Gesicht für Europa zu geben. »Mich hat es einfach<br />
gereizt, das Design einer Marke von Grund auf zu<br />
prägen«, sagt Bürkle.<br />
»Fluidic Sculpture« nennen sich die der Natur<br />
nachempfundenen fließenden Formen der Hyundai-<br />
Karosserien, ein in Form eines Hexagons gestalteter<br />
Frontgrill komplettiert das Erscheinungsbild. Die<br />
Form erinnere an die Form einer Bienenwabe, leicht<br />
und trotzdem äußerst stabil, eine effiziente Konstruktion<br />
der Natur. Und für Effizienz in attraktiver<br />
Gestalt soll auch die Marke stehen. Denn eines war<br />
klar: Nachdem Hyundai in den Jahren zuvor vor allem<br />
mit seinem guten Preis-Leistungs-Verhältnis die<br />
Kunden gelockt hatte, wollte man fortan auch mit<br />
dem Design punkten. Immer noch günstig, aber<br />
nicht mehr billig kommt Hyundai jetzt daher.<br />
Entgegen dem Ruf des zentralistisch geführten<br />
koreanischen Konzerns hätte sein aus einem Dutzend<br />
Nationalitäten rekrutiertes Team »viel Freiraum« bekommen,<br />
betont der europäische Chefdesigner.<br />
Bürkle und seine 30 Kreativen residieren im kreisförmig<br />
angelegten Europäischen Entwicklungszentrum<br />
von Hyundai am Rande von Rüsselsheim. Schon das<br />
erste dort entwickelte Modell, das Kompaktauto i30,<br />
kam beim Publikum sehr gut an. Weitere erfolgreiche<br />
Modelle vom Kleinwagen bis hin zum VW-Passat-/<br />
Opel-Insignia-Konkurrenten Hyundai i40 haben das<br />
Standing der Rüsselsheimer in Seoul gefestigt.<br />
Deutsche Ingenieurskunst. Doch die Hyundai-<br />
Strategen haben ihre Autos nicht nur optisch europäisiert.<br />
Auch technisch galt es die Erwartungen der<br />
verwöhnten Kundschaft zu erfüllen. Dafür steht beispielsweise<br />
das 80-köpfige Team von Motoren- und<br />
Getriebeentwicklern um den Ingenieur Jürgen<br />
Grimm, das ebenfalls im Rüsselsheimer Entwicklungszentrum<br />
seinen Platz hat. Der 43-jährige Franke<br />
ist der Prototyp des deutschen Ingenieurs, der sich<br />
einem Thema verschrieben hat – dem effizienten Einsatz<br />
von Energie. Er hat Maschinenbau mit Schwerpunkt<br />
Energietechnik studiert, bei VW und Zulieferern<br />
an der modernen Dieseltechnik gearbeitet. Im<br />
Jahr 2002 ereilte ihn der Ruf von Hyundai, das damals<br />
seine Dieselmotoren noch von anderen Herstellern<br />
zukaufte. »Die Chance, quasi auf einem weißen<br />
Blatt Papier einen eigenen Dieselmotor zu entwickeln,<br />
war äußerst reizvoll«, erinnert er sich.<br />
Das Beispiel der Motorenkonstrukteure macht<br />
klar, weshalb die Strategen aus Seoul Rüsselsheim<br />
unweit des Frankfurter Großflughafens auswählten.<br />
»Mit dem Standort Deutschland hatte man das ganze<br />
Umfeld der namhaften Zulieferer«, erklärt Jürgen<br />
Grimm. Elektronik von Bosch, Turbolader von Borg<br />
Warner, Entwicklungsdienstleistungen von AVL ...<br />
»Die meisten Patente liegen nicht bei den Autoherstellern,<br />
sondern bei den Zulieferern«,<br />
klärt Grimm auf, »so war es<br />
keine Utopie, den Vorsprung der<br />
deutschen Hersteller wie Mercedes,<br />
VW/Audi oder BMW aufzuholen.«<br />
Knapp zehn Jahre später kann<br />
der zum Chef-Antriebsentwickler in<br />
Rüsselsheim beförderte Grimm bei<br />
einem Test mit einem seiner kleinen<br />
Diesel-Pkw den niedrigsten Wert bei<br />
den CO₂-Emissionen eines konventionell<br />
angetriebenen Pkw vorweisen.<br />
»Bei Dieselmotoren brauchen<br />
wir uns vor den Konkurrenten nicht<br />
zu verstecken, unsere Motoren sind<br />
auf europäischem Niveau«, sagt ein<br />
stolzer Ingenieur in Rüsselsheim.<br />
Grimms Truppe liefert für Hyundai<br />
und für Kia. Nach dem Muster des<br />
großen Vorbilds aus Wolfsburg, das<br />
seine Motoren und Getriebe kostensparend<br />
bei seinen Marken VW,<br />
Audi, Škoda und Seat einsetzt.<br />
Und schon im kommenden Jahr<br />
kommt die neue Generation von<br />
Benzinmotoren in die Autos. Dann<br />
spiele man auch hier vorne mit, verspricht<br />
Grimm. Das Wort eines<br />
deutschen Ingenieurs.<br />
Lange Garantie schafft Vertrauen.<br />
»Der Benzinverbrauch ist das eine,<br />
aber Design ist immer noch Kaufgrund<br />
Nummer eins«, weiß Benny<br />
Oeyen nach 22 Jahren Erfahrung<br />
in Marketing, Produktplanung und<br />
Vertrieb von Autofirmen. Der<br />
50-jährige Belgier hat für Ford,<br />
Mazda und DaimlerChrysler in<br />
Europa gearbeitet, dann für Chrysler<br />
in den USA. Dort erreichte ihn<br />
mitten in der Branchenkrise 2009<br />
der Anruf eines Headhunters. Ob<br />
er sich vorstellen könne, sich in<br />
Frankfurt bei Kia um Marketing<br />
und Produktplanung zu kümmern?<br />
Oeyen konnte.<br />
Vier Manager aus vier Ländern<br />
sollten die Marke aus dem Exotenstatus<br />
in Europa herausholen.<br />
Der europäische Markt sei gesättigt,<br />
beschreibt Oeyen die Ausgangslage.<br />
Also brauchte man – neben dem<br />
Design – ein weiteres Argument, um Kunden anderer<br />
Marken herüberzuziehen. Qualität sollte die zweite<br />
Achse in der Marketingstrategie sein. »Die Leute<br />
glauben erst mal, dass die Qualität bei einem Newcomer<br />
nicht gut ist«, schildert Oeyen die Herausforderung.<br />
»Wie kann man das ändern?«, fragten sich<br />
Oeyen und sein Chef.<br />
Im Herbst 2009 lag das Konzept auf dem Tisch:<br />
Sieben Jahre Garantie sollte es für jeden neuen Kia<br />
geben. Das war mutig. Denn Mercedes, VW, Audi,<br />
BMW und Co. geben nur zwei Jahre Garantie.<br />
Einfach war es nicht, diese revolutionäre Idee in<br />
Seoul durchzusetzen. Doch schon im Januar 2010<br />
wurde die 7-Jahres-Garantie tatsächlich eingeführt.<br />
»So schnell hätte man das bei einem amerikanischen<br />
oder europäischen Hersteller nie durch die Instanzen<br />
bekommen«, ist sich Oeyen sicher. Koreaner bereiten<br />
Entscheidungen bis ins Detail vor. »Wenn<br />
dann die Konzernspitze etwas beschlossen hat, geht<br />
es aber ruckzuck.«<br />
»Palli, palli«, koreanisch für schnell, schnell, sei<br />
oft zu hören. Hyundai könne man in dieser Hinsicht<br />
mit anderen koreanischen Konzernen wie Samsung<br />
Koreaner,<br />
europäisch gestylt<br />
und LG vergleichen, die hätten den Markt für Flachbildfernseher<br />
oder Smartphones aufgemischt und<br />
etablierte Firmen wie Sony oder Nokia abgehängt.<br />
Die jüngsten Verkaufserfolge bei Kia – und auch<br />
bei Hyundai, das mit einer 5-Jahres-Garantie nachzog<br />
– sprechen für die Strategie. Aber die Koreaner wollen<br />
weiter wachsen. »Noch sind unsere Produkte besser<br />
als das Image«, sagt Oeyen. Immerhin hat das Sponsoring<br />
bei der Fußball-WM die<br />
Markenbekanntschaft von Kia/<br />
Hyundai kräftig erhöht.<br />
Natürlich sei die strenge Hierarchie<br />
in einem koreanischen<br />
Konzern für europäische Mitarbeiter<br />
nicht immer einfach, aber andererseits<br />
wisse man in Seoul, dass<br />
man aus Korea heraus nicht alles<br />
Peter Schreyer hat Kia schaffe – »man kauft sich Talent<br />
weltweit ein attraktives ein, und man hört zu«, schildert<br />
Design verpasst<br />
Oeyen seine Erfahrungen.<br />
»Die Koreaner treffen mit ihrem<br />
frischen Design den Zeitgeist«, stellt<br />
Roland-Berger-Berater Kalmbach<br />
fest, »die Produkte haben mit den<br />
alten Billigautos nichts mehr zu<br />
tun. Sie haben verstanden, dass sie<br />
in Europa europäisch sein müssen.«<br />
In dieser Hinsicht hätten sie Toyota<br />
und die anderen Japaner überrundet.<br />
Die langen Garantiefristen<br />
Benny Oeyen setzt beim zeigten den Glauben an die eigene<br />
Kia-Marketing auf die Qualität. Das wird von den Kunden<br />
7-Jahres-Garantie wahrgenommen. Man liegt nicht<br />
mehr daneben, wenn man einen<br />
Koreaner fährt.<br />
Jürgen Grimm hat für<br />
Hyundai sparsame<br />
Motoren entwickelt<br />
Thomas Bürkle gab den<br />
Hyundai-Modellen ihr<br />
europäisches Gesicht<br />
WIRTSCHAFT<br />
Know-how aus allen Regionen.<br />
Die Beispiele aus Frankfurt und<br />
Rüsselsheim zeigen das Prinzip<br />
der erfolgreichen Hyundai/Kia-<br />
Wachstumsstrategie: Man zapft in<br />
der jeweiligen Weltregion das vorhandene<br />
Know-how an, holt sich<br />
einheimische Talente, um die jeweiligen<br />
Platzhirsche mit ihren<br />
eigenen Waffen zu schlagen. Kleine,<br />
preiswerte Autos baut Hyundai<br />
in Indien, die Elektronikentwickler<br />
sitzen in Japan, große<br />
Fahrzeuge werden in Amerika entworfen,<br />
technische Neuerungen<br />
und Modelle speziell für Europa<br />
in Deutschland. In Korea wird alles<br />
perfektioniert.<br />
»Die Kompetenzen sind schlüssig<br />
auf die Weltregionen aufgeteilt«, sagt<br />
Ingenieur Grimm, »wir müssen<br />
nicht immer die Trendsetter sein,<br />
konnten von Amerikanern den Managementansatz,<br />
von den Japanern<br />
das Qualitätsdenken und den Deutschen<br />
Gründlichkeit und Innovationskultur lernen.«<br />
Trotz aller Internationalität herrsche, schon durch<br />
die Dominanz der Familie Chung, die Atmosphäre<br />
eines Familienunternehmens, erzählen die Europäer<br />
in koreanischen Diensten.<br />
In diesem Jahr will Hyundai/Kia schon mehr als<br />
sieben Millionen Autos verkaufen. Volkswagen gilt<br />
als großes Vorbild, noch liegen die Korea-Marken<br />
imagemäßig zurück. »Wir haben mit dem neuen Golf<br />
den Abstand zu den Koreanern wieder vergrößert«,<br />
sagte VW-Chef Martin Winterkorn bei der Präsentation<br />
des Golf VII vor wenigen Tagen in Berlin.<br />
Bislang war Hyundai in der Verfolgerposition,<br />
konnte sich vieles bei den Konkurrenten abschauen.<br />
Wenn sich die Marken aber weiter nach oben entwickeln<br />
wollen, müssten sich die Koreaner von der<br />
Rolle des bloßen Nachahmers emanzipieren, mit<br />
eigenen Neuerungen Zeichen setzen, sagt Branchenexperte<br />
Bratzel. »Das waren jetzt tolle fünf Jahre für<br />
Hyundai und Kia. In Zukunft wird es schwieriger.«<br />
Weitere Informationen im Internet:<br />
www.zeit.de/automobilindustrie<br />
Fotos: PR
WIRTSCHAFT<br />
<strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>: Herr Kim, ein Arzt als Chef der Weltbank?<br />
Sie haben selbst mal gesagt, Sie wüssten<br />
nicht, was ein Hedgefonds ist ...<br />
Jim Yong Kim: Das habe ich gesagt, ehe ich die<br />
Leitung der Universität in Dartmouth übernahm.<br />
Aber seit ich mich dort um das Stiftungskapital<br />
von 3,5 Milliarden Dollar kümmern musste, weiß<br />
ich sehr wohl, was ein Fonds ist! Es stimmt, dass<br />
ich der erste Chef der Weltbank bin, der nicht<br />
vorher Banker oder Politiker war. Dafür bin ich<br />
der erste, der praktische Erfahrungen in der Entwicklungshilfe<br />
hat.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Schon mit Bankern aneinandergeraten?<br />
Kim: Ganz und gar nicht. Ich treffe in der Weltbank<br />
viele Leute, die echtes Interesse an der Arbeit<br />
haben. Ein kleiner Teil schreibt vor allem wissenschaftliche<br />
Studien, die große Mehrheit kommt<br />
aus der Praxis und will, dass unsere Investitionen<br />
etwas verändern. Wir reden Klartext miteinander.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Und das ist neu?<br />
Kim: Es gab Zeiten in der Bank, da ging es vor<br />
allem um die ganz großen Ideen. Da wurde Strukturanpassung<br />
verordnet, Freihandel und freie<br />
Märkte, und es hieß: »Privatisiert die Gesundheitsversorgung!«<br />
oder »Lasst das Kapital frei fließen!«.<br />
Einige dieser Ideen halten wir auch heute<br />
noch für richtig, aber es gibt nicht die eine Lösung<br />
für alle. Besser, man entwickelt die passende<br />
Strategie für jedes einzelne Land – und dann können<br />
die Länder voneinander lernen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Wie soll das gehen?<br />
Kim: Es gab in den Achtzigern den Durchbruch<br />
der evidenzbasierten Medizin ...<br />
<strong>ZEIT</strong>: Das heißt: Kein Eingriff, ohne dass die<br />
Wirkung belegt ist ...<br />
Kim: ... und seitdem erforschen Mediziner systematischer<br />
den Erfolg von Therapien. Ähnlich<br />
muss es in der Entwicklungspolitik sein. Wir<br />
müssen konkret fragen: Was hat funktioniert und<br />
was nicht? Wenn wir dann ein Land beraten, können<br />
wir beispielsweise sagen: Subventionen für<br />
Treibstoff haben meist diese und jene Wirkungen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Machen Sie damit nicht eine tonangebende<br />
Institution zur Service-Einrichtung?<br />
Kim: Es gibt ja nach wie vor eine Menge Leute in<br />
der Bank, die große Ideen haben, und das ist sehr<br />
wichtig. Auch den Freiraum, darüber intensiv zu<br />
diskutieren, muss eine Wissensbank bieten. Es<br />
gab ja beispielsweise mal eine große Debatte darüber,<br />
ob man seine Grenzen für den Handel öffnen<br />
sollte oder nicht – heute verschließt sich kaum<br />
noch ein Land dieser Idee.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Der Grad und das Tempo der Öffnung sind<br />
allerdings nach wie vor strittig.<br />
Kim: Das ist der Punkt. Solche Entscheidungen<br />
kann man treffen, wenn man die Vor- und Nach-<br />
»Ich<br />
setze auf<br />
Beweise«<br />
Der neue Weltbankchef Jim Yong<br />
Kim zweifelt an großen Th eorien<br />
und allgemeingültigen Lösungen<br />
Jim Yong Kim war Arzt und Helfer<br />
teile der unterschiedlichen Modelle kennt. Als<br />
ich in Äthiopien war, interessierte sich die Regierung<br />
intensiv dafür, was sie von den Südkoreanern<br />
lernen könnte. Denen war auch mal vorhergesagt<br />
worden, sie würden sich nie entwickeln,<br />
aber dann schafften sie einen rasanten Aufstieg.<br />
Manche Wissenschaftler sagen: Der Konfuzianismus<br />
war der Schlüssel. Vor Jahrzehnten hieß es<br />
noch: Konfuzius ist das Problem. Solche Deutungsunterschiede<br />
machen mich sehr misstrauisch,<br />
wenn ich von angeblich allgemeingültigen<br />
Lösungen höre.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Ökonomen lieben allgemeingültige Ideen.<br />
Kim: Die helfen uns ja auch, anders zu denken.<br />
Aber Äthiopien braucht konkrete Hilfe bei der<br />
ländlichen Entwicklung und keine abstrakten<br />
Großentwürfe. Die gute Nachricht ist: Wir bei<br />
der Bank haben eine Unmenge von Experten, die<br />
haben in allen Ländern der Welt gearbeitet und<br />
kennen 20, 30 oder 40 Beispiele für Landwirtschaftsreformen.<br />
Die wissen genau, wo es funktioniert<br />
hat und wo es danebengegangen ist.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Landwirtschaft gilt als Schüssel zur Entwicklung,<br />
gerade die Nahrungsmittelproduktion<br />
steckt in einer dramatischen Krise. Sie sind in<br />
Iowa aufgewachsen, dort herrscht schlimme<br />
Dürre ...<br />
Kim: Ich habe dort Freunde, mit denen ich auf<br />
Facebook Kontakt halte, und kenne deren Sorgen.<br />
Ja: Dies ist die schlimmste Dürre seit 50 Jahren,<br />
und wir sind extrem beunruhigt.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Die Preise für Getreide sind explodiert, in<br />
manchen Ländern droht Hunger.<br />
Kim: Ich kenne das Problem aus der Perspektive<br />
des Arztes, ich habe in Ländern gearbeitet, in denen<br />
Menschen krank wurden, weil sie extrem unterernährt<br />
waren. Diese Bedrohung steckt mir sozusagen<br />
in den Knochen. Wir sind in der Bank<br />
hellwach, um die Länder, die ihre Menschen nicht<br />
ausreichend ernähren können, mit Wissen, Finanzmitteln<br />
und notfalls Lebensmitteln zu unterstützen.<br />
Wir wollen nicht, dass Eltern ihre Kinder<br />
aus der Schule nehmen müssen, weil sie nicht genug<br />
zu essen haben. Oder dass sie sich den Arzt<br />
nicht mehr leisten können.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Es gab immer wieder Kritik, dass die Weltbank<br />
gerade in der Landwirtschaft die Falschen<br />
unterstützt. Sie hat zum Beispiel in Entwicklungsländern<br />
die Investitionen von Agrarkonzernen finanziert.<br />
Kleinbauern wurden vertrieben und indigene<br />
Völker. Manche nennen das »Landraub«.<br />
Kim: Glauben Sie mir: Dieses Problem nehmen<br />
wir ganz besonders ernst. Eine Bestandsaufnahme<br />
war eine meiner ersten Beschäftigungen. Es ist<br />
ganz gewiss nicht die Absicht der Weltbank,<br />
Kleinbauern zu vertreiben, und es widerspricht<br />
unseren Wertvorstellungen, Menschen ihren Lebensunterhalt<br />
zu rauben. Im Gegenteil: Wir wollen,<br />
dass die Menschen von ihrem Land leben und<br />
es nachhaltig bewirtschaften können.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Müssten Sie sich nicht stärker in politische<br />
Debatten einmischen, um das zu erreichen? Beispielsweise<br />
bei der Biospritproduktion?<br />
Kim: Sie wissen, das ist ein hoch kontroverses<br />
Thema. Die Produktion von Pflanzen, aus denen<br />
dann Biosprit wird, begann ja einst als gute Idee.<br />
Man wollte die Klimagase reduzieren. Aber jetzt<br />
wachsen die Sorgen, dass Biosprit zu den höheren<br />
Lebensmittelpreisen beiträgt. Mein Eindruck ist,<br />
dass sich selbst die Wissenschaftler noch nicht einig<br />
sind. Wir müssen die Auswirkungen auf die<br />
Armen noch besser verstehen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Wie politisch können Sie sein?<br />
Kim: Beim Klimawandel hat sich die Weltbank ja<br />
durchaus aus dem Fenster gehängt. Noch einmal:<br />
Ich bin der erste Wissenschaftler an ihrer Spitze,<br />
und bei diesem Thema sehe ich klar, dass es unter<br />
den Experten einen Konsens gibt. Die Klimaforscher<br />
haben gerade wieder bestätigt, dass das extreme<br />
Wetter dieses Sommers<br />
» Vielleicht schauen<br />
eine Folge der Treibhausgase ist,<br />
und wir beobachten in den Meeren<br />
Veränderungen, von denen<br />
wir dachten, sie träten erst bei<br />
zwei Grad ein. Ich verspreche Ihnen:<br />
Eines der Themen, über die<br />
ich laut reden werde, ist der Klimawandel.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Auch wenn Amerikaner<br />
und Chinesen manche Konsequenz<br />
daraus nicht gern hören?<br />
Kim: Meine Aufgabe ist, den Politikern die wissenschaftlichen<br />
Erkenntnisse nahezubringen.<br />
Man muss sich mithilfe von Beweisen durchsetzen,<br />
damit Entscheidungen besser getroffen werden<br />
können. Ist das politisch? Vielleicht, aber gerade<br />
deswegen verlasse ich mich auf die Fakten.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Auch bei den Umwelt- und Sozialstandards<br />
für Infrastrukturprojekte gibt es unterschiedliche<br />
Vorstellungen, etwa zwischen Europa und den<br />
großen Schwellenländern. Manche der Kriterien<br />
sind von Indien und China verwässert worden.<br />
Werden Sie sich für strenge Regeln einsetzen?<br />
Kim: Ich habe meinen Job als überzeugter Multilateralist<br />
angetreten. Wir müssen die Diskussionen<br />
über Standards intensiv führen. Das betrifft<br />
natürlich besonders die Energieversorgung.<br />
Unterwegs in Afrika habe ich erlebt, wie gigantisch<br />
die Herausforderung ist: Viele Länder<br />
brauchen ein immenses Wachstum, aber die<br />
Energie fehlt. Nigeria muss seine Energieproduktion<br />
in zehn bis fünfzehn Jahre verfünf-<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 23<br />
fachen – auf der anderen Seite müssen wir<br />
Rücksicht auf die Umwelt nehmen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Werden Sie über die Euro-Krise sprechen?<br />
Kim: Ich hoffe sehr, dass Sie die Krise bald überwinden.<br />
Sonst wären die Auswirkungen auf die<br />
Entwicklungsländer enorm! Der Nahe Osten,<br />
Nordafrika, ganz Afrika, viele Regionen leiden<br />
schon jetzt.<br />
europäische Länder<br />
sich etwas von den<br />
Erfahrungen der<br />
koreanischen<br />
Wirtschaftskrise der<br />
90er Jahre ab? «<br />
<strong>ZEIT</strong>: Würde die Weltbank eigentlich auch Län-<br />
dern wie Griechenland und Spanien helfen?<br />
Kim: Die Regierungen müssen uns natürlich fragen.<br />
Und wir sagen ihnen nicht, was sie zu tun<br />
haben. Aber wir bieten ihnen die besten Leute,<br />
die auch anderswo in Krisensituationen gearbeitet<br />
haben und ihnen Optionen vorstellen können.<br />
Wenn das hilft – wir kommen gern. Und wir<br />
bringen dann auch das Wissen des Südens mit.<br />
Denn es gibt inzwischen eine Menge Dinge, die<br />
reiche Länder von den Entwicklungsländern lernen<br />
können.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Zum Beispiel?<br />
Kim: Vielleicht schauen sich ja auch europäische<br />
Länder etwas von den Erfahrungen der koreanischen<br />
Wirtschaftskrise in den<br />
späten neunziger Jahren ab?<br />
Oder nehmen Sie das Gesundheitswesen,<br />
das ist für jedes<br />
Land zentral. In vielen Entwicklungsländern<br />
gibt es schon<br />
lange einfache Gesundheitsdienste<br />
in den Gemeinden,<br />
und jetzt stellen Sie sich vor:<br />
Die Vereinigten Staaten von<br />
Amerika haben festgestellt,<br />
dass solche Basismediziner die<br />
Kosten des Gesundheitswesens verringern und die<br />
Versorgung verbessern können – selbst bei sehr<br />
kranken Patienten.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Macht Ihnen der neue Job Freude – oder ist<br />
er vor allem anstrengend?<br />
Kim: Ich staune über die Möglichkeiten. Ich habe<br />
mein Leben lang gegen Armut und Krankheit<br />
gekämpft. Ich habe für Wohn- und Ernährungsprogramme<br />
gearbeitet, in Sibirien ein Gesundheitssystem<br />
aufgebaut und diese Arbeit geliebt.<br />
Und plötzlich kann ich mit den Ministern Niebel<br />
und Schäuble darüber reden, morgen mit Politikern<br />
in Südafrika. Wissen Sie: Ich träume tatsächlich<br />
immer noch von einer Welt ohne Armut.<br />
Und da ist die Weltbank eine von zwei, drei Organisationen,<br />
die dafür wirklich Entscheidendes tun<br />
können. Jeden Morgen gehe ich zur Arbeit, und<br />
denke: Okay, was könnte besser sein?<br />
Das Gespräch führten CHRISTIANE GREFE<br />
und PETRA PINZLER<br />
Fotos: Manfred Klimek für <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>
24 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> WIRTSCHAFT<br />
Datei Datei<br />
Künftig sollen die Absender großer Datenmengen Vorfahrt erhalten und dafür extra zahlen<br />
Heute werden beim<br />
Datentransport<br />
alle gleich behandelt,<br />
das aber kann<br />
zu Staus führen<br />
Was der »Internet-Evangelist«<br />
verkündete, hatte wenig von<br />
einer frohen Botschaft. »Das<br />
offene Netz war nie in größerer<br />
Gefahr als jetzt«, erklärte<br />
Vint Cerf, Informatiker und einer der Väter des<br />
Internets, Ende Mai in einer Anhörung des<br />
US-Kongresses. Cerf steht heute in Diensten<br />
des Suchmaschinenbetreibers Google, er ist<br />
dort Vordenker und eben Chief Internet Evangelist.<br />
Die Abgeordneten warnte Cerf mit<br />
scharfen Worten: »Eine internationale Schlacht<br />
bahnt sich an, eine Schlacht, die über die Zukunft<br />
des Internets bestimmen wird.«<br />
In dem düsteren Szenario, das Cerf entwarf,<br />
geht die Bedrohung des Internets von einer wenig<br />
bekannten Sonderorganisation der Vereinten<br />
Nationen aus: der Internationalen Fernmeldeunion<br />
ITU. Russland, China und andere autoritäre<br />
Staaten würden versuchen, über die ITU<br />
weite Teile des Internets unter ihre Kontrolle zu<br />
bringen. Bislang koordiniert ein loses Netzwerk<br />
nichtstaatlicher Organisationen das Netz. Die<br />
Folgen wären laut Cerf Planwirtschaft, Zensur<br />
und technologischer Stillstand. Im Dezember, bei<br />
der nächsten Vertragskonferenz der ITU in Dubai,<br />
stünde die Entscheidungsschlacht an.<br />
Cerf sagt allerdings nur die halbe Wahrheit.<br />
Denn in Dubai wird noch ein zweiter Konflikt<br />
ausgetragen, der für Google nicht minder bedrohlich<br />
ist, bei dem es aber weniger um<br />
Macht als um Geld geht. Es geht darum, wer<br />
für das Netz und seine Infrastruktur bezahlt –<br />
und wer davon profitiert. Hier kämpfen Konzerne<br />
wie die Deutsche Telekom gegen Google<br />
und Apple.<br />
Die ITU, gegründet vor fast 150 Jahren als<br />
Internationaler Telegraphenverein und seitdem<br />
vorrangig mit der Regelung des grenzüberschreitenden<br />
Telefonverkehrs betraut, will in Dubai ihr<br />
Hauptvertragswerk reformieren. Das Abkommen,<br />
zuletzt geändert im Jahr 1988, gilt als hoffnungslos<br />
überholt: Statt im Festnetz wird heute<br />
vor allem mobil kommuniziert; der Unterschied<br />
zwischen Sprach- und Datenverbindung verschwindet,<br />
Anbieter wie Skype erlauben Sprach-<br />
und Videotelefonie über das Internet.<br />
Einige Staaten – darunter auch China, Brasilien<br />
und Indien – würden die Gelegenheit in<br />
Dubai tatsächlich gerne nutzen, um mit dem<br />
gegenwärtigen Modell dezentraler Internetregulierung<br />
aufzuräumen. Der russische Präsident<br />
Wladimir Putin erklärte bei einem Besuch in der<br />
Genfer ITU-Zentrale im Jahr 2011 sogar unverblümt,<br />
er unterstütze das Ziel »internationaler<br />
Kontrolle über das Internet mithilfe der Kontroll-<br />
und Überwachungsmöglichkeiten der ITU«.<br />
Nur: In den bisherigen Vertragsentwürfen<br />
findet sich davon wenig. »Internet-Governance<br />
steht gar nicht auf der Agenda«, bestätigt ITU-<br />
Generalsekretär Hamadoun Touré. Und selbst<br />
wenn es so wäre, Amerikaner und Europäer<br />
könnten jede Schwellenländer-Initiative blockieren,<br />
denn die 193 ITU-Mitgliedsstaaten treffen<br />
Datenverkehr im Internet<br />
Google, Apple – und ein Buhmann<br />
Geht es ums Geld? Oder um die Freiheit des Internet? Eine Konferenz der Vereinten Nationen wird zur Bühne für eine große Lobbyschlacht VON NIKLAS WIRMINGHAUS<br />
ihre Beschlüsse traditionell einstimmig. Es geht<br />
nun mal um technische Standards, die nur Sinn<br />
ergeben, wenn alle mitmachen.<br />
Dessen ungeachtet kommt eine netzpolitische<br />
Bewegung in Gang, die gegen einen neuen ITU-<br />
Vertrag mobil macht. Netzaktivisten und Bürgerrechtler<br />
verfassen offene Briefe; in den USA<br />
verurteilen Republikaner und Demokraten in<br />
seltener Eintracht den vermeintlichen Zugriff der<br />
UN-Sonderorganisation aufs Internet. Immer<br />
wieder zu vernehmen: Google. In der <strong>ZEIT</strong> (Nr.<br />
34/12) beklagte Konzernlobbyist William Echikson,<br />
»dass eine Reihe von Regierungen daran<br />
arbeitet, die Freiheit des Internets einzuschränken,<br />
wenn nicht zu zerstören«.<br />
Die Logik erschließt sich nur, wenn man weiß,<br />
dass neben der Schwellenländer-Debatte ein wirtschaftlicher<br />
Konflikt tobt: Wer investiert in den<br />
Ausbau des Internets und wer trägt die Kosten?<br />
Auf der einen Seite stehen Internetfirmen wie<br />
Google und Facebook, die immer größere Datenmengen<br />
durchs Netz schicken. Auf der anderen<br />
Seite stehen die Betreiber der Netzinfrastruktur,<br />
zumeist traditionelle Telekom-Konzerne. Sie<br />
wollen sich nicht länger damit abfinden, dass<br />
Google und Co. ihnen nur überschaubare Summen<br />
überweisen und zugleich Renditen zwischen<br />
20 und 30 Prozent einfahren, während die Gewinne<br />
etwa der Deutschen Telekom im niedrigen<br />
einstelligen Bereich liegen. Es gehe darum, »diejenigen,<br />
die mit ihren Geschäftsmodellen von den<br />
Netzen profitieren, auch verursachungsgerecht<br />
an den Kosten zu beteiligen«, argumentiert der<br />
deutsche Konzern.<br />
Zusammen mit 40 weiteren Konzernen hat<br />
die Telekom deshalb über die Vereinigung der<br />
europäischen Netzbetreiber namens Etno Änderungsvorschläge<br />
für den ITU-Vertrag unterbreitet.<br />
Es sind Vorschläge. Abstimmen dürfen<br />
nur Staaten, und deshalb findet die Lobbyschlacht<br />
vor und hinter den Kulissen statt.<br />
Vor allem wollen die Telekom-Konzerne ein<br />
Business-Class-Internet einführen.<br />
Bislang funktioniert der Internetverkehr bemerkenswert<br />
egalitär. Für den Versand werden<br />
Daten in viele verschiedene Pakete aufgeteilt und<br />
erst am Bestimmungsort wieder zusammengesetzt.<br />
Das Netz behandelt dabei alle Pakete gleich<br />
– ganz egal, welchen Inhalt sie transportieren und<br />
wie groß sie sind. Ein YouTube-Video hat nicht<br />
mehr Rechte als eine E-Mail.<br />
Der Telekom-Vorschlag würde mit diesem<br />
Prinzip der sogenannten Netzneutralität brechen.<br />
Wer große Datenmengen schnell befördern will,<br />
also im Business-Class-Internet, soll höhere Gebühren<br />
zahlen. Bewegtbilder vom Google-Videoportal<br />
YouTube dürften künftig wohl nur gegen<br />
Aufschlag ruckelfrei übertragen werden. Kritiker<br />
glauben, dass dann nicht nur für Google, sondern<br />
auch für Start-ups die Kosten steigen würden,<br />
durch eine solche Regelung also Innovation erschwert<br />
würde. Die Telekom hingegen preist das<br />
Konzept als »intelligente Steuerung des Internetverkehrs«<br />
und »effizientere Netznutzung«.<br />
Nicht weniger revolutionär ist ein zweiter Vorschlag<br />
der Telekom-Unternehmen. An den Berührungspunkten<br />
der Datenleitungen verschiedener<br />
Firmen fließen die Datenströme bislang<br />
weitgehend kostenfrei hin und her. Das soll sich<br />
ändern. Ruft ein Nutzer ein YouTube-Video auf,<br />
soll künftig auch YouTube dafür zahlen (beziehungsweise<br />
die Muttergesellschaft Google).<br />
Kritiker halten das Modell allerdings für bürokratisch<br />
und unpraktikabel.<br />
Bei der ITU gibt es offensichtlich Sympathien<br />
für die Vorschläge der Telekommunika<br />
tionsunternehmen, Generalsekretär Touré gibt<br />
als Ziel für Dubai aus, »ausreichend Investment<br />
in die Infrastruktur zu sichern, um mit dem<br />
exponentiellen Wachstum der Datenströme mithalten<br />
zu können«.<br />
Doch je mehr die Konferenz in den nächsten<br />
Monaten in den Ruf kommt, dort würden autoritäre<br />
Staaten versuchen, das Internet zu übernehmen,<br />
desto geringer werden die Chancen<br />
auf einen neuen Vertrag. »Es wird viel Lärm<br />
geben und am Schluss wird wenig herauskommen«,<br />
prophezeit Wolfgang Kleinwächter,<br />
Professor für Internetpolitik an der dänischen<br />
Universität Aarhus.<br />
Zumindest Hamadoun Touré glaubt noch<br />
an den Erfolg. Schließlich hätten sich sogar<br />
während des Kalten Krieges die USA und die<br />
Sowjetunion in der ITU auf gemeinsame Standards<br />
geeinigt, sagt er. »Diesmal ist es nicht<br />
schlimmer.«
WIRTSCHAFT<br />
Geschacher<br />
um Jobs<br />
Über eine Fusion der beiden Rüstungskonzerne EADS und BAE<br />
Systems entscheiden nationale Interessen VON JOHN F. JUNGCLAUSSEN<br />
Es begann mit zwei bitteren Niederlagen.<br />
Vergangenes Jahr verlor der EADS-<br />
Konzern das Wettbieten um einen<br />
35-Milliarden-Dollar-Auftrag für<br />
Tankflugzeuge für die amerikanische<br />
Luftwaffe an Boeing. Den Europäern war klar, dass<br />
sie auch in Zukunft keine nennenswerte Rolle auf<br />
dem größten Rüstungsmarkt der Welt spielen wür-<br />
den. Dann, im Januar, wurden die Briten in Indien<br />
geschlagen, als die dortige Regierung entschied,<br />
ihre Luftwaffe nicht mit dem Eurofighter von BAE<br />
Systems auszustatten, sondern mit dem Rafale-Jet<br />
des französischen Konkurrenten Dassault. Zwei<br />
Monate später trafen sich die Besiegten zur Manö-<br />
verkritik in München. BAE-Chef Ian King und der<br />
Vorstandschef von EADS, Thomas Enders, sind<br />
Partner im Eurofighter-Konsortium und diskutierten,<br />
was beim Indien-Deal schiefgelaufen war. Die<br />
beiden Männer könnten gar nicht unterschiedlicher<br />
sein. Der eine, King, ein nüchterner Schotte,<br />
der seine Karriere als Buchhalter begonnen hatte,<br />
und der andere, Enders, ein forscher Deutscher, der<br />
einst Fallschirmspringer bei der Bundeswehr war.<br />
Und dennoch dauerte es nicht lange, bis sie einen<br />
wahrlich ambitionierten Plan entwickelten.<br />
Durch eine Fusion von EADS und BAE Systems<br />
wollen sie den zweitgrößten Rüstungs-, Raum- und<br />
Luftfahrtkonzern der Welt erschaffen. Es wäre »ein<br />
Koloss mit enormer Feuerkraft«, sagt Michael Clarke<br />
vom Londoner Militär-Thinktank Rusi. Der gemeinsame<br />
Jahresumsatz läge bei rund 75 Milliarden Euro,<br />
aber die beiden Konzernteile würden weiterhin unabhängig<br />
von einander an den Börsen von Amsterdam<br />
und London notiert bleiben. Thomas Enders<br />
übernähme die Führung.<br />
»Die indische Niederlage war deswegen so<br />
schlimm für BAE, weil sie klar gezeigt hat, wie verwundbar<br />
das Unternehmen geworden ist«, sagt der<br />
Analyst von der Citibank, Jeremy Bragg. »Die Verteidigungsbudgets<br />
der westlichen Industrienationen<br />
sind in den vergangenen Jahren ausnahmslos verkleinert<br />
worden, und das bedeutet, dass Deals wie der<br />
mit Indien extrem wichtig werden.« Um im Geschäft<br />
zu bleiben, muss BAE Systems also vielseitiger werden.<br />
EADS dagegen würde durch den Zusammenschluss<br />
endlich Zugang zum US-Markt gewinnen.<br />
Nur handelt es sich eben nicht um Supermarktketten,<br />
sondern um zwei Unternehmen, auf die<br />
deutsche, französische und britische Regierungen<br />
direkten Einfluss nehmen.<br />
In London herrscht seit einer Woche Verwirrung.<br />
Aus der Downing Street hörte man, die Regierung<br />
sei von Anfang an eingeweiht gewesen. »Grundsätzlich<br />
verschließt sich der Premierminister nicht der<br />
wirtschaftlichen Logik des Deals«, sagt ein Mitarbeiter<br />
aus dem Stab von David Cameron. Sein Wirtschaftsminister<br />
Vince Cable dagegen warnte: »Nach<br />
geltendem Arbeitsrecht ist es bei uns viel leichter,<br />
Stellen abzubauen, als in Deutschland und in Frankreich.<br />
Dieser Deal kann nur funktionieren, wenn<br />
britische Arbeiter nicht dafür bezahlen müssen.« Zugleich<br />
wies der Industrieverband CBI darauf hin, dass<br />
ein Zusammenschluss die Chance biete, den britischen<br />
Anteil an der Airbus-Produktion auszubauen.<br />
Der war in den vergangenen Jahren von etwas über<br />
20 Prozent auf knapp 15 Prozent gesunken.<br />
Im britischen Militär sind dagegen Stimmen des<br />
Entsetzens zu hören. BAE Systems steht hinter dem<br />
nuklearen Abschreckungsprogramm Trident, das in<br />
den nächsten Jahren erneuert werden soll. »Es muss<br />
absolut sichergestellt werden, dass unsere nationalen<br />
Sicherheitsinteressen hier nicht gefährdet werden«,<br />
sagt ein ranghoher Offizier aus dem Verteidigungsministerium.<br />
»Auch für die Franzosen«, so glaubt er,<br />
werde dies ein echtes Problem, »denn EADS stellt<br />
eine Reihe von Komponenten für das französische<br />
Atomwaffenarsenal her«.<br />
Es gibt noch einen weiteren Einwand. »Einer der<br />
wichtigsten Aspekte der britischen Verteidigungspolitik<br />
der vergangenen sechs Jahrzehnte ist die besondere<br />
Beziehung zu den USA«, erklärt der Soldat.<br />
»Militärisch gesehen, sind wir der wichtigste Ver-<br />
bündete der Amerikaner in Europa, weswegen BAE<br />
Systems auch der größte ausländische Lieferant für<br />
die US-Armee ist. Eine Fusion könnte nicht nur<br />
bedeuten, dass sich der größte Markt auf einmal<br />
schließt, sondern auch, dass die Amerikaner dies als<br />
Signal verstehen, wir Briten würden uns von ihnen<br />
abwenden. Das wäre fatal.«<br />
Tatsächlich müssen sich Enders und King nicht<br />
nur um die Regierungen in Berlin, London und Paris<br />
bemühen, sondern auch um die Administration in<br />
Washington. Zwar sieht der Fusionsplan eine Abschottung<br />
der militärischen Kontrakte mit dem<br />
Pentagon vom Rest des Unternehmens vor. »Wenn<br />
aber das Kongresskomitee für ausländische Investitionen<br />
den Fall in den nächsten Wochen behandelt,<br />
kann es durchaus sein, dass die Politiker eine Gefährdung<br />
der nationalen Sicherheitsinteressen erkennen«,<br />
glaubt Militärexperte Michael Clarke.<br />
Und wie reagieren die Franzosen? Enders und<br />
King haben keine Spitzenposition für einen französischen<br />
EADS-Manager vorgesehen, und in Berlin<br />
scheint man dies nicht weiter kommentieren zu<br />
wollen. Genau wie Enders hält es auch die Bundesregierung<br />
für sinnvoll, den Bundesanteil an EADS<br />
von 22,5 Prozent aufzugeben. »Damit ist Berlin mit<br />
seinen Interessen eher auf Augenhöhe mit London<br />
als mit Paris. Dort wird eine staatliche Beteiligung an<br />
so einem Koloss nicht gerne aufgegeben«, glaubt Jeremy<br />
Bragg von der Citibank. »Der Vorschlag, dass<br />
die drei Regierungen je eine ›goldene Aktie‹ bekommen,<br />
mit der sie mögliche Übernahmen verhindern<br />
können, um nationale Sicherheitsinteressen zu schützen,<br />
ist für Deutsche und Briten akzeptabel, aber zum<br />
französischen Selbstbild passt es nicht.«<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 25<br />
Auch in Berlin sorgt man sich um Arbeitsplätze.<br />
»Wir müssen verhindern, dass sich die Industrieproduktion<br />
innerhalb der neuen Gruppe<br />
nach Frankreich verlagert, wo es ja schon jetzt<br />
eine erheblich größere Militärindustrie gibt als in<br />
Deutschland«, erklärt eine Mitarbeiterin des Wirtschaftsministeriums.<br />
EADS-Chef Enders wird<br />
bald die Gelegenheit haben, die entscheidenden<br />
Personen zu überzeugen. Auf einem Jobgipfel wollen<br />
Angela Merkel, David Cameron und François<br />
Hollande gemeinsam über die Zukunft von BAE<br />
Systems und EADS beraten.<br />
A www.zeit.de/audio<br />
Ein Eurofighter auf der<br />
Pariser Luftfahrtschau<br />
Foto [M]: Remy de la Mauviniere/AP/dapd
26 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> WIRTSCHAFT<br />
<strong>ZEIT</strong>-GRAFIK<br />
250 km<br />
MONGOLEI<br />
Die Nomadenfamilie Zogtgerel<br />
Der Minenmanager B. Batsaikhan<br />
Ulan Bator<br />
Provinz<br />
Südgobi<br />
RUSSLAND<br />
TAVAN TOLGOI<br />
CHINA<br />
Der Schatz von Tavan Tolgoi<br />
An jedem zweiten Tag macht sich<br />
die Nomadin Erdenechimeg<br />
auf den Weg in die Moderne.<br />
Sie erwacht in der Jurte, dem<br />
Ger, in der die Familie eng aneinandergekuschelt<br />
geschlafen<br />
hat, noch schnarcht ihr Mann,<br />
ihr Sohn pfeift und draußen seufzen die Kamele.<br />
Sorgfältig legt sie die Schmetterlingsohrringe<br />
an, cremt sich die Haut, schlüpft in ihr grünes<br />
Shirt, und sieht plötzlich kein bisschen mehr aus<br />
wie eine Nomadin. Sie steigt in den Jeep, rumpelt<br />
über den Wüstensand, nach Tavan Tolgoi, zum<br />
größten Kokskohlevorkommen der Welt. Ihr<br />
Mann bleibt zurück, bei den Tieren. Wenn er, der<br />
Nomade Zogtgerel, für die Vergangenheit der<br />
Mongolei steht, dann repräsentiert Erdenechimeg<br />
ihre Zukunft: den Bergbau.<br />
Wer die Zogtgerels besuchen will, muss kurz, bevor<br />
er das Ende der Welt erreicht, mitten im Nichts<br />
scharf links abbiegen, muss kilometerweit über Wüstensand<br />
brettern, bis er zwei Jurten erblickt, klein wie<br />
Segelschiffe in einem Meer aus Steppe, Sand und endlosem<br />
Himmel. Am Horizont eine Bergkette, leicht<br />
wie ein Pinselstrich. Der Besucher schlängelt sich<br />
vorbei an Schafen, Ziegen und Kamelen und macht<br />
sich den riesigen Hund besser zum Freund. In der<br />
Jurte wartet Zogtgerel, ein Typ, der so gern trinkt wie<br />
er lacht. Seine Nägel sind neonrosa angemalt, das<br />
waren die Kinder, egal, sagt er, »die Tiere wird’s schon<br />
nicht stören«. Neben ihm walkt Erdenechimeg Nudelteig<br />
und bedenkt ihren Mann mit liebevollem<br />
Spott. Zwei ihrer fünf Kinder und drei kleine Verwandte<br />
purzeln unentwegt übereinander und über<br />
alle anderen Anwesenden.<br />
Der Abend wird innerhalb von Minuten zum<br />
Ereignis. Es wird gelacht und erzählt, man schenkt<br />
Kamelmilch aus und Wodka. Der kleine solarzellenbetriebene<br />
Fernseher plärrt die mongolischen<br />
Popsongs in die Wüste hinaus. 20 Kilometer hinter<br />
Tsogtsesi, in der Provinz Südgobi, ist der Nachthimmel<br />
ein See aus Sternen.<br />
Schon immer waren die Zogtgerels Nomaden,<br />
so wie ihre Vorfahren und Vorvorfahren. Zogtgerel<br />
und Erdenechimeg waren Anfang 20, als sie sich<br />
auf einer Weide kennenlernten, schon bald, mit<br />
Mitte 40, werden sie ihre silberne Hochzeit feiern.<br />
Es ist, lacht Zogtgerel wodkabeseelt, »einfach Liebe«.<br />
In all den Jahren hat sich einiges verändert, sie<br />
haben sich Handys besorgt, im Fernsehen laufen<br />
schon lange keine sozialistischen Schauparaden<br />
mehr. Und doch ist das Leben irgendwie gleich geblieben.<br />
Mittags bringen sie die Tiere zum Tränken,<br />
im Winter führen sie sie auf die Winterweide.<br />
Sie melken Kamele und Schafe, buttern und<br />
schlachten, scheren und drehen Seile aus langem<br />
Kamelhaar.<br />
Bis vor ein paar Jahren der Kohlehügel in Tavan<br />
Tolgoi auftauchte und größer und größer wurde. Eine<br />
Straße wurde gebaut, auf der brettern jetzt die Kohlelaster<br />
Richtung chinesische Grenze. Bald hörte<br />
Erdenechimeg in der Stadt, dass das Staatsunternehmen<br />
Erdenet Mitarbeiter suchte. Weil es viel Geld<br />
kostet, fünf Kinder großzuziehen, reihte sich Erdenechimeg<br />
in die Schlange der Arbeitssuchenden ein.<br />
Sie wurde genommen, seit zwei Jahren arbeitet sie<br />
dort als Wäscherin. Das Familienmodell findet sich<br />
jetzt immer öfter in der Gegend: Die Frau ist berufstätig,<br />
der Mann bleibt bei den Tieren.<br />
Banken und Hotels haben eröffnet,<br />
ein Dandy stolziert durch den Staub<br />
Ulan-Bator. Wer aus dem Büro von C. Otgochuluu<br />
blickt, der genießt einen einzigartigen Blick<br />
über die Stadt. Und was für eine Stadt! Zusammengewürfelt<br />
aus Sowjetbauten, New-Economy-<br />
Architektur, Holzhäuschen und Gers, als habe sie<br />
einer aus dem All auf die Steppe fallen lassen.<br />
Hochhäuser kriechen empor, dazwischen ruht ein<br />
Riesenrad, in der Ferne blickt Dschingis Khan<br />
über die Stadt – sie haben sein Konterfei mit weißen<br />
Steinen auf die Hügel gesetzt. Otgochuluu<br />
nickt: »Irrer Ausblick, was?« Er ist Direktor des<br />
Economic Policy and Competitiveness Center,<br />
dem ersten privaten Thinktank des Landes.<br />
»Im vergangenen Jahr hatten wir ein Wirtschaftswachstum<br />
von 17,3 Prozent«, sagt er. In zwei Jahren<br />
»wird die Wirtschaft voraussichtlich um 30 bis 53<br />
Prozent wachsen« – dann, wenn die beiden gewaltigen<br />
Minen in der Südgobi voll entwickelt seien: Tavan<br />
Tolgoi, wo die Teilzeitnomadin Erdenechimeg<br />
arbeitet, sowie Uyo Tolgoi etwas weiter im Süden, wo<br />
das größte unberührte Gold- und Kupfervorkommen<br />
der Welt im Boden schlummert. Wahrscheinlich wird<br />
die Mongolei in der nächsten Dekade schneller wachsen<br />
als jedes andere Land der Erde. Wegen der Rohstoffe.<br />
Die Weltmarktpreise steigen, und die Nachfrage<br />
aus China ist schier unerschöpflich.<br />
Allein die zehn größten Bergbauprojekte des<br />
Landes bergen Reichtümer im Wert von geschätzten<br />
2,2 Billionen US-Dollar. Ein neues Katar, ein<br />
neues Brunei in der Steppe, so haben manche die<br />
Mongolei genannt. Man würde meinen, einer wie<br />
Otgochuluu müsste jetzt jubilieren, sich an der<br />
Goldgräberstimmung berauschen, doch stattdessen<br />
wiegt er vorsichtig den Kopf. »Wir sind auf<br />
den Boom überhaupt nicht vorbereitet.« Er hat<br />
noch ein anderes Szenario vor Augen und das ist<br />
der denkbar größte Gegenpol zu Katar: Nigeria.<br />
Beide Länder sind rohstoffreich. Im einen führte<br />
das zu allgemeinem Wohlstand. Im anderen zu<br />
extremer Ungleichheit und Gewalt. Otgochuluu<br />
bemüht das Schreckgespenst, das jeder Intellektuelle<br />
auf den Lippen hat, der sich um die Zukunft<br />
des Landes sorgt: »Dutch Disease«, die holländische<br />
Krankheit. Man konnte sie in einer ganzen<br />
Reihe von Staaten beobachten. Im Spanien des 16.<br />
Jahrhunderts etwa, im Australien des 19. Jahrhunderts,<br />
in den Niederlanden nach 1960, im Aserbaidschan<br />
nach 2000, und eben auch in Nigeria.<br />
Dutch Disease entsteht in etwa so: Der Boom<br />
in einem rohstoffreichen Land treibt seine Währung<br />
nach oben. Die Produkte des Landes werden<br />
dadurch im Ausland sehr teuer, darunter leidet die<br />
verarbeitende Industrie. Den Rohstofffirmen<br />
macht das wenig aus. Sie können ihre Leute so gut<br />
bezahlen, dass sie die größten Talente des Landes<br />
anziehen. Die wiederum fehlen dann in anderen<br />
Industriezweigen. Firmen müssen schließen, Industriezweige<br />
wanken, es kommt zu hoher Arbeitslosigkeit<br />
und extremer Ungleichheit.<br />
Der Bergbau selbst schafft nur wenige Jobs.<br />
»Der macht 20 Prozent unseres Bruttosozialprodukts<br />
aus und mehr als 90 Prozent unserer Exporte.<br />
Doch nur 1,5 Prozent der Bevölkerung arbeiten<br />
dort.« Otgochuluu runzelt die Stirn. »Wir hatten<br />
noch nie eine nennenswerte Mittelklasse. Zu Sowjetzeiten<br />
gab es sie nicht, und seither hat sie sich<br />
nicht entwickelt.« Und doch liegen gleich unter<br />
Otgochuluus Büro Luxusshops, in denen sich die<br />
Neu- und Superreichen einkleiden. Ein Rohstoffboom,<br />
er kann zum Segen werden oder zum Fluch.<br />
Provinz Südgobi. Erdenechimeg steuert den<br />
Jeep in das Kaff Tsogtsesi, im Hintergrund erhebt<br />
sich der riesige Kohlehügel von Tavan Tolgoi.<br />
Tsogtsesi ist ein Ort, so unwirklich, als habe ihn<br />
sich der Regisseur Wim Wenders ausgedacht. Ein<br />
Wildwestort mitten im Osten, staubig und karg,<br />
würde sich darüber nicht ein Wüstenhimmel wölben,<br />
der mit aller Tristesse auf Erden versöhnt.<br />
Bergarbeiter in orangefarbenen Helmen stiefeln<br />
vorbei, Nomaden brettern auf Motorrädern, in<br />
Baracken wurden Bars und Geschäfte eingerichtet.<br />
Und doch steckt Tsogtsesi mitten in einer Verwandlung.<br />
Banken und Hotels haben eröffnet, ein<br />
mongolischer Dandy stolziert durch den Staub,<br />
Wildlederstiefeletten zu britischer Tolle. In verzweifelter<br />
Entschlossenheit schiebt ein Paar einen<br />
Kinderwagen durch Sanddünen, immer wieder<br />
rutscht er hinunter, doch sie lassen nicht ab. Tsogtsesi<br />
schickt sich an, Stadt zu spielen, da wollen sie<br />
nicht nachstehen.<br />
Seit Erdenechimeg als Wäscherin arbeitet, hat<br />
sich ihr Leben schlagartig verändert. »Ich habe so<br />
viele Leute kennengelernt, Freunde gefunden.<br />
Draußen bei den Tieren lebst du so abgeschottet.«<br />
Erdenechimeg ist innerhalb von zwei Jahren ein<br />
wenig zur Stadtfrau geworden, sie klagt über die<br />
Doppelbelastung und doch spürt man, dass sie<br />
ihre Rolle auch genießt. Die Zogtgerels haben jetzt<br />
ein festes Einkommen, und nicht immer nur dann<br />
Geld, wenn gerade geschlachtet wird und sie das<br />
Fleisch verkaufen. Ihr Leben hat an Sicherheit gewonnen,<br />
sie können ihr Fleisch und ihre Milch<br />
teurer verkaufen, auch hat der Fortschritt neue
WIRTSCHAFT<br />
Unter den Wüsten und Steppen der Mongolei lagern gewaltige Rohstoff vorkommen. Kann<br />
das Land davon profi tieren – oder wird sein Reichtum zum Fluch? VON ANGELA KÖCKRITZ<br />
Möglichkeiten geschaffen: Ihre Tochter macht gerade<br />
ein Praktikum in der Bank in Tsogtsesi.<br />
Und doch, sagen die Zogtgerels, hat die Entwicklung<br />
zwei Seiten. Die andere Seite, das sind<br />
die Zäune und die Mauern, die jetzt überall gebaut<br />
werden. »Früher«, sagt Zogtgerel, »konnten wir die<br />
Tiere hinführen, wo wir wollten. Jetzt können wir<br />
uns nicht mehr so frei bewegen.« Auch die Wasserknappheit<br />
macht Zogtgerel Sorgen. »Ich weiß<br />
nicht, ob es daran liegt, dass unser Brunnen schon<br />
so alt ist oder ob es mit dem Bergbau zu tun hat,<br />
doch in der letzten Zeit ist der Wasserspiegel stark<br />
gesunken.« Umweltschützer teilen seine Bedenken,<br />
sie kritisieren die Bergbauprojekte scharf, entstehen<br />
doch ausgerechnet die beiden größten des<br />
Landes im fragilen Ökosystem der Gobiwüste.<br />
Der Kohlehügel, sagt Zogtgerel, wehe an windigen<br />
Tagen Staub und Schmutz auf die Weiden, »für<br />
die Tiere ist das nicht gut«.<br />
Im Camp des Staatsunternehmens Erdenet<br />
wartet bereits sein Kollege, Campleiter R. Natsagdash.<br />
Er ist ein viel beschäftigter Mann, immer<br />
klingelt eines seiner beiden Handys, dann wieder<br />
kommen Parlamentarier zu Besuch, alle wollen<br />
wissen, wie es vorangeht. Er steht in seinem kleinen<br />
Containerbüro, gleich dahinter liegt die<br />
Waschküche, in der Erdenechimeg arbeitet, und<br />
tippt auf eine Karte, auf der unterschiedlich große<br />
Kringel zu sehen sind: die Vorkommen. 6,4 Milliarden<br />
Tonnen hochwertiger Kokskohle liegen hier.<br />
Noch beschäftigt das Projekt gerade mal 300 Mitarbeiter,<br />
2016 aber wird es das größte staatliche<br />
Bergbauunternehmen des Landes sein.<br />
Der Bauleiter ist kein Typ, der zu Überschwänglichkeit<br />
neigt, und doch malt er fantastische<br />
Visionen in den Gobisand. Die Kohle soll in<br />
einem ersten Verarbeitungsschritt gereinigt werden,<br />
ein Kraftwerk soll entstehen, ein Industriekomplex,<br />
zu viel wolle er da allerdings noch nicht<br />
verraten. Mitten in der Wüste soll eine neue Stadt<br />
gebaut werden, eine Erdenet-Stadt für Erdenet-<br />
Mitarbeiter, für 10 000 Menschen hat man geplant.<br />
Das mit dem Wasser, sagt der Campleiter,<br />
sei gar kein Problem, »wir haben da staatliche Gutachten«.<br />
Die Botschaft des Campleiters: Die Mine<br />
schafft Arbeitsplätze. Und nutzt außerdem jedem<br />
Mongolen. »Unabhängig vom Alter und Geschlecht<br />
soll jeder Mongole Anteile am Unternehmen<br />
erhalten. Wenn sie die nicht wollen, können<br />
sie sie verkaufen und Bargeld dafür bekommen.«<br />
Für Erdenechimeg und Zogtgerel steht fest: Sie<br />
werden die Aktien behalten. Ein bisschen haben<br />
sie sich schon an Geschenke des Staates gewöhnt.<br />
Vor der letzten Wahl hat man ihnen 500 000 Tugrig<br />
versprochen, etwa 300 Euro, 300 000 haben sie<br />
dann wirklich bekommen. »Wie wir das ausgegeben<br />
haben? Ach, keine Ahnung«, lacht Zogtgerel.<br />
»Irgendwie haben wir’s schon verbraten. Wahrscheinlich<br />
für das Studium der Töchter.« Im Prinzip<br />
aber findet er die Bargeldgeschenke nicht richtig.<br />
»Viel besser wäre es doch gewesen, der Staat<br />
hätte mit dem Geld Schulen und Straßen gebaut,<br />
das hätte allen etwas gebracht.« Zogtgerel glaubt,<br />
dass von dem Bergbauboom nur wenige profitieren<br />
werden. »Und wir gehören nicht dazu.«<br />
Das mit den Cash-Handouts, sagt Otgochuluu,<br />
der Mann von dem Thinktank, war einfach nur fatal.<br />
»Das ganze Hot Money macht die Politiker völlig<br />
kurzsichtig. Sie machten Wahlgeschenke, bei der<br />
letzten Wahl bekam jeder Mongole Bargeld, und was<br />
waren die Folgen? Die Inflation ging hoch, die Zentralbank<br />
erhöhte den Leitzins, der Privatsektor litt,<br />
und viele Jobs wurden vernichtet.« Ob die Mongolei<br />
es schaffen wird, ihren Reichtum gut zu verwalten,<br />
das liege an den Menschen, glaubt Otgochuluu. Und<br />
an politischen Institutionen.<br />
Einerseits scheinen diese, trotz Korruption, für<br />
eine junge Demokratie recht stabil zu sein – eine<br />
Ausnahme waren die Unruhen bei der Wahl von<br />
2008. Andererseits aber wirken sie bisweilen ähnlich<br />
zusammengewürfelt wie die Architektur Ulan-<br />
Bators. Beim Wahlrecht hat man sich sowohl von<br />
Deutschland als auch von Großbritannien inspirieren<br />
lassen, beim Budgetrecht von Neuseeland,<br />
»von jedem ein bisschen, und am Ende passt es<br />
nicht wirklich zusammen«, sagt Otgochuluu.<br />
Was die Mongolei außer Bodenschätzen<br />
noch zu bieten hat, ist schwer zu sagen<br />
Mit einem Mal geht die Tür auf und P. Tsagaan<br />
schreitet herein, der Berater des Präsidenten für<br />
Rohstoffpolitik. Kopfschüttelnd überreicht er seine<br />
Visitenkarte: »Da steht Senior Advisor drauf,<br />
dabei müsste es doch Chief Advisor heißen. Pff,<br />
meine Berater können alle kein Englisch.« Die<br />
Bargeldgeschenke ans Volk, sagt er, »waren ein<br />
wirklich schlechtes Beispiel. Das Parlament hat sie<br />
jetzt verboten«.<br />
Ein Staatsfonds, das sei die einzige Lösung,<br />
»Dutch Disease und den Fluch der Bodenschätze<br />
zu vermeiden«. Nur so könnten die Einnahmen<br />
aus den Bodenschätzen sinnvoll verwaltet werden.<br />
»Wir schauen uns das genau an, 60 Länder haben<br />
ganz unterschiedliche Lösungen gefunden.« Er<br />
persönlich liebäugele mit dem norwegischen Pensionsfonds,<br />
auch einige arabische Länder hätten<br />
gute Lösungen gefunden. Statt Bargeld zu verteilen,<br />
solle die Regierung lieber soziale Anreize setzen.<br />
»Kindergeld zum Beispiel.«<br />
Die eine Frage ist, wie man die Einnahmen aus<br />
den Bodenschätzen sinnvoll verwaltet. Die andere,<br />
was die Mongolei außer Bodenschätzen eigentlich<br />
zu bieten hat. Wenn das Land wirklich dem Fluch<br />
der Bodenschätze entkommen will: Welche Geschäftszweige<br />
könnte es dann noch entwickeln?<br />
Keine einfache Frage – bei diesen Nachbarn.<br />
Südgobi, Tavan Tolgoi. Mitten in der Wüste<br />
tut sich ein schwarzer Schlund auf, Bagger graben<br />
sich tief in die Kohlevorkommen hinein. Am<br />
Rand des Abgrunds steht Minenmanager B. Batsaikhan,<br />
ein bulliger Typ, Goldringe an dicken<br />
Fingern, die Sonnenbrille erinnert an Men in<br />
Black. Er ist kein Mann der großen Worte. Lieber<br />
raucht er genüsslich vor einem »Hier können Sie<br />
rauchen«-Schild, eher wirkt es wie ein »Hier können<br />
Sie nicht rauchen«-Schild, dem einer das<br />
»nicht« davongetragen hat, doch wer könnte das<br />
hier schon so genau sagen. Er nickt zu den Kohlelastern.<br />
»Kommt alles nach China. Bald werden<br />
wir die größten Exporteure des Landes sein.« Noch<br />
liefern sie unter Weltmarktpreis, eine Tonne für 70<br />
US-Dollar.<br />
Otgochuluu lächelt müde. »Der niedrige Preis,<br />
den wir für unsere Kohle bekommen, das hat ein<br />
wenig damit zu tun, dass die Kohle noch nicht veredelt<br />
ist. Viel mehr aber mit der Macht der Chinesen.<br />
China ist unser einziger Käufer. Es absorbiert<br />
92 Prozent unserer Exporte und versorgt uns mit<br />
der Hälfte an Importen, Öl nicht eingeschlossen.<br />
Das mongolische Wachstum hängt ganz am chinesischen.«<br />
Das zu akzeptieren ist für viele Mongolen<br />
nicht einfach, pflegen sie doch ihre antichinesischen<br />
Ressentiments mit Leidenschaft.<br />
»Keines der Viehzüchterkinder<br />
will mehr Viehzüchter sein«<br />
Sie sind ein Erbe des jahrtausendealten Konfliktes<br />
zwischen Nomaden und sesshaften Bauern, vor allem<br />
aber das Erbe einer Zeit, als die Qing-Dynastie die<br />
Mongolei beherrschte. Chinesische Männer, die mit<br />
mongolischen Frauen ausgehen, werden bisweilen<br />
verprügelt, chinesische Wanderarbeiter ebenso – was<br />
viele Mongolen achselzuckend quittieren. »So was<br />
passiert eben«, heißt es dann.<br />
Ganz im Gegensatz dazu steht das diplomatische<br />
Geschick und Feingefühl, das die Mongolei<br />
auf der internationalen Bühne aufbringen muss.<br />
Eingezwängt zwischen zwei Großmächten, Russland<br />
und China, hat jedes Detail das Potenzial,<br />
zur Staatsaffäre zu werden. So auch die Mine Tavan<br />
Tolgoi. Eigentlich sollte sie vom chinesischen<br />
Konzern Shenhua, Peabody sowie einer russischmongolischen<br />
Gruppe gemeinsam entwickelt<br />
werden. Dann aber protestierten Japaner und<br />
Südkoreaner, weil man sie nicht einbezogen hatte,<br />
und die mongolische Regierung blies das Projekt<br />
ab.<br />
Die Mongolei muss auf viele Staaten Rücksicht<br />
nehmen. Um die Übermacht Chinas und Russlands<br />
zu kontern, hat sie die Politik des Dritten<br />
Nachbarn entwickelt. Südkorea, Japan, die USA,<br />
Deutschland, auch Italien zählt die Mongolei zu<br />
diesem Kreis. Gerne würde man dem Einfluss<br />
Chinas auch durch ein Bündnis mit Indien begegnen,<br />
»doch die Inder sind leider nicht so aktiv«.<br />
Die strategische Lage beherrscht auch die<br />
Volkswirtschaft der Mongolei. Die berühmte Eisenbahnlinie<br />
etwa. Sie verläuft einspurig, gerne<br />
würde die Regierung sie ausbauen. Das aber führt<br />
zu allerlei Verwicklungen und Problemen mit dem<br />
russischen Staat, dem 50 Prozent der Linie gehören.<br />
Ähnlich verhält es sich mit den Exporten. Allzu<br />
gerne würde die Mongolei mehr Waren nach<br />
Europa exportieren, doch dazu müssten sie Russland<br />
passieren, »und die Transitgebühren sind<br />
sehr, sehr hoch«, sagt Otgochuluu.<br />
Ohnehin stellt sich die Frage: Was will die<br />
Mongolei eigentlich exportieren, wo China, der<br />
Nachbar im Süden, der Welt doch fast alles billiger<br />
und in besserer Qualität bieten kann? In sozialistischen<br />
Zeiten war die mongolische Industrie entwickelter<br />
als heute. Damals waren etwa 30 Prozent<br />
der Fleischexporte verarbeitet, heute ist es nur<br />
noch ein verschwindend geringer Teil. Aus der<br />
Mongolei stammt zwar ein Drittel der weltweiten<br />
Kaschmirproduktion, das meiste aber wird als<br />
Rohstoff in andere Länder geliefert. Nur wenige<br />
Firmen wie zum Beispiel Gobi schneidern daraus<br />
auch Kleider.<br />
Was Otgochuluu nicht davon abhält, von einer<br />
Zukunft zu träumen, in der die Mongolei Ökofleisch<br />
und feine Kaschmirkleidung in die ganze<br />
Welt verkauft und Ökotourismus in der Steppe<br />
anbietet. »Wir können uns nicht mit China messen.<br />
Wir müssen etwas ganz anderes machen.« Mit<br />
Kaschmirpullis und Reiterferien kann man zwar<br />
nicht Millionen Jobs schaffen. Andererseits gibt es<br />
auch nur 3,18 Millionen Mongolen.<br />
Südgobi, die Jurte der Zogtgerels. Die Nacht<br />
senkt sich über der Steppe. Tochter Sumya geht<br />
die Kamele melken. Sie kann es noch immer wie<br />
im Schlaf, obwohl sie doch längst in Ulan-Bator<br />
Elektrotechnik studiert. Auch sie möchte mal bei<br />
Erdenet arbeiten, am liebsten im Kraftwerk, »so<br />
kann ich nahe bei meiner Familie sein«. Der Bergbauboom<br />
habe sein Gutes, sagt sie, und doch frage<br />
sie sich, »ob noch genug bleibt für die Generationen,<br />
die nach uns kommen«.<br />
Wie diese wohl mal leben werden? Sumya<br />
selbst will keine Viehzüchterin mehr sein, ihren<br />
Freunden und Kollegen geht das genauso. »Und<br />
trotzdem kann ich mir gar keine Mongolei ohne<br />
Nomaden vorstellen. Das macht uns doch aus.«<br />
Zogtgerel hört zu und nickt. »Ich sehe es um<br />
uns herum, keines der Viehzüchterkinder will<br />
mehr Viehzüchter sein. Wir«, sagt er und nickt in<br />
Richtung seiner Frau, »werden bei den Tieren bleiben,<br />
bis wir sterben.« Er schweigt und greift zur<br />
Wodkaflasche, einen kurzen Moment denkt er<br />
nach, will den traurigen Satz wohl nicht so stehen<br />
lassen. Er nimmt einen tiefen Schluck und lacht.<br />
Draußen seufzen die Kamele.<br />
Lastwagen fahren zur Kokskohlemine Tavan Tolgoi im Süden der Gobiwüste<br />
Ein Mädchen springt Seil vor den Toren Ulan Bators<br />
Lastwagen stehen vor dem Bergwerk von Tavan Tolgoi<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 27<br />
Fotos: Kieran Doherty/Corbis (2); Gilles Sabrie/NYT/Redux/laif (mitte); Angela Köckritz für <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> (klein, S. 26)
28 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong><br />
Kursverlauf<br />
Veränderungen<br />
seit Jahresbeginn<br />
GELD UND LEBEN<br />
Innerer Weltspartag<br />
Banken verachten das Kleingeld,<br />
das ist gar nicht schön<br />
Vermutlich geht es vielen Menschen wie mir. Am Ende<br />
des Tages leere ich meine Hosentaschen, finde dort<br />
vielleicht ein altes Taschentuch, eine Büroklammer<br />
und ein paar Münzen. Kleingeld, 1-, 2- oder 5-Cent-<br />
Stücke, auch mal was Größeres. Das Geld wandert in<br />
eine kleine Kiste im Flur, vielleicht brauche ich es<br />
später. Doch dummerweise lasse ich es am nächsten<br />
Morgen regelmäßig dort liegen, sodass ich all die<br />
kleinen Einkäufe des Tages wieder mit Scheinen bezahlen<br />
muss, nur um abends neue Münzen für die<br />
Kiste zu haben. So geht das weiter. Bis die Kiste voll<br />
und schwer geworden ist und ich mich frage: Was jetzt?<br />
Einmal bin ich eines Tages mit den Münzen aus<br />
meiner Kiste in meine Bankfiliale spaziert und dachte,<br />
die Leute da kippen das<br />
Die Woche von<br />
Marcus Rohwetter<br />
DAX<br />
7368<br />
+24,9 %<br />
in eine Maschine, wo es<br />
durchrattert, und dann<br />
schauen wir mal, wie viel<br />
da so zusammengekommen<br />
ist. Von wegen! So<br />
eine Maschine gab es<br />
zwar, aber das Durchlaufenlassen<br />
sollte um die<br />
20 Euro kosten. Als kostenlose<br />
und kunden-<br />
freundliche Alternative reichte man mir bunte Zettel<br />
aus Papier zum Selbereinrollen der Münzen. Das war<br />
sogar überraschend kontemplativ, ich habe daheim<br />
mehrere Stunden so verbracht. Es ist gar nicht so leicht,<br />
einen Stapel aus 1-Cent-Stücken so aufzureihen, dass<br />
beim Einschlagen ins Papier nichts wegkullert.<br />
Ich habe gelernt, dass meine Bank mit dem Thema<br />
Kleingeld nicht viel zu tun haben möchte. Das ist<br />
symptomatisch für eine Zeit, in der es vielen nur um<br />
das ganz große Geld geht. Menschen scheinen nur als<br />
»Ultra High Net Worth Individuals« für die Finanzindustrie<br />
interessant zu sein, also als Superreiche. Bei<br />
Vermögensvermehrung und Steuervermeidung helfen<br />
Banken ja gern. Andere müssen sich selber helfen.<br />
Abgeben durfte ich die Rollen bei meiner Filiale<br />
übrigens nicht. Rollen würden nur bei der nächsten<br />
Zentralfiliale entgegengenommen, hieß es, dort fuhr<br />
ich mit dem Auto hin. Mein Kontostand war anschließend<br />
um 71,30 Euro gewachsen. Immerhin. Es<br />
war mir ein innerer Weltspartag. Und davon abgesehen<br />
ein Tag, den ich mir gern erspart hätte.<br />
$<br />
DOW JONES<br />
13 559<br />
+11,0 %<br />
Illustration: Karsten Petrat für <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>/www.splitintoone.com<br />
JAPAN-AKTIEN<br />
NIKKEI: 9157<br />
+8,3 %<br />
Ein Euro ist wieder mehr als<br />
1,30 Dollar wert, die Risikoaufschläge<br />
auf Staatsanleihen aus<br />
Portugal, Spanien und Italien<br />
sind deutlich zurückgegangen,<br />
der Deutsche Aktienindex bewegt<br />
sich um die Marke von<br />
7400 Punkten, auch andere europäische Börsenindizes<br />
sind im September gestiegen. So positiv<br />
präsentieren sich derzeit viele Märkte, dass Anleger<br />
sich fragen: Was sind die Gründe für den<br />
deutlichen Aufschwung in den vergangenen<br />
Wochen? Ist die Krise nun vorbei? Beginnt gar<br />
eine neue Phase der Stabilität?<br />
Aktueller Auslöser für die Belebung der europäischen<br />
Börsen war ein Bündel spektakulär<br />
guter Nachrichten binnen weniger Tage. So<br />
folgte die Europäische Zentralbank (EZB) ihrem<br />
Präsidenten Mario Draghi auf seinem Kurs,<br />
alles Erdenkliche zu tun, um den Euro zu ver-<br />
BRASILIEN-<br />
AKTIEN<br />
BOVESPA: 61 806<br />
+9,2 %<br />
FINANZSEITE<br />
EURO<br />
1,31 US$<br />
+1,2 %<br />
teidigen. Dann gab das deutsche Bundesverfassungsgericht<br />
den Weg für den neuen europäischen<br />
Rettungsfonds ESM unter Auflagen frei.<br />
Und schließlich verkündete die amerikanische<br />
Notenbank am vergangenen Freitag, erneut<br />
Wertpapiere aufkaufen zu wollen und auf diese<br />
Weise weiter Geld in die Wirtschaft zu pumpen.<br />
Insbesondere die Entwicklung in Europa erfreute<br />
viele Anleger. »Die Märkte haben auf mehr<br />
Risiko umgeschaltet«, sagt Hans-Jörg Naumer,<br />
Leiter der Kapitalmarktanalyse beim Anlageriesen<br />
Allianz Global Investors. Lange hatte die Angst vor<br />
einer dramatischen Eskalation der Krise, vor einem<br />
Auseinanderbrechen der Euro-Zone, das Verhalten<br />
vieler Investoren geprägt. »Diese Angst ist vom<br />
Tisch«, sagt Naumer. »Europa ist nicht mehr im<br />
Krisenmodus. Jetzt beginnt die Zeit des Aufräumens.«<br />
Dabei würden die jüngsten Schritte, die<br />
Entscheidungen der EZB und des Bundesverfassungsgerichts,<br />
allerdings »von den Märkten aktuell<br />
ROHÖL (WTI)<br />
97 US$/BARREL<br />
–2,4 %<br />
SILBER<br />
35 US$/<br />
FEINUNZE<br />
+24,3 %<br />
Erleichterung,<br />
keine Euphorie<br />
Ob Aktien, Euro oder Staatsanleihen, die Stimmung<br />
an den Börsen steigt – zu Recht? VON ARNE STORN<br />
etwas überschätzt«, denn diese seien zwar entscheidend<br />
für die Stabilisierung der Währungsunion,<br />
keineswegs aber deren finale Rettung. Wichtig sei<br />
nun vor allem, dass Länder wie Spanien oder Italien<br />
in ihren Reformbemühungen vorankämen. Vor<br />
ihnen liege noch ein sehr langer Weg.<br />
Es ist mehr die Erleichterung über das Ausbleiben<br />
der Apokalypse, die die Anleger derzeit<br />
kaufen lässt. So sei das aktuelle Hoch des Dax eindeutig<br />
von der EZB und »weniger von Zahlen und<br />
Nachrichten aus den Unternehmen getrieben«, sagt<br />
Robert Greil, der bei der Bank Merck Finck viele<br />
Unternehmen aus der Auto-, Stahl- und Konsumindustrie<br />
beobachtet. Zwar stehen einige Branchen<br />
gut da, doch Grund zur Euphorie gibt es <strong>2012</strong><br />
nicht. Es sei möglich, »dass bis Jahresende noch<br />
einige Unternehmen beim Gewinn zurückrudern<br />
müssen«, glaubt Matthias Thiel von der Privatbank<br />
M. M. Warburg. »Unternehmenszahlen laufen allerdings<br />
der Entwicklung hinterher.<br />
Es ist denkbar, dass sich die<br />
Aussichten parallel verbessern.«<br />
Das zumindest ist die Hoffnung<br />
(siehe dazu auch S. 21).<br />
Natürlich hängt die exportorientierte<br />
deutsche Wirtschaft stark<br />
von der Euro-Zone ab, und da sieht<br />
es schlechter aus als hierzulande.<br />
Bei M. M. Warburg erwartet man<br />
2013 ein Plus von null Prozent, im<br />
Klartext: Stagnation. »Die Euro-<br />
Zone wird deutlich schwächer<br />
wachsen als Amerika«, so Matthias<br />
Thiel, dort rechne man mit einem<br />
Plus um die 2,5 Prozent. Die Lage<br />
bei den Fundamentaldaten – Daten<br />
wie zum Beispiel Absatz, Auftragseingänge<br />
oder Wachstum –<br />
bleibe weiter sehr angespannt. Er<br />
sehe daher nur einen »Ein maleffekt«<br />
der geldpolitischen Entscheidungen,<br />
neue Rückschläge<br />
seien möglich. Auch bei schlechten<br />
Nachrichten aus anderen Teilen der<br />
Welt. »Probleme in China, im Iran<br />
oder beim Öl hätten alle das Potenzial,<br />
die Märkte noch einmal<br />
ordentlich zu schütteln«, sagt Thiel. Wenn in China<br />
das Wachstum weiter falle oder wenn es im Iran<br />
zu einem Luftschlag durch Israel kommen sollte,<br />
dann seien die Folgen schwer abzuschätzen.<br />
Interessant an der jüngsten Rallye der Kurse ist,<br />
dass sie offenbar an den Investoren hierzulande vorbeilief.<br />
»Die institutionellen Anleger aus Deutschland<br />
haben über Wochen hinweg Skepsis und<br />
Pessimismus an den Tag gelegt. Die Nachfrage jetzt<br />
kam überwiegend aus dem Ausland«, sagt Joachim<br />
Goldberg, der mit seiner Firma Cognitrend das Verhalten<br />
der Marktteilnehmer analysiert und mit der<br />
Deutschen Börse regelmäßig Umfragen unter institutionellen<br />
Investoren wie Versicherungen oder<br />
Pensionsfonds durchführt. Das Vertrauen in Europa<br />
sei jenseits der Grenze größer als diesseits der<br />
Grenze. Komme es kurzfristig zu einer Korrektur<br />
der Kurse, dürfte dies eher die bisherigen Skeptiker<br />
zu Käufen bewegen als wieder eine Talfahrt auslösen,<br />
wie sie zwischen März und Juni zu beobachten<br />
war. Sollte der Dax unter die Marke von 7200<br />
Punkten fallen, glaubt Goldberg, komme es zu<br />
erster neuer Nachfrage, unterschreite das Börsenbarometer<br />
die Marke von 7000 Punkten, dann<br />
greife auch das Gros derer zu, die den jüngsten Aufschwung<br />
verpasst hätten.<br />
Dass sich die Beurteilung der Lage vor allem im<br />
Ausland geändert hat, darauf deutet auch eine aktuelle<br />
Studie der Bank of America hin. In einer<br />
Erhebung unter mehr als 250 europäischen Fondsmanagern<br />
in der vergangenen Woche zeigt sich ein<br />
Realrendite<br />
BAUMWOLLE<br />
0,76 US$/PFUND<br />
–16,5 %<br />
großer Umschwung. Die Angst um die Entwicklung<br />
in den USA, wo demnächst Steuererleichterungen<br />
auslaufen und die Staatsverschuldung<br />
wieder gesetzliche Grenzen zu erreichen droht, ist<br />
im Vergleich zur Erhebung im August deutlich gestiegen.<br />
Parallel dazu ist die Angst um Europa<br />
dramatisch zurückgegangen. Zum ersten Mal seit<br />
rund 18 Monaten sehen die Herrscher über Hunderte<br />
Milliarden die Finanzierungsprobleme europäischer<br />
Staaten nicht mehr als das größte Risiko<br />
an. Im Zusammenspiel mit der Tatsache, dass europäische<br />
Unternehmen derzeit, gemessen an den<br />
Gewinnen, im globalen Vergleich am billigsten zu<br />
haben sind, hat dies die Attraktivität Europas als<br />
Anlageziel für Investoren deutlich erhöht. Der Anstieg<br />
des Euro ist eine logische Folge.<br />
Fließt mehr Geld, fließt es derzeit vor allem in<br />
Aktien. Wer sie erwirbt, erwirbt Anteile an Unternehmen<br />
mit konkreten Produkten und kann im<br />
Fall von Gewinnen auf Ausschüttungen<br />
hoffen. »Wo<br />
wollen Sie derzeit investie-<br />
ren, wenn nicht in reale<br />
Werte?«, fragt Kapitalmarktexperte<br />
Naumer. Zu groß ist<br />
die Sorge um die Realrendite.<br />
Die Renditen vieler<br />
festverzinslicher Anlagen<br />
sind derzeit angesichts des<br />
niedrigen Zinsniveaus im<br />
Vergleich wenig attraktiv.<br />
Fügt man alle Puzzlestücke<br />
zusammen, so ergibt<br />
sich am ehesten das Bild<br />
eines plötzlich robusteren<br />
Europas. Nach eher ruhigen<br />
Wochen wird es an den<br />
Märkten zwar bald wieder<br />
mehr Ausschläge geben, da<br />
sind sich die Experten einig.<br />
Schlechte Nachrichten<br />
aus Spanien, Griechenland<br />
oder auch einzelnen Unternehmen<br />
könnten wieder zu<br />
sinkenden Kursen führen.<br />
Sofern diese Nachrichten<br />
aber nicht völlig überraschend<br />
kämen, komme es nicht zu tiefen Abstürzen.<br />
Für Euphorie und Hoffnungen auf einen<br />
ungebremsten Höhenflug ist es demnach zu<br />
früh, die Zeit der Untergangsszenarien aber<br />
scheint vorbei.<br />
Never fight the Fed, kämpfe niemals gegen die<br />
amerikanische Notenbank – diese alte Weisheit<br />
gelte im gleichen Maß für die Europäische Zentralbank,<br />
glaubt Hans-Jörg Naumer von Allianz<br />
Global Investors, und werde nun von vielen Investoren<br />
beherzigt. Wichtigster Indikator dafür<br />
sei, dass die Risikoprämien für Staatsanleihen aus<br />
Portugal, Spanien und Italien im Vergleich zu<br />
Staatsanleihen aus Deutschland zuletzt teils um<br />
mehrere Prozentpunkte zurückgegangen seien.<br />
»Das ist massiv. Das ist dauerhaft«, sagt der Kapitalmarktexperte.<br />
Er sehe nun ein positives Momentum,<br />
registriere in Gesprächen allerdings<br />
weiter eine gewisse Skepsis.<br />
Damit sich die Wahrnehmung grundlegend<br />
verschiebt, »muss die Phase länger anhalten«,<br />
sagt Naumer, »dafür muss auch der letzte Bär kapitulieren«,<br />
also auch der letzte Pessimist überzeugt<br />
werden. Er richtet seinen Blick bereits auf<br />
2014 und die Zeit danach. Erst dann werde man<br />
sehen, ob Europas Krisenstaaten mit ihren Reformen<br />
erfolgreich seien und ob das Eingreifen<br />
der Notenbanken – wie von vielen befürchtet –<br />
zu mehr In fla tion führe. »Wir haben noch eine<br />
Menge Schlaglöcher vor uns. Um die müssen<br />
wir herum.«<br />
Unter der Realrendite<br />
verstehen Investoren die<br />
Rendite einer Anlage<br />
nach Abzug der<br />
Inflation. Vor lauter<br />
Angst, dass die aktuelle<br />
Geldpolitik der EZB in<br />
Zukunft zu steigenden<br />
Preisen führen könnte,<br />
wird gern übersehen,<br />
dass die Realrendite<br />
vieler Anlagen schon<br />
heute – bei einer<br />
Inflationsrate von nur<br />
rund zwei Prozent – oft<br />
im Minus liegt. Abhilfe<br />
können etwa Aktien von<br />
Firmen bieten, die hohe<br />
Dividenden zahlen<br />
WIRTSCHAFT<br />
KUPFER<br />
8316 US$/<br />
TONNE<br />
+9,9 %
Fotos: Steffens/ddp; SVEN SIMON (u.)<br />
WIRTSCHAFT<br />
LEISTUNGSSCHUTZRECHT<br />
Werkzeug oder Knute?<br />
Internetfi rmen nutzen Presseausschnitte kostenlos. Ein Gesetz soll dagegen<br />
helfen – und wird zum Symbol der Netzpolitik. Ein Pro und Contra<br />
Die Bundesregierung will ihren Entwurf für<br />
ein Leistungsschutzrecht demnächst in<br />
Bundesrat und Bundestag einbringen.<br />
Der Gesetzentwurf erweckt den Eindruck, als ginge<br />
es darum, dass der Internetkonzern Google<br />
künftig dafür zahlt, dass er seinen Dienst Google<br />
News aus Nachrichten zusammenstellt, die zuvor<br />
auf den Online-Seiten deutscher Verlage erschienen<br />
sind. Erst bei genauem Hinsehen erschließt<br />
sich: Dieses Gesetz würde Deutschland als Innovationsstandort<br />
für unabsehbare Zeit zurückwerfen.<br />
Nach dem Entwurf sollen Suchmaschinenanbieter<br />
und »gewerbliche Anbieter von Diensten,<br />
die Inhalte entsprechend aufbereiten«, in Deutschland<br />
immer das Recht einholen müssen, kleine<br />
Auszüge aus Texten (Snippets) zu verwenden, die<br />
Presseverlage und andere Online-Publikationen<br />
erstellt haben.<br />
Wieso das innovationshemmend ist? Dazu muss<br />
man Parallelen zur Musikindustrie und zum digitalen<br />
Streaming-Dienst Spotify ziehen. Spotify kam 2008<br />
in Schweden auf den Markt und erlaubt es, Lieder<br />
bekannter Künstler aus dem Internet abzurufen. In<br />
Deutschland wurde der Dienst, der als einer der Wegbereiter<br />
in die Zukunft der Musikwirtschaft angesehen<br />
wird und Millionen Nutzer hat, erst im März<br />
<strong>2012</strong> gestartet. Und warum? Weil es fast vier Jahre<br />
gedauert hat, um alle Rechte zu »klären«, also Lizenzverträge<br />
mit der hiesigen Musikindustrie zu schließen.<br />
Vier Jahre sind im digitalen Zeitalter Äonen.<br />
Das Leistungsschutzrecht würde ähnliche Verhältnisse<br />
auf dem Markt für innovative Informationsdienste<br />
schaffen. Es soll ein geistiges Eigentumsrecht,<br />
ein Immaterialgüterrecht sein. Solche Rechte haben<br />
die Eigenschaft, dass jeder, der ein hierdurch geschütztes<br />
Gut nutzen will, vorher eine Erlaubnis (eine<br />
Lizenz) vom Rechteinhaber einholen muss. Tut er<br />
dies nicht, drohen ihm Abmahnungen, Schadensersatzforderungen<br />
und unter Umständen sogar<br />
Das Leistungsschutzrecht wird ein Schub<br />
von Innovationen und neuen Ideen auslösen.<br />
Kritiker, die das bezweifeln, gehen<br />
von falschen Voraussetzungen aus. Das Recht errichtet<br />
keinen Schutzwall um überholte Geschäftsmodelle.<br />
Vielmehr schafft es die Voraussetzungen<br />
für einen boomenden neuen Markt: mit Suchmaschinen<br />
und mit Aggregatoren.<br />
Was sind Aggregatoren? Das sind elektronische<br />
Angebote, die Texte, Fotos und Videos aus verschiedenen<br />
Quellen zusammentragen und dem Leser<br />
bequem wie eine persönliche Internet-Zeitung auf<br />
den Bildschirm liefern. Aggregatoren sind sehr beliebt.<br />
Sie sparen dem Leser Wege und Zeit.<br />
Die allermeisten Aggregatoren zahlen den Urhebern<br />
und ihren Verlagen heute kein Geld, sondern<br />
bedienen sich kostenlos auf deren Webseiten.<br />
Manche Aggregatoren liefern den Verlagen Besucher,<br />
weil man sich von ihnen auf die Originalseiten<br />
durchklicken kann. Andere versuchen, das<br />
Publikum bei sich zu behalten, ihm Abos schmackhaft<br />
zu machen oder Werbung zu zeigen. Wieder<br />
andere verkaufen die kopierten Artikel weiter an<br />
Kunden in der Wirtschaft, denen das Durchsuchen<br />
des Webs nach Beiträgen über ihre Firma<br />
oder Branche zu mühsam wäre.<br />
Der Leser hat immer recht. Deshalb wissen Verlage,<br />
dass sie die Entwicklung nicht aufhalten sollten.<br />
Eines aber können sie nicht akzeptieren: dass sie<br />
journalistische Leistungen kostenlos zur Verfügung<br />
stellen sollen.<br />
Leider ist in den vergangenen Jahren ein erbitterter<br />
Streit um Lizenzen entbrannt. Zu viele Internetfirmen<br />
verweigern sich noch einem Lizenzvertrag.<br />
Andere, die eher dazu bereit sind, zögern<br />
ihre Unterschrift hinaus, solange wichtige Kon-<br />
strafrechtliche Sanktionen. Massenhaft Lizenzen einzuholen<br />
bedeutet massenhaft Verträge zu schließen.<br />
Dies wiederum ist mit enormen Transaktionskosten<br />
verbunden und erfordert spezielles Know-how. Google<br />
und Microsoft mögen hierzu fähig sein, Start-ups<br />
verfügen weder über das nötige Geld noch über das<br />
Wissen. Oder sie brauchen Jahre – wie Spotify.<br />
Wird das Leistungsschutzrecht eingeführt, werden<br />
Innovationen auf dem Markt der Informationsdienste<br />
nicht aus Deutschland<br />
kommen. Zum anderen<br />
werden hiesige Unternehmen<br />
und Bürger von<br />
solchen Diensten (oft<br />
auf Jahre) abgeschnitten<br />
sein. Hätte es vor zehn<br />
Jahren schon ein Leistungsschutzrechtgegeben,<br />
wer weiß, ob Deutsche<br />
heute schon Google<br />
nutzen könnten.<br />
Die Verlage argumentieren,<br />
sie brauchten<br />
das Gesetz, da es heute<br />
sehr schwierig sei, gegen<br />
das systematische Raubkopieren<br />
von Texten vorzugehen.<br />
Als Grund wird<br />
angegeben, dass sie mit<br />
vielen Autoren zusammenarbeiten<br />
und sie vor<br />
Gericht für jeden einzelnen<br />
Text beweisen müs-<br />
sen, dass sie die Verwertungsrechte an einem Text<br />
haben. Das zu ändern, braucht es kein Leistungsschutzrecht.<br />
Eine simple prozessrechtliche Regelung<br />
würde ausreichen, nach der vermutet wird, dass der<br />
Verleger befugt ist, Rechte an den im Presseerzeugnis<br />
enthaltenen Werken vor Gericht geltend zu machen.<br />
kurrenten noch Totalverweigerer sind – und ein<br />
Gesetz fehlt.<br />
Die Verlage, unter ihnen Axel Springer, verhandeln<br />
mit vielen Aggregatoren, und diese Gespräche<br />
werden zu fairen Verträgen führen, fair für alle Seiten,<br />
sobald das Leistungsschutzrecht in Kraft ist. Es leistet<br />
also einen Beitrag zur<br />
Lösung des Problems<br />
und erlaubt, rechtlich<br />
gegen gewerbliche Angebote<br />
vorzugehen, die<br />
ohne Genehmigung<br />
kopieren. Damit wird<br />
der Weg für Aggregatoren<br />
geebnet, die ein faires<br />
Geschäft machen möchten.<br />
Sie müssen keine<br />
Gratiskonkurrenz mehr<br />
fürchten. Private Kopien<br />
bleiben weiter kostenlos.<br />
Wer nun wie die SPD<br />
sagt, man brauche kein<br />
Gesetz, sondern könne es<br />
den Verlagen durch einen<br />
juristischen Trick<br />
erleichtern, ihre Interessen<br />
vor Gericht durchzusetzen,<br />
macht einen<br />
Denkfehler. Ohne das<br />
Gesetz muss der Verlag<br />
Contra<br />
TILL<br />
KREUTZER<br />
ist Anwalt für<br />
Urheberrecht,<br />
Datenschutzrecht<br />
und Telekommunikationsrecht<br />
Pro<br />
CHRISTOPH<br />
KEESE<br />
ist Urheberrechtssprecher<br />
der<br />
Verlegerverbände<br />
und Manager bei<br />
Axel Springer<br />
heute für jeden Text einzeln nachweisen, welche Verwertungsrechte<br />
er besitzt. Nun einfach pauschal alle<br />
Rechte dem Verlag zuzumessen, damit es vor Gericht<br />
schneller geht, ist Journalisten gegenüber unfair. Sie<br />
müssen an der Zweitverwertung ihrer Texte beteiligt<br />
werden. Genau das will das Leistungsschutzrecht.<br />
ANALYSE UND MEINUNG<br />
ANALYSE<br />
A<strong>DIE</strong> ANALYSE<br />
Das papierlose Büro. Globale Videokonferenzen.<br />
Arbeiten von<br />
jedem Ort der Welt aus. Kommunikationstechnik<br />
verändert<br />
permanent den Arbeitsalltag,<br />
und an passenden Utopien mangelte es noch<br />
nie. Das klassische Angestelltenverhältnis als<br />
nine to five-Job samt Zeiterfassung und Überstundenkonto<br />
weiche einer flexiblen Arbeitsrealität,<br />
von der alle profitierten – das war eine<br />
Zukunftsvision. Und sie klang vielversprechend:<br />
Der Arbeitnehmer wäre nicht mehr<br />
durch feste Bürozeiten an seinen Schreibtisch<br />
gefesselt und könnte so Job und Privatleben viel<br />
besser zusammenbringen. Der Arbeitgeber hätte<br />
Personal, das einen eiligen Auftrag aus Fernost<br />
umgehend und nicht erst am nächsten<br />
Morgen bearbeiten könnte. So weit der Plan.<br />
Mit den Chancen und Risiken der Digitalen<br />
Arbeit in Deutschland hat sich nun die der SPD<br />
nahestehende Friedrich-Ebert-Stiftung befasst.<br />
Dabei zeichnen die beiden Autoren Michael<br />
Schwemmle und Peter Wedde zwar ein differenziertes,<br />
im Kern aber einseitiges Bild. Digitale<br />
Arbeit sei »vorwiegend von Vorgaben und Dispositionen<br />
der Unternehmen, der Arbeit- und<br />
Auftraggeber abhängig«, schreiben sie, »zu wenig<br />
jedoch an den Bedürfnissen der Erwerbstätigen<br />
und am Ziel guter Arbeit ausgerichtet.«<br />
Was ein digitaler Arbeiter sein soll, definieren<br />
Schwemmle und Wedde bewusst eng. Ein Dachdecker<br />
mit E-Mail-Account und Mobiltelefon<br />
gehört nicht dazu. Stattdessen sind Menschen<br />
gemeint, die hauptsächlich mit Laptops, Smartphones,<br />
Tablets und dergleichen solche Informationen<br />
bearbeiten, die typischerweise in digitali-<br />
Ungemach für die Kanzlerin<br />
Eigentlich könnte es ein ruhiger Herbst werden:<br />
Das Bundesverfassungsgericht hat den Weg frei<br />
gemacht für den Rettungsschirm ESM, die Europäische<br />
Zentralbank (EZB) hat entschieden, die<br />
Krisenländer im Ernstfall durch den Kauf von<br />
Staatsanleihen zu stützen. Es gibt also jetzt einen<br />
Schlachtplan, und es gibt eine im Prinzip unerschöpfliche<br />
Kriegskasse – und trotzdem könnte<br />
die Euro-Rettung die Bundesregierung innenpolitisch<br />
noch in die Bredouille bringen.<br />
Da ist der Konflikt zwischen Bundesbank-<br />
Präsident Jens Weidmann und EZB-Chef Mario<br />
Draghi. Weidmann ist gegen das Anleiheprogramm,<br />
Draghi hat es sich ausgedacht. Die<br />
Bundesregierung hält zu Draghi, weil sie<br />
glaubt, dass sich die Krise ohne die Feuerkraft<br />
der Notenbank nicht lösen lässt. Sie kann es<br />
sich aber nicht leisten, Weidmann zu kritisieren,<br />
weil die Bundesbank in der Öffentlichkeit<br />
hoch angesehen ist und ihre Bedenken von<br />
vielen Deutschen geteilt werden.<br />
Angela Merkels Ausweg: Sie lobt einfach<br />
beide – obwohl das rein logisch betrachtet<br />
nicht zusammenpasst. Bislang kommt die<br />
Kanzlerin damit ganz gut durch. Doch wenn<br />
die EZB wirklich gezwungen sein sollte, im<br />
großen Stil Anleihen zu kaufen, und der öffentliche<br />
Druck wächst, muss sich Merkel<br />
möglicherweise für einen der beiden entschei-<br />
sierter Fassung vorliegen: Texte, Grafiken, Zahlen,<br />
Fotos. Eine Untersuchung des Statistischen Bundesamts<br />
von 2010 besagt, dass fast zwei Drittel<br />
aller Beschäftigten in Deutschland regelmäßig am<br />
Computer arbeiten.<br />
Doch was macht der Rechner, macht das Netz<br />
mit ihnen?<br />
Aus der Perspektive von abhängig Beschäftigten<br />
lösen sich herkömmliche Alltagsbegriffe auf.<br />
Der Arbeitsplatz ist kein klar umgrenzter Ort<br />
mehr, stattdessen befindet er sich jeweils dort, wo<br />
ein Computer Zugang zum Netz hat – mithin<br />
überall. Ebenso schwierig wird es, Beginn und<br />
Ende der Arbeitszeit zu definieren, vor allem,<br />
wenn Teams aus mehreren Ländern und Zeitzonen<br />
an einem Projekt arbeiten. Arbeitsort und<br />
-zeit zum Teil selbst bestimmen zu können, werten<br />
Schwemmle und Wedde zwar grundsätzlich als<br />
positiv und einen Zugewinn von Macht und<br />
Freiheit. Das könne aber nur gelten, wenn die<br />
Arbeitsmenge es überhaupt zulasse, diese Freiheit<br />
sinnvoll ausüben zu können. Überspitzt gesagt:<br />
Wer rund um die Uhr arbeitet, hat von der Flexibilität<br />
gar nichts. Viele Beschäftigte empfinden es<br />
der Studie zufolge als Last, nie genau zu wissen,<br />
wann eigentlich Schluss ist.<br />
Eine Vielzahl von »Solo-Selbstständigen« betrachtet<br />
es demgegenüber offenbar als große<br />
Chance, selbstbestimmt und frei von klassischen<br />
Anwesenheitszwängen zu arbeiten. Die Autoren<br />
diskutieren eine Selbstdarstellung aus der Szene<br />
der Digital Natives, derzufolge die Regeln eines<br />
Normalarbeitsverhältnisses als »Relikt aus den<br />
Zeiten der Industrialisierung« beschrieben werden.<br />
Unklar bleibt, warum die Gruppe der Digitalarbeiter<br />
so begeistert ist, obwohl sie sich in einer<br />
den. Schlägt sie sich auf Draghis Seite, wird<br />
sie innenpolitisch Schwierigkeiten bekommen<br />
und müsste um ihre Kanzlerschaft bangen.<br />
Schlägt sie sich dagegen auf Weidmanns Seite,<br />
wäre die Krise wahrscheinlich mit einem<br />
Schlag zurück, weil die Akteure an den Finanzmärkten<br />
in einem solchen Fall daran zweifeln<br />
würden, dass die EZB ihr Programm gegen<br />
den Willen Deutschlands fortsetzen kann.<br />
Da ist das Ringen um Spanien. Um sich für<br />
die Anleihekäufe der EZB zu qualifizieren,<br />
muss das Land einen Antrag auf ein Hilfsprogramm<br />
der EU stellen. Bislang schreckt die<br />
Regierung in Madrid jedoch davor zurück,<br />
nicht zuletzt weil sie die Auflagen fürchtet, die<br />
mit einem solchen Programm verbunden sein<br />
könnten – obwohl die Notenbank die Kriterien<br />
bereits gelockert hat.<br />
Auch in der Bundesregierung sähen es einige<br />
gerne, wenn die Spanier auf diesen Schritt<br />
vorerst verzichten würden. Denn andernfalls<br />
müsste Angela Merkel noch einmal vor den<br />
Bundestag, um sich das Programm genehmigen<br />
zu lassen. Auch wenn die Abgeordneten<br />
am Ende wohl zustimmen würden, bliebe das<br />
Restrisiko eines Scheiterns – und es blieben<br />
Tage, wenn nicht gar Wochen, mit kontroversen<br />
Debatten, die wieder für Unruhe an den<br />
Finanzmärkten sorgen könnten.<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 29<br />
Ohne Feierabend<br />
Freiheit oder Zwang? Eine Studie untersucht die<br />
digitale Arbeitswelt VON MARCUS ROHWETTER<br />
vergleichsweise schlechten finanziellen Lage<br />
befindet. »Unter den vermeintlich Privilegierten<br />
der Kreativszene schrammen viele an prekären<br />
Verhältnissen vorbei«, heißt es im Vorwort der<br />
Studie. »Ungezählte Solounternehmer leben von<br />
der Hand in den Mund. Im digitalen Nomadentum<br />
kann der gesicherte Broterwerb zur<br />
Utopie werden.«<br />
Die Studie der Ebert-Stiftung basiert großteils<br />
auf Statistiken und wissenschaftlicher Literatur.<br />
Ihr Ergebnis: Digitale Arbeit ist psychische Last<br />
für einige, bedeutet oft wenig Geld für andere,<br />
aber auch Freiheit und Selbstbestimmtheit. Die<br />
Untersuchung lässt den Schluss zu, dass sich Politik<br />
und Gesellschaft vom Tempo des technischen<br />
Fortschritts überrumpelt sehen. Getrieben von der<br />
Erkenntnis, dass Unternehmen als Arbeit- oder<br />
Auftraggeber zunehmend im globalen Wettbewerb<br />
stehen und nie eine Zeit kommt, zu der die<br />
ganze Welt zugleich Feierabend macht. »Es dominiert<br />
eine Akzeptanz der normativen Kraft des<br />
Faktischen«, schreiben Schwemmle und Wedde,<br />
gleichwohl sei der Gesetzgeber nicht zum Zuschauen<br />
verdammt. So regen die Autoren an, Beschäftigten<br />
gesetzlich die Möglichkeit zuzugestehen,<br />
ihre Arbeit teilweise von selbst gewählten<br />
Orten aus erbringen zu dürfen – und zugleich ein<br />
»Recht auf Nichterreichbarkeit außerhalb bestimmter<br />
Arbeitszeitkorridore« festzuschreiben.<br />
Zudem sollten Solo-Selbstständige stärker in soziale<br />
Sicherungssysteme integriert werden.<br />
All das sind wichtige Fragen, auf die es bislang<br />
keine Antworten gibt. Fest steht nur, dass Technik<br />
für sich genommen weder gut noch schlecht ist.<br />
Gesellschaft und Politik können die digitale Zukunft<br />
mitgestalten. Sie müssen es nur tun.<br />
Die Finanzmärkte haben sich beruhigt, politisch bleibt die Euro-Rettung heikel VON MARK SCHIERITZ<br />
Deshalb hofft man in Berlin, dass allein die<br />
Ankündigung möglicher Stützungskäufe durch<br />
die EZB ausreicht, um die Zinsen so weit zu<br />
drücken, dass sich die Spanier wieder zu annehmbaren<br />
Konditionen finanzieren können.<br />
Tatsächlich kommt das Land derzeit erheblich<br />
günstiger an frisches Geld als vor Draghis Ankündigung,<br />
im Rahmen seines Mandats alles zu<br />
tun, um den Euro zu retten. Nach Analysen der<br />
Bundesregierung liegen die Zinsen im Süden<br />
jetzt in etwa wieder auf einem Niveau, das zu<br />
den ökonomischen Rahmenbedingungen passt.<br />
Doch auch eine solche Garantieerklärung<br />
ist eine Form der Unterstützung – selbst wenn<br />
noch kein Geld fließt. Und solange die Regierung<br />
in Madrid sich keinem Anpassungsprogramm<br />
unterwirft, haben die Europäer keine<br />
Handhabe, um zusätzliche Auflagen durchzusetzen.<br />
Damit wächst die Gefahr, dass das Land<br />
vom Reformkurs abkommt, und das Risiko<br />
politischer Kontroversen in Deutschland.<br />
Im Kanzleramt setzt man darauf, dass die<br />
Intervention der Notenbank bis zur Bundestagswahl<br />
für Ruhe sorgt – um dann vielleicht<br />
im Rahmen einer Großen Koalition den Umbau<br />
der Währungsunion mit frischer Kraft voranzutreiben.<br />
Die Lage an den Finanzmärkten<br />
hat sich beruhigt, politisch bleibt die Euro-<br />
Rettung spannend.
30 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong><br />
»Wir ziehen<br />
das durch«<br />
Der britische Unternehmer Richard Branson will Spaß haben und<br />
die Welt verbessern. Ein Gespräch über Abenteuer und Disziplin<br />
7.30 Uhr morgens am vergangenen Samstag auf<br />
dem High-Tech-Gelände in Berlin-Adlershof.<br />
Richard Branson ist für ein paar Stunden nach<br />
Deutschland gekommen. 2009 hat er die Initiative<br />
Carbon War Room gegründet. Sie will Unternehmer,<br />
Erfinder und Geldgeber zusammenbringen,<br />
um neue Konzepte fürs Klima zu entwickeln und<br />
weltweit umzusetzen. Deshalb veranstaltet sie<br />
hochrangige Brainstorming-Treffen. Und nun war<br />
man gemeinsam mit dem deutschen Partner Triad<br />
Berlin dafür erstmals in Deutschland.<br />
Am Samstagmorgen kommt der Milliardär aus<br />
Großbritannien dazu. Er trägt ein dunkles Samtjackett<br />
über einem offenen weißen Hemd, die<br />
blond-weißen Haare sind in der Mitte gescheitelt,<br />
der Bart ist sorgfältig geschnitten. Der Konferenzleiter<br />
hält ihm die Hand hin, »umarmen Sie mich«,<br />
sagt er mit ausgebreiteten Armen. Der Ton ist gesetzt.<br />
Branson wirkt gelöst und erzählt, wie er<br />
neulich in Japan ein Auditorium um Fragen bat,<br />
und als niemand reagierte, bot er an, er werde<br />
dem ersten Fragensteller einen Erste-Klasse-Flug<br />
nach Europa spendieren. Die Zuhörer in Berlin<br />
schweigen kurz, aber keiner erhält einen Flug.<br />
Dann die Präsentation der Brainstorming-Ergebnisse.<br />
Es geht darum, wie Trucker sich gegenseitig<br />
informieren können, wenn sie noch freien Laderaum<br />
haben. Später um ein Effizienz-Rating für<br />
die Industrie. Schließlich darum, wie man ganze<br />
Inseln mit sauberer Energie versorgt. Erst eine,<br />
dann zehn, dann alle.<br />
Branson ist konzentriert, aber man merkt ihm<br />
an: Wenn der Vortragende nicht präzise und witzig<br />
redet, wird er unruhig. Das »Fantastisch« am<br />
Ende klingt dann nicht mehr ganz so herzlich.<br />
Und doch: Mit seiner leisen, klaren Stimme stellt<br />
er Fragen, die zeigen, er hat genau zugehört.<br />
Nach einer halben Stunde ist alles gesagt. Ein Fototermin<br />
noch mit den Teilnehmern, und Branson<br />
hat Zeit fürs Interview. Einen Kaffee braucht<br />
er. Dann ist er wieder entspannt und ganz bei<br />
der Sache. Übrigens, in einer halben Stunde muss<br />
er zum Flieger. UWE JEAN HEUSER<br />
<strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>: Jemand, der Ihnen nahesteht, hat gesagt,<br />
wenn es ihm Spaß machen soll, frag ihn<br />
nach den Sex Pistols. Also – die Sex Pistols. Warum<br />
gerade die?<br />
Richard Branson: Ich hatte ein unabhängiges<br />
Musik-Label in den Siebzigern, und die Sex Pistols<br />
waren mit mein erster Klient. Ohne sie säßen<br />
wir heute nicht hier. Nachdem wir sie gewonnen<br />
hatten, kamen die Rolling Stones, kam auch Genesis.<br />
Die Sex Pistols haben meiner Firma Virgin<br />
geholfen, überhaupt auf die Beine zu kommen.<br />
Ohne sie hätten wir keine Airline. Ohne sie hätten<br />
wir keine Bank.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Und ohne sie würden Sie heute nicht versuchen,<br />
die Welt zu retten.<br />
Branson: Ja, eins ist aus dem anderen entstanden.<br />
Ich bin neugierig, will immer etwas Neues<br />
lernen. Deshalb hat Virgin neue Felder besetzt.<br />
Jetzt verbringe ich 90 Prozent meiner<br />
Zeit damit, gemeinnützige Organisationen<br />
aufzubauen. Ich bin nun mal<br />
einer von denen, die glauben,<br />
dass die Erderwärmung ein<br />
ernstes Problem ist. Aber selbst<br />
wenn ich falschliege, müssen<br />
die Volkswirtschaften autark in<br />
ihrer Energieversorgung werden.<br />
Das Öl geht aus, da sind<br />
wir besser fantasievoll und bewahren<br />
die wertvollen Naturschätze,<br />
die wir haben.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Daher also der Carbon<br />
War Room?<br />
Branson: Den haben wir aufgebaut, um mit der<br />
Industrie zu arbeiten, statt sie zu attackieren,<br />
wie es ein Teil der grünen Bewegung macht.<br />
Unser Ziel ist es, 25 Gigatonnen an Kohlenstoffen<br />
aus der Atmosphäre herauszubringen<br />
und gleichzeitig der Industrie zu helfen, Geld<br />
zu verdienen und zu sparen, indem sie kein<br />
teures Öl aus Übersee kaufen muss. Wir wollen<br />
unsere Volkswirtschaften wohlhabender<br />
und gesünder zugleich machen. Dabei entstehen<br />
aufregende Ideen und Geschäftsmöglichkeiten.<br />
Wenn Leute zum Beispiel meinen, sie<br />
können Geld verdienen, indem sie eine Insel<br />
mit Öko-Energie versorgen, dann werden sie<br />
das tun. Als Unternehmer weiß ich, was die<br />
Welt bewegt.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Geld?<br />
Branson: Es ist nicht nur das Geld. Aber Sie müssen<br />
nachhaltig arbeiten können. Wenn Sie Geld<br />
mit einer Insel verdienen, können Sie alle Inseln<br />
der Welt verwandeln. Wir haben all diese tollen<br />
Leute im Carbon War Room, hier in Deutschland<br />
zum Beispiel, die dann ihren Weg nach<br />
China finden. Ideen können mit anderen geteilt<br />
werden, ohne dass es geistiger Diebstahl wäre.<br />
Und dann kann man auf globaler Ebene arbeiten.<br />
Energie ist so zentral für die Weltwirtschaft,<br />
dass viele Leute mitmischen können.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Noch mal zurück zu Ihren Anfängen ...<br />
RICHARD BRANSON<br />
» Wir sollten nicht die<br />
Menschen davon<br />
abhalten, Spaß zu<br />
haben, sondern dafür<br />
sorgen, dass sie reisen<br />
können, ohne die Welt<br />
zu beschädigen «<br />
Branson: (lacht) ... wenn ich so lange antworte,<br />
dass mir ein Weihnachtsmannbart wächst, müssen<br />
Sie das entschuldigen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Ich stelle Sie mir nur vor, damals auf Ihrem<br />
Hausboot in London, als sie eine kleine<br />
Musikfirma lenkten – und frage mich, was Sie,<br />
abgesehen von Ihrer Neugier, als Unternehmer<br />
ausmacht. Was Sie vorwärtstreibt.<br />
Branson: Ich glaube, der Begriff des Unternehmers<br />
oder Geschäftsmannes führt in die Irre.<br />
Was ist Geschäft? Im Wesentlichen, dass jemand<br />
mit einer Idee aufwartet, die für andere Menschen<br />
eine Verbesserung in ihrem Leben ist. In<br />
meinem Fall war es der Vietnamkrieg, den ich<br />
für ungerecht und falsch hielt. Ich wollte die<br />
Schule verlassen, um ein Magazin zu gründen,<br />
mit dem ich gegen den Krieg kämpfen konnte.<br />
Als das Magazin geschrieben wurde, kamen Musiker<br />
mit Bändern zu mir. Wunderbare Musik,<br />
die niemand bringen wollte. Also habe ich eine<br />
Plattenfirma gegründet. Ich dachte nicht daran,<br />
viel Geld zu verdienen, sondern wollte das Magazin<br />
und die Musik öffentlich machen. Später<br />
wollte ich eine Fluglinie aufbauen, bei der ich<br />
selber gerne mitfliegen würde. Und so weiter.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Geld brauchten Sie dafür auch.<br />
Branson: Natürlich hoffte ich, dass am Ende des<br />
Jahres mehr Geld reingekommen als rausgeflossen<br />
war. Ich war furchtbar in Mathe gewesen und<br />
Legastheniker dazu, also brauchte ich Leute, die<br />
darauf achteten. Manche Jahre schafften wir es,<br />
andere nicht. Zeit meines Lebens habe ich es aber<br />
geliebt, große Unternehmen und große Branchen,<br />
die ineffizient sind, herauszufordern. Mit<br />
Produkten wie der besten Airline der Welt, der<br />
besten Bahnlinie der Welt, der aufregendsten<br />
Raumfahrtfirma. Wir setzen uns Herausforderungen<br />
und versuchen Dinge zu schaffen, auf die<br />
wir wirklich stolz sein können. Und jetzt mache<br />
ich dasselbe im gemeinnützigen Sektor, der für<br />
mich gar nicht so anders ist.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Sowohl als Geschäftsmann wie auch als<br />
Abenteurer sind Sie wagemutig. Extremsportler<br />
sagen einem, die Wagemutigsten bräuchten auch<br />
die meiste Disziplin, sonst seien sie schnell tot.<br />
Sind Sie disziplinierter, als man es öffentlich<br />
wahrnimmt?<br />
Branson: Ein bisschen mehr. Als Geschäftsmann<br />
müssen Sie sich gegen die downside schützen,<br />
gegen die schlimmste Möglichkeit. Ich bin im<br />
Geschäft, seit ich 15 bin, und noch nie ist uns<br />
eine Firma wirklich pleite gegangen. Aber natürlich<br />
habe ich Dinge probiert, die noch kein<br />
Mensch gemacht hat, und die sind mit Risiko<br />
verbunden. Wenn Sie zum Beispiel in einem<br />
Ballon die Erde umrunden wollen und Sie wissen,<br />
dass es niemand vor Ihnen gemacht hat,<br />
dann gehen Sie ein kalkuliertes Risiko ein. Wir<br />
haben eine Kapsel gebaut, die schwimmen würde,<br />
wenn sie in den Ozean stürzt, damit wir zurückkehren<br />
und unsere Geschichte erzählen<br />
könnten. Im Meer sind wir dann auch sechs Mal<br />
gelandet. Aber Glück hatten wir natürlich auch.<br />
Bei den vielen Abenteuern hat jemand von oben<br />
auf uns heruntergelächelt.<br />
Und doch habe ich auch da<br />
immer versucht, fürs<br />
Schlimmste gerüstet zu sein.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Gehen Sie Ihre philanthropischen<br />
Unternehmungen<br />
genauso an?<br />
Branson: Die Leute vom Carbon<br />
War Room haben diese<br />
Haltung, zum Teufel, wir ziehen<br />
das jetzt durch. Sie haben<br />
hier deutsche Geschäftsleute<br />
getroffen, die eher nach einem<br />
festen Plan vorgehen – oder, wie einige der War-<br />
Room-Leute sagten, die schottischer seien als wir.<br />
Eine Mischung der beiden Ansätze ist ideal. Insgesamt<br />
nehmen wir unsere gemeinnützigen Projekte<br />
vielleicht noch ernster als unsere Geschäfte.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Sie sind wahrscheinlich der einzige Unternehmer,<br />
der es schafft, als ernster Klimakämpfer<br />
zu gelten und gleichzeitig einen Formel-1-Rennstall<br />
zu betreiben ...<br />
Branson: ... und ein Raumfahrtunternehmen.<br />
(lacht laut auf)<br />
<strong>ZEIT</strong>: Wie bringen Sie das überein?<br />
Branson: Ich betrachte mich gerne als ehrlich.<br />
Und meine Botschaft lautet: Sie können die<br />
Welt nicht in dunkle Zeiten zurückversetzen.<br />
Stattdessen müssen wir vorwärtsgehen. Wir verwenden<br />
alle Profite unserer Airline und unserer<br />
Zuglinie, um saubere Treibstoffe zu entwickeln.<br />
Allzu viel Gewinn machen wir da vielleicht<br />
nicht, aber den geben wir dafür aus. Und mithilfe<br />
des Carbon War Room gibt es jetzt Treibstoffe<br />
für Flugzeuge und Raumschiffe, Züge und<br />
Formel-1-Autos, die fast zu hundert Prozent<br />
sauber sind. Nehmen Sie die Airline-Industrie.<br />
Es gibt nur rund 1800 Pumpstationen auf der<br />
Welt, um große Flieger aufzutanken. Da können<br />
Sie sich sehr schnell von einer der dreckigsten<br />
zu einer der saubersten Industrien wandeln.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Welche Treibstoffe sind das?<br />
WAS BEWEGT RICHARD BRANSON?<br />
Abenteurer<br />
Es war Mitte der sechziger Jahre, und<br />
er war fünfzehn Jahre alt, als er meinte,<br />
jetzt müsse er etwas gegen den<br />
Vietnamkrieg unternehmen. Also<br />
verlegte Richard Branson ein Magazin<br />
und bekam Interviews mit Berühmtheiten<br />
wie Mick Jagger. Bald<br />
schickten ihm Protestbands auch ihre<br />
Musikbänder; und 1969 gründete er<br />
ein Plattenlabel. Die Marke Virgin<br />
war geboren. 1984 kam eine Airline<br />
hinzu, dann Radiosender, Bahnfirmen,<br />
Mobilfunkbetreiber, ein Formel-1-Team<br />
und ein Unternehmen<br />
für private Raumflüge. Letzteres soll<br />
bald auch ganz normale Leute befördern,<br />
verspricht Branson. Heute betreibt<br />
der 61-jährige Milliardär rund<br />
200 Firmen mit insgesamt etwa<br />
50 000 Mitarbeitern in 29 Ländern.<br />
Die meiste Zeit verbringt er indes mit<br />
seiner Stiftung Virgin Unite, die soziale<br />
und ökologische Probleme in<br />
aller Welt anpacken soll. 2007 gründete<br />
er mit anderen Prominenten die<br />
Gruppe The Elders, die unter anderem<br />
versucht, regionale Konflikte,<br />
etwa in Kenia, zu lösen.<br />
Als Abenteurer bleibt sich Branson treu.<br />
Anfang Juli hat er als ältester Kitesurfer<br />
den Ärmelkanal überquert und sich<br />
dabei einige Blessuren zugezogen<br />
(Foto). Den Rekord zu brechen – das<br />
war seinem Sohn vorbehalten. UJH<br />
Branson: Sprit aus Algen oder aus den Abgasen<br />
von Aluminium- und Stahlfabriken. Jetzt müssen<br />
wir die Verfahren entwickeln, um die Mengen<br />
herzustellen, die man braucht. Das ist für<br />
mich die Antwort: nicht die Menschen davon<br />
abhalten, Spaß zu haben, sie nicht vom Reisen<br />
abhalten. Besser sorgt man dafür, dass sie reisen<br />
können, ohne die Welt zu beschädigen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Klingt prima. Aber glaubt man Umweltexperten,<br />
hält die Welt nicht mehr viel Wachstum<br />
aus, weil wir dann immer mehr Ressourcen verbrauchen.<br />
Der Nutzen aus höherer Effizienz und<br />
Innovation wird mehr als aufgefressen von der<br />
schieren, wachsenden Menge der Produktion.<br />
Branson: Der Carbon War Room kann zum Beispiel<br />
zeigen: Wenn Sie jedes Gebäude umweltfreundlich<br />
machen, können Sie den Energiekonsum<br />
um 60 Prozent verringern und den Besitzern<br />
viel Geld sparen. Wir haben gerade Kapital von<br />
850 Millionen Dollar eingeworben, um in<br />
Miami damit zu experimentieren. Die Banken<br />
verdienen daran, die Bauunternehmer verdienen<br />
daran, die Stadt verdient daran. Jeder. Verlierer<br />
sind nur die Ölimporteure in Amerika. Man<br />
kann den Verbrauch enorm reduzieren, wenn<br />
man auch Boote, Flugzeuge, Batterien und so<br />
weiter effizienter macht. Nehmen Sie an, jedes<br />
Land der Welt sagt, im Jahr 2025 importieren<br />
wir kein Öl mehr. Wenn Sie sich dieses Ziel setzen<br />
und von da aus arbeiten, ist es auch zu schaffen.<br />
Dann entwickeln Sie neue Treibstoffe, die<br />
nicht die Nahrungsmittelproduktion beeinträchtigen.<br />
Wir haben die Sonne, wir haben den<br />
Wind, vielleicht ist all diese Energie am Anfang<br />
etwas teurer, aber schnell wird der Preis sinken<br />
und wettbewerbsfähig sein.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Ist der Staat Ihr Freund in diesem Unterfangen?<br />
Branson: Wenn er zukunftsbewusst ist, kann er<br />
uns ein sehr starker Freund sein und die ganze<br />
Entwicklung beschleunigen. Der Staat will und<br />
braucht Organisationen wie den Carbon War<br />
Room, um mit ihnen zu arbeiten. Politiker können<br />
nicht drei- oder viertägige Brainstorming-<br />
Sitzungen abhalten, wir schon.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Hätte der Staat die europäische Solarindustrie<br />
beschützen sollen, in der Sie auch Geld<br />
verloren haben?<br />
WIRTSCHAFT<br />
Sir Richard Branson auf einer Konferenz im New Yorker Museum of Modern Art<br />
Branson: Die wichtigste Aufgabe des Staates ist<br />
es, Ziele für die Reduzierung der Emissionen zu<br />
setzen und für fairen Wettbewerb zu sorgen, wo<br />
auch immer auf der Welt. Ich glaube fest an den<br />
Markt, und soweit es um mein Geschäft geht,<br />
kann ich nur sagen: Sie müssen das Süße und das<br />
Saure schlucken. Einige Firmen haben Erfolg,<br />
andere nicht.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Sie hatten Ihr grünes Coming-out Mitte<br />
des vergangenen Jahrzehnts. Was war der entscheidende<br />
Moment, in dem sie zum Krieger<br />
fürs Klima wurden?<br />
Branson: Es war ein Besuch des früheren USamerikanischen<br />
Vize-Präsidenten Al Gore. Die<br />
Wissenschaft spricht in der Sache eine eindeutige<br />
Sprache – und die neuen Berichte über die<br />
Eisschmelze in der Arktis verstärken diese Botschaft.<br />
Aber ich bin ein geborener Optimist<br />
und glaube, die menschliche Erfindungsgabe<br />
kann alle Schwierigkeiten überwinden. Trotzdem<br />
müssen wir besser darin werden, unsere<br />
Bemühungen zu koordinieren. Deshalb habe<br />
ich den Carbon War Room gegründet, um die<br />
klügsten Leute aus Wirtschaft und Finanzen,<br />
Technologie und Wissenschaft zusammenzubringen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Wie wichtig ist der Spaßfaktor? Würden<br />
Sie auch etwas machen, was keinen Spaß macht?<br />
Branson: Spaß und Abenteuer sind mir wichtig.<br />
Ohne Spaß sind Sie nicht so gut in dem, was Sie<br />
tun. Gerade habe ich mit meinen Kindern den<br />
Mont Blanc bestiegen, um beim Start ihrer gemeinnützigen<br />
Initiative zu helfen. Das hat ebenso<br />
Spaß gemacht wie das Treffen hier in Berlin.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Sie wirken bei alldem sehr entspannt. Was<br />
aber macht Sie unruhig, was macht Sie besorgt?<br />
Branson: Nicht viel (lacht). Die meisten Probleme<br />
dieser Welt können gelöst werden.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Und was inspiriert Sie?<br />
Branson: Viele meiner besten Ideen sind durch<br />
Interviews entstanden. Einmal wurde ich gefragt,<br />
warum ich nicht im Bahn-Geschäft sei. Dann<br />
stand in dem Artikel am nächsten Tag, dass ich<br />
darüber nachdächte. Also musste ich einen Managing<br />
Director finden, um das Bahngeschäft<br />
wirklich zu starten.<br />
Die Fragen stellte UWE JEAN HEUSER<br />
Fotos: Gerald Holubowicz/laif; Hussein Samir/SIPA/ddp (u.)
Foto [M]: Vincent Hazat/PhotoAlto/dpa<br />
WISSEN Tödlicher<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 31<br />
Geld<br />
oder<br />
Leben<br />
Diese Worte kennt jeder Arzt:<br />
»Ich werde ärztliche Verordnungen<br />
treffen zum Nutzen der<br />
Kranken nach meiner Fähigkeit<br />
und meinem Urteil, hüten aber<br />
werde ich mich davor, sie zum<br />
Schaden und in unrechter Weise<br />
anzuwenden ...« So steht es in jenem berühmten<br />
Eid aus der Antike, der nach dem griechischen Arzt<br />
Hippokrates benannt ist. Heute, 2500 Jahre später,<br />
schwören Mediziner zwar nicht mehr bei den Göttern<br />
Apollon und Asklepios. Doch die wichtigsten Gedanken<br />
dieser Ethik gelten noch immer: das Primat des<br />
Patientenwohls. Die Schweigepflicht. Das Euthanasieverbot.<br />
Oder das primum non nocere: das Gebot,<br />
einen Eingriff eher zu unterlassen, als künftige Beeinträchtigungen,<br />
gar den Tod zu riskieren.<br />
Aber Papier ist geduldig, und in den Widersprüchen<br />
des Alltags verlieren sich die Ideale allzu oft. Wie<br />
groß der Leidensdruck vieler Ärzte mittlerweile ist,<br />
belegt die Flut von Leserbriefen, die uns nach Erscheinen<br />
unserer Titelgeschichte Das Ende der Schweigepflicht<br />
(<strong>ZEIT</strong> Nr. 21/12) erreichte. Darin hatten Ärzte<br />
aus dem Alltag ihrer Krankenhäuser berichtet und geklagt,<br />
wie sie immer häufiger in den Interessenskonflikt<br />
zwischen dem Wohl der Patienten und den Gewinn<br />
erwar tun gen ihres Hauses gerieten. Berichtet<br />
wurde von unnötigen Therapien, die aus finanziellen<br />
Gründen angeordnet wurden, oder davon, dass Kliniken<br />
Patienten nicht gehen ließen, für die es lukrative<br />
Pauschalen zu kassieren gab.<br />
Die Ärzte und Ärztinnen, die uns diese Fälle erzählten,<br />
hatten anonym bleiben wollen. Nur so schien<br />
es ihnen möglich, weiter zu arbeiten, ohne vom Arbeitgeber<br />
oder von geschädigten Patienten verklagt zu<br />
werden. Doch das überwältigende Echo, das die Berichte<br />
auslösten, macht klar: Die bitteren Erfahrungen<br />
sind keine Einzelfälle. Auch die Mehrheit unserer<br />
Leserbriefschreiber, darunter viele Ärzte, beklagte,<br />
dass in deutschen Krankenhäusern ein brutaler Verteilungskampf<br />
tobt, bei dem das Überleben des Hauses<br />
immer wieder Vorrang hat vor einer adäquaten<br />
Behandlung der Patienten.<br />
Bleibt der Patient zu lange – weil er alt ist<br />
oder gebrechlich –, zahlt die Klinik drauf<br />
Ein entscheidender Grund liegt im veränderten Finanzierungssystem<br />
von Krankenhäusern und Arztpraxen.<br />
Seit 2003 bekommen die deutschen Kliniken<br />
keine Tagessätze mehr. Sie werden nach Fallpauschalen<br />
bezahlt, die sich aus der Ein lie fe rungs dia gno se<br />
errechnen. Für eine künstliche Hüfte gibt es eine<br />
anderen Pauschale als für einen Herzinfarkt. Wenn<br />
die Patienten länger bleiben müssen, als es die einkalkulierte<br />
Verweildauer vorsieht – weil sie alt und<br />
gebrechlich sind oder weil es Wartezeiten bei den<br />
Untersuchungen gibt –, dann geht die längere Liegezeit<br />
zulasten des Krankenhauses.<br />
Das ist ein Anreiz, schneller zu arbeiten. Die<br />
durchschnittliche Aufenthaltsdauer wurde zwischen<br />
2000 und 2010 um zwei Tage auf 7,8 Tage verkürzt.<br />
Eroberer: Auf den<br />
Wiesen und Weiden breitet<br />
sich das Kreuzkraut aus S. 38<br />
Was hat in Krankenhäusern Vorrang – der Profi t oder<br />
die Patienten? Einladung zu einer überfälligen Debatte<br />
VON HEIKE FALLER UND CHRISTIANE GREFE<br />
TITELGESCHICHTE<br />
GESUNDHEIT<br />
Krankenhäuser werden<br />
heute wie Unternehmen<br />
geführt, sie wetteifern um<br />
Patienten und lukrative<br />
Therapien. Da bleiben<br />
die Interessen der<br />
Kranken leicht auf der<br />
Strecke (diese Seite).<br />
Fünf Insider schildern,<br />
wie es hinter den<br />
OP-Türen zugeht, und<br />
entwerfen ein Manifest<br />
für eine menschliche<br />
Medizin (Seite 32/33)<br />
Das trug dazu bei, dass die Krankenhausausgaben in<br />
Deutschland seit Jahren stabil bleiben, obwohl die<br />
Bevölkerung älter wird und der medizinische Fortschritt<br />
neue Möglichkeiten bietet.<br />
Zugleich sorgte die Pauschalabrechnung dafür,<br />
dass die Effizienz von Krankenhäusern vergleichbar<br />
wurde und sich der Wettbewerb der Kliniken erhitzte.<br />
Wer es nicht schafft, wirtschaftlich zu arbeiten,<br />
der kann nun überführt werden – und wird früher<br />
oder später fusioniert, privatisiert oder geschlossen.<br />
In den vergangenen Wochen haben die niedergelassenen<br />
Ärzte für höhere Honorare gekämpft.<br />
Auch in Arztpraxen werden Leistungen unterschiedlich<br />
vergütet, und hinter dem Streit mit den Krankenkassen<br />
steht der Unmut vieler Mediziner über<br />
das Abrechnungssystem. Welche Leistungen wie<br />
bezahlt werden, wird in Ausschüssen immer wieder<br />
neu ausgehandelt. So kommt es, dass auch Fachärzte<br />
die Patienten mal zur Akupunktur und mal zur vorsorglichen<br />
Darmspiegelung bitten, je nachdem, was<br />
gerade gesondert honoriert wird.<br />
In den Kliniken aber hat die Steuerung über Fallpauschalen<br />
besonders drastische Folgen: Die Krankenhäuser<br />
suchen sich oft die lukrativsten Patienten<br />
oder Prozeduren heraus (»Cherry Picking«). Der<br />
Anreiz ist gestiegen, das Lohnenswerte – aufwendige<br />
Operationen – häufig zu tun und das Notwendige<br />
zu vernachlässigen, etwa das Gespräch mit den Patienten.<br />
Ältere und gebrechliche Menschen werden<br />
entweder gar nicht erst aufgenommen oder zu früh<br />
nach Hause geschickt, wenn die Kosten ihrer Behandlung<br />
die Fallpauschale übersteigen (»blutige<br />
Entlassung«). Dabei entstehen am Ende womöglich<br />
noch höhere Kosten, die von anderen Systemen getragen<br />
werden. Aber das Krankenhaus erscheint auf<br />
dem Papier wirtschaftlicher.<br />
Die Arbeit in den Häusern hat sich bis in den<br />
letzten Winkel verändert. Pfleger sehen schon an<br />
Farbmarkierungen im Computersystem, ob ein Patient<br />
die Grenzverweildauer überschritten hat und<br />
zum Minusgeschäft geworden ist. Pfleger und Ärzte<br />
verbringen viel mehr Zeit am Rechner. Chef- und<br />
Oberärzte werden über Bonusverträge an betriebswirtschaftlichen<br />
Zielen beteiligt, die auch im Widerspruch<br />
zur angemessenen Behandlung stehen können.<br />
Krankenhäuser würden heute geführt »wie Industrieunternehmen«,<br />
bemängelte jüngst die Deutsche<br />
Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM).<br />
Krankheiten würden »zur Ware, Ärzte zu Anbietern<br />
und Patienten zu abgerechneten Fällen«.<br />
Natürlich sitzen nicht in allen Klinikleitungen<br />
Spekulanten, und schon gar nicht arbeiten alle Ärzte<br />
fahrlässig oder rücksichtslos. Die Mehrheit versorgt<br />
die Kranken weiterhin professionell und verantwortungsvoll.<br />
Aber der Patient kann sich nicht mehr sicher<br />
sein, ob der Arzt, der ihn berät, wirklich nur<br />
seine Heilung im Sinn hat.<br />
Nun könnte man sagen: Das ist doch nicht neu.<br />
In der Geschichte der Medizin gab es – allen Eiden<br />
zum Trotz – stets Quacksalber und Scharlatane, die<br />
nur aufs Geldverdienen aus waren. Und in modernen<br />
Krankenhäusern ging es neben der Genesung<br />
KINDER<strong>ZEIT</strong><br />
Zu Besuch bei einem<br />
Seifenkistenrennen S. 41<br />
stets auch um Profit: Zur Zeit der Tagessätze behielt<br />
man Patienten gern ein paar Tage länger als notwendig<br />
da, um die vorhandenen Betten auszulasten. Privatpatienten<br />
laufen immer schon Gefahr, dass nicht<br />
nur zu viel auf ihre Rechnung gesetzt, sondern auch<br />
zu viel gemessen, durchleuchtet, operiert und verordnet<br />
wird.<br />
Doch offensichtlich erhöhen die neuen Rahmenbedingungen<br />
das Risiko, dass mehr auf die Unternehmensziele<br />
des Krankenhauses als auf das Wohl<br />
der Patienten geachtet wird. Das geschieht oft ganz<br />
unbewusst, weil sich schon eine entsprechende Unternehmenskultur<br />
entwickelt hat. Ärzte folgen kritiklos<br />
den Weisungen ihres Ober- oder Chefarztes,<br />
weil sonst die eigene Karriere gefährdet wäre.<br />
Die Ärzte selbst fordern inzwischen<br />
einen deutlichen Kurswechsel<br />
Mittlerweile aber regt sich Widerstand. Die Deutsche<br />
Gesellschaft für Innere Medizin stellte sich im<br />
Juli gegen »Fehlentwicklungen durch falsche Anreize«.<br />
Bonusverträge, die höhere Fallzahlen oder Umsätze<br />
belobigen, könnten Ärzte zu »großzügigen Indikationsstellungen«<br />
verleiten und »korrumpierbar«<br />
machen, heißt es in der Stellungnahme der DGIM.<br />
Berufsanfänger erlernten eine »falsche Priorisierung<br />
ärztlicher Tätigkeiten«. Das betriebswirtschaftliche<br />
Denken vermindere »in erheblichem Maße die<br />
Möglichkeiten der Anteilnahme und der geduldigen<br />
Zuwendung«. Die DGIM fordert einen deutlichen<br />
Kurswechsel. Doch solche Reformen dauern, und<br />
bis dahin stellt sich die Frage: Ist das alles noch mit<br />
dem Berufsethos des Arztes vereinbar?<br />
Gerade Ärzte haben zu allen Zeiten großen Wert<br />
auf die Selbstverpflichtung ihres Standes gelegt. So<br />
wurde der hippokratische Eid nach dem Zweiten<br />
Weltkrieg vom Weltärztebund zeitgemäß neu formuliert.<br />
Dieses »Genfer Gelöbnis« betont ausdrücklich,<br />
dass Ärzte ihre Patienten unabhängig von sozialer<br />
Stellung, Geschlecht oder ethnischer, konfessioneller<br />
und politischer Zugehörigkeit behandeln und<br />
ihre medizinischen Kenntnisse auch unter Drohung<br />
nicht »in Widerspruch zu den Geboten der Menschlichkeit«<br />
anwenden sollen. Der Text ist in Deutschland<br />
der Berufsordnung vorangestellt.<br />
Von Boniverträgen ist im Genfer Gelöbnis noch<br />
keine Rede. Darum geht es in einer Charta of Medical<br />
Professionalism, die von europäischen und amerikanischen<br />
Ärzten erarbeitet und 2002 veröffentlicht<br />
wurde, aber in Deutschland wenig bekannt<br />
und nicht verpflichtend ist.<br />
Braucht es also für das Arbeiten in Krankenhäusern<br />
und Praxen einen neuen Eid? Ein Gelöbnis, das<br />
Ärzten Standfestigkeit und Patienten Sicherheit<br />
gibt? Wir haben einen ehemaligen Chefarzt, einen<br />
Notarzt, eine Krankenschwester, eine Chirurgin<br />
und einen Medizinethiker eingeladen, über diese<br />
Fragen zu diskutieren. Das Ergebnis finden Sie auf<br />
den folgenden Seiten.<br />
A www.zeit.de/audio<br />
HAUTKREBS<br />
Geröstetes Schwein<br />
Rufmord an der Wissenschaft?<br />
Nein, eine Gesundheitskampagne<br />
Auf den ersten Blick war die Täuschung<br />
gut gemacht. Was da unter der Webadresse<br />
http://46.245.180.132 im Netz zu sehen<br />
war, hätte tatsächlich ein geleakter Forschungsbericht<br />
sein können. Die Bilder<br />
waren jedenfalls empörend: Sie zeigten ein<br />
Schwein in einem Versuchslabor, das von<br />
Männern in blütenweißen Kitteln bei lebendigem<br />
Leib mit einer UV-Lampe geröstet<br />
wurde. Seine Haut warf rote Blasen, das<br />
Tier krümmte sich jämmerlich. »Schmerzäußerungen«<br />
und »offene Wundbildung«<br />
verzeichnete das danebenstehende Versuchsprotokoll,<br />
das sich wie durch Zufall<br />
ebenfalls im Netz fand.<br />
Ein besonders herzloses Tierexperiment?<br />
Ein weiterer Beweis für die Skrupellosigkeit<br />
der modernen Wissenschaft? Oder eine Inszenierung<br />
von radikalen Tierschützern?<br />
Weit gefehlt. In Wirklichkeit handelte es<br />
sich um eine gut gemeinte Kampagne der<br />
Deutschen Krebshilfe.<br />
Mithilfe der Werbeagentur Jung von<br />
Matt wollte die Krebshilfe vor allem Jugendliche<br />
über das Risiko von Hautkrebs<br />
aufklären. Schließlich sterben jedes Jahr in<br />
Deutschland rund 3000 Menschen an dessen<br />
Folgen. Und 167 000 Jugendliche unter<br />
18 Jahren zieht es laut Krebshilfe ins<br />
Solarium – obwohl Minderjährigen diese<br />
Art von Schönheitspflege seit 2009 verboten<br />
ist. Diese junge Zielgruppe sollte durch<br />
die frei erfundene Schweinequäl-Webseite<br />
aufgerüttelt werden. Via Face book und<br />
Twitter würde sich die Botschaft per viralem<br />
Marketing im Internet verbreiten, die<br />
Jugendlichen wären geschockt – und würden<br />
danach ernsthaft über ihr eigenes<br />
Hautkrebsrisiko diskutieren. So stellten<br />
sich die Herren bei der Krebshilfe die Sache<br />
vor.<br />
Ein glorioser Irrtum. Zwar wurde der<br />
Link verbreitet und kräftig diskutiert.<br />
Allerdings ging es dabei nicht – wie von der<br />
Krebshilfe erhofft – um die Schädlichkeit<br />
künstlicher UV-Bestrahlung, sondern vielmehr<br />
um die Frage, ob dieser Versuch echt<br />
sein könne oder ob es sich um einen Hoax<br />
handele; und darum, ob Wissenschaftlern<br />
diese Art von Tierversuchen wirklich zuzutrauen<br />
sei.<br />
Dabei agieren die Forscher im Film völlig<br />
stümperhaft und quälen ein Tier ohne<br />
erkennbaren Zweck, denn die schädliche<br />
Wirkung von UV-Strahlen ist längst bewiesen.<br />
Eine schlechtere Imagekampagne für<br />
die Wissenschaft ist kaum vorstellbar.<br />
Doch die Vertreter der Deutschen Krebshilfe<br />
klopfen sich auch noch selbst auf die<br />
Schulter: »Mit dieser Aktion werden wir die<br />
Leute wachrütteln«, schwärmt Hauptgeschäftsführer<br />
Gerd Nettekoven auf rosi-hatschwein-gehabt.de.<br />
Millionen Menschen<br />
hätten das Video gesehen, die Aktion sei ein<br />
voller Erfolg gewesen.<br />
Hat Nettekoven sich vom Werbegeschwätz<br />
von Jung von Matt einwickeln<br />
lassen? Fakt ist: Von den geschminkten<br />
Wunden auf der Haut des Schweins zog bei<br />
Face book und Twitter niemand die Verbindung<br />
zum eigenen Solariumbesuch. In<br />
den Diskussionen im Netz ging es nie um<br />
Hautkrebs. Dafür rückte die Kampagne<br />
ganz offenbar wissenschaftliche Forschung<br />
in ein falsches Licht. Eine Institution, die<br />
auf die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern<br />
angewiesen ist, hätte so etwas nicht zulassen<br />
dürfen.<br />
Vielleicht liegt der Flop ja auch nur daran,<br />
dass niemand das Schwein zurate gezogen<br />
hat. LAURA HENNEMANN<br />
Glück und Glotze<br />
Laut dem Glücksatlas <strong>2012</strong> ist die »Lebenszufriedenheit«<br />
in Deutschland in einem »klaren<br />
Aufwärtstrend«. Hurra! Endlich gute Nachrichten<br />
in krisengeschüttelten Zeiten. Doch auf<br />
Seite 70 des frohgemuten Werkes kommt man<br />
ins Grübeln. Dort geht es um das »Vertrauen<br />
HALB<br />
WISSEN<br />
in Institutionen«. Und<br />
darum steht es schlecht.<br />
Nur jeder Siebte traut<br />
den politischen Parteien<br />
über den Weg. Gerade mal ein Drittel der<br />
Deutschen hält die Bundesregierung für glaubwürdig;<br />
kaum besser weg kommen Kirchen<br />
und Gewerkschaften. Echtes Zutrauen genießen<br />
dagegen Rechtsstaat, Polizei, Bundeswehr<br />
– und das Fernsehen! Dem Geflimmer auf der<br />
Mattscheibe glauben angeblich sogar zwei<br />
Drittel der Deutschen, doppelt so viele wie<br />
ihrer Regierung. Ausgerechnet die größte Illusionsmaschine<br />
als Fels in der Brandung der<br />
Ungewissheit? Der Glücksatlas <strong>2012</strong> wird von<br />
der Deutschen Post herausgegeben. Der können<br />
Sie glauben – vertrauen Sie uns. BEL
32 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong><br />
<strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>: Einige von Ihnen haben uns Leserbriefe<br />
geschrieben, in denen Sie die Folgen eines durchökonomisierten<br />
Klinikalltags beklagen. Können<br />
Sie Beispiele erzählen?<br />
Ursula Stüwe: Ich kann Ihnen eines aus meiner<br />
Familie nennen: Da bekam eine junge Frau ein<br />
Kind, das kurz nach der Geburt in die Kinderklinik<br />
verlegt wurde, zur Überwachung wegen angeblicher<br />
Herzgeräusche. Dort sollte es für 48<br />
Stunden bleiben, obwohl es keinen krankhaften<br />
Befund gab. Die Eltern waren natürlich total<br />
beunruhigt. Ich fragte die Ärztin, ob Ihre Entscheidung<br />
vielleicht etwas mit der Mindestverweildauer<br />
zu tun habe. Wenn diese nicht eingehalten<br />
wird, gibt es weniger Geld von der Kasse.<br />
Und in der Tat: die Kollegin konnte keinen medizinischen<br />
Grund nennen.<br />
Susanne Sänger: Man hört im Arbeitsalltag ständig<br />
den Satz: Das machen wir jetzt so, sonst bekommt<br />
die Abteilung kein Geld. Zum Beispiel, wenn ein<br />
Rückenpatient zur Schmerztherapie in der Chirurgie<br />
aufgenommen wird und dort bleibt, obwohl<br />
seine Befunde eher auf eine urologische Erkrankung<br />
hindeuten.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Sie behaupten also, dass in diesen Fällen betriebswirtschaftliche<br />
Ziele der Klinik den Vorrang<br />
vor dem medizinisch Angebrachten haben?<br />
Urban Wiesing: Ich wäre da vorsichtig. Das sind<br />
Einzelfälle, bei denen Sie schlecht nachweisen können,<br />
dass es um ökonomische Einflüsse geht.<br />
Medizin ist nun einmal uneindeutig, sie fordert<br />
komplexe Entscheidungen, die können Sie nie mit<br />
mathematischer Exaktheit fällen.<br />
Paul Brandenburg: Aber in diesem Graubereich<br />
wird tendenziell das gemacht, was vom Haus gewünscht<br />
wird.<br />
Wiesing: Ich glaube trotzdem, dass wir nicht auf<br />
Einzelfälle schauen sollten, sondern auf die generelle<br />
Frage: Werden falsche Entscheidungen getroffen,<br />
weil es seit einigen Jahren Fallpauschalen<br />
gibt, die bestimmte Prozeduren besser honorieren<br />
als andere? Machen wir deswegen in Deutschland<br />
insgesamt zu viel? Führt das Anreizsystem zum<br />
Beispiel dazu, dass zu viel operiert wird?<br />
Brandenburg: Orthopäden sagen immer so schön,<br />
wenn man nur einen Hammer hat, sehen viele<br />
Probleme aus wie ein Nagel. Was man sicher sagen<br />
kann, ist, dass es bestimmte Moden gibt. Im<br />
Moment werden beispielsweise komplexe Herzfrequenzanalysen<br />
besonders gut honoriert. Und<br />
siehe da, die steigen. Oder: In kaum einem anderen<br />
Land wird so viel katheterisiert wie in Deutschland.<br />
Es gibt Kliniken, die man als Notarzt vermeidet,<br />
weil man genau weiß: Wenn sich dort der<br />
Patient einmal an die Brust fasst, kriegt er prompt<br />
einen Herzkatheter. Das ist ein Eingriff, der Leben<br />
retten kann. Aber es gibt eben auch Risiken. Da<br />
wird ein Schnitt in die Leistenarterie gemacht und<br />
dann ein Draht bis zum Herzen geführt. Und natürlich<br />
kann es da Komplikationen geben, man<br />
kann die Gefäße beschädigen, man kann allergische<br />
Reaktionen verursachen, man kann sogar<br />
einen Herzinfarkt auslösen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Und deshalb kommt es vor, dass Sie als Notarzt<br />
entscheiden: Diese Klinik fahre ich nicht an,<br />
dort bekommt der Patient vielleicht einen unnötigen<br />
Eingriff?<br />
Brandenburg: Ja. Man kann sich beispielsweise<br />
sicher sein, dass eine vierzigjährige Frau, die fit und<br />
schlank ist und gerade Psychostress hat, höchstwahrscheinlich<br />
keinen Herzinfarkt hat, wenn sie<br />
ein Engegefühl in der Brust verspürt. Da entscheide<br />
ich mich als Notarzt manchmal gegen Klinik A,<br />
weil ich weiß, da heißt es gleich: durchfahren zum<br />
Herzkatheter.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Vielleicht besser, als eine Krankheit unentdeckt<br />
zu lassen?<br />
Brandenburg: Schon – andererseits gibt es Studien,<br />
nach denen bis zu einem Prozent aller Behandelten<br />
an diesem Eingriff sterben.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Wie bitte?<br />
Brandenburg: Natürlich ist diese scheinbar hohe<br />
Zahl auch der Tatsache geschuldet, dass die Patienten<br />
in der Regel schwer krank sind – es gibt also<br />
keinen Grund, Angst vor einer solchen Unter-<br />
suchung zu haben. Aber die Indikation muss eben<br />
sorgfältig gestellt werden.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Und das wird sie nicht?<br />
Wiesing: Wir beobachten in den vergangenen Jahren<br />
tatsächlich eine Zunahme bestimmter Eingriffe,<br />
die wir nicht medizinisch erklären können,<br />
auch nicht mit der älter werdenden Bevölkerung.<br />
Wir sind Weltmeister im Katheterisieren, bei<br />
Endo prothesen – dabei leben wir überhaupt nicht<br />
länger als andere Nationen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Haben Sie auch schon selbst Entscheidungen<br />
getroffen, von denen Sie sagen würden: Da<br />
hab ich mich zu sehr von ökonomischen Kriterien<br />
leiten lassen?<br />
Brandenburg: Ganz ehrlich? Ja, das ist so. Ich würde<br />
allerdings für mich und die meisten meiner<br />
Kollegen in Anspruch nehmen, dass das ausschließlich<br />
in Bereichen passiert ist, wo es dem<br />
Patienten nicht geschadet hat. Im Rettungswesen,<br />
das ist ein offenes Geheimnis, ist der Großteil der<br />
Fahrten völlig unsinnig. Trotzdem wird der Patient<br />
fast immer transportiert. Warum? Weil es Geld<br />
gibt. Der Rettungsdienst hat nach<br />
meiner Erfahrung meist die klare<br />
Order vom Wachleiter: Wenn ihr<br />
dahin fahrt, nehmt ihr den mit.<br />
Michael Scheele: Ein anderes Beispiel:<br />
Ein Kreißsaal ist irgendwann<br />
mal überlastet. Wenn das Krankenhaus<br />
dennoch weitere Schwangere<br />
annimmt, hat das oft auch<br />
einen ökonomischen Hintergrund.<br />
Es kam zum Beispiel schon<br />
vor, dass Zwillinge auf der Station<br />
im Badezimmer zur Welt kamen.<br />
Natürlich steht dort nicht das ganze<br />
Equipment eines Kreißsaals zur<br />
Verfügung. Da kämpft man als<br />
Chefarzt ständig mit der Grenze:<br />
Was ist wirklich nicht mehr verantwortbar,<br />
und was müssen wir<br />
machen? Wir brauchen schließ-<br />
lich Geburten.<br />
Wiesing: Das ist sicher nicht<br />
schön, Herr Scheele, aber wir<br />
müssen uns auch darüber im Klaren<br />
sein, dass die Mehrheit der<br />
Weltbevölkerung froh wäre, wenn<br />
sie überhaupt so ein Badezimmer<br />
hätte. Also, da wäre ich etwas zurückhaltender.<br />
Aber dass laut der<br />
Techniker Krankenkasse 80 Prozent<br />
der Rückenoperationen überflüssig<br />
sind: Das ist für mich ein<br />
Skandal. Oder dass es mittlerweile<br />
eine Gruppe von ehemaligen<br />
Knieoperateuren gibt, die sich zusammengeschlossen<br />
haben, um<br />
Patienten eine Zweitmeinung zu geben, weil sie<br />
finden, es werde zu viel am Knie operiert: Das ist<br />
doch genauso gut ein Skandal. Ebenso, dass wir in<br />
Europa die größte Dichte an Herzkathetern haben,<br />
aber nicht herzgesünder sind.<br />
Sänger: Ich denke jedenfalls, dass man sich, wenn<br />
man ein Krankenhaus betritt, darüber im Klaren<br />
sein muss, dass die medizinischen Entscheidungen<br />
der Ärzte von ökonomischen Gesichtspunkten<br />
beeinflusst sein können. Als Patient kann ich nicht<br />
ohne Weiteres davon ausgehen, dass die Entscheidung<br />
so ausfällt, wie es für mich das Beste wäre.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Warum machen Sie als Ärzte da mit? Keiner<br />
kann Sie zwingen, unnötige Behandlungen vorzunehmen<br />
...<br />
Stüwe: Ich bin seit 1965 in deutschen Krankenhäusern<br />
tätig, insofern überblicke ich viele Jahre.<br />
Die Einführung der Fallpauschalen im Jahr 2003<br />
war für mich tatsächlich der Wendepunkt. In einer<br />
mir bekannten Klinik wurde damals beispielsweise<br />
ein neuer Operationstrakt eingerichtet, der sollte<br />
sich natürlich rentieren. Da setzen sich dann die<br />
Ökonomen hin und rechnen aus: Wenn man pro<br />
Tag etwa 35 Gallen operiert, dann ist der neue<br />
Trakt rentabel. Das wird auch den Ärzten so kommuniziert.<br />
Damit beginnt der Konflikt zwischen<br />
Ökonomie und Medizin. Denn Gallen wachsen ja<br />
TITELGESCHICHTE: Geld oder Leben<br />
nicht auf Bäumen. Die Folge: Unklare Oberbauchbeschwerden<br />
bei vorhandenem Gallenstein führen<br />
dann eben etwas schneller zur Operation.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Aber irgendjemand muss ja die Indikation<br />
stellen. Wie bringt man Ärzte dazu?<br />
Brandenburg: Sagen wir, eine Klinik hat sich gerade<br />
zum Darmexzellenzzentrum erklärt. Der Chefarzt<br />
weiß: Er muss jetzt soundso viele Betten mit<br />
Patienten zur stationären Darmspiegelung belegen.<br />
Der Oberarzt kennt die Zielzahlen, und der<br />
Assistent erfährt vom Oberarzt, was gewünscht<br />
wird. Unter vier Augen wird klar gesprochen.<br />
Dann heißt es: Hör zu, wir haben hier Vorgaben,<br />
wir brauchen X-hundert Darmspiegelungen, die<br />
müssen reinkommen. Der Assistent weiß auch:<br />
Wenn ich dem Oberarzt noch einen Patienten zuspiele,<br />
steigen meine Chancen, dass ich die Untersuchung<br />
machen darf, die ich für meine Weiterbildung<br />
brauche. Und weil man eine Problematik<br />
meistens unterschiedlich deuten kann, tendiert<br />
man vielleicht zu einer invasiven Diagnostik, die<br />
man in manchen Fällen auch durch Abwarten und<br />
Beobachten hätte lösen können. Dabei ist die Prozedur<br />
der Darmspiegelung nicht ohne: In zwei von<br />
tausend Fällen wird dabei der Darm perforiert.<br />
Ohne dass die Klinikleitung in dem konkreten Fall<br />
den Eingriff angeordnet hätte.<br />
Wiesing: Genau, Herr Brandenburg, das ist ganz<br />
wichtig. Kaum ein Geschäftsführer ist so töricht,<br />
zum Arzt zu gehen und sich direkt in medizinische<br />
Entscheidungen einzumischen.<br />
Scheele: Einspruch. Es gibt Klinikdirektoren, die<br />
machen das. Ich kenne Beispiele, da staunen Sie.<br />
Wiesing: Was ich sagen will, ist, dass das in der<br />
Regel subtil läuft. Zumal jeder Mitarbeiter ja selbst<br />
am Fortbestand des Krankenhauses interessiert ist.<br />
Scheele: Das stimmt. Die Angst, das Haus könnte<br />
schließen, ist bei den Mitarbeitern allgegenwärtig.<br />
Wenn die Leistungszahlen sinken, dann wird das<br />
deutlich kommuniziert: Wir haben die Planzahlen<br />
nicht erreicht. Wenn das so weitergeht, müssen wir<br />
die Mittel kürzen.<br />
Wiesing: Aber da muss man auch Ross und Reiter<br />
benennen. Jeder weiß, dass wir zu viele Krankenhäuser<br />
in Deutschland haben. Jeder weiß, dass wir<br />
einen Überlebenswettbewerb haben, der nicht<br />
über den medizinischen Nutzen läuft, sondern<br />
darüber, wer schwarze Zahlen schreibt. Das heißt:<br />
Die Häuser, die sich halten, sind nicht die guten,<br />
nicht die notwendigen, sondern die finanziell erfolgreichen.<br />
Die Politik wagt es aber nicht, inhaltlich<br />
einzugreifen, sondern sie macht einen<br />
Überlebenswettbewerb über Rentabilität. Das ist<br />
der politische Hauptgrund. Das geht beim Bürgermeister<br />
los, der nicht wiedergewählt wird,<br />
wenn er sein Krankenhaus schließt. Und das hört<br />
bei den Wählern auf, die vor Ort behandelt werden<br />
wollen.<br />
Brandenburg: Aber wir sind ja nun mal alle nicht<br />
aus der Politik, und die Frage ist doch: Warum<br />
machen wir es mit? Warum halten die Ärzte alle<br />
die Klappe?<br />
Scheele: So einfach ist das nicht.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Wieso nicht?<br />
Scheele: Ich war seit 1995 Chefarzt in einem Perinatalzentrum<br />
Level 1, also einer Geburtshilfe, die<br />
auf höchste Risiken ausgelegt ist. Die Geschäftsleitung<br />
wollte offene Schichten mit Honorarärzten<br />
besetzen; das sind Ärzte, die keine festen Verträge<br />
haben und kurzfristig einspringen. Es wurde dann<br />
eine Kollegin engagiert, die noch nie bei uns gear-<br />
beitet hat. Sie müssen sich vorstellen: Da kommt<br />
eine Ärztin in eine Nachtschicht, die total alleine<br />
ist, sich nicht auskennt und die dann in einer Risikogeburtshilfe<br />
vor Ort die Entscheiderin sein soll.<br />
Daraufhin habe ich protestiert, weil ich der Meinung<br />
war, dass ich damit meine Patienten gefährde.<br />
Abgesehen davon gibt es Leitlinien, in denen<br />
eindeutig steht, dass ein Chefarzt einen Facharzt<br />
nicht einsetzen darf, ohne zu überprüfen, ob dieser<br />
Mensch das auch kann. Deshalb habe ich eine<br />
zweiwöchige Einarbeitungszeit gefordert. Und da<br />
ist das passiert, was Sie nicht für möglich gehalten<br />
haben, Herr Wiesing: Der Klinikdirektor hat den<br />
Dienstplan angeordnet.<br />
Wiesing: Das ist seine Aufgabe.<br />
Scheele: Ja, aber aus fachlicher Sicht sage ich, der<br />
Dienstplan ist so nicht machbar, weil er Patienten<br />
gefährdet. Das ist meine Pflicht. Patienten sind<br />
wichtiger als Profit. Ich habe dann den Kreißsaal für<br />
diese Zeiten von der öffentlichen Notfallversorgung<br />
abgemeldet, worüber sich die Behörde bei der Klinikleitung<br />
beschwerte. Es kann nicht sein, dass der<br />
medizinische Sachverstand des Chefarztes vom Klinikdirektor<br />
überstimmt wird. Und wenn das so ist,<br />
muss der Chefarzt handeln. Über die Konsequenzen<br />
muss er sich allerdings im Klaren sein.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Was waren die Konsequenzen?<br />
WISSEN<br />
»Klappe halten<br />
und wegsehen«<br />
So kennen sie den Alltag im Medizinbetrieb. Sie haben erfahren,<br />
dass manchmal der Profi t wichtiger als das Wohl des Patienten ist.<br />
Ein Gespräch über das, was sich in Krankenhäusern ändern muss<br />
Paul Brandenburg<br />
Dr. Paul Brandenburg, 34, ist<br />
Facharzt für Allgemein- und<br />
Notfallmedizin. Seine Ausbildung<br />
zum Chirurgen hat er<br />
abgebrochen und ist in die<br />
Notfallmedizin gewechselt.<br />
Heute arbeitet er selbstständig<br />
für verschiedene Krankenhäuser<br />
Ursula Stüwe<br />
Dr. Ursula Stüwe, 65, war zunächst<br />
Krankenschwester und<br />
dann Chirurgin in einem<br />
kommunalen Krankenhaus in<br />
Wiesbaden. Von 2004 bis<br />
2008 war sie Präsidentin der<br />
Landesärztekammer Hessen<br />
und Stellvertretende Vorsitzende<br />
der Ärztegewerkschaft<br />
Marburger Bund, Hessen<br />
Urban Wiesing<br />
Prof. Dr. Dr. Urban Wiesing,<br />
54, ist Arzt und Philosoph. Er<br />
leitet das Institut für Ethik<br />
und Geschichte der Medizin<br />
an der Universität Tübingen<br />
Susanne Sänger<br />
Susanne Sänger, 51, arbeitet<br />
seit 23 Jahren als Krankenschwester,<br />
überwiegend auf<br />
chirurgischen Stationen<br />
Scheele: Ich darf das juristisch nicht in einen Zusammenhang<br />
stellen, aber Arbeitgeber wissen ja,<br />
wie sie unliebsame Mitarbeiter mürbe kriegen.<br />
Solche Mitarbeiter haben eine schlechtere Verhandlungsposition<br />
bei der Stellenvergabe, der Ton<br />
in Verhandlungen wird feindselig, gleichzeitig wird<br />
einem vorgeworfen, nicht konstruktiv zu sein.<br />
Man verliert die ganze Arbeitsfreude. Das können<br />
Sie dann nur mit einem guten Anwalt und einem<br />
guten Coach überstehen. Irgendwann habe ich<br />
einer Vertragsauflösung zugestimmt.<br />
Wiesing: Sind Sie sicher, dass bei Ihnen wirklich<br />
Patienten gefährdet gewesen wären?<br />
Scheele: Ja. Wenn diese Kollegin uneingearbeitet<br />
auf einen Notfall getroffen wäre, dann wäre das<br />
schiefgegangen.<br />
Wiesing: Vielleicht stellt sich dann die Klinikleitung<br />
eben stur und sagt: Wofür gibt es einen<br />
Facharzt-Titel?<br />
Scheele: Natürlich kann eine Fachärztin eine einfache,<br />
normale Geburt betreuen, aber hier handelt<br />
es sich um Notfälle in einer Hochrisikogeburtshil-<br />
Michael Scheele<br />
Dr. Michael Scheele, 61, war<br />
16 Jahre lang Chefarzt in der<br />
Geburtshilfe eines städtischen<br />
Krankenhauses in Hamburg,<br />
das 2004 privatisiert wurde.<br />
Risikomanagement war einer<br />
seiner Schwerpunkte. Er schied<br />
2011 aus und arbeitet seither<br />
als Gutachter. Im Deutschen<br />
Ärzteorchester spielt er Geige<br />
fe, wo man innerhalb von Minuten die richtige<br />
Entscheidung treffen muss. Das kann nur, wer die<br />
Erfahrung hat. Wenn jemand die Örtlichkeiten<br />
nicht kennt, nicht weiß, wen er ansprechen muss,<br />
dann geht das nicht – so wie sich ein Flugkapitän<br />
ja auch nicht in ein ihm völlig fremdes Flugzeug<br />
setzt. Deshalb fordern die Leitlinien eine Einarbeitungszeit.<br />
Damit kommen wir aber an einen<br />
entscheidenden Punkt: Wer entscheidet, was<br />
rechtens ist? Da gibt es eine Arbeitsgemeinschaft<br />
für Medizinrecht, die stellt Leitlinien auf. Die<br />
sind rechtlich aber nicht bindend, sagte mir der<br />
Klinikdirektor, als ich mich darauf berief. Wenn<br />
jedoch etwas schiefgeht und Sie als Chefarzt vor<br />
Gericht landen, werden Sie an den Leitlinien gemessen.<br />
Und dann können Sie auch nicht argumentieren,<br />
dass die Geschäftsführung sich nicht<br />
daran halten wollte.<br />
Wiesing: Sie können sich aber auf die Berufsordnung<br />
beziehen, in der explizit steht, dass ein Arzt<br />
sich nicht von Nichtärzten in seinen medizinischen<br />
Entscheidungen beeinflussen lassen darf.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Hat die Berufsordnung, hat das Genfer Gelöbnis,<br />
in dem Sie in feierlichen Worten versprechen,<br />
das Patientenwohl über alles zu stellen, denn<br />
noch eine Bedeutung? Oder ist das einfach ein<br />
Stück Papier, das im Alltag keine Rolle spielt? Be-<br />
Foto [M]: Benno Kraehahn für <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>
WISSEN TITELGESCHICHTE: Geld oder Leben<br />
rufsanfänger bekommen es ziemlich profan mit<br />
der Post zugeschickt ...<br />
Wiesing: Letztlich ist das Gelöbnis ja die Präambel<br />
der Berufsordnung. Ich glaube, dass beide den<br />
Ärzten starke Argumente für ihre Entscheidungen<br />
bieten und dass darin auch ein Arzt ethos ausgedrückt<br />
ist, das im Kern unumstritten ist. Ich glaube<br />
nicht, dass wir die Berufsordnung neu schreiben<br />
müssen. Wir müssen uns daran erinnern.<br />
Brandenburg: Allerdings muss man auch ein Umfeld<br />
haben, in dem das möglich ist, ohne sofort<br />
Repressalien zu bekommen.<br />
Scheele: Was mir in der Tat gefehlt hat, war die<br />
Solidarität der anderen Chefärzte.<br />
Wiesing: Also, liebe Chefärzte: Habt Mut, euch<br />
des Berufsethos zu bedienen!<br />
Brandenburg: Vergessen Sie es. Im Gegenteil, wir<br />
haben in der Ärzteschaft eine besonders ausgeprägte<br />
Kultur des Klappehaltens und Wegsehens.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Woher rührt diese Kultur, die Sie da sehen?<br />
Brandenburg: Der Arztberuf ist von Anfang an ein<br />
Verdrängungswettkampf. Ich muss dem Chef ge-<br />
fügig sein, am besten in vorauseilendem Gehorsam,<br />
sonst krieg ich meinen für den Facharzt notwendigen<br />
Operationsplan nicht voll. Das ist ein<br />
Weiterbildungssystem aus dem Mittelalter, ein<br />
absolutes Machtinstrument, mit dem der Weiterbildungsermächtigte<br />
den Assistenten völlig in<br />
seiner Abhängigkeit hält. Ein solcher Assistent<br />
kritisiert nichts in seinem Haus.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Was hätte er denn zu befürchten?<br />
Brandenburg: In meiner Zeit als chirurgischer Assistenzarzt<br />
habe ich einmal kritisch nachgefragt, ob<br />
denn eine risikoreiche Leber-Lebendspende einer<br />
30-jährigen Frau und zweifachen Mutter ethisch<br />
vertretbar sei. Die Leber sollte ihrem todgeweihten<br />
Ehemann transplantiert werden. Der Patient litt<br />
unter einem überaus bösartigen Tumor der Gallenwege,<br />
die Frau wollte eigentlich nicht spenden,<br />
ließ sich dann aber von ihrem verängstigten Mann<br />
zu der Operation drängen. Die verantwortlichen<br />
Chirurgen haben ihm diese prestigeträchtige Operation<br />
als realistische Heilungschance verkauft.<br />
Damals warnte mich ein wohlmeinender Oberarzt:<br />
Noch so eine Nachfrage – und du gehst.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Und? Sind Sie rausgeflogen?<br />
Brandenburg: Ich bin auf eigenen Wunsch gegangen.<br />
Meine chirurgische Ausbildung habe ich irgendwann<br />
abgebrochen, um lieber als Notarzt zu<br />
arbeiten. Das ist übrigens kein seltener Weg: Wer<br />
in diesen Hierarchien nicht mehr arbeiten will,<br />
endet außerhalb der Klinik, als Honorararzt oder<br />
niedergelassener Arzt. Viele von denen, die bleiben,<br />
schalten dagegen irgendwann das kritische<br />
Reflektieren aus und erwarten das später auch von<br />
ihren Untergebenen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Was müsste sich strukturell ändern?<br />
Brandenburg: Evaluiert die Weiterbildung, macht<br />
die Ausbildungskriterien auch für den Weiterbildner<br />
verbindlich, und schafft unabhängige Instanzen,<br />
die diesen prüfen können.<br />
Stüwe: Die Ärztekammern müssten sich unbeliebt<br />
machen und zum Beispiel die Kataloge, die von<br />
den Assistenten vorgelegt werden, nachprüfen. Im<br />
Moment geschieht das nur stichprobenartig.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Herr Scheele, was hätte Ihnen, außer mutigeren<br />
Kollegen, denn geholfen, sich an Ihre Berufsordnung<br />
zu halten, ohne einen so hohen persönlichen<br />
Preis zu zahlen?<br />
Scheele: Wenn es beispielsweise ein Gremium<br />
gegeben hätte, das in Kenntnis der Lage gesagt<br />
hätte: Das kann man so machen – oder eben<br />
nicht. Davon hätte ich mich ja womöglich überzeugen<br />
lassen.<br />
Brandenburg: Ich finde, der Ruf nach Institutionen<br />
ist falsch. Es ist eine Kulturfrage, da muss ein<br />
Wandel kommen. In Ihrem Fall hätten alle, einschließlich<br />
der Assistenzärzte, aufstehen müssen<br />
und sagen: So geht das nicht, ohne uns.<br />
Scheele: Es gab 35 Chefärzte in diesem Haus<br />
– und fünf haben für mich erkennbar zu mir gestanden;<br />
zwei unter Inkaufnahme persönlicher<br />
Nachteile. Der Rest hat geschwiegen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Mutigere Ärzte einzufordern ist wohl so<br />
ähnlich, wie von Bankern Bescheidenheit zu verlangen.<br />
Was hätte Ihnen institutionell geholfen,<br />
Herr Scheele?<br />
Scheele: Wenn ich einen Ansprechpartner gehabt<br />
hätte, an den ich mich hätte wenden können,<br />
ohne dass man mir den Vorwurf gemacht hätte,<br />
ich verrate Betriebsgeheimnisse.<br />
Stüwe: Auch da müssten die Ärztekammern noch<br />
viel stärker in Erscheinung treten!<br />
Scheele: Sie müssten nicht nur Ärzten den Rücken<br />
stärken, sondern auch vom Krankenhausträger anerkannt<br />
sein. Eine Art Schiedsstelle.<br />
Brandenburg: An der verkorksten Kultur ändern<br />
solche Gremien aber leider nichts.<br />
Wiesing: Ich wäre da nicht so pessimistisch. In der<br />
heutigen Arbeitswelt ist Supervision keine Seltenheit.<br />
So etwas Ähnliches wäre das ja hier: Wir<br />
wenden uns einer dritten Person zu, stellen uns<br />
neben das Problem und berichten.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Der Interessenkonflikt zwischen Arzt und<br />
Klinikleitung ist inzwischen oft internalisiert.<br />
Viele Chef- und Oberärzte sind über Bonusverträge<br />
selbst am wirtschaftlichen Erfolg des Hauses<br />
be teiligt.<br />
Wiesing: Die Frage ist, welche Boni akzeptabel<br />
sind. Meiner Meinung nach gibt es viele unschädliche<br />
Anreize: Wenn der Chefarzt es schafft, die<br />
Wartezeiten für Patienten zu reduzieren, dann ist<br />
das in Ordnung.<br />
Stüwe: Die Forderung wäre ganz einfach: keine<br />
Boni, die auf Fallzahlsteigerungen gründen. Man<br />
kann Boni für die Patientenzufriedenheit bekommen<br />
oder für die Zufriedenheit der Weiterbildungsassistenten<br />
– aber nicht für die Steigerung<br />
der Fälle und dann mit fragwürdigen Indikationen<br />
den Patienten auf den OP-Tisch legen. Das hat<br />
Manifest für eine menschliche Medizin *<br />
1.<br />
Ärzte<br />
Dauerkonflikt zwischen<br />
und Ärztinnen<br />
befinden sich in einem<br />
dem Wohl des Patienten und<br />
den wirtschaftlichen Zielen der<br />
Klinik. Wenn ein Arzt sich in<br />
einem konkreten Fall, seinem<br />
Gewissen folgend, gegen die<br />
Klinik stellt, darf er nicht allein<br />
gelassen werden. Ärztekammern<br />
sollen Ärzten, die sich<br />
gegen ökonomische Vorgaben<br />
der Klinik wenden, den Rücken<br />
stärken. Sie sollen<br />
Schiedsstellen einrichten, vor<br />
denen Konflikte ausgetragen<br />
werden können.<br />
2.<br />
Ärzte<br />
willig ökonomischen<br />
und Ärztinnen<br />
ordnen sich zu bereit-<br />
und hierarchischen Zwängen<br />
unter und verlieren dabei mitunter<br />
das Wohl des Patienten<br />
aus dem Auge. Es gibt in deutschen<br />
Krankenhäusern eine<br />
Kultur des vorauseilenden Gehorsams,<br />
die durch eine übermäßige<br />
Abhängigkeit der Assistenzärzte<br />
von Ober- und<br />
Chefärzten während ihrer<br />
Weiterbildungszeit gefördert<br />
wird. Deshalb sollen Weiterbildungskataloge<br />
für Chefärzte<br />
verbindlich gemacht werden.<br />
Die Ärzte kammern sollen<br />
diese überprüfen.<br />
3.<br />
Der<br />
ist es nicht, Renditeer-<br />
vorrangige Zweck<br />
von Krankenhäusern<br />
wartungen zu befriedigen. Die<br />
Ökonomie soll der Medizin<br />
dienen, nicht umgekehrt. Bonusverträge,<br />
die ärztliche Entscheidungen<br />
beeinflussen, sind<br />
deshalb unethisch.<br />
4.<br />
Ärzte<br />
mit Patienten und zu<br />
und Pfleger verbringen<br />
zu wenig Zeit<br />
viel Zeit mit Dokumentation<br />
und berufsfremden Tätigkeiten.<br />
Ihre Arbeit soll von fachfremden<br />
Aufgaben entlastet<br />
werden.<br />
5.<br />
Nicht<br />
verstehen – Ökono-<br />
nur Ärzte müssen<br />
die Ökonomie<br />
men müssen auch die medizinische<br />
Seite im Blick haben.<br />
Deshalb gehört zur Ausbildung<br />
von Gesundheitsökonomen<br />
ein Pflichtpraktikum<br />
auf Station.<br />
6.<br />
Gesprächsschulung<br />
und Supervision sollen<br />
fester Bestandteil der<br />
Arbeit sein.<br />
7.<br />
Auch<br />
Gesundheitssystem be-<br />
Patienten können<br />
dazu beitragen, dass das<br />
zahlbar bleibt. Durch eine<br />
transparente Darstellung der in<br />
Anspruch genommenen Leistungen<br />
und durch Selbstbeteiligung<br />
können Kosten gespart<br />
werden.<br />
* Dieses Manifest haben die Teilnehmer<br />
des <strong>ZEIT</strong>-Gesprächs –<br />
Susanne Sänger, Ursula Stüwe,<br />
Paul Brandenburg, Michael<br />
Scheele und Urban Wiesing –<br />
gemeinsam formuliert.<br />
Es soll eine Debatte über das<br />
gegenwärtige Gesundheitssystem<br />
anregen.<br />
Sie können sich auf<br />
facebook.com/medizinermanifest<br />
an der Diskussion beteiligen<br />
übrigens gerade auch die Deutsche Gesellschaft<br />
für Innere Medizin gefordert. Da kann ich mich<br />
nur anschließen.<br />
Wiesing: Also: kein Anreizsystem, das direkt oder<br />
indirekt die ärztliche Entscheidung beeinflusst!<br />
Die Ökonomie hat der Medizin zu dienen – nicht<br />
umgekehrt.<br />
Scheele: Eigentlich eine Selbstverständlichkeit.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Das System der Fallpauschalen wurde ja<br />
eingeführt, damit die Krankenhauskosten nicht<br />
steigen. Wie soll man stattdessen sparen?<br />
Brandenburg: Die Frage ist doch: Warum steigen<br />
die Kosten? Es sind ja nicht die wenigen schwer<br />
kranken Menschen auf den Intensivstationen,<br />
die das deutsche System so teuer machen. Es sind<br />
Lappalien: wenn Leute den Rettungsdienst rufen,<br />
weil ihr Kind gestolpert ist und einen blauen<br />
Fleck hat, und die dann im Krankenhaus noch<br />
eine Computertomografie verlangen. Was wir<br />
Krankenkasse nennen, ist auch ein Umlagesystem<br />
für die Folgen unserer überhöhten Anspruchshaltung.<br />
Stüwe: ... und die Kassen hatten ja auch eine<br />
Zeitlang viel Geld und haben diese Einstellung<br />
gefördert.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Das heißt: Auch die Patienten tragen Verantwortung?<br />
Brandenburg: Ja, jeder Patient sollte eine Rechnung<br />
kriegen. Nicht nur die Privatpatienten. Momentan<br />
kann ein gesetzlich versicherter Patient gar<br />
nicht wissen, welche Kosten er generiert. Ich sage<br />
dem Patienten, der sich nachts um vier wegen<br />
langjährig bestehendem Rückenschmerz abholen<br />
lässt: Wissen Sie, dass das 400 Euro gekostet hat?<br />
Die Privatpatienten kommen nicht so schnell, weil<br />
sie etwa 150 Euro erst mal selbst bezahlen müssen.<br />
Stüwe: Warum fordert man keine Selbstbeteiligung,<br />
ähnlich wie bei Privatversicherten? Das kann<br />
man auch sozial gerecht gestalten.<br />
Scheele: Stimmt – wobei man auch sagen muss,<br />
dass sich kein Arzt mehr traut, den Patienten ohne<br />
irgendeine Prozedur oder Tablette wieder nach<br />
Hause zu schicken.<br />
Sänger: Wenn man das im Gespräch ausführlich<br />
begründet, akzeptiert der Patient das auch. Wir<br />
müssen an dieser Stelle aber über das Thema Zeit<br />
reden. In deutschen Krankenhäusern haben wir<br />
kaum Zeit für ein ausführliches Gespräch und<br />
stehen tagtäglich vor der Frage: Machen wir Papier-<br />
oder Patientenpflege?<br />
Wiesing: Richtig, wir haben eine<br />
höhere Arbeitsverdichtung, sowohl<br />
beim Pflegepersonal als auch<br />
bei den Ärzten. Das hat aber auch<br />
Vorteile ...<br />
Brandenburg:... und die wären?<br />
Wiesing: Jeder Arzt, der rumsitzt<br />
und nichts tut, wird bezahlt – das<br />
ist Verschwendung.<br />
Sänger: Das ist aber lange her.<br />
Wiesing: Dennoch: Früher gab es<br />
das. Und da haben die Ärzte und<br />
Schwestern in der freien Zeit keineswegs<br />
immer nur mit den Patienten<br />
gesprochen. Ich glaube,<br />
man muss den Arztberuf auf arztspezifische<br />
Tätigkeiten konzentrieren<br />
und die Ärzte und Pfleger<br />
von Bürokratie entlasten.<br />
Sänger: Früher haben wir Schwestern<br />
jedenfalls nicht alle möglichen<br />
Dienstleister kontrollieren<br />
müssen. Und kaum hat man sich<br />
mit einem eingearbeitet, wird der<br />
schon wieder ausgetauscht, weil<br />
ein anderer ein Angebot macht,<br />
das billiger ist – auf dem Papier.<br />
Brandenburg: Oder die Schwestern<br />
teilen mittags Essen aus. Und<br />
niemand merkt, wenn einer aus<br />
dem Bett fällt.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Das heißt: zusätzliche Stellen?<br />
Wiesing: Nein, aber differenzierte<br />
und angemessene Stellen.<br />
Sänger: Wobei ich das Essenverteilen als pflegerische<br />
Tätigkeit ansehe. Als Schwester muss ich einen<br />
Überblick haben, ob und wie viel ein Patient isst<br />
und welche Hilfe er dabei benötigt.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Welche Tätigkeiten würden sie delegieren<br />
wollen, Frau Sänger?<br />
Sänger: Putzen zum Beispiel. Ich bin der Meinung,<br />
dass eine Station von einer gewissen Größe eine<br />
ganztägig beschäftigte Putzfrau benötigt – gerade<br />
in Zeiten von resistenten Keimen.<br />
Brandenburg: Oder einen Transportdienst! Stattdessen<br />
schieben Schwestern mit zwanzig Jahren<br />
Berufserfahrung Patienten durchs Krankenhaus.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Wir reden hier die ganze Zeit darüber, wie<br />
man sich innerhalb der Rahmenbedingungen besser<br />
arrangiert – wieso versuchen Sie nicht, daran<br />
etwas zu ändern? Müssten die Krankenhausärzte<br />
nicht stärker politisch aktiv sein?<br />
Stüwe: Das wäre schön. Die Ärzte haben sich die<br />
Fallpauschalen einfach überstülpen lassen. Viele<br />
haben sich halt auch gefreut, dass Abläufe effizienter<br />
wurden. Aber das Problem sollte nicht allein bei der<br />
Ärzteschaft hängen bleiben. Auch ein Krankenhausgeschäftsführer<br />
sollte die ethischen Ansprüche unseres<br />
Berufes kennen. Wenn die Ökonomen so viel<br />
von Medizin verstehen würden wie die Ärzte von<br />
Ökonomie, wäre die Ko ope ra tion sicher leichter.<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 33<br />
»Es gibt Kliniken, die man als Notarzt vermeidet«, sagt der Arzt<br />
<strong>ZEIT</strong>: Wie wollen Sie das erreichen? Mit einem<br />
Pflichtpraktikum auf Station für die Controller?<br />
Stüwe: Manche machen das ja freiwillig. So ein<br />
Praktikum gehört in die Ausbildung jedes Krankenhausökonomen.<br />
Wiesing: Aber das ist doch wie in der Politik:<br />
Nicht jeder Verteidigungsminister muss im Krieg<br />
gewesen sein, nicht jeder Ernährungsminister<br />
einen Bauernhof geführt haben. Bei einer komplexen<br />
Rollenverteilung ist es nur wichtig, die<br />
Rolle richtig auszuführen.<br />
Stüwe: Das Verständnis würde gefördert!<br />
Scheele: Eine Kenntnis des ärztlichen Ethos wäre<br />
schon wichtig. Der Meister zeigt sich darin, dass er<br />
weiß, was er nicht kann.<br />
Wiesing: Entscheidend ist, dass er sich nicht einmischt.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Einmal aus Sicht des misstrauischen Patienten<br />
gefragt: Was muss ich beachten, damit ich in<br />
einem Krankenhaus gut behandelt werde?<br />
Brandenburg: Fragen Sie einen Arzt, der diese Prozedur<br />
nicht selbst durchführt! Gehen Sie im Falle<br />
einer Hüftoperation noch zu einem konservativen<br />
Orthopäden. Das bietet keine absolute Sicherheit,<br />
aber Sie haben zumindest den Faktor ausgeschaltet,<br />
dass der Arzt von Ihrer Operation profitiert.<br />
Wiesing: Fragen Sie so lange, bis Ihr Fragebedürfnis<br />
gestillt ist. Und wenn eine Klinik nicht gewillt<br />
ist, Ihre Fragen zu beantworten, gehen Sie zur<br />
nächsten!<br />
Scheele: Die Zeit dafür muss da sein. Und wenn<br />
sie nicht da ist, würde ich das als schlechtes Zeichen<br />
werten – vorausgesetzt, es geht um nichts<br />
Akutes. Sehr häufig fürchten die Patienten: Wenn<br />
ich aufsässig bin, rächen die sich an mir. Aber das<br />
muss man Ihnen zugestehen, Sie sind ja auch ein<br />
bisschen Kunde. Das muss ein Team aushalten.<br />
Das wäre übrigens noch eine Forderung: Gesprächsschulung.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Gibt es noch andere Anhaltspunkte für eine<br />
gute Klinik? Bin ich zum Beispiel in einem konfessionellen<br />
Krankenhaus sicherer als in einem<br />
öffentlichen oder privaten?<br />
Stüwe: Grundsätzlich: Nein.<br />
Scheele: Der gnadenlose Verdrängungskampf auf<br />
Kosten der Patienten tobt in jedem einzelnen<br />
Krankenhaus.<br />
Wiesing: Es gibt in Deutschland keine objektiven<br />
Daten wie in anderen Ländern. Man kann dem<br />
Patienten nichts anderes empfehlen, als zu fragen,<br />
und wenn er sich nicht aufgehoben fühlt, wieder<br />
zu gehen.<br />
Scheele: Reden Sie mit dem einweisenden Arzt.<br />
Der kennt die Krankenhäuser in seiner Umgebung.<br />
Fragen Sie ruhig: Wo würden Sie Ihre<br />
Mutter hinschicken?<br />
Das Gespräch führten HEIKE FALLER<br />
und CHRISTIANE GREFE<br />
I Haben Sie Informationen oder Dokumente, die<br />
Missstände im Gesundheitssystem belegen und von<br />
denen die Öffentlichkeit erfahren sollte? Schicken Sie<br />
diese über unseren »digitalen Briefkasten« an die<br />
Investigativ-Redaktion der <strong>ZEIT</strong> – anonym und<br />
vertraulich: www.zeit.de/briefkasten<br />
Foto [M]: Hartmut Schwarzbach/argus
34 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong><br />
STIMMT’S?<br />
Hat Schluckauf<br />
einen Sinn?<br />
… fragt Linda Heitmann<br />
aus Reutlingen<br />
Es ist schon erstaunlich, dass die Wissenschaft<br />
immer noch über den Hintersinn einiger Körperphänomene<br />
rätselt. Manchmal lautet die Antwort<br />
der Experten einfach »hat keinen Sinn, ist ein evolutionäres<br />
Überbleibsel«, etwa bei den männlichen<br />
Brustwarzen. Manche Forscher vertreten diese Ansicht<br />
auch bezüglich des Schluckaufs – weiteres<br />
Nachdenken wäre dann zwecklos.<br />
Aber der Schluckauf ist eine Plage, von der nur<br />
Säugetiere befallen werden, und deshalb evolutionsgeschichtlich<br />
ziemlich jung. Babys haben diesen<br />
Reflex schon im Mutterleib, Säuglinge hicksen<br />
sehr häufig, mit zunehmendem Alter wird das<br />
Phänomen seltener. Erfüllt der Schluckauf vielleicht<br />
bei Föten und kleinen Babys einen Zweck?<br />
Der Reflex ist erstaunlich komplex: Er beginnt<br />
mit einer heftigen Kontraktion des Zwerchfells. In<br />
der Folge wird die Atemmuskulatur aktiviert. Etwa<br />
35 Millisekunden später verschließt sich die<br />
Stimmritze, dabei entsteht der charakteristische<br />
Hicks. Durch diesen Verschluss kommt es zu einem<br />
Unterdruck im gesamten Brustraum.<br />
Oft kann man lesen, der Schluckauf verhindere<br />
beim Ungeborenen, dass Fruchtwasser in die Lungen<br />
eintritt. Bis zum dritten Lebensmonat nämlich<br />
verschließt der Kehlkopf noch nicht die Luftröhre,<br />
und das Baby kann gleichzeitig schlucken<br />
und atmen.<br />
Aber hilft der Schluckauf tatsächlich gegen<br />
Flüssigkeit oder Fremdkörper, die in die Luftröhre<br />
geraten? In diesem Jahr erschien ein Aufsatz in der<br />
Zeitschrift Bioessays. Darin bezweifelt der Autor,<br />
Daniel Howes von der Queen’s University im kanadischen<br />
Kingston, diese Erklärung. Die Luftröhre<br />
werde ja beim Schluckauf verschlossen, und<br />
das heftige Einatmen vor dem Verschluss sorge<br />
eher dafür, dass Fremdkörper noch tiefer rutschten<br />
und nicht herauskatapultiert würden, argumentiert<br />
Howes. Außerdem hätten wir schon genügend<br />
Reflexe, die für eine freie Luftröhre sorgten<br />
– etwa Husten und Niesen.<br />
Howes’ Theorie: Der Schluckauf ziele auf die<br />
Speiseröhre. Er sei dazu geeignet, Luft aus dem<br />
Magen nach draußen zu befördern – also eine Art<br />
aktives Rülpsen. Das erkläre auch, warum ausschließlich<br />
Säugetiere Schluckauf bekämen: Die<br />
Milch trinkenden Babys könnten so ihren Magen<br />
besser füllen und schneller wachsen – ein klarer<br />
evolutionärer Vorteil. CHRISTOPH DRÖSSER<br />
Die Adressen für »Stimmt’s«-Fragen:<br />
<strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>, Stimmt’s?, 20079 Hamburg, oder stimmts@<br />
zeit.de. Das »Stimmt’s?«-Archiv: www.zeit.de/stimmts<br />
www.zeit.de/audio<br />
KOMPAKT<br />
Man kann ja mal nachsehen<br />
Mit welchen Tricks sich deutsche Wissenschaftler in Palermo zu Mumienforschern machten VON URS WILLMANN<br />
Erhalten deutsche Forscher Gelegenheit,<br />
eine Mumiensammlung in der Gruft<br />
eines sizilianischen Kapuzinerklosters zu<br />
inspizieren, ist das für Journalisten eine<br />
reizvolle Konstellation. Aus diesem Grund sahen<br />
Fernsehzuschauer am Montagabend eine dreiviertelstündige<br />
Dokumentation auf n-tv und lasen<br />
Zeitungsleser in der <strong>ZEIT</strong> vor einigen Wochen<br />
(Nr. 36/12) einen Artikel über rund 2000<br />
jahrhundertealte Mumien in Palermo. Die seien<br />
kaum erforscht, erklärten die deutschen Forscher<br />
und versprachen, Licht ins Dunkel zu bringen.<br />
Der Wuppertaler Archäologe Jörg Scheidt und<br />
die Kriminalbiologen Mark Benecke und Kristina<br />
Baumjohann wollten zudem behilflich sein,<br />
den toten Schatz vor dem Verfall zu retten.<br />
Man kann die Vorgänge in den Katakomben<br />
auch aus anderem Blickwinkel betrachten – etwa<br />
aus dem der Europäischen Akademie Bozen (Eurac).<br />
Dieses Südtiroler Institut für Mumien und<br />
den Iceman erforscht nicht nur den Ötzi, sondern<br />
seit 2007 auch in einem interdisziplinären<br />
Projekt die Totensammlung der Kapuziner. Das<br />
Institut besitzt Exklusivverträge mit der Soprintendenza,<br />
dem Landesdenkmalamt für Kunst<br />
und Kultur in Palermo. Seit fünf Jahren rücken<br />
Mumienexperten aus Italien, Österreich und den<br />
USA den Toten zu Leibe – mit Methoden aus<br />
Anthropologie, Gerichtsmedizin, Paläopathologie<br />
und Genetik. Es fanden toxikologische, histologische<br />
und entomologische Untersuchungen<br />
statt. Die Forscher ergründen die Geheimnisse<br />
der Überreste mit Röntgenstrahlen und Computertomografie,<br />
prüfen Zähne, Knochen, Raumklima.<br />
Mit dem German Mummy Project der<br />
Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim beteiligen<br />
sich auch Deutsche. Sie untersuchen Haarproben,<br />
Textilien und archäologische Artefakte.<br />
Diese Arbeiten wurden von der deutschen<br />
Forschergruppe um Jörg Scheidt explizit marginalisiert<br />
– stattdessen vermittelte der selbstständige<br />
Archäologe den Eindruck, mit seinem Wirken<br />
Neuland zu betreten. Und weder <strong>ZEIT</strong>-Leser<br />
noch n-tv-Zuschauer erfuhren, dass es mit Dario<br />
Piombino-Mascali einen wissenschaftlichen Kurator<br />
der Katakomben gibt, der auch Ehreninspektor<br />
für Mumienfunde der Region Sizilien<br />
ist. Stattdessen drängte sich das deutsche Forschergrüppchen<br />
mit seinen angeblichen Pioniertaten<br />
dreist in den Mittelpunkt. Der aus Talkshows<br />
bekannte Forensiker Benecke zupfte mit<br />
der Pinzette Insekten aus den Nasenlöchern von<br />
Mumien. Man sah ihn im Fernsehen auf trockene<br />
Körper klopfen, er hob Bauchdecken an und stocherte<br />
mit dem Finger in den Leichenresten eines<br />
frisch geöffneten Sargs herum.<br />
Ein unschöner Anblick für jene, die seit Jahren<br />
die Exklusiverlaubnis für die Forschung an<br />
den Mumien besitzen. Eine solche Erlaubnis<br />
können Scheidt, Benecke und Baumjohann<br />
nicht vorweisen. Als die Deutschen im Juli zu<br />
den Toten hinabstiegen, lag ihnen einzig eine<br />
Bewilligung vor, sich fünf Tage in der Gruft aufhalten<br />
zu dürfen – gegen einen finanziellen Obo-<br />
lus. Keine Erlaubnis jedoch zum Forschen oder<br />
gar zum Entnehmen von Insekten-, Haar- oder<br />
Gewebeproben. Oder doch?<br />
Scheidt sagt: »Die Mumien gehören den<br />
Kapuzinern. Der Friedhof ist deren Privateigentum.«<br />
Und so habe der Abt seiner Gruppe<br />
anlässlich eines Gesprächs in der Bibliothek<br />
den »offiziellen Auftrag« erteilt, die Mumien zu<br />
erforschen, leider nur »mündlich«.<br />
In schriftlicher Form lag dem Archäologen<br />
seit Monaten allerdings das explizite Verbot<br />
vor, in der Gruft zu forschen. Kurator Piombino<br />
hatte den Wuppertaler darauf hingewiesen,<br />
dass es für Untersuchungen an Kulturgütern<br />
(zu denen die Mumien zählen) einer Genehmigung<br />
der Region Sizilien bedarf. Diese Bewilligung<br />
hat einzig und allein die Forschergruppe<br />
unter Bozener Führung.<br />
Die Deutschen machten sich trotzdem auf.<br />
Und die Kapuziner gaben ihren Gästen bereitwillig<br />
eine »Forschungserlaubnis«. Den Grund dafür<br />
verriet der Abt in einem Gespräch im Kloster: Es<br />
bestehe große Enttäuschung darüber, dass die<br />
Bozener kaum Resultate lieferten. Sie täten auch<br />
wenig für den Erhalt, beklagte sich der Abt. Und<br />
dann fielen unschöne Worte über den angeblich<br />
faulen Kurator Piombino, der von den Bozenern<br />
längst entlassen worden sei – was schlichtweg<br />
nicht stimmt. Mit seinen Argumenten setzte sich<br />
der Abt kurzerhand über weltliche Vorschriften<br />
hinweg. Auch das Kamerateam von n-tv durfte<br />
in die Gruft (gegen eine Spende).<br />
ERFORSCHT UND ERFUNDEN<br />
Strom aus Abwärme<br />
In Industrieanlagen geht viel Energie ungenutzt<br />
verloren. Auch in Autos verpufft ein<br />
Großteil als Abwärme. Nun haben US-Forscher<br />
ein Material entwickelt, das noch besser<br />
als jedes bisherige Wärme in nutzbaren Strom<br />
umwandeln kann (Nature, Bd. 489, S. 414).<br />
Es besteht aus Bleitellurid, dessen Aufbau die<br />
Wissenschaftler sowohl auf atomarer Ebene,<br />
auf der Größenskala von Nanometern, als<br />
auch auf der Größenordnung der körnigen<br />
Struktur optimierten. Damit erreicht es eine<br />
Effizienz, die bislang kein anderes Material<br />
vorweisen kann. Schon bei der ersten Mondlandung<br />
wurden thermoelektrische Elemente<br />
als Energiequellen eingesetzt. Auch der Marsrover<br />
Curiosity wird von solchen angetrieben.<br />
Die dort verwendeten Bauteile haben jedoch<br />
lediglich eine Effizienz-Kennzahl von 1, während<br />
der nun entwickelte Stoff eine Kennzahl<br />
von 2,2 erreicht.<br />
Brunft-Gebrummel<br />
Nicht nur das fröhliche Trällern der Nachtigallen-Männchen<br />
beeindruckt potenzielle<br />
Partnerinnen. Langgezogene Passagen, die eher<br />
nach einem Brummeln oder Schnarren klingen<br />
und im Abstand von etwa fünf Minuten ertönen,<br />
können den Weibchen viel über den Sänger<br />
verraten, schreiben Verhaltensbiologen im<br />
Fachblatt Plos One (online). Die Forscher stellten<br />
fest, dass schwerere Männchen mehr<br />
Brummel-Untereinheiten pro Sekunde schafften<br />
als leichtere Artgenossen. Auch der Beziehungsstatus<br />
wird über die schnarrenden Passagen<br />
angedeutet: Wer zum Ende der Saison<br />
noch Single war, brummte kürzer, aber dafür<br />
häufiger als noch zu Beginn der Partnersuche.<br />
Tatsächlich scheinen die Brummel-Passagen<br />
den Weibchen zu gefallen: Wurden ihnen solche<br />
Liedteile vorgespielt, hüpften die Damen<br />
häufiger und wippten öfter mit dem Schwanz;<br />
beides zeigt eine höhere Erregung an. Womöglich<br />
sind wir Menschen die Ausnahme, wenn<br />
wir uns beim Gesang der Nachtigallen vor<br />
allem über das Zwitschern freuen.<br />
Auf den Umstand hingewiesen, dass die Probenentnahme<br />
an den Mumien illegal gewesen sein dürfte,<br />
zeigt die »interdisziplinäre Forschergruppe«, deren<br />
»leitender Archäologe« Scheidt laut eigener Website<br />
ist, erstaunlich rasante Zerfallserscheinungen. »Ich<br />
habe keine Proben entnommen. Und Herr Benecke<br />
hat in Palermo autark geforscht«, sagt Scheidt.<br />
Unterdessen haben die italienischen Wissenschaftler<br />
um den Ötzi-Experten Albert Zink die zuständige<br />
Behörde informiert. Die Beamten werden<br />
den Abt ins Gebet nehmen und ihn darauf aufmerksam<br />
machen müssen, dass weltliche Vorschriften,<br />
Verträge und Gebote durchaus Gültigkeit haben –<br />
auch wenn es nur um Personal im Jenseits geht.<br />
MEHR WISSEN:<br />
Zell-Phone<br />
WISSEN<br />
In der Kapuzinergruft:<br />
Benecke und Baumjohann<br />
(links), Scheidt<br />
(ganz rechts)<br />
Im Netz:<br />
:-) – der Smiley im Netz wird dreißig<br />
www.zeit.de/smiley<br />
Gesund essen trotz<br />
Hektik: Wie man die<br />
größten Fallen in der<br />
Mittagspause umgeht<br />
Das neue<br />
<strong>ZEIT</strong> Wissen: am<br />
Kiosk oder unter<br />
www.zeitabo.de<br />
Mit »cell phones« im wahrsten Sinne des Wortes<br />
beschäftigen sich Wissenschaftler der ETH<br />
Zürich: Sie ahmten auf künstliche Weise die<br />
Kommunikation zwischen Körperzellen<br />
nach (Nature Biotechnology, online), durch die<br />
etwa Entzündungsreaktionen oder das Wachstum<br />
der Blutgefäße reguliert werden. Die Forscher<br />
manipulierten Säugetierzellen so, dass<br />
diese sich über Botenstoffe austauschen konn-<br />
ten. Durch Zugabe des Blütenduftstoffs Indol<br />
wurde in Senderzellen die Produktion einer<br />
Aminosäure ausgelöst. Die Empfängerzellen<br />
reagierten darauf mit der Produktion von Acetaldehyd.<br />
Sobald die Sender wiederum eine bestimmte<br />
Konzentration von Acetaldehyd bemerkten,<br />
stoppten sie die Produktion ihrer<br />
Aminosäure. Die Zukunftsvision der Forscher:<br />
Durch gesteuerte Zellkommunikation das<br />
Wachstum von Blutgefäßen zu unterbinden,<br />
die einen Tumor versorgen.<br />
Foto: Fritz Habekuß
35<br />
GRAFIK<br />
1. Pflücken Welken 3. Fixieren 4. Rollen 5. Fermentieren 6. Trocknen 7. Sortieren<br />
Grüntee Schwarztee<br />
20. September <strong>2012</strong><br />
<strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong><br />
It’s Tea<br />
Time!<br />
Über 50 000 Tonnen Tee gießen die Deutschen jährlich auf.<br />
Aber nur ein Drittel davon, nämlich Schwarz- und Grüntee,<br />
ist »echter Tee«, hergestellt aus den Blättern des Teestrauchs<br />
Tee-Bräuche<br />
Andere Länder, andere Tee-Sitten<br />
Ostfriesland: ein Stück Kandis in die<br />
Tasse, Tee einschenken, Sahne dazugeben<br />
– und bloß nicht umrühren! So genießt<br />
man drei Tee-Geschmäcker.<br />
Russland: Auf dem Samowar steht<br />
eine kleine Kanne mit konzentriertem<br />
Tee. Der kommt ins Glas und wird<br />
mit heißem Wasser aufgefüllt.<br />
Indien: Der Tee wird mit kochender<br />
Milch aufgebrüht und mit Zimt,<br />
Nelken und Kardamom gewürzt –<br />
fertig ist der »Chai«.<br />
England: Beim typisch britischen<br />
Five o’Clock Tea kommt zuerst<br />
Milch in die Tasse, dann der Tee.<br />
Am Schluss wird gesüßt.<br />
Japan: Bei der Teezeremonie wird<br />
grüner Pulvertee in einer Schale mit<br />
heißem Wasser aufgegossen.<br />
Alle trinken aus derselben Teeschale.<br />
Die Tee-Herstellung<br />
Grüner und schwarzer Tee entstehen aus den gleichen Teeblättern<br />
Für bestimmte Sorten gilt<br />
die Regel: »Two Leaves and<br />
a Bud« – nur die zwei<br />
obersten Blätter eines<br />
Triebs und die Knospe<br />
dürfen gepflückt werden.<br />
2.<br />
Die Blätter werden auf<br />
langen Gestellen aus gebreitet<br />
und welken in der Sonne bis<br />
zu 20 Stunden lang. So sinkt<br />
der Wasseranteil auf 60 bis<br />
65 Prozent.<br />
2<br />
Um die Fermentierung des<br />
grünen Tees zu vermeiden,<br />
müssen Enzyme im Blatt<br />
zerstört werden. Dazu<br />
werden die gewelkten<br />
Teeblätter kurz erhitzt.<br />
Schwarz vorne<br />
Die beliebtesten Teesorten<br />
der Deutschen<br />
(Marktanteile in Prozent)<br />
19,2 %<br />
Aromatisierte Kräuter-<br />
und Früchteteemischungen<br />
Bekannte Vertreter:<br />
Waldfrüchtetee, Pina-<br />
Colada, Gute-Nacht-Tee<br />
Zutaten: Kräuter, Früchte,<br />
Gewürze sowie Aroma-Öle<br />
oder Aroma-Granulate<br />
Zubereitung:<br />
nach Belieben ziehen lassen<br />
Anteil des exportierten Tees<br />
Gesamtproduktion<br />
in tausend Tonnen<br />
in Prozent<br />
1 China 1376 22,2<br />
2 Indien 973 21,0<br />
3 Kenia 314 105,6*<br />
4 Sri Lanka 290 99,5<br />
5 Türkei 199 1,1<br />
6 Vietnam 186 44,4<br />
7 Iran 166 6,5<br />
8 Indonesien 146 63,0<br />
9 Japan 86 2,7<br />
10 Argentinien 72 97,4<br />
*importierter Tee wird weiterverarbeitet<br />
10<br />
1<br />
Tee-Länder<br />
Zwei schwere Metallplatten<br />
drehen gegeneinander. Die<br />
Blätter werden dazwischen<br />
bis zu einer Stunde lang<br />
gerollt. Dabei brechen die<br />
Zellen in den Blättern auf.<br />
5<br />
3<br />
Schwarztee<br />
Die wichtigsten<br />
Teeproduzenten der Welt<br />
Bekannte Vertreter:<br />
kräftiger Assam, vielseitiger<br />
Darjeeling oder Ceylon-Tee<br />
Zutaten: fermentierte<br />
Blätter des Teestrauchs<br />
Zubereitung:<br />
maximal fünf Minuten<br />
ziehen lassen<br />
7<br />
2<br />
4<br />
6<br />
1<br />
8<br />
9<br />
26%<br />
Im ausgequetschten Zellsaft<br />
sind Enzyme, die nun mit<br />
dem Sauerstoff aus der Luft<br />
reagieren. Nach einigen<br />
Stunden hat der schwarze<br />
Tee sein typisches Aroma.<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
In bis zu 95 Grad heißer<br />
Luft werden die Blätter<br />
getrocknet. Die Fermentation<br />
des Schwarztees<br />
stoppt, die Restfeuchte<br />
beträgt etwa fünf Prozent.<br />
10,8 %<br />
Pfefferminztee<br />
Zutaten: Blätter der Pflanze<br />
Mentha piperita<br />
Zubereitung: Beutel wenige<br />
Minuten, frische Blätter<br />
zehn Minuten ziehen lassen<br />
10,1 %<br />
Beuteltee<br />
40 %<br />
loser Tee<br />
60 %<br />
8,0 %<br />
7,7 %<br />
7,3 %<br />
Nicht aromatisierte<br />
Mischungen<br />
Grüntee<br />
Kamillentee<br />
Fencheltee<br />
Die Blätter werden mechanisch<br />
nach Größe sortiert,<br />
zum Beispiel Blatt (große<br />
Blätter), Broken (kleine<br />
Blätter), Fanning (kleinste<br />
Blattteile für Teebeutel).<br />
N<br />
171<br />
o<br />
THEMA:<br />
TEE<br />
Die Themen der<br />
letzten Grafiken:<br />
170<br />
Facebook<br />
169<br />
Kompost<br />
168<br />
Neil Armstrong<br />
Weitere Grafiken<br />
im Internet:<br />
www.zeit.de/grafik<br />
Illustration:<br />
Anne Gerdes<br />
Recherche:<br />
Franziska<br />
Badenschier<br />
Quellen:<br />
Deutscher Teeverband;WirtschaftsvereinigungKräuter-<br />
und Früchtetee;<br />
tea-up-your-life.de;<br />
teekampagne.de<br />
Fotos:<br />
Abraham’s Tea<br />
House, Ernst-<br />
August Galerie<br />
Hannover,<br />
www.a-teehaus.de
Illustration: Martin Burgdorff für <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>, verwendete Fotos: alimdi.net (2); bildstelle; Claudia Schatz (u.)<br />
38 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong><br />
Fast täglich zieht Eva Maria Limmer, mit<br />
Spaten und Handschuhen bewaffnet, in<br />
den Kampf. Die Front ihres Feldzugs<br />
verläuft hinter ihrem Haus in Friedenshorst,<br />
einem Weiler mit acht Häusern,<br />
70 Kilometer nordwestlich von Berlin. Durch die<br />
Fenster ihres Wohnzimmers sieht die Pferdehalterin<br />
die gelben Flecken, die der Feind wie Fahnen<br />
hochhält: Die Blütenstände von Senecio jacobaea,<br />
dem Jakobskreuzkraut, sprenkeln die nah gelegenen<br />
Wiesen und Weiden.<br />
»Ausreißen, ausgraben, mähen, mulchen – ich<br />
habe alles versucht«, sagt Limmer, während sie in<br />
Lederstiefeln und Reiterweste auf die Weide stapft<br />
und versucht, Rosetten gefiederter Blätter, die auf<br />
dem kargen brandenburgischen Sandboden zwischen<br />
dem spärlichen Bewuchs hervorragen, mitsamt<br />
den Wurzeln auszureißen. Seit zwei Jahren<br />
versucht sie das Kreuzkraut zurückzudrängen, das<br />
ihre Weiden erobert hat und durch das sie das Leben<br />
ihrer Pferde bedroht sieht. »Es kommt immer<br />
wieder«, sagt Limmer. »Das ist echt gruselig.«<br />
Jakobskreuzkraut ist eine gelb blühende Pflanze<br />
mit gefiederten Blättern und schirmartigen Blütenständen.<br />
Sie heißt auch Jakobsgreiskraut, ist<br />
schön anzusehen – und hochgiftig. Das Kraut enthält<br />
Pyrrolizidin-Alkaloide, eine Klasse pflanzlicher<br />
Inhaltsstoffe, die in der Leber zu giftigen<br />
Stoffwechselprodukten abgebaut werden. In großer<br />
Menge können die Abbaustoffe die Leber stark<br />
schädigen und wenige Tage nach Aufnahme zu irreversiblen,<br />
oft tödlichen Leberschäden führen.<br />
Bei Tierärzten ist das Krankheitsbild als Seneziose<br />
oder Schweinsberger Krankheit bekannt. Neben<br />
direkten Leberschäden können die Giftstoffe langfristig<br />
auch Leberkrebs verursachen, Missbildungen<br />
hervorrufen und Embryonen schädigen.<br />
Giftige Pflanzen gibt es viele, auch hierzulande.<br />
Das Problem: Jakobskreuzkraut und verwandte<br />
Kreuzkräuter scheinen sich seit einigen Jahren<br />
massiv in unseren Breitengraden auszubreiten und<br />
Brachen, Weiden und Heuwiesen zu erobern. Verlässliche<br />
Zahlen zur tatsächlichen Verbreitung gibt<br />
es zwar nicht. Das Julius-Kühn-Institut, das Bundesforschungsinstitut<br />
für Kulturpflanzen, bestätigt<br />
aber, dass sich Berichte über das zunehmende Vorkommen,<br />
die Ausbreitung und Verdachtsmomente<br />
auf Vergiftungen beim Weidevieh häufen. Auch<br />
die Landwirtschaftsministerien der Länder sprechen<br />
von einer massiven Zunahme des Kreuzkrauts<br />
seit einigen Jahren.<br />
Mögliche Gründe hierfür gibt es viele: Der Klimawandel<br />
mit trockenen heißen Sommern begünstigt<br />
das anspruchslose Kraut und schwächt<br />
konkurrierende Gräser auf den Wiesen. Agrarpolitisch<br />
lange Zeit geförderte landwirtschaftliche<br />
Das Kreuz mit dem Kraut<br />
Das hochgiftige Jakobskreuzkraut breitet sich auf deutschen Wiesen aus.<br />
Toxische Substanzen zen gelangen auch in die menschliche Nahrung. Ist das gefährlich? VON <strong>DIE</strong>TRICH <strong>DIE</strong>TRI VON RICHTHOFEN<br />
Brachflächen bieten ihm mehr Lebensraum. Bis<br />
2009 wurde Jakobskreuzkraut auch in Regelsaatgutmischungen<br />
ausgesät, um Straßenböschungen<br />
und Bahndämme zu befestigen. Von hier aus kann<br />
es durch seine hartnäckigen Fortpflanzungsstrategie<br />
Weiden und Heuwiesen besiedeln.<br />
Während erfahrene Weidetiere das bittere<br />
Kraut gewöhnlich meiden, solange sie genug zu<br />
fressen finden, sind Jungtiere gefährdet. Spätestens<br />
wenn die Giftpflanze zu Heu verarbeitet wird,<br />
können auch erwachsene Pferde und Kühe sie<br />
nicht mehr von bekömmlichen Pflanzen unterscheiden.<br />
Die Bitterstoffe werden abgebaut, die<br />
Alkaloide bleiben aktiv und werden mit dem Futter<br />
aufgenommen.<br />
Die Lage ist konfus: Einzelne Tierärzte verzeichnen<br />
eine Häufung von Erkrankungen, die<br />
toxikologischen Institute mehrerer veterinärmedizinischer<br />
Fakultäten können dies nicht bestätigen.<br />
Ernst Petzinger, Direktor des Instituts für Pharmakologie<br />
und Toxikologie an der Universität Gießen,<br />
kann sich jedoch vorstellen, dass es bei Vergiftungen<br />
mit dem Kraut eine hohe Dunkelziffer<br />
gibt. »Das Jakobskreuzkraut ist eine Pflanze, die<br />
überwiegend nach chronischer, wochen- bis monatelanger<br />
Einnahme mit dem Heu einen tödlich<br />
verlaufenden Leberschaden verursacht«, sagt der<br />
Veterinärmediziner. Eine Vergiftung falle zunächst<br />
nicht auf. »Da die Pferde abmagern, werden sie<br />
aussortiert und zum Schlachter gegeben, noch bevor<br />
sie ein Tierarzt zu behandeln versucht hat.«<br />
Petzinger plädiert deshalb für eine Meldepflicht<br />
für Schlachthöfe und Krematorien bei Verdacht<br />
auf Leberzirrhose und ähnliche Krankheiten.<br />
Nicht nur Weidetiere sind durch das Kraut gefährdet<br />
– immer wieder kam es auch zu Vergiftungen<br />
von Menschen durch Nahrungsmittel, in die<br />
Pyrrolizidin-Alkaloid-haltige Pflanzen gelangt waren.<br />
Insgesamt gibt es weltweit rund 6000 Pflanzen,<br />
die Substanzen dieser Stoffklasse enthalten.<br />
Die Kreuzkräuter gehören mit weit über 1000 Arten<br />
zu den wichtigsten Vertretern und verfügen<br />
mit über die höchsten Alkaloid-Konzentrationen.<br />
Verwandte des Jakobskreuzkrauts lösten in Afghanistan<br />
durch kontaminiertes Getreide Massenvergiftungen<br />
mit Tausenden von Toten aus und führten<br />
in Ägypten zu massiven Leberschäden bei<br />
Kleinkindern, die mit belasteter Ziegenmilch gefüttert<br />
wurden.<br />
In Deutschland geriet 2009 das gemeine Kreuzkraut<br />
(Senecio vulgaris) in den Fokus der Aufmerksamkeit,<br />
nachdem die dem Rucola ähnlichen Kreuzkrautblätter<br />
in Salatpackungen gefunden wurden. Im<br />
gleichen Jahr verlor eine schwangere Frau ihren Fötus,<br />
nachdem sie über einen längeren Zeitraum einen<br />
Alkaloid-haltigen Kräutertee getrunken hatte. In<br />
diesem Jahr starb ein Mann in Bayern, der das Jakobskreuzkraut<br />
beim Kräutersammeln verwechselt und<br />
sich Tee daraus zubereitet hatte, eine Frau zog sich<br />
massive Leberschäden zu, nachdem sie einen Wildkräutersalat<br />
gegessen hatte.<br />
Tragische Einzelfälle? Helmut Wiedenfeld, akademischer<br />
Direktor am Pharmazeutischen Institut<br />
Giftiger Eroberer<br />
Jakobskreuzkraut ist eine in Deutschland<br />
heimische Art, die eine wichtige<br />
Funktion im Ökosystem innehat. Die<br />
Pflanze (im Bild die beiden Blätter<br />
links) wird oft mit Löwenzahn, Rucola<br />
oder Wiesenpippau (im Bild rechts)<br />
verwechselt. Sie bietet zahlreichen<br />
Insekten Lebensraum. Diese fressen das<br />
bittere Kreuzkraut, um sich für Feinde<br />
ungenießbar zu machen.<br />
Bei der Eroberung des neuen Lebensraums<br />
hat das Kraut leichtes Spiel: Eine<br />
Pflanze kann 100 000 Flugsamen<br />
produzieren, die wie beim Löwenzahn<br />
mit dem Wind verbreitet werden. Die<br />
Samen überdauern bis zu 35 Jahre in<br />
der Erde. Wird sie abgeschnitten, veranlasst<br />
dies die Pflanze zur Notblüte.<br />
Aus verbleibenden Wurzelresten treiben<br />
neue Stängel aus. DVR<br />
der Universität Bonn, ist überzeugt, dass die Gefahr<br />
weiter reicht. »Zahlreiche Studien haben gezeigt,<br />
dass die Giftstoffe auch über Milch, Honig<br />
und andere landwirtschaftliche Produkte in die<br />
menschliche Nahrungskette gelangen können.«<br />
Die umfangreichsten Daten über die Belastung<br />
mit den Alkaloiden liegen für Honig vor. Demnach<br />
enthält ein erheblicher Anteil der Honige auf<br />
dem deutschen Markt die leberschädigenden Substanzen.<br />
Besonders stark betroffen sind den Untersuchungen<br />
zufolge Rohhonige aus Mittelamerika<br />
und Asien, wo dieselbe Art des Kreuzkrautes teils<br />
die zehnfache Menge an Alkaloiden entwickeln<br />
kann wie hierzulande. Noch höhere Giftmengen<br />
wurden in pollenhaltigen Nahrungsergänzungsmitteln<br />
aus diesen Regionen gefunden.<br />
Honige deutscher Herkunft waren zwar geringer<br />
betroffen, aber auch hier waren einzelne Rohhonige<br />
belastet. Ein Imker in Schleswig-Holstein<br />
vernichtete vor Kurzem seine gesamte Ernte, nachdem<br />
er durch einen Test auf die starke Belastung<br />
seines Produkts aufmerksam wurde. Die meisten<br />
Honige auf dem Markt sind zudem Mischungen,<br />
die neben deutschen zu hohen Anteilen auch ausländische<br />
Honige beinhalten. In Milch wurden die<br />
Alkaloide ebenfalls bereits nachgewiesen – meist<br />
wird jedoch die Milch vieler verschiedener Produzenten<br />
zusammengeschüttet, sodass hier mit erheblichen<br />
Verdünnungseffekten zu rechnen ist, die<br />
die Alkaloidkonzentration vermindern.<br />
Doch welcher Belastung sind wir im Alltag<br />
tatsächlich ausgesetzt? Wie hoch ist die Gefahr?<br />
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit<br />
(EFSA) hat am ehesten gesundheitliche<br />
Bedenken bei Kleinkindern und Kindern, die große<br />
Mengen an Honig verzehren, sowie bei Menschen,<br />
die regelmäßig unverschnittenen Honig bestimmter<br />
Kleinerzeuger zu sich nehmen.<br />
Viele Fragen zur toxischen Wirkung der Pyrrolizidin-Alkaloide<br />
sind jedoch offen. Warum sind<br />
Pferde, Kühe und Schweine besonders anfällig,<br />
während Ziegen und Hasen kaum auf das Gift<br />
reagieren? Warum reagieren Kinder besonders<br />
stark, und woher rührt die unterschiedliche Wirkung<br />
auf Männer und Frauen? Und vor allem:<br />
Wie weit verbreitet sind Vergiftungen mit den<br />
Substanzen tatsächlich?<br />
Es gibt bislang weder Therapiemöglichkeiten<br />
bei einer Vergiftung noch verbindliche Höchstwerte<br />
für Lebensmittel. Das Bundesinstitut für<br />
Risikobewertung (BfR) empfiehlt, eine tägliche<br />
Dosis an Pyrrolizidin-Alkaloiden von 0,007 Mikrogramm<br />
je Kilogramm Körpergewicht nicht zu<br />
überschreiten. Allerdings erreicht diese Menge bereits<br />
jemand, der von stark belasteten deutschen<br />
Honigen fünf bis zehn Gramm konsumiert.<br />
»Nimmt man die vorgeschlagenen Grenzwerte<br />
ernst, müssten einige Honige sofort vom Markt genommen<br />
werden«, sagt Helmut Wiedenfeld. Von der<br />
Einführung von Grenzwerten hält er ohnehin wenig.<br />
Eine dauerhafte Kontrolle von Lebensmitteln auf<br />
ihren Alkaloidgehalt dürfte extrem schwierig sein.<br />
Die Stoffklasse der Pyrrolizidin-Alkaloide umfasst<br />
insgesamt etwa 500 Substanzen, darunter hochtoxi-<br />
sche und vollkommen harmlose Vertreter. »Man muss<br />
schon genau wissen, welches Alkaloid in welcher<br />
Menge enthalten ist, um die Toxizität eines Lebensmittels<br />
abzuschätzen«, sagt Wiedenfeld.<br />
Einen verbindlichen Höchstwert hielte er für irreführend.<br />
Geringe Belastungen über längere Zeiträume<br />
seien für Menschen vermutlich sogar gefährlicher<br />
als eine einmalige Einnahme größerer Mengen.<br />
Es gelte vor allem Kinder zu schützen. Bei ihnen sei<br />
der zur Abwehr nötige Entgiftungsmechanismus noch<br />
nicht ausreichend entwickelt. Sie produzierten deshalb<br />
weit mehr Gift aus den aufgenommenen Alkaloiden<br />
als Erwachsene. Gerade in Kindernahrung<br />
fände aber Honig weit verbreiteten Einsatz als Süßstoff.<br />
Wiedenfeld fordert deshalb absolute Nulltoleranz<br />
bei Pyrrolizidin-Alkaloiden. »Diese Stoffe haben<br />
in Lebensmitteln einfach nichts verloren.«<br />
Nur wie lassen sich die toxischen Substanzen<br />
aus der Lebensmittelerzeugung verbannen? Das<br />
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Verbraucherschutz (BMELV) fordert<br />
Eigentümer von Wiesen und Weiden dazu auf,<br />
ihre Flächen sachgerecht zu pflegen – sieht aber im<br />
Moment keinen weiteren Handlungsbedarf. Sabine<br />
Jördens vom Arbeitskreis Kreuzkraut ist hingegen<br />
davon überzeugt, dass die Pflanze zu einer<br />
Plage geworden ist, gegen die man schnell aktiv<br />
vorgehen müsste. »Die massive Ausbreitung ist<br />
durch menschlichen Einfluss verursacht, nun müssen<br />
wir hier auch korrigierend eingreifen.«<br />
Jördens betreibt im niedersächsischen Uetze<br />
eine private Rinderzucht und hält Pferde. Sie hat<br />
2007 ein Pferd verloren und ist davon überzeugt,<br />
dass es am Jakobskreuzkraut gestorben ist. Damals<br />
gründete sie den Arbeitskreis, um andere Tierhalter<br />
zu beraten, Aufklärungsarbeit zu betreiben und<br />
das Kraut zurückzudrängen. Sie sieht sich und die<br />
anderen Tierhalter in der Pflicht, die Weidepflege<br />
zu verbessern. Doch um dem Kraut flächendeckend<br />
beizukommen, sei ein konzertiertes Vorgehen<br />
unausweichlich. »Die Regierung muss endlich<br />
zentral gegen die massive Ausbreitung von<br />
Jakobskreuzkraut vorgehen.«<br />
Immerhin wird auf EU-Ebene daran gearbeitet,<br />
die Analytik zu gewährleisten. Zusätzlich werde,<br />
sagt das BMELV, eine EU-Empfehlung für ein<br />
Monitoring vorbereitet, um eine gesicherte Datenlage<br />
zu erhalten. Ziel sei es, zulässige Höchstgehalte<br />
in Lebensmitteln festlegen zu können.<br />
Währenddessen schreibt Jördens an ihrer Liste<br />
weiter: Sie führt Buch über Tierhalter, deren Weiden<br />
von Jakobskreuzkraut überwuchert werden<br />
und die teils auch Tiere verloren haben. Die Liste<br />
ist lang, und sie wächst beständig.<br />
A www.zeit.de/audio<br />
WISSEN
HIER AUSREISSEN!<br />
VERRÜCKTE VIECHER (22)<br />
Hummel-Fledermaus<br />
1973 entdeckte ein thailändischer Forscher in<br />
seiner Heimat ein kleines pelziges Wesen. In der<br />
Abenddämmerung schwirrte es durch die Luft<br />
und war durch seine braune Farbe schwer zu erkennen.<br />
Der Biologe vermutete, dass er eine neue<br />
Hummelart gefunden hatte. Doch bei näherer Betrachtung<br />
stellte sich heraus, dass das Tierchen<br />
kein Insekt, sondern eine Fledermaus war. Die<br />
Hummel-Fledermaus ist eines der kleinsten Säugetiere<br />
der Welt, nur drei Zentimeter lang. Die<br />
Winzlinge leben in Kalksteinhöhlen in Thailand<br />
und im Nachbarstaat Myanmar und ernähren sich<br />
von noch kleineren Insekten, die sie im Flug von<br />
Pflanzen abpicken. Weil ihre Körpergröße so erstaunlich<br />
ist, machen leider immer wieder Wilderer<br />
Jagd auf sie, um sie ausgestopft an Souvenirsammler<br />
zu verkaufen.<br />
Die Radiogeschichte über die Hummel-Fledermaus<br />
hörst Du am Sonntag um 8.05 Uhr in der Sendung<br />
»Mikado – Radio für Kinder« auf<br />
oder im Internet unter www.ndr.de/mikado<br />
FRAGEBOGEN<br />
Dein Vorname:<br />
Wie alt bist Du?<br />
Wo wohnst Du?<br />
Was ist besonders schön dort?<br />
Und was gefällt Dir dort nicht?<br />
Was macht Dich traurig?<br />
Was möchtest Du einmal werden?<br />
Was ist typisch für Erwachsene?<br />
Wie heißt Dein Lieblingsbuch?<br />
Jede Woche stellt sich hier<br />
ein Kind vor. Willst Du auch<br />
mitmachen?<br />
Dann guck mal unter<br />
www.zeit.de/fragebogen<br />
Bei welchem Wort verschreibst Du Dich immer?<br />
BUCH-<br />
TIPP<br />
Falschgeld-<br />
Alarm<br />
Wie gern hätte Anton diese coolen Turnschuhe mit<br />
ausklappbaren Rollen! Doch dann geht die Waschmaschine<br />
kaputt, und überhaupt ist das Geld bei<br />
Antons Eltern knapp. Was tun? Versuch eins: Geld<br />
gewinnen. Anton reicht ein selbst gedrehtes Video<br />
bei einem Wettbewerb ein. Leider gewinnt er nicht.<br />
Versuch zwei: Falschgeld drucken am Computer. Genial,<br />
findet Anton – bis ihm aufgeht, dass die Polizei<br />
sich für das Falschgeld in seinem Viertel interessiert ...<br />
Das zweite Anton-Buch von Milena Baisch ist nicht<br />
ganz so gut wie Band 1, Anton taucht ab, aber dafür<br />
gibt es mehr Nervenkitzel für Krimifans.<br />
Milena Baisch: Anton macht’s klar<br />
Beltz & Gelberg <strong>2012</strong>; 12,95 Euro; ab 10 Jahren<br />
Mehr für Kinder!<br />
Die D neue Ausgabe<br />
von vo <strong>ZEIT</strong> LEO,<br />
dem d Magazin für<br />
Kinder, K<br />
jetzt je am Kiosk!<br />
WWeitere<br />
Infos im<br />
In Internet:<br />
wwww.zeitleo.de<br />
Fotos: Inge Schrüfer (Seifenkisten); Merlin Tuttle/NAS/Okapia (Viech); Illustrationen: Jon Frickey für <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>/www.jonfrickey.com (Wappen, Leo)<br />
POLITIK, WISSEN, KULTUR UND ANDERE RÄTSEL FÜR JUNGE LESERINNEN UND LESER<br />
Vorsichtig klettert Simon<br />
in das Cockpit<br />
seines silbern lackiertenMini-Rennwagens.<br />
Er streckt beide<br />
Beine durch den<br />
schmalen Einstieg<br />
und schiebt dann den Oberkörper hinterher.<br />
Als er endlich im Rennwagen<br />
liegt, ist nur noch sein Kopf im schwarzen<br />
Helm hinter dem Visier zu sehen.<br />
Geschafft. Der Seifenkistenpilot ist bereit<br />
für die Testfahrt vor dem wichtigsten<br />
Rennen der Saison.<br />
Simon, zwölf Jahre alt, und sein Vater<br />
Markus überprüfen, ob der Renner<br />
bereit ist für die Deutsche und die Europameisterschaft<br />
im Seifenkistenfahren.<br />
Simon testet auf einer Probefahrt<br />
die Bremse und die Lenkung. Alles<br />
funktioniert. Er steigt aus der engen<br />
Kiste aus und setzt den Helm ab.<br />
Seit er neun Jahre alt ist, fährt Simon<br />
Rennen in Seifenkisten. Früher<br />
bastelten sich Kinder aus alten Kisten<br />
für Käse und Seife oder aus Blechwannen<br />
ihre Rennwagen selbst. Damit<br />
sausten sie Berge und Abhänge hinunter.<br />
Heute haben die Kisten keine<br />
Ecken mehr, sondern sind vorne spitz,<br />
damit der Wind sie nicht bremst. Sie<br />
sind heute richtige Profi-Wagen mit<br />
teuren Spe zial rä dern und besonderen<br />
Bremsen, die wie ein Stempel auf den<br />
Boden gehen. »Seifenkisten« heißen sie<br />
aber immer noch.<br />
Seifenkisten haben keinen Motor.<br />
Sie rollen auf ihren vier Rädern von<br />
ganz allein, wenn die Rennstrecke<br />
bergab geht. Für die Seifenkistenrennen<br />
werden normale Straßen abgesperrt.<br />
300 Meter sind die meisten<br />
Strecken lang. Alle Piloten tragen bei<br />
den Rennen einen Helm, weil ein Unfall<br />
sonst sehr gefährlich wäre. Bis zu<br />
60 Kilometer in der Stunde werden die<br />
Kisten schnell, wenn die Strecke ein<br />
starkes Gefälle hat. Das ist schneller, als<br />
Autos in Ortschaften fahren dürfen.<br />
Die Fahrer müssten sich darum sehr<br />
konzentrieren, sagt Simon. Gullideckel,<br />
Schlaglöcher oder Hubbel könnten die<br />
Kiste von der Ideallinie abbringen. Einmal<br />
knallte Simon bei einem Rennen<br />
gegen die Bande, die der Veranstalter<br />
zum Schutz der Fahrer aufgestellt hatte.<br />
Passiert ist Simon dabei nichts.<br />
Simons Seifenkiste steht in der Garage<br />
seiner Eltern in einer Kleinstadt in<br />
Bayern. Daneben ist die Kiste seiner<br />
Schwester Stella aufgebockt. Auch Stella,<br />
zehn Jahre alt, wird bei den Meisterschaften<br />
antreten, in der Juniorklasse<br />
Früher waren Seifenkisten eckig, heute sind sie windschnittig<br />
Auf der Piste<br />
Seifenkisten schaff en 60 Kilometer in der Stunde – ohne Motor. Ein Besuch bei zwei Piloten vor<br />
dem wichtigsten Rennen der Saison VON HAUKE FRIEDERICHS<br />
für Acht- bis Elfjährige. Simon startet<br />
in der Seniorklasse, in der die Älteren<br />
bis 18 Jahre antreten. Stella hat ihren<br />
älteren Bruder bei Rennen gesehen und<br />
selbst Lust darauf bekommen. Die Junioren<br />
steuern ihre Wagen im Sitzen,<br />
die Größeren im Liegen. Stella macht<br />
sich bei den Rennen ganz klein, beugt<br />
sich nach vorn, um möglichst wenig<br />
Luftwiderstand zu erzeugen.<br />
»Die Seifenkisten sind ein Hobby der<br />
ganzen Familie«, sagt Inge, die Mutter.<br />
Von der Rampe, fertig, los!<br />
Spezialbehandlung für Spezialräder<br />
Simon steuert im Liegen, Stella sitzt<br />
Die Kinder steuern die Wagen. Der Vater<br />
ist im Team der Mechaniker. Er repariert<br />
die Kisten, versucht sie immer schneller<br />
zu machen und schiebt die schweren<br />
Rennwagen die Rampe hoch, wenn der<br />
nächste Start ansteht. Stellas Kiste hat ihr<br />
Vater sogar selbst gebaut, im Keller der<br />
Garage. Stella hat dabei geholfen, Holz<br />
abgeschliffen und ganz oft Probe gesessen.<br />
Auch Simons Kiste, gebraucht gekauft,<br />
hat er gründlich überholt. Die<br />
Mutter gibt bei den Rennen Tipps und<br />
diskutiert mit den Piloten die richtige<br />
Taktik. Wo verläuft die Ideallinie? Soll<br />
man die Kurve weiter links anfahren?<br />
Außerdem macht sie Fotos von den Wettkämpfen<br />
und tröstet, wenn es sein muss.<br />
In diesem Jahr brauchten ihre Piloten<br />
kaum Aufmunterung. Auf einer<br />
Fensterbank im Wohnzimmer stehen<br />
viele Pokale – Simon und Stella haben<br />
sie allein in diesem Jahr gewonnen.<br />
»Am meisten Spaß macht die Geschwindigkeit«,<br />
sagt Simon. Manchmal<br />
fährt seine Kiste so schnell, dass er den<br />
Fahrtwind rauschen hört. »Ich gewinne<br />
gerne«, sagt Stella, »und ich fahre am<br />
liebsten richtig schnell.«<br />
Am zweiten Septemberwochenende<br />
ist es so weit: Die Meisterschaften beginnen.<br />
Simon und Stella laden mit<br />
ihren Eltern die Seifenkisten in einen<br />
Kleinbus und fahren nach Mettingen,<br />
in die Nähe von Osnabrück. Dort treffen<br />
sie auf andere Rennfamilien aus<br />
ganz Deutschland, Österreich, der<br />
Schweiz und Dänemark. 70 Teams<br />
starten in der Seniorklasse und 49 bei<br />
den Junioren.<br />
Ein Rennen besteht aus drei Probeläufen<br />
und aus drei Läufen, die gewertet<br />
werden. Meistens starten zwei Fahrer<br />
gleichzeitig nebeneinander. Mit<br />
Laseranlagen messen die Organisatoren,<br />
wie lange die Fahrer von der Startrampe<br />
bis ins Ziel brauchen. Wer nach<br />
drei Fahrten insgesamt die niedrigste<br />
Zeit hat, gewinnt. Simon hat zuletzt<br />
oft den ersten Platz belegt. In diesem<br />
Jahr ist er bayerischer Meister geworden<br />
– 2011 war er sogar Europameister.<br />
Auf seiner Kiste steht der Schriftzug<br />
»Carpe Momentum«. Das ist Latein<br />
und heißt übersetzt »Nutze den Moment«.<br />
Beim Seifenkistenrennen entscheiden<br />
oft Hundertstelsekunden über<br />
Sieg oder Niederlage.<br />
Für Stella läuft es am Samstag super.<br />
Schon bei den Probeläufen ist ihre Kiste<br />
richtig schnell. Stella belegt zweimal<br />
den zweiten Platz. Sie freut sich riesig,<br />
auch über die Digitalkamera, die sie als<br />
Preis bekommt.<br />
Am Sonntag ist Simon dran. Vor allem<br />
der Start ist immer spannend: Simons<br />
Kiste steht dabei oben auf einer<br />
Rampe. Vor ihm liegt die Piste. Ein<br />
Mann von den Rennorganisatoren<br />
prüft noch mal die Bremsen. Dann<br />
geht es los. Eine Platte vor den Reifen<br />
klappt weg, und Simons Seifenkiste<br />
rollt die Rampe hinunter. Die Räder<br />
drehen sich immer schneller. Dann rast<br />
Simons Seifenkiste dem Ziel entgegen.<br />
Etwas mehr als 36 Sekunden später<br />
bleibt die Uhr stehen – Simon hat<br />
knapp verloren. Nur wenige Hundertstelsekunden<br />
fehlen ihm zu einem Platz<br />
auf dem Treppchen. Er wird Fünfter<br />
bei der Deutschen und Vierter bei der<br />
Europameisterschaft. Nächstes Jahr<br />
wird er wieder antreten.<br />
U<br />
M S<br />
E<br />
C K<br />
C<br />
H E<br />
N<br />
G E<br />
D ACHT<br />
20. September <strong>2012</strong><br />
<strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> No <strong>39</strong><br />
UMS ECKCHEN GEDACHT<br />
Findest Du die Antworten<br />
und – in den getönten Feldern –<br />
das Lösungswort der Woche?<br />
DER D ELEKTRONISCHE HUND<br />
BLEEKER<br />
41<br />
1. Am Ende der Autobahnstrecke<br />
nehmen wir eine – viel gemütlicher ist<br />
eine mit dem Pferdewagen<br />
2. Statt Lenkrad hält er Leinen, und »Hü!«<br />
ruft er, statt ein Gaspedal zu treten<br />
3. GERD ZUPFE wird keinen<br />
Kutschwagen bewegen,<br />
die hingegen können’s schaffen<br />
4. Auf einer Kutschfahrt kann man gut ...,<br />
nur für die Zugtiere kommt die Erholung<br />
erst nach dem ...<br />
5. Auf dem sitzt der Kutscher – was nicht<br />
heißt, dass wir beim Ziegenreiten wären<br />
6. Auch ein KOCH, DER’S eilig hatte,<br />
nahm einst statt Taxi die<br />
7. Sechs wurden eingespannt,<br />
als Aschenputtel ins Schloss reiste<br />
8. Mit dieser als Gestänge erhöht sich<br />
vorn die Kutschenlänge<br />
9. Kutschpferde ... oft, fürs Galoppieren<br />
sind die Wagen ja zu schwer<br />
10. Na, dufte: Was die Motorabgase beim<br />
Auto, ist der bei der Kutsche<br />
1<br />
6<br />
S T<br />
2<br />
H<br />
3<br />
D<br />
4<br />
U P<br />
5<br />
O<br />
R<br />
7<br />
I<br />
8<br />
L<br />
9<br />
N<br />
10<br />
F A<br />
Schick es bis Dienstag, den 2. Oktober,<br />
auf einer Postkarte an<br />
<strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>, Kinder<strong>ZEIT</strong>,<br />
20079 Hamburg,<br />
und mit etwas Losglück gewinnst Du mit<br />
der richtigen Lösung einen Preis, ein<br />
Bücher-Überraschungspaket.<br />
Lösung aus der Nr. 37:<br />
1. auswendig, 2. ein Laden / einladen,<br />
3. Prospekt, 4. Dosen, 5. Bedienung,<br />
6. B/braten, 7. Wechselgeld, 8. Waagen,<br />
9. Lakritze, 10. Kuehltruhe. – WARENREGAL
»Vorsicht, »Vo i h ddie<br />
Herdmanns<br />
schon wieder«<br />
Sechs Kinder gibt es in der<br />
Familie Herdmann, und eins ist<br />
schlimmer als das andere.<br />
An ihrer Schule gilt die eiserne<br />
Regel: Nur ein Herdmann pro<br />
Klasse! Also ist ausgeschlossen,<br />
dass ein Herdmann-Kind jemals<br />
sitzen bleibt. Eine tolle<br />
Geschichte über die<br />
schlimmsten Geschwister aller<br />
Zeiten von der amerikanischen<br />
Autorin Barbara Robinson<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
Der erste Schultag<br />
Das tätowierte Baby<br />
Die Katze im<br />
Waschsalon<br />
Leopolds Schlange<br />
Die Talentshow<br />
Das Lehrerzimmer<br />
Der Schulbus<br />
Baby an der Leine<br />
Eugenia, die Retterin<br />
10. Die Feuerübung<br />
11. Haustier-Panik<br />
12. Genial!<br />
(Abdruck mit freundlicher<br />
Genehmigung des Oetinger Verlages)<br />
© Barbara Robinson:<br />
Vorsicht, die Herdmanns schon wieder,<br />
Deutsch von Kristina Kreuzer,<br />
Verlag Friedrich Oetinger GmbH,<br />
Hamburg 2010 Illustrationen: Martin Burgdorff für <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>/www.martinburgdorff.de<br />
42 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong><br />
Zwei- oder dreimal im Jahr fehlten<br />
alle Herdmanns in der<br />
Schule, und das war dann wie<br />
Ferien. Man wusste, man würde<br />
in der Pause nicht umgebracht,<br />
man müsste nichts von seinem<br />
Pausenbrot abgeben, und man<br />
brauchte sein Geld nicht zu verstecken, falls man<br />
welches hatte. Sogar der Unterricht war einfacher<br />
als sonst. Bosse Fährmann meinte, die Lehrer<br />
würden das mit Absicht machen, als Erholung<br />
für uns, aber meine Mutter meinte, das<br />
taten sie wahrscheinlich, um selbst wieder zu<br />
Kräften zu kommen.<br />
Man wusste nie, wann die Herdmanns fehlen<br />
würden, aber eigentlich war das auch ganz egal,<br />
außer einmal, als sie bei einem Feuerwehrprobealarm<br />
fehlten und unsere Schule daraufhin den<br />
Schnelligkeits- und Sicherheitspreis der Feuerwehr<br />
gewann. »Ich kann es gar nicht glauben«, sagte der<br />
Feuerwehrhauptmann. »Letztes Mal haben Sie<br />
vierunddreißig Minuten gebraucht, um das Gebäude<br />
zu räumen. Was war denn da los?« – »Sie<br />
wissen doch, was da los war«, sagte Herr Zwackbaum.<br />
»Uns war der halbe Kindergarten abhandengekommen.<br />
Olli Herdmann hatte die Kinder<br />
aus einer Tür im Erdgeschoss rausgelassen und<br />
dann mit in die Stadt genommen.« – »Ich meine,<br />
was war dieses Mal los?« – »Dieses Mal ist nichts<br />
passiert«, sagte Herr Zwackbaum. »Olli ist nicht<br />
da. Und Ralf und Eugenia und Leopold und Klaus<br />
und Hedwig auch nicht.« – »Und wo sind sie,<br />
wenn ich fragen darf?« – »Sie fehlen heute«, sagte<br />
Herr Zwackbaum. Der Feuerwehrhauptmann<br />
seufzte. »Ich dachte schon, sie wären weggezogen<br />
oder so. Nun gut ...« Er seufzte wieder und sagte,<br />
dass er dann wohl lieber mal zurück auf die Feuerwehrwache<br />
gehen würde, um auf alles vorbereitet<br />
zu sein. Alle waren ziemlich aufgeregt wegen<br />
des Schnelligkeits- und Sicherheitspreises, denn<br />
noch nie zuvor hatten wir etwas in der Art gewonnen,<br />
und wir würden es wohl auch nie wieder,<br />
zumindest nicht, bevor der letzte Herdmann die<br />
Woodrow-Wilson-Schule verlassen hatte. Doch<br />
erst mal durften wir uns nur über die Ehre freuen,<br />
denn den richtigen Preis würden wir erst am<br />
Brandschutztag erhalten.<br />
Es würde eine besondere Versammlung geben,<br />
mit dem Feuerwehrhauptmann und dem Bürgermeister,<br />
und es würde jemand von der Zeitung<br />
kommen, der Fotos machte und den Kindern<br />
Fragen zum Brandschutz stellte. Brandschutz war<br />
natürlich etwas, wovon die Herdmanns überhaupt<br />
keine Ahnung hatten – außer dass sie dagegen<br />
waren, denke ich. Also musste man hoffen, dass<br />
die Reporter nicht gerade einen von ihnen befragen<br />
würden. Man hoffte außerdem, sie würden zu<br />
diesem großen Spektakel am besten gar nicht erst<br />
auftauchen mit ihren T-Shirts, die für Bier Werbung<br />
machten. Oder besser noch, sie würden einfach<br />
überhaupt nicht auftauchen.<br />
In der Morgenansage am nächsten Tag wurde<br />
das Treffen der Feuerschutzgruppe im Aufenthaltsraum<br />
angekündigt. Eugenia stieß mich an. »Was<br />
ist die Feuerschutzgruppe?« – »Die ist für die Versammlung<br />
am Brandschutztag«, sagte ich. »Ein<br />
paar Kinder werden vorführen, was man im Falle<br />
eines Feuers machen muss.« Eugenia zuckte die<br />
Schultern. »Wasser draufschütten und die Beine<br />
in die Hand nehmen.« Dann kniff sie die Augen<br />
zusammen. »Wer ist in der Gruppe?« Ich wollte<br />
gerade sagen: »Ich weiß es nicht«, oder: »Ist doch<br />
egal« – irgendetwas, was Eugenia die Lust am<br />
Nachfragen nehmen würde –, aber wie immer<br />
musste Alice ihren Senf dazugeben. »Ich bin dabei«,<br />
sagte sie. »Wir sind zu zehnt, plus zwei Ersatzleute,<br />
falls jemand in letzter Minute krank wird.«<br />
Es war nicht ungewöhnlich, dass Leute in<br />
letzter Minute krank wurden – insbesondere wenn<br />
die Herdmanns mitmischten –, daher hörte Eugenia<br />
nun genauer hin. Sie schien aber noch immer<br />
nicht sonderlich interessiert, bis Alice sagte: »Wir<br />
werden T-Shirts tragen, auf denen ›Feuerschutzgruppe<br />
Woodrow-Wilson-Schule‹ steht, damit wir<br />
dann auf dem Foto alle gleich aussehen.« Ich<br />
brauchte gar nicht mehr »Halt den Mund, Alice«<br />
zu sagen – es war sowieso schon zu spät.<br />
Natürlich war Eugenia nicht die Einzige der<br />
Herdmanns, die nach der Schule im Aufenthalts-<br />
raum auftauchte. Sie waren alle da und lungerten<br />
herum, zu jeder Schandtat bereit. Sie hockten auf<br />
den Tischen, kratzten Kaugummi unter den Bänken<br />
hervor und kauten es – und es war wirklich<br />
altes Kaugummi, vor Keimen schimmernd und<br />
hart genug, um sich daran die Zähne auszubeißen.<br />
Aus jedem Jahrgang war mindestens ein Kind in<br />
der Feuerschutzgruppe, und sie alle behielten die<br />
Herdmanns im Auge, sodass Herr Zwackbaum sie<br />
nicht einfach ignorieren konnte, auch wenn er das<br />
wahrscheinlich am liebsten getan hätte. »Die<br />
Schule ist aus, Ralf«, sagte Herr Zwackbaum.<br />
»Eugenia, Olli – ich denke, ihr habt hier eigentlich<br />
nichts mehr zu suchen, und es ist Zeit für euch,<br />
nach Hause zu gehen. Hier findet jetzt ein Treffen<br />
statt.« – »Wir wollten uns eintragen«, sagte Ralf.<br />
»Eintragen für was? Das hier ist die Feuerschutzgruppe.«<br />
– »Genau«, sagte Leopold. »Für die<br />
wollen wir uns eintragen.« – »Wir haben es in der<br />
Ansage gehört«, sagte Hedwig, »als es um das<br />
Treffen nach der Schule ging.«<br />
Herr Zwackbaum machte den Mund auf und<br />
dann wieder zu, weil er nichts dagegen tun konn-<br />
te. Er hatte selbst die Regel aufgestellt, dass jeder<br />
Schüler der Woodrow-Wilson-Schule sich für alles<br />
eintragen durfte, was er wollte, ohne Ausnahme.<br />
Und eine andere Regel war, dass jeder sich für irgendetwas<br />
eintragen musste, ob er wollte oder<br />
nicht. Doch bisher war es noch nie vorgekommen,<br />
dass sich die Herdmanns für irgendetwas eintrugen.<br />
Bis jetzt. Mama meinte, es sei eine gute Idee,<br />
dass die Herdmanns bei der Feuerschutzgruppe<br />
mitmachten. »Wer sonst muss so viel über Feuerschutz<br />
wissen wie diese Kinder?«, sagte sie. Einige<br />
Leute meinten, so könne man sie wenigstens bei<br />
der Versammlung am Brandschutztag im Auge<br />
behalten. Mein Vater sagte, das sei so, wie wenn<br />
man Bankräuber einlud, um ihnen zu zeigen, wie<br />
man eine Bank ausraubt. Drei Kinder stiegen direkt<br />
aus der Feuerschutzgruppe aus, bevor ihnen<br />
noch irgendetwas Schlimmeres passierte. Ihre<br />
Mütter meinten, sie sollten aber trotzdem die<br />
T-Shirts bekommen, wegen der besonderen Umstände.<br />
Herr Zwackbaum wusste, was für Umstände<br />
sie meinten – die Herdmanns nämlich –,<br />
daher sagte er weiter nichts dazu. Er erklärte nur,<br />
er habe nichts mit den T-Shirts zu tun. »Das ent-<br />
scheidet der Elternbeirat«, sagte er. »Der Elternbeirat<br />
stellt die T-Shirts für die Feuerschutzgruppe<br />
zur Verfügung, zu Ehren dieses besonderen Anlasses.«<br />
Der Vorsitzende des Elternbeirats sagte, sie<br />
hätten keine T-Shirts für Kinder, die aus der Feuerschutzgruppe<br />
austreten. Frau Wendlaken sagte, sie<br />
sollten den Herdmanns keine T-Shirts geben, da<br />
sie sich einfach in die Feuerschutzgruppe reingemogelt<br />
hätten. Alle redeten von den T-Shirts, aber<br />
ich musste Charly recht geben, der sagte, selbst für<br />
Geld würde er nicht bei der Feuerschutzgruppe<br />
mitmachen, nicht mal für fünfzig T-Shirts.<br />
Im letzten Moment wurden zwei Kinder krank<br />
(oder zumindest sagten sie, dass sie krank seien),<br />
und direkt danach traten auch die beiden Ersatzleute<br />
aus, was niemanden wirklich erstaunte. »Ich<br />
bin nur Ersatz«, sagte Rebecca Schneider. »Ich<br />
kann nicht wirklich dabei sein.« – »Rebecca, als<br />
Ersatz solltest du immer bereit sein«, sagte Herr<br />
Zwackbaum. »Es ist deine Aufgabe, mit Leib und<br />
Seele dabei zu sein. Das gilt auch für dich, Mats<br />
Hagemann.« Mats war der andere Ersatzmann,<br />
und er sagte, er müsse wegen seines Asthmas aus-<br />
Die Feuerübung<br />
Die Herdmanns sprengen den Brandschutztag und werden<br />
natürlich dafür belohnt VON BARBARA ROBINSON<br />
treten. »Netter Versuch, V Mats«, sagte Herr Zwack-<br />
baum. »Aber du d hast gar kein Asthma. Zufälliger-<br />
weise weiß ich, ic welche Schüler Asthma haben. Ich<br />
weiß, iß, wer Bindehautentzündung, Fußpilz oder<br />
sonstige e Krankheiten hat, und übrigens weiß ich<br />
auch, wer Husten oder Grippe oder einen empfindlichen<br />
Magen hat.« Herr Zwackbaum nannte<br />
keine weiteren Krankheiten, und als Mats’ Mutter<br />
in der Schule anrief, um zu sagen, dass Mats einen<br />
Ausschlag habe, glaubte Herr Zwackbaum ihr kein<br />
Wort. »Das ist zu einfach«, sagte er. »Es ist wahrscheinlich<br />
Fingerfarbe oder Textmarker, irgendwas<br />
in der Art. Vor ein paar Wochen sah ich Leopold<br />
Herdmann mit roten Flecken im Gesicht rumlaufen,<br />
er führte mal wieder irgendwas im Schilde.<br />
Da habe ich zu ihm gesagt, Leopold, geh und<br />
wasch dein Gesicht, und als ich ihn das nächste<br />
Mal sah, waren alle Flecken verschwunden.«<br />
Aber bei Mats war es keine Fingerfarbe. Es<br />
waren Windpocken, und bevor man das Wort<br />
»Schnelligkeits- und Sicherheitspreis« auch nur<br />
aussprechen konnte, war so gut wie kein Schüler<br />
mehr übrig, der zur Verleihung gehen konnte. Herr<br />
Zwackbaum wollte den Brandschutztag verlegen,<br />
ZUM (VOR)LESEN<br />
aber der Feuerwehrhauptmann meinte, das könne<br />
man nicht tun. »In der ganzen Stadt ist Brandschutztag«,<br />
sagte er, »sogar im ganzen Bundesstaat.<br />
Sie können nicht einfach Ihren eigenen Brandschutztag<br />
feiern, wann Sie gerade Lust dazu haben.<br />
Aber ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wenn Sie<br />
eine kleine Gruppe zusammenstellen aus den<br />
Kindern, die noch übrig sind – Ihre Feuerschutzgruppe<br />
zum Beispiel –, können Sie mit denen zu<br />
uns auf die Feuerwehrwache kommen, dann findet<br />
die Verleihung dort statt. Das wird eine ganz große<br />
Sache.« Es wurde eine noch größere Sache, als<br />
alle erwartet hatten, denn der Ofen des Pizzabäckers<br />
ging eine Stunde vor der Verleihung in die<br />
Luft. Das Feuer konnte zwar sofort gelöscht werden,<br />
aber Herr Santoro schickte alle seine Gäste<br />
wegen des Rauches fort, und die meisten von ihnen<br />
folgten dem Feuerwehrauto bis zur Wache und<br />
blieben gleich für die Verleihung dort. Einige<br />
Leute dachten, das Feuer wäre Teil der Verleihung,<br />
vor allem, als Herr Santoro kam und die übrig<br />
gebliebene Pizza umsonst verteilte. Alle fanden,<br />
das sei eine tolle Art, Werbung für Brandschutz zu<br />
machen. Dem Zeitungsreporter geriet dann alles<br />
durcheinander. »KÜNSTLICHES FEUER HÖ-<br />
HEPUNKT DES BRANDSCHUTZTAGES«,<br />
schrieb er. »RESTAURANTBESITZER VER-<br />
TEILT PIZZA AN DUTZENDE VON MEN-<br />
SCHEN, <strong>DIE</strong> DER VERLEIHUNG BEIWOH-<br />
NEN. SCHÜLER AUSGEZEICHNET FÜR<br />
SICHERHEITS<strong>DIE</strong>NSTE.« Die »ausgezeichneten<br />
Schüler« waren die, die von der Feuerschutzgruppe<br />
übrig geblieben waren – Ralf, Eugenia,<br />
Leopold, Klaus, Olli und Hedwig –, und von ihnen<br />
war ein Foto abgebildet, wie sie vor dem<br />
Feuerwehrauto standen. Das sah aus wie eine<br />
Gegenüberstellung bei der Polizei. Und sie trugen<br />
natürlich alle die gleichen, heiß begehrten T-Shirts.<br />
»Wenn ich es nicht anders wüsste«, sagte meine<br />
Mutter, »würde ich denken, dass hier die Herdmanns<br />
ausgezeichnet werden statt der Schule.«<br />
Anscheinend war sie nicht die Einzige, die das<br />
Gefühl hatte, und einige riefen bei der Zeitung<br />
an, um sich zu beschweren, sodass eine andere<br />
Meldung gedruckt wurde – »WOODROW-WIL-<br />
SON-SCHULE GEWINNT TROTZ WIND-<br />
POCKEN DEN SCHNELLIGKEITS- UND<br />
SICHERHEITSPREIS«. Mein Vater meinte, das<br />
sei besser als nichts, aber noch immer nicht ganz<br />
richtig. »Was haben die Windpocken denn damit<br />
zu tun?«, wollte er wissen, doch Mama sagte, er<br />
könne nur das Wort Windpocken nicht mehr<br />
hören, weil ihm unsere ständige Kratzerei so<br />
furchtbar auf die Nerven ging. Frau Wendlaken<br />
steckte Alice in eine Badewanne voll Backpulverwasser,<br />
und sie musste weiße Baumwollhandschuhe<br />
tragen, damit sie sich nicht kratzte. »Ich<br />
denke nicht, dass das nötig ist«, sagte Fräulein<br />
Kornfeld. »Ich muss sie tragen, beim Nachdenken«,<br />
erklärte Alice ihr, »sonst vergesse ich, dass<br />
ich mich nicht kratzen darf. Wenn man Windpocken<br />
aufkratzt, entzünden sie sich und hinterlassen<br />
Narben.« – »Bei Leopold nicht«, sagte<br />
Eugenia. »Und bei Olli auch nicht. Und bei ...«<br />
– »Warte mal kurz«, sagte Fräulein Kornfeld. »Leopold?<br />
Olli? Ich habe nicht mitbekommen, dass<br />
einer von ihnen während unserer Epidemie gefehlt<br />
hat.« – »Oh, das haben sie auch nicht«, sagte Eugenia.<br />
Fräulein Kornfeld runzelte die Stirn. »Aber<br />
du hattest keine Windpocken, oder?«, fragte sie.<br />
»Sie wollen wissen, ob ich Windpocken hatte?«,<br />
sagte Eugenia. »Wenn du Windpocken hattest,<br />
kannst du aber nicht ohne eine Bescheinigung<br />
vom Arzt wiederkommen«, sagte Fräulein Kornfeld,<br />
und Eugenia sagte: »Aha. Ist gut«, stand auf<br />
und verließ das Zimmer.<br />
Niemand wusste also genau, ob sie tatsächlich<br />
die Windpocken gehabt hatten oder nicht, und<br />
auch nicht, wie viele von ihnen die Windpocken<br />
hatten. Es wusste ebenfalls niemand, ob sie zur<br />
Schule gekommen und alle angesteckt hatten und<br />
damit unsere große Preisverleihung ruiniert hatten<br />
oder ob sie alle krank gewesen waren und am Tag<br />
des Feueralarms zu Hause geblieben waren, sodass<br />
wir den Preis überhaupt gewinnen konnten.<br />
Nächste Woche: Eugenia Herdmann schmiert<br />
den Kopf eines Jungen mit Margarine ein und<br />
befreit ihn aus dem Fahrradständer
FEUILLETON<br />
Vom Star<br />
zum Opfer<br />
im Netz<br />
Die Kommunikation im Internet ist voller<br />
Fallen. Selbst die Piratenpolitikerin Julia<br />
Schramm verfi ng sich darin VON JENS JESSEN<br />
Das Internet ist ein gefährlicher<br />
Ort. Selbst Menschen,<br />
die das Netz als ihren natürlichen<br />
Lebensraum betrachten,<br />
können darin scheitern,<br />
wie das Beispiel der Piratenpolitikerin<br />
Julia Schramm<br />
zeigt. Ihr Schiffbruch offenbart einen Selbstwiderspruch,<br />
den weder die Sphäre des Web noch die der<br />
Politik verzeihen kann: Sie hat ihr eigenes Medium<br />
nicht verstanden.<br />
»Mein Name ist Julia, und ich lebe im Internet.<br />
Ich bin da ziemlich glücklich, habe Freunde, die<br />
ich nur digital kenne und abschalten kann, wann<br />
ich will.« Mit dieser Idylle beginnt ein autobiografisches<br />
Buch, das sie dieser Tage veröffentlicht hat<br />
– aber unglückseligerweise in traditionell verlegter<br />
Form, zum Kaufen im Buchhandel, und nicht<br />
etwa als Datei zum kostenlosen Download im<br />
Netz, wie es die Autorin eigentlich hätte machen<br />
müssen. Denn Julia Schramm ist eine bekennende<br />
Verächterin des Urheberrechts, eine der radikalsten<br />
und prominentesten, sie fände geistiges Eigentum<br />
»ekelhaft«, äußerte sie einmal. Was will sie<br />
dann im Verlagsgeschäft? Um den Widerspruch<br />
auf die Spitze zu treiben, haben ihre Freunde im<br />
Netz jetzt eine Datei des Buches zur freien Raubkopie<br />
bereitgestellt. Und was tun Julia Schramm<br />
und ihr Verlag? Sie lassen die Datei so schnell wie<br />
möglich verschwinden und bedrohen jeden mit<br />
Abmahnung, der von ihr Gebrauch machen sollte,<br />
falls sich eine Kopie noch irgendwo finden sollte<br />
– was im Labyrinth des Netzes mehr als wahrscheinlich<br />
ist.<br />
Schneller dürfte politische Glaubwürdigkeit noch<br />
nie verspielt worden sein. Jetzt wird sich zeigen, wie<br />
das mit dem Glück und den Freunden im Internet<br />
ist – das heißt, wer wen abschaltet, wenn er den nötigen<br />
Verdruss verspürt. Klick mich heißt der neckische<br />
Titel von Julia Schramms Buch, und der Aufforderung<br />
werden gewiss viele nachkommen: zum<br />
Wegklicken. Der Gerechtigkeit halber muss man allerdings<br />
sagen, dass Personen der Öffentlichkeit sich<br />
schon vor Erfindung des Netzes in gefährliche Selbstwidersprüche<br />
verstrickt haben. Cicero, einer der<br />
berühmtesten Politiker und Autoren der Antike,<br />
wechselte zwischen den Protagonisten des römischen<br />
Julia Schramm, erklärte Feindin des Urheberrechts. Ihr Verlag geht gegen Raubkopien ihres Buches vor<br />
Bürgerkrieges, zwischen Marc Anton und Octavian,<br />
so lange hin und her und hielt für jedes der Lager so<br />
eindrucksvolle, tief überzeugte Reden, dass schließlich<br />
jede Autorität dahin war. Themistokles, der<br />
glänzende Verteidiger athenischer Freiheit gegen die<br />
persische Monarchie, lief am Ende seines Lebens zum<br />
Großkönig über – was ihn in der griechischen Öffentlichkeit<br />
vom demokratischen Freiheitshelden zum<br />
Hasardeur, wenn nicht Lakaien machte.<br />
Seitenwechsel sind in der Politik nicht immer<br />
tödlich – aber immer dann, wenn die Sache der einen<br />
Seite mit einem Maß an ideologischer Überhöhung<br />
vertreten wurde, dass der Übertritt ins andere Lager<br />
nicht mehr als taktisch, noch nicht einmal als opportunistisch,<br />
sondern als blanker Verrat, als Ausweis<br />
bodenloser Charakterlosigkeit erlebt wird. Angela<br />
Merkel, deren Hin und Her in der Finanzkrise gewiss<br />
nicht prinzipienfest war, hat es doch klug vermieden,<br />
jemals irgendeine ihrer vorübergehenden Positionen<br />
ideologisch zu begründen. Das war schlimm in den<br />
Augen ihrer Kritiker, die Prinzipientreue gerne hätten<br />
– aber nicht schlimm für sie, die etwas anderes als<br />
Pragmatismus niemals versprach.<br />
Und vor allem: Das Drama der Merkelschen<br />
Krisenbewältigung wird<br />
nicht im Netz uraufgeführt. Es spiegelt<br />
sich nur dort – wie sich alles im<br />
Netz spiegelt. Das ist ein bedeutender<br />
Unterschied. Angela Merkel kann sich an die<br />
üblichen politischen Teilöffentlichkeiten wenden,<br />
an das Parlament, das Kabinett, die Partei; an das<br />
Plenum internationaler Gipfeltreffen oder kaum<br />
sichtbare Diplomatenkreise; schließlich auch an<br />
eine allgemeine, aber immer medial vermittelte<br />
Öffentlichkeit, sieht man von ihrem Podcast einmal<br />
ab. Mit anderen Worten: Es sind deutlich verschiedene,<br />
voneinander abgegrenzte Sprechakte, je<br />
nach Publikum und Adressat, und selbst Botschaften<br />
direkt ans Volk haben ihre eigentümliche, definierte<br />
Form wie in den Weihnachtsansprachen<br />
oder werden von Journalisten übermittelt, also gewohnheitsmäßigen<br />
Übersetzern.<br />
Nirgendwo schießen diese Sprechakte unvermittelt<br />
zusammen oder treffen auf ungeübte Ohren.<br />
Sie verlieren auch ihre zeitliche Ordnung<br />
nicht. Es gibt nur einen Ort, wo dies geschehen<br />
könnte – wo nicht mehr kalkulierbar ist, zu wem<br />
man spricht, und wo Entstehung und Zeit einer<br />
Wortmeldung unsichtbar werden: Das ist das Internet.<br />
Man überlege sich nur einmal, was im Netz<br />
mit dem politischen Denker Heinrich Heine geschehen<br />
wäre, dessen Position sich im Laufe seines<br />
Lebens vom Demokraten zum Kommunisten und<br />
schließlich Monarchisten wandelte. Jede Phase<br />
seines Denkens hätte die andere unrettbar denunziert,<br />
obwohl Jahrzehnte zwischen ihnen lagen<br />
und Heines charakteristische Dialektik im Übrigen<br />
auch nahelegte, jeweils eine Gegenposition zur<br />
herrschenden Meinung zu artikulieren.<br />
Heinrich Heine, der bedeutendste Gesellschaftskritiker<br />
vor Marx und Nietzsche, wäre im Netz nichts<br />
als eine verlachte Hassfigur – wenig mehr als eine<br />
Julia Schramm, die gestern das Urheberrecht verachtet<br />
und heute die Profite daraus sichern möchte.<br />
Nun wird man zugeben müssen, dass Schramm ihre<br />
Positionen auch nach Maßstäben der Dialektik deutlich<br />
zu rasch und unvermittelt gewechselt hat. Aber<br />
in einer anderen Kommunikationsumgebung hätte<br />
man doch von gewandelter Einsicht sprechen können<br />
oder sogar eine Unterscheidung gemacht zwischen<br />
der politischen Person und der Geld verdienenden<br />
Privatperson – vielleicht jedenfalls.<br />
Das eigentliche Dilemma des Netzes besteht in<br />
seiner grenzenlosen, für niemanden einschätzbaren<br />
Öffentlichkeit. Wer im Netz spricht, weiß niemals,<br />
zu wem er spricht – von klar eingegrenzten Foren<br />
einmal abgesehen. Gibt es Kenntnisse, Einsichten,<br />
moralische Maßstäbe, gar Ironiefähigkeit oder Bildung?<br />
Es gibt sie natürlich – und es gibt sie natürlich<br />
nicht. Wer das Wesen seines Adressaten nicht kennt,<br />
kann aber keinen sinnvollen Satz formulieren. Was<br />
dem einen als selbstverständlich, fast als Plattitüde<br />
erscheint, kann schon dem nächsten Tränen des Zorns<br />
in die Augen treiben. Man äußere nur einmal im Netz,<br />
dass Norwegen oder die Ukraine künstlich geschaffene,<br />
auf wackliger Grundlage erfundene Nationen<br />
ohne Tradition seien – es würde bei jedem Historiker,<br />
auch bei jedem historisch gebildeten Norweger oder<br />
Ukrainer nur müde Zustimmung, aber bei allen<br />
naiven Patrioten Wutschreie provozieren.<br />
Nicht nur die Welt als Ganze, auch jede Nation<br />
und jede Stadt besteht aus zahllosen Parallelgesellschaften,<br />
deren Denkhorizonte nicht ohne bizarre<br />
LITERATUR<br />
Ulf Erdmann Zieglers Roman<br />
»Nichts Weißes« S. 47<br />
Missverständnisse und tiefe Kränkungen zusammengeführt<br />
werden können. Nur ein besonders trauriges<br />
Beispiel ist das antimohammedanische Video, das<br />
derzeit sein Hasspotenzial vom Internet hinaus auf<br />
die Straße trägt, aber für ein westliches Publikum nur<br />
eine Albernheit darstellt, während es die islamische<br />
Welt ganz ernsthaft ins Mark trifft. Mit guten Gründen<br />
haben die traditionellen Medien, die regional<br />
begrenzten Sender und Zeitungen, stets nur Teilöffentlichkeiten<br />
bedient – die Parallelgesellschaften<br />
der Welt abgebildet.<br />
Natürlich kann es seinen Witz, mitunter<br />
auch eine lehrreiche Pointe<br />
haben, wenn die Mauern zwischen<br />
Milieus eingerissen werden – und<br />
die Welt erfährt, wie der amerikanische<br />
Präsidentschaftskandidat Romney im kleinen<br />
Kreis die Wähler seines Kontrahenten Obama<br />
beschimpft, die er eigentlich für sich gewinnen<br />
müsste. Aber was folgt daraus? Mitt Romney hat<br />
den Sprechakt gewählt, der dem kleinen Kreis von<br />
Anhängern vielleicht sehr angemessen war – nur<br />
eben nicht geeignet, heimlich mitgefilmt und ins<br />
World Wide Web gepustet zu werden. Nüchtern<br />
gesehen, war sein Fehler nur, die jederzeit mögliche<br />
und tödliche Denunziation im Netz nicht einkalkuliert<br />
zu haben.<br />
Auf der Überschreitung von Milieugrenzen, die<br />
in den traditionellen Medien selbstverständlich bestanden,<br />
beruhte auch die Aufregung über die<br />
Nacktfotos von Kate Middleton. In der Schmuddelpresse<br />
mit ihrem Schmuddelpublikum hätten sie<br />
ihren rechten Ort gehabt und vielleicht nur einen<br />
kleinen Prozess nach sich gezogen, der zur Feier<br />
solcher Indiskretion gehört. Erst die Präsentation<br />
vor dem unspezifischen Publikum des Internets<br />
konnte den Gedanken der Majestätsbeleidigung<br />
aufkommen lassen. Niemand weiß, wie die Fotos<br />
dort gelesen werden, mit einem Augenzwinkern<br />
oder dem dramatischen Verlust jeden Respekts vor<br />
der Monarchie.<br />
Die Revolution einer Weltöffentlichkeit, die das<br />
Internet geschaffen hat, wird Jahrzehnte, wenn nicht<br />
Jahrhunderte brauchen, um aufgeklärte, tolerante<br />
Formen des Gesprächs zu entwickeln, das nicht Hass<br />
und Missgunst jederzeit fürchten muss.<br />
Foto (Ausschnitt): Hermann Bredehorst/Polaris/laif<br />
GLAUBEN & ZWEIFELN<br />
Blasphemie: Ein Gespräch mit Seyran Ates<br />
über Demokratie und religiöse Gefühle S. 58<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 43<br />
HASS-VIDEO<br />
Falsche Bärte<br />
Was zeigt der Schmähfilm gegen<br />
Mohammed eigentlich?<br />
Jeder kennt diese scheinbar von einem Nichts<br />
ausgelösten Familienstreite, die zu Türenknallen,<br />
Geschrei, ja sogar panischen Fluchten<br />
im Auto eskalieren. Nach einer Weile,<br />
wenn alle heiser geschrien wieder zusammenkommen,<br />
fragt man sich, was zum Teufel eigentlich<br />
der Auslöser war. Zwei der schlimmsten<br />
Streite unserer Familie wurden ausgelöst<br />
von einer roten Socke, die meine Schwester<br />
oder ich aus Versehen in die Kochwäsche geworfen<br />
hatte, und von einem unter den Teller<br />
geklebten Kaugummi.<br />
Es ist nicht zynisch, die Ausschreitungen<br />
der Muslime in aller Welt aus einem analogen<br />
Blickwinkel zu betrachten. Es ist nicht<br />
zynisch, weil der Konflikt ganz offenkundig<br />
nur einen beliebigen, ja regelrecht abseitigen<br />
Auslöser brauchte, um sich in stereotyper<br />
Weise zu entfalten. Wer sich den sogenannten<br />
Mohammed-Schmähfilm The Innocence<br />
of Muslims als Kurzversion im Internet anschaut,<br />
der sieht: Menschen mit angeklebten<br />
Bärten, die in eine Art digitale Wüstentapete<br />
montiert sind. Männer in scheichartigen<br />
Gewändern (die es in Berlin bei Deko-Behrend<br />
in besserer Qualität gibt), die mit<br />
Schwertern herumfuchteln. Einen Typen namens<br />
Mohammed, der sich mit einem Straßenjungen<br />
um einen abgenagten Knochen<br />
streitet, seinen Kopf linkisch zwischen die<br />
Beine einer Frau steckt, alle weiblichen Wesen<br />
in seiner Umgebung ins Bett zieht und<br />
auf debile Weise zum Feldzug gegen Christen<br />
aufruft. Das Ganze, man muss es einfach<br />
sagen, sieht aus, als habe Otto Waalkes den<br />
Koran gelesen und nach einer Wasserpfeife<br />
einen Trailer für 7 Zwerge – Männer allein in<br />
der Wüste gedreht. Oder als habe sich eine<br />
Laienspielgruppe in der deutschen Provinz<br />
nach ein paar Kästen Bier vorgenommen, bei<br />
den Passionsspielen mal was richtig Abgefahrenes<br />
zu machen.<br />
Es nimmt nicht weiter Wunder, dass für<br />
den Dreh des Films ein Trash-und-Porno-<br />
Regisseur mit dem Pseudonym Alan Roberts<br />
verantwortlich zeichnet (seine weiteren<br />
Werke sind: Zombie-Kriege, Die glückliche<br />
Nutte geht nach Hollywood). Der Internetclip<br />
ist ja tatsächlich ein Pornofilm, ein<br />
schmutziges, kleines, blödes Werk mit Alibihandlung,<br />
das möglichst umstandslos<br />
zum Ziel kommt. Die einstündige Langfassung<br />
wurde bisher nur einmal, vergangenen<br />
Juni, in einem halb leeren Kino in Hollywood<br />
gezeigt, ohne dass sich irgendjemand<br />
darüber aufgeregt hat.<br />
Was heißt das? Dass es rein gar nichts<br />
bringen kann, hinter den teilnahmslos in die<br />
Wüste blickenden Kamelen und Blechsäbeln<br />
von The Innocence of Muslims nach Gründen<br />
für die Hassausbrüche und die Toten der<br />
letzten Tage zu suchen. Dass den Ernst der<br />
Lage zu erkennen gerade bedeuten kann, den<br />
Auslöser nicht zu ernst zu nehmen. Und dass<br />
es eine Irreleitung wäre, den Clip durch ein<br />
Verbot noch weiter aufzuwerten und zu dämonisieren.<br />
Man wird unzählige Werke finden<br />
können, die mit den vielschichtigen Ursachen<br />
der arabischen Unruhen zwar nichts<br />
zu tun haben, aber mühelos für weitere Mobilmachungen<br />
instrumentalisiert werden<br />
können. Genauso gut könnte man rote Socken<br />
verbieten. KATJA NICODEMUS
Illustration: P.M.Hoffmann für <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>/www.pmhoffmann.de; Foto: Piper Ferguson/Corbis<br />
44 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong><br />
Der Teufel regiert immer mit<br />
Ry Cooder, legendärer Songwriter und Gitarrist, spricht über die Abgründe der amerikanischen Politik<br />
Der Gitarrist, Sänger und Songwriter Ry Cooder<br />
gehört seit vier Jahrzehnten zu den wichtigsten<br />
amerikanischen Roots-Musikern. Er hat mit den<br />
Rolling Stones, Randy Newman und Captain<br />
Beefheart gespielt und die alten Herren des Buena<br />
Vista Social Club weltbekannt gemacht. Von<br />
ihm stammen Klassiker wie »Paradise and<br />
Lunch«, »Chicken Skin Music« oder »Bop Till You<br />
Drop«. Den kommerziellen Durchbruch brachten<br />
ihm Filmsoundtracks – insbesondere zu Wim<br />
Wenders’ Film »Paris, Texas«. Sein neues Album<br />
»Election Special« ist ein beißender Kommentar<br />
zur aktuellen amerikanischen Politik. In neun<br />
Blues- und Folk-Songs mischt Cooder sich in den<br />
Präsidentschaftswahlkampf ein.<br />
<strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>: Mr. Cooder, gefährden Sie nicht Ihren<br />
Ruf als Songwriter, wenn Sie sich mit Election<br />
Spe cial in die Untiefen des US-Wahlkampfs begeben?<br />
Ry Cooder: Ich tue das aus Notwehr. Die amerikanische<br />
Rechte ist sehr clever in ihrer Propaganda.<br />
Sie bringt die Wähler am Ende dazu, gegen ihre<br />
eigenen Interessen zu stimmen – insbesondere<br />
weiße Amerikaner, die um ihre Jobs und Häuser<br />
fürchten. Und Songs zu schreiben ist doch besser,<br />
als nur mit der Faust auf den Tisch zu hauen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Sie sind wütend?<br />
Cooder: Und ob. Viele Amerikaner sind sehr<br />
wütend. Leider versteht sich die Tea Party nur allzu<br />
gut darauf, diesen Ärger für ihre Zwecke zu<br />
nutzen. Der rechte Flügel der Republikaner finanziert<br />
ein pausenloses Trommelfeuer im Internet,<br />
im Fernsehen, im Radio. Die Rechte kontrolliert<br />
einen Großteil dieser Medien. Sie nutzt<br />
sie, um ihre Lügen zu wiederholen, bis die Leute<br />
sie irgendwann glauben.<br />
<strong>ZEIT</strong>: In früheren Songs haben Sie sich regelmäßig<br />
mit der amerikanischen Geschichte befasst.<br />
Ist es schwieriger, über aktuelle Tagespolitik zu<br />
schreiben?<br />
Cooder: Ich habe bewusst die Form des Bluesund<br />
Folk-Songs gewählt. So knüpfe ich an eine<br />
amerikanische Tradition an, die bis Joe Hill und<br />
Woody Guthrie zurückreicht und heute von der<br />
Occupy-Bewegung aufgenommen wird. Warum<br />
nicht über Tagespolitik singen? Woody Guthrie<br />
hat so anschauliche Songs geschrieben, weil er die<br />
De pres sion selbst erlebt hat.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Sie nennen Woody Guthrie Ihr Vorbild.<br />
Ihre Songs unterscheiden sich dennoch vom feierlich-pathetischen<br />
Protest-Folk der sechziger Jahre.<br />
Cooder: Weil ich meine Songs nicht für die Front,<br />
für Demos oder Sit-ins geschrieben habe. Lieber<br />
erzähle ich Geschichten – so wie es Country-Musiker<br />
tun, nur dass meine story lines etwas über den<br />
Zustand unseres Landes und die Moral unserer<br />
Politiker aussagen. Nehmen Sie etwa den Mutt<br />
Romney Blues. Mutt wie Trottel. Das sage natürlich<br />
nicht ich, sondern ich lasse seinen Hund erzählen.<br />
Sie haben sicher die Geschichte gehört,<br />
wie Romney in den Urlaub fuhr und seinen<br />
Hund einfach für 1000 Meilen auf das Autodach<br />
geschnallt hat.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Deswegen gibt es ja schon eine »Mein<br />
Hund bellt gegen Romney«-Kampagne. Auf Ihrem<br />
Album überwiegen die düsteren, manchmal<br />
bitteren Töne: vom Gefängnis-Lamento namens<br />
Guan ta na mo bis zu Kool-Aid, wo Sie die Gehirnwäsche<br />
durch die Rechte anklagen. Steht es wirklich<br />
so schlecht um Ihr Land?<br />
Cooder: Es geht ein tiefer Riss durch Amerika.<br />
Und die rechte Propaganda hat ihn zu verantworten.<br />
Sie hetzen die Menschen so lange auf, bis<br />
ein selbst ernannter Wachmann namens George<br />
Zimmerman einen unbewaffneten schwarzen<br />
Ein Demokrat:<br />
Ry Cooder<br />
Teenager erschießen kann und die Polizei ihn<br />
laufen lässt.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Immerhin haben Ihre Landsleute vor vier<br />
Jahren den ersten schwarzen Präsidenten gewählt.<br />
Cooder: Präsident Obama macht seinen Job so<br />
gut wie möglich. Ich singe in Cold Cold Feeling<br />
über seine Einsamkeit im Oval Office. Am Ende<br />
aber steht er wie David gegen Goliath: Großindustrielle<br />
wie die Koch-Brüder können inzwischen<br />
ganz legal Millionen ausgeben, um den<br />
Äther mit ihren Lügen zu vergiften.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Auch diesen berüchtigten Financiers der Ultrarechten<br />
widmen Sie einen Song: Brother Is Gone.<br />
Cooder: Ich habe lange nach einem Weg gesucht,<br />
über die Brüder Charles und David Koch zu singen.<br />
Bis mir Robert Johnsons alte Blues-Fabel<br />
einfiel; er spricht von der Wegkreuzung, an der<br />
man den Teufel trifft. So erkläre ich die Macht<br />
der Koch-Brüder. Satan verspricht ihnen einen<br />
Pakt: Ihr könnt die totale Macht haben. Aber ich<br />
werde als meinen Preis einen von euch Brüdern<br />
zur Hölle mitnehmen, und nur ich weiß, wen<br />
und wann. So wacht Charley Koch eines Tages<br />
auf, und sein Bruder Davey ist verschwunden.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Wollen Sie mit Ihren Songs den Kampfgeist<br />
des linken, demokratischen Amerikas anstacheln?<br />
Cooder: Ein Präsident der Demokraten kann<br />
kaum etwas richtig machen. Weil die zwei Amtszeiten<br />
von George Bush das Präsidentenamt beschädigt<br />
haben. Was nützt es, auf dem Fahrersitz<br />
des Autos zu sitzen, wenn das Auto nicht mehr<br />
fährt? Obama hat ein kaputtes Fahrzeug von den<br />
Republikanern übernommen. Und natürlich hätte<br />
ich ihn lieber radikaler, er hat es viel zu lange<br />
vermieden, die unsozialen Pläne der Republikaner<br />
frontal anzugreifen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Glauben Sie, dass Polit-Songs eine Rolle<br />
im Präsidentschaftswahlkampf spielen werden?<br />
Cooder: Ich überschätze die Rolle von Musik<br />
nicht. Songs geben dir nur Bilder, kleine Allegorien.<br />
Vor achtzig oder hundert Jahren waren Songs<br />
für viele Menschen noch die einzige Informationsquelle.<br />
Heute kauft kaum jemand noch Platten.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Und doch hat der politische Song überlebt<br />
...<br />
Cooder: Dass die Occupy-Bewegung keine kommerziellen<br />
Absichten verfolgt, gibt mir große<br />
Hoffnung. Diese Menschen können vielleicht<br />
auch meine Lieder brauchen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: So wie Ihren Song The 90 And The 9, auf<br />
dem Sie die 99 Prozent der nicht superreichen<br />
Amerikaner auffordern, für ihre Rechte zu<br />
kämpfen?<br />
Cooder: Würden die einfachen Menschen sich<br />
verbünden, hätten die rechten Republikaner keine<br />
Chance. Doch die Reichen spielen immer eine<br />
Gruppe gegen die andere aus: Speziell in Kalifornien<br />
werden die mexikanischen Wanderarbeiter<br />
vor jeder Wahl angeklagt, den Weißen ihre Jobs<br />
wegzunehmen. Nach der Wahl muss man sie dann<br />
wieder zurückholen – weil ja irgendjemand ihre<br />
Arbeit machen muss. Noch schlimmer ist der Versuch<br />
der Rechten, die Wahlrechte zu beschneiden.<br />
Sie wollen Menschen, die für Obama stimmen<br />
würden, von den Urnen fernhalten: Schwarze sollen<br />
nicht wählen. Arme sollen nicht wählen. Und<br />
die Leute vom Obersten Gerichtshof finden Wege,<br />
all die Gesetze, die Präsident Johnson während der<br />
Bürgerrechtsbewegung erließ, rückgängig zu machen.<br />
Das ist der gefährlichste Angriff auf unsere<br />
Bürgerrechte in der Geschichte unseres Landes.<br />
Das Gespräch führte JONATHAN FISCHER<br />
Madame Tattoo<br />
Ein Rückblick auf die hysterische Debatte um Bettina Wulff<br />
VON URSULA MÄRZ<br />
Ein paar Fragen sind in der Causa Bettina<br />
Wulff schon noch offen, Fragen,<br />
die über den Einzelfall hinaus durchaus<br />
interessant sind. Zum Beispiel die<br />
Frage, ob Bettina Wulffs Anspruch,<br />
Gerüchte über eine angebliche Rotlichtvergangenheit<br />
auf juristischem Weg auszuräumen, dadurch<br />
beeinträchtigt oder gar desavouiert ist, dass sie ihn<br />
mit der Veröffentlichung ihres Buches und dessen<br />
Vermarktung zeitlich, also strategisch verknüpfte.<br />
Hat Bettina Wulff, die sich den Medien sehr gern,<br />
sehr selbstbezogen und auf durchaus peinliche<br />
Weise hingibt, hierdurch ihr Recht verwirkt, sich<br />
gegen die Auslieferung ihres Namens an As so ziations<br />
be grif fe wie »Prostituierte« oder »Escort-Service«<br />
im Medium Internet zu wehren? Eindeutig:<br />
Nein. Sie hat das Recht, ohne Wenn und Aber. Ihr<br />
Anspruch, sich von unwahren Bordellgeschichten<br />
zu befreien, wird keinen Millimeter geschmälert<br />
durch die Show, die sie in den vergangenen zwei<br />
Wochen abzog. Auch wenn Bettina Wulff, wonach<br />
es aussieht, komplett den Überblick verloren hat,<br />
auch wenn sie uns bis Weihnachten mit Privata,<br />
Kochrezepten oder biografischen Erinnerungen<br />
bombardiert, auch wenn sie der Aufgabe, zwischen<br />
ihrer Ehrenrettung und ihren Selbstdarstellungsgelüsten<br />
zu unterscheiden, überhaupt nicht gewachsen<br />
ist: Die Öffentlichkeit hat die Aufgabe,<br />
hier zu unterscheiden und das eine vom anderen<br />
zu trennen.<br />
Die Klage gegen Google ist ein Muss,<br />
da sind alle Allüren egal<br />
Was Frau Wulff in ihrem wahrhaft unangenehmen<br />
Buch Jenseits des Protokolls, was sie von Interview zu<br />
Interview an Banalitäten und Plattitüden, von Foto<br />
zu Foto an Styling aufbietet, ist schon nervig. Was<br />
der Gattin eines ehemaligen deutschen Bundespräsidenten<br />
in verleumderischer Absicht angehängt<br />
wurde und im Internet immer noch anhängt, das<br />
allerdings ist nicht nervig. Es ist absolut untolerierbar.<br />
Nicht nur für die Gattin. Auch für uns. Man<br />
möchte es nicht hinnehmen, dass die Allüren einer<br />
jungen, etwas wichtigtuerischen Frau die Ablagerung<br />
von erlogenen Schmutzgeschichten um das höchste<br />
Amt im Staat rechtfertigen. Die Bild-Zeitung will<br />
durch eine Umfrage herausgebracht haben, dass bis<br />
zum Beginn des Spektakels vor zwei Wochen nur<br />
15 Prozent der Bundesdeutschen von den Rotlichtgerüchten<br />
wussten. Das sind 15 Prozent zu viel. Zu<br />
viel dafür, dass die Betroffene über ein Jahr lang der<br />
Repräsentation der Bundesrepublik diente. Wer sich<br />
ein paar Stunden damit beschäftigt, durch das Labyrinth<br />
der digitalen Sex- und Bordellseiten zu<br />
surfen, die sich bei Google aus der Eingabe des Vornamens<br />
»Bettina« ableiten, der empfindet Bettina<br />
Wulffs Ehetherapie-Outing als vergleichsweise unmonströs.<br />
Bettina Wulff hat gegen Google Klage<br />
erhoben. Der juristische Ausgang dürfte relevant<br />
genug sein, um die Klägerin künftig vorzugsweise<br />
in diesem Kontext wahrzunehmen – nicht im Kontext<br />
ihrer desaströsen PR-Offensive.<br />
Warum geriet sie überhaupt in dieses Desaster?<br />
Wie kann es sein, dass Bettina Wulff die Anfeindungen,<br />
die ihr nun geballt entgegenschlagen, noch<br />
nicht einmal als ferne Möglichkeit in Betracht zog?<br />
Wie kommt es, dass eine Frau, von deren intellektuellen<br />
Kapazitäten und deren Erfahrung als PR-<br />
Expertin zumindest die Effektberechnung ihres<br />
Auftretens zu erwarten ist, sich bei ihrer Schreiberei<br />
und Quasselei über den Gefühlsstress im Schloss<br />
Bellevue, über die Unbehaglichkeit der Bundespräsidentenvilla,<br />
über die Wahl des Kostüms gelegentlich<br />
des Rücktritts Christian Wulffs etc. pp. in völliger<br />
Sicherheit wähnte, all dies würde vom Publikum<br />
als bedeutsame und Sympathie stiftende<br />
Auskunft begrüßt? Diese Frage ist nicht leicht zu<br />
beantworten. Die Suche nach einer Antwort führt<br />
zu einer anderen Frage: Wo lebt Bettina Wulff eigentlich?<br />
Wie ist aus ihrer Sicht ein Land beschaf-<br />
FEUILLETON<br />
fen, das ihr Buch so einstimmig bejubelt wie ihre<br />
wechselnden Modelposen? Ja wie eigentlich?<br />
Es ist ein Land, in dem die Journalistin, die schon<br />
erfolgreich mit Veronica Ferres an einem Buch gearbeitet<br />
hat, genau die richtige Ghostwriterin für das<br />
Buch einer Politikergattin ist. Ein Land also, in dem<br />
das System Unterhaltungsprominenz als Referenzgröße<br />
für das System Politik dient. In diesem Land<br />
genügt die Aussage eines Looks als Aussage über das<br />
Rollenverständnis einer Bundespräsidentengattin<br />
und eine Tätowierung als politisches Thema. Das<br />
Drehbuch, welches dieses Land auf die Geschichte<br />
seines öffentlichen Personals anwendet, ist kein<br />
anderes als das des Medienstars. Und genau dies ist<br />
das Drehbuch, in dem Bettina Wulff sich befindet<br />
und das sie bis ins Detail hinein befolgt. Sie scheint<br />
tatsächlich zu glauben, dass sie alles richtig macht,<br />
wenn sie sich an die Erfolgsrezepte von Figuren hält,<br />
bei denen es darauf ankommt, möglichst ubiquitär<br />
sichtbar zu sein, möglichst viel privaten Episodenstoff<br />
zu liefern, möglichst umfangreich und reizstark<br />
abgebildet zu werden.<br />
Wenn sich Bettina Wulff in knallroter Bluse,<br />
knallrotem kurzem Rock, knallroten Stiefeln auf<br />
einer Treppe sitzend fotografieren lässt, dann demonstriert<br />
sie nicht nur ihren Attraktivitätsstolz. Sie<br />
demonstriert das elementare Missverständnis der<br />
Rolle, der sie ihre öffentliche Karriere verdankt. In<br />
dem Land, das Bettina Wulff wahrnimmt, ist der<br />
Vorteil, den Daniela Katzenberger gegenüber Annette<br />
Schavan insofern genießt, als sie das Medienprinzip<br />
schlichtweg professioneller beherrscht,<br />
durchaus von einer gewissen Bedeutung. Man würde<br />
sich kaum mehr wundern, wenn die Gattin des<br />
ehemaligen Bundespräsidenten demnächst einen<br />
Werbevertrag unterschriebe und im Fernsehen für<br />
Müller-Milch aufträte. Kurzum: Bettina Wulff hat<br />
sich verrannt, wie sich Stephanie zu Guttenberg, der<br />
sie augenscheinlich nacheifert, ebenso gnadenlos<br />
verrannt hätte, wenn das Schicksal sie nicht im<br />
letzten Moment über den Atlantik entführt hätte.<br />
Endlich Glamour im Politbetrieb,<br />
endlich auch bei uns ein wenig Bruni<br />
Was ist mit diesen Geschöpfen eigentlich los? Erfahrene,<br />
selbstbewusste, willensstarke Frauen aus<br />
einer Generation mit weiten Spiel- und Handlungsräumen,<br />
die sich, kaum haben sie die Sphäre<br />
der Politik betreten, in einer Art benehmen, als<br />
handele es sich dabei um die Location eines Fotoshootings.<br />
Nun ja, ein wenig übereitel sind sie<br />
schon, und sie wissen auch sehr um ihr optisches<br />
Po ten zial. Aber die Erfahrung, dass sie dank dieses<br />
Potenzials von der Öffentlichkeit empfangen wurden,<br />
als brächten sie ein Glas Wasser in die Wüste,<br />
um den vom Verstaubungstod bedrohten Politbetrieb<br />
zu retten, diese Erfahrung begleitete ihre<br />
ersten Schritte auf dem roten Teppich allerdings<br />
auch. Endlich!, schallte es ihnen entgegen, endlich<br />
weiblicher Glamour und Palastglanz in der Berliner<br />
Bürokratenhütte. Endlich ein klein wenig Michelle<br />
Obama, eine Spur Carla Bruni, endlich Garderobe<br />
von Designern, die Annette Schavan nicht einmal<br />
vom Namen her bekannt sein dürften.<br />
Man kann, was ihnen angeboten wurde, einen<br />
Deal nennen: Dafür, dass sie dem Drehbuch der<br />
Politik einen Look und Celebrity beisteuerten,<br />
durften sie eine Weile ignorieren, dass es sich bei<br />
dem Land, in dem sie leben, um eine repräsentative<br />
Demokratie handelt, deren Akteure Stellvertreter,<br />
nicht Selbstdarsteller sein sollen. Diesen Deal hat<br />
sich Bettina Wulff restlos zu eigen gemacht. Sie<br />
erschien zum großen Zapfenstreich mit neuer Frisur,<br />
sie erzählte, wie sie Herrn Wulff im Flugzeug<br />
kennenlernte, sie schrieb ein Buch mit einer Celebrity-Ghostwriterin.<br />
Sie spielte, was im Drehbuch<br />
eines Unterhaltungsstars so drinsteht. Und das war<br />
offensichtlich ein großer Fehler.<br />
A www.zeit.de/audio<br />
Individualität hat<br />
ihren Preis: Das<br />
Motiv von Bettina<br />
Wulffs Tätowierung
FEUILLETON<br />
Es ist so ruhig, als hätte einer den<br />
Soundtrack der Großstadt auf null<br />
gedreht. Bedford Square im Londoner<br />
Stadtteil Bloomsbury atmet<br />
die Gelassenheit einer entspannten<br />
Epoche. Schnurgerade Häuserreihen<br />
um einen Park. Türbögen in<br />
Rot-Weiß. Man stellt sich vor, wie Virginia Woolf,<br />
vom Tavis tock Square her kommend, ihrem Spaniel<br />
nachhechelte in Richtung Grün, aus dessen Hecken<br />
sich jetzt allerdings erstaunlich viele Männer lösen.<br />
Es kommen: einer von links, zwei von rechts, einer<br />
von geradeaus, es sind pralle Typen in schwarzen<br />
Anzügen, verkabelte fleischige Ohren. Security!<br />
Ich versuche einen Scherz und sage: »Ich habe<br />
hier ein Date mit Salman Rushdie.« Sie fragen, wer<br />
Salman Rushdie sei. Ich frage sie, wer sie sind, und<br />
sie antworten, sie seien die Security zum Schutz der<br />
Studenten, die heute im Park Examen feiern.<br />
Studenten! Ob das eine gute, eine schlechte<br />
Nachricht ist? Dass der Autor Salman Rushdie, auf<br />
dessen Kopf der islamische Mullah Ajatollah Chomeini<br />
am 14. Februar 1989 eine Million Dollar ausgesetzt<br />
hatte, dessen Name in Schockwellen um die<br />
Welt lief, der vom Special Service des Vereinigten<br />
Königreiches über zehn Jahre lang von Versteck zu<br />
Versteck gebracht, vor Mörderkommandos geschützt<br />
werden musste, dass Salman Rushdie einem<br />
Londoner Security Service heute ein Unbekannter<br />
ist? Und Studenten der Security bedürfen?<br />
Wir sind mit Salman Rushdie in seiner Agentur<br />
verabredet. Zu Wylie hatte Rushdie sich geflüchtet,<br />
als der Boden unter seinen Füßen zu beben begann,<br />
als er hörte, was der Ajatollah Chomeini sagte:<br />
Ich informiere das stolze muslimische Volk der<br />
Welt, dass der Autor des Buches »Die satanischen Verse«,<br />
welches sich gegen den Islam, den Propheten und<br />
den Koran richtet, sowie alle, die zu seiner Publi kation<br />
beigetragen haben, zum Tode verurteilt sind. Ich<br />
bitte alle Muslime, die Betroffenen hinzurichten ...<br />
Heute sitzt der Autor bei Wylie auf der Terrasse,<br />
ein kleiner, molliger Herr. Er hat seine Autobiografie<br />
geschrieben, eine 700 Seiten lange Aufzählung<br />
der Horrorszenarien seiner Zeit im Untergrund.<br />
Alles überstanden! Besser gesagt: überlebt. Es ist ein<br />
sonniger Tag. In Pakistan wurde ein 14-jähriges<br />
Mädchen, das der Beleidigung des Korans angeklagt<br />
war, aus dem Gefängnis entlassen. Nicht so gut die<br />
Nachricht, dass, weil die iranische Schauspielerin<br />
Gol shif teh Farhani in einem Künstlervideo eine<br />
Brust entblößt hat mit dem Satz: »Ich werde deine<br />
Träume nähren«, ihr Vater Drohanrufe erhält, jemand<br />
schrie ins Telefon, man werde ihr die Brüste<br />
abschneiden und ihm auf einem Tablett servieren.<br />
Wir wissen noch nicht, dass es eine Woche vor dem<br />
Tag ist, an dem ein Mob die amerikanische Botschaft<br />
in Bengasi stürmt und den Botschafter tötet,<br />
die deutsche Botschaft in Khartoum brennt und in<br />
Tripolis Kentucky Fried Chicken. Unruhen in Irak,<br />
Iran, Katar, Kaschmir und Ägypten, wegen eines<br />
Films, der den Propheten Mohammed verspottet.<br />
<strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>: Die Fatwa gab Ihrem Leben eine völlig<br />
neue Richtung. Wann haben Sie das verstanden?<br />
Salman Rushdie: Vielleicht eine Woche nachdem es<br />
begann. Als die diplomatischen Bemühungen gescheitert<br />
waren. Es gab diesen Moment, in dem ein<br />
Senior Police Officer sagte: Hören Sie, sieht so aus,<br />
als könnte es auf unbestimmte Zeit so bleiben.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Auf unbestimmte Zeit ein Fliehender. Sie,<br />
der Star des literarischen London, Gewinner des<br />
Booker Prize für Midnight’s Children, verjagt aus<br />
dem eigenen Leben. Was waren Ihre Gefühle?<br />
Rushdie: Furchtbar. In den ersten zwei Jahren war<br />
ich in Gefahr, mich zu verlieren. Eine Spirale in die<br />
Depression. Nicht schreiben können, nicht arbeiten,<br />
können nicht klar denken können. Sie betonten,<br />
ich würde nicht mehr nach Hause zurück<br />
können. Ich hatte ein wunderbares Haus, ich hätte<br />
darauf bestehen sollen, dort zu bleiben.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Sie verloren Ihr Haus, Ihre Ehe ging zu<br />
Bruch, Ihr Name war nur noch ein Symbol, Sie<br />
brauchten einen neuen. Sie wählten: Joseph Anton.<br />
Rushdie: Joseph wie Joseph Conrad. Anton wie<br />
Anton Tschechow.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Wir alle lernten, dass eine heilige Fatwa nie<br />
mehr zurückgerufen werden kann.<br />
Rushdie: Die theologische Komponente ist mir<br />
egal. Entscheidend war, dass es um einen staatlich<br />
unterstützten Terrorismus ging. Die iranische Regierung<br />
hatte Killer. Mir wurde klargemacht, dass<br />
mir der Schutz des britischen Staates nur zuteil<br />
würde, weil es sich um einen Angriff eines Staates<br />
auf einen britischen Bürger handelte.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Die Fatwa veränderte auch Ihren hochgelobten<br />
Roman – in einen Stein des Anstoßes.<br />
Rushdie: Das passierte schon vor der Fatwa. Auf<br />
den Tag vier Wochen vorher, als das Buch in Bradford<br />
verbrannt wurde. Als ich das brennende Buch<br />
sah, verstand ich, dass das Buch sich in etwas anderes<br />
verwandelt hatte, in eine Ikone für Abscheu<br />
oder ein Objekt der Blasphemie oder etwas, das<br />
man unterstützen musste. Als ich das brennende<br />
Buch sah, passierte in mir etwas sehr Tiefgehendes.<br />
Was? Es machte mich sehr, sehr, sehr wütend.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Ich erinnere mich an meine Lektüre des Buches,<br />
wundervoll. Ich habe oft schallend gelacht.<br />
Keine Kompromisse!<br />
Über zehn Jahre lang musste sich Salman Rushdie vor einer Fatwa verstecken. In seiner<br />
Autobiografi e erzählt er von seinem Leiden. SUSANNE MAYER hat den Autor besucht<br />
Rushdie: So etwas Schönes hat seit Langem niemand<br />
mehr über das Buch gesagt.<br />
Die Satanischen Verse sind ein Werk von 500 bis 700<br />
Seiten, je nach Druck. Neun Kapitel. Das Buch,<br />
dessen Verdammung erst später als Auftakt einer<br />
Zeitenwende verstanden wird, die auch zum 11.<br />
Sep tember führte, beginnt mit der Explosion eines<br />
Flugzeuges über London. Jumbo AI-420 bricht auf<br />
wie eine alte Zigarre. In dem Regen aus Getränketrolleys,<br />
Einreiseformularen, Pappbechern befinden<br />
sich Saladin Chamcha und Gibril Farishta, die kopfüber<br />
in London landen. Multiple Handlungsstränge<br />
überschneiden sich zu einer Textstruktur, in der sich<br />
religionsgeschichtliche, märchenhafte, auf Träumen<br />
basierende, ironische, burleske Passagen überlagern.<br />
Ein Ajatollah wird als zwanghafter Greis karikiert.<br />
Da ist ein Harem, in dem Damen unter den Namen<br />
der Frauen Mohammeds anschaffen. Und ein<br />
Traum, in dem der Offenbarung des Korans Satanische<br />
Verse untergejubelt werden. Wieder Nominierung<br />
für den Booker Prize!<br />
<strong>ZEIT</strong>: Dieses Buch war die Krönung Ihres Werkes.<br />
Rushdie: Ich bin ungeheuer stolz auf dieses Buch.<br />
Der Erfolg von Midnight’s Children und Shame<br />
hatte mir das Vertrauen gegeben, neues Terrain zu<br />
erobern, ich finde, das ist gelungen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Andere finden, es sei eine respektlose Ironisierung<br />
religiöser Themen. Andererseits: War Religion<br />
damals nicht – altmodisch?<br />
Rushdie: Genau so war es. Es war eine andere<br />
Welt. Der Libanon war eine offene säkulare Gesellschaft.<br />
Beirut nannte man das Paris des Ostens.<br />
Teheran und Bagdad waren kosmopolitische Städte.<br />
Religiösen Fanatismus kannte man nicht.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Eine Meinung, die sich als naiv erwies.<br />
Salman Rushdie<br />
Der Autor der »Satanischen Verse« wurde am<br />
19. Juni 1947 in die Familie eines wohlhabenden<br />
Geschäftsmanns in Bombay geboren. Mit 14 ging<br />
er auf die elitäre englische Privatschule Rugby. Dort<br />
machte er die Erfahrung von Anderssein und Ausgeschlossenwerden,<br />
die sich auch durch das Geschichtsstudium<br />
in Cambridge nicht verwischte.<br />
Rushdie: Als Fehler (lacht). Tatsächlich dachte die<br />
Generation der sechziger Jahre, Religion sei vorbei.<br />
Also, warum hätte man nicht respektlos sein dürfen?<br />
Als ich dieses Buch schrieb, hatte ich wirklich<br />
keine Vorstellung davon, dass ich meine Sicherheit<br />
riskierte. Ich zeigte das Manuskript einigen Freunden,<br />
unter ihnen Edward Said ...<br />
<strong>ZEIT</strong>: … dem Autor des Buches Orientalismus!<br />
Rushdie: Er sagte: Stell dich auf Krach ein.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Taten Sie das?<br />
Rushdie: Natürlich. Ich finde, dass ist genau das,<br />
was Bücher tun sollten – eine Debatte lostreten. Das<br />
ist so gut an Büchern, dass sie Gesellschaften oder<br />
Kulturen zwingen können, sich auf eine Unterhaltung<br />
einzulassen, die diese gerne vermeiden würden.<br />
Man streitet, und vielleicht hat jeder etwas gelernt.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Eine sehr westliche Betrachtungsart. In Ägypten<br />
wurde der liberale Denker Nasr Hamid Abu<br />
Zaid zwangsgeschieden und ins Exil gejagt, weil er<br />
dachte, man könne sich über den Koran unterhalten<br />
wie über jeden anderen literarischen Text.<br />
Rushdie: Ich bin in Indien aufgewachsen, in einer<br />
muslimischen Familie. Indische Muslime waren<br />
immer säkularisiert. Als Gandhi und Nehru über<br />
die indische Unabhängigkeit nachdachten, bestanden<br />
sie darauf, dass Indien ein säkularer Staat sein<br />
müsste. In Indien gibt es eine 80-prozentige Hindumajorität;<br />
wäre die Verfassung nicht säkular,<br />
hätten Hindus immer die Macht. Die muslimische<br />
Minderheit, immer noch 140 Millionen Menschen,<br />
weiß, dass ein säkularer Staat ihr bester<br />
Schutz ist. Der Islam, der sich im 20. Jahrhundert<br />
in den arabischen Ländern entwickelte, ist etwas<br />
anderes, etwas Härteres. Ich bin in Indien gebo<br />
ren, einer freien Gesellschaft, und zog og nach<br />
England, in eine andere freie Gesellschaft, lschaft,<br />
ich hatte damit keine Erfahrung.<br />
Nach Wanderjahren als Schauspieler<br />
und Werbetexter fand Rushdie zum<br />
Schreiben. Schon sein zweites Buch<br />
»Midnight’s Children« war ein großer<br />
Erfolg. Rushdie war viermal verheiratet<br />
und hat zwei Söhne, er lebt<br />
heute in New York.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Sie sind der globale flexible Bürger, an dem<br />
sich ein globaler Streit entzündete.<br />
Rushdie: Es war der Beginn von etwas. Wir leben<br />
in einer Gesellschaft, deren Plage die Rückkehr der<br />
Religionen ist. Nicht nur des Islams. In Amerika<br />
sehen Sie die Erstarkung der christlichen Rechten,<br />
in Indien eine Erhebung des rechten Hinduismus.<br />
Pakistan ist heute ein dunkler Ort.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Ihre Freunde haben sich um sie gestellt –<br />
Martin Amis, Ian McEwan, Julian Barnes, Susan<br />
Sontag. Solidaritätsadressen, Veranstaltungen, sie<br />
gaben Ihnen Unterschlupf. Ob Ihre Bedrohung<br />
auch das Schreiben dieser Autoren beeinflusst hat?<br />
Rushdie: Nein. Aber sie formte unsere Beziehungen<br />
zueinander. Ian McEwan sagte einmal, die Fatwa<br />
habe uns als Generation zusammengebracht, sie<br />
prägte uns, hier, zu einem historischen Zeitpunkt.<br />
Auch anderswo hieß es Farbe bekennen. Die Fatwa<br />
erklärte zum Kriegsgebiet: das Verlagswesen, die<br />
Lektoren, die Übersetzer, Buchhändler; alle, die das<br />
Buch verbreiten würden, waren der Fatwa unterworfen.<br />
In englischen Buchhandlungen detonierten<br />
Bomben. In Amerika lebte der Verleger Peter Mayer<br />
als Sicherheitsgefangener in seiner Wohnung, eine<br />
traumatische Erfahrung, erzählt sein Freund, der Verleger<br />
Helge Malchow, dessen Verlag Kiepenheuer &<br />
Witsch die Satanischen Verse auf der Frankfurter<br />
Buchmesse 1988 gekauft hatte mit der Auflage, das<br />
Buch im Herbst auf Deutsch zu veröffentlichen.<br />
Reinhold Neven DuMont, damals Eigentümer und<br />
Verleger, erinnert sich, wie er in seinem Verlag von<br />
einer Frau mit schreckgeweiteten Augen empfangen<br />
wird: »Man Man hat Sie S zum Tode verurteilt!« Die Hek-<br />
tik! Straßensperrung! Straßens Einbau von Pollern, um<br />
das Heranf Heranfahren von mit Sprengstoff belade-<br />
nen Autos zu verhindern. Fällen eines Bau-<br />
Salman Sa Rushdie:<br />
JJoseph<br />
Anton.<br />
Die Autobiografie<br />
Aus dem Englischen von<br />
Bernhard Robben und<br />
Verena von Koskull;<br />
Ve Verlag C. Bertelsmann,<br />
Mü MMünchen<br />
<strong>2012</strong>; 720 S., 24,99 €<br />
Fotos: Garry Clarkson/Picture Press (o.); Chris Young/The Canadian Press/ddp/AP<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 45<br />
Das Buch »Die satanischen Verse«<br />
wird am 14. Januar 1989 in Bradford<br />
von Muslimen verbrannt<br />
mes, von dem aus man den Verlag hätten beschießen<br />
können. Die Übersetzerin der Satanischen Verse wirft<br />
hin. Was tun? Der Verlag zögert. Dann kommt es zu<br />
einer beispiellosen Solidarisierung, zu einem neuen<br />
Verlag, genannt »Artikel 19«, in Anspielung auf die<br />
Erklärung der Menschenrechte zur freien Meinungsäußerung.<br />
Das Verzeichnis der Unterstützer ist zwei<br />
Seiten lang. Herbert Achternbusch und Jürgen Becker<br />
und Lew Kopelew, Thomas Kling, Katja Lange-<br />
Müller, die Verlage Haffmans, Rowohlt, Rotbuch,<br />
Wagenbach, Suhrkamp und so weiter. Es ist ein heroischer<br />
Akt. Es werden neue Übersetzer gefunden, die<br />
undercover arbeiten. Nicht ohne Bangen. Der dänische<br />
Übersetzer wird angegriffen, der japanische von einem<br />
Messerstecher hingerichtet. Einer der deutschen Übersetzer<br />
erinnert sich, wie er in Arbeitspausen auf seinem<br />
Balkon rauchte und sich dabei beobachtete, wie er die<br />
Straße beobachtete. Sollte er das Kind noch in den<br />
Kindergarten bringen? War es sicher, jeden Tag um<br />
acht das Haus zu verlassen?<br />
Von solchen Ängsten anderer Menschen oder<br />
ihrem Mut findet sich in Rushdies Buch wenig. Da<br />
ist ein gereizter Unterton. Die Beschützer werden ihm<br />
zu Freiheitsberaubern. Viele kommen schlecht weg,<br />
Mitschüler in Rugby, Kommilitonen in Cambridge,<br />
Engländer überhaupt, gar nicht zu reden von Ehefrauen<br />
(drei). So gesehen, ist die oft sehr intime Erzählung<br />
auch ein Dokument des Unbewältigten.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Man hat Sie angegriffen. Als eitel, provokant,<br />
diabolisch – hat es Ihre Sicht auf sich selbst berührt?<br />
Rushdie: Nein, es änderte meine Sicht auf einige<br />
Leute. Wenn ich etwas sagen kann, dann, dass ich<br />
weiß, wer ich bin. Aber die Attacken waren effektvoll,<br />
noch Jahre später würden die Leute sagten:<br />
Oh, Sie sind tatsächlich ganz nett.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Die Diskussion polarisierte sich schnell. Ihren<br />
Unterstützern wurde ein fundamentalistischer<br />
Menschenrechtsbegriff vorgeworfen.<br />
Rushdie: Die religiösen Faschisten behaupteten,<br />
die Verteidiger des Rechts auf freie Meinungsäußerung<br />
seien absolutistisch. Aber Liberale verlangen<br />
nicht, dass Menschen, die anderer Meinung sind,<br />
umgebracht werden. Ich hatte den Impuls, meinen<br />
Text zu verteidigen. Ich dachte, dann würden die<br />
Mullahs sich an den Kopf schlagen und sagen:<br />
Aber natürlich. Sorry. Alles okay. Das war naiv.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Es ging nicht um Argumente. Verstehen Sie,<br />
warum Sie die Gefühle von Leuten verletzten?<br />
Rushdie: Es ist mir egal, warum sie sich verletzt<br />
fühlten. Um von einem 600-Seiten-Buch verletzt<br />
zu sein, muss man viel Arbeit investieren. Es ist<br />
sehr einfach, nicht verletzt zu sein, man guckt sich<br />
ein anderes Kunstwerk an. Unsere Buchläden sind<br />
voll mit Büchern, damit man auswählen kann. Es<br />
gibt auch Bücher, die mich verletzen würden,<br />
Shades of Grey vermutlich (lacht), aber deswegen<br />
fackele ich nicht den Laden ab. Das Gerede von<br />
»Verletztsein« ist Quatsch. Keiner hat das Recht,<br />
verletzt zu sein. Wäre Verletztsein ein Argument,<br />
wäre Harry Potter in Amerika verboten, weil einige<br />
Leute finden, dass es Hexerei unterstützt.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Wünschen Sie sich heute, angesichts dessen,<br />
was Sie und viele durchgemacht haben, Sie hätten<br />
das eine oder andere zurückhaltender formuliert?<br />
Rushdie: Im Gegenteil. Wenn ich etwas gelernt<br />
habe: Keine Kompromisse. Es gibt Werte, nach<br />
denen ich mein Leben leben möchte, und sie bilden<br />
die Grundlage für die Art von offener Gesellschaft,<br />
in der ich gerne lebe. Bei diesen Werten<br />
kann es keine Kompromisse geben. Die Freiheit<br />
der Meinungsäußerung gehört dazu, ohne sie verschwinden<br />
alle anderen Freiheiten.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Haben Sie jemals daran gedacht, den Mördern<br />
zuvorzukommen und sich selber zu töten?<br />
Rushdie: Nein, das ist mir nicht gegeben. Aber ich<br />
hatte auch Menschen, die zu mir standen, meine<br />
Familie, meine Frau Elizabeth, mein Sohn.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Sie sprechen oft, mehr noch als von Furcht,<br />
von Scham, die Sie empfunden haben. Was ist der<br />
Kern dieses Gefühls von Scham?<br />
Rushdie: In der östlichen Kultur gibt es diese Achse<br />
zwischen Ehre und Scham. In der christlichen<br />
Welt liegt sie zwischen Sünde und Erlösung. Es<br />
bedeutet, etwa aus der Perspektive der muslimischen<br />
Kultur, dass Stolz eng verbunden ist mit der<br />
Identität. Wer gezwungen ist, sich so zu verhalten,<br />
das der Stolz verletzt wird – empfindet Scham.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Aber Sie waren noch immer Salman<br />
Rushdie, der den Booker Prize gewonnen hat ...<br />
Rushdie: Das macht es schlimmer. Der Salman<br />
Rushdie, der den Booker Prize gewonnen hat,<br />
muss sich unter dem Küchentisch verstecken,<br />
wenn ein Nachbar vor dem Haus steht.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Sie leben jetzt mitten in Manhattan ...<br />
Rushdie: Ja.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Im Gewühle beim Union Square ...<br />
Rushdie: Nein, tue ich nicht!<br />
<strong>ZEIT</strong>: Sehen Sie ab und zu über die Schulter?<br />
Rushdie: Nie. In Manhattan sind alle Taxifahrer<br />
Muslime, nicht selten wollen sie ein Autogramm.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Mr. Rushdie, vielen Dank für das Gespräch.<br />
PS. Der Daily Telegraph meldete am 17. September<br />
<strong>2012</strong>, dass die iranische Gruppierung<br />
15 Khordad Foundation das Kopfgeld auf Salman<br />
Rushdie auf 3,3 Millionen US-Dollar erhöht hat.
46 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> FEUILLETON<br />
Wir können es nicht riechen.<br />
Aber es muss entsetzlich<br />
stinken, als die<br />
Polizei die Tür aufbricht,<br />
in die Wohnung eindringt<br />
und die Klebestreifen<br />
mit einem schneidenden<br />
Geräusch herunterreißt, mit denen jemand die<br />
Schlafzimmertür versiegelt hat. Und dann sehen wir<br />
auch schon die Tote. Sehr fern, sehr wächsern und<br />
majestätisch liegt sie auf dem Bett. Die Zeit im<br />
Totenzimmer, die gerade noch stillstand, beginnt<br />
wieder zu laufen. Gleich werden die Beamten die<br />
Tote einpacken, die jetzt noch, mit Blumen geschmückt<br />
und im besten Kleid, wie zu einer letzten<br />
großen Verabredung daliegt. Man wird die Fenster<br />
öffnen. Der Lärm des Lebens wird wieder einsetzen.<br />
Paris wird auch diese Tote verschlucken.<br />
Täglich sterben überall Menschen. Selten sieht<br />
ihnen jemand geduldig dabei zu. Beobachtet, wie die<br />
Zeit sich am Sterbebett aufstaut, wie alle Zukunft in<br />
sich zusammenfällt, wie das Leben sich in die Augenblicke<br />
zurückzieht, wie alles andere verschwindet und<br />
nur noch das da ist, was ist. Michael Hanekes Film<br />
Liebe nimmt sich die Zeit dafür. Und schenkt uns die<br />
Zeit der genauen Empfindung, von der oft behauptet<br />
wird, dass es sie nicht mehr gibt, für einen Kinoabend<br />
zurück. Er erzählt ruhig, ungerührt, diskret, was in<br />
den Tagen und Monaten geschah, bevor die zarte<br />
Dame aus ihrer dornröschenhaften Totenruhe gerissen<br />
wurde. Wer sie war, wer sie geliebt hat, wie tief<br />
und bedingungslos sie geliebt wurde, wo sie gelebt<br />
hat, wie sie todkrank wurde, wer bei ihr war und wer<br />
ihr beim Sterben half.<br />
Die Totenszene, mit der der Film beginnt, ist ein<br />
Vorgriff. Das Ende, das in jedem Anfang schon enthalten<br />
ist. Gleich darauf sieht man die zarte Dame,<br />
Fotos (Ausschnitte): X Verleih<br />
Die Zärtlichkeit des Endes<br />
Michael Hanekes grandioser Film »Liebe« über die letzten Lebenswochen eines alten Paares VON IRIS RADISCH<br />
von Emmanuelle Riva mit dem trockenen, ein wenig<br />
gouvernantenhaften Charme der alten Pariser Großbourgeoisie<br />
fabelhaft gespielt, neben ihrem Mann in<br />
einem Konzert sitzen und im Bus nach Hause fahren.<br />
Es sind die letzten Momente ihres alten Lebens. In<br />
der Nacht kann die sie nicht schlafen. Am nächsten<br />
Morgen beim Frühstück erleidet sie einen Schlaganfall.<br />
Es beginnt ein langer Abschied vom Leben,<br />
der in manchen Augenblicken quälend ist, in manchen<br />
banal, in manchen komisch und manchmal<br />
auch so innig, dass einem die Tränen kommen.<br />
Ein Mann und eine Frau<br />
bei ihrem letzten Tango in Paris<br />
Die schöne, geräumige alte Pariser Innenstadtwohnung<br />
des Paares mit soziologisch korrektem Interieur<br />
– im Salon Bibliothek, Flügel, Samtsessel,<br />
Gemälde; im Vestibül eine große Tapisserie; neben<br />
der Küche das ehemalige Dienstbotenkabinett –<br />
bleibt dann das einzige Bühnenbild für dieses<br />
Sterbe schauspiel, das uns immer tiefer hineinzieht<br />
bis zu jenem letzten Punkt, an dem nur noch der<br />
Tod aus der Enge dieser vakuumverpackten Räume<br />
wieder hinausführt. Am Ende kennt man jedes<br />
Möbelstück so genau, als habe man selbst sein Leben<br />
in diesem retreat verbracht, in das Haneke sich<br />
mit seinen beiden Hauptdarstellern zurückgezogen<br />
hat, um in der Stille und ungestört von der<br />
hypernervösen Gegenwart ein paar menschlichen<br />
Wahrheiten auf den Grund zu gehen.<br />
In Das weiße Band, Hanekes vorigem Film über<br />
die protestantischen Lebensläufe in einem brandenburgischen<br />
Dorf zu Beginn des 20. Jahrhunderts,<br />
konnte man manchmal das Gefühl haben, in<br />
ein gegen die Quicklebendigkeit des Lebens restlos<br />
abgedichtetes, allergikerfreundliches Filmmuseum<br />
interniert zu werden. Und obwohl auch das Pariser<br />
Sterbequartier einer luxuriösen Anstalt gleicht, aus<br />
der beinahe alles verbannt wurde, was den Anstaltsregeln<br />
widersprechen könnte, ist der legendäre<br />
Perfektionismus Hanekes hier niemals störend.<br />
Für ein leidenschaftliches Liebesdrama mag dieser<br />
Puritanismus ungeeignet sein. Die Banalität eines<br />
langsamen Sterbens, das letzte zärtliche Aufflackern<br />
einer alten Liebe, das Lächerliche und Erbärmliche<br />
des Todes hingegen entfalten ihre atemberaubende<br />
Wucht in der rigorosen Konzentration dieses Films<br />
auf grandiose Weise. Es sind die porösen, die tragischen<br />
Seiten des Lebens, die sich vielleicht erst unter<br />
den Laborbedingungen des Autorenkinos mit aller<br />
Unerbittlichkeit erfahren lassen.<br />
Der Tod nähert sich behutsam. Und auch der<br />
Film scheint immer wieder fast zum Stillstand zu<br />
kommen, zeigt in langen Tableaus die leeren Räume,<br />
als wäre alles schon vorbei. Zunächst ist aber<br />
nur eine Operation fehlgeschlagen, ein Bein und<br />
ein Arm bleiben gelähmt. Jean-Louis Trin ti gnant<br />
läuft in Turnschuhen, leicht humpelnd wie ein verletzter<br />
Krieger hinter dem Rollstuhl seiner Frau her<br />
und sieht dem Unvermeidlichen mit einer umwerfend<br />
stoischen Ratlosigkeit ins Gesicht. Ein Krankenbett,<br />
eine neue Matratze werden geliefert und<br />
eine Filmewigkeit lang ausgepackt. Im großen Entrée<br />
werden Gehübungen abgehalten. Das alte<br />
Paar, eng umschlungen bei seinem letzten Tango<br />
in Paris. Ein Mann, eine Frau, eine Wohnung in<br />
Paris, eine ausweglose Liebe, zum Tod verurteilt,<br />
sternenweit vom Alltagsleben entfernt, das hinter<br />
den geschlossenen Fenstern unbemerkt weitergeht.<br />
Immer wieder denkt man an den alten Filmklassiker<br />
von Bernardo Bertolucci. Aber nicht die nackte<br />
Lust, sondern die nackte Anstrengung des Überlebens<br />
zeigt sich auf den geröteten Wangen der greisen<br />
Liebenden. Und wenn er ihr das Höschen herunterzieht,<br />
dann eben nicht, um sie zu besitzen,<br />
sondern um sie auf die Toilette zu setzen.<br />
Darin ist auch nicht das kleinste Gran von sanfter<br />
Seniorenerotik, wie das Mainstreamkino sie für<br />
den wachsenden, an einem gepflegten Altershedonismus<br />
interessierten Markt hervorbringt. Georges<br />
und Anne, wie die beiden Alten heißen, behandeln<br />
sich mit ausgesuchter altfranzösischer Oberklassenförmlichkeit.<br />
Im Bett liest er ihr aus Le Monde vor.<br />
Bei Tisch fragt er, ob er ihr noch ein Glas Wein anbieten<br />
dürfe. Die Art und Weise, wie Anne ihre<br />
Sätze mit einem spitzen »S’il te plaît« beschließt, lässt<br />
keine Missverständnisse darüber aufkommen, dass<br />
es sich beim Leben um harte Präzisionsarbeit und<br />
nicht etwa um Vergnügen handelt. Man wundert<br />
sich, dass die beiden sich nicht siezen, wie Simone<br />
de Beauvoir und Jean-Paul Sartre das gemacht haben.<br />
Zärtlichkeiten entstehen in flüchtigen Augenblicken,<br />
mitten in der ehelichen Tischkonversation,<br />
bei einem kurzen Händedruck, beim Betrachten<br />
alter Fotografien. Auch später noch auf dem Sterbebett,<br />
beim Füttern, beim nur Dasitzen. Liebe ist<br />
eher das, was man nicht sieht.<br />
Einmal verlässt Georges die Wohnung, um am<br />
Begräbnis eines Freundes teilzunehmen. Als er zurückkommt,<br />
liegt Anne am Boden unter dem geöffneten<br />
Fenster im Vestibül. Vielleicht wollte sie sich<br />
hinausstürzen. Er führt sie in den Salon, erzählt von<br />
dem Begräbnis, der kleinen Urne auf der viel zu<br />
großen Bahre, dem erbärmlichen Kassettenrekorder,<br />
auf dem jemand Yesterday von den Beatles abspielte,<br />
und so weiter. Anne sieht ihm hart ins Gesicht und<br />
sagt: »Es gibt keinen Grund weiterzuleben.« Von da<br />
an läuft das Räderwerk einer griechischen Zimmertragödie<br />
unerbittlich auf das unabwendbare Ende zu.<br />
Nein, es gibt doch keinen<br />
Trost mehr in der Kunst<br />
Bevor Anne durch einen zweiten, diskret ausgesparten<br />
Anfall gänzlich gelähmt und unfähig zu sprechen<br />
wird, kommt ihr ehemaliger Klavierschüler noch<br />
einmal zu Besuch, in dessen Konzert wir sie in den<br />
letzten Augenblicken ihres unversehrten Lebens gesehen<br />
haben. Das Gespräch ist ausgesprochen dünnlippig.<br />
Nach der Lähmung gefragt, antwortet Anne:<br />
»Das passiert mit dem Alter.«<br />
Mit solchen sehr französischen Konversationsbruchstücken<br />
redet man sich durch den ganzen Film.<br />
»Das Leben ist schön. Das lange Leben«, sagt Anne<br />
beim Betrachten alter Fotografien. »Ich habe Pfirsichsaft<br />
dazugegeben«, sagt Georges, um der Sterbenden<br />
seinen Brei anzupreisen. »Wir sind nicht die Einzigen,<br />
die auf die Idee kommen, Immobilien zu kaufen«,<br />
sagt die Tochter, um die kranke Mutter zu unterhalten.<br />
So redet man, wenn man zeigen will, dass Worte<br />
nichts mehr ausrichten können. Manchmal beendet<br />
die Musik die Spachfloskelverfertigung. Man spielt<br />
Beethoven oder Bach. Einmal verliert sich die Kamera<br />
in den romantischen Landschaftsbildern, die an<br />
den Wänden hängen, als wäre die Kunst das Einzige,<br />
das hier noch mithalten kann. Doch als Annes ehemaliger<br />
Klavierschüler seine CD-Aufnahme der Impromptus<br />
von Schubert schickt, bittet sie Georges<br />
nach ein paar Takten, die Musik abzustellen. Nein,<br />
es gibt doch keinen Trost mehr in der Kunst. Oder<br />
Anne (Emmanuelle Riva)<br />
und Georges (Jean-Louis<br />
Trintignant) in »Liebe«<br />
nur ein Mal. Aber da singt Jean-Louis Trintignant<br />
mit der nur noch mühsam lallenden Emmanuelle<br />
Riva das Kinderlied Sur le pont d’Avignon, und für<br />
einen Augenblick könnte man glauben, dass die<br />
beiden nie etwas Schöneres gemeinsam erlebt haben.<br />
Wunderbar ist, wie viel Geduld der Film für<br />
seine Darsteller und seine Zuschauer aufbringt, sich<br />
Schritt für Schritt von der Hoffnungslosigkeit selbst<br />
zu überzeugen. Immer wieder wirbelt die aufgebrachte<br />
Tochter herein, die Isabelle Huppert mit<br />
einer ganz erstaunlich kraftvollen Schnauze und<br />
hinreißender verzweifelter Nervosität gibt. Ihr leerlaufendes<br />
Man-muss-doch-etwas-tun-Gerede, das<br />
sie von draußen aus dem technischen Zeitalter mitbringt,<br />
prallt ab an der stillen Klarsicht ihres Vaters,<br />
der sich wie ein alter Grieche in das Schicksal fügt.<br />
»Das Alter ist ein Massaker«, heißt es in Philip Roths<br />
erbarmungslosem Altersroman Jedermann. Ein ewiges<br />
Warten auf nichts sei das Altwerden, ein sinnloser<br />
Verfall, auf den ein noch sinnloserer Tod folgt. Haneke<br />
dementiert das nicht. Aber er zeigt, dass die einzige<br />
Würde, die einem dabei bleibt, die illusionslose<br />
Nüchternheit ist. Er habe, hat er in Bezug auf sein<br />
großes Vorbild Robert Bresson einmal gesagt, es<br />
immer als obszön empfunden, einem mit darstellerischem<br />
Furor gestalteten Leiden und Sterben zuzusehen.<br />
Denn es bestiehlt die tatsächlich Leidenden und<br />
Sterbenden um ihr letztes Gut: die Wahrheit.<br />
Und wenn dann die Zeit gekommen ist und Georges,<br />
der Anne gerade noch mit einer alten Kindergeschichte<br />
in den Schlaf gesprochen hat, seine Frau in einem<br />
letzten endgültigen Liebesakt fest an sich drückt – ist<br />
man nicht nur einverstanden, sondern hat einen der<br />
ganz großen Augenblicke der Kinogeschichte erlebt.<br />
A www.zeit.de/audio<br />
Sehenswert<br />
Was bleibt von Hans-Christian Schmidt<br />
Herr Wichmann aus der dritten Reihe<br />
von Andreas Dresen<br />
Roman Polanski: A Film Memoir<br />
von Laurent Bouserau<br />
Guilty of Romance von Sion Sono<br />
Cosmopolis von David Cronenberg
FEUILLETON<br />
LITERATUR<br />
Keiner wäscht reiner<br />
Ulf Erdmann Zieglers Roman erkundet die weißen Geheimnisse der deutschen Vergangenheit VON HUBERT WINKELS<br />
W<br />
»heilige« Johanna, zur Erstkommunion gehen.<br />
Lore trennt sich von ihrem Petrus und bleibt<br />
mit dem Geistlichen Valentin zusammen.<br />
Kennengelernt haben sich Lore und der<br />
Kaplan, weil Marleen dem Kommunionunterricht<br />
fernblieb. Sie sah keine Chance, »Mini«<br />
zu werden, also Ministrantin, eben wegen der<br />
»Unreinheit« der Mädchen. Dafür wurden<br />
Marleen und ihre Schwestern dann die ersten<br />
Testerinnen der neuen o.b.-Tampons, bevor<br />
eben auf dem Hintergrund von etwas. Dies<br />
eben meint der Titel: Es gibt nichts Weißes,<br />
ohne dass es sich von einer farbigen Umgebung<br />
abheben würde, sei es einer Linie, einem<br />
Fond, einem Schatten. Die bildende Kunst<br />
hat sich im 20. Jahrhundert mit Malewitsch<br />
und den amerikanischen Farbfeldmalern in<br />
diese Richtung weit vorgearbeitet, mit dem<br />
Weißen und dem Schwarzen Quadrat als quasimetaphysischen<br />
Schlüsselpositionen. Das<br />
Papa damit die große Werbe- und Aufklärungs- Motiv des »Reinweißen« bildet auch einen<br />
Ulf Erdmann<br />
Ziegler:<br />
Nichts Weißes<br />
Roman;<br />
Suhrkamp<br />
Verlag, Berlin<br />
259 S., 16,99 €<br />
äre der Tampon, wäre o.b.<br />
schon erfunden gewesen,<br />
hätten Mädchen dann<br />
schon früher in der katholischen<br />
Messe den Ministrantendienst<br />
versehen dürfen,<br />
gäbe es gar weibliche Geistliche,<br />
Zelebrantinnen der Verwandlung<br />
von Wein in Blut?<br />
Dürften sie o.b.-bewehrt das<br />
Blut opfer feiern, weil sie selbst<br />
nicht mehr bluteten, jedenfalls nicht sicht-<br />
und riechbar?<br />
Das ist eine der großen Fragen, die Ulf<br />
Erdmann Zieglers Roman aufwirft. o.b. und<br />
Eucharistie, Menstruationsblut und Blut der<br />
Wandlung, Kommunionkinder und Charles<br />
Wilps Afri-Cola-Nonnen hinter beschlagenen<br />
Glasscheiben, Sex im Aschram und der<br />
heilige Yogi, Letraset-Buchstaben und die<br />
Heilige Schrift, Katechismus und Werbetexte<br />
im Düsseldorf der siebziger, achtziger Jahre:<br />
Das sind Kon fron ta tio nen, mit denen<br />
Ziegler spielt. Dabei geht es ihm durchaus<br />
um den inneren Zusammenhang zwischen<br />
der modernen Gesellschaft und den spirituellen<br />
Sinnwelten.<br />
Ein Architekt, ein Designer, ein Typograf<br />
organisieren Räume und Zeichen, die Bedeutung<br />
tragen, ohne dass man sie bemerken<br />
muss. Das war schon in Zieglers erstem Roman<br />
Hamburger Hochbahn ein Thema. Im<br />
neuen Roman geht es um Schrifttypen und<br />
Typografie und ihre Anwendung in der<br />
Werbe indus trie. Die puristische Moderne<br />
und die Überlieferung des Abendlandes sind<br />
das Spannungsfeld des Buches. Und es ist<br />
von Anfang an klar, dass dieses Verhältnis<br />
sich in Übergängen, Spiegelungen, Konversionen,<br />
Übersetzungen und geheimen Identitäten<br />
ausdrückt, nicht in Gegensätzen und<br />
Ausschlüssen.<br />
Ebenso klar ist, dass Nichts Weißes dem<br />
rätselhaften Titel zum Trotz kein intellektueller<br />
Essay ist, sondern ein Roman mit richtigen<br />
Figuren und vielen Geschichten, die von<br />
der Beinahe-Gegenwart bis in die unmittelbare<br />
Nachkriegszeit und manchmal darüber<br />
hinaus zurückreichen: ein Familien-, Gesellschafts-,<br />
Entwicklungsroman, wie geschaffen<br />
für den Deutschen Buchpreis, auf dessen<br />
Shortlist er inzwischen steht. Zeitgeschichte<br />
spiegelt sich in Familien- und individuellen<br />
Schicksalsgeschichten.<br />
Und das sieht in etwa so aus: Marleen, zentrale<br />
Figur des Romans, ist die Tochter eines<br />
erfolgreichen Werbers und einer Gebrauchsgrafik<br />
produzierenden Mutter. Die fünfköpfige<br />
Familie zieht von Düsseldorf in einen modernistischen<br />
Vorort von Neuss namens Pomona,<br />
im späten Bauhausverhunzungsstil gebaut, und<br />
ist dort durchaus nicht glücklich. Was unter<br />
anderem mit den weltlich-geistlichen Konversionen<br />
zu tun hat, die fast alle Familienmitglieder<br />
erfassen: Der flotte Vater namens Petrus,<br />
der ebenjene »Ohne Binde«-Hygienekampagne<br />
gestartet hat und damit die Frauenrolle, das<br />
Freiheitsgefühl, die intime Verfassung der Republik<br />
verändert hat, dieser Petrus wird von<br />
einem Sinnhunger befallen, der ihn vom ruhelosen<br />
Dasein als Jet set-Geschäftsmann zwischen<br />
New York, Hongkong und Delhi nach Poona<br />
führt, wo er Anhänger des heiligen Rolls-<br />
Royce-Fahrers Shree Rajneesh wird, sprich ein<br />
Sannyasi. Mutter Lore verguckt sich ihrerseits<br />
in einen katholischen Kaplan der Kirchengemeinde,<br />
in der die Töchter, namentlich die<br />
Die ersten Tampons haben nicht nur die innere<br />
Verfassung der Republik verändert.<br />
Sie warfen auch schwerwiegende religiöse Fragen auf<br />
kampagne aufzog. Der sexuell-säkularisationsgeschichtliche<br />
Untergrund des Romans wird<br />
bald überdeutlich. Marleens erste große Liebe<br />
Franziskus verlässt sie, nachdem er ihr ein Kind<br />
gemacht hat, um in einen katholischen Orden<br />
einzutreten. Johanna liegt weinend vor dem<br />
Bild des nackten zwölfjährigen o.b. bewerbenden<br />
Illustrierten-Mädchens, den Katechismus<br />
neben sich, aus dem der tröstende Papa Petrus<br />
ihr vorliest. Am selben Abend liegen die Eheleute<br />
im Bett und überlegen, ob Johanna wohl<br />
eifersüchtig sei, auf die o.b.-Kampagne, auf<br />
Papa Petrus, auf den Papst, und dabei lässt Lore<br />
»ihre Hand in seine seidene Pyjamahose gleiten«<br />
und flüstert: »Ihr werdet ein Fleisch sein.«<br />
Untergrund, Hintergrund, Figur<br />
und Grund: Nach diesem Muster<br />
entwickelt sich noch ein<br />
anderes, eher erkenntnistheoretisches<br />
Problem im Roman, eigentlich<br />
das reizvollere, das sich daraus ergibt,<br />
dass wir etwas immer nur in Abgrenzung zu<br />
etwas anderem wahrnehmen können oder<br />
schönen bildlichen Anschluss an die Kinderkommunion,<br />
die Unbeflecktheit Mariens,<br />
die o.b.-Trägerinnen, die weißen Pomonavillen<br />
und was da sonst alles weiß durch den<br />
Roman gespenstert.<br />
Seltsamerweise hat sich Ziegler in seinem<br />
Neuss-Düsseldorf-Buch den Weißheitsfuror<br />
der Persil-Werbung des dortigen Henkel-Konzerns<br />
entgehen lassen, der metaphorisch überdeutlich<br />
den Sauberkeits- und Weißheitswahn<br />
der deutschen Nachkriegsgesellschaft verkörpert<br />
– alles wurde blütenweiß gewaschen und<br />
von der historischen Schuld des Nationalsozialismus<br />
von Grund auf gereinigt. Nur in einem<br />
Interview von Petrus kommt das vor, wenn er,<br />
selbst Werbeguru geworden, einer Illustrierten<br />
erläutert, dass er die Nazibeschriftung durch<br />
die Napola, der er als Kind ausgesetzt war,<br />
überwinden musste.<br />
Man muss an dieser Stelle auf einen zu<br />
Unrecht halb vergessenen Roman von Dieter<br />
Forte, Auf der anderen Seite der Welt, hinweisen,<br />
der von der Düsseldorfer Werbeszene ab den<br />
fünfziger Jahren handelt, im starken Zusam-<br />
menhang mit der Kunstakademie und dem<br />
Henkel-Konzern. Die Geschichte der Bundesrepublik<br />
und ihrer zunehmenden Einbindung<br />
in die westliche Konsumwelt über Werbung,<br />
Grafik und Kampagnen zu erzählen wäre überhaupt<br />
von höchstem Reiz.<br />
Ulf Erdmann Zieglers Roman leistet durchaus<br />
einen gewissen Beitrag dazu, obwohl er<br />
mehr an der Metaphysik des Buchstabens und<br />
anderen intellektuellen Kostbarkeiten interessiert<br />
ist. Die gute Romankonstruktion leidet<br />
unter dieser Fracht. Jede Episode, jede Bemerkung<br />
wird im Zieglerschen Idealfall dreimal<br />
codiert. Alles spielt auf vielen Ebenen gleichzeitig.<br />
Der Roman ist von einem überfordernden,<br />
leicht snobistischen Ästhetizismus geprägt.<br />
Man sieht die Mittel, erkennt die Technik,<br />
bewundert des Autors Fingerfertigkeit, doch<br />
ebendies, das Demonstrative, die modernistische<br />
Angeberei, ärgert ein wenig.<br />
Diese Sichtbarkeit des Könnens<br />
steht in Spannung zur Arbeit<br />
Marleens. Sie möchte eine<br />
Schrift entwickeln, die »alle<br />
Vorzüge aller existierenden<br />
Schriften hat und alle Nachteile Buchstabe<br />
für Buchstabe überwindet«. Herauskommen<br />
soll dabei eine Schrift, »die man gar nicht<br />
bemerkt«. Diese Idee von einem beinahe<br />
unsichtbaren, aber dennoch bedeutungstragenden<br />
Zeichen zieht sich durch das gesamte<br />
Buch – und ist zugleich eine euphorisierende<br />
Chiffre in der modernen Kunst. Marleen<br />
trifft auf ihrer Suche nach dieser geheimnisvollen<br />
Schrift einen Schweizer<br />
Schriftentwickler in Paris, der eine solche<br />
Schrift type schon erfunden hat. Nicht zufällig<br />
heißt sie Tempi Novi. Ihr Erfinder<br />
wird mit dieser eigenschaftslosen modernen<br />
Schrift zum »Gott der Gottlosigkeit« und<br />
Marleen eine »Ketzerin, die nun gezwungen<br />
wäre anzuerkennen, dass den Kult der Gottlosigkeit<br />
zu begründen nicht mehr möglich<br />
wäre«. Unter dieser Großmetaphorik tut es<br />
der Roman an keiner Stelle.<br />
Trotzdem kommt er gut in der Welt herum.<br />
Zur Ausbildung Marleens geht es nach Nördlingen<br />
in eine Druckerei, die der Anderen Bibliothek<br />
von Franz Greno zum Verwechseln ähnelt,<br />
dann nach Kassel zum Studium, nach Paris in<br />
eine Agentur und schließlich in die USA, wo<br />
nach der Blei- und der Lichtsatz-Phase jetzt die<br />
digitalen Schriften entwickelt werden. In den<br />
späten Achtzigern, als Marleen bei IOM arbeitet,<br />
einem IBM nachempfundenen Unternehmen,<br />
endet der Roman, der mit ihrem Weg<br />
in die USA begonnen hat. Unterwegs haben wir<br />
viel gelernt über die Lebendigkeit der Schrift,<br />
die ja eine paulinische ist, eine lutherische und<br />
eine typografische.<br />
Die Eigenschaftslosigkeit ist dabei ein Ideal,<br />
das Ziegler nicht nur beschwört, sondern auch<br />
inszeniert. Was seine Romanheldin Marleen<br />
angeht, gelingt ihm das vorzüglich. Für den<br />
Roman selbst gilt das allerdings nicht. Er ist in<br />
seiner Form und mit seinen Zeitsprüngen als<br />
Kunstwerk jederzeit gut sichtbar. Er lenkt die<br />
Leseaufmerksamkeit hochgradig auf sein Gemacht-,<br />
sein Gekonntsein. Ein Jota zu viel für<br />
ein ästhetisches Programm der Weißwäsche, der<br />
Dezenz, der Diskretion und des Sich-unsichtbar-Machens.<br />
Als hygienisches Vorzeigestück<br />
blutet und riecht das Buch zwar nicht, doch dass<br />
es voll von Bedeutung und sinnschwanger wie<br />
die trächtige Muttergottes ist, das will es uns<br />
allzu deutlich sagen.<br />
Fotos [M]: Johnson & Johnson (l.); www.launer.com<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 47<br />
GEDICHT: RICHARD BRAUTIGAN<br />
(1935–1984)<br />
Liebesgedicht<br />
Es ist so schön,<br />
morgens ganz allein<br />
aufzuwachen<br />
und keinem sagen zu müssen,<br />
dass man ihn liebt,<br />
wenn man ihn nicht mehr<br />
liebt.<br />
Richard Brautigan: Ausgewählte Texte<br />
Aus dem Englischen von Günter Ohnemus u. a.;<br />
Hoffmann und Campe, Hamburg <strong>2012</strong>;<br />
128 S., 12,– €<br />
WIR RATEN ZU UND AB<br />
Buch zur Tasche<br />
Von allen Gegenständen, die mit Kin deraugen<br />
beschaut werden, ist die Handtasche<br />
der märchenhafteste. Klein und handlich<br />
schwankt sie am Arm der Mutter, und es<br />
entspringen ihr im Laufe eines nachmittäglichen<br />
Spaziergangs eine Flut an Gerätschaften,<br />
die unmöglich allesamt in ihr Platz finden<br />
können: Taschentücher und ein Notizblock,<br />
ein Lippenstift und die dicke Geldbörse,<br />
Fisherman’s Friend und Obst, heute<br />
vermutlich auch ein Smart phone samt Kabelsalat.<br />
Ein Durch ein an der muss in so einer<br />
Handtasche ja herrschen, doch findet<br />
die Hand sofort immer das, was sie sucht.<br />
Es ahnt schon der heranwachsende Junge,<br />
dass darin auch Diskretes Platz findet. Aber<br />
niemals würde er die Tasche heimlich öffnen.<br />
Er ahnt, dass ihn nichts stärker an die<br />
Mutter bindet als das Ungezeigte. Und<br />
nichts fürchtet er natürlich mehr als das Erwachsenwerden.<br />
Jetzt, endlich, hat Jean-<br />
Claude Kaufmann das Buch zur Handtasche<br />
geschrieben. ADAM SOBOCZYNSKI<br />
Völlig unnötig<br />
Der Soziologe Jean-Claude Kaufmann hat<br />
ein Frauenbuch geschrieben. Über Handtaschen<br />
– rosa Cover mit roter Lacktasche aus<br />
den Neunzigern. Wer braucht das? Frauen<br />
wissen um ihr in der Tasche lebendes erweitertes<br />
Ich, sie müssen dazu nichts lesen – es<br />
sei denn, sie tragen rote Lacktaschen aus<br />
den Neunzigern, dann herrscht Nachholbedarf.<br />
Kaufmann gelingt es nicht, über Stereotype<br />
hinauszukommen. Dass Frauen mit<br />
Papier in der Tasche (zum Lesen oder<br />
Schreiben) eher intellektuell sind und Frauen<br />
mit vielen Kunden- und Kreditkarten<br />
eher shoppingsüchtig, hätte man vermuten<br />
können. Als es auf Seite 120 interessant zu<br />
werden droht, rät der Autor: »Die Leser,<br />
denen dies zu komplex ist, können problemlos<br />
die folgenden Seiten überspringen.«<br />
Ernsthaft? NIKOLA HELMREICH<br />
Jean-Cl. Kaufmann:<br />
Privatsache Handtasche<br />
UVK Verlagsgesellschaft <strong>2012</strong>; 198 S., 19,99 €
48 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> FEUILLETON<br />
LITERATUR<br />
Erinnerung, sprich<br />
Käthe Sasso bewegt mit ihren<br />
Erlebnissen aus Widerstand und KZ<br />
Die beiden 19-jährigen Mädchen erreichten im<br />
Mai 1945 Wien, kurz nach Kriegs ende. Ihnen<br />
war zuvor die Flucht vor der SS gelungen, auf<br />
dem Todesmarsch vom KZ Ravensbrück zum<br />
KZ Bergen-Belsen. Erschöpft setzten sie sich nun<br />
in die Straßenbahn. »Das werd ich nie vergessen<br />
im Leben. Die Schaffnerin ist gekommen, wir<br />
haben gesagt, dass wir aus dem KZ kommen und<br />
uns keine Fahrscheine kaufen können. Die ganze<br />
Tramway war voller Leute, niemand hat ein Ohrwaschl<br />
gerührt. Die Schaffnerin hat die Straßenbahn<br />
angehalten und uns gezwungen, auszusteigen.<br />
Das war die Begrüßung in der Heimat.« Mit<br />
ruhiger Stimme trägt die 86-jährige Käthe Sasso<br />
ihre Geschichte vor, genau, präzise, lebendig, in<br />
charmant weichem wienerischem Singsang, über<br />
»die Zeit, an die ich mich noch erinnern kann«.<br />
Mit diesen Worten beginnt das eindrucksvolle<br />
Hörbuch Nicht nur in Worten, auch in der Tat:<br />
Die alte Dame erzählt Kindheit und Jugend in<br />
Österreich – vom Widerstand gegen Hitler, von<br />
Verhaftung und Zelle, Prozess und schließlich<br />
KZ. Längst ist ja die Zeit des Nationalsozialismus<br />
zur fernen Geschichte geworden; zur »Epoche<br />
der Mitlebenden«, so einst die klassische De fi nition<br />
für unmittelbar vergangene Zeitgeschichte<br />
durch den Historiker Hans Rothfels, gehört er in<br />
Kürze nicht mehr. Offizielle Erinnerungskultur<br />
und wissenschaftliche oder künstlerische Verarbeitung<br />
ersetzen die Erfahrung. Umso bemerkenswerter<br />
ist dieses Dokument direkter Zeitzeugenschaft,<br />
das so anders funktioniert als jene Erinnerungsfetzen,<br />
die in Fernsehdokumentationen<br />
die älteren Damen und Herren<br />
routiniert von sich geben.<br />
Käthe Sasso führt uns Nachgeborene<br />
heran, tief hinein in<br />
die Finsternis – drei spannungsvolle<br />
Stunden lang,<br />
ohne Pause. Einmal mehr hat<br />
das kleine, nicht genug zu<br />
Nicht nur in<br />
Worten, auch in<br />
der Tat. Käthe<br />
Sasso erzählt<br />
ihre Jugend im<br />
Widerstand<br />
supposé, Berlin<br />
<strong>2012</strong>; 3 CDs, 183<br />
Min., 29,80 €<br />
HÖRBUCH<br />
preisende Label supposé von<br />
Klaus Sander damit ein Hörbuch<br />
produziert, das die Kraft<br />
der konzentrierten mündlichen<br />
Erzählung zeigt.<br />
Idyllisch sind die Kindertage<br />
im Dorf, mit blühenden<br />
Wiesen und der liebevollen<br />
Großmutter Majka – später<br />
im Wien der dreißiger Jahre<br />
erlebt Käthe die politischen<br />
Unruhen mit ihren in der Arbeiterbewegung<br />
engagierten Eltern bis zum »Anschluss« 1938.<br />
Danach brüllt ihre vergötterte Lehrerin: »Jüdische<br />
Fratzen haben in unserer Klasse keinen<br />
Platz!«, nachdem Käthe nach ihren verschwundenen<br />
jüdischen Mitschülerinnen fragte. Die<br />
Mutter stirbt 1941, der Vater muss zur Wehrmacht<br />
– die 15-Jährige engagiert sich in der<br />
Widerstandsgruppe »Gustav Adolf Neustadl«,<br />
hilft Angehörigen von Hingerichteten und verteilt<br />
Flugblätter, bis zur Verhaftung 1942. Als<br />
Minderjährige entgeht sie der Todesstrafe, die<br />
anderen werden hingerichtet. »I bin a Köpfler«,<br />
sagt eine Freundin, die weiß, dass sie dem Tod<br />
entgegengeht. Ein Polizist erklärt ihr heimlich,<br />
wie man das Alphabet klopft, um mit Häftlingen<br />
in der Nebenzelle zu kommunizieren; ein<br />
Abschiedsgedicht der Todgeweihten erreicht sie<br />
auf einem Zettel. Käthe Sasso kommt 18-jährig<br />
ins Frauen-KZ Ravensbrück. Präzise schildert<br />
sie den Lageralltag zwischen Terror und Solidarität.<br />
So erlebt sie zweihundert ungarische Kinder<br />
aus Auschwitz, die zu Weihnachten Bonbons<br />
kriegen, bevor sie alsbald vergast werden.<br />
Gebannt hört man vom unglaublichen Entkommen<br />
der Erzählerin aus den SS-Fängen. Ihr<br />
Wienerisch nimmt dem Bericht nichts von seiner<br />
erschütternden Wirkung, sondern erzeugt<br />
eine authentische Intensität: Lange hallt Käthe<br />
Sassos Stimme nach. ALEXANDER CAMMANN<br />
Gründungsverleger 1946–1995:<br />
Gerd Bucerius †<br />
Herausgeber:<br />
Dr. Marion Gräfin Dönhoff (1909–2002)<br />
Helmut Schmidt<br />
Dr. Josef Joffe<br />
Chefredakteur:<br />
Giovanni di Lorenzo<br />
Stellvertretende Chefredakteure:<br />
Moritz Müller-Wirth<br />
Bernd Ulrich<br />
Chef vom Dienst:<br />
Iris Mainka (verantwortlich), Mark Spörrle<br />
Textchefin: Anna von Münchhausen (Leserbriefe)<br />
Internationaler Korrespondent: Matthias Naß<br />
Titelgeschichten: Hanns-Bruno Kammertöns (Koordination)<br />
Redakteur für besondere Aufgaben: Patrik Schwarz<br />
Politik: Bernd Ulrich (verantwortlich),<br />
Dr. Jochen Bittner, Andrea Böhm, Alice Bota, Frank<br />
Drieschner, Anna Kemper, Ulrich Ladurner, Khuê Pham,<br />
Jan Roß (Außen politik), Özlem Topçu, Dr. Heinrich Wefing<br />
Dossier: Sabine Rückert/Dr. Stefan Willeke (verantwortlich),<br />
Anita Blasberg, Roland Kirbach, Tanja Stelzer,<br />
Henning Sußebach<br />
Wochenschau: Ulrich Stock (verantwortlich)<br />
Geschichte: Benedikt Erenz (verantwortlich), Christian Staas<br />
Wirtschaft: Dr. Uwe J. Heuser (verantwortlich),<br />
Thomas Fischermann (Koordination Weltwirtschaft),<br />
Götz Hamann (Koordination Unternehmen), Kerstin Bund,<br />
Marie- Luise Hauch-Fleck, Rüdiger Jungbluth,<br />
Dietmar H. Lamparter, Gunhild Lütge, Marcus Rohwetter,<br />
Dr. Kolja Rudzio, Christian Tenbrock<br />
Wissen: Andreas Sentker (verantwortlich),<br />
Dr. Harro Albrecht, Dr. Ulrich Bahnsen, Christoph Drösser<br />
(Computer), Inge Kutter, Stefan Schmitt,<br />
Ulrich Schnabel, Dr. Hans Schuh-Tschan (Wissenschaft),<br />
Martin Spiewak, Urs Willmann<br />
Reich ohne Mitte<br />
Der Hamburger Sinologe Kai Vogelsang legt eine fulminante Geschichte Chinas vor VON MATTHIAS NASS<br />
Chinas 5000-jährige Geschichte – es<br />
schreibt sich so leicht dahin. Die<br />
Floskel geht zumeist einher mit einer<br />
Verbeugung vor der Kontinuität<br />
einer unvergleichlichen Kultur, die<br />
aus der Frühzeit bis in die Gegenwart reicht und<br />
die gerade eine neue, verblüffende Vitalität entfaltet.<br />
Beispiellos!<br />
Nichts daran ist falsch, gewiss nicht die Bewunderung<br />
für die Leistungen der jahrtausendealten<br />
chinesischen Kultur. Falsch ist allein die<br />
Floskel selber, das schnell dahingesagte oder -geschriebene<br />
Wort. Denn sie blendet allzu leicht<br />
das Komplexe und Ambivalente aus. Nun sind es<br />
aber gerade die Brüche, die Abstürze und Neuanfänge,<br />
die den Reichtum der Geschichte ausmachen.<br />
Eine Geschichtsschreibung, die Diskontinuitäten<br />
negiert, wird zur Ideologie. In diesem<br />
Fall heißt das: Es gibt das »ewige China« nicht,<br />
hat es nie gegeben.<br />
Dies ist die Arbeitshypothese, mit der sich der<br />
Hamburger Sinologe Kai Vogelsang ans Werk gemacht<br />
hat. In seiner fulminanten Geschichte Chinas<br />
legt er sich mit der traditionellen chinesischen Historiografie<br />
ebenso an wie mit der klassischen Sinologie<br />
des Westens. Sein donnerndes Verdikt: »›China‹<br />
und die ›Chinesen‹ sind Geschöpfe der Geschichtsschreibung.«<br />
China und die Chinesen in<br />
Anführungszeichen, das fängt ja gut an!<br />
Auf den folgenden mehr als 600 Seiten fehlen<br />
die Anführungszeichen dann meist wieder, und das<br />
ist auch richtig so. Denn natürlich gibt es eine chinesische<br />
Geschichte, was auch Vogelsang keineswegs<br />
bestreitet. Wogegen er sich wendet, ist die »ahistorische<br />
Perspektive« einer Kontinuität der chinesischen<br />
Kultur, ist das »Dogma« von der Einheit des Landes,<br />
ist die »Fiktion« einer rechtmäßigen Linie in der<br />
Abfolge der Dynastien inklusive Weitergabe eines<br />
dubiosen »Mandats des Himmels«.<br />
Oder, wie er den Anspruch seiner Arbeit formuliert:<br />
»Diese Geschichte Chinas geht davon aus, dass<br />
Wenn Männer eine Seilschaft bilden<br />
Der Diplomat Stefan aus dem Siepen hat eine Romanparabel über das ewige Mitläufertum geschrieben VON GABRIELE VON ARNIM<br />
Stefan aus dem Siepen, 1964 in Essen<br />
geboren, Jurist und Diplomat im Auswärtigen<br />
Amt, ist dabei, sich als ein<br />
eigensinniger Schriftsteller zu eta blieren,<br />
der seine Stoffe im Urgrund des<br />
Menschseins aufspürt. Mal geht es ihm um bizarre<br />
Einzelgänger, die am Rande der Normalität balancieren<br />
und konventionelle Gesellschaften mit<br />
ihrem Anderssein überfordern, dann um Gruppen,<br />
die existenziellen Gefährdungen nicht standhalten.<br />
Und da er ein Faible hat für Parabeln, ist<br />
in seinem neuen Roman die Herausforderung ein<br />
Seil, ein sehr langes Seil.<br />
In einem Dorf im Wald, fernab von irgendeiner<br />
Welt, ein paar Tagesmärsche entfernt vom nächsten<br />
Weiler, leben in einer Zeit, die schon sehr lange her<br />
sein muss, vielleicht ein Dutzend Bauern oder auch<br />
mehr mit ihren Frauen und Kindern und Alten. Sie<br />
führen ein friedliches Dasein – arbeitsam, freundlich,<br />
ereignislos. Bis Bernhardt eines Abends das<br />
Seil entdeckt. Fest geflochten und dick wie ein<br />
Daumen. Ein gutes Seil. So ein Seil hat gewiss<br />
niemand im Dorf. Aber wem kann es dann gehören?<br />
Schon früh am Morgen ist Bernhardt wieder<br />
auf den Beinen, ist auf dem Weg zum Seil. Er folgt<br />
ihm hinein in den Wald und kehrt alsbald ratlos<br />
zurück, weil das Seil kein Ende nimmt.<br />
Nun palavert das Dorf. Endlich gibt es ein Geheimnis,<br />
an dem man herumrätseln kann. Und man<br />
wird es lösen. Die erste Gruppe macht sich auf den<br />
Weg und kommt mit einem Verletzten zurück. Was<br />
Junge Leser: Dr. Susanne Gaschke (verantwortlich),<br />
Katrin Hörnlein<br />
Feuilleton: Jens Jessen/Moritz Müller-Wirth (verantwortlich),<br />
Thomas Ass heuer, Peter Kümmel, Christine Lemke-Matwey,<br />
Ijoma Mangold, Katja Nico de mus, Iris Radisch (Literatur;<br />
verantwortlich), Dr. Hanno Rauterberg, Dr. Adam Sobo czynski<br />
(Koordination), Dr. Elisabeth von Thadden (Politisches Buch)<br />
Kulturreporter: Dr. Susanne Mayer (Sachbuch),<br />
Dr. Christof Siemes<br />
Glauben & Zweifeln: Evelyn Finger (verantwortlich)<br />
Reisen: Dorothée Stöbener (verantwortlich),<br />
Michael Allmaier, Stefanie Flamm, Merten Worthmann<br />
Chancen: Thomas Kerstan (verantwortlich),<br />
Jeannette Otto, Arnfrid Schenk, Jan-Martin Wiarda<br />
Die <strong>ZEIT</strong> der Leser: Dr. Wolfgang Lechner (verantwortlich),<br />
Jutta Hoffritz<br />
<strong>ZEIT</strong>magazin: Christoph Amend (Chefredakteur),<br />
Matthias Kalle (Stellv. Chefredakteur), Christine Meffert<br />
(Textchefin), Jörg Burger, Heike Faller, Ilka Piepgras,<br />
Tillmann Prüfer (Style Director), Elisabeth Raether,<br />
Jürgen von Ruten berg, Matthias Stolz<br />
Art-Direktorin: Katja Kollmann<br />
Gestaltung: Nina Bengtson, Jasmin Müller-Stoy<br />
Fotoredaktion: Milena Carstens (verantwortlich i.V.),<br />
Michael Biedowicz<br />
Redaktion <strong>ZEIT</strong>magazin:<br />
Dorotheenstraße 33, 10117 Berlin,<br />
Tel.: 030/59 00 48-7, Fax: 030/59 00 00 <strong>39</strong>;<br />
E-Mail: zeitmagazin@ zeit.de<br />
Die <strong>ZEIT</strong>-App:<br />
Redaktionsleitung: Dr. Christof Siemes,<br />
Jürgen von Rutenberg (<strong>ZEIT</strong>magazin)<br />
Art-Direktion: Haika Hinze, Katja Kollmann (<strong>ZEIT</strong>magazin)<br />
Betreiber: <strong>ZEIT</strong> Online GmbH<br />
Verantwortlicher Redakteur Reportage:<br />
Wolfgang Ucha tius<br />
Reporter: Wolfgang Bauer, Marian Blasberg,<br />
Dr. Carolin Emcke, Dr. Wolfgang Gehrmann,<br />
Christiane Grefe, Jana Simon, Annabel Wahba<br />
Politischer Korrespondent:<br />
Prof. Dr. h. c. Robert Leicht<br />
Autoren: Dr. Theo Sommer (Editor-at-Large),<br />
Stefan Aust, Dr. Dieter Buhl, Ulrich Greiner,<br />
Bartholomäus Grill, Dr. Thomas Groß, Nina Grunen berg,<br />
Ingeborg Harms, Klaus Harpprecht, Wilfried Herz,<br />
Dr. Gunter Hofmann, Gerhard Jör der,<br />
Dr. Petra Kipphoff, Erwin Koch, Dr. Werner A. Perger,<br />
Roberto Saviano, Chris tian Schmidt- Häuer, Burk hard<br />
Straßmann, Tobias Timm, Dr. Volker Ullrich<br />
Berater der Art-Direktion: Mirko Borsche<br />
Art-Direktion: Haika Hinze (verantwortlich),<br />
Jan Kny (i. V.), Klaus-D. Sieling<br />
Gestaltung: Mirko Bosse, Martin Burgdorff,<br />
Mechthild Fortmann, Sina Giesecke, Katrin Guddat,<br />
Philipp Schultz, Delia Wilms<br />
Infografik: Gisela Breuer, Anne Gerdes<br />
Bildredaktion: Ellen Dietrich (verantwortlich),<br />
Florian Fritzsche, Jutta Schein, Gabriele Vorwerg<br />
Dokumentation: Mirjam Zimmer (verantwortlich),<br />
Davina Domanski, Melanie Moenig,<br />
Dorothee Schöndorf, Dr. Kerstin Wilhelms<br />
Korrektorat: Mechthild Warmbier (verantwortlich)<br />
Hauptstadtredaktion: Marc Brost (Wirtschaftspolitik)/<br />
Matthias Geis (Politik), gemeinsam verantwortlich;<br />
Peter Dausend, Christoph Dieckmann, Jörg Lau,<br />
Mariam Lau, Petra Pinzler, Dr. Thomas E. Schmidt (Kulturkorres<br />
pondent), Dr. Fritz Vorholz<br />
Reporter: Tina Hildebrandt, Elisabeth Niejahr<br />
Wirtschaftspolitischer Korrespondent: Mark Schieritz<br />
Mitarbeit: Dagmar Rosenfeld<br />
Dorotheenstraße 33, 10117 Berlin,<br />
Tel.: 030/59 00 48-0, Fax: 030/59 00 00 40<br />
Investigative Recherche: Stephan Lebert (verantwortlich),<br />
Hans Werner Kilz, Kerstin Kohlenberg, Martin Kotynek,<br />
Yassin Musharbash, Daniel Müller (Autor)<br />
Frankfurter Redaktion: Arne Storn,<br />
Eschersheimer Landstraße 50, 60322 Frankfurt a.M.,<br />
Tel.: 069/24 24 49 62, Fax: 069/24 24 49 63,<br />
E-Mail: arne.storn@zeit.de<br />
Dresdner Redaktion: Stefan Schirmer, Martin Machowecz,<br />
Ostra-Allee 18, 01067 Dresden, Tel.: 0351/48 64 24 05,<br />
E-Mail: stefan.schirmer@zeit.de<br />
Europa-Redaktion: Matthias Krupa, Residence Palace,<br />
Rue de la Loi 155, 1040 Brüssel, Tel.: 0032-2/230 30 82,<br />
Fax: 0032-2/230 64 98, E-Mail: matthias.krupa@zeit.de<br />
Pariser Redaktion: Gero von Randow,<br />
<strong>39</strong>, rue Cambronne, 75015 Paris, Tel.: 0033-972 23 81 95,<br />
E-Mail: gero.von.randow@zeit.de<br />
Kultur in China von Anbeginn nicht durch Einheitlichkeit,<br />
sondern durch Vielfalt geprägt war.«<br />
Weil bekanntermaßen einige der größten Dynastien<br />
ohnehin keine »chinesischen« waren, darunter eine<br />
mongolische (Yuan-Dynastie, 1271 bis 1368) und<br />
eine mandschurische (Qing-Dynastie, 1644 bis<br />
1912). Weil überhaupt die Chinesen von Beginn an<br />
ein buntes Gemisch aus Han-Volk und allen möglichen<br />
»Barbaren« aus den Grenzregionen des Reiches<br />
waren. »Die Wiege der chinesischen Kultur<br />
stand keineswegs nur am Gelben Fluss.«<br />
Mit anderen Worten, hier löckt einer kräftig<br />
wider den Stachel. Herausgekommen ist dabei<br />
ein Werk von staunenswerter Gelehrsamkeit, mit<br />
der sich der noch recht junge Vogelsang (Jahrgang<br />
1969) in die Riege der großen Hamburger<br />
Sinologen einreiht.<br />
Schaut nicht allein auf die großen Namen der<br />
Dynastien, schreibt er, nicht allein auf die Herrscher<br />
und ihre Schlachten, sondern mehr auf die gesellschaftlichen<br />
Bewegungen. Schaut nicht nur auf das<br />
Zentrum, sondern auch auf die einflussreichen<br />
Familien und die Regionalfürsten. Tatsächlich ist<br />
der Kampf zwischen Zentrum und Peripherie bis<br />
heute ein Dauerthema der chinesischen Geschichte.<br />
Und dabei war und ist die Zentralmacht häufig viel<br />
schwächer als gemeinhin angenommen.<br />
Auch Vogelsangs Geschichte Chinas hält sich an<br />
die Abfolge der Dynastien. Aber sie setzt die Zäsuren<br />
anders, gewichtet den sozialen Wandel stärker als<br />
den Aufstieg und den Fall der Herrscherhäuser. So<br />
beginnt für ihn die Neuzeit Chinas mitten in der<br />
Tang-Dynastie (618 bis 907), die Kaiserzeit endet<br />
lange vor der bürgerlichen Revolution und dem<br />
Ende der Qing-Dynastie 1912, nämlich schon im<br />
Jahr 1793. Vogelsang will »fraglose Kontinuitäten<br />
auflösen und zugleich den Blick auf Zusammenhänge<br />
lenken, die durch herkömmliche Unterteilung<br />
allzu leicht verdeckt werden«.<br />
Das gelingt ihm deshalb so gut, weil er zu Beginn<br />
jedes Kapitels prägnant die großen Entwicklungs-<br />
die von der Herausforderung Entzündeten erst<br />
recht antreibt, das Mysterium des Seils ergründen<br />
zu wollen. Und obwohl gerade Erntezeit ist, gehen<br />
jetzt fast alle Männer los, marschieren hinein in den<br />
Wald, dem Seil hinterher – und das Unheil nimmt<br />
seinen Lauf.<br />
Gewiss, man begreift alsbald, dass das Seil für<br />
die tückische Schlange der Versuchung steht, die<br />
den Männern einen vagen, aber einmaligen Triumph<br />
verheißt. Und natürlich verfallen sie dem<br />
sinnlosen Kitzel der Verlockung, folgen dem Seil in<br />
ungestümer Er regung. Bis die Erschöpfung sie<br />
zernagt, die Zerrüttung der Nerven die Moral<br />
zersetzt, bis aus den sittsamen Bauern eine so blindwütige<br />
wie ängstliche Meute geworden ist, die, körperlich<br />
versifft und seelisch zerfetzt, dem blöden<br />
Seil in tumber Beharrlichkeit folgt.<br />
Auch ist kaum überraschend, dass es alsbald<br />
einen Führer gibt, den Lehrer Reck. Ein kleiner<br />
Mann mit zwei großen Doggen und Klumpfuß –<br />
wie sollte man nicht an Goebbels denken bei dieser<br />
Figur –, der kann, was die Bauern nicht können,<br />
nämlich reden: ein eloquenter Beelzebub, der Sehnsüchte<br />
in den Männern zu wecken versteht, von<br />
deren Lebendigkeit in sich sie bisher noch nichts<br />
ahnten, der treuherzig die Flöte bläst und die Horde<br />
vorantreibt. Einmal hält er gar eine Ansprache,<br />
bei der die berühmte Posener Rede von Heinrich<br />
Himmler Pate gestanden haben dürfte.<br />
In Siepens Roman ruft Lehrer Reck nach einem<br />
mörderischen Kampf mit einer Wolfsmeute seinen<br />
Mittelost-Redaktion: Michael Thumann, Posta kutusu 2,<br />
Arnavutköy 34345, Istanbul, E-Mail: michael.thumann@zeit.de<br />
Washingtoner Redaktion: Martin Klingst, 7303 Maple Ave.,<br />
Chevy-Chase, Md. 20815; martin.klingst@zeit.de<br />
New Yorker Redaktion: Heike Buchter, 11, Broadway,<br />
Suite 851, 10004 New York, Tel.: 001-212/ 269 34 38,<br />
E-Mail: hbuchter@newyorkgermanpress.com<br />
Moskauer Redaktion: Johannes Voswinkel,<br />
Srednjaja Perejaslaws ka ja 14, Kw. 19, 129110 Moskau,<br />
Tel.: 007-495/680 03 85, Fax: 007-495/974 17 90<br />
Österreich-Seiten: Joachim Riedl, Alserstraße 26/6a,<br />
A-1090 Wien, Tel.: 0043-664/426 93 79,<br />
E -Mail: joachim.riedl@zeit.de<br />
Schweiz-Seiten: Peer Teuwsen, Kronengasse 10,<br />
CH-5400 Baden, Tel.: 0041-562 104 950,<br />
E-Mail: peer.teuwsen@zeit.de<br />
Weitere Auslandskorrespondenten:<br />
Georg Blume, Neu-Delhi, Tel.: 0091-96-50 80 66 77,<br />
E-Mail: blumegeorg@yahoo.de;<br />
Angela Köckritz, Peking,<br />
E-Mail: angela.koeckritz@zeit.de;<br />
Gisela Dachs, Tel Aviv, Fax: 00972-3/525 03 49;<br />
Dr. John F. Jungclaussen, Lon don,<br />
Tel.: 0044-2073/54 47 00, E-Mail: johnf.jungclaussen @ zeit.de;<br />
Reiner Luyken, Achiltibuie by Ullapool,<br />
Tel.: 0044-7802/50 04 97, E-Mail: reiner.luyken@zeit.de;<br />
Birgit Schönau, Rom, Tel.: 00<strong>39</strong>-3<strong>39</strong>-229 60 79<br />
<strong>ZEIT</strong> Online GmbH:<br />
Chefredaktion: Wolfgang Blau (Chefredakteur), Domenika<br />
Ahlrichs (Stellv. Chef redakteurin), Karsten Polke-Majewski<br />
(Stellv. Chef redakteur), Christoph Dowe (Geschäftsf. Red.),<br />
Fabian Mohr (Entwicklung, Multimedia-Formate, Video);<br />
Textchefin: Meike Dülffer; Chef/-in vom Dienst: Christian<br />
Bangel, Kirsten Haake, Alexander Schwabe; Nachrichten:<br />
Karin Geil, Tilman Steffen, Till Schwarze, Zacharias<br />
Zacharakis; Politik, Meinung, Gesellschaft: Markus Horeld<br />
(Leitung), Lisa Caspari, Ludwig Greven, Carsten Luther,<br />
Steffen Richter, Parvin Sadigh, Michael Schlieben, Katharina<br />
Schuler; Wirtschaft, Karriere, Auto: Marcus Gatzke (Leitung),<br />
Matthias Breitinger, Alexandra Endres, Philip Faigle, Tina Groll;<br />
Kultur, Lebensart, Reisen: Jessica Braun (Leitung), Maria<br />
Exner, David Hugendick, Wenke Husmann, Evelyn Runge,<br />
Carolin Ströbele, Rabea Weihser; Digital, Wissen, Studium:<br />
Dagny Lüdemann (Leitung), Patrick Beuth, Kai Biermann,<br />
Ruben Karschnik, Sven Stock rahm; Sport: Steffen Dobbert<br />
linien des dargestellten Zeitraums umreißt. Jeder<br />
Abschnitt hat zudem eine eigene Zeittafel, die eine<br />
rasche Orientierung erlaubt. Was dem Werk aber<br />
seinen besonderen Reiz gibt, sind die ein- bis zweiseitigen<br />
Begriffserklärungen, die Vogelsang in seinen<br />
Text einstreut. Stichwörter wie »Jade«, »Schrift«,<br />
»Die Große Mauer«, »Tribut«, »Korruption« oder<br />
»Mao-Kult« fügen sich zu einem eigenen kleinen<br />
China-Lexikon. Die vielen eingestreuten literarischen<br />
Zitate, Gedichte, Auszüge aus Geschichtswerken<br />
machen die Lektüre nur noch angenehmer.<br />
Vogelsang zeigt, dass Umbruchzeiten wie das<br />
Zeitalter der »Frühlings- und Herbstannalen«<br />
(722 bis 481 v. Chr.) oder der »Kämpfenden<br />
Staaten« (453 bis 221 v. Chr.) gesellschaftlich<br />
oft die produktivsten Pe rioden<br />
waren. »Gerade die Zeiten politischer<br />
Desintegration waren in der Geschichte<br />
Chinas zugleich Zeiten geistigen Auftriebs<br />
und höchster kultureller Leistungen.«<br />
Wie im Altertum, so auch nach dem<br />
Ende des Kaiserreichs 1912. Gegen die<br />
damals nach der Macht greifenden restaurativen<br />
Kräfte gingen die Studenten im<br />
Namen von Demokratie und Wissenschaft<br />
auf die Straße. Das literarische Leben<br />
blühte auf, in den neu gegründeten Zeitungen<br />
riefen Intellektuelle nach Reformen.<br />
»Wie so oft, wenn China politisch<br />
zerrissen war, erwachten die kulturellen<br />
Kräfte zu umso regerem Leben. Als die<br />
Revolution politisch am Ende war, sollte<br />
sie kulturell erst beginnen.«<br />
Immer wieder kehrt Vogelsang zu der Frage<br />
zurück: Was heißt das eigentlich – chinesisch?<br />
China war ja über Jahrtausende kein fest gefügtes<br />
Reich mit klaren Grenzen. Es verstand sich als<br />
Mittelpunkt der Welt und wurde doch immer<br />
wieder von den Völkern an seinen Grenzen überrannt.<br />
Einmal an der Macht, prägten sie das<br />
Reich – und wurden von diesem geprägt. Die<br />
Männern zu: »All dies geschieht nicht umsonst, wir<br />
müssen die Bürde auf uns nehmen.«<br />
Doch trotz aller vorhersehbaren Entwicklungen<br />
liest man den schmalen Roman mit banger Spannung:<br />
weil es dem Autor gelingt, die Absurdität des<br />
gefährlichen Sogs, den das Seil auf die Bauern ausübt,<br />
spürbar zu machen. Weil man den Irrsinn des<br />
Mitläufertums begreift und auch seine<br />
fast unentrinnbare Bedrängnis. Nach<br />
einer Weile können die Bauern nicht<br />
mehr umkehren. Sie müssen weiter hinein<br />
in den Wald, dem Seil hinterher. Sie<br />
sind schon zu weit gegangen – und das<br />
in jeder Hinsicht. Sie haben ihre Frauen<br />
und ihre Felder im Stich gelassen und<br />
sich selber verraten. Also gehen sie weiter,<br />
Tag für Tag, wochenlang.<br />
Und wir folgen dem Sog des Seils und<br />
des suggestiven Sprachklangs. Denn Siepen<br />
ist ein bedächtiger Wortsucher, der<br />
sprachlich unbeirrbar in seiner ruhigen<br />
Prä zi sion den Bauern in die Ver rohung<br />
und die Verzweiflung folgt. Hin und wieder<br />
allerdings erliegt der Autor seiner<br />
Wortlust. Dann lässt er Sturm und Hagel,<br />
Blitz und Donner über die Männer herfallen<br />
und schwelgt so ausgiebig in unheilvollen<br />
Bildern, als wolle er seinem grimmigen Sujet<br />
ein diabolisch schillerndes Gewand überwerfen.<br />
Gustave Le Bon hat einst in seiner Psychologie<br />
der Massen das »Gesetz von der seelischen Einheit<br />
(verantwortl. Red.), Christian Spiller; Video: René<br />
Dettmann, Adrian Pohr; Social Media: Juliane Leopold;<br />
Community: Sebastian Horn; E-Mail: community@zeit.de;<br />
Bildredaktion, Grafik und Layout: Tibor Bogun (Leitung),<br />
Paul Blickle, Anne Fritsch, Nele Heitmeyer, Sonja Mohr,<br />
Martina Schories; Entwicklungsredaktion: Thomas Jöchler<br />
(Leitung), Michael Schultheiß, Sascha Venohr<br />
Geschäftsführer: Dr. Rainer Esser, Christian Röpke<br />
Verlag und Redaktion:<br />
Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG,<br />
Buceriusstraße, Eingang Speersort 1, 20095 Hamburg<br />
Telefon: 040/32 80-0 Fax: 040/32 71 11<br />
E-Mail: DieZeit@zeit.de<br />
<strong>ZEIT</strong> Online GmbH: www.zeit.de<br />
© Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Hamburg<br />
Geschäftsführer: Dr. Rainer Esser<br />
Verlagsleitung: Stefanie Hauer<br />
Vertrieb: Jürgen Jacobs<br />
Marketing: Nils von der Kall<br />
Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen:<br />
Silvie Rundel<br />
Herstellung/Schlussgrafik: Torsten Bastian (verantwortlich),<br />
Helga Ernst, Nicole Hausmann, Oliver Nagel,<br />
Hartmut Neitzel, Frank Siemienski, Pascal Struckmann,<br />
Birgit Vester, Lisa Wolk;<br />
Bildbearbeitung: Anke Brinks, Hanno Hammacher, Martin Hinz<br />
Druck: Frankfurter Societäts-Druckerei GmbH,<br />
Kurhessenstr. 4 –6, 64546 Mörfelden-Walldorf<br />
Axel Springer AG, Kornkamp 11, 22926 Ahrensburg<br />
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bilder<br />
übernimmt der Verlag keine Haftung.<br />
Anzeigen: <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>, Matthias Weidling<br />
Empfehlungs anzeigen: iq media marketing, Axel Kuhlmann<br />
Anzeigenstruktur: Ulf Askamp<br />
Anzeigen: Preisliste Nr. 57 vom 1. Januar <strong>2012</strong><br />
Magazine und Neue Geschäftsfelder: Sandra Kreft<br />
Projektreisen: Christopher Alexander<br />
Bankverbindungen:<br />
Commerzbank Stuttgart, Konto-Nr. 525 52 52,<br />
BLZ 600 400 71; Postbank Hamburg,<br />
Konto-Nr. 129 00 02 07, BLZ 200 100 20<br />
Börsenpflichtblatt:<br />
An allen acht deutschen Wertpapierbörsen<br />
Kai Vogelsang:<br />
Geschichte<br />
Chinas<br />
54 Abb. und 14<br />
Karten; Reclam,<br />
Stuttgart <strong>2012</strong>;<br />
645 S., <strong>39</strong>,95 €<br />
Stefan aus dem<br />
Siepen: Das Seil<br />
Roman; dtv<br />
premium,<br />
München <strong>2012</strong>;<br />
176 S., 14,90 €;<br />
als E-Book 12,99 €<br />
Mandschuren der Qing-Dynastie etwa »gaben<br />
sich in Beijing chinesischer als die Chinesen«.<br />
Der Frage nachzuspüren, was eigentlich das<br />
»Chinesische« an China sei, ist ein delikates Unterfangen<br />
in Zeiten, in denen der Nationalismus<br />
blüht. China strebt nach Weltgeltung, es strotzt<br />
vor Selbstbewusstsein. Die Erfolge der Reformpolitik<br />
Deng Xiaopings machen die Welt staunen;<br />
sie hat das Land gerettet nach dem Wahn von<br />
Maos »Großem Sprung vorwärts«, der zur vielleicht<br />
größten Hungersnot der Menschheitsgeschichte<br />
wurde, und nach dem Wüten der »Großen<br />
Proletarischen Kulturrevolution«.<br />
Die Führung der Kommunistischen<br />
Partei muss derzeit um ihre Macht nicht<br />
fürchten. Und doch wirkt sie unsicher.<br />
Nichts ist ihr wichtiger als die Wahrung<br />
der nationalen Einheit. Verspielte sie<br />
diese, verlöre sie ihre Legitimität. »Das<br />
Grundproblem der chinesischen Gesellschaft«,<br />
schreibt Vogelsang, bleibe »die<br />
Ordnung einer heterogenen Gesellschaft«.<br />
Das gelte heute wie zu allen Zeiten.<br />
Es sei deshalb kein Zufall, dass die von<br />
der KP propagierte »harmonische Gesellschaft«<br />
den Konfuzianismus zu neuen<br />
Ehren kommen lasse, der schon im Altertum<br />
die »Ideologie des bürokratischen<br />
Absolutismus« gewesen sei.<br />
Harmonisch ist das heutige China<br />
wahrlich nicht. Es ist voller Gegensätze<br />
und Spannungen: zwischen Stadt und<br />
Land, zwischen Zentrum und Peripherie, zwischen<br />
Arm und Reich – und damit ein getreues<br />
Abbild seiner 5000-jährigen Geschichte. Man begreift<br />
die Herausforderungen, vor denen das<br />
Land steht, viel besser, wenn man die oft grandiose,<br />
oft grauenvolle Geschichte des Riesenreiches<br />
studiert. Vogelsangs fabelhaftes Werk ist jedem,<br />
der sich dieser Mühe unterziehen will, ans Herz<br />
zu legen. Ein großer Wurf.<br />
der Massen« untersucht. Genau das will Siepen mit<br />
den Mitteln der Fik tion tun, will die »Kollektivseele«<br />
ergründen und erzählerisch fassen. Er beschreibt<br />
nur selten ein »ich«, sondern meist ein »sie«<br />
– die Gruppe als physische und psychische Einheit.<br />
Sie denken, schwitzen, stinken, laufen gemeinschaftlich.<br />
Sie leiden, entgleisen, verdumpfen: »Sie<br />
dachten nicht mehr, sondern marschierten<br />
nur noch.«<br />
Das kann man nun als Konstrukt abtun.<br />
Denn es bleiben in der Tat die Figuren<br />
Statisten im Szenario. Aber man kann<br />
sich auch hineinbegeben und schreckgebannt<br />
zusehen, wie normale Männer<br />
sich enthemmen, wie verfügbar der Einzelne<br />
wird im bestimmenden Kollektiv,<br />
wie schnell der Verstand sich verwirrt,<br />
der Anstand zum Nebelgespinst zerfließt,<br />
der Mensch seine viel gerühmte Menschlichkeit<br />
verliert. Man kommt nicht<br />
umhin, auch sich zu fragen, wie lange<br />
man wohl Mitläufer geblieben wäre in<br />
dieser Seilschaft.<br />
Nur Bernhardt, der das Seil entdeckte,<br />
kehrt nach kurzer Zeit um. Er bleibt<br />
sich und seinem Gewissen treu. Und ausgerechnet<br />
ihn lässt Siepen auf dem Rückweg<br />
zugrunde gehen, sich unserem romantischen<br />
Wunsch verweigernd, dass doch bitte jedenfalls in<br />
der Literatur der belohnt werden möge, der anständig<br />
bleibt.<br />
<strong>ZEIT</strong>-LESERSERVICE<br />
Leserbriefe<br />
Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH &<br />
Co. KG, 20079 Hamburg,<br />
Fax: 040/32 80-404;<br />
E-Mail: leserbriefe@zeit.de<br />
Artikelabfrage aus dem Archiv<br />
Fax: 040/32 80-404;<br />
E-Mail: archiv@zeit.de<br />
Abonnement<br />
Jahresabonnement € 197,60;<br />
für Studenten € 124,80<br />
(inkl. <strong>ZEIT</strong> Campus);<br />
Lieferung frei Haus;<br />
Digitales Abo € 2,99 pro Ausgabe;<br />
Digitales Abo für <strong>ZEIT</strong>-Abonnenten<br />
€ 0,40 pro Ausgabe<br />
Schriftlicher Bestellservice:<br />
<strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>, 20080 Hamburg<br />
Abonnentenservice:<br />
Telefon: 0180-525 29 09*<br />
Fax: 0180-525 29 08*<br />
E-Mail: abo@zeit. de<br />
* 0,14 €/Min. aus dem deutschen<br />
Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem<br />
deutschen Mobilfunknetz<br />
Abonnement für<br />
Österreich, Schweiz und<br />
restliches Ausland<br />
<strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Deutschland<br />
Telefon: +49-1805-861 00 09<br />
Fax: +49-1805-25 29 08<br />
E-Mail: abo@zeit.de<br />
Abonnement Kanada<br />
Anschrift: German Canadian News<br />
25–29 Coldwater Road Toronto,<br />
Ontario, M3B 1Y8<br />
Telefon: 001-416/<strong>39</strong>1 41 92<br />
Fax: 001-416/<strong>39</strong>1 41 94<br />
E-Mail: info@gcnews.ca<br />
Abonnement USA<br />
<strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> (USPS No. 0014259)<br />
is published weekly by Zeitverlag.<br />
Subscription price for the USA<br />
is $ 270.00 per annum.<br />
K.O.P.: German Language Pub.,<br />
153 S Dean St., Englewood NJ<br />
7631. Periodicals postage is paid<br />
at Englewood NJ 07631 and<br />
additional mailing offices.<br />
Postmaster: Send address<br />
changes to: <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>, GLP, PO<br />
Box 9868, Englewood NJ 07631<br />
Telefon: 001-201/871 10 10<br />
Fax: 001-201/871 08 70<br />
E-Mail: subscribe@glpnews.com<br />
Einzelverkaufspreis<br />
Deutschland: € 4,20<br />
Ausland:<br />
Dänemark DKR 43,00;<br />
Finnland € 6,70;<br />
Norwegen NOK 62,00;<br />
Schweden SEK 61,00;<br />
Belgien € 4,50;<br />
Frank reich € 5,20;<br />
Portugal € 5,20;<br />
Großbritannien GBP 5,00;<br />
Nieder lande € 4,50;<br />
Luxemburg € 4,50;<br />
Österreich € 4,30;<br />
Schweiz CHF 7.30;<br />
Griechenland € 5,70;<br />
Italien € 5,20; Spanien € 5,20;<br />
Kanarische Inseln € 5,40;<br />
Tschechische Republik CZK 175,00;<br />
Slowakei € 6,20;<br />
Ungarn HUF 1690,00;<br />
Slowenien € 5,20<br />
ISSN: 0044-2070
FEUILLETON<br />
LITERATUR<br />
Foto: Pavel Baňka, Tschechische Republik, 1941<br />
Der Desperado in uns<br />
Von Aristoteles bis Foucault: Daniel Heller-Roazen erkundet die Philosophie des inneren Sinns VON GISELA VON WYSOCKI<br />
So hat es wohl kommen müssen,<br />
denkt man und blickt auf ein Werk<br />
von fünfhundert Seiten, dessen<br />
Schriftbild allein schon ein typografisches<br />
Ereignis ist. Netzwerke<br />
europaweiter Zitate breiten sich<br />
vor uns aus, die mit griechischen<br />
und arabischen Lettern aufwarten, mit ausladenden<br />
Belegstellen aus lateinisch verfassten Originaltexten.<br />
So aufwendig muss es wohl zugehen, wenn<br />
es sich um einen Begriff handelt, der, so wie der<br />
»innere Sinn«, schon lange ein Schattendasein<br />
führt als ungeliebtes, schließlich aus der Familiengeschichte<br />
des europäischen Denkens verstoßenes<br />
Kind. Eine Geschichte, die sich nach und nach<br />
um das Kind herumgemogelt hat, um schließlich<br />
seine wenig einladende Rätselhaftigkeit mit Ausschluss<br />
zu ahnden.<br />
Die guten Nachrichten zuerst, das Buch lässt<br />
zwei Protagonisten auftreten, deren Geschichten es<br />
uns besonders leicht machen, dem vieldeutigen<br />
Phänomen näherzukommen: den in den Wachzustand<br />
überwechselnden Schläfer am Beginn des<br />
großen Romanwerks von Marcel Proust und E.T.A.<br />
Hoffmanns Kater Murr. Woher eigentlich, um mit<br />
ihm zu beginnen, nimmt dieses so selbstgefällig urteilende<br />
Wesen die Sicherheit, sich lustig zu machen<br />
über das »auf zwei Füßen aufrecht einhergehende«<br />
Menschenpack? Was berechtigt einen Kater, so die<br />
Frage des Autors Daniel Heller-Roazen, Professor<br />
der Komparatistik an der Universität Princeton, so<br />
vollmundig mit eigenen Erfahrungen herumzuprotzen,<br />
die von einem »über allem waltenden Prinzip«<br />
und von einem »Gefühl des Daseins« schwafeln?<br />
In dem großen Aristoteles hat er allerdings für<br />
seine Haltung einen ernst zu nehmenden Mitstreiter<br />
gehabt, der das Vermögen der Tiere, sich in der<br />
Schöpfung in ihrem ureigensten Element zu fühlen,<br />
für »unfehlbar« hielt. Dafür bietet seine Schrift<br />
De anima eine ganze Palette von Beispielen. Ihn<br />
überzeugt der kunstvoll sich wie von selbst vollziehende<br />
Nestbau der Schwalbe. Die präzise angepeilte<br />
Flughöhe des Kranichs, mit der er die Landschaft<br />
unter ihm umfassend überblicken kann. Die<br />
Weitsicht und Skrupellosigkeit des Kuckucks, der<br />
sich seiner Jungen entledigt in der realistischen<br />
Selbsteinschätzung, ein Feigling zu sein und deshalb<br />
nicht dazu in der Lage, seine Brut<br />
versorgen zu können. Die Tiere, meinte<br />
ein hingerissener Seneca, kämen ausnahmslos<br />
»schon unterwiesen« zur Welt.<br />
Eine wahre Oase des sensus interior eröffnet<br />
sich auch dem Schläfer in den Augenblicken<br />
seines Erwachens. Walter<br />
Benjamin sprach ihm Wahrnehmungen<br />
von »unendlicher Varietät« zu. Mit den<br />
Worten »Lange Zeit bin ich früh schlafen<br />
gegangen« findet Marcel Proust den fulmi-<br />
nanten Einstieg in seinen Roman. Den<br />
langsam zu sich Kommenden sieht er mit<br />
einer Empfindung für die grenzenlose<br />
Reichweite der Existenz beschenkt, wie sie<br />
vergleichbar nur in einem Tier zu »beben«<br />
vermag. Alles scheint möglich, alles erreichbar<br />
zu sein, der entblößte Höhlenmensch<br />
und der Raumfahrer, der mit Lichtgeschwindigkeit<br />
durch »Jahrtausende der<br />
Menschheitsgeschichte« geschleudert wird.<br />
Daniel Heller-<br />
Roazen:<br />
Der innere Sinn<br />
A. d. Engl. von<br />
Horst Brühmann;<br />
S. Fischer, Frankfurt/M.<br />
<strong>2012</strong>; 502<br />
S., 24,99 €; als<br />
E-Book 21,99 €<br />
Daniel Heller-Roazen, 1974 geboren, hat sicher<br />
kein Talent zur halbwachen Romanfigur, aber ein<br />
offenbar ebenfalls bewusstseinserweitertes Ich zu<br />
bieten. Das Buch, das nun in der kundigen und<br />
präzisen Übersetzung von Horst Brühmann vorliegt,<br />
formuliert seine Absicht mit den Worten, die »tausendjährige<br />
Reflexion über die Natur des sprechenden<br />
Lebewesens im Abendland« nachzuvollziehen. Also<br />
bis hin zu Michel Foucault, ausgehend von Aristoteles.<br />
So weit das Auge reicht. Die Bedeutung des inneren<br />
Sinns oder die Fähigkeit, sich selber als existierend<br />
wahrzunehmen, hat Aristoteles mit dem Begriff<br />
des »Gemeinsinns« zu einer funktionstüchtigen, protokollführenden<br />
Zentrale im Reich der<br />
Sinne ausgebaut. Von diesem philosophischen<br />
Hochsitz aus äußerte er die Ansicht,<br />
es könne dem menschlichen Lebewesen<br />
unter gar keinen Umständen »sein eigenes<br />
Dasein verborgen bleiben«.<br />
Wie das Buch mit vielen Beispielen<br />
beweist, wollte die akademische Nachwelt<br />
diesen Befund nicht hinnehmen,<br />
drehte und wendete ihn so lange, bis er,<br />
hoffähig gemacht, eine besser passende<br />
Lesart ausspuckte. Man implantierte<br />
dem »inneren Tastsinn« nach und nach<br />
eine in der aristotelischen Philosophie<br />
schmerzlich vermisste Größe: das erkennende<br />
Bewusstsein. Nicht ihm, wäre es<br />
nach Aristoteles gegangen, hätte die<br />
Primadonnenrolle in der Geschichte des<br />
europäischen Philosophierens zufallen<br />
sollen, sondern ihrem Gegenpart, dem<br />
»Wissen vom Leben«. Eine Turbulenz,<br />
Dichten und<br />
verdichten<br />
Der Blick auf die Welt ist ein dichtender, weshalb wir<br />
uns nur entweder zwingen können, ihn auf das zu<br />
reduzieren, was uns real vor den Augen liegt, oder, in<br />
anderer Richtung, zu entdecken, auf welche Weise<br />
wir das Sichtbare uns anverwandeln. Der Fotograf<br />
Pavel Banka, der in Prag lebt und arbeitet, wählt den<br />
zweiten Weg, in seinen Bildern entfaltet sich die Fiktionalisierung<br />
des Realen, er verzaubert ein Kornfeld,<br />
während er in der Natur die Spuren des menschlichen<br />
Eingriffes betont. Der Band Sense of Place. Europäische<br />
Landschaftsfotografie lässt den Blick vom Norden<br />
Europas, vom Baltikum über Schweden und Däne-<br />
ein dramatisches Geschehnis, das den Blick auf das<br />
schüttere Fundament freigibt, auf dem der Bewusstseinsbegriff<br />
sesshaft geworden ist.<br />
Das Buch gibt erst spät zu erkennen, welches<br />
Motiv sich hinter dem Aufgebot an Informationen,<br />
Daten, Deutungen und inhaltlichen Verzweigungen<br />
versteckt: die Ze le bra tion eines Abschieds,<br />
der Abgesang auf ein vergessenes, menschliches<br />
Vermögen. Vor lauter Willensstärke, Belesenheit<br />
und Klugheit hat der Autor eine kleine, aber folgenreiche<br />
Schwäche nicht im Griff, es ist die Idee,<br />
auf nichts verzichten zu können.<br />
Sein Buch ist dem vor sieben Jahren verstorbenen<br />
Vater gewidmet, dem großen Historiker Paul Roazen,<br />
dessen Untersuchungen das Zustandekommen und<br />
die Auswirkungen der Wiener Psychoanalyse stoffreich<br />
zur Darstellung bringen. Man kann vermuten,<br />
dass dieses posthume Präsent den Sohn zu besonderer<br />
Seriosität verpflichtete. Aus diesem Grund hat sein<br />
neues Buch wohl nicht ganz so brillant und so ungezwungen<br />
originell werden können wie die Essays<br />
Echolalien, die von der Geburt und dem Sterben von<br />
Lauten handeln.<br />
Das dennoch eindrucksvolle Werk macht streckenweise<br />
den Eindruck, als ginge es ihm um<br />
nichts anderes als um die luftdicht abgeschlossene<br />
Rekonstruktion eines Begriffs. Bemüht um Vollständigkeit,<br />
schleust uns Heller-Roazen quer durch<br />
die philosophischen Systeme, im Gepäck die abgewandelte<br />
Gretchenfrage: Wie haltet ihr es mit dem<br />
inneren Sinn? Antwort geben unter anderem Platon,<br />
Marc Aurel, Augustinus, Albertus Magnus,<br />
Thomas von Aquin, Bacon, Campanella, Locke,<br />
Rousseau und Condillac.<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 49<br />
mark nach Zentraleuropa, über Ungarn und<br />
Österreich nach Italien, Malta, Griechenland wandern.<br />
Wir sehen schneebedeckte Schlachtfelder<br />
oder lichtüberflutetes Meer, die Wunden, die wir<br />
durch Berge schlugen, Stadtsilhouetten, in denen<br />
sich Jahrhunderte verdichten. Gäbe es etwas, das<br />
dieses Europa zusammenhielte? Darüber zu meditieren,<br />
hier böte es sich an. SM<br />
Sense of Place<br />
Europäische Landschaftsfotografie<br />
Prestel Verlag, München <strong>2012</strong>; 280 S., 49,95 €<br />
Eine brillante Zitaten-Show, dabei gilt ja der eigentliche<br />
Impuls und die Leidenschaft des Buches<br />
dem Werdegang und Abstieg eines Gefühls, das<br />
uns nicht nur unser Leben spüren lässt, sondern<br />
auch unsere Sterblichkeit. »Das Fleisch der Menschen«,<br />
schrieb Aristoteles, »ist das allerzarteste.« In<br />
ihre Existenz greift der innere Sinn am tiefsten ein.<br />
Erst am Schluss des Buches werden die Karten auf<br />
den Tisch gelegt; und das mit plakativer Abruptheit.<br />
Asche über das Haupt von Descartes. Er war<br />
es, der »das Tier« aus dem Menschen »verschwinden«<br />
ließ. Ein Tötungsakt, aus dem ein empfindungsfreier,<br />
wahrnehmungsbereinigter Raum des<br />
Denkens erwuchs und eine der einflussreichsten<br />
Theorien der Frühmoderne.<br />
Glaubt man dem Autor, wird dem inneren Sinn<br />
heute kein anderes Überleben zugestanden als das<br />
eines Des pe ra dos, der in beängstigenden Quartieren<br />
Unterschlupf finden muss: im Phantomschmerz der<br />
Amputierten. In den Dissoziationsstörungen und<br />
Unvollständigkeitsgefühlen der Psychotiker. Der innere<br />
Sinn ging ein in Krankheitsbilder. Von Patienten<br />
ist die Rede, deren Leiden aus der Wahrnehmung<br />
entstand, dass sie nichts mehr wahrnehmen.<br />
Es wäre eine schöne Pointe des Buches gewesen,<br />
an seinen Anfang zurückzukehren, zu Marcel Proust,<br />
der allein schon in den Schlafhaltungen seines Protagonisten<br />
verschwenderisch angelegte Speicherorgane<br />
des inneren Sinns aufspürt. Das Phänomen, so<br />
könnte man deshalb sagen, liegt direkt vor der Haustür.<br />
Es ist zu haben. Aber zu geringfügig, zu unverlässlich,<br />
zu vielgestaltig, um unter der Gewalt der<br />
großen Konstruktionen eine Bleibe in der Philosophie<br />
gefunden zu haben.
Foto (Ausschnitt): Isolde Ohlbaum/laif<br />
50 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> FEUILLETON<br />
Der Brite unter<br />
den Deutschen<br />
Von allen Intellektuellen ist er der verwegenste Abenteurer. Ein<br />
Besuch beim Essayisten und Schriftsteller Karl Heinz Bohrer in<br />
London aus Anlass seines 80. Geburtstags VON IJOMA MANGOLD<br />
Karl Heinz Bohrer<br />
Geboren am 26. September 1932 in<br />
Köln. Sein Vater war ein liberaler Volkswirt<br />
mit starken Neigungen nach Frankreich<br />
und Spanien. Bohrer besuchte das<br />
humanistische Landschulheim Birklehof<br />
im Schwarzwald, wo er seine Leidenschaft<br />
für Latein und Griechisch entdeckte.<br />
Er war Literaturchef der »FAZ« bis<br />
1973, danach ging er als deren Kulturkorrespondent<br />
nach London. 1983 wurde<br />
er Professor für Literaturwissenschaft<br />
in Bielefeld. Mit seiner zweiten Frau, der<br />
Schriftstellerin Undine Gruenter (1952<br />
bis 2002), lebte er in Paris. Bohrer war<br />
Herausgeber des »Merkur«. Seit 2003 ist<br />
er Gastprofessor in Stanford. Heute lebt<br />
er wieder in London.<br />
Irgendwie muss ich nach der Landung in<br />
London etwas mit der Zeitverschiebung<br />
durcheinandergebracht haben, denn als ich<br />
pünktlich an der Tür von Karl Heinz Bohrers<br />
Haus klingele, öffnet seine Frau überrascht:<br />
»Mein Mann erwartet Sie erst in einer<br />
Stunde.« Das sei mir jetzt aber unangenehm, gewiss<br />
halte Herr Bohrer seinen Mittagsschlaf? Nein,<br />
er sei am Lesen. Karl Heinz Bohrer, der auch kurz<br />
vor seinem 80. Geburtstag in seiner Statur immer<br />
noch diese einmalige Mischung aus Lässigkeit und<br />
Heroismus ausstrahlt, kommt nun die Treppe herunter,<br />
ein Buch in der Hand. Ja, er habe gelesen,<br />
und ich möge bitte mal raten, was. Fontane. Irrungen<br />
und Wirrungen. Das möge man sich bitte mal<br />
geben! Er lese zurzeit die großen Realisten, auch<br />
Flauberts Erziehung des Herzens. Ausgerechnet er,<br />
der doch sein ganzes Leben immer der Mann der<br />
Tragödie gewesen sei, des Surrealismus und der<br />
romantischen Imagination. Er müsse beschämt zugeben:<br />
Das sei schon verdammt gut. Mit rheinischem<br />
Akzent, der etwas Karnevaleskes hat: »Ich<br />
habe dem Realismus unrecht getan.«<br />
Dazu muss man zweierlei wissen. Erstens: Bohrer<br />
ist jemand, der ästhetische Fragen existenziell ernst<br />
nimmt. Es wäre völlig absurd, über Bohrer zu sagen,<br />
die griechische Tragödie sei einer seiner Forschungsschwerpunkte.<br />
Genauso gut könnte man sagen, Napoleon<br />
habe sich sein Brot mit Kriegführen verdient.<br />
Nein, hier gilt die Abwandlung des bekannten Fichte-Worts:<br />
Für welche Literatur einer brennt, das verrät,<br />
was für ein Kerl er ist. Und Bohrer, zweitens, war<br />
immer ein Kerl, der alles Biedere und Verdruckste<br />
verachtete und alles Gefährliche begeistert aufnahm.<br />
Dort, wo die phantasmatische Gewalt des literarischen<br />
Worts für irgendeine dahinterliegende sittliche<br />
Idee in Dienst genommen werden sollte, da trat<br />
Bohrer als Anwalt poetischer Autonomie auf den<br />
Plan. Sophokles’ Antigone ein wahlweise pazifistisches<br />
oder feministisches Stück? Nicht mit ihm, dem Feind<br />
jeder idealistischen Hermeneutik. In diesem Sinne<br />
war Bohrer immer ein Ernst-Jünger-Leser, ein André-<br />
Breton-Verehrer, ein Baudelaire-Anhänger, während<br />
ihm das realistische Erzählen allzu harmlos vorkam.<br />
Aber es ist etwas passiert im Leben von Karl Heinz<br />
Bohrer. Seine Laufbahn begann er, nach einem Vorspiel<br />
bei der Welt, als Literaturchef der FAZ, bevor<br />
Marcel Reich-Ranicki 1973 seinen Posten übernahm.<br />
Bohrer ging darauf als Kulturkorrespondent für die<br />
FAZ nach London und wurde zum roten Tuch des<br />
bundesrepublikanischen Linksmilieus, als er in einem<br />
berühmten Artikel Thatchers Falkland-Krieg verteidigte<br />
und im deutschen Pazifismus nur die sentimentalen<br />
Reflexe von Mainzelmännchen erkennen<br />
wollte, die sich vor der Wirklichkeit der Macht in<br />
Moralismus flüchten. 1983 wurde er Professor für<br />
Literaturwissenschaft in Bielefeld, und als Herausgeber<br />
der Suhrkamp-Reihe Aesthetica ließ er den amerikanischen<br />
Dekonstruktivismus um Paul de Man<br />
diskutieren. Und schließlich seine Herausgeberschaft<br />
des Merkurs, wo ihm in den fast 30 Jahren seines<br />
Wirkens trotz der überschaubaren Auflage dieses vornehmen<br />
Organs immer wieder enorme publizistische<br />
Aufreger gelangen, bei denen dann halb Deutschland<br />
auf dem Sofa saß und übel nahm. Kurz, Bohrer war<br />
sein ganzes bewegtes Leben lang ein Mann des Wortes.<br />
Aber eben ein Mann des journalistischen, des<br />
literaturwissenschaftlichen und des essayistischen<br />
Wortes. Doch plötzlich, in seinem achten Lebensjahrzehnt,<br />
fängt er an, Prosa zu schreiben.<br />
Die Schlampigkeit des Penners und die<br />
Grandezza des Weltmanns<br />
Bohrer ist ein stolzer und formbewusster Mann.<br />
Ältere, die ihn von früher kennen, erinnern sich an<br />
ihn gerne als jemanden, der die Schlampigkeit eines<br />
Penners mit der Grandezza des Weltmanns zu verbinden<br />
wusste. Die Frauen, heißt es, lagen diesem<br />
unbourgeoisen Bürger reihenweise zu Füßen. Sein<br />
Formbewusstsein hat eher etwas mit intellektueller<br />
Delikatesse und Unerschrockenheit zu tun, mit ritterlichem<br />
Stolz. Jedenfalls scheint er sich zu sorgen,<br />
dass es irgendwie läppisch aussehen könnte, dass er<br />
nun auf seine alten Tage sich als Schriftsteller geriere.<br />
Er sagt das nicht, aber wenn er vom »Prosa-Schreiben«<br />
spricht, bekommt sein Tonfall eine Klarheit, als<br />
wolle er jede aufkommende Verwunderung schon im<br />
Keim ersticken. Doch eine stärkere Kraft als der Stolz<br />
ist die Freude. Karl Heinz Bohrer ist nämlich sehr<br />
freudefähig. Er liebt die schneidende Auseinandersetzung,<br />
aber er genießt auch das Glück, er ist kein<br />
Melancholiker. Jetzt steht er ganz im Zeichen der<br />
Freude. Er ist selbst überrascht, wie viel Freude ihm<br />
dieses für ihn neue Schreiben von Prosa bereitet hat.<br />
Dass er jetzt die Realisten lese, habe etwas mit der<br />
Niederschrift seines Buches Granatsplitter zu tun, das<br />
Ende Juli erschienen ist. Seither denke er darüber<br />
nach, wie man darstellt. Er habe Lust, Szenen zu<br />
schildern. Nichts Autobiografisches schwebe ihm vor,<br />
eher so eine Art Epochenbild der wilden siebziger<br />
Jahre. Die Unterhaltung mit einer Studentin. Oder<br />
die Art, wie man an einer deutschen Gremienuniversität<br />
miteinander kommuniziert habe. Vielleicht<br />
müsse man sogar eine Figur einführen, die sich an<br />
Jürgen Habermas orientiere, die einzige überragende<br />
Gestalt der Epoche in Deutschland, Luhmann werde<br />
ja im Ausland so gut wie nicht gelesen. Er habe, fügt<br />
Bohrer dann wie ein Radsportler hinzu, der bekannt<br />
gibt, für sein nächstes Rennen am Montblanc trainiert<br />
zu haben, jetzt auch Don DeLillo gelesen.<br />
Dionysos wartet, und Bohrer denkt<br />
ans Prosa-Schreiben<br />
Er müsse mir etwas gestehen. Der Gedanke ans Prosa-Schreiben<br />
lenke ihn gerade ab von seinen Vorbereitungen<br />
für Stanford. Seit 2003 ist Bohrer dort Gastprofessor.<br />
Eigentlich müsse er seine Vorlesungen über<br />
Dionysos vorantreiben. Er habe nämlich herausgefunden,<br />
dass das griechische Wort für »Erscheinen« bei<br />
Homer ausschließlich dem Dionysos vorbehalten sei.<br />
Götterfiguren wie Apoll oder Aphrodite, bei allem<br />
Glanz, der ihnen eigne, träten auf, zeigten sich, aber<br />
erschienen niemals. Und weil Bohrer wirklich der<br />
Letzte ist, der der Frage, mit welchem Verb Dionysos<br />
bei Homer eingeführt wird, nicht die höchste Priorität<br />
einräumen würde, deshalb ist es wirklich erstaunlich,<br />
dass er jetzt sagt: »Der Gedanke, Prosa zu<br />
schreiben, lenkt mich von meinem Dionysos ab.«<br />
Und als verbiete er sich weitere Spekulationen: »Mehr<br />
kann ich dazu nicht sagen.«<br />
Seit Granatsplitter, die Erzählung einer Jugend,<br />
erschienen ist, hat das Buch nur glänzende Kritiken<br />
bekommen, und der Hanser Verlag muss ständig<br />
nachdrucken. Wie aus dem oft ziemlich hermetischen<br />
Literaturwissenschaftler ein fesselnd anschaulicher<br />
Erzähler wurde, dafür hat er, der das geschichtsphilosophische<br />
Denken nicht sehr schätzt, gleichwohl<br />
seine eigene kleine Privatgeschichtsphilosophie parat.<br />
Sie hat zu tun mit seinem Misstrauen gegen Ideen<br />
und seiner Vorliebe für Ereignishaftigkeit. Das klingt<br />
dann so: »Meine theoretische Kritik an einer bestimmten<br />
Tradition des hermeneutischen Idealismus<br />
hat wohl auf die Dauer zu der Einsicht geführt, das,<br />
was ich sagen will, nicht mehr theoretisch zu sagen,<br />
sondern erzählerisch. Weil nur das erzählerische Wort<br />
das Klischee vermeiden kann. Klischee in dem Sinne,<br />
wie Nietzsche einmal gesagt hat: ›Nur keine Gedanken!‹<br />
Nichts ist verräterischer und kompromittierender<br />
als Gedanken. Warum? Weil in jedem Gedanken<br />
eine abgenutzte Idee steckt.«<br />
Tatsächlich ist Granatsplitter ein so brillantes<br />
Debüt, weil es, indem es eine Kindheit und Jugend<br />
am Ende des Zweiten Weltkriegs erzählt, auf alles<br />
retrospektive Besserwissen verzichtet. Hier ist alles<br />
Anschauung und Erlebnis aus der Perspektive »des<br />
Jungen«, wie der Autor sein kindliches Alter Ego stets<br />
in der dritten Person nennt. »Nur keine Gedanken«<br />
meint in diesem Sinne: Nur keine moralischen Deutungen<br />
des Zeitgeschehens einbringen, die dem<br />
Jungen seinerzeit selbst nicht zur Verfügung standen.<br />
So lernt der Leser einen Jungen kennen, der zwar<br />
früh von seinem Vater über die verbrecherische Natur<br />
des Naziregimes ins Bild gesetzt wurde, der sich aber<br />
den abenteuerlichen Seiten des Krieges in seiner<br />
Fantasie nicht entziehen kann. Fasziniert sammelt er<br />
die herrlich funkelnden Granatsplitter der deutschen<br />
Flakabwehr. Auf dem Internat Birklehof erlebt er eine<br />
Aufführung von Aischylos’ Orestie und begeistert sich<br />
für das erhabene Schicksal der Atriden und die »Tonfülle«<br />
der Tragödie: »Heldisches war auch noch zu<br />
diesem Zeitpunkt seine schönste Vorstellung«, heißt<br />
es. Die männlichen Tugenden von Mut und Tapferkeit<br />
bewundert er an den Soldaten, und es fällt ihm<br />
schwer, zu akzeptieren, dass die Engländer keineswegs,<br />
wie die Propaganda verkündete, feige sind,<br />
sondern sogar siegreich, die deutschen Soldaten hin-<br />
gegen für eine gemeine Sache gekämpft haben. Nach<br />
der Kapitulation sucht der Junge nach einer Lösung<br />
für diesen Konflikt: »Wenn die Englischlehrerin ihm<br />
von der BBC erzählte und aus der englischen Geschichte,<br />
dann fand er seine Lieblingsvorstellungen<br />
von Mut und Stolz auch dort wieder. Es waren für<br />
ihn sozusagen andere, bessere Deutsche.«<br />
Überhaupt die Engländer: In diesem Bildungsroman<br />
läuft alles auf England hinaus. Erst waren sie<br />
der Feind schlechthin, später dann geradezu Bohrers<br />
normativer Begriff einer Nation. Das Buch endet mit<br />
der ersten Reise des Jungen 1953 nach England, wo<br />
ihn die beiden Seiten von Englands theatralischem<br />
Temperament tief beeindrucken: die parlamentarischen<br />
Debatten und die Shakespeare-Aufführungen.<br />
Und noch etwas kann man aus diesem herrlichen<br />
Buch lernen: Weil Bohrers Familie nie gemeinsame<br />
Sache mit den Nazis gemacht hatte, gab es für ihn<br />
auch keinen Grund, den antiheroischen Habitus der<br />
Bundesrepublik sich zu eigen zu machen. Das selbstbewusst<br />
kriegerische England, »immer im Bund mit<br />
der See und den Winden«, blieb sein Stilideal.<br />
Aber eines ist Bohrer wichtig: Granatsplitter sei<br />
keine Autobiografie. Was er dort erzähle, habe er<br />
allein aus poetologischen Gründen erzählt. Dass<br />
es zufällig auch stimme, sei nachrangig. Er habe<br />
gute Prosa schreiben wollen, nicht eine authentische<br />
Geschichte.<br />
Karl Heinz Bohrer war immer ein ausgesprochen<br />
markanter, hochindividueller Charakter. Er war dies<br />
aber nie durch Ich-Sagen, durch einen ausgestellten<br />
Biografismus, sondern allein durch seine in tel lek tuelle<br />
Verwegenheit. Es ging ihm immer um philosophische,<br />
ästhetische, politische Positionen. Das Erstaunliche<br />
ist nun dies: Alle theoretischen Begriffe, die man<br />
mit Bohrers Denken verbindet, kommen in seiner<br />
Erzählung einer Jugend plötzlich als atmende Lebensinhalte<br />
eines mit Neugier die Welt erobernden Jungen<br />
zur Erscheinung. Auch wenn Granatsplitter partout<br />
keine Autobiografie sein will, erzählt sie doch, wie<br />
einer wurde, was er ist. Wenn Mut, Schrecken, Stolz,<br />
Gefahr und Erhabenheit zentrale Begriffe von Bohrers<br />
Nachdenken über Ästhetik sind, dann finden wir sie<br />
alle bereits angelegt auf dem Abenteuerspielplatz<br />
seiner Kindheit zwischen Schultheateraufführungen<br />
von Shakespeares Was ihr wollt und den Bombennächten<br />
in Köln. Dies also sind die Bildungserlebnisse,<br />
die Bohrer zu diesem ungewöhnlichen Menschen<br />
machten, der Artistik und Machtrealismus<br />
verbindet. Nietzsche und Hobbes in einem. Der<br />
Fluchtpunkt seines Denkens ist vermutlich, dass das<br />
für ihn keineswegs zwei Seelen, ach, in einer Brust<br />
sind. Und schon gar nicht: ach.<br />
Hat sich die Abenteuererwartung des Jungen an<br />
das Leben eigentlich erfüllt? »Oh ja«, sagt Bohrer,<br />
»und zwar in meinen vielen verschiedenen Lebensphasen<br />
immer wieder aufs Neue.« Bohrer, der große<br />
Liberale, war nie ein 68er. Aber die freche Schnauze,<br />
das Antiautoritäre von 68 genoss er sehr. In ihren<br />
besten Momenten waren sie zumindest eines nicht:<br />
verdruckst. Und Bohrers Stirn kann viele Ausdrücke<br />
annehmen, aber eines ist sie nie: verdruckst. Er kann<br />
über sich lachen, aber die Radikalitätsvermeidung<br />
des selbstironischen Schmunzlers ist ihm fremd.<br />
Vielleicht trifft es auch hier am besten ein englisches<br />
Lebenskonzept: Sportsgeist. Am 28. September feiert<br />
der liberale Sportsfreund intellektueller Debatten<br />
seinen 80. Geburtstag. Wie schön, dass es ihn gibt.
FEUILLETON<br />
Goethes Mutter, eine modern<br />
gesinnte Frau, pflegte in europäische<br />
Staatsanleihen zu investieren,<br />
aber nachdem ihre<br />
Preußen- und Franzosenbonds<br />
praktisch wertlos geworden waren,<br />
musste der Sohn sie verkaufen – es gab zu<br />
viele Schlösser und Soldaten in den Staaten,<br />
zu viel Krieg und Gier, kurzum: zu viele<br />
Schulden. Es ist ja nicht so, dass etwas Neues<br />
passierte unter der fahlen Krisensonne. Man<br />
gewöhnt sich inzwischen daran, Goethe auch<br />
als finanzpolitischen Zeitgenossen zu behandeln,<br />
den Kritiker des Papiergeldes und<br />
des irren Strebens nach dem Golde, den Moralisten<br />
und Antimodernisten. Faust II: eine<br />
Allegorie des Kapitalismus. Faust I: der Bürger<br />
in totaler Selbstverantwortung. Und alles<br />
geht im Spiele komplett schief, genau wie<br />
heute in echt.<br />
Das Frankfurter Schauspiel sieht den<br />
Turm der Europäischen Zentralbank vor sich,<br />
unten lagert der letzte Trödel der Occupy-Bewegung,<br />
rechts ein Parkhaus, links eine Baustelle,<br />
welche sich »The Riverside Financial<br />
District« nennt. Goethe würde diese Lage vermutlich<br />
»bedeutend« genannt haben. Sie verpflichtet<br />
in diesen Zeiten auch künstlerisch.<br />
Und tatsächlich: Frankfurt strömt gleichsam<br />
in die Neuinszenierungen dieses Doppel-<br />
Faust ein, ins Bühnenbild ebenso wie ins ewig<br />
flackernde Videomaterial: Man sieht die Glasfassaden<br />
und die Trinkhallen, die Porsches<br />
und den Osterspaziergang am Mainufer entlang,<br />
bis der schwarze Königspudel schelmisch<br />
in die Kamera glotzt.<br />
Wie zwei unterschiedliche Tonspuren<br />
folgen die beiden Dramen dem Aus- und<br />
Einatmen dieser Finanzmetropole. Noch<br />
immer recken sich die Schlote der Geldfabriken<br />
in den Himmel, wenngleich nicht mehr<br />
so selbstsicher wie einst. Frankfurt ist die<br />
einzige kapitalistische deutsche Stadt, die zugleich<br />
eine vollkommen antikapitalistische<br />
ist. Stefan Pucher, der jüngere der beiden<br />
Regisseure, Jahrgang 1965, macht aus dem<br />
ersten Faust ein grell bebildertes Roadmovie,<br />
es ist eine urbane Revue, die in einem überdimensionalen<br />
Polyeder stattfindet, immerfort<br />
sich drehend und die Farben wechselnd,<br />
die Spieler durch expressionistisch schräge<br />
Türen drängend und durch Schlupf- und<br />
Mauselöcher. Es ist ein Gewese und Gewusel<br />
durch all die Kicks der Großstadt hindurch,<br />
die einen schlechten Geschmack im Mund<br />
hinterlassen, aber mehr auch nicht.<br />
Selbst dem Mephisto ist das ganze<br />
Unglück ein wenig peinlich<br />
Puchers Faust (Marc Oliver Schulze) tritt<br />
auf als verwahrloster Oberstudienrat aus<br />
dem Frankfurter Nordend. Irgendwie scheint<br />
er ein Zurückgelassener der Kritischen Theorie<br />
zu sein, einer, dem spät, zu spät aufging,<br />
dass sich über der fortgesetzten Adorno-Lektüre<br />
eine große Traurigkeit seines Gemütes<br />
bemächtigte. Mephisto (Alexander Scheer)<br />
sieht demgegenüber aus wie der junge David<br />
Bowie. Er ist die Club-Bekanntschaft, die<br />
immer cooler sein wird als man selbst, der<br />
Smarte, mit dem auf einmal alles möglich<br />
wird, der lang erwartete Grenzüberschreiter,<br />
der Besorger. A walk on the wild side mit einem<br />
niederen Teufel. Mephisto-Scheer vergeigt<br />
die Schüler-Szene, spielt aber passabel<br />
Gitarre. Das Gretchen (Henrike Johanna<br />
Jörissen): Typ fuck doll. Am Ende stehen alle<br />
belämmert da, sogar Mephisto ist das Ganze<br />
ein wenig peinlich. Kurzweilig war diese Affäre<br />
schon, aber es wird davon kaum etwas<br />
im Gedächtnis bleiben.<br />
Pucher macht so etwas wie Moraltheater<br />
für die Jugend. Es handelt vom Egomanen,<br />
der die Krise heraufbeschwor, dem Egoshoo-<br />
Hier wird niemand gerettet<br />
Das Stück zur Krise in der Metropole des Kapitalismus: Frankfurt genehmigt sich den ganzen<br />
»Faust« – und wird, wie sollte es anders sein, nicht warm mit ihm VON THOMAS E. SCHMIDT<br />
ter und Erlebnisjunkie, dem Auskoster, das<br />
Leben abgrasend und auf nichts und niemanden<br />
Rücksicht nehmend. Sind wir nicht alle<br />
ein bisschen Faust? Nicht länger (alter Faust)<br />
sucht er die künstlichen Paradiese in sich, sondern<br />
er wirft die Heroinnadel mit großer Geste<br />
fort und will fortan (verjüngter Faust), dass<br />
sich die Welt für ihn in ein Intensitätskontinuum<br />
verwandelt, wieder nur für sich und auf<br />
Kosten anderer. Ähnlich wie in Bret Easton<br />
Ellis’ American Psycho streift hier ein Investmentbanker<br />
durch die Stadt, Finsteres im<br />
Sinn. Nachdem er den Weiberschoß gekostet<br />
hat, gelüstet es ihn schon wieder nach dem<br />
Mammon. Für die Entsprechung von Begehren<br />
und Geld, Zahlungs- und Geschlechtsverkehr,<br />
gibt es bei Goethe zahllose Prunkzitate.<br />
Alle werden sie bei Pucher herbeideklamiert.<br />
Puchers Faust I ist ein fernsehtauglicher<br />
Calderon, von lulligem Gitarrenrock begleitet<br />
und in Videos getaucht, die oft ziemlich penetrant<br />
nach Robert Wilson aussehen. Mitten<br />
Faust<br />
(Wolfgang<br />
Michael) und<br />
Mephisto<br />
(Constanze<br />
Becker) in<br />
»Faust II«<br />
im Tohuwabohu macht sich das Gefühl von<br />
Belanglosigkeit breit. Es ist ein Theater der<br />
kapitalismuskritischen Gegenreformation.<br />
Wutbürgerkunst ist alles im Herbst <strong>2012</strong>,<br />
in den Romanen, den Filmen und auf dem<br />
Staatstheater auch. Frankfurt feiert seinen großen<br />
Sohn mit einem breit gefächerten Festprogramm.<br />
Im Goethehaus hat gerade eine Goethe<br />
und das Geld betitelte Ausstellung eröffnet.<br />
Ihre Exponate sind karg, ihr geistiger Ertrag<br />
passt in einen kleinen Aufsatz: Er war ein guter<br />
Geschäftsmann und ein skeptischer Zeitgenosse<br />
von Adam Smith. Möchte man, entsprechend<br />
dem Zeitgeist in Wut und Empörung<br />
sich windend, nicht eigentlich lieber so<br />
sein wie er? Distanziert und erfolgreich, statt<br />
den üblichen Verdächtigen zuzuhören, die<br />
mittags um zwei über »Negativität. Die Dialektik<br />
des Fortschritts« schwadronieren?<br />
Altmeister Günter Krämer hat den zweiten<br />
Faust inszeniert. Empörung kommt in dieser Regiearbeit<br />
vielleicht auch zum Ausdruck, aber<br />
plakativ ist sie beileibe nicht. Auch Krämer spürt<br />
dem Ich nach, um eine Erklärung für die Krise<br />
zu finden. Es ist Faust, der die Jetztzeit angerichtet<br />
hat, die in ihrem, mit Goethe gesprochen,<br />
»velociferischen« Fortgang sich selbst auffressende<br />
Moderne, den existenzverschlingenden Kapitalismus,<br />
der scheinbar selbst nicht mehr existieren<br />
will. Genau das verkörpert Krämers agiler<br />
und doch von der ersten Sekunde an seltsam resignierter<br />
Faust (Wolfgang Michael). Krämer<br />
interessiert am Stück eigentlich nur der Helena-<br />
Akt. Ihn inszeniert er aus, dieses gewaltige, klassische<br />
die Zeit, auch die Theaterzeit still stellende<br />
Intermezzo, in dem Faust erotische Erfüllung zuteil<br />
wird. Es ist strenges Schauspiel, so verschieden<br />
von Puchers Arbeit, wie die beiden Teile des<br />
Stücks sich voneinander unterscheiden. Sparsam<br />
das Bühnenbild, doch wirkungsvoll, wenig Musik,<br />
eigentlich sind es nur Klänge, welche die<br />
Sprach-Partitur akzentuieren.<br />
Es gibt kein Glück, und wenn der Augenblick<br />
erfüllt ist, ist er schon über sich hinaus.<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 51<br />
Faust muss das lernen, Helena, ebenso die Zuschauer.<br />
Die Vereinigung des romantischen<br />
Helden mit der klassischen Schönheit ist von<br />
Dauer nicht. Günter Krämer bettet das Begehren<br />
von vornherein in ein Gewaltgeschehen<br />
ein, lässt es sich im Medium noch stärkerer,<br />
noch tieferer kreatürlicher Bedürfnisse ereignen,<br />
inmitten zerstörerischer, zentrifugaler<br />
Impulse, die mit der brüchigen Bildung des<br />
Ichs zu tun haben und die Zivilisation mit der<br />
blutigen Spur des Fortschritts durchziehen.<br />
Dabei wird die Liebe einfach mitgerissen.<br />
Nein, die Liebe ist nicht die Rettung, niemand<br />
wird hier gerettet. Zerbrechlich stehen die<br />
Körper auf der Bühne, immer bereit umzusinken.<br />
Auch die Erotik ist Moderne – und insofern<br />
krisenhaft geworden.<br />
Entsprechend ist Faust in dieser Inszenierung<br />
keine »Person« mehr, nicht länger der<br />
Gegenstand von Psychologie, sondern Artikulationsfläche<br />
mächtigerer Kräfte, er ist das<br />
Zentrum von hereingebrochenen Katastrophen,<br />
die größer waren als jeder Einzelne,<br />
mochte er ein Titan gewesen sein. Auch Mephisto<br />
(Constanze Becker) ist bloß noch ein<br />
Conferencier. Er zeigt ein Geschehen her, das<br />
ihm irgendwann entglitten ist.<br />
Die schöne Helena (fast immer nackig:<br />
Valery Tscheplanowa) hat hier gar nichts<br />
mehr von griechischer Vollkommenheit. Sie<br />
ist die Auslöserin eines die Welt aufstörenden<br />
Begehrens, und dieses Begehren kann nicht<br />
mehr erwidert, geschweige denn gezügelt<br />
werden. Helena reißt ein körperliches Loch<br />
ins Dasein, und das saugt hernach Phantasmen<br />
in sich ein, Tatkraft, Macht und Ehre,<br />
sämtliche männliche Ich-Prothesen, kurz:<br />
den Irrwitz der Zivilisationsgeschichte, den<br />
ganzen alten Faust.<br />
Goethe war Anschaffer und<br />
Verschwender zugleich<br />
Was sonst so alles im Stück passiert, es muss<br />
hier nicht mehr ausgespielt werden. Ein Bühnenbild<br />
lang – Krämer bringt das Occupy-<br />
Camp kurz aufs Theater – genügt, um zu zeigen,<br />
dass die Faustschen Visionen längst Ereignis<br />
geworden sind. Dieser Faust II zeigt<br />
nicht den scheiternden Kapitalismus, sondern<br />
seine poetische Vorgeschichte. Es geschehen<br />
dabei schöne Momente auf der Bühne, beispielsweise<br />
wenn Faust gegen Ende liebend<br />
mit der Sorge ringt – die zugleich Helena ist.<br />
Oder ganz am Schluss, wenn er sich, blind<br />
und gescheitert, in Zeitlupe die Hosen auszieht<br />
und sich zum Sterben niederlegt. Das ist<br />
beinahe ein barmherziger Augenblick, den<br />
Krämer sich erlaubt. Mag sein, dass danach<br />
die allerletzten Liebesqualen des Teufels noch<br />
immer ironische Wutbürgerkunst bedeuten<br />
wollen. Dann ist es eine äußerst sublimierte.<br />
Kurz vor seinem Ende machte Goethe in<br />
Weimar Kassensturz. Er rechnete zusammen,<br />
was ihm in mehr als achtzig Jahren an Geldern<br />
so zugeflossen war. Die Summe überraschte<br />
ihn. Er hatte mit weniger gerechnet. Noch<br />
mehr überraschte ihn, dass er im Laufe seines<br />
Lebens fast alles wieder ausgegeben hatte. Er<br />
war ein harter Anschaffer und ein Verschwender.<br />
Und er resümierte, dass Geld, viel Geld<br />
nötig war, um diese Persönlichkeit so zu bilden,<br />
wie sie am Ende ausfiel, und ihrem Horizont<br />
eine solche Breite zu verschaffen. In Goethes<br />
Augen dienten all die Taler der eigenen<br />
Vervollkommnung: »Und wie mir’s gefallen, /<br />
Gefall’ ich auch mir.«<br />
Der Dichter opferte seinen Faust den Zeitläuften;<br />
er selbst überlebte in ihnen ganz gut.<br />
Übrigens lieh er später keiner europäischen Nation<br />
mehr Geld, nur dem Zwergstaat noch, in<br />
dem er wohnte. Als Mitglied des Kabinetts hatte<br />
er allerdings auch erheblichen Einfluss auf die<br />
Zahlungswilligkeit seines Schuldners. Das ist eine<br />
Ökonomie, die Sinn bewahrt und Krisen trotzt.<br />
Foto (Ausschnitt): Birgit Hupfeld
52 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong><br />
Tief in der Düsternis<br />
Ein berührender Fernsehfi lm über die Entführung und den Tod des Jungen Jakob von Metzler VON HEINRICH WEFING<br />
Leise ist dieser Film, kühl, diszipliniert.<br />
Und doch platzt einem beim<br />
Zuschauen irgendwann schier der<br />
Schädel. Denn unerbittlich steuert<br />
Der Fall Jakob von Metzler, der am<br />
kommenden Montag im ZDF ausgestrahlt<br />
wird, auf eine Frage zu,<br />
der man sich unmöglich entziehen kann. Kurz gesagt,<br />
lautet diese Frage: Was darf die Polizei, um das<br />
Leben eines Kindes zu retten? Aber man muss die<br />
Frage genauer formulieren, ausführlicher, um dem<br />
Film gerecht zu werden – und der wahren Geschichte,<br />
die er erzählt: Was passiert mit Menschen,<br />
die die Verantwortung für ein Kind haben, dessen<br />
Leben in höchster Gefahr ist? Und wie gehen wir<br />
als Gesellschaft mit ihnen um, wenn sie eine Entscheidung<br />
getroffen haben?<br />
Vor genau zehn Jahren, Ende September 2002,<br />
entführte der Jurastudent Magnus Gäfgen den elfjährigen<br />
Jakob von Metzler, den Sohn einer alteingesessenen<br />
Frankfurter Bankiersfamilie, auf dem<br />
Schulweg. Der Entführer tötete sein Opfer sofort,<br />
erpresste gleichwohl ein Lösegeld, wurde rasch aufgespürt<br />
und festgenommen, weigerte sich aber tagelang,<br />
das Versteck des Jungen preiszugeben, den<br />
die Polizei noch am Leben wähnte. Daraufhin entschied<br />
Wolfgang Daschner, der damalige Vizepräsident<br />
der Frankfurter Polizei, Gäfgen mit der Zufügung<br />
von Schmerzen zu drohen, um ihn zu einer<br />
Aussage zu bewegen. Eine Anordnung, die Kriminalgeschichte<br />
geschrieben hat und die Republik bis<br />
heute erregt. In jedem Strafrechtskommentar wird<br />
der Fall diskutiert.<br />
Jeder weiß, dass der Rechtsstaat nicht foltern<br />
darf, weil er sonst aufhört, Rechtsstaat zu sein. Niemand<br />
will in einem Land leben, in dem die Polizei<br />
Verdächtige quält, um an Informationen zu kommen.<br />
Und doch, und doch: Wer könnte von sich<br />
behaupten, er werde am Folterverbot festhalten,<br />
eisern, unerschütterlich, auch wenn es um das Leben<br />
des eigenen Kindes geht? Wer? Es ist ein Dilemma,<br />
furchtbar und unauflöslich.<br />
Nico Hofmann, der Produzent von Der Fall Jakob<br />
von Metzler, Regisseur Stephan Wagner und Jochen<br />
Bitzer, der Drehbuchautor, haben sich auf dieses<br />
Dilemma eingelassen. Sie meiden entschlossen den<br />
Kitsch, die Kühle des Herbstes steckt in ihrem Film,<br />
in seinen Bildern, in der extrem kontrollierten Emotion<br />
der herausragenden Darsteller. Lange gehen einem<br />
die Blicke von Jenny Schily nach, die Jakobs<br />
Mutter spielt, stumm, wie gelähmt, ungeheuer eindringlich.<br />
Und Hanns Zischler verleiht dem Bankier<br />
Friedrich von Metzler eine großbürgerliche Würde,<br />
die fast übermenschlich ist.<br />
Keinen Moment lässt der Film einen Zweifel an<br />
der Widerwärtigkeit von Gäfgens Tat, aber in der<br />
zentralen moralischen Frage, auf die alles hindrängt,<br />
verzichtet er auf ein Urteil. Er legt die quälende Mechanik<br />
des Konflikts bloß, Schicht um Schicht, er<br />
zeigt die fieberhaften Anstrengungen der Kripo, die<br />
ersten Reibereien zwischen den Beamten, zählt die<br />
Stunden, die noch bleiben. Aber das alles ist nur Vorspiel,<br />
notwendige Voraussetzung für die entscheidende<br />
Frage: Durfte Daschner tun, was er getan hat? Hat<br />
er richtig gehandelt? Oder hat er dem Rechtsstaat<br />
geschadet? Es ist keine Schwäche, sondern die große<br />
Stärke dieses bewegenden Films, dass er darauf keine<br />
Antwort gibt.<br />
Natürlich: Der Rechtsstaat darf nicht foltern,<br />
nicht einmal damit drohen, aus Respekt vor der<br />
Menschenwürde jedes Verdächtigen und um seiner<br />
selbst willen. Nach dem 11. September 2001, als<br />
die Debatte heftig aufflammte, haben Strafrechtler<br />
durchgespielt, was die von manchen geforderte<br />
Zulassung der Folter real bedeuten würde, neben<br />
allen moralischen Verwerfungen: Es brauchte ausgebildete,<br />
staatlich entlohnte Folterer, dazu Ärzte,<br />
die bereitstehen, um dem Gefolterten zu Hilfe zu<br />
eilen, wenn die Schmerzen über das Gewollte hinausgehen.<br />
Es brauchte, Gipfel der Perversion,<br />
eine Dienstanweisung für die Durchführung der<br />
Marter, eine Bundesfolterordnung, und Juristen,<br />
die all das ausarbeiten und kontrollieren. Die Vereinigten<br />
Staaten, die im Kampf gegen den Terror<br />
das waterboarding, das simulierte Ertränken, zugelassen<br />
haben, haben erlebt, was das mit dem<br />
Rechtsstaat macht: Es zersetzt ihn von innen wie<br />
ein ätzendes Gift.<br />
Keine Folter also, das ist das Prinzip,<br />
auch nicht, wenn das Leben eines<br />
Kindes auf dem Spiel steht, nicht einmal,<br />
wenn ein Anschlag mit Atomwaffen<br />
droht, den ein Häftling verhindern<br />
könnte, wenn er nur reden würde. Das ist<br />
Konsens. Klammheimlich aber, gut verborgen in<br />
unserem Innern, hoffen wir da nicht, dass sich in<br />
solch einer furchtbaren Lage doch ein Mensch<br />
findet, ein Minister, ein Offizier, ein Polizei-Vizepräsident,<br />
der sich über die Regeln hinwegsetzt?<br />
Einer, der das Recht bricht, damit es Recht bleiben<br />
kann, und dafür die Verantwortung übernimmt.<br />
Einer, archaisch gesprochen, der sich opfert.<br />
Von solch einem Menschen handelt Der Fall Jakob<br />
von Metzler. Nicht von der Entführung selbst,<br />
nicht vom elenden Täter, nicht von den Ermittlungen,<br />
so packend sie geschildert werden. Es ist ein<br />
Film über Wolfgang Daschner, über den Mann, der<br />
es auf sich genommen hat, trotz allem zu versuchen,<br />
Jakobs Leben zu retten. »Der Fall Daschner« wäre<br />
der bessere Titel für den Film gewesen.<br />
Ein großartiger Robert Atzorn spielt<br />
diesen Mann, nicht als Helden, nicht<br />
als moralisches Vorbild, vielmehr verkniffen,<br />
gebrochen, verbiestert, ein<br />
Bürokrat, der an seinen Pflichten schier<br />
verzweifelt. Man kann ihm dabei zusehen, wie er<br />
immer grauer wird, immer entschlossener und einsamer,<br />
während die Zeit verrinnt, während Gäfgen<br />
die Polizei narrt und immer neue Lügen auftischt.<br />
Schließlich, die Beamten glauben, der entführte<br />
Junge drohe zu verdursten, ordnet Daschner die<br />
Androhung von »unmittelbarem Zwang«, von Gewalt,<br />
an. Aber es ist keine Anweisung, es ist ein<br />
Ausbruch, Wut mischt sich darin mit Verzweiflung,<br />
das Recht, das er doch schützen soll, wird<br />
ihm zur Fessel, die er sprengt, unbeherrscht, voller<br />
Zorn. Und doch bleibt er Beamter genug, über<br />
seinen Befehl eine Aktennotiz zu verfassen.<br />
Der Film sympathisiert offen mit diesem Daschner,<br />
aber er spricht ihn nicht frei, er bleibt bei seiner Ambivalenz,<br />
er zeigt, wie der Polizist sich hineinsteigert<br />
in seine Entschlossenheit, wie er alle Zweifel wegdrückt,<br />
wie er sich gerechtfertigt glaubt. »Es gab nur<br />
eine richtige Entscheidung«, brüllt Daschner irgendwann<br />
seinen eigenen Anwalt an. Hätte er nicht gehandelt,<br />
so glaubt er, hätte er sich der Tötung durch<br />
Unterlassen schuldig gemacht. Vielleicht muss sich<br />
einer wie er panzern gegen Skepsis und Schuldgefühle,<br />
vielleicht muss er das Fragwürdige seines Handels<br />
ausblenden, um dessen Konsequenzen ertragen zu<br />
können. Kollegen rückten von ihm ab, der Innenminister<br />
entließ ihn, in der Öffentlichkeit wurde er<br />
FEUILLETON<br />
als Folterer beschimpft, die Staatsanwaltschaft erhob<br />
Klage, und im Prozess musste er sich von Gäfgen,<br />
dem Kindermörder, verhöhnen lassen, der sich als<br />
Opfer stilisierte und sich bis heute in dieser ekelhaften<br />
Rolle gefällt.<br />
Die zentrale Szene, um die immer noch gestritten<br />
wird, blendet der Film aus. Weil niemand außer den<br />
beiden Beteiligten weiß, was damals geschah. Aussage<br />
steht gegen Aussage. Was genau hat der Beamte Ortwin<br />
Ennigkeit, den Daschner mit dem letzten, entscheidenden<br />
Verhör betraute, Gäfgen angedroht? Hat<br />
er ihn geschubst, geschlagen, ihm den sexuellen Missbrauch<br />
von Kindermördern im Gefängnis geschildert,<br />
wie Gäfgen behauptet? Wir wissen es nicht. Am Ende<br />
gestand Gäfgen und führte die Polizei zu dem Ort, an<br />
dem er Jakobs Leiche versteckt hatte. Was, wenn der<br />
Junge da noch gelebt hätte? Würden wir Daschner<br />
dann anders sehen? Und was im umgekehrten Fall,<br />
wenn die Polizei nichts unternommen hätte, der Junge<br />
aber noch hätte gerettet werden können? Wäre die<br />
Öffentlichkeit dann über die Polizei hergefallen? Jede<br />
Frage führt tiefer in die Düsternis.<br />
Auch das Urteil, das schließlich über Daschner<br />
gesprochen wurde, vermochte das moralische und<br />
rechtliche Dilemma nicht zu klären, es brachte es nur<br />
in eine juristische Form. Im Dezember 2004 verurteilte<br />
das Landgericht Frankfurt Daschner und Ennigkeit<br />
wegen Nötigung zu einer Geldstrafe auf Bewährung<br />
und verwarnte beide. Dass sie bestraft wurden,<br />
bekräftigte das Verbot der Folter. Dass die Strafe so<br />
niedrig ausfiel, respektierte die furchtbare Zwangslage<br />
der Angeklagten. Strafprozessual mag das weise gewesen<br />
sein, vermutlich sogar das beste Urteil, das sich<br />
denken lässt. Frieden aber stiftet es nicht. In einem<br />
solchen Fall, das zeigt Stephan Wagners berührender<br />
Film, gibt es nur Gezeichnete.
FEUILLETON<br />
Geburt des Theaters<br />
Vor dem Theater, morgens. Natürlich<br />
trifft man gleich welche, die schon<br />
wissen, dass es idiotisch ist. Drei<br />
Opern an einem Tag, alle drei, die von<br />
»Il divino Claudio« überliefert sind,<br />
das ist doch bloß Event und Rekordversuch, die<br />
werden sich gegenseitig erschlagen. Manche haben<br />
sich den Verdacht zurechtgelegt, dass eine Neuinstrumentierung,<br />
die auch arabische Einsaiter und<br />
einen Synthesizer umfasst, nur weltmusikalisches<br />
Gaga sein kann, Populismus! Fürs Erste versprechen<br />
sie sich Kontaktpflege von diesem Tag an Berlins<br />
Komischer Oper. So viele Intendanten, Dramaturgen,<br />
Dirigenten sind angereist, dass ein Hauch Betriebsausflug<br />
in der Spätsommerluft liegt.<br />
Aber auch ein Hauch Huldigung. Ohne ihn, ohne<br />
Claudio Monteverdi, gäbe es das Genre gar nicht.<br />
Vielleicht erhofft man sich da den Zuspruch des<br />
großen, alten Bruders in einer anstrengenden Zeit,<br />
er hatte es ja auch nicht leicht. Alle sind erschöpft, es<br />
schläft keiner mehr ausreichend, alle haben Sorgen,<br />
erst recht die großen, rumpelnden Opernhausmaschinen.<br />
Dauernd werden sie auf einen ominösen Prüfstand<br />
geschoben, der, von wem, weiß keiner, so<br />
eingestellt ist, dass der Pfeil immer auf »zu teuer«<br />
zeigt. Das hat Konsequenzen, das schlaucht. Manche<br />
halten sich aufrecht mit der Gewissheit, dass schon<br />
seit gut 400 Jahren Opern gespielt werden.<br />
Im Theater, vormittags, Orpheus. Ein tiefes<br />
schwankendes D vom Kontrabass. Flirrende Orientalistik<br />
von einer Djoze, einem einsaitigen Streichinstrument<br />
aus dem Irak. Etwas Cimbalom. Frühe<br />
Regungen, die Oper ist noch gar nicht erfunden, nur<br />
Amor gibt es längst, einen alterslosen Mann im rosa<br />
Röckchen, der sich an einem Teich zu schaffen macht.<br />
Der Tod ist auch schon da, ein Mann in Schwarz<br />
lenkt die zarten Bewegungen einer skelettartigen<br />
Puppe. Dann aber platzt die Toccata aus dem Graben,<br />
und überall im Raum, in den Rängen, im wuchernden<br />
Garten, sind plötzlich Nymphen und Faune und<br />
lassen an langen Stangen Vögel flattern. Nymphen<br />
und Faune! Wo sind wir denn hier? In einem deut-<br />
schen Opernhaus des frühen 21. Jahrhunderts? Egal,<br />
es ist das pure Glück. Wäre der Jubel der Musik nicht<br />
so stark, man könnte hören, wie den Kritikern die<br />
Skalpelle und Messgeräte vom Schoß fallen. Es ist ein<br />
Ausbruch von so traumhafter, bunter Vitalität, dass<br />
einem der Grauschleier von Augen und Ohren gerissen<br />
wird und man nichts Geringeres erlebt als die<br />
Geburt des Theaters. Regisseur Barrie Kosky, der hier<br />
als Regisseur zugleich seine Intendanz eröffnet, ist<br />
offensichtlich kein bisschen erschöpft – und auch<br />
nicht naiv. In der überwältigenden Direktheit seines<br />
arkadischen Urknalls stecken alle Erfahrungen des<br />
Regietheaters, Ironie, Überspitzung, Brechung.<br />
Er hatte aber einfach mal Lust, neu anzufangen<br />
auf dieser Basis. Im wuchernden Garten, den Katrin<br />
Lea Tag geschaffen hat, gedeihen surreal große<br />
Früchte, während der Teich eindeutig ein Plastikpool<br />
ist. Das Timing, in dem die Fabelmenschen<br />
ausschwärmen, ist genau auf die Partitur abgestimmt.<br />
Elena Kats-Chernin, die sie neu instrumentiert,<br />
teils neu komponiert hat, lässt sie auch<br />
nicht einfach deswegen so arabisch starten, weil<br />
ein bisschen Cross-over nie schaden kann. Die Renaissance,<br />
aus der Monteverdi wuchs, ist undenkbar<br />
ohne den Umweg antiker Stoffe über jene<br />
maurischen Gelehrten, die sie besser hüteten als<br />
die Christen. Was wiederum alles egal ist, wenn<br />
man sich von dieser Musik verstanden fühlt.<br />
Es entsteht jene Komik, unter der<br />
man die Tiefe ahnt<br />
Dass Monteverdis Linien und Harmonien für Freude<br />
und Trauer, Schmerz und Hoffnung über 400<br />
Jahre hinweg ihre Bindungskraft behalten haben, ist<br />
ein Wunder, das gerade hier deutlich wird, im durchtrieben<br />
schlichten Setting. Wenn Orpheus (man singt<br />
deutsch) vom Tod seiner Eurydike erfahren hat, spielt<br />
Amor versonnen und tröstlich mit Papierschiffchen<br />
im Bassin, es sind aber zugleich die Vehikel des Fährmanns<br />
Charon – eine von vielen unaufwendigen,<br />
beiläufigen, treffenden Chiffren. In diesem Bassin<br />
ertrinkt am Ende der Held, anstatt mit Apoll zum<br />
Himmel aufzusteigen. Die Freudengesänge der Hirten<br />
sind zum puren Rhythmus skelettiert, in einem<br />
Trommelgewitter kämpft der Sänger vergeblich gegen<br />
seinen Untergang.<br />
Theater, mittags, 33 Jahre später. So viel Zeit verging<br />
für Monteverdi zwischen L’Orfeo und Il ritorno<br />
d’Ulisse, uraufgeführt 1640 in Venedig, diesmal nicht<br />
für einen vermögenden Herrscher, sondern für bürgerliches<br />
Publikum und mit kleinerem Etat, also<br />
ohne Chor. Vom zeitlosen Arkadien zum historisch<br />
grundierten Mythos, vom Garten zur Kunstrasenschräge,<br />
um die herum nun das Orchester sitzt – acht<br />
Celli, viel Blech, zwei Flügel, zwei moderne Harfen,<br />
eine westafrikanische Stegharfe, eine arabische Laute.<br />
Diesmal hat der exzellente Dirigent André de<br />
Ridder Probleme mit der Koordination, es fehlt zunächst<br />
am metrischen Zugriff, und auf dem Kunstrasen<br />
geht es szenisch so reduziert zu, dass ein paar<br />
Erschöpfte im Publikum eine Siesta einlegen. Theater<br />
ist eben auch anstrengend.<br />
Gerade noch rechtzeitig reißt Kosky den kargen<br />
Gegenentwurf zum verlorenen Arkadien hoch zur<br />
Karikatur, gemeinsam mit Monteverdi, der neben<br />
dem Erfinder der Oper auch ihr erster Hochkomiker<br />
ist. Die Freier, die Penelope belagern und hier als<br />
halbseidene Knallchargen auf Klappstühlen lümmeln,<br />
wären aber ohne Wirkung, hätte man nicht<br />
zuvor erlebt, wie bitter das ungewisse Warten für<br />
Penelope und Odysseus war. Die zwanzig Jahre der<br />
Trennung stellt man sich gern vor mittelmeerischem<br />
Hintergrund vor. Von dem bleibt hier nur das Funkeln<br />
der Kaskaden an Flügeln und Harfen, wobei das,<br />
nicht fern von Poulenc, auch etwas Ironisches hat.<br />
Der Kunstrasen lässt eher an Ehepaare denken, die<br />
sich auf ihrem Stückchen Grün vorm Reihenhaus<br />
auch ungetrennt nie wirklich finden.<br />
Monteverdi schreibt jetzt differenzierte, realitätsnahe<br />
Rezitative, in den Zwischenspielen lässt noch<br />
Orpheus grüßen. Zugleich aber wird deren archaische<br />
Aura von Elena Kats-Chernin in Tango und Paso<br />
doble überführt, und wenn dazu die Freier posen,<br />
entsteht jene Komik, hinter der es eben nicht flach,<br />
sondern tief wird. Trotzdem bleibt das Ganze so<br />
skizzenhaft wie das von Monteverdi überlieferte<br />
Material. Weder der Komponist spannt den großen<br />
Bogen noch der Regisseur – wobei ironischerweise<br />
der große Bogen des Odysseus zentrales Requisit ist.<br />
Es bleibt ein Tastversuch, Theater in der Krise, auch<br />
im 17. Jahrhundert, eine Krise, die dort allerdings<br />
einen ungeheuren Sprung vorbereitet.<br />
Zu preisen ist Barrie Kosky, einer der<br />
musikalischsten Regisseure heutzutage<br />
Arkadische Szene aus<br />
Monteverdis »Orpheus«<br />
an der Komischen Oper<br />
Berlin<br />
Vorm Theater, abends. Irgendwie ist man sogar<br />
erleichtert, dass der Odysseus ein bisschen karg und<br />
nicht nur aufregend war. Wer den ganzen Tag in<br />
und vor einem Opernhaus zubringt, sieht es gern,<br />
wenn es auch gewisse Parallelen zum Alltag gibt,<br />
vorausgesetzt, dass die Kurve am Abend wieder<br />
steigt. Und das tut sie, gerade weil Claudio Monteverdi,<br />
mittlerweile 75 Jahre alt, nur zwei Jahre<br />
nach seinem Odysseus, endgültig in der gesellschaftlichen<br />
Gegenwart ankommt mit der Krönung<br />
der Poppea. Längst versunken das mythische<br />
Arkadien mit seinen zeitlosen Schmerzen, es gibt<br />
auch keine Helden mehr, keine lauteren Herrscher.<br />
Es gibt Intrigen, Machtwahn, Geilheit, nirgends<br />
einen Gott.<br />
Außer natürlich Amor, den überragenden Peter<br />
Renz, der aber nun, längst zynisch geworden, als Diva<br />
mit weißer Boa den Champagnerkelch aus dem<br />
Bassin füllt, das einst ein Teich in Arkadien war und<br />
nun eine Pfütze in einer Steinwüste ist. Und Amor<br />
unterstützt ausgerechnet die Verbindung der Bösesten.<br />
Nur, wie böse sind Nero und Poppea? Monteverdi<br />
liefert in Dialogen von einer treffsicheren Rasanz,<br />
neben der jedes deutsche Fernsehspiel eine<br />
Meditationsrunde ist, eine Kritik der Macht und der<br />
Feigheit, die umso tiefer sitzt, als er jedem Protagonisten<br />
differenziert begegnet. Dem finalen Herrscherpaar,<br />
das über die Leiche des Philosophen Seneca geht,<br />
schreibt er eines der schönsten aller Liebesduette.<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 53<br />
Abenteuerreise in die Welt Claudio Monteverdis:<br />
In Berlin sind alle drei Opern des Komponisten an einem Tag<br />
zu sehen – ein aufregender Kraftakt VON VOLKER HAGEDORN<br />
Niemanden verurteilt er mit seiner Musik, alle<br />
sieht er genau an, mal spöttisch, mal einfühlend. Eine<br />
comédie humaine der Oper, von keinem eingeholt – es<br />
ist, als habe Monteverdi die Entwicklung der Gattung<br />
vom Urmythos bis zu dem Moment, in dem Menschen<br />
wie wir auf der Bühne die Augen aufschlagen,<br />
in seinem Schaffen vorweggenommen. Barrie Kosky<br />
ist nicht der Erste, der die Gegenwärtigkeit entdeckt,<br />
aber er kann im Zusammenhang der Trilogie zusätzlich<br />
den Prozess der Ernüchterung zeigen, in der<br />
die Sehnsucht dem Zynismus weicht. Er will außerdem<br />
zeigen, welche Grausamkeiten der Zynismus<br />
hervorbringt. Sein Nero, seine Poppea foltern, blenden,<br />
richten hin. Sie sind richtig böse.<br />
Damit aber bleibt Kosky weit hinter Monteverdi<br />
zurück und auch hinter dem aktuellen Stand der<br />
Opernregie. Wie man eine Vergewaltigung so inszeniert,<br />
dass die Musik stirbt, das hat an diesem Haus<br />
vor neun Jahren Calixto Bieto vorgeführt, das brauchen<br />
wir nicht mehr, und eigentlich ist Kosky selbst<br />
viel weiter – als einer der musikalischsten Regisseure.<br />
Es ist wunderbar, wenn die gewaltige Amme Arnalta<br />
in Gestalt einer Putzfrau ihre Kippe genau dann ins<br />
Gürteltäschchen ascht, wenn neben fünf Bratschen<br />
ein Synthi-Ornament aufflackert. Und wie dieselbe<br />
Amme – Thomas Michael Allen mit dem raren Register<br />
des Haute-Contre – ihr Wiegenlied für Poppea<br />
singt, für diese Innigkeit hat Kosky Sinn.<br />
Und was dann nachts bleibt, wenn seltsamerweise<br />
niemand mehr erschöpft ist, das sind doch<br />
weniger diese und jene Schwäche und die Frage, ob<br />
das Banjo in der Poppea nicht unter seinen Möglichkeiten<br />
eingesetzt wurde. Es ist Bewunderung für 32<br />
Solisten, viele überragend, für einen kreativen Kraftakt,<br />
der weit mehr als die Summe seiner Teile hervorbrachte,<br />
nämlich das Universum eines Künstlers,<br />
der so viel von uns weiß, der unsere Gefühle in einer<br />
ungeheuren Klarheit wachruft. Natürlich wird sich<br />
das wieder alles relativieren, und die Kritiker haben<br />
ihr Besteck längst wieder zur Hand genommen.<br />
Aber so geht das ja nun schon seit 400 Jahren.<br />
Manchmal fühlen die sich an wie ein Tag.<br />
Foto (Ausschnitt): drama-berlin.de
DER NEUE KUNSTMARKT<br />
Es gibt viel zu entdecken:<br />
In den Galerien und auf den<br />
Messen, bei den Auktionen und<br />
im Kunsthandel brummt es trotz<br />
der Krise wie schon lange nicht<br />
mehr. Unser erweiterter<br />
Kunstmarkt bietet künftig auf<br />
zwei Seiten aktuelle Hintergrundberichte<br />
und Analysen,<br />
dazu Nachrichten und eine neue<br />
Kolumne, in der <strong>ZEIT</strong>-Autoren<br />
über ihr »Traumstück« schreiben<br />
NEUES VOM MARKT<br />
Schinkels Toilette<br />
Die Villa Grisebach öffnet sich den angewandten<br />
Künsten. Unter dem Titel »Orangerie« wird das<br />
Berliner Auktionshaus »besondere Objekte«<br />
anbieten: Möbel, Kunsthandwerk bis hin zu<br />
Autografen. Für den Aufbau der »Orangerie«-<br />
Auktion wurde der Kunsthistoriker Stefan<br />
Körner angeheuert, der bislang die Sammlungen<br />
der Fürsten Esterházy leitete. »Es geht uns um<br />
Objekte mit Aura und mit Geschichte«, erklärt<br />
Körner. Am 28. November kommen rund 30<br />
Lose zum Aufruf, darunter eine Königin-Luise-<br />
Büste von Christian Daniel Rauch, eine silberne<br />
Toilettengarnitur von Schinkel und ein Brief<br />
Schillers übers Theater.<br />
Koons’ Muskeln<br />
Bis vor Kurzem waren der Milliardär Ronald<br />
Perelman und der Galerist Larry Gagosian, der<br />
unter anderem Damien Hirst und Anselm Kiefer<br />
vertritt, Freunde. Jetzt verklagen sie sich gegenseitig.<br />
Gagosian habe ihn gedrängt, so Perelman,<br />
für vier Millionen Dollar eine Granitskulptur<br />
von Jeff Koons mit dem Titel Pop eye zu<br />
kaufen. Dabei sei ihm vorenthalten worden, dass<br />
Gagosian einen Vertrag mit Koons hat, der dem<br />
Künstler im Fall eines Wiederverkaufs 70 Prozent<br />
der Summe verspricht, die über die vier<br />
Millionen hinausgeht. Diese Information aber<br />
hätte den Sammler womöglich vom Kauf abgehalten,<br />
denn die hohe Marge für den Künstler<br />
verstärkt nicht unbedingt Gagosians Lust, Popeye<br />
irgendwann einmal zurück- oder weiterzuverkaufen.<br />
Das geheime Abkommen sei also ein<br />
finanzielles Handicap für ihn, so Perelman. Aber<br />
es ist noch komplizierter. Perelman soll die<br />
Skulptur dann zusammen mit drei anderen<br />
Kunstwerken und 250 000 Dollar bei Gagosian<br />
gegen ein ungenanntes Gemälde eingetauscht<br />
haben. Gagosian verklagt nun Perelman, weil<br />
dieser nicht gezahlt habe. Ein Novum, so Gagosian,<br />
noch nie habe er in den vergangenen 30<br />
Jahren einen Kunden verklagen müssen: »Solche<br />
Prozesse sind schlecht für die Kunden, für die<br />
Künstler und für die Kunstwerke.«<br />
»Neues vom Markt« wird erstellt von<br />
den Redaktionen der WELTKUNST und<br />
KUNST UND AUKTIONEN. Beide<br />
Magazine erscheinen im <strong>ZEIT</strong> Kunstverlag<br />
Abb.: Galerie De Jonckheere<br />
54 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> KUNSTMARKT<br />
Ein super<br />
Markt<br />
Die Pariser Biennale des Antiquaires ist die eleganteste<br />
Kunstmesse der Welt und ein Ort für Studien: Über die<br />
Geschmäcker der Superreichen VON TOBIAS TIMM<br />
Es ist die Kunstmesse der Superlative.<br />
Für die Sammler der eleganteste<br />
Ort weltweit, um sich im<br />
großen Stil Kunst und Antiquitäten<br />
anzueignen. Für die ausstellenden<br />
Händler die teuerste<br />
Messe von allen. Und die Besucher<br />
kommen zu Zehntausenden. Die Biennale<br />
des Antiquaires ist ein super Markt. Seit vergangenem<br />
Donnerstag und bis kommenden<br />
Sonntag ist er wieder geöffnet: Unter der monumentalen<br />
Glaskuppel des Grand Palais präsentieren<br />
sich diesmal 121 Galerien – gut dreißig Aussteller<br />
mehr als im Jahr zuvor. Kein Geringerer<br />
als Karl Lagerfeld hat diesmal das Bühnenbild<br />
für die Kunstmesse entworfen, sie sollte einfach<br />
noch schöner werden. In der Mitte der Halle<br />
schwebt nun ein großer, blau-weiß gestreifter<br />
Heißluftballon samt Gondel. Für die Galeristen<br />
baute Lagerfeld eine Fassadenkulisse, die mit<br />
dem grauen Pflasterstrandteppich und den aus<br />
Draht geformten Pseudogaslaternen an das Paris<br />
um 1900 erinnern soll – aber leider eher wie ein<br />
historisierendes Outletcenter anmutet.<br />
Wäre da nicht die angebotene Ware: Die Galerie<br />
Krugier aus Genf hat ein Gemälde von Cézanne<br />
mitgebracht, ein Bild mit Früchten, einer<br />
Tasse und einem nicht einmal zur Hälfte gefüllten<br />
Glas – für eine zweistellige Millionen-Euro-<br />
Summe. Rund 35 Millionen Dollar soll eine von<br />
Andy Warhols Liz-Taylor-Porträts auf dem Stand<br />
von L&M Arts (New York, Los Angeles) kosten.<br />
Und die Galerie De Jonckheere aus Paris, Brüssel<br />
und Genf hat ein von Lucas Cranach d. Ä. gemaltes<br />
Porträt des dänischen Königs Christian II.<br />
für 900 000 Euro im Angebot, dazu ein erstaunliches,<br />
protosurrealistisches Stillleben aus dem Jahr<br />
1659 mit Muscheln, Insekten und Blüten von<br />
Jan van Kessel für 750 000 Euro sowie eine Ernte<br />
von Pieter Brueghel d. J. für fünf Millionen Euro.<br />
Die Preise verraten es, diese Messe ist eine<br />
Feier des Luxus, sie bietet ein Panoptikum des<br />
Reichen-Geschmacks, und somit auch einen<br />
Ort für Studien, für eine Feldforschung zu den<br />
Geschmacksvarianten innerhalb der Internationale<br />
der Superreichen. Juweliere wie Bulgari,<br />
Cartier oder Wallace Chan aus Hongkong zeigen<br />
ihre neuesten Prunkstücke: Uhren, über<br />
und über mit Brillanten bepflastert, Zikaden<br />
aus Jade und Gold geformt oder Kristalllöwen,<br />
mit der Pranke theatralisch nach Diamantensternen<br />
greifend. Auffallend viele Asiaten stehen<br />
am Eröffnungstag Schlange vor diesen glitzernden<br />
Schaustücken.<br />
Etwas entspannter ging es nebenan in dem<br />
dämmrigen Raum der Librairie Thomas-Schel-<br />
ler zu, wo es eine Rarität ganz anderer Art gibt:<br />
die erste Karte Kanadas, Teil der Erstausgabe<br />
von Samuel de Champlains Reiseberichten ins<br />
»Neue Frankreich« (650 000 Euro). Dezent ist<br />
die Stimmung auch bei dem auf japanische<br />
Rüstungen spezialisierten Händler Charbonnier,<br />
der einen besonders spektakulären Helm<br />
ausstellte, einen Kawari Kabuto aus der Momoyama-Zeit<br />
(1573 bis 1603). Wie eine modern-abstrakte<br />
Skulptur mutet dieser Kopfschutz<br />
an: Über dem noch recht traditionell<br />
gestalteten, schwarzbraunen Eisenhelm ragt etwas<br />
auf, das eine komplizierte Faltung einer<br />
aufgerollten Seidenrolle darstellen soll. Wer hat<br />
diesen wunderbaren Helm getragen? War er ein<br />
Zierstück? Oder Teil einer Taktik, den Gegner<br />
im Kampf zu irritieren? Hyperrealistisch dagegen<br />
die schnauzbärtigen Masken aus der Edo-<br />
Zeit oder der Koi, ein Karpfen, aus fein gearbeiteten<br />
Eisenteilen zusammengesetzt (alle<br />
Preise auf Anfrage).<br />
So wie man die verschiedenen Typen von<br />
Reichen an ihren Schuhen (Pferdeleder handgenäht,<br />
Gucci oder Turnschuh) erkennen kann, so<br />
kann man die Antiquitätenhändler auf dieser<br />
Messe nach ihrem Fußbodenbelag einordnen.<br />
Die Händler kennen ihre jeweilige Klientel, und<br />
so inszenieren sie auch ihre Ware in der passenden<br />
Atmosphäre: Steinitz aus Paris präsentiert<br />
Kommoden aus dem 18. Jahrhundert ausschließlich<br />
auf original alten Parkett- und Steinböden,<br />
die umständlich ins Grand Palais transportiert<br />
wurden. Cheska Vallois zeigt ihre Artdéco-Möbel<br />
auf einem Teppich aus ebender<br />
Zeit. Und die auf schwülstige Orientalismen,<br />
auf Harems- und Basarszenen aus dem 19. Jahrhundert<br />
spezialisierte Galerie Ary Jan hat einen<br />
Stahlblechboden mit arabischem Ornament auslegen<br />
lassen. Auf dem darf zur Authentisierung<br />
der Atmosphäre sogar ein Brunnen plätschern,<br />
es fehlt nur der Ruf des Muezzin.<br />
Aber nicht nur die feinen Unterschiede der<br />
herrschenden Geschmäcker lassen sich auf dieser<br />
Biennale studieren, man erfährt hier auch viel<br />
über den Zustand des internationalen Kunstmarkts.<br />
Etwa, dass einige internationale Kunsthändler<br />
derzeit angeblich die superteuren, extrem<br />
seltenen Stücke lieber direkt zu ihren besten<br />
Kunden nach Katar, Abu Dhabi oder China<br />
bringen, statt sie auf einer Messe der breiteren<br />
Sammlerschar zu präsentieren. So mancher wählerische<br />
Supersammler, heißt es, kaufe Kunstwerke<br />
im Dutzende-Millionen-Euro-Bereich<br />
heute nur noch dann, wenn er das Recht des ersten<br />
Blicks habe und das Geschäft fernab der Öffentlichkeit<br />
einer Messe oder eines Auktionssaals<br />
abgewickelt werde – obwohl die Händler und<br />
Auktionatoren doch so gern mit ihren Kostbarkeiten<br />
werben.<br />
Vielleicht ist das der Grund dafür, dass im Vergleich<br />
zum vergangenen Jahr weniger Meisterstücke<br />
auf dieser Biennale zu sehen sind. Womöglich erklärt<br />
sich der Mangel aber auch einfach dadurch,<br />
dass diesmal die französischen Händler auf der<br />
Biennale weitgehend unter sich bleiben, und trotz<br />
der stark gestiegenen Anzahl an Ausstellern mehrere<br />
bedeutende Kunsthändler aus dem Ausland nicht<br />
mehr gekommen sind. Aus Deutschland etwa ist<br />
nur der Münchner Händler Dr. Riedl angereist.<br />
Die schöne<br />
Vielfalt der<br />
Arten:<br />
Stillleben<br />
von Jan<br />
van Kessel<br />
aus dem<br />
Jahr 1659<br />
Die geminderte Kauflust, von der mehrere Händler<br />
berichteten, mag hingegen ein Indiz für die gegenwärtige<br />
Stimmung bei der französischen Oberschicht<br />
sein. Vielleicht trauen sich die dortigen Vermögenden<br />
derzeit einfach nicht, hemmungslos zu shoppen – sei<br />
es wegen des neuen, ihnen nicht mehr ganz so gewogenen<br />
Präsidenten Hollande oder aus Angst vor einem<br />
Euro-Crash. Der von Lagerfeld installierte<br />
Heißluftballon jedenfalls blieb auch am dritten Tag<br />
der Messe stets einige Meter über dem Boden hängen<br />
und gab so ein schönes Bild für diese Ausgabe der<br />
elegantesten Kunstmesse der Welt. Er wollte und<br />
konnte einfach nicht in den Himmel aufsteigen.
KUNSTMARKT<br />
Auf dem aufgeräumten Tisch<br />
liegen iPad und iPhone. In<br />
schöner Regelmäßigkeit summen<br />
die Geräte und melden<br />
diskret den Eingang neuer E-<br />
Mails oder Anrufe. Wir sind in<br />
einer Galerie, in einer jungen<br />
noch dazu. Ihr Name: Kraupa-Tuskany. Der<br />
knapp 30-jährige Amadeo Kraupa-Tuskany betreibt<br />
sie gemeinsam mit seiner Partnerin Nadine<br />
Zeidler, einer Kunsthistorikerin. Seit 2011 zeigt<br />
das Duo meist junge, oftmals internetaffine<br />
Kunst von Künstlern wie AIDS-3D oder Florian<br />
Auer an einer selbst für Berliner Verhältnisse eher<br />
ungewöhnlichen Adresse. Kraupa-Tuskany residiert<br />
in einem ehemaligen Serverraum im vierten<br />
Stock eines alten Ostberliner Bürogebäudes direkt<br />
am Alexanderplatz. Wer den Aufzug nimmt<br />
und den nüchternen Bürogang hinuntergeht,<br />
erwartet hier alles, nur keinen Ausstellungsraum:<br />
Die Nachbarn sind Import-Export-Geschäfte<br />
und Vertreterbüros. »Es war uns wichtig, in ein<br />
Bürogebäude zu gehen«, erklärt Ziegler. »Das hat<br />
etwas Ehrliches.«<br />
Was treibt jemanden dazu, nach einem Boom-<br />
Jahrzehnt in den kriselnden Kunstmarkt einzusteigen?<br />
Was verkauft man da eigentlich und vor allem:<br />
wie? Nach Schätzungen gibt es etwa 400 Galerien<br />
in Berlin. Jedes Jahr schließen einige, dafür machen<br />
neue auf. Der Galerist ist der Zehnkämpfer des<br />
Kunstbetriebs: Er muss kalkulieren, verkaufen,<br />
spekulieren und dabei nicht nur die Kunstproduktion<br />
seiner Künstler, sondern auch die schwierigsten<br />
Sammler lange und geduldig begleiten. Den Besten<br />
gelingt es, ihre Künstler in strategisch wichtigen Ausstellungen<br />
zu platzieren und so möglichst geräusch-<br />
Intellektuell und sexy<br />
los für die Einordnung in kunsthistorische Zusammenhänge<br />
zu sorgen. Sprechen sie selbst über ihr<br />
Tun, dann klingt es ganz einfach. Er sehe sich als eine<br />
Art »Agent«, sagt Kraupa-Tuskany, als jemand, dem<br />
es darum gehe, »die Sachen an den Mann zu bringen,<br />
inhaltlich wie kommerziell«.<br />
Ist es diese Mischung aus intellektuellem Glamour<br />
und der Sexiness unternehmerischer Risikobereitschaft,<br />
die den Galeristen gegenwärtig zur<br />
heimlichen Leitfigur des Betriebs macht? Langsam,<br />
aber sicher hat das Galerist-Sein den freien Kurator<br />
als begehrten Trendjob der Kunstwelt abgelöst.<br />
Colin de Land ist heute cooler als Harald Szeemann.<br />
Der 2003 verstorbene Betreiber der New Yorker<br />
Galerie American Fine Arts ist das role model all jener,<br />
die in ihrem Tun mehr als Kunsthändler sein möchten.<br />
De Land steht nicht für schnelles Geld und ein<br />
Jetset-Leben. Vielmehr steht er für Markt-Distanz<br />
innerhalb desselben sowie für ein integratives Verständnis<br />
der Galerie als eines Ortes, an dem man das,<br />
was Kunst genannt wird, in einer engen Interaktion<br />
zwischen Künstlern, Galeristen, Kritikern und<br />
Sammlern gemeinsam herstellt.<br />
Der Grund für die anhaltende Attraktivität hängt<br />
also mit einem offeneren Begriff dessen zusammen,<br />
was eine Galerie gegenwärtig sein kann und muss.<br />
»Die Rollen im Kunstbetrieb mischen sich immer<br />
mehr, und eine Galerie ist ein sehr flexibles Format«,<br />
sagt Zeidler, die vor ihrem Einstieg in die Galerie als<br />
Kuratorin tätig war. In einer Landschaft zwischen<br />
notorisch unterfinanzierten und wenig risikobereiten<br />
Kunstinstitutionen stellt der Weg ins selbstständige<br />
(und nicht selten selbstausbeuterische)<br />
Unternehmertum oft die einzige Möglichkeit dar,<br />
einer neuen, eigenen Kunst zum Durchbruch zu<br />
verhelfen. Nicht wenige Idealisten haben deswegen<br />
inzwischen die Seiten gewechselt. »Wer früher Kurator<br />
oder Ausstellungsmacher war, ist heute Galerist«,<br />
sagt auch Waling Boers, der in der zweiten<br />
Hälfte der neunziger Jahre den bekannten Berliner<br />
Projektraum Büro Friedrich betrieb und seit 2005<br />
zusammen mit seinem Partner Pi Li die international<br />
erfolgreiche Galerie Boers-Li in Peking führt.<br />
Boers hatte es irgendwann satt, bei lokalen Verwaltungen<br />
um Geld für seinen Projektraum zu betteln.<br />
Die Arbeit als Galerist bedeutet für ihn finanzielle<br />
Unabhängigkeit: »Schwierige Kunst zu popularisieren<br />
– das machen die Galerien heute besser.«<br />
Wie Boers haben die meisten seiner Kollegen ein<br />
Vorleben im Betrieb. In Galerien oder Museen haben<br />
sie das Handwerk gelernt und Kontakte geknüpft.<br />
»Ein gutes Adressbuch ist schon wichtig«, sagt Christine<br />
Heidemann, die in Berlin seit 2009 ihre Galerie<br />
Reception betreibt. Zuvor war die promovierte<br />
Kunsthistorikerin als freie Kuratorin tätig und jobbte<br />
in Galerien. »Es hat mich irgendwann angestrengt,<br />
sich immer wieder an unterschiedliche Orten und<br />
Gegebenheiten anpassen zu müssen.« Sie sei eine<br />
»promovierte Galeristin«, sagt Heidemann und<br />
meint damit die geschmeidige Verbindung von<br />
Marktpräsenz und intellektuellem Anspruch.<br />
Ohne finanzielles Backing – durch Kredite,<br />
Erbschaften oder häufig auch durch stille Teilhaber<br />
– geht es gerade für junge Galerien nicht.<br />
Um am Markt durchzuhalten, braucht man<br />
Startkapital. Und das nicht zu knapp. Ausstellungs-<br />
und Lagerräume müssen gemietet werden,<br />
Computer angeschafft werden; Sammleressen<br />
müssen veranstaltet, Produktionskosten vorfinanziert<br />
werden. Vor allem aber schlagen die<br />
kostspieligen Messebeteiligungen zu Buche. »Auf<br />
Messen zu gehen ist extrem wichtig, um ernst<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 55<br />
Der Beruf des Galeristen ist der neue Traumjob im Kunstbetrieb. Doch wie wird man einer? VON DOMINIKUS MÜLLER UND KITO NEDO<br />
Agenten der<br />
Kunst: Die<br />
Berliner<br />
Galeristen<br />
Nadine<br />
Zeidler und<br />
Amadeo<br />
Kraupa-<br />
Tuskany<br />
genommen zu werden, auch in ökonomischer<br />
Hinsicht«, berichtet Heidemann. Eine verhältnismäßig<br />
junge und kleine Verkaufsveranstaltung<br />
wie die gerade zu Ende gegangene Berliner ABC<br />
ist mit 4000 Euro Teilnahmegebühr je ausgestelltem<br />
Künstler verhältnismäßig günstig. Für die<br />
Teilnahme auf großen Messen wie der Art Basel<br />
muss man gut und gern das Zehnfache investieren<br />
– wenn man eine der begehrten Zulassungen<br />
bekommt. Gerade in der notorisch klammen<br />
Stadt Berlin verspricht die Kombination aus<br />
Messeteilnahme und Verkäufen über das Internet<br />
den Erfolg: Kontakte knüpft man persönlich,<br />
dann schickt man ein Angebot via E-Mail hinterher.<br />
Im besten Fall beginnen danach die Geräte<br />
zu summen. »Wir haben schon in viele Städte<br />
verkauft«, sagt Kraupa-Tuskany, »aber nach Berlin<br />
bislang noch nichts.«<br />
ZAHL DER WOCHE<br />
20 000<br />
… Objekte hat die Warhol Foundation bei<br />
Christie’s eingeliefert. Die Stiftung trennt<br />
sich von ihrer Sammlung, um den Erlös, der<br />
auf mehr als 100 Millionen Dollar geschätzt<br />
wird, in Künstlerstipendien zu stecken.<br />
Nach einer Auktion in New York im<br />
November werden die meisten Lose von<br />
Februar an online versteigert.<br />
TRAUMSTÜCK<br />
Dürers »Schaustellung<br />
Christi« aus der Großen<br />
Holzschnittpasssion<br />
Ecce homo!<br />
Die Spekulanten haben Albrecht<br />
Dürer noch nicht entdeckt<br />
Kann man sich einen Dürer leisten? Ja, man kann.<br />
Auch in dem überhitzten Kunstmarkt von heute<br />
gibt es Bereiche, in denen erstrangige Werke größter<br />
Künstler zu vergleichsweise moderaten Preisen<br />
gehandelt werden; vielleicht weil sie ein Minimum<br />
an Kenntnis verlangen und sich nicht dekorativ an<br />
Wände hängen lassen. Einer dieser Bereiche ist die<br />
Alte Grafik (ein anderer die Kunst der Antike).<br />
Für die Kölner Auktion am 21. September lobt<br />
Venator & Haunstein eine Reihe von Kupferstichen<br />
und Holzschnitten Albrecht Dürers aus, darunter die<br />
komplette Kupferstichpassion von 1507–13, sechzehn<br />
gut erhaltene Blätter unterschiedlicher, aber stets kontrastreicher<br />
Druckqualität, zu einem Schätzpreis von<br />
15 000 Euro. Es werden aber auch Einzelblätter aus<br />
den beiden anderen Passionszyklen Dürers angeboten,<br />
aus der Kleinen Holzschnittpassion von 1511 und<br />
aus der kunsthistorisch berühmtesten, der Großen<br />
Holzschnittpassion von 1510. Letztere, in ihrem für<br />
die Zeit spek takulären Format von circa <strong>39</strong> mal 28<br />
Zentimetern, zeigen alle staunenswerten Neuerungen<br />
der Dürerschen Holzschnitttechnik, vor allem die<br />
bezwingende Plastizität durch Mitteltonschraffuren.<br />
Es sind Illustrationen zu einem lateinischen Text<br />
des humanistisch gebildeten Mönchs Benedikt<br />
Schwalbe, der die Passion Christi nicht aus der Bibel,<br />
sondern mit zeitgenössischen Nachdichtungen der<br />
Renaissance erzählt – Jesus ist hier vor allem Mensch<br />
mit menschlichen Empfindungen –, und dementsprechend<br />
zeitgenössisch gestaltet Dürer die Szenen<br />
und Figuren. Die Leiden Christi werden so nah wie<br />
möglich gerückt – als lautete das Motto »Jesu, wenn<br />
er heute lebte«. Mein Lieblingsblatt ist Die Schaustellung<br />
Christi, also jene Szene, in der Pontius Pilatus,<br />
der sich ums Urteil drückt, den gefangenen Jesus dem<br />
Volk zeigt, mit den seither geflügelten Worten: »Ecce<br />
homo« – »Seht, ein Mensch!«<br />
Das Blatt, dessen einzige Makel kleine Restaurierungen<br />
und ein Beschnitt des linken Randes<br />
über die Einfassungslinie hinaus sind, wird mit<br />
1200 Euro angeboten. Selbst wenn sich der Schätzpreis<br />
in der Auktion verdoppeln oder verdreifachen<br />
würde, bekäme man noch immer das Meisterwerk<br />
eines der größten Meister der Kunstgeschichte<br />
für eine Summe, für die man auf dem<br />
Schrottplatz der Gegenwartskunst nur ein höhnisches<br />
Lachen hören würde. – Die übrigen Dürer-<br />
Grafiken in der Auktion sind auf 750 bis 2000<br />
Euro geschätzt. JENS JESSEN<br />
Foto: Christoph Neumann für <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>/christoph-neumann.com, Kunstwerk im Hintergrund: »Hanging low (bitter sweet), <strong>2012</strong>, von Slavs and Tatars; Abb.: Venator & Hanstein KG
FEUILLETON<br />
Hier<br />
ist das<br />
Leben!<br />
Wie steht’s eigentlich um<br />
die Kunst der Gegenwart?<br />
Ein kleiner Erfahrungsbericht<br />
VON HANNO RAUTERBERG<br />
Ein Verlust ist zu vermelden, doch hält<br />
sich die Trauer in Grenzen. So gut wie<br />
niemand vermisst das große Kunstgerumpel<br />
von einst, all die schrillen,<br />
stinkenden, stechenden Gesten des<br />
Schocks und der Provokation. Heute mag kaum<br />
noch ein Künstler den Bürgerschreck geben. Kein<br />
Blutgesudel mehr, keine Selbstverstümmelungen<br />
im Namen einer höheren Wahrheit. Binnen weniger<br />
Jahre hat sich das Wollen und Wirken vieler<br />
Gegenwartskünstler gewandelt: Wo Gewalt war,<br />
ist jetzt Wohlgefallen. Wo Verzweiflung wohnte,<br />
weht ein milder Geist der Güte.<br />
Mitunter kann das sogar ein semireligiöser<br />
Geist sein, etwa auf der Mediations Biennale in<br />
Posen, die am vorigen Wochenende begann. Ungewöhnlich<br />
weihevoll geht es dort zu, vieles<br />
träumt, vieles raunt, vieles ist auf theatralische<br />
Weise gedämpft. Unter dem Motto »The Unknown«<br />
fahndet diese Biennale nach einer Kraft,<br />
die nicht zu greifen, die nur zu ahnen ist. Und<br />
nicht zufällig lassen sich die Kuratoren von christlicher<br />
Seite unterstützen.<br />
Allerdings, von Jesus, Maria und anderweitigem<br />
Kirchenpersonal wollen die Künstler nichts<br />
wissen. Für sie ist das Ungewusste vor allem das<br />
Ungefähre, sie halten die Dinge in der Schwebe.<br />
Der Koreaner Kibong Rhee zum Beispiel, der ein<br />
nachtblaues Aquarium nach Posen verbracht hat,<br />
BERLINER CANAPÉ<br />
INGEBORG HARMS<br />
Kollektive<br />
Feuerplätze<br />
Hier lesen Sie im Wechsel die Kolumnen<br />
»Klarer denken« von Rolf Dobelli,<br />
»Jessens Tierleben« von Jens Jessen und<br />
»Berliner Canapés« von Ingeborg Harms<br />
um dort im Strudel der Blasen einen höchst seltsamen<br />
Fisch treiben zu lassen, einen Bücherrochen,<br />
der beschwingt durchs Becken trudelt und<br />
mit seinen eng bedruckten Seiten winkt. Das<br />
schwere Wissen, hier scheint es schwerelos. Und<br />
egal, welche Wahrheit in diesem Buch stehen<br />
mag: Sie steht nicht fest. Sie ist nicht eingeklemmt<br />
zwischen zwei Deckeln, sondern entfaltet, wandelt,<br />
entblättert sich. Liquide Gelehrsamkeit.<br />
Daher kann man diesen Bücherfisch, obwohl<br />
wir ihn auf dieser Seite zeigen, eigentlich nicht abbilden.<br />
Man muss ihn mit den eigenen Augen sehen,<br />
wie er vom Wasserstrudel erfasst wird, sich<br />
sträubt, sich gleiten lässt. Er lässt sich nicht einfangen,<br />
von einer Kamera erst recht nicht.<br />
Und so ist es derzeit mit vielen Werken der<br />
Kunst. Auch wenn weiterhin fleißig gemalt und an<br />
Installationen gewerkelt wird, gibt es doch gerade<br />
etliche Künstler, die sich von der vertrauten Dingkultur<br />
abwenden. Sie wollen keine Objekte herstellen,<br />
nichts, was sich einfach an eine Wand hängen<br />
und auf der nächsten Auktion teuer verkaufen<br />
ließe. Nichts, was man rasch abknipsen und in die<br />
Welt hinaustwittern kann. Nein, ihre Kunst sucht<br />
das Hier und Jetzt, sie will im Augenblick aufgehen,<br />
körperlich spürbar, eine wahre, nondigitale Erfahrung.<br />
Es ist die Kunst der Präsenz.<br />
Wohin man auch schaut, überall ist derzeit Performance.<br />
Überall wandeln sich Ausstellungen in<br />
Clubs waren gestern, heute gibt es die »Valise<br />
Society«, eine Art mobilen Salon, den<br />
der seit einigen Jahren in Berlin lebende<br />
Kalifornier Tobias Tanner gegründet hat. In regelmäßigen<br />
Abständen lädt er an wechselnden Orten<br />
zum Cocktail oder Dinner ein und bringt so die<br />
mobile globale Szene in der deutschen Hauptstadt<br />
zusammen. Der jüngste Umtrunk im ULA, einem<br />
japanischen Restaurant in der Anklamer Straße,<br />
fand zu Ehren von Deanna Zandt, einer New<br />
Yorker Netzwerkberaterin für Aktivisten und<br />
NGOs, statt. Die Avantgarde braucht keine Drogen<br />
mehr, erklärte sie zu einem Glas Leitungswasser,<br />
»es geht um Emotionen, um Möglichkeiten,<br />
in Kontakt zu treten. Als die sozialen Medien<br />
auf kamen, wurden sie sofort begeistert angenommen.<br />
Wir wollen nicht allein sein.« Auf der TED,<br />
einer Art philosophischer Trendkonferenz, die<br />
diesen Sommer in Berlin stattfand, hat Zandt ihre<br />
eigene Biografie als zeittypisches Muster gedeutet:<br />
»Jeder Job, den ich je hatte, hat sich durch Freunde<br />
ergeben. Unsere Karrieren verlaufen nicht länger<br />
geradlinig.« Sie stimmt Marshall McLuhan zu, der<br />
Aufführungen, werden Museen zu Bühnen, auf<br />
denen gezetert, gelacht und sehr viel Blödsinn verhandelt<br />
wird. Manchmal geht es auch schwer meditativ<br />
zu, wie kürzlich in Berlin, als sich die riesige<br />
Halle des Hamburger Bahnhofs mit einer Kunst<br />
füllte, die nichts als Raum, Zeit und Licht sein<br />
wollte. Im tiefsten Dunkel erstrahlten klirrend helle<br />
Spots, als hätte der Leuchtstrahl eines Ufos das Museum<br />
erfasst. Und die Menschen duschten, badeten<br />
im Licht des Künstlers Anthony McCall, versuchten<br />
es zu ergreifen. Eine irreal-reale Erfahrung.<br />
So ähnlich ist es auch in vielen Räumen des<br />
belgischen Künstlers Hans op de Beeck, dessen<br />
traumhaft verlangsamte Kunst gerade erstmals groß<br />
in Deutschland zu sehen ist, im Kunstverein Hannover.<br />
Hier gibt es Räume, in denen der Künstler<br />
auf recht gewöhnliche Weise seine Modelle und<br />
Zeichnungen zeigt; andere Räume hingegen sind<br />
nicht mehr Raum, sie sind ganz und gar Bild, und<br />
dieses Bild verschluckt uns. Ein tableau vivant<br />
könnte man es nennen, wäre hier nicht alles, das<br />
zerwühlte Bett, der Tisch, das Sofa, selbst die Mandarine,<br />
steinhart und gänzlich grau. Alles Leben<br />
scheint erloschen, und wir sitzen mittendrin in<br />
dieser Erloschenheit, schauen aus dem Fenster und<br />
sehen einem Springbrunnen beim Plätschern zu. Es<br />
ist wie in einem David-Lynch-Film, mit dem Unterschied,<br />
dass es hier nur einen einzigen Darsteller<br />
gibt. Man kannte ihn bislang als »den Betrachter«.<br />
die mediale Revolution vorhersagte und schon vor<br />
50 Jahren das Ende der Linearität proklamierte.<br />
Ihm genügte das Phänomen des Radio-DJs, um<br />
die Rückkehr der Stammesgesellschaft mit ihren<br />
Buschtrommeln und kollektiven Feuerplätzen vor<br />
sich zu sehen. Kaum waren wir im Gespräch, da<br />
hatte Zandt mir schon einen Link geschickt, den<br />
ich, ganz linear, erst zu Hause studierte. Er handelte<br />
vom Neuroökonomen Paul Zak, der nachwies,<br />
dass intensives Twittern den Ausstoß von Oxytocin<br />
beflügelt, einem Empathiehormon, das für Gesundheit<br />
und ein langes Leben sorgt.<br />
Wissenschaftler der Washington University allerdings<br />
kamen zum selben Ergebnis, als sie mit<br />
Romanlesern experimentierten. Wie bei Social-<br />
Media-Anhängern reagierte auch ihre Chemie auf<br />
die Geschicke der fiktionalen Helden, als hätten sie<br />
sie leibhaftig miterlebt. Dass der einzige Buchtipp<br />
an diesem Abend vom jüngsten Teilnehmer, dem<br />
1989 in Ostberlin geborenen »Erfahrungsmanager«<br />
Felix Wieduwilt, stammt, zeigt allerdings noch keine<br />
Trendwende an. All die neuen Berufe, die im ULA<br />
zu Lachs-Tempura zusammenkamen, drehten sich<br />
Schwebende<br />
Wahrheiten:<br />
Der Koreaner<br />
Kibong Rhee lässt<br />
ein Buch durchs<br />
Aquarium trudeln<br />
Dieser Betrachter wird nun zum Erkunder und<br />
Entdecker, zu einem, der die Kunst mit allen Sinnen<br />
zu spüren bekommt – und manchmal auch<br />
Handstand auf ihr probt. So wie auf dem Horizon<br />
Field von Antony Gormley, das in diesem Sommer<br />
rund 120 000 Besucher in die Hamburger Deichtorhallen<br />
lockte. Nichts als eine große, polierte<br />
Fläche, aufgehängt in acht Meter Höhe – und doch<br />
sah man die Menschen selten derart begeistert. Sie<br />
stiegen die Treppe hinauf, wanderten in Socken<br />
oder barfuß über das schwarze Feld, viele saßen,<br />
hüpften oder beobachteten nur, wie andere diese<br />
hochabstrakte und doch ganz und gar unabstrakte<br />
Kunst für sich vereinnahmten. Manche fotografierten,<br />
aber die schwankende Erfahrung, das leichte<br />
Zittern, das manchmal durch die glatte Fläche lief,<br />
lässt sich so wenig auf einem Bild einfangen wie die<br />
heiter-beschwingte Stimmung.<br />
Die Erschöpfungsgesellschaft des 21. Jahrhunderts<br />
mag diese Art von Kunst. Sie mag die Besinnung<br />
ebenso wie das Ereignishafte. Und sie<br />
genießt es, wenn sich die alte Konfrontation –<br />
hier das Bild, dort der Betrachter – auflöst. Die<br />
Vereinzelung weicht der Kollektiverfahrung, einem<br />
Miteinander auf Zeit. Das kann manchmal<br />
schwülstig sein, manchmal kindergartenhaft albern,<br />
gelegentlich auch ergreifend. Die Kunst aber<br />
zeigt sich in diesen Werken, die keine Werke sein<br />
wollen, so lebendig wie schon lange nicht mehr.<br />
darum, wie sich das eigene Leben durch Netzwerken<br />
intensivieren lässt. Wieduwilt organisiert Unternehmenstreffen<br />
und private Dinner von Paris bis<br />
Tokio; Hunderson Sabbat bietet New-York-Besuchern,<br />
wie Tobias Tanner in Berlin, einen »kulturellen<br />
Escort-Service« an. Die Londonerin Anju Rupal<br />
ist ein »Angel Investor«, sie sammelt das nötige Geld,<br />
um Frauenhäuser und Kinderhorte in Indien und<br />
der Schweiz auf die Beine zu stellen: »Dafür habe<br />
ich keine Ausbildung«, sagt sie, »aber ein Netzwerk.«<br />
Sie plant ein indisches Äquivalent zum Body Shop<br />
und hat nebenbei eine Onlinepartnervermittlung<br />
gegründet, die auch die DNA der Interessierten<br />
berücksichtigen will.<br />
Wissenschaftliche Hilfestellungen sind in dieser<br />
Welt der Pragmatiker so wenig tabu wie pädagogische<br />
Katalysatoren. Spielerisches Lernen steht<br />
bei Deanna Zandt hoch im Kurs, auch wenn es<br />
wundert, dass die NGO-Beraterin zur Verbesserung<br />
des schulischen Alltags ausgerechnet Monopoly<br />
empfahl. Um das Stochern im Small Talk zu<br />
vermeiden, bat Tanner jeden Gast, drei Dinge zu<br />
benennen, zu denen er sich gern befragen lasse.<br />
Abb. (Ausschnitt): Ki-bong Rhee/ZKM, Karlsruhe/courtesy the artist and Kukje Gallery, Seoul<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 57<br />
Das Letzte<br />
Das EU-Parlament, weil man nicht immer nur<br />
über die Wirtschaftskrise beraten kann, möchte<br />
neue Lärm-Grenzwerte beschließen, da die<br />
Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgefunden<br />
hat, dass laute Motorengeräusche zu<br />
schlimmen Krankheiten führen. Etwa 50 000<br />
tödliche Herzinfarkte pro Jahr werden EU-weit<br />
von lauten Motoren verursacht!<br />
Vor wenigen Monaten haben Wissenschaftler<br />
vom Tufts Medical Center in Boston<br />
in einer Studie behauptet, dass die Gefahr, einen<br />
Herzinfarkt zu erleiden, um das Dreifache<br />
ansteigt, wenn man nur unregelmäßig Sex hat.<br />
Wer schon länger abstinent war, sollte lieber<br />
die Finger vom Geliebten lassen.<br />
Ein niederländisch-dänisches Forscherteam<br />
veröffentlichte Ende Juli in der renommierten<br />
Fachzeitschrift Archives of Internal Medicine<br />
eine Studie, in der aufgezeigt wurde, dass das<br />
Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, in den<br />
ersten zwei Wochen nach einer Hüft- oder<br />
Kniegelenkoperation deutlich erhöht ist.<br />
Im Februar haben amerikanische Universitäten<br />
in Miami und New York nachgewiesen, dass<br />
der regelmäßige Konsum von Diätgetränken<br />
das Risiko von Herzinfarkten massiv erhöht.<br />
Ein kanadisches Forscherteam hat nur vier<br />
Monate später die Entdeckung gemacht, dass<br />
Schichtarbeit ein Risikofaktor für Gefäßverkalkungen<br />
– und damit naturgemäß auch für<br />
den Herzinfarkt ist.<br />
An der Harvard-Universität in Boston hat<br />
man im März eindringlich vor dem Verzehr<br />
von rotem Fleisch gewarnt. Das steigere das<br />
Herzinfarktrisiko.<br />
Stockholmer Wissenschaftler hatten zuvor<br />
darauf aufmerksam gemacht, dass Zahnlücken<br />
zu erhöhtem Herzinfarktrisiko führen, es gibt<br />
erwiesenermaßen einen Zusammenhang zwischen<br />
Zahnhygiene und Herzkrankheiten.<br />
Vorschlag für Lebensmüde: Beißen Sie so<br />
hemmungslos in ein blutiges Steak, dass Ihnen<br />
ein Zahn ausfällt. Machen Sie dann eine Nachtschicht<br />
in einer Autobahngaststätte. Während<br />
des Kellnerns renken Sie sich, da Sie übermüdet<br />
sind, das Knie aus, und zwar so, dass eine Operation<br />
unerlässlich ist. Im Krankenhaus sollten<br />
Sie auf Diätgetränken bestehen. Sobald Sie<br />
entlassen werden, stürzen Sie sich bitte in eine<br />
Affäre – aber nur, wenn der letzte Beischlaf<br />
schon etwas her war. La petite mort, der kleine<br />
Tod, wie die Franzosen zum Höhepunkt sagen,<br />
sollte mühelos mit dem großen in eins fallen.<br />
Sollte Ihr Herz, wider Erwarten, all diese<br />
Schandtaten überstehen, hilft nur das Warten<br />
auf ein natürliches FINIS<br />
www.zeit.de/audio<br />
Ein Architekt aus Mailand schlug Mailand, Architektur<br />
und Feminismus vor. Der Leiter eines norwegischen<br />
Softwareunternehmens bot Künstliche Intelligenz,<br />
Ski und französische Frauen an. So füllte sich<br />
der Raum schnell mit Informationsknotenpunkten.<br />
Ich brauchte Tage, um das dichte Netz am PC zu entwirren.<br />
Jemand, der Einkaufsassistent für Versace<br />
gewesen war, kam nicht aus London oder New York,<br />
sondern aus »Boetzzettelerfehn« in Ostfriesland, wie<br />
er mir aufschrieb, 48 Einwohner, sagte er. Doch das<br />
musste eine Insider-Schreibweise sein, denn das Netz<br />
wusste nur von einem seit 1180 aktenkundigen<br />
Boek zeteler fehn. In der Willkommensadresse des<br />
Ortes wird denn auch betont, dass das Hochmoordorf<br />
»nicht auf dem Reißbrett« entstanden sei und<br />
dass »die Tatsache, dass sich fast jeder Boek zete ler in<br />
irgendeiner Weise in einem Verein engagiert«, sehr<br />
für die Dorfkultur spreche. Wir können also davon<br />
ausgehen, dass sich auch unsere Vorfahren schon zu<br />
vernetzen wussten und dabei nicht linear vorgingen.<br />
Clubs mögen out sein und mediale Salons im Kommen,<br />
aber die Oxytocin-Ausschüttung, die das deutsche<br />
Vereinswesen hervorruft, übersteht jede Krise.<br />
Illustration: QuickHoney für <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>/www.quickhoney.com/Peter Stemmler
Fotos (Ausschnitte): Vahid Salemi/AP (Teherean, 13.9.<strong>2012</strong>); Alex Trebus für <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> (u.)<br />
<strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>: Frau Ateş, fühlen Sie sich von dem<br />
Film Unschuld der Muslime beleidigt?<br />
Seyran Ateş: Nein. Ich grenze meinen Glauben an<br />
Gott ab von Menschen, die diesen Gott kritisieren.<br />
Ich fühle mich von so einem Film nicht persönlich<br />
angegriffen, sondern kann ihn diskutieren.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Aber müssten Sie als gläubige Muslimin<br />
nicht trotzdem beleidigt sein?<br />
Ateş: Wenn ich jemandem erlaube, mich zu beleidigen,<br />
nehme ich ihn ernst und gebe ihm Macht.<br />
Dass Beleidigungen ausgesprochen werden, heißt<br />
noch lange nicht, dass ich mich getroffen fühle.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Verstehen Sie, dass andere empört sind?<br />
Ateş: Ich weiß, dass es so ist, aber nachvollziehen<br />
kann ich es nicht. Natürlich lehne ich islamfeindliche<br />
Provokationen ab, wie wir sie von Vereinen<br />
wie Pro NRW kennen. Aber dieser Film wird nicht<br />
nur benutzt, um zu beleidigen, sondern auch, um<br />
demonstrativ beleidigt zu sein. Er kann nicht der<br />
wahre Grund der plötzlichen Gewalt sein, denn er<br />
steht ja schon seit sechs Monaten im Netz. Es<br />
kommt mir vor, als ob das Internet durchgescannt<br />
wurde nach einem Anlass für politische Ak tio nen<br />
im Namen des Islams.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Mit welchem Ziel?<br />
Ateş: Das ist die Frage. Woher kommt der extreme<br />
Hass auf den Westen, und wohin führt er? Die<br />
Fundamentalisten wollen Demokratie verhindern<br />
und die gesamte Gesellschaft nach religiösen Regeln<br />
gestalten. Gottes Wort ist ihnen Gesetz. Es<br />
soll auch für das Verhältnis der Bürger un ter einander<br />
gelten. Islamische Fundamentalisten wollen<br />
keine zivile Gesellschaft unabhängig vom Glauben.<br />
Deshalb hassen sie uns.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Die Demonstranten werfen dem Westen<br />
Blasphemie vor. Was heißt das?<br />
Ateş: Blasphemie ist Gotteslästerung und Verächtlichmachung<br />
des Glaubens und des Propheten.<br />
Wer so tiefreligiös ist, dass sein ganzer Alltag vom<br />
Glauben durchsetzt ist, der muss die Beleidigung<br />
Gottes persönlich nehmen und sich dagegen wehren.<br />
Jeder Kritiker des Islams ist für ihn ein Feind,<br />
egal ob die Kritik respektvoll oder respektlos geäußert<br />
wird. Der tiefgläubige Muslim ist verpflichtet,<br />
den Feind zu bestrafen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Aber muss er ihn töten?<br />
Ateş: Nein. Natürlich nicht. Nur in Pakistan, Saudi-Arabien,<br />
im Iran, in Afghanistan und neuerdings<br />
auch im Sudan steht auf Blasphemie die<br />
Todesstrafe, und sie wird aus dem Koran und den<br />
Hadithen abgeleitet. Aber das ist Auslegungssache.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Was steht denn im Koran?<br />
Ateş: Der Vers 4,89 besagt: »Wenn sie sich abkehren,<br />
dann greift sie und tötet sie, wo immer ihr sie<br />
findet.« Das bezieht sich zunächst auf die sogenannten<br />
Heuchler, aber auch auf Abtrünnige, also<br />
Apostaten. Schließlich wird der Vers kombiniert<br />
mit der neunten Sure, Vers 65/66: »Wolltet ihr<br />
denn über Gott und seine Zeichen und seinen Gesandten<br />
spotten? Entschuldigt euch nicht! Ihr seid<br />
ungläubig geworden, nachdem ihr geglaubt hattet.«<br />
Es gibt also keine Vergebung für diejenigen,<br />
die Gott verspotten. Auch die Sure 33,61: »Verflucht<br />
sind sie. Wo immer man sie trifft, wird man<br />
sie ergreifen und unerbittlich töten«, könnte herangezogen<br />
werden, um Gewalt gegen diejenigen zu<br />
rechtfertigen, die den Islam beleidigen. Also Blasphemie<br />
wird gleichgesetzt mit Unglaube, und Unglaube<br />
gilt als größte Sünde, die ein Mensch auf<br />
sich laden kann. Darauf steht der Tod. Wie gesagt,<br />
man kann das alles auch anders deuten.<br />
<strong>ZEIT</strong>: In der deutschen Rechtsprechung gibt es<br />
nur Rudimente eines Blasphemieverbotes, und<br />
zwar im Strafgesetzbuch.<br />
Ateş: Bei uns ist Gotteslästerung kein Straftatbestand.<br />
Der Strafparagraf 166 regelt, dass Verächtlichmachung<br />
oder Verhöhnung einer Religion dann<br />
strafbar ist, wenn die öffentliche Ordnung gefährdet<br />
wird. Das hat nichts zu tun mit Blasphemie, wie sie<br />
in islamischen Ländern unter Strafe steht. Dort darf<br />
man Gott und seinen Propheten nicht beleidigen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Die Gerichte berufen sich auf die Scharia.<br />
Ateş: Sie ist das sogenannte islamische Gesetz, aber<br />
kein einheitliches Werk für die gesamte islamische<br />
Welt, wie viele Menschen im Westen irrtümlich<br />
annehmen. Sie besteht zum einen aus religiösen Geboten<br />
und glaubenspraktischen Anweisungen und<br />
unter anderem aus zivilrechtlichen und strafrechtlichen<br />
Normen, inklusive konkreter Sanktionen und<br />
Strafparagrafen. Die Scharia wird in den verschiedenen<br />
Ländern aber ganz unterschiedlich ausgelegt<br />
und praktiziert. Je nach Rechtsschule und politischem<br />
System. Die Sunniten verstehen sie anders als<br />
die Schiiten, die Hanafiten anders als die Malikiten,<br />
um nur einige zu nennen. Der Iran behauptet zwar,<br />
es sei islamisches Recht, dass auf Blasphemie die<br />
Iranische Frauen<br />
protestieren in<br />
Teheran gegen den<br />
Film »Unschuld<br />
der Muslime« am<br />
13. September <strong>2012</strong><br />
»Beleidigt sind nur<br />
Fundamentalisten«<br />
Was heißt hier Blasphemie? Und wem nützt sie? Ein Gespräch mit<br />
der muslimischen Juristin und Menschenrechtlerin Seyran Ateş<br />
Todesstrafe steht. Trotzdem gilt sie in anderen islamisch<br />
geprägten Ländern nicht unbedingt.<br />
<strong>ZEIT</strong>: In der Türkei, Ihrem Herkunftsland, gibt es<br />
keinen Straftatbestand der Blasphemie.<br />
Ateş: Jedenfalls nicht auf Grundlage der Scharia.<br />
Weil die Türkei ein laizistischer Staat ist. Atatürk<br />
hat die Scharia abgeschafft.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Aber damit sind die religiösen Gefühle nicht<br />
abgeschafft, von denen jetzt so viel die Rede ist.<br />
Ateş: Die Abschaffung der Scharia in der Türkei<br />
sollte auch nicht die Re li gion abschaffen, sondern<br />
das weltliche Recht über das Gesetz Gottes stellen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Was halten Sie davon, den Film Unschuld<br />
der Muslime in Deutschland zu verbieten?<br />
Ateş: Nichts. Es ist fatal, wenn eine Re li gionsgemein<br />
schaft Strafgesetze nötig hat, um sich zu<br />
verteidigen, wenn also ihr Selbstwertgefühl zu<br />
schwach ist, sich in einer freien Gesellschaft zu behaupten.<br />
Unsere deutsche Rechtsprechung ist sehr<br />
vernünftig. Gerade weil wir die Versammlungs-<br />
und Meinungsfreiheit, die Kunst-<br />
und Pressefreiheit so stark machen, findet<br />
Gotteslästerung nur selten statt.<br />
Wenn wir die Aufführung verbieten,<br />
schließen wir uns dem Streit der Extremisten<br />
auf beiden Seiten an. Ich halte es<br />
für besser, ganz demokratisch gegen den<br />
Kirchenverbrechen bleiben Kirchensache<br />
Von dem Kölner Kardinal Joachim Meisner ist die<br />
Anekdote überliefert, wie ihn einmal eine fromme<br />
Muslimin durch tätige Empörung beschämte und<br />
zum Nachdenken über seine eigene Laxheit bei der<br />
Verteidigung des christlichen Glaubens brachte.<br />
Der Kardinal wurde nämlich Zeuge, wie eine Verschleierte<br />
an einem Zeitungskiosk pornografische<br />
Magazine runterriss, und da dachte er bei sich:<br />
Warum habe ich das nicht gemacht?<br />
Vielleicht müsste man sich als katholischer Bischof<br />
mal wieder so richtig über die Kirchenfeinde<br />
aufregen. Vielleicht müsste man die Gotteslästerlichkeit<br />
der westlichen Welt leibhaftig bekämpfen. Viel-<br />
GLAUBEN & ZWEIFELN<br />
leicht würde man dann wieder ernst genommen, ja<br />
gefürchtet, anstatt sich täglich mit unbotmäßigem<br />
Kirchenvolk rumzuschlagen. So denken in diesen<br />
hitzigen Tagen des Blasphemie-Streites wohl manche<br />
Kirchenhierarchen, zumal sie ein weltliches Gesetz<br />
gegen Gotteslästerung für Deutschland fordern.<br />
Muss man Pornomagazine vernichten, um ein<br />
guter Katholik zu sein? Muss man sich empören<br />
über Blasphemie? Muss man nicht, sagen selbst<br />
katho lische Kirchenrechtler. Auf die Beleidigung<br />
religiöser Gefühle etwa durch unzüchtige Magazine<br />
muss man nicht mit heiligem Zorn reagieren. Auch<br />
nicht auf Bilder gekreuzigter Schweine oder Spiel-<br />
Film und dessen Vorführer vorm Kino zu demonstrieren.<br />
So sehen wir die Gesichter der Rassisten<br />
und stehen weiterhin für die Meinungsfreiheit.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Der katholische Schriftsteller Martin Mosebach<br />
fordert, dass Blasphemie auch bei uns strafbar<br />
sein soll. Katholische Bischöfe pflichten ihm bei.<br />
Ateş: Das halte ich für Unsinn. Denn in diesem<br />
Land ist genug Platz für den Glauben. Wo aber Reli<br />
gion nur der Abgrenzung dient, stellt sie sich gegen<br />
die Demokratie. Und wo Re li gion nach Strafen<br />
schreit, beginnt der Krieg gegen die Aufklärung und<br />
gegen jene Freiheiten, von denen hierzulande alle<br />
Kirchen und Glaubensgemeinschaften profitieren.<br />
Auch ihre Wahrheit muss kritisierbar bleiben. Beleidigt<br />
werden kann im Grunde nur der Fundamentalist.<br />
Solchen Fundamentalismus zu bekämpfen<br />
sollte auch Aufgabe der Gläubigen sein.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Und was soll der säkulare Staat tun?<br />
Ateş: Sich raushalten. Nur im Einzelfall, wenn es<br />
Konflikte gibt, soll er entscheiden, welches<br />
Recht hier Vorrang genießt. Dass islamfeindliche<br />
Vereine Mohammed-Karikaturen vor<br />
Moscheen zeigen dürfen, ist unschön, aber<br />
gehört zur Meinungsfreiheit. Der Strafparagraf<br />
166 schützt die öffentliche Ordnung,<br />
nicht die Re li gion. Karikaturen sind in unserer<br />
zivilen Gesellschaft keine Straftat.<br />
filme, in denen eine Christin das Kreuz zum Masturbieren<br />
benutzt – um nur zwei deutsche Fälle aus<br />
jüngster Zeit zu nennen. Denn man kann sich als<br />
Katholik auch an die Devise der europäischen Aufklärung<br />
halten, dass die Idee, Gott müsse von den<br />
Menschen gegen Beleidigung verteidigt werden,<br />
einem kleinlichen und daher unzutreffenden Gottesbild<br />
folgt.<br />
Selbstverständlich gibt es im kanonischen Recht<br />
den Straftatbestand der Blasphemie. Artikel 1369<br />
rechnet sie zu den Kirchenverbrechen: »Wer in einer<br />
Aufführung oder Versammlung oder durch schriftliche<br />
Verbreitung oder sonst unter Benutzung von<br />
<strong>ZEIT</strong>: Es gibt aber Leute, die gern den Seelenfrieden<br />
der Rechtgläubigen stören. Das Satiremagazin Titanic<br />
hat soeben einen Prozess gewonnen, den der<br />
Vatikan gegen das Bild eines besudelten Papstes angestrengt<br />
hatte. Warum ist solche Satire erlaubt?<br />
Ateş: Weil sie ein Teil unseres kritischen Denkens<br />
ist. Wenn wir bös arti ge Kritik verbieten, müssen<br />
wir irgendwann alle Kritik verbieten.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Dürfen religiöse Gefühle also in unserer<br />
Rechtsprechung keine Rolle spielen?<br />
Ateş: Doch. Aber das Recht schützt die Religionsgemeinschaften,<br />
keine Gefühle und keinen Gott.<br />
Das ist ein Beleg unserer Rechtsstaatlichkeit, nicht<br />
Ermunterung zum Schmähen von Glaubenden.<br />
Unser Staat will kein verlängerter Arm einer bestimmten<br />
Religion sein. Obwohl die Bürger dieses<br />
Landes mehrheitlich Christen sind, spielt sich die<br />
Regierung nicht als Wächter über die Unantastbarkeit<br />
des Christengottes auf.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Und was ist mit der Politik?<br />
Ateş: Ich halte es mit Dolf Sternberger, der sagt:<br />
Keine Freiheit den Gegnern der Freiheit, keine Toleranz<br />
den Gegnern der Toleranz. Religiöse Fanatiker<br />
haben vor niemandem außerhalb ihrer Re li gion<br />
Respekt. Sie sind selbstherrlich und größenwahnsinnig,<br />
deshalb darf man sie auch politisch nicht<br />
ernst nehmen. Ihre religiösen Gefühle sind in mei-<br />
SEYRAN ATEŞ wurde 1963 in der Türkei geboren sich für Integration. Sie streitet gegen das<br />
und kam mit sechs Jahren nach Kopftuch und forderte einen Straftatbestand<br />
Berlin. Die Juristin war Mitglied der Zwangsverheiratung. Für ihr Buch »Der<br />
der Islamkonferenz und engagiert Multikulti-Irrtum« wurde sie von radikalen<br />
sozialen Kommunikationsmitteln eine Gotteslästerung<br />
zum Ausdruck bringt, die guten Sitten schwer<br />
verletzt, gegen die Religion oder die Kirche Beleidigungen<br />
ausspricht oder Hass und Verachtung hervorruft,<br />
soll mit einer gerechten Strafe belegt werden.«<br />
Diese Strafe aber ist eine geistliche Strafe, sie hat<br />
keine Entsprechung im weltlichen Recht – und das<br />
ist ein Fortschritt, finden hierzulande selbst Kanonisten.<br />
Religiöse Gefühle sind kein objektivierbares<br />
Kriterium, ihre Verletzung hat deshalb in der Rechtsprechung<br />
einer Demokratie nichts zu suchen. Atheisten<br />
beispielsweise müssen keinen Respekt vor dem<br />
Glau ben zeigen, nur vor der Person des Gläubigen.<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 58<br />
nen Augen keine religiösen Gefühle, sondern Ressentiments.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Die Kanzlerin hat die Mohammed-Karikaturen<br />
verteidigt und erntet dafür nun den Hass der<br />
Fanatiker. Hätte die Pfarrerstochter Angela Merkel<br />
gottesfürchtiger sprechen sollen?<br />
Ateş: Nein. Denn sie muss sich an unseren eigenen<br />
Maßstäben orientieren. Sie kann nicht nach den<br />
Maßstäben eines Gottesstaates wie des Irans handeln.<br />
Demokratie darf sich nicht verleugnen. Es<br />
gibt im Westen längst eine fatale Tendenz dazu.<br />
Man knickt vor den Fundamentalisten ein und<br />
warnt stattdessen vor respektloser Religionskritik.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Haben Sie kein Verständnis für eine Politik<br />
der Deeskalation?<br />
Ateş: Nein, weil sie den religiösen Eiferern nützt.<br />
Wir haben mittlerweile eine überspitzte Sensibilität<br />
gegenüber dem Islam. Eine meiner Klientinnen<br />
musste ihren Job als Lehrerin aufgeben, weil es ihr<br />
unmöglich war, die überwiegend muslimischen<br />
Schüler für ihr Verhalten zu kritisieren. Die empfanden<br />
das als Beleidigung. Oder nehmen wir das<br />
Kopftuch. Es wird so gründlich toleriert, dass die<br />
politischen Motive dafür kaum noch Beachtung<br />
finden. Wer es kritisiert, gilt als religionsfeindlich.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Das Kopftuch ist ein religiöses Symbol.<br />
Ateş: Es ist Symbol der Geschlechtertrennung, also<br />
einer politischen Haltung innerhalb der Religion.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Wurden Sie auch schon einmal als Gotteslästerer<br />
beschimpft?<br />
Ateş: Nicht so direkt, aber als Islamfeindin. Ich bin<br />
in der Islamkonferenz angegriffen worden, dass ich<br />
eigentlich keine Muslimin sei.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Wegen Ihrer liberalen Positionen wurden Sie<br />
mehrfach mit dem Tod bedroht. Sie mussten jahrelang<br />
in der Anonymität leben und stehen auch jetzt<br />
unter Personenschutz.<br />
Ateş: Ja, da gab es immer wieder den Vorwurf, ich<br />
würde den Islam beleidigen. Und wenn ich nicht<br />
aufhöre, würde man mich töten. Der entscheidende<br />
Punkt ist, dass die Bedroher meine Bücher nicht lesen<br />
und die Meinungsfreiheit einschränken wollen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Ärgern Sie sich eigentlich mehr über blasphemische<br />
Filmemacher, die den Hass des Mobs<br />
entsichern, oder über den Hass selbst?<br />
Ateş: Weder – noch. Ich ärgere mich am meisten<br />
über die Masse der Ignoranten, die sich einschüchtern<br />
lassen. Die Provokateure und die Fanatiker<br />
kommen für mich an zweiter und dritter Stelle.<br />
Schlimmer sind die Gleichgültigen, die nicht mitwirken<br />
an der Stärkung unserer Demokratie.<br />
Schlimmer sind die Relativisten, die nicht aufstehen,<br />
um die Meinungsfreiheit zu verteidigen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Nachdem neulich Salafisten in deutschen<br />
Städten den Koran verteilt haben und dann Christen<br />
die Bibel, beteiligten Sie sich an einer Ak tion<br />
zur Verteilung des Grundgesetzes. Warum?<br />
Ateş: Weil ich Verfassungspatriotin bin. Die Aktion<br />
kam von muslimischen Frauen. Wir wollten<br />
zeigen, dass es auch Muslime gibt, die säkular denken<br />
und sich dem Grundgesetz verpflichtet fühlen.<br />
Für uns ist der Glaube Privatsache. Es muss aufhören,<br />
dass im Westen nur muslimische Kopftuchfrauen<br />
sichtbar sind und dass nur als Muslim<br />
gilt, wer ständig den Koran vor sich herträgt.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Was sagen Sie den Islamophoben, die Ihre<br />
Religion für unaufklärbar halten?<br />
Ateş: Dass das nun wirklich eine Verhöhnung des<br />
Islams ist – aber von der Meinungsfreiheit gedeckt.<br />
Ich würde die Behauptung nie unter Strafe stellen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Was tun Sie stattdessen gegen Islamhass?<br />
Ateş: Argumente vorbringen und authentisches<br />
Verhalten an den Tag legen. Mich zur Freiheit<br />
bekennen und trotzdem an Allah glauben.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Endlich fällt der Name Allahs. Muss ein<br />
Muslim ihn wirklich nicht gegen Hohn verteidigen?<br />
Ateş: Ich würde erst einmal das Niveau der Verhöhnung<br />
prüfen. Der Film Das Leben des Brian ist<br />
ein Kunstwerk, aber das Video Unschuld der Muslime<br />
ist ein Machwerk. Die Satire von Monty<br />
Python soll die Leute zum Lachen bringen. Das<br />
grottenschlechte Video soll Hass schüren. Aber<br />
Gott ist über den Hass erhaben.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Auch über blasphemische Witze?<br />
Ateş: Das Lachen über etwas, was uns heilig ist,<br />
gehört zu den menschlichen Eigenheiten, die vom<br />
Wunsch eines liebenden Gottes getragen sind.<br />
Daran glaube ich ganz fest. Weder Allah noch der<br />
christliche Gott lassen sich beleidigen. Deshalb<br />
können wir Gläubigen durch Gelassenheit zur Befriedung<br />
der Welt beitragen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Ist Ihnen denn gar nichts heilig?<br />
Ateş: Doch. Ich glaube, dass wir Muslime einen<br />
viel toleranteren Gott haben, als viele denken.<br />
Das Gespräch führte EVELYN FINGER<br />
Muslimen angefeindet. Wegen Todesdrohungen<br />
gab sie zeitweise ihre Anwaltstätigkeit<br />
auf. Zuletzt erschien »Der<br />
Islam braucht eine sexuelle Revolution«<br />
Mag sein, dass der christliche Glaube von der<br />
christlichen Person schwer unterscheidbar ist. Aber<br />
wenn der Staat die Unterscheidung nicht träfe,<br />
müsste er Blasphemie tatsächlich ahnden und<br />
agierte bald als Gesinnungspolizei. Blasphemisch<br />
sind ja nicht nur gewisse Hetzvideos, blasphemisch<br />
ist auch die Meinung, dass es keinen Gott gibt. Das<br />
Überwachen und Strafen finge also bei einem Film<br />
an. Und wo hörte es auf? Vielleicht hätten christliche<br />
Freunde eines weltlichen Blasphemiegesetzes<br />
gern, dass Christen sich wieder mehr aufregen.<br />
Aber Aufregung allein ist kein Glaubensbeweis.<br />
Nein, auch nach dem Kirchenrecht nicht. EF
REISEN<br />
Berlins größter Spielplatz<br />
Weitläufi ger als der New Yorker Central Park, überschaubar wie eine Steppe: Der stillgelegte Flughafen Tempelhof zieht Modellfl ieger,<br />
Gärtner und Lebenskünstler an. Die Berliner verteidigen ihr Stück Anarchie gegen Bebauungspläne des Senats VON HANS W. KORFMANN<br />
Ein dünner Nebelschleier liegt über<br />
dem hohen Gras. Es duftet nach Erde<br />
und letzten Spätsommerblüten. Alles<br />
ist grau, nur weit im Osten, am anderen<br />
Ende der Ebene, mischt sich eine<br />
erste Spur von Rot ins Morgengrauen. Dann steigt<br />
die Sonne auf. Dunkel zeichnen sich Eichen am<br />
Horizont ab. In der Ferne, am Südrand der Fläche,<br />
zieht klein wie eine Spielzeugeisenbahn die Lichterkette<br />
einer S-Bahn vorüber.<br />
Am nördlichen Rand des Wiesenmeers sitzt in<br />
der Nähe einer Baumgruppe ein Fuchs. Er wartet<br />
auf einen kleinen Mann, der jeden Morgen<br />
kommt und ihm etwas zu essen bringt. »Der kann<br />
nicht mehr jagen, der hat was am Bein, genau wie<br />
ich«, sagt der Rentner und holt eine Stulle für das<br />
hinkende Tier aus der Tasche.<br />
Fuchs und Rentner sind die Einzigen, die,<br />
wenn es hell wird, auf dem riesigen Gelände zu<br />
sehen sind. Einst war es Ackerland zwischen dem<br />
Dörfchen Tempelhof und der kleinen Stadt an<br />
der Spree. Später landeten hier die ersten Flugzeuge.<br />
Bald war der Flughafen von einem Häusermeer<br />
umgeben, von Neukölln, Kreuzberg und<br />
Tempelhof, drei Ortsteilen inmitten der lauten<br />
Weltstadt Berlin. Doch seit im Herbst 2008 das<br />
letzte Flugzeug den Airport verließ, seit plötzlich<br />
Stille eingekehrt ist, liegt das Feld außerhalb von<br />
Raum und Zeit.<br />
Wie aus der Vergangenheit dringt von Süden<br />
das Läuten eines Kirchturms herüber – als läge<br />
dort hinten, zwischen Feldern, noch immer das<br />
Gut der Templer. Und so winzig erscheinen im<br />
Osten die Dächer von Neukölln, als wären sie<br />
eine Tagesreise entfernt. Der »Park der Tempelhofer<br />
Freiheit«, wie er heute heißt, ist größer als<br />
der Tiergarten, größer als der Central Park, aber<br />
so flach und übersichtlich wie ein Fußballfeld.<br />
Wie fünfhundert zusammengelegte Fußballfelder.<br />
Diese Weite in der Großstadt hat etwas Magisches,<br />
und sie zieht immer mehr Menschen an,<br />
aus Berlin und der ganzen Welt.<br />
Nach dem Fuchs und dem Rentner tauchen<br />
die ersten Radfahrer auf. Sie nutzen die beiden<br />
über zwei Kilometer langen Start- und Landebahnen<br />
als autofreie Ost-West-Achse. Jogger laufen<br />
auf dem Flugfeld ihre Runden. Spaziergänger<br />
führen ihre Hunde aus. Allmählich löst sich der<br />
Nebel aus den Gräsern des verwilderten Rasens<br />
und steigt in den Himmel auf. Wenn die Sonne<br />
höher steht, zeigt sich der erste bunte Punkt an<br />
der weiten blauen Kuppel: der Hubschrauber von<br />
Christian Sigora. »Ich komme am liebsten so um<br />
zehn. Später sind zu viele Leute hier.« Senkrecht<br />
steigt der rote Modellhubschrauber in den Himmel,<br />
dreht Loopings und verrückte Schrauben,<br />
um am Ende brav vor den Füßen des Meisters zu<br />
landen. Die kleinen Fluggeräte gingen in Tempelhof<br />
an den Start, nachdem die großen abgeflogen<br />
waren. Abends, wenn die Sonne sinkt, kleben die<br />
Modellpiloten farbige Lichter unter die Tragflächen<br />
ihrer Spielzeuge, die dann wie bunte Glühwürmchen<br />
durch die Nacht schwirren.<br />
Bald bekommt der Hubschrauber Gesellschaft<br />
von zwei Drachen. Sie gehören André und Andor,<br />
die mit Sturzhelmen, Rucksäcken und Skateboards<br />
angerückt sind. »Das ist der einzige Spot<br />
im Umkreis von 100 Kilometern«, sagt André.<br />
»Und das mitten in der Stadt. Du kannst da einfach<br />
mit der U-Bahn hinfahren!« Es sind nicht<br />
nur die langen Asphaltstreifen, die die Kite-Piloten<br />
locken: »Auf dieser riesigen Fläche hast du immer<br />
Wind. Und keine Bäume, in denen du hängen<br />
bleibst. Das ist einmalig. Manchmal sind fünfzig<br />
Kites in der Luft, ich hab sie mal gezählt.«<br />
Doch noch ist reichlich Platz im Luftraum<br />
über dem Park, und auch am Boden wird es nicht<br />
eng. Nur bei der Baumgruppe im Norden stehen<br />
zwei Campingstühle. Darin sitzen zwei Menschen<br />
und lesen. »Hier findest du immer eine<br />
Ecke, wo du komplett ungestört<br />
bist.« Ebenso ungestört fühlt<br />
sich ein junges Paar im Schutz<br />
des hohen Grases.<br />
Auch später am Tag,<br />
wenn mehr und mehr Besucher<br />
den alten Flughafen<br />
bevölkern, bleibt die<br />
Magie der Leere erhalten.<br />
Die Menschen gehen<br />
ein in diese Landschaft,<br />
weit zerstreut im<br />
dichten Grün erinnern sie<br />
an die Tiere der Serengeti, die<br />
unter den breiten Schirmen vereinzelter<br />
Bäume lagern.<br />
Tiergarten<br />
Charlottenburg<br />
Wilmersdorf<br />
Marienfelde<br />
BERLIN<br />
Mitte<br />
Kreuzberg<br />
TEMPELHOFER FELD<br />
Es ist Mittag, Christian Sigora packt<br />
seinen Hubschrauber ein. Mittlerweile herrscht<br />
lebhafter Flugbetrieb, Drachen in allen möglichen<br />
Farben und Formen bevölkern den Himmel. Drachen<br />
von alten Männern und kleinen Mädchen,<br />
von Bastlern, die 180 kleine Rauten an eine einzige<br />
Schnur reihen und sie wie eine bunte Himmelsleiter<br />
ins Blau hinaufschicken. Streetsurfer<br />
kreuzen mit ihren Segeln auf den Asphaltstreifen<br />
durch das Wiesenmeer, Mütter schieben Kinderwagen.<br />
Hunderte Menschen sind jetzt unterwegs.<br />
»Es gibt keine Regeln, keine Straßenverkehrsordnung,<br />
und alles funktioniert trotzdem! Das ist<br />
Anarchie, ein kleines Stück Freiheit«, sagt Christian<br />
Puder vom Neuköllner Stadtteilgarten Schillerkiez,<br />
einem der Pionierprojekte, die sich im<br />
Osten der Ebene ansiedeln durften. Das Projekt<br />
ist so etwas wie die grüne Außenstelle eines Bürgerzentrums,<br />
ein gemeinschaftlicher Schrebergarten.<br />
»Wir waren total überrascht, dass wir unsere<br />
großen Blumenkästen und unsere Sessel hier aufstellen<br />
durften.«<br />
Die Pachtverträge der Neuköllner sind jedoch<br />
jederzeit kündbar, sie sind sogenannte Zwischen-<br />
<strong>ZEIT</strong>-GRAFIK<br />
3 km<br />
nutzer. Am Ende, so fürchten sie, kommen die<br />
Bagger. Die Stadt Berlin hat Pläne mit dem Areal.<br />
Aber noch krabbeln zwischen den Blumen, Kürbissen<br />
und meterhohen Stangenbohnen der mobilen<br />
Beete die Babys, sitzen auf ausgedienten<br />
Sofas und zusammengenagelten Liegestühlen<br />
Mütter in der Sonne. Ein Mann spielt Geige, von<br />
Ferne klingt ein Saxofon, auf der Wiese steht ein<br />
nackter Yogi seit fünf Minuten auf dem Kopf,<br />
während seine Freundin vom Lotossitz aus den<br />
Blick über die Landschaft schweifen lässt.<br />
Die Stadtgärtner gehören längst zum Sightseeing-Programm,<br />
Touristen kommen und stellen<br />
Fragen. »Wir haben schon überlegt, ob wir eine<br />
Sprachbox installieren, mehrsprachig, damit wir<br />
nicht so viel reden müssen«, sagt Puder. »Gestern<br />
war einer aus Togo da, und der fragte das Gleiche<br />
wie das ZDF letzte Woche.« Wer die Gärtnerei erlaubt<br />
habe, und warum niemand die Tomaten<br />
klaue, obwohl es doch keinen Zaun gebe.<br />
Die Besucher fotografieren Franks<br />
Sonnenstudio, diese Symbiose<br />
von Liegestuhl und Gewächs-<br />
Lichtenhaus mit drei Wänden aus<br />
berg Fensterflügeln und der offenen<br />
Tür nach Süden.<br />
»Ich hab hier im Februar<br />
mit nacktem Oberkörper<br />
Neukölln gesessen, bei offener Tür.<br />
18 Grad Innentemperatur!«<br />
Dann richten sie ihre<br />
Kameras auf all die anderen<br />
Treptow kleinen Gartenkunstwerke,<br />
die Blumen, die aus alten<br />
Schuhen, einem Autospoiler, aus<br />
einem platten Fußball sprießen, all<br />
diese kleinen Symbole des Sieges der<br />
Natur über die Zivilisation.<br />
Die wachsende Beliebtheit der Tempelhofer<br />
Freiheit missfällt dem Berliner Senat. Er will mehr<br />
als nur eine Wiese, auf der sich jeder wohlfühlt, er<br />
möchte Breschen in die Wildnis schlagen, Sport- und<br />
Spielplätze bauen, die Steppe mit einem künstlichen<br />
See und einem Kletterberg anreichern. Und am<br />
Rand des Geländes luxuriöse Wohnviertel errichten.<br />
»Brauchen wir nicht!«, sagt Michael Stachowicz,<br />
ein Rentner aus der Nachbarschaft, der Lust<br />
auf eine Brezel im bayerischen Biergarten hatte<br />
und unter der Baumgruppe am Steppenrand sitzt.<br />
»Jedes Haus, das hier gebaut wird, ist eines zu<br />
viel.« Doch der Senat hört nicht auf Stachowicz.<br />
60 Hektar sollen bebaut werden. Das ist zwar nur<br />
ein Sechstel der Tempelhofer Freiheit, einer der<br />
größten innerstädtischen Freiflächen der Welt.<br />
Aber Freiheit ist unteilbar. Schon im kommenden<br />
Jahr könnte es losgehen, und 2020 soll die Wiese<br />
den Architekten der Internationalen Bauausstellung<br />
zur Verfügung stehen.<br />
Nur ungern geben die Planer der stadteigenen<br />
Gartenfirma Grün Berlin und der zur Entwick-<br />
lung des Areals eigens gegründeten Tempelhof<br />
Projekt GmbH zu, dass der stillgelegte Flughafen<br />
offensichtlich mehr Besucher anzieht als irgendeine<br />
andere der städtischen Grünanlagen. Dass<br />
der Wildwuchs in der Mitte der deutschen Hauptstadt<br />
attraktiver ist als jeder gestaltete Park. Selbst<br />
der Senator für Stadtentwicklung erklärte: »Die<br />
Menschen haben sich diese Fläche erobert.« Und<br />
Kreuzbergs Bürgermeister fügte hinzu: »Es gibt<br />
keine Brache in dieser Stadt, die von den Berlinern<br />
so schnell besetzt wurde wie diese.«<br />
Die Sonne hat den höchsten Stand überschritten,<br />
Menschenmassen ziehen über den Columbiadamm<br />
am Nordrand des Parks. Benannt ist er nach der<br />
blechernen Miss Columbia, die 1927 nach 43 Stunden<br />
über dem Atlantik auf dem Feld von Tempelhof<br />
landete. Sie kommen mit Taschen, Decken, Picknickkörben<br />
und Sonnensegeln, mit Bällen, Boulekugeln<br />
und Schachspielen, mit Frisbeescheiben und<br />
Federballschlägern, mit Freunden und Frauen und<br />
Gästen. Sie sind braun oder weiß oder schwarz, sie<br />
tragen Turbane, Baseballkäppis, Kopftücher und<br />
Strohhüte. Sie alle haben ihren Platz gefunden auf<br />
dem Feld. 30 000 Besucher an schönen Tagen,<br />
schätzen die Statistiker des Senats. »Viel zu wenig für<br />
so eine große Fläche«, findet Christoph Schmidt von<br />
Grün Berlin. Doch wie will man ein neues Publikum<br />
anlocken, ohne das alte zu vertreiben? Die Menschen<br />
sind glücklich mit dieser Brache. Sie wollen keine<br />
künstliche Parklandschaft. Keine teure Gestaltung.<br />
Sie wollen, dass alles ganz einfach so bleibt, wie es<br />
gerade ist.<br />
Über der Grillwiese vor dem Halbkreis des alten<br />
Terminals steigen Rauchfahnen in den Himmel.<br />
Daneben kämpfen 22 Männer in kurzen<br />
Hosen um einen Ball. Schon vor 130 Jahren weihte<br />
Germania 1888 Berlin, der älteste Fußballverein<br />
Deutschlands, seinen Platz auf dem Feld ein.<br />
Diese Wiese war immer Berlins Spielwiese. Alte<br />
Kupferstiche zeigen Damen, die in wehenden<br />
Kleidern mit Drachen an der Leine über das Feld<br />
laufen, und Männer mit Schmetterlingsnetzen.<br />
Unscharfe Fotografien dokumentieren den Start<br />
von Heißluftballons und anderen bis dahin unbekannten<br />
Flugobjekten. »Dieses Feld war auch<br />
immer ein Experimentierfeld«, sagt der Landschaftsarchitekt<br />
Hermann Barges. Nur die Experimente<br />
des Senats möchte er hier nicht sehen.<br />
Barges gehört zur »Demokratischen Initiative<br />
100% Tempelhofer Feld«, die am Wochenende<br />
eine Unterschriftensammlung startet, um eine<br />
Bebauung des Feldes zu verhindern. Er ist optimistisch:<br />
»Nicht der Mensch verändert die Orte,<br />
sondern die Orte verändern den Menschen.«<br />
Am frühen Abend sind die meisten Liegestühle<br />
in der Nähe des Biergartens besetzt. Die Stadt<br />
chillt, plaudert zum Sonnenuntergang leise vor<br />
sich hin. Auch Burghard Kieker kommt mit seinen<br />
Kindern gern aufs Feld. Der Chef von Visit<br />
Berlin ist so etwas wie der geheime Tourismus-<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N No <strong>39</strong> 59<br />
senator. »Wir haben in Berlin bald drei Millionen Besucher<br />
pro Jahr, das sind Pariser Dimensionen! Diese<br />
Leute müssen verteilt werden, die dürfen nicht nur<br />
um den Reichstag kreisen.«<br />
Es wird stiller auf der Tempelhofer Freiheit, friedlich<br />
und elegant hängt die Sichel des Mondes über dem<br />
Horizont. Im hohen Gras lässt sich wieder der Herbstnebel<br />
nieder, nur vom Asphalt der Rollbahn steigt wie<br />
eine leise Erinnerung an den Sommer noch Wärme auf.<br />
Ein Radfahrer fährt ohne Licht, mit einem Radio am<br />
Lenker, aus dem Ravels Bolero tönt. Es ist finster in der<br />
Mitte Berlins. Noch immer sind Menschen unterwegs.<br />
Leises Gelächter dringt herüber aus den Inseln im Gras.<br />
Eine Gitarre klingt, Feuerzeuge flackern, der blaue<br />
Schein der Telefone: kleine menschliche Leuchtfeuer in<br />
der Steppe, während in der Ferne wieder der Lichterzug<br />
der S-Bahn vorüberzieht.<br />
A www.zeit.de/audio<br />
Der »Park der<br />
Tempelhofer<br />
Freiheit« am Abend.<br />
Die hölzernen<br />
Vögel wurden von<br />
Schülern aufgestellt<br />
Foto: Pierre Adenis/laif
60 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> No 60 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N <strong>39</strong> REISEN<br />
o <strong>39</strong><br />
Aerolineas<br />
Argentinas,<br />
Argentinien<br />
(1978–92)<br />
United<br />
Airlines,<br />
USA<br />
(1968–70)<br />
Braniff<br />
International,<br />
USA<br />
(1966–68)<br />
Air France,<br />
Frankreich<br />
(1987–98)<br />
Southwest<br />
Airlines,<br />
USA<br />
(1995–2004)<br />
Caledonian<br />
Airways,<br />
Großbritannien<br />
(1990)<br />
Braniff<br />
International,<br />
USA<br />
(1973–74)<br />
Emirates,<br />
Arabische<br />
Emirate<br />
(1990–2009)<br />
Alle meine Stewardessen<br />
Ob gelb, ob rot, ob blau – Cliff Muskiet liebt die Uniformen der Flugbegleiterinnen. 1134 Kostüme hat er bereits gesammelt. Ein Gespräch über Rocklängen und den Traum vom Fliegen<br />
<strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>: Herr Muskiet, Sie arbeiten als Purser<br />
für die KLM. Unterwegs suchen Sie an freien<br />
Tagen oft die Büros anderer Fluggesellschaften<br />
auf und fragen nach Stewardessen-Uniformen<br />
für Ihre Sammlung. Wie reagieren die Kollegen<br />
anderer Airlines auf Ihre Sammelleidenschaft?<br />
Cliff Muskiet: Für mich ist das ein unschuldiges<br />
Hobby. Aber manche Fluggesellschaften sehen das<br />
offenbar anders – besonders japanische und chinesische.<br />
Auf Mail-Anfragen reagieren die erst gar<br />
nicht. Und wenn ich vorbeischaue, heißt es, die<br />
Abgabe einer Uniform sei gefährlich. Ein Fremder,<br />
entsprechend eingekleidet, könne eines der Flugzeuge<br />
betreten und Menschen entführen. Ich habe<br />
einen Stewardessen-Hut von Japan Airlines aus<br />
den siebziger Jahren, und mir fehlt die Uniform<br />
dazu. Es scheint aber aussichtslos, über die Fluglinie<br />
dranzukommen. Das ist frustrierend.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Immerhin haben Sie schon 1134 Stewardessen-Uniformen<br />
von 443 Airlines, allesamt<br />
dokumentiert auf Ihrer Website Uniformfreak.<br />
com. Was war Ihr letztes Erfolgserlebnis?<br />
Muskiet: Vor ein paar Wochen<br />
war ich in Angola. KLM hat die<br />
Strecke nach Luanda erst kürzlich<br />
aufgenommen. Normalerweise<br />
arbeite ich auf Flügen nach Amerika<br />
oder Asien. Für Luanda habe<br />
ich mich extra beworben, weil ich<br />
noch keine angolanische Uniform<br />
besaß. Und es ist mir tatsächlich<br />
gelungen, ein komplettes Outfit<br />
von Angola Airlines zu bekommen.<br />
Diese Mission ist erfüllt.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Da hat Sie keiner komisch<br />
angeguckt?<br />
Muskiet: Nein, ich betrat das Büro in meiner<br />
KLM-Uniform, zeigte Fotos aus meiner Sammlung,<br />
ein paar Artikel aus der Presse, schließlich<br />
meine Website. Das überzeugt meistens.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Es geht Ihnen nur um den weiblichen<br />
Dress?<br />
Muskiet: Kleidung für Männer finde ich langweilig.<br />
Dunkelblauer Anzug, weißes Hemd, das<br />
ist es in der Regel. Stewardessen-Uniformen sind<br />
viel verspielter, haben mehr Accessoires.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Was macht für Sie eine schöne Uniform<br />
aus?<br />
Muskiet: Ein Hut ist das Sahnehäubchen jeden<br />
Outfits. Besonders die Pillbox-Hüte aus den sechziger<br />
Jahren gefallen mir. Damit sticht eine Frau<br />
aus der Masse hervor. Die Sechziger waren überhaupt<br />
eine spannende Zeit, es gab Uniformen in<br />
verschiedenen Farben, in Gelb, Orange, Lila. Es<br />
gab kurze Röcke, lange Röcke, Hosen, Hütchen ...<br />
<strong>ZEIT</strong>: Besonders Braniff International scheint<br />
experimentierfreudig gewesen zu sein.<br />
Muskiet: Deren Uniformen sind besonders. Die<br />
Outfits waren bunt, fast psychedelisch und sind<br />
heute so etwas wie Sammlerstücke. Für Stewardessen<br />
waren die Uniformen gewagt. Aber in den<br />
späten sechziger Jahren ging es noch darum,<br />
hauptsächlich männliche Kunden anzulocken.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Heute ist alles dezenter geworden?<br />
Muskiet: Ja, viele Flugbegleiterinnen gleichen einander.<br />
Blaue Kostüme, weiße Blusen, goldene<br />
Knöpfe am Ärmel. In den USA unterscheiden<br />
sich American Airlines oder United kaum mehr.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Haben Sie eine Erklärung für das viele<br />
Blau?<br />
Muskiet: Blau ist eine einfache Farbe, sie passt zu<br />
blonden wie brünetten Typen, wirkt professionell,<br />
und wenn Kaffee verschüttet wird, sieht man die<br />
Flecken nicht so stark wie bei helleren Farben.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Sie sammeln Uniformen aus allen Jahrzehnten.<br />
Welche Trends können Sie ablesen?<br />
Muskiet: In den späten sechziger und frühen siebziger<br />
Jahren kamen kurze Röcke oder Hosen in<br />
Mode. In den achtziger Jahren gingen die Röcke<br />
wieder bis über die Knie, die Jacketts wurden in<br />
den Schultern breiter. Ab den neunziger Jahren<br />
durften Frauen die Röcke erneut höher tragen,<br />
dafür verengten sich die Schultern. Insgesamt ha-<br />
Hughes<br />
Airwest,<br />
USA<br />
(1970)<br />
Cliff Muskiet arbeitet als<br />
Flugbegleiter für die<br />
niederländische KLM<br />
ben sich die Stoffe sehr verbessert. Früher war fast<br />
alles aus Polyester – ein extrem brennbares Material.<br />
Heute dominieren Wolle oder Baumwolle.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Sehen Sie regionale Besonderheiten?<br />
Muskiet: Wenige. Im Nahen Osten gibt es Air-<br />
lines wie Emirates, wo Stewardessen einen kleinen<br />
Schleier an den Hüten haben. Im Fernen<br />
Osten tragen Frauen bei Singapore und Malaysia<br />
Airlines eine Art Sarong – bodenlange Röcke, die<br />
typisch für die Länder sind.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Wie hat es eigentlich begonnen mit Ihrer<br />
Uniform-Obsession?<br />
Muskiet: Über meine Begeisterung für die Luftfahrt.<br />
Seit meiner Kindheit sammle ich alles, was<br />
mit Fliegen zu tun hat. Uniformen von Polizistinnen<br />
oder Schiffs-Stewardessen würden mich<br />
nicht die Bohne interessieren.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Und woher kam die Faszination für die<br />
Luftfahrt?<br />
Muskiet: Genau kann ich das gar nicht sagen.<br />
Jedenfalls fing es mit einem Flug im Jahr 1970<br />
von New York nach Amsterdam an.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Was ist damals passiert?<br />
Muskiet: Nicht viel. Es war ein<br />
Nachtflug, ich war fünf Jahre alt<br />
und schlief sofort ein. Als ich in<br />
Amsterdam aufwachte, war ich<br />
so enttäuscht, den Flug verschlafen<br />
zu haben, dass ich alle möglichen<br />
Andenken daran mitnahm:<br />
die Kotztüten, Servietten, Sicherheitskarten<br />
...<br />
<strong>ZEIT</strong>: ... weil Sie den Flug nachholen<br />
wollten, den Sie verpasst<br />
hatten?<br />
Muskiet: Wahrscheinlich. Von da<br />
an malte ich nur noch Flugzeuge, baute Modellflieger,<br />
hängte mir Poster von Boeings an die<br />
Wand und ging mit 14 Jahren regelmäßig in die<br />
Büros der Fluggesellschaften, um mir neue Sticker,<br />
Flugpläne oder Broschüren abzuholen. Ich wusste:<br />
Eines Tages würde ich an Bord eines Flugzeuges<br />
arbeiten – und zwar als Steward. Schon mit 15<br />
jobbte ich dann jeden Sommer freudig für eine<br />
Reinigungsfirma, die Flugzeuge säuberte.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Und wann ging Ihr Flugbegleiter-Traum<br />
in Erfüllung?<br />
Muskiet: Mit 21 Jahren durfte ich nach einer<br />
fünfmonatigen Unterweisung zum ersten Mal in<br />
Uniform fliegen. Es war Flug KL 235 nach München.<br />
Eine DC 9 am 9. Februar 1987 – einer der<br />
glücklichsten Momente meines Lebens.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Viele, die den gleichen »Traumjob« haben<br />
wie Sie, versuchen sich heute bessere Arbeitsbedingungen<br />
zu erstreiken. Hat der Beruf an Attraktivität<br />
eingebüßt?<br />
Muskiet: Nicht für mich. Heute werden zwar<br />
mehr Passagiere befördert als vor 25 Jahren, und<br />
wir müssen alle härter arbeiten. Aber ich fühle<br />
mich immer noch am richtigen Platz.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Welches wäre der richtige Platz für Ihre<br />
Sammlung? Ein Museum?<br />
Muskiet: Einen Ausstellungsort kann ich mir<br />
nicht leisten. Im Moment ist alles in meiner<br />
Vierzimmerwohnung in Amsterdam verstaut.<br />
In der nahen Zukunft würde ich gern ein Coffee-Table-Buch<br />
herausgeben, für das Models in<br />
meinen Uniformen fotografiert werden. Fünf<br />
Verleger haben mich kontaktiert, aber bisher ist<br />
jedes Projekt an zu hohen Produktionskosten<br />
gescheitert.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Hand aufs Herz: Wenn Sie allein sind mit<br />
ihren Uniformen, ziehen Sie sich dann manchmal<br />
eine an?<br />
Muskiet: Als ich in den 80er Jahren von einer<br />
Freundin meiner Mutter die allererste Uniform<br />
geschenkt bekam, ein KLM-Outfit aus den Siebzigern,<br />
da habe ich die mal anprobiert. Aber das<br />
war’s. Ich bin 1,89 Meter groß, die Uniformen<br />
sind viel zu klein. Ich würde doch ziemlich blöd<br />
darin aussehen.<br />
Interview: ULF LIPPITZ<br />
Air New<br />
Zealand,<br />
Neuseeland<br />
(1992–2006)<br />
Foto: Cliff Muskiet
REISEN<br />
Ein Stück vom Himmel<br />
Seit vielen Jahrzehnten reisen Juden in die Schweizer Alpen. Doch von den koscheren Hotels ist nur eines geblieben,<br />
das Metropol in Arosa. Jeder Gast sei ein Gottesgeschenk, sagen seine Besitzer, die Levins VON PAULA SCHEIDT<br />
Zur Abendessenszeit sind die gedeckten<br />
Tische im Hotel Metropol unbesetzt,<br />
nur an einem löffelt ein älterer Herr mit<br />
grauen Schläfenlocken und Kippa auf<br />
dem Kopf bedächtig seine Suppe. Ab<br />
und zu hebt der einsame Gast den Blick und betrachtet<br />
die Alpengipfel, die sich vor der Fensterfront<br />
erheben. Die Kellnerin beobachtet ihn aus<br />
einiger Entfernung; als er den Löffel ablegt, kommt<br />
sie, räumt das Suppenschälchen ab und bringt den<br />
Hauptgang: Rinderbraten, Nudeln und Erbsen-<br />
Karotten-Gemüse. Der Gast kann nicht sehen, dass<br />
das Fleisch von einem geschächteten Tier stammt<br />
und im richtigen Topf zubereitet wurde. Aber er<br />
kann sich darauf verlassen, deshalb ist er hier.<br />
Weder der Hauptgang noch die Vorspeise oder<br />
das Dessert, ein Stück Apfelkuchen, enthalten Milchprodukte.<br />
Orthodoxe Juden müssen Milch und<br />
Fleisch zu getrennten Mahlzeiten essen, und das<br />
Metropol ist ein jüdisches Hotel. In der Küche verwenden<br />
die Angestellten unterschiedliches Geschirr<br />
für milchige und fleischige Speisen. Es gibt kein<br />
Schweinefleisch. Und der Wein ist koscher, was unter<br />
anderem bedeutet, dass die Trauben erst im vierten<br />
Jahr nach der Pflanzung geerntet und alle Geräte<br />
unter der Aufsicht eines Rabbiners gesäubert wurden.<br />
Marcel Levin, Besitzer des Hotels, mit dichtem<br />
grauem Bart, Nadelstreifenanzug und Kippa auf dem<br />
Kopf, macht einen Rundgang durch seinen leeren<br />
Speisesaal. Die Vorhänge sind von der Sonne ausgeblichen,<br />
von den Fensterrahmen bröckelt an einigen<br />
Stellen die Lackierung. Er begrüßt seinen einzigen<br />
Gast mit Händedruck. Der möchte wissen, wie lange<br />
denn die Saison dauern werde in diesem Jahr. Herr<br />
Levin seufzt und antwortet in einer Mischung aus<br />
Iwrit und Hochdeutsch: »Früher wussten wir immer,<br />
wie viele Gäste wir erwarten und wie lange sie bleiben.<br />
Heute ist jeder einzelne Gast ein Geschenk Gottes.«<br />
Der andere nickt, er weiß, wovon die Rede ist. Seit<br />
vier Generationen macht seine Familie hier jedes Jahr<br />
Ferien, sie reisen von Jerusalem an. In den 1980er<br />
Jahren gab es noch sechs koschere Hotels in den<br />
Schweizer Alpen, doch nach und nach haben fast alle<br />
den Kampf um die jüdischen Gäste verloren: das<br />
Silberhorn in Grindelwald, das Edelweiß in St. Moritz,<br />
das Palace in Scuols. Heute ist das Metropol in<br />
Arosa das einzige, das noch übrig ist. Aber auch zu<br />
den Levins kommen von Jahr zu Jahr weniger Gäste.<br />
Viele haben finanzielle Gründe. Sie entscheiden<br />
sich lieber für eine Ferienwohnung, seit einige Vermieter<br />
begonnen haben, sich auf die Wünsche jüdisch-orthodoxer<br />
Gäste einzustellen. Die Eigentümer<br />
schalten am Freitagabend etwa den Bewegungsmelder<br />
vor dem Haus aus, weil Juden am Sabbat keine elektrischen<br />
Geräte betätigen dürfen. In einer Wohnung<br />
können fünf Personen zu einem Preis übernachten,<br />
den im Metropol eine einzige bezahlt. Wenn die<br />
Wohnung in der Nähe des Hotels liegt, können die<br />
Urlauber trotzdem noch zum Essen, Beten und<br />
Freunde treffen dorthin gehen.<br />
Die größere Bedrohung für das Metropol aber<br />
ist eine andere. Seit der schwache Euro manchen<br />
Touristen einen Bogen um die Schweiz machen<br />
lässt, stehen einige Hotels leer; nur hin und wieder<br />
werden sie für ein paar Wochen verpachtet, etwa<br />
an Pauschalreisen-Veranstalter. Seit einigen Jahren<br />
quartieren sich in der Hochsaison auch geschäftstüchtige<br />
Hoteliers aus Israel darin ein. Diese Kurzzeithoteliers<br />
müssen im Gegensatz zu den Levins<br />
weder Instandhaltungskosten für das Gebäude bezahlen<br />
noch Schweizer Sozialversicherungsbeiträge<br />
für die Angestellten oder teure Schweizer Lebensmittel.<br />
Alles, was sie brauchen, bringen sie aus dem<br />
Ausland mit, vom Suppenpulver über die Gebetsbücher<br />
bis zum Personal – und sogar die Gäste:<br />
Die Kurzzeithoteliers werben gezielt in Israel für<br />
ihr Angebot wie für ein Ferienlager.<br />
Diese Entwicklung hat inzwischen auch die Levins »Um einen Apfel ernten zu können, pflanzt man ei-<br />
erfasst: Die sechs Kinder der Familie reisen jeden nen Baum, der wächst von allein; und wenn er groß<br />
Sommer aus London, Tel Aviv und Zürich an und ist, muss man nur den Arm ausstrecken und die<br />
quartieren sich in Davos im ehemaligen Sheraton ein, Äpfel pflücken. Für eine Kartoffel muss man erst mit<br />
das heute Derby heißt. »The Levin Family invites you dem Pflug Furchen in den Acker ziehen, dann wird<br />
this Summer to join them for a High Class Kosher Ho- gesät, und wenn die Kartoffeln reif sind, muss man<br />
liday in the ****Derby Davos – Switzerland«, steht auf jede ausgraben.« Herr Levin ist der Ansicht, dass Gott<br />
der Homepage. Das Haus hat 200 Betten, mehr als absichtlich nicht nur Äpfel, sondern auch Kartoffeln<br />
doppelt so viele wie das Metropol, und einen Pool. erschaffen hat. Die Menschen sollen nicht immer den<br />
In Arosa gibt es nur ein öffentliches Bad.<br />
leichten Weg gehen, sondern auch die Mühen des<br />
Beinas Levin war es, der Vater des heutigen Hotel- Kartoffelanbaus auf sich nehmen. Vielleicht ist das<br />
besitzers, der die jüdischen Gäste ursprünglich nach Metropol sein persönlicher Kartoffelacker.<br />
Arosa holte. Anfang der 1930er Jahre kam er von Das Hotel liegt an der Hauptstraße von Arosa, die<br />
Russland nach Davos, weil er an Tuberkulose litt und<br />
die Kurorte in den Bündner Bergen für ihre heilende<br />
Wirkung weltbekannt waren. Von der Krankheit<br />
kuriert, zog er weiter nach Arosa und eröffnete das<br />
erste und einzige koschere Hotel im Ort. »Auf sanfter<br />
Höhe (...) steht das Hotel Metropol, das seit einigen<br />
Jahren in bestimmten Sommer- und Wintermonaten<br />
Treffpunkt jüdischer Menschen ist, die sich in die<br />
Berge flüchten, wo sie am schönsten sind und wo die<br />
Schneedecke noch blendend leuchtet, wenn unten<br />
bereits die Alpenrosen blühen«, schrieb die Zeitschrift<br />
Israelit im Jahr 1935. Neben der Faszination, die die<br />
Bergwelt auf viele Städter ausübt, haben die Alpen<br />
für Juden traditionell eine besondere Bedeutung: Der<br />
Fels steht in der Thora bildhaft für Gott, Gipfel symbolisieren<br />
die Berührung von Irdischem und Göttlichem.<br />
Vom Begründer der jüdischen Neoorthodoxie<br />
Samson Raphael Hirsch ist der Satz überliefert:<br />
»Wenn ich vor Gott stehen werde, wird der Ewige<br />
mich fragen: Hast du meine Alpen gesehen?«<br />
Als Beinas Levin das Metropol in den 1980er<br />
Jahren seinem Sohn übergab, hatte das Hotel schon<br />
manch dunkle Zeit überstanden. In den Jahren des<br />
Nationalsozialismus machten auch viele Nazis Urlaub<br />
in den Schweizer Alpen – die Stimmung zwischen<br />
den Gästen war nicht zum Besten. Später wurden die<br />
jüdischen Urlauber ebenfalls nicht immer herzlich<br />
empfangen. Manche Leute, denen die vielen frommen<br />
Juden nicht passten, nannten das Hotel abschätzig<br />
»Arosalem«.<br />
Nachdem das Frühstücksbüfett abgeräumt ist, holt<br />
Lea Levin ihre Einkaufstasche, um ein paar Dinge im<br />
Dorf zu erledigen. Sie trägt einen dunklen, langen<br />
Rock und blickdichte Nylonstrümpfe, p wie<br />
es sich für eine fromme Jüdin gehört, ört,<br />
jedoch keine Perücke wie einige e<br />
ihrer besonders gläubigen weiblichen<br />
Gäste. Anfangs war Frau<br />
Levin nicht begeistert von der<br />
sich vom Bahnhof den Berg hinauf windet. Sie führt<br />
Idee, ihren Job als Kindergärtnerin<br />
aufzugeben, um das Hotel<br />
des Schwiegervaters mitzuübernehmen.<br />
»Gäste sind wie<br />
SCHWEIZ<br />
Grindelwald<br />
Davos<br />
AROSA Scuol<br />
Graubünden<br />
durch das Zentrum des<br />
2600-Einwohner-Dorfes,<br />
Kinder«, überredete ihr Mann<br />
St. Moritz vorbei am Supermarkt, der<br />
sie schließlich doch. Ein Satz, der<br />
Bäckerei B und dem Sportgeschäft<br />
ihr geblieben ist.<br />
– und wenn man bis zum Ende<br />
Bis zum Fotofachgeschäft sind es<br />
nur ein paar Schritte die Straße hinunter. unter.<br />
<strong>ZEIT</strong>-GRAFIK<br />
50 km<br />
geht geht, dann liegt dort das »Eggahuus«,<br />
huus«, das Heimatmuseum: ein hüb-<br />
Lea Levin, die in Israel geboren ist, fragt die<br />
sches altes Chalet mit roten Fensterläden<br />
Verkäuferin in fast perfektem Schweizerdeutsch, und Blumen im Vorgarten. Hier ist alles dokumen-<br />
welche Postkartenmotive sie zur Auswahl habe. Ihre tiert, was in Arosa Bedeutung hat. Fotos von Turnver-<br />
Gäste schicken gerne Grüße nach Hause. Frau Levin einsfesten und Skirennen sind ausgestellt, antike<br />
entscheidet sich für ein Gipfelpanorama, einen Berg- Blechtöpfe und Landkarten. Nachmittags treffen sich<br />
see, eine Blumenwiese, Arosa von oben; insgesamt ein paar Einheimische im Museum zu Kaffee und<br />
bestellt sie 75 Karten. Als Nächstes betritt sie die Tal- Kuchen. Die Familie Levin? Ist nicht dabei und war<br />
station der Gondelbahn. Hier können Hotelbesitzer nie hier; und umgekehrt hat keiner der Anwesenden<br />
für ihre Gäste die Arosa-All-inclusive-Card abholen, das Metropol je betreten. Nur Renzo Semadeni, der<br />
mit der man verschiedene Vergünstigungen bekommt. Dorfhistoriker, hat dort mal ein Glas Wein getrunken,<br />
Lea Levin nimmt 200 Karten mit. Ob sie die braucht, aus geschäftlichen Gründen. Als Kind ist er mit Mar-<br />
ist ungewiss.<br />
cel Levin zur Schule gegangen. Der und seine Ge-<br />
Es gibt ein Gleichnis, das Marcel Levin seinen schwister waren die Einzigen, die am Samstag, dem<br />
Gästen gern erzählt, das Gleichnis vom Apfel und der Sabbat, ihren Schulranzen nicht tragen durften, das<br />
Kartoffel. »Worin besteht der Unterschied zwischen machten dann die Schulkameraden für sie. Semadeni<br />
den beiden?«, fragt er und gibt selbst die Antwort: holt dicke Chroniken aus dem Regal und blättert<br />
ÖSTER- ÖSTER-<br />
REICH REICH<br />
ITALIEN ITALIEN<br />
darin. Ein einziger Satz erwähnt die Ankunft von<br />
Marcel Levins Vater im Ort, mehr ist nicht zu finden<br />
über die Familie oder das Hotel. »Es ist, als ob es<br />
dieses Thema hier einfach nicht gibt«, sagt Semadeni.<br />
Nachmittags zieht Marcel Levin sich einen Fahrradhelm<br />
über die Kippa und Bikerhandschuhe an,<br />
steigt auf sein silberfarbenes Mountainbike und radelt<br />
einen der vielen Schotterwege den Berg hinauf. Auf<br />
Höhe der Mittelstation macht er Pause, setzt sich auf<br />
eine Bank und atmet tief durch, bevor es wieder hinunter<br />
geht. Die rauschenden Bäche, das Gebimmel<br />
der Kuhglocken, die gepflegten Wanderwege: Das<br />
alles liebt er, auch wenn es von oben aussieht wie die<br />
Kulisse eines kitschigen Heimatfilms. Manchmal<br />
nimmt er auch einen seiner Gäste aus Tel Aviv, New<br />
York oder Antwerpen mit auf eine Mountainbiketour.<br />
Marcel Levin setzt darauf, dass manche Urlauber<br />
auch weiter lieber in seinem Familienhotel nächtigen<br />
als im Derby mit seinen 200 Betten: Weil die Levins<br />
einen Gast, der nachts einen Schwächeanfall bekommt,<br />
nach Chur ins Krankenhaus fahren. Weil sie<br />
suchen helfen, wenn sich ein Kind verlaufen hat. Weil<br />
ihre Angestellten jeden Gast mit Namen ansprechen.<br />
Und wenn jemand seine Mahlzeit ungesalzen essen<br />
möchte, wird das in der Küche berücksichtigt.<br />
Das moderne Kurzzeithotel der Kinder in Davos<br />
will Marcel Levin nicht als Konkurrenz betrachten:<br />
Ist doch positiv, dass die nächste Generation etwas<br />
Eigenes auf die Beine gestellt hat. Wenn man die<br />
Telefonnummer der Levins wählt, hebt neuerdings<br />
nicht mehr Frau Levins ältere Schwester den Hörer<br />
ab. Sondern eine automatische Stimme sagt am anderen<br />
Ende der Leitung: »Drücken Sie die 1 für<br />
Davos oder die 2 für Arosa.«<br />
Hotel Metropol, Poststraße, 7050 Arosa, Schweiz,<br />
Tel. 0041-81/378 81 81, www.levinarosa.com<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 61<br />
Orthodoxe Juden<br />
in der Seilbahn an<br />
der Talstation<br />
Diavolezza bei<br />
Sankt Moritz<br />
Foto: Patricia Schon & Michael Melcer/foto@melcer.de
REISEN<br />
Der Kerker in der umbrischen<br />
Kleinstadt Narni liegt drei Meter<br />
unter der Erde. Höchstens<br />
acht Quadratmeter ist die Zelle<br />
groß. Durch eine vergitterte<br />
Öffnung in der Decke gelangt Licht herein und<br />
fällt auf die Zeichen an den Wänden: Striche für<br />
abgesessene Stunden, Kreuze, geheimnisvolle<br />
Zahlenfolgen, eine aufgehende Sonne, ein abnehmender<br />
Mond. Neben der Kerkertür ist ein<br />
Satz tief in den Stein eingekerbt, die Buchstaben<br />
ziehen sich über die gesamte Länge der Wand.<br />
Offenbar wollte ihr Graveur sicherstellen, dass<br />
sie die Zeit überdauern: »Ich, Giuseppe Andrea<br />
Lombardini, wurde hier am 4. Dezember 1759<br />
eingekerkert.« Darunter ein weiteres Wort, fast<br />
unlesbar, man muss ganz nah herangehen, um<br />
es zu entziffern: »innocente«, unschuldig.<br />
»Lombardini – jahrzehntelang hat mich<br />
dieser Name verfolgt«, sagt Roberto Nini. Er<br />
hat den Kerker entdeckt, als er 19 Jahre alt<br />
war. Heute ist er 53, ein schlanker Mann,<br />
hochgewachsen und ungewöhnlich blass für<br />
einen Italiener. Das graue Haar hat er zum<br />
Seitenscheitel gekämmt. Nini redet schnell,<br />
mit heiserer Stimme. Wenn er geht, hält er<br />
den Kopf geduckt und bewegt kaum die<br />
Arme, als ob er unbemerkt bleiben wolle.<br />
Umso mehr überrascht die Entschlossenheit in<br />
seinen Worten, als er sagt: »Lombardinis Geschichte<br />
musste ans Licht.«<br />
Gut eine Stunde braucht der Zug von Rom<br />
nach Narni. Die meisten Touristen fahren vorbei<br />
und ahnen nichts von den kulturellen Schätzen<br />
der Stadt, die sich auf einem Hügel erhebt: Einst<br />
stand hier eine der größten Brücken, die die Römer<br />
je gebaut haben, die Ponte d’Augusto. Einer<br />
ihrer ehemals vier Bögen ragt noch immer empor<br />
aus dem Nera, ein kolossales Tor von 30 Metern<br />
Höhe. Der jahrtausendealte Aquädukt, der unterirdisch<br />
die Stadt durchzieht, ist begehbar, man<br />
kann hinabsteigen und durch die Wasserleitung<br />
spazieren. Und ganz oben auf der Hügelkuppe<br />
thront die Festung Albornoz – im Mittelalter ein<br />
Bollwerk päpstlicher Macht.<br />
Am Ortsrand steht eine mächtige Dominikanerkirche.<br />
Nur wenige Meter entfernt davon<br />
fällt eine Schlucht steil ab in die Tiefe; auf der<br />
anderen Seite erheben sich die Felszähne des<br />
Apennin, und alte Klöster ragen aus den bewaldeten<br />
Gebirgshängen. »Auch hier oben<br />
stand mal ein Kloster«, sagt Nini und deutet<br />
auf ein paar überwachsene Mauerreste hinter<br />
der Kirche: »Päpste und Kardinäle kamen auf<br />
ihren Reisen darin unter.«<br />
Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude<br />
zerstört, ein Gärtner baute später zwischen den<br />
Trümmern Gemüse an. Nini kann sich noch erinnern,<br />
wie er und seine Freunde an einem Nachmittag<br />
im Mai 1979 an einer der Steinmauern<br />
das Abseilen übten. Damals war er der Anführer<br />
einer Gruppe Jugendlicher, die sich banda del<br />
buco, die Höhlenbande, nannte. Kein Brunnen,<br />
kein Schacht in Narni war vor ihnen sicher.<br />
»Du Elender!«, schrie ihn der Gärtner an,<br />
als Nini bei seinen Übungen auf ein Gemüsebeet<br />
fiel und den Salat zertrampelte. Als der alte<br />
Mann jedoch von den Kletterkünsten der Jungen<br />
erfuhr, erzählte er ihnen von einem Schatz,<br />
der unter den Trümmern vergraben sein sollte.<br />
Er führte sie zum einzigen intakten Raum der<br />
Klosterruine – eine unterirdische Kammer im<br />
Nachbargarten, bei den Gandolfis. Die Familie<br />
nutzte sie als Lagerraum. An der hinteren<br />
Wand befand sich eine zugemauerte Tür. Nini<br />
und seine Freunde brannten darauf, die Mauer<br />
einzuschlagen, doch die Gandolfis verboten es.<br />
Zu gefährlich, sagten sie. Nini lächelt und zieht<br />
Schultern und Augenbrauen hoch.<br />
Seine Freunde und er, erzählt er, hätten den<br />
Corsa all’Anello abgewartet, Narnis bedeutendstes<br />
Stadtfest. Der ganze Ort war an jenem<br />
Abend auf der Straße, Trommlergruppen zogen<br />
durch die Stadt, niemand hörte, wie die sechs mit<br />
Axt und Hammer die Mauer einschlugen. Ganz in<br />
der Nähe waren sie erst kurz zuvor bei einer ihrer<br />
Expeditionen auf eine unterirdische Kirche gestoßen.<br />
Doch der Raum, den sie nun fanden, übertraf<br />
all ihre Erwartungen.<br />
Die Aufregung ist Nini immer noch anzuhören,<br />
wenn er Touristen heute seine Entdeckung zeigt. Nach<br />
der eingeschlagenen Türe folgt ein enger Gang – dann<br />
ist man da: An den Wänden des Gewölbes brennen<br />
Fackeln, auf dem Boden stehen Kopien mittelalterlicher<br />
Foltergeräte, eine Streckbank, eine Daumenschraube.<br />
Von der Decke hängt ein Strick, mit dem<br />
die Arme der Gefangenen ruck artig in die Höhe gerissen<br />
wurden. Die Gräuelwerkzeuge hat Nini nachträglich<br />
hergebracht. Damals, im Frühjahr 1979, war<br />
der Saal leer, und die Jungen wussten nichts über<br />
seine Geschichte. »Aber wir fanden Knochen«, sagt<br />
Nini. Und hinter einer Holztüre, die von dem Raum<br />
wegführt, den Kerker. An der Wand gegenüber von<br />
Lombardinis Namen entdeckten sie außerdem die<br />
Inschrift »S. Uffizio« – der Palazzo del Sant’Uffizio,<br />
das Gebäude der In qui si tionszentrale im Vatikan.<br />
Gegen Mitte des 16. Jahrhunderts hatte die In quisi<br />
tion in Italien an Schärfe zugenommen. Luther, dem<br />
Reformator, liefen die Menschen in Scharen zu, der<br />
Papst musste handeln – und gründete die Heilige Römische<br />
und Universale Inquisition mit zwölf Kardinälen<br />
an der Führungsspitze. Diese sollten über die<br />
reine Lehre des Katholizismus wachen. Stellvertreter<br />
wurden in die Provinz entsandt. Bald waren Nord-<br />
und Mittelitalien von einem feinmaschigen Netz an<br />
In qui si tions ge rich ten überzogen.<br />
»Was genau geschah hier unten 1759 mit Lombardini?<br />
Das haben wir uns damals gefragt«, sagt<br />
Nini im flackernden Licht der Fackeln. »Hatte hier<br />
im Verborgenen etwa eines der lokalen In qui si-<br />
Henit amet aliquam commy nostrud<br />
magna feugue facilla feugiam<br />
volorUdit que nusamus cipita<br />
andit fugitatenim remod est aut<br />
aut alique maionseque quibus<br />
aut everumet etur? Qui odiaectae<br />
ea nimaio voluptatem net<br />
laceptatiat qui a voluptam et, ate<br />
Der Gefangene von Narni<br />
Giuseppe Lombardini war ein Opfer der Inquisition. Drei Jahrzehnte lang hat der Historiker Roberto Nini<br />
den Fall erforscht. Heute zeigt er Touristen den Kerker in der umbrischen Hügelstadt VON JULIA REICHARDT<br />
tionsgerichte getagt?« Priester und Henker, die über<br />
Ketzer, Ehebrecher und Gotteslästerer richteten<br />
und Abtrünnige so lange quälten, bis sie mit letzter<br />
Kraft abschworen? Der Gedanke schien zu unheimlich,<br />
um wahr zu sein. »Wem immer wir unsere<br />
Vermutungen erzählten: Die Leute hielten uns<br />
für verrückt«, sagt Nini. »Einige glaubten sogar, wir<br />
hätten die Zeichen selbst in die Wände geritzt.«<br />
Nach dem Kerkerdunkel blendet draußen grell das<br />
Tageslicht. Der Ort liegt verschlafen in der Sonne; nur<br />
ein paar dreirädrige Kleintransporter rasen durch die<br />
Gassen. Wie Rapunzelzöpfe hängen Efeuranken<br />
von mittelalterlichen Türmen.<br />
Statt Souvenirs stehen Pasta tüten<br />
und Haarfärbemittel in den<br />
Schaufenstern. Von den Fassaden<br />
flattern die Wimpel vom<br />
vergangenen Stadtfest. In den<br />
Cafés sitzen alte Männer in<br />
Unterhemden, mit weit über<br />
den Bauch gezogenen Hosen.<br />
An der Piazza dei Priori,<br />
einem von Palazzi umgebenen<br />
Platz im Zentrum, liegt die Bibliothek.<br />
Im Lesesaal schlägt Nini<br />
ein in Leder gebundenes Buch auf: Er<br />
will die ersten Indizien zeigen, die er<br />
Orvieto<br />
Perugia<br />
UMBRIEN RIEN<br />
NARNI<br />
Nera<br />
damals für seine These fand. Der Band enthält<br />
Narnis Magistratsbeschlüsse vom Anfang des 18.<br />
Jahrhunderts. »Mittwoch, 17. April 1726:«, steht<br />
auf Seite 65 mit schwarzer Tinte in lateinischer<br />
Sprache, »Domenico Sciabocco wurde von der Heiligen<br />
In qui si tion wegen illegaler Heirat in den Kerker<br />
von S. Maria Maggiore gesperrt.« Santa Maria<br />
Maggiore: So hieß, das hatte er inzwischen herausgefunden,<br />
die unterirdische Kapelle neben dem<br />
Kerker. Damit war bewiesen: Auch in Narni hatte<br />
die In qui si tion gewütet.<br />
Terni<br />
<strong>ZEIT</strong>-GRAFIK<br />
20 km<br />
Für viele Hobbyforscher wäre die Suche nach<br />
diesem Fund zu Ende gewesen. Für Nini aber fing sie<br />
erst richtig an. »Ich hatte das Verlies entdeckt«, sagt<br />
er. »Und der Name an der Wand, Giuseppe Andrea<br />
Lombardini, ließ mich nicht mehr los.« Seinetwegen<br />
studierte er Archäologie und mittelalterliche Geschichte,<br />
gründete später den Verein Narni Sotterranea,<br />
Unterirdisches Narni. Mit Spendengeldern ließ er die<br />
Kerkerräume restaurieren. Mehrfach beantragte Nini<br />
auch eine Forschungserlaubnis für das Archiv im Palazzo<br />
del Sant’Uffizio in Rom, wo 4500 Aktenbündel<br />
in 27 Sälen lagern, ein halbes Jahrtausend<br />
In qui si tion. Doch der Vatikan schwieg.<br />
Erst im Jahr 2006 nahm die Recherche<br />
eine unverhoffte Wendung.<br />
Ein Archivar, der an Ninis<br />
Spoleto<br />
ROM<br />
LATIUM M<br />
Kerkerführung teilgenommen<br />
hatte, verschaffte ihm die lang<br />
ersehnte Forschungserlaubnis<br />
für das In qui si tions archiv. Einen<br />
Monat lang pendelte Nini<br />
zwischen Narni und Rom, jede<br />
freie Minute verbrachte er mit<br />
Protokollen über Verhörmethoden<br />
und Foltertechniken, Urteilen<br />
gegen Ketzer, andere Abtrünnige und<br />
Juden, überall suchte er nach Lombardi-<br />
ni. Zahllose Einzelschicksale lagen vor ihm ausgebreitet,<br />
akribisch aufgezeichnete Gräueltaten, die<br />
im Namen der Kirche begangen wurden. »Irgendwann<br />
bin ich dann auf einen Grundriss der Inquisitionskammern<br />
gestoßen, die ich in Narni entdeckt hatte.«<br />
Jeder Raum war beschriftet: das Verhörzimmer, in<br />
dem heute die Folterwerkzeuge stehen, die unterirdische<br />
Kirche, der Kerker ... und noch ein zweites Verlies:<br />
Die zugemauerte Türöffnung, hinter der es lag,<br />
hatten Nini und seine Freunde bereits zu durchbrechen<br />
versucht – sich aber aus dem Staub gemacht, als<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 63<br />
sie die erschrockenen Stimmen der Gandolfis durch<br />
die Wand gehört hatten. Rosita Gandolfi, 72, wusste<br />
damals nicht, dass es ein ehemaliger Kerker war, in<br />
dem sie ihr Schlafzimmer eingerichtet hatte.<br />
»Im Fe bru ar 2006«, erzählt Roberto Nini, »saß<br />
ich wieder im Inquisitionsarchiv über Prozessakten<br />
von 1760.« Er schlug das Namensverzeichnis auf,<br />
glitt mit dem Finger über die Liste – erstarrte. »Auf<br />
der Mitte der Seite las ich den Namen: Giuseppe<br />
Andrea Lombardini.« Er hatte ihn gefunden. Und<br />
auch den Grund für die Inhaftierung: Lombardini<br />
war selbst Leiter des In qui si tions ge fäng nis ses von<br />
Spoleto gewesen. Er war ertappt worden, als er versuchte,<br />
einen Häftling zu befreien, der ihn in die<br />
Gedankenwelt der Freimaurer eingewiesen hatte.<br />
Wenn Roberto Nini heute auf der Pritsche hockt,<br />
die er in Lombardinis Kerker gestellt hat, gleitet sein<br />
Blick etwas ruhiger über die Kreuze, Zahlenfolgen,<br />
Sonnen und Monde an den Wänden als früher. Nicht<br />
nur Lombardinis Geschichte, auch ein paar Zeichen<br />
hat er inzwischen entschlüsselt. Sie wurden mit einer<br />
Mischung aus Kalk und Urin aufgetragen. »70 Prozent<br />
der Gravuren«, glaubt Nini, »stammen von Lombardini.<br />
Es sind Geheimzeichen der Freimaurer.«<br />
Es sind auch die letzten Spuren des Mannes, der<br />
ihn fast 30 Jahre lang beschäftigt hat: Nini weiß nur,<br />
dass Lombardini nach etwa drei Monaten Haft auf<br />
dem Marktplatz als Ketzer zur Schau gestellt, vom<br />
Volk verhöhnt und ins Exil getrieben wurde. Mehr<br />
war nicht herauszufinden. Nini hält die Hände gefaltet.<br />
Er sagt, er empfinde es als seine Aufgabe, Lombardinis<br />
Geschichte weiterzuerzählen. »Mein halbes<br />
Leben lang hat er mich begleitet«, sagt er und richtet<br />
dabei seinen Blick auf den Boden. »Lombardini ist<br />
wie ein Bruder für mich.« Hier unten im Kerker könne<br />
er ihn manchmal sogar spüren, direkt neben sich.<br />
www.narnisotterranea.it<br />
Narni wird<br />
überragt von der<br />
Festung Albornoz.<br />
Unten: In diesem<br />
Kerker saß<br />
Giuseppe<br />
Lombardini 1759<br />
drei Monate lang<br />
in Haft<br />
Fotos: Marco Santarelli
Foto: Eccles/Delius Klasing Verlag<br />
64 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> REISEN<br />
Die Briten Cee und David Eccles<br />
halten seit über 35 Jahren dem<br />
VW-Bulli die Treue<br />
Lektionen, die<br />
das Campen lehrt<br />
Unser freilufterprobter Autor BJØRN ERIK SASS sucht in drei neuen<br />
Büchern nach Tipps für erfolgreiches Urlauben in der Natur<br />
Zum nahenden Ende der Campingsaison<br />
kann ich melden: Endlich doch etwas<br />
verstanden über das Leben im Freien.<br />
Das habe ich vor allem der Literatur zu<br />
verdanken. Und das kam so: Einmal in<br />
diesem Sommer, da gehen mir der Beton, der Lärm<br />
und die Massen in der Stadt fürchterlich auf die<br />
Nerven. Also lade ich den Kofferraum voll Draußenzeug<br />
und suche einen Platz im Freien. Meine<br />
engere soziale Umgebung findet sich nach meinem<br />
Aufruf zum Camping sämtlich in dringende Verpflichtungen<br />
eingebunden, leider, ehrlich. Ich fahre<br />
allein hinaus und nehme stattdessen einige Bücher<br />
mit, die in den vergangenen zwölf Monaten zum<br />
Thema Camping erschienen sind.<br />
Ich beginne, meinen Abendreis im Blechnapf<br />
zwischen den Knien, mit dem handlichsten Werk:<br />
Das Vorzelt zur Hölle – ist ja schon mal ein sagenhaft<br />
guter Titel. Tommy Krappweis, unter anderem Erfinder<br />
von Bernd das Brot, beschreibt darin, Wie ich<br />
die Familienurlaube meiner Kindheit überlebte. Wie<br />
er als Kind am liebsten zu Hause auf dem Sofa lesen<br />
und Pumuckl-Kassetten hören wollte. Stattdessen<br />
musste er Sommerferien für Sommerferien mit der<br />
Familie im VW-Bus nach »Egal, es ist überall heiß<br />
und scheiße«-Land fahren. Sein Vater mag Strände<br />
ohne Sand und Plätze ohne Klo und selbst Seeigelstacheln<br />
in den Füßen, denn es zeigt ihm, dass er<br />
wirklich im Urlaub ist. Krappweis hasst das alles.<br />
Das erinnert mich an unsere Familienurlaube in<br />
den Siebzigern. Wir fuhren mit dem Wohnwagen<br />
nach Südfrankreich. Rumpelten immer ohne Pause<br />
durch, immer auf denselben Campingplatz. Spätestens<br />
ab Lyon übergaben sich reisekrank meine Mutter<br />
rechts hinaus, meine Schwester links hinaus und<br />
unser erschöpfungsschaumschnauziger Hund auf<br />
meinen Schoß. Angekommen und das Lager aufgebaut,<br />
steckte sich mein Vater eine Pfeife an, schwärmte<br />
von der glatten Fahrt, holte sich am Imbiss Muscheln<br />
mit Pommes, war also glücklich, und die Familie<br />
ging im Caravan auf Rekonvaleszenz.<br />
Daran muss ich denken, allein an diesem Sommerabend<br />
dort draußen. Und dann wird mir klar:<br />
Viele Campingkinder werden später Campingväter.<br />
Auch ich bin mit meinen Kindern campen gegangen.<br />
Nicht im Wohnwagen, ich wollte sie nicht einengen.<br />
Ich schaute mir mit ihnen Filme wie Der letzte Mohikaner<br />
an. Nach dem Abspann rasierte ich uns<br />
Mohawk-Frisuren und strich uns Farbe ins Gesicht.<br />
Wir nahmen Wurfbeile und Bogen und Käsestullen,<br />
gingen in den Wald, stellten die besten Szenen des<br />
Films nach und schliefen unter einem Ästedach. Ich<br />
fand es großartig. Mein Sohn nicht. Er nahm mir<br />
seine neue Frisur übel, fand unsere Attacken auf die<br />
Waldspaziergänger albern und wollte nach Hause.<br />
Und das ist nun die beängstigende Lehre aus Das<br />
Vorzelt zur Hölle: Bilde ich mir heute ein, für Angehörige<br />
meines Haushaltes ein tolles Campingevent zu<br />
kreieren, wird es mir in vielen Jahren vielleicht als<br />
zorniges »J’accuse!« um die Ohren gehauen. Um meine<br />
Stimmung aufzuhellen, nehme ich als Nächstes<br />
Campingküche – fantasievoll kochen auf kleinem Raum<br />
zur Hand. Ein rundweg schönes Buch. Zwar handelt<br />
es ebenfalls vom Camping, doch gibt es auf all den<br />
Bildern nur eine einzige Dreiviertelhose und kein einziges<br />
Nackensteak zu sehen. Stattdessen viele süße<br />
Kinder; sie schlagen Purzelbäume im Sand und sammeln<br />
Blümchen für einen Sommerblütensalat.<br />
Frauen in den Schlafsack kochen? Mit<br />
dem richtigen Rezept könnte es klappen<br />
Die Menschen in diesem Buch wohnen in einem<br />
putzigen Eriba-Puck-Caravan, mit Kräuterkasten am<br />
Ausstellfenster. Gehen sie in den Wald, hocken sie in<br />
einem Steilwandzelt ohne Boden und Moskitonetz.<br />
Zeltete ich so, die Mücken würden mich binnen eines<br />
Ferientages auslutschen. Weil diese Menschen aber,<br />
schwingt mir als Botschaft aus den Fotos entgegen, so<br />
leckere Sachen essen und sich mit so vielen schönen<br />
Dingen umgeben, sind sie von stachelabwehrender<br />
Immunkraft. Seifert will mit diesem Buch »beweisen,<br />
dass sich das Kochen beim Campen trotz erschwerter<br />
Bedingungen nicht auf Spaghetti mit Tomatensoße,<br />
Würstchen und Kartoffelsalat oder die ewigen<br />
Pommes vom Imbiss beschränken muss«. Die Rezepte<br />
sind in Sektionen für den Strand, den Hinterhof,<br />
den See, den Wald und den Winter gegliedert. Symbole<br />
zeigen, wann ich Topf, Pfanne oder beides brauche.<br />
Die nötige Ausrüstung wurde klein gehalten.<br />
Empfindliche Menschen wie ich reagieren auf all<br />
diese Perfektion zunächst verschüchtert. Das ist natürlich<br />
meine Schuld, die Autorin weiß ja nicht, von<br />
wie weit entfernt sie mich in ihr Leckerschmecker-<br />
Camping-Land abholen muss. Einmal war eine<br />
Freundin meiner Vorstellung von Campingessen<br />
während einer langen Reise durch die USA ausgeliefert.<br />
Ich kochte. Reis. Heute mit Tomaten, morgen<br />
mit Bohnen, übermorgen mit Mais. Nach einiger<br />
Zeit gewöhnte sich diese Freundin an, vor dem<br />
Abendessen eine Runde spazieren zu fahren. Wenn<br />
sie zurückkam, hatte sie meist doch keinen Appetit.<br />
Sie nahm aber nicht ab. Eines Abends setzte ich den<br />
Reis auf und ging spazieren. Gleich außerhalb des<br />
Campingplatzes sah ich unser Auto. Es stand vor<br />
einem Imbiss. Meine Freundin aß eine Pizza. Wir<br />
stritten. Sie behauptete irgendwann sogar, mein Reis<br />
sei nicht lecker. Wir reisten getrennt weiter.<br />
Daher also komme ich und sehe die Zi tro nen tarte<br />
auf Seite 66 der Campingküche und denke: Um Himmels<br />
willen, soll ich denn noch einen Backofen mitschleppen?<br />
Ist dann aber doch nur reine Anrührware.<br />
Kann man eine Frau in den Schlafsack kochen? In<br />
diesem Buch steht jedenfalls, wie es gehen könnte.<br />
Und im nächsten, in welchem Unterschlupf sich<br />
der Schlafsack noch besser machen würde: Für ihr<br />
Mit dem Bulli durch die Welt haben David und Cee<br />
Eccles Fotos und Geschichten von VW-Bussen, ihren<br />
Besitzern und Reisen gesammelt. Viele bildhübsche<br />
Fahrzeuge sind darunter: makellos eingerichtet, Vorhänge<br />
vor den Fenstern, nirgends ein Riss in der Innenverkleidung,<br />
nicht ein Schmorfleck von zu heiß<br />
abgestellten Töpfen auf den Küchenarbeitsplatten.<br />
Es muss wunderschön sein, in einem solchen Puppenstubentraum<br />
zu campen, am liebsten zusammen mit<br />
den Mädels vom Immenhof auf einer Pony-Koppel.<br />
Sollte unser blitzsauberes Abenteuer von Dauer sein,<br />
brauchte so ein Bus noch einen Anhänger: In dem<br />
führen dann Putzfrau, Inneneinrichterin und Kfz-<br />
Meisterin mit.<br />
Es gibt aber auch die Menschen, die tatsächlich<br />
aufbrechen. Von hier durch Afrika. Von dort nach<br />
Indien und Südamerika und immer weiter. Monate-<br />
und jahrelang. Da wird nicht geschraubt und geschweißt<br />
und lackiert, um für VW-Bus-Vereinstreffen<br />
auf gut gemähter Wiese kataloggetreu auszusehen,<br />
sondern allein, um weiterzukommen. Ein Foto zeigt<br />
einen Bulli auf einer anatolischen Schotterpiste: Viel<br />
mehr Lust aufs Draußensein passt nicht in ein Bild.<br />
Tommy Krappweis: Das Vorzelt zur Hölle. Wie<br />
ich die Familienurlaube meiner Kindheit überlebte.<br />
Knaur Verlag, München <strong>2012</strong>; 272 S., 8,99 €<br />
Claudia Seifert, Julia Hoersch, Nelly Mager:<br />
Campingküche: Fantasievoll kochen auf kleinem<br />
Raum. AT Verlag, Aarau <strong>2012</strong>; 160 S., 24,90 €<br />
David und Cee Eccles: Mit dem Bulli durch<br />
die Welt: Der VW-Bus und seine Fans.<br />
Delius Klasing Verlag, Bielefeld 2011; 176 S., 19,90 €
CHANCENSCHULE<br />
HOCHSCHULE<br />
BERUF<br />
Der »Anti-Sarrazin«<br />
Der Pädagoge Paul Schwarz versucht den Deutschen etwas beizubringen – mit Filmen über Schule VON FRIEDERIKE LÜBKE<br />
Wenn Paul Schwarz über sich<br />
spricht, dann benutzt er gerne<br />
einen Begriff, den er als Auszeichnung<br />
empfindet. Vor einem<br />
Jahr zeigte er im Stuttgarter<br />
Rathaus einen Film über Migranten. Danach<br />
befand eine Zuschauerin: »Sie sind ja ein richtiger<br />
Anti-Sarrazin.« Das Gegenteil von Thilo Sarrazin<br />
und seinen Thesen über Migrantenkinder – das<br />
trifft es, dachte Schwarz.<br />
Paul Schwarz ist Pädagoge, doch er wechselte<br />
von der Schule zum Fernsehen. Seit mehr als<br />
20 Jahren produziert er Filme über Bildung, insgesamt<br />
über 120, so viele wie kaum jemand sonst<br />
in Deutschland. 2007 bekam er dafür das Bundesverdienstkreuz<br />
am Bande. Dreimal waren seine<br />
Filme für den Grimme-Preis nominiert, darunter<br />
der ARD-Dreiteiler »Fremd und doch vertraut«.<br />
Aber bekannt wie Sarrazin ist er nicht.<br />
Schwarz glaubt, das liege an den Medien. »Ein<br />
türkischer U-Bahn-Schläger macht Schlagzeilen.<br />
Ein türkischer Arzt nicht«, sagt er. Gerade um<br />
solche Menschen geht es aber in seinen jüngsten<br />
Filmen. Bildung ist sein Thema, Erfolge zeigt er<br />
am liebsten. Oberstes Prinzip: Mut machen. Zeigen:<br />
Es geht doch.<br />
Paul Schwarz ist 68. Das weiße Haar fällt ihm<br />
lang über die Ohren. Er könnte aufhören zu arbeiten,<br />
aber er will nicht. Wenn Sarrazin schreibt,<br />
dass ungebildete Eltern mit großer Wahrscheinlichkeit<br />
ungebildete Kinder haben, gibt Schwarz<br />
ihm im Prinzip recht. Auch er sieht das häufig.<br />
Der Sohn des Arztes wird wahrscheinlich studieren.<br />
Der Sohn der Putzfrau nicht. Nur glaubt<br />
Schwarz, dass das nicht an den Eltern liegt. Seiner<br />
Ansicht nach scheitern Kinder am dreigliedrigen<br />
Schulsystem und nicht selten auch an Vorurteilen.<br />
Er hat Ärztinnen und Rechtsanwälte getroffen,<br />
die zuerst auf die Hauptschule geschickt<br />
wurden, »nur weil ihre Eltern Türken waren«. So<br />
etwas ärgert ihn. Vielleicht auch wegen seiner eigenen<br />
Geschichte.<br />
In Japan hat er unterrichtet,<br />
heute filmt er in der ganzen Welt<br />
Sein Vater fiel im Krieg, seine Mutter hatte wenig<br />
Geld. »Kleine Verhältnisse« nennt Schwarz das.<br />
Erst auf der Abendschule machte er das Abitur,<br />
studierte und wurde Lehrer. Insgesamt zehn Jahre<br />
lang hat er unterrichtet. Ende der siebziger<br />
Jahre ging er mit seiner Frau nach Japan und<br />
lehrte Deutsch an der Universität. Ende der achtziger<br />
Jahre verbrachte er mit ihr noch einmal vier<br />
Jahre als Dozent in Argentinien. »Ich kenne die<br />
Welt so ’n bisschen«, sagt er heute. Zurück in<br />
Deutschland, betreute er Sendungen über guten<br />
Unterricht und wurde vom Lehrer zum Beobachter<br />
der Lernkultur.<br />
Dabei stieß er auf einen Widerspruch: Im<br />
Land der Dichter und Denker hat Schule einen<br />
schlechten Stand. Einmal drehte Schwarz in einem<br />
internationalen Physikkurs in Göttingen.<br />
Horst Köhler, damals Bundespräsident, besuchte<br />
den Unterricht und setzte sich zu den Schülern.<br />
»In Physik war ich nie gut«, sagte der Bundespräsident.<br />
Koketterie vielleicht, aber Schwarz fällt so<br />
etwas auf: Prominente, die mit schlechten Noten<br />
prahlen. Wettermoderatoren, die es als gute<br />
Nachricht bringen, wenn die Schule ausfällt.<br />
Wer es zu etwas gebracht hat, behauptet, dass es<br />
nicht an der Schule lag. »Keiner will ein Streber<br />
sein«, sagt Schwarz. Alle fänden Bildung wichtig,<br />
aber in den Massenmedien tauche sie kaum auf.<br />
»Wann lief der letzte Film über Schule, in dem es<br />
nicht um einen Amoklauf ging?«, fragt er. »Wann<br />
ging es in einer Talkshow mal um Bildung?«<br />
Er bemerkt das auch, weil es ihn selbst betrifft.<br />
In den letzten Jahren war er viel im Auftrag<br />
staatlicher oder privater Bildungseinrichtungen<br />
unterwegs. Das Interesse der Sender aber hat<br />
nachgelassen. Für neue Filmideen muss er Sponsoren<br />
suchen.<br />
»Paul Schwarz ist jemand, der dranbleibt«,<br />
sagt der Pädagoge und Schulreformer Heinz<br />
Klippert. Die beiden sind auf einer Wellenlänge,<br />
seit 20 Jahren kennen sie sich, immer wieder arbeiten<br />
sie zusammen. Wenn Schwarz über die<br />
Bildungschancen von Migranten berichte, geschehe<br />
das »aus innerem Antrieb und persönlichem<br />
Anliegen«, glaubt Klippert. Er hat erlebt,<br />
wie Schwarz mit Politikern diskutiert. »Da legt er<br />
den Finger in die Wunde. Er ist unerbittlich,<br />
wenn sich ihre Ansprüche nicht mit der Realität<br />
decken.« Gleichzeitig sei Schwarz pragmatisch.<br />
Es gehe ihm um normale Schulen, nicht um einzelne<br />
Leuchtturmprojekte.<br />
»Die Schüler sind nicht faul<br />
und die Lehrer nicht dumm«<br />
Schwarz hat sich ein Bild gemacht und wird nicht<br />
müde, zu wiederholen, was ihm wichtig ist. Er<br />
wünscht sich auch in Deutschland eine Schule<br />
für alle und langes gemeinsames Lernen. Er zitiert<br />
den ehemaligen UN-Sonderberichterstatter<br />
für das Recht auf Bildung, der ihm sagte: »Die<br />
deutsche Schule teilt, sie führt nicht zusammen.«<br />
Er wünscht sich, dass die Bildungsforscher und<br />
Pädagogikprofessoren mehr Mitsprache in der<br />
Politik einfordern. Er selbst muss nicht dozieren,<br />
er kann die Bilder wirken lassen. Seine Filme<br />
sollen Politikern einen Anstoß geben, indem sie<br />
zeigen, was schon gut läuft.<br />
Im Gegensatz zum Unterrichten ist Filmemachen<br />
Teamarbeit. Schwarz recherchiert, schreibt<br />
das Drehbuch, führt die Interviews und entscheidet<br />
über den Aufbau. Filmen und Schneiden<br />
übernehmen Kameraleute und Cutter. »Mit der<br />
Kamera kenne ich mich nicht aus«, sagt er freimütig,<br />
»Das beste Bild findet der Kameramann.«<br />
Dominanz ist nicht seine Sache. »Genügsam und<br />
sehr gelassen« sei Schwarz, bescheinigt ihm Jens-<br />
Ove Heckel, der ihn letztes Jahr bei einem<br />
schwierigen Dreh erlebt hat. Gemeinsam waren<br />
sie in Dschibuti, am Horn von Afrika. Heckel<br />
leitete dort Umweltbildungs-Workshops für<br />
Grundschullehrer, Schwarz machte einen Film<br />
darüber. Anstrengend war für beide auch eine anschließende<br />
mehrtägige Exkursion in den entlegenen<br />
Forêt du Day, besonders weil die Straßen<br />
dorthin und die Unterkunft sehr bescheiden waren.<br />
Aber Schwarz mache so etwas mit.<br />
Für seine Filme ist er viel unterwegs, von Afrika<br />
bis Schweden. Ständig fallen ihm Erlebnisse<br />
aus anderen Ländern ein. Er hat gesehen, wie sich<br />
Schüler in Japan für ihre Schule einsetzen. Es<br />
läuft Polkamusik von Strauß, und die Jugendlichen<br />
fegen die Flure. »Undenkbar bei uns«, sagt<br />
Schwarz. Er hat gesehen, wie anschaulich Schüler<br />
in Schweden lernen, wie gut das Schulessen in<br />
Finnland ist. »Diese Länder lobt man, aber man<br />
lernt nicht von ihnen«, sagt er. Ein Lehrer in<br />
Skandinavien erklärte ihm: »Ihr Deutschen habt<br />
die Reformpädagogik erfunden, wir haben sie umgesetzt.«<br />
Dabei sei nicht alles schlecht in Deutschland,<br />
findet Paul Schwarz. Deshalb sagt er auch Sätze wie:<br />
»Die Schüler sind nicht faul und die Lehrer nicht<br />
dumm« und: »Multikulti ist nicht gescheitert.«<br />
Es ist für Schwarz ein Dilemma. Einerseits ärgert<br />
er sich über das deutsche Schulsystem, er findet in<br />
anderen Ländern bessere Beispiele – andererseits<br />
aber will er die Schule nicht dauernd kritisieren, wie<br />
das so viele tun. Er versucht es im Guten. Wäre das<br />
deutsche Bildungswesen ein Kind in seiner Klasse,<br />
er hätte es noch nicht aufgegeben. Er lobt den Schüler<br />
Deutschland, damit er sich vielleicht noch ein<br />
bisschen mehr anstrengt.<br />
S. 73 BERUF<br />
S. 87 LESERBRIEFE<br />
S. 88 <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> DER LESER<br />
Dank Internet und 3-D-Druckern werden<br />
Ingenieure zu Erfindern, die keine Industrie<br />
zur Produktentwicklung brauchen ab S. 77 STELLENMARKT<br />
2005 war Schwarz für das Auswärtige Amt in Afghanistan.<br />
Sein Film zeigt ein Schulhaus, in dem<br />
sich die Mädchen drängen. Ihre Schuhe sind staubig.<br />
Das Klassenzimmer ist mehr Verschlag als<br />
Raum, unterrichtet wird bis abends um sieben.<br />
Trotzdem lernen die Schülerinnen eifrig. Wenn<br />
Schwarz sich diesen Film ansieht, ist er immer noch<br />
beeindruckt. »Die Mädchen dort«, sagt er, »können<br />
alles erreichen, wenn man sie lässt.« In Berlin hat er<br />
vor Kurzem Hauptschüler gefragt, was sie werden<br />
wollen. »Hartz IV«, haben sie zu ihm gesagt. Paul<br />
Schwarz bleibt noch viel zu tun.<br />
www.zeit.de/audio<br />
Paul Schwarz (Mitte) war<br />
früher Lehrer, jetzt dreht er<br />
Filme über Bildung, hier in<br />
einer Realschule in Landau<br />
Foto: Markus Hintzen für <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>/www.markus-hintzen.com<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 69<br />
BILDUNGSPOLITIK<br />
Letzter Mann<br />
Die CDU stellt nur noch einen<br />
Kultusminister<br />
Vor Kurzem hat Bundesbildungsministerin<br />
Annette Schavan angekündigt, nicht mehr als<br />
stellvertretende CDU-Vorsitzende zu kandidieren.<br />
Jetzt sei der richtige Zeitpunkt, sich aus<br />
der Parteiführung zurückzuziehen, sagte sie<br />
zur Begründung, weil auf dem vergangenen<br />
Bundesparteitag der CDU mit der Modernisierung<br />
der Bildungspolitik eines ihrer Kernanliegen<br />
verwirklicht worden sei.<br />
Verlässt sie also ein gut bestelltes Haus?<br />
Tatsächlich hat sich ihre Partei vom dreigliedrigen<br />
Schulsystem verabschiedet, tritt für<br />
frühkindliche Bildung und Ganztagsschulen<br />
ein. Das ist vernünftig, wenn auch – oder gerade<br />
weil – damit die Grenzen zur Schulpolitik<br />
von SPD und Grünen verschwimmen.<br />
Da aber die inhaltlichen Unterschiede<br />
zwischen den Parteien schwinden, muss man<br />
mit Persönlichkeiten punkten. Und da ist die<br />
Bilanz der CDU unterirdisch. Als Schavan im<br />
Jahr 2005 Bundesministerin wurde, waren<br />
sieben Schulminister – darunter die von Baden-Württemberg,<br />
Hessen und Nordrhein-<br />
Westfalen – Mitglied der CDU. Doch diese<br />
Gestaltungsmacht wurde nicht genutzt, und<br />
Jahr um Jahr wurde es einer weniger.<br />
Nun ist der Niedersachse Bernd Althusmann<br />
der einzige Kultusminister mit CDU-<br />
Parteibuch. Am 17. Januar 2013 sind in seinem<br />
Bundesland Wahlen ... Vielleicht ist jetzt<br />
der Zeitpunkt für die CDU, sich einmal richtig<br />
Sorgen um ihre künftige Bildungspolitik<br />
zu machen. THOMAS KERSTAN<br />
MEHR CHANCEN:<br />
Neu am Kiosk:<br />
<strong>ZEIT</strong> CAMPUS<br />
Wie Studenten<br />
schummeln und warum<br />
es so schwierig ist, sie<br />
davon abzubringen<br />
Im Netz:<br />
Wo studieren? Welche Hochschule in einem<br />
Fach führt, verrät das CHE-Hochschulranking<br />
www.zeit.de/hochschulranking
70 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong><br />
70 in einer Klasse<br />
Ägypten fehlt<br />
eine Schulrevolution<br />
<strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>: Herr Mager, mehr als ein Drittel der<br />
Ägypter sind Analphabeten, »Bildung für alle« ist<br />
eine zentrale Forderung der Demokratie-Bewegung.<br />
Was läuft an den Schulen schief?<br />
Wolfgang Mager: Das ägyptische Schulsystem leidet<br />
vor allem am hohen Bevölkerungswachstum.<br />
In den Klassen sitzen 60, 70 Kinder. Es findet ausschließlich<br />
Frontalunterricht statt, moderne Methoden<br />
wie »Selbstorganisiertes Lernen« sind<br />
kaum möglich. Deshalb schicken Ärzte, Militärs<br />
und Unternehmer ihre Kinder auf Privatschulen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Verdienen auch die Lehrer zu wenig?<br />
Mager: Seit der Revolution bekommen die Lehrer<br />
wenigstens in Kairo und Alexandria an staatlichen<br />
Schulen mehr Geld. Aber 750 ägyptische Pfund,<br />
also etwa 100 Euro, sind zum Leben natürlich zu<br />
wenig. Zum Vergleich: Ein Kilo Fleisch kostet<br />
etwa 80 Pfund. Die meisten leben von Nachhilfe –<br />
das ist eine richtige Industrie. Leider verlassen sich<br />
viele Kinder darauf und sind im Unterricht nur<br />
noch physisch anwesend. Mit Hausaufgabenbetreuung<br />
haben wir an unserer Schule versucht,<br />
dem entgegenzuwirken, aber viele Eltern schicken<br />
ihre Kinder trotzdem zur Nachhilfe.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Wie finanzieren Sie Ihre Lehrer?<br />
Mager: Ein Viertel sind entsandte Lehrkräfte, die<br />
zu den in Deutschland üblichen Tarifen bezahlt<br />
werden. Unsere ägyptischen Lehrer finanzieren wir<br />
über das Schulgeld. Sie verdienen etwa sechs Mal<br />
mehr als die Lehrer an staatlichen Schulen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Wie qualifiziert sind die ägyptischen Lehrer?<br />
Mager: Die Arbeitslosigkeit ist groß. Deshalb bekomme<br />
ich auch Initiativbewerbungen, die noch<br />
nie mit Schule zu tun hatten. In Ägypten gibt es<br />
zwar ein Lehramtsstudium, aber kein Referendariat,<br />
und bei Weitem nicht jeder Lehrer einer staatlichen<br />
Schule hat ein Lehramtsstudium absolviert.<br />
Ich achte aber darauf, dass<br />
die Lehrer wenigstens Erfahrung<br />
mit Kindern gesammelt<br />
und ihre Unterrichtsfächer<br />
studiert haben.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Wie teuer ist es, auf<br />
Ihre Schule zu gehen?<br />
Wolfgang Mager<br />
leitet eine<br />
Deutsche<br />
Auslandsschule<br />
in Alexandria<br />
Mager: Wir verlangen etwa<br />
1900 Euro im Jahr und gehören<br />
damit zu den günstigen<br />
Privatschulen. Von der<br />
Zentralstelle für Auslandsschulwesen<br />
in Deutschland<br />
sind wir gehalten, keine Ge-<br />
winne zu erwirtschaften und auch Kindern aus<br />
finanziell schwachen Familien einen Besuch zu ermöglichen.<br />
Das entspricht auch dem Grundsatz<br />
unseres katholischen Trägers, dem Orden der<br />
Borromäerinnen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Welche Auswirkungen wird es für das Schulsystem<br />
und für Ihre Schule haben, wenn jetzt die<br />
Muslimbrüder regieren?<br />
Mager: Es ist noch viel zu früh, um das wirklich<br />
sagen zu können. Vermutlich wird das Militär weiterhin<br />
auf gute Bildung in den eigenen Reihen<br />
achten und seine Privilegien nicht so leicht aufgeben.<br />
Wir haben bei uns 85 Prozent Muslime, der<br />
Rest sind koptische Christen. An unserer Schule<br />
funktioniert das Miteinander. Allerdings ist eine<br />
unserer Schülerinnen bei dem Anschlag auf die<br />
koptische Kirche im vergangenen Jahr ums Leben<br />
gekommen. Seit der Revolution gibt es auch immer<br />
wieder viele Gerüchte, die Ängste schüren.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Was meinen Sie damit?<br />
Mager: Einmal habe ich die Schule geschlossen,<br />
weil angeblich der Bahnhof brannte. Als ich später<br />
dort vorbeifuhr, war gar nichts passiert. Seitdem<br />
habe ich ein Netzwerk aus sicheren Informanten<br />
an kritischen Orten aufgebaut. An den Wahltagen<br />
war die Angst bei einigen so groß, dass wir zum<br />
Teil keinen Unterricht gemacht haben.<br />
Die Fragen stellte GABRIELE MEISTER<br />
Gehirnwäsche<br />
Wirtschaftsverbände und Gewerkschaftsstiftungen versorgen Lehrer mit Unterrichtsmaterial. Sieht so Aufklärung aus? VON SEBASTIAN KRETZ<br />
Mitbestimmung stört, Umverteilung<br />
bremst, der Sozialstaat ufert<br />
aus – höchste Zeit, mehr Marktwirtschaft<br />
zu wagen! So einfach ist<br />
das; am besten lernen es die Kinder<br />
schon in der Schule. Und wenn Kultusminister<br />
und Schulbuchverlage das anders sehen, bringt<br />
man es den Schülern einfach selbst bei.<br />
»Man«, das sind deutsche Unternehmen und Wirtschaftsverbände,<br />
die versuchen, Lobbyarbeit schon<br />
bei Schülern zu betreiben, möglichst direkt und ungefiltert.<br />
So sponsern sie Schulen mit ihren Produkten<br />
oder schicken Mitarbeiter in die Klassenzimmer, die<br />
– scheinbar neutral – aus der Praxis berichten.<br />
Es gibt aber auch einen diskreteren Weg, den Kapitalismus<br />
an den Schüler zu bringen. Seit einigen<br />
Jahren machen wirtschaftsnahe Institute dem Schulbuch<br />
Konkurrenz – mit eigenen, unterrichtsfertig<br />
aufbereiteten Broschüren zu Themen wie Mitbestimmung,<br />
Globalisierung oder Gerechtigkeit. Besonders<br />
eifrig sind dabei das Kölner Institut der deutschen<br />
Wirtschaft (IW), unter anderem vom Bund der<br />
deutschen Industrie finanziert, und das Institut für<br />
ökonomische Bildung (IÖB) der Universität Oldenburg,<br />
das mit dem Handelsblatt und wechselnden<br />
Partnern wie dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag<br />
zusammenarbeitet. »Der Kampf um<br />
die Köpfe der Kinder hat begonnen«, sagt Tim Engartner,<br />
Professor für Didaktik der Sozialwissenschaften<br />
an der Universität Frankfurt. Denn während der<br />
Satz des Pythagoras unabänderlich gilt, behandeln<br />
Fächer wie Sozialkunde offene Fragen: Welche ist die<br />
beste Staatsform? Wie sieht die ideale Wirtschaftsordnung<br />
aus? Was ist gerecht? »In diesen Fächern wird<br />
die geistig-moralische Grundhaltung der Schüler<br />
geprägt«, sagt Engartner.<br />
In der politischen Bildung gibt es deshalb eine Art<br />
Grundgesetz, auf das sich 1976 alle Parteien und<br />
Konfessionen geeinigt haben. Dieser sogenannte<br />
Beutelsbacher Konsens soll verhindern, dass Regierungen,<br />
Schulbuchverlage oder Lehrer das Klassenzimmer<br />
missbrauchen, um eigene politische Ansichten<br />
auszusäen. Der Konsens verpflichtet Lehrer unter<br />
anderem auf folgende Grundsätze: Sie müssen das<br />
Überwältigungsverbot achten, dürfen also Schülern<br />
nicht ihre Meinung aufzwingen, sollen vielmehr verschiedene<br />
Standpunkte neutral vermitteln und die<br />
Schüler ermuntern, sich ein eigenes Bild zu machen.<br />
Wenn Themen in der Gesellschaft kontrovers diskutiert<br />
werden, müssen sie unterschiedliche Meinungen<br />
abbilden, dürfen also nicht einseitig unterrichten.<br />
»Die Schüler sollen wirtschaftspolitisch<br />
eingenordet werden«<br />
Doch während die meisten Bundesländer offizielle<br />
Schulbücher erst nach gründlicher Prüfung zulassen,<br />
gibt es für privat hergestelltes und verbreitetes Material<br />
keine Qualitätskontrolle. Den Lehrern steht es<br />
frei, nach eigenem Ermessen ergänzendes Material zu<br />
verwenden.<br />
Die Frage ist: Sind Heftreihen wie Handelsblatt<br />
macht Schule von IÖB und Verlagsgruppe Handelsblatt<br />
(die zur Dieter von Holtzbrinck Medien GmbH<br />
gehört, die auch 50 Prozent am Zeitverlag hält) oder<br />
Thema Wirtschaft (IW) eine achtbare Ergänzung der<br />
bestehenden Schulbücher, aktuell und ausgewogen?<br />
Oder sind sie das Deckmäntelchen, unter dem eine<br />
wirtschaftsliberale Weltanschauung in die Klassenzimmer<br />
huscht – und in die Köpfe der Schüler?<br />
»Solche Broschüren missachten die Prinzipien des<br />
Beutelsbacher Konsenses«, sagt Jeannette Klauza vom<br />
Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Die Hefte<br />
höben einseitig die Vorzüge eines schlanken Staats<br />
hervor und stellten das Sozialsystem als überfordert<br />
dar, ohne die Gegenposition abzubilden. »Die Schüler<br />
sollen wirtschaftspolitisch eingenordet werden.«<br />
Hans Kaminski, der Direktor des IÖB, bestreitet,<br />
dass seine Veröffentlichungen eine neoliberale Schlagseite<br />
haben. »Wir berücksichtigen selbstverständlich<br />
SCHULE<br />
CHANCEN<br />
den Beutelsbacher Konsens. Unser Ziel ist es, gemeinsame<br />
und unterschiedliche Interessen deutlich zu<br />
machen und didaktisch ausgewogen zu informieren.«<br />
Tatsächlich kommen etwa im Heft Unsere Wirtschaftsordnung<br />
sowohl Befürworter als auch Kritiker der<br />
freien Marktwirtschaft zu Wort. Allerdings ist für<br />
Kommentare, die eine »überzogene Umverteilungspolitik«<br />
und einen »ausufernden Sozialstaat« geißeln,<br />
Platz auf vier Seiten. Dem mäßigen Rang, den<br />
Deutschland bei der sozialen Gerechtigkeit im internationalen<br />
Vergleich einnimmt, müssen dagegen<br />
17 Zeilen genügen – ohne einen Hinweis auf mögliche<br />
Ursachen oder Lösungen.<br />
Das Kölner IW beschäftigt sich in einem Thema<br />
Wirtschaft von 2005, das das IW auf seiner Website<br />
anbietet, mit Mitbestimmung. Mehrfach geht es<br />
gegen »ideologisch eingestellte Betriebsräte«, die<br />
»unbestritten« in der Lage seien, »Betriebsabläufe<br />
empfindlich zu stören«. Als wertvoll bezeichnen die<br />
Autoren die Arbeit eines Betriebsrats nur dann, wenn<br />
sie dem »wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens<br />
dient« und »die Beteiligten nicht im Traum daran<br />
denken, Punkt für Punkt die Paragraphen des Betriebsverfassungsgesetzes<br />
umzusetzen«.<br />
Die offiziellen Schulbücher sind oft<br />
veraltet, für neue fehlt Geld<br />
Die zuständige Redakteurin des IW, Irina Berenfeld,<br />
möchte sich zum Inhalt der Mitbestimmungsbroschüre<br />
nicht äußern; sie habe diese nicht verantwortet.<br />
Neuere Hefte seien jedoch »so neutral und ausgewogen<br />
wie möglich«. Vollkommen objektiv könne ein<br />
Text aber nie sein. »Wenn es also zu kleinen Verzerrungen<br />
kommt, sind diese eher ungewollt.«<br />
In einem weiteren IW-Heft von 2011 verwirft der<br />
Autor die Ansichten von »Otto und Lieschen Normalverbraucher«<br />
und lässt dann die »Ökonomen« zu Wort<br />
kommen, die sich offenbar allesamt einig sind, dass<br />
»ein hoher Kündigungsschutz (...) ein Hindernis« sei<br />
– die These bleibt unwidersprochen.<br />
Ob und wie Lehrer die Broschüren im Unterricht<br />
verwenden, dazu gibt es keine Studien. »Ein<br />
ausgebildeter Wirtschaftslehrer kann solche Materialien<br />
sichten, bewerten und gezielt einsetzen«, sagt<br />
Didaktiker Engartner. Allerdings mangele es oft an<br />
Fachlehrern. Zudem sind die offiziellen Schulbücher<br />
oftmals veraltet, für neue fehlt das Geld. Wollen<br />
Lehrer ihren Schülern etwa Finanzkrise oder<br />
Euro-Rettung erklären, müssen sie improvisieren.<br />
Oder zu den kostenlosen Broschüren samt vorbereiteten<br />
Fragestellungen und Übungen greifen. Die<br />
IÖB-Reihe »Handelsblatt macht Schule« wird nach<br />
eigenen Angaben Lehrern ausschließlich auf Anforderung<br />
zugeschickt – die Gesamtauflage des erfolgreichsten<br />
Hefts liegt derzeit bei 35 000 Stück.<br />
Auch die Kritiker des Kapitalismus versuchen,<br />
ihren Standpunkt mit kostenlosem Material an den<br />
Schüler zu bringen. An Einseitigkeit stehen sie dabei<br />
ihren Gegenspielern aus der Wirtschaft in<br />
nichts nach. Die globalisierungskritische Organisation<br />
Attac wettert in einem ihrer Hefte gegen »radikale<br />
Privatisierung« und macht Werbung für eine<br />
eigene Kampagne gegen Energiekonzerne. Die<br />
Hans-Böckler-Stiftung des DGB ignoriert in ihrem<br />
Heft zur Mitbestimmung mögliche Nachteile so<br />
entschlossen wie das IW die Vorteile.<br />
»Wenn Lehrer das Thema mit Heften des IW<br />
behandeln, werden sie es in der Regel nicht noch<br />
einmal mit Materialien der Hans-Böckler-Stiftung<br />
unterrichten«, sagt Engartner. »Eine am Beutelsbacher<br />
Konsens ausgerichtete Darstellung findet nicht<br />
statt. Das ist ein didaktisches Desaster.« Ohnehin<br />
kämpfen die Kontrahenten mit ungleichen Mitteln:<br />
So setzte die Böckler-Stiftung in sechs Jahren<br />
insgesamt 18 000 ihrer Hefte ab, während das IW<br />
jährlich allein 8000 Exemplare von Thema Wirtschaft<br />
druckt. Attac hat 2008 ganz aufgehört, neue<br />
»Bildungsbausteine« zu produzieren – den Globalisierungskritikern<br />
fehlt das Geld.<br />
Abb.: Beck für <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>/www.schneeschnee.de; Foto: privat
CHANCEN HOCHSCHULE<br />
Globuli-<br />
Akademie<br />
Über die Gründung privater Hochschulen<br />
erlangen Pseudowissenschaften<br />
höhere Weihen VON BERND KRAMER<br />
In diesen Tagen ist die Freude in Traunstein<br />
groß. Die 18 000-Einwohner-Stadt in<br />
Oberbayern bekommt bald eine eigene<br />
Hochschule. Bloß was für eine? Im Ort soll<br />
die erste europäische Hochschule für Homöopathie<br />
eröffnen, getragen von der European<br />
Union of Homoeopathy, einem Lobbyverband<br />
der Alternativmedizin aus Freiburg. Die ersten<br />
Studenten werden im kommenden Jahr erwartet.<br />
Eines Tages sollen sie als Homöopathen mit<br />
Bache lor- und Mastergrad abschließen. Über das<br />
genaue Konzept hüllen sich die Hochschulgründer<br />
noch in Schweigen. Die Lokalpolitik ist dafür<br />
umso begeisterter: Einstimmig begrüßte der<br />
Kreisausschuss das Vorhaben. Landrat Hermann<br />
Steinmaßl sieht in der Homöopathie-Hochschule<br />
gar einen »wichtigen Baustein für die Bildung<br />
und die medizinische Versorgung im Landkreis«.<br />
Kritik? Fehlanzeige.<br />
Es wirkt wie ein Schildbürgerstreich: Was die<br />
Wissenschaft als wirkungsloses Therapieverfahren<br />
ad acta gelegt hat, blüht in der bayerischen<br />
Provinz wieder auf. Unzählige Studien zeigen,<br />
dass homöopathische Mittel nicht besser helfen<br />
als ein Placebo. Mit privatem Geld lässt sich um<br />
ein spekulatives Verfahren herum aber offenbar<br />
ohne großen Widerstand eine Hochschule bauen.<br />
Wie kann das sein?<br />
Der Traunsteiner Fall zeigt eine Entwicklung,<br />
die sich auch andernorts abzeichnet. Die Zahl<br />
der privaten Hochschulen ist in den vergangenen<br />
Jahren förmlich explodiert und hat sich in den<br />
letzten zehn Jahren verdoppelt. 2000 boten erst<br />
47 Privathochschulen ihre Dienste auf dem<br />
deutschen Markt an. Jetzt sind es schon 108. Die<br />
privaten machen damit inzwischen rund ein<br />
Viertel aller Hochschulen aus. Der Wissenschaftsrat,<br />
das wichtigste Beratungsgremium der<br />
Politik in Fragen von Forschung und Lehre, sieht<br />
die Entwicklung positiv: Die privaten Anbieter<br />
böten oft Beispiele für die »erfolgreiche Akademisierung<br />
bisher nicht akademischer Berufe«,<br />
vor allem im Bildungs- und Gesundheitsbereich,<br />
wo sie erste Studiengänge für angehende Erzieher<br />
oder Krankenpfleger schaffen und damit oft zu<br />
Vorreitern werden. Einer Studie zufolge, die der<br />
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft<br />
und die Unternehmensberatung McKinsey 2010<br />
vorlegten, locken die Privathochschulen mit der<br />
Aufwertung früherer Ausbildungsberufe gerade<br />
die Bevölkerungsschichten in die Hörsäle, die<br />
bislang nicht studierten. Doch diese Akademisierung<br />
hat Schattenseiten: Private Hochschulen<br />
lehren auffällig oft wissenschaftlich fragwürdige<br />
Inhalte – ohne dass sie bislang allzu viel zu befürchten<br />
hätten.<br />
Eine inhaltliche Prüfung des<br />
Angebots findet nicht statt<br />
Die Berliner Steinbeis-Hochschule bietet beispielsweise<br />
Studiengänge in Komplementärmedizin an,<br />
ebenso wie die Fresenius-Hochschule in Idstein und<br />
die Berliner Hochschule für Gesundheit und Sport.<br />
An der anthroposophischen Alanus-Hochschule in<br />
Alfter bei Bonn kann man sogar einen Bachelor in<br />
Eurythmie machen. »Was sich im staatlichen System<br />
nicht unterbringen lässt, schmuggelt man in<br />
privat organisierte Hochschulen hinein«, kritisiert<br />
Martin Mahner von der Gesellschaft zur wissenschaftlichen<br />
Untersuchung von Parawissenschaften.<br />
Nach den wilden Gründerjahren haben sich die<br />
Kultusminister im Jahr 2004 darauf verständigt,<br />
dass neue Privathochschulen vom Wissenschaftsrat<br />
begutachtet werden sollen, ehe sie eine staatliche<br />
Anerkennung erhalten. Diese sogenannte institutionelle<br />
Akkreditierung privater Hochschulen solle<br />
»möglichst vor Betriebsaufnahme, aber spätestens<br />
vor der endgültigen Anerkennung durch die Länder«<br />
geschehen, so die Empfehlung der Kul tusminis<br />
ter kon fe renz. Im Akkreditierungsverfahren<br />
prüfen Experten des Wissenschaftsrates das Konzept,<br />
die Finanzen, das Personal, Betreuungsrelationen<br />
und Lehrpläne; sie besuchen die Hochschulen<br />
und begutachten Raumausstattung und<br />
die Bestände der Bibliotheken. Der Wissenschaftsrat<br />
bezeichnet die institutionelle Akkreditierung<br />
als »Verfahren der Qualitätssicherung, das<br />
klären soll, ob eine Hochschuleinrichtung in der<br />
Lage ist, Leistungen in Lehre und Forschung zu<br />
erbringen, die anerkannten wissenschaftlichen<br />
Maßstäben entsprechen«.<br />
Studium für Alternativmediziner? In Traunstein soll eine Hochschule für Homöopathie entstehen<br />
Geprüft wird in der Tat ziemlich viel – bloß<br />
bemängeln Kritiker, dass im Akkreditierungsverfahren<br />
lediglich formale Aspekte im Vordergrund<br />
stünden. »Eine inhaltliche Prüfung im ei gentlichen<br />
Sinne findet kaum statt«, sagt Matthias<br />
Jaroch, Sprecher des Deutschen Hochschulverbandes.<br />
»Die Akkreditierung ist weitgehend eine<br />
formale Kontrolle. Man kann sich natürlich fragen,<br />
was der Sinn des Ganzen ist. Da wird ein<br />
Siegel vergeben, das eigentlich nichts aussagt.«<br />
Auch die Hochschulforscherin Margret Bülow-<br />
Schramm von der Uni Hamburg bemängelt, im<br />
Akkreditierungsprozess sei die »Fachlichkeit generell<br />
unterbelichtet«.<br />
Bislang hat der Wissenschaftsrat erst einen Teil<br />
der Privathochschulen geprüft. 58 Einrichtungen<br />
hat er sein Okay gegeben, lediglich acht Hochschulen<br />
bekamen die Akkreditierung nicht.<br />
Einer der wenigen Fälle, in denen der Wissenschaftsrat<br />
aus inhaltlichen Zweifeln einem<br />
Angebot die Akkreditierung verweigerte, ist die<br />
anthroposophische Freie Hochschule Mannheim,<br />
die Bachelor- und Mastergrade in Waldorfpädagogik<br />
vergeben wollte. Das Urteil des<br />
Wissenschaftsrates fiel hart aus: Das Institut erreiche<br />
auf »einer grundsätzlichen Ebene nicht<br />
die für eine Hochschule erforderliche Wissenschaftlichkeit«,<br />
schrieben die Gutachter in ihrer<br />
Entscheidung aus dem Januar 2011. »Dies betrifft<br />
die Vielfalt methodischer Ansätze und den<br />
Anspruch, den in den Erziehungswissenschaften<br />
üblichen Standards gerecht zu werden.<br />
Ohne eine solche Klärung besteht jedoch die<br />
Gefahr, eine spezifische, weltanschaulich geprägte<br />
Pädagogik im Sinne einer außer wissenschaft<br />
lichen Erziehungslehre zur Grundlage einer<br />
Hochschuleinrichtung zu machen.« Im<br />
Klartext: Waldorfpädagogik ohne ein Minimum<br />
an erziehungswissenschaftlicher Grundbildung<br />
ist akademischer Weihen nicht würdig.<br />
Die Freie Hochschule Mannheim nennt sich<br />
seither »Akademie für Waldorfpädagogik« – was<br />
akademisch klingt, es aber nicht ist. Im Gegensatz<br />
zu »Hochschule« ist die Bezeichnung »Akademie«<br />
nicht geschützt. Den Bachelorstudiengang<br />
gibt es nach wie vor: Mit einem Trick wird<br />
»Die Mediziner sind am schnellsten«<br />
Wann gründen Absolventen eine Familie? Ein Interview mit der Hochschulforscherin Gesche Brandt<br />
<strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>: In Ihrer Studie, die diese Woche erscheint,<br />
haben Sie untersucht, wie Hochschulabsolventen<br />
Berufstätigkeit und die Gründung<br />
einer Familie vereinbaren. Wann bekommen<br />
denn die meisten Absolventen das erste Kind?<br />
Gesche Brandt: Die wenigsten bekommen gleich<br />
nach dem Studium Kinder, mit zunehmendem<br />
Abstand vom Abschluss steigt die Anzahl der Eltern.<br />
Wir haben rund 5400 Absolventen des<br />
Jahrgangs 1997 befragt, zu verschiedenen Zeitpunkten.<br />
Ein Jahr nach dem Studium haben 13<br />
Prozent der Frauen ein Kind, nach fünf Jahren<br />
37 Prozent und nach zehn Jahren haben 62 Prozent<br />
der Absolventinnen Kinder.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Bleiben Akademikerinnen eher kinderlos<br />
als andere Frauen?<br />
Brandt: Der Anteil kinderloser Frauen ist bei<br />
Hochschulabsolventinnen etwas größer als in anderen<br />
Bildungs- oder Berufsgruppen. Man kann<br />
aber nicht sagen, dass 40 Prozent ohne Kinder<br />
bleiben, rund die Hälfte der bisher kinderlosen<br />
Absolventinnen möchte noch Kinder bekommen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Gibt es Unterschiede bei den verschiedenen<br />
Fachrichtungen? Bekommen Biologen eher<br />
Kinder als zum Beispiel Informatiker?<br />
Brandt: Es gibt tatsächlich Unterschiede zwischen<br />
den Fachrichtungen. Bei den Absolventen<br />
von Medizin, Psychologie, Pädagogik und Sozialwesen<br />
wird jeder zweite bereits in den ersten fünf<br />
Jahren nach dem Studium Mutter<br />
oder Vater. Andere Hochschulabsolventen,<br />
für die es länger<br />
dauert, sich beruflich zu etablieren,<br />
zögern das Kinderkriegen<br />
hinaus. Juristen und Naturwissenschaftler<br />
sind meistens noch<br />
fünf Jahre nach Studienende kin-<br />
derlos. Die männlichen Mediziner<br />
sind am schnellsten: Sie bekommen<br />
häufiger und früher als<br />
alle anderen Absolventen Kinder.<br />
Vermutlich leben sie häufiger als<br />
andere in traditionellen Beziehungen,<br />
in denen die Partnerinnen<br />
sich ums Kind kümmern.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Sind die Männer allgemein im Vorteil?<br />
Brandt: Für Männer lassen sich keine beruflichen<br />
Nachteile erkennen, wenn sie Vater werden. Bei<br />
den Frauen hingegen gehen Kinder und Karriere<br />
selten miteinander einher.<br />
Gesche Brandt ist<br />
wissenschaftliche<br />
Mitarbeiterin beim HIS-<br />
Institut für Hochschulforschung<br />
und beschäftigt<br />
sich mit Absolventen<br />
<strong>ZEIT</strong>: Hängt der berufliche Erfolg der Frauen<br />
also auch davon ab, ob sie Kinder bekommen<br />
oder nicht?<br />
Brandt: Absolventinnen mit Kindern sind auf<br />
jeden Fall seltener in leitenden<br />
beruflichen Positionen und haben<br />
geringere Durchschnittseinkommen<br />
als Väter oder auch als<br />
kinderlose Absolventinnen. Das<br />
hängt auch damit zusammen,<br />
dass Mütter häufig in Teilzeit beschäftigt<br />
sind. Nur vier Prozent<br />
der von uns befragten Männer<br />
mit Kindern arbeiten in Teilzeit.<br />
Bei den Müttern sind es 61 Prozent.<br />
Wenn Frauen die Karriere<br />
wichtig ist, bekommen sie unserer<br />
Studie zufolge seltener Kinder<br />
als Frauen, denen Familie wichtig<br />
ist. Das liegt wahrscheinlich daran,<br />
dass sie das Kinderkriegen aufschieben wollen<br />
bis zu dem Zeitpunkt, wo sie sich beruflich<br />
etabliert haben.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Laut Ihrer Studie steigt aber auch etwa ein<br />
Viertel der Mütter nur kurz aus dem Beruf aus<br />
das Votum umschifft. Ihre Dozenten hat die ehemalige<br />
Freie Hochschule Mannheim an die<br />
ebenfalls anthroposophische Alanus-Hochschule<br />
in Nordrhein-Westfalen angedockt; sie geben<br />
per Franchisevertrag Unterricht für die Mannheimer<br />
Studenten und bereiten sie auf die Prüfungen<br />
der Alanus-Hochschule vor. Da die Alanus-Hochschule<br />
in Nordrhein-Westfalen anerkannt<br />
ist, ist dieses Vorgehen in Baden-Württemberg<br />
rechtens. Ähnlich wird sich wohl auch<br />
die Traunsteiner Hochschule für Homöopathie<br />
durch den bildungsföderalen Wirrwarr schlagen.<br />
Ein Weiterbildungsinstitut für Heilpraktiker<br />
dürfte sich nämlich nicht ohne Weiteres als<br />
Hochschule bezeichnen.<br />
Eine Hochschule nimmt<br />
die nächste Huckepack<br />
Gerade in Bayern sind die formalen Hürden für<br />
eine Gründung hoch: Das Land verlangt unter<br />
anderem, dass für die Lehre überwiegend hauptberufliche<br />
Fachkräfte eingesetzt werden, die Zugangsvoraussetzungen<br />
müssen die gleichen sein<br />
wie an einer öffentlichen Hochschule, und es<br />
müssen mehrere Studiengänge angeboten werden.<br />
Es sei denn, eine Hochschule, die sich andernorts<br />
etablieren konnte, nimmt die neue<br />
Einrichtung huckepack: Ein solcher Partner soll<br />
in Traunstein die homöopathiefreundliche Steinbeis-Hochschule<br />
aus Berlin werden. Ist eine<br />
Hochschule bereits in einem anderen Bundesland<br />
anerkannt, kann sie auch in Bayern Lehrangebote<br />
machen – ohne dass noch einmal neu<br />
geprüft werden muss, ob ihre Vorlesungen und<br />
Seminare tatsächlich wissenschaftlichen Ansprüchen<br />
genügen.<br />
Auf diese Weise bietet beispielsweise schon jetzt<br />
die Berliner Hochschule für Gesundheit und Sport<br />
in Ismaning den Studiengang Komplementärmedizin<br />
an. »Wenn eine Hochschule bereits in einem<br />
anderen Bundesland oder EU-Staat anerkannt ist<br />
und hier einen Standort aufmacht, können wir das<br />
nicht einfach untersagen«, erklärt eine Sprecherin<br />
des Wissenschaftsministeriums. »Selbst wenn es uns<br />
nicht gefällt.«<br />
und ist danach wieder in Vollzeit tätig. Was können<br />
die Gründe dafür sein?<br />
Brandt: Bei diesen Frauen hat die Berufstätigkeit<br />
einen hohen Stellenwert. Für sie kommen Teilzeitstellen<br />
weniger infrage. Außerdem ist ein Teil dieser<br />
Frauen selbstständig, wodurch sie Kinder und<br />
Beruf zeitlich besser vereinbaren können. Und<br />
diese Frauen beziehen häufig auch ihren Partner<br />
stärker in die Kinderbetreuung ein – wenngleich<br />
auch in diesen Fällen die Männer nur selten die<br />
Hauptverantwortung für die Kinder tragen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Können Sie aus Ihrer Studie ablesen, wann<br />
der beste Zeitpunkt fürs Kinderkriegen ist, um<br />
den beruflichen Wiedereinstieg zu schaffen?<br />
Brandt: Das ist sehr individuell und hängt auch<br />
davon ab, inwieweit der Partner sich in die Betreuung<br />
einbringen kann oder möchte. Aber sicherlich<br />
ist es hilfreich, nach dem Studium erst<br />
einmal eine Weile berufstätig zu sein. Für den<br />
Wiedereinstieg ist es von Vorteil, wenn die Frau<br />
sich vor der Familiengründung beruflich etabliert<br />
hat, um so gesichert wieder einsteigen zu<br />
können.<br />
Interview: ANIKA KRELLER<br />
Fotos: Peter Dazeley/Getty Images (o:); D. Ausserhofer (r.); privat (2)<br />
»<br />
»<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 71<br />
STUDENTEN ERKLÄREN IHRE WELT<br />
Hast du Ideen, wie sich Professorinnen<br />
und Professoren mit ihrem Expertenwissen<br />
mehr Gehör in der Politik<br />
verschaffen können?«<br />
… fragt:<br />
Jörg Hacker, Präsident<br />
der Leopoldina<br />
Zumindest nicht so, wie es zuletzt einige Experten<br />
anlässlich der Euro-Krise getan haben: Ihr<br />
offener Brief kam schlicht zu spät. Ich frage mich<br />
aber generell, ob Professoren überhaupt realitätsnahe<br />
Ratschläge geben können. Schließlich hängt<br />
ihre Karriere heute vor allem von der Zahl möglichst<br />
komplizierter Veröffentlichungen in Fachzeitschriften<br />
mit entsprechend begrenzter Leserschaft<br />
ab. Vielleicht wäre deshalb ein Vermittler<br />
zwischen Professoren, Politikern und Bürgern eine<br />
Lösung – ein Botschafter zwischen abstrakter Wissenschaftswelt<br />
und schnelllebigem Politikalltag.<br />
Kein einfacher Pressesprecher also, sondern vielmehr<br />
ein neutraler Ombudsmann als Übersetzer<br />
und Vermittler. Er müsste dafür sorgen, dass wichtige<br />
Forschungsergebnisse verständlich erklärt und<br />
publik gemacht würden. Mithilfe solcher Ansprechpartner<br />
würde Expertenwissen eher da landen,<br />
wo es hingehört: in der Realität.«<br />
… antwortet:<br />
Henrike Junge, 22 Jahre,<br />
die an der Uni Tübingen<br />
Internationale VWL studiert<br />
NACKTE ZAHLEN<br />
13<br />
... Prozent der befragten Westdeutschen zwischen<br />
16 und 24 wollen zum Studium nach Ostdeutschland<br />
ziehen. Das ergab eine Umfrage<br />
der Hochschulinitiative Neue Bundesländer.<br />
TIPPS UND TERMINE<br />
»Master Materialchemie«<br />
An der Universität des Saarlandes gibt es<br />
vom Wintersemester an den viersemestrigen<br />
Masterstudiengang Materialchemie. Er<br />
richtet sich an Absolventen der Fächer Chemie<br />
und Materialwissenschaften. Die Materialwissenschaftler<br />
erlernen die Grundoperationen<br />
der chemischen Synthese, während<br />
Chemiker die Betrachtung von Materialien<br />
und deren Eigenschaften aus einem werkstoffwissenschaftlichen<br />
Blickwinkel kennenlernen.<br />
Bewerbung bis zum 31. August.<br />
www.uni-saarland.de/materialchemie<br />
Deutscher Schulpreis<br />
Die Bosch-Stiftung zeichnet Schulen aus,<br />
die Kreativität und Lust an Leistung fördern,<br />
Lebensfreude und Lebensmut stärken<br />
und zu Fairness und Verantwortung erziehen.<br />
Bis zum 15. Oktober können sich alle<br />
deutschen Schulen bewerben – berufliche<br />
Schulen dann, wenn sie allgemeinbildende<br />
Abschlüsse vergeben und als Vollzeitschule<br />
organisiert sind. Der Hauptpreis beträgt<br />
100 000 Euro. Fünf weitere Preise von je<br />
25 000 Euro werden vergeben, alle anderen<br />
nominierten Schulen erhalten 2000 Euro.<br />
http://schulpreis.bosch-stiftung.de<br />
Berichtigung<br />
Auf Seite 79 der <strong>ZEIT</strong> Nr. 37 im Artikel Mission:<br />
Europa ist uns leider ein Fehler unterlaufen. Im<br />
dritten Absatz muss es heißen: »250 Interviewmitschnitte«,<br />
und nicht 25. Wir bitten um Entschuldigung.
BERUF Spezial:<br />
Die Top Ten der<br />
Open-Source-Maschinen<br />
5<br />
Die Ackerfräse<br />
ergänzt den Traktor.<br />
Sie pflügt und<br />
lockert den Boden<br />
Baukasten für<br />
Aussteiger<br />
Die Maschinen auf dieser Seite sind Teil<br />
des zurzeit wohl ehrgeizigsten Projekts der<br />
kollaborativen, offenen Hardwareentwicklung.<br />
In den USA hat der junge<br />
Physiker Marcin Jakubowski dazu aufgerufen,<br />
gemeinsam ein Global Village Construction<br />
Set zu entwickeln – einen Do-ityourself-Maschinenpark<br />
aus 50 Geräten,<br />
die man braucht, um in einer kleinen<br />
Gemeinschaft nachhaltig, aber mit modernem<br />
Komfort zu leben. Traktor, Generator,<br />
Ziegelpresse und Ackerfräse sind bereits<br />
fertig, von weiteren Maschinen gibt es Prototypen.<br />
Die Idee dahinter: Viele Industriemaschinen<br />
sind inzwischen zu<br />
kompliziert und deshalb gerade für Menschen<br />
in armen Ländern zu teuer. Das von<br />
Jakubowski schon 2003 gegründete Netzwerk<br />
Open Source Ecology (OSE) hat deshalb<br />
durchaus auch einen politischen Anspruch.<br />
Jakubowski lebt auf einer Farm in<br />
Missouri, wo Interessierte an der Entwicklung<br />
der Maschinen mitwirken können.<br />
Mitarbeit ist auch in Deutschland möglich,<br />
www.opensourceecology.de AW<br />
Ein 3-D-Drucker druckt<br />
Prototypen und Ersatzteile<br />
Der Generator<br />
mit Motor und<br />
hydraulischer<br />
Pumpe ist vielseitig<br />
einsetzbar<br />
6<br />
Ein Windrad sichert die<br />
Energieversorgung vor Ort<br />
Ingenieure und Techniker<br />
Ingenieure bauen Brücken oder verankern<br />
Windräder im Meer (siehe Seite 74 und 75).<br />
Und ihre Arbeitswelt verändert sich<br />
Manchmal gerät die Revolution<br />
ganz plötzlich ins<br />
Stocken. »Irgendwie ist<br />
hier ein Schalter kaputt«,<br />
sagt Alexander Speckmann,<br />
Maschinenbau-<br />
Student an der Fachhochschule<br />
Köln. »Dann geht die Düse zu weit<br />
runter oder bleibt stehen. Aber an guten Tagen<br />
stellt er sehr filigrane Teile her.« Das unscheinbare<br />
Gerät mit dem defekten Schalter ist ein 3-D-<br />
Drucker. Er schmilzt Plastik und modelliert daraus<br />
Schicht für Schicht kleine Skulpturen. So<br />
werden aus Grafiken am Bildschirm dreidimensionale<br />
Objekte. Unter Ingenieuren haben solche<br />
Drucker eine Revolution ausgelöst, die die Art,<br />
wie Entwickler forschen und arbeiten, grundlegend<br />
verändern könnte.<br />
Alexander Speckmann hat sich seinen 3-D-<br />
Drucker auf einem Workshop selbst zusammengebaut.<br />
Auch wenn das Gerät manchmal noch<br />
etwas störrisch ist, stellt er das Herzstück der<br />
»Dingfabrik« in Köln dar. In einem alten Industriegebäude,<br />
zwischen Werbeagenturen und Designerbüros,<br />
haben der 28 Jahre alte Speckmann<br />
und seine Mitstreiter einen kleinen Maschinenpark<br />
zusammengetragen: Klassische Werkzeuge<br />
wie Sägen und Hämmer hängen neben einem<br />
computergesteuerten Lasercutter, einer CNC-<br />
Fräse und dem 3-D-Drucker – einem Gerät, das<br />
sich früher nur die Entwicklungsabteilungen<br />
großer Konzerne leisten konnten. Heute kosten<br />
Einsteigergeräte wie das Modell Reprap, das in<br />
der Dingfabrik läuft, nur rund 500 Euro und<br />
lassen sich einfach im Internet bestellen. Außerdem<br />
kann der Reprap sich zum Teil selbst reproduzieren,<br />
indem er seine eigenen Bauteile einfach<br />
ausdruckt.<br />
All das ermutigt Erfinder, viel auszuprobieren.<br />
Wer eine gute Idee hat, setzt sich an einen<br />
Computer, schnappt sich einen Lötkolben und<br />
baut los. »Alle helfen sich gegenseitig, das ist die<br />
Grundidee«, sagt Speckmann. Will jemand zum<br />
Beispiel eine computergesteuerte Lampe bauen,<br />
die sich nach einiger Zeit selbst abschaltet, hat<br />
aber keine Ahnung vom Programmieren, findet<br />
er in der Dingfabrik schnell einen Informatiker,<br />
der ihm hilft.<br />
Offene Hightech-Werkstätten wie die Dingfabrik,<br />
in denen Ingenieure, Techniker und Hobbybastler<br />
gemeinsam an Entwicklungen arbeiten,<br />
könnten zu neuen kreativen Zentren werden.<br />
Was dort passiert, könnte sogar die traditionellen<br />
Strukturen der Industrie mächtig ins Wanken<br />
bringen. Das britische Wirtschaftsmagazin Economist<br />
sieht bereits die dritte industrielle Revolution<br />
heraufziehen, die das Ende der Massenpro-<br />
7<br />
duktion einläutet. Für Ingenieure verspricht der<br />
Umbruch goldene Zeiten. »Man braucht inzwischen<br />
kein ganzes Unternehmen mehr, um seine<br />
Ideen zu verwirklichen«, sagt Holm Friebe,<br />
Trendforscher am Zukunftsinstitut in Kelkheim,<br />
einem Thinktank. »Es reichen zwei Freunde und<br />
ein Laptop.«<br />
An der RWTH Aachen hat man diese Entwicklung<br />
früh erkannt: Schon 2009 gründete<br />
Informatikprofessor Jan Borchers in Aachen das<br />
erste Fablab Deutschlands. Die Abkürzung steht<br />
für fabrication laboratory, ein Fertigungslabor.<br />
»Unsere Ingenieurstudenten entwickeln hier ihre<br />
Prototypen«, sagt René Bohne, der das Fab-lab<br />
organisiert. »Jedes Objekt, das man sich vorstellen<br />
kann, kann man jetzt auch bauen.« Statt wie<br />
früher einen Prototypen mühsam aus Holz und<br />
Leim zu fertigen, können Ingenieure ihre Erfindungen<br />
nun mal eben ausdrucken. Das geht<br />
schneller und ist billiger.<br />
Die Entwicklungsarbeit fin-<br />
det ausschließlich am Computer<br />
mit sogenannten CAD-Programmen<br />
statt, einer speziellen<br />
Designsoftware. Auch gute<br />
CAD-Programme kosteten vor<br />
ein paar Jahren noch mehrere<br />
hundert Euro, inzwischen gibt<br />
es brauchbare Programme gratis<br />
im Internet.<br />
Der große Vorteil des digitalen<br />
Erfindens: Auf Internetseiten<br />
wie Thingiverse.com, einer<br />
Art kostenlosem iTunes-<br />
Store für 3-D-Drucker, sind tausende CAD-Dateien<br />
archiviert, mit denen man den eigenen<br />
3-D-Drucker füttern kann. »So kann ich Standardbauteile,<br />
die andere entwickelt haben, einfach<br />
herunterladen und ausdrucken«, sagt Maschinenbaustudent<br />
Alexander Speckmann. »Das<br />
beschleunigt den Entwicklungsprozess enorm,<br />
weil ich nicht jeden Schritt noch einmal selbst<br />
machen muss.«<br />
Außerdem kann man seine CAD-Datei<br />
schnell per E-Mail an Forscherkollegen senden,<br />
damit die einen Blick darauf werfen. Oder man<br />
lädt die Datei gleich in ein Technikforum hoch,<br />
wo Ingenieure, Elektrotechniker und Informatiker<br />
aus der ganzen Welt die neuen Ideen kritisch<br />
begutachten und diskutieren.<br />
Ähnlich wie im Online-Lexikon Wikipedia,<br />
bei dem die Nutzer ihre Artikel gegenseitig korrigieren,<br />
werden die technischen Entwürfe in den<br />
Foren immer weiter verbessert. Der Reprap-Drucker<br />
in der Dingfabrik ist selbst so ein Open-<br />
Source-Projekt, das von Hobbybastlern immer<br />
weiter entwickelt wird.<br />
Ein Brennschneidtisch hilft<br />
bei der Metallverarbeitung<br />
Die Ziegelpresse<br />
verarbeitet Lehm zu<br />
Mauersteinen. Sie<br />
schafft 16 pro Minute<br />
Offene<br />
Baustelle<br />
Die Open-Source-Kultur im Internet und billige 3-D-Drucker revolutionieren die Art,<br />
wie Ingenieure neue Produkte entwickeln VON MALTE BUHSE<br />
Auf Knopfdruck<br />
Statt mühsam einen<br />
Prototypen aus Holz<br />
zu leimen, können<br />
Ingenieure ihre<br />
digitalen Entwürfe<br />
mal eben in Plastik<br />
ausdrucken<br />
8<br />
Eine Baggerschaufel f passt<br />
als Zubehör auf den Traktor<br />
In der Software-Entwicklung heißt dieses<br />
Prinzip Open Source, weil dabei der Quellcode<br />
eines Programms ins Internet gestellt wird und<br />
von jedem mit Programmierkenntnissen gelesen,<br />
verändert und ergänzt werden kann. Open-<br />
Source-Programme wie der Internetbrowser Firefox,<br />
das Bürosoftware-Paket Open Office oder<br />
das Betriebssystem Linux sind inzwischen weit<br />
verbreitet und können es mit den teuren Varianten<br />
aus den Programmierabteilungen etablierter<br />
Hersteller wie Microsoft aufnehmen.<br />
Aus Open Source wurde bei Ingenieuren<br />
Open Design, offenes Entwerfen. Und das ist<br />
längst über Hobbykeller-Niveau hinaus, wie die<br />
amerikanische Firma Local Motors beweist. Sie<br />
hat das erste Open-Source-Auto der Welt gebaut:<br />
Mehr als 2000 Entwickler aus der ganzen Welt<br />
arbeiteten mehre Jahre an dem Modell Rally<br />
Fighter. Die Designentwürfe standen die ganze<br />
Zeit frei im Internet, jeder<br />
konnte Verbesserungsvorschlä-<br />
ge machen. Als ein fahrtüchtiges<br />
Konzept stand, bauten professionelle<br />
Autobauer das Fahrzeug<br />
zusammen. Sogar das US-<br />
Militär glaubt an die schöpferische<br />
Kraft der Masse und gab<br />
bei der Local-Motors-Community<br />
einen Prototypen für<br />
ein Wüstenfahrzeug in Auftrag,<br />
der nun von den Armee-Ingenieuren<br />
weiterentwickelt wird.<br />
Als Nächstes will Local Motors<br />
ein spezielles Auto für Pizzadienste<br />
bauen. Wer eine gute Idee hat, kann mitmachen<br />
und auf der Internetseite der Firma Vorschläge<br />
einreichen.<br />
Damit wird die Denkweise der Ingenieure revolutioniert.<br />
Statt auf Geheimhaltung und Patente<br />
setzen sie auf Offenheit und Zusammenarbeit.<br />
Doch je erfolgreicher die Erfindungen der Open-<br />
Design-Ingenieure werden, desto schwieriger wird<br />
es, den idealistischen Grundgedanken von der<br />
freien Forschung beizubehalten. Wenn Produkte<br />
sich plötzlich gut verkaufen, stellt sich die Frage,<br />
wem das verdiente Geld gehört. Bei Tausenden<br />
Ko-Entwicklern, die über das Internet an den Entwürfen<br />
mitgearbeitet haben, ist es unmöglich, faire<br />
Anteile zu berechnen. Meistens kassiert daher<br />
derjenige, der die Chance am Schopf packt und<br />
das Produkt auf den Markt bringt.<br />
Ingenieure finden im Internet nicht nur digitale<br />
Baupläne und Gleichgesinnte mit spannenden<br />
Ideen, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten,<br />
wie sie ihre Entwürfe zur Marktreife<br />
bringen können. Auf Crowdfunding-Seiten wie<br />
kickstarter.com können sie um Investoren wer-<br />
9<br />
Eine Sägemühle mit zwei<br />
Sägeblättern liefert Bauholz<br />
10<br />
20. September <strong>2012</strong><br />
<strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong><br />
Der Traktor hat<br />
Allradantrieb und bis zu<br />
200 PS. Er ist robust<br />
und leicht zu reparieren<br />
73<br />
ben, die für Produktion und Vertrieb Geld geben.<br />
Über Portale wie alibaba.com lassen sich<br />
günstig Fabrikkapazitäten in Asien anmieten,<br />
wenn das Produkt reif für die Serienproduktion<br />
ist. Oder man versucht es bei Unternehmen wie<br />
dem amerikanische Quirky: Auf der Website<br />
können Entwickler ihre Ideen hochladen und<br />
andere Nutzer darüber abstimmen lassen. Die<br />
beliebtesten Entwürfe bringen die Quirky-Mit-<br />
arbeiter in den Laden, die Erfinder bekommen<br />
30 Prozent des Verkaufserlöses.<br />
So haben auch Ideen eine Chance, die sich<br />
unter den Regeln der klassischen Massenproduktion<br />
nicht durchsetzen würden. »Innovationen<br />
hängen nicht mehr von der Entscheidung<br />
des CEOs ab«, sagt Zukunftsforscher Holm Friebe.<br />
Stattdessen entscheiden nun die Verbraucher<br />
selbst, was sie haben wollen. »Dabei entstehen<br />
Produkte mit mehr Gesellschaftsrelevanz«, glaubt<br />
Alexander Speckmann. »Dinge, die nicht unbedingt<br />
große Gewinne abwerfen müssen.« Auf der<br />
Quirky-Website sind das bislang vor allem kleine<br />
praktische Helfer für den Alltag wie Clips, die<br />
den Kabelsalat am Rechner beseitigen, oder Kleiderbügel,<br />
die verhindern, dass das Lieblingsstück<br />
im Schrank verknittert.<br />
Doch auch individuell angefertigte Einzelteile<br />
für einen exklusiven Kundenkreis können per<br />
3-D-Drucker rentabel produziert werden. Denn<br />
hochwertige Geräte produzieren nicht nur Prototypen,<br />
sondern lassen sich auch als Fertigungsmaschine<br />
einsetzen. Weil sie deutlich billiger sind<br />
als komplette Maschinenstraßen mit Industrierobotern,<br />
wie sie in klassischen Fabriken stehen,<br />
und auch das Material oft günstig ist, lohnen sich<br />
beim 3-D-Druck auch kleine Stückzahlen.<br />
Deshalb kommen in die Dingfabrik nicht nur<br />
Ingenieure und Techniker. Eine Modedesignerin<br />
hat die Maschinen benutzt, um ein Kleid zu entwerfen,<br />
Künstler arbeiten dort an Skulpturen.<br />
Eine kreative Spielwiese will Alexander Speckmann<br />
aber vor allem den Ingenieurstudenten<br />
bieten. Denn zum ungezwungenen Rumprobieren<br />
komme man im Studium viel zu selten, sagt<br />
er. »Viele Studenten nehmen sich im vollgepackten<br />
Stundenplan nicht mehr die Zeit, nach rechts<br />
und links zu schauen.« Das können sie in der<br />
Dingfabrik und in anderen Fablabs, die es inzwischen<br />
in einigen größeren Städten gibt.<br />
In Zukunft könnten 3-D-Drucker sogar zu<br />
Hause am Schreibtisch stehen, zusammen mit<br />
3-D-Scannern, die wie ein Replikator funktionieren:<br />
Stellt man etwa eine Tasse in den Scanner,<br />
erstellt der Drucker ein perfektes Abbild aus Plastik.<br />
Irgendwann, vermuten Ingenieure, wird man<br />
einen Lichtschalter einfach zu Hause ausdrucken<br />
können, wenn der alte kaputtgeht.<br />
Ein Backofen und 40 weitere<br />
Maschinen sind noch geplant<br />
Alle Abbildungen: Open Source Ecology
Illustration: Anne Gerdes für <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong><br />
74 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong><br />
100 Jahre sollten sie halten<br />
Aber viele Brücken sind dem heutigen Verkehr nicht mehr gewachsen. Dann sind die Rechenkünste von Bauingenieuren gefragt VON CHRISTINE BÖHRINGER<br />
Wenn Gunnar Schönherr über<br />
neue Brücken fährt, dann fühlt er<br />
sich manchmal wie im Himmel:<br />
Auf dem Viadukt von Millau<br />
etwa, der längsten Schrägseilbrücke<br />
der Welt, hat man, sobald sich tief unten im<br />
südfranzösischen Tal des Flusses Tarn der Nebel<br />
staut, den Eindruck, man gleite auf den Wolken.<br />
Sind die Brücken jedoch alt, kehrt Schönherr ganz<br />
schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück:<br />
Automatisch scannt er die Bauwerke nach<br />
Schwachstellen ab. Ist eine Brücke für Laster über<br />
30 Tonnen gesperrt, muss er gar nicht erst weiter<br />
schauen. Dann weiß er: Sie ist noch verkehrssicher,<br />
aber marode – und die ihr verbleibenden Tage sind<br />
längst gezählt.<br />
Gunnar Schönherr, 33, ist Bauingenieur. Er<br />
konstruiert neue Brücken – und er berechnet, wie<br />
lange die alten noch halten werden. Rund 120 000<br />
Brücken gibt es in Deutschland, allein 37 000 verbinden<br />
Bundesstraßen und Autobahnen, die meisten<br />
wurden zwischen Mitte der sechziger und Mitte<br />
der achtziger Jahre errichtet. »Eigentlich wurden<br />
sie für die nächsten hundert Jahre gebaut«, sagt<br />
Gunnar Schönherr. Doch damals, bei ihrer Planung,<br />
legte man die meisten von ihnen für viel geringere<br />
Lasten aus, als sie heute tragen müssen.<br />
Denn eines hatte man nicht mit einkalkuliert: Es<br />
gibt mehr Verkehr als früher, besonders der Schwerverkehr<br />
hat überproportional stark zugenommen.<br />
Weil aber 40-Tonner auf Dauer die Substanz zermürben,<br />
werden die Brücken von Ingenieuren alle<br />
drei Jahre einer kleineren und alle sechs Jahre einer<br />
großen Prüfung unterzogen.<br />
Zwanzig Brücken hat Gunnar Schönherr, der<br />
2008 nach seinem Abschluss an der TU Berlin bei<br />
einem Planungsbüro einstieg, bislang gemeinsam<br />
mit Kollegen besichtigt. An das erste Mal kann er<br />
sich noch gut erinnern: die Zoobrücke in Köln,<br />
259 Meter Spannweite, fertiggestellt 1966, überquert<br />
von täglich 125 000 Fahrzeugen, getragen<br />
von zwei Stahlhohlkästen. Um alle Bauteile zu begutachten,<br />
muss man schwindelfrei sein und sich<br />
auf eine Art Laufsteg direkt unter der Fahrbahn<br />
hoch über dem Rhein stellen. »Brücken werden aus<br />
Beton und Stahl gebaut, weil Beton besonders gut<br />
Spannungen durch Druck aufnehmen kann. Stahl<br />
kann das auch, aber noch besser Spannungen durch<br />
Zug.« Sehen die Ingenieure bei ihrer Besichtigung<br />
Rost, ist das kein Problem – die Stellen können<br />
ausgebessert werden. Sehen sie hingegen Risse, ist<br />
das Material ermüdet, der Zug oder Druck zu groß.<br />
Dass bei einer Brücke etwas nicht stimmt, merken<br />
dann auch die Autofahrer: Ist plötzlich in beide<br />
Richtungen eine Fahrbahn für Lastwagen gesperrt<br />
oder sollen jetzt alle statt 50 Stundenkilometer nur<br />
noch 30 fahren, ist das der Versuch, die Brücke zu<br />
schonen, um dadurch ihre Lebensdauer zu verlängern.<br />
Im Hintergrund arbeiten die Ingenieure fieberhaft:<br />
»Wir ermitteln bei jeder beschädigten<br />
Brücke, wie lange man sie noch nutzen kann«, erklärt<br />
Schönherr. »Anhand der alten Pläne und der<br />
Verkehrsstatistik können wir dann zum Beispiel<br />
sagen: Die Last kann die Brücke noch 100 000 Mal<br />
tragen, dann ist Schluss. Das ist wie bei einer Büroklammer:<br />
Wenn man sie zu oft biegt, bricht sie irgendwann<br />
entzwei.« Es werden Überholverbote,<br />
Geschwindigkeits- und Gewichtsbeschränkungen<br />
eingeführt – und es wird versucht, die Brücke zu<br />
verstärken. Allein im vergangenen Jahr stellte der<br />
Bund 674 Millionen Euro für solche Sanierungen<br />
bereit. Hilft auch das nichts, kommen irgendwann<br />
die Abrissbagger – wie bei der Köhlbrandbrücke in<br />
Hamburg. Sie führt durch den Hafen und soll bald<br />
durch eine neue ersetzt werden.<br />
Die passende Lösung für eine Brücke zu finden<br />
ist für Schönherr oft »richtige Detektivarbeit«.<br />
Doch genau die mag er. Wurde die Brücke etwa<br />
falsch konstruiert? Oder ist sie dem aktuellen Verkehr<br />
nicht mehr gewachsen? Schon während seiner<br />
kaufmännischen Lehre bei einem Baubetreuer wurde<br />
er neugierig auf Materialien und wollte wissen,<br />
warum sich Stahl im Beton befindet, Gebäude<br />
überhaupt stehen bleiben und wofür man welche<br />
Baustoffe braucht. Er begann zu studieren – und<br />
spezialisierte sich auf Brücken. »Anders als bei Häusern<br />
ist ihre Konstruktion den Ingenieuren vorbehalten.<br />
Ich sehe, was ich tue, und trage dazu bei, die<br />
Infrastruktur aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln.«<br />
Das beste Anschauungsbeispiel fand<br />
Schönherr in der Heimat: In seiner Studienzeit wurde<br />
die Rügenbrücke zwischen das Festland und die<br />
Insel gesetzt. Ein 4,1 Kilometer langes, spektakuläres<br />
Werk aus 180 000 Tonnen Beton und 22 000<br />
Tonnen Stahl. Alle zwei Wochen fuhr Schönherr<br />
hin und beobachtete, wie Pfeiler aus dem Strelasund<br />
und Pylonen in den Himmel wuchsen. »Die Rügenbrücke<br />
vereint alles, was der Brückenbau bietet,<br />
da hätte ich am liebsten mitgewerkelt.«<br />
Wenn Schönherr selbst Brücken konstruiert,<br />
tut er das hingegen noch in anderen Dimensionen:<br />
Er hat bislang fünf Fußgänger- und Straßenbrücken<br />
entworfen, alle nicht mehr als 60 Meter lang.<br />
»Man fängt klein an«, sagt Schönherr. Und doch<br />
ist es auch hier nicht anders als bei den Großen:<br />
Ein Anfangs- und ein Endpunkt müssen so wirt-<br />
SPEZIAL: INGENIEURE UND TECHNIKER<br />
schaftlich wie möglich miteinander verbunden<br />
werden. Was dazwischen liegt, soll gut aussehen,<br />
in die Landschaft passen – und halten. Drei Monate<br />
vergehen von der ersten Idee bis zur Berechnung,<br />
diese schafft der Bauingenieur dann in vier<br />
Wochen. Steht die Brücke schließlich, erlebt<br />
Schönherr immer wieder einen Aha-Effekt und ist<br />
von dem, was aus seiner Zeichnung wurde, begeistert:<br />
»Eine Brücke ist wie ein eigenes Baby«,<br />
sagt er – und das wird, wenn alles glatt geht, mindestens<br />
100 Jahre alt.<br />
»Ein Drittel ist grauenvoll«<br />
Ein 50 Jahre alter Ingenieur sagt, wie es ist, heute noch einmal zu studieren<br />
<strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>: Sie sind 50 Jahre alt, Diplom-Ingenieur<br />
und Vater von drei Kindern. Warum machen Sie<br />
jetzt noch einen Master of Engineering?<br />
Stephan Fischer: Ich wollte in der Mitte des Arbeitslebens<br />
noch mal neuen Input bekommen und<br />
mein Wissen auffrischen. Mittlerweile studiere ich<br />
seit anderthalb Jahren, das heißt im vierten und<br />
letzten Semester, und habe viel Spaß an den Fächern,<br />
die ich in meinem ersten Studium nicht<br />
gemacht habe. Manche gab es damals noch gar<br />
nicht, zum Beispiel Baumanagement. Das hat sich<br />
in den letzten Jahren sehr entwickelt. Auch Brandschutz<br />
gehört dazu.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Sie haben ein Ingenieurbüro. Wie schaffen<br />
Sie das Studium nebenher?<br />
Fischer: Ich betreibe mein Büro nicht in Vollzeit<br />
und stimme die Termine mit den Vorlesungen<br />
ab. Als die Kinder noch klein waren, habe ich<br />
einen Deal mit meiner Frau gemacht, der beinhaltete,<br />
dass sie als Lehrerin voll in den Beruf<br />
einstieg. Mittlerweile sind unsere Kinder aber<br />
groß. Ich kann mich jetzt also auf den Master<br />
konzentrieren.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Wie unterscheidet sich das heutige Ingenieursstudium<br />
vom damaligen?<br />
Fischer: Früher wurde zwar mehr Praxis vermittelt,<br />
es war aber noch verschulter. Man musste<br />
einfach einen Katalog an Vorlesungen abarbeiten,<br />
Scheine holen, Haken dran. Was früher Vorlesung<br />
hieß, heißt heute Modul. Im Master können<br />
wir jetzt je nach Interesse aus etwa 25 Modulen<br />
wählen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Finden Sie, das Masterstudium bereitet die<br />
Studenten genügend auf den Arbeitsalltag vor?<br />
Fischer: Zum Teil. Ein Drittel der Dozenten<br />
macht mit den Studenten Projekte, in denen sie<br />
mit realistischen Problemen konfrontiert werden.<br />
Ein weiteres Drittel der Dozenten macht ganz ordentliche<br />
Arbeit. Und bei einem Drittel ist es<br />
grauenvoll. An denen sind Pädagogik und Didaktik<br />
vorbeigegangen. Die geben einem die Formeln,<br />
und in der Klausur muss man dann nur Zahlen<br />
einsetzen und runterrechnen. In der Praxis aber<br />
kommt der Kunde mit einem statischen oder baurechtlichen<br />
Problem, und ich muss eine Lösung<br />
dafür finden. Darauf sollten die Studenten vorbereitet<br />
werden.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Viele behaupten, der Dipl.-Ing. sei der bessere<br />
Abschluss gewesen. Wie sehen Sie das?<br />
Fischer: Als ich anfing, erneut zu studieren, dachte<br />
ich, mein Diplomstudium würde mir anerkannt<br />
werden. Es hieß ja, der Bachelor sei weniger wert<br />
als ein Fachhochschuldiplom. Stattdessen sagte<br />
man mir bei der Anmeldung für den Master, ich<br />
könne froh sein, dass ich nicht noch ein paar<br />
Credits nachholen müsse. Denn das In ge nieurstu<br />
dium ging bei mir damals offiziell nur über<br />
fünfeinhalb Semester, der Bachelor aber hat sechs<br />
Semester. Trotzdem denke ich, dass der Bachelor<br />
allein nicht erstrebenswert ist. Er ist sehr verschult.<br />
Man sollte immer noch den Master machen,<br />
dadurch kommt man auf eine ganz andere<br />
Wissensebene.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Wissen Sie schon, was Sie nach dem Studium<br />
machen?<br />
Fischer: Ich bin jetzt seit 15 Jahren selbstständig<br />
und habe noch mal etwa 15 Jahre Berufsleben vor<br />
mir. Ich kann mir vorstellen, nach dem Studium<br />
noch einmal bei einer Firma anzufangen. Vielleicht<br />
werde ich aber auch Lehrer für Mathe und<br />
Physik. Das geht in Hessen als Quereinsteiger. Es<br />
gefällt mir, jungen Menschen etwas beizubringen.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Bringen Sie Ihren jungen Kommilitonen<br />
auch manchmal etwas bei?<br />
Fischer: Es ist schon so, dass ich immer mal Mails<br />
von Kommilitonen bekomme, die mich fragen, ob<br />
ich über eine Rechnung schauen kann oder was<br />
ich zu einer Lösung sage. Ich antworte gerne, denn<br />
wenn ich etwas erklären kann, heißt das, ich habe<br />
es verstanden.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Widersprechen Sie den Dozenten auch mal?<br />
Fischer: Gelegentlich schon. Einmal hat der Professor<br />
eine Aufgabe zum Thema Bauablaufstörung<br />
ausgeteilt. Die Informationen waren unvollständig,<br />
auf dieser Basis hätte man als Ingenieur nicht<br />
anfangen können zu arbeiten. Das habe ich dann<br />
auch gesagt.<br />
<strong>ZEIT</strong>: Und gehen Sie mit Ihren Kommilitonen<br />
auf Studentenpartys?<br />
Fischer: Auf einer großen Party war ich noch<br />
nicht, aber wir waren mal zusammen in der Kneipe,<br />
um das Semester nach den letzten Klausuren<br />
gemeinsam ausklingen zu lassen. Am Anfang war<br />
das für meine Kommilitonen, glaube ich, ein bisschen<br />
komisch: so ein alter Typ, der da rumsitzt.<br />
Vom Alter her könnten sie meine Kinder sein, zuerst<br />
haben sie mich gesiezt. Jetzt ist das ein ganz<br />
natürlicher Umgang miteinander. Ich frage sie<br />
auch manchmal nach den Unterlagen, wenn ich<br />
mal nicht da sein konnte. Ich bin einer von denen<br />
geworden.<br />
Stephan Fischer, 50, studiert Konstruktiver<br />
Ingenieurbau/Baumanagement an<br />
der Hochschule RheinMain in Wiesbaden<br />
Interview: ANIKA KRELLER<br />
CHANCEN
CHANCEN<br />
In Halle B4 auf der Schiffbaumesse SMM in<br />
den Hamburger Messehallen liegen in diesem<br />
Jahr Freud und Leid nah beieinander:<br />
Nach einer endgültigen After-Work-Party<br />
sieht es am Biertresen der Werftengruppe<br />
P+S aus; Ende August haben die Werften in Stralsund<br />
und Wolgast Insolvenz angemeldet. Am<br />
Messestand direkt nebenan dagegen präsentiert die<br />
Werftengruppe Nordic Yards in einem Glaskasten<br />
das Modell ihres neuesten Großauftrags: Neben<br />
Umspannplattformen für Offshore-Windparks<br />
baut die Werft nun auch ein Wartungsschiff zur<br />
Reparatur und Versorgung.<br />
Schon im Frühjahr hat Nordic Yards mit Sitz in<br />
Wismar die Personalressourcen mit den neuen<br />
Vorhaben abgeglichen. Ergebnis: Bis zum Ende<br />
des Jahres fehlen 100 Leute, darunter 60 Ingenieure.<br />
Man könnte meinen, dass eifriges Werben notwendig<br />
ist, um diese Lücke zu füllen. Doch Personalleiter<br />
Björn Cleven schüttelt den Kopf: »Wir<br />
haben die klassischen Kanäle genutzt – die üblichen<br />
Internetplattformen wie Stepstone, vor allem<br />
aber Anzeigen in der regionalen Presse.«<br />
Schon Ende Juni lagen 300 Bewerbungen auf<br />
dem Tisch, vier Monate später sind bereits drei<br />
Viertel der Stellen besetzt, zu großen Teilen von<br />
Mecklenburgern, die woanders gearbeitet haben<br />
und zurück wollen an die Küste. Nur fünf Facharbeiter<br />
fehlen noch, bei den Ingenieuren ist es<br />
nicht ganz so leicht: 20 muss Cleven noch finden.<br />
Auch deshalb ist er auf der Schiffbaumesse in<br />
Hamburg. Er wolle die Ingenieurslücke nicht<br />
kleinreden, meint Cleven. »Aber dass es ein bisschen<br />
schwerer ist, die passenden Spezialisten zu<br />
finden, ist kein Zeichen mangelnden Nachwuchses,<br />
sondern liegt an der neuen Disziplin.«<br />
Das Wort »Offshore« ist auch an den Messeständen<br />
omnipräsent. Viele Werften,<br />
gerade die deutschen, die mit den<br />
Riesendocks in Asien nicht<br />
mehr mithalten können, sehen<br />
in dem neuen Markt<br />
ihre Chance. Nicht ohne<br />
Grund: Allein vor der<br />
deutschen Küste sind<br />
neben den 72 bestehenden<br />
448 Windkraftan-<br />
TIPPS UND TERMINE<br />
Wettbewerb für effiziente Technologien<br />
Für den Innovation Award der internationalen<br />
Altran-Stiftung können sich Einzelpersonen,<br />
Teams, Forschungsinstitute und Unternehmen<br />
bewerben. »Sustainovation – der Schlüssel zu<br />
einer immer besseren Eco-Effizienz« zeichnet<br />
Ideen aus, welche die Welt ein wenig besser<br />
machen könnten. Dabei stehen Effizienzfortschritte<br />
bei Technologien im Vordergrund. Der<br />
Gewinner darf seine Idee umsetzen. Der Bewerbungsschluss<br />
ist am 31. Oktober.<br />
www.de.altran-foundation.org<br />
Stipendien für Auslandspraktika<br />
Junge Berufstätige, Absolventen und Studierende<br />
mit einer technischen oder kaufmännischen<br />
Hochschulbildung können sich bis zum<br />
30. September für das Heinz Nixdorf Programm<br />
bewerben. Die Deutsche Gesellschaft<br />
für Internationale Zusammenarbeit bietet den<br />
Teilnehmern sechsmonatige Praktika in acht<br />
asiatischen Ländern, um deren Wirtschafts-<br />
und Bildungssysteme kennenzulernen.<br />
Sprachkurse in Deutschland und im Zielland<br />
sowie interkulturelle Seminare bereiten auf<br />
das Praktikum vor. Von der Heinz Nixdorf<br />
Stiftung gibt es Stipendien für die Lebenshaltungskosten<br />
während des Aufenthaltes.<br />
www.giz.de/hnp<br />
Elektrotechnik neu ausgerichtet<br />
Studieninteressierten mit Spaß an der Entwicklung<br />
technischer Komponenten sowie am Aufbau,<br />
Betrieb und Marketing technischer Kommunikationssysteme<br />
bietet die FH Frankfurt<br />
am Main zum Wintersemester den neuen Bachelorstudiengang<br />
»Elektrotechnik und Kommunikationstechnik«<br />
an. In sieben Semestern<br />
soll er das gesamte Spektrum der Kommunikationstechnik<br />
vom Komponentendesign bis zur<br />
Systemintegration vermitteln. Außerdem absolvieren<br />
die Studenten ein einsemestriges Berufspraktikum.<br />
Vor Beginn des Studiums muss<br />
ein Praktikum im MINT-Bereich von acht<br />
Wochen absolviert werden. Als Vorpraktikum<br />
werden Berufsabschlüsse in Metall- und Elektroberufen<br />
sowie als Technischer Zeichner anerkannt.<br />
Einschreibungen bis zum 8. Oktober.<br />
http://tinyurl.com/9krrasw<br />
Technologie- und Innovationsmanagement<br />
Interdisziplinäre Profis, die über ein solides<br />
technisches Wissen verfügen und gleichzeitig<br />
SPEZIAL: INGENIEURE UND TECHNIKER<br />
»Ein Riesenarbeitsmarkt«<br />
Für den Bau von Off shore-Plattformen sind Qualitätsmanager sehr gefragt VON ALEXANDRA WERDES<br />
lagen im Bau. 8235 weitere wurden<br />
bereits genehmigt. Das beflügelt<br />
nicht nur die Hersteller von Windrädern,<br />
sondern auch eine ganze<br />
Zuliefererindustrie. »Es ist irre, wie<br />
weit man da den Bogen spannen<br />
kann«, sagt York Ilgner der beim Verein<br />
Deutscher Ingenieure (VDI) den n<br />
Arbeitskreis Schiffbau und Schiffs-<br />
technik leitet. »Das ist ein Riesenarr-<br />
beitsmarkt.«<br />
Wie baut man die Plattform? Wie<br />
bringt man sie vor die Küste, wie errichichtet und gründet man sie?<br />
Jede Menge Ingenieure und Techniker niker<br />
werden auch benötigt, um all die Anlagen nlagen<br />
am Laufen zu halten. »Mit viel Wartungsrtungsaufwand ist schon deshalb zu rechnen, nen, weil<br />
die Erfahrung fehlt«, sagt Björn Cleven. even. »In<br />
Deutschland wurde der Offshore-Bereich ereich bisbislang eher stiefmütterlich behandelt. Wir haben<br />
kein Öl und kein Gas, da haben die e Niederländer<br />
und die Engländer einen Vorsprung.« rsprung.«<br />
Dafür mischen aber auch Konkurrenzländer enzländer<br />
wie Korea und China noch nicht mit. t.<br />
»Dass wir hier Neuland betreten, ist bei der<br />
Personalsuche unser Hauptargument«, ent«, sagt<br />
Cleven. Er sei selbst überrascht, wie viele junge<br />
Leute sich begeistern lassen von den enerneuerbaren Energien und gerne irgendwo womitarbeiten, wo man die Welt verbessern ern kann.<br />
»Der Pioniergeist motiviert viele«, sagt gt Cleven.<br />
Offenbar nehme man den Werften auch wieder<br />
ab, dass sie Perspektiven bieten können. können.<br />
»Als Offshore kam, ging es vielen n Werften<br />
schlecht«, sagt York Ilgner vom Verein ein Deutscher<br />
Ingenieure. »Viele haben sich mit<br />
günstigen Angeboten darauf arauf gegestürzt und dann den Aufwand<br />
völlig unterschätzt, t, vor alallem was die Qualitätssicherung<br />
angeht.« ht.«<br />
Im klassischen lassischen<br />
Schiffbau können<br />
sich Werften, en, KunKunden und Behörden<br />
an den deutschen deutschen<br />
Sucht Experten:<br />
Björn Cleven,<br />
Personalleiter bei<br />
Nordic Yards<br />
die komplexen Instrumente des Technologie-<br />
und Innovationsmanagements beherrschen:<br />
Die will die FH Brandenburg mit ihrem Masterstudium<br />
»Technologie- und Innovationsmanagement«<br />
ausbilden. Für das kommende<br />
Wintersemester stehen noch ein paar Studienplätze<br />
zur Verfügung. Schnellentschlossene<br />
können sich bis zum 30. September bewerben.<br />
www.tim-master.de<br />
Neuer Master »Energieeffizienz<br />
technischer Systeme«<br />
Die FH Brandenburg startet zum Wintersemester<br />
den neuen Masterstudiengang »Energieeffizienz<br />
technischer Systeme«. Er vermittelt<br />
Absolventen aller technischen und naturwissenschaftlichen<br />
Fachrichtungen weiterbildende<br />
Kenntnisse auf dem Gebiet der Energieeffizienz.<br />
Der Masterabschluss qualifiziert<br />
für vielfältige Aufgaben in der Energie- und<br />
Umwelttechnik, Verkehrswesen, Verfahrenstechnik,<br />
Gebäudetechnik, Automatisierungstechnik<br />
sowie Informations- und Kommunikationstechnik.<br />
Die Einschreibung ist bis 30.<br />
September möglich.<br />
www.fh-brandenburg.de/bewerben.html<br />
Verlängerte Fristen in Erfurt<br />
Die FH Erfurt hat die Bewerbungsfristen fürs<br />
Wintersemester in einigen Studiengängen bis<br />
zum 28. September verlängert. Kurzentschlossene<br />
können sich daher noch für einen Studienplatz<br />
in den folgenden Bachelorstudiengängen<br />
bewerben: Angewandte Informatik, Bauingenieurwesen,<br />
Eisenbahnwesen, Gartenbau,<br />
Gebäude- und Energietechnik, Landschaftsarchitektur,<br />
Verkehrsinformatik, Wirtschaftsingenieur<br />
Gebäude- und Energietechnik und<br />
Wirtschaftsingenieur Verkehr, Transport und<br />
Logistik sowie in den Masterstudiengängen Intelligente<br />
Verkehrssysteme, Landschaftsarchitektur<br />
sowie Materialfluss und Logistik.<br />
www.fh-erfurt.de/fhe/studieninteressierte/bewerbung-co<br />
Deutsch-amerikanischer Master<br />
Die Hochschule Ulm und das amerikanische<br />
Rose-Hulman Institute of Technology bieten<br />
den Masterstudiengang »Systems Engineering<br />
and Management« künftig gemeinsam an. Er<br />
kann dann mit einer internationalen Ausrichtung<br />
studiert werden.<br />
www.hs-ulm.de/graduateschool<br />
Schiffbaustandardhalten,<br />
im Offshore-Windanlagenbau<br />
fehlen<br />
solche solche Standards, es<br />
gibt gibt auch noch kaum<br />
Vorschriften. »Jede einzelne<br />
Schweißnaht muss dokumentiert<br />
und geröntgt werden«, werden«,<br />
sagt Ilgner. Deshalb zählen vor allem<br />
auch Schweißfachingenieure und<br />
die Leute fürs fürs Qualitätsmanagement zu<br />
den Experten, die ganz besonders gefragt sind.<br />
»Inzwischen haben alle verstanden, dass es<br />
dabei nicht lediglich um einfachen Stahlbau<br />
geht, und bezeichnen das als Schiffbau, was<br />
wir wir hier tun«, sagt der Mann von Nordic Yards,<br />
Björn Cleven.<br />
Für Wehmut nach den vergangenen Zeiten<br />
bleibt bleibt da kein Raum.<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 75<br />
Bauteil einer<br />
Offshore-Plattform<br />
Fotos [M]: Andreas Herzau für <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>/www.andreasherzau.de
76 20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong><br />
So läuft’s rund<br />
Beim DIN-Institut sorgen Ingenieure dafür, dass ein Teil zum anderen passt VON THOMAS RÖBKE<br />
Gerade neulich hat Juliane Jung sich<br />
wieder geärgert: »Ich repariere<br />
mein Fahrrad, und die Ventile passen<br />
nicht – weil sie nicht genormt<br />
sind.« Ausgerechnet. Damit uns<br />
allen solcher Ärger erspart bleibt, arbeitet die<br />
28-Jährige im Norm aus schuss »Sport- und Freizeitgeräte«<br />
beim DIN, dem Deutschen Institut für<br />
Normung in Berlin. Seit Kurzem entwickelt sie<br />
mit ihren Kollegen eine Norm »für Fahrradabstellanlagen<br />
und Fahrradparksysteme – auch Fahrradständer<br />
genannt«. Am Anfang stehen grundsätzliche<br />
Überlegungen: »Das Fahrrad darf beim Einstellen<br />
nicht zerkratzen, zu den anderen Rädern<br />
muss genug Platz sein, die Lenker müssen aneinander<br />
vorbei passen.« Es folgen viele Ausschusssitzungen,<br />
und am Ende stehen eine oder mehrere<br />
Normen, die zu den bereits bestehenden mehr als<br />
30 000 hinzukommen.<br />
Dabei ist die Normung kein Selbstzweck, sondern<br />
ein nützliches Instrument, das der deutschen<br />
Industrie jährlich 16 bis 20 Milliarden<br />
Euro einspart, weil sie nicht für unterschiedliche<br />
Märkte unterschiedliche Produkte herstellen<br />
muss. Und mit dem sie nicht selten den Maßstab<br />
setzt – so basieren zwei Drittel des internationalen<br />
Normenwerks im Maschinenbau auf deutschen<br />
Industrienormen.<br />
Beim DIN arbeiten Akademiker aus allen<br />
Sparten der Wirtschaft: Maschinenbau, Elektrotechnik,<br />
Bauwesen, Medizintechnik; Naturwissenschaftler<br />
aller Art. Juliane Jung entschied sich<br />
für das sechssemestrige Bachelorstudium Sport<br />
und Technik in Magdeburg. »Ich wollte nie ganz<br />
in der Sportwissenschaft arbeiten, nicht im Fitnessstudio<br />
und auch nicht als Lehrerin. Lieber in<br />
einem Unternehmen.« Das Studienfach »Normen<br />
und Design« führte sie an das Thema heran, ein<br />
Stellenaushang des DIN an ihrer Fakultät weckte<br />
das Interesse an ihrem heutigen Arbeitgeber:<br />
»Obwohl ich zuerst die gleichen Vorurteile hatte<br />
wie die meisten, die das DIN nicht näher kennen:<br />
Ich hielt es für eine verstaubte Behörde.« Tatsächlich<br />
ist das DIN ein gemeinnütziger, privater<br />
Verein. Im Februar 2007 fing Jung beim DIN<br />
an. Bereut hat sie es nie: »Ich habe immer wieder<br />
mit neuen Themen zu tun, und kein Projekt<br />
gleicht dem anderen.«<br />
Auch Bernd Reinmüller ist DINler aus Überzeugung.<br />
»Neue Projekte, neue Produkte, neue<br />
Prüfverfahren – langweilig wird es nie«, sagt er.<br />
Der 49-jährige Diplomingenieur der Chemie leitet<br />
seit 23 Jahren die Normenausschüsse für Beschichtungsstoffe<br />
und Beschichtungen sowie für<br />
Pigmente und Füllstoffe. Die Warnung seines<br />
Professors habe sich bestätigt: »Wer sich einmal<br />
mit Lack befasst, der bleibt daran kleben.« Eine<br />
gewisse Detailverliebtheit (»aber auch nicht zu<br />
extrem«) sollte man für die Normungsarbeit<br />
schon mitbringen, meint Reinmüller. Erklärungsbedürftig<br />
sei sein Job unter Nichtfachleuten noch<br />
immer: »Ich sage dann: DIN ist dazu da, dass<br />
Sachen zusammenpassen.«<br />
Ein Beispiel für eine gelungene Normung zum<br />
Nutzen aller Beteiligten ist der GSM-Standard bei<br />
Mobiltelefonen: Hätten sich die Hersteller nicht<br />
auf eine Schnittstelle geeinigt, über die sich die<br />
Handys jenseits der Grenze automatisch in ein<br />
anderes europäisches Netz einwählen, gäbe es<br />
heute vielleicht 30 verschiedene Mobilfunkkonzeptionen,<br />
und die Geräte hätten nicht die heutige<br />
Marktverbreitung.<br />
Was eine Norm ist und wie sie entsteht – auch<br />
dafür gibt es eine Norm: die DIN 820. Die 400<br />
Institutsmitarbeiter sind auf 71 Normenausschüsse<br />
verteilt – von Lebensmitteln und Wälzlagern<br />
bis zu Rundstahlketten und Metallfedern.<br />
Sie beraten mit Vertretern aus der Industrie über<br />
neue Normen oder die Änderung von alten. »Das<br />
Vor- und Nachbereiten von Sitzungen macht den<br />
größten Teil der Arbeit aus«, sagt Jung. Entschieden<br />
wird im Konsensverfahren. Wer nicht in der<br />
Runde der Experten war, kann im öffentlichen<br />
Einspruchsverfahren seine Einwände äußern.<br />
Vom Antrag bis zur fertigen Norm m<br />
vergehen so im Schnitt drei Jahre. Für ür<br />
besonders eilige Normen gibt es ein<br />
Schnellverfahren, das zwischen zwei wei<br />
und zwölf Monate dauert.<br />
Gerade das Konsensverfahren findet findet<br />
Juliane Jung spannend, »weil man unterschiedliche<br />
Interessen auf einen gemeinsameinsamen Nenner bringen muss. Da ist manchmal<br />
diplomatisches Geschick gefragt oder er strategi- strategisches<br />
Agieren.« Noch ist die DIN-Welt N-Welt eine<br />
Männerwelt: »Ich bin oft die einzige e Frau in den<br />
Sitzungen. Aber das ist okay für mich«, h«, sagt Jung.<br />
Und wenn eine Norm nach vielen Monaten harter<br />
Verhandlung endlich verabschiedet det wird – ist<br />
das dann ein befriedigendes Gefühl? Bernd Reinmüller<br />
holt tief Luft. »Ja!«, ruft er aus us tiefster Seele.<br />
»Hinter jeder Norm steckt sehr r viel Arbeit,<br />
mitunter ist der Konsensprozess sehr ehr mühsam.<br />
Und wenn man die Norm dann veröffentlicht<br />
hat, ist das schon ein sehr schönes Gefühl.«<br />
Genormt wird nicht um des Normens rmens willen,<br />
denn nur Normen von allgemeinem em Interesse<br />
spielen das Geld des Normungsprozesses zesses wieder<br />
herein. Jeder Bürger kann eine Norm m beantragen.<br />
Das DIN prüft dann, ob für diese Norm tatsächlich<br />
ein Bedarf besteht, und lädt die e potenziellen<br />
Interessengruppen zur Mitarbeit ein. Andere Nor- Normen<br />
werden dadurch angestoßen, dass der Staat<br />
gesetzliche Anforderungen erlässt – etwa für Wärmedämmung<br />
an Gebäuden oder Emissionsgrenzwerte<br />
im Automobilbereich – und die technische<br />
Umsetzung in die Hände der Wirtschaft legt. Jede<br />
Norm wird alle fünf Jahre überprüft, ob sie noch<br />
gebraucht wird und ob sie noch dem Stand der<br />
Technik entspricht – gegebenenfalls wird sie zurückgezogen<br />
oder überarbeitet. Zusammen mit<br />
den neuen Normen werden jedes Jahr mehr als<br />
2000 Dokumente verändert oder neu erstellt. Zunehmend<br />
wichtiger werden Normen für Dienstleistungen<br />
– so gibt es europaweite Ausschreibungen<br />
für den öffentlichen Personenverkehr oder<br />
SPEZIAL: INGENIEURE UND TECHNIKER<br />
CHANCEN<br />
Umzugsfirmen,<br />
die<br />
ihre Leistungen<br />
in mehreren<br />
Ländern anbieten<br />
und die daher für den<br />
Verbraucher transparent werden<br />
müssen. Noch ist der Anteil<br />
aber gering und liegt vielleicht bei einem<br />
Prozent.<br />
Getagt wird durchaus auch mal vor Ort und<br />
auf europäischer Ebene: »Unser Ausschuss kommt Nicht jedes Ventil passt in<br />
viel mit dem französischen Normungsinstitut in<br />
jeden Fahrradschlauch:<br />
Paris zusammen«, erzählt Jung. »Wir planen unse-<br />
Eine neue DIN-Norm<br />
re Sitzungen auch schon mal anlässlich von Fahr-<br />
könnte Abhilfe schaffen<br />
radmessen, dann sind sowieso alle Experten vor<br />
Ort.« Seit sie beim DIN arbeitet, geht Juliane<br />
Jung »mit Sicherheit mit offeneren Augen durch<br />
die Welt. Ich sehe: Ah, hier ist schon etwas genormt,<br />
oder entdecke im Schwimmbad: Hier<br />
hätten sie etwas anderes einbauen müssen, das ist<br />
jetzt nicht normgerecht.« Ihr nächstes Projekt<br />
zeichnet sich übrigens auch schon ab: »Leichtathletikgeräte.<br />
Man glaubt es kaum, aber die<br />
waren bisher überhaupt nicht genormt, damit<br />
fangen wir gerade erst an.«<br />
Foto [M]: colourbox
<strong>ZEIT</strong> DER LESER S.88<br />
LESERBRIEFE<br />
AKTUELL ZUR <strong>ZEIT</strong> NR. 38<br />
Endlich<br />
Martin Hecht: »Die Stadt,<br />
das Bier und der Hass«<br />
Vielen Dank, dass Sie in Ihrem Artikel<br />
Zusammenhänge herausgearbeitet haben,<br />
die in München auch aus meiner<br />
Perspektive bisher nicht zur Sprache gekommen<br />
sind.<br />
Ich bin gebürtige Münchnerin und<br />
habe an einem Münchner Gymnasium<br />
1997 mit den Leistungskursen Geschichte-Sozialkunde<br />
und Deutsch Abitur<br />
gemacht. In meiner schulischen<br />
Laufbahn wurde der Nationalsozialismus<br />
sehr ausführlich in vielen Schulfächern<br />
(Geschichte, Deutsch, Kunst,<br />
Religion) thematisiert. Es ging viel um<br />
die historischen Ereignisse in ihrer zeitlichen<br />
Reihenfolge und die Mentalität<br />
der Deutschen zwischen Kaiserzeit und<br />
Drittem Reich. Ich erinnere mich besonders<br />
an das Herausstellen von<br />
»preu ßischer Obrigkeitshörigkeit« und<br />
dem Drang aller Deutschen nach »starker<br />
Führung«.<br />
Was im Münchner Curriculum völlig<br />
fehlte, war die Diskussion, warum ausgerechnet<br />
unsere Stadt zur »Hauptstadt<br />
der Bewegung« wurde. Ließ sich Hitler<br />
nur zufällig hier nieder, oder bot ihm<br />
München die beste Kombination von<br />
Mentalität, Infrastruktur und Kapital<br />
für sein Vorhaben?<br />
Dass diese Fragen nicht schon längst<br />
Bestandteil des gesellschaftlichen Diskurses<br />
Münchens mit der NS-Zeit sind,<br />
ist eine verpasste Chance. Das geplante<br />
NS-Dokumentationszentrum wird nur<br />
eine echte Bereicherung sein, wenn es<br />
mutig genug ist, sich dieser »neuen«<br />
Frage anzunehmen, und sich auch das<br />
Ziel setzt, die Stammtische von Vilshofen<br />
bis ins Hofbräuhaus zur Diskussion<br />
anzuregen.<br />
Wo ist die Grenze zwischen gesundem<br />
Traditionsbewusstsein, ausgeprägter<br />
Identität, humoristischem Derb lecken<br />
und Wirtshausmentalität mit Gefahrenpotenzial?<br />
Wann muss man als Einzelner<br />
im Stammtisch-Diskurs Zivilcourage<br />
aufbringen, um gefährlichem<br />
Unsinn Einhalt zu gebieten, oder – auf<br />
Bayerisch gesagt – »auch mal auf den<br />
Tisch haun«?<br />
Diese Fragen sind über die Grenzen<br />
Münchens hinaus relevant. Ein ehrlicher<br />
Blick auf München anno 1923<br />
kann dabei nur helfen.<br />
Claudia Urschbach, München<br />
Pin-up-<br />
Parade<br />
»Mode in Topform«<br />
<strong>ZEIT</strong>MAGAZIN NR. 37<br />
Nie waren die Silhouetten in der Mode<br />
so vielfältig? Vielleicht, aber auf Ihre<br />
Fotostrecke trifft das nicht zu. Weniger<br />
originell und geschmackloser hätte sie<br />
kaum geraten können. Eine junge, dünne,<br />
blonde Frau räkelt sich wenig bekleidet<br />
in eindeutigen Posen und verfügt<br />
über nur einen Gesichtsausdruck – dessen<br />
Übersetzung sich hier verbietet. Den<br />
Tiefpunkt bildet die Parodie eines sich<br />
anbietenden Zimmermädchens.<br />
Finden Sie das witzig? Glauben Sie,<br />
dass Ihre LeserInnen, zum nicht geringen<br />
Teil selbstbewusste und gebildete<br />
Frauen, darüber lachen können? Ich<br />
kann nur hoffen, dass es in Ihrer Redaktion<br />
zumindest erbitterte Diskussionen<br />
darüber gegeben hat, ob das<br />
<strong>ZEIT</strong>magazin das geeignete Medium<br />
für eine Pin-up-Strecke darstellt. Schade,<br />
dass der interessante und informative<br />
Artikel daneben dann ausgesprochen<br />
zynisch wirkt.<br />
Daniela Halbfas, Bremen<br />
Ihre Zuschriften erreichen uns am<br />
schnellsten unter der Mail-Adresse:<br />
leserbriefe@zeit.de<br />
Beilagenhinweis<br />
Die heutige Ausgabe enthält in Teilauflagen<br />
Prospekte folgender Unternehmen:<br />
Hamburg Marketing GmbH,<br />
22305 Hamburg; Hamburger Sparkasse<br />
AG, 20537 Hamburg; Innovation<br />
Norway, 20355 Hamburg; Inpact media<br />
GmbH, 10115 Berlin; OXO Media<br />
Verlag, 20359 Hamburg; Süddeutsche<br />
Zeitung GmbH, 81677 München<br />
Zum Titelthema: »Philosophen entdecken das Gefühl«, <strong>ZEIT</strong> NR. 37<br />
Ich bin ja so verdorben<br />
Streitgespräch zwischen Manfred Spitzer und Peter Vorderer: »Macht uns der Computer dumm?« <strong>ZEIT</strong> NR. 37<br />
Immer schon haben die Älteren am<br />
besten gewusst, was für die Jungen<br />
nicht gut ist: Selbstbefriedigung zum<br />
Beispiel, vorehelicher Sex sowie Jazz-<br />
oder Rockmusik.<br />
Meiner Großmutter, Jahrgang 1905,<br />
haben die Eltern das Lesen verboten:<br />
Es mache dumm und halte von wichtigen<br />
Tätigkeiten ab. Wichtig waren<br />
Handarbeiten und Kochen. Zum Glück<br />
war meine Großmutter eigensinnig und<br />
hat sich das Lesen nicht verbieten lassen,<br />
sonst hätte ich, Kind der fünfziger<br />
Jahre, vermutlich weder das Abitur<br />
gemacht noch ein Studium abgeschlossen.<br />
Muss ich noch sagen, was ich von<br />
Herrn Spitzers steilen Bestseller-Thesen<br />
halte?<br />
Anne Verfürth, Düsseldorf<br />
Was Spitzer in seiner Ballerspiel- und<br />
Verblödungspolemik verkennt, ist die<br />
Notwendigkeit, Kinder an die zweckmäßige<br />
Nutzung digitaler Medien heranzuführen,<br />
und der Nutzen, den<br />
Schüler durch die digitale Vernetzung<br />
schon während ihrer Schullaufbahn<br />
haben. Neben Softwareanwendungen<br />
und Webdiensten wie Geogebra oder<br />
Wolfram Alpha stellt allein die Möglichkeit,<br />
sich mit Mitschülern über das<br />
Internet fachlich auszutauschen und<br />
sich in der »großen Gruppe« zu helfen,<br />
also gemeinsam zu lernen, wie das in<br />
der analogen Welt kaum vorstellbar<br />
Man solle die Lehrer in Ruhe (arbeiten)<br />
lassen, weil sie bei ihren Schülern ja<br />
doch ganz passable Ergebnisse bewirkt<br />
haben, schreiben Sie.<br />
Das finde ich auch. Eine Frage habe<br />
ich aber. Sie haben eine Gruppe von<br />
Lehrern (und ihre Schüler) ganz besonders<br />
in Ruhe gelassen und deshalb<br />
überhaupt nicht erwähnt: die Grundschullehrer<br />
(die meistens ja Grundschullehrerinnen<br />
sind). Ich habe nicht<br />
ganz verstanden, warum. Vielleicht,<br />
weil deutsche Grundschulkinder im<br />
internationalen Vergleich (IGLK) so-<br />
wäre, einen Vorteil dar. Wer bei Eltern<br />
eine Sucht- und Verblödungshysterie<br />
auslöst, tut damit vielen Kindern keinen<br />
Gefallen, sondern beraubt sie der<br />
Möglichkeit, unter angemessener Kontrolle<br />
ein eigenes Gespür für den Nutzen<br />
der digitalen Medien zu entwickeln.<br />
Marius Wegener, Aachen<br />
Die Wirkung klassischer Computer und<br />
Taschenrechner ist gewiss vergleichbar: Es<br />
wird das behalten, was gebraucht wird,<br />
das andere kann man ja nachschlagen<br />
oder berechnen lassen.<br />
Ein Beispiel: Mir half ein Abiturient bei<br />
der Gartenarbeit. Stundenlohn 8 Euro.<br />
Abrechnung nach 12 Stunden. Er errechnet<br />
86 Euro. Ich: »Prima, da spare ich<br />
10 Euro!« Er: »Wieso?« Wir ermitteln<br />
gemeinsam: 12x8=96. Das nächste Mal<br />
fallen 13 Stunden an. Er erinnert sich an<br />
12x8=96 und will nun 96+8 rechnen.<br />
Aber da ist der Hunderterübergang im<br />
Wege! Mittlerweile studiert er.<br />
Ludwig Kellner, Baden-Baden<br />
Das Thema ist für viele Menschen für<br />
ihr privates, erzieherisches, aber auch<br />
berufliches Umfeld von großem Interesse.<br />
Ich habe mich auf die Lektüre<br />
regelrecht gefreut. Was ich zu lesen bekommen<br />
habe, ist das zänkische Gespräch<br />
zweier »Experten«, die sich auf<br />
dem Niveau einer RTL-Talkshow<br />
nicht einmal die Mühe geben, eine gemeinsame<br />
Ebene zu finden, die einem<br />
wieso schon zu Pisa-Zeiten deutlich<br />
besser abgeschnitten haben als die in<br />
Pisa getesteten 15-Jährigen?<br />
Oder weil Grundschulen und ihre<br />
Lehrkräfte nicht so wichtig sind (sowieso<br />
alles Frauen, die so ein bisschen mit<br />
kleinen Kindern rumspielen, was soll<br />
daran denn Arbeit sein)?<br />
Oder weil Hamburger Kinder ihre<br />
Schullaufbahn gleich mit dem Gymnasium<br />
anfangen? Hier in NRW müssen<br />
die Grundlagen für die Schulbildung<br />
noch in vier Jahren Grundschule gelegt<br />
werden und, ganz ehrlich, das ist nicht<br />
Leser von Nutzen sein könnte. Absolut<br />
enttäuschend.<br />
Dieter Schöneborn, Buxtehude<br />
Nachdem ich die Positionen des Herrn<br />
Spitzer verinnerlicht hatte, überkam<br />
mich eine große Besorgnis. Blicke ich<br />
zurück auf mein Leben, das fast ein<br />
Vierteljahrhundert währt, wachsen<br />
meine Sorgen.<br />
Mit neun bekam ich einen Gameboy,<br />
den ich ausgiebig bediente, später eine<br />
Playstation, einen ersten Fernseher mit<br />
vierzehn. Meine Familie leistete sich<br />
zu diesem Zeitpunkt einen Internetanschluss,<br />
die Tarife waren noch hoch,<br />
ich durfte nur sonntags in die Weiten<br />
des Netzes aufbrechen. Ich nutzte jede<br />
Minute, jede Sekunde, um meine ersten<br />
eigenen Webseiten zu gestalten, um<br />
mich in Chats und Foren mit Freunden<br />
auszutauschen.<br />
Ein oder zwei Jahre später bekam ich<br />
einen eigenen Computer samt Internetflatrate.<br />
Ich verbrachte Stunden in den<br />
digitalen Welten, hatte dort Freunde,<br />
denen ich nie begegnen sollte. Wir waren<br />
uns nah, wir vertrauten einander;<br />
ich bin nie enttäuscht worden. Doch,<br />
einmal, als ich mich digital verliebte –<br />
wie im wahren Leben, oder?<br />
Alleine oder mit Freunden »durchzechte«<br />
ich so manche Nacht mit exzessiven<br />
Spielen. Neben den geliebten Strategiespielen<br />
standen auch Ballerspiele auf<br />
dem Programm: Droidwars, ein Brow-<br />
Eine deutsche Einheitskirche – wozu denn?<br />
Aufruf zur Einheit: »Ökumene jetzt – Wir sind eine Kirche!« <strong>ZEIT</strong> NR. 37<br />
Der Tonfall kommt einem bekannt vor:<br />
Vor bald 195 Jahren, am 27. September<br />
1817, er geht eine Kabinettsorder Friedrich<br />
Wilhelms III., in der er zu einer<br />
»wahrhaft religiösen Vereinigung der<br />
beiden, nur noch durch äußere Unterschiede<br />
getrennten protestantischen<br />
Kirchen« aufruft. Offenbar waren dem<br />
preußischen König die erheblichen Unterschiede<br />
im Abendmahlsverständnis<br />
der Lutheraner und der Reformierten<br />
nicht besonders wichtig. Er war die<br />
Streitereien leid, wollte Ruhe haben<br />
und eine Kirche unter sich, die die Untertanen<br />
eint.<br />
Heute sind es wieder vor allem Politiker,<br />
die in dem Aufruf »Ökumene jetzt«<br />
feststellen, dass es unter den Christen<br />
eigentlich nur »einen Glauben« gebe<br />
und es auch heute nur äußere und für<br />
das wirkliche Leben in der »Mitte der<br />
Kirche« letztlich irrelevante Unterschiede<br />
seien, die einer Einheit im Wege<br />
stünden. Über Fachfragen sollten sich<br />
die Kirchenleitungen einigen.<br />
Aber wie sähe eine solche politisch herbeigeforderte<br />
Einheit aus? Wir Christen<br />
sind uns nicht einig, wer oder was die<br />
Kirche, ein Bischof, ein Priester, die<br />
Ehe ist. Wir sind uns nicht einig, wie<br />
(und ob ohne oder auch mit oder durch<br />
Menschen oder die Kirche) Gott in der<br />
Welt konkret handelt, liebt, vergibt.<br />
Wir sind uns nicht einig, ob oder wie<br />
wir miteinander das Leben der Ungeborenen<br />
und der Alten schützen sollen,<br />
und in Gender-Zeiten bröckelt unsere<br />
Einigkeit darüber, was ein Mann und<br />
was eine Frau ist.<br />
Wir können nicht gemeinsam für die<br />
Toten beten, und wir können miteinander<br />
die Toten auch nicht für uns beten<br />
lassen, weil wir uns nicht einig sind,<br />
ob sie jetzt schon bei Gott leben. Wir<br />
sind uns nicht einig, was wir mit Amen<br />
meinen, wenn uns jemand ein Stück<br />
Brot reicht und uns sagt, das sei der<br />
Leib Christi.<br />
Natürlich können wir all das für unwichtig<br />
oder äußerlich erklären. Wir<br />
können behaupten, dass das alles Randthemen<br />
seien und dass die, für die diese<br />
Dinge fundamental zum Leben und<br />
Zeugnis der Christen in unserem Land<br />
gehören, Fundamentalisten seien. Das<br />
alles können wir tun. Aber dann müssen<br />
wir uns nicht wundern, wenn eine<br />
solche Neuauflage einer deutschen Einheitskirche<br />
nicht mehr Heilsrelevantes<br />
zum Leben der Menschen zu sagen hat<br />
als die CDU.<br />
Der preußische König hätte sicher seinen<br />
Friedrich Wilhelm unter den Aufruf<br />
gesetzt, aber mit der Einheit, die der<br />
gekreuzigte König meint, hat er gar<br />
nichts zu tun.<br />
Fra’ Dr. Georg Lengerke, Leiter des<br />
Geistlichen Zentrums der Malteser,<br />
Ehreshoven<br />
so einfach, wie Sie vielleicht denken,<br />
denn viele Sechsjährige können echt<br />
noch nicht viel, vor allem noch nicht so<br />
viel Deutsch.<br />
Aber auch Zuhören, Schnürsenkel<br />
binden, Mengen bis zehn erfassen,<br />
Laute hören und unterscheiden, tun,<br />
was eine Lehrerin ihnen sagt und<br />
zeigt, sich konzentrieren, sich etwas<br />
merken – bei vielen Kindern ist das<br />
noch nicht besonders weit gediehen<br />
und muss ihnen – wie gesagt, jedenfalls<br />
in Nordrhein-Westfalen – erst<br />
mal beigebracht werden.<br />
20. September <strong>2012</strong> <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 87<br />
sergame, dessen wesentliche Komponenten<br />
Wörter, Zahlen und Zeit sind.<br />
Sieben Monate lang zog mich das Spiel<br />
in seinen Bann, dann hörte ich auf, zugunsten<br />
Sozialer Netzwerke. Wenn<br />
man all die Wörter, die ich über Instant<br />
Messenger, in Chats und Sozialen Netzwerken<br />
mit Freunden und Fremden<br />
gewechselt habe, zu Büchern zusammenfasst<br />
und sie ins Bord stellt, würden<br />
daneben Spitzers Werke vermutlich<br />
nicht einmal die Hälfte des Platzes<br />
brauchen.<br />
Ich muss mir also ein schlechtes Zeugnis<br />
ausstellen.<br />
Wer bin ich nur? Ein sehr passabler Lehramtsstudent<br />
der Germanistik und Geschichte.<br />
Ein Naturliebhaber und Imker.<br />
Ein Freund der Bücher und Gespräche.<br />
Ein Verehrer des auf Papier oder digitalen<br />
Seiten geschriebenen Wortes, das ich<br />
mit meinen Liebsten wechsle. Ein<br />
Mensch, der dem Web 2.0, den Computerspielen<br />
und dem Fernsehen die<br />
Gefolgschaft aufgekündigt hat, weil sich<br />
all das im privaten Leben als überflüssig<br />
erwiesen hat – wie die Bravo nach der<br />
Pubertät manches Jugendlichen.<br />
Ich bin ganz und gar verdorben.<br />
In zwei Wochen schreibe ich eine Examensarbeit<br />
über das Thema »Blended<br />
Learning«. Es wird um den Einsatz von<br />
digitalen Medien in Lehr-Lern-Prozessen<br />
gehen. Ich bin froh, diese Arbeit nicht<br />
Herrn Spitzer vorlegen zu müssen.<br />
Julian Klein, 24 Jahre, Aachen<br />
Ein Aufstand mit Günther Jauch und<br />
Richard von Weizsäcker? Das funktioniert<br />
sicher nicht. Ein Aufstand wird<br />
normalerweise gegen etwas geführt.<br />
Gegen Diktatoren oder politische Systeme.<br />
Soll dieser Aufstand gegen die<br />
Trennung verschiedener christlicher<br />
Gruppierungen und damit für ein einziges<br />
Christentum geführt werden?<br />
Ökumene zu verwirklichen ist viel problematischer,<br />
als die Europäische Union<br />
harmonisch zu gestalten. Sollte man<br />
nicht einmal darüber nachdenken, die<br />
Auswüchse religiösen Wahnsinns zu beenden?<br />
Von fundamentalistischen Islamisten<br />
bis zu den Kreationisten.<br />
Was mit dem Internationalen Gerichtshof<br />
in Den Haag gelungen ist, sollte<br />
auf dieser Ebene auch bei der Bekämpfung<br />
von Ideologien angestrebt werden.<br />
Die Ökumene ist mit einem »Aufstand«<br />
kräftig überfordert.<br />
Hermann Goldkamp, Braunschweig<br />
Hamburger Kinder starten wohl gleich im Gymnasium<br />
Thomas Kerstan: »Lasst sie in Ruhe!« <strong>ZEIT</strong> NR. 37<br />
Und das dauert. Bei manchen ziemlich<br />
lange, und die werden immer mehr und<br />
die anderen immer weniger.<br />
Ach ja, und »die Integration behinderter<br />
Kinder bewerkstelligen« müssen die<br />
Grundschullehrer hier in NRW auch,<br />
manche schon seit Jahren, manche erst<br />
seit Kurzem.<br />
Also, wie gesagt, warum Sie die Grundschullehrer<br />
jetzt so total in Ruhe gelassen<br />
haben, habe ich dann doch nicht<br />
verstanden. Obwohl das ja bestimmt<br />
nett gemeint war von Ihnen.<br />
Sibylle Clement, Bonn<br />
Aus N<br />
37<br />
o :<br />
6. September <strong>2012</strong><br />
Kampfbegriff<br />
Kerstin Bund: »Generation<br />
Erblast« <strong>ZEIT</strong> NR. 37<br />
Es ist richtig, dass Kerstin Bund daran<br />
erinnert, dass die Politik vergangener<br />
Jahrzehnte den künftigen Generationen<br />
in vielerlei Hinsicht Hypotheken auferlegt<br />
hat. Das muss gestoppt werden, und<br />
insofern will ich ihr zustimmen. Allerdings<br />
spricht sie nicht für mich, wenn sie<br />
in der aktuellen Debatte eine zentrale<br />
Konfliktlinie zwischen heutigen und zukünftigen<br />
Generationen zieht. Als jetzt<br />
32-jähriger werdender Vater möchte ich<br />
nicht in einer Gesellschaft leben, die einen<br />
solchen Gegensatz zum Kampfbegriff<br />
der Politik erhebt; es gibt wichtigere.<br />
Es ist Frau Bund sicher nicht zu unterstellen,<br />
aber ich möchte nicht, dass eine<br />
Debatte über Generationengerechtigkeit<br />
die viel wesentlichere, generationenübergreifende<br />
Debatte über die generellen<br />
Ungerechtigkeiten zwischen den<br />
Vermögenden und den Nichtvermögenden<br />
verdeckt. Es reicht schon, dass<br />
heute über »faule Griechen« statt über<br />
zügellose Banken und renditegierige<br />
Vermögende diskutiert wird ...<br />
Tim Schöning, Diepholz<br />
Sie haben einen wichtigen Aspekt vergessen.<br />
Die junge Generation erbt nicht<br />
nur Schulden in Billionenhöhe, sondern<br />
auch Vermögen in Billionenhöhe. Leider<br />
ist dieses Erbe sehr ungleich verteilt, und<br />
diese Ungleichheit wird tendenziell zunehmen,<br />
weil die Generation der Älteren<br />
es nicht schafft, eine gerechte Vermögensverteilung<br />
herbeizuführen.<br />
Anne Dominitzki, Ober-Olm<br />
Kerstin Bund hat mir aus der Seele gesprochen!<br />
Schön, dass sich mal jemand<br />
traut, auf der Titelseite zu schreiben:<br />
»Die Demokratie passt sich der Demografie<br />
an ... Die Alten sind bald in der<br />
Mehrheit. Die Herrschaft der Alten<br />
über die Jungen wäre aber die Herrschaft<br />
derer, die nicht mehr arbeiten,<br />
über die, die arbeiten.« Genau diese<br />
Entwicklung macht mir als 25-jährigem<br />
Vollzeit Arbeitendem Angst!<br />
Cornelia Ullmann, per E-Mail<br />
Sie erwähnen nicht, dass wir berufsständische<br />
Versorgungssysteme haben<br />
und die Beamten nicht in die Sozialversicherung<br />
einzahlen. Warum will die<br />
Politik das Rentenniveau drastisch absenken,<br />
ohne dass die Beamtenpensionen<br />
angetastet werden?<br />
Die »reichste« Elterngeneration kommt<br />
dadurch zustande, dass alle Regierungen<br />
seit 1949 die Gewinne/Vermögen<br />
nicht genügend besteuerten. Auch von<br />
Verlagen wie dem Zeitverlag.<br />
Wenn alle Erwerbstätigen in eine gemeinsame<br />
Sozialversicherung einzahlen<br />
und der Millionär eben auch nur eine<br />
Basisrente erhält, weil er vorsorgen<br />
kann: Dann wäre genug Geld da.<br />
Hubert Laufer, Gütersloh<br />
Mann!<br />
Nadine Ahr: »Wohnung in<br />
bester Krisenlage« <strong>ZEIT</strong> NR. 37<br />
Ich lese die <strong>ZEIT</strong> sehr gerne, doch<br />
manchmal muss ich mich auch sehr<br />
über sie ärgern. Sobald es in der <strong>ZEIT</strong><br />
um Politik geht, gibt es keine Frauen<br />
mehr. It’s a man’s world.<br />
Da geht es in der Europa-Serie um spanische<br />
Polizisten, einen griechischen<br />
Schmuckhändler, zwei italienische Kioskbetreiber<br />
und einen deutschen Makler.<br />
Was ist los? Sind keine Frauen von der<br />
Krise betroffen? Polizistinnen, Händlerinnen,<br />
Maklerinnen? Keine Erwähnung in<br />
den Artikeln. Nicht mal in der Serie.<br />
Genauso bei Bernd Ulrich, ein guter,<br />
langer Beitrag über das aktuelle Verhältnis<br />
der Deutschen zum Holocaust.<br />
Ein Botschafter, ein Museumsdirektor,<br />
ein Schriftsteller, ein Journalist. Keine<br />
Frauen: weder in Deutschland noch in<br />
Israel. Es sagt viel darüber aus, wie beiläufig<br />
es geschieht. Hätte in den Serien<br />
nicht eine Frau Platz gehabt? Eine einzige<br />
Quotenfrau?<br />
Ein chinesisches Sprichwort sagt: »Frauen<br />
tragen die Hälfte des Himmels«. Diese<br />
Hälfte würde ich auch gerne in der <strong>ZEIT</strong><br />
und vor allem in der Politik lesen.<br />
Eli Schmid, Bad Tölz
Leserbriefe siehe Seite 87<br />
Liebe <strong>ZEIT</strong>-Leserinnen<br />
und -Leser, in dieser<br />
Ausgabe endet unsere<br />
Sommer-Serie »Internationale<br />
Küche«. Die<br />
»Sohlenfi lets«, »Meerärsche«<br />
und »Mundtäschchen«,<br />
die Sie auf<br />
den Speisekarten rund<br />
um die Welt entdeckt<br />
haben, waren einfach<br />
köstlich! Und wenn<br />
Ihnen der Abschied<br />
von der Reisesaison<br />
genauso schwerfällt<br />
wie uns, dann<br />
schicken Sie künftig<br />
einfach originelle<br />
Urlaubsandenken für<br />
unsere Rubrik<br />
»Mein Ding«! HOF<br />
Mein<br />
Wort-Schatz<br />
Ich mag das Wort nächtigen. Was<br />
für eine Breite an Möglichkeiten<br />
enthält es: das Obdachlosenquartier<br />
im Eingang eines Geschäftes,<br />
das Wachen vor einer Kaserne sowie<br />
die kuschelige oder auch schlaflose<br />
Nacht mit einer Bettgefährtin.<br />
Ulrich Fest, Emden<br />
Wenn man bei uns ein Nickerchen<br />
machen wollte, hieß es: »Ich nehme<br />
noch eine Mütze voll Schlaf.« Und<br />
nach einem langen Tag sagte meine<br />
Mutter zu uns Kindern: »Heute<br />
werdet ihr so tief schlafen, dass ein<br />
Auge das andere nicht sieht.«<br />
Karl-Heinz Becker,<br />
Jettingen, Baden-Württemberg<br />
»Ich mache mich dann schon mal<br />
bett(geh)fein«, kündige ich am<br />
Abend gerne an. Wobei dieses<br />
nostalgisch klingende Wort neben<br />
dem Anziehen eines (nicht mal<br />
feinen) Schlafanzuges auch die<br />
Routine im Badezimmer (Zähne<br />
putzen, Kontaktlinsen reinigen)<br />
umfasst. Der Duden gibt keine<br />
Info, die Suchergebnisse im Internet<br />
sind überschaubar. Umso wichtiger,<br />
dieses Wort nicht in Vergessenheit<br />
geraten zu lassen.<br />
Jan Wagemester, Braunschweig<br />
Manchmal scheint es, als ob Anstrengung<br />
nur noch negativ wahrgenommen<br />
wird. Ich will das<br />
Burn-out in unserer hektischen<br />
Zeit nicht kleinreden, aber wie<br />
schön ist es, nach getaner Arbeit<br />
wohlig ermattet zu sein. Diese<br />
Momente wunschloser Zufriedenheit<br />
und meditativer Leere sind das<br />
pure Glück. Falls Sie das nächste<br />
Mal einer fragt: »Na, bist du auch<br />
so kaputt?«, wäre es doch toll, wenn<br />
Sie antworten könnten: »Nein, nur<br />
ein wenig ermattet.«<br />
Thorsten Faust,<br />
Leingarten, Baden-Württemberg<br />
Schicken Sie Ihre Beiträge für<br />
»Die <strong>ZEIT</strong> der Leser« bitte an:<br />
leser@zeit.de<br />
oder an<br />
Redaktion <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>,<br />
»Die <strong>ZEIT</strong> der Leser«,<br />
20079 Hamburg<br />
Die Redaktion behält sich die<br />
Auswahl, eine Kürzung und die<br />
übliche redaktionelle Bearbeitung<br />
der Bei träge vor. Mit der Einsendung<br />
eines Beitrags erklären<br />
Sie sich damit einverstanden, dass<br />
der Beitrag in der <strong>ZEIT</strong>, im Internet<br />
unter www.zeit.de/zeit-der-leser<br />
und auch in einem <strong>ZEIT</strong>-der-<br />
Leser-Buch (Sammlung von<br />
Leserbei trägen) veröffentlicht<br />
werden kann<br />
1999 <strong>2012</strong><br />
Diese beiden Fotos wurden in der Nähe unserer<br />
Lieblingsbadestelle an der Nordsee bei Lüttmoorsiel<br />
aufgenommen.<br />
Das linke Bild entstand im Februar 1999 auf einem<br />
winterlichen Spaziergang. Gut ausgerüstet<br />
mit heißem Kakao und Keksen legten mein Mann<br />
Hauke und unsere Tochter Sirka mit unserer Hün-<br />
EIN GEDICHT!<br />
Klassische Lyrik, neu verfasst<br />
Das Fräulein stand<br />
im Parke<br />
(Nach Heinrich Heine, »Das Fräulein stand am Meere«)<br />
Das Fräulein stand im Parke<br />
Und seufzte lang und schwer,<br />
Es rührte sie so arge<br />
Der Blattfall ringsumher.<br />
Mein Fräulein! sein Sie munter,<br />
Das ist ein altes Stück;<br />
Im Herbst, da fallen sie runter<br />
Und kommen im Frühling zurück.<br />
Elsa Zettelmann, Köln<br />
STRASSENBILD<br />
Eigentümlich<br />
Dieses Foto habe ich vor einiger Zeit auf einem Friedhof in<br />
Berlin gemacht. Es lebe das Privateigentum!<br />
Doris Nienhüser, Haltern am See<br />
!<br />
Zeitsprung<br />
din Nala, die damals etwa neun Monate alt war,<br />
eine Verschnaufpause oben auf dem Deich ein.<br />
Das rechte Bild habe ich in diesem Jahr fotografiert.<br />
Inzwischen sind mehr als dreizehn Jahre ins<br />
Land gegangen. Unsere Tochter ist inzwischen erwachsen,<br />
Herrchen und Hund sind etwas ergraut.<br />
An diesem stürmischen Sommertag <strong>2012</strong> war es nicht<br />
Internationale Küche<br />
Auf Mallorca bot ein Chinarestaurant auf<br />
einer Holztafel seine »Speialitäten« an. Ich war<br />
zwar nicht dort zu Gast, möchte aber zugunsten<br />
des Kochs annehmen, dass seine<br />
Speisen S bekömmlicher waren, als es<br />
die d Tafel vermuten ließ ...<br />
Margret M Dick, Dülmen<br />
Man M muss gar nicht so weit fahren,<br />
auch hierzulande ist der Fehlerteufel<br />
unterwegs. So fand ich in meiner<br />
Heimatstadt Osnabrück bei<br />
den Weintagen eines Restaurants<br />
den »falschen Wein des Monats«<br />
für 12,50 Euro. Die Frage, ob ich<br />
mit Falschgeld des Monats bezah-<br />
Wiedergefunden:<br />
Umschlag<br />
auf Umwegen<br />
Beim Durchsehen alter Unterlagen fand<br />
ich diesen Briefumschlag aus dem Jahr<br />
1972. Damals gab es kein Internet und<br />
kaum Kopierer, daher bat man die Autoren<br />
einer wissenschaftlichen Veröf-<br />
fentlichung um einen Nachdruck, indem mman man<br />
ihnen vorgedruckte Postkarten schickte: »I would greatly appreciate receiving a reprint ...«<br />
Leider vergaß ich damals, die betreffende Karte mit dem Institutsstempel zu versehen.<br />
Der angeschriebene Kollege in Israel hatte deshalb nur den Poststempel und meine Unterschrift<br />
als Anhaltspunkt. Mit grenzenlosem Vertrauen in die Fähigkeiten der Post schnitt<br />
er beides aus der Karte aus, klebte es auf seinen Brief und fügte Germany hinzu. In der<br />
Hauptpost Gießen muss es manches Kopfschütteln gegeben haben, aber auch sportlichen<br />
Ehrgeiz. Nach einigen Umwegen erreichte mich der Umschlag.<br />
VIELEN DANK, LIEBE BUNDESPOST!<br />
Albrecht Grimm, Nottuln, Nordrhein-Westfalen<br />
Die Kritzelei der Woche<br />
Während die Kinder die letzten Ferientage bei Oma und Opa verbringen, habe ich<br />
aufgeräumt – und auf der Schreibtischunterlage meiner achtjährigen Tochter Birte<br />
diese Kritzelei gefunden. Entstanden ist sie in vielen Stunden des CD-Hörens, Vorsich-hin-Träumens,<br />
Sich-vor-Schularbeiten-Drückens ...<br />
Susanne Kremer, Stuttgart<br />
einfach, Nala zum Stillhalten zu bewegen: Der Wind<br />
brauste über den Deich, und die Kekse drohten wegzufliegen.<br />
Dennoch hatten wir viel Spaß – nach dem<br />
Fototermin setzten wir die Kakaopause allerdings in<br />
einer windstilleren Ecke fort.<br />
Jutta Hogrefe-Feddersen, Bredstedt, Schleswig-Holstein<br />
len darf, wurde allerdings leider mit Nein<br />
beantwortet.<br />
Christian Heinecke, Osnabrück<br />
Kleine Taverne auf Rhodos mit Blick auf den<br />
Sonnenuntergang. Auf der dreisprachigen<br />
Speisekarte wurden »Gigantes« (Normalerweise<br />
dicke weiße Bohnen in Tomatensoße)<br />
angeboten. Die englische Übersetzung lautete<br />
»Lion Beans« – deren Existenz sich jedoch<br />
auch nachträglich in keinem der üblichen<br />
Nachschlagewerke erhärten ließ. Noch skurriler<br />
dann die Weiterübersetzung ins Deutsche:<br />
»Löwen Bienen«! ... Lecker!<br />
Benno Remling, Düsseldorf<br />
ALLTAGSKUNST<br />
20. September <strong>2012</strong><br />
<strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong> N o <strong>39</strong> 88<br />
Was mein<br />
LEBEN<br />
reicher macht<br />
Das Citrusbäumchen auf meiner<br />
Terrasse. Es steht in voller Blüte und<br />
verströmt einen betörenden Duft.<br />
Beate van Oel, Berlin<br />
Seit April lebe und arbeite ich auf<br />
Mallorca. Und mein Liebster macht<br />
Überstunden, damit er mich jeden<br />
Monat für ein paar Tage besuchen<br />
kann. Jan, ich liebe dich!<br />
Claudia Hein, Costa de los Pinos<br />
Nachts um halb drei Uhr von unserem<br />
Dreijährigen geweckt zu werden:<br />
»Ich muss Pipi.« Den Sohnemann<br />
schlaftrunken auf die Toilette<br />
zu setzen und mir während des Pinkelns<br />
von ihm ins Ohr flüstern zu<br />
lassen: »Papi, ich hab dich lieb.«<br />
Karsten Stanberger, Recklinghausen<br />
Ich lebe allein mit César, meinem<br />
14-jährigen Sohn. Sein Vater<br />
wohnt in Frankreich. Phasenweise<br />
fürchte ich, manches falsch gemacht<br />
zu haben – gerade, wenn<br />
das Vokabular meines Sohnes nur<br />
aus »Digger!«, »Scheiße« und<br />
»Chill, Mama!« zu bestehen<br />
scheint. Gestern jedoch hörte ich<br />
ihn durch die geöffnete Tür zu einer<br />
seiner Wüstenrennmäuse im<br />
Terrarium sagen: »Na, Mäuschen,<br />
soll Papa César dich mal hochnehmen?«<br />
Da dachte ich gerührt:<br />
Ach, das wird schon ...<br />
Barbara Hintze-Maurin, Hamburg<br />
Das spontane nächtliche Treffen auf<br />
unserer Terrasse, um mucksmäuschenstill<br />
vier Igelkinder bei ihren<br />
ersten Streifzügen durch unseren<br />
Garten zu beobachten.<br />
Sigrid Heuer,<br />
Vallendar, Rheinland-Pfalz<br />
Meine Psychoanalyse – begonnen in<br />
der Not, häufig anstrengend, immer<br />
wieder beglückend und heilsam,<br />
wenn sich innere Räume auftun und<br />
gemeinsam verstehbar wird, weshalb<br />
ich so bin, wie ich nun mal bin.<br />
Paula Kleeblum, Freiburg<br />
Neu in Wien. Auf dem Weg zur<br />
Arbeit – und in Eile – wollte ich<br />
gerade in die U-Bahn hechten, als<br />
die automatische Bandstimme<br />
mit »Zug fährt ab« drohte. Resigniert<br />
trat ich zurück, um nicht<br />
zwischen den sich schließenden<br />
Türhälften zermalmt zu werden.<br />
Da schallte aus dem Lautsprecher<br />
die ungeduldig-freundliche Stimme<br />
der Fahrerin quer über den gesamten<br />
Bahnsteig: »Na, Schatzerl,<br />
wooos iiiis?« Mit einem Lächeln<br />
stieg ich ein.<br />
Brigitte Gläser, Wien<br />
Kürzlich war ich in meiner Heimatstadt<br />
Wismar und begleitete meinen<br />
Freund auf eine seiner Gewölbeführungen<br />
in der Sankt-Nikolai-Kirche.<br />
Dabei zeigt er Touristen die Backsteingotik-Kathedrale.<br />
Auf seine<br />
Eingangsfrage, ob jemand unter<br />
Zeitdruck stehe, fragte ein kleiner<br />
Junge zurück: »Was ist das?« Er<br />
erntete einige Lacher, aber eigentlich<br />
ist es beruhigend, dass dieses Wort<br />
für ihn noch keine Bedeutung hat!<br />
Wiebke Neelsen, Erfurt<br />
Meine erste Türkischstunde im<br />
Café Neruda: Immer wieder kommen<br />
türkische Gäste vorbei, begrüßen<br />
meinen Lehrer Fikret und<br />
mich, loben und verbessern mich:<br />
Integration hautnah.<br />
Barbara Lutz, Augsburg<br />
Nach einem kurzen, aber wunderschönen<br />
Urlaubsbesuch bei der<br />
Familie meiner Freundin sitze ich<br />
im Zug zurück aus Sylt. Ich lese<br />
und döse ein wenig vor mich hin.<br />
Alle Herausforderungen des neuen<br />
Schuljahres scheinen mit einem Mal<br />
weniger schwierig.<br />
Tim Bosch, Nittel, Rheinland-Pfalz<br />
Ich bin früh morgens zu Fuß unterwegs,<br />
um etwas zu erledigen. Es ist<br />
alles noch ganz ruhig. Nur ein Bauarbeiter<br />
ist auf dem eingerüsteten<br />
Kirchturm zugange. Plötzlich schallt<br />
Highway to Hell vom Turm.<br />
Angelika Schmaus,<br />
Schliersee, Bayern
Dirk@work<br />
Nr. <strong>39</strong> 20. 9. <strong>2012</strong><br />
Von Kindern lernen, Seite 24 24
Ein deutscher Superstar in Amerika –<br />
unterwegs mit dem Basketballspieler Dirk Nowitzki
INHALT NR. <strong>39</strong> Alles, was in diesem Heft passiert<br />
32<br />
Der Traum der<br />
Popsängerin Lykke Li<br />
34<br />
Israelis reden über ihren<br />
Militärdienst<br />
6 Harald Martenstein über die Farbe von Eiern und über Geschlechtertheorien<br />
7 Auch das gehört ins Tagebuch: Alleine schlafen<br />
8 Wer in Köln lebt, hat allen Grund, heiter zu sein<br />
10 Wer wissen will, wo die Hipster leben, erfährt es in der Deutschlandkarte<br />
11 Die große PR-Offensive des englischen Königshauses<br />
12 Der Schriftsteller Thomas Pletzinger über seine Begegnungen mit Dirk Nowitzki<br />
44 Unser Stilkolumnist joggt regelmäßig – aber was hat er dabei an?<br />
45 Einmal rund um den Starnberger See nimmt der Chef vom Dienst lieber das Auto<br />
46 Der Wochenmarkt singt ein Lob auf die indische Küche<br />
48 Auch eine Frage der Liebe: Wer darf bestimmen, woran der Sohn glauben soll?<br />
50 Die Stichfrage ist diesmal so was von süß<br />
54 Gesine Schwans Rettung waren ihr Glaube und die Psychoanalyse<br />
Und so sieht unser Zeichner Ahoi Polloi die Welt<br />
Titelfotos Pari Dukovic Fotos Inhalt Nadine Elfenbein; Andreas Herzau; KLAX-Kinderkunstgalerie<br />
24<br />
Was wir von Kindern<br />
lernen können<br />
5
Die Firma Ferrero macht Werbung für sogenannte Über raschungs eier<br />
aus Schokolade, die speziell für Mädchen gemacht sind. Diese Eier<br />
sind schweinchenrosa verpackt. Die Werbung ist eine einzige Orgie in<br />
Rosa. Erwartungsgemäß gab es Proteste, weil mit der Farbe Rosa ja auf<br />
billigste Weise historisch überholte Geschlechterklischees bedient werden.<br />
Mäd chen eier rosa, Büb chen eier hellblau – provozierender geht es<br />
kaum. Ich vermute stark, dass die Werbeagentur feministische Proteste<br />
einkalkuliert hat. Ein Aufreger-Ei, das politische Debatten in intellektuellen<br />
Milieus anstößt, ist aus kaufmännischer Sicht weit besser als<br />
ein Konsens-Ei, über das von CSU bis Linkspartei alle sich einig sind.<br />
Eine Kulturwissenschaftlerin hat mir erklärt, dass noch<br />
im 19. Jahrhundert die Farbe Rosa für die Kleidung von Knaben<br />
verwendet wurde und die Farbe Blau für Mädchen. Das ist alles nur<br />
Kultur, sagte die Kulturwissenschaftlerin. Wenn sich die Gesellschaft<br />
morgen darüber kulturell verständigt, dass Grün die Mädchenfarbe<br />
ist und Gelb die Bübchenfarbe, und wenn sich alle daran<br />
halten, dann ziehen die Mädchen sich übermorgen lindgrüne<br />
Trachtenjanker an. Und überübermorgen gibt es dann Proteste dagegen.<br />
Proteste sind auch Kultur.<br />
Jeder, der mal Jungen und Mädchen hat aufwachsen sehen,<br />
weiß, dass sie irgendwann anfangen, sich auf extrem klischeehafte<br />
Weise wie Jungen und Mädchen aufzuführen. Als mein Sohn klein<br />
war, hat meine Oma ihm oft Puppen geschenkt. Er wollte aber mit<br />
Autos spielen. Ich glaube nicht an die Verschwörungstheorie. Die Verschwörungstheorie<br />
lautet, dass all diese Verhaltensweisen auf unbewusste<br />
Manipulation durch die Erwachsenen zurückzuführen sind.<br />
Mädchen und Jungen möchten einfach ihre Identität finden. Wenn<br />
6<br />
HARALD MARTENSTEIN<br />
Über Geschlechtertheorien:<br />
»Ein Aufreger-Ei ist besser als ein Konsens-Ei«<br />
man der Natur ihren Lauf lässt, kommen am Ende verschiedene Geschlechter<br />
heraus, die sich, trotz vieler Gemeinsamkeiten, in ein paar<br />
Punkten unterschiedlich verhalten.<br />
Ich frage mich, was daran schlecht sein soll und wieso man<br />
es ändern will. Ein Einheitsgender, die Mauen oder die Fränner oder<br />
wie immer das dann heißt, so was wäre doch total langweilig. Frauen<br />
und Männer in klischeehaften Situationen – ich bin dafür. Bei den<br />
Schnecken gibt es das Gegenteil ja bereits, Schnecken haben alle ein<br />
Einheitsgeschlecht. Bis zu meinem letzten Atemzug werde ich dagegen<br />
kämpfen, dass die Schnecke in unserer Gesellschaft das neue Rollenmodell<br />
wird. Rumschleimen, Salat essen, überall zu spät kommen und<br />
ein einziges Geschlecht haben, ich toleriere das, ich kann damit umgehen,<br />
aber es soll bitte nicht Pflicht werden.<br />
Ich möchte etwas Privates enthüllen. Meine Oma hat auch<br />
mir oft Puppen geschenkt. Ich weiß nicht, wieso. Sie war nicht auf dem<br />
Gender-Trip, sie hat nicht Judith Butler gelesen, sie war lediglich ein<br />
bisschen unkonventionell. Einen nicht unwesentlichen Teil meiner<br />
Kindheit habe ich folglich damit verbracht, Puppen an- und auszuziehen.<br />
Das hat Spaß gemacht, auch wenn ich dadurch falsche Vorstellungen<br />
von der weiblichen Anatomie bekommen habe. Puppen sind in<br />
dieser Hinsicht ein bisschen unrealistisch, was Jungen, die mit Puppen<br />
spielen, leider nicht immer gleich wissen. Und? Am Ende der Puppenspielerei<br />
bin ich vermutlich der gleiche Typ geworden, der ich sowieso<br />
bin, ein Typ, der es völlig egal findet, ob Mädchen rosa Eier essen oder<br />
giftgrüne Eier oder gar keine Eier, ein Typ, der nicht daran glaubt, dass<br />
man mithilfe von Erziehung Menschen in andere Menschen verwandeln<br />
kann, mehr noch, ein Typ, der genau dies gut findet.<br />
Zu hören unter www.zeit.de/audio Illustration Fengel
TAGEBUCH EINER JUNGEN FRAU<br />
Emeric und ich haben uns dieses Frühjahr getrennt, nach vier Jahren.<br />
Ich war mir sicher gewesen, dass wir für immer zusammenbleiben würden,<br />
aber ich begreife gerade, dass auf dieser Welt nichts sicher ist. Die<br />
Unsicherheit ist ein großer Teil ihres Charmes, so furchteinflößend das<br />
sein mag. Was ich auch gerade lerne, ist die Kunst, allein zu schlafen. Es<br />
ist ein langsamer Prozess. Montagnacht bin ich aufgewacht, weil jemand<br />
an meine Wohnungstür klopfte, aber weil ich zu viel Angst hatte,<br />
sie zu öffnen, blieb ich im Bett. Am Dienstag bin ich aufgewacht und<br />
war mir sicher, dass das Kissen neben mir das Gesicht eines Mannes ist.<br />
ALLEIN SCHLAFEN<br />
Mittwochnacht fiel ein Bild von der Wand. Donnerstagnacht hatte ich<br />
so schlimme Migräne, dass ich gar nicht schlafen konnte, bis ich mich<br />
übergab und vor Schmerzen ohnmächtig wurde. Und dann gibt es<br />
noch die normalen Nächte, in denen ich kaum einschlafen kann, weil<br />
mein Kopf voller Gedanken ist und mein Bett leer.<br />
Die schwedische Fotografin Lina Scheynius, Jahrgang 1981,<br />
lebt in London. Sie arbeitet für internationale Magazine – und führt<br />
in diesem Jahr für uns Tagebuch<br />
7
Die <strong>ZEIT</strong>magazin n En Entdeckungen der Woche<br />
Die einen schwören ren<br />
auf »Ritter Sport«,<br />
andere essen lieber<br />
SCHOKOLADE<br />
in Fischform von<br />
Rococo Chocolates<br />
aus London<br />
Wer in Köln diese<br />
FAHRENDE<br />
ESPRESSOBAR<br />
der Kaffeerösterei<br />
Van Dyck sieht:<br />
Hand heben.<br />
Dann hält sie an<br />
H E I T E R B I S G L Ü C K L I C H<br />
Diese hier ruft in freudiger Erwartung: Bis morgen! Von Papermash<br />
Sagen Sie es mit einer PARTYGIRLANDE.<br />
»Reden und sich gleichzeitig<br />
bewegen. Das war echt schwer«<br />
RYAN LOCHTE, mehrfacher Olympiasieger im Schwimmen,<br />
über seinen Gastauftritt in der US-Fernsehserie »90210«<br />
Das ist Greta Garbo, fotografiert von Cecil Beaton.<br />
Ein BILDBAND mit seinen imposanten Porträts ist gerade bei ei<br />
Schirmer/Mosel erschienen: »The Essential Cecil Beaton«<br />
100 %<br />
Die neue Ausgabe des<br />
MAGAZINS »032c«<br />
aus Berlin hat kein<br />
geringeres Ziel, als die<br />
Welt zu verstehen<br />
Die Di schönsten<br />
LEDER LE JACKEN<br />
gibt es beim Label<br />
Muubaa: ohne<br />
Biker-Attitüde,<br />
schmal geschnitten,<br />
heitere Farben<br />
Gummistiefel gibt<br />
es jetzt als SEIFE –<br />
bei Scottish Fine Soaps<br />
(sie haben auch<br />
Ballerinas aus Seife)<br />
Fotos Papermash; Rococo Chocolates; Muuba; Sarah Beckhoff; Espressizy;<br />
The Cecil Beaton Archive / Schirmer / Mosel; Scottish Fine Soaps
Deutschlandkarte HIPSTER-VIERTEL<br />
Hamburg<br />
Wilhelmsburg:<br />
Vogelhüttendeich,<br />
Stübenplatz<br />
St. Pauli:<br />
Simon-von-Utrecht-Straße,<br />
Paul-Roosen-Straße,<br />
Wohlwillstraße,<br />
Thadenstraße,<br />
Karolinenviertel,<br />
Gegend um Sternschanze<br />
und Schulterblatt<br />
Altona:<br />
Gegend im Straßendreieck<br />
Holstenstraße, Königstraße,<br />
Max-Brauer-Allee<br />
Düsseldorf<br />
Flingern:<br />
Ackerstraße<br />
Köln<br />
Belgisches<br />
Viertel:<br />
Brüsseler Platz<br />
Ehrenfeld:<br />
rund um die<br />
Körnerstraße<br />
Frankfurt<br />
Bahnhofsviertel:<br />
zwischen<br />
Münchener Straße<br />
und Kaiserstraße<br />
Sachsenhausen:<br />
Brückenstraße<br />
und Wallstraße<br />
Innenstadt:<br />
Willy-Brandt-Platz<br />
und Bethmannstraße<br />
Altstadt:<br />
Schöne Aussicht<br />
10<br />
Stuttgart<br />
Mitte:<br />
Geißstraße und<br />
Heusteigviertel<br />
Das Buch Hipster, herausgegeben von dem<br />
amerikanischen Essayisten Mark Greif, zählt<br />
Hipster-Viertel in amerikanischen Städten<br />
auf. Wir fragten uns, wie weit das Hipstertum<br />
von Amerika aus in die deutsche Provinz vorgedrungen<br />
ist, auch deshalb, weil viele Berlin-<br />
Touristen aus deutschen Kleinstädten die bekannten<br />
Hipster-Accessoires tragen (dicke<br />
Stadtviertel, denen eine hohe Hipster-Dichte nachgesagt wird<br />
Brille, Bart, Jutetasche). Wir telefonierten mit<br />
Stadtmagazinen und ausgehfreudigen Freunden<br />
im ganzen Land und fragten: Welche<br />
Hipster-Viertel habt ihr so? Wenn die Gegenfrage<br />
hieß: »Was meint ihr damit?«, strichen<br />
wir die Stadt von der Karte. Das schien uns<br />
wissenschaftlich korrekt zu sein. Andere Städte<br />
vermeldeten In- oder Studentenviertel.<br />
Berlin<br />
Neukölln:<br />
Weserstraße<br />
und Weichselstraße<br />
Mitte:<br />
Tostraße,<br />
Münzstraße,<br />
Brunnenstraße<br />
Kreuzberg:<br />
rund um die<br />
Oranienstraße<br />
Schöneberg:<br />
Potsdamer<br />
Straße<br />
Leipzig<br />
Plagwitz:<br />
Zschochersche Straße,<br />
Karl-Heine-Straße und<br />
Sachsenbrücke<br />
München<br />
Gärtnerplatzviertel<br />
Glockenbachviertel:<br />
Fraunhoferstraße<br />
Dreimühlenviertel:<br />
Ehrengutstraße und<br />
Dreimühlenstraße<br />
Westend:<br />
Schwanthalerstraße,<br />
Theresienhöhe und<br />
Gollierstraße<br />
Aber ein Student ist noch lange kein Hipster,<br />
und in ist ja auch eher ein Wort von früher.<br />
Hipster mag es überall geben, Hipster-Viertel<br />
aber nur in acht Städten, das ist das Ergebnis<br />
unserer Befragung. Zum Hipstertum gehört,<br />
nicht gerne in Hipster-Vierteln zu wohnen,<br />
weshalb diese Karte nur von begrenzter Haltbarkeit<br />
sein dürfte. Matthias Stolz<br />
Illustration Jörg Block Recherche Friederike Milbradt
Für Mitglieder<br />
des Königshauses<br />
ist es unmöglich,<br />
sich zu verstecken<br />
London, im September. Vor Kurzem ist<br />
Prinz Harry nackt beim Strip-Billard in<br />
Las Vegas fotografiert worden. Zum Glück<br />
sind in der PR-Zentrale des Palastes seit<br />
einigen Jahren Profis am Werk. Sie wissen,<br />
dass man peinliche Geschichten nur auf<br />
eine Weise vergessen machen kann: durch<br />
neue Bilder. Über die Diskussionen, die<br />
der Bilderflut der letzten Tage vorangingen,<br />
können wir nur spekulieren:<br />
Praktikant: »Wie wär’s mit Harry in Afghanistan?<br />
In Uniform? Keine Frau weit<br />
und breit, nur Sonne und Sand.«<br />
PR-Guru: »Gut gedacht, James, aber dann<br />
wird es heißen, wir hätten ihn aus PR-<br />
Gründen in den Krieg geschickt.«<br />
Praktikant: »Vielleicht könnte er in Las Vegas<br />
was von Abschiedsparty gerufen haben.«<br />
PR-Guru: »Du bist dein Geld wert, James.«<br />
Praktikant: »Könnte Kate nicht auch ein<br />
Foto liefern? Oben ohne oder so?<br />
PR-Guru: »Vergiss es. Ist unrealistisch.«<br />
Praktikant: »Schon vergessen.«<br />
PR-Guru: »Prinz Andrew bietet seit Jahren<br />
an, sich von einem Wolkenkratzer abzuseilen.«<br />
Praktikant: »Hm ...«<br />
PR-Guru: »Egal, wir können wirklich jedes<br />
Bild gebrauchen.«<br />
Praktikant: »Und wie begründen wir es?«<br />
PR-Guru: »Charity.«<br />
Foto Nicky Loh / Getty Images<br />
Gesellschaftskritik<br />
Über PR-Strategien<br />
Praktikant: »Sekunde, Sir. Hier kommt<br />
gerade eine Mail rein. Monty ist tot.«<br />
PR-Guru: »Wer?«<br />
Praktikant: »Einer der Hunde der Queen,<br />
Sir.«<br />
PR-Guru: »Das ist ja fürchterlich. Jag die<br />
Meldung raus, James!«<br />
Tippt: Trauerfall im Buckingham-Palast:<br />
Monty, eines der Corgi-Hündchen der<br />
Queen, ist gestorben. Der Hund hinterlässt<br />
seine Geschwister Willow und Holly<br />
sowie zwei Dorgis, Candy und Vulcan ...<br />
PR-Guru: »Stopp, das reicht an Tiernamen,<br />
James. Wir sind ja kein Zoo. Gott,<br />
was für ein Unsinn.«<br />
Wenige Tage später.<br />
Praktikant: »Sie haben angebissen, Sir.«<br />
PR-Guru: »Wer?«<br />
Praktikant: »Äh, die Taliban.«<br />
Liest vor: »›Wir haben unsere Kommandanten<br />
angewiesen, alles zu tun, um Harry<br />
zu eliminieren‹, sagte Taliban-Sprecher<br />
Mudschahid. Die Taliban hätten einen<br />
Plan ausgearbeitet, erklärte er.«<br />
PR-Guru: »Steht da was von Vegas?«<br />
Praktikant: »Kein Wort, Sir.«<br />
PR-Guru: »Mission accomplished, James.«<br />
Praktikant: »Oh Gott, hier kommt schon<br />
die nächste Meldung: Kate topless!«<br />
PR-Guru: »Wir brauchen neue Bilder,<br />
James!« Heike Faller<br />
11
12<br />
Eine andere Liga<br />
Von<br />
THOMAS PLETZINGER<br />
Fotos<br />
PARI DUKOVIC
Die Arena der Dallas Mavericks, Nowitzkis<br />
Arbeitsplatz – und er selbst nach einem Spiel<br />
Dirk Nowitzki ist in Deutschland ein Superstar –<br />
in den USA aber ist er »Saint Dirk«.<br />
Der Schriftsteller Thomas Pletzinger hat ihn getroffen<br />
13
MANCHMAL GIBT einem der Zufall Antworten, ehe man<br />
seine Fragen gestellt hat. Der Taxifahrer, der mich vom Flughafen Dallas<br />
zum Hotel bringen soll, heißt Haile, ist Mitte vierzig und stammt<br />
aus Eritrea. Er glaubt an Gott, Großzügigkeit und Dirk Nowitzki.<br />
Haile trägt ein blaues T-Shirt mit Nowitzkis 41. Sein Taxi riecht nach<br />
Süßholz, an seinem Rückspiegel baumelt ein Rosenkranz aus blau-weißen<br />
Plastikperlen, die Farben der Dallas Mave ricks. Auf seinem Armaturenbrett<br />
klebt eine elfenbeinerne Plakette, der heilige Christophorus,<br />
Schutzpatron der Autofahrer. Direkt daneben: eine goldgerahmte Autogrammkarte<br />
von Dirk Nowitzki mit langen Haaren und Stirnband.<br />
Nowitzki ist der Grund, warum ich nach Dallas gekommen bin,<br />
aber davon weiß der Taxifahrer nichts, als er »Saint Dirk« sagt und<br />
lächelt, »savior of Dallas basketball«. Der Verkehr ist dickflüssig, die<br />
Sonne steht steil auf dem Asphalt, die Klimaanlage des Taxis jammert.<br />
Haile hupt und jubelt und reicht mir Lakritz. Warum ich nach<br />
Dallas gekommen sei, fragt er. Ich sei hier, um Dirk Nowitzki zu<br />
treffen, erkläre ich und nicke Richtung Armaturenbrett, Richtung<br />
blau-weißer Rosenkranz, es seien ja jetzt Play-offs. Haile dreht sich in<br />
voller Fahrt um und starrt mich fassungslos an. »You’re meeting Dirk?<br />
Are you fucking joking?«<br />
Wie viele andere habe auch ich einmal von einer Basketballkarriere<br />
geträumt. Die Träumerei aufgegeben habe ich 1994, als man zum<br />
ersten Mal Gerüchte von einem talentierten Spargeltarzan aus Würzburg<br />
hörte, 16 Jahre alt, knapp zwei Meter groß, sehr beweglich und<br />
mit exzellentem Wurf. In den Turnhallen erzählte man sich, dass er das<br />
Zeug zum besten Spieler Deutschlands habe. Ein paar Jahre später sah<br />
ich Nowitzki dann zum ersten Mal spielen, Brandt Hagen gegen<br />
Würzburg, es muss 1998 gewesen sein. Das Spiel war nicht ausverkauft.<br />
Nowitzki war jetzt 2,13 Meter und musste sich schon damals<br />
nicht mehr an die Rollen und Regeln halten, an die man in Deutschland<br />
glaubte: Große und schwere Spieler unter den Korb, kleine und<br />
schnelle nach außen. Nowitzki konnte alles. Er war groß, schnell und<br />
clever, er konnte von überall werfen und treffen, er dribbelte und fand<br />
seine freien Mitspieler – er beherrschte das Spiel auf allen Ebenen.<br />
14<br />
Dallas-Mavericks-Fans im American Airlines<br />
Center, »the house that Dirk built«<br />
Nowitzki schien die Struktur des Spiels besser lesen zu können, er<br />
schien schneller zu denken. Er war anders als alle anderen Basketballspieler,<br />
die wir damals kannten. Mein altes Team gewann das Spiel<br />
gegen Würzburg, doch wir hatten die Zukunft des Spiels gesehen.<br />
Basketball hat mich nie in Ruhe gelassen. Ich liebe das Spiel, das<br />
ich nur noch selten spiele. Ich bin Enthusiast, in seltenen Momenten<br />
bin ich Fan. Wenn ich Basketballspiele sehe, ist da eine melancholische<br />
Begeisterung, eine freudige Nostalgie, eine angenehme Trauer um die<br />
Dinge, die einmal möglich schienen, aber nie geschehen sind. Solche<br />
wie mich gibt es viele: Nostalgiker und Statistikliebhaber, theoretische<br />
Sportler. Dirk Nowitzki ist unser Stellvertreter. Er ist alles, was wir<br />
niemals geworden sind. Nur viel, viel besser.<br />
In Deutschland ist Dirk Nowitzki bekannter als das Spiel, das er<br />
spielt. Er ist berühmt, weil er berühmt ist. Seit Jahren wirbt er für eine<br />
Bank und eine Sportmarke. Er sitzt bei Wetten, dass..?. In den USA ist<br />
Nowitzki ein echter Superstar. Er gehört zu den absolut Besten einer<br />
uramerikanischen Sportart. Die eigenen Fans lieben Nowitzki, die<br />
gegnerischen fürchten ihn. Zu Recht. Journalisten und Kulturwissenschaftler<br />
schreiben über das Faszinosum Nowitzki. Angela Merkel<br />
empfängt ihn im Kanzleramt, Barack Obama empfängt ihn im Weißen<br />
Haus. Nowitzki ist der beste Europäer, der jemals das Spiel gespielt<br />
hat. Er ist der beste weiße Basketballer seiner Zeit. Er war wertvollster<br />
Spieler der Finalserie, Fahnenträger bei Olympia, Allstar,<br />
NBA-Champion. Sein Spiel hält dem immensen Sportwissen Amerikas<br />
stand – statistisch, taktisch und historisch. Mehr noch: Nowitzki<br />
hat ein amerikanisches Spiel grundlegend verändert, er hat es revolutioniert.<br />
Basketball nach Nowitzki ist anders als Basketball vor ihm:<br />
beweglicher, variabler, weniger erwartbar, feiner, raffinierter.<br />
Ich bin in Dallas, um von Nowitzkis Bedeutung und den Gründen<br />
dafür zu erzählen. Es gibt unfassbar viele Texte zu Nowitzki, es<br />
gibt Biografien, es gibt Hunderte Interviews und Porträts. Dirk Nowitzki<br />
steht in der Gala, im Goldenen Blatt und in der Super Illu. Die<br />
Geschichte, die erzählt wird, ist immer ähnlich: Ein Junge aus Würzburg<br />
wird allen Widerständen und Unwahrscheinlichkeiten zum Trotz
einer der besten Basketballer der Welt. Mit der Hilfe eines verschroben-genialischen<br />
Mentors geht er unkonventionelle Wege,<br />
trainiert in der Zurückgezogenheit einer oberfränkischen Schulturnhalle<br />
und erreicht schließlich sein großes Ziel. Es ist eine<br />
Legende, eine Heldengeschichte mit verzeihbaren Scharten.<br />
Und ich bin hier, um etwas Neues zu erzählen.<br />
Helden müssen sich schützen. Das System Nowitzki ist ein<br />
geschlossenes. Dirk und ich haben zwar gemeinsame Freunde<br />
– Mithat Demirel, seinen Zimmergenossen bei der Nationalmannschaft,<br />
und Rekordnationalspieler Patrick Femerling –,<br />
aber es gibt ungeschriebene Gesetze, und Nowitzkis Mannschafts<br />
kame ra den würden sich eher ihre Wurfhand abhacken,<br />
als seine Telefonnummer zu verraten. Es blieben die offiziellen<br />
Wege. Wenn ich erst mal in Dallas bin, so habe ich gehofft, wird<br />
das eine zum anderen führen. Die Pressechefin der Mavericks<br />
hat mir ein Interview mit ihm zugesagt. Zehn Minuten nach<br />
dem Spiel. Heute Abend.<br />
Ich habe mir Fragen notiert: nach seinen Ritualen. Nach<br />
der Langeweile des Lebens als Profisportler. Der Bedeutung<br />
seiner Hautfarbe für seine Berühmtheit, der Bedeutung von<br />
Rasse im Sport. Ob ihn manchmal Geldsorgen plagen (die Sorge,<br />
was man mit knapp zwanzig Millionen Dollar pro Jahr anfangen<br />
soll). Wie man vierzehn Jahre lang die Kon zen tra tion bei<br />
der Arbeit so unfassbar hoch hält. Ob Basketball ihm immer<br />
noch Spaß bereitet. Ob man für andere Prominente Sympathie<br />
empfindet (oder nur dasselbe Leid teilt). Ob er zur Motivation<br />
wirklich Joseph Conrads Taifun liest. Wie er seine Position in<br />
der Basketballgeschichte sieht. Wann der erste Paparazzo vor<br />
seiner Tür aufgetaucht ist. Was man denkt, wenn die Bild Polizeifotos<br />
der Exfreundin druckt oder wenn sämtliche Zeitungen<br />
über die Steuerangelegenheiten seines Mentors Holger Geschwindner<br />
berichten. Ob er so bodenständig ist, wie alle sagen.<br />
Wie oft er das alles verflucht. Was ihn am meisten schmerzt.<br />
Wem man vertrauen kann. Was echt ist und was falsch.<br />
Jetzt rase ich mit einem Taxi durch Dallas, und Haile beantwortet<br />
mir sämtliche Fragen mit Enthusiasmus. Er hat den<br />
Highway verlassen und fährt auf Schleichwegen zum American<br />
Airlines Center: Wohngebiete, Industriebrachen, Kakteen, ein<br />
ausgetrocknetes Flussbett. Parkplätze, Hochhäuser, Parkplätze.<br />
Haile weiß alles über Dirk. Wir hauen uns die großen<br />
Momente seiner Karriere um die Ohren: Haile erzählt von Indianapolis<br />
2002, Deutschlands Weltmeisterschaftsbronze, diesem<br />
unerwarteten Erfolg. Nowitzki wurde zum wertvollsten<br />
Spieler des Turniers gewählt. Ich erzähle vom Europameisterschaftsfinale<br />
2005 und wie das Publikum in der Belgrad-Arena<br />
kurz vor Ende des verlorenen Finales gegen die Griechen geschlossen<br />
aufstand und minutenlang applaudierte, als Nowitzki<br />
ausgewechselt wurde. Oder Dirk nach der verlorenen Meisterschaft<br />
2006: wie er in den Katakomben verschwindet, die Hände<br />
über dem Kopf, als habe er gerade einen Schlag in den Magen<br />
bekommen, als ringe er um Luft. Dirk Nowitzki hat in den<br />
letzten vierzehn Jahren für etliche solcher Augenblicke gesorgt.<br />
»Here we are«, sagt Haile und parkt an der Victory Lane.<br />
»The house that Dirk built.«<br />
Ein riesiges Banner zieht sich über das Eingangsportal der<br />
Arena, darauf ein brüllender Dirk und der Play-off-Schlachtruf<br />
der Mave ricks: Dallas is all in. Haile lacht sein gläubiges Lachen:<br />
»Welcome to the church of Nowitzki.« Er ist sich sicher,<br />
dass Dirk heute gewinnen wird. Er rechnet fest mit ihm. Und<br />
mir wird klar, dass ich nicht nur für ein Interview nach Dallas<br />
geflogen bin: Ich will Zeuge einer Heldentat werden. Haile öffnet<br />
mir die Tür und gibt mir seine Karte. »Ein Freund von Dirk<br />
ist ein Freund von mir«, sagt er. »Ruf mich an.«<br />
Die Plaza vor dem American Airlines Center ist bis auf ein<br />
paar Lieferwagen leer, die Sonne brennt, wie die texanische Sonne<br />
eben brennt. Vor einem klimatisierten Fanshop warten zehn,<br />
fünfzehn Verkäufer auf Kundschaft. Alle tragen blaue T-Shirts<br />
mit dem Play-off-Slogan. Eine freundliche Dame mit einem se-<br />
15
niorenblau toupierten Haarhelm führt mir das komplette Nowitzki-<br />
Sortiment vor: Es gibt Nowitzki-Trikots, -Hosen, -Hemden, es gibt<br />
Stirnbänder, Rucksäcke, Pantoffeln und Schlafanzüge, Becher, Schlüsselbänder,<br />
Base caps, Wollmützen, Panamahüte. Es gibt Dirk-Nowitzki-<br />
Bierkrüge. Außer mir ist nur noch ein Kunde hier. Er trägt ein grünes<br />
Polohemd und fotografiert zwei verloren wirkende Trikots von Nowitzkis<br />
Mannschaftskamerad Yi Jianlian. Der Mann im grünen Polohemd<br />
ist Pari Dukovic, der Fotograf dieser Geschichte. Pari sieht aus, wie<br />
man sich einen Fotografen vorstellt, drei Kameras um den Hals, eine<br />
Tasche voller Filmrollen. »This Dirk-guy is famous, right?«, sagt er<br />
und macht ein paar Bilder von Dirk-Mülleimern. Pari ist kein Sportfotograf<br />
und kennt sich mit Basketball nicht aus. Aber er will nah ran.<br />
Meist fotografiere er Mode, Politiker, Burlesque-Künstler, sagt er, am<br />
meisten interessiere ihn aber, was hinter den Bühnen passiere. Die<br />
grobkörnigen Geschichten von leuchtenden Menschen. Mich auch,<br />
sage ich. Wir geben uns die Hand, wir arbeiten jetzt zu zweit.<br />
Auf Monitoren laufen die Highlights der Meistersaison. Dirk<br />
wirft und trifft. Die Mave ricks schalten zuerst Portland aus, dann das<br />
junge Team der Oklahoma City Thunder, dann die Los Angeles Lakers<br />
mit Über-Star Kobe Bryant und schließlich die Miami Heat. Dirk<br />
verschleißt seine Verteidiger reihenweise. Gegen kleine Gegenspieler<br />
wirft er, gegen große spielt er seine Beweglichkeit aus, er ist in allen<br />
Belangen überlegen. Er hält dem Druck stand, er wächst mit ihm.<br />
Nichts hilft gegen seine Dominanz. »Außerirdisch!« – »Ridirkulous!«<br />
Immer wieder sieht man seinen einbeinigen Sprungwurf im Rückwärtsfallen,<br />
den fl a m in go fa d e - a w a y, der von keinem Gegenspieler<br />
der Welt zu verteidigen ist. Nowitzki spielt mit Fieber und gerissener<br />
Sehne im Finger. Man sieht ihn mit dem Meisterpokal, man sieht ihn<br />
mit der Trophäe für den besten Spieler der Finalserie. Das war vor einem<br />
Jahr, erkläre ich Pari, der den Bildschirm fotografiert, jetzt sind<br />
wieder Play-offs, die Mavericks spielen mit einer anderen Mannschaft<br />
und haben die ersten beiden Spiele verloren. Ein Jahr verändert alles.<br />
16<br />
»Welcome to the church of Dirk«:<br />
Nowitzki hat Dallas verändert<br />
Die Parkplätze füllen sich, die Halle wird geöffnet, und als das<br />
Spiel beginnt, stehe ich mitten in einer unfasslichen Begeisterung für<br />
Dirk, Dirk, immer wieder Dirk, aber schon im ersten Viertel lässt das<br />
Spiel selbst die Luft aus der perfekten Inszenierung. Es läuft nicht<br />
rund, auch nicht bei Nowitzki. Ich bin zu müde, um die komplexe<br />
taktische Textur dieses Spiels zu begreifen, aber ich sehe, dass die<br />
Mave ricks verlieren. Dirk wird ausgewechselt. Die zweite Halbzeit verbringe<br />
ich in der Pressebox unter dem Hallendach und sehe das Spiel<br />
außer Reichweite geraten. Die Mave ricks und ich finden keinen Zugang<br />
zum Spiel. Ich höre das frenetische Tippen der amerikanischen<br />
Journalisten um mich herum, notiere Spielstände, und als ich wieder<br />
aufsehe, ist das Spiel vorbei und verloren, 79 : 95.<br />
Pari und ich sitzen im Presseraum und warten auf Dirk, der nach<br />
jedem wichtigen Spiel vor die Journalisten treten muss. Aus dem Interview<br />
werde heute leider nichts mehr, sagt mir die Pressesprecherin,<br />
nicht nach so einer Niederlage, aber ich hätte 25, vielleicht 30 Sekunden<br />
nach der Pressekonferenz, um mich vorzustellen. Nowitzki beantwortet<br />
sämtliche Fragen in sichtlich angestrengter Höflichkeit, und als<br />
er den Presseraum frustriert verlässt, renne ich hinterher und stelle ihm<br />
im Gang – ohne mich vorzustellen – eine Frage, die zu dämlich ist, um<br />
sie hier aufzuschreiben. Nowitzki sieht mich entgeistert an, sammelt<br />
sich aber sofort wieder und unterschreibt den Basketball eines kleinen<br />
Jungen. »Good night, buddy«, sagt er. Dann ist er verschwunden.<br />
Zwei Tage später stehen die Mave ricks mit dem Rücken zur<br />
Wand – wenn sie verlieren, sind sie raus. Am frühen Morgen laufe ich<br />
zur Arena. Dirks Gesicht an der Hallenfront sieht entschlossener aus<br />
als noch vor zwei Tagen, ausgeschlafener. Unser Treffen wurde mittlerweile<br />
fünf Mal verschoben. Dirk brauche seine Kon zen tra tion,<br />
wird uns gesagt. Stattdessen spreche ich mit Busfahrern, Ticketverkäufern<br />
und Betrunkenen (jeder hier nennt ihn Dirk, mit ö). Es ist<br />
immer dasselbe: Dirk ist unglaublich, Dirk ist nett, Dirk ist einer von<br />
uns. Das Securitypersonal grüßt auf Deutsch.
Am Morgen des entscheidenden Spieltags ist Donnie Nelson<br />
unser Ersatz für Dirk. Nelson ist General Manager der<br />
Mave ricks und hat Nowitzki 1998 nach Dallas geholt. Er sitzt<br />
in seinem Büro zwischen Papierstapeln, Pokalen und Erinnerungsfotos<br />
und kommt sofort zur Sache. Ungefragt erzählt er,<br />
wie fürchterlich Dirks erstes Jahr hier war. Pfiffe von den Zuschauern,<br />
Schmähungen in den Zeitungen, ligaweiter Spott.<br />
Nelson lehnt sich zurück, er sieht an den Wänden entlang, an<br />
den Sports Illustrated-Titelseiten und Mannschaftsbildern, an<br />
den Pokalen. Plötzlich wirft er völlig ansatzlos ein glitzerndes<br />
Ding in meine Richtung. Nur mit Glück fange ich das Teil.<br />
Nelsons Lachen ist lauter als erwartet. Ich halte einen Meisterring<br />
der Mave ricks in der Hand, Gold und Diamanten, 50 000<br />
Dollar pro Stück. »Ein Test«, sagt Nelson, ich hätte gute Hände.<br />
Was Dirk denn nun wirklich für Dallas bedeutet? Nelson<br />
überlegt keine Sekunde: »Dirk hat Dallas verändert, ökonomisch<br />
und kulturell. Die Mentalität. Er verdient ein Denkmal,<br />
ganz einfach.« Donnie Nelson ist für einen kurzen Moment<br />
ernst. »Mehrere«, sagt er, »Dirk verdient mehrere Denkmäler.«<br />
Als wir die Kabine betreten, befiehlt mir Nelson, mich auf<br />
Dirks Platz zu setzen, auf Dirks riesigen Ledersessel, zwischen<br />
Dirks Socken und Schuhe. Er nimmt sein Trikot mit der 41<br />
vom Bügel und überreicht es mir feierlich. Es ist das Trikot, das<br />
Dirk heute Abend tragen wird. Dirk Nowitzkis Trikot, denke<br />
ich, überrascht von meiner eigenen Feierlichkeit.<br />
Nachmittags dann Holger Geschwindner bei Starbucks:<br />
mad professor, Genie im Flanellhemd, rätselhafter Querkopf,<br />
Entdecker Nowitzkis, Mentor, Freund und – wenn es so etwas<br />
gibt – sein Schöpfer. Vor ihm eine leere Kaffeetasse. Das Spiel<br />
heute Abend scheint ihn nicht nervös zu machen. Er sei hier,<br />
um Dirks Wurf zu korrigieren, wenn nötig. Seit Jahren benutzen<br />
sie ihre eingespielten Zeichen, »höher werfen« und »Finger<br />
auseinander«. Er sei hier, um auf seinem Platz zu sein, wenn<br />
Dirk ihn braucht.<br />
Wenn man sich mit Holger Geschwindner unterhält, ahnt<br />
man, warum Nowitzki schon so lange auf allerhöchstem Niveau<br />
spielt. Man ahnt es, aber man weiß es nicht. Er hat den jugendlichen<br />
Dirk unter seine Fittiche genommen und einen Sieben-<br />
Stufen-Plan zur Erschaffung dessen entwickelt, was Dirk heute<br />
ist. Geschwindners Methode ist ein Komplettpaket aus Mathematik,<br />
Psychologie, Bildung, Disziplin und plausiblem Aberwitz.<br />
Geschwindner war der Kapitän der Olympiamannschaft<br />
1972, hat Physik und Mathematik studiert und wohnt auf einem<br />
Schloss bei Bamberg.<br />
In Gesprächen klappt er bisweilen seinen Rechner auf.<br />
Auf dem Bildschirm bewegt sich dann ein Strichmännchen mit<br />
Dirk Nowitzkis genauen Körperproportionen. Die Winkel-<br />
und Kurvenberechnungen zeigen, wie der ideale Wurf aussieht.<br />
Es geht darum, in welchem Winkel Nowitzki werfen muss, damit<br />
er auch dann trifft, wenn er Fehler macht. Geschwindner<br />
spricht von Basketball als Jazz, von Till Brönner in der Turnhalle,<br />
von Faulkner und Froschsprüngen. Manchmal hält Geschwindner<br />
mitten im Gespräch inne, sieht ins Leere und<br />
schreibt sich einen Gedanken in sein Notizbuch.<br />
Geschwindner fordert einen heraus und will herausgefordert<br />
werden. Er ist sich nicht sicher, ob man über Nowitzki angemessen<br />
schreiben kann. Ob es schon passende Worte gibt für<br />
das, was Dirk seit Jahren tut. Man müsse da eine eigene Sprache<br />
entwickeln. Geschwindner vergleicht Dirk mit einem Extrembergsteiger<br />
und dessen körperlichen und mentalen Anforderungen,<br />
die zu erfassen konventionelle Sätze nicht ausreichen.<br />
»Wenn man mal auf einem Sechstausender war, weiß man, was<br />
das Hirn da veranstaltet«, sagt er. »Das zu beschreiben ist<br />
schwierig. Dirk befindet sich seit Jahren in sehr großen Höhen.<br />
Wer solche Erfahrungen macht, dem fehlen oft die Worte, und<br />
umgekehrt: Worte ohne Erfahrung sind meist zu wenig.«<br />
Ich sehe mich um. Die Kulisse ist beeindruckend und surreal,<br />
Kameras auf dem Spielfeld, alle sechs Ebenen plus Presse-<br />
17
und Promiboxen sind ausverkauft, geschminkte Dekolletés, das Star-<br />
Spangled Banner, dann das Two-Minute-Warning. Dallas is all in.<br />
Kurz vor dem Sprungball sehe ich Paris grünes Polohemd zwischen<br />
den Spielern herumschwirren. Die Mave ricks spielen, um die Saison<br />
und ihre Ehre zu retten, und er macht Bilder aus allernächster Nähe.<br />
Heute läuft alles über Dirk. Die Halle trägt Blau, sie schwenkt<br />
blaue Handtücher. Sie raunt, wenn er den Ball bekommt, sie brüllt,<br />
wenn er gefoult wird. Die Mavericks isolieren ihn und geben ihm den<br />
Ball, und er wird der Verantwortung gerecht. Er kann ausblenden, dass<br />
die Welt ihn beobachtet. Er liefert ein richtig gutes Spiel ab. Zu Beginn<br />
des letzten Viertels führen die Mavericks mit dreizehn Punkten,<br />
81 : 68, aber dann brechen die Dämme. Oklahoma holt Punkt um<br />
Punkt auf, und kurz vor Schluss gehen sie in Führung. Die Halle wirkt<br />
geschockt. Als Dirk eine halbe Minute vor Schluss per Freiwurf seine<br />
Punkte 33 und 34 erzielt, als der Hallensprecher ein letztes »Dööörk«<br />
durch die Halle ruft und die Uhr unaufhörlich auf das Ende der Saison<br />
zuläuft, wird es still und stiller. Es reicht nicht, Dallas scheidet aus.<br />
Auf dem Weg in die Kabine dann wieder Dirks Pose: die Arme<br />
erhoben, als müsse er sich von den Schlägen erholen. Die Presse folgt<br />
den Spielern in die Kabine, es herrscht betretenes Schweigen. Keine<br />
Fotos, keine Autogrammanfragen. Die Spieler kommen einer nach<br />
dem anderen aus der Dusche, die Pressemeute umkreist sie und stellt<br />
ihre tristen Fragen. Die Spieler tragen Handtücher mit Gummizug<br />
und ihrer Trikotnummer um die Hüften, die Meute treibt von einem<br />
zum anderen durch die Kabine. Als Dirk aus der Dusche kommt, ein<br />
gebückter Held, beißt das Rudel zu. Alle Kameras und Mikrofone auf<br />
Dirk, man kann ihn nicht sehen, aber sein Handtuch fliegt und landet<br />
im Dreckwäschetrog in der Kabinenmitte.<br />
Am Morgen die letzten Gespräche vor der Sommerpause. Die<br />
Mavericks haben das wichtigste Spiel des Jahres verloren. Trainer, Manager<br />
und Spieler treten ein letztes Mal vor die Presse, es liegt Wehmut<br />
in der Luft. Nowitzki antwortet höflich, aber ein paar Fragen klingen<br />
dringlich, als könne er die Lage noch ändern. Auch Kritik ist dabei.<br />
Dann arbeitet sich Dirk Nowitzki die Treppe hoch, ein trauriger Hei-<br />
18<br />
land in T-Shirt und Flipflops. Die Journalisten sehen ihm nach, »here<br />
goes another year of Dirk«, sagt einer.<br />
Aus der Nähe kann man Erleichterung und Erschöpfung in<br />
seinem Gesicht nicht unterscheiden. Dirk Nowitzki sitzt in der Teeküche<br />
der Mave ricks und redet, jetzt hat er Zeit. Gestern Abend hat<br />
er noch Basketball auf Weltniveau gespielt, jetzt ist Sommer. Kurz<br />
seufzt er, die Fragen der Journalisten nach seinen Knien, seinem Alter,<br />
dem Scheitern, seinem Karriereende hallen nach. »Ich mache das<br />
jetzt schon lange genug«, sagt er. »Ein paar von denen muss man<br />
runterkochen, ich gebe da kein Material.« Jemand bringt Wasser, wir<br />
wechseln ins Deutsche. Niemand hört zu. Was er gestern Abend<br />
noch gemacht habe, frage ich. »Gestern Abend habe ich mir Fast<br />
Food reingezogen«, sagt er. Er grinst. Während der Saison isst er kein<br />
rotes Fleisch, trinkt keinen Alkohol und hält sich an Fisch und<br />
Huhn. »Normalerweise wären wir weggegangen. Aber das gestern<br />
kam so schnell und abrupt, ich war einfach nicht in der Lage, noch<br />
Leute zu sehen. Also burger, fries und milkshake. Dann habe ich<br />
noch das andere Spiel gesehen, Spurs gegen Utah.«<br />
Dirk Nowitzki macht Pausen, seine Antworten sind ehrlich, aber<br />
er ist sich immer bewusst, was er zu sagen hat und welche Anekdote<br />
bei welchem Frage stel ler funktioniert. Er sagt: »Interviews und Fotoshoots<br />
und Werbedrehs sind jetzt nicht meine Lieblingsdinge.« Und:<br />
»Wenn ich in ein Restaurant gehe und alle applaudieren, ist mir das<br />
immer noch peinlich.« Wir sprechen über seine Gegensätze, über Texas<br />
und Würzburg, seine neue und seine alte Welt, wo immer noch<br />
vieles so ist wie früher, »es gibt noch den Edeka und das Sonnenstudio«.<br />
Er wohnt tatsächlich noch bei seinen Eltern, erst nach der Meisterschaft<br />
haben sie das Bad umgebaut, sodass er sich jetzt beim Zähneputzen<br />
nicht mehr bücken muss. Wir reden und reden, und<br />
irgendwann kommt die Pressefrau und ruft ihn zum nächsten Termin.<br />
Im Hintergrund hört man seine Mannschaftskollegen krakeelen, es<br />
wird ein Abschiedsbier getrunken.<br />
Um Nowitzkis Bedeutung zu verstehen, muss man weite Kreise<br />
ziehen. Ende August treffe ich Wolf Lepenies, den Soziologen, His-<br />
Der Aufwärmraum der Dallas Mavericks<br />
in den Katakomben der riesigen Arena
toriker und Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels. Berlin<br />
ist nur halb so heiß wie Dallas, aber die Fenster des Wissenschaftskollegs<br />
in Grunewald stehen sperrangelweit offen. Hinter der Villa<br />
steht ein Basketballkorb.<br />
Lepenies, Jahrgang 41, hat als junger Mann für Rot-Weiß Koblenz<br />
gespielt, Punkterekord 48 Punkte. Wie Basketball richtig zu lesen<br />
und zu verstehen ist, hat ihm der Über-Ethnologe Clifford Geertz<br />
bei den Spielen der Prince ton Tigers beigebracht. Er hat in New York<br />
Bill Bradley und die 72er-Mannschaft der Knicks bewundert, Willis<br />
Reed, Earl Monroe und Walt Frazier.<br />
Wolf Lepenies weiß also, wovon er spricht, wenn er über Basketball<br />
spricht. Er ist ein kluger, begeisterungsfähiger Mann, wir geraten<br />
direkt in enthusiastische Fachsimpelei. Lepenies erzählt, wie er Nowitzki<br />
und Geschwindner einmal beim Training zugesehen habe, 75<br />
Minuten Würfe ohne Unterlass, beeindruckend, allerbeste Schematik!<br />
»Geschwindner ist im tollsten Sinne verrückt, mir imponiert sein<br />
Denken vom Maximum her«, sagt er. »Wo unsereiner vom Durchschnitt<br />
her denkt, sind die beiden gnadenlos. Sieben Treffer von zehn<br />
Würfen heißt für sie: drei Fehlwürfe. Sie wollen zehn Treffer.«<br />
Die Meisterschaft hat Lepenies nachts am Computer verfolgt,<br />
beim letzten Spiel hat er sogar kurz vor Schluss seine Frau geweckt –<br />
das habe sie einfach sehen müssen. Danach hat er über Nowitzki geschrieben.<br />
Für Lepenies ist er weit mehr als ein Star: »Nowitzki hat<br />
Größe«, sagt er, das sei etwas grundsätzlich anderes. Lepenies bringt<br />
Pierre Bourdieu in Anschlag. Nowitzki habe ein beeindruckendes kulturelles<br />
und soziales Kapital, er sieht ihn in einer Reihe mit Fritz Walter,<br />
Max Schmeling, Uwe Seeler und Franz Beckenbauer. Ihre Niederlagen<br />
lassen uns trauern, ihre Siege empfinden wir als Gerechtigkeit.<br />
Das Gespräch treibt von Nowitzkis Größe zu seiner Bodenständigkeit,<br />
zu Begriffen wie Ehrlichkeit, Inszenierung und Authentizität<br />
– und plötzlich analysieren wir Nowitzkis Hochzeitsfoto, als wäre es<br />
Jan van Eycks Arnolfini-Hochzeit, den Schnitt des Anzugs, den de-<br />
Nowitzki gibt nach dem Spiel Interviews; das<br />
Einlaufen in die Halle vor dem Spiel (rechts)<br />
zenten Schmuck der Braut. »Vielleicht geht das jetzt zu weit bei Nowitzki«,<br />
sagt Wolf Lepenies und lacht, »aber dieses Bild ist kein Starfoto,<br />
es ist nicht nur Style. Man ahnt einen Kern, an dem man nicht<br />
rühren kann. Das ist diffus, aber da ist irgendetwas, das ›richtig‹ ist.<br />
Lauter. So etwas ist selten: Lauterkeit.« Lepenies sieht aus dem Fenster<br />
auf den Basketballkorb. Er denkt nach, er lächelt, er kehrt zum<br />
Thema zurück. »Dirk Nowitzki«, sagt Lepenies, »ist eine unserer ganz<br />
großen Sportgeschichten.«<br />
Anfang September rase ich wieder zu einer Halle, diesmal fährt<br />
Nowitzki. Wir sind auf dem Weg zum Training, morgens um neun,<br />
die Strecke vom Haus seiner Eltern zur Trainingshalle in Rattelsdorf<br />
kennt er im Schlaf, er fährt sie schon mehr als sein halbes Leben lang.<br />
»Seit achtzehn Jahren machen wir das jetzt«, sagt er, seit achtzehn Jahren<br />
fährt er von Würzburg nach Rattelsdorf, A 7, A 70. Hier ist er auf<br />
Händen durch die Halle gelaufen, auf Kästen gesprungen und herunter,<br />
zwei, zweieinhalb Stunden am Stück. »Wir haben früher trainiert<br />
wie die alten Russen.« Jetzt ist alles dosierter und routinierter. Er habe<br />
seine Lehren aus dem letzten Jahr gezogen und den Sommer durchtrainiert,<br />
»bisschen gerannt« sei er, um die Spannung zu halten. »Selbst<br />
wenn ich Pause mache, kann ich nicht mehr auf null runterfahren.« Er<br />
merke sein Alter, sagt er. »Man bezahlt dafür.«<br />
Dirk sortiert seinen Sommer. Er zählt an den Knöcheln seiner<br />
Hand ab, welcher Monat wie viele Tage hatte, er lacht, die Erinnerung<br />
an die letzten Monate scheint ihm zu gefallen. Seit unserem Treffen ist<br />
viel passiert. Zunächst Dallas, weil seine Frau in der Galerie arbeiten<br />
musste. Schon eine Woche nach dem Ausscheiden war er wieder im<br />
Kraftraum. Anfang Juli dann Feier in Kenia. Trauung in Dallas. Fest in<br />
der Karibik. Werbedreh auf Mallorca. Neues Visum. Besuch in Würzburg.<br />
»Bisschen Wimbledon geguckt«, sagt er und meint damit nicht,<br />
dass er den Fernseher angeschaltet hat.<br />
Kenia sei großartig gewesen, sagt Nowitzki. Er habe sein Telefon<br />
nur sehr selten angefasst, das endgültige Auseinanderbrechen seiner<br />
21
Meistermannschaft habe er deshalb nur durch Zufall mitbekommen.<br />
Nur wenn er reception hatte. Nowitzki stockt kurz, manchmal schleichen<br />
sich englische Brocken in sein Deutsch, aber er macht sich noch<br />
die Mühe, das zu korrigieren: Empfang! Bei Empfang hat er erfahren,<br />
dass sein Spielmacher Jason Kidd, sein Adjutant Jason Terry und sein<br />
bester Freund Brian Cardinal nicht zurückkommen werden. Aber<br />
nach vierzehn Jahren in der Liga scheint er solche Dinge ganz nüchtern<br />
zu sehen. Letzte Saison ist letzte Saison, jetzt trainiert er für das<br />
nächste Jahr. Jetzt geht wieder alles von vorne los. Wenn er über Sport<br />
redet, klingt Nowitzki manchmal wie eine Maschine. Er fährt schnell<br />
und ruhig, der Wagen riecht neu, die Strecke ist alt.<br />
Vor den Fenstern wird es Herbst, wir rauschen zwischen Pappelreihen<br />
und Gladiolenfeldern entlang, ein Hauch von Gold liegt über<br />
den Hügeln. Dirk spricht von der jungen britischen Kunst, die seine<br />
Frau ausstellt und die er manchmal nicht verstehe, vom Fliegen, das<br />
wie Busfahren sei, von den Feierlichkeiten des Sommers. Wir schweigen<br />
kurz. Jetzt wäre es an der Zeit, die konkreten Fragen zu stellen, die<br />
ich mir zurechtgelegt habe, denke ich, aber ich lasse die Gelegenheit<br />
ungenutzt verstreichen. Ich bleibe Beifahrer, wir unterhalten uns gut.<br />
»Wir haben während Olympia geheiratet«, sagt Dirk, »wir haben Bolt<br />
und Basketball verpasst.«<br />
Kurz hinter dem Ortsschild Rattelsdorf biegt Nowitzki ab und<br />
parkt vor einer Turnhalle, wie es sie überall in Deutschland gibt. Jetzt<br />
am Vormittag ist der Parkplatz fast leer, ein paar Fahrräder, ein einzelner<br />
Pkw. Eine Frau mit Hund und Zigarette nickt uns zu. Keine Kameras,<br />
niemand. »Ich habe diesen Sommer fast drei Monate keinen<br />
Ball in der Hand gehabt«, sagt Dirk und nimmt einen völlig abgewetzten<br />
Lederball aus dem Kofferraum. »Das Teil ist elf Jahre alt, ich<br />
habe seit 2001 jeden Sommer damit trainiert.«<br />
Als wir das Spielfeld betreten, ist Geschwindner längst da. Kunststoffboden,<br />
kein Parkett. Er trainiert ein paar Zwölf- und Dreizehnjährige,<br />
zwei Väter sehen zu. Die Jungs drehen genau die Pirouetten,<br />
machen genau die Ausfallschritte, wirbeln den Ball genauso um ihren<br />
Körper, wie man es von Nowitzki kennt. Bei einigen sieht das wie<br />
22<br />
Stolpern aus, bei anderen ist es ein Tanz. »Wickel«, ruft Geschwindner,<br />
»Innendrehung«, die Anfänge einer Sprache, die er und Nowitzki<br />
seit Jahren sprechen. Die Jungs bemühen sich, Dirk zu ignorieren, als<br />
er seine Schuhe schnürt, aber als er mit staksigen Schritten das Spielfeld<br />
betritt und langsam zu werfen beginnt, wird es still in der Halle.<br />
Die Jungs sehen ihm zu, man sieht ihre Gedanken rasen. Ich notiere<br />
das Wort »andächtig«. Nowitzki wirft und wirft und trifft die ersten<br />
21 Würfe. Wir alle zählen mit.<br />
Wenn Nowitzki und Geschwindner trainieren, herrscht Schweigen.<br />
Die beiden haben diese Laufwege und Übungen in den letzten<br />
Jahren, Jahrzehnten so oft absolviert, dass fast keine Worte nötig sind.<br />
Ein Rennpferd und sein Trainer. Dirk wirft, Holger passt. Holger<br />
nickt, Dirk versteht. Wir beobachten ein Ritual, das Geräusch des<br />
ur alten Basketballs ist ein Mantra, swish, swish, immer wieder. Dirk<br />
wird schneller und schneller, springt höher, trifft besser, die Kon zentra<br />
tion füllt die Halle.<br />
Keiner von uns ist jemals so gut gewesen, und keiner von uns<br />
wird es jemals werden.<br />
Die Wahrheit über Dirk Nowitzki liegt in seinem Kofferraum:<br />
der ur alte Basketball, millionenfach geworfen und gedribbelt, fast<br />
schwarz vor Schweiß und Hallenstaub. Wenn man diesen Ball in den<br />
Händen hat, wird einem klar, warum Dirk Nowitzki ein so unfassbar<br />
guter Basketballspieler geworden ist.<br />
Dirk Nowitzki hat alles, was andere Spieler zum Aufhören, zur<br />
Sta gna tion verleitet: Geld, Ruhm, Auszeichnungen. Interviews, Interviews,<br />
Interviews. »Aber diese Sachen haben mich nie interessiert«,<br />
sagt er, und wenn man ihn trainieren sieht, glaubt man ihm. Man<br />
glaubt der Geschichte vom bescheidenen Superstar, man glaubt an<br />
Bodenständigkeit, an Kon zen tra tion, man glaubt an die Kraft der<br />
Normalität, sogar an Gerechtigkeit. Die Jungs in den Turnhallen<br />
wollen werden wie er. »Ich wollte immer Basketballspieler sein«, sagt<br />
er, »einer der besten.«<br />
Wahrscheinlich muss ich gar nichts Neues über Dirk Nowitzki<br />
sagen: Er ist wie wir. Nur viel, viel besser.<br />
zeitmagazin<br />
nr . <strong>39</strong><br />
Vor einem Play-off-Spiel versammeln sich<br />
die Mannschaftskollegen um Nowitzki
24<br />
STEFAN KLEINS WISSENSCHAFTSGESPRÄCHE<br />
Folge 20<br />
»Schon Einjährige<br />
betreiben Statistik«<br />
Kreativ, wach, neugierig: Für die Entwicklungspsychologin<br />
Alison Gopnik sind Kinder Genies und Vorbilder<br />
Auch für Farben haben Kinder viel Gefühl: »Krokodil« von Oda, 5 Jahre
IHREN WEG vom Kind zum Erwachsenen<br />
sehen die meisten Menschen als Fortschritt,<br />
für Alison Gopnik ist es auch die Geschichte<br />
eines Verlusts. Sie vergleicht Kinder<br />
mit Schmetterlingen, aus denen Raupen werden<br />
– wo unser Verstand einst das Fliegen beherrschte,<br />
krabbelt er heute auf dem Boden<br />
dahin. Was ist mit uns geschehen? Seit drei<br />
Jahrzehnten spürt die amerikanische Entwicklungspsychologin<br />
Gopnik dem kindlichen<br />
Denken nach. Ratschläge für Eltern, Lehrer<br />
oder auch für die Vorstände, die ihr 2010 auf<br />
dem Davoser Weltwirtschaftsforum zuhörten,<br />
sieht sie allerdings nur als Nebenprodukt ihrer<br />
Forschung. Sie will das menschliche Leben als<br />
Ganzes verstehen: An der University of California<br />
in Berkeley hat sie je eine Professur für<br />
Psychologie und Philosophie. Wir treffen uns<br />
in ihrem alten Holzhaus, einen Steinwurf vom<br />
Campus entfernt. Seit dem Auszug ihrer drei<br />
Söhne sei es ungewohnt still hier, sagt Gopnik.<br />
Für den Nachmittag ist der Besuch des vier<br />
Monate alten ersten Enkelsohns angekündigt.<br />
Frau Gopnik, möchten Sie wieder ein<br />
Kind sein?<br />
Ich hatte eine sehr erfüllte Kindheit. Und eine<br />
Woche lang würde ich gerne die Welt noch<br />
einmal durch die Augen einer Dreijährigen<br />
sehen. Das würde meine Arbeit erleichtern.<br />
Stefan Klein,<br />
geboren 1965, ist Biophysiker. Der<br />
Wissen schaft sautor hat den Bestseller<br />
»Die Glücksformel« geschrieben, der<br />
jetzt als erweiterte Neuausgabe erscheint.<br />
In seinem Buch »Der Sinn des Gebens«,<br />
erschienen im S. Fischer Verlag, untersuchte<br />
Klein den Ursprung von Gut und Böse<br />
Alison Gopnik,<br />
geboren 1955, ist Entwicklungspsychologin.<br />
In ihren Untersuchungen hat sie sich<br />
intensiv mit dem Lernverhalten von Kindern<br />
beschäftigt. Zuletzt erschien von ihr auf<br />
Deutsch »Kleine Philosophen: Was wir von<br />
unseren Kindern über Liebe, Wahrheit<br />
und den Sinn des Lebens lernen können«<br />
Aber auf Dauer? Ich glaube nicht, dass ich<br />
diese intensiven Gefühle aushalten könnte.<br />
Stellen Sie sich vor, Sie erleben zum ersten<br />
Mal Paris, sind dabei von einer unglücklichen<br />
Liebesaffäre gequält, haben außerdem gerade<br />
eine Schachtel Gauloises weggeraucht und<br />
drei Espressi getrunken – so ist es, ein Baby zu<br />
sein. Wir können das aus Hirnuntersuchungen<br />
schließen. Mir kommt dieser Zustand<br />
ziemlich anstrengend vor.<br />
Wieso nennen Sie eine Dreijährige Baby?<br />
Ein Baby ist für mich jeder mit Pausbäckchen<br />
und einer drolligen Aussprache – also alle<br />
unter fünf. Im Englischen gibt es für diese<br />
Lebensphase kein eigenes Wort.<br />
Auf Deutsch sagen wir Kleinkind.<br />
Da ist Ihre Sprache im Vorteil. Andererseits<br />
trifft »Baby« unsere Empfindungen für diese<br />
kleinen Wesen sehr gut – unsere besondere<br />
Zuneigung, unsere Sorge um sie. Darum nennen<br />
wir ja auch Erwachsene, die wir besonders<br />
zärtlich lieben, Baby.<br />
Mein zweijähriger Sohn und meine vierjährige<br />
Tochter wären darüber empört! Als<br />
Baby bezeichnen sie abfällig jedes Kind,<br />
das auch nur ein halbes Jahr jünger ist als<br />
sie selbst.<br />
Sicher. Viele der beliebtesten Kindergeschichten<br />
handeln von der Sehnsucht, ohne Erwachsene<br />
allein durch die Welt zu gehen.<br />
Wie Pippi Langstrumpf oder Mogli im<br />
Dschungel.<br />
Sie wollen unabhängig sein, ihrer Kindheit<br />
entfliehen. Erst als Erwachsene leisten wir uns<br />
den Luxus, diese Zeit zu verklären.<br />
Dabei können wir nicht einmal mehr in<br />
unserer Vorstellung dorthin gelangen,<br />
schreiben Sie: Kinder und Erwachsene<br />
seien so verschieden, als gäbe es zwei Erscheinungsformen<br />
der Art Mensch. Wie<br />
kommen Sie darauf?<br />
Viele halten Kinder für fehlerhafte Erwachsene.<br />
So sehen es Lehrer, Hirnforscher, Philosophen.<br />
Selbst Jean Piaget, der große Pionier<br />
der Entwicklungspsychologie, der als Erster<br />
den kindlichen Verstand ernst nahm, beschrieb<br />
vor allem ihre Defekte – nicht das,<br />
was Kinder uns voraushaben. Weit wahrscheinlicher<br />
ist es allerdings, dass die Natur in<br />
jeder Lebensphase bestimmte Schwächen als<br />
Preis für besondere Stärken in Kauf nimmt.<br />
Daher die Unterschiede. Raupen sind auch<br />
keine Schmetterlinge mit Mängeln.<br />
Unsere Kinder ähneln uns immerhin.<br />
Äußerlich. Aber warum macht Entwicklungspsychologie<br />
so viel Spaß? Weil es keine Marsmenschen<br />
gibt. Das Nächstbeste, wenn Sie<br />
eine fremdartige Intelligenz untersuchen wollen,<br />
sind diese Wesen mit kleinen Körpern<br />
und großen Köpfen. Bei einem Zweijährigen<br />
ist buchstäblich alles anders, als man es vermutet.<br />
Und diese Aliens kontrollieren uns –<br />
oft ohne dass wir es merken.<br />
Überraschenderweise behaupten Sie, dass<br />
Kinder bewusster seien als Erwachsene.<br />
Was genau meinen Sie damit?<br />
Nach Ansicht der Philosophen gibt es verschiedene<br />
Arten von Bewusstsein – eine<br />
Aufmerksamkeit für den eigenen inneren<br />
Zustand und eine für die Außenwelt. Das<br />
Erste ist das, was Descartes mit seinem »Ich<br />
denke, also bin ich« im Sinn hatte. Wer sich<br />
allerdings ganz seinen Gedanken und Gefühlen<br />
hingibt, blendet die Umgebung vollständig<br />
aus. Wenn ich in meine Arbeit vertieft<br />
war, machten sich meine Kinder einen<br />
Spaß daraus, Dinge zu rufen wie: »Mama,<br />
da ist ein Puma im Garten!« Dann freuten<br />
sie sich, von mir »Geht in Ordnung, Schatz«<br />
zu hören. Ich hatte gar nicht wahrgenommen,<br />
was sie erzählten.<br />
Die sprichwörtliche Geistesabwesenheit<br />
des Professors.<br />
Dennoch halten wir dies für die höchste Form<br />
von Bewusstsein. Oder aber man ist im Gegenteil<br />
völlig von seiner Umwelt gebannt und<br />
verzichtet dafür auf das innere Geschwätz und<br />
die Beschäftigung mit sich selbst. Das tun Babys.<br />
Ist das nun mehr oder weniger Bewusstsein?<br />
Ich glaube, es handelt sich zumindest um<br />
einen Zustand größerer Wachheit.<br />
Im Zoo entdeckt meine vierjährige Tochter<br />
jedes noch so perfekt getarnte Reptil.<br />
Ihre achtjährige, etwas verträumte Schwester<br />
dagegen sieht nur ein leeres Terrarium.<br />
Vielleicht liegt es nicht am unter schiedlichen<br />
Charakter der beiden Mädchen,<br />
sondern an ihrem Alter.<br />
Dass die Kleinen mehr erkennen, zeigen<br />
nicht nur Experimente – auch ein Kaufhausdetektiv<br />
erzählte es mir. Er überwacht<br />
sein Geschäft von einem Balkon aus, wo<br />
kein Erwachsener ihn wahrnimmt. Doch<br />
die Kinder unter fünf winken ihm zu. Hier<br />
haben Sie ein Beispiel dafür, wie viel Kinder<br />
uns lehren können. Leider denkt der typische<br />
Philosoph noch immer allein im Lehnstuhl<br />
über seinen Geist nach. Dabei entgeht<br />
ihm der Reichtum an Bewusstseinszuständen<br />
in anderen Wesen.<br />
Nur wollen die meisten Menschen vor allem<br />
etwas über sich selbst erfahren. Wenn<br />
aber Kinder ganz anders als Erwachsene<br />
wahrnehmen, denken und fühlen, können<br />
sie dann wirklich dazu beitragen, die Rätsel<br />
unseres Geistes zu lösen?<br />
Biologen erkennen zunehmend, dass man einen<br />
Organismus nur verstehen kann, wenn<br />
man die Phasen seiner Entwicklung kennt.<br />
Ich glaube, für unseren Geist gilt dasselbe.<br />
Wie viel Kenntnis der Welt ist uns angeboren?<br />
Was mussten wir erst lernen? Woher kommt<br />
unser moralisches Empfinden? Solche Fragen<br />
lassen sich nur beantworten, wenn wir unsere<br />
Kindheit verstehen.<br />
Die Frage, ob es so etwas gibt wie angeborenes<br />
Wissen, ist uralt. Schon die Philosophen<br />
der griechischen Antike dachten darüber<br />
nach.<br />
Inzwischen ist klar, dass Babys wahre Meister<br />
darin sind, Zusammenhänge zu erschließen.<br />
Schon Einjährige betreiben so etwas wie eine<br />
unbewusste Statistik: Sie können häufige von<br />
seltenen Ereignissen unterscheiden und daraus<br />
Regeln ableiten. Und Dreijährige haben<br />
bereits eine Vorstellung von Ursache und<br />
26 Foto Daniel Schumann
»Frosch fängt Fliege« von Sarah, 6 Jahre<br />
27
Wirkung. Die gewinnen sie, indem sie mit<br />
allem, was sie in die Finger bekommen, herumspielen.<br />
Demnach wäre kein Wissen angeboren –<br />
wohl aber wären es Regeln, wie wir Erfahrungen<br />
ordnen. Was immer uns begegnet,<br />
versuchen wir in ein unbewusstes Schema<br />
von Wahrscheinlichkeiten, Ursache und<br />
Wirkung zu pressen. Was nicht in den<br />
Rahmen passt, bleibt uns verborgen: Immanuel<br />
Kant hat im 17. Jahrhundert genau<br />
das vermutet.<br />
Ja, aber die Kategorien sind nicht starr. Ein<br />
neun Monate altes Baby versteht Wahrscheinlichkeiten<br />
anders als mit 18 Monaten oder als<br />
ein Erwachsener. Im Grunde erforschen Kinder<br />
die Welt, wie Wissenschaftler es tun: Ihre<br />
Theorien verändern sich ständig.<br />
Sehr tröstlich, zu wissen, dass wir einem<br />
Forschungsprojekt beiwohnen, wenn die<br />
Kinder wieder einmal das Haus verwüsten.<br />
Aber konnten Sie als Mutter dreier<br />
Jungen aus solch philosophischer Warte<br />
die Ruhe bewahren?<br />
28<br />
Ich bin sowieso geistesabwesend und desorganisiert.<br />
Das machte es leicht, mit kleinen<br />
Kindern zu leben, während ich gleichzeitig<br />
meine wissenschaftliche Karriere voranzubringen<br />
versuchte. Ich fand das Chaos um<br />
mich herum ganz natürlich. Deutschen mag<br />
das schwererfallen.<br />
Nun ja.<br />
Ein Vorurteil, ich weiß. Aber tatsächlich ist<br />
das Spiel der Kinder höchst rational. Wir<br />
wissen heute, dass ein wenig Unordnung oft<br />
zu besseren Lernergebnissen führt als planvolles<br />
Vorgehen. Wildes Herumprobieren<br />
bewährt sich umso besser, je weniger man<br />
über ein Problem weiß. Kinder und Wissenschaftler<br />
werden dadurch schneller klug als<br />
mit durchdachten Experimenten. Darum<br />
ähnelt der Verstand in den ersten Jahren einer<br />
Laterne – er beleuchtet alles, was ihm<br />
begegnet. Sein einziges Ziel ist es, möglichst<br />
viel über die Welt herauszufinden. Später<br />
dagegen, wenn wir Ergebnisse bringen müssen,<br />
ist die Aufmerksamkeit wie ein Scheinwerfer<br />
gebündelt.<br />
»Feuerdrache« von Leopold, 7 Jahre<br />
Mich erinnert die kindliche Denkweise an<br />
Leonardo da Vinci, der sich von Malerei<br />
über Wasserbau bis hin zur Konstruktion<br />
von Flugmaschinen stets mit einem Dutzend<br />
vertrackter Probleme gleichzeitig<br />
befasste – allerdings die wenigsten seiner<br />
Erkenntnisse praktisch umsetzen konnte.<br />
Steckt in jedem Kind ein Leonardo?<br />
Unbedingt. Wir hören heute andauernd, wie<br />
wichtig es sei, Kinder Konzentration zu lehren.<br />
Allerdings geht Impulskontrolle auf<br />
Kosten der Kreativität. Wir wissen das aus<br />
Untersuchungen an Jazzmusikern. Beim Improvisieren<br />
funktionieren deren Gehirne ganz<br />
anders als beim Spielen vom Blatt: Die Zentren,<br />
die die Aufmerksamkeit fokussieren,<br />
sind heruntergeregelt. Menschen konnten<br />
nur deswegen so viel entdecken, weil ihr Verstand<br />
in der Kindheit diese lange unkontrollierte<br />
Phase durchläuft.<br />
Wann verlieren wir den weiten Blick auf<br />
die Welt?<br />
Das beginnt mit etwa fünf Jahren. Nicht zufällig<br />
ist das meist die Zeit der Einschulung.
Im Klassenzimmer werden die Kinder<br />
auf zielgerichtetes Denken trainiert.<br />
Über Leonardo sagt man oft, er sei ein<br />
Genie gewesen, obwohl er kaum vier<br />
Jahre lang die Schule besuchte und nicht<br />
einmal das Bruchrechnen lernte. Aber<br />
möglicherweise war genau das sein<br />
Glück – er konnte sich sein kindliches<br />
Denken erhalten!<br />
Ich habe ein paarmal in Forschungszentren<br />
vor hochrangigen Physikern geredet. Ich<br />
erklärte ihnen, dass Wissenschaftler große<br />
Kinder sind.<br />
Wie fanden die Physiker das?<br />
Sie stimmten zu. Aber natürlich kann nicht<br />
jeder ein Peter Pan sein. Wir brauchen auch<br />
Menschen, die zielorientiert denken.<br />
Allerdings gibt unsere Kultur den Ergebnissen<br />
Vorrang. Mir scheint, dass<br />
mehr wildes kindliches Denken wohltuend<br />
und sogar nützlich sein könnte.<br />
Nicht um die Zielstrebigkeit zu ersetzen,<br />
sondern um sie zu ergänzen.<br />
Nur müssen sich die meisten Erwachsenen<br />
sehr anstrengen, das Laternenbewusstsein<br />
zu erreichen. Bestimmte Formen der Meditation<br />
können es fördern. Reisen, auf denen<br />
wir ziellos Entdeckungen machen, auch<br />
Sabbatjahre. Kinder dagegen befinden sich<br />
ganz natürlich in diesem Zustand.<br />
Wenn wir ihnen den nicht austreiben.<br />
Darum hege ich gegenüber der sogenannten<br />
Frühförderung auch gemischte Gefühle.<br />
Sie kann viel Gutes bei Kindern bewirken,<br />
die zu Hause wenig Anregung<br />
bekommen. Doch der gegenwärtige Druck<br />
auf die Kindergärten, Unterricht anzubieten,<br />
ist gefährlich.<br />
Meist geht er von Eltern aus, die ihren<br />
Nachwuchs schon vor dem ersten Schultag<br />
lesen oder akzentfrei Mandarin sprechen<br />
hören wollen.<br />
Eine New Yorker Mutter hat kürzlich eine<br />
Vorschule verklagt. Sie fand, dass ihre<br />
Dreijährige dort zu viel spielte und nicht<br />
genug auf das College vorbereitet wurde!<br />
Und dann wundern wir Professoren uns<br />
über Studenten, die hart arbeiten – aber<br />
leider nur über das nachdenken, was in der<br />
Prüfung abgefragt wird. Nun, genau diese<br />
jungen Leute haben wir uns ausgesucht.<br />
Besser würden wir Jugendliche begünstigen,<br />
die uns erklären, dass sie in einer<br />
wichtigen Prüfung leider durchgefallen<br />
sind, weil sie in der Nacht zuvor bis zum<br />
Morgengrauen über den Sinn des Lebens<br />
diskutiert haben. Denn das ist die Haltung,<br />
die Philosophie und Wissenschaft<br />
hervorgebracht hat.<br />
Ironischerweise bewirken viele ehrgeizige<br />
Eltern genau das Gegenteil von dem, was<br />
sie wollen – eigentlich möchten sie ja<br />
kluge Kinder.<br />
So ist es. Kinder haben ein erstaunliches<br />
Sensorium dafür, ob Erwachsene eine Sache<br />
nur tun, um sie zu belehren. In einer<br />
Serie von Experimenten probierte meine<br />
Kollegin Laura Schulz vor den Augen ei-<br />
ner Gruppe von Vierjährigen an einem<br />
ziemlich komplizierten elektronischen<br />
Spielzeug herum. Allein gelassen, fanden<br />
die Kinder bald selbst alles heraus, was<br />
dieses Ding konnte. Anderen Jungen und<br />
Mädchen gleichen Alters zeigte Schulz<br />
gezielt ein paar Funktionen des Spielzeugs.<br />
Doch als sie ging, wiederholten<br />
diese Kinder nur das wenige, was sie ihnen<br />
vorgeführt hatte.<br />
Was die Kinder im Spiel lernen, lässt<br />
sich weder vorhersehen noch kontrollieren.<br />
Offenbar mangelt es den ehrgeizigen<br />
Eltern an Vertrauen in die Lernfähig<br />
keit ihrer Kleinen.<br />
Das Problem liegt noch tiefer: Früher war<br />
es selbstverständlich, den Umgang mit Kindern<br />
an seinen Geschwistern, Cousins und<br />
Nichten zu üben. Doch die Großfamilie ist<br />
dahin. So sind wir vermutlich die erste Generation<br />
von Eltern, die intensiver mit Kindern<br />
zu tun haben, wenn sie selbst welche<br />
in die Welt setzen. Das erzeugt eine gewaltige<br />
Verunsicherung. Hingegen ist uns das<br />
zielstrebige Handeln aus der Ausbildung<br />
und aus dem Beruf sehr vertraut. Dieses<br />
Modell versuchen wir nun auf das Familienleben<br />
zu übertragen.<br />
Und scheitern ...<br />
... weil Erziehung eben keine zielorientierte<br />
Tätigkeit ist.<br />
Wirklich? Ich will schon, dass meine<br />
Kinder den Weg in ein erfülltes Erwachsenenleben<br />
finden – auch wenn ich<br />
nicht weiß, was das für sie genau heißt.<br />
Eben. Trotzdem quälen sich gerade Mittelschichteltern<br />
mit Fragen wie: Tue ich<br />
das Richtige? Was kommt dabei heraus?<br />
Was wird er mit 30 seinem Psychotherapeuten<br />
erzählen? Dabei kommt es oft gar<br />
nicht so sehr darauf an, was wir unseren<br />
Kindern beibringen. Entscheidend ist<br />
vielmehr, ihnen einen geschützten Raum<br />
zu geben, in dem sie selbst ihre Erkundungen<br />
machen können. Der andere Weg<br />
ist also, zu erleben, was es bedeutet, ein<br />
Kind zu sein – und zu verstehen, was das<br />
Kind jetzt braucht ...<br />
... was uns die Entwicklungspsychologie<br />
leider auch nicht verrät. Denn Sie und<br />
Ihre Kollegen beschreiben die Fiktion<br />
eines durchschnittlichen Kindes von<br />
drei oder fünf Jahren – wo doch in<br />
Wirklichkeit jedes seine eigene Persönlichkeit<br />
hat.<br />
Wir verstehen noch nicht, woher die Unterschiede<br />
kommen. Ich vermute, dass<br />
sich bestimmte Neigungen der Kinder<br />
mit der Zeit von selbst immer weiter verstärken.<br />
Am Anfang können winzige, beispielsweise<br />
genetisch bedingte Abweichungen<br />
stehen – ein Kind macht lieber<br />
weiträumigere, ein anderes etwas feinere<br />
Bewegungen. Die Kinder wählen sich<br />
dann selbst eine Umgebung, die diesem<br />
Naturell entspricht.<br />
So wird der eine im Fußball, der andere<br />
im Zeichnen immer besser.
Und die Reaktionen der Eltern und Erzieher<br />
verstärken diese Vorlieben weiter. Auch viele<br />
Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen<br />
lassen sich so erklären.<br />
Ich gestehe, dass ich Frauen ausgesprochen<br />
anziehend finde, wenn sie mit Schlagbohrmaschinen<br />
hantieren. Aber trotz aller Bemühungen<br />
haben mir meine Töchter nie<br />
die Freude gemacht, sich für Technik zu interessieren.<br />
Mein Sohn hingegen geriet<br />
schon mit einem Jahr in Erregung, sobald er<br />
mich zu einem Schraubenzieher greifen sah.<br />
Gerade für Eltern, die Geschlechterrollen<br />
durchbrechen wollen, ist es oft zum Verzweifeln.<br />
Dass Testosteron Männer zu Elektrowerkzeugen<br />
hinziehen könnte, ist natürlich<br />
absurd. Sehr wohl aber kann dieses Hormon<br />
in Jungen einen Hang zu ausladenden Bewegungen<br />
bewirken. Papa ist dann für sie interessanter,<br />
wenn er werkelt, als am Schreibtisch.<br />
Und indem der Kleine das imitiert und selbst<br />
immer geschickter mit Werkzeugen umgeht,<br />
verstärkt sich der anfänglich kleine Unterschied<br />
zu seinen Schwestern.<br />
30<br />
»Besuch für die Kuh« von Rosa, 6 Jahre<br />
Demnach wäre es grundsätzlich unmöglich,<br />
den Einfluss der Gene von dem der<br />
Umwelt zu trennen.<br />
Weil Menschen ihre Umwelt ständig verändern,<br />
können wir nie wissen, welchen Effekt<br />
bestimmte Anlagen haben. Ein anderes gutes<br />
Beispiel ist die Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung<br />
ADHS ...<br />
... das sogenannte Zappelphilipp-Syndrom.<br />
Hunderttausende Kinder in<br />
Deutschland bekommen dagegen täglich<br />
Ritalin.<br />
ADHS hat genetische Ursachen. Doch für<br />
unsere fernen Vorfahren spielten sie überhaupt<br />
keine Rolle. Wenn überhaupt, dann<br />
waren hyperaktive Menschen bessere Jäger.<br />
Aber wenn Sie Kinder mit diesen Anlagen in<br />
eine Schule setzen, haben Sie ein Problem.<br />
Und schon spricht man von einer genetisch<br />
bedingten Krankheit. Dabei gibt es die Umgebung<br />
Klassenzimmer, in der ADHS erst<br />
auftritt, gerade einmal seit 100 Jahren.<br />
Ritalin gibt uns die Möglichkeit, diese<br />
Kinder der Schule anzupassen.<br />
Vor allem ihren Eltern. Denn die kommen<br />
eindeutig mit hyperaktiven Kindern unter<br />
Ritalin besser zurecht. Hingegen fehlt bisher<br />
der Nachweis, dass sich dieses Medikament<br />
positiver auf den Schul erfolg auswirkt als beispielsweise<br />
eine Verhaltenstherapie.<br />
Andererseits kann ich Eltern verstehen,<br />
die ihrem Kind die Pille verschreiben<br />
lassen, weil sie fürchten, dass ein völlig<br />
unkonzentriertes Kind in der Schule für<br />
immer den Anschluss verliert.<br />
Nur schlucken hier in den USA schon Dreijährige<br />
Ritalin – das ist Wahnsinn. Doch gewiss<br />
gibt es Fälle, in denen man zu jedem<br />
Mittel greifen muss.<br />
Zumal die Eltern auch keine unendliche<br />
Kapazität haben, ihr Kind zu unterstützen.<br />
Schon unter normalen Umständen<br />
brauchen Kinder oft mehr, als wir ihnen<br />
geben können. Das ist für mich die<br />
schmerzliche Seite daran, Vater zu sein.<br />
Elternschaft stellt uns im Alltag vor einige der<br />
tiefsten moralischen Dilemmata, die es überhaupt<br />
gibt. Auch dies macht unser Verhältnis
zu Kindern philosophisch so interessant. In<br />
keiner anderen menschlichen Beziehung<br />
sorgen wir auch nur annähernd so viel für<br />
den anderen. Ich liebe meinen Mann und<br />
versuche, ihm eine gute Ehefrau zu sein.<br />
Also koche ich für ihn und höre ihm zu.<br />
Aber wenn ich nur das für ein Baby tun<br />
würde, wäre es Kindesmisshandlung. Dabei<br />
bemerken die Kinder unsere Opfer nicht<br />
einmal. Wenn sie die ständige Fürsorge als<br />
etwas Besonderes wahrnehmen, ist das sogar<br />
ein Alarmsignal.<br />
Daher dieses Gefühl, dass wir als Mütter<br />
und Väter nie gut genug sind, dass wir<br />
unserem Kind immer noch etwas mehr<br />
schulden. Verlangt Elternschaft Unmögliches<br />
von uns?<br />
Jemanden, der so viel für Fremde tut wie<br />
wir alle für unsere Kinder, würde man einen<br />
Heiligen nennen ...<br />
... aufgrund seiner Selbstlosigkeit, nicht<br />
weil er Wunder vollbringt.<br />
Sicher, ich bin eine jüdische Atheistin. Allerdings<br />
glaube ich, das Leben mit einem<br />
Dreijährigen ist tatsächlich ein schneller<br />
Weg, ein gewisses Maß an Heiligkeit zu<br />
erreichen.<br />
Ich spüre davon an mir nicht viel.<br />
Das tun selbst große Heilige selten. Was die<br />
Schuldgefühle angeht: Für gute Amerikaner<br />
gehört es sich nicht, welche zu haben.<br />
Ich allerdings fürchte, dass sie eine völlig<br />
angemessene Reaktion auf unsere enorme<br />
Verantwortung als Eltern sind.<br />
Feministinnen werden von solchen Gedanken<br />
wenig angetan sein. Jahrzehntelang<br />
haben die Frauen zu lernen versucht,<br />
sich nicht immer nur in den<br />
Dienst anderer zu stellen – und jetzt<br />
kommen Sie mit angemessenen Schuldgefühlen<br />
und Heiligkeit!<br />
Feminismus hat zwei Seiten: Neben dem<br />
Kampf gegen die Unterdrückung ging es<br />
immer auch darum, die weiblichen Erfahrungen<br />
ernst zu nehmen. Frauen haben ja<br />
nicht die letzten 10 000 Jahre lang Däumchen<br />
gedreht, sie haben die ganze Erdbevölkerung<br />
großgezogen. Die Einsichten, die sie<br />
dabei gewannen, sind genauso wertvoll wie<br />
die Überlieferung der meist alleinstehenden<br />
männlichen Philosophen und Theologen.<br />
Genau darum habe ich meinen Ausflug in<br />
die Entwicklungspsychologie gemacht: Ich<br />
wollte helfen, der Philosophie eine Sichtweise<br />
zu öffnen, für die sie zu lange blind<br />
war. Es entsprach mir – als Älteste von sechs<br />
Geschwistern habe ich in meinem ganzen<br />
Leben nur drei Jahre verbracht, ohne mich<br />
um kleine Kinder zu kümmern.<br />
Welche Frage trieb Sie um, dass Sie eine<br />
Antwort in der Philosophie suchten?<br />
Woher unsere Weltkenntnis kommt. Gemessen<br />
daran, wie wenig Informationen<br />
wir über die Sinne erhalten, wissen wir unglaublich<br />
viel. Das ist für mich noch immer<br />
das Rätsel aller Rätsel. Schon Platon wunderte<br />
sich darüber. Ich las ihn zum ersten<br />
Mal mit zehn Jahren.<br />
Haben Sie ihn verstanden?<br />
Meine Eltern hätten nie gesagt, dass wir<br />
Kinder einen Philosophen nicht verstehen<br />
können. Sie gaben uns jedes Buch, weil sie<br />
vernünftigerweise dachten, dass wir die uns<br />
zugänglichen Teile schon heraussuchen<br />
würden. Übrigens haben mir viele Philosophen<br />
erzählt, dass sie in diesem Alter oder<br />
etwas später mit Platon anfingen.<br />
Weil er so wundervoll und anschaulich<br />
schreibt.<br />
Und zwischen dem achten und zehnten<br />
Lebensjahr beginnen Kinder typischerweise,<br />
theologische Fragen zu stellen. Etwa:<br />
»Wie ist alles entstanden?« Wie Untersuchungen<br />
zeigen, machen sie sich solche<br />
Gedanken sogar, wenn sie in einer atheistischen<br />
Umgebung aufwachsen.<br />
Ja, selbst unsere Berliner Kinder fragen<br />
nach Gott. Allerdings erscheint mir Ihr<br />
Beispiel nicht besonders theologisch.<br />
Aber die Antworten, die Kinder spontan<br />
darauf geben, sind es. Etwa: »Jemand<br />
muss das Universum gemacht haben.« Sie<br />
folgen aus einer natürlichen Entwicklung.<br />
Schon dreijährige Babys fragen sich sehr<br />
grundsätzliche Dinge. Etwa wollen sie<br />
wissen, was im Kopf eines anderen Menschen<br />
vorgeht und warum er tut, was er<br />
tut. So ist es normal, dass Kinder im Lauf<br />
der Zeit immer umfassendere Erklärungen<br />
suchen – bis sie irgendwann überlegen,<br />
ob vielleicht die ganze Welt einen<br />
Zweck haben könnte.<br />
Ich weiß, dass ich mir solche Fragen gegen<br />
Ende meiner Grundschulzeit stellte.<br />
Aber mir fehlt jede Erinnerung, wie es<br />
dazu kam. Die eigene Kindheit kommt<br />
mir vor wie ein Traum nach dem Erwachen:<br />
Einige Szenen ziehen wir mühsam<br />
aus dem Gedächtnis hervor. Aber je weiter<br />
wir zurückgehen, umso mehr liegt im<br />
Dunkel. Als wäre der ganze Reichtum der<br />
frühen Jahre für immer verloren.<br />
Wir wissen nicht einmal, warum es so ist.<br />
Wahrscheinlich haben Kinder unter vier<br />
Jahren kein Verständnis dafür, dass sie durch<br />
die Zeit wandern – dass ihr Ich der Vergangenheit<br />
und jenes der Gegenwart Teil derselben<br />
Geschichte sind. Darum können sie<br />
kaum bleibende Erinnerungen anlegen.<br />
Hat es Sie nie traurig gestimmt, zu erleben,<br />
wie schnell eine Kindheit vergeht?<br />
Doch. In Japan gibt es den wunderbaren<br />
Begriff aaware. Er meint die ganz besondere<br />
Schönheit des Flüchtigen: der Kirschblüte<br />
etwa oder des ersten Schnees. Wer sie<br />
genießen will, muss sich hingeben – und<br />
leidenschaftlich lieben, was er weder kontrollieren<br />
noch festhalten kann.<br />
Stefan Klein führt für das <strong>ZEIT</strong>magazin<br />
regelmäßig Gespräche mit<br />
Wissenschaftlern über die großen Fragen.<br />
Zuletzt erschienen »Altern« (Nr. 16/12)<br />
und »Freundschaft« (Nr. 5/12)<br />
Wir danken der KLAX-Kinderkunstgalerie aus Berlin
Ich habe einen Traum
Lykke Li<br />
»Wir krochen durch Erdtunnel, kletterten über Felsen und wollten einen Berg besteigen«<br />
funden hatte, wollte ich nicht mehr weitermachen. Aber man lernt<br />
bei so einer Arbeit, dass die Menschen sich gegenseitig helfen müssen.<br />
Ein großes Problem in unserer Kultur ist ja, das wir unsere<br />
Alten allein lassen. In einem Altersheim lernt man vor allem, dass<br />
das Leben sehr kurz ist. Und dass es daher wichtig ist, sich rechtzeitig<br />
um die Verwirklichung der eigenen Träume zu kümmern.<br />
Ehrlich gesagt, fühle ich mich jetzt schon manchmal<br />
sehr alt, weil ich so viel Schlaf brauche wie ein Rentner und immer<br />
nur ins Bett will. Manchmal wünsche ich mir, total dumm<br />
zu sein, um mir nicht mehr so oft den Kopf zu zerbrechen über<br />
Gott und Welt. Aber dann hätte ich vielleicht auch nur noch<br />
langweilige Träume.<br />
Lykke Li,<br />
26, heißt mit bürgerlichem Namen Li Lykke Timotej Svensson<br />
Zachrisson und ist eine schwedische Musikerin. In Deutschland<br />
wurde sie in den vergangenen Monaten durch den Hit »I Follow<br />
Rivers« bekannt, der im Juli Platz 1 der Single-Charts erreichte<br />
treten. Aber zu einer Weltkarriere hat es dann doch nicht gereicht.<br />
Trotzdem habe ich die Hoffnung bis heute nicht aufgegeben. Ich<br />
bin ja noch jung, da kann noch viel passieren. Andererseits habe<br />
ich Angst davor, alt zu werden. Das scheint mir ein Albtraum zu<br />
sein. Ein kurzes, schnelles, aufregendes Leben würde ich einem<br />
öden und langen vorziehen.<br />
Bevor ich Musikerin wurde, habe ich ein halbes Jahr in<br />
einem Altersheim gearbeitet. Ich habe dort vollgepinkelte Windeln<br />
gewechselt, schmutzige Bettlaken ausgetauscht und gewaschen,<br />
alte Menschen geduscht und für sie gekocht. Ich habe also alles<br />
gemacht, was so anfiel. Am Abend war ich dann immer völlig zerstört.<br />
Es war harte Arbeit, aber ich brauchte das Geld. Noch anstrengender<br />
als die Arbeit war es, so viele einsame Menschen zu<br />
sehen, die niemanden mehr hatten. Ich betreute zehn von ihnen.<br />
Glücklich waren nur die Leute, die Alzheimer hatten und nicht<br />
mehr viel merkten. Da war eine alte Frau, mit der ich mich etwas<br />
angefreundet hatte. Eine ehemalige Friseurin. Die sagte immer:<br />
Kindchen, du musst hier weg, du solltest Filmstar werden. Nachdem<br />
ich einen sterbenden alten Mann in seinem Blut liegend ge-<br />
Bevor ich schlafen gehe, überlege ich mir immer, wovon ich träumen<br />
möchte. Alle meine Träume sind sehr intensiv, psychedelisch.<br />
Oft beginnen sie gruselig. Neulich irrte ich mit einem merkwürdigen,<br />
mir unbekannten Mann durch einen finsteren Wald. Wir<br />
krochen durch Erdtunnel, kletterten über Felsen und wollten einen<br />
Berg besteigen. Bei solchen Träumen stehe ich manchmal<br />
neben mir und freue mich darüber, was ich da gerade wieder Aufregendes<br />
träume. Ich merke also, dass ich träume, was die psychedelische<br />
Wirkung noch erhöht. Manchmal werde ich dann allerdings<br />
auch traurig, weil ich weiß, dass der Traum leider bald zu<br />
Ende sein wird, spätestens, wenn wir die Bergspitze erreichen.<br />
Wenn ich aus einem wilden Traum erwache, bin ich immer traurig.<br />
Oft notiere ich mir dann, was passiert ist. Alle Songs, die ich<br />
schreibe, sind von meinen Träumen beeinflusst.<br />
Musiker zu sein ist dagegen kein Traum, sondern<br />
nüchterne Realität. Das ist meine Arbeit, mit der ich meinen Lebensunterhalt<br />
finanziere. Wären meine Kindheitsträume wahr<br />
geworden, wäre ich nämlich ein Filmstar geworden. So wie Gena<br />
Rowlands. Als Kind bin ich oft mit unserem Schultheater aufge-<br />
33 Aufgezeichnet von Christoph Dallach Foto Nadine Elfenbein Zu hören unter www.zeit.de/audio
34<br />
Von<br />
JÖRG LAU<br />
Fotos<br />
ANDREAS HERZAU<br />
Strategie der Verunsicherung: Immer neue Checkpoints werden in Hebron errichtet.<br />
In der ehemaligen Hauptstraße sind alle Läden geschlossen und verschweißt (rechts)
Für Israel, gegen die Besatzung: Junge Israelis brechen<br />
das Schweigen über ihren Militärdienst<br />
TAPFERKEIT VOR<br />
DEM FREUND<br />
35
WENN JEHUDA SCHAUL die jungen<br />
Soldaten der israelischen Armee in He bron<br />
sieht, kommen die Erinnerungen wieder zurück.<br />
Jehuda, ein bärenhafter 29-Jähriger mit<br />
Vollbart, war auch einmal hier eingesetzt. Er<br />
hat in dieser Stadt Dinge erlebt, die er bis heute<br />
nicht loswird: »Ich glaubte zu wissen, wer<br />
ich bin, was gut und was böse ist und wofür<br />
ich stehe. Nach 14 Monaten He bron war<br />
nichts davon übrig. Als hätte man alles, was<br />
ich war, durch einen Schredder geschoben.«<br />
Ein Besuch in He bron ist für Jehuda<br />
immer auch eine Suche nach dem verlorenen<br />
Selbst. Es ist ein herrlicher Morgen. Wir gehen<br />
durch das Viertel Bab al-Khan im Herzen<br />
der Altstadt. Palästinenser dürfen hier nur<br />
eine Seite der Straße benutzen, hinter einer<br />
Betonbarriere. Die Straßen der alten Kasbah<br />
sind leer, die Geschäfte versiegelt und lange<br />
schon aufgegeben. Das Herz He brons ist abgestorben.<br />
Dies ist eine Geisterstadt, belebt<br />
nur von den Soldaten, die in kleinen Gruppen<br />
patrouillieren. Alles normal, wird es nach<br />
diesem Tag in den Lageberichten heißen.<br />
Mit dieser Normalität kann Jehuda sich<br />
nicht abfinden. Er und ein paar Freunde haben<br />
nach ihrem Militärdienst eine Gruppe<br />
gegründet, die sich auf Hebräisch Schowrim<br />
Schtika nennt, auf Englisch Breaking the Si-<br />
36<br />
In Hebron ist der Nahostkonflikt wie unter einem Brennglas zu beobachten:<br />
Blick von der israelisch besetzten Zone in Hebron auf den palästinensischen Teil<br />
lence – »Das Schweigen brechen«. Sie haben<br />
einen Kampf begonnen, der fast aussichtslos<br />
scheint, einen Kampf gegen die Sachzwänge<br />
der Realpolitik und die Trägheit des Herzens<br />
nach 45 Jahren der Besatzung.<br />
Jehuda und seine Freunde vermeiden<br />
abgedroschene Formeln wie »Zwei staa tenlösung«<br />
und »Friedensprozess«, die das Publikum<br />
nicht nur in Israel mittlerweile in<br />
Sekunden schlaf versetzen. Sie haben etwas<br />
Interessanteres, aber auch Schwierigeres zu<br />
bieten: die Erfahrung der Soldaten, die die<br />
Besatzung am Laufen halten. Den Blick vom<br />
Checkpoint aus, durch das Visier des Gewehrs,<br />
das Westjordanland im grünen Licht<br />
eines Nachtsichtgeräts.<br />
Soldaten sprechen über ihren Dienst:<br />
Das ist überall heikel, umso mehr aber in Israel,<br />
dessen Existenzrecht immer noch infrage<br />
gestellt wird. Ohne Bereitschaft zur Selbstverteidigung<br />
gäbe es den jüdischen Staat längst<br />
nicht mehr. Die Armee ist auch heute noch die<br />
wichtigste In sti tu tion im Land. Sie hat es gegründet,<br />
sie erhält es, sie bewahrt die zionistischen<br />
Werte, sie macht Juden aus aller Welt zu<br />
Israelis. Erwachsen werden, Soldat werden,<br />
Bürger werden, das ist alles eins, wenn die<br />
18-jährigen Männer für drei Jahre und die<br />
Frauen für 21 Monate eingezogen werden.<br />
Die Aktivisten von Breaking the Silence waren<br />
alle in He bron eingesetzt. Wie Jehuda ist<br />
auch die Geschäftsführerin Dana Golan,<br />
ebenfalls 29 Jahre alt, hier geprägt worden.<br />
Die beiden sind zusammen mit dem 33-jährigen<br />
Michael Manekin der harte Kern der<br />
Gruppe. »Die Menschen in diesem Land«, so<br />
beschreibt Dana Golan ihre Mission, »müssen<br />
sich klarmachen, was sie ihren Söhnen und<br />
Töchtern antun, die in der Besatzung dienen.<br />
Viele wollen lieber nicht genau wissen, was<br />
der Preis für das Besatzungsregime ist, was wir<br />
dort tun – und was das uns antut.«<br />
Als Jehuda anfing, im Sommer 2001,<br />
trug er voller Stolz die olivgrüne Uniform. Es<br />
tobte die Zweite Intifada, ein blutiger Aufstand,<br />
der innerhalb von fünf Jahren 1036<br />
Israelis und 3592 Palästinenser das Leben<br />
kosten sollte. Jehudas Brigade hatte die Aufgabe,<br />
die jüdischen Siedler der Stadt vor den<br />
Angriffen von Palästinensern zu schützen.<br />
Hebron ist für Juden und Muslime ein<br />
heiliger Ort. Die Gräber von Abraham, Isaak<br />
und Jakob, Sara, Rebekka und Lea werden<br />
seit biblischer Zeit hier verehrt. Für diese<br />
Stadt, einen der am längsten ununterbrochen<br />
bewohnten Flecken der Erde, ist das Heilige<br />
immer wieder zum Fluch geworden. Weil<br />
Abraham auch im Islam als Ur vater und erster
»Ich kann es mir nicht erlauben, ein Gewissen zu haben«,<br />
hat diese junge Soldatin auf ihren Arm tätowieren lassen<br />
37
Prophet gilt, tobt ein jahrhundertelanger<br />
Kampf um die Erinnerung, der immer wieder<br />
zu Pogromen und Massakern geführt<br />
hat. 1929 fielen 67 Juden einem Massenmord<br />
zum Opfer, 1994 erschoss der Siedler<br />
Baruch Goldstein 29 betende Muslime. In<br />
He bron ist der Nahostkonflikt wie unter<br />
einem Brennglas zu beobachten.<br />
Einige jüdische Siedlungen, das ist das<br />
Besondere, liegen in der früher arabisch<br />
dominierten Altstadt He brons. Die Siedlerbewegung<br />
hat hier angefangen. Nach Israels<br />
Sieg im Sechstagekrieg von 1967 wurde<br />
He bron als Teil des Westjordanlands<br />
von israelischen Truppen besetzt. Bald begannen<br />
National-Religiöse, im Zentrum<br />
der Stadt Häuser zu besetzen. Eine Gruppe<br />
um den Rabbiner Mosche Lewinger mietete<br />
sich in einem Hotel für eine Pessach-<br />
Feier ein und blieb. Die Armee rückte an,<br />
um die Siedler abzusichern. So ging es<br />
immer wieder in He bron: Checkpoints<br />
wurden errichtet, Straßen gesperrt. Die<br />
palästinensische Bevölkerung verließ infolgedessen<br />
das Zentrum zu Tausenden,<br />
und He bron wurde durch den Oslo-Vertrag<br />
von 1994 eine geteilte Stadt: In »H1«<br />
sind die Palästinenser für die Sicher heit<br />
verantwortlich, in »H2« – dem alten Stadtkern<br />
– die Israelis. Allerdings versuchten<br />
die Siedler immer wieder, in palästinensisches<br />
Ter ri to rium vorzudringen.<br />
Jehuda wurde Zeuge einer solchen<br />
Aktion. Eines Tages zu Beginn von Jehudas<br />
Dienstzeit hatte sich eine Gruppe jüdischer<br />
Siedlerfrauen mit ihren Kindern<br />
nach Abu Sneina aufgemacht, einem arabischen<br />
Stadtteil He brons. Das war lebensgefährlich.<br />
Aus diesem Quartier heraus war<br />
einige Wochen zuvor ein zehn Monate altes<br />
israelisches Baby von einem arabischen<br />
Heckenschützen erschossen worden. Es<br />
wimmelte in Abu Sneina von Militanten.<br />
Die Siedlerfrauen wollten in dem arabischen<br />
Viertel einen Stützpunkt errichten.<br />
Die Armee, so ihr Kalkül, musste ihnen<br />
folgen, um sie zu schützen. Wenn es ihnen<br />
gelänge, sich festzusetzen, wäre ein weiteres<br />
Stück biblischen Bodens befreit. Es wurde<br />
Alarm ausgelöst, und Jehudas Kampfgruppe<br />
bekam den Auftrag, die Frauen aus Abu<br />
Sneina herauszuholen und in die sichere<br />
Zone zurückzugeleiten. Nach Abschluss der<br />
Aktion bildeten die Soldaten einen Ring um<br />
die Siedlung, um die Frauen daran zu hindern,<br />
wieder loszuziehen. »Da ging das Geschrei<br />
los«, erinnert er sich: »Ihr seid Nazi-<br />
Soldaten, die Juden ins Ghetto einsperren!<br />
Hey, Nazi, hier ist eine Schwangere. Schlag<br />
sie doch, dann wird sie eine Fehlgeburt haben,<br />
und es gibt einen Juden weniger!«<br />
Von anderen Juden, für die man gerade<br />
sein Leben riskiert hatte, Nazi genannt<br />
zu werden war ein Schock. Die Armee war<br />
in He bron, um Juden vor Arabern zu beschützen.<br />
Aber hier musste man oft genug<br />
die Araber vor den Juden schützen – und<br />
He brons Juden vor sich selbst.<br />
Jehuda Schaul hat die Gruppe<br />
Breaking the Silence gegründet<br />
Jehuda stammt selbst aus einer ultraorthodoxen<br />
Familie. Er hat sich aus dieser Welt<br />
gelöst, betrachtet sich aber weiter als gläubig,<br />
ernährt sich koscher und hält den Sabbat<br />
ein. Seine Entscheidung, zur Armee zu<br />
gehen – statt, wie es damals gesetzlich erlaubt<br />
war, als Ultraorthodoxer vom Privileg<br />
der Befreiung vom Wehrdienst Gebrauch<br />
zu machen –, fiel gegen den Willen der Familie:<br />
»Ich sah es als patriotische Pflicht.«<br />
Für die Siedler He brons, musste er erkennen,<br />
war er als Soldat nur ein Mittel<br />
zum Zweck in ihrem Kampf um den heiligen<br />
Boden. Doch um diese Menschen zu<br />
schützen, hat er Dinge getan, die er sich vor<br />
He bron nicht hätte vorstellen können.<br />
Einer seiner ersten Einsätze bestand<br />
darin, aus einem Posten hoch über der<br />
Stadt ein Granatmaschinengewehr zu bedienen.<br />
Aus dem arabischen Viertel waren<br />
immer wieder die Siedlungen beschossen<br />
worden. Also wurde befohlen, zurückzuschießen:<br />
»Es ist unmöglich, mit einem<br />
Granatmaschinengewehr präzise zu treffen.<br />
In einem 15-Meter-Radius vom Zielpunkt<br />
tötet es alles. Jetzt sollte ich diese Waffe in<br />
einer dicht besiedelten Stadt abfeuern. Ich<br />
habe geschossen und gebetet, dass ich keine<br />
Unschuldigen treffe.« Die ersten Tage waren<br />
schrecklich, aber bald gewöhnte er sich<br />
daran: »Nach einer Weile war es dann die<br />
Attraktion des Tages, wenn man endlich<br />
zurückschießen konnte.«<br />
Doch irgendwann begann Jehuda mit<br />
dem Gedanken der nachträglichen Dienstverweigerung<br />
zu spielen, was eine Gefängnisstrafe<br />
zur Folge gehabt hätte. Er hat es<br />
nach einem Gespräch mit seinem Kommandeur<br />
nicht getan, sondern sich sogar<br />
zum Offizierskurs angemeldet. Gerade<br />
Leute wie er müssten dabeibleiben, wurde
Dana Golan war stolz, Soldatin zu sein.<br />
Das ist sie heute nicht mehr<br />
ihm gesagt. Er könne Dinge verändern und<br />
Exzesse verhindern. Heute hält er das für<br />
eine Lebenslüge: »Nicht individuelles Fehlverhalten<br />
war das Problem, sondern das<br />
System der Besatzung.«<br />
Wie Jehuda haben auch Dana und<br />
die anderen von Breaking the Silence ihren<br />
Dienst ordnungsgemäß beendet. Es<br />
herrschte schließlich ein Krieg, in dem der<br />
Gegner barbarische Methoden anwandte:<br />
Selbstmordanschläge auf Cafés und Reisebusse<br />
in Israel waren damals Alltag.<br />
Erst nachdem sie aus der Armee entlassen<br />
waren, setzte das Erschrecken über<br />
die eigene Ver rohung ein. Jahre später noch<br />
stehen viele der Soldaten wie neben sich.<br />
Dana Golan ist seit drei Jahren Geschäftsführerin<br />
der Gruppe. Wir besuchen<br />
sie im Jerusalemer Stadtteil Talpiot. Das<br />
Büro liegt in einem Industriegebiet. Vier<br />
schmucklose Zimmer mit Teeküche, ein<br />
Konferenzraum, Ikea-Möbel. Dana könnte<br />
man mit ihrer modischen Sonnenbrille und<br />
ihren langen braunen Haaren für eine typische<br />
Tel Aviver Israelin halten: unbeschwert,<br />
eher unpolitisch. Und vielleicht wäre sie<br />
ohne He bron auch so geworden. Sie<br />
kommt, anders als Jehuda, aus einer säkularen<br />
zionistischen Familie, die an das Militär<br />
glaubte. Als sie für den Dienst in den besetzten<br />
Gebieten eingeteilt wurde, war sie<br />
stolz: »Sie schicken dich in die Frontstadt,<br />
weil du zu den Harten gehörst«, dachte sie.<br />
Bei der ersten Hausdurchsuchung<br />
brennt sich ihr der Wandschmuck ins Gedächtnis<br />
ein: »Ich sehe ein Poster von der<br />
Al-Aksa-Moschee in Jerusalem und ein Bild<br />
Saddam Husseins, und da wird mir klar:<br />
Ich bin tatsächlich in einem palästinensischen<br />
Haus. Der nächste Gedanke: Komisch,<br />
ich war noch nie bei Palästinensern<br />
zu Hause. Jetzt stehe ich um zwei Uhr<br />
nachts mit einem MG in einem He bro ner<br />
Haus, und alle haben Angst vor mir.«<br />
Die Kameraden stellen alles auf den<br />
Kopf, man sucht Waffen. Stattdessen finden<br />
sie die Pornosammlung des Familienvaters.<br />
»Mir ist es unendlich peinlich. Ich<br />
schäme mich. Dann kommt der Befehl, ich<br />
soll die Frauen im Haus filzen.« Dana<br />
klopft die Frauen ab: »Beine auseinander,<br />
Hände an die Wand. Ich fasse sie überall<br />
an, auch an den Brüsten. Sie lassen es geschehen.<br />
Sie haben Angst. Dabei schaut der<br />
kleine Sohn zu mir herüber, und ich sehe<br />
den Hass in seinen Augen. In diesem Moment<br />
konnte ich ihn verstehen.«<br />
Sich plötzlich im Blick des anderen<br />
erkennen zu müssen kann Folgen haben.<br />
Michael Manekins Schlüs sel erleb nis begann<br />
mit einem Scherz. Man hatte dem<br />
Kommandeur der Patrouille, einem großen,<br />
rundlichen Mann, statt regulärer<br />
Tarnfarbe giftgrüne Schminke gegeben.<br />
Weil die Farbe im Dunkeln aufgelegt wurde,<br />
hatte er es nicht bemerkt. Man hämmert<br />
an die Tür eines palästinensischen<br />
Hauses, die Tür wird geöffnet, der Kommandeur<br />
stürmt voran und brüllt »Hände<br />
hoch, keine Bewegung!«: »Die ganze Familie<br />
lacht bei seinem Anblick, und ein Kind<br />
ruft: ›Shrek! Shrek!‹ Wir lachen auch, und<br />
schließlich lacht selbst der Kommandeur,<br />
der in einem Spiegel erkennt, dass er wirklich<br />
aussieht wie das Ungeheuer aus dem<br />
Film. Mein Gott, denke ich, sie kennen<br />
Shrek! Und sie haben Humor, diese Palästinenser.<br />
Sie haben mich zum Lachen gebracht.<br />
Sie leben in der gleichen amerikanisierten<br />
Popwelt wie wir. Der nächste<br />
Gedanke: Was hast du bloß gedacht, wie<br />
die sind? In dem Moment fiel meine Soldatenwelt<br />
in sich zusammen. Ich hatte oft<br />
erlebt, dass sich Kinder bei unserem Anblick<br />
vor Angst in die Hose machen. Das<br />
hat mir nicht so viel ausgemacht wie dieses<br />
Lachen über Shrek.«<br />
Noam Chajut, der mit Jehuda zu den<br />
Gründern von Breaking the Silence gehört,<br />
trifft uns in Tel Aviv, im Café Henrietta am<br />
zentralen Busbahnhof. Der 32-Jährige mit<br />
schütterem blonden Haar ist für die Videodokumentation<br />
der Soldatenerfahrungen<br />
zuständig. Nach dem Militär hat er Biologie<br />
studiert und ist heute Bioingenieur.<br />
Seine freundliche und offene Art kann eine<br />
große Wut kaum verdecken.<br />
Noam war Offizier im Westjordanland<br />
und in Gaza. Seine Groß eltern waren<br />
vor dem Zweiten Weltkrieg aus der Ukraine<br />
und Polen eingewandert. Alle verbliebenen<br />
Verwandten in Europa wurden von den<br />
Deutschen ermordet. Noam wollte immer<br />
schon Offizier werden. Er kam zu einer<br />
Eliteeinheit, die während der Zweiten Intifada<br />
überall im Westjordanland kämpfte.<br />
Wie Jehuda war auch er später in Hebron<br />
eingesetzt: »Es hieß immer, wir bekämpfen<br />
den Terrorismus. Aber dort bedeu-
tete das, ein Volk unter Kontrolle zu halten.<br />
Mit dem Gewehr in der Hand bist du als<br />
20-Jähriger plötzlich Herr über Leben und<br />
Tod. Auch wenn du anders sein willst, ein guter<br />
Soldat, merkst du bald, dass es dein Daseinszweck<br />
ist, die Palästinenser deine Macht<br />
spüren zu lassen, damit sie sich nicht erheben.<br />
Unsere Parole war: Brennt ihnen ins Bewusstsein,<br />
dass es sich nicht lohnt zu kämpfen.«<br />
In den drei Jahren beim Militär, sagt er,<br />
»war die Erzeugung von Unsicherheit mein<br />
Beruf«. Das bedeutete nächtliche Hausdurchsuchungen;<br />
stetig wechselnde Checkpoints,<br />
Verhaftungen ganzer Dorfgemeinschaften,<br />
Zerstörung von Häusern, laute Patrouillen<br />
mitten in der Nacht: »Niemand sollte sich sicher<br />
fühlen. Einmal wurden mit Panzern<br />
ganze Reihen von palästinensischen Autos<br />
plattgemacht. Ein andermal haben wir am<br />
Checkpoint alle Autoschlüssel einkassiert,<br />
weil jemand keine Papiere hatte. Die Unberechenbarkeit<br />
– und manchmal Sinnlosigkeit<br />
– der Maßnahmen war Absicht. Jeden kann<br />
es jederzeit treffen, das war unsere Botschaft.<br />
Und am Wochenende fragen deine Eltern zu<br />
Hause, wie es dir geht, und du sagst: ›Gut,<br />
alles klar.‹ Du willst nicht über das reden, was<br />
du in den Gebieten gemacht hast. Was sollen<br />
sie denn anfangen mit deinen Geschichten?«<br />
Die Initiative will zeigen, was die Besatzung bedeutet – auch mit Führungen in den Hügeln<br />
von Hebron. Rechts eine Soldatin vor einem israelischen Wandgemälde<br />
Aber war der Kampf gegen den Terrorismus<br />
nicht erfolgreich? »So kann man das sehen«,<br />
sagt Noam. »Aber die Leute sollten wissen,<br />
wie teuer ihre Sicherheit erkauft wird.«<br />
Jehuda, Dana, Michael und Noam sind<br />
weder Defätisten noch Ver räter. Breaking the<br />
Silence ist ein Versuch von Exsoldaten, die<br />
Armee vor dem Missbrauch durch die Politik<br />
zu retten. Und wer die Armee retten will, der<br />
meint in Israel eigentlich das Land selbst. Pathetischer<br />
gesagt: dessen Seele, die durch die<br />
Besatzung korrumpiert zu werden droht.<br />
Mehr als sieben Jahre liegt Jehudas<br />
Wehrdienst jetzt zurück, doch jede Woche<br />
fährt er wieder nach He bron, oft sogar mehrmals:<br />
»Manchmal sage ich mir: Jehuda, du<br />
hast die Armee eigentlich nie verlassen. Du<br />
bist irgendwie immer noch im Dienst.«<br />
Es begann damit, dass er zusammen mit<br />
Noam Chajut die Fotos sammelte, die sie bei<br />
ihren Einsätzen mit Handys und Digicams<br />
gemacht hatten. Bilder von palästinensischen<br />
Wohnungen, von Gefangenen, von Straßensperren.<br />
Sie zeigten die Bilder einem professionellen<br />
Fotografen, der ihnen half, eine Ausstellung<br />
in Tel Aviv zu organisieren.<br />
Das war im Sommer 2004, wenige Monate<br />
nach Jehudas Entlassung, und der Titel<br />
lautete Breaking the Silence. Die Ausstellung<br />
war gut besucht. Die Soldaten erklärten ihre<br />
eigenen Bilder. Viele Eltern von Soldaten kamen.<br />
In der zweiten Woche tauchte auch Jehudas<br />
Vater auf. Nach dem Rundgang wandte<br />
er sich schockiert an seinen Sohn: »Jehuda,<br />
so etwas hast du getan?« Der Vater ging ohne<br />
ein weiteres Wort. Eine Woche später besuchte<br />
er Jehuda und gestand: »Ich verstehe, warum<br />
du tust, was du tust.«<br />
Nach der Ausstellung begann Jehuda mit<br />
Freunden, Zeugenaussagen von Soldaten auf<br />
Band aufzunehmen. Sie sprachen Bekannte<br />
an, die wiederum ihre Freunde mitbrachten.<br />
Mittlerweile sind so über 800 Aussagen dokumentiert.<br />
In diesen Tagen erscheint eine Auswahl<br />
auf Deutsch: Das Buch Breaking the<br />
Silence. Israelische Soldaten berichten von<br />
ihrem Einsatz in den besetzten Gebieten<br />
(Econ-Verlag) enthält Berichte von Misshandlungen,<br />
gezielten Tötungen, mutwilliger<br />
Zerstörung. Aber seine Sprengkraft liegt nicht<br />
in den drastischen Schilderungen, sondern<br />
darin, dass es einen Einblick in den seelischen<br />
Zustand der Besatzer bietet.<br />
Je mehr Zeugnisse die Veteranen sammelten,<br />
umso deutlicher zeichneten sich<br />
Muster ab, die der offiziellen Version widersprachen,<br />
dass es sich um bedauerliche Einzelfälle<br />
handelte. Es entstand das Bild einer<br />
41
systematischen und auf Dauer angelegten<br />
Politik der Einschüchterung und Kontrolle,<br />
die das Geflecht des alltäglichen Lebens der<br />
Palästinenser zerstört. Jehuda beschreibt seine<br />
Lernkurve so: »Wir waren mit der Haltung<br />
in die Armee gegangen, dass wir es<br />
besser machen wollten. Heute sehe ich das<br />
als Teil des Problems: die Idee, dass es eine<br />
menschliche, anständige, korrekte Besatzung<br />
geben kann, trägt dazu bei, dass alles<br />
immer so weitergeht.«<br />
Die Veröffentlichung der Zeugnisse hat<br />
Breaking the Silence zu einem führenden Akteur<br />
der israelischen Friedensbewegung gemacht.<br />
Gegenreaktionen konnten nicht ausbleiben.<br />
Regierungsnahe Leitartikler und<br />
Thinktanks versuchen die Gruppe als Antizionisten<br />
in Diensten des Auslands zu diskreditieren,<br />
als unpatriotische Linke. In Israel<br />
scheidet die Frage, ob man Besatzung und<br />
Siedlungspolitik kritisiert oder verteidigt,<br />
Links und Rechts. Und die Linken stehen<br />
zurzeit auf verlorenem Posten. Es gibt keine<br />
Friedensverhandlungen mehr. Die Zweistaatenlösung<br />
ist zur leeren Phrase geworden.<br />
Man hat beiderseits den Glauben an einen<br />
Frieden durch Verhandlungen verloren. Die<br />
Palästinenser haben erleben müssen, dass die<br />
Siedlungen in den letzten 17 Jahren – also seit<br />
42<br />
»Es gibt keine Heiligkeit in einer besetzten Stadt« steht auf dem T-Shirt (rechts),<br />
das gilt auch für Hebron, das einem Geisterort gleicht<br />
dem Oslo-Abkommen, das die Rückabwicklung<br />
der Besatzung vorsah – um das Zweieinhalbfache<br />
gewachsen sind, auf nun fast<br />
300 000 Bewohner. Die Israelis hingegen haben<br />
zweimal erlebt, dass Rückzüge der Armee<br />
– 2000 aus dem Libanon und 2005 aus Gaza<br />
– mit einem Hagel von Raketen durch Hisbollah<br />
und Hamas beantwortet wurden.<br />
Was nutzt es da, sich den unangenehmen<br />
Zeugnissen der Exsoldaten auszusetzen?<br />
Die »besetzten Gebiete« verschwinden mittlerweile<br />
fast vollständig hinter Mauern und<br />
Zäunen, die Terroristen draußen halten und<br />
peinliche Anblicke der palästinensischen Realität<br />
vermeiden helfen. Jehuda versucht darum<br />
neuerdings, möglichst viele Menschen in<br />
die besetzten Gebiete zu bringen, damit sie<br />
mit eigenen Augen sehen können, was Besatzung<br />
bedeutet. Breaking the Silence organisiert<br />
Touren nach He bron, die man auf der<br />
Web site buchen kann. An die 10 000 Teilnehmer<br />
waren schon dabei, ein Drittel von<br />
ihnen junge Israelis vor der Einberufung.<br />
Der kritische Okkupationstourismus ist<br />
der Regierung nicht genehm. Anfang des Jahres<br />
wurde eine von Jehudas He bron-Touren<br />
mit Schulkindern polizeilich verboten. Der<br />
Erziehungsminister erklärte, er wolle mit eigens<br />
organisierten Touren dafür sorgen, dass<br />
alle Schulkinder nach He bron kommen, um<br />
ihre Verbundenheit mit der »ewigen Wiege<br />
der jüdischen Nation« zu stärken. Die Kinder<br />
werden viel über Abraham und Rachel hören,<br />
aber wenig über Extremisten wie Mosche Lewinger<br />
und Baruch Goldstein.<br />
Die Knesset berät eine Gesetzesvorlage,<br />
die Gruppen wie Breaking the Silence von<br />
ausländischen Finanzierungsquellen abschneiden<br />
soll. Etwa die Hälfte des Etats von<br />
umgerechnet 650 000 Euro erhalten die Aktivisten<br />
von europäischen Gebern – darunter<br />
kirchliche und entwicklungspolitische Stiftungen<br />
wie Misereor, aber auch die britische<br />
Botschaft und die EU-Delegation. Israels<br />
Regierung betrachtet diese Unterstützung<br />
als Einmischung in die inneren Angelegenheiten<br />
des Landes.<br />
Jehuda nimmt das sportlich: »Irgendwas<br />
machen wir richtig, wenn die so auf uns losgehen.«<br />
Dabei sind die Veteranen mit ihrer<br />
schonungslosen Selbst erfor schung die beste<br />
Werbung, die man sich für Israel und seine<br />
Armee vorstellen kann. Welches andere Land<br />
im Dauerkrieg mit seiner Umgebung leistet<br />
sich solch schneidende Selbstkritik? Undenkbar<br />
ist es nicht, dass man eines Tages in Jehudas<br />
und Danas Eigensinn eine andere Form<br />
von Patriotismus erkennt. zeitmagazin<br />
nr . <strong>39</strong>
Der Stil<br />
44<br />
Damit kann man endlich schön schnell sein: Die EA7 »C-Cube Corsa« von Giorgio Armani, 165 Euro<br />
Foto Peter Langer
Echt guter<br />
Lauf<br />
Tillmann Prüfer über Joggingschuhe<br />
Ich laufe regelmäßig, ich bin gar nicht schlecht<br />
darin. Ich bin sogar einigermaßen schnell.<br />
Manchmal allerdings denke ich, dass ich deshalb<br />
so ein hohes Tempo vorlege, weil ich es schleunigst<br />
hinter mich bringen will.<br />
In Berlin ist das Laufen ja keine Angelegenheit,<br />
die man in weitläufigen Parks betreiben könnte.<br />
Man muss sich auf staubige Straßen beschränken,<br />
hastet zwischen Menschen durch, die sich<br />
gerade nicht sportlich betätigen, und fühlt sich<br />
ein bisschen wie ein schwitzender Außerirdischer.<br />
Dabei drängen sich zwei große Modethemen<br />
auf: kurze Hosen und Laufschuhe.<br />
Während der Sneaker sich immer weiter in Richtung<br />
eines Modeartikels verfeinert hat, wurde<br />
der Laufschuh zu einer Art Maschine. Es begann<br />
wohl in den achtziger Jahren mit dem Nike Air,<br />
einem Laufschuh, der im Fersenbereich ein<br />
sichtbares Luftkissen hatte. Fortan sahen Laufschuhe<br />
aus wie Roboterfüße aus einem Transformers-Film.<br />
Da der klassische Sneaker zum<br />
büro taug lichen Accessoire wurde, musste der<br />
Laufschuh umso vehementer unterstreichen,<br />
dass er ein Sportgerät ist: mit Dämmgummis in<br />
Neonfarben und einem Sohlenprofil, das aussehen<br />
sollte, als ob es den Boden förmlich fräße.<br />
Nun allerdings gibt es auch Laufschuhe, die modischen<br />
Aspekten genügen. Der belgische Designer<br />
Raf Simons entwirft schon seit einigen<br />
Jahren welche in Zusammenarbeit mit dem<br />
Sportschuhhersteller Asics. Große Modemarken<br />
nehmen sich des Themas an. Gerade hat Giorgio<br />
Armani mit seiner Sportmarke EA7 Laufschuhe<br />
vorgestellt, die mit einem neuen Karbon-Dämpfungssystem<br />
ausgestattet sind – dabei aber durchaus<br />
elegant aus sehen. Damit wurde sogar die italienische<br />
Olympia-Mannschaft ausgestattet. Der<br />
Laufschuh ist gewissermaßen auf dem Weg in<br />
die Mode.<br />
Neulich konnte ich ein Paar weißer Armani-Joggingschuhe<br />
ausprobieren. Ob man darin wirklich<br />
schnell ist, kann ich aber nicht sagen. Ich bin<br />
einfach ungemein entspannt gelaufen – eigentlich<br />
bin ich fast geschlendert durch die Straßen<br />
der Stadt. In den Park traut man sich damit nicht<br />
mehr, aus Angst, man könnte die Schuhe<br />
schmutzig machen.<br />
Ungelöst bleibt jetzt nur noch das Problem mit<br />
den kurzen Hosen. Vielleicht laufe ich einfach<br />
weiter, bis ich andere Beine habe.<br />
A<br />
Mark Spörrle fährt mit dem BMW ActiveHybrid 5<br />
einmal rund um den Starnberger See<br />
Seeshaupt am Südende des Starnberger Sees.<br />
Die Sonne brennt. Auf der Straße viele Eis<br />
essende junge Mütter, keine Männer. Wir<br />
wollen hier diesen BMW testen, er ist schön,<br />
schnell und ein Hybrid. Bis zu 60 km/h soll<br />
allein der Elektromotor schaffen. Klingt gut<br />
– aber etwas paradox ist das schon: Was<br />
bringt Ökotechnik bei 340 PS? Degradiert<br />
der Sechszylinder den Elektroantrieb nicht<br />
zum Gimmick für Reiche? Was liegt da näher<br />
als eine Tour um den Starnberger See; hier ist<br />
das Pro-Kopf-Einkommen am höchsten,<br />
hier glitzert das Wasser, im Hintergrund die<br />
Alpen. Und vor der Eisdiele sitzt dann doch<br />
ein Mann, der aussieht wie Hansi Hinterseer.<br />
Wir fahren in Richtung Bernried. Die Straße<br />
wird eng und kurvig, wir schleichen so, dass<br />
wir die elektrische Höchstgeschwindigkeit<br />
testen können. Schade – schon bei 40 km/h<br />
springt der Benziner bei. Wir cruisen durch<br />
Tutzing, Feldafing; Jahrhundertwendehäuser<br />
und grässliche Neubauten wech seln sich ab.<br />
Den See sehen wir nicht mehr, die Villengrundstücke<br />
sind dicht bepflanzt.<br />
Rushhour in Starnberg. Reicht das Elektroaggregat<br />
wenigstens für den zähen Stadtverkehr?<br />
Nein, aus der Ökotraum: Der Benzinmotor<br />
setzt immer zu früh ein. Weiter, zum<br />
Ostufer! Die Häuser werden kleiner, die<br />
Mark Spörrle ist stellvertretender Chef vom Dienst der <strong>ZEIT</strong><br />
Wiesen größer, es gibt Seeblick. Rechts liegt<br />
Berg, wo sie König Ludwig II. tot im Wasser<br />
fanden, links wohnte Heinz Rühmann, wieder<br />
rechts kommt Ammerland, wo Loriot<br />
lebte. Vor der Pizzeria am Münsinger Sportplatz<br />
sitzt Schauspieler Josef Bierbichler und<br />
isst. Wir fahren den Bergen entgegen, an<br />
weißbraunen Kühen vorbei, biegen ab zum<br />
See. Obwohl die Uferstraße in Ambach<br />
schmal und verboten ist, haben alle SUV-<br />
Fahrer Münchens beschlossen, herzukommen,<br />
zum Gasthof, der Josef Bierbichler<br />
gehört (kein Wunder, dass der Mann woanders<br />
isst!). Vorbei am denkmalgeschützten<br />
Kasten von 1893, den Finanzinvestor Carsten<br />
Masch meyer umbauen wollte und angeblich<br />
wieder loswerden will. Wir biegen<br />
wieder auf die Hauptstraße ein und ignorieren<br />
das Haus von Schauspieler Heiner Lauterbach.<br />
Zurück in Seeshaupt, haben wir viel<br />
mehr Sprit verbraucht, als BMW angibt,<br />
nach ein paar Hundert Kilometern wird der<br />
Schnitt bei 10 Litern liegen. Lohnt es sich,<br />
dafür ein Hybridauto zu kaufen? Darüber<br />
hätte man sich mit dem Mann unterhalten<br />
können, der aussieht wie Hansi Hinterseer<br />
und der immer noch vor der Eisdiele sitzt.<br />
Aber eine Mutter schnappt uns mit dem<br />
Kinderwagen den letzten Parkplatz weg.<br />
TECHNISCHE DATEN Motorbauart: 6-Zylinder-Benzinmotor plus Elektromotor,<br />
Systemleistung: 250 kW (340 PS), Beschleunigung (0–100 km/h): 5,9 s,<br />
Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h, Durchschnittsverbrauch: 7 Liter,<br />
CO 2 -Emission: 163 g/km, Basispreis: 62 900 Euro<br />
Nächste Woche fährt Tillmann Prüfer mit dem Smart Electric Bike zum Zahnarzt<br />
Foto BMW AG<br />
Von<br />
nach B<br />
45
Wochenmarkt<br />
Von<br />
ELISABETH RAETHER<br />
Die kulinarische Integration von Einwanderern<br />
funktioniert in Deutschland insofern<br />
sehr gut, als die Inder, Chinesen, Türken,<br />
Griechen wie echte Deutsche das Kochen verlernen,<br />
sobald sie unser Land betreten. Die<br />
chinesische Küche, eine der besten der Welt,<br />
ist in Deutschland durch Nudelbratstationen<br />
in Bahnhöfen repräsentiert. Die Türken vergessen<br />
ihre Sultane und servieren Pressfleisch<br />
im Brot. Die üble Qualität der Einwandererküche,<br />
in der nichts Ursprüngliches mehr zu<br />
schmecken ist, sagt wahrscheinlich einiges<br />
darüber aus, wie viel Kulturunterschiede ein<br />
Land bereit ist auszuhalten.<br />
Die Inder kochen in ihren Restaurants hier<br />
ja nur Gerichte, die grundsätzlich braungelb-rotbraun<br />
sind, was sie sich in deutschen<br />
Kantinen abgeguckt haben. Aber über die<br />
indische Küche gibt es auch 800 Seiten umfassende<br />
Kochbücher. Indien von Pushpesh<br />
Pant erscheint jetzt im Edel Verlag auf<br />
46<br />
Wann kommt die Greencard für indische Gemüse-Fisch-Currys?<br />
Deutsch. Darin steht zum Beispiel, dass ein<br />
Kürbis gar nicht unbedingt zur Suppe gemacht<br />
werden muss. Man kann ihn, nach<br />
einem Einkauf beim Asiamarkt, auch gut in<br />
einem Fischcurry essen.<br />
Dafür werden zunächst Kurkuma und Limettensaft<br />
in einer Schüssel verrührt. Man reibt<br />
den Fisch damit ein und salzt ihn etwas. So<br />
zieht er 15 Minuten im Kühlschrank durch.<br />
Fischcurry mit Kürbis (für 4 Personen)<br />
1 TL gemahlene Kurkuma, 1 EL Limettensaft,<br />
Salz, 750 g festes Fischfilet (ohne Haut),<br />
1 EL Pflanzenöl, 500 g Kürbis (z. B. Hokkaido;<br />
evtl. Saisongemüse wie Mangold,<br />
Karotten usw.), 1 EL Tamarindenextrakt,<br />
1 Tomate (gehäutet), ½ TL Cayennepfeffer,<br />
½ TL Zucker, ¼ TL Garam Masala<br />
Das Laub fällt, der KÜRBIS kommt<br />
Für die Würzpaste<br />
1 großer Zweig Koriandergrün,<br />
4 grüne Chilischoten (entkernt, gehackt),<br />
2–3 cm großes Stück Ingwer (geschält, grob<br />
gehackt), 6 Knoblauchzehen (geschält)<br />
Für die Würzpaste werden alle Zutaten im<br />
Mixer fein püriert. Etwas salzen. Falls nötig,<br />
die Paste mit etwas Wasser verdünnen.<br />
Das Öl lässt man in einem tiefen Topf bei<br />
schwacher bis mittlerer Hitze heiß werden.<br />
Sanft und ohne zu bräunen, soll die Würzpaste<br />
darin unter Rühren anbraten. Jetzt kommen<br />
der in Würfel geschnittene Kürbis und<br />
das Gemüse hinzu sowie 250 ml Wasser. Aufkochen,<br />
die Hitze reduzieren und alles zugedeckt<br />
je nach Garzeit ungefähr 8 Minuten<br />
köcheln lassen. (Wer will, fügt auch vorgekochte<br />
Kichererbsen hinzu.) Tama rin denextrakt,<br />
Tomate und den Fisch dazugeben.<br />
Man gießt noch mal 250 ml Wasser nach und<br />
schmeckt mit Cayennepfeffer, Zucker und<br />
Salz ab. Zugedeckt in etwa 5 Minuten fertig<br />
garen. Mit Garam Masala bestreut servieren.<br />
Fotos Jason Lowe
Die großen Fragen der Liebe<br />
Nr.<br />
211<br />
Darf sie allein bestimmen, was der Sohn glaubt?<br />
Nuray und Gerhard haben sich in der Softwarefirma kennengelernt,<br />
in der sie beide arbeiteten. Nurays türkische Eltern und<br />
Gerhards Mutter verstehen sich gut. Nurays Mutter trägt kein<br />
Kopftuch. Gerhards Mutter hat ihren Sohn alleine aufgezogen.<br />
Sie ist mit 18 aus der Kirche ausgetreten und hat es Gerhard überlassen,<br />
ob er sich einer Konfession anschließen will. Der siebenjährige<br />
Sohn Orhan war mit Nuray zu Besuch bei den Großeltern<br />
in Izmir. Bei der Rückkehr ist er ernster als sonst. Gerhard ist<br />
sehr zornig, als er erfährt, dass Orhan jetzt beschnitten ist. »Das<br />
ist barbarisch. Ihr hättet mich fragen müssen!« – »Ich dachte,<br />
Religion ist dir egal«, sagt Nuray. »Er soll nicht der einzige Junge<br />
in meiner Familie sein, der nicht beschnitten ist!«<br />
Wolfgang Schmidbauer<br />
ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Sein aktuelles Buch »Partnerschaft<br />
und Babykrise« ist im Gütersloher Verlagshaus erschienen<br />
Wolfgang Schmidbauer antwortet: Je nach Perspektive ist<br />
Beschneidung Körperverletzung oder ein ehrwürdiges Ritual.<br />
Nuray hat nicht verstanden oder nicht verstehen wollen, dass es<br />
Gerhard wichtig ist, einem Kind kein Ritual aufzuzwingen,<br />
vor allem keines, das nicht ganz ungefährlich ist. Aber warum<br />
hat Gerhard nicht von sich aus diese Frage angesprochen?<br />
Interessiert er sich nicht für die interkulturelle Dynamik seiner<br />
Ehe? Nachdem die Sache nicht rückgängig zu machen ist,<br />
sollte Gerhard Nurays Aktion respektieren und Orhan nicht mit<br />
seiner Abscheu vor solchen Ritualen plagen. Vielleicht kann<br />
er ein Wörtchen mitreden, wenn Orhan erwachsen ist und die<br />
Beschneidung von Gerhards Enkeln zur Debatte steht.<br />
49
Stichfrage Nr. 6<br />
Wer trägt dieses Tattoo?<br />
Sudoku<br />
50<br />
Spiele<br />
A: Der Filmemacher Michael Moore<br />
B: Der Modedesigner Marc Jacobs<br />
C: Die Schauspielerin Chloë Sevigny<br />
Lösung rechte Seite unten<br />
Lösung<br />
aus Nr. 38<br />
1<br />
9<br />
8<br />
5<br />
4<br />
2<br />
7<br />
6<br />
3<br />
4<br />
1<br />
3<br />
5<br />
7<br />
5<br />
6<br />
2<br />
3<br />
7<br />
8<br />
1<br />
9<br />
4<br />
4<br />
3<br />
7<br />
6<br />
1<br />
9<br />
8<br />
5<br />
2<br />
7<br />
4<br />
6<br />
3<br />
2<br />
1<br />
8<br />
5<br />
6<br />
9<br />
4<br />
7<br />
7<br />
4<br />
6<br />
9<br />
2<br />
1<br />
3<br />
8<br />
5<br />
2<br />
1<br />
8<br />
5<br />
9<br />
4<br />
3<br />
7<br />
2<br />
1<br />
6<br />
2<br />
8<br />
5<br />
7<br />
9<br />
4<br />
6<br />
3<br />
1<br />
6<br />
1<br />
4<br />
2<br />
8<br />
3<br />
5<br />
7<br />
9<br />
6<br />
5<br />
9<br />
1<br />
9<br />
7<br />
3<br />
1<br />
6<br />
5<br />
4<br />
2<br />
8<br />
4<br />
3<br />
Foto Tracey Renee / Retna Ltd. Sudoku Zweistein<br />
2<br />
1<br />
6<br />
8<br />
7<br />
4<br />
1<br />
8<br />
5<br />
3<br />
5<br />
1<br />
8<br />
4<br />
Füllen Sie die leeren<br />
Felder des Quadrates so<br />
aus, dass in jeder Zeile,<br />
in jeder Spalte und in<br />
jedem mit stärkeren Linien<br />
gekennzeichneten<br />
3 × 3-Kasten alle Zah -<br />
len von 1 bis 9 stehen.
Um die Ecke gedacht Nr. 2138<br />
WAAGERECHT: 7 Heißer Anwärter fürs Wappensymbol der Verfechter<br />
der Ebenmäßigkeit 11 Bauernregelgemäß: Wie der …, so das<br />
Kraut 14 Antwort auf das Sich-leisten-können-Fragezeichen 18 Trägt<br />
den Kondor im Wappen: Spaniens globale Gürtellinie 19 Wird folgen,<br />
wo sich 7-senkr. häufen 20 Innere Ursache für Mogelabstinenz 21 Der<br />
Zweck vom Sinn: so was zu verarbeiten 22 Sein Strand: Tiefstseerand 24<br />
Die … reizt uns, nicht die Stufen (Goethe) 25 Eilands Republik, gerafft<br />
26 Auftrag im Strom-Gewerbe? Last aus Energieumsetzung 27 Teil vom<br />
Eigenen, spendiert von Mutter und Vater 28 Luftqualität im 19-waager.<br />
29 Liegt in Raterhand, kommt unter den Hammer 30 Ihretwegen das<br />
fünfte Rad am Wagen 32 Abendsitte mancherorts: in der … vor der …<br />
eindösen 33 Forderung der Trainer an Bolzplatz wie Velodrom 35 Einer<br />
zum Lesen, eine zum Hören, eines zum Halten 37 Eine Schau, ein<br />
Dienst, ein Speiseplatz 38 Mann – welcher Unfug hinterlässt viel Kopfschütteln?<br />
<strong>39</strong> Sehr gebeverhalten 40 Heringsverwendung, Vetorechtausübung<br />
41 Längst zu eigener Music, passend zum Raum, gestylt<br />
Lösung von Nr. 2136<br />
Kreuzworträtsel Eckstein<br />
SENKRECHT: 1 Niederung, Seil und Münze – zusammengenommen:<br />
Schlaufuchsens Hobby 2 Urnenfüllung nach Protestwahl 3 Hast und …<br />
sind Bruder und Schwester (Sprichwort) 4 Hoch soll er leben 5 In ihrem<br />
Blatt ist der Geschmack auf Zack 6 Ekbatana – was war das noch:<br />
irgendwas mit …? 7 Ausgesät auf der schwarzen Seite der Seele 8 Wahrer<br />
Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im … (R. W. Emerson)<br />
9 Eine Fabrizierde blühender Wirtschaft 10 Pharao mit viel Widerhall<br />
im Namen 11 Hier ärztlicher Rat, dort zarter Pflänzchen-Hort<br />
12 Rotiert im Dienst der Halmfrisur 13 Skepsis ist, was die Opposition<br />
im Parlament. Sie ist ebenso wohltätig wie … (Schopenhauer)<br />
15 Steinerne Farbe, auch an Meer und See gern gesehen 16 Anlässe für<br />
höchste Lampenfiebergrade 17 Bildungsweggenossenverbände 22 Verderbliche<br />
Stoffe 23 Passt zu Meer und Gebirge, andererseits zu Geld und<br />
Haus 27 Sprichwörtlich: … ist leichter als bitten 31 Schwacher Leuchte<br />
leichter Kern 34 Der flüstert uns: Sei nicht <strong>39</strong>-waager., wenn’s um die<br />
21-waager. geht! 36 Doppelter Tupfer in Frankreichs Sommer<br />
WAAGERECHT: 7 BLOEDELEI 10 BRIDGE = Brücke (engl.) 14 BEAGLE Snoopy (»Peanuts«) 16 SOS-Kinderdörfer 17 RANKUENEN 19 »Streicht Rio!«<br />
und STREICHT-RIO 20 REGAL 21 STORCH in Pala-st-Orch-ester 23 ROBERT Koch 24 KUEHN 25 DOENER 27 TROPF = Infusion 28 KORNSPEICHER<br />
mit Pinscher 29 LESEN 31 NIERE-ntisch 32 Aeroporto RIMINI »Federico Fellini« 35 ENTE in Karpf-ente-ich 36 ROSMARIN 41 (Lampen-)OEL<br />
(Matth. 25,3) 42 ESA 43 GESA von Gertrud (fries.) 44 NEURONEN 45 REUE 46 ANSTELLEN 47 TYRANN (Schiller, »Bürgschaft«)<br />
SENKRECHT: 1 PLATT 2 TELE 3 Flohspiel und »jmdm. einen FLOH ins Ohr setzen« 4 WIRR 5 MIKRO(-fon) 6 BENARES, Ganges 7 BESSERUNG<br />
8 DEICHKRONE 9 EST = Einkommensteuer 10 BAI 11 DUEBEL = Teufel (plattdt.) 12 Ent-GEGEN-kommen 13 WELTREISEN 15 GROUPIES 16 »junger<br />
SCHNOESEL« 18 NORDERNEY 22 REFERATE 24 KONTEN 26 Großer Hund / Canis Maior, im Mythos der Jagdhund des ORION 30 EILEN 33 MERAN<br />
(Lied »Die Tiroler sind lustig«) 34 Sudoku: NEUN 37 MULL-windeln 38 »We ARE …« <strong>39</strong> Per + RON = Perron 40 Sonnengott INTI<br />
Lösung von Nr. 2137<br />
1 2 3 4 5 6<br />
7 8 9 10 11 12 13<br />
14 15 16 17 18<br />
19 20<br />
21 22 23 24<br />
25 26 27<br />
28 29 30 31<br />
32 33 34 35 36<br />
37 38 <strong>39</strong><br />
40 41<br />
WAAGERECHT: 7 SCHACHZUEGE 11 Bark-asse ASSE = Bark 15 LEHRPLAENE 17 Joseph v. Eichendorff, »ABSCHIED« 18 PIA in Olym-pia 19 Udo<br />
Jürgens, »PARIS« 20 LAECHELN 21 TEDEUM 22 TIER-park = Zoo 23 HEBE in Fac-hebe-ne 25 BEFINDEN 27 CHOLERIKER 29 (Wein-)LESE 31 SEHEN<br />
32 ERZ in Förd-erz-eitraum, Güt-erz-ug 34 SMS 36 BARKEEPER 38 AGATHA Christie, Miss-Marple-Romane 40 LEGUANE 41 PROMENIEREN<br />
42 ENTGLEISUNG 43 DRIN – SENKRECHT: 1 SCHIEFLAGE 2 das und die KAPPEN 3 CHARME 4 SEELE 5 UEBERLEGEN 6 KEILE 7 SEPTEMBER 8 CLAUDE<br />
Debussy, Monet 9 <strong>ZEIT</strong>-punkt, Ewigkeit 10 UNSICHER 11 ASCHE 12 SCHERZ in Geräu-scherz-ielung 13 Roxette, »SHE’s got nothing on but the radio«<br />
14 GENIESSEN 16 RA<strong>DIE</strong>RUNG 17 Nick und AARON Carter 24 BISHER 26 NEPPER 28 HEROS Herakles 30 der SKAT im Skat-spiel 31 SEE 33 Theater-<br />
RANG 35 MARIA 37 ENGE in Flasch-enge-ist 38 amour und AMUR <strong>39</strong> TIDE<br />
1<br />
3 9<br />
Lösung der Stichfrage: B – Marc Jacobs trägt das Tattoo auf dem Oberarm. Ein Buchstabe war<br />
ihm zu simpel, deswegen ließ er sich sein Initial in Form des M&M-Männchens stechen<br />
2
Schach<br />
52<br />
a b c d e f g h<br />
Vor einiger Zeit nahm ich im Oberlandesgericht Bamberg<br />
an einer Gedenkfeier für Thomas Dehler teil, den Präsidenten<br />
dieses Gerichts von 1947 bis 1949 und danach ersten<br />
Justizminister der Bundesrepublik Deutschland.<br />
Vor allem durch den Festvortrag des Staatssekretärs im<br />
Justizministerium, Max Stadler, wurde mir dieser umstrittene<br />
Mann – Franke durch und durch – viel näher gebracht.<br />
Offenbar war Dehler ein »Mann der klaren Worte«,<br />
der in der Hitze des Gefechts schon einmal giftige<br />
Pfeile abschoss und dabei weder Freund noch Feind schonte,<br />
der sich aber auch stets mutig zu seiner jüdischen Frau<br />
bekannte und sich dem Nationalsozialismus widersetzte.<br />
Gleichzeitig sei er im privaten Bereich und in der Familie<br />
liebenswürdig und bescheiden gewesen und fuhr lieber mit<br />
dem eigenen Käfer statt mit der Staatslimousine vor.<br />
Und vermutlich hätte Sigmund Freud seine Freude an ihm<br />
gehabt. Als man Dehler einmal bat, in seinem Vortrag gemäßigt<br />
zu bleiben, soll er geantwortet haben: »Ach, wissen<br />
Sie, ich nehme mir ja immer das Beste vor, aber wenn ich<br />
am Rednerpult stehe, dann spricht nicht mehr ›er‹, sondern<br />
›es‹ aus mir.« Und sein Vermächtnis laut Max Stadler?<br />
»Rechtspolitik muss man mit heißem Herzen und kühlem<br />
Verstand zugleich betreiben!«<br />
So wie der Niederbayer Stadler Schach spielt.<br />
Mit welcher petite combinaison gewann dieser als Weißer<br />
am Zug gegen Alfred Eder mindestens die Dame?<br />
Lösung aus<br />
Nr. 38<br />
Wie eroberte der opferfreudige Weiße am Zug Haus und Hof<br />
von Schwarz? Nach dem Donnerschlag 1.Tg8+!! gab Schwarz<br />
auf, weil er nach 1...Kxg8 und dem Damenrückzug 2.Dg1+! Kf8<br />
3.Dg7+ Ke8 4.Dg8+ Kd7 5.Dxf7+ Kd8 6.La5+! bald matt ist<br />
Jetzt online Schach spielen unter www.zeit.de/schach<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
Spiele<br />
Lebensgeschichte<br />
Er kam von ganz unten. Als er sieben Jahre alt war, starb seine schöne und lungenkranke<br />
Mutter, die vom Mitleid ihrer Nachbarn gelebt hatte. Sein Vater,<br />
Alkoholiker und ständig auf Arbeitssuche, übergab den Jungen seiner Halbschwester<br />
und verschwand auf Nimmerwiedersehen. Die junge Frau schlug<br />
sich mühsam als Gehilfin einer Modistin durch, sie kümmerte sich nicht um<br />
den ungewollten Zögling, ließ sogar aus Zorn über ihn seine Staatsangehörigkeit<br />
annullieren. Nun war er staatenlos – bis an sein Lebensende. Der Zwölfjährige,<br />
der erst spät lesen und schreiben lernte, riss aus und vagabundierte durch<br />
eine Großstadt im Aufbruch. Schließlich landete er in einer Besserungsanstalt.<br />
Ein Pfarrer, der sich des »Wilden« annahm, erkannte seine überragende Begabung<br />
und ermutigte ihn zu einer Ausbildung. Nach einer kurzen Lehre gelang<br />
ihm der Sprung an eine renommierte Akademie. Dort fand er Freunde und<br />
Förderer, verblüffte durch seine Beobachtungsgabe und durch Proben seines<br />
Könnens. Und er fügte seinem Namen ein »n« zu. Mit seiner über alles geliebten<br />
Gefährtin aus einer der besten bürgerlichen Familien zog er aus der dunstigen<br />
Ebene in ein freundliches Hügelland, um im Kontakt mit der Natur zu<br />
arbeiten. Trotz hoher Auszeichnungen und erster Erfolge lebte das Paar oft von<br />
der Hand in den Mund. Schließlich folgte er seiner Sehnsucht nach dem besonderen<br />
Licht , der Weite und Härte alpiner Landschaften und siedelte sich in<br />
einer bäuerlichen Gemeinde an. Seine symbolisch überhöhten Szenen aus dem<br />
einfachen, naturnahen Leben brachten ihm internationale Anerkennung. Noch<br />
einmal zwangen ihn Schulden und die Furcht vor Ausweisung zum Wechsel in<br />
ein Hochtal. Er erwanderte seine neue Heimat, ging der Adlerjagd nach, zog<br />
mit seinen Utensilien an exponierte Orte und arbeitete rastlos in Wind und<br />
Wetter. Ein grandioses Projekt sollte sein Werk krönen: Mit allen Mitteln der<br />
Kunst und lebenden Zugaben wollte er für eine überwältigende Landschaft<br />
werben. Doch der Plan scheiterte an den hohen Kosten. Als er in den besten<br />
Jahren an einer Bauchfellentzündung starb, hatte der Niemand sein Lebensziel<br />
erreicht: Ruhm als Künstler und gesellschaftliche Anerkennung. Wer war’s?<br />
Lösung aus Nr. 38<br />
Oriana Fallaci (1929 bis 2006) stammte aus Florenz, lebte viel in New York, war<br />
Kriegsreporterin, Journalistin, Schriftstellerin (»Ein Mann«) und Islam-Kritikerin<br />
Logelei<br />
Luise ist sehr kontaktfreudig und hat auf ihrer Kaffeefahrt in die Eifel fünf<br />
neue Bekanntschaften gemacht. Lustigerweise hat jeder, inklusive ihrer selbst,<br />
etwas anderes gekauft, und alle kommen aus einer anderen Stadt. Wieder zu<br />
Hause, kramt sie ihr Tagebuch hervor, wo sie sich während der Fahrt Notizen<br />
gemacht hat:<br />
Der Reisebus hielt in sechs Städten, unter anderem in Ulm.<br />
Maria stieg später in den Reisebus als Walter.<br />
Die Heizdecke wurde nicht von einer Person aus Baden-Württemberg gekauft.<br />
Weder die Person aus Karlsruhe noch die aus Pirmasens kaufte eine Tischdecke.<br />
Die Person, die in Regensburg zustieg, kaufte ein Kochbuch.<br />
Roswitha kommt aus Stuttgart.<br />
Die Strümpfe wurden von einem Mann, das Beauty-Set von einer Frau gekauft.<br />
Die weiteste Anreise hatte Gunter, die kürzeste Ursula.<br />
Die Frau aus Ingolstadt kaufte eine Salatschleuder.<br />
Jetzt versucht sie sich zu erinnern, wer aus welcher Stadt kam und wer was<br />
gekauft hatte. Können Sie das für sie herausfinden?<br />
Lösung aus Nr. 38<br />
Die Vögel haben gerechnet: 2929292+4524524+1766179 = 9219995<br />
Schach Helmut Pfleger Lebensgeschichte Wolfgang Müller Logelei Zweistein
Scrabble<br />
Ein beim Scrabble häufig zu beobachtendes<br />
Phänomen ist die Ausgrenzung des Nordwestens<br />
des Spielfeldes. In der Regel geschieht<br />
das Verbauen von Anlegemöglichkeiten jedoch<br />
nicht vorsätzlich. Die hier abgebildete Konstellation<br />
stammt aus einer Partie zwischen<br />
Claudia Aumüller und mir. Nach den ersten<br />
vier Zügen MOLY, MUSIK, EUTER und<br />
MONDÄN waren die Weichen quasi schon<br />
gestellt. In der siebten Spalte ließ sich zwar<br />
noch das O auf H7 in ein Wort einbinden,<br />
jedoch nur unter Verzicht auf Belegung eines<br />
Wortprämienfeldes. Tatsächlich konnte sich<br />
kein Spieler für diese Stelle erwärmen.<br />
Obendrein erlauben auch das F auf B14 sowie<br />
das B auf D12 nur einfach zählende Züge. In<br />
derartigen Situationen ist die Taktik am<br />
Punktestand zu orientieren. Wer deutlich<br />
hinten liegt, ist gut beraten, beizeiten eine Eröffnung<br />
zu wagen.<br />
Mein Glück war, dass ich den Abstand – trotz<br />
semiattraktiver Buchstabenkombination – auf<br />
einen Schlag gehörig verkürzen konnte. Wie?<br />
Dreifacher Wortwert<br />
Doppelter Wortwert<br />
Dreifacher Buchstabenwert<br />
Doppelter Buchstabenwert<br />
Lösung aus Nr. 38<br />
Mit der ESELIN auf 11H-11M kamen wir auf<br />
exakt 30 Punkte<br />
Es gelten nur Wörter, die im Duden, »Die<br />
deutsche Rechtschreibung«, 25. Auflage,<br />
verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen.<br />
Die Scrabble-Regeln finden Sie im<br />
Internet unter www.scrabble.de<br />
Impressum<br />
Im nächsten Heft<br />
Seelenlose Inhalte, Quotendruck, keine<br />
Ideen und überall nur Talkshows – wie gut ist<br />
das deutsche Fernsehen eigentlich?<br />
Die Wahrheit lautet: Besser als sein Ruf<br />
Unterwegs im Vatikan mit dem Künstler<br />
Christoph Brech<br />
Diese Woche in der iPad-App »<strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>«:<br />
Breaking the Silence: Israelische Soldaten<br />
brechen ihr Schweigen über ihre Erlebnisse als<br />
Wehrpflichtige – auch mit Videobotschaften<br />
Scrabble Sebastian Herzog Foto Christian Grund 53<br />
1<br />
3 9<br />
Chefredakteur Christoph Amend<br />
Stellvertr. Chefredakteur Matthias Kalle<br />
Art Director Katja Kollmann<br />
Creative Director Mirko Borsche<br />
Berater Andreas Wellnitz (Bild)<br />
Textchefin Christine Meffert<br />
Redaktion Jörg Burger, Heike Faller, Ilka Piepgras,<br />
Tillmann Prüfer (Style Director), Elisabeth Raether,<br />
Jürgen von Rutenberg, Matthias Stolz<br />
Mitarbeit: Markus Ebner (Paris), Elisabeth von Thurn und<br />
Taxis (New York), Annabel Wahba<br />
Fotoredaktion Milena Carstens (verantwortlich i.V.),<br />
Michael Biedowicz<br />
Gestaltung Nina Bengtson, Jasmin Müller-Stoy,<br />
Mitarbeit: Gianna Pfeifer<br />
Autoren Marian Blasberg, Wolfgang Büscher, Carolin Emcke,<br />
Lara Fritzsche, Herlinde Koelbl, Louis Lewitan, Harald<br />
Martenstein, Paolo Pellegrin, Lina Scheynius, Wolfram<br />
Siebeck, Jana Simon, Juergen Teller, Moritz von Uslar,<br />
Günter Wallraff, Roger Willemsen<br />
Produktionsassistenz Margit Stoffels<br />
Korrektorat Mechthild Warmbier (verantwortlich)<br />
Dokumentation Mirjam Zimmer (verantwortlich)<br />
Herstellung Torsten Bastian (verantwortlich),<br />
Oliver Nagel, Frank Siemienski<br />
Druck Prinovis Ahrensburg GmbH<br />
Repro Twentyfour Seven Creative Media Services GmbH<br />
Anzeigen <strong>DIE</strong> <strong>ZEIT</strong>, Matthias Weidling<br />
(Gesamtanzeigenleitung), Nathalie Senden<br />
Empfehlungsanzeigen iq media marketing,<br />
Axel Kuhlmann, Michael Zehentmeier<br />
Anzeigenpreise <strong>ZEIT</strong>magazin, Preisliste Nr. 6 vom 1. 1. <strong>2012</strong><br />
Anschrift Verlag Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG,<br />
Buceriusstraße, Eingang Speersort 1, 20095 Hamburg;<br />
Tel.: 040/32 80-0, Fax: 040/32 71 11; E-Mail: DieZeit@zeit.de<br />
Anschrift Redaktion <strong>ZEIT</strong>magazin, Dorotheenstraße 33,<br />
10117 Berlin; Tel.: 030/59 00 48-7, Fax: 030/59 00 00 <strong>39</strong>;<br />
www.zeitmagazin.de, www.facebook.com/<strong>ZEIT</strong>magazin,<br />
E-Mail: zeitmagazin@zeit.de<br />
2
Frau Schwan, was haben Sie aus Ihren<br />
zwei vergeblichen Kandidaturen für das<br />
Amt der Bundespräsidentin gelernt?<br />
Das politische Leben ist wölfisch, man darf<br />
nicht zu vertrauensselig sein. Meine Gegner<br />
haben mich als einsame, ehrgeizige Ziege, als<br />
professoral und abgehoben beschrieben. Das<br />
sind unschöne Bezeichnungen. Viele konnten<br />
mir überhaupt nicht abnehmen, dass ich<br />
wirklich um der Demokratie willen kandidiert<br />
habe. Ich galt als Einzelkämpferin, auch<br />
weil die SPD-Spitze nicht geschlossen hinter<br />
mir stand. Um den Menschen prinzipiell zu<br />
vertrauen, muss man stark genug sein, auch<br />
solche Enttäuschungen zu verkraften. Wenn<br />
ich mich im Übrigen sehr über eine Person<br />
ärgere, sage ich mir: Ist auch ein Gotteskind,<br />
damit musst du umgehen. Dann werde ich<br />
gelassener. Ich habe aber während der Kandidatur<br />
auch überaus viel Zuwendung erlebt,<br />
viele Menschen auf der Straße bedanken sich<br />
noch heute, obwohl sie gar keinen Anlass<br />
haben, mir irgendwas ums Maul zu schmieren.<br />
Und in der SPD gab es natürlich auch<br />
große Unterstützung.<br />
Wie haben Sie die Niederlagen weggesteckt?<br />
Das Gefühl zu verlieren kannte ich aus schwierigeren<br />
Situationen, vor allem von der Krebskrankheit<br />
meines ersten Mannes, und insofern<br />
wusste ich: Das wirft dich nicht aus der Bahn.<br />
Der Tod eines nahestehenden Menschen nach<br />
drei Jahren Krankheit ist ja viel gravierender.<br />
Überdies weckt er fast immer Schuldgefühle,<br />
die man nicht steuern kann.<br />
Warum Schuldgefühle?<br />
Ich war einige Monate vor dem Tod meines<br />
Mannes in eine emotionale Distanz zu ihm<br />
geraten und habe das als einen Akt der Untreue<br />
erlebt. Nachdem ich wie eine Löwin um<br />
sein Überleben gekämpft hatte, war ich erschrocken<br />
über meine innere Unzuverlässigkeit,<br />
dabei ist Verlässlichkeit für mich ein ganz<br />
hoher Wert. Das hat mich in große Verzweiflung<br />
gestürzt. Ich konnte rein gar nichts Positives<br />
mehr sehen, alles war schwarz. Eigentlich<br />
wollte ich nur weg sein, nicht mehr leben,<br />
war ausgebrannt. Ich habe gebetet, aber gedacht,<br />
dieser Gott liebt nicht. Nach außen<br />
habe ich funktioniert, kein Mensch wäre darauf<br />
gekommen, dass ich depressiv bin, ich<br />
war Dekanin, erfolgreich, alles toll. Zu Hause<br />
habe ich geheult. Mein Sohn war damals 14<br />
Jahre, meine Tochter zwölf. Sie spürten das<br />
natürlich, auch wenn ich nie vor ihnen weinte.<br />
Ich muss ganz klar sagen: Der Glaube allei-<br />
54<br />
Das war meine Rettung<br />
»Glaube und<br />
Psychoanalyse«<br />
Gesine Schwan über das Verkraften von<br />
Niederlagen, den Sturz in tiefe<br />
Verzweiflung und ihren Heilungsweg<br />
Gesine Schwan,<br />
69, geboren in Berlin, ist Politikwissenschaftlerin<br />
und prominentes<br />
SPD-Mitglied. 2004 und 2009<br />
kandidierte sie für das Amt der<br />
Bundespräsidentin und scheiterte<br />
beide Male an Horst Köhler. Sie<br />
ist Präsidentin der Humboldt-<br />
Viadrina School of Governance in<br />
Berlin. Schwan ist verheiratet<br />
und hat zwei Kinder aus erster Ehe<br />
Herlinde Koelbl<br />
gehört neben dem Psychologen<br />
Louis Lewitan, Lara Fritzsche<br />
und Ijoma Mangold zu den<br />
Interviewern unserer Gesprächsreihe.<br />
Die renommierte Fotografin<br />
wurde in Deutschland auch<br />
durch ihre Interviews bekannt<br />
ne hätte mir nicht geholfen. Das ist mir schon<br />
wichtig, weil die Gesellschaft nach wie vor<br />
psychische Erkrankungen als Schwäche interpretiert.<br />
Man braucht professionelle Hilfe von<br />
außen. Die Verbindung von Glaube und Psychoanalyse<br />
hat mich gerettet.<br />
Hatten Sie Angst, so krank zu werden wie<br />
Ihre Mutter?<br />
Ja, das war meine Sorge. Meine Mutter war<br />
manisch-depressiv. Meine Gefühle hatten sich<br />
mit einer ganzen Reihe von anderen Problemen<br />
verknotet. Ich wollte zum Beispiel nie<br />
sehen, dass mir Menschen wehtaten, die ich<br />
lieb hatte. Man blendet das aus, und dann<br />
entsteht eine negative Hypothek, die selbstzerstörerisch<br />
werden kann. Diesen psychologischen<br />
Zusammenhang kann man nicht<br />
durch den Glauben oder durch das Lesen von<br />
Psalmen begreifen. Da spielt sich etwas ab,<br />
was man erfühlen muss. Bei der Erinnerung<br />
daran habe ich körperlich reagiert: gezittert,<br />
geweint, völlig spontan. Der Heilungsweg<br />
war für mich insgesamt aber ein schöner Weg,<br />
ich habe nie gelitten in der Analyse.<br />
Wie haben Sie sich verändert?<br />
Ich bin persönlich konfliktfähiger geworden.<br />
Als Kind hatte ich in meiner Familie die Rolle<br />
der Versöhnerin. Ich hatte immer Angst, dass<br />
alles auseinanderfliegt. Wir hatten ein Boot,<br />
und sonnabends segelten wir manchmal auf<br />
dem Tegeler See, sangen viel, auch mehrstimmig,<br />
das machte mir Freude. Aber wenn vier<br />
temperamentvolle Familienmitglieder ein<br />
Wochenende auf einem Boot verbringen,<br />
führt das fast immer zu Krach. Also habe ich,<br />
wenn es mulmig wurde, das Liederbuch auf<br />
den Schoß genommen und gesungen, alle<br />
sollten einstimmen und aufhören zu streiten,<br />
weil ich darunter sehr gelitten habe. Bis heute<br />
ist mir das Glück meiner Familie sehr wichtig.<br />
Das nächste Gala-Dinner und noch eine Auszeichnung<br />
bedeuten mir nicht so viel.<br />
Ihr Gottvertrauen ist geblieben?<br />
Es gibt auch Zweifel, aber wenn ich die Summe<br />
meines Lebens nehme, bin ich darin eher<br />
bestärkt worden. Auch in total harten Momenten<br />
wirst du getragen, du fällst nicht ins<br />
Nichts. Ich weiß, dass der Glaube, bei aller<br />
eigenen Bemühung, letztlich eine Gnade ist.<br />
In Momenten großer Bedrängnis kann man<br />
den lieben Gott schon anrufen, man sollte ihn<br />
nur nicht behelligen, wenn es einigermaßen<br />
gut geht. Aber danken darf man immer.<br />
Interview und Foto von Herlinde Koelbl



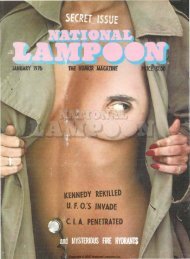


![[270].pdf 37407KB Sep 02 2010 09:55:57 AM - ElectronicsAndBooks](https://img.yumpu.com/50350834/1/185x260/270pdf-37407kb-sep-02-2010-095557-am-electronicsandbooks.jpg?quality=85)
![draaien, A Viruly 1935 OCR c20130324 [320]. - ElectronicsAndBooks](https://img.yumpu.com/49957773/1/190x252/draaien-a-viruly-1935-ocr-c20130324-320-electronicsandbooks.jpg?quality=85)



![20051110 c20051031 [105].pdf 35001KB Feb 18 2009 08:46:32 PM](https://img.yumpu.com/48687202/1/190x253/20051110-c20051031-105pdf-35001kb-feb-18-2009-084632-pm.jpg?quality=85)





