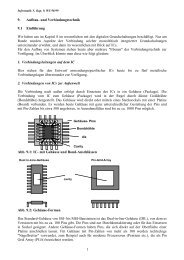Einführung in die elektrische Antriebstechnik
Einführung in die elektrische Antriebstechnik
Einführung in die elektrische Antriebstechnik
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ANTEIN, J.Best, WS2000/01 Seite 5<br />
Hauptschütz be<strong>die</strong>nen soll. Auf jeden Fall ist es wünschenswert, wenn <strong>die</strong> Hilfsenergieversorgung<br />
auch dann aufrecht erhalten bleibt, wenn der Antrieb <strong>in</strong>folge e<strong>in</strong>er Störung abschaltet.<br />
Nur so kann <strong>die</strong> Kommunikation mit dem Leitsystem aufrecht erhalten bleiben.<br />
Es gibt auch Konzepte das Netzteil nicht, wie <strong>in</strong> Bild 2 mit 230V Wechselspannung zu versorgen,<br />
sondern mit 24V Gleichspannung. Dies ist zum Teil bei den Antriebsregelgeräten <strong>in</strong><br />
Werkzeugmasch<strong>in</strong>en üblich. Insbesondere, wenn man auch <strong>die</strong> Steuerung mit 24V Gleichspannung<br />
versorgt, ist es so viel leichter möglich, bei Bedarf <strong>die</strong> gesamte Signalverarbeitung<br />
bei Netzspannungsausfall am Leben zu erhalten.<br />
Bei über Wechselrichter betriebenen Drehstromantrieben („Frequenzumrichter“) gibt es meist<br />
e<strong>in</strong>en Gleichspannungszwischenkreis, der außerdem über Kondensatoren gepuffert ist.<br />
Manchmal wird das Netzteil dann über <strong>die</strong>sen Zwischenkreis versorgt. Bei e<strong>in</strong>em Netzspannungsausfall<br />
kann dann wenigstens noch für <strong>die</strong> Zeit, <strong>in</strong> der noch Energie im Zwischenkreis<br />
ist, <strong>die</strong> Hilfsenergieversorgung aufrecht erhalten werden.<br />
Obwohl also das Netzteil im allgeme<strong>in</strong>en e<strong>in</strong> Schattendase<strong>in</strong> führt, ist das richtige Konzept<br />
doch wichtig für das Gesamtsystem.<br />
3.3 Konventionelle Schnittstelle<br />
Auf der „Anwenderseite“ hat das Antriebsregelgerät meist e<strong>in</strong>e konventionelle Schnittstelle<br />
(B<strong>in</strong>är I/O, meist <strong>in</strong> 24V-Technik, analoge Sollwerte<strong>in</strong>gänge, eventuell auch Analogausgänge).<br />
Bei e<strong>in</strong>er typischen konventionellen Schnittstelle bekommt der Antrieb e<strong>in</strong>en analogen<br />
Drehzahlsollwert (meist ±10V) und e<strong>in</strong>ige b<strong>in</strong>äre Signale wie z.B. „EIN/AUS“,<br />
„START/STOPP“ etc. Der Antrieb liefert b<strong>in</strong>äre Status<strong>in</strong>formation z.B. „BEREIT“, „STÖ-<br />
RUNG“ etc. an <strong>die</strong> Steuerung.<br />
Darüberh<strong>in</strong>aus wird <strong>die</strong> konventionelle Schnittstelle auch zur E<strong>in</strong>/Ausgabe von Prozesssignalen<br />
benötigt. Beispiele s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> B<strong>in</strong>ärausgang zum Ansteuern e<strong>in</strong>er mechanischen Bremse,<br />
B<strong>in</strong>äre<strong>in</strong>gänge zum Abfragen von Endschaltern, (eventuell spezielle) Analoge<strong>in</strong>gänge zum<br />
Erfassen von Temperaturen etc.<br />
3.4 Feldbusschnittstelle<br />
Moderne Antriebsregelgeräte s<strong>in</strong>d (meist optionell) mit e<strong>in</strong>er Feldbusschnittstelle ausgestattet.<br />
Dann bekommt das Antriebsregelgerät se<strong>in</strong>e Sollwerte und Steuerbefehle (E<strong>in</strong>/Aus etc.)<br />
über serielle Telegramme vom übergeordneten Leitsystem (Steuerung) und liefert umgekehrt<br />
auch auf <strong>die</strong>sem Wege Istwerte und Status<strong>in</strong>formation an das Leitsystem zurück. Eventuell<br />
können über <strong>die</strong> Feldbusschnittstelle <strong>die</strong> Antriebsregelgeräte auch untere<strong>in</strong>ander Information<br />
austauschen. Ob <strong>die</strong>s möglich ist, hängt von der Art des Feldbussystems ab. Die Feldbusschnittstelle<br />
macht <strong>die</strong> konventionelle Schnittstelle, soweit sie nicht für Prozesssignale benötigt<br />
wird, überflüssig. Sie spart nicht nur Verkabelungsaufwand, sondern ermöglicht z.B. auch<br />
noch nachträgliche Änderungen im Signalaustausch, ohne dass <strong>die</strong> Verkabelung geändert<br />
werden muss. Ohne Mehraufwand kann zusätzliche Information übertragen werden. So ist<br />
meist e<strong>in</strong> Verstellen von Parametern möglich und es kann detaillierte Diagnose<strong>in</strong>formation an<br />
<strong>die</strong> Leitebene geliefert werden. Schließlich können Soll- und Istwerte mit höherer Auflösung<br />
übertragen werden, als <strong>die</strong>s über <strong>die</strong> konventionelle Schnittstelle praktikabel wäre.