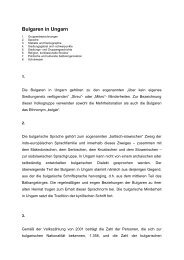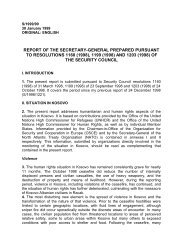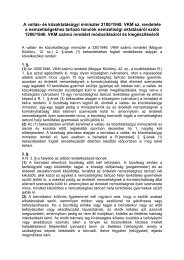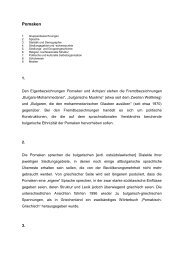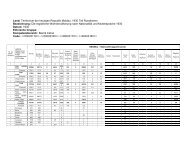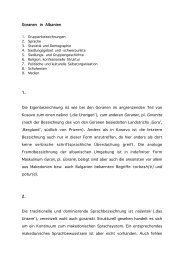Vlachen: Aromunen und Meglenorumänen in Makedonien 1 ...
Vlachen: Aromunen und Meglenorumänen in Makedonien 1 ...
Vlachen: Aromunen und Meglenorumänen in Makedonien 1 ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Vlachen</strong>: <strong>Aromunen</strong> <strong>und</strong> <strong>Meglenorumänen</strong> <strong>in</strong> <strong>Makedonien</strong><br />
1. Gruppenbezeichnungen<br />
2. Sprache<br />
3. Statistik <strong>und</strong> Demographie<br />
4. Siedlungsgebiet <strong>und</strong> -schwerpunkte<br />
5. Siedlungs- <strong>und</strong> Gruppengeschichte<br />
6. Religion, konfessionelle Struktur<br />
7. Politische <strong>und</strong> kulturelle Selbstorganisation<br />
8. Schulwesen<br />
9. Medien<br />
1.<br />
Das Wort Vlache dient als Fremdbezeichnung für <strong>Aromunen</strong> <strong>und</strong> <strong>Meglenorumänen</strong>:<br />
Vlaf (pl. Vlasi) heißen sie im Slawomakedonischen, Vlah (pl. Vlasi) im Serbischen<br />
<strong>und</strong> Bulgarischen, Vláchos (pl. Vláhi) im Griechischen, Ullah (pl. Ullahlar) im<br />
Türkischen. Andere Namen wie Kutsovlachen, Makedorumänen, haben <strong>in</strong><br />
<strong>Makedonien</strong> weniger Verbreitung gef<strong>und</strong>en, eher bekannt ist das serbische Z<strong>in</strong>zaren<br />
(c<strong>in</strong>cari). Die Eigenbezeichnung der <strong>Aromunen</strong> ist Armân (pl. Armâń i ) – diejenige der<br />
<strong>Meglenorumänen</strong> Vlau (pl. Vlaş i ).<br />
2.<br />
Das Aromunische gilt neben dem Meglenorumänischen, dem Istrorumänischen <strong>und</strong><br />
dem Dakorumänischen als e<strong>in</strong>er der vier Dialekte des Balkanromanischen<br />
(Rumänischen im weitesten S<strong>in</strong>ne). In der Republik <strong>Makedonien</strong> existiert e<strong>in</strong>e<br />
standardisierte Rechtschreibung, sie wird jedoch von vielen <strong>Aromunen</strong> Rumäniens<br />
<strong>und</strong> Griechenlands nicht akzeptiert.
3.<br />
Laut Volkszählung von 1994 bezeichneten sich 8.462 Personen als <strong>Vlachen</strong>, 1991<br />
sogar nur 7.764.<br />
4.<br />
Die <strong>Aromunen</strong> <strong>Makedonien</strong>s s<strong>in</strong>d vor allem im Südwesten des Landes zu f<strong>in</strong>den: Im<br />
Pelister-Gebirge (Pelagonien), genauer <strong>in</strong> den Dörfern Magarevo, Trnovo, Malovište,<br />
Nižopole, Gopeš sowie <strong>in</strong> Bitola. Die Dörfer am Pelister stehen heute im W<strong>in</strong>ter fast<br />
leer haben heute vor allem Funktion von Sommerfrischen. Größte Siedlung der<br />
<strong>Aromunen</strong> ist Kruševo (aromunisch Cruşuva) bei Prilep. Daneben gibt es zahlreiche<br />
Dörfer im Raum um Štip, Sveti Nikole <strong>und</strong> V<strong>in</strong>ica; Städte mit großem aromunischen<br />
Bevölkerungsanteil s<strong>in</strong>d auch Skopje <strong>und</strong> Veles. Die meglenitischen <strong>Vlachen</strong> leben<br />
ursprünglich <strong>in</strong> den Gebirgen Kožuf <strong>und</strong> Páiko. Ihr Siedlungsgebiet <strong>in</strong> der Republik<br />
<strong>Makedonien</strong> ist auf das verlassene Dorf Huma beschränkt, dessen Bevölkerung nach<br />
Gevgelija abgewandert ist.<br />
5.<br />
Die Rekonstruktion der Herkunft der <strong>Aromunen</strong> <strong>und</strong> <strong>Meglenorumänen</strong> fällt aufgr<strong>und</strong><br />
des Mangels historischer Belege früher Balkangeschichte <strong>und</strong> des späten E<strong>in</strong>setzens<br />
von Schriftzeugnissen schwer. Durch die Vermittlung des germanischen Wortes<br />
„Vlach“ durch das Slawische s<strong>in</strong>d <strong>Vlachen</strong> im 8. Jahrh<strong>und</strong>ert <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er griechischen<br />
Aufzeichnung des Klosters Kastamonítu auf dem Athos als Vlachorynchíni<br />
(Βλαχορυγχίνοι) erstmals schriftlich nachzuweisen. Bei der Lokalisierung der<br />
aromunischen „Urheimat“ stehen sich Theorien von der Autochthonie <strong>in</strong> ihren<br />
heutigen Stammgebieten (P<strong>in</strong>dos) <strong>und</strong> Theorien von ihrer E<strong>in</strong>wanderung aus<br />
nördlichen Gebieten gegenüber.<br />
Die <strong>Meglenorumänen</strong> (auch meglenitischen <strong>Vlachen</strong>) heben sich vor allem durch<br />
unterschiedliche Lebensweise (halbagrarisch, Seidenraupenzucht), Dialekt <strong>und</strong><br />
materielle Kultur (v.a. makedoslawische Bee<strong>in</strong>flussung) von den <strong>Aromunen</strong> ab.
E<strong>in</strong>igkeit herrscht darüber, dass sie sich später von der gesamtromanischen<br />
Bevölkerung des Balkans gelöst haben <strong>und</strong> daher länger mit den späteren<br />
Dakorumänen zusammen lebten als die <strong>Aromunen</strong>, weshalb das<br />
Meglenorumänische dem Dakorumänischen näher steht als das Aromunische.<br />
Unabhängig von den Betrachtungen zur aromunischen Ethnogenese kann der<br />
Raum, <strong>in</strong> dem sich aromunische Kultur <strong>und</strong> Sprache zuletzt nachweislich am<br />
längsten ausbilden konnte, e<strong>in</strong>deutig auf das P<strong>in</strong>dos-Gebirge festgelegt werden.<br />
Ursprünglich Wanderhirten, wurden sie <strong>in</strong> großen Sommersiedlungen sesshaft <strong>und</strong><br />
widmen sich dem Handel <strong>und</strong> Warentransport. Ihre Zentren, die bis heute oft nur<br />
noch als Wüstungen vorzuf<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>d, erlebten im 17. Jahrh<strong>und</strong>ert <strong>und</strong> 18.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert ihre demographische <strong>und</strong> wirtschaftliche Blüte. Die meist re<strong>in</strong> christliche<br />
Bevölkerung, der seitens der osmanischen Herrscher vor allem steuerliche Vorrechte<br />
zugestanden wurden, zeichnete sich durch Wohlhabenheit <strong>und</strong> hohen Bildungsstand<br />
aus. In ihren Siedlungen gab es ke<strong>in</strong>e türkischen Verwaltungsgebäude, Moscheen<br />
oder Hamams. In Moschópolis (heute Voskopojë <strong>in</strong> Albanien) war es den<br />
osmanischen Türken verboten, <strong>in</strong> der Stadt zu wohnen. Die frühesten<br />
Auswanderungen aus ihren Stammgebieten (im 15./16. Jahrh<strong>und</strong>ert) waren durch<br />
Epidemien <strong>und</strong> Überweidung motiviert, später erfolgte e<strong>in</strong>e starke Abwanderung der<br />
urbanisierten Bevölkerung <strong>in</strong> Folge der aromunischen Handelsexpansion (17./18.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert) <strong>in</strong> städtische Zentren des gesamten südosteuropäischen Raumes. In<br />
diese Zeit fallen auch die erste Ansiedlungen von <strong>Aromunen</strong> <strong>in</strong> vielen Städten der<br />
späteren Republik <strong>Makedonien</strong>s. Vor allem seit Ende des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts nahm<br />
das wirtschaftliche Wohlergehen vieler aromunischer Geme<strong>in</strong>den e<strong>in</strong> abruptes Ende,<br />
als albanisch-muslimische Plünderer, allen voran Ali Pascha (1744–1822),<br />
begannen, aromunische Sommerdörfer <strong>und</strong> -städte <strong>in</strong> den Gebirgen zu zerstören.<br />
Neuansiedlungen erfolgten bevorzugt dort, wo sich die gelernte Tätigkeit fortsetzen<br />
ließ, im Fall urbaner Bevölkerung also <strong>in</strong> Städten, im Fall der Hirtenbevölkerung <strong>in</strong><br />
hohen Gebirgen. Die geflohenen urbanisierten <strong>Aromunen</strong> ließen sich teilweise <strong>in</strong><br />
bereits bestehenden Siedlungen nieder wie z.B. <strong>in</strong> <strong>in</strong> der bis heute größten<br />
aromunischen Siedlung der Republik <strong>Makedonien</strong> Kruševo. Teilweise gründeten sie<br />
aber auch neue re<strong>in</strong> aromunische Ortschaften wie z.B. Magarevo, Trnovo, Nižepole<br />
am Pelister. Die geflohenen Hirten ließen vorzugsweise östlich des Vardar nieder, im<br />
ganzen östlichen <strong>Makedonien</strong> <strong>und</strong> <strong>in</strong> Ost-Rumelien
6.<br />
Sowohl die <strong>Aromunen</strong> als auch die meglenitischen <strong>Vlachen</strong> der Republik s<strong>in</strong>d<br />
orthodoxe Christen. Die Kirche des Heiligen Peter (Sumchetru) <strong>in</strong> Malovište sowie<br />
die Kirchen des Heiligen Demeter (Dimitri) <strong>in</strong> Magarevo <strong>und</strong> Bitola wurden als<br />
"griechische" Kirchen aufgebaut. Von rumänophilen <strong>Aromunen</strong> h<strong>in</strong>gegen wurden die<br />
Heilandskirche (Sutira) <strong>in</strong> Gopeš <strong>und</strong> die Kirche des Heiligen Konstant<strong>in</strong> <strong>und</strong> der<br />
Heiligen Helena (Custand<strong>in</strong> şi Elena) <strong>in</strong> Bitola erbaut. Die Streitereien zwischen<br />
rumänisch <strong>und</strong> griechisch ges<strong>in</strong>nten <strong>Aromunen</strong> wurden kompliziert, als es den<br />
Bulgaren gelang, e<strong>in</strong>e unabhängige Kirche mit eigenem Millet-Status <strong>in</strong>nerhalb des<br />
Osmanischen Reiches zu erlangen. Kirchen <strong>und</strong> Schulen waren somit nicht nur von<br />
griechischen <strong>und</strong> rumänischen Nationalbewegungen bee<strong>in</strong>flusst, sondern auch von<br />
der bulgarischen. E<strong>in</strong>e Besonderheit unter den aromunischen E<strong>in</strong>richtungen des<br />
Landes s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Bitola der „Cimitir armânescu“ (Aromunischer Friedhof), der auch auf<br />
se<strong>in</strong>em E<strong>in</strong>gangstor als solcher ausgezeichnet ist. In der Mitte dieses Kirchhofs liegt<br />
Apostol Margarit begraben, nicht weit von ihm Constant<strong>in</strong> Belimace <strong>und</strong> schließlich<br />
auch Milton Manaki. In den rumänischen Kirchen von Bitola <strong>und</strong> Kruševo wird<br />
gelegentlich <strong>in</strong> Aromunisch zelebriert.<br />
7.<br />
2001 <strong>und</strong> 2003 s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Skopje zwei aromunische M<strong>in</strong>derheitenparteien gegründet<br />
worden. Die zahlreichen regionalen aromunischen Vere<strong>in</strong>e s<strong>in</strong>d durch e<strong>in</strong>er<br />
Dachverband, der „Liga der <strong>Vlachen</strong>“, mite<strong>in</strong>ander verb<strong>und</strong>en. E<strong>in</strong>e starke Aktivität<br />
haben neuerd<strong>in</strong>gs aromunische Folkloregruppen entwickelt. Kulturelle <strong>und</strong> politische<br />
Veranstaltungen führen die <strong>Aromunen</strong> <strong>in</strong> der Republik <strong>Makedonien</strong> besonders am<br />
22.5. durch, dem Gedenktag der Anerkennung der <strong>Vlachen</strong> als Millet, der zum<br />
Nationalfeiertag der <strong>Aromunen</strong> erklärt wurde.
8.<br />
Die makedonische Regierung ermöglichte im März 1995 die E<strong>in</strong>führung fakultativer<br />
Kurse des Aromunischen an den Volksschulen. Zu dieser Zeit existierte bereits e<strong>in</strong><br />
Aromunisch-Kurs <strong>in</strong> Bitola. Bed<strong>in</strong>gung für das Zustandekommen der Kurse ist die<br />
M<strong>in</strong>destzahl von zehn Kursteilnehmern. Nach me<strong>in</strong>en eigenen Beobachtungen auf<br />
Kurzvisiten im Aromunisch-Unterricht ist der Erfolg noch mäßig zu nennen.<br />
Schulfibeln, aromunische Textsammlungen <strong>und</strong> sonstige aromunische Publikationen<br />
haben aber e<strong>in</strong>e erstaunliche Verbreitung gef<strong>und</strong>en <strong>und</strong> täuschen über die Tatsache<br />
h<strong>in</strong>weg, dass die Sprache weiterh<strong>in</strong> von der Mehrheit der aromunischen Bevölkerung<br />
nicht geschrieben werden kann.<br />
9.<br />
Um die Jahrh<strong>und</strong>ertwende wurden auf heute makedonischem Boden e<strong>in</strong>ige der<br />
wichtigsten aromunischen Zeitschriften herausgegeben, allen voran die<br />
umfangreiche Zeitschrift Lum<strong>in</strong>a. Nach e<strong>in</strong>er Pause von über 80 Jahren ersche<strong>in</strong>en<br />
hier heute aromunische Schulbücher, Poesiebände <strong>und</strong> Zeitschriften wie <strong>in</strong> ke<strong>in</strong>em<br />
anderen Land Südosteuropas. Die alle zwei Monate ersche<strong>in</strong>ende Zeitschrift Fenix<br />
(Phönix; Skopje 1993-1998, ab 1999 Bitola) berichtet ausschließlich <strong>in</strong> aromunischer<br />
Sprache. Seit 1997 ersche<strong>in</strong>t <strong>in</strong> Skopje das Informationsblatt aromunischer Frauen<br />
Armâna Machedona (Die aromunische Makedonier<strong>in</strong>), 1998 wurde die Zeitschrift<br />
Grailu Armânescu (Die aromunische Sprache) gegründet, im Frühjahr 1999 folgte<br />
e<strong>in</strong>e weitere namens Lânduricâ (Schwälbchen), die sich vor allem an K<strong>in</strong>der richtet.<br />
Sie werden ohne jegliche Unterstützung durch den rumänischen Staat f<strong>in</strong>anziert <strong>und</strong><br />
verwenden ausschließlich das Aromunische. Gemessen an der ger<strong>in</strong>gen Zahl der<br />
<strong>Aromunen</strong> ist die Republik <strong>Makedonien</strong> derjenige Staat mit den weltweit meisten<br />
spezifisch aromunischen Aktivitäten. Die aromunische Fernsehsendung Scanteauā<br />
("Der Funken") überträgt drei Mal <strong>in</strong> der Woche im Sender MTV3 für jeweils e<strong>in</strong>e<br />
halbe St<strong>und</strong>e. Sie br<strong>in</strong>gt Interviews mit älteren <strong>Aromunen</strong> oder mit aromunischen<br />
Aktivisten aus der ganzen Welt sowie Beiträge zu literarischen, kulturellen <strong>und</strong><br />
künstlerischen Aktivitäten der <strong>Aromunen</strong> sowie Berichte über Tagungen. Die<br />
Sendungen tragen wesentlich zu e<strong>in</strong>em besseren Image des Aromunischen bei,
allerd<strong>in</strong>gs werden sie nicht von allen <strong>Aromunen</strong> gleichermaßen akzeptiert. E<strong>in</strong>e<br />
aromunische Radiosendung strahlt täglich e<strong>in</strong>e St<strong>und</strong>e aromunische Nachrichten<br />
<strong>und</strong> andere Texte aus. In Gevgelija gab es von 1993 bis 1998 auch e<strong>in</strong> lokales<br />
Radioprogramm, das zweimal pro Woche jeweils e<strong>in</strong>e halbe St<strong>und</strong>e vlachische<br />
Sendungen im meglenitischen Dialekt brachte. Die meglenitischen <strong>Vlachen</strong> erfreuen<br />
sich aufgr<strong>und</strong> ihrer ger<strong>in</strong>gen Zahl ke<strong>in</strong>er sonderlichen Würdigung durch die<br />
aromunischen Medien.<br />
Thede Kahl