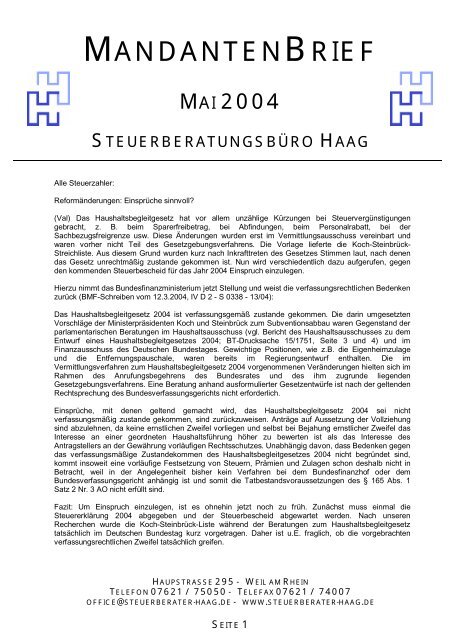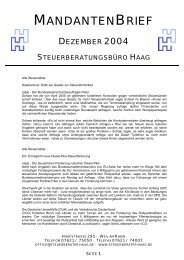MANDANTENBRIEF - Valuenet Recht & Steuern
MANDANTENBRIEF - Valuenet Recht & Steuern
MANDANTENBRIEF - Valuenet Recht & Steuern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>MANDANTENBRIEF</strong><br />
Alle Steuerzahler:<br />
MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
Reformänderungen: Einsprüche sinnvoll?<br />
(Val) Das Haushaltsbegleitgesetz hat vor allem unzählige Kürzungen bei Steuervergünstigungen<br />
gebracht, z. B. beim Sparerfreibetrag, bei Abfindungen, beim Personalrabatt, bei der<br />
Sachbezugsfreigrenze usw. Diese Änderungen wurden erst im Vermittlungsausschuss vereinbart und<br />
waren vorher nicht Teil des Gesetzgebungsverfahrens. Die Vorlage lieferte die Koch-Steinbrück-<br />
Streichliste. Aus diesem Grund wurden kurz nach Inkrafttreten des Gesetzes Stimmen laut, nach denen<br />
das Gesetz unrechtmäßig zustande gekommen ist. Nun wird verschiedentlich dazu aufgerufen, gegen<br />
den kommenden Steuerbescheid für das Jahr 2004 Einspruch einzulegen.<br />
Hierzu nimmt das Bundesfinanzministerium jetzt Stellung und weist die verfassungsrechtlichen Bedenken<br />
zurück (BMF-Schreiben vom 12.3.2004, IV D 2 - S 0338 - 13/04):<br />
Das Haushaltsbegleitgesetz 2004 ist verfassungsgemäß zustande gekommen. Die darin umgesetzten<br />
Vorschläge der Ministerpräsidenten Koch und Steinbrück zum Subventionsabbau waren Gegenstand der<br />
parlamentarischen Beratungen im Haushaltsausschuss (vgl. Bericht des Haushaltsausschusses zu dem<br />
Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2004; BT-Drucksache 15/1751, Seite 3 und 4) und im<br />
Finanzausschuss des Deutschen Bundestages. Gewichtige Positionen, wie z.B. die Eigenheimzulage<br />
und die Entfernungspauschale, waren bereits im Regierungsentwurf enthalten. Die im<br />
Vermittlungsverfahren zum Haushaltsbegleitgesetz 2004 vorgenommenen Veränderungen hielten sich im<br />
Rahmen des Anrufungsbegehrens des Bundesrates und des ihm zugrunde liegenden<br />
Gesetzgebungsverfahrens. Eine Beratung anhand ausformulierter Gesetzentwürfe ist nach der geltenden<br />
<strong>Recht</strong>sprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht erforderlich.<br />
Einsprüche, mit denen geltend gemacht wird, das Haushaltsbegleitgesetz 2004 sei nicht<br />
verfassungsmäßig zustande gekommen, sind zurückzuweisen. Anträge auf Aussetzung der Vollziehung<br />
sind abzulehnen, da keine ernstlichen Zweifel vorliegen und selbst bei Bejahung ernstlicher Zweifel das<br />
Interesse an einer geordneten Haushaltsführung höher zu bewerten ist als das Interesse des<br />
Antragstellers an der Gewährung vorläufigen <strong>Recht</strong>sschutzes. Unabhängig davon, dass Bedenken gegen<br />
das verfassungsmäßige Zustandekommen des Haushaltsbegleitgesetzes 2004 nicht begründet sind,<br />
kommt insoweit eine vorläufige Festsetzung von <strong>Steuern</strong>, Prämien und Zulagen schon deshalb nicht in<br />
Betracht, weil in der Angelegenheit bisher kein Verfahren bei dem Bundesfinanzhof oder dem<br />
Bundesverfassungsgericht anhängig ist und somit die Tatbestandsvoraussetzungen des § 165 Abs. 1<br />
Satz 2 Nr. 3 AO nicht erfüllt sind.<br />
Fazit: Um Einspruch einzulegen, ist es ohnehin jetzt noch zu früh. Zunächst muss einmal die<br />
Steuererklärung 2004 abgegeben und der Steuerbescheid abgewartet werden. Nach unseren<br />
Recherchen wurde die Koch-Steinbrück-Liste während der Beratungen zum Haushaltsbegleitgesetz<br />
tatsächlich im Deutschen Bundestag kurz vorgetragen. Daher ist u.E. fraglich, ob die vorgebrachten<br />
verfassungsrechtlichen Zweifel tatsächlich greifen.<br />
HAUPSTRASSE 295 – WEIL AM RHEIN<br />
TELEFON 07621 / 75050 – TELEFAX 07621 / 74007<br />
OFFICE@STEUERBERATER-HAAG.DE – WWW.STEUERBERATER-HAAG.DE<br />
SEITE 1
Alle Steuerzahler:<br />
Kirchensteuer: Auch Katholiken klagen<br />
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
Schleswig (dpa) - Das Schleswiger Verwaltungsgericht<br />
verhandelt an diesem Mittwoch über vier Klagen von Katholiken gegen die unterschiedliche Erhebung der<br />
Kirchensteuer in Hamburg und Schleswig-Holstein von 1992 bis 2000. Wie bei der evangelischen Kirche<br />
betrug damals der Hebesatz im nördlichsten Bundesland neun und in Hamburg nur acht Prozent. Im<br />
Sommer 2000 hatte das Oberverwaltungsgericht in Schleswig für die Protestanten festgestellt, das<br />
Gleichbehandlungsgebot werde missachtet.<br />
Alle Steuerzahler:<br />
Verjährung: Auch im Steuerrecht<br />
(Val) Nach den Bestimmungen der Abgabenordnung erlöschen durch die Verjährung Anspüche des<br />
Staates auf die Steuerschuld. Hierbei ist zwischen der Festsetzungsverjährung und der<br />
Zahlungsverjährung zu unterscheiden.<br />
Zahlungsverjährung<br />
Steueransprüche unterliegen einer Zahlungsverjährung von fünf Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt, mit<br />
Ablauf des Kalenderjahres in dem der Anspruch fällig geworden ist. Die Frist kann durch nachfolgende<br />
Tatbestände unterbrochen werden: durch Mahnung, Zahlungsaufschub, Stundung, Anmeldung von<br />
Konkurs, Aussetzung der Vollziehung, Vollstreckungsaufschub, Vollstreckungsmaßnahmen,<br />
Sicherheitsleistungen und durch Ermittungen von Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt des<br />
Steuerpflichtigen. Nach Ablauf des Kalenderjahres der Unterbrechung beginnt die Verjährungsfrist<br />
erneut.<br />
Festsetzungsverjährung<br />
Die Festsetzungsverjährung gilt insbesondere für die Festsetzung der Besteuerungsgrundlage und die<br />
Festsetzung der Steuermessbeträge. Zudem kann die Festsetzungsverjährung bei steuerlichen<br />
Nebenleistungen zur Anwendung kommen, falls dies besonders vorgeschrieben ist. Die<br />
Festsetzungsverjährung beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres in dem die Steueransprüche entstanden<br />
sind. Mit der Anlaufhemmung wird der Beginn der Festsetzungsfrist verzögert. Diese kommt bei allen<br />
Besitz- und Verkehrssteuern zur Anwendung, insofern hierfür eine Steuererklärung / Steueranmeldung<br />
notwendig ist. Kommt die Anlaufhemmung zur Anwendung, beginnt die Festsetzungefrist mit Ablauf des<br />
Kalenderjahres, in welchem die Steuererklärung eingereicht wurde. Sie kann aber auch spätestens mit<br />
Ablauf des dtitten Kalenderjahres, das auf das Jahr der Steuerentstehung folgt, beginnen.<br />
Die Festsetzungsfrist beträgt für Zolle und Verbrauchsteuern sowie Zinsen und Vollstreckungskosten ein<br />
Jahr, für Besitz und Verkehrssteuern vier Jahre, für Steuerverkürzungen fünf Jahre und für<br />
Steuerhinterziehung zehn Jahre.<br />
Alle Steuerzahler:<br />
Erbschaftsteuer: Studie zur Erhöhung<br />
Mannheim/Düsseldorf (dpa) - Eine von Bundesfinanzminister Hans Eichel (SPD) in Auftrag gegebene<br />
Studie liefert Befürwortern einer höheren Erbschaftsteuer neue Argumente. Das Gutachten komme zu<br />
dem Ergebnis, dass die Belastung bei geringen Vermögen in Deutschland verhältnismäßig moderat<br />
ausfällt, teilte das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Donnerstag in Mannheim mit<br />
und bestätigte damit einen Bericht des «Handelsblatts».<br />
SEITE - 2 -
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
Im Vergleich zu 14 anderen untersuchten Industrieländern sei die Belastung in Deutschland dank<br />
günstiger Bewertungsvorschriften bei<br />
Betriebs- und Grundvermögen, vorteilhafter Steuervergünstigungen bei der Übertragung von<br />
Firmenvermögen und hoher Freibeträge für Ehegatten und Kinder gering, heißt es in der ZEW-Studie.<br />
Diesen Vorteilen stehe ein vergleichsweise hoher tariflicher Steuersatz gegenüber, der aber erst bei<br />
höheren Erbschaften greife.<br />
Bei der Erbschaftsteuer auf Privatvermögen im Wert eines Einfamilienhauses bleibe die Übertragung an<br />
den Ehegatten auf Grund hoher Freibeträge vollständig steuerfrei, bei Kindern sei die Steuerbelastung<br />
mit 0,3 Prozent sehr gering. Diese Form der Übertragung mache den mit Abstand größten Teil der<br />
Erbschaften in Deutschland aus. Erst bei Privatvermögen im zweistelligen Millionenbereich<br />
verschlechtere sich die deutsche Position im internationalen Vergleich.<br />
Ungünstiger schneidet Deutschland der Studie zufolge bei Unternehmensvermögen ab. Bei der<br />
Übertragung eines repräsentativen mittelständische Unternehmens belege Deutschland bei<br />
Einzelunternehmen und bei Kapitalgesellschaften den siebten von 15 Plätzen. Steuerfrei erfolge die<br />
Übertragung eines Einzelunternehmens an ein Kind in Irland, Luxemburg und im Vereinigten Königreich,<br />
während in Deutschland 3,77 Prozent Erbschaftsteuer anfallen. Am schlechtesten schneiden Japan<br />
(29,79 Prozent) und die USA (35,91<br />
Prozent) ab.<br />
Alle Steuerzahler:<br />
Darlehen: Mit Risikolebensversicherung absichern<br />
(Val) Mit einem Policendarlehen wird ein Darlehen durch eine Lebensversicherung abgesichert. Bis zum<br />
Rückkaufwert einer Lebensversicherung werden Darlehensmittel gewährt. Hierbei besteht die Gefahr,<br />
dass der Sonderausgabenabzug der Lebensversicherungsbeiträge verloren geht. Denn der<br />
Sonderausgabenabzug wird nicht gewährt, wenn die Ansprüche aus der Versicherung der Tilgung oder<br />
Sicherung eines Darlehens dienen und die Darlehenskosten als Betriebsausgaben oder Werbungskosten<br />
abzugsfähig sind. Dies gilt jedoch nicht für Risikolebensversicherungen.<br />
Bleibt der Sonderausgabenabzug versagt, wird auch die später ausgezahlte Versicherungssumme zu<br />
100 Prozent steuerpflichtig. Damit unterliegt auch der Ertragsanteil aus der Versicherung der<br />
Besteuerung.<br />
Praxistipp:<br />
Werden Risikolebensversicherungen (Anspruch nur im Todesfall) für die Absicherung eines Darlehens<br />
genutzt, bleiben die Erträge weiterhin steuerfrei.<br />
Alle Steuerzahler:<br />
Spekulation: Auch bei Gebrauchsgegenständen?<br />
(Val) Zu den steuerpflichtigen privaten Veräußerungsgeschäften gehören nicht nur Wertpapiere und<br />
Immobilien, sondern grundsätzlich alle Verkäufe von Wirtschaftsgütern aus dem Privatvermögen, bei<br />
denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als ein Jahr beträgt (§ 23 Abs. 1<br />
Nr. 2 EStG).<br />
Werden Güter des täglichen Gebrauchs innerhalb eines Jahres angeschafft und wieder veräußert, stellt<br />
sich die Frage, ob ein steuerrelevantes Veräußerungsgeschäft vorliegt. Jedenfalls stand es in der<br />
amtlichen Anleitung zur Anlage SO für das Jahr 2001 schwarz auf grau geschrieben, dass dies so sei.<br />
SEITE - 3 -
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
Die Finanzverwaltung hat aber ihre Auffassung noch im Dezember 2001 wieder geändert. Seitdem gilt,<br />
dass Verluste aus der Veräußerung von Gebrauchsgegenständen steuerlich generell nicht anerkannt<br />
werden. Das bedeutet andererseits, dass Sie sich um die Versteuerung von Veräußerungsgewinnen<br />
keine Gedanken machen müssen (OFD Münster vom 9.1.2002, DB 2002 S. 243).<br />
Das FG Schleswig-Holstein hat jetzt in einem aktuellen Urteil ebenfalls die Auffassung vertreten, dass<br />
Gegenstände des täglichen Gebrauchs nicht von der Vorschrift des § 23 Abs. 1 Nr. 2 EStG erfasst<br />
werden. Denn hier sei nicht mit einer Werterhöhung zu rechnen. Es gebe im Steuerrecht keinen Grund,<br />
die durch den privaten Gebrauch verursachte Wertminderung steuerlich wirksam werden zu lassen.<br />
Hinzu komme, dass die Finanzverwaltung keine effektiven Ermittlungs- und Kontrollmöglichkeiten zur<br />
Erfassung solcher Veräußerungsgewinne habe (FG Schleswig-Holstein vom 2.10.2003, EFG 2004 S.<br />
265).<br />
Angestellte:<br />
Internetkosten: Die private Nutzung<br />
(Val) Private Internetkosten, die beruflich veranlasst sind, können als Werbungskosten geltend gemacht<br />
werden. Dabei ist eine Rechnung des Providers oder der Telefongesellschaft vorzulegen. Um<br />
Schwierigkeiten mit dem Finanzamt zu vermeiden, sollte zudem für das Surfen im Internet ein<br />
"Fahrtenbuch" geführt werden. Darin sind folgende Punkte festzuhalten:<br />
- berufliche Veranlassung der Internetnutzung(Warum?),<br />
- Datum, Uhrzeit, Dauer (Wann?, Wie lange?),<br />
- konkrete Verbindung/ Website (Was?).<br />
Nutzt der Arbeitnehmer den betrieblichen Internetzugang für private Zwecke, so ist der Nutzungsvorteil<br />
steuerfrei.<br />
Angestellte:<br />
Arbeitsmittel: Spezielle Computerbrille absetzbar<br />
(Val) Aufwendungen für eine Brille sind nicht als Werbungskosten abzugsfähig, wenn sie zum Ausgleich<br />
einer Sehschwäche dient. Das gilt auch dann, wenn das Tragen der Brille für die berufliche Tätigkeit<br />
nützlich ist oder sie erst ermöglicht, und sogar auch dann, wenn die Brille ausschließlich am Arbeitsplatz<br />
getragen wird (BFH-Urteil vom 23.10.1992, BStBl. 1992 II S. 193).<br />
Jetzt hat aktuell das FG Baden-Württemberg entschieden, dass eine Brille, die speziell für das Arbeiten<br />
am Computer vom Augenarzt vermessen und verordnet wird, beruflich veranlasst ist und die Kosten dafür<br />
als Werbungskosten absetzbar sind. Die Brille hatte keinen Fernteil, sondern zwei Nahteile mit<br />
unterschiedlichen Dioptrien zum Sehen von Tastatur und Manuskript und zum Scharfsehen des<br />
Bildschirms. Wegen dieser Ausgestaltung war die Brille weder für andere Tätigkeiten noch im<br />
Lebensalltag nutzbar (FG Baden-Württemberg vom 26.6.2003, 13 K 261/97). Gegen diese freundliche<br />
Entscheidung hat das Finanzamt Revision vor dem BFH erhoben (Aktenzeichen: VI R 50/03).<br />
Wenn der Arbeitgeber die Kosten einer solchen Bildschirmarbeitsbrille übernimmt oder erstattet, kann er<br />
die Kosten als Betriebsausgaben absetzen. Beim Arbeitnehmer ist dieser Vorteil nicht steuerpflichtig (R<br />
70 Abs. 2 Nr. 2 LStR). Wenn also bei einem Arbeitnehmer, der die Kosten erstattet bekommt, kein<br />
Arbeitslohn vorliegt, müssen die Kosten beim anderen Arbeitnehmer, der sie selbst trägt, steuerlich als<br />
Werbungskosten berücksichtigt werden. Da die Anschaffungskosten der Brille im Urteilsfall mehr als 475<br />
Euro betrugen, mussten sie über eine Nutzungsdauer von drei Jahren verteilt werden. Absetzbar ist also<br />
in jedem Jahr die Jahresabschreibung in Höhe von einem Drittel der Anschaffungskosten.<br />
SEITE - 4 -
Angestellte:<br />
Arbeitsmittel: Computertisch voll absetzbar<br />
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
(Val) Da ein Computer im Allgemeinen nicht ausschließlich beruflich, sondern auch für private Zwecke<br />
mitbenutzt wird, sind die Anschaffungskosten nur mit dem beruflichen Nutzungsanteil als<br />
Werbungskosten oder Betriebsausgaben absetzbar. Dasselbe gilt für die Peripheriegeräte, wie Monitor,<br />
Drucker oder Scanner.<br />
Nach einer aktuellen Entscheidung des FG Rheinland-Pfalz gilt etwas anderes für den Computertisch<br />
(FG Rheinland-Pfalz vom 22.1.2004, 6 K 2184/02):<br />
Der Computertisch ist nämlich selbstständig nutzungsfähig. Im Gegensatz zu den Peripheriegeräten kann<br />
der Tisch auch zu anderen Zwecken genutzt werden und ist wegen seiner technischen Abstimmung auf<br />
einen PC nicht unbedingt nur zusammen mit diesem nutzbar. Deshalb können die Anschaffungskosten in<br />
voller Höhe abgesetzt werden, auch wenn der darauf befindliche PC nur anteilig anerkannt wird. Sollten<br />
die Anschaffungskosten für den Tisch mehr als 410 Euro betragen, ist die jeweilige Jahres-AfA in voller<br />
Höhe abziehbar.<br />
Diese Entscheidung ist nicht nur für Arbeitnehmer bedeutsam, sondern auch für Kinder, die in<br />
Berufsausbildung sind. Wenn deren Einkünfte mehr als 7.680 Euro (bis 2003: 7.188 Euro) im Jahr<br />
betragen, verlieren die Eltern das Kindergeld sowie den Kinder- und BEA-Freibetrag für Betreuung,<br />
Erziehung und Ausbildung. Bei einer Ausbildungsvergütung über diesem Betrag ist es daher wichtig,<br />
dass sie möglichst viele Aufwendungen als Werbungskosten geltend machen und so ihre Einnahmen<br />
unter den maßgeblichen Jahresgrenzbetrag drücken.<br />
Angestellte:<br />
Lohnsteuerpflichtig: Der Computer als Geschenk<br />
(Val) Schenkt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer einen Computer und/ oder dazugehörige Geräte<br />
(z.B. Drucker), so ist das Geschenk nur einer pauschalen Lohnsteuer von 25 Prozent zu unterwerfen.<br />
Handelt es sich nicht um einen neuen, sondern um einen bereits abgeschriebenen Computer, fällt keine<br />
Lohnsteuer an.<br />
Nutzt der Arbeitnehmer den betrieblichen Computer bzw. den betrieblichen Internetzugang für private<br />
Zwecke, so ist der daraus resultierende Nutzungsvorteil steuerfei.<br />
Angestellte:<br />
Provision: Für eigene Versicherungen steuerfrei<br />
(Val) Vor dem Abschluss einer Lebens- oder Rentenversicherung vereinbart manch einer mit dem<br />
Versicherungsvertreter, dass dieser ihm einen Teil der Provision gewährt. Umstritten war lange Zeit, ob<br />
solche Einnahmen als sonstige Einkünfte nach § 22 Nr. 3 EStG steuerpflichtig sind.<br />
Jetzt hat der Bundesfinanzhof aktuell entschieden, dass Provisionsanteile für den Abschluss eigener<br />
Versicherungen vollkommen steuerfrei sind (BFH-Urteil vom 2.3.2004, IX R 68/02).<br />
Nach Auffassung des BFH handelt es sich hier nicht um eine steuerpflichtige Leistung, denn nicht der<br />
Versicherungsnehmer erbringt eine Vermittlungsleistung, sondern der Versicherungsvertreter. Reicht der<br />
Vertreter dem Versicherungsnehmer einen Teil seiner Provision weiter, bekommt dieser lediglich einen<br />
Teil des Geldes zurück, das er über die Versicherungsprämien wirtschaftlich trägt. Die Provisionsanteile<br />
stellen also einen Preisnachlass dar und mindern den Preis der Versicherung.<br />
SEITE - 5 -
Angestellte:<br />
Lehrerausflug: Fahrtkosten nicht absetzbar<br />
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
Düsseldorf (dpa) - Die privaten Fahrtkosten für einen Lehrerausflug sind nach einem Urteil des<br />
Finanzgerichts Düsseldorf nicht als Werbungskosten von der Steuer absetzbar. Der Ausflug des<br />
Kollegiums sei zwar beruflich veranlasst, diene aber in erheblichen Umfang der zwischenmenschlichen<br />
Kontaktpflege und dem Sammeln von kulturellen und touristischen Eindrücken, begründete das Gericht<br />
seine Entscheidung (Az.: 10 K 2335/00 E). Ein Lehrer hatte eine 300 Kilometer lange Fahrt mit seinem<br />
Privatwagen absetzen wollen.<br />
Angestellte:<br />
Bonusmeilen: Freibetrag verringert<br />
(Val) Wer aus beruflichen Gründen in größerem Umfang Dienstleistungen von Fluggesellschaften,<br />
Hotelketten, Mietwagen- und Kreditkartenunternehmen u. a. nutzt, kann dafür häufig Bonusleistungen<br />
zum persönlichen Vorteil kostenlos in Anspruch nehmen. Das bekannteste dieser<br />
Kundenbindungsprogramme ist das Vielfliegerprogramm "Miles & More" der Lufthansa bzw. des<br />
Luftfahrtbündnisses Star Alliance. Der geldwerte Vorteil solcher Sachprämien blieb bis einschließlich<br />
2003 bis zu einem Betrag von 1.224 Euro im Jahr steuer- und sozialversicherungsfrei (§ 3 Nr. 38 EStG).<br />
Zum 1.1.2004 wurde dieser Freibetrag für Sachprämien von 1.224 Euro auf 1.080 Euro verringert.<br />
Die Fluggesellschaft, die die Bonusmeilen gewährt, kann beim Betriebsstätten-Finanzamt beantragen,<br />
dass sie den Wert der Prämien pauschal versteuert und damit dem Kunden die Versteuerung eines<br />
geldwerten Vorteils erspart. In diesem Fall war der geldwerte Vorteil für die Kunden in vollem Umfang<br />
steuer- und sozialversicherungsfrei, wenn das Unternehmen die Sachprämien bis 2003 pauschal mit 2 %<br />
versteuert hat (§ 37a EStG).<br />
Zum 1.1.2004 wurde der Pauschsteuersatz für das Unternehmen, das die Sachprämien pauschal<br />
versteuert, von 2 % auf 2,25 % angehoben.<br />
Angestellte:<br />
Bahncard: Besser vom Arbeitgeber holen<br />
(Val) Fährt der Arbeitnehmer regelmäßig mit der Deutschen Bundesbahn zu seiner Arbeitsstätte und<br />
nutzt er die Bahn für Dienstreisen oder für Dienstgänge, so kann der die Kosten für die Bahncard im<br />
Rahmen seiner jährlichen Einkommensteuer als Werbungskosten bei den Einkünften aus<br />
nichtselbständiger Arbeit absetzen. Günstiger ist jedoch eine Erstattung dieser Kosten durch den<br />
Arbeitgeber, denn nur so bekommt der Arbeitnehmer 100 Prozent der Bahncardkosten zurück.<br />
Zu beachten ist, dass die steuerfreie Kostenerstattung durch den Arbeitgeber nur in folgenden Fällen<br />
möglich ist:<br />
Der Arbeitnehmer nutzt die Bahncard für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte.<br />
Durch den Einsatz der Bahncard kann der Arbeitgeber die steuerfreie Reisekostenerstattung für den<br />
jeweiligen Arbeitnehmer mindern. Hierbei muss nachgewiesen werden, dass der Arbeitnehmer die<br />
Bahncard tatsächlich für dienstliche Wege nutzt.<br />
Liegt eindeutig nur eine ausschließliche Privatnutzung der Bahncard durch den Arbeitnehmer vor, bleibt<br />
der Werbungskostenabzug sowie die steuerfreie Kostenerstattung durch den Arbeitgeber versagt.<br />
SEITE - 6 -
Arbeit, Ausbildung & Soziales:<br />
Firmenwagen: Kein Schmerzensgeld nach Unfall<br />
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
Karlsruhe (dpa) - Arbeitnehmer können kein Schmerzensgeld verlangen, wenn sie bei einer<br />
gemeinsamen Fahrt vom Wohnort zum Einsatzort mit dem Firmenwagen verunglücken. Dies hat der<br />
Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Dienstag entschieden. Entscheidend sei, ob die<br />
Arbeitskollegen ihre Fahrgemeinschaft privat organisierten oder eine «vom Arbeitgeber eröffnete<br />
Beförderungsmöglichkeit» in Anspruch nähmen, erklärte der VI. Zivilsenat. Im zweiten Fall handle es sich<br />
nicht um einen «Wegeunfall», sondern um einen «Arbeitsunfall».<br />
Die Richter wiesen damit zwei Klagen von Bauarbeitern ab, die mit ihren Kollegen regelmäßig vom<br />
Wohnort zu ihrer Baustelle gefahren waren. Auf dem Rückweg hatte einer der Kollegen als Fahrer des<br />
Kleintransporters einen Unfall verursacht, bei dem die Kläger schwer verletzt wurden. Das<br />
Oberlandesgericht Brandenburg hatte den Klägern gegenüber dem Arbeitgeber und dem Fahrer einen<br />
Anspruch auf Schadenersatz und Schmerzensgeld zugestanden. Der BGH hob dieses Urteil auf.<br />
Die verletzten Kollegen haben demnach keine zivilrechtlichen Ansprüche, die über die Leistungen der<br />
gesetzlichen Unfallversicherung hinausgehen. Sie hätten sich «in die betrieblichen Abläufe und die<br />
betriebliche Gefahrengemeinschaft eingegliedert», betonte der BGH. Daher müssten sie «die im <strong>Recht</strong><br />
der gesetzlichen Unfallversicherung vorgesehene Haftungsbeschränkung gegen sich gelten lassen». (Az:<br />
VI ZR 348/02 und 349/02)<br />
Arbeit, Ausbildung & Soziales:<br />
Änderungskündigung: Der Unternehmer entscheidet<br />
(Val) Entschließt sich der Arbeitgeber zu einer betrieblichen Umorganisation, die zu einer anderen<br />
zeitlichen Lage und Herabsetzung der Dauer der Arbeitszeit führt, so handelt es sich dabei um eine im<br />
Ermessen des Arbeitgebers stehende unternehmerische Entscheidung, die von den Arbeitsgerichten<br />
nicht auf ihre Zweckmäßigkeit, sondern lediglich - zur Vermeidung von Missbrauch - auf offenbare<br />
Unvernunft oder Willkür zu überprüfen ist. Dies stellte das Bundesarbeitsgericht in einem Verfahren fest,<br />
das eine Änderungskündigung zum Gegenstand hatte.<br />
Das Gericht wies die Klage aber an das Berufungsgericht zurück, weil dies nicht genügend<br />
Tatsachenfeststellungen getroffen hatte, um das Vorliegen einer missbräuchlichen Änderungskündigung<br />
zu prüfen.<br />
Ein Missbrauch der unternehmerischen Organisationsfreiheit liegt nicht schon dann vor, wenn der<br />
Arbeitgeber die Möglichkeit hätte, auf die Reorganisation zu verzichten. War die Reorganisation im<br />
vorliegenden Fall dauerhafter Natur und nicht nur vorgeschoben, so bestand ein anerkennenswerter<br />
Anlass zum Ausspruch einer Änderungskündigung. Allerdings hat die Klägerin geltend gemacht, die<br />
betriebliche Umorganisation sei allein deshalb erfolgt, weil sie sich über den Bauleiter beschwert habe.<br />
Trifft dies zu, so kann ein Missbrauch vorgelegen haben. Da es insoweit an Tatsachenfeststellungen<br />
fehlt, war die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.<br />
Die Klägerin war seit 1997 bei der Beklagten als Vollzeitkraft (40 Wochenstunden) beschäftigt. Als<br />
technische Mitarbeiterin hatte sie zwei Arbeitsgebiete zu betreuen, in denen sie dem technischen Leiter<br />
einerseits und dem Bauleiter andererseits zuarbeitete. Im November 2001 kündigte die Beklagte das<br />
Arbeitsverhältnis zum 31. Dezember 2001 und bot der Klägerin zugleich die Fortsetzung des<br />
Arbeitsverhältnisses ab 1. Januar 2002 mit reduziertem Arbeitsgebiet, halbierter Stundenzahl (20<br />
Wochenstunden, montags bis freitags vormittags) und entsprechend geringerer Vergütung an. Sie sollte<br />
allein noch für die vom technischen Leiter zugewiesene Arbeit zuständig sein. Für das der Klägerin<br />
SEITE - 7 -
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
entzogene Arbeitsgebiet (Bauleiter) stellte die Beklagte eine weitere Halbtagskraft ein, die zeitgleich mit<br />
der Klägerin (20 Wochenstunden, montags bis freitags vormittags) eingesetzt wurde.<br />
Die Klägerin hat das Änderungsangebot unter Vorbehalt angenommen und geltend gemacht, die<br />
Änderung der Arbeitsbedingungen sei sozial ungerechtfertigt. Die Beklagte hat sich auf die höhere<br />
Effizienz des neuen Arbeitszeitkonzepts berufen. Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht haben der<br />
Klage stattgegeben, weil die Reorganisation nicht zwingend notwendig gewesen sei und die frühere<br />
zeitliche Aufteilung zu keinen Nachteilen geführt habe.<br />
BAG, Urteil vom 22. April 2004 - 2 AZR 385/03 -<br />
Arbeit, Ausbildung & Soziales:<br />
Betriebsrente: Unverfallbarkeit von Anwartschaften<br />
(Val) Der Pensions-Sicherungs-Verein, Träger der gesetzlichen Insolvenzsicherung, muss für<br />
Versorgungsanwartschaften nur dann eintreten, wenn sie gesetzlich unverfallbar sind. Das bestätigte das<br />
Bundesarbeitsgericht in dem Verfahren einer Angestellten, die nacheinander für zwei eng verflochtene<br />
Unternehmen tätig war.<br />
Der Dritte Senat hat die Klage abgewiesen. Die Anwartschaft der Klägerin war nicht gesetzlich<br />
unverfallbar. Zwar scheitert die Anerkennung der früheren Tätigkeit nicht daran, dass sie für die spätere<br />
Insolvenzschuldnerin nicht als Arbeitnehmerin tätig war. Die Klägerin hatte jedoch die Tätigkeit nicht für<br />
diese, sondern für eine andere Gesellschaft erbracht. Trotz der engen wirtschaftlichen Verflechtung<br />
beider Gesellschaften waren nur Zeiten zu berücksichtigen, in denen vertragliche Beziehungen zwischen<br />
der späteren Insolvenzschuldnerin und der Klägerin bestanden.<br />
Die Klägerin hatte vor der Insolvenzeröffnung etwa 9 1/2 Jahre in einem Arbeitsverhältnis zu dem später<br />
insolvent gewordenen Unternehmen gestanden. Ihr war im Arbeitsvertrag eine Betriebsrente zugesagt<br />
worden. Zuvor war sie schon aufgrund eines zwischen ihr und einer anderen Gesellschaft geschlossenen<br />
Vertrages viele Jahre für das spätere Unternehmen tätig gewesen. Die Klägerin hat geltend gemacht,<br />
diese Zeiten seien bei der Berechnung der Betriebszugehörigkeit mitzuzählen.<br />
Nach § 1 Abs. 1 BetrAVG aF wurden Versorgungsanwartschaften von Gesetzes wegen unverfallbar,<br />
wenn der Arbeitnehmer bei Beendigung seines Arbeitsverhältnisses mindestens 35 Jahre alt war und<br />
entweder die Versorgungszusage für ihn mindestens 10 Jahre bestand, oder die Zusage mindestens drei<br />
Jahre bestand und der Beginn der Betriebszugehörigkeit mindestens 12 Jahre zurücklag. Nach § 17 Abs.<br />
1 Satz 2 BetrAVG sind grundsätzlich auch Zeiten zu berücksichtigen, in denen Personen, die nicht<br />
Arbeitnehmer sind, "für ein Unternehmen" tätig geworden sind. Dabei kommt es grundsätzlich nicht auf<br />
den Status an, in dem diese Tätigkeit für ein Unternehmen erbracht wird, sondern darauf, dass es sich<br />
um "ein" Unternehmen handelt.<br />
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 20. April 2004 - 3 AZR 297/03 -<br />
Arbeit, Ausbildung & Soziales:<br />
Krankenkasse: Zahlt nicht für Arzneimittelstudie<br />
Mainz (dpa) - Eine gesetzliche Krankenkasse muss nicht für Kosten aufkommen, die bei der Teilnahme<br />
eines Patienten an einer Arzneimittelstudie entstehen. Das entschied das Landessozialgericht Rheinland-<br />
Pfalz in Mainz in einem am Montag veröffentlichten Urteil<br />
(Az.: L 5 KR80/01). Die Finanzierung von Studien zähle nicht zum Leistungskatalog der gesetzlichen<br />
Krankenkassen, entschieden die Richter.<br />
SEITE - 8 -
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
Das Gericht wies mit seinem grundlegenden Urteil die Klage eines Klinikbetreibers ab, ließ jedoch<br />
zugleich wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Sache die Revision zum Bundessozialgericht in<br />
Kassel zu. Mehrere bei der beklagten Krankenkasse versicherte Patienten hatten in der Klinik an einer<br />
Arzneimittelstudie teilgenommen. Die Kasse weigerte sich, die Behandlungskosten von rund 90 000 Euro<br />
zu übernehmen, da nicht die medizinische Behandlung der Patienten im Vordergrund gestanden habe.<br />
Arbeit, Ausbildung & Soziales:<br />
13. Gehalt: Kann jährlich neu entschieden werden<br />
Mainz (dpa) - Arbeitgeber müssen die Zahlung eines 13. Monatsgehalts nicht ausdrücklich als freiwillige<br />
Leistung kennzeichnen. Nach einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil des Landesarbeitsgerichts (LAG)<br />
Rheinland-Pfalz in Mainz genügt es, wenn objektiv erkennbar sei, dass der Arbeitgeber über die<br />
Auszahlung in jedem Jahr neu entscheiden wolle (Az.: 7 Sa 730/03).<br />
Das Gericht wies die Klage eines Arbeitnehmers ab. Dieser hatte von seinem Arbeitgeber die Zahlung<br />
des 13. Monatsgehalts verlangt und zur Begründung auf eine entsprechende langjährige betriebliche<br />
Praxis verwiesen. Dadurch habe er auf die erneute Zahlung vertraut.<br />
Der Arbeitgeber hatte die jährlichen Mitteilungen zum 13. Gehalt stets mit den Worten eingeleitet: «Die<br />
Geschäftsleitung hat sich wieder zur Zahlung .... entschlossen.» Das LAG wertete diese Formulierung als<br />
Vorbehalt, mit dem hinreichend deutlich gemacht werde, dass die jährliche Zahlung nicht gleichsam<br />
automatisch erfolge. Ein schutzwürdiges Vertrauen habe folglich erst gar nicht entstehen könne, befand<br />
das Gericht.<br />
Arbeit, Ausbildung & Soziales:<br />
Wirtschaftsausschuss: Fällt mit Belegschaftsschwund<br />
(Val) Das Amt eines nach 106 BetrVG gebildeten Wirtschaftsausschusses endet, wenn die<br />
Belegschaftsstärke eines Unternehmens nicht nur vorübergehend auf weniger als 101 Arbeitnehmer<br />
absinkt. Auf die Beendigung der Wahlzeit kommt es dabei nicht an, entschied das Bundesarbeitsgericht.<br />
Nach § 106 Abs. 1 Satz 1 BetrVG ist in allen Unternehmen mit in der Regel mehr als 100 ständig<br />
beschäftigten Arbeitnehmern ein Wirtschaftsausschuss zu bilden. Was aber, wenn die Voraussetzungen<br />
für die Errichtung wegfallen? Das Gesetz enthält darüber keine Regelung. In § 107 Abs. 2 Satz 2 BetrVG<br />
ist lediglich geregelt, dass die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses vom Betriebsrat für die Dauer<br />
seiner Amtszeit bestimmt werden.<br />
Der Siebte Senat des Bundesarbeitsgerichts hat entschieden, dass das Amt des Wirtschaftsausschusses<br />
endet, wenn nicht nur vorübergehend weniger als 101 Arbeitnehmer in dem Betrieb arbeiten. Der<br />
Wirtschaftsausschuss besteht in diesem Fall nicht bis zur Beendigung der Amtszeit des Betriebsrats fort.<br />
Die Arbeitgeberin beschäftigte in ihrem Unternehmen früher mehr als 100 Arbeitnehmer. Im Mai 2002<br />
wurde ein Wirtschaftsausschuss bestellt. Nach einem Personalabbau im Sommer 2002 arbeiten in dem<br />
Unternehmen dauerhaft nur noch 82 Arbeitnehmer. Seitdem informiert die Arbeitgeberin den<br />
Wirtschaftsausschuss nicht mehr über die wirtschaftlichen Angelegenheiten des Unternehmens, weil sie<br />
meint, das Amt des Wirtschaftsausschusses habe wegen der Verringerung der Belegschaft geendet. Der<br />
Betriebsrat hat daraufhin beantragt, den Fortbestand des Wirtschaftsausschusses bis zum Ende der<br />
Amtszeit des Betriebsrats festzustellen. Der Siebte Senat des Bundesarbeitsgerichts hat den Antrag<br />
zurückgewiesen. Wegen der nicht nur vorübergehenden Verringerung der Belegschaft auf 82<br />
Arbeitnehmer sind die Errichtungsvoraussetzungen für den Wirtschaftsausschuss in dem Unternehmen<br />
der Arbeitgeberin entfallen. Das hat die Beendigung der Amtszeit des Wirtschaftsausschusses zur Folge.<br />
Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 7. April 2004 - 7 ABR 41/03 -<br />
SEITE - 9 -
Arbeit, Ausbildung & Soziales:<br />
Arbeitslosengeld: Auch für entlassenen Ehepartner<br />
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
Mainz (dpa) - Wer im Betrieb seines Ehepartners arbeitet, kann je nach Arbeitsbedingungen eine<br />
versicherungspflichtige Beschäftigung geltend machen und demnach bei Entlassung Arbeitslosengeld<br />
bekommen. Das teilte das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz in einem am Montag veröffentlichten<br />
Urteil in Mainz mit (Az.: L 1 AL 57/02). Die meist nicht als normales Arbeitsverhältnis gewertete<br />
Beschäftigung von Familienmitgliedern ändert sich demnach, wenn sich der Ehepartner an feste<br />
Dienstzeiten halten muss und regelmäßig Lohn erhält.<br />
Arbeit, Ausbildung & Soziales:<br />
Betriebsrat: Anwaltskosten trägt der Arbeitgeber<br />
Bonn/Erfurt (dpa) - Benötigt ein Betriebsrat in einem arbeitsrechtlichen Streitfall die Hilfe eines Anwalts,<br />
muss der Arbeitgeber die Kosten übernehmen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Konflikt mit dem<br />
Unternehmer selbst, in den eigenen Reihen oder gegenüber anderen besteht. Darauf weist der in Bonn<br />
erscheinende Informationsdienst «Arbeitgeber-Handbuch Betriebsrat» unter Berufung auf Beschlüsse<br />
des Bundesarbeitsgerichts (BAG) in Erfurt hin. Der Arbeitgeber müsse nur dann nicht für die Kosten<br />
aufkommen, wenn der Betriebsrat leichtfertig einen <strong>Recht</strong>sanwalt einschalte.<br />
Die Arbeitnehmervertretung muss nach Angaben des Informationsdienstes zuerst ernsthaft versuchen,<br />
die Angelegenheit selbst zu regeln und klären, ob sich die Streitfrage nicht auch ohne Anwalt lösen ließe.<br />
Die Kosten müssen ebenfalls nicht vom Arbeitgeber übernommen werden, wenn der Betriebsrat mit einer<br />
offensichtlich aussichtslosen Forderung oder aber nach Einlenken des Arbeitgebers rechtliche Hilfe<br />
aufsucht.<br />
Arbeit, Ausbildung & Soziales:<br />
Rentner: Höherer Beitrag zur Pflegeversicherung<br />
(Val) Bisher wird die Hälfte des Beitrages zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung vom<br />
Rentenversicherungsträger übernommen. Rentner zahlen also 0,85 % ihrer Rente für die<br />
Pflegeversicherung, und ebenso viel zahlt die Rentenkasse hinzu. Dies gilt sowohl für gesetzlich<br />
versicherte Rentner als auch für freiwillig und privat versicherte Rentner.<br />
Seit dem 01.04.2004 müssen Rentner ihren Beitrag zur Pflegeversicherung ohne Beteiligung des<br />
Rentenversicherungsträger alleine tragen. Das sind dann 1,7 % der Rente - anstatt bisher 0,85 % (§ 59<br />
Abs. 1 SGB XI). Für freiwillig und privat krankenversicherte Rentner fällt der Zuschuss des<br />
Rentenversicherungsträgers zur Pflegeversicherung künftig weg (§ 106a SGB VI wird aufgehoben).<br />
Bei einer Monatsrente von 1 000 EUR führt diese Mehrbelastung von 0,85 % zu einer Rentenminderung<br />
von 8,50 EUR im Monat bzw. 102 EUR im Jahr.<br />
Begründet wird die Maßnahme damit, dass Rentner während ihrer Erwerbsphase nicht oder nur in den<br />
letzten Jahren mit eigenen Beiträgen zur Finanzierung der Pflegeversicherung beigetragen hätten.<br />
Zudem hätten Arbeitnehmer zur Finanzierung auf einen Feiertag (den Buß- und Bettag) verzichten<br />
müssen. Dieser Vergleich aber hinkt, denn Arbeitnehmer in Sachsen haben nicht auf den Feiertag<br />
verzichtet und zahlen nur 1,35 % (statt 1,7 %) für die Pflegeversicherung.<br />
SEITE - 10 -
Bauen & Wohnen:<br />
Asbestbelastung: Mietminderung gerechtfertigt<br />
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
München (dpa) - Bei einer asbestbelasteten Wohnung kann der Mieter eine geringfügige Mietminderung<br />
auch dann verlangen, wenn eine konkrete Gesundheitsbeeinträchtigung nicht nachgewiesen ist. Das hat<br />
das Amtsgericht München in einem Urteil klar gestellt (Az.: 433 C 9149/C1). Das Gericht hielt das<br />
Begehren des Mieters auf 50-prozentige Kürzung aber für überzogen und setzte eine Mietminderung von<br />
15 Prozent fest.<br />
Allein die Unsicherheit für einen Mieter, ob durch die Asbestbelastung auch eine Schädigung der<br />
Gesundheit zu befürchten sei, stellt laut Urteilsbegründung eine derartige psychische Belastung dar, dass<br />
eine Mietminderung gerechtfertigt sei. Das Landgericht München I wies in zweiter Instanz eine Berufung<br />
des Vermieters ab, so dass das Urteil des Amtsgerichts nun rechtskräftig wurde.<br />
Bauen & Wohnen:<br />
Umbau: Vermieter muss Mieter im Detail informieren<br />
Frankfurt/Main (dpa) - Der Eigentümer muss den Mieter über in der Wohnung geplante Umbau- und<br />
Sanierungsmaßnahmen in allen Einzelheiten informieren. Das geht aus einem am Mittwoch bekannt<br />
gewordenen Urteil des Amtsgerichts Frankfurt hervor. Die Richter wiesen damit die Klage eines<br />
Vermieters gegen seinen Mieter zurück, der sich gegen den Umbau gewehrt hatte. (AZ 33 C 4766/03-<br />
93). Dem Mieter war vom Wohnungseigentümer lediglich mitgeteilt worden, dass der Einbau einer<br />
Gasetagenheizung geplant sei.<br />
Bauen & Wohnen:<br />
Energieeinsparung: Deutliche Mieterhöhung rechtens<br />
Karlsruhe (dpa) - Vermieter dürfen ihre Mieter für Energie sparende Ausbaumaßnahmen auch über die<br />
erreichte Heizkostenersparnis hinaus zur Kasse bitten. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) für den -<br />
besonderen Regeln unterliegenden - öffentlich geförderten Wohnraum entschieden. Der BGH billigte eine<br />
Mieterhöhung für eine Berliner 85-Quadratmeterwohnung von 250 auf 320 Euro pro Monat - also um fast<br />
30 Prozent. Der Vermieter hatte an dem Wohnblock eine Wärmedämmfassade anbringen lassen, die zu<br />
einer Energieeinsparung von rund 12 Prozent führte. (Aktenzeichen: VIII ZR 149/03 vom 3. März 2004.)<br />
Nach den Worten des BGH ist die zulässige Mieterhöhung nicht durch den Umfang der<br />
Heizkostenersparnis begrenzt. Der Gesetzgeber habe bewusst auf eine «Kappungsgrenze» verzichtet,<br />
um die Modernisierung des Wohnbestands zu fördern - auch mit dem volkswirtschaftlichen Ziel, den<br />
Energieverbrauch generell zu senken. Der Mieter sei allerdings gegen Modernisierungen geschützt, die<br />
eine nicht mehr zu rechtfertigende Härte für ihn oder seine Familie bedeuten würde.<br />
Bei nicht geförderten Wohnungen haben die Gerichte bisher kein einheitliches Limit für Mieterhöhungen<br />
auf Grund von Energiesparmaßnahmen festgesetzt. Teilweise gehen sie davon aus, die Erhöhung dürfe<br />
«nicht außer Verhältnis» zu den ersparten Kosten stehen, teilweise wird sie auf das Doppelte oder<br />
Dreifache begrenzt.<br />
SEITE - 11 -
Bauen & Wohnen:<br />
Reisemangel: Kaputte Klimaanlage<br />
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
Düsseldorf/Frankfurt/Main (dpa) - Eine kaputte Klimaanlage bei hochsommerlichen Temperaturen<br />
müssen Urlauber nicht klaglos hinnehmen. Das Schwitzen wider Willen gilt als Reisemangel und<br />
rechtfertigt eine Minderung des Reisepreises um 15 Prozent. So entschied das Landgericht Düsseldorf<br />
(Az.: 22 S 257/02), wie die Deutsche Gesellschaft für Reiserecht in Frankfurt in ihrer Fachzeitschrift<br />
«Reise<strong>Recht</strong> aktuell» berichtet.<br />
In dem verhandelten Fall funktionierte die Klimaanlage während der gesamten Reisezeit nicht. Der Kläger<br />
beschwerte sich vor Gericht über Temperaturen «weit über 30 Grad». Auch wenn sich nicht nachweisen<br />
lasse, dass es durchgehend so heiß war, seien diese Temperaturen als erhebliche Beeinträchtigung zu<br />
werten, so das Gericht.<br />
Bauen & Wohnen:<br />
Wohnungsübergabe: Exaktes Protokoll wichtig<br />
Berlin/Düsseldorf (dpa) - Beim Ein- und Auszug sollte ein exaktes Wohnungsübergabeprotokoll erstellt<br />
werden, um den Zustand der Mietsache zu dokumentieren. So lassen sich spätere Streitigkeiten über<br />
Schäden oder schlecht ausgeführte Schönheitsreparaturen weitgehend vermeiden, rät der Deutsche<br />
Mieterbund (DMB) in Berlin unter Berufung auf das Oberlandesgericht Düsseldorf. Dieses hatte einen<br />
Mieter zur Zahlung von 150 Euro Schadensersatz verurteilt, da der Vermieter beim Auszug Haarrisse im<br />
Waschbecken entdeckt hatte<br />
(Az.: 10 U 64/02).<br />
Der Mieter argumentierte, diese Haarrisse hätten bereits bei Beginn des Mietverhältnisses vorgelegen<br />
und müssten von ihm nicht ersetzt werden. Allerdings hatten Mieter und Vermieter eine gemeinsame<br />
Wohnungsübergabe vorgenommen und den Zustand der Mieträume im Übergabeprotokoll als<br />
ordnungsgemäß und fehlerfrei dokumentiert. Daher spricht nach Ansicht des Gerichts die «tatsächliche<br />
Vermutung» dafür, dass keine Beschädigungen vorhanden waren.<br />
Informationen: Die neue Broschüre «Geld sparen beim Umzug» ist für fünf Euro bei allen örtlichen<br />
Mietervereinen erhältlich oder zu bestellen beim Deutschen Mieterbund, 10169 Berlin. Im Internet kann<br />
unter www.mieterbund.de auch das Formular eines Übergabeprotokolls kostenlos heruntergeladen<br />
werden.<br />
Bußgeld & Verkehr:<br />
Neu: Bußgeldkatalog verschärft<br />
(Val) Der Bußgeldkatalog ist wieder einmal aktualisiert worden. Folgende Missetaten sind ab heute<br />
teuerer:<br />
Handy am Steuer:<br />
40 Euro und ein Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg werden fällig, wenn ein Autofahrer mit<br />
dem Handy am Ohr hinterm Steuer erwischt wird.<br />
Falschparken:<br />
SEITE - 12 -
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
40 Euro kostet es, wenn das Auto an einer unübersichtlichen Stelle oder in einer Kurve steht und damit<br />
Rettungsfahrzeuge behindert. Auch wer eine Feuerwehrzufahrt zuparkt, zahlt mehr: 50 statt bisher 35<br />
Euro. In beiden Fällen ist außerdem ein Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg fällig.<br />
Geisterfahrt im Kreisverkehr:<br />
Wer im Kreisverkehr in die falsche Richtung fährt und ertappt wird, ist mit 20 Euro dabei.<br />
Anschnallpflicht in Bussen:<br />
In Bussen, die mit Gurten ausgestattet sind, müssen sich die Fahrgäste künftig anschnallen. Gurtmuffel<br />
zahlen 30 Euro.<br />
Zu schnelle Busse:<br />
Für zu schnelles Fahren werden Busfahrer härter bestraft. Wenn sie innerorts 21 Stundenkilometer oder<br />
außerhalb von Ortschaften 26 Stundenkilometer zu schnell fahren, droht ihnen ein Monat Fahrverbot.<br />
Ebenfalls härter bestraft wird, wenn Busse verspätet zur TÜV-Untersuchung gebracht werden.<br />
Lastwagen:<br />
Wie bei Bussen wird auch bei Lastwagen stärker durchgegriffen, wenn die Fristen für<br />
Sicherheitsprüfungen nicht eingehalten werden. Auch ein Fahrverbot bei zu schnellem Fahren wird früher<br />
erteilt. Beim Überholen auf der Autobahn muss der Lastwagenfahrer mindestens zehn Stundenkilometer<br />
schneller fahren als das Fahrzeug, das er überholen möchte. Sonst riskiert er einen Punkt in Flensburg<br />
und muss 40 statt bisher 30 Euro zahlen.<br />
Illegale Autorennen:<br />
1000 Euro Strafe, vier Punkte und ein Monat Fahrverbot drohen Fahrern, die bei illegalen Autorennen<br />
erwischt werden.<br />
Bußgeld & Verkehr:<br />
Tempolimit: Bei Lärmschutz genauso verbindlich<br />
Karlsruhe (dpa) - Geschwindigkeitsbegrenzungen zum Lärmschutz sind nicht weniger ernst zu nehmen<br />
als Tempolimits aus Sicherheitsgründen. Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe in einem<br />
Beschluss bekräftigt. Das Gericht bestätigte ein einmonatiges Fahrverbot gegen einen Studenten aus<br />
Südbaden, der auf der Autobahn 5 bei Heidelberg früh morgens mit 147 Stundenkilometern durch eine<br />
Tempo-100-Zone gerast war.<br />
Der 24-Jährige meinte, er habe keine «grobe Pflichtverletzung» begangen. Denn das Tempolimit sei an<br />
der Stelle nur wegen des Ruhebedürfnisses der Anwohner, nicht aber wegen der Sicherheit des Verkehrs<br />
angeordnet worden. Das OLG dagegen hält das Fahrverbot auch in solchen Fällen für angezeigt.<br />
(Aktenzeichen: 2 Ss 25/04 - Beschluss vom 2. März 2004)<br />
Der Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Abgasen betreffe ihr Grundrecht auf körperliche<br />
Unversehrtheit, teilte das Gericht mit. Der hohe Rang, der ihrer psychischen und physischen Gesundheit<br />
zukomme, lasse es deshalb in der Regel nicht zu, auf einen «Denkzettel» für Raser zu verzichten.<br />
SEITE - 13 -
Bußgeld & Verkehr:<br />
Boots-Vignette: Nur für große Motoren geplant<br />
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
Berlin (dpa) - Die vom Bundesverkehrsministerium geplante Boots- Vignette für den Verkehr auf<br />
Bundeswasserstraßen soll bei kleinen Motoren nicht erhoben werden. Nur für Yachten und Boote mit<br />
großen Motoren müssen die Besitzer demnach mit Kosten von 60 bis 90 Euro für eine Jahresvignette<br />
rechnen, erläuterte ein Sprecher des Ministeriums am Freitag. Der Start des Vorhabens, das «etwas<br />
mehr als 7 Millionen Euro» einbringen solle, sei für Anfang 2005 geplant.<br />
Einstimmig habe der Rechnungsprüfungsausschuss die Regierung - wie zuvor der Bundesrechnungshof -<br />
aufgefordert, eine solche Nutzergebühr für den Verkehr auf Kanälen und in Schleusen zu erheben, hieß<br />
es. Die von Freizeitkapitänen verursachten Kosten dürften nicht den Steuerzahlern abverlangt werden.<br />
Von Umweltschützern wird die Bootsmaut unterstützt. Große Boote richteten auf Grund ihres<br />
Wellenschlages starke Schäden an den Ufern an, erklärte der Bund für Umwelt und Naturschutz<br />
Deutschland<br />
(BUND) am Freitag in Berlin. Deshalb sollten sie vergleichsweise höher besteuert werden, forderte<br />
Geschäftsführer Gerhard Timm. «Umweltfreundliche und langsamere Boote mit Solar-Elektroantrieben<br />
sollten hingegen Steuervorteile erhalten.»<br />
Bußgeld & Verkehr:<br />
Radfahrer: Auf kombinierten Wegen aufpassen<br />
Oldenburg (dpa) - Auf kombinierten Rad- und Fußwegen müssen Fahrradfahrer besondere Rücksicht auf<br />
Fußgänger nehmen. Das hat das Oberlandesgericht Oldenburg in einem veröffentlichten Beschluss<br />
entschieden. Danach erhält eine Radfahrerin nach einem Unfall mit einem Fußgänger keinen<br />
Schadenersatz und kein Schmerzensgeld. (Az: 8 U 19/04/04)<br />
Im September 2002 war die damals 60-jährige Frau auf einem kombinierten Rad- und Fußweg in<br />
Oldenburg mit einem 67-jährigen Mann zusammen gestoßen. Dabei zog sie sich einen komplizierten<br />
Beinbruch zu. Sie machte den Rentner für den Unfall verantwortlich und verlangte Schadenersatz und<br />
Schmerzensgeld. Mit ihrer Klage scheiterte sie im Dezember vergangenen Jahres schon vor dem<br />
Landgericht Oldenburg und nun im Berufungsverfahren auch vor dem Oberlandesgericht.<br />
Die Richter wiesen darauf hin, dass Radfahrer auf kombinierten Wegen besondere Sorgfaltspflichten<br />
haben. Insbesondere bei unklarer Verkehrslage müssten sie gegebenenfalls per Blickkontakt eine<br />
Verständigung mit dem Fußgänger suchen. Notfalls dürften sie nur Schrittgeschwindigkeit fahren, um<br />
sofort anhalten zu können. Besondere Rücksicht müssten sie auf ältere und unachtsame Fußgänger<br />
nehmen.<br />
Ehe, Familie & Erben:<br />
Schulden: Ehefrau haftet nicht<br />
Koblenz (dpa) - Eine Ehefrau muss nicht für die Schulden ihres Mannes haften, wenn sie selbst dabei<br />
finanziell völlig überfordert ist. Das geht aus einem in der Zeitschrift «OLG-Report» veröffentlichten<br />
Beschluss des Oberlandesgerichts (OLG) Koblenz hervor. Nach Auffassung der Richter liegt eine<br />
finanzielle Überforderung in jedem Fall dann vor, wenn die Frau nicht einmal in der Lage ist, die<br />
laufenden Zinsen aufzubringen. Ein so genanntes Schuldanerkenntnis sei in diesem Fall nichtig.<br />
Das Gericht bewilligte mit seinem Beschluss (Az.: 5 W 568/03) einer Ehefrau Prozesskostenhilfe. Die<br />
Frau wandte sich gegen die von einer Bank wegen der Geschäftsschulden ihres Mannes betriebene<br />
Zwangsvollstreckung. Sie hatte sich in einem notariellen Vertrag zur Übernahme der Schulden<br />
SEITE - 14 -
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
verpflichtet. Das OLG hielt dieses, von der Bank erwirkte Schuldanerkenntnis jedoch für sittenwidrig. Der<br />
Bank hätten die Vermögensverhältnisse der nicht berufstätigen Ehefrau auffallen müssen, argumentierten<br />
die Richter.<br />
Ehe, Familie & Erben:<br />
Auslegung: Zettelwirtschaft ist kein Testament<br />
(Val) Eine 73 jährige alleinstehende Dame hat vergeblich versucht, großzügig 12 verschiedene<br />
gemeinnützige Organisationen in ihrem Testament zu bedenken. Ihr Vorhaben ist an den<br />
Formvorschriften des bürgerlichen Gesetzbuches gescheitert. Das Landgericht München I befand das<br />
Testament für unwirksam und legte ein früher verfasstes Vermächtnis als Testament aus.<br />
Die alte Dame wurde tot in ihrer Münchner Wohnung gefunden. Sie hatte keine Geschwister und keine<br />
Kinder. Als gesetzliche Erben kamen deshalb nur entfernte Verwandte in Betracht. Sie hinterließ ein<br />
Bankguthaben von 600.000,- Euro.<br />
In der Wohnung der alten Dame fand sich nach ihrem Tod offen in der Küche ein Stapel von 13 einzelnen<br />
Blättern, auf denen ein kleiner Zettel mit der Aufschrift "Testament" lag. Die Verstorbene hatte dieses<br />
"Testament" offenbar kurz vor ihrem Tod so bereitgelegt. Auf 10 DIN-A5-Einzelblättern hatte sie<br />
unterschiedliche Bruchteile ihres Vermögens von 1/10, 1/20 oder 1/40 an insgesamt 12 gemeinnützige<br />
Organisationen verteilt.<br />
Eines dieser Blätter trug den handschriftlichen Vermerk "für alles zusammen im Vollbesitz meiner<br />
geistigen Kräfte" mit dem Datum 16.9.2000 und der Unterschrift der Verstorbenen.<br />
Drei weitere undatierte DIN-A4-Bögen sind jeweils beidseitig beschrieben, jedoch nicht unterschrieben.<br />
Zwei davon sind ersichtlich Entwürfe. Der dritte Bogen ist überschrieben mit "Mein Nachlass soll wie folgt<br />
verteilt werden". Darin soll das Guthaben von 2 Bausparverträgen und einem Girokonto sowie 1/5 der<br />
Ersparnisse aus Sparbüchern, ferner Hausrat und Grabstellen einer großen gemeinnützigen Organisation<br />
zufallen.<br />
Außer den Zetteln gibt es ein "Vermächtnis" vom 23.9.1990, wonach das Erbe nach Abzug aller Unkosten<br />
und Einzelzuweisungen verteilt werden soll auf 9 gemeinnützige Organisationen zu Bruchteilen von 2/5,<br />
1/10 und 1/20.<br />
Das Amtsgericht München sah die 10 DIN-A5-Blätter aus der Küche als wirksames, einheitliches<br />
Testament an. Das übrige Vermögen sollte nach dem "Vermächtnis" vom 23.9.1990 verteilt werden.<br />
Gegen die angekündigte Erteilung eines entsprechenden Erbscheins wandte sich die Organisation, die<br />
sowohl auf den DIN-A4-Bögen als auch durch das Testament vom 23.9.1990 mit dem größten Anteil<br />
bedacht war. Sie beansprucht das hinterlassene Vermögen als Alleinerbe, da ihr der Löwenanteil zufalle.<br />
Anders als das Amtsgericht hält die 16. Zivilkammer des Landgerichts München I das "Zettel-Testament"<br />
für unwirksam. Zwar müssen die Blätter eines Testaments nicht miteinander verbunden sein. Sie müssen<br />
aber inhaltlich einen Zusammenhang haben, der sie als untrennbare Urkunde und einheitliche<br />
Willenserklärung des Erblassers erkennbar macht. Die Blätter unterschiedlichen Formats hätten weder<br />
eine fortlaufende Nummerierung noch einen zusammenhängenden Text.<br />
Auf den kleineren Blättern seien Bruchteile genannt, ohne dass man wisse, wovon. Sie seien nur<br />
stichwortartig beschriftet und noch dazu auf unterschiedlichem Papier. Auch das Schriftbild sei nicht<br />
einheitlich. Der unterschriebene Zettel "für alles" sei keine ausreichende Zusammenfassung der Blätter.<br />
Es bliebe unklar, was mit "alles" gemeint sei. Dass beim Zusammenzählen der einzelnen Quoten ein<br />
Ganzes herauskomme, genüge nicht, nun eine einheitliche Urkunde anzunehmen.<br />
Die Erbfolge richte sich folglich nach dem "Vermächtnis" vom 23.9.1990, meinen die Richter. Erben seien<br />
die dort genannten gemeinnützigen Organisationen.<br />
Landgericht München I, 16 T 17192/03<br />
SEITE - 15 -
Ehe, Familie & Erben:<br />
Augsburg: Mädchen darf nicht Nicola heißen<br />
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
Augsburg (dpa) - Ein Augsburger Elternpaar darf seine Tochter nicht Nicola nennen. Dieses Urteil fällte in<br />
zweiter Instanz das Landgericht Augsburg (Aktenzeichen 4 T 5540/03) und bestätigte damit ein früheres<br />
Urteil des Amtsgerichtes. Zur Begründung gab das Gericht an, der Name Nicola sei in sämtlichen<br />
Namensbüchern sowohl als männlicher als auch als weiblicher Vornamen eingetragen. Nach dem<br />
deutschen Namensrecht müsse sich aus dem Vornamen aber eindeutig das Geschlecht der Person<br />
ergeben.<br />
Die Eltern hatten den Vorschlag des Gerichts abgelehnt, das Mädchen «Nikola» zu nennen. Mit dieser<br />
Schreibweise wäre der Name nach Ansicht des Gerichts eindeutig einer weiblichen Person zuzuordnen.<br />
Das Kind war am 14. August 2003 geboren worden und ist seither ohne Namen. Wie sich die Eltern<br />
nunmehr entschieden haben, ist nicht bekannt.<br />
Ehe, Familie & Erben:<br />
Elternunterhalt: Ein Fall unbilliger Härte<br />
(Val) Einen Fall unbilliger Härte erkannte der Bundesgerichtshof in dem Fall einer auf Elternunterhalt in<br />
Anspruch genommenen Tochter. Für einen Vater, der seiner Familie aufgrund von Kriegsfolgen nicht zu<br />
Verfügung stand und zu dem kaum eine persönliche Beziehung bestand, kann der Leistungsträger der<br />
Sozialhilfe keine Unterhaltsleistungen verlangen.<br />
Der Senat hat die zugelassene Revision des Landkreises zurückgewiesen. Er bestätigte die Auffassung<br />
der Vorinstanzen, dass der Übergang des Unterhaltsanspruchs auf die Tochter eine unbillige Härte (§ 91<br />
Abs. 2 Satz 2 BSHG) darstellen würde. Diese hat nicht nur während der Kriegsteilnahme ihres Vaters<br />
dessen emotionale und materielle Zuwendung entbehren müssen, sondern auch in der Folgezeit nicht die<br />
unter normalen Umständen zu erwartende väterliche Zuwendung erfahren, weil ihr Vater psychisch<br />
gestört aus dem Krieg zurückkehrte und der Familie keine Fürsorge zuteil werden lassen konnte.<br />
Aufgrund dieser Umstände war die Tochter bereits in den Jahren ihrer Kindheit in starkem Maße belastet.<br />
In der Folgezeit waren die Familienbande zum Vater zumindest stark gelockert. Wenn sie gleichwohl von<br />
dem Träger der Sozialhilfe auf Unterhalt für ihren Vater in Anspruch genommen werden könnte, würden<br />
dadurch soziale Belange vernachlässigt. Angesichts der Einbußen, die sie aufgrund der Krie! gs! folgen,<br />
von denen ihr Vater betroffen war, zu tragen hatte, und der weiteren Entwicklung der Beziehungen zu<br />
diesem kann von ihr nicht erwartet werden, Unterhaltsleistungen für den Vater an die öffentliche Hand zu<br />
erbringen.<br />
Der klagende Landkreis hatte dem Vater seit Mai 2000 Sozialhilfe in Höhe der nicht durch eigenes<br />
Einkommen gedeckten Kosten des Aufenthalts in einem Alten- und Pflegeheim gewährt. Die 1939<br />
geborene Tochter ist das einzige noch lebende Kind aus der seit 1971 geschiedenen Ehe ihrer Eltern.<br />
Ihre Mutter ist verstorben. Die Beklagte ist Rentnerin. Sie verfügte - nach Abzug der Kosten der Kranken-<br />
und Pflegeversicherung - über Renteneinkünfte von monatlich ca. 2.480 DM, die Renteneinkünfte ihres<br />
Ehemannes beliefen sich auf monatlich ca. 2.160 DM. Die Eheleute bewohnen eine Wohnung in dem der<br />
gemeinsamen Tochter gehörenden Haus, an der ihnen ein Wohnrecht zusteht. Auf ein Darlehen über<br />
30.000 DM hatte die Beklagte monatliche Raten von 530 DM zu zahlen.<br />
Der Vater der Beklagten diente als Soldat der Deutschen Wehrmacht im 2. Weltkrieg. Er kam nach<br />
mehreren Lazarettaufenthalten psychisch erkrankt aus dem Krieg zurück und befand sich seit August<br />
1949 ununterbrochen in einer psychiatrischen Klinik. Seit 1998 lebt er in einem Alten- und Pflegeheim.<br />
Die ungedeckten Heimkosten beliefen sich in der Zeit von Mai bis August 2000 auf Beträge, die zwischen<br />
monatlich ca. 1.370 DM und ca. 1.840 DM liegen.<br />
Mit seiner Klage machte der Landkreis übergegangene Unterhaltsansprüche des Vaters für die streitige<br />
Zeit von Mai bis August 2000 in Höhe von monatlich 1.031 DM geltend. Das Amtsgericht hat die Klage<br />
abgewiesen, Berufung und Revision des Landkreises blieben erfolglos.<br />
Urteil vom 21. April 2004 - XII ZR 326/01<br />
SEITE - 16 -
Familie und Kinder:<br />
Unterhalt: Nur an direkte Verwandte zahlen<br />
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
(Val) Ist der Ehemann oder die Ehefrau gegenüber ihrem Partner zu Unterhaltszahlungen verpflichtet,<br />
gelten diese Zahlungen steuerlich als außergewöhnliche Belastungen. Bis zu einem Betrag von 7.680<br />
Euro (ab Veranlagungszeitraum 2004) können die geleisteten Zahlungen bei der<br />
Einkommensteuererklärung geltend gemacht werden. Für den Veranlagungszeitraum 2003 kann ein<br />
Betrag von 7.188 Euro angesetzt werden.<br />
Ein gesetzlicher Unterhaltsanspruch besteht auch für Mütter eines nichtehelichen Kindes, falls sie das<br />
Kind betreut. Wenn der Vater das Kind betreut hat, hat auch er einen Unterhaltsanspruch gegenüber der<br />
Mutter des Kindes. Auch Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft können geleistete<br />
Unterhaltszahlungen als außergewöhnliche Belastungen ansetzen.<br />
Der Höchstbetrag von 7.680 Euro(ab Veranlagungszeitraum 2004) ist um die Einkünfte der zu<br />
unterhaltenen Person zu vermindern. Liegen die eigenen Einkünfte der zu unterhaltenen Person nicht<br />
über 624 ¿ im Jahr, müssen diese Einkünfte nicht berücksichtigt werden. Unterhaltszahlungen werden<br />
jedoch nur dann steuerlich anerkannt, wenn die Einkünfte des Leistenden bestimmte Grenzwerte nicht<br />
übersteigen. (Berechnung der Opfergrenze: BMF-Schreiben vom 15.9.1997)<br />
Werden Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehepartner gezahlt,<br />
so können diese bis zu einer Höhe von 13.805 Euroals Sonderausgaben steuerlich geltend gemacht<br />
werden. Folgende Voraussetzungen müssen gegeben sein: Der begünstigte ehemalige Partner ist<br />
unbeschränkt steuerpflichtig und er muss mit dem Abzug als Sonderausgabe einverstanden sein. Willigt<br />
der Partner in diesen Abzug als Sonderausgabe ein, so hat er diese Zuwendungen als sonstige Einkünfte<br />
in seiner Steuererklärung anzugeben.<br />
Praxistipp:<br />
Für Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft besteht keine Verpflichtung zu<br />
Unterhaltszahlungen nach Beendigung der Lebensgemeinschaft. Daher können tatsächlich geleistete<br />
Zahlungen an einen Partner nach der Trennung steuerlich nicht geltend gemacht werden. Das gleiche gilt<br />
für Unterhaltszahlungen an Geschwister, da keine gesetzliche Verpflichtung besteht. Zur Gewährung von<br />
Unterhalt sind nach dem bürgerlichen <strong>Recht</strong> nur Verwandte in gerader Linie verpflichtet. Wird trotzdem<br />
Unterhalt gezahlt, ist zu beachten, dass sich der Anspruch des Unterhaltenen auf Sozialhilfe vermindert.<br />
Familie und Kinder:<br />
Unterhalt: Ist ein Eigenheim schädlich?<br />
(Val) Unterhaltsleistungen an bedürftige Angehörige sind nur dann absetzbar, wenn der<br />
Unterhaltsempfänger kein oder nur ein geringes Vermögen besitzt (§ 33a Abs. 1 Satz 3 EStG).<br />
Unschädlich ist ein geringes Vermögen bis zu einem Verkehrswert von 15 500 EUR, wobei nach<br />
bisheriger <strong>Recht</strong>slage ein angemessenes Hausgrundstück außer Betracht bleibt, das vom<br />
Unterhaltsempfänger allein oder zusammen mit Angehörigen selbst bewohnt wird.<br />
Kürzlich hatte nun der Bundesfinanzhof entschieden, dass sich die Vermögensgrenze unabhängig von<br />
der Anlageart nach dem Verkehrswert richtet. Dabei solle es keinen Unterschied machen, ob der<br />
Unterhaltsempfänger sein Vermögen in Mietshäusern, Wertpapieren, Kunstgegenständen oder<br />
anderweitig angelegt hat. Deshalb sei auch ein selbst genutztes Eigenheim mit zu erfassen, und zwar mit<br />
dem Verkehrswert. Zwar ging es im Urteilsfall konkret um ein Dreifamilienhaus, doch der BFH hatte<br />
ausdrücklich die bisherige großzügige Auffassung der Finanzverwaltung abgelehnt, die ein Eigenheim als<br />
unschädlich ansieht (BFH-Urteil vom 12.12.2002, BStBl. 2003 II S. 655).<br />
Das Bundesfinanzministerium hat jetzt aktuell beschlossen, dass trotz des strengen BFH-Urteils weiterhin<br />
ein angemessenes Hausgrundstück bei der Vermögensermittlung außer Betracht bleiben soll, das vom<br />
SEITE - 17 -
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
Unterhaltsempfänger allein oder zusammen mit Angehörigen bewohnt wird. Dies sei im Sinne der Einheit<br />
der <strong>Recht</strong>sordnung geboten, weil auch im Sozialhilferecht ein angemessenes Hausgrundstück<br />
unschädlich sei (BMF-Schreiben vom 20.8.2003, BStBl. 2003 I S. 411).<br />
Familie und Kinder:<br />
Kinder: Studium neben dem Zivildienst oder Wehrdienst begünstigt?<br />
(Val) Für Kinder, die den gesetzlichen Zivildienst oder Wehrdienst leisten, erhalten die Eltern weder<br />
Kindergeld noch den steuerlichen Kinderfreibetrag und BEA-Freibetrag (für Betreuung, Erziehung und<br />
Ausbildung). Dafür aber werden diese Kinder über das 27. Lebensjahr hinaus berücksichtigt, wenn sie<br />
dann noch in Berufsausbildung sind, oder über das 21. Lebensjahr hinaus, wenn sie dann arbeitslos sind.<br />
Wenn nun ein Kind neben dem Zivildienst ein Studium oder ein Fernstudium aufnimmt, stellt sich die<br />
Frage, wie diese Zeit denn nun zu werten ist. Der Bundesfinanzhof hatte entschieden, dass sich das Kind<br />
in Berufsausbildung befindet, wenn es neben dem Zivildienst ein Studium ernsthaft und nachhaltig<br />
betreibt. Somit stehe den Eltern während dieser Zeit Kindergeld zu (BFH-Urteil vom 14.5.2002, BStBl.<br />
2002 II S. 807).<br />
Die Finanzverwaltung hat beschlossen, dieses Urteil zu akzeptieren (OFD Berlin vom 4.2.2003, DB 2003<br />
S. 853). Es soll nicht nur für das Kindergeld gelten, sondern in gleicher Weise auch für den<br />
Kinderfreibetrag und den BEA-Freibetrag. Und da Zivildienst und Wehrdienst im Steuerrecht immer gleich<br />
behandelt werden, ist das Urteil auch anzuwenden auf Kinder, die ihre Berufsausbildung neben dem<br />
Grundwehrdienst verfolgen. Es sei aber sicherzustellen, dass die Zeit des Zivil- oder Wehrdienstes später<br />
nach dem 21. bzw. dem 27. Lebensjahr nicht auch noch als Verlängerungszeitraum nach § 32 Abs. 5<br />
EStG berücksichtigt werde.<br />
Immobilienbesitzer:<br />
Eigenheimzulage: Erwerb vom Ehegatten in Konkurs<br />
(Val) Kauft ein Ehegatte eine Wohnung vom anderen Ehegatten, besteht kein Anspruch auf die<br />
Eigenheimzulage (§ 2 Abs. 1 Satz 3 EigZulG).<br />
Anders aber liegt der Fall, wenn über das Vermögen des anderen Ehegatten das Konkursverfahren<br />
eröffnet ist und der Ehegatte die Wohnung vom Konkursverwalter aus der Konkursmasse des anderen<br />
Ehegatten erwirbt. Dies hat jetzt aktuell der Bundesfinanzhof entschieden (BFH-Urteil vom 19.2.2004, III<br />
R 54/01).<br />
Im Urteilsfall war die gemeinsame Familienwohnung Eigentum des Ehemannes. Nachdem über sein<br />
Vermögen das Konkursverfahren eröffnet worden war, kaufte die Ehefrau die Wohnung vom<br />
Konkursverwalter. Nach der Entscheidung des BFH hat die Ehefrau Anspruch auf die Eigenheimzulage,<br />
weil mit der Eröffnung des Konkursverfahrens nicht mehr der Ehemann, sondern nur noch der<br />
Konkursverwalter über das konkursbefangene Grundstück habe verfügen dürfen. Zum Verkauf sei allein<br />
der Konkursverwalter berechtigt gewesen, so dass der Erwerb des Grundstücks praktisch dem Erwerb<br />
von einem Dritten gleichgekommen sei. In diesem Fall spielt es keine Rolle, dass formal das<br />
zivilrechtliche Eigentum an dem übertragenen Grundstück unmittelbar vom Ehemann auf die Ehefrau<br />
übergegangen war.<br />
Diese Auslegung entspricht nach Auffassung des BFH auch dem Zweck der Eigenheimzulage: Infolge<br />
des Konkurses sei die Familienwohnung der Familie wirtschaftlich als Objekt der Vermögensbildung<br />
entzogen worden, weil mit der Verwertung der Wohnung und der Auskehrung des Erlöses an die<br />
Gläubiger zu rechnen gewesen sei. Die Anschaffung durch die Ehefrau aus der Konkursmasse führe wie<br />
bei einem Erwerb durch einen Dritten zu einer neuen - mit dem EigZulG beabsichtigten -<br />
Vermögensbildung in Form von Wohneigentum für die Familie.<br />
SEITE - 18 -
Immobilienbesitzer:<br />
Eigenheimzulage: Wenn der Ehegatte stirbt<br />
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
(Val) Erhält der überlebende Ehegatte durch den Erbfall das Miteigentum an der vormals gemeinsamen<br />
Wohnung die durch Eigenheimzulage gefördert wird, so ist der bisherige Miteigentumsanteil zusammen<br />
mit dem hinzu erworbenen Anteil als ein Objekt zu behandeln. Dabei müssen bis zum Tod des Ehegatten<br />
die Voraussetzungen zur Zusammenveranlagung vorgelegen haben.<br />
Die auf den Miteigentumsanteil des toten Gatten entfallende Eigenheimzulage, erhält der überlebende<br />
Ehegatte. Ist bei dem überlebenden Ehegatten bereits der Objektverbrauch eingetreten, kann die<br />
Wohnung nicht mehr mit Eigenheimzulage gefördert werden. Objektverbrauch liegt vor, wenn eine<br />
Immobilie des Ehegatte bereits durch Eigenheimzulage gefördert wurde.<br />
Immobilienbesitzer:<br />
Kabelanschluss: Ist Erhaltungsaufwand<br />
(Val) Aufwendungen für den Einbau einer privaten Breitbandanlage (Kabelanschluss) und einmalige<br />
Gebühren für den Anschluss privater Breitbandanlagen an das öffentliche Breitbandnetz bei bestehenden<br />
Gebäuden gehören zu den Erhaltungsaufwendungen.<br />
Der Erhaltungsaufwand ist im Jahr seiner Entstehung als Werbungskosten bei den Einkünften aus<br />
Vermietung- und Verpachtung zu berücksichtigen. Vor dem 1.1.1999 entstandene größere<br />
Aufwendungen für Erhaltungsarbeiten an Wohngebäuden können auf zwei bis fünf Jahre regelmäßig<br />
verteilt werden. Für die in dem jeweiligen Veranlagungszeitraum geleisteten Aufwendungen kann ein<br />
besonderer Verteilungszeitraum gebildet werden. Bei unentgeltlicher Übereignung des Wohngebäudes<br />
auf einen neuen Eigentümer kann der <strong>Recht</strong>snachfolger größeren Erhaltungsaufwand noch in dem vom<br />
<strong>Recht</strong>svorgänger gewählten Verteilungszeitraum geltend machen.<br />
Immobilienbesitzer:<br />
Wohnungsleerstand: Reduziert nicht gleich die Steuer<br />
Minden (dpa) - Leerstände bei Mietwohnungen führen nach<br />
Ansicht des Verwaltungsgerichts Minden nicht automatisch zu einer reduzierten Grundsteuer. Die<br />
Grundsteuer sei vom Ertrag unabhängig und eine Ermäßigung nur in außergewöhnlichen Fällen zu<br />
rechtfertigen, teilte ein Justizssprecher am Dienstag mit. Ein Überangebot an Mietwohnungen gehöre<br />
nicht dazu. Mit dem noch nicht rechtskräftigen Urteil wies die 11. Kammer die Klage einer<br />
Vermietungsgesellschaft gegen die Stadt Detmold zurück. (AZ: 11 K 1426/02).<br />
Immobilienbesitzer:<br />
Billigmiete: Mietrechtliche Kappungsgrenze unwichtig<br />
(Val) Wird eine Wohnung zu einem verbilligten Mietpreis an Angehörige überlassen, können die<br />
Aufwendungen für das Objekt dennoch in voller Höhe als Werbungskosten absetzbar sein.<br />
Voraussetzung ist seit dem 1.1.2004 allerdings, dass die vereinbarte Miete mindestens 56 % der<br />
ortsüblichen Marktmiete beträgt. Beträgt die Miete tatsächlich mehr als 56 %, aber weniger als 75 % der<br />
Marktmiete, muss durch eine Prognoserechnung nachgewiesen werden, dass mit einem insgesamt<br />
SEITE - 19 -
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
positiven Ergebnis zu rechnen ist. Erst bei einer Miete von mehr als 75 % werden die Werbungskosten<br />
uneingeschränkt anerkannt.<br />
Die Frage ist nun, ob die vereinbarte Miete einfach auf 75 % der ortsüblichen Miete angehoben werden<br />
kann. Hierzu nimmt jetzt die OFD Münster Stellung (OFD Münster vom 13.2.2004, S 2253 - 60 - St 22 -<br />
31):<br />
Nach § 558 Abs. 3 BGB darf die Miete innerhalb von drei Jahren nicht um mehr als 20 % erhöht werden.<br />
So ist nach dem BGB eine Anhebung von bisher 50 % um maximal 20 % möglich, auf dann 60 % der<br />
ortsüblichen Miete. Die nächste Mieterhöhung ist grundsätzlich frühestens nach drei Jahren, in 2007,<br />
zulässig. Kann die Miete ab 2004 aufgrund dieser Kappungsgrenze nicht auf 75 % der ortsüblichen Miete<br />
angehoben werden und ist die Ertragsprognose negativ, sind die Werbungskosten nur anteilig abziehbar.<br />
Dies gilt ungeachtet der aus § 558 ff. BGB resultierenden Anpassungshindernisse. Wird bei einer<br />
Vermietung unter nahen Angehörigen eine über die Kappungsgrenzen des § 558 Abs. 3 BGB<br />
hinausgehende Mieterhöhung vereinbart und tatsächlich vollzogen, so ist allein hierdurch kein Umstand<br />
gegeben, der zu einem Ausschluss der steuerlichen Anerkennung des Mietverhältnisses führt. Bei einer<br />
klar und eindeutig vereinbarten und durchgeführten Mieterhöhung von z.B. 50 % auf 75 %. der<br />
ortsüblichen ! Mi! ete ist das Mietverhältnis, sofern es im Übrigen dem zwischen Fremden Üblichen<br />
entspricht (sog. Fremdvergleich), steuerlich anzuerkennen.<br />
Immobilienbesitzer:<br />
Zweitwohnungssteuer: In Essen nicht rechtens<br />
Gelsenkirchen (dpa) - Die von der Stadt Essen erhobene Zweitwohnungssteuer ist nach einem Urteil des<br />
Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen nicht rechtens. Die Stadt erhebe die Steuer, ohne ausreichende<br />
Kontrollen einzurichten. Die Folge sei eine Ungleichbehandlung gegenüber Bürgern, die ihren<br />
Zweitwohnsitz nicht gemeldet hätten, sagte am Donnerstag ein Gerichtssprecher. Die Stadt versuche<br />
über diesen Weg, die Zahl der Erstwohnsitze zu erhöhen, um höhere Schlüsselzuweisungen erhalten.<br />
«Die Satzung ist deshalb unwirksam», sagte der Sprecher.<br />
Das Gericht gab der Klage eines vielreisenden 40-jährigen Esseners statt, der aus praktischen Gründen<br />
das Kinderzimmer bei seinen Eltern als Zweitwohnsitz angemeldet und die Zahlung der Steuer verweigert<br />
hatte (Az.: 16 K 3699/01). Das Gericht verwies dabei auf eine Entscheidung des<br />
Bundesverfassungsgerichts vom 27.6.1991, wonach eine Behörde bei der Deklaration einer Steuer auch<br />
für die flächendeckende Zahlung Sorge tragen müsse.<br />
Anders als im Essener Fall hält das Verwaltungsgericht die Erhebung der Zweitwohnungssteuer in<br />
Dortmund und Haltern für rechtens und wies entsprechende Klagen von Betroffenen ab. In Dortmund sei<br />
für ausreichende Kontrollen gesorgt. In Haltern sei die Klage eines Campers abgewiesen worden, der<br />
einen festen Platz gemietet habe. Wer sich häufig dort aufhalte, könne prinzipiell auch zur Zahlung der<br />
Zweitwohnungssteuer herangezogen werden.<br />
Internet, Medien & Telekommunikation:<br />
Literatur: Darf auch nicht alles<br />
München (dpa) - Der stark autobiografisch gefärbte Liebesroman «Esra» des Schriftstellers Maxim Biller<br />
darf auch in einer entschärften Fassung nicht erscheinen. Das hat das Oberlandesgericht<br />
(OLG) München am Dienstag in zweiter Instanz entschieden. Der Roman verletze die<br />
Persönlichkeitsrechte von Billers Ex-Freundin und deren Mutter. Beide Frauen seien in den<br />
Romanfiguren auch in der geänderten Fassung des Buches erkennbar, befand der 18. OLG-Zivilsenat<br />
und bestätigte damit ein Urteil des Landgerichts München I vom Oktober 2003. Das OLG-Urteil kann<br />
SEITE - 20 -
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
beim Bundesgerichtshof angefochten werden. Billers Verlag Kiepenheuer & Witsch wollte am Dienstag<br />
jedoch noch keine inhaltliche Stellungnahme abgeben.<br />
Ob der Verlag das Urteil beim Bundesgerichtshof anfechten werde, sei noch nicht entschieden, sagte<br />
eine Verlagssprecherin. «Wir müssen uns erstmal die Begründung des Urteils angucken und werden<br />
dann über das weitere Vorgehen beraten.»<br />
Der Senat betonte, dass der Roman mit dem vorliegenden Urteil aber nicht «unrettbar verloren» sei, denn<br />
der Autor könne dem Buch ja noch eine ganz andere Fassung geben. Insofern sei das Verbot, das Buch<br />
in der jetzt vorliegenden Änderung weiter zu verbreiten, nicht unverhältnismäßig. Aus Rücksicht auf die<br />
Persönlichkeitsrechte der beiden Klägerinnen werde die schriftliche Begründung des OLG-Urteils nicht<br />
veröffentlicht.<br />
Die Änderungen, die der Verlag Kiepenheuer & Witsch in Köln zuletzt noch am 9. Februar dieses Jahres<br />
angeboten habe, stellten keine ausreichende Verfremdung dar (Az.: 18 U 4890/03). Auch in der jetzt<br />
vorliegenden Fassung werde in die Privatsphäre der Frauen eingegriffen und deren <strong>Recht</strong> am eigenen<br />
Lebensbild verletzt. Bei einer Abwägung mit dem <strong>Recht</strong> auf Kunstfreiheit seien die Eingriffe in die<br />
Schutzsphäre der Frauen nicht gerechtfertigt.<br />
Der Münchner <strong>Recht</strong>sanwalt der beiden Frauen, Wolfgang von Nostitz, nannte das Urteil sehr erfreulich.<br />
«Es setzt dem Trend, Privates in der Öffentlichkeit breitzutreten, eine Grenze», sagte Nostitz der dpa.<br />
«Auch wenn der Verlag bis vor den Bundesgerichtshof oder das Bundesverfassungsgericht ziehen sollte,<br />
sehen wir dem sehr gelassen entgegen.» Bei den vom Verlag stufenweise angebotenen Änderungen<br />
habe es sich nur um Kosmetik gehandelt, die grundsätzliche Erkennbarkeit sei nicht beseitigt worden.<br />
«Es müsste ein Minimum von künstlerischer Verfremdung vorgenommen werden, die aus dem Buch<br />
überhaupt erst ein Kunstwerk machen würde», erklärte der Anwalt.<br />
Kritiker sehen durch die Entscheidungen der Justiz die Freiheit der Kunst tangiert. Sie verweisen darauf,<br />
dass in literarische Werke in unterschiedlicher Form immer auch prägende Erlebnisse der Autoren<br />
einflössen. Der Anwalt der Frauen hatte dagegen wiederholt geltend gemacht, dass die Menschenwürde<br />
über der Kunstfreiheit stehe. Er hatte vor einer literarischen «Instrumentalisierung für persönliche Hass-<br />
Attacken» und vor «wirtschaftlichem Profitstreben aus der Schlüssellochperspektive» gewarnt.<br />
Schon das Landgericht München I hatte gerügt, Biller habe in seinem Roman Familienverhältnisse und<br />
Örtlichkeiten aus einer früheren Beziehung «eins zu eins übernommen, bis hin zur Siamkatze». Die<br />
Romanheldin ist Filmpreisträgerin wie Billers Ex-Geliebte, die Mutter wie in der Wirklichkeit Trägerin des<br />
alternativen Nobelpreises und in dritter Ehe verheiratet.<br />
Biller, 1960 in Prag geboren, lebt seit 1970 in Deutschland. Von ihm sind unter anderem die Erzählbände<br />
«Land der Väter und Verräter» und «Harlem Holocaust» sowie der Roman «Die Tochter» erschienen.<br />
Internet, Medien & Telekommunikation:<br />
Internetauktion: Bank haftet nicht für Abwicklung<br />
Frankfurt/Main (dpa) - Eine Bank haftet nicht für den Schaden aus einem verpatzten Internet-<br />
Auktionsgeschäft. Das hat das Amtsgericht Frankfurt in einem Urteil entschieden. Die Richter wiesen<br />
damit die Klage eines Mannes gegen die Postbank zurück (AZ 32 C 1364/03-40).<br />
Der Kläger hatte 900 Euro bei einer Postbank-Filiale für einen spanischen Geschäftsmann eingezahlt,<br />
von dem er bei einer Auktion des Internethauses eBay etwas ersteigert hatte. Die Bank zahlte daraufhin<br />
an den Spanier das Geld aus, obwohl dieser dem Kunden die ersteigerte Ware schuldig geblieben war.<br />
Der geprellte Kläger war der Ansicht, die Bank hätte das Geld erst nach Aushändigung der Ware<br />
auszahlen dürfen.<br />
Laut Urteil hatte die Bank nur die Pflicht, sich vor der Auszahlung des Geldes von der Identität des<br />
Kunden zu überzeugen. Weiter reichende Verpflichtungen wie zum Beispiel von Kunden des<br />
SEITE - 21 -
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
Auktionshauses Quittungen zu verlangen, gebe es nicht. Deshalb könne die Bank für den Schaden auch<br />
nicht haftbar gemacht werden, erklärte das Gericht.<br />
Internet, Medien & Telekommunikation:<br />
Dialer: 25.000 Registrierungen widerrufen<br />
(Val) Die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (Reg TP) hat den Unternehmen Intexus<br />
GmbH, Global-Netcom GmbH und Consul Info B.V. mit Bescheid vom 8. April 2004 insgesamt rund<br />
25.000 Dialerregistrierungen rückwirkend entzogen.<br />
Die betroffenen Dialer gelten daher als niemals registriert. Es besteht keine Zahlungspflicht für<br />
Verbindungen, die über diese Dialer zustande gekommen sind. Die Maßnahme ist noch nicht<br />
bestandskräftig, aber sofort vollziehbar.<br />
Verbraucher können über die Dialer-Datenbank auf der Internetseite der Reg TP<br />
(www.regtp.de/mwdgesetz/start/fs_12.html) überprüfen, ob angewählte Dialer registriert sind. Für nicht<br />
bzw. nicht mehr registrierte Dialer besteht keine Zahlungsverpflichtung.<br />
Maßgeblicher Grund für die Rücknahme der Registrierungen ist hier das Fehlen einer sog.<br />
Wegsurfsperre. Dadurch werden die Verbindungen zur extratarifierten Mehrwertdiensterufnummer des<br />
Dialers weiter aufrechterhalten, selbst wenn anschließend kostenfreie oder niedriger bepreiste<br />
Internetseiten besucht werden. Dies ist nach den von der Reg TP festgelegten Mindestanforderungen für<br />
Dialer aus Verbraucherschutzgründen nicht erlaubt.<br />
Internet, Medien & Telekommunikation:<br />
Dialer: 400.000 Registrierungen widerrufen<br />
(Val) Der Widerruf von fast 400.000 Dialerregistrierungen, der im Oktober 2003 von der<br />
Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (Reg TP) ausgesprochen wurde (siehe<br />
Pressemitteilung Reg TP vom 27. Oktober 2003), ist am 02.04.04 bestandskräftig geworden. Nachdem<br />
das betroffene Unternehmen gegen die Entscheidung der Reg TP vor dem Verwaltungsgericht Köln<br />
geklagt hatte, hat es heute in der mündlichen Verhandlung die Klage zurückgenommen. Damit gelten die<br />
Dialer als nie registriert und für den Verbraucher bestand damit zu keiner Zeit eine Zahlungsverpflichtung.<br />
Die Reg TP hatte die Registrierung widerrufen, weil die Dialer nicht die von der Reg TP festgelegten<br />
Mindestanforderungen erfüllten und die zur Registrierung von Dialern vorgelegte Konformitätserklärung<br />
nicht dem tatsächlichen Verhalten der Dialer entsprach.<br />
Mit einer solchen Konformitätserklärung müssen die Dialeranbieter bestätigen, dass die von ihnen in<br />
Verkehr gebrachten Dialer den rechtlichen Mindestanforderungen entsprechen. Eine falsche<br />
Konformitätserklärung führt zum Entzug der im Mehrwertdienstemissbrauchsgesetz vorgeschriebenen<br />
Registrierung.<br />
Internet, Medien & Telekommunikation:<br />
Fluggastdaten: Sache für den EUGH<br />
Straßburg (dpa) - Im Zusammenhang mit der Übermittlung einer großen Zahl privater Fluggastdaten an<br />
die Vereinigten Staaten wird das EU-Parlament den Europäischen Gerichtshof anrufen. Das beschlossen<br />
die Abgeordneten mit knapper Mehrheit am Mittwoch in Straßburg. In der EU gebe es keine<br />
<strong>Recht</strong>sgrundlage für die Datenübermittlung zu Zwecken der öffentlichen Sicherheit, hieß es. Zudem<br />
SEITE - 22 -
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
kritisierten die Parlamentarier, dass in dem entsprechenden Abkommen der EU-Kommission mit den USA<br />
auch die Übermittlung der Daten an Drittstaaten möglich sei.<br />
Die USA ziehen Daten wie Namen, Kreditkartennummern und Telefonnummern von Fluggästen ein, die<br />
in die Vereinigten Staaten reisen. Damit sollen potenzielle Terroristen frühzeitig identifiziert werden<br />
können.<br />
Die Parlaments-Berichterstatterin Johanna Boogerd-Quaak (Liberale) forderte die Gleichbehandlung von<br />
Bürgern der USA und der EU. Bisher würden die EU-Bürger jedoch nicht vor Datenmissbrauch in den<br />
USA geschützt. Nur US-Bürger hätten dort ein <strong>Recht</strong> auf Datenschutz. Der CDU-Abgeordnete Hans-<br />
Peter Lehne sagte, seine Fraktion sei gegen die Anrufung des Gerichtes. Ohne das Abkommen komme<br />
es zu einer erheblichen Belastung der EU-Bürger bei der Einreise in die USA.<br />
Staat & Verwaltung:<br />
Riester-Förderung: Besonderheit bei Beamten<br />
(Val) Da die Einkommensdaten von Beamten, Soldaten und Richtern (Besoldungsempfängern) nicht bei<br />
den Rentenversicherungsträgern gespeichert sind, erhalten die Besoldungsempfänger, die einen Riester-<br />
Vertrag abgeschlossen haben, die "Riester"-Förderung in Förm der Altersvorsorgezulage und ggf. des<br />
ergänzenden Sonderausgabenabzugs nur, wenn sie gegenüber ihrer Besoldungsdienststelle bzw.<br />
gegenüber ihrem Arbeitgeber eine Einverständniserklärung zur Weitergabe ihrer Einkommensdaten an<br />
die zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) abgegeben haben.<br />
Mit dieser Erklärung nach § 10a Abs. 1a EStG geben die Betroffenen ihr Einverständnis, dass<br />
- die Besoldungsstelle bzw. der Arbeitgeber der zentralen Zulagestelle für Altersvermögen (ZfA)<br />
jährlich die erforderlichen Daten mitteilen darf, um den Mindesteigenbeitrag und die Kinderzulage<br />
ermitteln zu können,<br />
- die zentrale Zulagestelle diese Daten für das Zulageverfahren verarbeiten und nutzen darf,<br />
- bei versicherungsfrei Beschäftigten der zentralen Zulagestelle bestätigt wird, dass die<br />
versorgungsrechtlichen Regelungen eine entsprechende Anwendung des Beamtenversorgungsgesetzes<br />
vorsehen.<br />
Die Einverständniserklärung ist bis auf Widerruf wirksam und muss für das Beitragsjahr, für das die<br />
Zulage und der Sonderausgabenabzug beantragt wird, bis zum 31. Januar des Folgejahres abgegeben<br />
werden. Der Widerruf muss vor Beginn eines Jahre bei der zuständigen Besoldungsstelle bzw. beim<br />
Arbeitgeber abgegeben werden.<br />
Offenbar gibt es in der Praxis noch erhebliche Schwierigkeiten mit der Einverständniserklärung. Daher<br />
haben die Finanzbehörden beschlossen, dass die Erklärung für die Beitragsjahre 2002 und 2003 und für<br />
das Beitragsjahr 2004 bis zum 30.6.2005 gegenüber der zuständigen Stelle abgegeben werden kann<br />
(BMF-Schreiben vom 11.3.2004, IV C 4 - S 2222 - 10/04).<br />
Staat & Verwaltung:<br />
Beamte: Keine Versetzung in Untätigkeit<br />
Berlin (dpa) - Die Versetzung eines Beamten in die Personalservice-Agentur Vivento der Deutschen<br />
Telekom ist dann rechtswidrig, wenn sie damit die völlige Beschäftigungslosigkeit des Betroffenen zur<br />
SEITE - 23 -
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
Folge hat. Dies entschied das Verwaltungsgericht Berlin nach Angaben vom Freitag. Die Maßnahme von<br />
Telekom gegen die Frau, eine Fernmeldeobersekretärin, «stellt de facto eine Zwangsbeurlaubung dar,<br />
die den Anspruch des Beamten auf eine seinem Amt angemessene Beschäftigung verletzt».<br />
Staat & Verwaltung:<br />
Bauplanung: Tabuzonen für Windkraft zulässig<br />
Koblenz/Trier (dpa) - Kommunale Standortplaner dürfen nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts<br />
(OVG) Koblenz bei ausgewogener Planung Taburäume für die Windkraft einrichten. Die Richter wiesen in<br />
einem am Montag veröffentlichten Urteil die Klage eines Windkraftbetreibers ab, der Windräder<br />
außerhalb vorgesehener Vorranggebiete bauen lassen wollte. Das OVG bestätigte die<br />
Raumordnungsplanung der Region Trier, in der Konzentrations-, aber eben auch Taburäume für<br />
Windräder vorgesehen sind (8 A 11520/03.OVG).<br />
Staat & Verwaltung:<br />
Straßenbau: Kommune darf nachträglich kassieren<br />
Bautzen (dpa) - Sächsische Städte und Gemeinden dürfen nach einer Entscheidung des<br />
Oberverwaltungsgerichtes (OVG) in Bautzen Anwohner für den Ausbau von Straßen auch im Nachhinein<br />
zur Kasse bitten. Das OVG bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der «Dresdner<br />
Neueste Nachrichten». Die Kommunen dürfen demnach auch dann noch einen Beitrag von den Anliegern<br />
verlangen, wenn sie erst nach dem Ausbau die entsprechende Beitragssatzung erlassen haben. Das<br />
Urteil könnte laut Gericht zehntausende Menschen betreffen.<br />
Staat & Verwaltung:<br />
Straßen: Anwohner müssen Bäume dulden<br />
Koblenz (dpa) - Anwohner müssen direkt neben ihren<br />
Grundstücken gepflanzte Bäume am Straßenrand dulden. Das geht aus einem am Donnerstag vom<br />
Verwaltungsgericht Koblenz veröffentlichten Urteil hervor. Während Privatleute beim Baumpflanzen nach<br />
dem rheinland-pfälzischen Nachbarrechtsgesetz bestimmte Mindestabstände zu ihren Nachbarn<br />
einhalten müssten, gelte dies nicht für Kommunen. Anwohner könnten aber Schadenersatz verlangen,<br />
falls Baumwurzeln ihre Garten- oder Hausmauern beschädigen (Az.: 8 K 2724/03).<br />
Staat & Verwaltung:<br />
Studienplatz: Wird immer häufiger eingeklagt<br />
Ansbach/Nürnberg (dpa) - Immer mehr abgelehnte Studienplatzbewerber versuchen, sich auf dem<br />
Gerichtsweg einen Studienplatz zu erstreiten. So habe sich an der Uni Erlangen-Nürnberg die Zahl der<br />
Studenten fast verdreifacht, die gegen ihre Ablehnung klagten, teilte das Verwaltungsgericht Ansbach am<br />
Dienstag mit. Zum Sommersemester 2004 seien 692 entsprechende Anträge eingegangen. Im Jahr 2003<br />
waren es noch 254. Die Klagen beträfen meist Studienplätze für die Fächer Humanmedizin (583) und<br />
Zahnmedizin (108).<br />
SEITE - 24 -
Staat & Verwaltung:<br />
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
EU-Ausländer: Doppelte Staatsbürgerschaft möglich<br />
Leipzig (dpa) - EU-Ausländer können bei der Einbürgerung in Deutschland ihre Staatsangehörigkeit<br />
behalten, wenn auch ihr Land bei der Einbürgerung von Deutschen die doppelte Staatsangehörigkeit<br />
hinnimmt. Mit diesem Urteil entschied der 1. Revisionssenat des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig<br />
am Dienstag zu Gunsten eines griechischen Psychotherapeuten. Der Kläger hatte in Bayern seine<br />
Einbürgerung beantragt, wollte aber auch seine griechische Staatsangehörigkeit nicht aufgeben.<br />
(BVerwG 1 C 13.03)<br />
Staat & Verwaltung:<br />
Einberufungspraxis: Als rechtswidrig beurteilt<br />
Köln (dpa) - Die Einberufungspraxis der Bundeswehr ist nach einer Grundsatzentscheidung des Kölner<br />
Verwaltungsgerichts rechtswidrig. Die derzeitige Regelung verstoße gegen das Willkürverbot des<br />
Grundgesetzes, entschieden die Richter am Mittwoch in Köln (Az: 8 K 154/04). Das Urteil hat nach<br />
Auskunft des Verteidigungsministeriums in Berlin aber keine Auswirkungen auf die Einberufungspraxis,<br />
da es sich um ein Einzelurteil handle.<br />
Verheiratete Wehrpflichtige werden seit fast einem Jahr nicht mehr einberufen. Dies gilt auch für Männer,<br />
die älter als 23 Jahre sind oder bei der Musterung nicht in die ersten beiden Tauglichkeitsstufen fallen.<br />
Nach den gültigen Richtlinien kann nach Meinung der Kölner Richter nicht mehr davon die Rede sein,<br />
dass die Wehrpflicht allgemein greift. Derzeit würden nur noch weniger als die Hälfte der für eine<br />
Einberufung in Frage kommenden jungen Männer zum Wehrdienst herangezogen. Jeder Wehrpflichtige<br />
könne deshalb fordern, dass er ebenfalls nicht den Grundwehrdienst antreten muss.<br />
Mit der Entscheidung im Hauptsacheverfahren vom Mittwoch kann nach Angaben eines<br />
Gerichtssprechers nun eine bundeseinheitliche rechtliche Klärung erfolgen. Gegen die Entscheidung der<br />
Kölner Richter könne Revision beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eingereicht werden. Das<br />
Verteidigungsministerium will erst nach genauer Prüfung der schriftlichen Urteilsbegründung entscheiden,<br />
ob es in Revision geht.<br />
Zuvor hatten die Kölner Richter bereits in einem Eilverfahren dem Kläger <strong>Recht</strong> gegeben. Andere<br />
Verwaltungsgerichte hatten gegenteilig entschieden. Die vorläufigen Beschlüsse hatten aber keinen<br />
grundsätzlichen Charakter und waren nicht anfechtbar.<br />
In einer ersten Stellungnahme begrüßte der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-<br />
Bundestagsfraktion, Volker Beck, das Urteil. «Die Wehrpflicht ist ein Auslaufmodell - und damit auch der<br />
unmittelbar mit ihr verknüpfte Zivildienst.» Mit der geplanten Verkleinerung der Bundeswehr in den<br />
nächsten Jahren werde der «Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz nur noch eklatanter».<br />
Der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU- Bundestagsfraktion, Christian Schmidt, sagte, die<br />
Änderung der Einberufungskriterien seien «von vornherein ein verfassungsrechtlicher Ritt über den<br />
Bodensee» gewesen. Wenn Verteidigungsminister Peter Struck (SPD) zur Wehrpflicht stehe, müssten die<br />
geänderten Einberufungskriterien rückgängig gemacht und die Wehrgerechtigkeit wieder hergestellt<br />
werden.<br />
Der verteidigungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Günther Nolting, sagte im «Kölner<br />
Stadt-Anzeiger»: «Gerechtigkeit ist nicht mehr gegeben. Wir werden im Mai einen Antrag zur<br />
Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht in den Bundestag einbringen».<br />
SEITE - 25 -
Staat & Verwaltung:<br />
Bodenreformland: Erneuter Musterprozess<br />
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
Schwerin (dpa) - Der juristische Streit um Bodenreformland geht in eine neue Runde. Betroffene, die vor<br />
1990 in der DDR entschädigungslos enteignet wurden, haben mit dem Landbund einen Musterprozess<br />
vor dem Verwaltungsgericht Schwerin angestrengt, berichtete die «Schweriner Volkszeitung» unter<br />
Berufung auf die Kläger. Es gehe um rund 80 000 Fälle in den neuen Bundesländern, bei denen nach<br />
Schätzungen des Landbundes rund 800 000 Hektar Land betroffen sein sollen.<br />
Unternehmer:<br />
Selbstständige: Vordruck EÜR problematisch<br />
(Val) Steuerpflichtige mit Gewinneinkünften (Einkünfte aus Gewerbebetrieb, aus selbstständiger Arbeit<br />
oder aus Land- und Forstwirtschaft), die ihren Gewinn mittels Einnahmenüberschussrechnung ermitteln,<br />
müssen für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2003 beginnen - in der Regel also ab dem Wj 2004 -,<br />
ihre Einnahmenüberschussrechnung auf einem amtlich vorgeschriebenen Vordruck ihrer Steuererklärung<br />
beifügen. Dieser Vordruck ist äußerst problematisch. So erfordert er die Einrichtung von 60 neuen<br />
Buchführungskonten. Der vom BMF entwickelte Vordruck EÜR (für Einnahmenüberschussrechnung)<br />
beruht auf einer gesetzlichen Ermächtigung durch das Gesetz zur Förderung von Kleinunternehmern und<br />
zur Verbesserung der Unternehmensfinanzierung vom 31.07.2003 (Kleinunternehmerförderungsgesetz).<br />
Ziele des Kleinunternehmerförderungsgesetzes waren Steuervereinfachung und Bürokratieabbau zu<br />
Gunsten kleiner und mittlerer Unternehmen. "Der Vordruck EÜR umfasst 82 Zeilen und ist derart<br />
kompliziert, dass selbst Fachleute damit erhebliche Schwierigkeiten haben werden. Die enthaltenen<br />
handwerklichen Fehler machen korrekte Angaben teilweise unmöglich", sagte Jürgen Pinne, Präsident<br />
des Deutschen Steuerberaterverbandes e.V. (DStV). Der Vordruck dient demnach in erster Linie der<br />
Verwaltung. Durch seine Verkennzifferung ermöglicht er der Finanzverwaltung einen massenhaften<br />
Datenabgleich und damit verbesserte Kontrollmöglichkeiten.<br />
"Die Finanzverwaltung brauchte bei der Entwicklung des Vordrucks nicht mit der Kontrolle durch das<br />
Parlament zu rechnen und hat deshalb allein fiskalische Interessen berücksichtigt. Die Ziele des<br />
Kleinunternehmerförderungsgesetzes werden in ihr Gegenteil verkehrt", so Pinne weiter. Nicht durch<br />
Steuerberater vertretene Steuerpflichtige würden 2005 ins kalte Wasser geworfen. Eine an diese Gruppe<br />
gerichtete Informationskampagne des BMF vermisse er, betonte Pinne. Dabei wäre es schon heute<br />
zwingend erforderlich, die Aufzeichnungen der Einnahmen und Ausgaben so aufzuschlüsseln, dass der<br />
Vordruck EÜR auch nur annähernd ausgefüllt werden kann.<br />
"Der Vordruck EÜR muss zurückgezogen werden und dem Geist des<br />
Kleinunternehmerförderungsgesetzes muss Geltung verschafft werden. Dazu bedarf es eines<br />
verständlichen und einfachen Vordruckes, der auch von Kleinunternehmern ohne Schwierigkeiten<br />
ausgefüllt werden kann", fordert Pinne. Rein fiskalische Interessen der Finanzverwaltung müssen dabei<br />
zurücktreten.<br />
Unternehmer:<br />
IFRS 3: Rechnungslegung bei Fusionen und Akquisitionen<br />
(Val) Am 31.03.04 hat das International Accounting Standards Board seinen neuen Standard IFRS 3<br />
Business Combinations veröffentlicht. Dieser wird die Rechnungslegung für Fusionen und Akquisitionen<br />
(M&A) grundlegend ändern, da er die Verbuchung von Goodwill und bestimmten immateriellen Aktiva als<br />
Periodenaufwand über die Gewinn- und Verlustrechnung abschafft - außer im Falle einer Wertminderung.<br />
SEITE - 26 -
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
Außerdem entfällt das Merger bzw. Pooling of Interest Accounting, das in der Praxis nur selten<br />
Anwendung fand.<br />
KPMG-Vorstand Wienand Schruff erklärt: "Wir begrüßen die Bemühungen des IASB zur<br />
Vervollständigung der Standards für Unternehmen, die gemäß den EU-Anforderungen für börsennotierte<br />
Konzerne in Europa nach IFRS bilanzieren müssen. Dieser Schritt markiert einen bedeutenden Wechsel,<br />
der Konsequenzen für die meisten Unternehmen hat, die die IFRS ab 2005 übernehmen. Diejenigen, die<br />
aktiv in M&A-Transaktionen engagiert sind, sollten sich schnellstmöglichst mit den Auswirkungen<br />
befassen; die anderen zumindest den erforderlichen Niederstwert-Test vorbereiten."<br />
Mark Vaessen, Leiter der International Financial Reporting Group bei KPMG: "Eine widerspruchsfreie<br />
Rechnungslegung für Unternehmenszusammenschlüsse ist im Hinblick auf die Schaffung einheitlicher<br />
Voraussetzungen für Unternehmen überall auf der Welt ein wichtiger Punkt. Die Forderung, den Goodwill<br />
nicht mehr planmäßig abzuschreiben und ihn stattdessen jährlich auf Wertminderung zu prüfen,<br />
entspricht der in den USA gängigen Praxis. Dies wird sich deutlich auf die Geschäftsergebnisse vieler<br />
Unternehmen auswirken, die nach IFRS bilanzieren. 2002 reichten einer Stichprobe zufolge die<br />
Abschreibungsaufwendungen von null bis zu 195 Prozent des Periodenergebnisses. Nach IFRS 3 wird<br />
keine jährliche Abschreibungsrate mehr verbucht. Dies wird - sofern keine außerplanmäßige<br />
Wertminderung vorgenommen werden muss - zunächst das Jahresergebnis verbessern.<br />
Allerdings werden Unternehmen wohl unregelmäßige, aber potenziell höhere<br />
Wertminderungsabschreibungen auf ihren Firmenwert ausweisen müssen, wenn die Ergebnisse des<br />
übernommenen Unternehmens nicht so gut sind wie erwartet. Auch wenn Abschreibungen auf den<br />
Firmenwert und Wertminderungsaufwendungen nicht ausgabenwirksame Posten sind, so haben sie doch<br />
Auswirkungen auf den Ertrag und ertragsbasierte Bewertungskennzahlen wie zum Beispiel der Gewinn je<br />
Aktie."<br />
Einstufiger Ansatz bei der Überprüfung vorgesehen<br />
Das IASB folgt nicht in allen Punkten dem US-Standard. So sieht IFRS 3 nun einen einstufigen Ansatz für<br />
die Überprüfung der Wertminderung des Goodwill vor. Anfänglich hatte das Board einen komplexeren<br />
zweistufigen Ansatz vorgeschlagen, der mit den US-Anforderungen konform geht. Auf der Grundlage der<br />
durchgeführten Feldversuche und der eingegangenen Rückmeldungen, insbesondere zu Erfahrungen mit<br />
den derzeitigen US-Wertminderungsanforderungen, beschloss das Board jedoch, vom US-Ansatz in<br />
diesem Punkt aus Kosten-Nutzen-Gründen abzuweichen. "Dieser Schritt ist sinnvoll", sagt Vaessen, "da<br />
er unnötige Komplexität und Kosten bei der Implementierung des neuen Standards vermeidet. Darüber<br />
hinaus verhindert er, dass Widersprüche zu anderen IFRS-Wertminderungsprüfungen entstehen."<br />
Unternehmer:<br />
Verlustzuweisung: Gesellschaften sparen nichts mehr<br />
(Val) Mit dem Steuerentlastungsgesetz wurde die Nichtabzugsfähigkeit von Verlusten (negativen<br />
Einkünften) aus Verlustzuweisungsgesellschaften oder ähnlichen Modellen eingeführt. Danach dürfen<br />
negative Einkünfte auf Grund von Beteiligungen an Gesellschaften oder Gemeinschaften oder ähnlichen<br />
Modellen nicht mit anderen Einkünften ausgeglichen werden, wenn bei dem Erwerb oder der Begründung<br />
der Einkunftsquelle die Erzielung eines steuerlichen Vorteils im Vordergrund steht. Die Verluste dürfen<br />
auch nicht nach § 10d (Verlustabzug) abgezogen werden. Verluste aus einer<br />
Verlustzuweisungsgesellschaft können nur mit Gewinnen, die aus dieser Einkunftsquelle ein Jahr zuvor<br />
erzielt wurden oder im kommenden Jahr erzielt werden, verrechnet werden.<br />
Die Erzielung eines steuerlichen Vorteils steht insbesondere dann im Vordergrund, wenn nach dem<br />
Betriebskonzept der Gesellschaft oder Gemeinschaft oder des ähnlichen Modells die Rendite auf das<br />
einzusetzende Kapital nach <strong>Steuern</strong> mehr als das Doppelte dieser Rendite vor <strong>Steuern</strong> beträgt und ihre<br />
Betriebsführung überwiegend auf diesem Umstand beruht, oder wenn Kapitalanlegern<br />
Steuerminderungen durch Verlustzuweisungen in Aussicht gestellt werden.<br />
SEITE - 27 -
Praxistipp:<br />
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
Auch bei geschlossenen Immobilienfonds besteht die Gefahr, dass die Finanzbehörden von einer<br />
Verlustzuweisungsgesellschaft ausgehen.<br />
Unternehmer:<br />
Baubranche: Ab 1. April Steuerschuldumkehr<br />
(Val) Seit dem 1.4.2004 gilt beim Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie bei bestimmten<br />
Bauleistungen die umgekehrte Steuerschuldnerschaft: Nun darf der Leistungsempfänger die<br />
Umsatzsteuer nicht mehr an den Leistungserbringer zahlen, sondern muss diese direkt an das Finanzamt<br />
abführen (§ 13b UStG).<br />
Die Steuerschuld wird bei diesem sog. Revers-Charge-Modell (Steuerschuldumkehr) also vom leistenden<br />
Unternehmer auf den Leistungsempfänger verlagert. Dieser soll nur dann den Vorsteuerabzug<br />
vornehmen können, wenn er auch die Umsatzsteuer an das Finanzamt entrichtet hat. Da die<br />
Neuregelung nicht mit EU-<strong>Recht</strong> übereinstimmt, hat die Bundesregierung einen entsprechenden Antrag<br />
auf Ausnahmegenehmigung an die EU-Kommission gestellt. Diese Genehmigung wurde am 30.3.2004<br />
erteilt und am 31.3.2004 im EU-Amtsblatt veröffentlicht.<br />
Von besonderer Bedeutung ist diese Steuerschuldumkehr für Bauunternehmer, Subunternehmer und<br />
Handwerker: Wenn sie Werklieferungen und sonstige Leistungen empfangen, die der Herstellung,<br />
Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen, dürfen sie die<br />
Umsatzsteuer nicht mehr an den leistenden Unternehmer zahlen, sondern müssen diese direkt an das<br />
Finanzamt abführen. Der Leistungserbringer muss also jetzt keine Umsatzsteuer mehr abführen und darf<br />
sie daher auch nicht mehr in seiner Rechnung an den Auftraggeber ausweisen (§ 13b Abs. 1 Nr. 4<br />
UStG). Die Zahlungspflicht besteht für Unternehmen der Baubranche auch dann, wenn die Leistung für<br />
den nichtunternehmerischen Bereich bezogen wird (§ 13b Abs. 2 UStG).<br />
Diese Regelung gilt, wenn der Leistungserbringer seinen Betriebssitz in Deutschland hat. Ist der<br />
Leistungserbringer im Ausland ansässig, muss der Leistungsempfänger - sofern er ein Unternehmen<br />
oder eine juristische Person des öffentlichen <strong>Recht</strong>s ist - die Umsatzsteuer bereits nach § 13b Abs. 1 Nr.<br />
1 UStG abführen.<br />
Bis zum 1. Juli gilt eine Übergangsfrist, in der Auftraggeber und Subunternehmer vereinbaren können,<br />
Rechnungen noch nach dem alten Verfahren zu begleichen. Die Anwendung der Übergangsregelung<br />
setzt allerdings voraus, dass der Subunternehmer den Umsatz in zutreffender Höhe versteuert.<br />
Unternehmer:<br />
Geschäftsessen: Anwälte müssen Namen nennen<br />
München (dpa) - Anwälte können Ausgaben für ein Geschäftsessen steuerlich nur dann geltend machen,<br />
wenn sie Teilnehmer und Anlass der Bewirtung nennen. Dies entschied der Bundesfinanzhof (BFH) in<br />
einem am Mittwoch in München bekannt gegeben Urteil (AZ:: IV R 50/01). Mit Hinweis auf seine<br />
Schweigepflicht hatte ein <strong>Recht</strong>sanwalt Gaststättenbesuche in Höhe von knapp 12 000 Mark (6135 Euro)<br />
geltend gemacht, ohne Angaben zum Bewirtungsanlass und zu den eingeladenen Personen zu machen.<br />
Im <strong>Recht</strong>sstreit berief sich der Anwalt auf seine Schweigepflicht. Nach Ansicht des BFH wird in das<br />
geschützte Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Mandant jedoch nicht unverhältnismäßig<br />
eingegriffen, wenn der <strong>Recht</strong>sanwalt Ziel und Zweck eines Geschäftsessens aufdeckt. Damit gab der<br />
BFH der Finanzbehörde <strong>Recht</strong>.<br />
SEITE - 28 -
Unternehmer:<br />
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
Bewirtung: Vorsteuerabzug teilweise ausgeschlossen<br />
(Val) Mit dem Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 wurde der Abzug von Vorsteuerbeträgen<br />
ausgeschlossen, die auf nicht abzugsfähige Aufwendungen entfallen. Damit war seit dem 1.4.1999 auch<br />
der Vorsteuerabzug aus dem - ertragsteuerlich - nicht abzugsfähigen Teil der Bewirtungskosten nicht<br />
mehr möglich. Nicht absetzbar war bis 2003 ein Anteil von 20 %.<br />
Mit dem Steueränderungsgesetz 2003 wurde nun der als Betriebsausgaben abzugsfähige Teil der<br />
Bewirtungskosten mit Wirkung ab dem 1.1.2004 von 80 % auf 70 % der angemessenen Aufwendungen<br />
für die Bewirtung von Personen aus geschäftlichem Anlass gekürzt. Das führt dazu, dass der<br />
Vorsteuerabzug ebenfalls nur aus dem Anteil von 70 % der Bewirtungskosten zulässig sein soll.<br />
Anderer Auffassung ist das Finanzgericht München: Die Finanzrichter haben jüngst die auf die<br />
Bewirtungskosten entfallenden Vorsteuerbeträge in vollem Umfang zum Abzug zugelassen. Die<br />
Beschränkung des <strong>Recht</strong>s auf Vorsteuerabzug sei - so die Richter - insoweit mit dem EU-<strong>Recht</strong><br />
unvereinbar. Der Unternehmer könne sich unmittelbar auf das für ihn günstigere EU-<strong>Recht</strong> berufen (FG<br />
München vom 13.11.2003, 14 K 3488/02). Gegen diese Entscheidung ist derzeit die Revision vor dem<br />
Bundesfinanzhof anhängig (Aktenzeichen: V R 76/03).<br />
Die Finanzverwaltung will aber vorerst nicht auf diese Linie einschwenken und wird Anträge auf vollen<br />
Vorsteuerabzug aus Bewirtungskosten ablehnen. Falls jedoch deswegen Einspruch eingelegt wird, sind<br />
die Finanzämter angewiesen, die Einsprüche ruhen zu lassen (nach § 363 Abs. 2 S. 2 AO). Anträgen auf<br />
Aussetzung der Vollziehung sollen die Finanzämter stattgeben (OFD Nürnberg vom 2.4.2004, S 7303a -<br />
4/ St 43).<br />
Unternehmer:<br />
Abschreibung: Nicht nachträglich möglich<br />
(Val) Wurde ein Wirtschaftsgut nicht bilanziert, kann eine nachträgliche Abschreibung nicht<br />
vorgenommen werden. Bei unterlassener Aktivierung eines Wirtschaftsgutes erfolgt ein späterer<br />
Bilanzansatz zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die verloren gegangenen<br />
Abschreibungsbeträge. Die Bilanzierung erfolgt damit zum "theoretisch" verbleibenden Restbuchwert.<br />
Wurde das Wirtschaftsgut bilanziert, erfolgte jedoch eine Abschreibung nicht oder in unzutreffender<br />
Höhe, kann die Abschreibung des Wirtschaftsgutes nachgeholt werden.<br />
Unternehmer:<br />
EU-Kommission: Will deutsche Wegzugsteuer kippen<br />
Brüssel (dpa) - Unternehmer und Anteilseigner an Unternehmen sollen nach dem Willen der EU-<br />
Kommission nicht mehr über das Steuerrecht am Wegzug aus Deutschland gehindert werden. Die EU-<br />
Kommission verstärkt deshalb den Druck gegen die deutsche Wegzugsbesteuerung, die nach<br />
Auffassung der Behörde dem Grundsatz der Personen-Freizügigkeit in der Union widerspricht. Laut einer<br />
Mitteilung vom Montag eröffnete die Kommission die zweite Stufe im Verfahren wegen Verletzung des<br />
EU-Vertrags, das in einer dritten Stufe in eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) münden<br />
kann. Die Bundesregierung hat nun zwei Monate Zeit, auf den Warnbrief zu reagieren.<br />
Laut EU-Kommission müssen Personen bei einem Wegzug aus Deutschland unter bestimmten<br />
Bedingungen auf den Wertzuwachs aus einer Unternehmensbeteiligung Einkommenssteuer zahlen, auch<br />
wenn sie die Beteiligung nicht veräußern. Mit diesem Schritt sollen nach ergänzenden Angaben stille<br />
Reserven besteuert werden, bevor der Bürger wegzieht. Voraussetzung sei, dass die Anteilseigner<br />
SEITE - 29 -
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
mindestens zehn Jahre in Deutschland einkommenssteuerpflichtig gewesen sind und in den fünf Jahren<br />
vor dem Wegzug einen Anteil von mindestens einem Prozent an einer Kapitalgesellschaft gehalten<br />
haben.<br />
Die Kommission monierte, bei Bürgern, die in Deutschland bleiben, werde lediglich der realisierte<br />
Wertzuwachs von Unternehmensteiligungen - also etwa nach einem Verkauf - besteuert. Die Kommission<br />
verwies auch auf ein Urteil des EuGH vom vergangenen März, das die französische<br />
Wegzugsbesteuerung für rechtswidrig erklärt hatte.<br />
«Die Kommission erkennt das <strong>Recht</strong> Deutschlands zur Besteuerung des Wertzuwachses durchaus an»,<br />
hieß es in der Mitteilung. Es gehe in dem Verfahrens also nicht um die Besteuerung des Wertzuwachses<br />
an sich. <strong>Recht</strong>swidrig ist hingegen nach Auffassung der Behörde, dass der nicht realisierte Wertzuwachs<br />
ausschließlich beim Wegzug ins Ausland besteuert werde.<br />
Unternehmer:<br />
Limited-Gesellschaften: Vorteile werden überschätzt<br />
(Val) Vor einer Überschätzung der Vorteile von "Limited"-Gesellschaften warnt ausdrücklich der Deutsche<br />
Industrie- und Handelskammertag (DIHK).<br />
Auch in dieser ausländischen <strong>Recht</strong>sform geführte Unternehmen würden mit ihrer Niederlassung oder<br />
Betriebsstätte in Deutschland wie eine deutsche GmbH zur Körperschafts- und Gewerbesteuer veranlagt.<br />
Limiteds benötigten bei entsprechender Tätigkeit auch die gleichen Erlaubnisse und Genehmigungen<br />
(zum Beispiel Maklererlaubnis, Gaststättengenehmigung, Handwerksrolleneintragung) und seien<br />
Pflichtmitglied in der Berufsgenossenschaften sowie bei der Industrie- und Handelskammer oder<br />
Handwerkskammer.<br />
Die <strong>Recht</strong>sform der Limited werde seit den einschlägigen Entscheidungen des Europäischen<br />
Gerichtshofes (EuGH) in den Fällen "Überseering" und "InspireArt" von Unternehmensberatern<br />
zunehmend als preiswerte Alternative zur GmbH angepriesen. Dabei würden, so der DIHK, häufig auch<br />
Vorteile benannt, die es tatsächlich nicht gebe.<br />
Nach den Entscheidungen des EuGH sei zwar die <strong>Recht</strong>sfähigkeit der in einem anderen EU-Mitgliedstaat<br />
gegründeten Kapitalgesellschaften in Deutschland anerkannt. Sie seien dadurch aber entgegen<br />
vollmundiger Versprechungen nicht der deutschen <strong>Recht</strong>sordnung entzogen.<br />
Gern werde im Übrigen auch verschwiegen, welche Folgekosten auf diese "deutschen" Limiteds im<br />
Gründungsstaat zukämen, so in England etwa das regelmäßige Honorar des dort zwingend zu<br />
bestellenden Company Secretary. Außerdem müsse die Gesellschaft im dortigen Handelsregister jährlich<br />
ihre Bilanzen hinterlegen.<br />
Informationen zu den <strong>Recht</strong>en und Pflichten einer ausländischen Gesellschaft bei einer Betätigung in<br />
Deutschland liegen bei den IHKs vor.<br />
Verbraucher, Versicherung & Haftung:<br />
Totalschaden: Ersatz ohne Umsatzsteuer<br />
(Val) In einem weiteren Urteil bestätigte der Bundesgerichtshof, dass im Rahmen des Schadensersatzes<br />
bei einem Verkehrsunfall Umsatzsteuer nur dann ersetzt wird, wenn sie auch tatsächlich angefallen ist (§<br />
SEITE - 30 -
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
249 Abs. 2 Satz 2 BGB, Art 229 § 8 Abs. 1 EGBGB). Eine Ausnahme hiervon ergibt sich nicht aus § 251<br />
BGB, der den Schadensersatz bei Zerstörung einer Sache regelt.<br />
Vor der Neufassung des § 249 BGB wurde § 251 BGB von der <strong>Recht</strong>sprechung nur in den seltenen<br />
Fällen herangezogen, in denen eine Sache zerstört und auch die Beschaffung einer gleichwertigen<br />
Ersatzsache nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich war.<br />
Nach der Auffassung des Gerichts umfasst der Anspruch nach § 249 Abs. 2 Satz 2 BGB auch dann keine<br />
fiktive Umsatzsteuer, wenn an dem Unfallfahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden entstanden ist. Nach<br />
neuem <strong>Recht</strong> sei daran festzuhalten, dass im Falle eines wirtschaftlichen Totalschadens an einem<br />
Kraftfahrzeug regelmäßig keine § 251 BGB unterfallende Zerstörung der Sache vorliegt. Denn schließlich<br />
kann der Geschädigte Ersatz meist durch den Erwerb eines (gleichwertigen) Ersatzfahrzeuges erlangen.<br />
Fälle der Ersatzbeschaffung regelt aber § 249 BGB. Deshalb erfasst § 249 Abs. 2 Satz 2 BGB auch die<br />
Fälle wirtschaftlichen Totalschadens an einem Kraftfahrzeug.<br />
Die Frage, ob bei der Ermittlung des Nettowiederbeschaffungswertes von der Regelbesteuerung nach §<br />
10 UStG oder von der Differenzbesteuerung nach § 25 a UStG auszugehen sei, brauchte der<br />
Bundesgerichtshof im Streitfall nicht zu entscheiden. Der Kläger hatte hierzu in den Tatsacheninstanzen<br />
nichts vorgetragen.<br />
Bei einem Verkehrsunfall im August 2002 war am Kraftfahrzeug des Klägers wirtschaftlicher<br />
Totalschaden entstanden. Der Kläger hatte kein Ersatzfahrzeug erworben. Der Haftpflichtversicherer<br />
legte seiner Schadensabrechnung den von einem Sachverständigen ermittelten<br />
Nettowiederbeschaffungswert eines gleichwertigen Ersatzwagens zugrunde.<br />
Mit seiner Klage hatte der Kläger Umsatzsteuer auf den Nettowiederbeschaffungswert verlangt. Dieses<br />
Klagebegehren, das in den Vorinstanzen ohne Erfolg blieb, verfolgte er mit seiner vom Berufungsgericht<br />
zugelassenen Revision weiter. Der VI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat die Revision des Klägers<br />
zurückgewiesen.<br />
Urteil vom 20. April 2004 ¿ VI ZR 109/03<br />
Verbraucher, Versicherung & Haftung:<br />
Reisemängel: Auch für Lebensgefährten einklagbar<br />
Köln/Frankfurt/Main (dpa) - Bei Mängeln im Urlaub kann ein Kunde auch für seine Lebensgefährtin eine<br />
Reisepreisminderung verlangen. In solchen Fällen gelten die gleichen Grundsätze wie für eheliche<br />
Lebensgemeinschaften, entschied das Amtsgericht Köln (Az.: 128 C 384/02). Auf das Urteil weist die<br />
Deutsche Gesellschaft für Reiserecht in Frankfurt in der Zeitschrift «Reise<strong>Recht</strong> aktuell» hin. Im<br />
verhandelten Fall hatte der Kläger für sich, seine Kinder und seine Lebensgefährtin eine Pauschalreise<br />
nach Zypern gebucht. Unter anderem wegen Baulärms am Urlaubsort verlangte er anschließend eine<br />
Minderung des Reisepreises. In diesem Fall gelten nach Einschätzung des Gerichts die Grundsätze für<br />
Familienreisen. Der Kläger durfte deshalb auch für seine Lebensgefährtin Ansprüche anmelden.<br />
Verbraucher, Versicherung & Haftung:<br />
Notfall: <strong>Recht</strong>e bei Sicherheitslandungen<br />
Braunschweig/Frankfurt/Main (dpa) - Eine halbe Stunde lang verläuft der Flug der Delta Airlines von<br />
Frankfurt nach Atlanta wie immer. Die Passagiere kramen herum und warten auf Getränke. Dann sinkt<br />
eine Frau in ihrem Sitz zur Seite, die Umsitzenden machen sich Sorgen. «Ist ein Arzt an Bord oder eine<br />
Krankenschwester?», wird über das Bordmikrofon gefragt. Kurz darauf landet die Maschine unplanmäßig<br />
in London, damit die Patientin im Krankenhaus versorgt werden kann. Wer aber entscheidet eine solche<br />
SEITE - 31 -
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
Unterbrechung, wer kommt für die Kosten auf - und welche <strong>Recht</strong>e haben plötzlich Erkrankte und die<br />
Passagiere an Bord?<br />
«Eine so genannte Sicherheitslandung wird allein vom Flugkapitän veranlasst und verantwortet»,<br />
erläutert Cornelia Eichhorn vom Luftfahrt-Bundesamt in Braunschweig.<br />
«Natürlich muss ein vernünftiges Krankenhaus in der Nähe sein und ein passender Flughafen», ergänzt<br />
Ronald Schmid, Professor für Reiserecht an den Universitäten Darmstadt und Dresden. «Über dem<br />
Nordpol macht eine schnelle Landung keinen Sinn.» Um die Kosten brauche sich der Patient aber in<br />
keinem Fall zu sorgen: «Die Krankenversicherung des Passagiers muss meiner Meinung nach für die<br />
Kosten einer medizinisch initiierten Sicherheitslandung eintreten und macht das in der Regel auch ohne<br />
Probleme.»<br />
Die Lufthansa zum Beispiel trägt die Kosten in jedem Fall selbst. «Uns ist in erster Linie wichtig, dass der<br />
Passagier überlebt», sagt Sprecher Michael Lamberty in Frankfurt. Lufthansa arbeite auch am Boden mit<br />
International SOS zusammen.<br />
Damit aber nicht jeder medizinische Notfall in der Luft mit einem «medical emergency landing» endet, ist<br />
das Bordpersonal medizinisch geschult und trainiert auch regelmäßig Erste Hilfe. Auch gibt es eine<br />
Mindestanforderung an die Notfallausrüstung.<br />
Die Bordapotheke ist Lamberty zufolge in Lufthansa-Maschinen bestens ausgestattet: Es gibt Pflaster<br />
und Nasentropfen, aber auch Schienen für Arme und Beine, Blutdruckmessgeräte und chirurgisches<br />
Besteck. Inzwischen haben viele Airlines auch Defibrillatoren an Bord<br />
und können selbst bei Herzinfarkten Erste Hilfe leisten.<br />
Die übrigen Passagiere müssen die mit einem medizinischen Notfall verbundenen Unannehmlichkeiten<br />
hinnehmen. «Dabei handelt es sich um höhere Gewalt, und damit gibt es keinen Anspruch auf<br />
Schadensersatz», sagt Schmid. «Die Airline muss sich um die Passagiere kümmern, sie verpflegen und<br />
sich notfalls um Hotels und Anschlussflüge kümmern.»<br />
Wenn allerdings im Zielland Anschlussflüge bei einer anderen Airline gebucht worden sind, die nicht im<br />
Zusammenhang mit der Ursprungsbeförderung stehen, hat man laut Reiserechtler Schmid bei<br />
Verspätung schlechte Karten. Für verpasste Anschlussflüge gebe es dann keinen Anspruch auf<br />
Schadensersatz.<br />
Welche <strong>Recht</strong>e und Pflichten hat eigentlich ein Arzt an Bord, der als «normaler» Passagier reist? In den<br />
USA hatten sich eine Zeit lang Klagen auf Schadensersatz gegen Ärzte gehäuft, die bei Notfällen in der<br />
Luft geholfen hatten - nicht immer zur Zufriedenheit der Patienten. Daraufhin hatte es eine zunehmende<br />
Tendenz medizinisch Ausgebildeter gegeben, sich bei Hilferufen taub zu stellen: Nur noch wenige trauten<br />
sich, sich als Arzt zu outen.<br />
«Darüber sollten sich Mediziner keine Sorge machen und helfen», sagt Reiserechtler Schmid. «Bei den<br />
großen Luftfahrtgesellschaften sind Mediziner in aller Regel versichert.» Die Lufthansa bestätigt<br />
das: «Es gibt keinen Grund, sich nicht zu melden», sagt Michael Lamberty. «Alle, die an Bord Hilfe<br />
leisten, stellen wir von der Haftung frei.»<br />
Verbraucher, Versicherung & Haftung:<br />
Anlegerrechte: Stärkung durch Musterverfahren<br />
Berlin (dpa) - Kleinaktionäre sollen ihre Schadensersatzansprüche gegen Unternehmen künftig leichter<br />
durchsetzen können. Durch die Einführung von Musterverfahren sollen nach Gesetzesplänen von<br />
Bundesjustizministerin Brigitte Zypries (SPD) Klagen gegen Verluste der Anleger durch<br />
Falschinformationen etwa in Bilanzen oder Börsenprospekten in Zukunft gebündelt und beschleunigt<br />
SEITE - 32 -
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
werden. Dadurch verringere sich das Risiko einer Klage für den einzelnen Anleger erheblich, sagte<br />
Zypries am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung eines entsprechenden Diskussionsentwurfs.<br />
Nach den bisherigen Regelungen stehe der Aufwand etwa für Gutachterkosten für den einzelnen Anleger<br />
häufig in keinem Verhältnis zur Schadenssumme. So seien wegen angeblich falscher Bilanzen beim<br />
Börsengang der Deutschen Telekom 13 000 Klagen mit einer Klagesumme von durchschnittlich nur 3500<br />
Euro anhängig. «Die kommen seit drei Jahren nicht weiter», sagte die Ministerin.<br />
Der Entwurf sieht vor, dass Anleger in einem solchen Fall künftig bei der Klageeinreichung ein<br />
Musterverfahren beantragen können. Werden mehr als zehn solcher Anträge eingereicht, wird vorab<br />
anhand eines Musterfalls geklärt, ob das Unternehmen tatsächlich falsch informiert hat. Die Kosten etwa<br />
für Sachverständige werden geteilt.<br />
Um die Verfahren zu konzentrieren, soll zudem anders als bisher das Landgericht am Hauptsitz des<br />
Unternehmens die ausschließliche Zuständigkeit für solche Fälle erhalten. Anträge auf Einleitung eines<br />
Musterverfahrens sollen in einem neuen elektronischen Klageregister bekannt gemacht werden, so dass<br />
andere Geschädigte leichter davon erfahren können. Für die Klärung der Musterfrage ist das zuständige<br />
Oberlandesgericht vorgesehen.<br />
Das Gesetzesvorhaben ist Kernstück eines 2002 beschlossenen Zehn- Punkte-Programms der<br />
Bundesregierung zur Verbesserung des Anlegerschutzes. Dazu soll auch ein Gesetz beitragen, das eine<br />
persönliche Haftung von Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder von Unternehmen für Schäden der<br />
Anleger durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Falschinformationen vorsieht. Ein entsprechender<br />
Referentenentwurf werde derzeit im Finanzministerium erarbeitet, hieß es aus Regierungskreisen.<br />
Verbraucher, Versicherung & Haftung:<br />
Auto: Konstruktionsfehler berechtigen zum Rücktritt<br />
Osnabrück (dpa) - Konstruktionsfehler an Autos berechtigen zum Rücktritt von Kaufverträgen. Dies geht<br />
aus einem Urteil des Landgerichts Osnabrück hervor (Az.: 9 O 2381/03).<br />
Die Klägerin wollte ihren Geländewagen wegen störender Brummgeräusche zurückgeben. Das beklagte<br />
Autohaus hingegen sah keine Mängel, da Fahrgeräusche bei Geländewagen stets höher seien. Das<br />
Gericht stellte jedoch einen Konstruktionsfehler im Getriebe fest, der bei einem teuren Auto nicht<br />
hingenommen werden müsse.<br />
Verbraucher, Versicherung & Haftung:<br />
Skiunfall: Schadensersatz und Schmerzensgeld<br />
Dresden (dpa) - Das Oberlandesgericht Dresden hat einem Ski-Unfallopfer Schadenersatz und<br />
Schmerzensgeld von insgesamt 5800 Euro zugesprochen. Mit dem Urteil (Az: 7 U 1994/03)<br />
widersprachen die Richter der Vorinstanz, die die Klage abgewiesen hatte. Das Landgericht hatte ein<br />
alleiniges Verschulden des Mannes angenommen, da dieser nicht an unübersichtlicher Stelle hätte<br />
stehen dürfen. Er erlitt beim Zusammenprall auf einer Skipiste in Österreich eine Gehirnerschütterung<br />
und verlor zwei Schneidezähne.<br />
Nach FIS-Regel Nr. 2 müsse jeder Skifahrer auf Sicht fahren, Tempo und Fahrweise seinem Können, der<br />
Verkehrsdichte sowie den Gelände- und Witterungsverhältnissen anpassen, hieß es in der OLG-<br />
Begründung. An kritischen Stellen müsse so gefahren werden, dass bei Auftreten von Hindernissen noch<br />
gebremst oder ausgewichen werden könne. Dagegen habe der Beklagte verstoßen, den Kläger trifft nach<br />
Meinung des OLG-Senats kein Mitverschulden.<br />
SEITE - 33 -
Verbraucher, Versicherung & Haftung:<br />
Haustürgeschäft: Was ist ein Widerruf in Textform?<br />
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
(Val) Das Landgericht München I sprach einer 85jährigen Kundin einer Sanierungsfirma ein<br />
Widerrufsrecht nach Ablauf der Widerrufsfrist zu. Die Dame sei nicht ordnungsgemäß belehrt worden. Es<br />
sei dem Laien nicht verständlich, was mit einem Widerruf "in Textform" gemeint sei. Hierzu hätte es einer<br />
Erklärung durch Nennung eines Beispiels wie Brief, Fax oder Email bedurft.<br />
Die Kundin hatte mit dem Vertreter der Sanierungsfirma eine Dachsanierung vereinbart. Am 28.10.2002<br />
besuchte er die alte Dame ein weiteres Mal wegen der Dachbeschichtung. Dabei kam die Rede auf die<br />
Sanierung der Fenster in ihrem Haus. Weil sich die Kundin dafür interessierte, füllte der Vertreter sofort<br />
ein Auftragsformular aus für den Einbau von Renovierungsfenstern zum Preis von 37.955,83 Euro. Die<br />
Interessentin unterschrieb den Bestellschein und gesondert auch die Belehrung, dass sie binnen zwei<br />
Wochen "in Textform" den Kauf widerrufen könne.<br />
Etwa zwei Wochen später bestellte sie wieder über Vertreter S. bei der Fensterfirma noch eine<br />
Kunststoffbalkontüre zum Preis von 3.587,- Euro inklusive Einbau.<br />
Etwa fünf Monate später besann sie sich jedoch eines Besseren und focht den Vertrag über ihren<br />
<strong>Recht</strong>sanwalt mit Schreiben vom 17.4.03 wegen Irrtums und arglistiger Täuschung an. Sie benötige<br />
weder aus Wärmeschutz- noch aus Sicherheitsgründen neue Fenster. S. habe sie falsch beraten.<br />
Außerdem seien die Preise überhöht.<br />
Die Fensterfirma fasste dieses Schreiben als Kündigung auf und verklagte die Kundin auf Bezahlung<br />
eines Teils der vereinbarten Vergütung in Höhe von 11.818,22 Euro. Dieser Betrag entspricht 33% des<br />
vereinbarten Nettowerklohnes. Darin enthalten sind 22% Handelsvertreterprovision, 5%<br />
Bearbeitungsgebühr und 6% kalkulierter Gewinn.<br />
Die 2. Zivilkammer des Landgerichts München I wies die Klage ab: Die alte Dame habe ein<br />
Widerrufsrecht gem. § 312 BGB. Von diesem <strong>Recht</strong> habe sie Gebrauch gemacht.<br />
Es handele sich bei beiden Verträgen um Haustürgeschäfte, die in der Privatwohnung der Beklagten<br />
ohne vorherige Bestellung initiiert, ausgehandelt und abgeschlossen wurden. Therese B. hatte den<br />
Vertreter S. nicht extra eingeladen, um mit ihm über die Sanierung ihrer Fenster zu verhandeln. Dass die<br />
85-Jährige anlässlich des Vertreterbesuchs von sich aus auf die Fenster zu sprechen kam, ändere nichts<br />
an der "Haustürsituation".<br />
Der Verbraucher soll sich von einem Vertrag lösen können, der auf Überrumpelung oder einem übereilten<br />
Entschluss beruht. Dies ist nach Auffassung des Gerichts auch dann zu befürchten, wenn der<br />
Verbraucher sich zwar grundsätzlich für ein Angebot interessiert, Zeit und Ort der Vertragsverhandlungen<br />
aber nicht vorher selbst bestimmt hat. Auch in diesen Fällen bestehe die Gefahr, dass der Kunde weniger<br />
gut vorbereitet in die Verhandlungen gehe als bei einem selbst gewählten Termin und dass er dem<br />
Eindruck erliege, eine unerwartete Gelegenheit "jetzt oder nie" ergreifen zu müssen.<br />
Normalerweise hätte Therese B. ihre Bestellung innerhalb von zwei Wochen widerrufen müssen.<br />
Das Gericht sah in der Erklärung vom 17.4.2003 trotzdem einen rechtzeitigen Widerruf, weil die alte<br />
Dame über ihr Widerrufsrecht nicht ordnungsgemäß belehrt worden sei. Der Begriff "Textform" gehe auf<br />
eine neue gesetzliche Bestimmung zurück, die neben Brief und Fax auch neue elektronische Medien<br />
zulässt.<br />
Landgericht München I, 2 O 15288/03<br />
SEITE - 34 -
Verbraucher, Versicherung & Haftung:<br />
Gewinne: Müssen ausbezahlt werden<br />
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
Bamberg/Coburg (dpa) - Ein versprochener Geldgewinn in einem Werbebrief muss unter bestimmten<br />
Umständen ausgezahlt werden. Das entschied das Oberlandesgericht Bamberg in einem am Freitag<br />
veröffentlichten Beschluss (Az: 5 U 270/03) und bestätigte damit ein Urteil des Landgerichts Coburg.<br />
Entscheidend ist nach Auffassung der Richter, ob die Mitteilung so zu verstehen ist, dass der Empfänger<br />
den Preis bereits gewonnen habe und das Geld lediglich abholen müsse.<br />
In dem Brief einer Versandhandelsfirma hatte es geheißen, der spätere Kläger habe 75 000 Mark (38 346<br />
Euro) gewonnen. Er müsse nur den beigefügten Bestätigungsschein unterschrieben zurücksenden, sich<br />
rund 90 Mark an Auslagen abziehen lassen und Ware im Mindestwert von 25 Mark bestellen. Dies tat der<br />
Adressat. Das Versandhaus verweigerte jedoch das Geld und verwies auf seine Teilnahmebedingungen.<br />
Der Kunde zog vor Gericht und bekam <strong>Recht</strong>.<br />
Das Landgericht verurteilte die Firma, dem Adressaten die rund 38 000 Euro zu zahlen. Das<br />
Unternehmen habe den Kläger persönlich mit Namen angeschrieben und den Eindruck erweckt, er habe<br />
bereits gewonnen. Die anders lautenden Teilnahmebedingungen der Beklagten spielten keine Rolle,<br />
befanden die Richter.<br />
Wirtschaft, Wettbewerb & Handel:<br />
Wettbewerbsrecht: Neues Gesetz verabschiedet<br />
(Val) Der Deutsche Bundestag hat am 01.04.04 die Neufassung des Gesetzes gegen den unlauteren<br />
Wettbewerb (UWG) beschlossen. Das Gesetz liberalisiert das bisherige Wettbewerbsrecht und setzt die<br />
mit der Abschaffung des Rabattgesetzes und der Zugabeverordnung begonnene Modernisierung der<br />
wirtschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen fort. "Den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken und<br />
Verbraucherrechte sichern ist das Motto dieser Reform. Die Novelle schafft einen fairen Ausgleich<br />
zwischen den Interessen der Wirtschaft und denen der Verbraucherinnen und Verbraucher", sagte<br />
Bundesjustizministerin Brigitte Zypries.<br />
Das neue UWG fördert die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Die<br />
Liberalisierung unterstützt die verbraucherfreundliche Politik der Bundesregierung, die sich am Leitbild<br />
des mündigen Verbrauchers orientiert, der selbst beurteilen kann, welche Geschäfte sich lohnen.<br />
Kernbereich der Liberalisierung ist die Aufhebung des Sonderveranstaltungsverbots. Die bisherigen<br />
Vorschriften über Schlussverkäufe und Jubiläumsverkäufe (bisher § 7 UWG) und Räumungsverkäufe<br />
(bisher § 8 UWG) fallen weg. Rabattaktionen werden in einem weiteren Umfang als bisher zulässig.<br />
Sommer- und Winterschlussverkäufe werden auch nach der Reform des UWG weiterhin möglich sein,<br />
sogar in einem größeren Rahmen als bisher. Denn: Der Handel entscheidet selbst, ob und wann solche<br />
Sonderverkäufe stattfinden sollen. Er kann sie zeitlich flexibel und regional unterschiedlich gestalten und<br />
ist dabei auch nicht mehr auf den Verkauf von Saisonartikeln beschränkt.<br />
Eine erhebliche Verbesserung des Verbraucherschutzes stellt der neu eingeführte<br />
Gewinnabschöpfungsanspruch dar. Wer zahlreiche Verbraucher vorsätzlich um kleine Beträge prellt und<br />
so zu Lasten einer Vielzahl von Abnehmern wettbewerbswidrige Gewinne erwirtschaftet, wird diese<br />
künftig nicht behalten können. Damit wird unseriösen Geschäftemachern das Handwerk gelegt und<br />
sichergestellt, dass sich vorsätzliche Unlauterkeit nicht lohnt.<br />
Wenig Verständnis zeigt Bundesjustizministerin Zypries für die Forderung, Telefonwerbung nur dann zu<br />
untersagen, wenn die Angerufenen sich ausdrücklich gegen einen solchen Kontakt ausgesprochen<br />
haben. "Der Schutz der Privatsphäre muss hier Vorrang vor den Interessen einzelner Wirtschaftszweige<br />
haben. Anrufe zuhause sind nur dann zulässig, wenn der Adressat zuvor eingewilligt hat - etwa im<br />
Rahmen einer bestehenden Geschäftsbeziehung".<br />
SEITE - 35 -
Wirtschaft, Wettbewerb & Handel:<br />
Dosenpfand: Gegner scheitern erneut vor Gericht<br />
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
Berlin (dpa) - Gegner des Dosenpfands sind erneut vor Gericht gescheitert. Das Berliner<br />
Oberverwaltungsgericht wies die letzten vier Eilanträge gegen die Pfandpflicht für Einwegverpackungen<br />
zurück, teilte das Gericht am Freitag mit. Die antragstellenden Unternehmen, ein Produktionsbetrieb für<br />
Weißblechdosen und drei Einzelhändler, wollten erreichen, dass die Pfandpflicht bis zur rechtskräftigen<br />
Entscheidung im Hauptverfahren ausgesetzt wird. Sie beriefen sich vor allem darauf, dass die EG-<br />
Kommission im Oktober 2003 in dieser Sache ein Verfahren gegen die Bundesrepublik eingeleitet hat.<br />
Das Gericht sah darin aber keinen hinreichenden Grund, das Pfand auszusetzen.<br />
Umweltschützer begrüßten die Entscheidung. Damit seien die «letzten Hoffnungen der Dosenlobby auf<br />
Aussetzung des Dosenpfandes gescheitert», sagte Jürgen Resch, der Geschäftsführer der Deutschen<br />
Umwelthilfe. Die Entscheidung in der Hauptsache werde erst in zwei bis drei Jahren getroffen werden.<br />
Roland Demleitner vom Bundesverband mittelständischer Privatbrauereien sagte: «Die heutige<br />
Entscheidung des OVG Berlin ist eine erneute eindrucksvolle Bestätigung des Dosenpfandes und schafft<br />
weitere Investitionssicherheit für die Mehrwegbranche».<br />
Akten-Z: OVG 2 S 38.03, OVG 2 S 32.03 bis OVG 2 S 34.03 - Beschlüsse vom 15. April 2004<br />
Wirtschaft, Wettbewerb & Handel:<br />
EDV: Reparateur haftet nicht für Datensicherung<br />
(Val) Gehen bei einer Reparatur an einer EDV-Anlage Daten verloren, ist dafür nicht unbedingt allein das<br />
ausführende Reparaturunternehmen verantwortlich. Entscheidend ist auch, ob der Besitzer der Anlage<br />
eine korrekte Datensicherung durchgeführt hat. Hat er das nicht, geht dies zu seinen Lasten, entschied<br />
das Oberlandesgericht Hamm.<br />
Ein Reiseunternehmen hatte eine Firma aus Bochum mit Arbeiten an ihrer Computeranlage beauftragt.<br />
Hierfür entstanden Kosten in Höhe von rund 14.000,00 Euro. Die Computerfirma erhielt anschließend den<br />
Auftrag, einer Fehlermeldung nachzugehen. Bei der Vorbereitung der Arbeiten kam es zum Absturz des<br />
Servers mit Datenverlust. Für die Beseitigung dieses Schadens entstanden Kosten von ebenfalls nahezu<br />
14.000,00 Euro. Mit diesen Kosten wollte die Auftraggeberin gegenüber der Rechnung der<br />
Computerfirma aufrechnen.<br />
Dies hat ihr das Oberlandesgericht verwehrt. Es hat eine Pflichtverletzung der Computerfirma nicht<br />
feststellen können. Außerdem scheitere ein Schadensersatzanspruch an einem überwiegenden<br />
Mitverschulden der Auftraggeberin. Diese habe nämlich nicht für eine zuverlässige Sicherungsroutine<br />
gesorgt. Im gewerblichen Anwenderbereich sei es selbstverständlich, dass eine zuverlässige, zeitnahe<br />
und umfassende Sicherung erfolge.<br />
Vor einem objektiv datengefährdenden Eingriff muss sich der Auftragnehmer zwar danach erkundigen<br />
und gegebenenfalls darüber vergewissern, ob die vom Anwender vorgenommene Datensicherung dem<br />
aktuellen Stand entspreche. Zusätzliche Überprüfungspflichten bestünden jedoch nur dann, wenn<br />
ernsthafte Zweifel vorlägen, dass die Datensicherung nicht ordnungsgemäß erfolgt sei oder das<br />
Sicherungssystem nicht funktioniere. Dass die Datensicherungsroutine hier völlig unzulänglich gewesen<br />
sei, habe der Mitarbeiter der Computerfirma nicht erkennen können. Die Sicherung hätte täglich erfolgen<br />
müssen, die Vollsicherung mindestens einmal wöchentlich.<br />
Bei der Auftraggeberin sei nicht einmal eine monatliche Komplettsicherung erfolgt. Unter diesen<br />
Voraussetzungen habe sich die Auftraggeberin den Schaden allein zuzurechnen, selbst wenn der<br />
Computerfirma eine Pflichtverletzung vorzuwerfen gewesen wäre.<br />
Aktenzeichen: 13 U 133/03 OLG Hamm<br />
SEITE - 36 -
Wirtschaft, Wettbewerb & Handel:<br />
Werbe-E-Mail: Versendung unzulässig<br />
<strong>MANDANTENBRIEF</strong> MAI 2004<br />
STEUERBERATUNGSBÜRO HAAG<br />
(Val) Gehen bei einer Reparatur an einer EDV-Anlage Daten verloren, ist dafür nicht unbedingt allein das<br />
ausführende Reparaturunternehmen verantwortlich. Entscheidend ist auch, ob der Besitzer der Anlage<br />
eine korrekte Datensicherung durchgeführt hat. Hat er das nicht, geht dies zu seinen Lasten, entschied<br />
das Oberlandesgericht Hamm.<br />
Ein Reiseunternehmen hatte eine Firma aus Bochum mit Arbeiten an ihrer Computeranlage beauftragt.<br />
Hierfür entstanden Kosten in Höhe von rund 14.000,00 Euro. Die Computerfirma erhielt anschließend den<br />
Auftrag, einer Fehlermeldung nachzugehen. Bei der Vorbereitung der Arbeiten kam es zum Absturz des<br />
Servers mit Datenverlust. Für die Beseitigung dieses Schadens entstanden Kosten von ebenfalls nahezu<br />
14.000,00 Euro. Mit diesen Kosten wollte die Auftraggeberin gegenüber der Rechnung der<br />
Computerfirma aufrechnen.<br />
Dies hat ihr das Oberlandesgericht verwehrt. Es hat eine Pflichtverletzung der Computerfirma nicht<br />
feststellen können. Außerdem scheitere ein Schadensersatzanspruch an einem überwiegenden<br />
Mitverschulden der Auftraggeberin. Diese habe nämlich nicht für eine zuverlässige Sicherungsroutine<br />
gesorgt. Im gewerblichen Anwenderbereich sei es selbstverständlich, dass eine zuverlässige, zeitnahe<br />
und umfassende Sicherung erfolge.<br />
Vor einem objektiv datengefährdenden Eingriff muss sich der Auftragnehmer zwar danach erkundigen<br />
und gegebenenfalls darüber vergewissern, ob die vom Anwender vorgenommene Datensicherung dem<br />
aktuellen Stand entspreche. Zusätzliche Überprüfungspflichten bestünden jedoch nur dann, wenn<br />
ernsthafte Zweifel vorlägen, dass die Datensicherung nicht ordnungsgemäß erfolgt sei oder das<br />
Sicherungssystem nicht funktioniere. Dass die Datensicherungsroutine hier völlig unzulänglich gewesen<br />
sei, habe der Mitarbeiter der Computerfirma nicht erkennen können. Die Sicherung hätte täglich erfolgen<br />
müssen, die Vollsicherung mindestens einmal wöchentlich.<br />
Bei der Auftraggeberin sei nicht einmal eine monatliche Komplettsicherung erfolgt. Unter diesen<br />
Voraussetzungen habe sich die Auftraggeberin den Schaden allein zuzurechnen, selbst wenn der<br />
Computerfirma eine Pflichtverletzung vorzuwerfen gewesen wäre.<br />
Aktenzeichen: 13 U 133/03 OLG Hamm<br />
********************************************<br />
Ein Service der Kanzlei Hans Peter Haag.<br />
Der Mandantenbrief ersetzt keine Beratung. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine<br />
Gewährleistung für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informationen übernehmen.<br />
Impressum<br />
Hans Peter Haag<br />
Steuerberater<br />
Mandantenbrief-Service<br />
Hauptstraße 295<br />
79576 Weil am Rhein<br />
Tel.: 0762175050<br />
Fax: 0762174007<br />
EMail: office@steuerberater-haag.de<br />
SEITE - 37 -