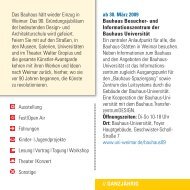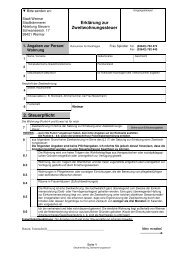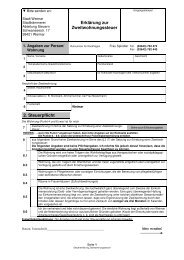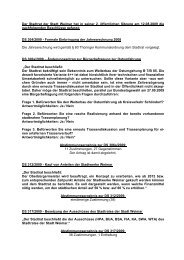0000_offenes_Denkmal_2007.indd 1 15.08.2007 11:47:57 ... - Weimar
0000_offenes_Denkmal_2007.indd 1 15.08.2007 11:47:57 ... - Weimar
0000_offenes_Denkmal_2007.indd 1 15.08.2007 11:47:57 ... - Weimar
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>0000</strong>_<strong>offenes</strong>_<strong>Denkmal</strong>_<strong>2007.indd</strong> 1 <strong>15.08.2007</strong> <strong>11</strong>:<strong>47</strong>:<strong>57</strong> Uhr
Programm zum Tag des offenen <strong>Denkmal</strong>s in <strong>Weimar</strong><br />
Sonntag, 9. September 2007<br />
Eröffnung des <strong>Denkmal</strong>tages<br />
Oberbürgermeister Herr Wolf<br />
An der Herderkirche<br />
9.00 Uhr<br />
1 Kirchenpilgerweg durch <strong>Weimar</strong><br />
1.1 Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche) ><br />
Herderplatz, <strong>Weimar</strong><br />
Ansprechperson vor Ort<br />
Kirche geöffnet von 10.00 bis 18.00 Uhr<br />
09.30 Uhr Gottesdienst<br />
15.00 Uhr Führung<br />
16.00 Uhr Kinderführung<br />
18.00 Uhr <strong>Weimar</strong>er Orgelsommer<br />
1.2 Jakobskirche ><br />
Am Jakobskirchhof, <strong>Weimar</strong><br />
Pfarrer Herr Rylke<br />
Kirche geöffnet von 10.00 bis 18.00 Uhr<br />
10.00 Uhr Gottesdienst<br />
<strong>11</strong>.30 und 14.00 Uhr Führung<br />
1.3 Kreuzkirche ><br />
William-Shakespeare-Straße, <strong>Weimar</strong><br />
Kirche geöffnet von 10.00 bis 18.00 Uhr<br />
10.00 Uhr Gottesdienst<br />
14.00 Uhr Erläuterungen zu Kirchensanierung als<br />
Gemeindeprojekt<br />
1.4 Johanneskirche ><br />
Tiefurter Allee 2 b, <strong>Weimar</strong><br />
Pfarrer Herr Geßner<br />
Kirche geöffnet von 10.00 bis 18.00 Uhr<br />
10.30 Uhr Gottesdienst<br />
<strong>11</strong>.30 Uhr Führung<br />
1.5 Evangelisches Gemeindezentrum <strong>Weimar</strong> Paul Schneider ><br />
Moskauer Strasse 1 a, <strong>Weimar</strong><br />
10.00 Uhr Gottesdienst<br />
1.6 Kirche St. Peter und Paul in Oberweimar ><br />
Kirche geöffnet von 10.00 bis 18.00 Uhr<br />
10.00 Uhr Gottesdienst<br />
<strong>11</strong>.00 und 16.00 Uhr Führung<br />
1.7 Marienkirche in Ehringsdorf ><br />
Kirche geöffnet von 10.00 bis 18.00 Uhr<br />
08.30 Uhr Gottesdienst<br />
15.00 Uhr Führung<br />
1.8 Dorfkirche in Possendorf ><br />
Gemeindekirchenrat und Ortschronist Herr Dr. Jäger<br />
Kirche geöffnet von <strong>11</strong>.00 bis 17.00 Uhr<br />
Erläuterungen nach Bedarf<br />
1.9 Trinitatiskirche in Legefeld ><br />
Pfarramt Buchfart, Frau Anding<br />
Kirche geöffnet von <strong>11</strong>.00 bis 18.00 Uhr<br />
09.30 Uhr Gottesdienst<br />
1.10 Autobahn- und Feiningerkirche in Gelmeroda ><br />
Pfarramt Buchfart, Frau Roth<br />
Kirche geöffnet von <strong>11</strong>.00 bis 18.00 Uhr<br />
<strong>11</strong>.00 Uhr Gottesdienst<br />
<strong>0000</strong>_<strong>offenes</strong>_<strong>Denkmal</strong>_<strong>2007.indd</strong> 2 <strong>15.08.2007</strong> <strong>11</strong>:<strong>47</strong>:<strong>57</strong> Uhr
1.<strong>11</strong> Kirche „Zu unserer lieben Frauen“ in Buchfart ><br />
Pfarramt Buchfart, Pastorin Frau Bärlich<br />
Kirche geöffnet von <strong>11</strong>.00 bis 18.00 Uhr<br />
17.00 Chorkonzert unter der Leitung von Herrn Göring<br />
1.12 Mauritiuskirche in Niedergrunstedt ><br />
Pfarramt Buchfart<br />
Kirche geöffnet von <strong>11</strong>.00 bis 18.00 Uhr<br />
1.13 Schlosskirche in Ettersburg<br />
Kirche geöffnet von 10.00 bis 17.00 Uhr<br />
17.00 Uhr Vespergebet<br />
1.14 St. Stephanuskirche in Schöndorf ><br />
Pfarrer Herr Müller<br />
Kirche geöffnet von 10.00 bis 18.00 Uhr<br />
10.00 Uhr Familiengottesdienst<br />
<strong>11</strong>.00 Uhr Führung<br />
1.15 Christophoruskirche in Tiefurt<br />
Kirche geöffnet von 10.00 bis 18.00 Uhr<br />
14.00 Uhr Andacht zum Heiligen Christophorus<br />
14.00 bis 15.00 Uhr Singen des Männergesangsvereins und<br />
Erläuterungen zur Geschichte der Kirche, Dr. Roland Krause<br />
1.16 Dorfkirche in Süßenborn ><br />
Dorffest<br />
Pfarramt Umpferstedt, Ortsbürgermeister Herr Schwarz<br />
Kirche geöffnet von 10.00 bis 18.00 Uhr<br />
10.00 Uhr Glockenanschlag des historischen Uhrwerkes<br />
(bei Interesse auch mehrfach)<br />
<strong>11</strong>.00 Uhr Festgottesdienst<br />
ab 15.00 Uhr mehrere Konzerte internationaler Kirchenlieder<br />
und Präsentation Lyonel Feiningers Arbeiten zu Süßenborn am<br />
Originalstandplatz<br />
2 Rathaus, Marktplatz<br />
Porzellanglockenspiel – Konzert und Führung<br />
Öffnung des Rathauses mit Konzert und Führung<br />
von 12.00 bis 13.30 Uhr und von 16.30 bis 18.00 Uhr.<br />
Zum ersten Mal wird in diesem Jahr auch das Porzellanglockenspiel<br />
im Turm des <strong>Weimar</strong>er Rathauses in das Programm des<br />
<strong>Weimar</strong>er <strong>Denkmal</strong>tages integriert.<br />
Der Turmuhrenbauer Dipl. Ing. Klaus Ferner aus Niederau bei<br />
Meißen, der Dresdner Komponist Prof. Günther Schwarze sowie<br />
Dieter Kammler aus <strong>Weimar</strong> laden zum jeweils dreißigminütigen<br />
Konzert auf den Marktplatz ein. Das dargebotene Musikprogramm<br />
umfasst Stücke aus dem festen Programm des Glockenspiels,<br />
Klassik und Volkslieder. Anschließend laden die Glockenspieler in<br />
die Kammer unter dem Glockenspiel ein, um vor Ort die Mechanik<br />
des Spiels vorzuführen. Bei einem Glas Wein, dessen Spendenerlös<br />
der Oberbürgermeister an die Kinderkrebsstation in Jena<br />
übergeben wird, erzählen sie die ereignisreiche Geschichte des<br />
Glockenspiels aus Meißner Porzellan.<br />
Anschließend wird Kerstin Vogel, Architektin und Autorin der 2007<br />
erschienenen Planungs- und Baugeschichte des Rathauses, bei<br />
einer kenntnisreichen Führung Baugestalt und Ausstattung des<br />
neugotischen Bauwerks erläutern.<br />
3 Herz-Jesu-Kirche ><br />
August-Frölich-Platz, <strong>Weimar</strong><br />
Katholische Pfarrgemeinde <strong>Weimar</strong>, Ansprechperson vor Ort<br />
Kirche geöffnet von <strong>11</strong>.30 bis 17.30 Uhr<br />
9.00, 10.30 und 18.00 Uhr Gottesdienst<br />
Führungen auf den Turm und in die Kuppel nach Bedarf<br />
jeweils zur vollen Stunde kurze Vorträge zu Geschichte,<br />
Fenstern und Kunstgegenständen<br />
<strong>0000</strong>_<strong>offenes</strong>_<strong>Denkmal</strong>_<strong>2007.indd</strong> 3 <strong>15.08.2007</strong> <strong>11</strong>:<strong>47</strong>:<strong>57</strong> Uhr
4 Russisch-Orthodoxe Kirche<br />
(Heilige-Maria-Magdalena-Kirche)<br />
Karl-Hausknecht-Straße, Historischer Friedhof, <strong>Weimar</strong><br />
Klassik Stiftung <strong>Weimar</strong>, Ansprechperson vor Ort<br />
Kirche geöffnet von 10.00 bis 18.00 Uhr<br />
5 Kirche in Taubach<br />
Pfarrer Herr Wedler<br />
Kirche geöffnet von 10.00 bis 12.00 Uhr<br />
6 Kirche in Tröbsdorf<br />
Kirche geöffnet von 10.00 bis 18.00 Uhr<br />
14.00 Uhr Sommerkonzert – Kurzkonzert für Geige und<br />
Akkordeon<br />
7 Kirche St. Albani in Gaberndorf ><br />
Kirche geöffnet von 10.00 bis 18.00 Uhr<br />
<strong>11</strong>.00 Uhr Gottesdienst<br />
15.00, 16.00 und 17.00 Uhr Führungen<br />
8 Friedhofskapelle in Ehringsdorf<br />
„Vox coelestis“ e. V.<br />
Herr Prof. Leidel, Architekten Herr und Frau Schäfer<br />
Kapelle geöffnet von 10.00 bis 17.00 Uhr<br />
10.00, <strong>11</strong>.00, 15.00 und 16.00 Uhr kurze Erläuterungen und<br />
musikalisches Programm<br />
9 Residenzschloss <strong>Weimar</strong><br />
Besichtung der Hofkapelle<br />
Burgplatz 4, <strong>Weimar</strong><br />
Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten<br />
Klassik Stiftung <strong>Weimar</strong>, Herr Mende<br />
10.00 Führung<br />
10 Schloss Ettersburg<br />
Kuratorium Schloss Ettersburg e. V. in Zusammenarbeit mit<br />
dem Bildungswerk BAU Hessen-Thüringen e. V.<br />
Dr. Jakob, Leiter der Bauhaus-Akademie GmbH<br />
15.00 Uhr Führung Schlossbereich<br />
<strong>11</strong> Fürstengruft<br />
Grabstätte des großherzoglichen Hauses von Sachsen-<br />
<strong>Weimar</strong>-Eisenach<br />
Historischer Friedhof, <strong>Weimar</strong><br />
Klassik Stiftung <strong>Weimar</strong>, Herr Mende<br />
14.00 und 15.00 Uhr Führungen<br />
Teilnehmer maximal 25 Personen<br />
Treff: Haupteingang Fürstengruft<br />
12 Grabstätten im Historischen Friedhof<br />
Verein Friedhofskultur e. V.<br />
10.30 Führung<br />
Frau Ragwitz, freie Stadtführerin<br />
Treff: Haupteingang des Historischen Friedhofs am<br />
Poseckschen Garten<br />
13 Park-Regelschule (ehemals Eckermann-Schule) ><br />
Sophienstiftsplatz 1, <strong>Weimar</strong><br />
<strong>11</strong>.00 und 15.00 Uhr Führung<br />
Frau Habelmann,Architektin<br />
Treff: Haupteingang Park-Regelschule<br />
14 Christoph-Martin-Wieland-Grundschule ><br />
Profil Jenaplan<br />
Gropiusstrasse 1, <strong>Weimar</strong><br />
14.00 Uhr Führung Neubau und Planung Turnhallenneubau<br />
Herr Heide (Architekt)<br />
Treff: Schulhof Wieland-Grundschule<br />
16.00 Uhr Führung Altbau<br />
Herr Rämmler, Architekt<br />
Treff: Haupteingang Wieland-Grundschule<br />
<strong>0000</strong>_<strong>offenes</strong>_<strong>Denkmal</strong>_<strong>2007.indd</strong> 4 <strong>15.08.2007</strong> <strong>11</strong>:<strong>47</strong>:<strong>57</strong> Uhr
15 Cranachstraße 29<br />
Stiftung zur Förderung traditioneller Bauhandwerkskunst<br />
ab 10.00 Uhr<br />
Führung durch das Haus, Baujahr 1896, „Sanfte Sanierung“,<br />
Frau Fuhrmann<br />
20-Minuten-Vorträge, Herr Wutschke:<br />
Der gesunde Wohnraum – Schimmel<br />
Baubiologie – Kunststoffe<br />
Elektrosmog – Medizinische Wirkung<br />
Diskussion mit Frau Fuhrmann:<br />
zum Thema Wohnkultur<br />
17.00 Uhr Vortrag, Herr Prof. Pagel:<br />
„Bauernregeln und Baukunst“<br />
19.00 Uhr Vortrag, Frau Fuhrmann:<br />
„Gesunde Strahlungswärme – Kachelöfen“ mit praktischen<br />
Hinweisen von Ofenbaumeister Herrn Böhm<br />
16 Ehemaliges Palais Schardt<br />
Ehemaliges Elternhaus der Charlotte von Stein<br />
Scherfgasse 3, <strong>Weimar</strong><br />
Deutsche Stiftung <strong>Denkmal</strong>schutz, Herr Brinkmann<br />
geöffnet von <strong>11</strong>.00 bis 16.00 Uhr<br />
17 Trierer Straße 58<br />
Beispiel der Sanierung eines <strong>Denkmal</strong>s im Ensemble<br />
Eheleute Förster<br />
geöffnet Erdgeschoss und 1. Obergeschoss<br />
14.00 bis 17.00 Uhr<br />
18 Informationsstand<br />
Schlossdurchgang, <strong>Weimar</strong><br />
Ortskuratorium Deutsche Stiftung <strong>Denkmal</strong>schutz<br />
verweist auf Textbeiträge auf den folgenden Seiten ><br />
<strong>0000</strong>_<strong>offenes</strong>_<strong>Denkmal</strong>_<strong>2007.indd</strong> 5 <strong>15.08.2007</strong> <strong>11</strong>:<strong>47</strong>:58 Uhr
Grußwort<br />
Liebe Bürgerinnen und Bürger,<br />
verehrte Gäste,<br />
zum diesjährigen <strong>Denkmal</strong>tag stehen Sakralbauten im Mittelpunkt<br />
der Aufmerksamkeit. Mit Kirchen und Klöstern verbinden sich für<br />
jeden von uns, oft schon seit der Kindheit, nachhaltige Erlebnisse.<br />
Ob im Heimatort oder auf Reisen – immer wieder faszinieren uns<br />
diese großartigen schöpferischen Leistungen der Planung, des<br />
Handwerks, der Malerei und Bildhauerei, die oft bedeutende und<br />
unverwechselbare Architekturen wie Innenräume hervorgebracht<br />
haben. Sie bereichern die Silhouetten unserer Städte und Gemeinden,<br />
bieten geistlichen Beistand und schaffen eine durch nichts zu<br />
ersetzende Identifikation.<br />
Wenn man heute mit dem Auto auf modernen Straßen unterwegs<br />
ist, kann man wie eh und je bemerken, dass die Kirchturmspitze<br />
in der Straßenflucht bereits den Ort ankündigt, schon lange, bevor<br />
dessen Häuser zu sehen sind. Die alten Wegeverbindungen von<br />
Ort zu Ort hatten damit ihre charakteristischen Merkmale. Wenn<br />
der Kirchturm auftauchte, dann war man auf dem Weg in die richtige<br />
Richtung. Im Ort selbst ist die Kirche dann der zentrale Punkt,<br />
um den sich die Häuser scharen, der Mittelpunkt eines jeden Dorfes<br />
und jeder Stadt.<br />
Was wäre <strong>Weimar</strong> ohne die Herderkirche oder die Herz Jesu Kirche?<br />
Die Zwiebeltürme der Maria-Magdalena-Kapelle auf dem<br />
Historischen Friedhof gehören genauso zum unverwechselbaren<br />
Erscheinungsbild unserer Stadt wie die so oft von Feininger gemalte<br />
Kirche von Gelmeroda oder der schlanke Turm der modernen<br />
Stephanuskirche in Schöndorf.<br />
Wir freuen uns, dass zahlreiche Sakralbauten in <strong>Weimar</strong> und im<br />
Landkreis zugänglich sind und mit interessanten Angeboten aufwarten.<br />
Ergänzend bieten wir Ihnen an, sich in den Schulen am Sophienstiftsplatz<br />
und in der Gropiusstraße über die unter Berücksichtigung<br />
denkmalpflegerischer Gesichtspunkte durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen<br />
zu informieren.<br />
Und noch eine Besonderheit wartet auf Besucher: Zum ersten Mal<br />
wird in diesem Jahr auch das Porzellanglockenspiel im Turm des<br />
<strong>Weimar</strong>er Rathauses in das Programm des <strong>Weimar</strong>er <strong>Denkmal</strong>tages<br />
integriert.<br />
Glocken und Musik – das sind Themen, die sich mit den an diesem<br />
Tag geöffneten Sakralbauten verbinden, aber auch im <strong>Weimar</strong>er<br />
Rathaus seit der Installation des Glockenspiels im Jahre 1987 eine<br />
wichtige Rolle spielen.<br />
Ich danke allen an der Vorbereitung und Durchführung des <strong>Denkmal</strong>tages<br />
Beteiligten und hoffe, dass unser Programm Ihr Interesse<br />
findet.<br />
Stefan Wolf<br />
Oberbürgermeister der Stadt <strong>Weimar</strong><br />
<strong>0000</strong>_<strong>offenes</strong>_<strong>Denkmal</strong>_<strong>2007.indd</strong> 6 <strong>15.08.2007</strong> <strong>11</strong>:<strong>47</strong>:58 Uhr
1 Kirchenpilgerweg durch <strong>Weimar</strong><br />
1.1 Stadtkirche St. Peter und Paul<br />
(Herderkirche) in <strong>Weimar</strong><br />
Die spätgotische Stadtkirche St. Peter und Paul wurde als<br />
dreischiffige Hallenkirche in den Jahren 1498–1500 erbaut. Der<br />
erste Kirchenbau an dieser Stelle erfolgte in den Jahren 1245 bis<br />
1249. Die Fundamente des Westturms gehören zu den ältesten<br />
Bauteilen der Stadt. Von der spätgotischen Ausstattung der Kirche<br />
sind nur der Taufstein, der Aufgang zur barock umkleideten Kanzel<br />
und der Rest eines Wandbildes der heiligen Ursula unter der<br />
Orgelempore erhalten.<br />
Hauptanziehungspunkt ist der Flügelaltar, der 1552 von Lucas<br />
Cranach d. Ä. begonnen und von seinem Sohn vollendet wurde.<br />
Der Cranachaltar gilt als eines der Hauptwerke der sächsischthüringischen<br />
Kunst des 16. Jahrhunderts. Bemerkenswert ist auch<br />
der Lutherschrein, ein Triptychon aus dem Jahre 1<strong>57</strong>2, das Martin<br />
Luther als Mönch, als Junker Jörg und als Magister zeigt. 1945<br />
stark zerstört, konnte das Gotteshaus am 14. Juni 1953 wieder<br />
eingeweiht werden.<br />
Johann Gottfried Herder, nach ihm wird die Kirche auch<br />
„Herderkirche“ genannt, wirkte von 1776–1803 als Oberhofprediger,<br />
Oberkonsistorialrat, Generalsuperintendent und Pastor der<br />
Stadtkirche. Eine Gusseisenplatte mit Herders Wahlspruch „Licht<br />
Liebe Leben“ bedeckt sein Grab im westlichen Langhaus. Heute<br />
ist die Kirche Anziehungsort für viele Touristen. Seit 1998 steht sie<br />
zusammen mit dem Herderhaus als Teil des <strong>Denkmal</strong>ensembles<br />
„Klassisches <strong>Weimar</strong>“ auf der Weltkulturerbeliste der UNESCO.<br />
1.2 Jakobskirche in <strong>Weimar</strong><br />
Erbaut wurde St. Jakob als Pilgerkirche auf dem Weg nach<br />
Santiago de Compostela. <strong>11</strong>68 erfolgte die Weihe eines ersten<br />
Kirchbau an diesem Ort. 1535 wurde die Kirche aus finanziellen<br />
Nöten geschlossen. Der Bau wurde in den folgenden Jahrzehnten<br />
als Kornhaus und später für Trauerfeiern genutzt.<br />
1712/13 wurde die baufälligen Kirche abgerissen und durch<br />
Herzog Wilhelm Ernst neu erreichtet. 1728 wurde die Jakobskirche<br />
Garnisonskirche und als 1774 der <strong>Weimar</strong>er Stadtbrand die<br />
Schlosskapelle zerstörte, Hofkirche. Am 19. Oktober 1806 wurden<br />
in der Sakristei der Kirche Johann Wolfgang v. Goethe und<br />
Christiane Vulpius durch Oberkonsistorialrat Günther getraut. Das<br />
Kirchenschiff wurde während dessen als Lazarett für verwundete<br />
Soldaten aus der Schlacht von Jena und Auerstedt genutzt.<br />
1817 wurde die Kirche unter der Leitung von Bauinspektor Heß<br />
und der Beratung von Clemens Wenzeslaus Coudray renoviert.<br />
Die Kirche erhält den Kanzelaltar in seiner jetzigen Fassung. Seine<br />
Besonderheit ist die segnende Christusfigur, die nach einer Vorlage<br />
in der Kopenhagener Frauenkirche durch den Torwaldsen-Schüler<br />
Kaufmann geschaffen wurde.<br />
<strong>0000</strong>_<strong>offenes</strong>_<strong>Denkmal</strong>_<strong>2007.indd</strong> 7 <strong>15.08.2007</strong> <strong>11</strong>:<strong>47</strong>:58 Uhr
1989 bot die Jakobskirche Raum für kritische Jugend-, Frauen-<br />
und Friedensgruppen. Von hier aus wurde die friedliche Revolution<br />
in <strong>Weimar</strong> maßgeblich vorbereitet.<br />
1.3 Kreuzkirche in <strong>Weimar</strong><br />
Die Kreuzkirche, im Südwesten der Stadt gelegen, war als<br />
Gotteshaus für die Englische Gemeinde am Michaelstag<br />
(29. September) 1899 „Saint Michael and All Angels“ geweiht<br />
worden. Das Äußere lässt auch heute noch den typischen<br />
englischen Perpendikularstil erkennen. Nach der Verwüstung<br />
im ersten Weltkrieg wurde sie 1927 von der evangelischen<br />
Kirchgemeinde erworben und am 30.9.1928 als „Kreuzkirche“ in<br />
den Dienst der Gemeinde gestellt.<br />
1962 bekam die Kirche einen Glockenturm. In den Jahren 1972<br />
bis 1974 erfolgte eine Umgestaltung des gesamten Innenraumes.<br />
Den Mittelpunkt bildet ein gotischer Kruzifixus. Altar und Taufstein<br />
sind miteinander verbunden, beides Arbeiten des Dresdner<br />
Bildhauers Friedrich Press. 1989 erhielt die Kirche eine von der<br />
Potsdamer Orgelbaufirma Schuke gebaute Orgel. Ein modernes<br />
Gemeindehaus wurde im Jahre 1998 neben der Kirche errichtet.<br />
1.4 Johanneskirche in <strong>Weimar</strong><br />
Die Johanneskirche ist einer der wenigen Kirchenbauten der<br />
dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts. Sparzwänge ermöglichten<br />
nur einen schlichten Hallenbau, der in den Jahren 1938 bis<br />
1941 im Stil dieser Zeit entstand („Osthalle“). Pfingsten 1941<br />
wurde er als Herzog-Bernhard-Kirche eingeweiht und 19<strong>47</strong> in<br />
Johanneskirche umbenannt. 1953 trennte man die Empore durch<br />
eine Antikglasfensterwand vom Kirchenschiff ab und schuf damit<br />
eine gut beheizbare Winterkirche. 1977 entstanden durch den<br />
Einbau von weiteren Glaswänden zwei kleinere Gemeinderäume.<br />
Mit Küche, Toiletten und Jugendraum ausgestattet, ist die<br />
Johanneskirche für moderne Gemeindearbeit bestens geeignet.<br />
Der bühnenartige Altarraum erhielt 1981 fünf farbige Holzreliefs<br />
von Friedrich Popp aus Ebersdorf.<br />
1.5 Evangelisches Gemeindezentrum<br />
„Paul Schneider“ in <strong>Weimar</strong><br />
Das Gemeindezentrum wurde in den Jahren 1986 bis 1988 im<br />
größten Neubaugebiet <strong>Weimar</strong>s erbaut. Es ist ein Mehrzweckbau,<br />
in dem Kirche und Gemeinderäume unter einem Dach sind und<br />
durch Schiebewände variabel genutzt werden können.<br />
Das Gemeindezentrum ist nach Pfarrer Paul Schneider, dem<br />
„Prediger von Buchenwald“, benannt, dessen Glaubenskraft und<br />
Mut auch in der Einzelhaft im Konzentrationslager Buchenwald nicht<br />
gebrochen werden konnten. Er wurde am 18. Juli 1939 im Lager<br />
ermordet. Vier große Wandbehänge in den Kirchenjahresfarben,<br />
das Altarkreuz und eine Skulptur der Holzbildhauerin Elly-<br />
Viola Nahmmacher beziehen sich auf Paul Schneider und das<br />
Konzentrationslager Buchenwald.<br />
Im Jahre 1998 wurde neben dem Gemeindezentrum ein<br />
zwar in der Planung vorgesehener, aber in DDR-Zeiten nicht<br />
genehmigter Glockenturm errichtet. Im Gemeindezentrum finden<br />
Veranstaltungen der Kirchgemeinde, der Kinder- und Jugendarbeit<br />
und der Diakonie statt. Die im Mai 1997 gegründete „Pfarrer-Paul-<br />
Schneider-Gesellschaft“ e.V. hat ihren Sitz in diesem Haus.<br />
<strong>0000</strong>_<strong>offenes</strong>_<strong>Denkmal</strong>_<strong>2007.indd</strong> 8 <strong>15.08.2007</strong> <strong>11</strong>:<strong>47</strong>:58 Uhr
1.6 Kirche St. Peter und Paul in<br />
Oberweimar<br />
Die Kirche von Oberweimar geht auf eine Klosterkirche des<br />
Zisterzienserinnenordens zurück. Sie ist ein stattlicher Bau<br />
mit dreiseitigem Chorabschluss, zum Teil gotischen Fenstern,<br />
barockem Mansardendach und einem Westturm, der ein hohes<br />
Schieferdach trägt.<br />
In den Jahren 1248–1283 wurde die Kirche erbaut, aber schon<br />
fast 100 Jahre später wesentlich erweitert und umgestaltet.<br />
Ungewöhnlich ist der zwischen 1514 und 1517 über dem Papierbach<br />
auf alten Grundmauern errichtete Turm. In ihm hängt die aus dem<br />
Jahre 1506 stammende älteste Glocke. 1525 wurde das Kloster<br />
aufgelöst und ein Pfarrer „mit Weib und Kindern“ übernahm das<br />
Pfarramt mit der Filiale Ehringsdorf.<br />
In den folgenden Jahrhunderten wurde die Kirche mehrmals<br />
umgebaut und renoviert. Davon zeugen der barocke Kanzelaltar,<br />
der Taufengel und die immer wieder veränderte barocke Orgel. Von<br />
Cranachschüler Veit Thiem stammt ein Flügelaltar im Chorraum,<br />
auf dessen Rückseite eine Mariendarstellung aus dem frühen<br />
13. Jahrhundert erhalten ist. Ebenfalls im Chorraum befinden sich<br />
gotische Fresken mit Darstellungen der Heiligen Ursula und des<br />
Heiligen Antonius. Das an der Westseite befindliche Lukardis-<br />
Gewölbe, benannt nach der 1309 verstorbenen Nonne, gehört zu<br />
den ältesten baulichen Zeugnissen des Klosters und wird heute für<br />
Veranstaltungen und Ausstellungen genutzt.<br />
1.7 Marienkirche in Ehringsdorf<br />
Die Marienkirche in Ehringsdorf ist eine kleine Dorfkirche, die in<br />
ihren Ursprüngen auf eine romanische Chorturmanlage aus dem<br />
Jahre 1255 zurückgeht. Der Name „Unserer lieben Frauen“ wird<br />
erstmals 1365 urkundlich erwähnt.<br />
Die Kirche wurde im Laufe der Zeit immer wieder umgebaut und<br />
erweitert. Aus dem Jahre 1525 stammt der spätgotische Chor<br />
mit der Sakramentsnische. Erhalten sind aus dieser Zeit auch<br />
Wandmalereien, die bei Renovierungsarbeiten freigelegt wurden.<br />
Jugendstilelemente und eine neuromantische Orgel zeugen vom<br />
letzten Umbau der Kirche aus dem Jahre 1908.<br />
1.8 Dorfkirche in Possendorf<br />
Zustand bis 1987: Die Kanzel und<br />
der (verputzte) Altar befinden sich im<br />
Triumphbogen. Der Schnitzaltar hängt unter<br />
der Turmdecke.<br />
Zustand 2005: Blick in den Chorraum nach<br />
Entfernung der Kanzel und Versetzen<br />
des Altars. Der Schnitzaltar steht auf dem<br />
Altartisch.<br />
<strong>0000</strong>_<strong>offenes</strong>_<strong>Denkmal</strong>_<strong>2007.indd</strong> 9 <strong>15.08.2007</strong> <strong>11</strong>:<strong>47</strong>:59 Uhr
Die ältesten Teile der kleinen, verwinkelten Dorfkirche stammen aus<br />
dem späten 13. Jahrhundert. Bemerkenswert an der Innenausstattung<br />
sind restaurierte Renaissancewandmalereien im Chorraum. Es handelt<br />
sich hierbei um ein für die Zeit zwischen 1530 und 1650 typisches<br />
dekoratives „Rollwerk“, das es in Thüringen nur noch im Schloss<br />
Wilhelmsburg in Schmalkalden gibt. An der Decke im Chorraum<br />
wurde ein in seiner Art bisher in Thüringen einzigartiges Flechtwerk<br />
wieder entdeckt. Bemerkenswert ist ein Marienaltar aus dem Jahre<br />
1506 im Chorraum. Die Kirche liegt am Feininger-Radweg.<br />
1.9 Trinitatiskirche in Legefeld<br />
In Legefeld hat es häufig<br />
Brände gegeben, bei denen<br />
auch die Kirche mehrfach<br />
zerstört wurde. Der heutige<br />
Bau wurde 1788 auf<br />
den alten Grundmauern<br />
errichtet.<br />
Schon im Jahre 1789 konnte<br />
der barocke Kirchenraum<br />
mit zwei Emporen und<br />
einem mit Säulen und<br />
geschnitzten Früchteranken<br />
geschmückten Kanzelaltar<br />
durch den damaligen<br />
Generalsuperintendenten<br />
Johann Gottfried Herder<br />
eingeweiht werden.<br />
Nach dem neuerlichen<br />
Verfall der Kirche fand<br />
1987 die feierliche Wiedereinweihung<br />
als Trinitatiskirche statt. Die Innenausmalung bei der<br />
Renovierung erfolgte nach Vorgaben des <strong>Weimar</strong>er Malers Horst<br />
Jährling.<br />
1.10 Autobahn- und Feiningerkirche in<br />
Gelmeroda<br />
Um 1200 erbaut, wurde<br />
die Kirche 1381 erstmals<br />
urkundlich erwähnt. Aus<br />
dieser Zeit stammt die erst in<br />
diesem Jahrhundert wieder<br />
entdeckte byzantinische<br />
Seccomalerei.<br />
Ein Sakramentshäuschen,<br />
ein gotisches Fenster im<br />
Chor und der schlanke<br />
Kirchturm entstanden im<br />
15. Jahrhundert. Vom<br />
Umbau in der Barockzeit<br />
ist nur noch die Kanzel<br />
von 1713 erhalten. Seit<br />
den sechziger Jahren des<br />
letzten Jahrhunderts verfiel<br />
die Kirche total.<br />
In mühevoller Kleinarbeit<br />
wurde die Dorfkirche in<br />
den Jahren 1975 bis 1991<br />
restauriert. Hilfreich war dabei die Tatsache, dass der berühmte<br />
Maler des Bauhauses, Lyonel Feininger, die Gelmerodaer Kirche<br />
durch 13 große Gemälde und ungezählte Grafiken weltweit bekannt<br />
gemacht hatte. 1994 wurde Gelmeroda erste „Autobahnkirche“ in<br />
den neuen Bundesländern. Seitdem ist die Kirche täglich von 8 bis<br />
20 Uhr geöffnet. Jeden Sonntag um <strong>11</strong> findet Gottesdienst statt. Eine<br />
<strong>0000</strong>_<strong>offenes</strong>_<strong>Denkmal</strong>_<strong>2007.indd</strong> 10 <strong>15.08.2007</strong> <strong>11</strong>:<strong>47</strong>:59 Uhr
Ausstellung stellt Leben und Werk des Bauhausmeisters Feininger<br />
vor. Ein Anliegenbuch liegt aus, in das viele in- und ausländische<br />
Besucher einschreiben. Seit dem <strong>Weimar</strong>er Kulturstadtjahr 1999<br />
zieht zudem eine Lichtskulptur von Peter Mittmann bis heute viele<br />
Gäste an. Die Kirche ist außerdem eine stark frequentierte Station<br />
des Feininger-Radweges.<br />
1.<strong>11</strong> Kirche „Zu unserer lieben Frauen“<br />
in Buchfart<br />
Die Chorturmkirche stammt<br />
aus der Übergangszeit<br />
von der Romanik zur<br />
Gotik. Darauf weisen ein<br />
romanischer Rundbogen,<br />
ein Spitzbogenfenster<br />
und die gotische<br />
Sakramentsnische hin.<br />
In allen Jahrhunderten<br />
wurde die Kirche<br />
umgebaut und verändert.<br />
Das Langhaus und der<br />
Turm wurden erhöht, die<br />
Fenster vergrößert, ein<br />
Vorbau angebracht.<br />
Bei der Renovierung<br />
1956-<strong>57</strong> wurden der<br />
barocke Kanzelaufbau<br />
und die oberste Empore<br />
herausgenommen. Den<br />
Blickfang im Inneren der<br />
Kirche bildet der gotische Marienflügelaltar von 1492 aus der Jenaer<br />
Werkstatt Linde. Die Heerwagen-Orgel von 1829 zählt zu den<br />
wenigen vollständig erhaltenen romantischen Orgeln in Thüringen.<br />
Buchfart liegt an der Kreuzung von Feininger- und Ilmradweg.<br />
1.12 Mauritiuskirche in Niedergrunstedt<br />
In überraschender Farbigkeit<br />
präsentiert sich<br />
die kleine Kirche in<br />
Niedergrunstedt. Im 13.<br />
Jahrhundert erbaut, wurde<br />
sie dem Heiligen Moritz<br />
gewidmet. In den Jahren<br />
1726–1729 erfolgte ein<br />
barocker Umbau. Der<br />
<strong>Weimar</strong>er Hofmaler Johann<br />
Ernst Rentsch erhielt<br />
den Auftrag, die Kirche<br />
mit biblischen Motiven<br />
auszumalen. Bibelszenen<br />
mit Spruchbändern sind in<br />
der gesamten Kirche zu<br />
finden. Mit dem üppigen<br />
Pyramidenkanzelaltar vermutlich<br />
nach dem Vorbild<br />
der „Himmelsburg“ in der<br />
<strong>Weimar</strong>er Schlosskapelle<br />
und der original erhaltenen Malerei von Holztonne und doppelter<br />
Emporenreihe ist sie ein Kleinod unter der Thüringer Dorfkirchen.<br />
Die Kirche liegt ebenfalls am Feininger-Radweg.<br />
<strong>0000</strong>_<strong>offenes</strong>_<strong>Denkmal</strong>_<strong>2007.indd</strong> <strong>11</strong> <strong>15.08.2007</strong> <strong>11</strong>:<strong>47</strong>:59 Uhr
1.14 Stephanuskirche in Schöndorf<br />
Am Ausläufer des kleinen Ettersberges, mit sichtbarer Verbindung<br />
zum großen Ettersberg und der Gedenkstätte Buchenwald, liegt<br />
Schöndorf. Am 25.6.1964 wurde der Grundstein zu dem kleinen,<br />
modernen Kirchenbau inmitten gepflegter Obstbaumpflanzungen<br />
gelegt. Der Eisenacher Architekt Klaus Kaufmann suchte in<br />
seiner Gestaltung bewusst den Bezug zum Konzentrationslager<br />
Buchenwald. Farben und Formen erinnern an Gewalt, Intoleranz,<br />
Leid und Tod, zeigen aber auch den Weg der Hoffnung und<br />
Überwindung. Der Grundriss der Kirche ist wie ein Schiff gestaltet<br />
entsprechend dem alten Bild von der Gemeinde, die hier sicher<br />
und geborgen auf ihren Herrn wartet. Die Orgel wurde 1966 von<br />
der Orgelbaufirma Rudolf Böhm aus Gotha gebaut.<br />
1.16 Dorfkirche in Süßenborn<br />
Der Ort „Suzepurnum“ wurde im Jahre <strong>11</strong>50 erstmals urkundlich<br />
erwähnt. Der schmale Ostturm mit romanischen Schallöffnungen<br />
und Spuren eines ehemaligen Apsisanbaues sind Zeugnisse aus<br />
dieser Zeit. In den Jahren 1820–1821 wurde das Gotteshaus nach<br />
Plänen des <strong>Weimar</strong>er Baumeisters Clemens Wenzeslaus Coudray<br />
umfassend erneuert.<br />
3 Katholische Kirche „Herz-Jesu“,<br />
<strong>Weimar</strong><br />
Blick in die Kuppel<br />
„Ich schwärme zwar nicht für Kirchen in italienischer Renaissance<br />
in unserer Gegend und unserem Klima, aber ich getraue mir doch<br />
einen Plan zu machen, den der Großherzog für Renaissance ansieht,<br />
mit Kuppel und seitwärts stehendem Turms.<br />
… Warum sollte man da nicht etwas Schönes und schön gruppiertes<br />
machen können.“<br />
Mit diesen Worten ergab sich der Architekt und Baumeister Max<br />
Meckel aus Frankfurt a. M. im Februar 1888 in den Wunsch des<br />
<strong>Weimar</strong>er Großherzogs Carl Alexander, den geplanten Bau der<br />
Katholischen Kirche in früher florentinischer Renaissance auszuführen.<br />
Zu Beginn der Bauphase 1889 stand die Schwierigkeit des morastigen<br />
Baugrundes. Der <strong>Weimar</strong>er Bauunternehmer Röhr gründete<br />
die Fundamente der Katholischen Kirche auf 51 Pfeiler von 6–7 m<br />
Tiefe, die über Erdbögen verbunden werden mussten. Danach ging<br />
der Bau rasch voran. Und bereits am 27. September 1891 wurde<br />
die Kirche konsekriert.<br />
Die Gestaltung sowohl der Architektur als auch der Ausstattung des<br />
Innenraumes erfolgte im neugotischen Stil. Aus der Mayer’schen<br />
Hof-Kunstanstalt München stammen die beiden Altarbilder, die Fi-<br />
<strong>0000</strong>_<strong>offenes</strong>_<strong>Denkmal</strong>_<strong>2007.indd</strong> 12 <strong>15.08.2007</strong> <strong>11</strong>:48:00 Uhr
guren der Hl. Maria und des Hl. Josef sowie die Reliefs des Kreuzweges.<br />
Die Rechnung der Glaskunst-Werkstatt Gebr. Ely (Kassel)<br />
vom 3. Juli 1891 für die Herstellung der farbigen Kirchenfenster ist<br />
noch heute im Archiv der Kirchengemeinde zu finden.<br />
7 St. Albani in Gaberndorf<br />
Eine hohe, alte Feldsteinmauer umgibt Pfarrhaus und Kirche<br />
in Gaberndorf. Sie gibt dem Ensemble eine ungewöhnliche Geschlossenheit.<br />
Die Sandsteintafel neben der Toreinfahrt zeigt die<br />
Jahreszahl 1502 als Einweihungsjahr des Gotteshauses. Der außergewöhnliche<br />
Turmaufsatz, eine Zwischenform von Haube und<br />
Helm, wurde von <strong>Weimar</strong>er Malern häufig als Motiv gewählt.<br />
13 Staatliche Regelschule Parkschule in<br />
<strong>Weimar</strong><br />
Das Gebäude der heutigen Parkschule, zuvor Johann-Peter-Eckermann-Schule,<br />
wurde im Jahre 1877/1878 als Sophienstift von dem<br />
Architekten Karl Vent als ein Lehr- und Internatsgebäude für Mädchen,<br />
als Oberlyzeum im Auftrag der Großherzoglichen Regierung<br />
in <strong>Weimar</strong> erbaut.<br />
Es wurde nach dem Abbruch der Federwischmühle und dazugehöriger<br />
Nebengebäude, die sich seit dem 15. Jahrhundert dort befanden,<br />
an selbiger Stelle errichtet.<br />
Das Gebäude ist neben dem Landesmuseum der repräsentativste<br />
Vertreter der Neorenaissance-Architektur in <strong>Weimar</strong> und steht im<br />
Zentrum der Stadt an einer städtebaulich wichtigen Platzsituation.<br />
Das Gebäude der Parkschule befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft<br />
zum Gebäude der heutigen Christoph-Martin-Wieland-<br />
Schule, die 1877 als Großherzogliches Lehrerseminar an dem gemeinsamen<br />
Standort errichtet wurde. Beide Schulgebäude nutzen<br />
auch gemeinsame Freiflächen.<br />
1920 ging das Gebäude in städtischen Besitz über.<br />
Zur Zeit der <strong>Weimar</strong>er Republik diente es von Januar bis August<br />
1919 den Zwecken der nach <strong>Weimar</strong> verlegten Nationalversammlung<br />
(Fernsprechamt, Presseräume, Schutzwache).<br />
Von 1945 bis 1990 beherbergte das Gebäude eine Allgemeinbildende<br />
Polytechnische Oberschule.<br />
Nach der Innensanierung wird es als Staatliche Regelschule mit<br />
einem Ganztagsangebot genutzt.<br />
Die Parkschule hat durchschnittlich 17 Klassen in den Klassenstufen<br />
5 bis 10.<br />
Das Gebäude der Parkschule ist in die <strong>Denkmal</strong>liste des Freistaates<br />
Thüringen als Einzeldenkmal eingetragen.<br />
Der als Solitär angelegte Baukörper besteht aus einem 3-geschossigen<br />
Hauptgebäude und zwei im Osten und Westen angegliederten<br />
2-geschossigen Seitenflügeln, die jeweils über Verbinderbauten<br />
erschlossen werden.<br />
Aufgrund der langen und intensiven Nutzung als Schulgebäude<br />
und eines andauernden Unterhaltungsstaus waren alle Innenräume<br />
in einem äußerst schlechten baulichen Zustand. Die Baumaßnahmen<br />
betrafen daher sowohl die Oberflächen und teilweise die<br />
Konstruktionen sowie die Bekleidungen von Wänden, Fußböden<br />
<strong>0000</strong>_<strong>offenes</strong>_<strong>Denkmal</strong>_<strong>2007.indd</strong> 13 <strong>15.08.2007</strong> <strong>11</strong>:48:00 Uhr
und Decken, die Innen- und die Außentüren und diverse Einbauten<br />
und Ausstattungen als auch alle Ver- und Entsorgungsleitungen,<br />
die haustechnischen Installationen und Anlagen von Heizung,<br />
Lüftung, Sanitär, Elektro- und Sicherheitstechnik. In Teilbereichen<br />
von Decken und Dächern mussten zudem Sanierungsmaßnahmen<br />
aufgrund des Auffindens von Echtem Hausschwamm erfolgen.<br />
Einen wesentlichen Schwerpunkt für die weitere Nutzung als Schulgebäude<br />
stellte die Realisierung des baulichen Brandschutzes, insbesondere<br />
die denkmalverträgliche Schaffung der erforderlichen<br />
Rettungswege im Gebäude dar. Neben dem Umbau der Treppen<br />
in den beiden Verbindungsbaukörpern zu den Seitenflügeln zu<br />
notwendigen Treppenräumen, dem Einbau einer flächendeckenden<br />
Brandmeldeanlage sowie vielfältiger brandschutztechnischer<br />
Maßnahmen wurde das historische Haupttreppenhaus durch den<br />
Einbau einer Überdruck-Spüllüftungsanlage brandschutztechnisch<br />
ertüchtigt und als erster Rettungsweg aufgewertet.<br />
Das Hauptgebäude wird durch einen mittig zum Gebäude befindlichen<br />
Haupteingang von der Platzseite her betreten. Über einen<br />
Entreebereich gelangt man in das historische Herzstück des Gebäudes,<br />
das zentral gelegene repräsentative offene Treppenhaus<br />
mit einer symmetrisch angelegten, massiven dreiläufigen Treppenanlage<br />
und den umlaufenden Erschließungsfluren.<br />
Das Hauptgebäude steht mit 3 Vollgeschossen hauptsächlich dem<br />
Unterricht mit großzügigen Klassenzimmern, Fachunterrichts- und<br />
Vorbereitungsräumen sowie neu gestalteten Sanitärbereichen zur<br />
Verfügung.<br />
Neben dem historischen Treppenhaus sind die Aula im Erdgeschoss<br />
und die benachbarten ehemaligen Salonräume von besonderer<br />
denkmalpflegerischer Bedeutung aufgrund ihrer noch gut<br />
erhaltenen reichen Stuckornamentik an Wänden und Decken und<br />
dem erneuerten Tafelparkettboden.<br />
Außer dem Jugendclub befinden sich im Kellergeschoss des<br />
Hauptgebäudes die Räume für die haustechnischen Anlagen und<br />
weitere Abstellräume.<br />
Im Erdgeschoss des Ostflügels befindet sich ein Speise- und Aufenthaltsbereich<br />
für Schüler, die Ausgabeküche sowie ein Unterrichtsraum<br />
Hauswirtschaft. Im Obergeschoss sind die Schulleitung,<br />
die Lehrerzimmer sowie ein Elternsprech- und Sanitätsraum untergebracht.<br />
Im Untergeschoss sind neben Technik- und Abstellräumen<br />
die Unterrichtsräume Werken Ton / Keramik angeordnet.<br />
Im Untergeschoss der Turnhalle sind ein großer Unterrichtsraum<br />
Werken Metall / Holz sowie der dazugehörige Vorbereitungsraum<br />
untergebracht. Weiterhin befinden sich hier die neuen Umkleide-<br />
und Sanitärräume für den Sportunterricht.<br />
Der vorhandene Turnhallenraum im Erdgeschoss wird als Sport-<br />
und Mehrzweckraum genutzt und wurde vollständig neu gestaltet.<br />
14 Christoph-Martin-Wieland-<br />
Grundschule<br />
Das Gebäude der heutigen Christoph-Martin-Wielandschule wurde<br />
in den Jahren 1875 bis 1877 als Großherzogliches Lehrerseminar<br />
errichtet. Architekt war Karl Vent, der im Jahre 1888 auch das in<br />
unmittelbarer Nähe liegende Sophienstift (heute Johann-Peter-<br />
Eckermann-Schule) baute.<br />
Das Lehrerseminar ist, wie fast alle im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts<br />
in <strong>Weimar</strong> errichteten öffentlichen Gebäude im Stil des<br />
Historismus, speziell der Neorenaissance gestaltet.<br />
Das dreigeschossige Gebäude ist im Baukörper, den Fassaden und<br />
der Grundrissstruktur streng symmetrisch aufgebaut. Auf einem<br />
ca. 80 cm hohen Travertinsteinsockel mit dreiviertelkreisförmigem<br />
Rundstab als Sockelabschluss lagert das bandförmig rustizierte<br />
Erdgeschoss mit gleichmäßig gereihten Rundbogenfenstern und einem<br />
breiten Gurtgesims. Darüber bauen sich über zwei Geschosse<br />
die glattgeputzten Lochfassaden mit zwei Fensterreihen auf.<br />
Im mittleren Trakt der Schule sind die Eingänge, das Treppenhaus<br />
und die sich über zwei Geschosse erstreckende Aula untergebracht.<br />
Dieser Gebäudeteil mit den Hauptfunktionsräumen erfährt<br />
<strong>0000</strong>_<strong>offenes</strong>_<strong>Denkmal</strong>_<strong>2007.indd</strong> 14 <strong>15.08.2007</strong> <strong>11</strong>:48:00 Uhr
als plastisch abgesetzter Mittelrisalit mit reicher Detailvielfalt eine<br />
besondere gestalterische Beachtung. Der Mittelrisalit ist über der<br />
rustizierten Erdgeschosszone mittels<br />
Einfach- und Doppelpilastern in drei Felder geteilt und zum Dach<br />
hin mit einem betont breitem Attikagesims abgeschlossen. In diese<br />
drei Felder sind die drei hohen Fensterpaare der Aula untergebracht.<br />
Eindrucksvoll ist das Fenstermotiv gestaltet aus einer<br />
Zweiergruppe von Rundbogenfenstern mit seitlichen Pilastern und<br />
einer Mittelsäule. Ein zusätzlicher Rundbogen fasst das Fensterpaar<br />
zusammen und bietet in seinem Bogenfeld Platz für ein kreisförmiges<br />
Fenster.<br />
Die Hoffassade des Schulgebäudes ist wesentlich zurückhaltender<br />
gestaltet. Hier stellen sich die seitlichen Gebäudetrakte ohne<br />
Fenster als glatt geputzte Wände dar, die durch das Gurtgesims<br />
über dem Erdgeschoss horizontal unterteilt werden und durch die<br />
rustizierten Ecklisenen seitlich gefasst sind.<br />
Die Fassaden des Treppenhauses auf der Hofseite waren durch<br />
den Hofanbau aus dem Jahre 19<strong>11</strong> und den Änderungen im abgeschleppten<br />
Dachbereich nicht mehr in ursprünglicher Form erhalten.<br />
Im Rahmen der Sanierung 2005 wurde der hofseitige Anbau abgebrochen<br />
und die Fassade in ihre ursprüngliche Ansicht zurückgeführt.<br />
<strong>0000</strong>_<strong>offenes</strong>_<strong>Denkmal</strong>_<strong>2007.indd</strong> 15 <strong>15.08.2007</strong> <strong>11</strong>:48:00 Uhr
Texte, Textmitarbeit, Abbildungs- und<br />
Quellenverzeichnis<br />
(in Reihenfolge der Programmpunkte)<br />
1.1 bis 1.16<br />
Pfarrer Herr Dr. Hiddemann, Pastorin Frau Berlich<br />
3 Katholische Pfarrgemeinde, Frau Herzog<br />
7 Pfarrer Herr Dr. Hiddemann, Pastorin Frau Berlich<br />
13 Architektengemeinschaft Habelmann + Habelmann<br />
14 Architekt Herr Rämmler<br />
Herausgeber Stadt <strong>Weimar</strong><br />
Stadtverwaltung <strong>Weimar</strong>, Schwanseestraße 17, 99423 <strong>Weimar</strong><br />
Dezernat I<br />
Stadtentwicklungsamt / Abteilung <strong>Denkmal</strong>schutz –<br />
Untere <strong>Denkmal</strong>schutzbehörde<br />
Wir danken allen an der Vorbereitung und Durchführung beteiligten<br />
Kirchengemeinden, engagierten Interressenten, Eigentümern,<br />
Vereinen, Kultureinrichtungen, Planungsbüros und Behörden.<br />
Gesamtherstellung: Gutenberg Druckerei GmbH <strong>Weimar</strong><br />
<strong>0000</strong>_<strong>offenes</strong>_<strong>Denkmal</strong>_<strong>2007.indd</strong> 16 <strong>15.08.2007</strong> <strong>11</strong>:48:00 Uhr