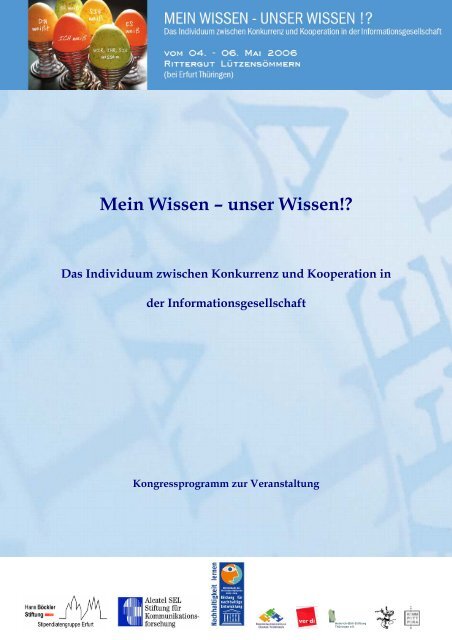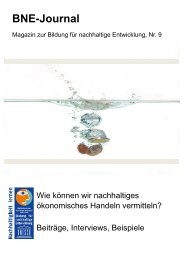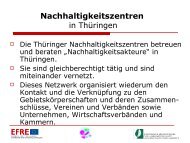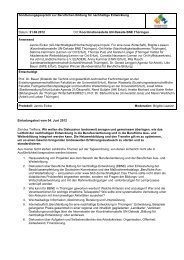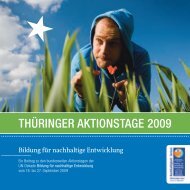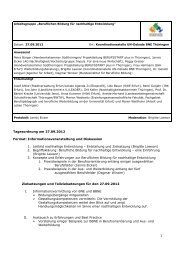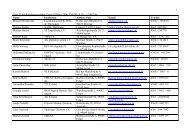Tagungsunterlagen (PDF, 380 KB) - Dekade Thüringen
Tagungsunterlagen (PDF, 380 KB) - Dekade Thüringen
Tagungsunterlagen (PDF, 380 KB) - Dekade Thüringen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
Das Individuum zwischen Konkurrenz und Kooperation in<br />
der Informationsgesellschaft<br />
Kongressprogramm zur Veranstaltung
Impressum:<br />
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
StipendiatInnengruppe Erfurt Hans-Böckler-Stiftung<br />
c/o Rita Herwig<br />
mail: RitaHerwig@web.de<br />
www.boeckler-stipendiaten-erfurt.de<br />
Verbundkolleg Berlin Alcatel SEL Stiftung<br />
www.verbundkolleg-berlin.de<br />
www.stiftungaktuell.de<br />
2
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
Der Studierendenkongress wurde im Januar 2006 nach erfolgtem Auswahlverfahren als offizielles<br />
Event der UN-Weltdekade Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ausgezeichnet.<br />
Der Studierendenkongress ist eine Veranstaltung der StipendiatInnengruppe Erfurt der<br />
Hans-Böckler-Stiftung und des Stiftungsverbundkollegs Informationsgesellschaft Berlin<br />
der Alcatel SEL Stiftung.<br />
Konzeptionell basiert die Veranstaltung auf der Verbindung von wissenschaftlichen, praktischen<br />
und künstlerischen Anteilen. Konkurrenz und/oder Kooperation? Unter diesem<br />
Kontext werden zu den Schwerpunkten Medien, Arbeitswelt, Bildung übergreifende Fragestellungen<br />
thematisiert und diskutiert. Begleitend zu den Vorträgen findet ein Kunstworkshop<br />
statt. Darüber hinaus stellen sich innovative selbstorganisierte Praxisprojekte<br />
vor.<br />
Unterstützt wird die Veranstaltung von folgenden Kooperationspartnern:<br />
Landesbezirksfachbereich 5 (Bildung, Wissenschaft, Forschung) der ver.di <strong>Thüringen</strong>,<br />
Sachsen und Sachsen-Anhalt; Koordinationsstelle <strong>Dekade</strong> <strong>Thüringen</strong>; Heinrich Böll Stiftung<br />
<strong>Thüringen</strong>; Bildungsstätte/Tagungshaus Rittergut e.V. Lützensömmern; KommPott-<br />
Pora e.V. Gotha<br />
3
Inhaltsverzeichnis<br />
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
UN-Weltdekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“ – Zur UN-Weltdekade<br />
Michael Brodowski<br />
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
Das Individuum zwischen Konkurrenz und Kooperation in der Informationsgesellschaft<br />
Zum Kongress<br />
Prof. Dr.-Ing. Klaus Rebensburg<br />
Multimediale Kommunikation ohne Grenzen?<br />
Informationsgesellschaft zwischen Anspruch und Wirklichkeit<br />
Prof. Dr.-Ing. Klaus Rebensburg<br />
»Lifestyle-TV« und Alltagsleben<br />
Zur Formierung von Selbst- und Weltauffassungen in einer Medienkultur<br />
Jun.-Prof. Dr. Tanja Thomas<br />
"Glotzt nicht so romantisch"<br />
Der Mythos der Medien als Methodologie des Studienerfolges<br />
Ein interaktiver Diskurs über den Entfremdungseffekt an den Hochschulen<br />
Dr. Wolf Siegert<br />
Innovation durch Kooperation<br />
Zur Bedeutung organisationalen Lernens für die Arbeitswelt von morgen<br />
Dr. Jan Schilling<br />
Erfolgreiche Karrieren –<br />
Voraussetzungen und Konsequenzen<br />
Prof. Dr. Heinz Mandl<br />
Lernen neben der Schule – Informelle Bildung im modernen Jugendalltag<br />
Prof. Dr. Claus J. Tully<br />
Workshop Kunst<br />
Mario Leibner (JKL)<br />
Aus der Praxis / Selbstorganisierte Initiativen und Netzwerke 17<br />
Über den Tellerrand – Kooperation oder Konkurrenz „Die Zukunft gestalten, aber wie?“<br />
Zur Abschlussdiskussion<br />
Michael Brodowski<br />
Thesen / Statements zur Abschlussdiskussion<br />
Prof. Dr. Bernd Overwien<br />
Günther Reißmann<br />
Michael Brodowski<br />
Prof. Dr.-Ing. Klaus Rebensburg<br />
Verzeichnis der ReferentInnen 27<br />
4<br />
5<br />
6<br />
8<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
23<br />
25
Zur UN-Weltdekade<br />
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
Michael Brodowski<br />
UN-Weltdekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“<br />
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist Teil einer übergreifenden Bildungsaufgabe<br />
mit der Intention, bei der breiten Bevölkerung, insbesondere der heranwachsenden Generation,<br />
zur Humanisierung der Lebensverhältnisse und zu einem verständigen Umgang<br />
mit der Lebenswelt beizutragen. Von der UNESCO wurde von 2005 – 2014 die Weltdekade<br />
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgerufen. Alle Länder wurden zur Beteiligung<br />
aufgefordert. Deutschland nimmt seit 2005 - mit dem Bekenntnis der deutschen U-<br />
NESCO Kommission und der Bildung des Runden Tisches - diese Herausforderung an.<br />
Ziel ist es, einen vitalen Beitrag zur Entwicklung einer nachhaltigen Gesellschaft zu leisten,<br />
ohne eine "Verzweckung des Individuums" - also eine Instrumentalisierung für ein fixes<br />
Ideal – zu Grunde zu legen. Dies baut auf dem Paradigma der nachhaltigen Entwicklung<br />
auf, „den gegenwärtigen Bedarf zu decken, ohne Fähigkeiten kommender Generationen<br />
zu schmälern, ihre Bedürfnisse zu befriedigen“.<br />
Für die Umsetzung der Bildung für nachhaltige Entwicklung gibt es kein allgemein verwendbares<br />
Schema. Es ist ein Prozess der partizipativen Entwicklung von Bildungs- und<br />
Vermittlungsmodellen, aber auch der Träger übergreifenden Schaffung optimaler Rahmenbedingungen<br />
für lebenslanges, informelles sowie selbstorganisiertes Lernen. Das<br />
Konzept der nachhaltigen Entwicklung ist dynamisch, daher erfordert auch die Bildung<br />
eine dynamische und mitbestimmte Herangehensweise. Endgültige Antworten sind nicht<br />
zu erwarten, wohl aber Formen kooperativer Weiterentwicklung, Diskurse und Debatten,<br />
etwa über die Zukunft der Bildung unter Einbeziehung breiter Bevölkerungsschichten.<br />
Unbestritten ist, dass nachhaltige Entwicklung eine Neuorientierung der Bildung erfordert,<br />
die den Wandel in Richtung Nachhaltigkeit unterstützt. Bildung für nachhaltige<br />
Entwicklung ist eine Chance, die bildungstheoretischen Prämissen der Offenheit, Reflexivität,<br />
Mitbestimmung und Zukunftsfähigkeit in interdisziplinäre Prozesse zu integrieren.<br />
Besonders Selbstbestimmung und verantwortungsvolles Mitgestalten stellen einen inhärenten<br />
Bestandteil dieser Neuorientierung dar.<br />
Gelernt (auch informell, selbstorganisiert!) und ausprobiert werden sollen vor allem Modelle<br />
des reflektierten Handelns (Handlungskompetenz), Gestaltens (Gestaltungskompetenz),<br />
Reflektierens (Reflexionskompetenz) und begründeten Argumentierens (Argumentationskompetenz).<br />
Diese Prozesse unterstützend sollen zudem Formen informellen,<br />
selbstorganisierten, kooperativ/ kollektiven und organisationalen Lernens entwickelt<br />
werden. Das stellt eine besondere Herausforderung für die Wissenschaft dar, die durch interdisziplinäre<br />
Forschung jedoch wichtige Grundlagen liefern kann.<br />
Insofern trägt der II. Studierendenkongress „Mein Wissen - unser Wissen!?“ mit Berechtigung<br />
das UN-Siegel und die Auszeichnung als offizielles Event der UN-Weltdekade „Bildung<br />
für nachhaltige Entwicklung“.<br />
5
Zum Kongress<br />
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
Prof. Dr.-Ing. Klaus Rebensburg<br />
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
Offensichtlich sind nun „alle“ in der Informationsgesellschaft angekommen. Zumindest<br />
vermuten wir das leichtfertig von den hier Anwesenden. Das Motto des Kongresses „Das<br />
Individuum zwischen Konkurrenz und Kooperation in der Informationsgesellschaft“<br />
scheint auf den ersten Blick unsere eigenen Positionen zu treffen. Und wenn wir real und<br />
virtuell zwischen den beiden Alternativen Konkurrenz und Kooperation hin- und hertreiben,<br />
dann bewegen uns Beschleunigungskräfte, die bestehende gesellschaftliche Strukturen<br />
erschüttern – so wie es auch beim Wechsel zur Industriegesellschaft geschah. Die Informationsgesellschaft<br />
mit einem allgegenwärtigen Kommunikationsnetzwerk, mit einer<br />
abnehmenden Halbwertszeit für die Relevanz von Information prägt unsere medienbestimmte<br />
Kultur, unsere Wirtschaft, unser soziales Leben.<br />
Da lohnt sich eine erneute Wertebestimmung für Kooperation - einerseits unabhängig von<br />
gesellschaftlichen Gegebenheiten, andererseits aber auch neues, gemeinsames Handeln<br />
angesichts der Strukturveränderungen mit neuen Parametern der Gleichberechtigung,<br />
Freiheit und Emanzipation.<br />
Das durchgängige Prinzip der Digitalisierung und Fragmentierung verleiht Macht dem<br />
Mächtigen, aber auch Macht und Möglichkeiten dem Individuum. So bietet es sich an, angesichts<br />
der Segnungen und Flüche fortgeschrittener Informationstechnik Werte und Unwerte<br />
der Konkurrenz neu zu bestimmen, die angeblich profitiert von neuen anregenden,<br />
inspirierenden und spielerischen virtuellen Möglichkeiten oder mächtiger und wirkungsvoller<br />
denn je virtuell organisiert werden kann.<br />
Zum Auftakt des Kongresses spannen wir zunächst einen Bogen von diesen generellen Betrachtungen<br />
zu einzelnen Beiträgen und gehen dann ausführlicher auf den Schlüssel zur<br />
Informationsgesellschaft, die „Multimediale Kommunikation ohne Grenzen“ ein. Über die<br />
Bedeutung des Wortes „Grenzen“ wird zu reden sein, ebenso sprechen wir über Multimedia,<br />
den Betrug der Bilder, die Explosion der Datenmengen und das durchgängige Prinzip<br />
digitaler Fragmentierung und stoßen zwangsläufig auf Konvergenzen und Divergenzen<br />
der Wirklichkeiten und Ansprüche. Zwangsläufig landen wir auch bei Triumphen und<br />
Katastrophen der Informationsgesellschaft, insbesondere ihrer Technologien und Wertemaßstäbe<br />
und regen Sie an, über Auswirkungen auf gesellschaftliche Konzepte, Politik,<br />
Ökonomie, Arbeit, Technik, Wissen/Medienethik und Recht – oder was auch immer Sie<br />
bewegt – im Verlaufe des Kongresses weiter nachzudenken und sich auszutauschen.<br />
6
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
Eröffnungsvorträge / Fachforen<br />
Donnerstag, 04.05. und Freitag, 05.05.2006<br />
Abstracts<br />
7
Abstract<br />
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
Prof. Dr.-Ing. Klaus Rebensburg<br />
Multimediale Kommunikation ohne Grenzen?<br />
Informationsgesellschaft zwischen Anspruch und Wirklichkeit<br />
Next Generation Information Society - Informationsgesellschaft -, irgendetwas<br />
treibt uns, die Begrifflichkeiten der Generation „Industriegesellschaft“ hinter uns<br />
zu lassen und auf etwas Neues hinzuweisen. Und tatsächlich, es gibt eine Häufung<br />
ungewöhnlicher Nachrichten und Dinge, so dass wir seit einiger Zeit von etwas<br />
Neuem sprechen dürfen. Unsere „neue Zeit“ ist geprägt durch:<br />
• Übersicht über scheinbar unendliche Datenmengen,<br />
• Beherrschung einer unüberschaubaren Komplexität von Zusammenhängen per<br />
Computer in Form von Benutzungsschnittstellen, Anwendungs-Software, Datenbanken,<br />
• scheinbar grenzenlose Transportmöglichkeit von Daten an jeden auch mobilen<br />
Ort zu jeder Zeit (das Internet),<br />
• den Siegeszug von Mehrwerten, der sich durch lokal und weltweit vernetzte Kooperation<br />
ergibt,<br />
• digitale Integration sämtlicher existierender Sensorik und Aktorik über die obigen<br />
digitalen Wirkungskreise, ob für die Gesundheit im Körper des Menschen,<br />
ob für Sicherheit und Komfort im Auto, ob für die Kassierer der Autobahn-Maut,<br />
für Mobbing, Krieg und Vernichtung, zur Nordpolerforschung oder zur Filmproduktion<br />
und für Kunstwerke sowie nicht zu vergessen:<br />
• umfassende digitale Erschließung von Text, Bild, Bewegtbild und Ton und damit<br />
die Nutzbarkeit aller hier genannten Errungenschaften auch für Medien, sei es<br />
zur Erzeugung von Emotionen, zur Beeinflussung von Bürgern, zur Bildung der<br />
Gesellschaft oder zum Geldverdienen.<br />
Das scheint sich alles grenzenlos und in einer gewissen „Beliebigkeit“ zu entwickeln,<br />
aber die Wirkungen sind in vielen Bereichen des Lebens konkret und nachhaltig<br />
fühlbar. Diese „Beliebigkeit“ hat Änderungen in einem Maße zur Folge, so<br />
dass wir vor weiteren großen Herausforderungen stehen - als wenn der Globus<br />
nicht genug mit Problemen, Katastrophen und Ungerechtigkeiten alleine der Industriegesellschaft<br />
gebeutelt würde. Eingetretene Wirklichkeiten der Informationsgesellschaft<br />
scheinen Individuen, Gruppen, gesellschaftliche Akteure und Regierungen<br />
in nie da gewesener Intensität zu fördern aber, auch zu fordern. Einige<br />
sprechen von Überforderung durch zu raschen Wertewandel und mahnen die ge-<br />
8
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
zielte Verlangsamung an, anderen kann es nicht schnell genug gehen. Woraus<br />
schließen wir eigentlich, dass Menschen die Informationsgesellschaft genau mit ihren<br />
eigenen Entwicklungen bewältigen können – nämlich mit dem virtualisierten,<br />
vernetzten und automatisch verwaltbar gemachten Wissen, das in seiner Wirkung<br />
scheinbar allmächtig und segensreich sein soll? Wird der Anspruch an die sogenannte<br />
Wissensgesellschaft in eine neue „ Wirklichkeit“ führen? Mit neuen Kompetenzen?<br />
Mit neuen Qualitäten der Kooperation oder Konkurrenz? Ihr Mitwissen<br />
und Mitwirken ist gefragt!<br />
9
Abstract<br />
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
Jun.- Prof. Dr. Tanja Thomas<br />
»Lifestyle-TV« und Alltagsleben<br />
Zur Formierung von Selbst- und Weltauffassungen in einer Medienkultur<br />
Häufig wird die grundlegende Annahme vertreten, dass mediale Unterhaltungsangebote<br />
in „postmodernen Gesellschaften“ immer mehr an die Stelle der direkten eigenen<br />
Erfahrung treten und Selbst- und Weltauffassungen prägen. Tatsächlich gilt<br />
es inzwischen als kommunikations-, medien-, kulturwissenschaftlicher wie (medien-)soziologischer<br />
Gemeinplatz, dass Medien generell bei der sozialen Organisation<br />
und Strukturierung des Alltags unterstützen, dass sie einstimmen auf verschiedene<br />
Phasen des Alltags, dass sie individuelle Lebensläufe mit dem „Alltag“<br />
der Gesellschaft synchronisieren oder etwa helfen, Belastungen und Konflikte zu<br />
bewältigen und die Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern und den Geschlechtern<br />
zu regeln. Das Fernsehen beispielsweise dient als Zeitkoordinator, Gemeinschaftsstifter,<br />
Lieferant von Themen und Ansichten, Hilfe zur Konfliktvermeidung<br />
– aber auch als Mittel der Abgrenzung von „den anderen“, als Status- und<br />
Rollenmerkmal, als Kampffeld um individuelle Rechte und Selbstständigkeit – und<br />
ist so beteiligt an der (Re-) Produktion sozialer Beziehungen und Verhältnisse.<br />
Vor diesem Hintergrund wurde bereits gefordert, TV-Genres als Teil einer umfassenden<br />
(neoliberalen) Machttechnologie zu analysieren: Es wird konstatiert, dass<br />
etwa Genres des Reality-TV dazu beitragen, einen erwünschten Umgang mit sich<br />
‚Selbst’, Modelle ‚normaler‘ Subjektivität und akzeptabler Auffassung von Welt (inklusive<br />
bestimmter Ungleichheiten) zu produzieren. Wenn deren Verbreitung und<br />
Akzeptanz ohne Analysen medialer Angebote und ihrer Aneignung nicht mehr zu<br />
verstehen sind, so müssen empirische Untersuchungen – beispielsweise aktueller<br />
Unterhaltungsformate – rückgebunden werden an die Analyse zeitgenössischer,<br />
gesellschaftlich dominanter Diskurse, in denen u.a. Konkurrenz, Selektion und Kooperation<br />
als Paradigmen bezeichnet werden können. Vor diesem Hintergrund<br />
werde ich exemplarisch (transnational verbreitete, hier an den deutschen Markt<br />
spezifisch angepasste) Unterhaltungsformate – konkret die Modelshow „Germany’s<br />
next Top Model“, die OP- bzw. Makeover-Show „The Swan“ und die<br />
Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – als Modi der Vergesellschaftung<br />
im Zeitalter des Neoliberalismus interpretieren und freue mich auf angeregte Diskussionen<br />
mit den TeilnehmerInnen der Konferenz.<br />
10
Abstract<br />
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
Dr. Wolf Siegert<br />
"Glotzt nicht so romantisch"<br />
Der Mythos der Medien als Methodologie des Studienerfolges<br />
Ein interaktiver Diskurs über den Entfremdungseffekt an den Hochschulen<br />
Als Medienexperte und -nutzer stellt sich der Referent einer besonderen Herausforderung:<br />
über die Medien, ihre Nutzung und ihren Nutzen zu reden, ohne diese<br />
im Vortrag selber einzusetzen. Jenseits jeglicher Power-Point-Pointen soll hier hic et<br />
nunc, jetzt und vor Ort, versucht werden, einen Diskurs zu entfalten, in dem das<br />
Ritual von Vortrag und Fragen vom Kopf auf die Füße gestellt werden kann. Die<br />
für den Vortrag vorbereiteten Thesen zur selbst gestellten Frage: "Medien: Mediatoren<br />
oder Methadon?" sollen möglichst als Erfahrungswissen entfaltet werden - will<br />
sagen, sie sollen nach Möglichkeit Antworten stimulieren, die auch latent für das<br />
Auditorium von Bedeutung sind. Also sind alle Interessierte, Neugierige, Ungeduldige,<br />
..., eingeladen, auch ihre Fragen schon vorab zu stellen. Gemäß dem Motto:<br />
„Wer nicht fragt, der nicht gewinnt!“ kann man dieses schon vorab per Mail tun<br />
an "wolf.siegert@iris-media.com" oder noch mit einem Zettel direkt vor Ort. Ja,<br />
selbst während der Vortrages ist es gestattet, per SMS zu intervenieren. In der<br />
Spannung zwischen der Aufgabe, einen "schönen Vortrag" zu halten (Methadon)<br />
und/oder einen Dialog vor und mit dem Auditorium zu inszenieren (Mediation)<br />
wird das Thema der Medien selbst zum "Kino im Kopf": "Verehrtes Publikum, los,<br />
such dir selbst den Schluss! Es muss ein guter da sein, muss, muss, muss!" *)<br />
*) Brecht: "Der gute Mensch von Sezuan." Epilog, 1938.<br />
11
Abstract<br />
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
Dr. Jan Schilling<br />
Innovation durch Kooperation<br />
Zur Bedeutung organisationalen Lernens für die Arbeitswelt von morgen<br />
Die Forschung und Literatur zum Thema organisationales Lernen ist in weiten Teilen<br />
von einem stark optimistischen Grundton in Bezug auf die Möglichkeiten und<br />
Effekte von Lernen im Unternehmen gekennzeichnet. Strategien, Strukturen und<br />
Werte zur Unterstützung von organisationalem Lernen könnten bei entsprechender<br />
Einbeziehung aller Organisationsmitglieder (leicht) implementiert werden und erbrächten<br />
entsprechend positive Ergebnisse für Unternehmen (z.B. innovative Produkte<br />
und Prozesse, erhöhte Produktivität, Qualität und Marktanteile) und Mitarbeiterschaft<br />
(z.B. interessantere Tätigkeiten, zusätzliche Qualifikation, Aufstiegschancen).<br />
Dieser teilweise naive Optimismus verhindert die notwendige Auseinandersetzung<br />
mit den Hindernissen und Barrieren, die bei der Gestaltung organisationaler<br />
Lernprozesse zu beachten gilt. Im Rahmen des Vortrags sollen zunächst<br />
das Verhältnis der Begriffe ‚Lernen’ und ‚Organisation’ betrachtet, organisationales<br />
von individuellem Lernen abgegrenzt und die Beziehung von organisationalem<br />
Lernen und lernenden Organisationen geklärt werden. Davon ausgehend wird ein<br />
Modell des organisationalen Lernzyklus und den daran beteiligten sozialpsychologischen<br />
und mikropolitischen Prozessen vorgestellt. Im Weiteren werden anhand<br />
dieses Modells sieben Barrieren organisationalen Lernens (learning under ambiguity,<br />
role-constrained learning, audience learning, fragmented learning, superstitious<br />
learning, situational learning, opportunistic learning) und hierzu beitragende Faktoren<br />
im Spiegel von Theorie und empirischer Forschung vorgestellt. In der abschließenden<br />
Diskussion wird auf Implikationen des Modells für die zukünftige<br />
Forschung und Unternehmenspraxis hingewiesen.<br />
12
Abstract<br />
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
Prof. Dr. Heinz Mandl<br />
Erfolgreiche Karrieren –<br />
Voraussetzungen und Konsequenzen<br />
Ausgehend von verschiedenen Karriereorientierungen wie Vorankommen, Sicherheit,<br />
Freiheit, Exzellenz und Balance wird Karriereerfolg als Verbindung von individuellen<br />
Merkmalen der Person und beruflichen Kontextfaktoren betrachtet.<br />
Grundlegende Schlüsselqualifikationen für die Karriereentwicklung sind neben<br />
fundiertem Fachwissen Teamfähigkeit, Verbindlichkeit und Verlässlichkeit, Kreativität,<br />
Selbstmanagement, Ausdauer und Belastbarkeit und Ausstrahlung. Förderliche<br />
und hinderliche Aufstiegsfaktoren in der Karriereentwicklung von Frauen<br />
werden aufgezeigt.<br />
13
Abstract<br />
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
PD Dr. Claus J. Tully<br />
Lernen neben der Schule –<br />
Informelle Bildung im modernen Jugendalltag<br />
Die Jugendphase scheint weitgehend von organisiertem Lernen in Schulen bestimmt.<br />
In den letzten Jahren hat eine umfangreiche Diskussion um die Öffnung<br />
und Weiterentwicklung der Schule stattgefunden. Die eigentlichen Adressaten,<br />
nämlich die Jugendlichen als lernende Individuen, spielen bislang noch eher eine<br />
Nebenrolle. Sie werden vorwiegend aus dem Blickwinkel der Institution Schule betrachtet.<br />
Die Modernisierung des gesellschaftlichen Alltags macht einen differenzierten<br />
Blick auf Bildung und Lernen im Jugendalltag erforderlich. Jugendliche lernen<br />
in ganz vielen Kontexten, von ihren Peers, wenn sie ihre digitalen Apparate<br />
nutzen, wenn sie jobben, wenn sie sich in sozialen Diensten engagieren usw. Informelle<br />
Bildungsprozesse haben eine wachsende Bedeutung. Diesem Sachverhalt<br />
geht der Vortrag nach.<br />
14
Abstract<br />
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
Mario Leibner JKL<br />
Workshop Kunst<br />
Auch zu diesem Studierendenkongress findet wieder – wie im vergangenen Jahr -<br />
ein Kunstworkshop statt. Parallel zu den Vorträgen der FachexpertInnen und der<br />
Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Themen und Fragestellungen wird es<br />
wieder über den Zeitraum des Kongresses die Möglichkeit geben, sich gedankenvoll<br />
künstlerischen Aspekten zu widmen und eigene Ideen mit künstlerischen Mitteln<br />
darzustellen.<br />
Das übergreifende Thema „Mein Wissen – unser Wissen!?“ bietet zudem, um auf<br />
die Kunst zu kommen, reizvolle und ideenformende Aspekte, die man auf Leinwand<br />
oder auf gutes Büttenpapier bringen kann. Es wird dabei um die Frage gehen:<br />
Wie kann sich Kunst mit diesem Thema auseinandersetzen, wird sie doch<br />
selbst oft als fremd empfunden und ruft ebenso wie das Fremde Bewunderung und<br />
Ablehnung in gleichem Maße hervor? Die Idee, Kunst im Rahmen dieser Thematik<br />
mit Spaß und Fantasie zu verwirklichen, schlummert in vielen Köpfen. Jedoch bedarf<br />
es manchmal nur einer kleinen Anleitung, Farben anzumischen oder einen<br />
Druckstock herzustellen, um die Anfangshemmungen für drei Tage zu vergessen.<br />
Angeboten werden wieder Acrylmalerei, Arbeit mit Ton, Linolschnitt und Aquarellmalerei.<br />
Jedoch genügt es auch manchmal, einen Bleistift in die Hand zu nehmen<br />
und einfach auf einem weißen Blatt Papier zu zeichnen - dies ist bereits eine<br />
Keimzelle der künstlerischen Produktion. Unser Atelierraum dient als Labor für<br />
die künstlerische Arbeit.<br />
Bei unserem Workshop sind keine Grenzen gesetzt. Die Kunst bleibt frei, es gibt<br />
kein Zeitlimit und das Arbeitsmaterial, mit dem wir etwas herstellen, ist ausreichend<br />
vorhanden. Es geht darum, individuell oder gemeinsam etwas auszuprobieren.<br />
Der Versuch sollte ein Endergebnis werden. Diesen Teil der Kunst kann man<br />
weiter tragen. Die künstlerische Herangehensweise ähnelt in dem suchenden Vorgehen<br />
und dem Ausgehen von Visionen dem Betrachten, Innehalten und Finden<br />
von Möglichkeiten, die Kunst - und wir. Wir müssen uns nicht beweisen, sondern<br />
es geht darum, neue Sichtweisen für uns zu eröffnen.<br />
15
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
Aus der Praxis<br />
Selbstorganisierte Initiativen und Netzwerke<br />
Freitag, 05.05.2006 von 16 bis 18 Uhr<br />
Kurzvorstellungen<br />
16
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
hEFt für literatur, stadt & alltag<br />
Das Magazin hEFt soll zum einen Podium für nicht-etablierte AutorInnen und Projekte/Initiativen<br />
sein. Zum anderen sollen die Diskussionen (Kultur/Politik) in der<br />
Stadt widergespiegelt werden. Das hEFt erscheint vierteljährlich zum Jahreszeitenbeginn<br />
und liegt kostenlos an ausgewählten Plätzen in Erfurt aus.<br />
Auflage: 2.000 Stück, kostenlos<br />
Herausgeber: Kulturrausch Erfurt<br />
E-Mail: heft@kulturrausch.net<br />
Radio F.R.E.I.<br />
Radio F.R.E.I. ist ein selbstverwaltetes, nichtkommerzielles Lokalradio auf Vereinsbasis.<br />
Es ist nicht auf Gewinn ausgerichtet und durch Verzicht auf Rundfunk-<br />
Werbung von kommerziellen Interessengruppen unabhängig. Es lebt von aktiver<br />
BürgerInnenbeteiligung. Durch ein offenes, basisdemokratisches Redaktionsprinzip<br />
wird die Instrumentalisierung durch einzelne Gruppen ausgeschlossen. Keine<br />
Gruppe, Organisation oder Einzelperson darf eine Vorrangstellung im Sender einnehmen.<br />
Aus diesem Gedanken heraus werden keine Sendeplätze vergeben. Stattdessen gilt<br />
das Angebot, unmittelbar an der Gestaltung des Radiosenders mitzuarbeiten, sich<br />
mit anderen Leuten auseinanderzusetzen und auf diesem Wege das bestmögliche<br />
Programm zu entwickeln<br />
Dem Programm von Radio F.R.E.I. liegt ein von seinen AkteurInnen gemeinsam<br />
entworfenes Konzept zugrunde. Über die Platzierung von Magazinen, Konzeptsendungen,<br />
Einzelbeiträgen, Trailern,..., kurz, über das Gesicht des Radios und<br />
die Struktur, entscheiden alle in wöchentlichen und monatlichen Plenen gleichberechtigt.<br />
So versucht Radio F.R.E.I. gegenüber willkürlichen Einzelentscheidungen<br />
("Chefs"), gegen einen politischen oder finanziellen Maulkorb unabhängig zu bleiben.<br />
www.radio-frei.de<br />
17
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
Zughafen Erfurt<br />
Der Zughafen ist ein freies Netzwerk von Künstlern, Organisatoren, Firmen und<br />
Projekten mit Sitz im alten Erfurter Güterbahnhof. Ausgehend von zwei Musikstudios<br />
und einem kleinen Team um den Künstler Clueso hat sich der Zughafen zu einem<br />
Anziehungspunkt kreativer Köpfe entwickelt.<br />
Heute bilden neben allen Leistungen rund um das "Produkt Musik" die Bereiche<br />
Events, Management sowie Digital- und Printmedien die wichtigsten Aktionsfelder.<br />
www.zughafen.de<br />
Für Demokratie Courage zeigen!<br />
Netzwerk für Demokratie und Courage (NDC)<br />
Das NDC steht für die Ächtung von Rassismus. Wir bestärken den Mut zum Antirassismus<br />
in einer von rechten Gedanken beeinflussten Alltagskultur. Es geht uns<br />
nicht darum, handfeste Nazis zu bekehren. Wir fordern Zivilcourage eines jeden<br />
Einzelnen heraus - nur wer selbst aktiv wird, kann etwas verändern. Wir stärken<br />
soziale Kompetenzen.<br />
Wir kommen mit Jugendlichen ins Gespräch, indem wir ehrenamtlich an Schulen<br />
gehen. Unsere Methode sind die Projekttage "Für Demokratie Courage zeigen".<br />
Diese führen wir flächendeckend an verschiedensten Schulen in den Regionen<br />
durch. Wir beleuchten zusammen mit den Jugendlichen verschiedene Aspekte von<br />
Demokratie, Mitbestimmung, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Gewalt, Europa,<br />
Medien und Jugendkultur, zeigen Widersprüche auf und regen zum Nachdenken<br />
an, um Vorurteilen entgegenzutreten. Unser Netzwerk ist unsere gemeinsame<br />
Handlungsplattform. Das Netzwerk bündelt viele Menschen und Organisationen.<br />
Deren vielfältiges Know-How, Ideen und Erfahrungen – das macht unser Potential<br />
und unsere Kompetenz aus.<br />
www.netzwerk-courage.de<br />
18
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
Tagungshaus Rittergut<br />
Mitten im Herzen Deutschlands - im Thüringer Becken – liegt Lützensömmern. Da<br />
wiederum gibt es eine seit über zehn Jahren funktionierende Jugendbildungsstätte<br />
– das Tagungshaus Rittergut. Das Gelände der Einrichtung verfügt über 3 ha. Neben<br />
einer weitläufigen Parkanlage mit angelegten Trockenbiotopen, Lehmöfen und<br />
Lagerfeuerstelle befinden sich im Gesamtensemble eines Dreiseitenhofes unterschiedliche<br />
Häuser mit verschiedenen Unterbringungsmöglichkeiten (Ferienwohnungen,<br />
Mehr- und Zweibettzimmer). Parallel dazu sind Seminarräume und ein<br />
großer Veranstaltungsraum vorhanden. Beim Aufbau der Einrichtung wurde und<br />
wird sehr großer Wert auf naturnahe und umweltfreundliche Bauweise gelegt. Ein<br />
Großteil der Dachflächen ist als Gründach ausgebaut. Wärme wird sowohl über eine<br />
Solaranlage als auch über eine Holzvergaserheizung gewonnen. Um das Holz<br />
von morgen kümmern sich die Rittergütler mittels ihres 3,5 ha großen Aufforstungsprogramms<br />
am Dorfrand. Zentral im Innenhofbereich des Ritterguts befindet<br />
sich ein Feuchtbiotop, und es wäre noch vieles mehr hier aufzuzählen...<br />
Aber hier wird natürlich nicht nur das schöne Landleben genossen, sondern auch<br />
zukunftsträchtig gearbeitet. Als landesweit anerkannter Träger der freien Jugendhilfe<br />
widmet sich der Verein hauptsächlich der Kinder- und Jugendbildung im außerschulischen<br />
und im schulischen Bereich. Die Schwerpunkte der Bildungsarbeit<br />
liegen in den unterschiedlichsten Bereichen. Eine Segmentierung wie im KJHG<br />
wird hier nicht vollzogen. Besonders günstig ist im Rittergut vor allem, dass Kinder<br />
und Jugendliche hier erleben, dass vermittelte Werte nicht rein theoretischer Art<br />
sind, sondern auch und gerade praktische Anwendung finden bzw. im Leben derjenigen,<br />
die Bildung vermitteln, fest verankert sind.<br />
Parallel dazu werden auch andere Maßnahmen sowohl im Bereich der Kinder- und<br />
Jugenderholung als auch im integrativen und im internationalen Sektor durchgeführt.<br />
Daneben findet die Förderung ehrenamtlichen Engagements Berücksichtigung in<br />
der inhaltlichen Arbeit. So ist das Rittergut neben einem arbeitsmarktpolitischen<br />
Faktor in der Region Einsatzstelle für das Freiwillige Ökologische Jahr und für den<br />
Europäischen Freiwilligendienst. Ein Großteil der Maßnahmen wie die Thüringer-<br />
TheaterTage, Kinderferienlager, Internationales Intergeneratives Singetreffen und<br />
die Internationalen Workcamps wären ohne die Hilfe der Ehrenamtler gar nicht<br />
umsetzbar.<br />
www.rittergut.de<br />
19
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
Solidaritätsfond der Hans-Böckler-Stiftung<br />
Die Gründung des Solidaritätsfonds geht auf eine Initiative von StipendiatInnen<br />
der Hans-Böckler-Stiftung zurück, die sich aus Anlass des faschistischen Militärputsches<br />
in Chile 1973 entschlossen hat, freiwillig einen Teil ihres Stipendiums in<br />
einen Fond einzuzahlen, um die weltweite Solidaritätsarbeit für ein demokratisches<br />
Chile zu unterstützen.<br />
Mit dem Ende der Militärdiktatur in Chile 1992 wollte sich der Solidaritätsfond<br />
nicht mehr nur auf Chile konzentrieren und veränderte seine Ausrichtung. Seitdem<br />
wird mit den Mitteln des Fonds nationale und internationale Solidaritätsarbeit gefördert,<br />
die emanzipatorische Ansätze mit den Schwerpunkten Bildung, Unterstützung<br />
demokratischer Strukturen und gewerkschaftlicher Aktivitäten sowie den<br />
Themen Antifaschismus, Antirassismus und dem Kampf gegen Antisemitismus<br />
zum Inhalt hat.<br />
Durch die Spenden der StipendiatInnen, die materielle Unterstützung der VertrauensdozentInnen<br />
der Stiftung und nicht zuletzt durch die großzügige Verdoppelung<br />
aller eingegangenen Spenden durch die Hans-Böckler-Stiftung können jährlich annähernd<br />
einhundert Projekte mit einem Gesamtvolumen von 100.000 € und mehr<br />
gefördert werden.<br />
Über die Vergabe der Mittel entscheidet eine paritätisch besetzte Kommission aus<br />
gewählten StipendiatInnen, VertrauensdozentInnen und jeweils einem Vertreter<br />
des DGB und der Stiftung, die sich dreimal im Jahr trifft.<br />
Leitfaden zur Antragsstellung und weitere Informationen unter:<br />
www.boeckler.de.<br />
20
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
KommPottPora e.V.<br />
KommPottPora- ein Verein für soziokulturelle und internationale Zusammenarbeit<br />
(e.V.) - wurde 1998 als Netzwerk verschiedener Vereine, Initiativen und Arbeitsgemeinschaften<br />
gegründet. Die grundsätzliche Intention des KommPottPora e.V.<br />
Gotha besteht darin, Beiträge zur Entwicklung zivilgesellschaftlicher Handlungsformen<br />
und Strukturen zu leisten. In Abgrenzung zu anderen Auffassungen verstehen<br />
wir unter Zivilgesellschaft ein Konzept des sozialen Zusammenlebens, welches<br />
von Solidarität, Respekt, Verantwortung und Gemeinsinn getragen wird und<br />
den Menschen ermöglicht, ihre Belange weitgehend selbst zu regeln wie auch die<br />
Gestaltung ihrer Lebenswelt selbstbestimmt zu realisieren.<br />
Mit dieser Zielstellung arbeitet der Verein hauptsächlich in den Bereichen der Soziokultur<br />
und Bildung nach dem Arbeitsprinzip emanzipatorischer Gemeinwesenarbeit.<br />
www.kommpottpora.de<br />
Offener Raum<br />
„Der Versuch eines Offenen Raums zum Sozialforum in Erfurt“ - Bericht<br />
Im Rahmen des 1. Sozialforums in Deutschland gab es ein Experiment:<br />
Es wurde versucht, Herrschaftsfreiheit zu leben. Dazu wurde eine Schule als offener<br />
Raum eingerichtet, in dem man wohnte, diskutierte und feierte. Als "offener<br />
Raum" kann ein Aktionsfeld bezeichnet werden, in dem es keine Beschränkungen<br />
gibt, diesen zu nutzen und zu füllen. Ein Raum und seine Ausstattung ist dann offen,<br />
d.h. gleichberechtigt für alle nutzbar, wenn die Beschränkungen physisch und<br />
praktisch nicht bestehen. Wissensbarrieren dürfen nicht hingenommen werden.<br />
Dieses bedarf in der Regel eines aktiven Handelns, um Transparenz herzustellen,<br />
Zugänge zu Informationen zu ermöglichen und Erklärungen z.B. für technische<br />
Geräte bereitzustellen. Und das Pikanteste daran sind vielleicht die Kosten für das<br />
Projekt: 0 Euro.<br />
21
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
Abschlussdiskussion<br />
zum Thema:<br />
Über den Tellerrand – Kooperation oder Konkurrenz<br />
„Die Zukunft gestalten, aber wie?“<br />
Samstag, 06.05.2006 von 9.00 bis 11.00 Uhr<br />
Statements / Thesen<br />
22
Zur Abschlussdiskussion<br />
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
Michael Brodowski<br />
Wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten? Eine komplexe Frage, die - soll sie nicht im<br />
individuellen Planungsversuch persönlicher Lebensentwürfe stecken bleiben, sondern an<br />
systemische Überlegungen einer globalen Wechselbeziehung von Ökologie, Ökonomie,<br />
Sozialem und Politik anschlussfähig sein - erhebliche kognitive Anstrengungen voraussetzt.<br />
Da haben wir schon das erste Problem identifiziert: Wenn alles global ist, alles mit<br />
allem zusammenhängt, wie lässt sich dann diese fast unüberschaubare Komplexität überhaupt<br />
noch fassen bzw. auf ein bearbeitbares Maß reduzieren? Und ehrlich gesagt ist es<br />
für viele, und hier kann man nur allzu oft vor Überforderung warnen, schon anstrengend<br />
genug, ihre eigenen Lebens- bzw. Arbeitsverhältnisse zu durchschauen, hier gestalterisch<br />
zu wirken, tatsächlich Veränderungen für sich selbst und vielleicht auch Verbesserungen<br />
für andere herbeizuführen. Überdies bietet derartige Komplexität eine Spielfläche für<br />
Wirtschaftsweise, Verbandhäuptlinge, Politikschamanen und Regentänze der Unverbindlichkeit<br />
im Talkshow–Alltag, sodass Frau und Mann nur eins sicher weiß: Was immer sie<br />
oder er auch für eine Lösung für sich gefunden zu haben glaubt, sie ist – spätestens am<br />
nächsten Sonntag – so was von falsch.<br />
Wir müssen die Menschen durch Bildung dazu befähigen, ihre Zukunft gemeinsam mit<br />
anderen gestalten zu können. So zumindest äußert sich sinngemäß die UN-Kommission<br />
zur DEKADE einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. Auf den ersten Blick ein gangbarer<br />
Weg, auf den zweiten Blick mindestens ebenso schwierig wie die Komplexität des<br />
Globalen zu reduzieren. Die Menschen müssen zukünftig lebenslang Lernen, so lautet eine<br />
Forderung. Bei vielen ruft dieses Wort jedoch eher die Assoziation einer lebenslangen<br />
Strafverurteilung hervor, deren Foltermethode darin besteht, sich und seine Lebensplanung<br />
permanent selbst in Frage zu stellen. Zu sehr ist die Bildung noch an die für viele mit<br />
Leiden verbundene Rückschau auf Schule oder Lehrausbildung, Prüfungsangst, undurchsichtiges<br />
Bewerten und - trotz eingepaukter Informationen - Enttäuschtwerden verbunden.<br />
Bildungsprozesse schaffen also nicht automatisch Kompetenzen, sie ver- bzw. behindern<br />
häufig auch Kompetenzentwicklung. Bildungsinstitutionen/-systeme schaffen nicht<br />
nur Zukunftschancen, sie teilen sie vielmehr auf nicht immer nachvollziehbare, sehr subjektive<br />
Weise und zunehmend ungerechter, zu. Wie sollen wir Zukunft gestalten, wenn<br />
die Menschen durch zunehmende Zertifizierung und Formalisierungswahnsinn nur noch<br />
an formal regulatorischen Lerngründen interessiert sind? Die Lehrenden wie die Lernenden<br />
versuchen dann vernünftigerweise, den Bildungsanforderungen möglichst ökonomisch<br />
auszuweichen.<br />
Es wird auf dem Podium darüber zu reden sein, wie in Zukunft gelernt werden soll. Ebenso<br />
soll diskutiert werden, ob heutige Organisations- und Arbeitsverhältnisse zukünftige<br />
Gestaltung eher fördern, be- oder sogar verhindern. Was ist mit der viel zitierten „Lernenden<br />
Organisation“? Ein Mythos wie Nimmerland für die kleinen angestellten Peter<br />
23
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
Pans der Informationsgesellschaft, in das man sich in der Büropause, auf dem immerhin<br />
ergonomisch geformten Stuhl, träumt? Aber Peter Pan wurde nie mit drohender Erwerbslosigkeit<br />
unter Druck gesetzt, vom Chef (wer sollte das auch sein in einer der letzten demokratischen<br />
Kinderbewegungen?) nicht zurückgepfiffen, wenn er eine gute Idee hatte. Er<br />
wurde nicht gemobbt, nicht mit sinnlosen Tätigkeiten als Bestrafung für hohes Engagement<br />
kaltgestellt, nicht mit 50 in Frührente geschickt, was nebenbei auch nicht gegangen<br />
wäre, weil man ja in Nimmerland nie älter wurde.<br />
Konkurrenz oder Kooperation in Lernverhältnissen, was bringt uns weiter? Wie voraussetzungsvoll<br />
muss Bildung gestaltet sein, wenn sie nachhaltig wirken und Menschen befähigen<br />
soll, die Zukunft (selbst) zu gestalten? Was bietet die Wissenschaft für Grundlagen<br />
an? Wie weit sind wir in Bezug auf die Analyse informellen, selbstorganisierten, organisationalen<br />
Lernens? Dies sind Fragen, über die zu diskutieren sein wird und vielleicht gelingt<br />
ein Rückblick auf die vorangegangenen Themen des zurückliegenden Kongresses<br />
und ein Ausblick auf einen Studierendenkongress 2007.<br />
24
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
Prof. Dr. Bernd Overwien<br />
Angesichts einer sprunghaften Zunahme der Diskussionsbeiträge und Untersuchungen<br />
zum informellen Lernen stellen sich die Fragen nach dem Charakter dieses<br />
Phänomens und die nach den Gründen. Immer wieder wird dabei auf Entwicklungen<br />
hin zur „Informations- und Wissensgesellschaft“ hingewiesen und auf Globalisierungsprozesse.<br />
Globalisierung bedeutet u. a. eine zunehmend weltweite Organisation<br />
von sogenannten Wertschöpfungsketten. Als Folge davon werden Arbeitsprozesse<br />
stärker als je zuvor transnational organisiert und Arbeitsmärkte<br />
räumlich entgrenzt. Hinter diesen Entwicklungen verbergen sich auch Herausforderungen<br />
an die Kompetenzen der Beschäftigten. Hinzu kommt, dass sich Lebens-<br />
und Arbeitswelt immer mehr entgrenzen, sich damit die Arbeitswelt Stück für<br />
Stück in die Lebenswelt hinein fortsetzt. Umgedreht gewinnt Lernen außerhalb der<br />
Arbeit an Relevanz für berufliche Tätigkeiten. Informelles Lernen, ob Begleiterscheinung<br />
des Alltagslebens oder gezielte Aktivität, gewinnt eine größere Bedeutung.<br />
Informelles Lernen wird unter der Perspektive lebenslangen Lernens inzwischen<br />
als eine wichtige, bisher oft unterschätzte Art des Lernens betrachtet. Nicht zufällig<br />
liegt ein Schwerpunkt der Diskussion auf arbeitsbezogenem Lernen. Es sind also<br />
Bildungs- und Weiterbildungskonzepte zu entwickeln, die informelles Lernen berücksichtigen,<br />
bereits informell erworbene Kompetenzen anerkennen und gesellschaftliche<br />
Integration begleiten. Dabei sind soziale Lerngrenzen zu beachten, aber<br />
auch Strategien der Menschen, diese Grenzen zu überschreiten.<br />
Michael Brodowski<br />
• Wir müssen die Menschen durch Bildung dazu befähigen, ihre Zukunft gemeinsam<br />
mit anderen gestalten zu können.<br />
• ABER: Bildungsprozesse schaffen nicht automatisch Kompetenzen, sie ver- bzw.<br />
behindern häufig auch Kompetenzentwicklung.<br />
• Bildungsinstitutionen/-systeme schaffen nicht nur Zukunftschancen, sie teilen<br />
sie vielmehr auf nicht immer nachvollziehbare, sehr subjektive Weise und zunehmend<br />
ungerechter, zu.<br />
25
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
Günther Reißmann<br />
• Der Betriebsrat ist das Bindeglied zwischen Geschäftsleitung und Belegschaft.<br />
Mitbestimmung kann in diesem Kontext auch in Fragen der Unternehmensführung<br />
als Co-Management betrachtet werden. Betriebsräte müssen sich zukünftig<br />
zum Co-Manager entwickeln.<br />
• Nur ein wissender Betriebsrat kann auf gleicher Augenhöhe mit der Geschäftsleitung/dem<br />
Vorstand verhandeln. Dazu benötigt er einerseits das Wissen der<br />
Belegschaften, was eine kooperative Vertrauensbasis voraussetzt und andererseits<br />
ein hohes, stetig zu aktualisierendes Fachwissen, was die Motivation und<br />
Fähigkeit zu lebenslangem Lernen voraussetzt.<br />
• Europäische Mitbestimmung ist schlecht umsetzbar. Das nationale Recht wirkt<br />
hier als Hemmschuh. Grundsätzlich ist jedoch eine stärkere internationale,<br />
selbstorganisierte Kooperation der Belegschaften zu befördern.<br />
Prof. Dr.-Ing. Klaus Rebensburg<br />
Unsere Zukunft lässt sich (auch durch uns Individuen) gestalten. Insbesondere<br />
beim Strukturwandel durch Informations- und Kommunikationstechnologien ist<br />
jede/r gefordert!<br />
• Informationstechnologie und Kommunikationsnetze beschleunigen das berufliche<br />
Leben, aber sie unterstützen auch Kunst, Kultur und private Entschleunigung!<br />
(Nutzen von Personal Computing, Google, Blog, eBay, Wikipedia vs. Digital<br />
Divide und ungebändigte Globalisierung).<br />
• Ja, es gibt neue Kräfte für Kooperation, die die Informationsgesellschaft entwickelt<br />
hat! (Erreichbarkeit, Kommunikation und Kooperation über Netze und<br />
Medien, Communities, Hilfe zur Selbsthilfe, Gesundheit). Eine Chance für jeden,<br />
der sich der Techniken und Medien bedient.<br />
• Wer hofft, dass Konkurrenz in der Informationsgesellschaft zu einer friedlichen<br />
Ökonomie führt, der träumt! (Billing, Accounting, Data Mining, Sensor Netze,<br />
RFIDs - die Virtualisierung der wirtschaftlichen Prozesse macht den wirtschaftlichen<br />
Konkurrenzkampf -über Netz und Globalisierung – härter.)<br />
26
Verzeichnis der ReferentInnen<br />
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
Brodowski, Michael<br />
Dipl. Päd. Michael Brodowski<br />
Leiter der Koordinationsstelle zur Umsetzung der UN-<strong>Dekade</strong> Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung<br />
(<strong>Thüringen</strong>)<br />
2005 Promotion zum Thema Theorieentwicklung organisationalen und kooperativ/ kollektiven<br />
Lernens an der Universität Erfurt (erfolreich verteidigt)<br />
Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Lerntheoretische Analyse organisationalen Wandels,<br />
Selbstorganisierte kooperativ/ kollektive Lernprozesse, Bildungsplanung/ Bildungsmanagement.<br />
http://www.dekade-thueringen.de<br />
Leibner, Mario<br />
Mario Leibner (JKL)<br />
Freier ünstler, seit 1987 über 20 Kunstaussteellungen. Seit 2002 Studium der Freien Kunst / Plastik<br />
an der Bauhaus Universitöt Weimar. Stipendiat der Hans Böckler Stiftung.<br />
http://www.jkleibner.de<br />
Mandl, Heinz<br />
Prof. Dr. Heinz Mandl<br />
Lehrstuhlinhaber am Institut für Pädagogische Psychologie, Ludwig-Maximilians-Universität<br />
München<br />
Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Wissen und Handeln, Wissensmanagement, Transfer von<br />
Wissen, Selbstgesteuertes und kooperatives Lernen, Qualitätssicherung in der Weiterbildung<br />
http://www.lsmandl.emp.paed.uni-muenchen.de/staff/mandl_d.html<br />
Overwien, Bernd<br />
Prof. Dr. Bernd Overwien<br />
Gastprofessur für Didaktik der politischen Bildung TU Berlin<br />
Leitung der Arbeitsstelle für Globales Lernen und Internationale Kooperation<br />
Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Kinder und Arbeit, Informelles Lernen – Bildungsfragen<br />
im globalen Kontext<br />
http://www.bernd-overwien.de<br />
Rebensburg, Klaus<br />
Prof. Dr.-Ing. Klaus Rebensburg<br />
Professur am Institut für Informatik der Universität Potsdam<br />
Leiter des fachbereichsübergreifenden Forschungsschwerpunktes FSP-PV der Technischen Universität<br />
Berlin<br />
1999 -2002 Beauftragter für Information und Kommunikation der TU Berlin<br />
Sprecher des Stiftungsverbundkollegs Berlin der Alcatel SEL Stiftung („Informationsgesellschaft“)<br />
Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Fachgebiete Netzwerktechnologien und Multimedia Anwendungen,<br />
Internet, Medienproduktion und Nichtlineare Medien<br />
http://wwwpc.prz.tu-berlin.de/klaus<br />
Reißmann, Günther<br />
Günther Reißmann<br />
Vorsitzender des Konzernbetriebsrates der JENOPTIK AG, Jena<br />
http://www.jenoptik.com/cps/rde/xchg/jenoptik<br />
27
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
Schilling, Jan<br />
Dr. Jan Schilling<br />
Seit Oktober 2002 Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Betriebs- und Organisationspsychologie<br />
der RWTH Aachen<br />
Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Führung- und Führungskräfteentwicklung, Arbeits- und<br />
Organisationsanalyse, Personal- und Organisationsentwicklung<br />
http://www.bopsych.rwth-aachen.de/contenido/cms/front_content.php?idcat=23<br />
Siegert, Wolf<br />
Dr. Wolf Siegert<br />
Direktor Iris ® Media, Berlin<br />
Hg. & Autor: Day by Day<br />
2004 Lehrbeauftragter des Masterstudiengangs „Multimedia Produktion“ FH Kiel<br />
Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Paradigmenwechsel von alten in neue Medien<br />
http://www.iris-media.com<br />
http://www.iris-media.info<br />
Thomas, Tanja<br />
Jun.- Prof. Dr. Tanja Thomas<br />
Jun. Professur für Kommunikationswissenschaft und Medienkultur, Universität Lüneburg<br />
Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Cultural Studies, Mediensoziologie, Medien- und Alltagskulturen,<br />
Identität, Rassismus, Nationenkonzepte, Nationalismus, Banale Militarisierung<br />
http://www.uni-lueneburg.de/fb3/suk/thomas/thomas.php<br />
Tully, Claus J.<br />
Prof. Dr. Claus J. Tully<br />
Seit 2005 Professur Universität Quilmas (Buenos Aires, Argentinien)<br />
Seit 2003/04 Vertragsprofessur FU Bozen (Italien), Erziehungswissenschaftliche Fakultät<br />
Seit 2000 Lehrbeauftragter Soziologie TU München<br />
Deutsches Jugendinstitut (DJI ) München<br />
Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Jugend, Bildung, Medien, Modernisierung der Gesellschaft,<br />
Technik und Umwelt<br />
http://cgi.dji.de/cgi-bin/Mitarbeiter/homepage/mitarbeiterseite.php?mitarbeiter=156<br />
28
Mein Wissen – unser Wissen!?<br />
29