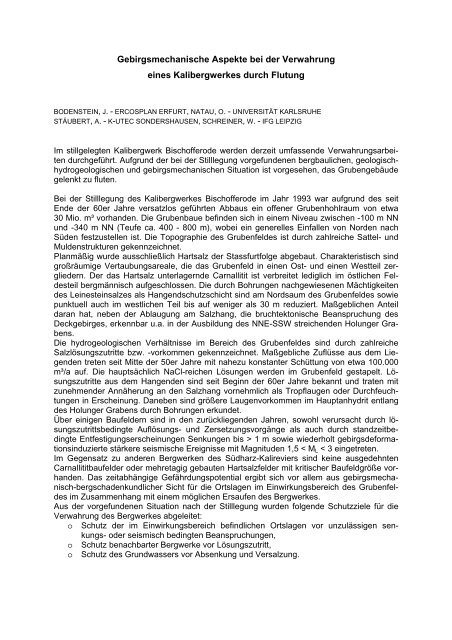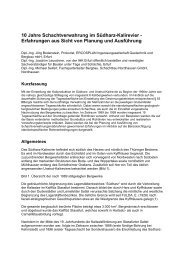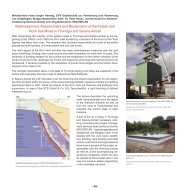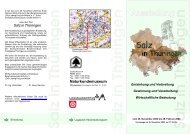Bodenstein, J. - ercosplan
Bodenstein, J. - ercosplan
Bodenstein, J. - ercosplan
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Gebirgsmechanische Aspekte bei der Verwahrung<br />
eines Kalibergwerkes durch Flutung<br />
BODENSTEIN, J. - ERCOSPLAN ERFURT, NATAU, O. - UNIVERSITÄT KARLSRUHE<br />
STÄUBERT, A. - K-UTEC SONDERSHAUSEN, SCHREINER, W. - IFG LEIPZIG<br />
Im stillgelegten Kalibergwerk Bischofferode werden derzeit umfassende Verwahrungsarbeiten<br />
durchgeführt. Aufgrund der bei der Stilllegung vorgefundenen bergbaulichen, geologischhydrogeologischen<br />
und gebirgsmechanischen Situation ist vorgesehen, das Grubengebäude<br />
gelenkt zu fluten.<br />
Bei der Stilllegung des Kalibergwerkes Bischofferode im Jahr 1993 war aufgrund des seit<br />
Ende der 60er Jahre versatzlos geführten Abbaus ein offener Grubenhohlraum von etwa<br />
30 Mio. m³ vorhanden. Die Grubenbaue befinden sich in einem Niveau zwischen -100 m NN<br />
und -340 m NN (Teufe ca. 400 - 800 m), wobei ein generelles Einfallen von Norden nach<br />
Süden festzustellen ist. Die Topographie des Grubenfeldes ist durch zahlreiche Sattel- und<br />
Muldenstrukturen gekennzeichnet.<br />
Planmäßig wurde ausschließlich Hartsalz der Stassfurtfolge abgebaut. Charakteristisch sind<br />
großräumige Vertaubungsareale, die das Grubenfeld in einen Ost- und einen Westteil zergliedern.<br />
Der das Hartsalz unterlagernde Carnallitit ist verbreitet lediglich im östlichen Feldesteil<br />
bergmännisch aufgeschlossen. Die durch Bohrungen nachgewiesenen Mächtigkeiten<br />
des Leinesteinsalzes als Hangendschutzschicht sind am Nordsaum des Grubenfeldes sowie<br />
punktuell auch im westlichen Teil bis auf weniger als 30 m reduziert. Maßgeblichen Anteil<br />
daran hat, neben der Ablaugung am Salzhang, die bruchtektonische Beanspruchung des<br />
Deckgebirges, erkennbar u.a. in der Ausbildung des NNE-SSW streichenden Holunger Grabens.<br />
Die hydrogeologischen Verhältnisse im Bereich des Grubenfeldes sind durch zahlreiche<br />
Salzlösungszutritte bzw. -vorkommen gekennzeichnet. Maßgebliche Zuflüsse aus dem Liegenden<br />
treten seit Mitte der 50er Jahre mit nahezu konstanter Schüttung von etwa 100.000<br />
m³/a auf. Die hauptsächlich NaCl-reichen Lösungen werden im Grubenfeld gestapelt. Lösungszutritte<br />
aus dem Hangenden sind seit Beginn der 60er Jahre bekannt und traten mit<br />
zunehmender Annäherung an den Salzhang vornehmlich als Tropflaugen oder Durchfeuchtungen<br />
in Erscheinung. Daneben sind größere Laugenvorkommen im Hauptanhydrit entlang<br />
des Holunger Grabens durch Bohrungen erkundet.<br />
Über einigen Baufeldern sind in den zurückliegenden Jahren, sowohl verursacht durch lösungszutrittsbedingte<br />
Auflösungs- und Zersetzungsvorgänge als auch durch standzeitbedingte<br />
Entfestigungserscheinungen Senkungen bis > 1 m sowie wiederholt gebirgsdeformationsinduzierte<br />
stärkere seismische Ereignisse mit Magnituden 1,5 < ML < 3 eingetreten.<br />
Im Gegensatz zu anderen Bergwerken des Südharz-Kalireviers sind keine ausgedehnten<br />
Carnallititbaufelder oder mehretagig gebauten Hartsalzfelder mit kritischer Baufeldgröße vorhanden.<br />
Das zeitabhängige Gefährdungspotential ergibt sich vor allem aus gebirgsmechanisch-bergschadenkundlicher<br />
Sicht für die Ortslagen im Einwirkungsbereich des Grubenfeldes<br />
im Zusammenhang mit einem möglichen Ersaufen des Bergwerkes.<br />
Aus der vorgefundenen Situation nach der Stilllegung wurden folgende Schutzziele für die<br />
Verwahrung des Bergwerkes abgeleitet:<br />
o Schutz der im Einwirkungsbereich befindlichen Ortslagen vor unzulässigen senkungs-<br />
oder seismisch bedingten Beanspruchungen,<br />
o Schutz benachbarter Bergwerke vor Lösungszutritt,<br />
o Schutz des Grundwassers vor Absenkung und Versalzung.
Die GVV mbH veranlasste eine umfassende gutachterliche Begleitung der Sicherungs- und<br />
Verwahrungsarbeiten mit wesentlich gebirgsmechanischer Zielstellung zur Vorbereitung der<br />
Flutung. Die in der Folge gebildete Gutachter-Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus Herrn<br />
Prof. Dr. Otfried Natau, Universität Karlsruhe, Herrn Dr. Arnold Schwandt, Erfurt, dem Institut<br />
für Gebirgsmechanik GmbH, Leipzig, der Kali-Umwelttechnik GmbH, Sondershausen und<br />
der ERCOSPLAN Ingenieurgesellschaft Geotechnik und Bergbau mbH, Erfurt, wurde u.a. mit<br />
folgenden Leistungen betraut:<br />
- Gutachten zur Gefährdungsbewertung (1994/95),<br />
- Untersuchungen zur Präzisierung des Gefährdungspotentials sowie zur Ableitung einer<br />
Rang- und Reihenfolge für Versatzmaßnahmen (1995/96),<br />
- Konzeption zur Verwahrung durch Flutung (1997/98),<br />
- Begleitende Überwachung und Präzisierung der Versatzmaßnahmen (seit 1996),<br />
- Laufende Auswertung der Beweissicherungsdaten (seit 1996),<br />
- Mitwirkung bei der Erarbeitung eines Simulationsmodells zur Flutung (seit 1998).<br />
Das für die Verwahrung des Bergwerkes erarbeitete Konzept der gelenkten Flutung basiert<br />
auf folgenden Prämissen:<br />
o Vermeidung bzw. Verzögerung des Zufließens von schwachmineralisierten Lösungen<br />
aus dem Hangenden,<br />
o Gegenfluten des Grubengebäudes aus dem Grubentiefsten mit Nutzung vorhandener<br />
Liegendzuflüsse und Laugenstapel,<br />
o Abdämmung von Flutungsarealen unterschiedlicher Mineralisation,<br />
o Verwertung der niederschlagsbedingt anfallenden Haldensalzlösungen<br />
für die Flutung.<br />
Mit dem Ziel einer Reduzierung der ersaufensbedingten Gefährdung wurde ein umfangreiches<br />
Versatzprogramm in den durch Hangendzuflüsse gefährdeten Feldesteilen realisiert.<br />
Dabei wird angestrebt, durch qualifizierten Vollversatz oder Teilversatz die Pfeiler zu stabilisieren<br />
und den Grauen Salzton in seiner Lage zu halten, um so das deformationsinduzierte<br />
Entstehen von Fliesswegen zu begrenzen. Die Rang- und Reihenfolge der Versatzarbeiten<br />
wurde anhand einer eigens erstellten Bewertungsmatrix aus den vorliegenden Bedingungen<br />
abgeleitet. Hierzu wurden u.a. folgende Kriterien herangezogen:<br />
- Schutzschichtmächtigkeit,<br />
- Lagerungsverhältnisse,<br />
- Bruchtektonische Beanspruchung,<br />
- Salzlösungszutritte,<br />
- Baufeldgröße und Durchbauungsgrad,<br />
- angebaute Bank,<br />
- First- bzw. Tonbrüche,<br />
- Pfeilerdeformation,<br />
- Sohlenniveau.<br />
Darüber hinaus war der teilweise schwach gebaute Trennpfeiler zum benachbarten Bergwerk<br />
Bleicherode durch befeuchtet und verdichtet eingebrachten Vollversatz so zu stabilisieren,<br />
dass gebirgsmechanische Überzugswirkungen verhindert und Lösungsübertritte ausgeschlossen<br />
werden können.<br />
Für das Prinzip des gelenkten Gegenflutens werden die vorliegenden grubentopographischen<br />
Verhältnisse (Generaleinfallen von Norden nach Süden, Sattel und Muldenstrukturen)<br />
gezielt genutzt. Somit kann das Grubenfeld unter Berücksichtigung der Faziesverteilung sowie<br />
der ungebauten Vertaubungsgebiete in unterschiedlich zu behandelnde Flutungsbereiche<br />
gegliedert werden.<br />
Zur zeit- und mengenmäßigen Abschätzung der Flutung wurde anhand grubenrisslicher Unterlagen<br />
eine aktualisierte Hohlraumbilanz erstellt.<br />
Die in einem verbesserten Fassungssystem übertage gesammelten Haldensalzlösungen<br />
werden über Rohrleitungen zunächst in ein bereits vorhandenes Stapelfeld (dominierender<br />
Hartsalzaufschluss, Spülversatz, Stapelung von Liegendlaugen) im kleineren westlichen Teil<br />
des Grubenfeldes eingeleitet (ca. 500 Tm³/a) und dort mit den NaCl-reichen Salzlösungen
aus dem Liegendzutritt vermischt. Dabei wird der Einleitungspunkt variiert. Aus dem Stapelfeld<br />
wird über Bohrungen eine an KCl und NaCl konditionierte Salzlösung abgezogen und in<br />
benachbarte, geodätisch tiefer liegende Hartsalzbaufelder übergeleitet.<br />
Daneben ist die Einleitung einer Mischlösung, bestehend aus Haldensalzlösung und MgCl2-<br />
Lösung aus Fremdbezug, in den größeren östlichen Grubenfeldesteil mit verbreitetem Aufschluss<br />
von Carnallitit im Liegenden vorgesehen. Die Zuführung kann von übertage über<br />
noch niederzubringende, gezielt angeordnete Flutungsbohrungen vorgenommen oder durch<br />
gelenkte Aufsättigung von untertage in ausgewählten Baublöcken mit mächtig unterlagerndem<br />
Carnallitit realisiert werden. Dazu läuft im SE-Feld z.Z. ein großtechnischer Versuch.<br />
Vorbereitend erfolgt die Abdämmung von Teilfeldern durch Errichtung von Absperrbauwerken<br />
mit folgenden Einzelfunktionen:<br />
o Verzögerung des Übertritts von schwachmineralisierten Lösungen in gebirgsmechanisch<br />
exponierte Bereiche,<br />
o Hermetisierung des Trennpfeilers zum Bergwerk Bleicherode,<br />
o Konvektionsbremse zwischen unterschiedlich mineralisierten Lösungen.<br />
Nach Abschluss der untertägigen Sicherungsarbeiten und vor Überflutung der Füllortbereiche<br />
ist die Verwahrung der Schächte durch Verfüllung und Abdichtung vorgesehen.<br />
Die Flutung des Grubengebäudes ist solange weiterzuführen, bis der Resthohlraum weniger<br />
als 5 Mio. m³ beträgt. Von den dann noch offen stehenden Grubenbauen im Norden des<br />
Bergwerkes wird keine Gefährdung mehr ausgehen, da die geodätisch tiefer liegenden Ortslagenbereiche<br />
dann bereits mit gesättigter Salzlösung geflutet sind.<br />
Der Zeitplan zur Flutung des Bergwerkes geht von einer Gesamtflutungsdauer von mehreren<br />
Jahrzehnten aus. Etwa 50 - 60 % des derzeit noch offenen Hohlraumes wird dann mit Salzlösungen<br />
erfüllt sein, ca. 20 - 30 % werden durch die fortschreitende Hohlraumkonvergenz<br />
liquidiert, der restliche Teil bleibt zunächst lufterfüllt.<br />
Die Versatzarbeiten im Bereich des Trennpfeilers zum Bergwerk Bleicherode wurden bereits<br />
im Jahr 1997 abgeschlossen. Durch geotechnische Beweissicherung konnte ein qualitätsgerechter<br />
Einbau des Versatzmaterials nachgewiesen werden. Die Erfolgsprognose anhand<br />
numerischer Modellrechnungen belegt eine ausreichende Versatzwirksamkeit im Hinblick auf<br />
die Kompaktion des Hangenden zeitlich vor dem druckhaften Anstehen des Flutungsmediums.<br />
Mindestens bis zu diesem Zeitpunkt wird der Versatzbereich durch Absperrbauwerke<br />
von im Grubenfeld ansteigenden Salzlösungen abgedämmt.<br />
Im nördlichen Teil des Grubenfeldes wurden bisher etwa 1,1 Mio. m³ Haufwerkversatz eingebracht.<br />
Durch eine auch in anderen Bergwerken erprobte Versatztechnologie mit Befeuchtung<br />
und nachträglicher Verdichtung des Salzhaufwerks können Einbringdichten bis 1,67<br />
g/cm³ erreicht werden. Für die Verfüllung von Bruchbereichen mit eingeschränkter Zugänglichkeit<br />
wird eine mobile Versatzschleuder eingesetzt.<br />
Der empfohlene Versatz im NE-Feld ist abgeschlossen. Derzeit liegt der Schwerpunkt der<br />
Arbeiten im N-Feld, wo weitere ca. 600.000 m³ Versatz eingebracht werden sollen. Die seitens<br />
der Gutachter-ARGE gewählten gebirgsmechanischen und geohydrologischen Kriterien<br />
für einen Voll- oder Teilversatz einzelner Baufelder oder Baufeldbereiche haben sich bewährt<br />
und werden auch in den übrigen Feldesteilen zur Bewertung herangezogen.<br />
Die Flutungsphase I, in der die Flutung des Westfeldes erprobt wurde, ist abgeschlossen.<br />
Bisher wurden mehr als 1 Mio. m³ Flutungslösung eingebracht.<br />
Die am jeweiligen Einleitungspunkt auftretende Klammbildung wird fortlaufend beobachtet<br />
und dokumentiert. Am Einleitungspunkt gebildete Klammen im Sohlenbereich werden so<br />
begrenzt, dass erforderliche Liegendschichtmächtigkeiten garantiert bleiben. Im Einleitungsbereich<br />
selbst verläuft die Entwicklung bisher gebirgsmechanisch verträglich. Ein Vergleich<br />
der Beschaffenheit des Flutungsmediums beim Eintritt in das Stapelfeld (Gesamtmineralisation<br />
ca. 220 g/l, Dichte 1,145 g/cm³) und beim Übertritt in den benachbarten Flutungsbereich<br />
(Gesamtmineralisation ca. 355 g/l, Dichte 1,225 g/cm³) verdeutlicht den gewünschten Effekt<br />
der untertägigen Konditionierung der Haldensalzlösungen.<br />
In der derzeit laufenden Flutungsphase II wird die Flutung des Westfeldes in der bewährten<br />
Weise fortgesetzt. Parallel dazu werden weitere Optimierungsmöglichkeiten für den östlichen<br />
Teil des Grubenfeldes geprüft. Mit einem speziell konzipierten in-situ-Versuch soll die geziel-
te untertägige Konditionierung der Haldensalzlösungen mit MgCl2 in ausgewählten Baufeldern<br />
getestet werden. Die erste Etappe (Überflutung eines Baublockes mit 65 Tm³ Haldenlösung)<br />
ist abgeschlossen. Erste Ergebnisse werden derzeit ausgewertet. Gebirgsmechanisch<br />
kritische Auswirkungen wurden nicht festgestellt.<br />
Die durch den Abbau eingeleiteten Senkungen der Tagesoberfläche über den bisher noch<br />
lufterfüllten Grubenfeldbereichen setzen sich fort. Dabei ist teilweise eine Abhängigkeit von<br />
der bruchtektonischen Zerteilung des Deckgebirges zu erkennen. Im Einwirkungsbereich des<br />
Grubenfeldes treten auch weiterhin seismische Ereignisse begrenzter Stärke (ML < 2,5) auf,<br />
deren Ursachen sowohl in tektonischen Vorprägungen als auch in der flutungsbedingten<br />
Durchfeuchtung von Tragelementen zu sehen sind. Alle bisher festgestellten gebirgsmechanischen<br />
Erscheinungen liegen im Bereich der Erwartungswerte. Zu bemerken ist ein deutlicher<br />
Rückgang der Seismizität nach realisierter Überflutung des Baufeldes.<br />
Die Flutung des Bergwerkes Bischofferode wird durch ein komplexes System der markscheiderischen<br />
sowie geotechnischen Beweissicherung und Überwachung begleitet. Dieses<br />
umfasst im wesentlichen:<br />
- Senkungsmessungen über Tage (Gesamt- und Sondernivellements),<br />
- Deformationsmessungen unter Tage (Konvergenz, Pfeilerquerdehnung),<br />
- Seismologische Überwachung (unter- und übertägige Seismometerstationen,<br />
Erschütterungsmessstellen),<br />
- visuelle Beobachtung (Befahrung, Videokamerauntersuchung, Fotodokumentation),<br />
- Überwachung von Salzlösungsmengen und Mineralisation,<br />
- Hydrofrac-Messungen und in-situ-Versatzprüfungen.<br />
Daneben wird ein komplexes Simulationsmodell zur Flutung entwickelt, welches dem Betreiber<br />
als Instrumentarium zur weiteren Optimierung der Flutungskonzeption dienen soll und<br />
sowohl<br />
- das gebirgsmechanische Verhalten der Kammer-Pfeiler-Systeme in<br />
den einzelnen Baublöcken und Baufeldern<br />
- lösungskinetisch bedingte Auflösungs- und Zersetzungsprozesse<br />
als auch das Flutungsrouting entsprechend der vorgegebenen Einleitpunkte, -wege und<br />
-konzentrationen sowie der gegebenen Höhenlagen der zu flutenden Hohlraumsysteme und<br />
deren Verbindung berücksichtigt.<br />
Die gutachterliche Begleitung der Flutung mit laufender Auswertung der Beweissicherungsdaten<br />
und Feststellung der sich entwickelnden gebirgsmechanischen Situation wird unter<br />
Beteiligung der GVV sowie des zuständigen Bergamtes fortgesetzt.