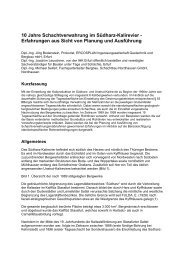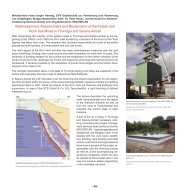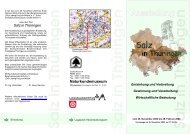Rauche, H. - ercosplan
Rauche, H. - ercosplan
Rauche, H. - ercosplan
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Exkursionsführer und<br />
Veröffentlichungen der GGW<br />
Berlin 214 (2001) Seite 199<br />
BRUCHMECHANIK DER MN-MINERALISIERTEN GANGBREKZIEN<br />
VON ARLESBERG UND OEHRENSTOCK IM THÜRINGER WALD<br />
Henry <strong>Rauche</strong> 1) V<br />
P<br />
1) Dipl.-Geol. Dr. H. A. M. <strong>Rauche</strong>, ERCOSPLAN Ingenieurgesellschaft Geotechnik und Bergbau mbH,<br />
Arnstädter Straße 28, 99096 Erfurt, e-mail: rauche@<strong>ercosplan</strong>.de<br />
Im südöstlichen Thüringer Wald treten nahe der<br />
Nordrandstörung in zwei von einander isolierten<br />
Vorkommen bei Arlesberg und bei Oehrenstock-<br />
Langewiesen Manganerzgänge auf, die in vergangenen<br />
Jahrhunderten auch bergmännisch abgebaut<br />
wurden. Die Nebengesteine der Gänge sind hier<br />
mehrheitlich Vulkanitdecken und Ignimbrite sowie<br />
untergeordnet auch Sedimentgesteine permosilesischen<br />
Alters. Vergleichbare Mineralgänge sind<br />
auch aus dem Ilfelder Becken am südlichen Harzrand<br />
bekannt, wo sie ausschließlich unterpermischen<br />
Vulkaniten aufsitzen.<br />
Im Revier Arlesberg sind vier verschiedene Gangscharen<br />
zu unterscheiden, die in annähernd äquidistanter<br />
Folge das Schollenfeld zwischen Kehltalstörung<br />
und Nordrandstörung des Thüringer<br />
Waldes besetzen. Diese Gangscharen streichen<br />
NW-SE und bestehen aus zahlreichen Einzelgängen,<br />
deren Streichrichtung zwischen NW und<br />
WNW variiert. In ähnlicher struktureller Position<br />
treten im Revier Oehrenstock-Langewiesen zwi-<br />
schen der Floßbergstörung und der Nordrandstörung<br />
ebenfalls Manganerzgänge auf, die hier annähernd<br />
E-W orientiert sind und ebenfalls verschiedene<br />
Gangscharen aufbauen, von denen einzelne über<br />
800 m bis 1000 m im Streichen zu verfolgen sind.<br />
Nach Hochrechnung der Förderraten dürfte die<br />
Rohstoffmenge an Mn-Oxiden in beiden Revieren<br />
kaum als 100.000 Tonnen betragen haben.<br />
Die innere Struktur der Gangzonen beider Reviere<br />
zeigt einen ähnlichen Aufbau:<br />
Meist nur einige Meter mächtige, teilweise aber bis<br />
auf wenige Dekameter anschwellende Brekzienzonen<br />
sind über Hunderte Meter im Streichen und -<br />
soweit durch den Bergbau ehemals aufgeschlossen -<br />
auch im Einfallen zu verfolgen. Die rhyolithischen<br />
Nebengesteine sind fragmentiert und durch mehrere<br />
Generationen von Mn-Oxiden verheilt. Die Verteilung<br />
der Fragmentgrößen ist stets sehr wechselhaft.<br />
Die Fragmentdurchmesser variieren von Metern bis<br />
Millimetern. Die Nebengesteinsfragmente sind<br />
10. Jahrestagung der Gesellschaft für Geowissenschaften e.V. Berlin<br />
Schmalkalden, 19. bis 23. September 2001 zum Thema<br />
„Regionale und Angewandte Geologie in der Grenzregion der Süddeutschen und der Mitteldeutschen Scholle“
Seite 200 214 (2001) Berlin<br />
alteriert, teilweise vollständig gebleicht. Durch die<br />
unterschiedlichen Mächtigkeiten und lokale Wechsel<br />
im Azimut entsteht eine linsige Struktur der<br />
Brekzienzonen. Gegen die Nebengesteine sind die<br />
Brekzien oft nur unregelmäßig begrenzt, wobei die<br />
Intensität der Fragmentierung zu den Randbereichen<br />
deutlich abnimmt und auch fließende Übergänge<br />
zu beobachten sind. Die einzelnen Brekzienkörper<br />
lagern annähernd saiger.<br />
Innerhalb dieser Gangbrekzien treten einzelne zentimeter-<br />
bis dezimetermächtige massive Gängchen<br />
von Pyrolusit, Manganit, Braunit und/oder Psilomelan<br />
(i.w. Coronadit, Hollandit) auf (sog. Reicherze,<br />
Stufen), die aber sowohl im Streichen als auch im<br />
Einfallen stark absetzig sind. Gangarten sind - im<br />
Arlesberger Revier eher selten - Calcit, z. T. durch<br />
den Einbau von Mn-oxiden schwarz gefärbt, und<br />
untergeordnet auch Fluorit.<br />
Bezogen auf die frühen Generationen der Mn-<br />
Oxide wurden die Brekzien und mit ihnen die Gänge<br />
postmineralisch überformt, wodurch einzelne bis<br />
zu Metern mächtige Scherzonen gebildet wurden,<br />
deren interne Gefüge eine polyphase Reaktivierung<br />
aufgezeichnet haben. Innerhalb dieser Scherzonen<br />
erfolgte eine sehr intensive Materialzerscherung,<br />
gepaart mit einer vollständigen Alteration des primären<br />
Mineralbestandes der rhyolithischen Nebengesteine,<br />
was zur Ausbildung mächtiger Lettenzonen<br />
führte. Diese mechanische Reaktivierung des<br />
Strukturinventars führte auch zur Remobilisierung<br />
der Mn-Oxide, die sich heute in Form von Sekun-<br />
Exkursionsführer und<br />
Veröffentlichungen der GGW<br />
därmineralen (sog. Mn-Mulm) auch innerhalb der<br />
Scherzonen finden.<br />
Die Gangbrekzien und die kleineren Gänge wurden<br />
zeitlich nacheinander und unter nach verschiedenartigen<br />
bruchmechanischen Voraussetzungen gebildet:<br />
Mit der Brekziierung versagten die vormals intakten<br />
rhyolithischen Gesteine unter dem Einfluss<br />
hoher Porenfluiddrucke, für deren Aufbau offenbar<br />
die Mn-Oxid-führenden Hydrothermen verantwortlich<br />
waren. Dabei muss der Porenfluiddruck solche<br />
Magnituden erreicht haben, die größer als die minimale<br />
Hauptnormalspannung waren, wodurch<br />
nach dem Prinzip der effektiven Spannungen Zugspannungen<br />
generiert wurden, die letztlich zur<br />
Fragmentierung der Gesteine führten und damit<br />
neue Wegsamkeiten für die Hydrothermen schufen.<br />
Auffällig ist, dass diese Brekziierung lediglich in<br />
den primär ausgesprochen geringpermeablen (niedrige<br />
Porosität) Rhyolithen, nicht aber in den permeableren<br />
permosilesischen Sedimentgesteinen zu<br />
beobachten sind.<br />
Die Bildung der kleineren Gänge innerhalb der<br />
Brekzienkörper stellte dagegen zumindest abschnittsweise<br />
eine Reaktivierung bereits vorhandener<br />
Bruchflächen war, die maßgeblich in einem<br />
Spannungsfeld erfolgte, dass durch die vertikale<br />
Position der größten Hauptnormalspannung und<br />
durch eine relativ geringe Anisotropie gekennzeichnet<br />
war.<br />
10. Jahrestagung der Gesellschaft für Geowissenschaften e.V. Berlin<br />
Schmalkalden, 19. bis 23. September 2001 zum Thema<br />
„Regionale und Angewandte Geologie in der Grenzregion der Süddeutschen und der Mitteldeutschen Scholle“