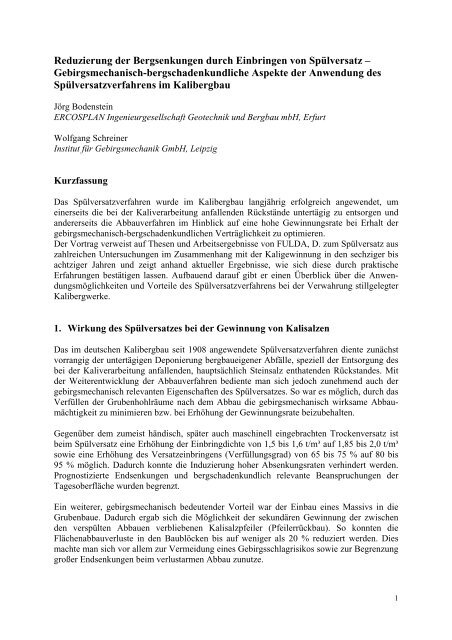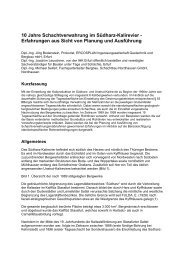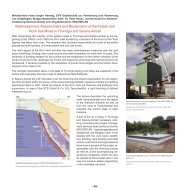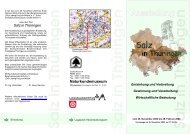Bodenstein, J. - ercosplan
Bodenstein, J. - ercosplan
Bodenstein, J. - ercosplan
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Reduzierung der Bergsenkungen durch Einbringen von Spülversatz –<br />
Gebirgsmechanisch-bergschadenkundliche Aspekte der Anwendung des<br />
Spülversatzverfahrens im Kalibergbau<br />
Jörg <strong>Bodenstein</strong><br />
ERCOSPLAN Ingenieurgesellschaft Geotechnik und Bergbau mbH, Erfurt<br />
Wolfgang Schreiner<br />
Institut für Gebirgsmechanik GmbH, Leipzig<br />
Kurzfassung<br />
Das Spülversatzverfahren wurde im Kalibergbau langjährig erfolgreich angewendet, um<br />
einerseits die bei der Kaliverarbeitung anfallenden Rückstände untertägig zu entsorgen und<br />
andererseits die Abbauverfahren im Hinblick auf eine hohe Gewinnungsrate bei Erhalt der<br />
gebirgsmechanisch-bergschadenkundlichen Verträglichkeit zu optimieren.<br />
Der Vortrag verweist auf Thesen und Arbeitsergebnisse von FULDA, D. zum Spülversatz aus<br />
zahlreichen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Kaligewinnung in den sechziger bis<br />
achtziger Jahren und zeigt anhand aktueller Ergebnisse, wie sich diese durch praktische<br />
Erfahrungen bestätigen lassen. Aufbauend darauf gibt er einen Überblick über die Anwendungsmöglichkeiten<br />
und Vorteile des Spülversatzverfahrens bei der Verwahrung stillgelegter<br />
Kalibergwerke.<br />
1. Wirkung des Spülversatzes bei der Gewinnung von Kalisalzen<br />
Das im deutschen Kalibergbau seit 1908 angewendete Spülversatzverfahren diente zunächst<br />
vorrangig der untertägigen Deponierung bergbaueigener Abfälle, speziell der Entsorgung des<br />
bei der Kaliverarbeitung anfallenden, hauptsächlich Steinsalz enthatenden Rückstandes. Mit<br />
der Weiterentwicklung der Abbauverfahren bediente man sich jedoch zunehmend auch der<br />
gebirgsmechanisch relevanten Eigenschaften des Spülversatzes. So war es möglich, durch das<br />
Verfüllen der Grubenhohlräume nach dem Abbau die gebirgsmechanisch wirksame Abbaumächtigkeit<br />
zu minimieren bzw. bei Erhöhung der Gewinnungsrate beizubehalten.<br />
Gegenüber dem zumeist händisch, später auch maschinell eingebrachten Trockenversatz ist<br />
beim Spülversatz eine Erhöhung der Einbringdichte von 1,5 bis 1,6 t/m³ auf 1,85 bis 2,0 t/m³<br />
sowie eine Erhöhung des Versatzeinbringens (Verfüllungsgrad) von 65 bis 75 % auf 80 bis<br />
95 % möglich. Dadurch konnte die Induzierung hoher Absenkungsraten verhindert werden.<br />
Prognostizierte Endsenkungen und bergschadenkundlich relevante Beanspruchungen der<br />
Tagesoberfläche wurden begrenzt.<br />
Ein weiterer, gebirgsmechanisch bedeutender Vorteil war der Einbau eines Massivs in die<br />
Grubenbaue. Dadurch ergab sich die Möglichkeit der sekundären Gewinnung der zwischen<br />
den verspülten Abbauen verbliebenen Kalisalzpfeiler (Pfeilerrückbau). So konnten die<br />
Flächenabbauverluste in den Baublöcken bis auf weniger als 20 % reduziert werden. Dies<br />
machte man sich vor allem zur Vermeidung eines Gebirgsschlagrisikos sowie zur Begrenzung<br />
großer Endsenkungen beim verlustarmen Abbau zunutze.<br />
1
2. Eigenschaften und Kennwerte des Versatzmaterials<br />
Die günstigen gebirgsmechanischen Eigenschaften des Spülversatzmassivs werden vor allem<br />
durch die Beschaffenheit der Ausgangsstoffe sowie durch die Art des Einbringens geprägt.<br />
Kalirückstände als klassisches Spülversatzmaterial besitzen aufgrund des hohen Steinsalzanteiles<br />
die Fähigkeit zur Rekristallisation, wodurch sich gebirgsähnliche Festigkeiten<br />
erzielen lassen. Die als Transportmedium verwendete Fabriklauge spielt dabei sowohl für das<br />
Bindeverhalten als auch für das primäre Sedimentationsverhalten des Versatzmaterials eine<br />
wesentliche Rolle. FULDA, D. postulierte in seinen wissenschaftlichen Arbeiten:<br />
Die einaxiale Druckfestigkeit des eingebrachten Spülversatzes ist im wesentlichen ein<br />
Resultat von chemischen Bindungsprozessen. Sie ist nicht die entscheidende Kennziffer für die<br />
Wirksamkeit des Versatzes, sondern sein Porenvolumen bzw. seine Kompressibilität.<br />
Es zeigt sich, daß es mit dem Spülversatzverfahren bei Einstellung stabiler Gemische mit<br />
definierten Eigenschaften der Ausgangsstoffe möglich ist, Hohlraumverfüllungen herzustellen,<br />
die nach relativ kurzer Zeit nicht nur hohe Druckfestigkeiten sondern auch geringe<br />
Permeabilitäten aufweisen.<br />
Im Einzelnen ergeben sich jedoch signifikante Unterschiede bezüglich der Kennwerte Dichte,<br />
Druckfestigkeit, Porosität und Permeabilität in Abhängigkeit von der jeweiligen Korngrößenverteilung<br />
und Homogenität des Spülversatzgemisches, was aus der Beprobung und labormäßigen<br />
Untersuchung alter Spülversatzkörper abgeleitet werden konnte (Abb. 1).<br />
Abb. 1: Bohrkerne aus Spülversatzmassiven des Südharzreviers<br />
3. Tragverhalten von Spülversatzpfeilern<br />
Im Ergebnis zahlreicher wissenschaftlicher Arbeiten leitete FULDA, D. in den sechziger<br />
Jahren ab:<br />
Durch das Spülversatzverfahren können aus dem Abprodukt Fabrikrückstand (oder anderen<br />
bergfremden Reststoffen) Tragelemente hergestellt werden, die in ihrem gebirgsmechanischen<br />
Verhalten (Tragfähigkeit, Deformierbarkeit) Hartsalzpfeilern entsprechen und analog<br />
dimensioniert werden können. Durch eine konvergenzbedingte Verdichtung nimmt ihre<br />
Tragfähigkeit im Zeitverlauf zu.<br />
Diese Erkenntnisse wurden in den Folgejahren im Südharz-Kalirevier vielfach genutzt, um<br />
durch den Rückbau der in Spülversatzfeldern verbliebenen Kalisalzpfeiler die Gewinnungsrate<br />
entscheidend zu erhöhen. Dabei erfolgte örtlich sowohl teilweiser (z. B. jeder zweite<br />
Pfeiler) als auch totaler Pfeilerrückbau. Die damit neu geschaffenen Abbaue wurden feldweise<br />
anschließend mit Spülversatz wieder verfüllt oder auch offen belassen.<br />
In Auswertung der fortlaufend durchgeführten Senkungsnivellements über alten Abbaufeldern<br />
des Südharz-Kalireviers läßt sich die o. a. These zum gebirgsmechanischen Verhalten von<br />
Spülversatzpfeilern bestätigen, wie Abb. 2 am Beispiel der Grube Sollstedt zeigt. Das<br />
Senkungsverhalten der Tagesoberfläche über Spülversatzfeldern mit Pfeilerrückbau zeigt<br />
signifikante Übereinstimmung mit der Senkungsentwicklung über Hartsalzbaufeldern mit<br />
Langkammerbau sowohl hinsichtlich der realisierten Senkungsraten als auch in Bezug auf die<br />
Gesamtsenkung.<br />
2
Abb. 2: Senkungsentwicklung der Tagesoberfläche über Spülversatzfeldern mit<br />
Pfeilerrückbau<br />
4. Senkungsentwicklung über Spülversatzfeldern<br />
Daß der Spülversatz sehr gut in der Lage ist, die Gesamtsenkung der Tagesoberfläche über<br />
Abbaufeldern des Kalibergbaus wirksam zu begrenzen, zeigt sich besonders deutlich am<br />
Beispiel der Grube Roßleben, wo er von 1916 bis 1985 großflächig betrieben wurde. Abb. 3<br />
verdeutlicht, daß die Senkungsgeschwindigkeit über den verspülten Baufeldern nach wenigen<br />
Jahrzehnten weitestgehend zur Ruhe gekommen ist.<br />
Abb. 3: Senkungsgeschwindigkeit der Tagesoberfläche im Einwirkungsbereich der Grube<br />
Roßleben im Jahr 1994<br />
Im Rahmen des Abschlußgutachtens für die im Jahr 1991 stillgelegte Grube Roßleben wurde<br />
eine gebirgsmechanische Modellierung vorgenommen. Die darauf aufbauende Senkungsprognose<br />
weist für einen Zeitraum von 1.000 Jahren eine signifikante flächendeckende<br />
Begrenzung der Endsenkung auf etwa 1,0 m über den verspülten Feldesteilen aus (Abb. 4).<br />
Damit verbunden ist eine wirksame Verhinderung bergschadenkundlich relevanter Auswirkungen,<br />
welche sich aus senkungsbedingten Schieflagen und Zerrungen oder Pressungen<br />
ergeben können.<br />
Abb. 4: Prognose der Gesamtsenkung der Tagesoberfläche im Einwirkungsbereich der<br />
Grube Roßleben im Jahr 2994.<br />
5. Möglichkeiten der Anwendung des Spülversatzverfahrens bei der<br />
Verwahrung stillgelegter Kalibergwerke<br />
5.1 Verfahrenstechnische Vorteile und mögliche Anwendungsfälle<br />
Ausgehend von den in den vorangegangenen Abschnitten hervorgehobenen Merkmalen des<br />
klassischen Spülversatzes lassen sich vor allem für die Verwahrung stillgelegter Kali- und<br />
Steinsalzbergwerke Anwendungsmöglichkeiten, für die gerade das Spülversatzverfahren<br />
hinsichtlich der erreichbaren Wirkungen prädestiniert ist. Dabei gilt es jedoch zu beachten,<br />
daß die ursprünglich verwendeten Ausgangsmaterialien nicht mehr oder nur noch sehr<br />
begrenzt zur Verfügung stehen. Die Suche nach alternativen Ausgangsstoffen bietet gleichzeitig<br />
die Möglichkeit der Verfahrensoptimierung und –anpassung an die konkret gestellten<br />
Anforderungen.<br />
Vorrangig wird das Spülversatzverfahren dort anzuwenden sein, wo eine Verfüllung nicht<br />
mehr zugänglicher oder nur mit wirtschaftlich unvertretbarem Aufwand zugänglich zu<br />
machender Abbaubereiche erforderlich und gleichzeitig eine Verwertung bergbaufremder<br />
Abfälle möglich ist.<br />
Bei optimierter Verfahrenstechnologie ist von folgenden erreichbaren Wirkmechanismen<br />
auszugehen:<br />
3
Das Verfüllen großflächig offen belassener Baufelder führt zu einer zeitlichen und<br />
größenmäßigen Begrenzung erwarteter Restsenkungen an der Tagesoberfläche.<br />
Durch eine gebirgsmechanisch und hydraulisch wirksame Parzellierung des Grubengebäudes<br />
kann ein großflächiger Baufeldkollaps verhindert oder die Zirkulation von<br />
Standlaugen maßgeblich behindert werden.<br />
Aufgrund der Versatzwirkung kommt es zur Behinderung der standzeitbedingten Entfestigung<br />
sowie zur langfristigen Wiederverfestigung der Tragelemente, was vor allem zur<br />
Dämpfung der dynamischen Reaktivität sprödbruchgefährdeter Tragelemente und somit<br />
zur maßgeblichen Begrenzung möglicher seismischer Emissionen führt.<br />
Die Bedeutung des letztgenannten Effektes für die Beherrschung carnallititischer Baufelder<br />
wurde durch FULDA, D. in den 80er Jahren erkannt, indem er postulierte:<br />
Gegenüber Pfeilern aus Carnallitit ist die Tragfähigkeit deutlich höher. Es besteht keine<br />
Sprödbruchgefahr.<br />
Insgesamt ist es durch gezielte Anwendung eines nachträglichen Spülversatzes möglich, einen<br />
entscheidenden Beitrag zur Gewährleistung der Langzeitsicherheit eines stillgelegten Bergwerkes<br />
sowie zur Beseitigung kritischer Gefährdungspotentiale infolge langfristig anhaltender<br />
großer Absenkung der Tagesoberfläche oder der standzeitbedingten Auslösung von<br />
Gebirgsschlägen zu leisten.<br />
5.2 Geeignete Versatzmaterialien und erwartete Versatzwirkungen<br />
Die Verwertung von geeigneten bergbaufremden Abfällen als Versatz unter Anwendung des<br />
Spülversatzverfahrens ist inzwischen durch zahlreiche labortechnische Untersuchungen als<br />
auch durch in-situ-Ergebnisse belegt. Vor allem in der Grube Bleicherode der NDH Entsorgungsbetreibergesellschaft<br />
mbH wird das Verfahren seit 1992 mit Erfolg praktiziert und<br />
weiterentwickelt. Das Deformationsverhalten des verfestigten Versatzkörpers wurde an<br />
Bohrkernen untersucht und läßt auf außerordentlich günstige gebirgsmechanische Eigenschaften<br />
schließen (Abb. 5).<br />
Abb. 5: Druckversuch an einem Bohrkern aus Spülversatz mit bergfremden Abfällen<br />
Das nach der Stillegung für die Grube Bleicherode ausgewiesene Gefährdungspotential ging<br />
vor allem von dem großflächig gebauten Ostfeld mit carnallititisch ausgebildeten Tragelementen<br />
aus. Die gebirgsmechanische Modellierung wies eine bergschadenkundlich<br />
unverträgliche Endsenkung von bis zu 3,0 m sowie einen mittel- bis langfristig möglichen<br />
Gebirgsschlag mit einer Lokalmagnitude zwischen 3,7 und 4,5 und einer plötzlichen Absenkung<br />
der Tagesoberfläche um 0,1 bis 0,4 m aus.<br />
Für den Versatz des Baufeldes konnte unter Ansatz des Spülversatzverfahrens im Modell eine<br />
maßgeblich verringerte Restsenkung ermittelt werden. Die Magnitude eines möglichen<br />
seismischen Ereignisses bleibt geringer als 2,0 und somit deutlich unterhalb der möglichen<br />
seismischen Anregung. Der maximal zu erwartende Senkungssprung verringert sich auf<br />
weniger als 5 mm.<br />
4
5.3 Vermeidung von Gebirgsschlägen in der Nachbetriebsphase<br />
Aufgrund der hohen Löslichkeit des Carnallitit war die Anwendung des Spülversatzverfahrens<br />
in carnallititischen Baufeldern lange Zeit umstritten. Durch Beobachtungen in situ<br />
und durch die Auswertung vergleichender Laboruntersuchungen gelangte FULDA, D. in den<br />
80er Jahren zu der Auffassung:<br />
Bei Einhaltung eines MgCl2-Gehaltes der Spüllaugen von > 220 g/l und Sättigung an NaCl<br />
und KCl bleibt beim Verspülen von Carnallititabbauen die Zersetzung des anstehenden<br />
Carnallitit auf den unmittelbaren Stoßbereich beschränkt. Der Pfeiler selbst bleibt von der<br />
Lauge isoliert (Sylvinitisierungssaum). Es tritt keine lösungs- oder feuchtebedingte Beeinträchtigung<br />
der Pfeilerstandsicherheit ein.<br />
In der Grube Bleicherode wird der Spülversatz mit bergbaufremden Abfällen seit 1992 großtechnisch<br />
betrieben. Mit der nachweislichen Reduzierung der Senkungsraten sowie der<br />
Begrenzung der seismischen Aktivität auf Ereignisse mit Magnituden < 2 läßt sich der<br />
gewünschte und erwartete Verwahrungserfolg bereits heute belegen.<br />
Eine weitere Anwendungsmöglichkeit des Spülversatzverfahrens besteht bei der Sicherung<br />
und Verwahrung großer Einzelhohlräume, wie sie z. B. beim Carnallitit-Kuppenabbau<br />
entstehen. Am Modell konnte nachgewiesen werden, daß durch die Verfüllung die Reaktivität<br />
des Hohlraumes entscheidend reduziert wird. Die bei dynamischer Anregung induzierte<br />
Lokalmagnitude, welche bei offenem Kuppenhohlraum kettenreaktionsartig zu einem<br />
Gebirgsschlag führt, kann durch den Spülversatz auf einen Wert begrenzt werden, der<br />
unterhalb der Anregungsschwelle liegt (Abb. 6).<br />
Abb. 6: Reaktivität des offenen und des verfüllten Kuppenhohlraumes bei dynamischer<br />
Anregung<br />
Zusammenfassend kann durch praktische Erfahrungen und durch Simulation am gebirgsmechanischen<br />
Modell bestätigt werden, was FULDA, D. im Jahr 1989 allgemein postulierte:<br />
Durch Spülversatz können Gebirgsschläge in carnallitischen Abbaufeldern vermieden<br />
werden.<br />
5