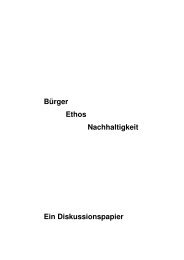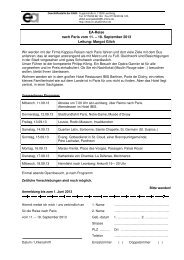Download im PDF-Format - Evangelische Akademikerschaft in ...
Download im PDF-Format - Evangelische Akademikerschaft in ...
Download im PDF-Format - Evangelische Akademikerschaft in ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Je stärker sich der plurale Charakter moderner Gesellschaften<br />
ausprägt, desto forcierter tritt auch die<br />
Standortbezogenheit jedes Wortgebrauchs hervor,<br />
mit dem sich die E<strong>in</strong>zelnen ihrer Individualität und<br />
Geme<strong>in</strong>schaftsbezogenheit vergewissern. Konkurrenzsituationen<br />
best<strong>im</strong>men die Lage, Lebenswelten<br />
werden zunehmend politisiert. Es eröffnen sich<br />
Chancen und Gestaltungsspielräume.<br />
Sobald Begriffe <strong>in</strong> den Bereich des Politischen<br />
h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>greifen, wirken sie zwangsläufig abgrenzend<br />
und zugleich situationsbezogen. Je nach Maßgabe<br />
ihres semantischen Aufladungspotentials avancieren<br />
Begriffe zur Angriffswaffe, zum Propagandamittel<br />
<strong>im</strong> Parteienkampf um zeitdiagnostische Deutungshoheit.<br />
Unter der trügerisch e<strong>in</strong>d<strong>im</strong>ensionalen Klarheit<br />
der Sprachoberfläche gespeicherte Spannungen<br />
werden <strong>im</strong> politischen Wörterstreit gezielt aktiviert,<br />
um die Stärke der jeweils eigenen Position desto<br />
wirkungsvoller zu präsentieren. Gerungen wird um<br />
die Durchsetzung von Herrschafts- und Gestaltungsansprüchen,<br />
die Setzung von E<strong>in</strong>deutigkeit als E<strong>in</strong>dämmung<br />
von Kont<strong>in</strong>genz.<br />
Theologische Werkstatt<br />
Die Freiheit der Werte<br />
Warum sich Menschenwürde nicht als Diskursbremse<br />
eignet<br />
von Alf Christophersen<br />
Die Ethik kann als kritische Reflexion über Moral zur gesell-<br />
schaftlichen Selbstverständigung beitragen. Sie verfügt aber<br />
ke<strong>in</strong>esfalls über e<strong>in</strong>en Universalschlüssel zur Lösung aller<br />
möglichen Konflikte. In den aktuellen Diskursen wird der<br />
Würdebegriff <strong>in</strong>flationär verwendet und droht so <strong>in</strong>haltlich<br />
entleert zu werden. Wem nichts mehr e<strong>in</strong>fällt, der beschwört<br />
die Würde. Aber das tut ihr nicht gut.<br />
Grundwerte und Kommunikationsfähigkeit<br />
Der Verwaltungsjurist und Soziologe Niklas Luhmann,<br />
Hauptvertreter der “Systemtheorie”, warf<br />
1992 <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Heidelberger Vortrag die Frage auf:<br />
“Gibt es <strong>in</strong> unserer Gesellschaft noch unverzichtbare<br />
Normen?” Vor allem das Problem e<strong>in</strong>er Inflationierung,<br />
e<strong>in</strong>es “pandemiehaften” Gebrauchs der<br />
Menschenwürdeidee trieb Luhmann um. Konsequent<br />
forderte er, den Fokus gezielt auf Fälle ihrer<br />
Verletzung zu richten.<br />
Mit dem nüchternen Beobachterblick des Soziologen<br />
konstatierte Luhmann: “Wie Sterne am H<strong>im</strong>mel<br />
gibt es unzählige Werte, weshalb man Grundwerte<br />
braucht, um Emphase auszudrücken. Hier werden<br />
dann Traditionsbegriffe wie Freiheit, Gleichheit,<br />
Gerechtigkeit, Frieden, Sicherheit, Würde, Wohlfahrt,<br />
Solidarität benutzt, um Sonderrang zu markieren.”<br />
E<strong>in</strong>her g<strong>in</strong>gen diese Setzungen mit dem<br />
Verzicht auf Begründungszusammenhänge. Dadurch<br />
komme es zu e<strong>in</strong>em Abbruch wirklicher<br />
Kommunikation.<br />
Die Vielfalt der Werte, ja ihre schlichte Masse,<br />
verlagere das <strong>in</strong> ihnen wohnende Chaos auf die Entscheidungsebenen,<br />
von denen E<strong>in</strong>deutigkeit erwartet<br />
werde. Werte kämen zum E<strong>in</strong>satz, “um Entscheidungen<br />
e<strong>in</strong>en Rückhalt <strong>in</strong> Unbezweifeltem zu geben”.<br />
Aber eben diese aus Abwägungsprozessen entstehenden<br />
Entscheidungen produzierten ihre Ergebnisse <strong>in</strong><br />
Form der Kont<strong>in</strong>genz, der Zufälligkeit.<br />
Hier<strong>in</strong> kann nun e<strong>in</strong>e besondere Tragik des Wertebegriffs<br />
gefunden werden. In se<strong>in</strong>er klassischen<br />
Abhandlung Grundrechte als Institution kam Luhmann<br />
schon 1965 zur E<strong>in</strong>sicht, dass mit dem Wertbegriff<br />
“die Schließung des unendlich-offenen Hori-<br />
evangelische aspekte 3/2009 41
Theologische Werkstatt<br />
zontes der Handlungsmöglichkeiten” gesucht werde,<br />
also e<strong>in</strong>e “Gesamtkonstruktion der Welt”. Diese erfolge<br />
durch den Aufbau von Systemen, und das <strong>im</strong><br />
Wertbegriff postulierte Absolute f<strong>in</strong>de sich <strong>in</strong> ihrer<br />
Funktionsfähigkeit.<br />
Damit die Systeme aber zu dieser Leistung <strong>im</strong><br />
Stande s<strong>in</strong>d, muss notwendig Kommunikation stattf<strong>in</strong>den,<br />
die e<strong>in</strong>erseits zu generalisieren, andererseits<br />
aber zu differenzieren hat, um<br />
Stabilität zu gewährleisten. Umso<br />
schwerwiegender wirkt es sich<br />
Prof. Dr. Alf Christophersen<br />
lehrt<br />
für die gesellschaftlichen Funkti-<br />
Systematische<br />
onszusammenhänge aus, wenn<br />
Theologie an der<br />
tragende Begriffe der Diskurse<br />
Evangelisch-Theo-<br />
durch übermäßigen Gebrauch trilogischen<br />
Fakultät<br />
vialisiert und ihrer analytischen<br />
der Ludwig-Maxi-<br />
Dist<strong>in</strong>ktionskraft beraubt wermilians-Universität<br />
München.<br />
den.<br />
42<br />
Menschenwürde: e<strong>in</strong> bewusst deutungsoffener<br />
Begriff<br />
Nicht erst Luhmann beobachtete freilich den Wertwortgebrauch<br />
mit wachsender Skepsis. Im Kontext<br />
der Ause<strong>in</strong>andersetzung mit Friedrich Nietzsche<br />
und dessen Rückführung der Wertsetzung auf den<br />
“Willen zur Macht” gelangte etwa Mart<strong>in</strong> Heidegger<br />
<strong>in</strong> den Holzwegen zu der E<strong>in</strong>sicht, dass das Denken<br />
<strong>in</strong> Werten, “das Werthafte […] zum positivistischen<br />
Ersatz für das Metaphysische” geworden sei; allerd<strong>in</strong>gs<br />
entspreche der “Häufigkeit des Redens von<br />
Werten die Unbest<strong>im</strong>mtheit des Begriffs. Diese<br />
ihrerseits entspricht der Dunkelheit der Wesensherkunft<br />
des Wertes aus dem Se<strong>in</strong>. Denn gesetzt, dass<br />
der <strong>in</strong> solcher Weise vielberufene Wert nicht nichts<br />
ist, muss er wohl se<strong>in</strong> Wesen <strong>im</strong> Se<strong>in</strong> haben.”<br />
Der Wert werde von e<strong>in</strong>em Gesichtspunkt aus<br />
beurteilt und bemessen. Im Rekurs auf Nietzsche ist<br />
sich Heidegger gewiss: “Der Wert ist Wert, <strong>in</strong>sofern<br />
er gilt. Er gilt, <strong>in</strong>sofern er als das gesetzt ist, worauf<br />
es ankommt.”<br />
Wird die Wertfrage <strong>in</strong> verfassungstheoretische<br />
Zusammenhänge überführt, erhält sie e<strong>in</strong>e ganz eigene<br />
Brisanz, wie die nunmehr über 60 Jahre währenden<br />
Debatten um das Grundgesetz zeigen. Hier<br />
beanspruchten gleich zu Beg<strong>in</strong>n – als Thema der<br />
Rechtswissenschaft und politischen Ordnung – Geltung<br />
und Begründung der Menschenwürde Aufmerksamkeit,<br />
und zwar vor dem H<strong>in</strong>tergrund theologischer<br />
und philosophischer Traditionsbildung.<br />
evangelische aspekte 3/2009<br />
Der Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik<br />
Deutschland hält zur Menschenwürde <strong>in</strong><br />
aller Universalität fest: “Die Würde des Menschen<br />
ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist<br />
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das deutsche<br />
Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und<br />
unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage<br />
jeder menschlichen Geme<strong>in</strong>schaft, des Friedens und<br />
der Gerechtigkeit <strong>in</strong> der Welt.”<br />
Im Selbstverständnis dieser Verfassungsurkunde<br />
liegt die besondere Po<strong>in</strong>te der Menschenwürde dar<strong>in</strong>,<br />
dass es sich bei ihr um e<strong>in</strong>en Begriff handelt,<br />
der bewusst deutungsoffen gehalten ist. Als der Text<br />
ausgearbeitet wurde, postulierte <strong>im</strong> Parlamentarischen<br />
Rat Theodor Heuss: “Ich möchte bei der Formung<br />
des ersten Absatzes von der Menschenwürde<br />
ausgehen, die der E<strong>in</strong>e theologisch, der Andere philosophisch,<br />
der Dritte ethisch auffassen kann.”<br />
Heuss verstand die Würde des Menschen, so<br />
se<strong>in</strong>e berühmte Formel, als e<strong>in</strong>e “nicht<strong>in</strong>terpretierte<br />
These”. Um e<strong>in</strong>en möglichst breiten Konsens zu erzielen,<br />
sahen die Verfassungsväter davon ab, die<br />
Menschenwürde eigens zu begründen. Diese Aufgabe<br />
überließen sie großzügig der Institution des<br />
Grundgesetzkommentars und den Experten des<br />
Faches.<br />
Das “christliche Menschenbild” als<br />
Kern des Menschenwürdekonzepts<br />
Im Grundgesetz kommt der Menschenwürde e<strong>in</strong> besonderer<br />
normativer Rang zu, der durch die Ewigkeitsgarantie<br />
des Artikels 79 Absatz 3 abgesichert<br />
wird. Die Würde des Menschen erhält e<strong>in</strong>e absolute<br />
Garantie, jede Antastung ist e<strong>in</strong> Verfassungsverstoß,<br />
sie lässt sich mit ke<strong>in</strong>em E<strong>in</strong>zelgrundrecht oder<br />
e<strong>in</strong>em anderen Verfassungswert abwägen, ist somit<br />
jedem Relativierungsversuch entzogen.<br />
Ausgehend vom Artikel 1 hat sich der Heidelberger<br />
Rechtswissenschaftler Paul Kirchhof mit der<br />
“Wertgebundenheit des Rechts” (<strong>in</strong>: Eilert Herms<br />
[Hg.]: Menschenbild und Menschenwürde, 2001,<br />
156-172) befasst und ist dabei zu e<strong>in</strong>er engen Verknüpfung<br />
von Christentum und Grundgesetz gelangt.<br />
“Die Garantie der Menschenwürde begründet<br />
e<strong>in</strong> subjektives Recht jedes e<strong>in</strong>zelnen, setzt sich also<br />
gegenüber dem mehrheitlichen oder auch e<strong>in</strong>st<strong>im</strong>migen<br />
Willen des demokratischen Staatsvolkes oder<br />
sonstiger Entscheidungsbefugter durch.” Die Menschenwürde<br />
beanspruche Universalität und sei je-
dem Verfassungsgeber als unverzichtbarer Verfassungsbestandteil<br />
vorgegeben, und zwar “ungeachtet<br />
se<strong>in</strong>es konkreten historischen Willens”. Bei<br />
der Menschenwürde handele es sich um e<strong>in</strong> Grundrecht,<br />
das auf e<strong>in</strong>e gewährleistende Institution angewiesen<br />
sei. So erwachse der konkrete “Gehalt aus<br />
den staatlichen Gewährleistungen”: Der Staat trete<br />
als Würdegarant auf, er habe zu achten und zu<br />
schützen.<br />
Es reiche also nicht aus, dass er <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en Organen<br />
zu e<strong>in</strong>er bloßen Respektierung der Würde gelange.<br />
Die Menschenwürde habe, so Kirchhof, den<br />
Rang e<strong>in</strong>er “verfassungsrechtlichen Basisnorm, e<strong>in</strong>er<br />
Staatsfundamentalnorm, die der gesamten staatlichen<br />
Rechtsordnung Maß und Ziel” gebe. Die Würdegarantie<br />
versehe den Staat mit e<strong>in</strong>er Wertgebundenheit,<br />
der Rechtsstaat habe <strong>in</strong> ihr se<strong>in</strong> Fundament.<br />
Kirchhof me<strong>in</strong>t <strong>im</strong> Grundgesetz und se<strong>in</strong>er<br />
Basisnorm das “Gedächtnis der Demokratie” ausmachen<br />
zu können, das <strong>in</strong> bewährten Institutionen<br />
und gesicherten politischen Erfahrungen Gegenwart<br />
und Zukunft verb<strong>in</strong>de. Die Konsequenz sei, dass die<br />
Menschenwürde <strong>in</strong> der Kont<strong>in</strong>uität von philosophischer<br />
und rechtlicher Überlieferung zu deuten sei.<br />
Im Menschenwürdekonzept liege e<strong>in</strong>e verdichtete<br />
Kulturerfahrung vor, als deren Kern der Jurist,<br />
das “christlich geprägte Menschenbild” ausmachen<br />
will. Das christliche Verständnis des Menschen als<br />
Gottes Ebenbild betrachtet Kirchhof als konkretes<br />
Fundament der Verfassung. “Die <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Menschenwürdekultur<br />
e<strong>in</strong>gebettete Freiheit gibt dem Staat<br />
e<strong>in</strong>e Wertungsmitte, dem demokratischen Staatsvolk<br />
e<strong>in</strong>en Zusammenhalt, der Rechtsordnung ihre<br />
tatsächliche Geltungskraft.”<br />
Aber wie entfalten sich vor diesem H<strong>in</strong>tergrund<br />
die Bezüge zu nicht-christlichen Kulturen? Grundsätzlich<br />
sei e<strong>in</strong> freiheitlicher Staat kulturoffen, aber<br />
nur “solange er sich se<strong>in</strong>er eigenen Werte und Ordnungspr<strong>in</strong>zipien<br />
gewiss ist”.<br />
Paul Kirchhof stellt e<strong>in</strong>en untrennbaren Zusammenhang<br />
zwischen <strong>im</strong> Grundgesetz verankerter<br />
Menschenwürde, christlicher Prägung dieser Basisnorm<br />
sowie Wertorientierung des Staates her. Die<br />
Bundesrepublik ersche<strong>in</strong>t somit als vom christlichen<br />
Menschenbild best<strong>im</strong>mter Staat, der sich, solange<br />
se<strong>in</strong>e Wertvorstellungen Akzeptanz f<strong>in</strong>den, als kulturoffen<br />
zeigt. Die Grenzen dieser Offenheit s<strong>in</strong>d<br />
damit aber auch klar vorgegeben und vertragen<br />
ke<strong>in</strong>e Ausnahme.<br />
Die enge B<strong>in</strong>dung und Ableitung staatlichen<br />
Rechts aus christlicher Wertvorstellung ist allerd<strong>in</strong>gs<br />
e<strong>in</strong>e Position, die bei weitem nicht Konsensfähigkeit<br />
beanspruchen kann, wie <strong>in</strong> der exemplarischen<br />
Aussage des ehemaligen Bundesverfassungsrichters<br />
Ernst-Wolfgang Böckenförde zum Ausdruck kommt,<br />
die “unabweisbare, <strong>im</strong> Recht selbst angelegte Frage<br />
nach dem (metapositiven) Grund und Maß des<br />
Rechts” könne “nicht durch Rückgriff auf Werte und<br />
den Wertbegriff zureichend beantwortet werden”<br />
(Recht, Staat, Freiheit, 2. Aufl. 1992, 91). Grundlegend<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Essay über den Wandel des Menschenbildes<br />
<strong>im</strong> Recht (2001), aber auch <strong>in</strong> zahlreichen<br />
Feuilletonbeiträgen macht Böckenförde deutlich,<br />
dass mit dem Zurücktreten des christlichen<br />
Glaubens als Lebensmacht und Orientierungspunkt<br />
eben dieser Glaube und mit ihm se<strong>in</strong> Wahrheitsanspruch<br />
den Charakter e<strong>in</strong>es Angebotes erhalten habe,<br />
das mit anderen Angeboten <strong>in</strong> Konkurrenz stehe.<br />
Es sei Kennzeichen des Pluralismus, dass dem<br />
Menschen die Freiheit zugemutet werde, sich selbst<br />
<strong>im</strong> H<strong>in</strong>blick auf se<strong>in</strong>e höhere Best<strong>im</strong>mung zu orientieren.<br />
Das christliche Menschenbild verliere zunehmend<br />
an Bedeutung gegenüber e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>dividualistisch-autonomen<br />
Best<strong>im</strong>mung des Menschen. E<strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>heitliches “Menschenbild” sei <strong>im</strong> gegenwärtigen<br />
Recht kaum noch vorhanden.<br />
“Groß- und Weichformeln” als E<strong>in</strong>fallstor<br />
für best<strong>im</strong>mte Anschauungen<br />
In der “Akademie für Politische Bildung <strong>in</strong> Tutz<strong>in</strong>g”<br />
fand <strong>im</strong> Mai 2009 e<strong>in</strong> Streitgespräch statt zwischen<br />
dem katholischen Philosophen Robert Spaemann<br />
und Horst Dreier, Verfassungsrechtler an der Universität<br />
Würzburg. Es g<strong>in</strong>g dabei um die Leitfrage, wie<br />
die Zukunft der Menschenwürde aussehe.<br />
Horst Dreier machte deutlich, dass er sie nicht<br />
<strong>in</strong> Frage stellen wolle. Es gebe aber Abwägungskonflikte,<br />
wo sich Würde gegen Würde positioniere. E<strong>in</strong><br />
besonderes Problem erkannte Dreier dar<strong>in</strong>, dass die<br />
Menschenwürde <strong>im</strong>mer mehr <strong>in</strong> den Status des<br />
“Allesproblemlösers” versetzt werde – dies gerade<br />
auch h<strong>in</strong>sichtlich bioethischer Konfliktfelder, wie<br />
der embryonalen Stammzellforschung. Menschenwürde<br />
gerate zum <strong>in</strong>haltsleeren “Megatopos für<br />
Kultiviertheit”.<br />
Gleichzeitig erkennt Dreier e<strong>in</strong>e Sakralisierung<br />
der Idee der Menschenwürde, die darauf h<strong>in</strong>auslaufe,<br />
dass jede abweichende Me<strong>in</strong>ung zurückgedrängt<br />
werde. Dies sei letztlich Ausdruck e<strong>in</strong>es “totalitären<br />
Tugendstaates”, der sich durch das undifferenzierte<br />
Theologische Werkstatt<br />
evangelische aspekte 3/2009 43
Theologische Werkstatt<br />
44<br />
Ine<strong>in</strong>ander von Moral und Recht auszeichne. Menschenwürde<br />
eigne sich demgegenüber nun aber<br />
gerade nicht als Moralersatz oder für die Begründung<br />
e<strong>in</strong>es zivilreligiösen Konzepts.<br />
In se<strong>in</strong>em Grundgesetzkommentar aus dem<br />
Jahr 2004, <strong>in</strong> dem sich auch Ausführungen zur Folterfrage<br />
f<strong>in</strong>den, die 2008 herangezogen wurden, um<br />
die Wahl Dreiers zum Verfassungsrichter erfolgreich<br />
zu durchkreuzen, entfaltet der Würzburger Jurist<br />
se<strong>in</strong>e Position <strong>in</strong> aller Breite. Es sei zwischen e<strong>in</strong>er<br />
“Heraufzonung” der Menschenwürde, etwa durch<br />
den Rekurs auf “Gattungswürde” (als Vertreter für<br />
diesen Typus wird Robert Spaemann genannt), und<br />
e<strong>in</strong>er “Herabzonung” durch Trivialisierung und<br />
Inflationierung zu unterscheiden.<br />
“Art. 1 I GG” sei dabei gerade “ke<strong>in</strong> probater<br />
‘Auffangproblemlöser’” und biete ke<strong>in</strong>en “geistigen<br />
Zauberstab für die humane Bewältigung aller Zukunftsprobleme”.<br />
Es sei nicht möglich, der Norm “e<strong>in</strong>fach<br />
per Wesensschau klare Antworten auf hochkomplexe<br />
Fragen der Staats- und Gesellschaftsentwicklung<br />
<strong>im</strong> allgeme<strong>in</strong>en wie der biotechnologischen<br />
Revolution <strong>im</strong> besonderen” zu entnehmen.<br />
“Vielmehr bergen gerade die genannten Großund<br />
Weichformeln die Gefahr <strong>in</strong> sich, dass Art. 1 I<br />
GG zum E<strong>in</strong>fallstor für best<strong>im</strong>mte Partikularethiken<br />
oder politische Anschauungen wird, die dann als<br />
allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dliche Max<strong>im</strong>e des positiven Verfassungsrechtes<br />
ausgegeben werden.” Die Menschenwürde<br />
des Grundgesetzes sei nun e<strong>in</strong>mal e<strong>in</strong> Konsens<br />
auf hoher Abstraktionsebene, der vor vere<strong>in</strong>heitlichender<br />
weltanschaulicher Vere<strong>in</strong>nahmung<br />
geschützt werden müsse.<br />
Moralisch-politischer Relativismus<br />
e<strong>in</strong>er Wertgeme<strong>in</strong>schaft<br />
Auch Robert Spaemann verlangte <strong>in</strong> Tutz<strong>in</strong>g,<br />
Grundrechte gegene<strong>in</strong>ander abzustufen und nicht<br />
vorschnell die “Menschenrechtskeule” zu zücken.<br />
Nur hält es der Philosoph nicht für möglich, durch<br />
Konsensbildung zu e<strong>in</strong>em Urteil zu gelangen, es<br />
gehe vielmehr um aus dem Naturrecht abzuleitende<br />
Wahrheitsansprüche.<br />
Die Natur selbst sei für den Menschen normsetzend,<br />
entscheidend sei die Gattungszugehörigkeit.<br />
Sie begrenze die Freiheit des Individuums, die ihr<br />
wahres Wesen nicht <strong>im</strong> unbegrenzten Individualismus<br />
habe, sondern <strong>in</strong> der Pflicht des E<strong>in</strong>zelnen,<br />
se<strong>in</strong> jeweiliges Handeln der unmittelbaren Umwelt<br />
evangelische aspekte 3/2009<br />
gegenüber zu begründen und zu rechtfertigen. Die<br />
größte Gefahr e<strong>in</strong>er Rede von Werten macht Spaemann<br />
<strong>im</strong>mer wieder dar<strong>in</strong> aus, dass die so genannte<br />
Wertgeme<strong>in</strong>schaft, die er als Ausdruck e<strong>in</strong>es<br />
moralisch-politischen Relativismus identifiziert,<br />
zuungunsten der für die Gesellschaft unabd<strong>in</strong>glichen<br />
Rechtsgeme<strong>in</strong>schaft überbetont werde. Denn<br />
diese sei schließlich entscheidend und nicht die<br />
Zugehörigkeit zu e<strong>in</strong>em wie auch <strong>im</strong>mer konstruierten<br />
Werteverbund, der totalitäre Ansprüche erheben<br />
könne, denen gegenüber das Recht als zweitrangig<br />
ersche<strong>in</strong>e.<br />
Die Stärke theologischer Sprachspiele<br />
E<strong>in</strong>es zeigt die Tutz<strong>in</strong>ger Debatte zwischen Spaemann<br />
und Dreier deutlich: Es darf ke<strong>in</strong>e Denkverbote<br />
geben. Wer Menschenwürde als Diskursbremse<br />
bemüht, droht Würde missbräuchlich zu verwenden.<br />
Menschenwürde <strong>im</strong>pliziert auch Denk- und<br />
Redefreiheit.<br />
Die Ethik kann als kritische Reflexion über<br />
Moral zur gesellschaftlichen Selbstverständigung<br />
beitragen. Sie dient der Überprüfung von moralischen<br />
Intuitionen, der Suche nach st<strong>im</strong>migen Argumenten<br />
und Begründungsmustern. Sie verfügt aber<br />
ke<strong>in</strong>esfalls über e<strong>in</strong>en Universalschlüssel zur Lösung<br />
aller möglichen Konflikte.<br />
E<strong>in</strong> wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Konsensf<strong>in</strong>dung<br />
ist es, die Beobachtung ernst zu nehmen,<br />
dass <strong>in</strong> den aktuellen Diskursen der Würdebegriff<br />
tatsächlich <strong>in</strong>flationär verwendet wird und so<br />
<strong>in</strong>haltlich entleert zu werden droht. Wem nichts<br />
mehr e<strong>in</strong>fällt, der beschwört die Würde. Aber das<br />
tut ihr nicht gut.<br />
Die Kirchen haben <strong>im</strong> öffentlichen Diskurs der<br />
Bundesrepublik e<strong>in</strong>e wichtige Funktion. Ihre Vertreter<br />
s<strong>in</strong>d präsent <strong>im</strong> Deutschen Ethikrat, <strong>in</strong> unterschiedlichen<br />
Ethikkommissionen. In der Bevölkerung<br />
bestehen hohe Erwartungen an die ethische<br />
Kompetenz der Kirchen. Im R<strong>in</strong>gen um gebotene Versachlichung<br />
haben sie und andere religiöse Akteure<br />
e<strong>in</strong>e entscheidende Rolle zu spielen, der sie aber oft<br />
<strong>in</strong> erkennbarer Trivialisierung ihrer religiösen Symbolsprache<br />
nicht nachkommen.<br />
Geht es um die Menschenwürde, ist das<br />
Menschse<strong>in</strong> wesentlich. E<strong>in</strong>e besondere Bedeutung<br />
kommt den <strong>in</strong>tuitiven Vorstellungen des Menschen<br />
zu, dem Wissen von dem, was für e<strong>in</strong>en Menschen
angemessen oder unangemessen ist. Das Intuitive<br />
überschreitet die bloß rationale Erfassung des Menschen<br />
als Vernunftwesen, das Freiheit und Autonomie<br />
besitzt.<br />
Theologische Ethik verfügt über andere Sprachmuster,<br />
Leitbegriffe und Denkfiguren als der rechtliche<br />
Diskurs und viele Positionen philosophischer<br />
Ethik. Man kann sagen: Gerade <strong>in</strong> den Sprachspielen<br />
der Theologie werden die Probleme besonders<br />
radikal erfasst.<br />
Aus theologischer Perspektive gilt die reformatorische,<br />
von der Rechtfertigungslehre best<strong>im</strong>mte<br />
Unterscheidung zwischen der Würde der Person<br />
und ihren Taten. Weder gute noch schlechte Handlungen<br />
können die Personenwürde qualifizieren.<br />
Eberhard Jüngel brachte dies Anfang der 1980er<br />
Jahre <strong>in</strong> dem Satz zum Ausdruck: “Geschöpfliches<br />
Gegenüber Gottes zu se<strong>in</strong>, das dazu best<strong>im</strong>mt ist,<br />
dessen Anspruch zu entsprechen, konstituiert den<br />
Menschen als Person.”<br />
In se<strong>in</strong>em Personse<strong>in</strong> unterscheide sich der<br />
Mensch von allen anderen Geschöpfen – dieses bedeute<br />
Anspruch und Auszeichnung zugleich. “Des<br />
Menschen höchste Würde ist die, dazuse<strong>in</strong>.” Doch<br />
mit der unmittelbaren Präsenz ist noch ke<strong>in</strong>e Kommunikation<br />
gesetzt, und diese ist gefordert, will sich<br />
e<strong>in</strong>e Gesellschaft stabil halten.<br />
Hermeneutische Sensibilität bei<br />
der Profilierung diskursleitender<br />
Begriffe<br />
Mit e<strong>in</strong>facher Beobachtung von Systemabläufen und<br />
dem Verzicht auf Normsetzung ist es, so postuliert<br />
auch Jürgen Habermas stets aufs Neue, nicht getan.<br />
In se<strong>in</strong>er Rede zum Thema “Glauben und Wissen”,<br />
die er anlässlich der Verleihung des Friedenspreises<br />
des Deutschen Buchhandels <strong>im</strong> Jahr 2001 <strong>in</strong> Frankfurt<br />
hielt, beschreibt Habermas den Prozess der<br />
Säkularisierung als Übersetzungsleistung.<br />
Dabei wählt er als Beispiel die Beschreibung der<br />
Geschöpflichkeit des Menschen als Ebenbild Gottes;<br />
<strong>in</strong> ihr drücke sich “e<strong>in</strong>e Intuition aus, die auch dem<br />
religiös Unmusikalischen etwas sagen” könne. Die<br />
“absolute Differenz zwischen Schöpfer und<br />
Geschöpf” dürfe, folgert der e<strong>in</strong>stige “Verächter” der<br />
Religion jetzt, nicht e<strong>in</strong>geebnet werden; denn nur so<br />
lange bedeute “die göttliche Formgebung ke<strong>in</strong>e<br />
Determ<strong>in</strong>ierung, die der Selbstbest<strong>im</strong>mung des<br />
Menschen <strong>in</strong> den Arm” falle.<br />
“Die <strong>in</strong>s Leben rufende St<strong>im</strong>me Gottes kommuniziert<br />
von vornhere<strong>in</strong> <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es moralisch<br />
empf<strong>in</strong>dlichen Universums. Deshalb kann Gott den<br />
Menschen <strong>in</strong> dem S<strong>in</strong>ne ‚best<strong>im</strong>men‘, dass er ihn<br />
zur Freiheit gleichzeitig befähigt und verpflichtet.”<br />
Das zu Reflexion fähige Ich ist gefordert. Nichts<br />
liegt dem menschlichen Gehirn näher als konsequente<br />
Selbstbespiegelung – begleitet vom bohrenden<br />
Zweifel eben des Ichs, ob es wirklich der Souverän<br />
ist. Die Gefahr, dachte Mart<strong>in</strong> Heidegger, ist<br />
groß, sich <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en Möglichkeiten existenziell zu<br />
verlaufen und zu verkennen; denn <strong>in</strong> “Se<strong>in</strong> und<br />
Zeit” gründe “die Undurchsichtigkeit des Dase<strong>in</strong>s<br />
nicht e<strong>in</strong>zig und pr<strong>im</strong>är <strong>in</strong> ‘egozentrischen’ Selbsttäuschungen,<br />
sondern ebensosehr <strong>in</strong> der Unkenntnis<br />
der Welt”.<br />
Was passiert aber nun, wenn die zur politischethischen<br />
Selbstverständigung verwendeten Begriffe<br />
so unscharf werden, dass die Kommunikation substanziell<br />
zusammenbricht? Dies wäre das Ende pluraler,<br />
freiheitlich-demokratischer Gesellschaften.<br />
Die Qualität politischer Kampfbegriffe erweist<br />
sich <strong>in</strong> ihrem evidenten Zugriff auf die momentane<br />
Wirklichkeit und <strong>im</strong> Versprechen zukunftsmächtiger<br />
Gestaltungskraft. Wird darauf verzichtet, hermeneutisch<br />
sensibel die diskursleitenden Begriffe zu<br />
profilieren und ihre mühsam erarbeitete Differenzierungsqualität<br />
zu erhalten, gleichen sich die Leere<br />
der Sprachwelten und die Profillosigkeit der Umwelt<br />
e<strong>in</strong>ander zwangsläufig <strong>in</strong> ihrer antihumanen Zerstörungskraft<br />
an. ó<br />
Theologische Werkstatt<br />
evangelische aspekte 3/2009 45