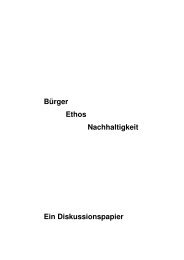2/2013 - Evangelische Akademikerschaft in Deutschland
2/2013 - Evangelische Akademikerschaft in Deutschland
2/2013 - Evangelische Akademikerschaft in Deutschland
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Rundbrief 2/<strong>2013</strong><br />
<strong>Evangelische</strong> <strong>Akademikerschaft</strong> <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong><br />
Landeverband Rhe<strong>in</strong>land e.V.<br />
Abraham und Isaak<br />
Quelle: Dieter Schütz / pixelio.de<br />
Seite 1
EDITORIAL<br />
Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Freund<strong>in</strong>nen des Landesverbandes Rhe<strong>in</strong>land,<br />
<strong>in</strong> unserem diesjährigen Veranstaltungsprogramm - erstmalig <strong>in</strong> ansprechender Form<br />
und farbenfroher Aufmachung gestaltet - haben wir wieder e<strong>in</strong>e Reihe von Themen<br />
angepackt, <strong>in</strong> denen sich aktuelle Lebensfragen unserer Zeit widerspiegeln. Unsere<br />
Frühjahrstagung <strong>in</strong> der <strong>Evangelische</strong>n Akademie Bad Godesberg hatte sich dem Leben <strong>in</strong><br />
den Städten <strong>in</strong> der Zukunft gewidmet. Im Zentrum der Beiträge und Diskussionen stand<br />
die Frage nach e<strong>in</strong>em lebenswerten Zusammenleben <strong>in</strong> Würde und Wohlergehen. Es<br />
blieb nicht aus, dass auf dieser Tagung die Vielzahl bedrohlicher und lebensgefährdender<br />
Probleme aufgezeigt wurde. Doch es wurde auch deutlich, dass dort, wo Gefahren<br />
drohen, auch das Rettende wächst und ermutigende Hoffnungen auf keimen. Dies wurde<br />
den Teilnehmern von Studienleiter Peter Mörbel <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Tagungsandacht e<strong>in</strong>drücklich<br />
vermittelt. Und so haben wir uns entschlossen, den Andachtstext <strong>in</strong> diesen Rundbrief<br />
aufzunehmen.<br />
Seit längerem mehren sich die Kontakte zwischen Juden, Christen und Muslimen <strong>in</strong> Dialogen<br />
und <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Trialog. Sie haben zu Annäherungen geführt, die früher kaum denkbar<br />
gewesen wären. Die Gestalt des Abraham, die <strong>in</strong> den heiligen Schriften dieser drei<br />
Religionen e<strong>in</strong>e wichtige Rolle spielt und damit die religiöse Grundlage dieses Trialogs<br />
ist, stand im Zentrum e<strong>in</strong>es Thementages, den unser Landesverband im Februar dieses<br />
Jahres <strong>in</strong> Bonn durchgeführt hat. Dass Wege der Verständigung zwischen Juden, Christen<br />
und Muslimen möglich s<strong>in</strong>d, wurde <strong>in</strong> Podiumsgesprächen ganz praktisch aufgezeigt.<br />
Mit dem Beitrag von Dr. Werner Trutw<strong>in</strong>, der e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> diese Thematik<br />
gibt, wollen wir zum weiteren Nachdenken und zur Diskussion anregen.<br />
Wer hat sich nicht schon bee<strong>in</strong>drucken lassen von den großen musikalischen Werken<br />
Johann Sebastian Bachs, der mit der gewaltigen Ausdruckskraft se<strong>in</strong>er schöpferischen<br />
musikalischen Mittel vielen Menschen den Zugang zum christlichen Glauben aufgezeigt<br />
hat? Das Schöpferische und die Ausstrahlung se<strong>in</strong>er Musik ist um so erstaunlicher als<br />
Bach se<strong>in</strong> ganzes Leben lang mit schwierigsten Lebensumständen und e<strong>in</strong>er Vielzahl von<br />
Widrigkeiten zu kämpfen gehabt hatte. Der Beitrag von Wolfgang Stockmeier greift dies<br />
auf und zeichnet das Leben dieses Ausnahmemenschen Bach <strong>in</strong> e<strong>in</strong>fühlsamer und bereichernder<br />
Weise nach.<br />
Nun bleibt mir nur noch, Sie auf unsere Mitgliederversammlung am 23. November h<strong>in</strong>zuweisen,<br />
auf der satzungsgemäß die Wahlen zu Vorstand und Beirat stattf<strong>in</strong>den. Die<br />
Wahlen s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> besonderer Höhepunkt <strong>in</strong> unserem Verbandsleben. Wir bitten Sie ganz<br />
herzlich, nach Möglichkeit daran teilzunehmen und damit Ihre Verbundenheit mit der<br />
<strong>Evangelische</strong>n <strong>Akademikerschaft</strong> zu bekunden. Teilen Sie uns bitte mit, ob Sie e<strong>in</strong>e Mitfahrgelegenheit<br />
benötigen.<br />
Es grüßt Sie im Namen der Rundbrief-Redaktion<br />
Rudolf Diersch<br />
Seite 2
INHALT<br />
EDITORIAL S. 2<br />
INHALTSVERZEICHNIS S. 3<br />
BESINNUNG<br />
Andacht zur Tagung „Stadt der Zukunft“ S. 4<br />
BEITRÄGE<br />
Die abrahamitischen Religionen S. 8<br />
Anmerkungen zu Johann Sebastian Bach S. 12<br />
AUS UNSEREM LANDESVERBAND<br />
Unser Leben nach der ESG S. 18<br />
Hauskreis Heyde <strong>in</strong> Bonn S. 20<br />
Impressionen von der Eifel-Wanderung S. 22<br />
AUS DEN EV. STUDIERENDENGEMEINDEN<br />
Bericht vom ESG-Ehemaligentreffen <strong>in</strong> Bonn S. 23<br />
AUS DEM BUNDESVERBAND<br />
Gründung des neuen LV Mitteldeutschland S. 24<br />
VORSCHAU UND TERMINE<br />
Wahlaufruf S. 27<br />
Mitgliederversammlung und<br />
Wahlen zu Vorstand und Beirat am 23.11.<strong>2013</strong> S. 28<br />
Thementag Reformation und Toleranz 7. Dezember., Wuppertal S. 29<br />
VORSTAND UND BEIRAT S. 31<br />
Seite 3
BESINNUNG<br />
Andacht auf der Kooperationstagung<br />
des Landesverbandes Rhe<strong>in</strong>land<br />
mit der <strong>Evangelische</strong>n Akademie im Rhe<strong>in</strong>land<br />
zum Thema „Stadt der Zukunft - Stadt der Hoffnung“<br />
vom 23. bis 24. März <strong>2013</strong> <strong>in</strong> Bonn - Bad Godesberg<br />
Peter Mörbel<br />
Cassandra Steen und Adel Tawil:<br />
Stadt<br />
Es ist so viel, so viel zuviel<br />
Überall Reklame<br />
Zuviel Brot und zuviel Spiel<br />
Das Glück hat ke<strong>in</strong>en Namen<br />
Alle Straßen s<strong>in</strong>d befahren<br />
In den Herzen kalte Bilder<br />
Ke<strong>in</strong>er kann Gedanken lesen<br />
Das Klima wird milder<br />
Refra<strong>in</strong>:<br />
Ich bau ne Stadt für dich<br />
Aus Glas und Gold und Ste<strong>in</strong><br />
Und jede Straße die h<strong>in</strong>ausführt<br />
Führt auch wieder re<strong>in</strong><br />
Ich bau ne Stadt für dich - und für mich<br />
Ke<strong>in</strong>er weiß mehr wie er aussieht - oder wie er heißt<br />
Alle s<strong>in</strong>d hier auf der Flucht - die Tränen s<strong>in</strong>d aus Eis<br />
Es muss doch auch anders gehen - so geht das nicht weiter<br />
Wo f<strong>in</strong>d ich Halt, wo f<strong>in</strong>d ich Schutz - der Himmel ist aus Blei hier<br />
Ich geb ke<strong>in</strong>e Antwort mehr - auf die falschen Fragen<br />
Die Zeit ist rasend schnell verspielt - und das Glück muss man jagen<br />
E<strong>in</strong>e Stadt <strong>in</strong> der es ke<strong>in</strong>e Angst gibt nur Vertrauen<br />
Wo wir die Mauern aus Gier und Verächtlichkeit abbauen<br />
Wo das Licht nicht erlischt<br />
Das Wasser hell<br />
Und jedes Morgenrot<br />
Seite 4
BESINNUNG<br />
Und jeder Traum sich lohnt<br />
Und wo jeder Blick durch Zeit und Raum <strong>in</strong> unsere Herzen fließt.<br />
Refra<strong>in</strong>:<br />
…..<br />
Offenbarung Kapitel 21, 1-18<br />
1 Und ich sah e<strong>in</strong>en neuen Himmel und e<strong>in</strong>e neue Erde; denn der erste Himmel und die<br />
erste Erde s<strong>in</strong>d vergangen, und das Meer ist nicht mehr….<br />
….<br />
18 Und ihr Mauerwerk war aus Jaspis und die Stadt aus re<strong>in</strong>em Gold, gleich re<strong>in</strong>em<br />
Glas.<br />
Liebe Tagungsgeme<strong>in</strong>de,<br />
das s<strong>in</strong>d zwei sehr verschiedene Texte. Der e<strong>in</strong>e - e<strong>in</strong> modernes Liebeslied aus unseren<br />
Tagen. Der andere e<strong>in</strong>e alte Vision. Was ist das Verb<strong>in</strong>dende? Beide f<strong>in</strong>den sich mit<br />
den jeweiligen Realitäten nicht ab. Die Welt, so wie sie erlebt wird, ist unerträglich.<br />
Beide Texte entwerfen Visionen, um über diese Unerträglichkeit h<strong>in</strong>wegzukommen.<br />
Das ist die Vision von e<strong>in</strong>er neuen Stadt aus Glas und Gold und Ste<strong>in</strong>. Und es ist<br />
der Widerstand gegen die Entmenschlichung des Menschen.<br />
Schauen wir uns zunächst das moderne Lied noch e<strong>in</strong>mal an:<br />
Das Vielzuviel des Großstadtgetümmels macht unsere Städte e<strong>in</strong>erseits quirlig, aufregend<br />
und lebendig, aber zugleich auch hektisch, gesichtslos und „unwirtlich“. Dieses<br />
Attribut „unwirtlich“ hat der Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich <strong>in</strong> der Mitte der<br />
60iger Jahre dem wuchernden Wachstum der deutschen Nachkriegsstädte gegeben.<br />
Auch e<strong>in</strong> halbes Jahrhundert danach beklagen Cassandra Stehen und Adel Tawil diese<br />
Unwirtlichkeit der Städte, die alle und alles entwertet.<br />
„Es muss doch auch anders gehen …“ Darum belassen die beiden es nicht dabei, an<br />
der Unwirtlichkeit nur lyrisch zu leiden, sondern sie protestieren gegen die Kälte. die<br />
irrs<strong>in</strong>nige Beschleunigung, gegen die falschen Fragen und die permanenten Fluchten<br />
vor Jedem und Allem.<br />
Ihr Protest im Namen der Menschlichkeit gebiert e<strong>in</strong>en Gegenentwurf. Sie erträumen,<br />
ne<strong>in</strong>: sie fordern e<strong>in</strong>e neue Stadt, <strong>in</strong> der es anders, menschlicher, wärmer zugeht, wo<br />
Menschen behutsam mite<strong>in</strong>ander umgehen. Diese neue Stadt wird aus Gold und Glas<br />
und Ste<strong>in</strong> gebaut werden.<br />
Seite 5
BESINNUNG<br />
Nun s<strong>in</strong>d Gold, Glas und Ste<strong>in</strong> auch die kalten Baumaterialien des Reichtums und der<br />
Macht. Polierter Granit, verspiegelte Glasfassaden und der Prunk goldener Armaturen<br />
am Treppengeländer oder <strong>in</strong> den Hotelsuiten. Doch im Lied verwandeln sich diese<br />
Materialien <strong>in</strong> ihr Gegenteil: der Ste<strong>in</strong> wird zum Symbol des Soliden, Gold wird zum<br />
Symbol des Wertbeständigen („treu wie Gold“) und Glas zum S<strong>in</strong>nbild der Transparenz<br />
(kristallklar). Alle Baumaterialien können - so verstanden - Schutz bieten und<br />
die Gewähr, dass e<strong>in</strong>er den anderen sieht, wie er wirklich ist, dass e<strong>in</strong>er den anderen<br />
wertschätzt und dadurch Vertrauen zue<strong>in</strong>ander und untere<strong>in</strong>ander wächst. Da lässt<br />
sichs gut leben und dort bleibt man gern.<br />
E<strong>in</strong>e Stadt <strong>in</strong> der es ke<strong>in</strong>e Angst gibt nur Vertrauen…<br />
Und wo jeder Blick durch Zeit und Raum <strong>in</strong> unsere Herzen fließt<br />
Klar, das ist e<strong>in</strong> Liebeslied, aber e<strong>in</strong>es, das die anderen mit e<strong>in</strong>bezieht <strong>in</strong> das Vertrauen<br />
, <strong>in</strong> die Zärtlichkeit, e<strong>in</strong> Lied, das den anderen an der Helligkeit und an der Hoffnung<br />
teilhaben lässt: „Wo jedes Morgenrot und jeder Traum sich lohnt.“<br />
Ich bau ne Stadt für dich…und für mich<br />
Dieser moderne Popsong greift - vielleicht nicht zufällig - auf jenes Material zurück,<br />
aus dem auch das Neue Jerusalem bestehen wird, von dem Johannes, der Seher der<br />
Offenbarung berichtet. Dieses neue Jerusalem, das sich allerd<strong>in</strong>gs nicht zwei Verliebte<br />
zurechtbauen als ihre heile Traumwelt, ist Teil e<strong>in</strong>er großen Vision von der neuen Welt,<br />
die auf Gerechtigkeit, Gewaltfreiheit und die Gegenwart Gottes gegründet se<strong>in</strong> wird.<br />
Diese neue Stadt ist nicht etwa das Ergebnis menschlicher Bemühungen um e<strong>in</strong>e bessere<br />
Welt, sondern es ist e<strong>in</strong> radikaler Neuanfang. Die neue Stadt wird den Menschen<br />
als nagelneues Architekturmodell schlüsselfertig und bewohnbar aus dem Himmel<br />
herab gereicht. Ke<strong>in</strong> Umbau, ke<strong>in</strong>e Sanierung, ke<strong>in</strong> Wiederaufbau, ke<strong>in</strong>e planungsaufwendige<br />
erhaltende Erneuerung, sondern e<strong>in</strong> völliger Neuanfang.<br />
Das neue Jerusalem steht nicht <strong>in</strong> der ambivalenten Tradition der europäischen Städte,<br />
im Grund auch nicht <strong>in</strong> der Tradition der altorientalischen Stadtkultur, auch wenn die<br />
Reißbrettmaße es nahe legen und sie auch nicht die Reparaturvariante für jene Stadtkultur,<br />
die die Bibel auf den Brudermörder Ka<strong>in</strong> zurückführt ( Gen 4,17). Die nea<br />
polis, das Neapel Gottes, ist e<strong>in</strong>e analogielose Neuschöpfung, die mit der Stadtkultur<br />
aus Ka<strong>in</strong>s Zeiten bricht. Das neue Jerusalem ist so bemessen, dass e<strong>in</strong> anderes, e<strong>in</strong><br />
besseres Leben dar<strong>in</strong> möglich se<strong>in</strong> wird, ohne Tränen, ohne Schmerz, ohne Geschrei,<br />
ja ohne Tod (Offenb. 21,4).<br />
E<strong>in</strong>e Stadt aus Glas und Gold und Ste<strong>in</strong>, die nicht als Wiedergeburt des alten, von<br />
den Römern im Jahr 70 brutal geschleiften Jerusalems kommen wird, sondern völlig<br />
Seite 6
BESINNUNG<br />
neu und gänzlich anders, bis dah<strong>in</strong>, dass sie ke<strong>in</strong> Zentralheiligtum mehr enthalten wird<br />
(Offenb 21,3). Gott wird ke<strong>in</strong>e separate Wohnung beziehen, <strong>in</strong> der er im allerheiligsten<br />
Séparée nur für e<strong>in</strong>e Handvoll Kultpersonal nahbar ist, sondern er will mitten unter<br />
se<strong>in</strong>en Menschen leben.<br />
Das neue Jerusalem ist e<strong>in</strong> stark verschlüsseltes Widerstandsbild. Es ist e<strong>in</strong> Gegenentwurf<br />
gegen das mächtige Rom, das mit e<strong>in</strong>er brutalen Unterdrückungspolitik alle unter<br />
die Knute se<strong>in</strong>es Rechts gezwungen hat. Mit gnadenloser Gewalt hatte das römische<br />
Reich jeden Widerstand <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en Prov<strong>in</strong>zen brechen können, um anschließend se<strong>in</strong>e<br />
Pax Romana zu oktroyieren, den römischen Frieden des verzweifelten Schweigens, wie<br />
er den Unterlegenen aller Zeiten von Siegern aufgezwungen wird.<br />
Dagegen wird der Frieden, den das neue Jerusalem ausstrahlt, ke<strong>in</strong> Überlebensangebot<br />
für Unterlegene se<strong>in</strong>. In der nea polis wird das Leben bed<strong>in</strong>gungslos möglich se<strong>in</strong> - auf<br />
Augenhöhe mit dem Schöpfer. Das ist das Atemberaubende an dem Bild: Die Distanz<br />
zwischen Himmel und Erde entfällt und damit alle anderen Hierarchien. Menschen<br />
können aufatmen, weil der Kreislauf der Gewalt und der Vernichtung durchbrochen<br />
se<strong>in</strong> wird.<br />
Der Tod wird nicht mehr se<strong>in</strong>. Nicht: alles auf Anfang, sondern: Alles wird neu<br />
und doch als polis, als Stadt, als geordnetes, wohnliches, politisches Mite<strong>in</strong>ander <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em bergenden und zugleich transparenten „Mauerwerk aus Jaspis und die Stadt aus<br />
re<strong>in</strong>em Gold, gleich re<strong>in</strong>em Glas.“ - e<strong>in</strong> Ort, an dem sich Himmel und Erde liebevoll<br />
berühren.<br />
Verstehen kann das nicht die Vernunft. Für die Vernunft ist e<strong>in</strong>e solche Vision, auch<br />
wenn sie rationale Strukturen aufweist, e<strong>in</strong> pathologischer Befund. Wie ja auch die<br />
Liebe für die Vernunft nicht wirklich fassbar und e<strong>in</strong> eher krankhaftes Phänomen von<br />
temporärer Verwirrung ist. Aber für den Glauben, der e<strong>in</strong>e andere Sicht der D<strong>in</strong>ge<br />
und der Menschen ermöglicht, ist die Neue Stadt e<strong>in</strong>e kommende Realität, auf die zu<br />
hoffen schon jetzt und hier S<strong>in</strong>n stiftet. Amen.<br />
Seite 7
BEITRÄGE<br />
Die abrahamitischen Religionen<br />
Der Trialog als Thema des katholischen Religionsunterrichts<br />
Dr. Werner Trutw<strong>in</strong><br />
Vorbemerkung: Während Abraham immer Gegenstand des katholischen Religionsunterrichts<br />
war, ist <strong>in</strong> den letzten Jahrzehnten das Thema dah<strong>in</strong>gehend erweitert worden,<br />
dass Abraham <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Bedeutung nicht nur für das Christentum, sondern auch für das<br />
Judentum und den Islam <strong>in</strong> den Blick genommen wurde. Das zeigt sich u .a. <strong>in</strong> den von<br />
mir verantworteten Schulbüchern für die Sekundarstufe I und II. Bei e<strong>in</strong>er Tagung im<br />
Februar <strong>2013</strong> <strong>in</strong> Bonn wurde ich gebeten, e<strong>in</strong>ige Auszüge daraus zu Verfügung zu stellen.<br />
Ich wähle zwei Beispiele aus den letzten Ausgaben zweier Schulbuchwerke, die Texte<br />
früherer Auflagen <strong>in</strong> neuer, revidierter Fassung br<strong>in</strong>gen. Sie s<strong>in</strong>d den beiden Unterrichtsreihen<br />
entnommen und werden hier - gekürzt - abgedruckt:<br />
Werner Trutw<strong>in</strong>: „Zeit der Freude. Religionsunterricht - Sekundarstufe I; Band 1; Jahrgangsstufe<br />
5/6“, Bayerischer Schulbuch Verlag, München, <strong>2013</strong> im Druck; S. 54<br />
Werner Trutw<strong>in</strong>: „Islam“, aus der Reihe „Weltreligionen - Arbeitsbücher Sekundarstufe<br />
II“, Bayerischer Schulbuch Verlag, München, 2010, S. 128-131<br />
Abrahamische Religionen: Abraham - drei Perspektiven<br />
1. Judentum - Stammvater des Volkes<br />
Im Alten Testament setzt die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel bei der Berufung<br />
Abrahams e<strong>in</strong>, dem e<strong>in</strong> neues Land verheißen wird. Er soll der Vater e<strong>in</strong>es<br />
großen Volkes (Israel/Judentum) werden. Diese Verheißung wurde auf Isaak, den Sohn<br />
Saras, weitergegeben. Darauf stützt sich bis heute der jüdische Glaube, dass Abraham<br />
der Stammvater des jüdischen Volkes ist. Se<strong>in</strong>e Berufung hat zugleich e<strong>in</strong>e universale<br />
Dimension.<br />
„Der Herr sprach zu Abraham: Zieh weg aus de<strong>in</strong>em Land, von de<strong>in</strong>er Verwandtschaft<br />
und aus de<strong>in</strong>em Vaterhaus <strong>in</strong> das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu<br />
e<strong>in</strong>em großen Volk machen, dich segnen und de<strong>in</strong>en Namen groß machen. E<strong>in</strong> Segen<br />
sollst du se<strong>in</strong>. Ich will segnen, die dich segnen; wer dich verwünscht, den will ich verfluchen.<br />
Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen Segen erlangen.“ (Gen.<br />
12, 1-3)<br />
„Er führte ihn h<strong>in</strong>aus und sprach: Sieh doch zum Himmel h<strong>in</strong>auf und zähl die Sterne,<br />
wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich werden de<strong>in</strong>e Nachkommen<br />
se<strong>in</strong>. Abraham glaubte dem Herrn und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit<br />
an.“ (Gen 15, 5-6)<br />
Seite 8
BEITRÄGE<br />
2. Christentum - Vater des Glaubens<br />
Im ersten Wort des Neuen Testaments wird Jesus programmatisch „Sohn Abrahams“<br />
(Mt. 1,1) genannt. Vor allem Paulus <strong>in</strong>teressiert sich für die Bedeutung Abrahams<br />
(Röm. 4, 17f; Gal. 3, 6-9). Er stützt sich auf die universale Dimension des<br />
Alten Testaments, das schon bei der Berufung Abrahams (Gen. 12, 3 u. ö.) alle Völker<br />
der Erde im Blick hat. In se<strong>in</strong>er Interpretation ist Abraham zwar nicht der leibliche<br />
Vater, wohl aber der Vater des Glaubens - auch für die Heiden (Christen).<br />
Von Abraham wird gesagt: Er glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet.<br />
Daran erkennt ihr, dass nur die, die glauben, Abrahams Söhne s<strong>in</strong>d. Und da<br />
die Schrift vorhersah, dass Gott die Heiden aufgrund des Glaubens gerecht macht, hat<br />
sie dem Abraham im Voraus verkündet: Durch dich sollen alle Völker Segen erlangen.<br />
Also gehören alle, die glauben, zu dem glaubenden Abraham und werden wie er gesegnet.“<br />
(Gal. 3, 6-9)<br />
3. Islam - Der erste Muslim<br />
Der Koran zeigt an e<strong>in</strong>er bewegenden Stelle ähnlich wie Gen. 15, 5-6, wie Gott den<br />
Abraham, der aus e<strong>in</strong>er polytheistischen Familie kam, zum Glauben an E<strong>in</strong>en Gott<br />
berief. Er war zunächst - wie die antiken Anhänger der Sternen- und Sonnenkulte - von<br />
der Schönheit der Sterne, des Mondes und der Sonne so fasz<strong>in</strong>iert, dass er sie für göttlich<br />
(„Erhalter“, d. h. „Schöpfer“) hielt. Am Ende erkennt er, dass sie Geschöpfe s<strong>in</strong>d und<br />
nur der Glaube an den e<strong>in</strong>zigen Schöpfer aller D<strong>in</strong>ge berechtigt ist. Damit ist er der erste<br />
Muslim.<br />
„Dann, als die Nacht ihn mit ihrer F<strong>in</strong>sternis überschattete, erblickte Abraham<br />
e<strong>in</strong>en Stern; (und) er rief aus: Dies ist me<strong>in</strong> Erhalter! - aber als er unterg<strong>in</strong>g, sagte<br />
er: Ich liebe nicht die D<strong>in</strong>ge, die untergehen. Dann, als er den Mond aufgehen<br />
sah, sagte er: Dies ist me<strong>in</strong> Erhalter! - aber als er unterg<strong>in</strong>g, sagte er: Fürwahr, wenn<br />
me<strong>in</strong> Erhalter mich nicht recht leitet, werde ich ganz gewiss e<strong>in</strong>er von den Leuten<br />
werden, die irregehen! Dann, als er die Sonne aufgehen sah, sagte er: Dies ist<br />
me<strong>in</strong> Erhalter! Dies ist das größte (von allen)! - aber als (auch) sie unterg<strong>in</strong>g, rief<br />
er aus: O me<strong>in</strong> Volk! Siehe, fern sei es von mir, etwas anderem neben Gott, wie<br />
ihr es tut, Göttlichkeit zuzuschreiben! Siehe, Ihm, der die Himmel und die Erde<br />
<strong>in</strong>s Dase<strong>in</strong> brachte, habe ich me<strong>in</strong> Gesicht zugewandt, <strong>in</strong>dem ich mich von allem,<br />
was falsch ist, abwandte; und ich b<strong>in</strong> nicht e<strong>in</strong>er jener, die etwas anderem neben Ihm<br />
Göttlichkeit zuschreiben.“ (Sure 6, 76-79)<br />
Seite 9
BEITRÄGE<br />
Der Trialog - e<strong>in</strong> Fortschritt zwischen den Religionen<br />
Der Trialog zwischen Juden, Christen und Muslimen hat, wenn man von e<strong>in</strong>igen<br />
Vorstufen absieht, erst nach den Schrecken der Schoa und des 2. Weltkriegs begonnen.<br />
Damals kamen zuerst e<strong>in</strong>zelne Vertreter, später auch offizielle Amtsträger der<br />
drei Religionen zu der E<strong>in</strong>sicht, dass e<strong>in</strong> Gespräch mite<strong>in</strong>ander notwendig ist. Die<br />
Geschichte hatte gezeigt, zu welch furchtbaren Erschütterungen die religiösen Fe<strong>in</strong>dschaften<br />
führen. Zu wenig hatten die Religionen ihre Chance wahrgenommen, sich<br />
geme<strong>in</strong>sam gegen Brutalität, Hass und Unfrieden - auch bei den eigenen Gläubigen -<br />
zu wenden und ihrem Auftrag zum Frieden und zur Versöhnung gerecht zu werden.<br />
Seitdem mehren sich die Kontakte der drei Religionen <strong>in</strong> Dialogen und <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Trialog.<br />
Sie haben schon zu Annäherungen geführt, die früher kaum denkbar gewesen<br />
wären.<br />
Geme<strong>in</strong>samkeiten und Ähnlichkeiten<br />
Religiöse Grundlagen des Trialogs s<strong>in</strong>d Geme<strong>in</strong>samkeiten, Verwandtschaften oder<br />
Ähnlichkeiten, so der Glaube an Gott, den Schöpfer und Vollender der Welt, die Achtung<br />
vor Abraham, Mose und den Propheten, die Hochschätzung der Vernunft, der<br />
E<strong>in</strong>satz für Frieden und Gerechtigkeit, Achtung vor dem Leben, ethische Gebote,<br />
Gebete, Brauchtum, Wallfahrten, Feste, Ablehnung der Religionslosigkeit oder Religionsfe<strong>in</strong>dlichkeit<br />
und des Sittenverfalls <strong>in</strong> der Moderne.<br />
Schwierigkeiten und Asymmetrien<br />
Die Gestalt des Abraham, die <strong>in</strong> den heiligen Schriften der drei Religionen e<strong>in</strong>e wichtige<br />
Rolle spielt, wird unterschiedlich <strong>in</strong>terpretiert und manchmal sogar exklusiv nur<br />
für die eigene Religion beansprucht. Im Judentum ist er über Isaak, den (2.) Sohn<br />
se<strong>in</strong>er Frau Sara, im Islam über Ismael, den (1.) Sohn der Nebenfrau Hagar der leibliche<br />
Vater der Gläubigen, im Christentum ist er durch se<strong>in</strong>en Glauben der geistige<br />
Vater der Christen.<br />
Die Stiftergestalten Mose, Jesus Christus und Mohammed haben e<strong>in</strong>e unterschiedliche<br />
Bedeutung für die Gläubigen.<br />
E<strong>in</strong>e pr<strong>in</strong>zipielle Schwierigkeit im Trialog besteht dar<strong>in</strong>, dass Islam und Christentum<br />
jeweils e<strong>in</strong>en absoluten Anspruch auf Wahrheit erheben, der im Trialog nicht zur<br />
Disposition stehen kann, weil er auf göttlicher Offenbarung beruht.<br />
Es bestehen erhebliche Asymmetrien zwischen den drei Religionen. Es gibt heute<br />
13 Millionen Juden, 2,1 Milliarden Christen und 1, 4 Milliarden Muslime. In<br />
Seite 10
BEITRÄGE<br />
allen Religionen f<strong>in</strong>den sich Gruppierungen mit unterschiedlichen Auffassungen über<br />
Lehre und Leben. Die Gläubigen leben nicht <strong>in</strong> denselben Regionen und Kulturen<br />
der Welt.<br />
Im Trialog werden viele religiöse Begriffe wie Gott und Mensch, Glaube und Leben<br />
nicht <strong>in</strong> gleicher Weise verstandenen und s<strong>in</strong>d deshalb schwer vergleichbar oder auch<br />
unvergleichbar. Sie s<strong>in</strong>d schon bei Dialogen zwischen Juden und Christen, Muslimen<br />
und Juden, Muslimen und Christen erheblich.<br />
Während die katholische Kirche im Papsttum über e<strong>in</strong>e zentrale Institution verfügt,<br />
die verb<strong>in</strong>dlich für die Kirche sprechen kann, gibt es solche Instanzen weder im Judentum<br />
noch im Islam.<br />
Die Stadt Jerusalem, die den drei Religionen aus unterschiedlichen Gründen heilig ist,<br />
ist bis heute der Schauplatz heftiger Ause<strong>in</strong>andersetzungen.<br />
Die Religionen haben verschiedenartige geschichtliche Erfahrungen, die ihre Existenz<br />
heute prägen. Das Judentum lebt mit der Er<strong>in</strong>nerung an die Schoa, das Christentum<br />
hat sich mit der Aufklärung und Säkularisierung ause<strong>in</strong>andersetzen müssen, der<br />
Islam konnte sich erst jüngst vom Kolonialismus lösen und erlebt e<strong>in</strong>en neuen Aufschwung.<br />
Auch aktuelle Ereignisse belasten den Trialog, z. B. der Nahostkonflikt und neue<br />
Formen des Antijudaismus, die Siedlungspolitik des Staates Israel <strong>in</strong> paläst<strong>in</strong>ensischen<br />
Gegenden, die schleichende Vertreibung mehrerer Millionen arabischer Christen aus<br />
islamischen Ländern, die religiöse und gesellschaftliche Unfreiheit der Christen <strong>in</strong> islamischen<br />
Staaten, die Angst vor neuen Kreuzzügen des Westens gegen den Islam, die<br />
islamistischen Anschläge und Drohungen.<br />
E<strong>in</strong>e unverzichtbare Aufgabe<br />
Dennoch ist es unerlässlich, im Trialog nach Wegen zu suchen, die e<strong>in</strong>en Frieden zwischen<br />
den Religionen herstellen und die die religiösen Ressourcen der drei Religionen,<br />
z. B. Glaube, Hoffnung, Liebe, Gerechtigkeit, Versöhnung, Frieden, für e<strong>in</strong>e bessere<br />
Zukunft der Menschheit erschließen. Trotz mancher Rückschläge gibt es <strong>in</strong> unserem<br />
Zeitalter der Globalisierung für den Trialog ke<strong>in</strong>e Alternative.<br />
Seite 11
BEITRÄGE<br />
Anmerkungen zu Johann Sebastian BACH<br />
Wolfgang Stockmeier<br />
Kurzform des am 3. 11. 2012 <strong>in</strong> der Johanneskirche Wuppertal gehaltenen Vortrags<br />
anlässlich des Thementages „Reformation und die Musik“ unseres Landesverbandes<br />
In Hans Küngs Mozart-Buch (Mozart - Spuren der Transzendenz, München 1991) lese<br />
ich: War Mozarts Musik katholisch oder doch religiös? Und frage: Was kann Musik<br />
alles se<strong>in</strong>? Kann sie religiös oder s<strong>in</strong>nlich oder zugleich religiös und s<strong>in</strong>nlich oder e<strong>in</strong>fach<br />
nur Musik se<strong>in</strong>, oder um mit dem Musikästhetiker Eduard Hanslick zu sprechen:<br />
„tönend bewegte Form“? Ist sie aus dem gleichen „Stoff“, aus dem die Gefühle s<strong>in</strong>d?<br />
Ist sie Vehikel e<strong>in</strong>er Botschaft aus dem Jenseits? Wie stellt sich dieses Problem bei Bach<br />
und se<strong>in</strong>er Musik dar?<br />
Es lässt sich nunmehr nicht vermeiden, über Bachs Leben zu sprechen, doch sollen<br />
gewisse, <strong>in</strong> unserem Zusammenhang relevante Gedanken daran geknüpft bzw. gewisse<br />
Akzente gesetzt werden.<br />
Johann Sebastian Bach wurde am 21. März 1685 <strong>in</strong> Eisenach geboren. Der Neunjährige<br />
verlor Mutter und Vater. Im Mai 1694 starb se<strong>in</strong>e Mutter, im Januar 1695 se<strong>in</strong> Vater.<br />
Sebastians Vater Ambrosius war nach dem Tode se<strong>in</strong>er Frau bereits sieben Monate<br />
später e<strong>in</strong>e neue Ehe e<strong>in</strong>gegangen. Der Bach-Biograph Philipp Spitta bemerkt dazu<br />
mit e<strong>in</strong>er gewissen Nachsicht, dass „Eheliches Zusammenleben für den gesunden<br />
Familiens<strong>in</strong>n der Bachs am schwersten zu entbehren war und sich ihre urwüchsige<br />
Kraft von den Toten rasch wieder den Lebenden zuwandte“. Indessen starb Ambrosius<br />
schon zwei Monate nach se<strong>in</strong>er erneuten Eheschließung, so dass also Sebastian<br />
endgültig als Waise aufwuchs. Er wurde von se<strong>in</strong>em ältesten Bruder Johann Christoph<br />
<strong>in</strong> Ohrdruf aufgenommen. Dort blieb er bis 1700. Da wurde das Haus se<strong>in</strong>es Bruders<br />
<strong>in</strong>folge dessen sich vergrößernder Familie zu kle<strong>in</strong>. Sebastian musste sich e<strong>in</strong>e neue<br />
Bleibe suchen. Der thür<strong>in</strong>gische Kantor Elias Herda, der den jungen Bach schätzte,<br />
empfahl diesen an die Michaelis-Schule <strong>in</strong> Lüneburg. Er war selbst Michaelis-Schüler<br />
gewesen. Bach wanderte also, mit se<strong>in</strong>em Freund Georg Erdmann, nach Lüneburg.<br />
Beide wurden aufgenommen. Von Erdmann wird später noch die Rede se<strong>in</strong>.<br />
Bachs Lüneburger Zeit, die vermutlich reich an musikalischen Anregungen war<br />
(Lüneburg, Celle, Hamburg) endete 1702. Im Jahre 1703 war er e<strong>in</strong>ige Monate lang<br />
als Orchester- oder auch Kammermusiker <strong>in</strong> Weimar tätig. Wir wissen nicht viel über<br />
diese Weimarer Episode.<br />
Im Anschluss daran begann e<strong>in</strong>e der unerfreulichsten Zeiten <strong>in</strong> Bachs Leben. Er fand<br />
e<strong>in</strong>e Anstellung <strong>in</strong> Arnstadt. Arnstadt war e<strong>in</strong>e Kle<strong>in</strong>stadt mit gut 4000 E<strong>in</strong>wohnern.<br />
In diesem kle<strong>in</strong>en Ort, der gleichwohl schon 1266 das Stadtrecht erhalten hatte, residierte<br />
e<strong>in</strong> Reichsgraf. An dessen Hof gab es e<strong>in</strong> kle<strong>in</strong>es Instrumentalensemble, <strong>in</strong> dem<br />
Seite 12
BEITRÄGE<br />
Bach als Geiger und Cembalist nach Bedarf mitgespielt haben dürfte. Se<strong>in</strong>e eigentliche<br />
Stelle hatte er an der Neuen Kirche. Er hatte nicht viel zu tun: Orgeldienst <strong>in</strong> drei<br />
Gottesdiensten am Sonntag, Montag und Donnerstag.<br />
Da Arnstadt ke<strong>in</strong>en Chor hatte, gründete Bach e<strong>in</strong>en solchen. Ob er das freiwillig<br />
oder im Auftrag des Konsistoriums tat, das lassen die Biographen offen. Als Choristen<br />
fungierten Schüler des Gymnasiums, nach zeitgenössischen Quellen, z. B. e<strong>in</strong>em<br />
Dokument des Stadtrats, „e<strong>in</strong>e gänzlich verwilderte Bande“. Mit solchen Halbstarken,<br />
Abkömml<strong>in</strong>gen e<strong>in</strong>er an sich nicht sonderlich kulturbewussten kle<strong>in</strong>bürgerlichen<br />
Bevölkerungsschicht, Chorarbeit zu betreiben, ist für e<strong>in</strong>en Chorleiter kaum erfreulich.<br />
Bach gab sich offenbar ironisch und <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Anspruch hart. Es kam zu Reibereien,<br />
er nannte e<strong>in</strong>en dieser Jüngl<strong>in</strong>ge erwiesenermaßen e<strong>in</strong>en „Zippelfagottisten“.<br />
Der nahm das übel und wollte mit Ges<strong>in</strong>nungsgenossen Bach überfallen. Bach muss<br />
wohl stark und zu allem entschlossen gewirkt haben: die Jüngl<strong>in</strong>ge flohen.<br />
Es dürfte für ihn klar gewesen se<strong>in</strong>, dass Arnstadt für ihn ke<strong>in</strong>e Zukunftsperspektive<br />
bot. Er machte sich auf nach Lübeck - zu Fuß -, wo <strong>in</strong> absehbarer Zeit die Stelle<br />
Dietrich Buxtehudes an St. Marien frei wurde. Vorher hatte er mit se<strong>in</strong>em Cous<strong>in</strong><br />
Johann Ernst Bach vere<strong>in</strong>bart, dass dieser während se<strong>in</strong>er Abwesenheit se<strong>in</strong>e Vertretung<br />
übernehmen sollte. Bach hatte für vier Wochen Urlaub beantragt, blieb aber sechzehn<br />
Wochen weg. Da er e<strong>in</strong>en guten Vertreter hatte, bekümmerte ihn das wenig. Er<br />
hatte sich im Grunde schon von Arnstadt gelöst.<br />
Der Lübecker Plan zerschlug sich. Bach hätte Buxtehudes Tochter heiraten müssen.<br />
Sie war neun Jahre älter als er und gefiel ihm nicht. Er hatte e<strong>in</strong>e andere im S<strong>in</strong>n. In<br />
Arnstadt hatte er se<strong>in</strong>e Kus<strong>in</strong>e Maria Barbara Bach kennen gelernt. Sie war die Tochter<br />
des verstorbenen Gehrener Organisten Johann Michael Bach und lebte <strong>in</strong> Arnstadt bei<br />
ihrer Tante Reg<strong>in</strong>a Wedemann.<br />
Gleich nach se<strong>in</strong>er Rückkehr erhielt Bach vom Konsistorium e<strong>in</strong>e Vorladung. Das Verhandlungsprotokoll<br />
ist erhalten. Se<strong>in</strong>e Urlaubsüberschreitung kam zur Sprache, ferner<br />
se<strong>in</strong> Umgang mit dem Schülerchor, se<strong>in</strong> Orgelspiel (bald zu lang, bald zu kurz), se<strong>in</strong>e<br />
Liedbegleitung, se<strong>in</strong>e Liedharmonisien-. Hierzu muss man sagen: die Konsistorialen<br />
hatten <strong>in</strong> gewisser H<strong>in</strong>sicht sogar recht. Es war damals üblich, dass man zwischen den<br />
Liedzeilen e<strong>in</strong>en oder zwei Zwischentakte spielte. Mir liegen noch aus späterer Zeit<br />
Liedbegleitungen, etwa von R<strong>in</strong>ck, vor. Die e<strong>in</strong>geschobenen Takte waren e<strong>in</strong>e greuliche<br />
Unsitte. Bei schlichten Organisten blieben sie wenigstens im Takt. Aber was Bach<br />
daraus machte, war genialisch und jedenfalls so geartet, dass man bei jedem neuen<br />
Zeilene<strong>in</strong>satz das S<strong>in</strong>gen vergaß bzw. nicht wusste, ob man schon „dran“ war. Was<br />
den empf<strong>in</strong>dlichen Bach empörte, war die Tatsache, dass e<strong>in</strong>e Truppe von unkundigen<br />
Laien sich <strong>in</strong> die Belange e<strong>in</strong>es schlechth<strong>in</strong> genialen Fachmusikers e<strong>in</strong>mischte.<br />
Nach dieser schrecklichen Sitzung, die am 21. Februar 1706 stattfand, gab es am<br />
11.November 1706 noch e<strong>in</strong>e zweite. Man tadelte, dass er nicht, „wie ihm bereits anbefohlen“,<br />
die Arbeit mit dem Schülerchor wiederaufgenommen hatte. Diese Chorarbeit<br />
Seite 13
BEITRÄGE<br />
war von Anfang an se<strong>in</strong> Privatvergnügen, und dass er nach den Erfahrungen mit den<br />
Rabauken ke<strong>in</strong>e Lust mehr dazu hatte, kann man nur zu gut verstehen.<br />
Schwerer noch aber wog e<strong>in</strong> anderer Vorwurf: Er war mit e<strong>in</strong>er fremden Jungfer<br />
alle<strong>in</strong> <strong>in</strong> der Kirche gewesen, und sie hatten auf der dritten Empore mite<strong>in</strong>ander<br />
musiziert. Spitta geht davon aus, dass e<strong>in</strong>e Frau ja nicht <strong>in</strong> der Kirche s<strong>in</strong>gen durfte,<br />
und die Musikwissenschaft ist angesichts der fremden Jungfer, offenbar Bachs bereits<br />
erwähnte Kus<strong>in</strong>e Maria Barbara, ratlos. Dabei ist die Lösung e<strong>in</strong>fach: Sie haben gar<br />
nicht mite<strong>in</strong>ander musiziert! Allenfalls hat er ihr vorgespielt, was er <strong>in</strong> der Ietzten Zeit<br />
komponiert hatte. Damit Bach spielen konnte, musste Barbara (sonst war ja niemand<br />
da) den mechanisch funktionierenden Blasebalg mit dem E<strong>in</strong>satz von Körperkräften.<br />
bedienen. Dass sie dabei gesungen haben sollte - diese Vorstellung ist grotesk! -<br />
Bach bewarb sich nach der Arnstädter Zeit um die Organistenstelle an Divi Blasii <strong>in</strong><br />
Mühlhausen. Ehe er dort den Dienst aufnahm, heiratete er se<strong>in</strong>e Kus<strong>in</strong>e Maria Barbara.<br />
Das war am 17. Oktober 1707 und geschah <strong>in</strong> Dornheim. Die Trauung vollzog<br />
der dortige Pfarrer Lorenz Stauber. Dass Bach nicht an den Segnungen der Arnstädter<br />
Pfarrerschaft <strong>in</strong>teressiert war, versteht sich von selbst.<br />
Es ist noch nachzutragen, dass wahrsche<strong>in</strong>lich <strong>in</strong> Arnstadt der Familientag der Bach-<br />
Familie stattfand, bei dem jenes deftige Quodlibet gesungen wurde (BWV 524), das<br />
leider nur fragmentarisch erhalten ist. Bach schrieb es wohl aus der Er<strong>in</strong>nerung nieder,<br />
e<strong>in</strong> opus, das an erotischer Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lässt und <strong>in</strong> dem sich<br />
die von Spitta so genannte „urwüchsige Kraft‘ der Bachs äußert. -<br />
Das Mühlhausener Amt trat Bach im Juni 1707 an. Doch schon bald zeigte sich, dass<br />
er hier <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en erbitterten religiösen Streit zwischen Orthodoxen und Pietisten geraten<br />
war, der es ihm unmöglich machte, se<strong>in</strong>en „Endzweck, nemlich e<strong>in</strong>e regulirte kirchen<br />
music zu Gottes Ehren“ zu erreichen. So bat er schon im Juni 1708 um se<strong>in</strong>e Entlassung.<br />
Von Mühlhausen aus bewarb sich Bach um die freigewordene Stelle e<strong>in</strong>es Hoforganisten<br />
und Kammermusikers <strong>in</strong> Weimar. Dort regierte der Herzog Wilhelm Ernst<br />
von Sachsen-Weimar, e<strong>in</strong> selbstherrlicher Egozentriker der unangenehmen Sorte. Er<br />
machte Bach zum Konzertmeister, verwehrte ihm aber den entscheidenden Aufstieg<br />
zum Kapellmeister, obgleich er e<strong>in</strong>e gewisse Genugtuung darüber empfunden haben<br />
muss, dass e<strong>in</strong> solch bedeutender Musiker <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en Diensten stand. Telemann hatte<br />
den Kapellmeisterposten abgelehnt. Das kränkte den Herzog, zumal Telemann gesagt<br />
hatte, er habe doch Bach. Das Klima verschlechterte sich, obwohl oder vielleicht<br />
gerade weil Bachs Ruhm wuchs. In der Weimarer Zeit sollte das geplante Wettspiel<br />
Bachs mit Marchand <strong>in</strong> Dresden stattf<strong>in</strong>den, dem sich der Franzose durch die Flucht<br />
entzog.<br />
In ebendieser Zeit bewarb sich Halle um Bach, suchte der Fürst Leopold von Anhalt-<br />
Köthen ihn nach Köthen zu ziehen. Wilhelm Ernst zürnte und verh<strong>in</strong>derte jeden<br />
Seite 14
BEITRÄGE<br />
weiteren Aufstieg Bachs. Als dieser se<strong>in</strong>e Demission erzw<strong>in</strong>gen wollte, warf ihn der<br />
Herzog kurzerhand <strong>in</strong>s Gefängnis.<br />
Betrachtet man die Weimarer Zeit <strong>in</strong>sgesamt, so entdeckt man jedoch auch e<strong>in</strong>ige Positiva:<br />
1708 wurde Cathar<strong>in</strong>a Dorothea, Barbaras und Sebastians erstes K<strong>in</strong>d, geboren,<br />
die junge Familie begann aufzublühen; <strong>in</strong> der Stadtkirche amtierte als Organist Johann<br />
Gottfried Walther, e<strong>in</strong> enger Verwandter Bachs, beide Männer waren freundschaftlich<br />
verbunden; Bach schuf e<strong>in</strong>e immense Anzahl von Werken, die meisten se<strong>in</strong>er Orgelwerke<br />
und viele Kompositionen für Cembalo; es entstand e<strong>in</strong>e Reihe von Kantaten,<br />
<strong>in</strong> denen er zunehmend den neuen Typ mit Arien und Rezitativen anwandte, wobei er<br />
sich oft auf Texte von Erdmann Neumeister und Salomo Franck stützte. -Nun aber<br />
kommen wir zu den glücklichsten Jahren und zur bittersten Katastrophe <strong>in</strong> Johann<br />
Sebastian Bachs Leben. Der junge musikliebende Fürst Leopold von Anhalt-Köthen<br />
berief Bach als Hofkapellmeister nach Köthen. Überblickt man das Schaffen Bachs,<br />
so zeigt sich, dass er immer das komponierte, was <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em jeweiligen Amt gebraucht<br />
wurde. In Weimar waren es vorzugsweise Orgelwerke, <strong>in</strong> Köthen der unbegreifliche<br />
Kosmos se<strong>in</strong>er Kammer-Klavier- und Orchestermusik, jedenfalls e<strong>in</strong> sehr, sehr großer<br />
Teil davon. Da Köthen e<strong>in</strong> reformierter und dazu noch liberaler Hof war, entfiel die<br />
Notwendigkeit, Orgelwerke zu schreiben.<br />
Köthen war zunächst e<strong>in</strong>e Zeit re<strong>in</strong>sten Glücks. Die Freundschaft mit Leopold<br />
beflügelte ihn, - da geschah das Furchtbare: Während er mit se<strong>in</strong>em Fürsten <strong>in</strong> Karlsbad<br />
unterwegs war, starb se<strong>in</strong>e Frau Maria Barbara. Bei se<strong>in</strong>er Rückkehr war sie schon<br />
unter der Erde.<br />
1730 schrieb er rückblickend an se<strong>in</strong>en Jugendfreund Georg Erdmann, dass er me<strong>in</strong>te,<br />
se<strong>in</strong>e Lebenszeit <strong>in</strong> Köthen zu beschließen. Und wieder war er dazu ausersehen,<br />
Unglück zu erdulden, Unglück, das ihn mehr und mehr <strong>in</strong> die Depression trieb.<br />
Der Brief an Erdmann, <strong>in</strong> Leipzig geschrieben, ist e<strong>in</strong> erschütternder Aufschrei: Die<br />
Leipziger Verhältnisse s<strong>in</strong>d entsetzlich und unerträglich, ich will weg; gibt es nicht<br />
für e<strong>in</strong>en „alten treüen Diener dasiges Ohrtes“ e<strong>in</strong>e konvenable Tätigkeit? Bach will<br />
„bestens beflißen seyn“, sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er solchen Stelle zu bewähren (Erdmann war<br />
zunächst <strong>in</strong> Litauen, später <strong>in</strong> Danzig „Oberauditeur“ <strong>in</strong> russischen Diensten). Aus<br />
Bachs Ersuchen wurde nichts, er musste das Leipziger Elend durchstehen. Unbegreiflicherweise<br />
nennt Spitta diesen Brief der Verzweiflung „anmutig“. -<br />
Noch e<strong>in</strong>mal zurück zu Köthen. 1720 starb Maria Barbara. Im Dezember 1722 heiratete<br />
Bach se<strong>in</strong>e zweite Frau Anna Magdalena. Im gleichen Monat heiratete Herzog<br />
Leopold e<strong>in</strong>e Pr<strong>in</strong>zess<strong>in</strong> aus dem Hause Anhalt-Bernburg. Diese war völlig un<strong>in</strong>teressiert<br />
an Musik, und <strong>in</strong>folgedessen ließ die Musikleidenschaft auch bei Leopold nach.<br />
Es wurde nicht mehr musiziert, Bach war überflüssig geworden. Die amusa aus Bernburg<br />
starb schon im April 1723. Der Herzog heiratete zum zweiten Mal im Juni 1725.<br />
Er selbst starb im November 1728. Bach schrieb ihm <strong>in</strong> dankbarer Er<strong>in</strong>nerung e<strong>in</strong>e<br />
Seite 15
BEITRÄGE<br />
Trauermusik. Da er <strong>in</strong> dieser Zeit an der Matthäuspassion arbeitete, verwendete er<br />
neun Stücke sowohl <strong>in</strong> der Passion wie auch <strong>in</strong> der Trauermusik. -<br />
Wir nähern uns dem Jahr 1723, <strong>in</strong> dem das Leipziger Martyrium Bachs begann. Wohl<br />
wäre er gern woandersh<strong>in</strong> gegangen, zum Beispiel nach Hamburg, alle<strong>in</strong> es hat sich<br />
nicht gefügt. 1720 war die Stelle an St. Jacobi vakant. Der Hauptpastor Erdmann Neumeister<br />
(Wir er<strong>in</strong>nern uns, Bach hatte Kantatentexte von ihm vertont.) hätte ihn gern<br />
an se<strong>in</strong>er Kirche gehabt. Doch der Kirchenvorstand wählte e<strong>in</strong>en anderen, der erst<br />
e<strong>in</strong>mal e<strong>in</strong>e Spende von viertausend Goldmark e<strong>in</strong>zahlte. Wir wissen von Neumeisters<br />
Empörung: „Wenn auch e<strong>in</strong>er von den bethlehemitischen Engeln vom Himmel käme,<br />
der göttlich spielte und wollte Organist zu St. Jacobi werden, hätte aber ke<strong>in</strong> Geld, so<br />
möchte er nur wieder davonfliegen.“<br />
--<br />
In Leipzig war man der Me<strong>in</strong>ung, man müsse, wenn man nicht e<strong>in</strong>en erstklassigen<br />
Musiker wie Telemann oder Graupner bekommen könne, mit e<strong>in</strong>em mittelmäßigen<br />
Mann zufrieden se<strong>in</strong>. Man wählte also sehr zögerlich Bach. E<strong>in</strong> Beispiel für das<br />
unsägliche Leipziger Klima ist die Rangelei um die Johannespassion. Bach wollte am<br />
Anfang se<strong>in</strong>er Tätigkeit e<strong>in</strong>e qualitätvolle Passionsmusik aufführen, wenn auch mit den<br />
unzulänglichen Leipziger Kräften. Nun war es üblich, dass Passionsmusiken abwechselnd<br />
<strong>in</strong> St. Nicolai und St. Thomas aufgeführt wurden. Im Jahr 1724 war St. Nicolai<br />
an der Reihe. Dort war e<strong>in</strong>e Aufführung aber nicht möglich: die Orgel war defekt,<br />
das Cembalo unbrauchbar und die Chorpodeste kurz vor dem Zusammenbrechen.<br />
Also setzte Bach die Aufführung <strong>in</strong> St. Thomas an. Das aber erregte e<strong>in</strong>en Sturm der<br />
Entrüstung, schließlich war ja auch St. Nicolai die Predigtkirche des Super<strong>in</strong>tendenten<br />
Deyl<strong>in</strong>g. Bach ließ nicht mit sich handeln. Entweder fände die Aufführung <strong>in</strong><br />
St. Thomas statt oder die Instrumente und Podeste <strong>in</strong> St. Nicolai müssten gründlich<br />
repariert werden. Man entschied sich für die kostspielige Reparatur. Mit solchen Querelen<br />
begann Bachs Leipziger Amtstätigkeit. Und es wurde immer schlimmer. In<br />
den 27 Jahren se<strong>in</strong>er Leipziger Tätigkeit hat Bach nicht die ger<strong>in</strong>gste Anerkennung,<br />
geschweige denn Zuwendung erfahren, abgesehen von den Jahren 1731 bis 1735, als<br />
Johann Matthias Gesner Rektor der Thomasschule war. Gesner, e<strong>in</strong> bedeutender Altphilologe,<br />
setzte se<strong>in</strong>er Bach-Verehrung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Anmerkung zu se<strong>in</strong>er Qu<strong>in</strong>tilian-Ausgabe<br />
e<strong>in</strong> Denkmal. Auch er hatte Schwierigkeiten mit dem Rat der Stadt und zog sich<br />
schließlich nach Gött<strong>in</strong>gen zurück.<br />
In Leipzig entstand e<strong>in</strong>e für e<strong>in</strong>en Normalmenschen unbegreifliche Fülle<br />
außergewöhnlichster Werke: die Johannespassion, die Matthäuspassion, die h-moll-<br />
Messe, das Magnificat, das Weihnachtsoratorium, e<strong>in</strong>e große Zahl wichtigster Kantaten,<br />
zwei Orchesterouvertüren, Konzerte für Cembalo bzw., für zwei bis vier Cembali und<br />
Orchester, viele der hervorragendsten Orgel- und Klavierwerke (Goldberg-Variationen,<br />
Wohltemperiertes Klavier II). Es entstand das Musikalische Opfer für Friedrich II.. Bach<br />
Seite 16
BEITRÄGE<br />
hatte den Preußenkönig besucht. Sah er <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Möglichkeit, von Leipzig wegzukommen?<br />
Der Besuch blieb ohne Folgen. Friedrich hatte ke<strong>in</strong> Verständnis für Bachs<br />
Rang und Eigenart. -<br />
E<strong>in</strong> Wort soll noch zum oft von Bach angewandten Parodieverfahren gesagt werden.<br />
Er hat oft Sätze aus se<strong>in</strong>en weltlichen Huldigungskantaten neu textiert <strong>in</strong> geistliche<br />
Werke übernommen. Es wäre zu schade gewesen, wenn diese Sätze nach dem e<strong>in</strong>maligen<br />
Anlass vergessen worden wären. Besonders das Weihnachtsoratorium enthält<br />
bei gleicher Musik völlig anders textierte Nummern. „Schlafe, me<strong>in</strong> Liebster“ wird<br />
dem Jesusk<strong>in</strong>d zugesungen. Ursprünglich sang die Wollust den Herkules <strong>in</strong> Schlaf:<br />
„Schlafe, me<strong>in</strong> Liebster“, aber dann „folge der Lockung entbrannter Gedanken“.<br />
„Großer Herr und starker König“ hatte <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Huldigungskantate den Text „Kron<br />
und Preis gekrönter Damen“ - geme<strong>in</strong>t ist die sächsische Kurfürst<strong>in</strong>. Die Beispiele<br />
ließen sich fortsetzen, Beiträge zum Thema: Bach und die Musik an sich. Es ist so,<br />
als ob Bach sich durch dieses ungeheure Schaffen von den Leipziger Schikanen hätte<br />
erholen wollen.<br />
Nach den erhabenen Werken noch e<strong>in</strong> Satyrspiel, zumal es <strong>in</strong> der wissenschaftlichen<br />
Bach-Literatur gern verschwiegen oder nur beiläufig behandelt wird. Die Leipziger<br />
Zeit bescherte uns zwei köstliche Werke: die Kaffeekantate BWV 211 und die burleske<br />
Bauernkantate BWV 212, beide von latenter und direkter Erotik durchpulst. „Die<br />
Katze lässt das Mausen nicht …“ Am Ende aber steht das Werk aller Werke: „Die<br />
Kunst der Fuge“ BWV 1080. Wenn man diesen unbegreiflichen d-moll-Komplex<br />
spielt, ist es, als empfange man e<strong>in</strong>e Botschaft aus e<strong>in</strong>er anderen Welt. Und im Contrapunctus<br />
11 reckt sich noch e<strong>in</strong>mal mit riesenhafter Kraft dieser Ausnahme-Mensch<br />
Johann Sebastian Bach.<br />
Seite 17
AUS UNSEREM LANDESVERBAND<br />
Unser Leben nach der ESG<br />
Dietrich Kauffmann<br />
Kennengelernt haben sich die Mediz<strong>in</strong>student<strong>in</strong> Kar<strong>in</strong> Holländer und der Jurastudent<br />
Dietrich Kauffmann Mitte der sechziger Jahre <strong>in</strong> der ESG Freiburg. Für uns wie für<br />
mehrere andere Paare bedeuteten Jahre später im Rückblick die drei Buchstaben ESG<br />
zugleich Ehe-Stiftungs-Geme<strong>in</strong>schaft, die auch e<strong>in</strong> Netzwerk von Freunden bildete,<br />
das wechselseitige Patenschaften für unsere K<strong>in</strong>der übernahm.<br />
Nach Berufsf<strong>in</strong>dungs- und Familiengründungsphase <strong>in</strong> Baden gelangten wir berufsbed<strong>in</strong>gt<br />
Ende 1972 nach Düsseldorf, wo uns nach e<strong>in</strong>iger Zeit das Ehepaar Bärbel<br />
und Ernst-Wilhelm Kurschat <strong>in</strong> den von der Oberschulrät<strong>in</strong> Dr. Helene Kogge geleiteten<br />
Hauskreis der Evgl. <strong>Akademikerschaft</strong> e<strong>in</strong>führte. Unter verschiedenen Leitungen<br />
besteht dieser <strong>in</strong>zwischen Ökumenische Hauskreis bis heute.<br />
Bei alljährlich über Pf<strong>in</strong>gsten durchgeführten Familienfreizeiten <strong>in</strong> den Jahren 1977 -<br />
1984 -Reml<strong>in</strong>grade, Wermelskirchen, Orsoy-Budberg und auf der CVJM-Bundeshöhe<br />
Wuppertal lernten wir auch die Familien Eichstädt, Hiddemann, Kurschat, Lorenz,<br />
von Schwe<strong>in</strong>itz, Wald und Westphal mit jeweils 1 - 3 K<strong>in</strong>dern, aber auch k<strong>in</strong>derlose<br />
Frauen und Männer kennen. Da konnte es nicht ausbleiben, dass wir selbst zum 1.<br />
Januar 1978 zu ea-Mitgliedern wurden. Bedeutsam waren <strong>in</strong> dieser Zeit auch Tagungen<br />
<strong>in</strong> der Ev. Akademie Mülheim mit <strong>in</strong>teressanten Themen, bedeutenden Referenten<br />
und vor allem K<strong>in</strong>derbetreuung ! Für das deutsch-israelische bzw. christlich-jüdische<br />
Gespräch und Verständnis standen sowohl als Referenten das Juristen-Ehepaar Dr.<br />
Barbara Just-Dahlmann und Helmut Just aus Mannheim, die auch Reisen nach Israel<br />
organisierten, als auch unser rhe<strong>in</strong>isches ea-Mitglieder-Ehepaar Ruth und Dr. Wilhelm<br />
Olmesdahl aus Mettmann e<strong>in</strong>.<br />
Wichtige Aktivitäten der ea <strong>in</strong> verschiedenen Landesverbänden waren ebenso die<br />
Teilnahme vieler Mitglieder an den Berl<strong>in</strong>er Bibelwochen und der Paket- und<br />
Bücherversand <strong>in</strong> die DDR zu dort lebenden Christen. So wurde nach den ESG-<br />
Partnerschaftstreffen von Ost- und West-Studierenden <strong>in</strong> Ostberl<strong>in</strong> oder östlichen<br />
Hochschulorten und neben den zunächst Paten- und später Partnerschaften der<br />
Kirchengeme<strong>in</strong>den auch weitere Kontakte zwischen rhe<strong>in</strong>ischen ea-Mitgliedern und<br />
befreundeten Christen <strong>in</strong> der sächsischen Oberlausitz gepflegt. Rentner aus dem Osten<br />
konnten schon vor dem Mauerfall an Tagungen <strong>in</strong> der Ev. Akademie Mülheim teilnehmen,<br />
was besonders für Johannes Cieslak aus Seifhennersdorf galt, der e<strong>in</strong> Motor des<br />
Lückendorfer Arbeitskreises war. Er brachte es auch zustande, dass über zehn rhei-<br />
Seite 18
AUS UNSEREM LANDESVERBAND<br />
nische ea-Mitglieder am Kreiskirchentag <strong>in</strong> Dresden vom 1. - 3. Mai 1987 als offizielle<br />
Delegation (ohne Pflichtumtausch) teilnehmen konnten, was für alle Beteiligten<br />
e<strong>in</strong> unvergessliches Erlebnis war. Diese <strong>in</strong>tensiven Beziehungen waren me<strong>in</strong>es Erachtens<br />
auch e<strong>in</strong>e wichtige Grundlage für geme<strong>in</strong>sam vom Lückendorfer Arbeitskreis der<br />
sächsischen Christen und der rhe<strong>in</strong>ischen ea ab 1990 zunächst an verschiedenen Orten<br />
der Lausitz (z.B. Lückendorf, Herrnhut, Seifhennersdorf) und später gewöhnlich<br />
im alljährlichen Wechsel zwischen Ost und West auch im Rhe<strong>in</strong>land durchgeführte<br />
mehrtägige Tagungen mit vor- oder nachgeschaltetem Besichtigungsprogramm über<br />
zwanzig Jahre h<strong>in</strong>weg.<br />
Den Zusammenhalt von ea-Mitgliedern unterstützten die vom Ehepaar Christ<strong>in</strong>e und<br />
Dietrich Eichstädt über viele Jahre h<strong>in</strong>weg geplanten und durchgeführten Herbstwanderungen<br />
<strong>in</strong> und durch das Hohe Venn. Mit dem Ehepaar Adelheid und Hagen<br />
Millauer lernten wanderlustige ea-Mitglieder jeweils im Frühjahr das Bergische Land<br />
kennen. Dabei haben alle Generationen ihre große Freude gehabt und bleibende Er<strong>in</strong>nerungen<br />
mitgenommen.<br />
Nachdem zunächst bis Ende 1998 Kar<strong>in</strong> Kauffmann und ich seit Oktober 2001 im<br />
Beirat des LV Rhe<strong>in</strong>land der ea mitarbeiteten, wir auch geme<strong>in</strong>sam oder e<strong>in</strong>zeln an<br />
Delegiertenversammlungen des Gesamtverbandes teilnahmen und selten den Mitgliederversammlungen<br />
des Landesverbandes fernblieben, halten wir es für gut und richtig,<br />
dass es ab Herbst diesen Jahres auch ohne uns im Beirat weitergeht.<br />
Impressum<br />
Der Rundbrief wird herausgegeben von der <strong>Evangelische</strong>n <strong>Akademikerschaft</strong> <strong>in</strong><br />
<strong>Deutschland</strong>, Landesverband Rhe<strong>in</strong>land e.V., Virchowstr. 51, 45147 Essen<br />
Redaktion: Dorothee Teschke, Dr. Rudolf Diersch, Dr. Kar<strong>in</strong> Kauffmann,<br />
Dietrich Kauffmann, Dr. Wieland Zademach<br />
Layout & Satz: Dorothea Diersch<br />
Druck: LEO Druck, Stockach<br />
Bankverb<strong>in</strong>dung:<br />
KD-Bank eG Duisburg BLZ 350 601 90 Konto-Nr.: 1010 5000 16<br />
Internet: www.evangelische-akademiker.de<br />
Seite 19
AUS UNSEREM LANDESVERBAND<br />
Hauskreis Heyde <strong>in</strong> Bonn-Bad Godesberg<br />
der <strong>Evangelische</strong>n <strong>Akademikerschaft</strong><br />
Liebe Freund<strong>in</strong>nen und Freunde im Hauskreis Bad Godesberg-Wachtberg!<br />
Am 21. August konnten wir im erfreulich großen Kreis Themen sammeln und das<br />
Programm für die zweite Jahreshälfte <strong>2013</strong> besprechen. Die aktuelle Umsetzung hakte,<br />
soweit es um auswärtige Referenten geht. Hier muss E<strong>in</strong>iges für das nächste Jahr aufgehoben<br />
werden. Bei der „Orientierungshilfe“ des Rates der EKD kommt h<strong>in</strong>zu, dass<br />
nach Auskunft von Altbischof Wollenweber der Rat die Theologische Kommission<br />
um e<strong>in</strong>e ergänzende theologische Ausarbeitung gebeten hat. Für das erste Treffen habe<br />
ich e<strong>in</strong>e Thematik gewählt, die wir lange nicht hatten.<br />
Beg<strong>in</strong>n jeweils um 16.00 Uhr. Herzliche E<strong>in</strong>ladung. Ich freue mich auf anregende<br />
Gespräche. Hier die Term<strong>in</strong>e, Gastgeber und Themen:<br />
18. September Rundgespräch im Kreis über aktuelle Lese-Erfahrungen -<br />
empfehlenswerte (auch nicht empfehlenswerte) Bücher.<br />
26. Oktober Angeregt durch die Lektüre der Biografie „Helmut Simon - Recht<br />
bändigt Gewalt“ von Almut und Wolf-Dieter Röse möchte ich über<br />
diesen engagierten rhe<strong>in</strong>ischen evangelischen Christen berichten, den<br />
ich auch persönlich kennengelernt habe; er war 16 Jahre Bundesverfassungsrichter,<br />
galt als „L<strong>in</strong>ksprotestant“ und war vielfach<br />
kirchlich engagiert, 1987 und 1989 als Präsident des<br />
<strong>Evangelische</strong>n Kirchtags.<br />
20. November Dr. Wilhelm Gieseke, der seit e<strong>in</strong>iger Zeit unseren Hauskreis<br />
bereichert, wird berichten: „Zum Thema ‚Migration‘ - das Schicksal<br />
e<strong>in</strong>er französischen Hugenottenfamilie 1685 - <strong>2013</strong>“.<br />
11. Dezember Adventlicher Nachmittag im traditionellen Rahmen.<br />
Gespräch über die Situation im Kreis und Programmplanung für da<br />
nächste Halbjahr.<br />
Seite 20
AUS UNSEREM LANDESVERBAND<br />
15. Januar Voraussichtlich Bericht unseres Sohnes York Heyde über se<strong>in</strong>e<br />
Erfahrungen bei e<strong>in</strong>em 6-monatigen E<strong>in</strong>satz als Soldat <strong>in</strong><br />
Afghanistan (Mazar e Sharif).<br />
Am 19. Februar voraussichtlich Referat von Dr. Wolfgang Osterhage zu den<br />
f<strong>in</strong>anziellen Perspektiven der <strong>Evangelische</strong>n Kirche im Rhe<strong>in</strong>land.<br />
Mit herzlichen Grüßen<br />
Ihr Wolfgang Heyde<br />
Tel. und Fax 0228 / 34 82 28<br />
E-Mail: harald.uhl@arcor.de<br />
Jesus Christus spricht:<br />
Ich b<strong>in</strong> das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird<br />
nicht wandeln <strong>in</strong> der F<strong>in</strong>sternis, sondern das Licht des Lebens haben.<br />
(Johannes 8,12)<br />
Dankbar nehmen wir Abschied von<br />
Frau Renate Hermanns<br />
8.9.1922 bis 2.10.<strong>2013</strong><br />
Sie gehörte mehr als 60 Jahre der <strong>Evangelische</strong>n <strong>Akademikerschaft</strong> an.<br />
Ihr Leben war ausgefüllt mit Lehren und Lernen und immer währendem Interesse<br />
an der Wissenschaft. Bis <strong>in</strong>s hohe Alter war sie e<strong>in</strong> engagiertes Mitglied <strong>in</strong><br />
Vorstand und Beirat.<br />
Für den Vorstand des Landesverbandes Rhe<strong>in</strong>land:<br />
Dorothee Teschke, Dr. Rudolf Diersch<br />
Seite 21
AUS UNSEREM LANDESVERBAND<br />
Impressionen von der Exkursion „Kirche im Nationalsozialismus<br />
zwischen Anpassung und Widerstand“<br />
Eifel-Wandertag vom 21. September <strong>2013</strong><br />
In bewährter Tradition hatte Dietrich Eichstädt den Herbstwandertag vorbereitet, an<br />
dem 15 Personen teilnahmen. Die Exkursion begann mit e<strong>in</strong>er Führung unter der Leitung<br />
von Pastor Meffert durch die Anlage Vogelsang bei Schleiden, e<strong>in</strong>em Schulungszentrum<br />
aus der ehemaligen NS-Zeit. Am Nachmittag erfreute sich die Gruppe e<strong>in</strong>er<br />
gemütlichen Bootsfahrt über den Rur-See bei mildem Herbstsonnensche<strong>in</strong>.<br />
Seite 22<br />
Fotos: Dr. Klaus Blatt
AUS DEN EV. STUDIERENDENGEMEINDEN<br />
Impressionen vom Ehemaligentag der ESG am Bonn<br />
Michael Pues, ESG Bonn<br />
ESG‘en s<strong>in</strong>d Orte gelebter Geme<strong>in</strong>schaft. Manchmal bleiben diese Orte e<strong>in</strong> Leben<br />
lang wichtig. Weil die, die e<strong>in</strong>mal hier e<strong>in</strong> und ausgegangen s<strong>in</strong>d, mit der ESG verwurzelt<br />
bleiben.<br />
„Verwurzelt“ - so lautete auch das Motto des Ehemaligentages der ESG Bonn am 20.<br />
April diesen Jahres. Für e<strong>in</strong>en Tag s<strong>in</strong>d 60 Ehemalige wieder zu „ihrer“ ESG nach<br />
Bonn zurückgekehrt, zum Teil nach über 50 Jahren! Vorbereitet und moderiert wurde<br />
der Ehemaligentag von aktuellen ESGler<strong>in</strong>nen und ESGlern.<br />
Die Ehemaligen erwartete e<strong>in</strong> abwechslungsreiches und s<strong>in</strong>nenreiches Programm: e<strong>in</strong><br />
Podiumsgespräch mit ehemaligen Pfarrern und anderen Ehemaligen, e<strong>in</strong>e Kunstwerkstatt,<br />
Hausführungen, die Dokumentation der eigenen Er<strong>in</strong>nerungen <strong>in</strong> der Historienbox<br />
usw. Und vielleicht am allerwichtigsten: das Wiedersehen, Wiedererkennen und<br />
geme<strong>in</strong>same Er<strong>in</strong>nern <strong>in</strong> den ungezählten Gesprächen bei Kaffee und Kuchen oder<br />
am abendlichen Pasta - Buffet.<br />
E<strong>in</strong>e Neuauflage <strong>in</strong> ähnlicher oder auch ganz anderer Form ersche<strong>in</strong>t nach den erfreuten<br />
Rückmeldungen recht wahrsche<strong>in</strong>lich. Zu e<strong>in</strong>em ersten Planungsgespräch trafen<br />
sich bereits Prof. Dr. Schmidt-Rost, Universität Bonn, Frau D. Teschke, <strong>Evangelische</strong><br />
<strong>Akademikerschaft</strong>, und der Studierendenpfarrer der ESG Bonn. Für den 3. Mai 2014<br />
ist e<strong>in</strong>e Veranstaltung im Rahmen der Lutherdekade zum Thema „Reformation und<br />
Politik“ vorgesehen.<br />
Seite 23
AUS DEM BUNDESVERBAND<br />
EIN NEUER LANDESVERBAND „MITTELDEUTSCHLAND<br />
DER EAiD“ ENTSTEHT:<br />
Auftaktveranstaltung am 12. Juli <strong>2013</strong> <strong>in</strong> Eisenach-Hörschel<br />
Dorothee Teschke<br />
Mitglieder und Interessierte der Region haben sich zusammen gefunden, um zukünftig<br />
getreu den Leitl<strong>in</strong>ien glauben - denken - handeln der <strong>Evangelische</strong>n <strong>Akademikerschaft</strong><br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em eigenen Verband tätig zu werden. Sie laden e<strong>in</strong> zu persönlicher Begegnung<br />
und zum Erfahrungsaustausch. Die Zielrichtung geme<strong>in</strong>samer Vorhaben, die es<br />
weiter zu entwickeln gilt, wird sich orientieren an aktuellen Fragen unserer Zeit <strong>in</strong><br />
Gesellschaft und Politik, <strong>in</strong> Wirtschaft und Kultur - geleitet von der befreienden Botschaft<br />
der Bibel.<br />
Das Nachdenken über e<strong>in</strong> zeitgemäßes Verständnis des christlichen Glaubens wird e<strong>in</strong><br />
<strong>in</strong>haltlicher Schwerpunkt der theologischen Themenstellungen se<strong>in</strong>.<br />
Als Beauftragte der EA hatte Frau Prof. Dr. Hegele mit großem Engagement e<strong>in</strong> <strong>in</strong>teressantes<br />
Tagesprogramm organisiert, das zahlreiche Attraktionen bot: e<strong>in</strong>e Wanderung<br />
auf dem Rennsteig, den Besuch der Lutherausstellung sowie die Teilnahme am<br />
Luther-Festival <strong>in</strong> Eisenach. Se<strong>in</strong>en Höhepunkt fand die Veranstaltung <strong>in</strong> der Feier des<br />
festlichen Gründungsgottesdienstes <strong>in</strong> der Hörscheler Kirche, zu dem etwa 35 Personen<br />
gekommen waren. Er wurde geleitet von dem Eisenacher Theologen Dr. Wolfgang<br />
Schenk. Als Mitglieder des Bundesvorstandes nahmen die Vorsitzende Dorothee<br />
Teschke und Horst Pageler am Gottesdienst teil.<br />
Die Veranstaltung am 12. Juli <strong>in</strong> Eisenach gilt als „Auftaktveranstaltung“. Die konkrete<br />
Weiterentwicklung der Gründungsarbeit wird Thema e<strong>in</strong>es Treffens <strong>in</strong> Eisenach se<strong>in</strong>,<br />
das im Oktober <strong>2013</strong> unter Beteiligung der Verantwortlichen Frau Prof. Dr. Hegele<br />
und Herrn Dr. Schenk sowie den Mitgliedern des Bundesvorstandes stattf<strong>in</strong>den wird.<br />
E<strong>in</strong>e erste Kontaktaufnahme soll mit Vertretern des „Nikolaikollegs“ der <strong>Evangelische</strong>n<br />
Kirchengeme<strong>in</strong>de Eisenach - dort zuständig für evangelische Erwachsenenbildung<br />
- erfolgen, um mögliche Kooperationen auszuloten.<br />
Die ersten erfolgreichen Schritte zur Gründung des LV Mitteldeutschland s<strong>in</strong>d getan.<br />
Wir wünschen für die zukünftige Arbeit gutes Gel<strong>in</strong>gen, ermutigende Begleiter und<br />
Gottes Segen.<br />
Seite 24
AUS DEM BUNDESVERBAND<br />
Horst Pageler vom Landesverband Hessen, Bundesvorsitzende Dorothee Teschke<br />
(Rhe<strong>in</strong>land), Wolfgang Schenk und Dorothea Hegele <strong>in</strong>formierten vor der Kirche von<br />
Hörschel<br />
Foto: Heiko Kle<strong>in</strong>schmidt, Eisenacher Allgeme<strong>in</strong>e Zeitung<br />
Weiter im S<strong>in</strong>ne von Luthers Reformation die Zukunft gestalten<br />
Heiko Kle<strong>in</strong>schmidt, Eisenacher Allgeme<strong>in</strong>e Zeitung vom 13.07.<strong>2013</strong><br />
Dass der Luthersche Reformationsgedanke noch im Hier und Heute se<strong>in</strong>e Bedeutung<br />
hat, auch verändern kann, das machten die Teilnehmer der Gründungsveranstaltung<br />
der <strong>Evangelische</strong>n <strong>Akademikerschaft</strong> Mitteldeutschland am gestrigen Freitag <strong>in</strong> Eisenach<br />
und Hörschel deutlich. Zwölf deutsche Landesverbände gibt es bereits, nun hat<br />
der dreizehnte Verband se<strong>in</strong>e Arbeit aufgenommen. Gründungsbeauftragte ist Professor<br />
Dorothea Hegele aus Eisenach, langjähriges Mitglied der <strong>Akademikerschaft</strong>. Dr.<br />
Wolfgang Schenk gehört zu den ersten Mitstreitern im mitteldeutschen Verband e<strong>in</strong>em<br />
laut Dorothea Hegele noch weißen Fleck.<br />
Vor der Kirche von Hörschel wurde e<strong>in</strong> Informationsstand aufgebaut, und alle Bürger<br />
waren zum Gründungsgottesdienst e<strong>in</strong>geladen. Die Predigt hielt Wolfgang Schenk.<br />
Seite 25
AUS DEM BUNDESVERBAND<br />
Am Morgen bereits traf man sich <strong>in</strong> geme<strong>in</strong>samer Runde <strong>in</strong> der Eisenacher Innenstadt<br />
und begab sich auf die Spuren des Reformators Mart<strong>in</strong> Luther.<br />
Mit dabei auch K<strong>in</strong>der von <strong>in</strong>teressierten Gästen. Am Eisenacher Lutherdenkmal gab<br />
es die erste Fragerunde: Was hat es mit den vier Tafeln am Denkmal auf sich? Da gab<br />
es bereits viel Neues zu erfahren.<br />
Reformation e<strong>in</strong>st und heute: Darum g<strong>in</strong>g es bei den zahlreichen Gesprächen am<br />
Gründungstag. Zumal der Beitritt zu <strong>Akademikerschaft</strong> ke<strong>in</strong>eswegs an e<strong>in</strong>e religiöse<br />
B<strong>in</strong>dung oder gar e<strong>in</strong> Hochschulstudium gebunden ist. „Wir s<strong>in</strong>d für jedermann<br />
offen“, betont Dorothee Teschke, e<strong>in</strong>e der Bundesvorsitzenden. Und lässt zugleich<br />
wissen, dass der Ursprung der <strong>Akademikerschaft</strong> <strong>in</strong> den evangelischen Studentengruppen<br />
<strong>in</strong> der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts zu f<strong>in</strong>den ist.<br />
Die Studenten wurden älter, gründeten 1954 die <strong>Evangelische</strong> <strong>Akademikerschaft</strong>, die<br />
e<strong>in</strong>st viele Tausend Mitglieder zählte. Mit der Öffnung für alle Interessierten trägt man<br />
der Tatsache Rechnung, das viele Menschen entweder christliche Wurzeln haben oder<br />
christliches Gedankengut ihr Eigen nennen. Gerade <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Landstrich wie Mitteldeutschland,<br />
wo zahlreiche Lutherstätten zu f<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>d, bietet sich eben e<strong>in</strong> fruchtbarer<br />
Gedankenaustausch geradezu an.<br />
Symbolisch traf man sich darum zum Gründungsgottesdienst <strong>in</strong> Hörschel am Beg<strong>in</strong>n<br />
des Rennste<strong>in</strong>wanderweges. „Wir wollen uns auf den Weg begeben“, erläutert Dorothea<br />
Hegele den Grund und zeigt sich mit anderen Besuchern bee<strong>in</strong>druckt von der<br />
Kirche. Zugleich geht sie wieder auf Luther e<strong>in</strong>. „Er soll nicht nur e<strong>in</strong>e kulturhistorische<br />
Marke se<strong>in</strong>. Die Reformation geht weiter.“<br />
Auf zwei soliden Standbe<strong>in</strong>en wirkt die <strong>Akademikerschaft</strong>. Zum e<strong>in</strong>en gibt es zahlreiche<br />
Veranstaltungen <strong>in</strong> den Bundesländern, wobei die Thematik „Nachhaltigkeit“ e<strong>in</strong><br />
Schwerpunkt ist. Aber ebenso die Ause<strong>in</strong>andersetzung mit der Vergangenheit. Dorothee<br />
Teschke gab schon e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>blick, was im Rhe<strong>in</strong>land von Interesse ist. Dort reicht<br />
die Palette der Veranstaltungen von der Armut <strong>in</strong> Europa, über die Fähigkeit, tolerant<br />
zu se<strong>in</strong> bis h<strong>in</strong> zur Stadt der Zukunft. Der neu gegründete mitteldeutsche Landesverband<br />
muss da noch se<strong>in</strong> Wirken abstecken. Zum anderen gibt es e<strong>in</strong>en regen Gedankenaustausch<br />
über die moderne Form des Internets. Besonders <strong>in</strong>teressant für die<br />
Jugend. Zum Programm gehörte noch der Besuch der Eisenacher Lutherausstellung.<br />
Am Abend g<strong>in</strong>g es dann <strong>in</strong>s Theater. „Luther! Rebell wider Willen“ stand auf dem<br />
Programm. Dieser Theaterbesuch musste e<strong>in</strong>fach se<strong>in</strong>.<br />
Seite 26
VORSCHAU UND TERMINE<br />
Seite 27
VORSCHAU UND TERMINE<br />
Achtung! Achtung! Achtung! Achtung! Achtung!<br />
E<strong>in</strong>ladung zur Vortragsveranstaltung,<br />
Mitgliederversammlung und Wahlen<br />
des Landesverbandes Rhe<strong>in</strong>land<br />
Samstag, 23. November <strong>2013</strong>, 11.00 - 16.00 Uhr<br />
<strong>in</strong> der <strong>Evangelische</strong>n Akademie im Rhe<strong>in</strong>land<br />
im Haus der Begegnung der <strong>Evangelische</strong>n Akademie im Rhe<strong>in</strong>land<br />
Mandelbaumweg 2; 53177 Bonn/Bad Godesberg<br />
Ab 10:00<br />
Ankommen und Kaffee<br />
11:00 - 12:30 Vortragsveranstaltung mit Gespräch<br />
Professor Dr. Johannes von Lüpke, Kirchliche Hochschule<br />
Wuppertal/Bethel:<br />
Aus Leidenschaft für uns - E<strong>in</strong>e Orientierungshilfe<br />
zum Verständnis des Kreuzestodes Jesu<br />
12:45 - 13:30 Mittagsimbiss <strong>in</strong> der Akademie<br />
13:45 - 16:00 Mitgliederversammlung am Nachmittag<br />
Tagesordnung<br />
1. Begrüßung<br />
2. Gedenken der verstorbenen Mitglieder<br />
2. Wahl des Versammlungsleiters und Protokollführers<br />
3. Feststellung und Verabschiedung der Tagesordnung<br />
4. Bericht des Vorstandes<br />
5. F<strong>in</strong>anzabschluss 2012<br />
6. Entlastung des Vorstandes<br />
7. Danksagungen<br />
8. Wahlen zu Vorstand und Beirat<br />
9. Wahl der Delegierten für die DV 2014<br />
10. Vorhaben und Term<strong>in</strong>e 2014<br />
11. Verschiedenes<br />
12. Abschluss und Reisesegen<br />
Seite 28
AUS UNSEREM LANDESVERBAND<br />
Im Rahmen des Themenjahres „Reformation und Toleranz“<br />
der Lutherdekade 2007 bis 2017 zum 500jährigen Reformationsjubiläum<br />
veranstalten wir e<strong>in</strong>en<br />
Thementag<br />
mit Herrn Prof. Re<strong>in</strong>hard Schmidt-Rost<br />
von der Rhe<strong>in</strong>ischen Friedrichs-Wilhelm-Universität Bonn zum Thema<br />
Toleranz grenzenlos?<br />
am Sonnabend, dem 07. Dezember <strong>2013</strong>, 11:00 bis 16:00 Uhr<br />
<strong>in</strong> der Johanneskirche der <strong>Evangelische</strong>n Kirchengeme<strong>in</strong>de<br />
Elberfeld-Südstadt, Altenberger Straße 25, 42 119 Wuppertal<br />
Toleranz ist e<strong>in</strong>e wesentliche Voraussetzung für das Zusammenleben <strong>in</strong> der modernen<br />
Gesellschaft, die durch Individualisierung und Pluralisierung gekennzeichnet ist.<br />
Dadurch hat sich die Erfahrung von Andersse<strong>in</strong> und Fremdheit verstärkt und deshalb<br />
ist der verantwortungsvolle Umgang mit Unterschieden die grundlegende Herausforderung<br />
<strong>in</strong> jeder Geme<strong>in</strong>schaft. Toleranz erhält und pflegt als soziales Pr<strong>in</strong>zip die Vielfalt<br />
moderner Gesellschaften. Toleranz ist aber ke<strong>in</strong> Wert an sich, ihr Wert zeigt sich<br />
<strong>in</strong> ihrer Wirkung im lebensweltlichen Nahbereich durch selbstverantwortliche Individuen.<br />
Wo s<strong>in</strong>d die Grenzen von Toleranz? Reicht das resignierte Ertragen des Anderen,<br />
dessen Existenz wir zwar h<strong>in</strong>nehmen, dem wir aber mit Gleichgültigkeit begegnen?<br />
Oder bedeutet Toleranz nicht erst die beiderseitige Anerkennung und Achtung der<br />
Andersheit des Anderen?<br />
Und sollte nicht - noch e<strong>in</strong>en Schritt weiter - auch die Geme<strong>in</strong>schaft mit ihm gesucht<br />
werden, <strong>in</strong> der es sogar zu wechselseitigem Verstehen kommen könnte?<br />
Wir freuen uns darauf, zu diesen Fragen mit Herrn Prof. Schmidt-Rost und untere<strong>in</strong>ander<br />
<strong>in</strong>s Gespräch zu kommen.<br />
Es laden herzlich e<strong>in</strong>:<br />
<strong>Evangelische</strong> <strong>Akademikerschaft</strong> <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong><br />
Landesverband Rhe<strong>in</strong>land<br />
<strong>Evangelische</strong> Kirchengeme<strong>in</strong>de<br />
Elberfeld-Südstadt<br />
Seite 29
Seite 30
VORSTAND UND BEIRAT<br />
VORSTAND<br />
1. Vorsitzende: Dorothee Teschke, Pützhardt 4, 53359 Rhe<strong>in</strong>bach<br />
Tel.: (02226) 66 57 E-Mail: dorothee.teschke@t-onl<strong>in</strong>e.de<br />
1. Vorsitzender: Dr. Rudolf Diersch, Virchowstr. 51, 45147 Essen<br />
Tel.: (02 01) 77 51 92 FAX: (0201) 61 56 492<br />
E-Mail: rudolf.diersch@web.de<br />
Schatzmeister: He<strong>in</strong>er Krückels, Am Schloßpark 32, 56564 Neuwied<br />
Tel.: (02631) 3 13 12 E-Mail: He<strong>in</strong>er.Krueckels@gmx.de<br />
Mitglied : Prof. Dr. Mart<strong>in</strong> Bruns, Erich-Böger-Str. 27, 53127 Bonn<br />
Tel.: (0228) 28 18 91, E-Mail: brunsmart<strong>in</strong>@t-onl<strong>in</strong>e.de<br />
BEIRAT<br />
Isela Arendt, Alfrediquelle 2, 45127 Essen<br />
Tel.: (0201) 23 90 62<br />
Dr. Rudolf Halberstadt, Metzkauser Str. 15,<br />
40625 Düsseldorf, Tel.: (0211 ) 29 39 85<br />
E-Mail: rudolf.halberstadt@posteo.de<br />
Prof. Dr. Maren Jochimsen, Leibergweg 18b, 45257 Essen<br />
Tel.: (0201) 48 38 78, E-Mail: maren.jochimsen@gmx.de<br />
Dietrich Kauffmann, Elfgenweg 27, 40547 Düsseldorf<br />
Tel.: (0211) 59 49 41<br />
E-Mail: dietrich.kauffmann@googlemail.com<br />
Renate Krückels, Am Schloßpark 32, 56564 Neuwied<br />
Tel.: (02631) 3 13 12 E-Mail: Renatekrueckels@t-onl<strong>in</strong>e.de<br />
Gerson Monhof, Worr<strong>in</strong>ger Str. 69, 42119 Wuppertal<br />
Tel.: (0202) 420 420 , E-Mail: gerson.monhof@ekir.de<br />
Peter Mörbel Ev. Akademie im Rhe<strong>in</strong>land, Mandelbaumweg 2,<br />
53177 Bonn, Tel.: (0228) 95 23 - 0 (d)<br />
E-Mail: peter.moerbel@akademie.ekir.de<br />
Dr. Wieland Zademach, Pfr. em., Brückerweg 1,<br />
53572 Unkel, Tel.: (02224 ) 98 92 718<br />
E-Mail: wieland.zademach@web.de<br />
Seite 31
Seite 32