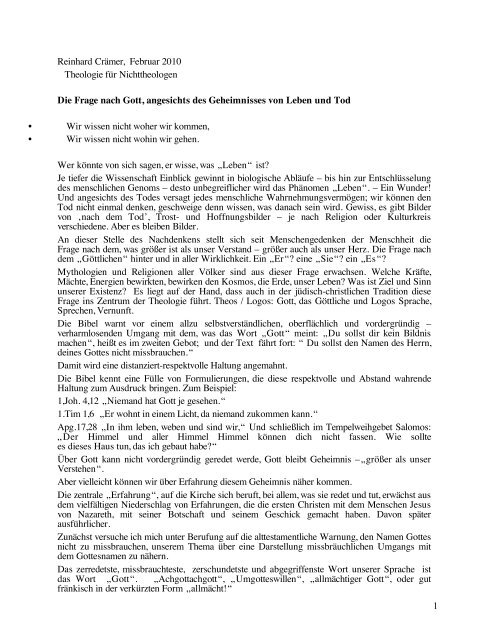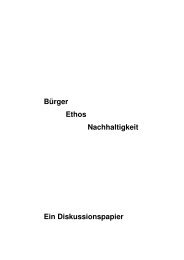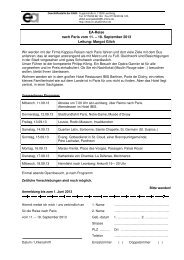1 Reinhard Crämer, Februar 2010 Theologie für Nichttheologen Die ...
1 Reinhard Crämer, Februar 2010 Theologie für Nichttheologen Die ...
1 Reinhard Crämer, Februar 2010 Theologie für Nichttheologen Die ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Reinhard</strong> <strong>Crämer</strong>, <strong>Februar</strong> <strong>2010</strong><br />
<strong>Theologie</strong> <strong>für</strong> <strong>Nichttheologen</strong><br />
<strong>Die</strong> Frage nach Gott, angesichts des Geheimnisses von Leben und Tod<br />
• Wir wissen nicht woher wir kommen,<br />
• Wir wissen nicht wohin wir gehen.<br />
Wer könnte von sich sagen, er wisse, was „Leben“ ist?<br />
Je tiefer die Wissenschaft Einblick gewinnt in biologische Abläufe – bis hin zur Entschlüsselung<br />
des menschlichen Genoms – desto unbegreiflicher wird das Phänomen „Leben“. – Ein Wunder!<br />
Und angesichts des Todes versagt jedes menschliche Wahrnehmungsvermögen; wir können den<br />
Tod nicht einmal denken, geschweige denn wissen, was danach sein wird. Gewiss, es gibt Bilder<br />
von ‚nach dem Tod’, Trost- und Hoffnungsbilder – je nach Religion oder Kulturkreis<br />
verschiedene. Aber es bleiben Bilder.<br />
An dieser Stelle des Nachdenkens stellt sich seit Menschengedenken der Menschheit die<br />
Frage nach dem, was größer ist als unser Verstand – größer auch als unser Herz. <strong>Die</strong> Frage nach<br />
dem „Göttlichen“ hinter und in aller Wirklichkeit. Ein „Er “? eine „Sie“? ein „Es “?<br />
Mythologien und Religionen aller Völker sind aus dieser Frage erwachsen. Welche Kräfte,<br />
Mächte, Energien bewirkten, bewirken den Kosmos, die Erde, unser Leben? Was ist Ziel und Sinn<br />
unserer Existenz? Es liegt auf der Hand, dass auch in der jüdisch-christlichen Tradition diese<br />
Frage ins Zentrum der <strong>Theologie</strong> führt. Theos / Logos: Gott, das Göttliche und Logos Sprache,<br />
Sprechen, Vernunft.<br />
<strong>Die</strong> Bibel warnt vor einem allzu selbstverständlichen, oberflächlich und vordergründig –<br />
verharmlosenden Umgang mit dem, was das Wort „Gott“ meint: „Du sollst dir kein Bildnis<br />
machen“, heißt es im zweiten Gebot; und der Text fährt fort: “ Du sollst den Namen des Herrn,<br />
deines Gottes nicht missbrauchen.“<br />
Damit wird eine distanziert-respektvolle Haltung angemahnt.<br />
<strong>Die</strong> Bibel kennt eine Fülle von Formulierungen, die diese respektvolle und Abstand wahrende<br />
Haltung zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel:<br />
1,Joh. 4,12 „Niemand hat Gott je gesehen.“<br />
1.Tim 1,6 „Er wohnt in einem Licht, da niemand zukommen kann.“<br />
Apg.17,28 „In ihm leben, weben und sind wir,“ Und schließlich im Tempelweihgebet Salomos:<br />
„Der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte<br />
es dieses Haus tun, das ich gebaut habe?“<br />
Über Gott kann nicht vordergründig geredet werde, Gott bleibt Geheimnis –„größer als unser<br />
Verstehen“.<br />
Aber vielleicht können wir über Erfahrung diesem Geheimnis näher kommen.<br />
<strong>Die</strong> zentrale „Erfahrung“, auf die Kirche sich beruft, bei allem, was sie redet und tut, erwächst aus<br />
dem vielfältigen Niederschlag von Erfahrungen, die die ersten Christen mit dem Menschen Jesus<br />
von Nazareth, mit seiner Botschaft und seinem Geschick gemacht haben. Davon später<br />
ausführlicher.<br />
Zunächst versuche ich mich unter Berufung auf die alttestamentliche Warnung, den Namen Gottes<br />
nicht zu missbrauchen, unserem Thema über eine Darstellung missbräuchlichen Umgangs mit<br />
dem Gottesnamen zu nähern.<br />
Das zerredetste, missbrauchteste, zerschundetste und abgegriffenste Wort unserer Sprache ist<br />
das Wort „Gott“. „Achgottachgott“, „Umgotteswillen“, „allmächtiger Gott“, oder gut<br />
fränkisch in der verkürzten Form „allmächt!“<br />
1
Das sind noch die harmloseren Missbräuche. Bedenklicher wird es, wenn wir uns<br />
vergegenwärtigen, was die Menschheit alles im Namen Gottes verbrochen hat.<br />
Heute fallen uns dazu natürlich zuallererst die Selbstmordattentate fanatischer Islamisten ein.<br />
Welch ein Wahnsinn, im Namen welchen Gottes auch immer sich selbst und andere zu<br />
ermorden!<br />
Aber vergessen wir nicht: Auch auf den Koppelschlössern deutscher Soldaten stand; “Gott mit<br />
uns! “ – nicht nur im ersten Weltkrieg, auch im zweiten, dem Naziweltkrieg mit all seinen Gräueln.<br />
Aber die Tradition ist viel älter. Immer schon hat Religion herhalten müssen zur Glorifizierung<br />
politischer Macht. Was war es denn anderes, als sich die römischen Imperatoren als „Söhne der<br />
Götter“ verehren und anbeten ließen? Christen hat es das Leben gekostet, wenn sie sich diesem<br />
Götzendienst verweigerten. Es war auch nicht wesentlich besser, wenn sich später deutsche<br />
Potentaten, als Könige bzw. Kaiser von Gottes Gnaden titulieren ließen – ganz unabhängig davon<br />
welche Politik sie betrieben (Kolonialpolitik, Kriegspolitik).<br />
Noch schlimmer aber ist es, dass die Kirchen selber sich immer wieder an der Heiligkeit Gottes<br />
vergriffen haben. Im Namen Jesu Christi, der zu Gewaltlosigkeit eingeladen hatte, haben Christen<br />
zu Kreuzzügen gegen den Islam aufgerufen, haben Blutbäder angerichtet unter unschuldigen<br />
Muslimen. Oder denken Sie an die Millionen gefolterter und auf Scheiterhaufen verbrannter<br />
Menschen, die der kirchlichen Inquisition und Hexenverfolgung zum Opfer gefallen sind. Von<br />
dieser Schuld sind leider auch die protestantischen Kirchen nicht frei geblieben. (Beispiel) Arzt<br />
Servet / Genv Calvins/ 1553 /unter Zustimmung lutherischer Theologen/ Melanchton , bei<br />
lebendigem Leib verbrannt, wegen Zweifel an Trinitätslehre.<br />
Das alles könnten wir von uns zu schieben versuchen, mit dem Hinweis: das seien eben Irrwege<br />
eines unaufgeklärten, finsteren Mittelalters gewesen – wenn sich nicht die spezifisch kirchliche<br />
Missbrausgeschichte bis in unsere jüngste Vergangenheit fortgesetzt hätte. Ich nenne ein<br />
Beispiel.<br />
Es war am Erntedankfest des Jahre 1939. Da wurde von evangelischen Kanzeln im Deutschen<br />
Reiche folgender Text verlesen:<br />
„In tiefer Demut und Dankbarkeit beugen wir uns am heutigen Erntedankfest vor der Güte und<br />
Freundlichkeit unseres Gottes. Wieder hat er Fluren und Felder gesegnet“ Es folgt der Dank <strong>für</strong><br />
die Ernte. Dann fährt der Text fort: “Aber der Gott, der die Geschicke der Völker lenkt, hat das<br />
deutsche Volk in diesem Jahr noch mit einer anderen, nicht weniger reichen Ernte gesegnet. Der<br />
Kampf auf den polnischen Schlachtfeldern ist, wie unsere Heeresberichte in diesen Tagen mit<br />
Stolz feststellen konnten, beendet, unsere deutschen Brüder und Schwestern in Polen sind von<br />
allen Schrecken und Bedrängnissen Leibes und der Seele erlöst... Wie könnten wir Gott da<strong>für</strong><br />
genugsam danken! Mit dem Dank gegen Gott verbinden wir den Dank gegen alle, die in wenigen<br />
Wochen eine solche gewaltige Wende heraufgeführt haben: gegen den Führer und seine Generale,<br />
gegen unsere tapferen Soldaten auf dem Land, zu Wasser und in der Luft, die freudig ihr Leben<br />
<strong>für</strong> das Vaterland eingesetzt haben. Wir loben dich droben, du Lenker der Schlachten und flehen,<br />
mögst stehen uns fernerhin bei.“ (Vertrauensrat der Deutschen Evangelischen Kirche)<br />
Kein Wort über die Verbrechen, die das Deutsche Reich in Polen begangen hat.<br />
Ein geradezu absurder Missbrauch Gottes.<br />
<strong>Die</strong> Propheten des Alten Testamentes werden nicht müde so etwas als Götzendienst zu<br />
bezeichnen. Das Neue Testament ergänzt; „Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten“<br />
(Galater 6,7) - Was der Fortgang der Geschichte des Dritten Reichs zu betätigen scheint.<br />
Wie aber lässt sich nach so viel Missbrauch zu einer angemessenen, der Heiligkeit Gottes<br />
entsprechenden „Gotteserkenntnis“ kommen?<br />
Von Gott können wir nicht „wissen“ im Sinn eines naturwissenschaftlichen Wissensbegriffs, der<br />
sich auf das Experiment beruft und eine gewonnene Theorie in dem aufwändigen Verfahren von<br />
Verifikation bzw. Falsifikation auf ihre Gültigkeit prüft. Alle Versuche, sei es der Philosophie<br />
oder der <strong>Theologie</strong>, sich der Frage nach Gott mittels sogenannter Gottesbeweise zu nähern, sind<br />
gescheitert. Der Philosoph, der alle vorausgegangenen Versuche, die Existenz oder Nichtexistenz<br />
2
Gottes durch Gründe der Vernunft zu beweisen, als grundsätzlich unmöglich beurteilt hat, ist<br />
Emanuel Kant.<br />
Gott ist größer als unser Verstand, größer auch als unser Herz. Er bleibt darum <strong>für</strong> uns<br />
Geheimnis.<br />
Dennoch, davon bin ich überzeugt, gibt es <strong>für</strong> uns zwei legitime Quellen <strong>für</strong> eine dem göttlichen<br />
Geheimnis adäquate „Gottes – Erkenntnis“. Bei beiden handelt es sich um Quellen der<br />
Erfahrung. Das ist einmal das Erfahrungswissen, wie es sich in der Literatur des Alten und des<br />
Neuen Testamentes niedergeschlagen hat; zum andern unsere eigene Lebenserfahrung. Ich<br />
versuche das anhand einiger Texte zu erläutern:<br />
- Jedem Menschen zugänglich ist die Erfahrung, alles Wesentliche im Leben nicht aus eigener<br />
Kraft erworben zu haben. Wir sind „ohn´ unser Verdienst und Würdigkeit“ Beschenkte.<br />
Geschenk heißt auf Griechisch charis d.h. Gnade. Alles ist Gnade.<br />
Wir ehren die göttliche Kraft, die hinter allem steckt, indem wir uns den „Geschenkcharakter“<br />
unseres Lebens bewusst machen und etwa mit dem 8. Psalm sprechen: „Was ist der Mensch,<br />
dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst. --- Mit Ehre<br />
und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.“<br />
- Wir ehren Gott, wenn wir auf den Reichtum der Natur, von der wir ein Teil sind, mit<br />
dankbarem Staunen reagieren: „Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast sie<br />
alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güte“ Psalm 104.<br />
- Wir habe die Erfahrung gemacht, dass die Kraft, der wir unser Leben verdanken trägt, auch<br />
führt. „Bis hier her hat mich Gott gebracht durch seine große Güte, bis hier her hat er Tag und<br />
Nacht bewahrt Herz und Gemüte, bis hier her hat er mich geleit´, bis hier her hat er mich<br />
erfreut, bis hier her mir geholfen.“ Mancher und manche hier in unserem Haus wird auf<br />
entsprechende Erfahrungen zurückblicken können. Wir wären sonst nicht 70, 80, 90, oder gar<br />
100 Jahre alt geworden. Wir ehren Gott, wenn wir auf diese Lebenskraft bewusst unser<br />
Vertrauen setzen. Vertrauen heißt in der Bibel „glauben“! „Der Herr ist mein Hirte, mir wird<br />
nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. “<br />
Welch eine große Erfahrung von Geborgenheit spricht aus diesen Worten des 23. Psalms!<br />
- Zu diesem Vertrauen sind wir auch dann eingeladen, wenn unser Lebensweg nicht über sonnige<br />
Fluren führt. Wir alle kennen Abgründe. Wir alle wissen etwas von den Schrecken der Natur:<br />
Von Tsunami bis Erdbeben, von Krankheit, Leiden und Tod. Darum fährt der Psalm fort:<br />
„Und ob ich schon wanderte im finstern Tal <strong>für</strong>chte ich kein Unglück, denn du bist bei mir,<br />
dein Stecken und Stab trösten mich.“ Das ist Vertrauen, das weiß, dass die uns tragende Kraft<br />
uns auch im Tod nicht fallen lässt.<br />
(Wer einmal miterlebt hat, wie ein Sterbender unter diesen Worten des 23. Psalm zur Ruhe<br />
kommt und einwilligen kann ins Loslassen, der vergisst das nicht mehr.)<br />
Auch hier: Welch eine Erfahrung von Geborgenheit. Vielleicht ist es dieses „Gottvertrauen“, das<br />
Paulus meint, wenn er einmal sagt: „Denen, die Gott Lieben werden alle Dinge (also auch die<br />
bedrückenden) zum Besten dienen.<br />
- Weitere Möglichkeiten der „Gotteserfahrung“ können Lebensfreude und Glücksgefühle sein:<br />
„Ich danke Gott und freue mich – wie´s Kind zur Weihnachtsgabe, dass ich bin, bin! – und<br />
dass ich dich schön menschlich Antlitz habe.“ (M.Claudius)<br />
In diese Dankbarkeit lässt sich alles einschließen, was uns beglückt: <strong>Die</strong> Begegnung mit einem<br />
Menschen, ein schöner Sommermorgen, ein Gedicht, eine Musik. ...<br />
- Wir ehren Gott ferner in Bescheidenheit und Demut: „Was hast du (Mensch), das du nicht<br />
empfangen hast? So du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht<br />
empfangen hättest?“ (1, Kor. 4,7) Oder mit Paulus, dem eine Bitte nicht erfüllt wurde, sondern<br />
der sich sagen lassen musste: “Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt<br />
in der Schwachheit zur Vollendung.“<br />
- Und schließlich ehren wir Gott im Gehorsam. Nicht einem dumpfen Sklavengehorsam, der sich<br />
ausschließlich an Befehlen, Paragraphen und Gesetzen orientiert, sondern einem freien<br />
3
Gehorsam, der auf Situationen reagiert, von denen er sich herausgefordert fühlt, so wie weiland<br />
der Samariter in der Beispielgeschichte Jesu, der – im Unterschied zu den Vertretern der<br />
religiösen Elite (Priester und Levit) - das menschlich Notwendige getan hat, an dem, der auf<br />
jener gefährlichen Straße nach Jericho unter die Räuber gefallen war. Wie viele solche<br />
„Strassen nach Jericho“ gibt es auf der Welt und gab es in unserem Leben, die uns zum<br />
Engagement <strong>für</strong> Menschlichkeit herausgefordert haben – sei es privat oder politisch? Mit<br />
dieser Geschichte hat Jesus das berühmte Doppelgebot illustriert: Gott lieben (also ernst<br />
nehmen) von ganzem Herzen und meinen Nächsten lieben wie mich selbst!<br />
Jesus, der Mann aus Nazareth, - <strong>für</strong> die Christen bleibt er die bedeutendste, ergiebigste und<br />
schlechthin gültige Erfahrungsquelle <strong>für</strong> “Gotteserkenntnis“. (Ich sprach eingangs schon kurz<br />
davon.) Von diesem Menschen scheint eine Faszination ausgegangen zu sein, die sich in<br />
leidenschaftlicher Begeisterung einerseits und in ebenso leidenschaftlicher Verurteilung<br />
andererseits niedergeschlagen hat: „Wahrlich dieser ist doch Gottes Sohn“ und „Kreuzige<br />
ihn!“<br />
Was seine Jünger in der Begegnung mit ihm zu verstehen gelernt hatten, fand seinen Niederschlag<br />
in einer Fülle von Bekenntnissen, aus denen später das Neue Testament erwuchs. Eines der<br />
kürzesten Bekenntnisse lautet „Jesus Christus“.<br />
Was wir fälschlicher Weise als Vor- und Nachnamen wahrnehmen, bedeutet <strong>für</strong> die damalige Zeit:<br />
Ich glaube, dass dieser Jesus der erwartete Messias ist (griechisch Christus, der Gesalbte Gottes),<br />
ein damals mit hohen Erwartungen befrachteter, politischer Würdetitel! Ohne das zu wissen, ist<br />
die Formel heute als Bekenntnis nicht mehr zu verstehen.<br />
Eines der schönsten Bekenntnisse von dem, was den Jünger in der Begegnung mit Jesus<br />
aufgegangen ist, steht aufgezeichnet im 1, Johannesbrief 4,16: „Gott ist Liebe und wer in der<br />
Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.“<br />
Mir gefällt dieses Bekenntnis besonders gut, denn die Liebe ist eine Kraft, keine Peron. Sie ist<br />
eine Kraft, die im Lieben und Geliebt werden erfahren werden kann.<br />
Man braucht sich also Gott nicht unbedingt als eine supranaturale Gott-Person über den Wolken<br />
vorzustellen. Gott kann auch als ‚Grund des Seins’, als ‚Geist’, als ‚Liebe’ verstanden werden.<br />
Ein evangelischer Theologe unserer Tage (Matthias Kroeger, er lehrte bis vor kurzem Kirchen-<br />
und <strong>Theologie</strong>geschichte an der Uni Hamburg) gebraucht in einem seiner letzten Bücher eine<br />
Formulierung, die mich positiv angesprochen hat: „ Was mit dem Wort „Gott“ gemeint ist, ist<br />
existentiell erfahrbar als wunderbare Kraft, die schafft, beschenkt, fordert, auch vernichtet, zu der<br />
anbetendes In-Beziehung-Treten möglich und lebensdienlich ist.“ Er bezieht sich in diesem<br />
Zusammenhang u.a. auf die bereits zitierte Stelle der Apostelgeschichte: „In ihm leben, weben<br />
und sind wir.“ Was sich in unsere Gegenwart etwa übersetzen ließe: „Gott ist uns unmittelbar<br />
nahe, so nahe wie der eigene Atem. Wir wissen uns in ihm geborgen, von ihm getragen und<br />
vor ihm verantwortlich, auch wenn wir über ihn nicht verfügen, ihn nicht auf Bilder festlegen<br />
und nicht in Begriffen definieren können.<br />
„Gott“ bleibt <strong>für</strong> uns Geheimnis.<br />
Und doch dürfen und können wir mit Bonhoeffer sprechen:<br />
„Von guten Mächten wunderbar geborgen<br />
erwarten wir getrost, was kommen mag.<br />
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen<br />
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“<br />
4