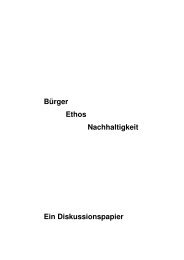Zum Vortragstext (PDF-Datei) - Evangelische Akademikerschaft in ...
Zum Vortragstext (PDF-Datei) - Evangelische Akademikerschaft in ...
Zum Vortragstext (PDF-Datei) - Evangelische Akademikerschaft in ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Prof. Dr. Jörg W<strong>in</strong>ter<br />
Aufgaben und Grenzen kirchlicher Äußerungen zu gesellschaftlichen Fragen.<br />
– Vortrag bei der Mitgliederversammlung der EAiD (Landesverband Baden) am 19. April<br />
2008 <strong>in</strong> Karlsruhe-Durlach –<br />
In Karlsruhe soll gebaut werden. Das Energieunternehmen EnBW plant e<strong>in</strong> neues Kohlekraftwerk<br />
im Rhe<strong>in</strong>hafen, das vor allem auch <strong>in</strong> kirchlichen Kreisen aus ökologischen<br />
Gründen auf heftige Kritik gestoßen ist. Die öffentliche Ablehnung des Projekts durch den<br />
<strong>Evangelische</strong>n Kirchenbezirk Karlsruhe und Durlach hat den Fraktionsvorsitzenden der<br />
FDP im Karlsruher Geme<strong>in</strong>derat, Michael Obert auf den Plan gerufen, der der Kirche zwar<br />
nicht das Recht zur politischen Me<strong>in</strong>ungsäußerung generell absprechen will, der es aber für<br />
grundsätzlich problematisch hält, wenn sich die Kirche zu konkreten tagespolitischen<br />
Fragen äußert. Vor allem dürfe es bei solchen Themen ke<strong>in</strong>e „spezifische christliche Sicht“<br />
geben. 1 Die Äußerungen von Obert haben e<strong>in</strong>e Fülle von Leserbriefen <strong>in</strong> den Badischen<br />
Neuesten Nachrichten (BNN) ausgelöst, die sich überwiegend kritisch mit se<strong>in</strong>er Position<br />
ause<strong>in</strong>andersetzen.<br />
Obert selbst hat <strong>in</strong> der Reaktion auf diese Kritik <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em eigenen Leserbrief betont, dass er<br />
es für das Recht und sogar die Pflicht der Kirchen hält „sich zu gesellschaftlichen Fragen<br />
zu äußern und <strong>in</strong>sbesondere an der Seite der Schwachen und Missachteten zu stehen. Erst<br />
recht gilt dies, wenn Menschenrechte mit Füßen getreten werden.“<br />
Er gibt dann aber zu bedenken:<br />
„Wer mit e<strong>in</strong>em hohen moralischen Anspruch, auf dem Fundament des Evangeliums,<br />
christliche Antworten zu strittigen E<strong>in</strong>zelfragen (…) zu geben können glaubt, der zeigt auf<br />
jeden, der anderer Me<strong>in</strong>ung ist, mit dem F<strong>in</strong>gern, weil dieser dann unweigerlich e<strong>in</strong>e<br />
moralisch niederwertigere ‚unchristliche Me<strong>in</strong>ung’ hat.“ 2<br />
Diese Kontroverse bietet e<strong>in</strong> anschauliches Beispiel dafür, dass die Frage nach den „Aufgaben<br />
und Grenzen kirchlicher Äußerungen zu gesellschaftlichen Fragen“ offenbar immer<br />
noch virulent ist und nach wie vor der Erörterung bedarf, obwohl die Kammer für soziale<br />
Ordnung der EKD mit e<strong>in</strong>er gleichnamigen Denkschrift bereits im Jahre 1970 dazu bereits<br />
das Notwendige gesagt hat. 3 Diese Denkschrift stellt zu der Frage, warum sich die Kirche<br />
zu politischen und gesellschaftlichen Fragen äußern soll oder sogar muss, fest:<br />
1 Siehe den Bericht <strong>in</strong> den BNN vom 29. 11. 2007, S. 17.<br />
22 BNN vom 6. Dezember 2007, S. 24<br />
3 Rat der <strong>Evangelische</strong>n Kirche <strong>in</strong> Deutschland (Hrsg.), Aufgaben und Grenzen kirchlicher Äußerungen zu<br />
gesellschaftlichen Fragen, E<strong>in</strong>e Denkschrift der Kammer für soziale Ordnung der <strong>Evangelische</strong>n Kirche <strong>in</strong><br />
Deutschland, 3. Aufl. Gütersloh 1970.
„Die Legitimation der Kirche, sich zu politischen und gesellschaftlichen Fragen zu<br />
äußern, beruht nach ihrem Selbstverständnis auf dem umfassenden Verkündigungs- und<br />
Sendungsauftrag ihres Herrn“ 4<br />
Abgewiesen wird damit e<strong>in</strong>e Auffassung, die zwar für das persönliche Leben, also für den<br />
Bereich der Individualethik e<strong>in</strong> frommes Gott wohlgefälliges Leben fordert, es aber nicht<br />
als e<strong>in</strong>en christlichen Auftrag betrachtet, sich <strong>in</strong> politischen und gesellschaftlichen Fragen<br />
zu engagieren. 5 E<strong>in</strong>er solche Haltung ist spätestens mit der Barmer Theologischen Erklärung<br />
von 1934 der Boden entzogen worden, die <strong>in</strong> ihrer zweiten These betont, dass<br />
Jesus Christus nicht nur Gottes Zuspruch der Vergebung aller unserer Sünden ist, sondern<br />
„so und mit gleichem Ernst ist er auch Gottes kräftiger Anspruch auf unser ganzes<br />
Leben“. Deshalb wird die falsche Lehre verworfen, „als gebe es Bereiche unseres Lebens<br />
<strong>in</strong> der wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren dieser Welt zu eigen wären, Bereiche<br />
<strong>in</strong> denen wir nicht der Rechtfertigung und Heilung durch ihn bedürften.“<br />
Das ist im zweiten Jahr der Herrschaft des Nationalsozialismus <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Situation h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>gesprochen<br />
worden, <strong>in</strong> der e<strong>in</strong> totaler Staat den Versuch unternahm, alle gesellschaftlichen<br />
Bereiche se<strong>in</strong>en ideologischen Machtansprüchen zu unterwerfen und also auch die Kirche<br />
für sich zu ursupieren. In dieser Situation leben wir heute zum Glück nicht mehr. Die<br />
damals gewonnene Erkenntnis aber, dass auch der Bereich der Politik ke<strong>in</strong> Eigenleben<br />
führen kann, der grundsätzlich außerhalb des Mandats der Kirche zur Verkündigung des<br />
Evangeliums steht, ist bis heute von bleibender Bedeutung und Aktualität.<br />
E<strong>in</strong>wände gegen diese Sichtweise s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>nerhalb der Kirche begründet <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er falsch verstandenen<br />
lutherische „Zwei-Reiche-Lehre“, die e<strong>in</strong>e strikte Trennung des Glaubens der<br />
Christen e<strong>in</strong>erseits und ihrem gesellschaftlichen und politischen Handeln anderseits behauptet.<br />
6 Auf politischer Seite f<strong>in</strong>det das unter Berufung auf das Neutralitätspr<strong>in</strong>zip des<br />
Staates <strong>in</strong> weltanschaulichen und religiösen Fragen und das Pr<strong>in</strong>zip der Trennung von Staat<br />
und Kirche se<strong>in</strong>e Entsprechung <strong>in</strong> der These: „Religion ist Privatsache“. E<strong>in</strong> Musterbeispiel<br />
dafür ist die Rede, die die Bundesm<strong>in</strong>ister<strong>in</strong> für Justiz, Frau Zypries am 12. Dezember<br />
2006 <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> zur Religionspolitik gehalten hat, <strong>in</strong> der sie unter anderem ausführt:<br />
„Das Ergebnis der Trennung zwischen weltlicher und geistlicher Macht ist der säkulare<br />
Verfassungsstaat. Er ist Staat, weil er das Monopol legitimer Herrschaftsgewalt besitzt.<br />
E<strong>in</strong>e Macht, die ihm historisch vor allem deshalb zugeschrieben wurde, um die Gesellschaft<br />
zu befrieden und vor dem religiös motivierten Bürgerkrieg zu bewahren. … Im<br />
säkularen Verfassungsstaat kann Religion nicht mehr den Anspruch haben, das Leben der<br />
Menschen vollständig und verb<strong>in</strong>dlich zu regeln, Religion bestimmt nicht mehr die gesamte<br />
gesellschaftliche Ordnung, sondern sie ist weitgehend zur Privatsache des e<strong>in</strong>zelnen<br />
Staatsbürgers geworden“.<br />
Gegen diese Ausführungen ist nichts e<strong>in</strong>zuwenden, soweit sie die Tatsache beschreiben,<br />
dass sich der säkulare Verfassungsstaat nicht mit e<strong>in</strong>er bestimmten Religion oder Weltanschauung<br />
identifizieren und sie zum alle<strong>in</strong>igen Maßstab se<strong>in</strong>es Handelns machen darf. Frau<br />
4 Ebd., S 10.<br />
5 Ebd., S.14.<br />
6 Vergl. dazu: M. Roth, Zwei-Reiche-Lehre, EvSTL Neuausgabe, Stuttgart 2006, Sp. 2789 ff.
Zypries rennt damit offene Türen e<strong>in</strong>, denn längst ist die Trennung von Staat und Kirche<br />
und se<strong>in</strong>e weltanschauliche Neutralität als Grundlage e<strong>in</strong>es pluralistischen Staatswesens,<br />
der sich zur umfassenden Gewährleistung der Religionsfreiheit für alle se<strong>in</strong>e Bürger verpflichtet<br />
weiß, auch von den Kirchen anerkannt. So hat sich die Bekennende Kirche im<br />
„Dritten Reich“ <strong>in</strong> der fünften These ihrer bereits erwähnte BTE 1934 nicht nur gegen die<br />
damaligen Übergriffe e<strong>in</strong>es sich total verstehenden Staates <strong>in</strong> den Bereich der Kirche zur<br />
Wehr gesetzt, sondern auch umgekehrt die falsche Lehre verworfen, „als solle und könne<br />
sich die Kirche über ihren besonderen Auftrag h<strong>in</strong>aus staatliche Art, staatliche Würde aneignen<br />
und damit selbst zu e<strong>in</strong>em Organ des Staates werden.“<br />
In diesem S<strong>in</strong>ne hat Dietrich Bonhoeffer <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em berühmten Aufsatz „Die Kirche vor der<br />
Judenfrage“ im April 1933 hervorgehoben, dass es nicht Aufgabe der Kirche se<strong>in</strong> könne,<br />
unmittelbar selbst politisch zu handeln und <strong>in</strong> die Verantwortlichkeit staatlichen Handelns<br />
e<strong>in</strong>zugreifen. Aber, so fährt Bonhoeffer fort, „das bedeutet nicht, daß sie teilnahmslos das<br />
politische Handeln an sich vorüberziehen läßt; sondern sie kann und soll, gerade weil sie<br />
nicht im e<strong>in</strong>zelnen Fall moralisiert, den Staat immer danach fragen, ob se<strong>in</strong> Handeln von<br />
ihm als legitim staatliches Handeln verantwortete werden könne, d.h. als Handeln, <strong>in</strong> dem<br />
Recht und Ordnung, nicht Rechtlosigkeit und Unordnung geschaffen werden“. 7<br />
Bonhoeffer sieht drei Möglichkeiten der Kirche, ihre politische Verantwortung gegenüber<br />
dem Staat wahrzunehmen, nämlich<br />
1. die an den Staat gerichteten Frage nach dem legitim staatlichen Charakter se<strong>in</strong>es<br />
Handelns, d.h. die Verantwortlichmachung des Staates für das was er tut oder unterlässt,<br />
2. den Dienst an den Opfern des Staatshandelns, denn die Kirche ist den Opfern jeder Gesellschaftsordnung<br />
<strong>in</strong> unbed<strong>in</strong>gter Weise verpflichtet, auch wenn sie nicht der christlichen<br />
Geme<strong>in</strong>de zugehören, und<br />
3. nicht nur die Opfer unter dem Rad zu verb<strong>in</strong>den, sondern dem Rad selbst <strong>in</strong> die<br />
Speichen zu fallen.<br />
Die dritte Möglichkeit wäre e<strong>in</strong> unmittelbar politisches Handeln der Kirche, das<br />
Bonhoeffer nur dann für möglich und gefordert ansieht, „wenn die Kirche des Staat <strong>in</strong><br />
se<strong>in</strong>er Recht und Ordnung schaffenden Funktion versagen sieht, d.h. wenn sie den Staat<br />
hemmungslos e<strong>in</strong> Zuviel oder Zuwenig an Ordnung und Recht verwirklichen sieht. In<br />
beiden muss sie dann die Existenz des Staates und damit auch ihre eigenen Existenz bedroht<br />
sehen.“ 8 Über die Notwendigkeit des unmittelbar politischen Handelns der Kirche <strong>in</strong><br />
diesem S<strong>in</strong>ne ist nach Auffassung Bonhoeffers jeweils von e<strong>in</strong>em „evangelischen Konzil“<br />
zu entscheiden und kann nie vorher kasuistisch konstruierte werden. 9 Dah<strong>in</strong>ter verbirgt<br />
sich letztlich das Problem, ob und unter welchen Voraussetzungen es e<strong>in</strong> Recht auf Widerstand<br />
gibt, das hier nicht vertieft werden kann.<br />
7<br />
D. Bonhoeffer, Die Kirche vor der Judenfrage, zitiert nach: Chr. Gremmels, W. Huber (Hrsg.), Dietrich<br />
Bonhoeffer Auswahl, Bd.2, Gütersloh 2006, S. 69 ff. (72).<br />
8<br />
Ebd., S. 74.<br />
9<br />
Ebd., S. 75..
Die Befürchtung, die Kirche könnte das Pr<strong>in</strong>zip der Trennung von Staat und Kirche <strong>in</strong><br />
Frage stellen und ziele darauf ab, sich an die Stelle des Staates zu setzen oder wolle die<br />
Politik klerikal bevormunden, ist deshalb jedenfalls heute ganz unbegründet. Gleichwohl<br />
ist es ke<strong>in</strong>e Grenzüberschreitung, wenn sich die Christen und die Kirche auch zu<br />
politischen Fragen zu Wort melden, denn: „Christliche Existenz ohne politische Relevanz“<br />
gibt es nicht. 10 Das kann sie schon deshalb nicht geben, weil gerade auch das Schweigen<br />
zu gesellschaftlichen Entwicklungen, das Wegsehen und e<strong>in</strong>fach Geschehen lassen, nicht<br />
ohne politische Auswirkungen bleibt, wie gerade auch die Erfahrungen aus der Zeit des<br />
Nationalsozialismus zeigen. Die Kirche muss nicht nur verantworten, was sie im H<strong>in</strong>blick<br />
auf politische und gesellschaftliche Themen sagt und tut, sondern auch was sie nicht sagt<br />
und was sie versäumt zu tun. Mart<strong>in</strong> Niemöller, der wegen se<strong>in</strong>es Widerstandes gegen das<br />
NS-Regime vier Jahre im KZ gesessen hat, hat diese versäumte Verantwortung im Rückblick<br />
e<strong>in</strong>drucksvoll wie folgt illustriert:<br />
„Ich stand mit me<strong>in</strong>er Frau vor dem Krematorium <strong>in</strong> Dachau, und an e<strong>in</strong>em Baum vor<br />
diesem Gebäude h<strong>in</strong>g e<strong>in</strong> weißgestrichenes Kistenbrett mit e<strong>in</strong>er schwarzen Inschrift.<br />
Diese Inschrift war e<strong>in</strong> letzter Gruß der Dachauer Häftl<strong>in</strong>ge, die <strong>in</strong> Dachau zurückgeblieben<br />
s<strong>in</strong>d und am Ende dort von den Amerikanern angetroffen und später befreit<br />
wurden. Es war e<strong>in</strong> letzter Gruß dieser Menschen für ihre im Tod vorangegangenen<br />
Kameraden und Brüder, und dort stand zu lesen: ‚Hier wurden <strong>in</strong> den Jahren 1933-1945<br />
238 756 Menschen verbrannt.’ Als ich es gelesen hatte, merkte ich, daß me<strong>in</strong>e Frau ohnmächtig<br />
wurde und an me<strong>in</strong>em Arm zitternd h<strong>in</strong>sank. Ich musste sie stützen, und ich merkte<br />
zugleich, wie mir e<strong>in</strong> kalter Schauer über den Rücken lief. Ich glaube, me<strong>in</strong>e Frau wurde<br />
ohnmächtig, als sie diese Viertelmillion las. Die hatte mich nicht bewegt. Denn sie sagte<br />
mir nicht neues. Was mich <strong>in</strong> diesem Augenblick <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en kalten Fieberschauer jagte, das<br />
war etwas anderes. Das waren die anderen zwei Zahlen: ‚1933-1945’, die da standen. Und<br />
ich faßte nach me<strong>in</strong>em Alibi und wusste, die zwei Zahlen, das ist der Steckbrief des<br />
lebendigen Gottes gegen Pastor Niemöller. Me<strong>in</strong> Alibi reichte vom 1. Juli 1937 bis Mitte<br />
1945. Da stand ‚1933-1945’. Adam, wo bist du? Mensch wo bist du gewesen? Ja, ich weiß,<br />
Mitte 1937 bis zum Ende hast Du e<strong>in</strong> Alibi. Aber, du wirst gefragt: ‚Wo warst du 1933 bis<br />
zum 1. Juli 1937?’ Und ich konnte dieser Frage nicht mehr ausweichen. … Die versäumte<br />
Verantwortung, die Verantwortung, die wir nicht haben sehen wollen und nicht haben<br />
wahr haben wollen, das ist es, was vor Gott wider uns zeugt und uns <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en Augen unnütz<br />
macht, daß er ke<strong>in</strong>en anderen Raum dafür hat als die Verdammnis der Hölle.“ 11<br />
Hier wird deutlich: mehr noch als durch ihr Reden und Handeln kann sich die Kirche <strong>in</strong><br />
Schuld verstricken, durch das was sie nicht zur rechten Zeit sagt und was sie unterlässt zu<br />
tun, wenn es notwendig ist. So wie unserer Väter und Mütter für die Juden 1933 rechtzeitig<br />
hätten schreien müssen, wie es Bonhoeffer e<strong>in</strong>gefordert hat, so stehen wir heute vor den<br />
Frage, was wir als Christen und als Kirche unterlassen haben, dass das Gedankengut des<br />
Rassismus wieder um sich greifen kann, das Ausländer <strong>in</strong> Deutschland nicht mehr sicher<br />
leben können, dass wir zu Lasten unserer Umwelt wirtschaften und die Gewährleistung der<br />
Freiheitsrechte <strong>in</strong> unserer Gesellschaft mehr und mehr an Substanz verliert. Ob wir es<br />
wollen oder nicht, ob es uns selbst oder den Politikern nun passt oder nicht, wir s<strong>in</strong>d durch<br />
10 Denkschrift der EKD, S. 14.<br />
11 M. Niemöller, Der Weg <strong>in</strong>s Freie (3.7.1946), <strong>in</strong>: M. Greschat (Hrsg.), Die Schuld der Kirche, Dokumente<br />
und Reflexionen zur Stuttgarter Schulderklärung vom 18./19. Oktober 1945, S. 199 ff. (201 ff)
diese Themen auch <strong>in</strong> der Bewährung unseres christlichen Glaubens herausgefordert und<br />
können uns nicht <strong>in</strong> die Nische privater Frömmigkeit zurückziehen oder abdrängen lassen,<br />
weil es Konflikte erspart und für alle Beteiligten der bequemere Weg ist.<br />
Es besteht also ke<strong>in</strong> Zweifel, wir müssen uns als Christen und als Kirche auch und gerade<br />
mit den Überzeugungen <strong>in</strong> die politischen Diskussionen e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen, die wir aus unserem<br />
Glauben gew<strong>in</strong>nen. <strong>Zum</strong> Glück leben wir <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Staat, der uns das durch die <strong>in</strong> Artikel 4<br />
GG gewährleiste Religionsfreiheit ermöglicht. Diese Freiheit umfasst nämlich nicht nur<br />
das Recht e<strong>in</strong>en Glauben zu haben, oder ihn abzulehnen, sondern auch – mit den Worten<br />
des Bundesverfassungsgerichts – er räumt auch das Recht e<strong>in</strong>, „se<strong>in</strong> gesamtes Verhalten<br />
an den Lehren des Glaubens auszurichten und se<strong>in</strong>er <strong>in</strong>neren Überzeugung gemäß zu<br />
handeln (...). In diesem S<strong>in</strong>ne enthält Art. 4 Abs. 1 und 2 GG nicht nur e<strong>in</strong> <strong>in</strong>dividuelles<br />
Abwehrrecht, das dem Staat die E<strong>in</strong>mischung <strong>in</strong> den höchstpersönlichen Bereich des<br />
E<strong>in</strong>zelnen verbietet, sondern es gebietet auch <strong>in</strong> positivem S<strong>in</strong>n, Raum für die aktive Betätigung<br />
der Glaubensüberzeugung und die Verwirklichung der autonomen Persönlichkeit<br />
auf weltanschaulich-religiösem Gebiet zu sichern.“ 12<br />
Wenn die Christen und ihre Kirchen sich <strong>in</strong> der Wahrnehmung dieses Rechtes <strong>in</strong> politische<br />
Diskussionen e<strong>in</strong>mischen und ihre Auffassung dazu zu Gehör br<strong>in</strong>gen, dann tun sie das<br />
nicht als Außenstehende, die – wie es im Leserbrief von Herrn Obert ankl<strong>in</strong>gt – mit dem<br />
Anspruch der hören moralischen Autorität andere kritisieren und bevormunden, sondern<br />
sie leisten damit e<strong>in</strong>en Beitrag zum politischen Diskurs <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em pluralistischen Staatswesen,<br />
das vor allem auch auf solche gesellschaftlichen Kräfte angewiesen ist, die sich<br />
dabei nicht primär von unmittelbar eigene Interessen leiten lassen. Für die evangelische<br />
Kirche ist von vornhere<strong>in</strong> klar, dass sie <strong>in</strong> solchen Fragen nicht etwa die Autorität e<strong>in</strong>es<br />
unfehlbaren Lehramtes für sich <strong>in</strong> Anspruch nimmt, das sie selbst <strong>in</strong> unmittelbaren Fragen<br />
des Glaubens nicht kennt. Auch die Kirche ist mit allem was sie sagt darauf angewiesen,<br />
dass sie mit ihren Argumenten überzeugen kann und sie kann ihre Ziele nur durchsetzten,<br />
wenn es ihr gel<strong>in</strong>gt, den demokratischen Willensbildungsprozess entsprechend zu bee<strong>in</strong>flussen<br />
und die erforderlichen Mehrheiten zu gew<strong>in</strong>nen. Insofern ist es missverständlich,<br />
wenn gelegentlich vom „Wächteramt der Kirche“ <strong>in</strong> gesellschaftspolitischen Fragen gesprochen<br />
wird. Diese Redewendung suggeriert e<strong>in</strong>e Position der Kirche, <strong>in</strong> der sie von<br />
e<strong>in</strong>er „höheren Warte“ von außen zur Gesellschaft und zum Staat als e<strong>in</strong>e von beiden unabhängige<br />
Instanz redet.<br />
Diese Bild, wie es von der römisch-katholischen Kirche im 19. Jahrhundert mit der Lehre<br />
von der Kirche als e<strong>in</strong>er „societas perfecta“ entwickelt worden ist, entspricht nicht mehr<br />
unserem heutigen Verständnis des demokratischen Verfassungsstaates und wäre zum<strong>in</strong>dest<br />
mit dem Selbstverständnis der evangelischen Kirche nicht zu vere<strong>in</strong>baren.<br />
Das gleiche gilt nach dem 2. vatikanischen Konzil wohl auch für die römisch-katholische<br />
Kirche. So hat sich das zweite Vatikanische Konzil <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Erklärung über die Religionsfreiheit<br />
„Dig<strong>in</strong>itatis Humanae“ zu e<strong>in</strong>er umfassenden Religionsfreiheit bekannt und erklärt<br />
–, „daß alle Menschen frei se<strong>in</strong> müssen von jedem Zwang sowohl von seiten E<strong>in</strong>zelner<br />
wie gesellschaftlicher Gruppen, wie jeglicher menschlicher Gewalt, so daß <strong>in</strong><br />
12 BVerfGE Bd. 41, S. 49.
eligiösen D<strong>in</strong>gen niemand gezwungen wird, gegen se<strong>in</strong> Gewissen zu handeln, noch daran<br />
geh<strong>in</strong>dert wird, privat und öffentlich, als e<strong>in</strong>zelner oder <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit anderen –<br />
<strong>in</strong>nerhalb der gebührenden Grenzen – nach se<strong>in</strong>em Gewissen zu handeln.“ 13<br />
Mit ihren Äußerungen br<strong>in</strong>gt sich die Kirche heute <strong>in</strong> den politischen Diskurs e<strong>in</strong>er Gesellschaft<br />
e<strong>in</strong>, der sie nicht gegenüber übersteht, sondern deren Bestandteil sie selbst ist. Ihr<br />
dieses Recht mit dem Argument zu verweigern, politische Entscheidungen dürften wegen<br />
der Neutralitätspflicht des Staates nicht religiös motiviert se<strong>in</strong>, wäre nicht nur e<strong>in</strong>en Beh<strong>in</strong>derung<br />
des Prozesses der demokratischen Willensbildung, sondern e<strong>in</strong> klarer Verstoß<br />
gegen die Gewährleistung der Religionsfreiheit, die auch und gerade diese öffentliche<br />
Dimension e<strong>in</strong>schließt.<br />
Wenn die Kirche im Konzert der pluralistischen Me<strong>in</strong>ungen auf den Prozess der<br />
politischen Willensbildung wirksam E<strong>in</strong>fluss nehmen will, dann setzt das freilich voraus,<br />
dass sie über die notwendige Kompetenz verfügt. Der frühere Oberkirchenrat im Kirchenamt<br />
der EKD, Tilman W<strong>in</strong>kler hat fünf Aspekt benannt, die diese Kompetenz ausmachen,<br />
nämlich:<br />
• Geistliche Vollmacht,<br />
• Glaubwürdigkeit,<br />
• Sachkundigkeit,<br />
• Weisheit und<br />
• Zuständigkeit. 14<br />
Kirchliche Äußerungen müssen ihre Wirkung verfehlen und werfen zu Recht die Frage<br />
nach ihrer <strong>in</strong>neren Legitimität auf, wenn sie sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em dieser Punkte als defizitär erweisen.<br />
Was die Vollmacht der Kirche angeht s<strong>in</strong>d mit den Begriffen Friede, Gerechtigkeit<br />
und Bewahrung der Schöpfung im Wesentlichen die Themenkreise benannt, die e<strong>in</strong>en besondern<br />
Bezug zu ihrem geistlichen Auftrag aufweisen. Entgegen e<strong>in</strong>em vielfach anzutreffenden<br />
Missverständnis ist es unbed<strong>in</strong>gt notwendig, diesen Zusammenhang herzustellen.<br />
Die Auffassung, dass sich die Kirche ja ruhig zu politischen Fragen äußern könne,<br />
ihre Me<strong>in</strong>ung aber bitte schön nicht vom Evangelium her begründen möge, verkennt, dass<br />
die Kirche überhaupt nur dann mit Vollmacht reden kann, wenn sie dies auf Grund e<strong>in</strong>er<br />
Motivation des Glaubens tut. Kann Sie das nicht deutlich machen, bleiben ihre<br />
Äußerungen e<strong>in</strong>e Stimme unter vielen ohne Profil und Gewicht. Die „Verb<strong>in</strong>dlichkeit und<br />
Autorität e<strong>in</strong>er kirchlichen Äußerung zu gesellschaftlichen und politischen Fragen bestimmt<br />
sich alle<strong>in</strong> danach, ob die Äußerung schrift- und sachegemäß und dar<strong>in</strong> überzeugend<br />
ist.“ 15<br />
E<strong>in</strong> häufiger E<strong>in</strong>wand dagegen, den auch Herr Obert <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em bereits erwähnten Leserbrief<br />
erhebt, besteht dar<strong>in</strong>, dass allen die e<strong>in</strong>e andere Me<strong>in</strong>ung vertreten, damit abgesprochen<br />
werde, gute Christen zu se<strong>in</strong>. Dieser E<strong>in</strong>wand trifft deshalb nicht zu, weil er<br />
13<br />
Zitiert nach: Karl Rahner/ Herbert Vorgrimler, Kle<strong>in</strong>es Konzilskompendium 27. Aufl., Freiburg<br />
i.Br. 1998, S., 662.<br />
14<br />
T. W<strong>in</strong>kler, Öffentliches Reden der Kirche, Thesen zur Frage nach der Kompetenz, Diakonie, Sondernummer<br />
8 März 1984, S. 148<br />
15<br />
Denkschrift der EKD. S. 19.
Sache und Person mite<strong>in</strong>ander verwechselt. Er verschiebt die mögliche und nötige Ause<strong>in</strong>andersetzung<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Sachfrage auf die Ebenen e<strong>in</strong>er Beurteilung der Person, die e<strong>in</strong>e<br />
bestimmte Auffassung vertritt, also auf e<strong>in</strong> Thema, dass im Normalfall gar nicht zur<br />
Debatte steht. E<strong>in</strong>e Ausnahme stellt hier möglicher Weise die besondere Situation dar,<br />
wenn die Kirche <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er politischen Frage den „Status confessionis“ ausruft, also gegenüber<br />
jedermann verb<strong>in</strong>dlich feststellt, das bestimmte Lehren und Handlungen oder deren<br />
Billigung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er bestimmten geschichtlichen Situation der Verleugnung des christlichen<br />
Glaubens gleichkommt. E<strong>in</strong> Beispiel dafür ist der Erklärung des Moderamens des Reformierten<br />
aus dem Jahre 1982, <strong>in</strong> dem heißt:<br />
„Die Friedensfrage ist e<strong>in</strong>e Bekenntnisfrage. Durch sie ist für uns der status confessionis<br />
gegeben, weil es <strong>in</strong> der Stellung zu den Massenvernichtungsmitteln um das Bekennen oder<br />
Verleugnen des Evangeliums geht.“ 16<br />
Diese Position, e<strong>in</strong>e politische Entscheidung – und sei es e<strong>in</strong>e solche auf Leben und Tod –<br />
zu e<strong>in</strong>er Frage des Bekenntnisses zu erheben, ist vor allem auf lutherischer Seite auf<br />
heftige Ablehnung gestoßen, weil die Voraussetzung nicht akzeptiert wird, dass des nur<br />
e<strong>in</strong>en denkbaren politischen Weg zur Erhaltung des Friedens gebe. Es ist sicher zutreffend,<br />
dass es <strong>in</strong> politischen Fragen so gut wie nie nur e<strong>in</strong>en denkbaren Weg gibt. Dennoch geht<br />
die lutherische Kritik am tieferen Kern des Problems vorbei, denn die entscheidende Frage<br />
ist, ob e<strong>in</strong>e bestimmte politische Lösung pr<strong>in</strong>zipiell als mit dem Evangelium unvere<strong>in</strong>bar<br />
anzusehen ist. Außer der Frage nach der Beurteilung der Option zur Anwendung von<br />
Massenvernichtungsmitteln, ist <strong>in</strong> diesem Zusammenhang z.B. an den absoluten Ausschluss<br />
der Anwendung von Folter zur Aufklärung von Straftaten oder die Ächtung jeglicher<br />
Form der Sklaverei zu denken. Gerade <strong>in</strong>dem bestimmte politische Lösungen<br />
schlechth<strong>in</strong> ausgeschlossen werden, wird der Weg frei, andere politische Alternativen zu<br />
entwickeln. Deshalb ist auch der Bismarck zugeschrieben Satz: „Mit der Bergpredigt lässt<br />
sich ke<strong>in</strong>e Politik machen“ falsch, weil er die Sache auf den Kopf stellt. Umgekehrt wird<br />
e<strong>in</strong> Schuh daraus: Die Ethik der Bergpredigt ermöglicht politische Lösungen, weil sie den<br />
Automatismus von Gewalt und Gegengewalt <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en zwanghaften Abläufen durchbricht<br />
und damit neue Möglichkeiten zur Konfliktbewältigung erst eröffnet.<br />
Festzuhalten bleibt aber, dass <strong>in</strong> normalen Zeiten die Verwerfung bestimmter politischer<br />
Lösungen im S<strong>in</strong>ne des „Status Confessionis“ die seltene Ausnahme se<strong>in</strong> dürfte. Im<br />
Übrigen bleibt dann immer noch die Frage, wer darüber zu entscheiden hat. Wenn man<br />
Bonhoeffer folgt, bedürfte es dazu e<strong>in</strong>es „evangelischen Konzil“, jedenfalls aber e<strong>in</strong>en<br />
„Magnus consensus“ <strong>in</strong>nerhalb der Kirche.<br />
Nach der geistlichen Vollmacht, ist das zweite Kriterium für kirchliche Äußerungen nach<br />
Tillmann W<strong>in</strong>kler die Glaubwürdigkeit. Da die Kirche, wie gesagt zu e<strong>in</strong>er Gesellschaft<br />
redet, von der sie selbst e<strong>in</strong> Teil ist, ist sie auch immer e<strong>in</strong> Stück weit Adressat ihrer<br />
eigenen Rede. Sie ist daher auch immer der Frage ausgesetzt, ob und wie sie selbst bereit<br />
ist, sich entsprechend ihrer eigenen politischen Forderungen zu verhalten und unbequeme<br />
Konsequenzen im Kauf zu nehmen. Zu Recht heißt es im geme<strong>in</strong>samen Wort des Rates der<br />
16 Das Bekenntnis zu Jesus Christus und die Friedensverantwortung der Kirche, E<strong>in</strong>e Erklärung des<br />
Moderamens des reformierten Bundes, Gütersloh 1982, S. 6.
<strong>Evangelische</strong>n Kirche <strong>in</strong> Deutschland und der Deutschen Bischofkonferenz zur wirtschaftlichen<br />
und sozialen Lage <strong>in</strong> Deutschland „Für e<strong>in</strong>e Zukunft <strong>in</strong> Solidarität und Gerechtigkeit“:<br />
„Deshalb dürfen Glauben und Leben, Verkündigung und Praxis der Kirche im eigen Verhalten<br />
der Kirche wie <strong>in</strong> ihrer Botschaft nicht ause<strong>in</strong>andertreten. Die Christen können<br />
nicht das Brot am Tisch des Herrn teilen, ohne auch das tägliche Brot zu teilen.“ 17<br />
Das freilich ist oft schwerer getan als gesagt, denn auch die Kirche unterliegt vielfachen<br />
wirtschaftlichen und anderen Zwängen, denen sie sich entziehen kann oder will.<br />
„Oft wird das Argument der Sachgesetzlichkeit gerade dann von Praktikern <strong>in</strong> Politik und<br />
Wirtschaft als Vorwand gebraucht, wenn man das Gebotene und auch Mögliche unterlässt,<br />
weil man es <strong>in</strong> Wahrheit nicht will“ 18<br />
In diesem zutreffenden Satz aus der Denkschrift über Möglichkeiten und Grenzen kirchlicher<br />
Äußerungen zu gesellschaftlichen Fragen, hätte auch die Kirche selbst erwähnt<br />
werden müssen, für die das nicht weniger gilt.<br />
Die Überzeugungskraft kirchlicher Stellungnahmen hängt auch mit dem nächsten<br />
Kriterium zusammen, nämlich der Sachkundigkeit. Sie werden umso überzeugender ausfallen,<br />
„je sachkundiger der vorf<strong>in</strong>dliche Sacheverhalt geklärt und die faktisch vorliegende<br />
Notlage erfasst wird. Als Antwort auf die so ermittelten Fragestellungen erwächst dann die<br />
konkrete Entscheidung aus e<strong>in</strong>em Zusammenspiel von Glaubenserkenntnis und vernunftmäßigem<br />
Erfahrungswissen.“ 19<br />
Mit anderen Worten: Glaubenstärke ersetzt nicht die Sachkunde. Dies bedeutet auch, dass<br />
es nicht Sache der Kirche se<strong>in</strong> kann, sich zu jedem beliebigen politischen Tagesthema zu<br />
äußern, wenn sie davon nicht genügend versteht und dafür ke<strong>in</strong> <strong>in</strong> ihrem Auftrag begründeter<br />
Anlass besteht. Die Kirche ist deshalb gut beraten, sich <strong>in</strong> der Orientierung an<br />
ihrem religiösen Auftrag der notwendigen Selbstbeschränkung zu unterwerfen. E<strong>in</strong>e geschwätzige<br />
und Kirche ist ebenso wenig hilfreich, wie e<strong>in</strong>e Kirche, die zur rechten Zeit<br />
nicht den Mund aufmacht.<br />
Kirchliche Äußerungen zu gesellschaftlichen und politischen Fragen, sollen aber nicht nur<br />
sachkundig se<strong>in</strong>, sondern auch „weise“. Unter dem Kriterium der „Weisheit“ vermerkt<br />
Tillmann W<strong>in</strong>kler u.a. die Stichworte „hilfreich“, seelsorgerlich“, „wohldurchdacht“, „besonnen“,<br />
„e<strong>in</strong>fühlsam“, „weitsichtig“, „maßvoll“ „geschickt“. Alle diese Kriterien s<strong>in</strong>d<br />
sicher zutreffend und richtig. Sie bergen aber die Gefahr <strong>in</strong> sich, dass kirchliche Stellungnahmen,<br />
<strong>in</strong> dem Bestreben, alle dieses gleichzeitig zu erfüllen, zu ausgewogen und zu<br />
harmonisch ausfallen. Sie müssen und sollen eben auch „anstößig“ se<strong>in</strong>, also Anstoß geben<br />
und Anstoß erregen, möglicherweise sogar <strong>in</strong>nerhalb der Kirche selbst. Auch die kirchliche<br />
E<strong>in</strong>heit ist ke<strong>in</strong> oberster Wert, der dadurch erhalten werden kann, „dass sich die Kirche auf<br />
17<br />
Kirchenamt der EKD, Sekretariat der Deutsche Bischofskonferenz (Hrsg.), Für e<strong>in</strong>e Zukunft <strong>in</strong> Solidarität<br />
und Gerechtigkeit, Hannover/Bonn 1997 (Geme<strong>in</strong>same Texte 9).<br />
18<br />
Denkschrift EKD, S. 16.<br />
19<br />
Ebd., S. 30.
‚todrichtige’ allgeme<strong>in</strong>e Äußerungen beschränkt, die der nahezu e<strong>in</strong>mütigen Zustimmung<br />
sicher s<strong>in</strong>d, weil sie ke<strong>in</strong>e Konsequenzen für das Verhalten <strong>in</strong> Politik und Gesellschaft erkennen<br />
lassen.“ 20<br />
Zu diesem Zweck ist es u.U. nötig, auch e<strong>in</strong>seitig Partei zu ergreifen, z.B. für solche<br />
Menschen, die <strong>in</strong> unserer Gesellschaft kaum e<strong>in</strong>e Stimme haben, deren Interessen allzu<br />
leicht unter die Räder geraten, weil sei ke<strong>in</strong>e eigene Stimme haben. Und derer gibt es viele<br />
von A, wie Asylbewerber und Arbeitslose bis Z, wie Zwangsprostituierte. Die Kirche muss<br />
deshalb im E<strong>in</strong>zelfall die Rolle def<strong>in</strong>ieren, <strong>in</strong> der sie jeweils reden will. Es kann se<strong>in</strong>, dass<br />
sie sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Streitfrage als Vermittler<strong>in</strong> anbietet, sie kann aber auch genötigt se<strong>in</strong>, im<br />
S<strong>in</strong>ne Bonhoeffers e<strong>in</strong>seitig und streitbar Partei zu ergreifen, wenn Menschen zu Opfern<br />
der Gesellschaft oder des stattlichen Handelns werden, und sie kann ihre Aufgabe dar<strong>in</strong><br />
sehen, <strong>in</strong> politischen Fragen voraus denkt und bestimmte Entwicklungen anzustoßen. E<strong>in</strong><br />
Musterbeispiel für das letzte ist die viel gerühmte Denkschrift der EKD „Die Lage der<br />
Vertrieben und das Verhältnis des deutschen Volkes zu se<strong>in</strong>en östlichen Nachbarn“ aus<br />
dem Jahre 1965, die entscheidend dazu beigetragen hat, der Aussöhnung mit den Staaten<br />
des ehemaligen Ostblocks den Weg zu ebnen.<br />
Lassen Sie mich das am Beispiel des so genannte „Kirchenasyl“ erläutern:<br />
Das „Kirchenasyl“ ist e<strong>in</strong>e Handlung zum Schutz akut bedrohten Lebens, die dazu helfen<br />
soll, Zeit zu gew<strong>in</strong>nen für e<strong>in</strong>e der Bedeutung e<strong>in</strong>es Menschenlebens entsprechende Überprüfung<br />
der Frage durch die zuständigen staatlichen Stellen, ob nicht doch e<strong>in</strong>e Duldung<br />
ausgesprochen werden kann, bis die Flüchtl<strong>in</strong>ge ohne Gefahr um ihr Leben <strong>in</strong> ihre Heimat<br />
zurückkehren können. "Kirchenasyl" <strong>in</strong> diesem Verständnis bedeutet die durch Mitglieder<br />
christlicher Geme<strong>in</strong>den gewährte Zuflucht und Fürsprache für menschenrechtswidrig Verfolgte.<br />
Als "subsidiärer Menschenrechtsschutz" kann das "Kirchenasyl" <strong>in</strong> Notfällen<br />
ethisch gerechtfertigt se<strong>in</strong>, wenn sich das staatliche Asylrecht nicht am Maßstab der<br />
Menschenwürde und der Achtung der Menschenrechte orientiert. 21 In der Gewährung von<br />
„Kirchenasyl“ schlägt sich unmittelbar die Beistandspflicht der christlichen Geme<strong>in</strong>de für<br />
bedrohte Menschen im konkreten E<strong>in</strong>zelfall nieder. Aber die E<strong>in</strong>zelfälle gew<strong>in</strong>nen zugleich<br />
allgeme<strong>in</strong>e Bedeutung, denn sie können "auf Mängel <strong>in</strong> der allgeme<strong>in</strong>en Rechtslage<br />
oder der e<strong>in</strong>zelnen Gesetzesregelungen h<strong>in</strong>weisen, die dann mit dem Ziel e<strong>in</strong>er Änderung<br />
zum Gegenstand öffentlicher Kritik und Ause<strong>in</strong>andersetzung gemacht werden müssen". 22<br />
E<strong>in</strong> anders Beispiel aus der Praxis betrifft die Frage nach der Rechtfertigung von Boykottaufrufen<br />
gegen bestimmte Firmen oder Produkte. Ich denke z.b. an die Aktion „Kauft<br />
ke<strong>in</strong>e Früchte der Apartheid“ der evangelischen Frauenarbeit währen der Zeit der Rassentrennung<br />
<strong>in</strong> Südafrika, oder – näher liegend – den Boykottaufruf gegen das Versandhaus<br />
Quelle im Kirchenbezirk Lörrach vor e<strong>in</strong> paar Jahren. H<strong>in</strong>tergrund war die Entscheidungen<br />
des Versandhauses, den Standort Lörrach des von ihr übernommenen Versandhauses<br />
„Schöpfl<strong>in</strong> Hagen“ zu schließen, mit entsprechenden negativen Folgen für die Be-<br />
20 Denkschrift EKD, ebd., S. 23.<br />
21 H.-R. Reuter, Kirchenasyl und staatliches Asylrecht, <strong>in</strong>: Rau/Reuter/Schlaich(Hrsg.), Das Recht der<br />
Kirche, Bd. III, (Forschungen und Berichte der <strong>Evangelische</strong>n Studiengeme<strong>in</strong>schaft Bd. 51), Gütersloh<br />
1994) , S. 598.<br />
22 Erklärung des Rates der EKD vom 9./10. September 1994, abgedruckt epd-Dokumentation Nr. 43/94, S.<br />
94.
schäftigten. Ebenso wie beim „Kirchenasyl“ handelt es sich hier <strong>in</strong>sofern um Grenzfälle,<br />
weil die Kirche hier über e<strong>in</strong>en Beitrag zur politischen Me<strong>in</strong>ungsbildung h<strong>in</strong>aus aktiv<br />
handelnd <strong>in</strong> den Aufgabenbereich des Staates bzw. den Rechtskreis e<strong>in</strong>es privaten Unternehmens<br />
e<strong>in</strong>greift. In diesem Zusammenhang können sich durchaus schwierige juristische<br />
Fragen stellen, die das Strafrecht und das Zivilrecht, aber auch das Verfassungsrecht und<br />
se<strong>in</strong>e Ausstrahlungswirkung auf andere Rechtsgebiete berühren.<br />
Das letzte von Tillmann W<strong>in</strong>kler genannte Kriterium ist die Frage nach der „Zuständigkeit“<br />
der Kirche. Tatsächlich ist die Kirche ja nicht „zuständig“ für die Frage, ob der Staat<br />
im E<strong>in</strong>zelfall Asyl gewährt oder nicht und sie ist auch nicht zuständig für die betriebswirtschaftlichen<br />
Entscheidungen e<strong>in</strong>zelner Unternehmen, z.B. bei Stilllegungen von Betrieben.<br />
Sie trägt dafür weder die politischen noch die wirtschaftlichen Konsequenzen.<br />
Woher also nimmt die Kirche das Recht, sich <strong>in</strong> solchen Fragen e<strong>in</strong>zumischen, von denen<br />
sie selbst gar nicht unmittelbar betroffen ist? Den Grund dafür hat bereits Dietrich<br />
Bonhoeffer <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em zitierten Aufsatz über die Kirche vor der Judenfrage genannt, die<br />
Tatsache nämlich, dass sich die Kirche den Opfern jeder Gesellschaftsordnung <strong>in</strong> unbed<strong>in</strong>gter<br />
Weise verpflichtet weiß. Gerade dann, wenn die Kirche nicht für ihre eigenen<br />
<strong>in</strong>stitutionellen Interessen e<strong>in</strong>tritt, erfüllt sie ihren besonderen Auftrag, <strong>in</strong>dem sie als<br />
Anwalt der Menschen auftritt, deren Rechte missachtet und deren Lebenschance zerstört<br />
werden. Gerade e<strong>in</strong>e Gesellschaft und e<strong>in</strong> Staat, die die Achtung der Menschenwürde zu<br />
ihrem obersten Ziel erklärt haben und die sich den Pr<strong>in</strong>zipien der Freiheit und der Demokratie<br />
verpflichte wissen, wären schlecht beraten auf diesen Dienst der Christen und ihrer<br />
Kirchen zu verzichten.