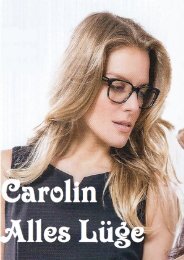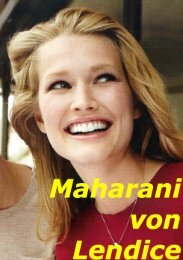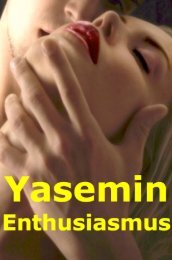Mica - Obsession
Ich habe noch nie erlebt, wie man empfindet, wenn ein für verschollen Gehaltener plötzlich wieder auftaucht, aber viel intensiver kann es auch nicht sein, wie das, was ich empfand, als ich Joscha in der Uni begegnete. Er war auch zu Hause geblieben. Nein, gut gehe es ihm nicht. Er habe sehr unter unserer Trennung zu leiden, erklärte Joscha. Wir sprachen nicht viel, wollten uns nur intensivste Liebkosungen und Zärtlichkeiten zukommen lassen, wie sie möglich sind, wenn man sich im Foyer gegenüber steht. In der anschließenden Vorlesung konnte ich mich nicht konzentrieren. Ein Euphemismus. Ich konnte die Stimme der Professorin nicht ertragen, die meine Ohren quälte. Am liebsten wäre ich nach unten gerannt, hätte ihr das Mikro abgeschaltet und sie verdroschen. Kein Wort verstand ich, hörte nur das schnarrende Geräusch der Dozierenden, das mir enorm auf die Nerven ging. Jedes Wort von jedem hätte ich jetzt als Belästigung empfunden. Es hatte keinen Sinn, ich musste da raus und fuhr nach Hause. Warf mich aufs Bett, trommelte auf die unschuldigen Kissen und schrie einfach. Meine Mutter, die reinkam, herrschte ich an: „Lass mich in Ruh.“ Das hatte sie von mir noch nie gehört. Mein Liebster muss leiden. Eine unerträgliche Vorstellung. Als ob mir jemand ätzende Flüssigkeit in offene Wunden gösse, so schmerzte es. Ich litt, schrie und weinte für Joschas Qualen. Woran ich sonst noch dachte, und was mir durch den Kopf lief, weiß ich nicht mehr genau, ein Tobsuchtsanfall meiner Seele, als ob sich alles in mir verkrampfte. Irgendwann muss ich wohl vor Erschöpfung eingeschlafen sein. Als ich am Nachmittag wach wurde, kam ich mir geläutert vor, wie erwacht aus einem Koma ähnlichen Niemandsland. Jetzt konnte ich auch wieder mit Mutter sprechen. Wir waren beide ratlos. Als ich Joscha einige Tage später wieder traf, lief es fast identisch ab. Ich versuchte mich immer in der Gewalt zu behalten, redete mir etwas ein, aber es blieb ohne Konsequenzen. „Mica, das geht doch nicht. Wir werden dich irgendwann in der Psychiatrie besuchen müssen.“ bewertete meine Mutter ängstlich mein Verhalten. Nein, zum Psychotherapeuten wollte ich trotzdem nicht. „Ich kann es nur nicht ertragen, Joscha zu treffen. Sonst ist doch alles o. k.. Wir müssen uns nur aus dem Wege gehen, dürfen uns nicht sehen.
Ich habe noch nie erlebt, wie man empfindet, wenn ein für verschollen Gehaltener plötzlich wieder auftaucht, aber viel intensiver kann es auch nicht sein, wie das, was ich empfand, als ich Joscha in der Uni begegnete. Er war auch zu Hause geblieben. Nein, gut gehe es ihm nicht. Er habe sehr unter unserer Trennung zu leiden, erklärte Joscha. Wir sprachen nicht viel, wollten uns nur intensivste Liebkosungen und Zärtlichkeiten zukommen lassen, wie sie möglich sind, wenn man sich im Foyer gegenüber steht. In der anschließenden Vorlesung konnte ich mich nicht konzentrieren. Ein Euphemismus. Ich konnte die Stimme der Professorin nicht ertragen, die meine Ohren quälte. Am liebsten wäre ich nach unten gerannt, hätte ihr das Mikro abgeschaltet und sie verdroschen. Kein Wort verstand ich, hörte nur das schnarrende Geräusch der Dozierenden, das mir enorm auf die Nerven ging. Jedes Wort von jedem hätte ich jetzt als Belästigung empfunden. Es hatte keinen Sinn, ich musste da raus und fuhr nach Hause. Warf mich aufs Bett, trommelte auf die unschuldigen Kissen und schrie einfach. Meine Mutter, die reinkam, herrschte ich an: „Lass mich in Ruh.“ Das hatte sie von mir noch nie gehört. Mein Liebster muss leiden. Eine unerträgliche Vorstellung. Als ob mir jemand ätzende Flüssigkeit in offene Wunden gösse, so schmerzte es. Ich litt, schrie und weinte für Joschas Qualen. Woran ich sonst noch dachte, und was mir durch den Kopf lief, weiß ich nicht mehr genau, ein Tobsuchtsanfall meiner Seele, als ob sich alles in mir verkrampfte. Irgendwann muss ich wohl vor Erschöpfung eingeschlafen sein. Als ich am Nachmittag wach wurde, kam ich mir geläutert vor, wie erwacht aus einem Koma ähnlichen Niemandsland. Jetzt konnte ich auch wieder mit Mutter sprechen. Wir waren beide ratlos. Als ich Joscha einige Tage später wieder traf, lief es fast identisch ab. Ich versuchte mich immer in der Gewalt zu behalten, redete mir etwas ein, aber es blieb ohne Konsequenzen. „Mica, das geht doch nicht. Wir werden dich irgendwann in der Psychiatrie besuchen müssen.“ bewertete meine Mutter ängstlich mein Verhalten. Nein, zum Psychotherapeuten wollte ich trotzdem nicht. „Ich kann es nur nicht ertragen, Joscha zu treffen. Sonst ist doch alles o. k.. Wir müssen uns nur aus dem Wege gehen, dürfen uns nicht sehen.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
annt, hätte ihr das Mikro abgeschaltet und sie verdroschen. Kein Wort verstand<br />
ich, hörte nur das schnarrende Geräusch der Dozierenden, das mir<br />
enorm auf die Nerven ging. Jedes Wort von jedem hätte ich jetzt als Belästigung<br />
empfunden. Es hatte keinen Sinn, ich musste da raus und fuhr nach Hause.<br />
Warf mich aufs Bett, trommelte auf die unschuldigen Kissen und schrie einfach.<br />
Meine Mutter, die reinkam, herrschte ich an: „Lass mich in Ruh.“ Das hatte<br />
sie von mir noch nie gehört. Mein Liebster muss leiden. Eine unerträgliche<br />
Vorstellung. Als ob mir jemand ätzende Flüssigkeit in offene Wunden gösse, so<br />
schmerzte es. Ich litt, schrie und weinte für Joschas Qualen. Woran ich sonst<br />
noch dachte, und was mir durch den Kopf lief, weiß ich nicht mehr genau, ein<br />
Tobsuchtsanfall meiner Seele, als ob sich alles in mir verkrampfte. Irgendwann<br />
muss ich wohl vor Erschöpfung eingeschlafen sein. Als ich am Nachmittag wach<br />
wurde, kam ich mir geläutert vor, wie erwacht aus einem Koma ähnlichen Niemandsland.<br />
Jetzt konnte ich auch wieder mit Mutter sprechen. Wir waren beide<br />
ratlos. Als ich Joscha einige Tage später wieder traf, lief es fast identisch ab.<br />
Ich versuchte mich immer in der Gewalt zu behalten, redete mir etwas ein,<br />
aber es blieb ohne Konsequenzen. „<strong>Mica</strong>, das geht doch nicht. Wir werden dich<br />
irgendwann in der Psychiatrie besuchen müssen.“ bewertete meine Mutter<br />
ängstlich mein Verhalten. Nein, zum Psychotherapeuten wollte ich trotzdem<br />
nicht. „Ich kann es nur nicht ertragen, Joscha zu treffen. Sonst ist doch alles o.<br />
k.. Wir müssen uns nur aus dem Wege gehen, dürfen uns nicht sehen. Er<br />
könnte ja genauso gut anderswo studieren, er kommt doch nicht von hier. Andererseits<br />
ist es aber mein Problem.“ beurteilte ich die Lage. Ich wollte zu einer<br />
anderen Uni gehen. Unendliche Probleme und Unannehmlichkeiten. Erst als<br />
ein Professor, zu dem ich ein sehr gutes Verhältnis hatte, mit seinem Kollegen<br />
an der anderen Uni gesprochen hatte, wurde es in diesem speziellen Fall ermöglicht,<br />
dass ich auch während des Semesters aus medizinischen Gründen<br />
wechseln konnte. Mein Hausarzt wollte mich auch unbedingt zum Psychotherapeuten<br />
schicken, hatte aber nach meinen Erklärungen bestimmt gedacht: „Die<br />
spinnt sowieso.“ und mir selbst ein Gutachten geschrieben. Nur so hatte ich<br />
mir mein Leben erst recht nicht gewünscht. Alles fremd und unbekannt, das<br />
würde sich im Laufe der Zeit ändern, aber nicht mehr zu Hause, sondern ganz<br />
allein in meinem kleinen Appartement leben zu müssen, war mir höchst zuwider.<br />
Mit unserer Gemeinsamkeit in Joschas kleiner Behausung hatte das natürlich<br />
nichts zu tun. Das Schlimmste aber waren die fehlenden Kontakte, die ich<br />
zu Hause hatte. Keinesfalls waren alle Leute, die zu uns kamen, meine Freundinnen<br />
und Freunde, aber sie bildeten einen Kreis von Menschen, zu denen unterschiedliche<br />
Beziehungen bestanden. Wie bedeutsam dieses soziale Beziehungsgeflecht<br />
für mich und meine Identität war, spürte ich erst jetzt, als da<br />
nichts mehr war. Zu Hause war alles selbstverständlich, und jetzt musste ich<br />
jeden kleinsten Kontakt neu entwickeln und organisieren. Ich stürzte mich in<br />
die Arbeit, was sonst. Wenn ich am Wochenende nach Hause kam, umarmten<br />
Mutter und ich uns lange, und meistens kamen uns dabei die Tränen. Mutter<br />
hatte auch etwas verloren. Natürlich war sie für mich immer die erwachsene<br />
Frau gewesen, aber sie kam mir gleichzeitig auch wie meine Schwester vor.<br />
Schon als Kind sprachen wir von uns als „Wir Frauen“. Besondere Anerkennung<br />
hatte mir auch ihre Behauptung, dass sie nicht kochen könne verschafft. Noch<br />
heute kokettiert sie damit, aber ich war solange ich mich erinnern kann, eine<br />
<strong>Mica</strong> – <strong>Obsession</strong> – Seite 24 von 37