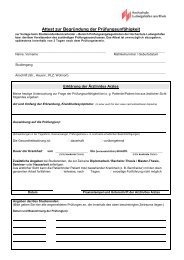Folien zur Vorbereitung auf die Klausur
Folien zur Vorbereitung auf die Klausur
Folien zur Vorbereitung auf die Klausur
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ambulanter Bereich aus<br />
rechtlicher und ökonomischer<br />
Sicht<br />
Auszug aus der Vorlesung<br />
<strong>zur</strong> <strong>Vorbereitung</strong> <strong>auf</strong> <strong>die</strong> <strong>Klausur</strong>
Ambulanter Bereich aus<br />
rechtlicher und ökonomischer<br />
Sicht<br />
I. Gesundheitswesen und Sozialversicherung<br />
- Die geschichtliche Entwicklung<br />
- Die ambulante ärztliche Versorgung
Gesundheitswesen und<br />
Sozialversicherung<br />
Behandlung des Patienten<br />
Patient Arzt<br />
Zahlung des Entgelts
Gesundheitswesen und<br />
1. Kaiserliche Botschaft (17.11.1881)<br />
Sozialversicherung<br />
„Schon im Februar <strong>die</strong>ses Jahres haben Wir Unsere Überzeugung aus-sprechen lassen,<br />
dass <strong>die</strong> Heilung der sozialen Schäden nicht aus-schließlich im Wege der Repression<br />
sozialdemokratischer Ausschreitun-gen, sondern gleichmäßig <strong>auf</strong> dem der positiven<br />
Förderung des Wohles der Arbeiter zu suchen sein werde. Wir halten es für Unsere<br />
Kaiserliche Pflicht, dem Reichstage <strong>die</strong>se Aufgabe von neuem ans Herz zu legen, und<br />
würden Wir mit um so größerer Befriedigung <strong>auf</strong> alle Erfolge, mit denen Gott Unsere<br />
Regierung sichtlich gesegnet hat, <strong>zur</strong>ückblicken, wenn es Uns gelänge, dereinst das<br />
Bewusstsein mitzunehmen, dem Vaterlande neue und dauernde Bürgschaften seines<br />
inneren Friedens und den Hilfsbedürftigen größere Sicherheit und Ergiebigkeit des<br />
Bei-standes, <strong>auf</strong> den sie Anspruch haben, zu hinterlassen. In Unseren dar<strong>auf</strong> gerichteten<br />
Bestrebungen sind Wir der Zustimmung aller verbündeten Regierungen gewiss und<br />
vertrauen <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Unterstützung des Reichstags ohne Unterschied der Parteistellungen.
Gesundheitswesen und<br />
Sozialversicherung<br />
In <strong>die</strong>sem Sinne wird zunächst der von den verbündeten Regierungen in der vorigen Session<br />
vorgelegte Entwurf eines Gesetzes über <strong>die</strong> Ver-sicherung der Arbeiter gegen Betriebsunfälle<br />
mit Rücksicht <strong>auf</strong> <strong>die</strong> im Reichstag stattgehabten Verhandlungen über denselben einer<br />
Umar-beitung unterzogen, um <strong>die</strong> erneute Beratung desselben vorzubereiten. Ergänzend wird<br />
ihm eine Vorlage <strong>zur</strong> Seite treten, welche sich eine gleichmäßige Organisation des<br />
gewerblichen Krankenkassenwesens <strong>zur</strong> Aufgabe stellt. Aber auch <strong>die</strong>jenigen, welche durch<br />
Alter oder Invalidität erwerbsunfähig werden, haben der Gesammtheit gegenüber einen<br />
be-gründeten Anspruch <strong>auf</strong> ein höheres Maß staatlicher Fürsorge, als ihnen bisher hat zu<br />
Theil werden können. Für <strong>die</strong>se Fürsorge <strong>die</strong> rechten Mittel und Wege zu finden, ist eine<br />
schwierige, aber auch eine der höchsten Aufgaben jedes Gemeinwesens, welches <strong>auf</strong> den<br />
sittlichen Fundamen-ten des christlichen Volkslebens steht. Der engere Anschluss an <strong>die</strong><br />
re-alen Kräfte <strong>die</strong>ses Volkslebens und das Zusammenfassen der letzteren in der Form<br />
kooperativer Genossenschaften unter staatlichem Schutz und staatlicher Förderung werden,<br />
wie Wir hoffen, <strong>die</strong> Lösung auch von Aufgaben möglich machen, denen <strong>die</strong> Staatsgewalt<br />
allein in gleichem Umfange nicht gewachsen sein würde. Immerhin aber wird auch <strong>auf</strong> <strong>die</strong>sem<br />
Wege das Ziel nicht ohne <strong>die</strong> Aufwendung erheblicher Mittel zu erreichen sein.“
Behandlung<br />
Arzt<br />
Gesundheitswesen und<br />
Sozialversicherung<br />
Versicherter<br />
Übernahme der<br />
Behandlungskosten<br />
Beitrag<br />
Kasse
Gesundheitswesen und<br />
Berliner Abkommen (23.12.1913)<br />
Sozialversicherung<br />
a) Einführung einer einheitlichen Zulassungsquote von 1.350 Versicherte (1.000 Versicherte bei<br />
Familienbehandlung)<br />
b) Eintragung der Ärzte bei den Versicherungsämtern in dort ausliegende Listen<br />
c) Einführung eines paritätisch besetzten Vertragsausschusses<br />
d) Festschreibung der Pauschalvergütung
Gesundheitswesen und<br />
Sozialversicherung<br />
Brüningsche Notverordnung (08.12.1931)<br />
a) Senkung der Verhältniszahl <strong>auf</strong> 1 zu 600<br />
b) Reichseinheitliche Einführung des Kopfpauschalsystems als einzige Vergütungsform<br />
c) Einführung einer Gesamtvergütung<br />
d) Konstituierung der KV als gesetzlicher Vertragspartner der Kranken-kassen<br />
e) Zulassung des Arztes für alle Kassen.
Behandlungsausweis<br />
Versicherter<br />
Arzt<br />
Gesundheitswesen und<br />
Sozialversicherung<br />
Ärztliche<br />
Behandlung<br />
Beiträge<br />
Übernahme<br />
Behandlungskosten<br />
Abrechnung<br />
Honorar<br />
Gesamtvergütung<br />
Krankenkasse<br />
KV<br />
Rechnung
Gesundheitswesen und<br />
Sozialversicherung<br />
Gesetz <strong>zur</strong> Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung<br />
GKV-Modernisierungsgesetz – GMG ab 01. Januar 2004<br />
Zentrale Elemente des Gesetzes<br />
Senkung der Beitragssätze durch Begrenzung der Ausgaben<br />
Ausbau der wettbewerbsrechtlichen Ausrichtung im System der gesetzlichen Krankenversicherung<br />
(GKV)<br />
Vermeidung tiefgreifender Reformmaßnahmen, welche <strong>zur</strong> langfristigen Stabilisierung der<br />
Finanzierungsgrundlagen des GKV-Systems erforderlich sind.
GMG<br />
Gesundheitswesen und<br />
Sozialversicherung<br />
Angestrebte Entlastungen in der GKV im Jahr 2004<br />
Leistungsausgrenzungen 2,5 Milliarden Euro<br />
Zuzahlungsanhebungen 3,2 Milliarden Euro<br />
Andere Entlastungseffekte 4,1 Milliarden Euro<br />
Gesamt 9,8 Milliarden Euro
GMG<br />
Gesundheitswesen und<br />
Leistungsausgrenzungen / -einschränkungen<br />
Sozialversicherung<br />
Leistungsanspruch <strong>auf</strong> nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel (OTC-Präparate)<br />
Versorgung mit Arzneimitteln, <strong>die</strong> der Verbesserung der privaten Lebensführung <strong>die</strong>nen,<br />
insbesondere <strong>zur</strong> Behandlung…<br />
- der erektilen Dysfunktion<br />
- der Anreizung und Steigerung der sexuellen Potenz<br />
- <strong>zur</strong> Raucherentwöhnung<br />
- <strong>zur</strong> Abmagerung oder <strong>zur</strong> Zügelung des Appetits<br />
- <strong>zur</strong> Regelung des Körpergewichts<br />
- <strong>zur</strong> Verbesserung des Haarwuchses
GMG<br />
Arzneimittel<br />
Verbandmittel<br />
Gesundheitswesen und<br />
Sozialversicherung<br />
Übersicht der Zuzahlungen ab 01.01.2004<br />
Heilmittel (beispielsweise Kranken-gymnastik,<br />
Massagen)<br />
Hilfsmittel<br />
Häusliche Krankenpflege<br />
Stationäre Vorsorgemaßnahmen<br />
10 % des Abgabepreises, nicht we-niger als 5, nicht mehr<br />
als 10 Euro<br />
10 % des Abgabepreises, nicht we-niger als 5, nicht mehr<br />
als 10 Euro<br />
10 % des Abgabepreises, nicht we-niger als 5, nicht mehr<br />
als 10 Euro, zusätzlich 10 Euro für <strong>die</strong> gesamte Verordnung<br />
10 Euro je Indikation und Monatsbedarf, unabhängig von<br />
der Verpackungsart, zuzüglich Festbetragsregelung<br />
10 % des Abgabepreises, nicht we-niger als 5, nicht mehr<br />
als 10 Euro, zusätzlich 10 Euro für <strong>die</strong> gesamte<br />
Verordnung, maximal 28 Tage je Jahr<br />
10 Euro je Tag
GMG<br />
Gesundheitswesen und<br />
Stationäre Vorsorgemaßnahmen für Mutter und Kind<br />
Soziotherapie<br />
Haushaltshilfe<br />
Stationäre Rehabilitation<br />
Rehabilitation für Mutter und Vater<br />
Ambulante Behandlung<br />
Stationäre Behandlung<br />
Sozialversicherung<br />
Übersicht der Zuzahlungen ab 01.01.2004<br />
10 Euro je Tag<br />
10 % der Kosten je Tag, nicht we-niger als 5, nicht mehr als<br />
10 Euro<br />
10 % der Kosten je Tag, nicht we-niger als 5, nicht mehr als<br />
10 Euro<br />
10 Euro je Tag, maximal 28 Tage je Jahr bei<br />
Anschlussheilbehandlung<br />
10 Euro je Tag<br />
10 Euro im Quartal<br />
10 Euro je Tag maximal 28 Tage je Jahr
GMG<br />
Gesundheitswesen und<br />
Bonus für Versicherte § 65a SGB V<br />
Sozialversicherung<br />
- <strong>die</strong> regelmäßig Leistungen <strong>zur</strong> Früherkennung von Krankheiten oder qualitätsgesicherte<br />
Leistungen der Krankenkassen <strong>zur</strong> primä-ren Prävention in Anspruch nehmen<br />
- <strong>die</strong> sich in <strong>die</strong> hausarztzentrierte Versorgung nach § 73b SGB V einschreiben<br />
- <strong>die</strong> an einem strukturieren Behandlungsprogramm nach § 137f SGB V teilnehmen (DMP)<br />
- <strong>die</strong> an einer betrieblichen Gesundheitsförderung durch den Arbeitgeber teilnehmen.
1881<br />
1882<br />
1900<br />
Gesundheitswesen und<br />
Entwicklung des Vertragsrechts<br />
Sozialversicherung<br />
„Kaiserliche Botschaft“ gibt dem Reichstag den Auftrag, eine GKV für <strong>die</strong> Arbeiter zu<br />
schaffen<br />
Reichstag beschließt das „Gesetz betreffend <strong>die</strong> Kran-kenversicherung der Arbeiter“; Krankenkas-sen<br />
diktieren den Ärzten Bedingungen, im Sys-tem tätig zu werden; Kassen suchen sich ihnen genehme Ärzte<br />
aus („Eink<strong>auf</strong>smodell“); <strong>die</strong> Ver-sicherung ist von Anbeginn „lohngekoppelt“:<br />
Im Aktenstück Nr. 330 vom 27.05.1883 „Kranken-versicherung der Arbeiter“ liest man unter § 9: „Die von der<br />
Gemeinde zu erhebenden Beiträge sollen … ein und ein halbes Prozent des ortsüblichen Tageslohnes nicht<br />
übersteigen“. Da-mit wurde den Ärzten ein Grundkonflikt einge-baut, der sie bis <strong>auf</strong> den heutigen Tag nicht<br />
los-lassen kann: Die Morbidität ihrer Patienten ent-wickelt sich völlig losgelöst von „Tagelohn“ oder zeitgemäß<br />
„Grundlohnsumme“.<br />
Gründung des Hartmannbundes als Kampfverband für Kollektivvertrag (alle Ärzte mit Kran-kenkassen) statt<br />
Einzelvertrag (Kasse mit Arzt), freie Arztwahl für Ver-sicherte; der Hartmannbund wird zu Recht als Keimzelle<br />
der späteren Kas-senärztlichen Vereinigung angesehen<br />
1900 bis<br />
1913 Heftige Auseinandersetzungen zwischen Ärzten, Krankenkassen und Politik<br />
1911 Reichsversicherungsordnung; durch Mindestmitglieder-zahl und Abschaffung<br />
der Gemeindekrankenver-sicherung starke Verein-heitlichung<br />
1914 Berliner Abkommen; Mitbestimmung der Ärzte bei Zu-lassung (paritätischer<br />
Registerausschuss und Vertrags-ausschuss)<br />
1923<br />
Notverordnung; notdürftige Verlängerung des Berliner Abkommens durch den Gesetzgeber
Gesundheitswesen und<br />
Entwicklung des Vertragsrechts<br />
Sozialversicherung<br />
1931 Gründung der Kassenärztlichen Vereinigung; Gesamt-vertrag zwischen ihr und<br />
den Kranken-kassen<br />
1932 Kassenärztliche Vereinigung Deutschlands (KVD) als Körperschaft öffentlichen<br />
Rechts<br />
1945 Auflösung der KVD; Wider<strong>auf</strong>bau der KVen wie seit 1931 in den westlichen<br />
Zonen<br />
1955 Kassenarztrecht als Bestandteil der RVO (Reichs-versicherungsordnung);<br />
Wiedereinfüh-rung der KV als Selbstverwaltungskörperschaft mit<br />
Sicherstellungs<strong>auf</strong>-trag; eigenem Vertragssys-tem (und Schiedsamt als<br />
Konfliktlösung)<br />
1960 Allgemeine Niederlassungsfreiheit (vorher galten Ver-hältniszahlen, „x<br />
Versicherte pro Kassenarzt“, mit glei-cher Wirkung wie heute <strong>die</strong><br />
Zulassungs-sperre); damit wurde das Bewusstsein des Kas-senarzte als<br />
Vertreter eines freien Berufes legi-timiert, mussten Einschrän-kungen der GKV –<br />
für eine Solidargemeinschaft ein selbstverständ-licher Ingre<strong>die</strong>nz – für den<br />
Kassenarzt in Zeiten des Mangels als nur schwer hinnehmbar erscheinen
Gesundheitswesen und<br />
Entwicklung des Vertragsrechts<br />
Sozialversicherung<br />
1970 Fortschreitende Leistungserweiterung in der GKV, ins-besondere im Bereich<br />
der Prävention; damit wurde das Inanspruchnahmeverhalten des<br />
Versicherten nachhaltig verändert; musste man früher krank sein, ehe man<br />
den Arzt <strong>auf</strong>suchte, bedurfte es jetzt nicht mehr <strong>die</strong>ses unglückbe-hafteten<br />
Anlasses; jeder Gesundheitsbe-wusste sollte einen Checkup vornehmen<br />
1977 Erstes Kostendämpfungsgesetz (einnahmeorien-tierte Ausgabenpolitik)<br />
1982 Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz (Nega-tiv- und<br />
Preisvergleichslisten für Arznei-mittel; Groß-gerätebedarfsplanung)<br />
1983 Haushaltsbegleitgesetz (Selbstbeteiligung bei Arznei-mitteln, Krankenhaus<br />
und Kuren<br />
1989 Gesundheits-Reformgesetz (GRG); Beitragssatzstabili-tät ist oberstes Gebot<br />
1990 Ausweitung des Geltungsbereiches des Sozialgesetz-buches <strong>auf</strong> <strong>die</strong> neuen<br />
Bundesländer
Gesundheitswesen und<br />
Entwicklung des Vertragsrechts<br />
Sozialversicherung<br />
1992 Sternmärsche der Vertragsärzte; große Protest-aktionen in vielen Bundesländern<br />
1993 Gesundheitsstrukturgesetz (GSG); Ende der Tarifauto-nomie; Ärzte haften für<br />
Arzneibudget; Zulassungs-sperren; der Vertragsarzt – als freier Beruf – muss<br />
seine Zulassung mit dem 68. Le-bensjahr <strong>zur</strong>ückgeben<br />
1997 Dritte Stufe der Gesundheitsreform; Lockerung für <strong>die</strong> Tarifautonomie durch<br />
Vereinbarung der Regelleistungs-volumina; Aufhebung der Groß-geräteplanung;<br />
Zuzah-lungsregelungen; Kosten-erstattung statt Sachleistung ist möglich<br />
1998 Der Budgetierung der Gesamtvergütung folgt im Innenverhältnis <strong>die</strong> Einführung<br />
der Praxisbudgets<br />
1999 „GKV-Solidaritätsstärkungsgesetz – GKV-SoIG“ (Vorschaltgesetz); Reduzierung der<br />
Zuzahlun-gen; Fest-legung des Arzneibudgets <strong>auf</strong> dem Niveau von 1992 und Kollektivhaftung<br />
der Ärzte; Aufhebung der Regel-leistungsvolumina zuguns-ten strikter Budgetierung der<br />
Gesamtvergütung <strong>auf</strong> der Basis von 1997, Aufhebung der Möglich-keit der Kostenerstattung für<br />
alle Versicherten<br />
2000 „Gesundheitsreform 2000“; Budgetierung festgeschrieben; Aufhebung des<br />
Sicherstellungsmono-pols durch KV zugunsten der Krankenkassen; Trennung von haus- und<br />
fachärztlicher Vergü-tung; Erweiterung der Prüfungen und der Doku-mentationspflichten des<br />
Arztes<br />
2002 Gesetz <strong>zur</strong> Reform des Risikostrukturausgleichs (RSA) (bis 2007 soll er einen<br />
ausgeprägteren Morbiditätsbezug bekommen)
Gesundheitswesen und<br />
Entwicklung des Vertragsrechts<br />
Sozialversicherung<br />
2002 Fallpauschalgesetz – im Krankenhausbereich wird für <strong>die</strong> Vergütung ein<br />
stärkerer Morbiditäts-bezug herge-stellt<br />
2002 ABAG (Arzneimittelbudgetablösungsgesetz) und AABAG<br />
(Arzneimittelausgabenbegrenzungs-gesetz) – mit beiden Gesetzen wird <strong>die</strong><br />
automa-tische Haftung der Vertragsärzte für <strong>die</strong> Über-schreitung eines<br />
Arznei-mittelbudgets durch ver-tragliche Regelungen abgelöst<br />
2003 Gesetz <strong>zur</strong> Einführung des Wohnortprinzips – <strong>die</strong> KV schließt Verträge und<br />
bekommt eine direkte Vergütung von den Krankenkassen für <strong>die</strong> Ver-sicherten,<br />
<strong>die</strong> im Bereich der KV wohnen, gleich-gültig wo <strong>die</strong> Kranken-kasse ihren Sitz<br />
hat<br />
2003 Beitragssatzsicherungsgesetz – Erhöhung der Beitrags-bemessungsgrenze; für<br />
Vertragsärzte Nullrunde; Apo-theken und Pharmaindustrie ge-währen<br />
Krankenkassen erhöhte Rabatte<br />
2004 GKV-Modernisierungsgesetz; zahlreiche Zuzahlungs-tatbestände werden<br />
wieder eingeführt, dazu eine Reihe neuer Vertragsfiguren (auch jenseits der<br />
KV), <strong>die</strong> medi-zinischen Versorgungszentren; Reorganisation der KVen und<br />
Gesetze des Miss-trauens; Fortbildungspflicht und Regelleistungs-volumen;<br />
erneut Öffnung für Kostenerstattung
2007<br />
(01.01.)<br />
2007<br />
(01.04.)<br />
Gesundheitswesen und<br />
Entwicklung des Vertragsrechts<br />
Sozialversicherung<br />
Vertragsarztrechtsänderungsgesetz<br />
Flexibilisierung der Niederlassung, Anstellung von Ärzten und Zusammenarbeit<br />
von Ärzten, auch mit nicht-ärztlichen Heilberufen<br />
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz –GKV-WSG-<br />
Versicherungspflicht für Alle, Neuordnung der Wirt-schaftlichkeitsprüfung,<br />
Umstellung der ärztlichen Hono-rierung, neue Gebührenordnung für Ärzte<br />
2009 (01.01.) Gesetz <strong>zur</strong> Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen in der Gesetzlichen<br />
Krankenversicherung, GKV-OrgWG
Ambulanter Bereich aus<br />
rechtlicher und ökonomischer<br />
Sicht<br />
II. Gesetzliche Grundlagen und<br />
systematische Einordnung
Gesetzliche Grundlagen und<br />
systematische Einordnung
Gesetzliche Grundlagen und<br />
systematische Einordnung
Ambulanter Bereich aus<br />
rechtlicher und ökonomischer<br />
Sicht<br />
III. GKV-WSG und VÄndG
• Ziele des Gesetzes<br />
• Ein Versicherungsschutz für alle Einwohner ohne Absicherung im Krankheitsfall in der gesetzlichen oder privaten Krankenver-sicherung,<br />
• Der Zugang der Versicherten zu allen medizinisch notwen-digen Leistungen unter Einbeziehung des medizinischen Fortschritts, unabhängig von der<br />
Höhe der jeweils einge-zahlten Beträge,<br />
• Weichenstellung für <strong>die</strong> Beteiligung aller an der Finanzierung des Gesundheitssystems nach ihrer Leistungsfähigkeit durch Fort-führung und Ausbau<br />
eines steuerfinanzierten Anteils,<br />
• Qualitäts- und Effizienzsteigerung durch Intensivierung des Wettbewerbs <strong>auf</strong> Kassenseite insbesondere durch mehr Vertragsfreiheit der Kassen mit<br />
Leistungserbringern, Reformen der Organisation wie z. B. <strong>die</strong> Ermöglichung kassenartenüber-greifender Fusionen sowie den neuen<br />
Gestaltungsmög-lichkeiten im Rahmen der Einführung des Gesundheitsfonds,<br />
• Qualitäts- und Effizienzsteigerung durch Intensivierung des Wettbewerbs <strong>auf</strong> Seiten der Leistungserbringer z. B. durch mehr Vertragsfreiheit in der<br />
ambulanten Versorgung, durch verstärkten Wettbewerb in der Arzneimittelversorgung sowie durch mehr Vertrags- und Preiswettbewerb in der Heil- und<br />
Hilfsmittel-versorgung,<br />
• Bürokratieabbau und mehr Transparenz <strong>auf</strong> allen Ebenen,<br />
• Einstieg in <strong>die</strong> Sicherung der Nachhaltigkeit der Finanzierung der GKV bei Lockerung der Abhängigkeit vom Faktor Arbeit,<br />
• Verbesserung der Wahlrechte und Wechselmöglichkeiten in der privaten Krankenversicherung durch anrechnungsfähige Ausgestaltung der<br />
Alterungsrückstellungen sowie Einführung eines Basistarifs in der PKV, der allen PKV-Versicherten, der PKV systematisch zuzuordnenden Personen<br />
und allen frei-willig Versicherten in der GKV offen steht.
Wirtschaftlichkeitsprüfung in der vertragsärztlichen Versorgung § 106<br />
SGB V<br />
• Wegfall der Prüfungsausschüsse<br />
• Ab 01.01.2008 Prüfungsstelle als selbständige Einrichtung der KV und<br />
Kassenverbänden führt <strong>die</strong> Prüfung durch und erlässt <strong>die</strong> Bescheide<br />
• Beschwerdeausschüsse fungieren als einzige außergericht-liche<br />
Instanz und werden von der Prüfungsstelle organisatorisch unterstützt<br />
• Errichtung, Sitz und Leiter der Prüfstelle werden von den<br />
Vertragspartnern bestimmt. Die Ver-tragspartner einigen sich <strong>auf</strong><br />
Vorschlag des Leiters jährlich bis zum 30.11. über <strong>die</strong> personelle,<br />
sachliche und finanzielle Aus-stattung der Prüfungsstelle für das<br />
folgende Kalenderjahr.
Gliederung: VÄndG<br />
Teilzulassungen – hälftiger Versorgungs<strong>auf</strong>trag –<br />
Anstellungsmöglichkeiten nach dem VÄndG<br />
– am Krankenhaus<br />
– in niedergelassener Praxis<br />
Tätigkeit an weiteren Orten<br />
– Zweigpraxis<br />
– überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft<br />
Das Medizinische Versorgungszentrum<br />
Genehmigungspflichten<br />
Persönliche Leistungserbringung<br />
Drittwiderspruch in der vertragsärztlichen<br />
Versorgung
isherige Rechtslage:<br />
vollzeitige Zulassung<br />
neue Rechtslage<br />
Teilzulassung:<br />
Beschränkung des Versorgungs<strong>auf</strong>trages <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Hälfte<br />
(von Anfang an oder später)<br />
Gilt auch für Sonderbedarfszulassungen gemäß § 24<br />
BedarfsplRL-Ärzte
Anstellung des Vertragsarztes<br />
am Krankenhaus:<br />
bisherige Rechtslage:<br />
§ 20 Abs. 2 Ärzte ZV a. F. Tätigkeit am Krankenhaus<br />
war mit der vertragsärztlichen Tätigkeit unvereinbar.<br />
neue Rechtslage:<br />
§ 20 Abs. 2 Ärzte-ZV n. F. Tätigkeit am Krankenhaus<br />
nunmehr ausdrücklich mit vertragsärztlicher Tätigkeit<br />
vereinbar.
Anstellung des Vertragsarztes<br />
am Krankenhaus<br />
Vertragsarzt mit Vollzulassung darf nicht mehr als<br />
13 h wöchentlich am KH angestellt sein (BSG Urt.<br />
30.01.2002, Aktz. B 6 KA 20/01R)<br />
Nebentätigkeit bedarf der Genehmigung durch<br />
Vorstand der KV<br />
Regelungen über Nebentätigkeit haben weiterhin<br />
bestand.
Anstellung in niedergelassener Praxis:<br />
Alte Rechtslage:<br />
Fachgebietsidentität und Leistungsbeschränkung<br />
Neue Rechtslage:<br />
Fachgebietsübergreifend, Leistungsbeschränkung nur in<br />
gesperrten Planungsbereichen<br />
(Achtung mögliches steuerrechtliches Problem)
Anstellung in niedergelassener Praxis:<br />
Übertragung des Vertragsarztsitzes<br />
Praxis Dr. A Praxis Dr. B<br />
Anstellung<br />
Bedarfsplanungsbereiche beachten!!!<br />
Bei Beendigung der Tätigkeit von Dr. B<br />
Nachbesetzungsverfahren nach § 103 Abs. 4b SGB V
Anstellung in niedergelassener Praxis:<br />
Sitzk<strong>auf</strong> durch Vertragsarztpraxis<br />
Anstellung von Ärzten <strong>auf</strong> den erworbenen Sitz<br />
Nachbesetzung bei Beendigung der Anstellung<br />
Sitzk<strong>auf</strong> und Anstellung auch bei Zweigpraxis<br />
durch Vertragsarzt möglich<br />
Derzeit 726 Anstellungen in Arztpraxen in RLP
Anstellung in niedergelassener Praxis:<br />
§ 14 a BMV-Ä<br />
„Die persönliche Leitung ist anzunehmen, wenn je<br />
Vertragsarzt nicht mehr als drei vollzeitbeschäftigte<br />
oder teilzeitbeschäftigte Ärzte in einer Anzahl, welche<br />
im zeitlichen Umfang ihrer Arbeitskraft drei vollzeitbeschäftigten<br />
Ärzten entspricht, angestellt werden“.
Alte Rechtslage:<br />
Überörtliche BAG:<br />
Nur bei nicht patientenorientierten Fachgebieten (z.B.<br />
Labor)<br />
Neue Rechtslage:<br />
Grundsätzlich unter allen Fachgebieten möglich.<br />
Zugehörigkeit auch zu mehreren BAG`s möglich.
Voraussetzungen:<br />
Überörtliche BAG:<br />
Erfüllung der Versorgungspflicht am Vertragsarztsitz<br />
Tätigkeit am „überörtlichen“ Standort nur in zeitlich<br />
begrenztem Umfang:<br />
Für Partner und für angestellte Ärzte ohne<br />
gesonderte Genehmigung<br />
Die Tätigkeit am Vertragsarztsitz muss überwiegen
Überörtliche BAG:<br />
Zulässigkeit:<br />
Innerhalb eines KV-Bereichs<br />
Zuständigkeit: ZA des KV-Bereichs<br />
KV-übergreifend<br />
Zuständigkeit in Abhängigkeit von der<br />
Wahlentscheidung der BAG (Hauptsitz)
Teil-BAG:<br />
Berufsausübungsgemeinschaft beschränkt <strong>auf</strong><br />
einzelne ärztliche Leistungen<br />
Unzulässig bei überweisungsgebundenen<br />
medizinisch-technischen Leistungen mit<br />
überweisungsberechtigten Ärzten, § 33 Abs. 2<br />
Satz 3 Ärzte-ZV<br />
Unzulässig bei Verstoß gegen § 31 MBO<br />
(Verbot der Zuweisung gegen Entgelt)
Ambulanter Bereich aus<br />
rechtlicher und ökonomischer<br />
Sicht<br />
IV. Teilnahme an der<br />
vertragsärztlichen Versorgung
IV. Teilnahme an der<br />
vertragsärztlichen Versorgung<br />
Voraussetzung für eine Eintragung in das<br />
Arztregister sind (§ 95 a SGB V, § 3 Ärzte-ZV)<br />
• <strong>die</strong> Approbation als Arzt,<br />
• der erfolgreiche Abschluss entweder einer allgemeinmedizini-schen<br />
Weiterbildung oder einer Weiterbildung in einem anderen Fachgebiet mit<br />
der Befugnis zum Führen der entsprechenden Gebietsbezeichnung oder<br />
der Nachweis einer Qualifikation, <strong>die</strong> entsprechend anerkannt ist.<br />
• (bei Zahnärzten <strong>die</strong> Ableistung einer 2-jährigen <strong>Vorbereitung</strong>s-zeit).
IV. Teilnahme an der<br />
vertragsärztlichen Versorgung<br />
Voraussetzungen für <strong>die</strong> Zulassung:<br />
• Eintragung ins Arztregister<br />
• kein Vorliegen von Hinderungsgründen<br />
• eine Zulassungssperre für den Vertragsarzt bzw. das Fachgebiet. In <strong>die</strong>sem Fall ist eine<br />
Zulassung nur möglich, wenn eine bereits bestehende Praxis gem. § 103, Abs. 4 SGB V endet<br />
und wieder fortgesetzt wird oder wenn nach den Bedarfsplanungsrichtlinien ein Sonderbedarf<br />
durch den Zulassungsausschuss festgestellt wird.<br />
• Altersgrenze von 55. Lebensjahr für Zulassung ab 01.01.2007 <strong>auf</strong>gehoben.<br />
• Vorliegen eines Beschäftigungsverhältnisses oder einer anderen Tätigkeit, wegen der der Arzt /<br />
Psychotherapeut nicht in einem ausreichenden Umfang für <strong>die</strong> Versorgung <strong>zur</strong> Verfügung steht.<br />
(Die Abgrenzung ist hier nicht eindeutig. Die Rechtsprechung hat sich in den vergangenen Jahren<br />
hier zu einer mehr großzügigen Sichtweise bewegt, <strong>die</strong> es auch noch zulässt, dass festangestellte<br />
Chefärzte von Krankenhausabteilungen unter bestimmten Voraussetzungen eine Zulassung als<br />
Vertragsarzt erhalten können.)<br />
• Ausübung einer anderen Tätigkeit, <strong>die</strong> ihrem Wesen nach nicht mit der Tätigkeit eines<br />
Vertragsarztes am Vertragsarztsitz vereinbar ist (z. B. als Amtsarzt, Beratungsarzt für<br />
Krankenkassen u. a. – nicht betroffen sind nichtärztliche Tätigkeiten z. B. als Zahnarzt oder<br />
Apotheker).<br />
• Schwerwiegende Mängel in der Person, geistiger oder sonstiger Art, insbesondere<br />
Rauschgiftsucht oder Trunkenheit in den letz-ten 5 Jahren vor dem Zulassungsantrag.
IV. Teilnahme an der<br />
vertragsärztlichen Versorgung<br />
• Neue Möglichkeiten durch das<br />
Vertragsarztänderungsgesetz (VändG) ab<br />
01.01.2007<br />
1. Teilzulassung von Ärzten<br />
2. Anstellung von Ärzten aller Fachgebiete<br />
3. Übernahme von Vertragsarztsitzen durch Praxis (analog<br />
MVZ) im gesperrten Gebiet<br />
4. Tätigkeit an weiteren Orten <strong>zur</strong> „Versorgungsverbesserung“<br />
5. Regelungen gegen Unterversorgung<br />
6. Berufsausübungsgemeinschaft für einzelne Leistungen<br />
(Teilgemeinschaftspraxis)<br />
7. Berufsausübungsgemeinschaft zulässig mit allen<br />
Leistungserbringern<br />
8. Überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft
IV. Teilnahme an der<br />
vertragsärztlichen Versorgung<br />
Für <strong>die</strong> Besetzung eines durch Zulassungsende frei werdenden Arztsitzes sind <strong>die</strong> nach einer<br />
Ausschreibung eingehenden Anträge in einer Liste <strong>auf</strong>zunehmen (§ 103 Abs. 4 SGB V). Aus<br />
<strong>die</strong>ser Liste hat dann der Zulassungsausschuss den Nachfolger nach pflichtgemäßem Ermessen<br />
auszuwählen. Dabei sind bei der Auswahl mehrere Kriterien ausschlaggebend:<br />
• berufliche Eignung,<br />
• Approbationsalter,<br />
• Dauer der ärztlichen Tätigkeit,<br />
• familiäre Bindung an den bisherigen Praxisinhaber,<br />
• <strong>die</strong> Tätigkeit als angestellter Arzt in der Praxis oder bisherigen Partner in der gemeinschaftlichen<br />
Praxisausübung.
IV. Teilnahme an der<br />
vertragsärztlichen Versorgung<br />
Zulassung bei Sonderbedarf<br />
Eine Zulassung ist möglich, wenn<br />
• a) ein nachweislicher lokaler Versorgungsbedarf in Teilen eines Landkreises besteht<br />
• b) ein besonderer Versorgungsbedarf in einem Behandlungsbereich besteht, wie er durch<br />
den Inhalt des Schwerpunkts, einer fakultativen Weiterbildung oder einer Fachkunde nach der<br />
Weiterbildungsordnung umschrieben ist<br />
• c) im Rahmen einer speziellen ärztlichen Tätigkeit <strong>die</strong> Bildung einer ärztlichen<br />
Gemeinschaftspraxis mit spezialistischen Versorgungs<strong>auf</strong>gaben ermöglicht wird (z. B.<br />
kardiologische oder onkologische Schwerpunktpraxis)<br />
• d) ambulante Operationen im Rahmen des Fachgebietes, für <strong>die</strong> auch <strong>die</strong> Sperrung erfolgt<br />
ist, nicht in ausreichendem Maße angeboten werden und der sich um <strong>die</strong> Zulassung bewerbende<br />
Vertragsarzt schwerpunktmäßig ambulante Operationen anbietet<br />
• e) der Vertragsarzt im Rahmen seiner Zulassung ausschließlich psychotherapeutisch tätig<br />
wird (galt bis 31.12.1998 – abgelöst durch <strong>die</strong> Neufassung der Regelung im Zusammenhang mit<br />
dem Psychotherapeutengesetz).
IV. Teilnahme an der<br />
vertragsärztlichen Versorgung<br />
Beendigung einer Zulassung / Ermächtigung<br />
Gründe für <strong>die</strong> Beendigung einer Zulassung / Ermächtigung sind<br />
• Tod<br />
• Verzicht<br />
• Wegzug<br />
• Erreichen der Altersgrenze<br />
• Abl<strong>auf</strong> der Befristung (Ermächtigung)<br />
• Entziehung
Ambulanter Bereich aus<br />
rechtlicher und ökonomischer<br />
Sicht<br />
V. Bedarfsplanung in der<br />
vertragsärztlichen Versorgung
Die Bedarfsplanungsrichtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und<br />
Krankenkassen<br />
• Festlegung der Planungsbereiche,<br />
• Feststellung des allgemeinen Versorgungsgrades,<br />
• Verfahren <strong>zur</strong> Feststellung einer Überversorgung,<br />
• Maßstäbe für <strong>die</strong> qualitätsbezogenen Sonderbedarfsfeststellungen,<br />
• Maßstäbe, Grundlagen und Verfahren <strong>zur</strong> Beurteilung einer drohenden<br />
oder bestehenden Unterversorgung,<br />
• Maßstäbe für eine ausgewogene hausärztliche und fachärztliche<br />
Versorgung.
Regionstypen<br />
• Regionstyp I = Agglomerationsräume<br />
• Regionstyp II = verstädterte Räume<br />
• Regionstyp III = ländliche Räume<br />
• Regionstyp IV = Sonderregionen im<br />
Ruhrgebiet
Regionstyp 1
Regionstyp 2
Regionstyp 3
Fachgebiete in der<br />
Bedarfsplanung<br />
• Anästhesisten<br />
• Augenärzte<br />
• Chirurgen<br />
• Frauenärzte<br />
• HNO-Ärzte<br />
• Hautärzte<br />
• An der fachärztlichen Versorgung teilnehmenden Internisten<br />
• Kinderärzte<br />
• Nervenärzte<br />
• Orthopäden<br />
• Psychotherapeuten<br />
• Fachärzte für diagnostische Radiologie (Ärzte für Radiologie, Ärzte für<br />
Strahlentherapie)<br />
• Urologen<br />
• Hausärzte (Allgemeinmediziner, hausärztlich tätige Internisten)
Anrechnung von angestellten<br />
Ärzten<br />
Arbeitszeit Anrechnungsfaktor<br />
• Bis 10 Stunden pro Woche 0,25<br />
• Über 10 bis 20 Stunden pro Woche 0,5<br />
• Über 20 bis 30 Stunden pro Woche 0,75<br />
• Über 30 Stunden pro Woche 1,0
Das Verfahren <strong>zur</strong> Feststellung<br />
einer Überversorgung<br />
• Beträgt der Unterschied exakt 10 % (d. h. <strong>die</strong> allgemeine Verhält-niszahl ist um 10 % größer als <strong>die</strong> Verhältniszahl<br />
für den Versor-gungsbereich = Versorgungsgrad = 10 %), ist grundsätzlich von einer Überversorgung<br />
auszugehen.<br />
• Bei 110 % ist eine Überversorgung durch den Landesausschuss festzustellen.<br />
• Der Landesausschuss hat in regelmäßigen Abständen <strong>die</strong> Versor-gungssituation in den Planungsbereichen zu<br />
prüfen. Soweit Über-versorgung vorliegt, hat der Landesausschuss mit verbindlicher Wirkung für <strong>die</strong><br />
Zulassungsausschüsse Zulassungsbeschrän-kungen anzuordnen.<br />
• Bei bestehender Zulassungsbeschränkung für einen Planungs-bereich und eine Arztgruppe ist eine Neuzulassung<br />
eines Arztes in <strong>die</strong>sem Rahmen ausgeschlossen. Möglich ist jedoch <strong>die</strong> Weiter-führung einer Praxis, deren<br />
Inhaber durch Erreichen der Alters-grenze, Tod, Verzicht oder Entziehung der Zulassung aus der<br />
vertragsärztlichen Versorgung ausscheidet. Im Rahmen eines förmlichen Ausschreibungsverfahrens <strong>auf</strong> Antrag<br />
des ausschei-denden Arztes oder seiner Erben für den frei werdenden Vertrags-arztsitz wird ein Nachfolger für <strong>die</strong><br />
Praxis bestimmt.<br />
• Im Falle des Wegfalls einer Überversorgung (Einwohnerzahl steigt, Praxisinhaber steigen aus) mit einem<br />
Versorgungsgrad unter<br />
110 % ist <strong>die</strong> Zulassungsbeschränkung <strong>auf</strong>zuheben. Es erfolgt durch Beschluss des Landesausschusses eine<br />
sog. Partielle Öff-nung, das ist eine Aufhebung der Zulassungsbeschränkung nur bis <strong>zur</strong> neuerlichen Erreichung<br />
des Überversorgungsgrades. Darüber hinaus sind dann automatisch keine weiteren Zulassungen mehr möglich.<br />
Hierbei müssen auch <strong>die</strong> zum Zeitpunkt der Aufhebung der Zulassungsbeschränkung bestehenden Zulassungen<br />
im Rah-men der Job-Sharing-Gemeinschaftspraxen entsprechend ihrer Zeitfolge bis <strong>zur</strong> Grenze der partiellen<br />
Öffnung in volle Zulas-sungen umgewandelt werden.<br />
• Ergibt <strong>die</strong> Prüfung für <strong>die</strong> Kassenärztliche Vereinigung oder für einen Landesverband der Krankenkassen oder für<br />
einen Verband der Ersatzkassen, dass eine Unterversorgung oder eine drohende Unterversorgung in dem<br />
Planungsbereich anzunehmen ist, so ist der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen unter Mittei-lung der<br />
für <strong>die</strong>se Feststellung maßgebenden Tatsachen und der Übersendung der <strong>zur</strong> Prüfung <strong>die</strong>ser Tatsachen<br />
erforderlichen Unterlagen zu benachrichtigen.
Ambulanter Bereich aus<br />
rechtlicher und ökonomischer<br />
Sicht<br />
VI. Umfang der vertragsärztlichen<br />
Versorgung
Schwerpunkte des Leistungsrechts<br />
sind:<br />
• 1. Leistungen <strong>zur</strong> Verhütung und Früherkennung von Krankheiten (§§ 20 ff, 25 ff SGB V)<br />
• 2. Leistungen bei Krankheit (§§ 27 ff SGB V)<br />
– 2.1. Krankenbehandlung<br />
– 2.1.1. Ärztliche/Zahnärztliche Behandlung<br />
– 2.1.2. Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und<br />
Hilfsmittel<br />
– 2.1.3. Häusliche Krankenpflege<br />
– 2.1.4. Haushaltshilfe<br />
– 2.1.5. Krankenhausbehandlung<br />
– 2.1.6. Soziotherapie<br />
– 2.1.7. Krankengeld<br />
– 2.1.8. Fahrtkosten<br />
• 3. Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§§ 195 – 200 b RVO)<br />
• 4. Leistungen <strong>zur</strong> medizinischen Rehabilitation einschließlich Belastungserprobung und Arbeitstherapie<br />
(§§ 40 – 43 SGB V)<br />
• 5. Nichtärztliche sozialpädiatrische Leistungen (§ 43a SGB V)<br />
• 6. Medizinische Vorsorge für Mütter und Väter (§ 24 SGB V)<br />
• 7. Leistungen <strong>zur</strong> Empfängnisverhütung und bei Schwangerschaftsabbruch (§§ 24a, 24b SGB V)<br />
• 8. Leistungen <strong>zur</strong> Herbeiführung einer Schwangerschaft (§ 27a SGBV )<br />
• 9. Stationäre und ambulante Hospizleistungen (§ 39a SGB V)<br />
• Nichtärztliche sozialpädiatrische Leitungen<br />
(§ 43a SGB V)
Behandlungsziele<br />
• Erkennung zum Zwecke der Therapie<br />
Heilen des regelwidrigen körperlichen oder<br />
geistigen Zustandes<br />
• Verhütung einer Verschlimmerung<br />
• Minderung von Schmerzen<br />
• Verlängerung des Lebens
Tätigkeitsfelder des<br />
Vertragsarztes<br />
• Ärztliche Behandlung<br />
• Zahnärztliche Behandlung einschl. <strong>die</strong> Versorgung mit Zahnersatz<br />
• Kieferorthopädische Behandlung nach Maßgabe § 28 Abs. 2 SGB V<br />
• Maßnahmen <strong>zur</strong> Früherkennung von Krankheiten<br />
• Ärztliche Betreuung bei Schwangerschaft und Mutterschaft<br />
• Verordnung von medizinischen Leistungen der Rehabilitation<br />
• Anordnung von Hilfeleistung anderer Personen<br />
• Verordnung von Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln, Krankentransporten sowie<br />
Krankenhausbehandlung oder Behandlung in Vorsorge oder<br />
Rehabilitationseinrichtungen<br />
• Verordnung häuslicher Krankenpflege<br />
• Ausstellung von Bescheinigungen und Erstellung von Berichten<br />
• Medizinische Maßnahmen <strong>zur</strong> Herbeiführung einer Schwangerschaft nach § 27a Abs.<br />
1 SGB V<br />
• Ärztliche Maßnahmen nach den §§ 24a, 24b SGB V (Empfängnisverhütung,<br />
Schwangerschaftsabbruch und Sterilisation)<br />
• Verordnung von Soziotherapie
Durchführung der ärztlichen Behandlung
Verordnungen durch den<br />
• Arzneimittel<br />
Vertragsarzt<br />
• Heil- und Hilfsmittel<br />
• Krankenhausbehandlung<br />
• Behandlung in Vorsorge- und Reha-<br />
Einrichtungen<br />
• Häusliche Krankenpflege<br />
• Krankentransporte
Verordnung von Arzneimitteln
Ambulanter Bereich aus<br />
rechtlicher und ökonomischer<br />
Sicht<br />
VII. Ärztliche Organisationen
Wesentliche Aufgabenbereiche der<br />
Landesärztekammern (LÄK)<br />
• Die Verabschiedung von Regelungen zu den Rechten und Pflichten der Ärzte in der<br />
Berufsordnung,<br />
• Verabschiedung der Weiterbildungsordnung für <strong>die</strong> Fachgebiete, Schwerpunkte,<br />
Zusatzbezeichnungen, fakultative Weiterbildungen,<br />
• Regelungen <strong>zur</strong> Fortbildung der Ärzte,<br />
• Regelungen <strong>zur</strong> Berufsgerichtsbarkeit,<br />
• Regelungen <strong>zur</strong> Ausbildung der Arzthelferinnen im Rahmen bestehender gesetzlicher<br />
Vorgaben,<br />
• Regelungen <strong>zur</strong> Qualitätssicherung ärztlicher Leistungen,<br />
• Einrichtungen von Schlichtungs- und Gutachterkommissionen für ärztliche<br />
Behandlungsfehler,<br />
• Einrichtung einer Ethik-Kommission <strong>zur</strong> Beurteilung der Zulassung von<br />
Forschungsvorhaben
Aufgaben der BÄK<br />
• ständiger Erfahrungsaustausch unter den Ärztekammern und gegenseitige Abstimmung der<br />
Tätigkeiten;<br />
• Vertretung der Positionen der Ärzteschaft zu gesundheits- und sozialpolitischen Diskussionen<br />
gegenüber der Öffentlichkeit;<br />
• Herbeiführung möglichst einheitlicher Regelungen der ärztlichen Berufspflichten (Beschluss einer<br />
Muster-Berufsordnung);<br />
• Herbeiführung einer möglichst einheitlichen Regelung der ärztlichen Weiterbildung (Beschluss<br />
einer Muster-Weiterbildungsordnung);<br />
• Förderung der ärztlichen Fortbildung (z. B. durch Fortbildungskon-gresse);<br />
• Wahrung der beruflichen Belange der Ärzteschaft in Angelegenheiten, <strong>die</strong> über <strong>die</strong> Zuständigkeit<br />
eines Landes hinausgehen (z. B. Bundes-gesetzgebung);<br />
• Herstellung von Beziehungen <strong>zur</strong> ärztlichen Wissenschaft und zu ärztlichen Vereinen im Ausland;<br />
• Beschluss von Richtlinien <strong>zur</strong> Qualitätssicherung (z. B. in medizinischen Laboratorien gemäß § 4<br />
der Eichordnung);<br />
• Pflege des Zusammengehörigkeitsgefühls der Ärzte und ihrer Organisationen.
Organisation der Kassenärztlichen<br />
Vereinigungen der Länder und der<br />
Kassenärztlichen Bundesvereinigung
Organe der KBV
Aufgaben der KBV<br />
• Vertretung der Belange der Vertragsärzte/-psychotherapeuten bei<br />
Gesetzgebungsverfahren gegenüber der Bundesregierung<br />
• Erlass von bundeseinheitlichen Richtlinien <strong>zur</strong> Qualitätssicherung<br />
(§ 75 Abs. 7 SGB V)<br />
• Mitwirkung im Gemeinsamen Bundesausschuss <strong>zur</strong> Bewertung des<br />
Nutzens, der Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit medizinischer<br />
Leis-tungen; bei der Beschlussfassung über Richtlinien <strong>zur</strong> Gewährleistung<br />
einer wirtschaftlichen, in ihrer Qualität gesicherten vertragsärztlichen<br />
Versorgung und <strong>zur</strong> Bedarfsplanung<br />
• Mitwirkung im Bundesschiedsamt bei der Festsetzung des Inhalts von<br />
Bundesmantelverträgen bei Nichteinigung der Vertragspartner<br />
• Durchführung des Fremdkassenzahlungsausgleichs<br />
(§ 81 Abs. 3 Nr. 1 SGB V)<br />
• Führen des Bundesarztregisters
Abschluss folgender Verträge<br />
Aufgaben der KBV<br />
• Bundesmantelverträge (Primärkassen, Ersatzkassen) (§ 82 SGB V)<br />
Vertragspartner sind <strong>die</strong> Bundesverbände der Krankenkassen bzw. <strong>die</strong> Verbände der<br />
Ersatzkassen. Die Bundesmantelverträge sind allgemeiner Inhalt der Gesamtverträge und daher<br />
für <strong>die</strong> Gesamt-vertragspartner verbindlich vorgegebener Vertragsinhalt.<br />
• Verträge mit besonderer Kostenträger (z. B. Unfallversicherungs-träger,<br />
Postbeamtenkrankenkasse, Bundeswehr)<br />
• Vereinbarung des einheitlichen Bewertungsmaßstabes durch den Bewertungsausschuss (§§ 82<br />
und 87 SGB V)<br />
• Rahmenempfehlungen für dreiseitige Verträge zwischen Kranken-kassen, Krankenhäusern und<br />
Vertragsärzten (§ 115 SGB V)<br />
• Vereinbarung über den Datenaustausch zwischen Kassenärztlichen Vereinigungen und<br />
Krankenkassen (§ 294 SGB V)<br />
• Vereinbarung einheitlicher Qualifikationserfordernisse für ärztliche Untersuchungs- und<br />
Behandlungsmethoden (§ 135 Abs. 2 SGB V)<br />
• Vereinbarung über <strong>die</strong> Einführung der Krankenversichertenkarte<br />
(§ 291 SGB V)<br />
• Vereinbarung über ambulantes Operieren und stationsersetzende Eingriffe im Krankenhaus (§<br />
115b SGB V)
Öffentlichrechtlich<br />
privat<br />
Ärztliche Verbände
Ambulanter Bereich aus<br />
rechtlicher und ökonomischer<br />
Sicht<br />
VIII. Die gemeinsame<br />
Selbstverwaltung in der<br />
vertragsärztlichen Versorgung
GBA-Besetzung<br />
KBV 2<br />
KZBV 1<br />
DKG 2
Bewertungsausschuss-Besetzung<br />
6 Vertreter (§ 87 Abs. 3 SGB V)<br />
davon<br />
- 3 durch den Spitzenverband Bund<br />
der KK benannte Vertreter<br />
- 3 durch <strong>die</strong> KBV benannte Vertreter
Erweiterter Bewertungsausschuss<br />
• 9 Vertreter<br />
davon<br />
– 1 unparteiischer Vorsitzender<br />
– 2 unparteiische Mitglieder<br />
• davon wird jeweils 1 Mitglied durch den SpiKK und <strong>die</strong> KBV<br />
benannt<br />
– 3 durch den SpiKK benannte Vertreter<br />
– 3 durch <strong>die</strong> KBV benannte Vertreter
Aufgaben des Landesausschusses<br />
Ärzte/Krankenkassen<br />
• Beratung der von den KVen <strong>auf</strong>gestellten Bedarfspläne <strong>zur</strong> Sicherstellung<br />
der vertragsärztlichen Versorgung,<br />
• Anordnung von Zulassungsbeschränkungen in bestimmten Gebieten eines<br />
Zulassungsbezirks <strong>zur</strong> Abwendung einer bestehenden oder drohenden<br />
Unterversorgung.<br />
• Feststellung einer Überversorgung in bestimmten Planungsbereichen und<br />
Anordnung von Zulassungsbeschränkungen.<br />
• Feststellung einer bestehenden oder in absehbarer Zeit drohenden<br />
Unterversorgung in bestimmten Planungsbereichen.
Besetzung des<br />
Landesausschusses<br />
• 1 Vorsitzender<br />
• 2 unparteiische Mitglieder<br />
• 8 Mitglieder als Vertreter der KV<br />
• 8 Mitglieder als Vertreter der KK-Verbände<br />
– Davon: AOK 3<br />
EK 2<br />
BKK 1<br />
IKK 1<br />
LKK 1<br />
GESAMT: 19 Mitglieder
Ambulanter Bereich aus<br />
rechtlicher und ökonomischer<br />
Sicht<br />
IX. Organisation und Aufgaben<br />
der Kassenärztlichen<br />
Vereinigungen
Die Rechts<strong>auf</strong>sicht umfasst:<br />
• <strong>die</strong> Möglichkeit, den vom Vorstand <strong>auf</strong>gestellten und von der Vertre-terversammlung festgestellten<br />
Haushaltsplan innerhalb eines Monats nach Vorlage zu beanstanden, soweit gegen Gesetz oder<br />
sonstiges für <strong>die</strong> Kassenärztliche Vereinigung maßgebendes Recht verstoßen wird,<br />
• <strong>die</strong> Bindung der Kassenärztlichen Vereinigung an <strong>die</strong> Verordnung über das Haushaltswesen in<br />
der Sozialversicherung, soweit <strong>die</strong> darin niedergelegten Grundsätze über <strong>die</strong> Aufstellung des<br />
Haushaltsplanes, seine Ausführung, <strong>die</strong> Rechnungsprüfung und <strong>die</strong> Entlastung der Vor-sitzenden<br />
sowie <strong>die</strong> Zahlung, <strong>die</strong> Buchführung und <strong>die</strong> Rechnungsle-gung für Kassenärztliche<br />
Vereinigungen entsprechend anwendbar sind,<br />
• <strong>die</strong> Verpflichtung <strong>zur</strong> Vorlage von Übersichten über <strong>die</strong> Geschäfts- und Rechnungsergebnisse<br />
sowie sonstigem statistischen Material aus dem jeweiligen Geschäftsbereich bei den<br />
Aufsichtsbehörden nach Maßgabe einer Verwaltungsvorschrift des Bundesministers für Arbeitund<br />
Sozialordnung,<br />
• <strong>die</strong> Verpflichtung <strong>zur</strong> Vorlage von Gesamtverträgen (Vergütungsver-einbarungen) mit der<br />
Möglichkeit einer Beanstandung innerhalb von zwei Monaten bei Rechtsverstößen,<br />
• <strong>die</strong> Verpflichtung <strong>zur</strong> Einholung einer Genehmigung für bestimmte Vermögensanlagen,<br />
insbesondere für den Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten durch <strong>die</strong><br />
zuständige Aufsichtsbehörde,<br />
• <strong>die</strong> Vorlage der – von der Vertreterversammlung beschlossenen – Satzungsänderungen <strong>zur</strong><br />
Genehmigung durch <strong>die</strong> betreffende Aufsichtsbehörde,<br />
• <strong>die</strong> Möglichkeit der Übernahme der Geschäfte der Kassenärztlichen Vereinigung durch <strong>die</strong><br />
Aufsichtsbehörde oder einen durch <strong>die</strong> Auf-sichtsbehörde eingesetzten Be<strong>auf</strong>tragten, sofern <strong>die</strong><br />
Wahl der Selbst-verwaltungsorgane nicht zustande kommt oder sie sich weigern, ihre Geschäft zu<br />
führen.
Aufgaben der<br />
Vertreterversammlung (VV)<br />
• Beschlussfassung über <strong>die</strong> Satzung<br />
• Wahl des Vorstandes<br />
• Wahl der Ausschussmitglieder<br />
• Überwachung des Vorstandes<br />
• Feststellung des Haushaltsplans<br />
• Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung des Vorstandes<br />
• Entscheidung in Grundsatzfragen der vertragsärztlichen Versorgung<br />
• Vertretung der Körperschaft gegenüber dem Vorstand und dessen Mitglieder<br />
• Beschlussfassung über den Erwerb, <strong>die</strong> Veräußerung oder <strong>die</strong> Belastung von<br />
Grundstücken sowie über <strong>die</strong> Errichtung von Gebäuden
Die Satzung muss Bestimmungen<br />
enthalten über:<br />
• Name, Bezirk und Sitz der Vereinigung<br />
• Zusammensetzung, Wahl, Amtsführung sowie Aufgaben und<br />
Befugnisse der Selbstverwaltungsorgane<br />
• Öffentlichkeit und Art der Beschlussfassung der<br />
Vertreterversammlung<br />
• Rechte und Pflichten der Organe und der Mitglieder<br />
• Aufbringung und Verwaltung der Mittel<br />
• Jährliche Prüfung der Betriebs- und Rechnungsführung und<br />
Abnahme der Jahresrechnung<br />
• Änderung der Satzung<br />
• Entschädigungsregelung für Organmitglieder<br />
• Art der Bekanntmachungen<br />
• Vertragsärztliche Pflichten <strong>zur</strong> Ausfüllung des<br />
Sicherstellungs<strong>auf</strong>trages
Aufgaben der KV<br />
• der Sicherstellungs<strong>auf</strong>trag – Verpflichtung <strong>zur</strong> Sicherstellung der<br />
vertragsärztlichen Versorgung in dem in § 73 Abs. 2 SGB V bezeichneten Umfang<br />
• <strong>die</strong> Interessenvertretung – Wahrung der Rechte der Vertragsärzte<br />
• <strong>die</strong> Gewährleistungspflicht – Gewährleistung einer ordnungsgemäßen<br />
Durchführung der vertragsärztlichen Tätigkeit gegenüber den Krankenkassen<br />
• <strong>die</strong> Vertragshoheit – Zuständigkeit zum Abschluss von Verträgen mit den<br />
Verbänden der Krankenkassen <strong>zur</strong> Gestaltung der vertragsärztlichen Versorgung<br />
• <strong>die</strong> Ausschussbesetzung – Recht <strong>zur</strong> Besetzung von Ausschüssen der<br />
gemeinsamen Selbstverwaltung von Ärzten und Krankenkassen.
Das Beziehungsfünfeck
Kassenärztliche Vereinigung der<br />
Länder
Ambulanter Bereich aus<br />
rechtlicher und ökonomischer<br />
Sicht<br />
X. Vertrags- und<br />
Regelungssysteme der<br />
Kassenärztlichen Vereinigungen
Autonome Regelungsbereiche
Inhalt der Bundesmantelverträge<br />
• Inhalt und Umfang der vertragsärztlichen Versorgung<br />
• Modalitäten <strong>zur</strong> Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung<br />
• Hausärztliche und fachärztliche Versorgung<br />
• Qualität der vertragsärztlichen Versorgung<br />
• Allgemeine Grundsätze der vertragsärztlichen Versorgung<br />
• Inanspruchnahme vertragsärztlicher Leistungen durch <strong>die</strong> Versicherten<br />
• Regelungen <strong>zur</strong> Abgabe vertragsärztlicher Leistungen<br />
• Vordrucke, Bescheinigungen und Auskünfte, Arztstempel<br />
• Belegärztliche Versorgung<br />
• Abrechnung der vertragsärztlichen Leistungen<br />
• Prüfung der Abrechnung und Wirtschaftlichkeit, Sonstiger Schaden<br />
• Allgemeine Regeln <strong>zur</strong> vertragsärztlichen Gesamtvergütung und den Abrechnungsgrundlagen<br />
• Besondere Rechte und Pflichten des Vertragsarztes der KVen und der<br />
Krankenkassen<br />
• Zusammenarbeit mit dem Medizinischen Dienst
Dreiseitige Verträge<br />
Gemäß § 115 Abs. 5 SGB V sollen <strong>die</strong> Spitzenverbände der Krankenkassen, <strong>die</strong> KBV<br />
und <strong>die</strong> Deutsche Krankenhausgesellschaft Rahmenempfehlungen zum Inhalt der<br />
Dreiseitigen Verträge <strong>auf</strong> Landesebene geben, <strong>die</strong><br />
• eine Förderung des Belegarztwesens sowie <strong>die</strong> Zusammenarbeit in Praxiskliniken<br />
regeln,<br />
• <strong>die</strong> gegenseitige Unterrichtung über <strong>die</strong> Behandlung der Patienten sowie <strong>die</strong><br />
Überlassung und Verwendung von Krankenunterlagen,<br />
• <strong>die</strong> Zusammenarbeit bei der Gestaltung und Durchführung eines ständig<br />
einsatzbereiten Not<strong>die</strong>nstes,<br />
• <strong>die</strong> Durchführung einer vor- und nachstationären Behandlung im Krankenhaus,<br />
• <strong>die</strong> allgemeinen Bedingungen der ambulanten Behandlung im Krankenhaus<br />
regeln.
Inhalt des Gesamtvertrages<br />
• Geltungsbereich<br />
• Art und Umfang der vertragsärztlichen Versorgung<br />
• Bewertung der im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung<br />
erbrachten Leistungen und Kosten<br />
• Vertragsarztstempel<br />
• Vordrucke<br />
• Sammelerklärung (bei Abgabe der Abrechnung)<br />
• Sachlich-rechnerische Prüfung der Abrechnung, Plausibilitätsprüfung<br />
• Abrechnung Fremdarztfälle<br />
• Gesamtvergütung<br />
• Rechnungslegung, Zahlungstermine<br />
• Anträge für nachgehende sachlich-rechnerische Honorarberichtigungen<br />
• Datenaustausch<br />
• Prüfung der Abrechnungsunterlagen und der Kontenführung<br />
• Befragung von Versicherten<br />
• Information der an der Vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden<br />
• Ärzte über ihre Verordnungen und entsprechenden Statistiken<br />
• Besetzung der Schlichtungsstelle<br />
• Verzeichnis der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden<br />
Ärzte
Ambulanter Bereich aus<br />
rechtlicher und ökonomischer<br />
Sicht<br />
XI. Richtlinien des Gemeinsamen<br />
Bundesausschusses
Gesetzlicher Auftrag des GBA<br />
Richtlinien über:<br />
• <strong>die</strong> ärztliche Behandlung,<br />
• <strong>die</strong> zahnärztliche Behandlung einschl. der Versorgung mit Zahnersatz sowie kieferorthopädische<br />
Behandlung,<br />
• Maßnahmen <strong>zur</strong> Früherkennung von Krankheiten,<br />
• ärztliche Betreuung bei Schwangerschaft und Mutterschaft,<br />
• Einführung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden,<br />
• Verordnung von Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln, Krankenhausbehandlung und häuslicher<br />
Krankenpflege,<br />
• Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit,<br />
• Verordnung von im Einzelfall gebotenen medizinischen Leistungen und <strong>die</strong> Beratung über <strong>die</strong><br />
medizinischen, berufsfördernden und ergänzenden Leistungen zu Rehabilitation,<br />
• Bedarfsplanung,<br />
• medizinische Maßnahmen <strong>zur</strong> Herbeiführung einer Schwangerschaft,<br />
• Maßnahmen bezüglich Empfängnisverhütung, Schwangerschaftsabbruch und Sterilisation<br />
• Verordnung von Krankentransporten<br />
• Qualitätssicherung<br />
• Spezielle ambulante Palliativversorgung<br />
• Schutzimpfungen
Rechtscharakter der Richtlinien<br />
Richtlinien<br />
= verbindlich<br />
Unterscheide davon<br />
Leitlinien (z.B. der Berufsfachverbände)<br />
= bedingte Verpflichtungskraft
Arzneimittel-Richtlinie<br />
Regelungsinhalte:<br />
• Wirtschaftlichkeitsgrundsätze<br />
• Ausschlüsse und Einschränkungen<br />
– § 34 Abs. 1 SGB V<br />
– Ziff. 17.1 und 17.2 AMRL<br />
• Negativliste nach § 34 Abs. 2 SGB V<br />
• Preisvergleichliste<br />
• Bildung von Festbetragsgruppen
Arzneimittel-Richtlinien<br />
Verordnungsformen:<br />
• Präparat (Fertigarzneimittel)<br />
• Präparat – aut idem<br />
• Wirkstoff<br />
• Rezeptur
Arzneimittel-Richtlinie<br />
Die Verordnungseinschränkungen<br />
• Umsetzung der Verordnungsausschlüsse gem. § 34 Abs. 1<br />
SGB V<br />
• Umsetzung der gem. § 34 Abs. 3 SGB V durch<br />
Rechtsverordnung herausgegebenen Liste unwirtschaftlicher<br />
Arzneimittel, <strong>die</strong> von der Leistungspflicht ausgeschlossen sind<br />
(sog. Negativliste)<br />
• Katalog von Mitteln, <strong>die</strong> abgesehen von den in den Richtlinien<br />
genannten Ausnahmen nicht verordnet werden dürfen (Ziffer<br />
17.1 Arzneimittel-Richtlinien)<br />
• Katalog von Arzneimitteln, <strong>die</strong> nur verordnet werden dürfen<br />
unter der Voraussetzung, dass zuvor allgemeine, nicht<br />
medikamentöse Maßnahmen genützt wurden, hierdurch aber<br />
das Behandlungsziel nicht erreicht werden konnte und eine<br />
medikamentöse Behandlung mit <strong>die</strong>sen Arzneimitteln<br />
zusätzlich erforderlich ist (Ziffer 17.2 Arzneimittel-Richtlinien)
Ambulanter Bereich aus<br />
rechtlicher und ökonomischer<br />
Sicht<br />
XII. Abrechnung und Vergütung<br />
von vertragsärztlichen Leistungen
Die Gebührenordnungen<br />
• Gebühren für Ärzte (GOÄ)<br />
• Einheitlicher Bewertungsmaßstab für Ärzte<br />
(EBM – Ärzte)<br />
Analog für den zahnärztlichen Bereich<br />
• Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ)<br />
• Einheitlicher Bewertungsmaßstab für<br />
Zahnärzte (BEMA)
Steigerungssätze GOÄ<br />
• Persönliche Leistungen<br />
2,3 (Schwellenwert)<br />
max. 3,5 (Höchstsatz)<br />
• Technische Leistungen<br />
1,8 (Schwellenwert)<br />
max. 2,5 (Höchstwert)<br />
• Labor<br />
1,15 (Schwellenwert)<br />
max. 1,3 (Höchstwert)
Struktureller Aufbau des EBM im<br />
Überblick<br />
• Allgemeine Bestimmungen<br />
• Arztgruppenübergreifende allgemeine Leistungen<br />
• Arztgruppenspezifische Leistungen<br />
03 Haus, 04 Kinder, 05 Anästh., 07 Chir., 08 Gyn., 09 HNO, 10<br />
Haut, 11 Humangen., 12 Labor, 13 FÄ-Intern., 14 Kinder-/Jug.psych./-PT,<br />
15 MKG, 16 Neurol.-/Neuroch., 17 Nukl., 18 Orth.,<br />
19 Pathologie, 20 Phon./Päd., 21 Psych./PT, 22 PT, 23<br />
Ärztl./psyh. (Kinder-/Jug.)-PT, 24 Radiologie, 25<br />
Strahlentherapie, 26 Urologie, 27 Phys. u. Reh. Medizin<br />
• Arztgruppenübergreifende spezielle Leistungen<br />
30.1 Allerg., 30.2 Chiroth., 30.3 Neurophys., 30.4 Phys.-Ther.,<br />
30.5 Phlebo., 30.6 Prokto., 30.7 Schmerzth., 30.9 Schlafap., 31<br />
Amb./beleg. Ops, 32 Labor, 33 Sono, 34 Rö., CT, MRT, 35 PT-<br />
RiLi’s<br />
• Pauschalerstattungen<br />
• Anhänge (z. B. nicht berechnungsfähige Einzelleistungen,<br />
OPS, Plausibilitätszeiten)
Anwendung des EBM<br />
• Abrechnung nur vollständig erbrachter Leistungen<br />
• keine Abrechnungsmöglichkeit von Teilleistungen als<br />
Bestandteil anderer abrechnungsfähiger Leistungen<br />
oder eines Leistungskomplexes<br />
• Abgrenzung der Kosten, <strong>die</strong> Bestandteil der<br />
Bewertungen sind bzw. <strong>die</strong> ausdrücklich zusätzlich<br />
berechnungsfähig sind<br />
• Grundsatz für Abrechnungsausschlüsse<br />
• Aufschläge für Gemeinschaftspraxen<br />
• Berichtspflicht an Hausarzt für bestimmte Leistungen
Die Honorarreform 2009
Honorarreform 2009<br />
Das Prinzip bisher und ab 2009
Ambulanter Bereich aus<br />
rechtlicher und ökonomischer<br />
Sicht<br />
XIII. Wirtschaftlichkeitsgebot und<br />
Wirtschaftlichkeitsprüfung
Wirtschaftlichkeitsgebote<br />
• Verpflichtung <strong>zur</strong> Qualitätssicherung,<br />
• Dokumentationspflicht,<br />
• Gewissenhafte Versorgung der Patienten mit<br />
geeigneten Untersuchungs- und<br />
Behandlungsmethoden,<br />
• Verhaltensregeln <strong>zur</strong> Kooperation, Überweisung und<br />
Kommunikation bei der Patientenbehandlung,<br />
• Grundsätzlichen Beschränkung <strong>auf</strong> <strong>die</strong> erworbenen<br />
Facharztbezeichnungen und Tätigkeitsverpflichtung im<br />
Schwerpunkt (§ 21 WBO)
§ 12 SGB V<br />
Wirtschaftlichkeitsgebot<br />
• Die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein;<br />
sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Leistungen, <strong>die</strong><br />
nicht notwendig oder unwirtschaftlich sind, können Versicherte nicht<br />
bean-spruchen, dürfen <strong>die</strong> Leistungserbringer nicht bewirken und <strong>die</strong><br />
Krankenkas-sen nicht bewilligen.<br />
• Ist für eine Leistung ein Festbetrag angesetzt, erfüllt <strong>die</strong> Krankenkasse ihre<br />
Leistungspflicht mit dem Festbetrag.<br />
• Hat eine Krankenkasse Leistungen ohne Rechtsgrundlage oder entgegen<br />
geltendem Recht erbracht und hat ein Vorstandsmitglied hiervon gewusst<br />
oder hätte es hiervon wissen müssen, hat <strong>die</strong> zuständige Aufsichtsbehörde<br />
nach Anhörung des Vorstandsmitglieds den Verwaltungsrat zu veranlassen,<br />
das Vorstandsmitglied <strong>auf</strong> Ersatz des aus der Pflichtverletzung<br />
entstandenen Schadens in Anspruch zu nehmen, falls der Verwaltungsrat<br />
das Regressverfahren nicht bereits von sich aus eingeleitet hat.
§ 70 SGB V Qualität, Humanität<br />
und Wirtschaftlichkeit<br />
• Die Krankenkassen und Leistungserbringer haben eine<br />
bedarfsgerechte und gleichmäßige, dem allgemein<br />
anerkannten Stand der medi-zinischen Erkenntnisse<br />
entsprechende Versorgung zu gewährleisten. Die<br />
Versorgung der Versicherten muss ausreichend und<br />
zweckmäßig sein, darf das Maß des Notwendigen nicht<br />
überschreiten und muss in der fachlich gebotenen<br />
Qualität sowie wirtschaftlich erbracht werden.<br />
• Die Krankenkassen und <strong>die</strong> Leistungserbringer haben<br />
durch geeignete Maßnahmen <strong>auf</strong> eine humane<br />
Krankenbehandlung ihrer Versicherten hinzuwirken.
Konkurrierende Aspekte der<br />
Wirtschaftlichkeit in der<br />
vertragsärztlichen Tätigkeit<br />
Patient<br />
Arzt<br />
Praxis<br />
GKV<br />
Kasse / KV
Begriff der Wirtschaftlichkeit nach<br />
Rechtsprechung des BSG<br />
• So hat das BSG bereits in einer Entscheidung im<br />
Jahr 1962 (BSG vom 29.05.1962, 6 RKA 24/59)<br />
festgestellt, dass <strong>die</strong> gesetzlichen Begriffe im<br />
Zusammenhang zu verstehen sind:<br />
„Unwirtschaftlichkeit folgt daraus, dass<br />
Überflüssiges (mehr als notwendig oder ausreichend<br />
ist) getan wird, oder dass – an sich geeignete –<br />
Behandlungsmethoden gewählt werden, <strong>die</strong><br />
<strong>auf</strong>wendiger als andere zum gleichen Erfolg<br />
führende Behandlungsweisen sind (nicht<br />
zweckmäßig).“
Die Bereiche des<br />
Wirtschaftlichkeitsgebots in der<br />
vertragsärztlichen Tätigkeit<br />
• Durchführung der eigenen ärztlichen<br />
Leistungen<br />
• Überweisung an andere Vertragsärzte<br />
• Verordnung von Arzneimitteln und<br />
Sprechstundenbedarf<br />
• Verordnung von Heilmitteln<br />
• Verordnung von Hilfsmitteln<br />
• Verordnung von Krankenhausbehandlung<br />
• Verordnung von Krankentransporten<br />
• Ausstellung von AU-Bescheinigungen
Kompensationsmöglichkeiten im<br />
Rahmen der Wirtschaftlichkeit<br />
• Erhöhte Hausbesuche als Zeichen einer<br />
intensiven Betreuung schwerkranker<br />
Patienten durch signifikant geringere<br />
Krankenhauseinweisungen<br />
• Oder eine erhöhte Injektionsbehandlung<br />
durch geringere Arzneiverordnungen<br />
• Oder vermehrte Verordnung von<br />
physikalischer Therapie durch geringere<br />
Arzneiverordnungen
Auffälligkeitszonen<br />
• Zone A: normale Streuung (bis D + 20 %)<br />
= Umfassende Einzelfallprüfung, d. h. genaue Überprüfung jedes<br />
einzelnen abgerechneten Behandlungsfalles <strong>auf</strong> Wirtschaftlichkeit der<br />
abgerechneten Leistungen in Bezug <strong>auf</strong> <strong>die</strong> angegebenen Diagnosen und<br />
<strong>die</strong> Leistungskombination<br />
• Zone B: Übergangszone (über D + 20 %)<br />
= Einzelfallprüfung anhand einer genügend ausreichenden Anzahl von<br />
Beispielsfällen (repräsentative, eingeschränkte Einzelfallprüfung),<br />
insbesondere wenn bei einer großen Gesamtfallzahl der Praxis eine<br />
umfassende Einzelfallprüfung mit einem unverhältnismäßigen Aufwand<br />
verbunden wäre.<br />
• Zone C: offensichtliches Missverhältnis (ab D + 40 %)<br />
= rein statistische Prüfung und Feststellung der Unwirtschaftlichkeit<br />
unter Annahme einer Beweislastumkehr, d. h. dass in <strong>die</strong>sem<br />
Überschreitungsbereich der Arzt seine Wirtschaftlichkeit entgegen der<br />
vermuteten Unwirtschaftlichkeit nachweisen muss.
Mögliche Prüfungsmaßnahmen<br />
• Hinweise<br />
• Kürzungen<br />
• Regresse<br />
• Feststellung eines sonstigen Schadens dem<br />
Grunde und der Höhe nach
Ambulanter Bereich aus<br />
rechtlicher und ökonomischer<br />
Sicht<br />
XIV. Besondere<br />
Versorgungsstrukturen
Vertragspartner der Krankenkassen für<br />
integrierte Versorgungsformen<br />
– einzelne, <strong>zur</strong> vertragsärztlichen Versorgung zugelassene Ärzte und Zahnärzte<br />
und einzelne sonstige, nach <strong>die</strong>sem Kapitel <strong>zur</strong> Versorgung der Versicherten<br />
berechtigten Leistungserbringer oder deren Gemeinschaften,<br />
– Träger zugelassener Krankenhäuser, soweit sie <strong>zur</strong> Versorgung der Versicherten<br />
berechtigt sind, Träger von stationären Vorsorge- und<br />
Rehabilitationseinrichtungen, soweit mit ihnen ein Versorgungsvertrag nach §<br />
111 Abs. 2 besteht, Träger von ambulanten Rehabilitationseinrichtungen oder<br />
deren Gemeinschaften,<br />
– Träger von Einrichtungen nach § 95 Abs. 1 Satz 2 oder deren Gemeinschaften<br />
(=MVZ),<br />
– Träger von Einrichtungen, <strong>die</strong> eine integrierte Versorgung nach § 140a durch <strong>zur</strong><br />
Versorgung der Versicherten nach dem Vierten Kapitel berechtigte<br />
Leistungserbringer anbieten,<br />
– Pflegekassen und zugelassenen Pflegeeinrichtungen <strong>auf</strong> der Grundlage des §<br />
92b des Elften Buches,<br />
– Gemeinschaften der vorgenannten Leistungserbringer und deren<br />
Gemeinschaften,<br />
– Praxiskliniken nach § 115 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 SGB V
Auswahlkriterien bei chronischen<br />
Krankheiten<br />
• Zahl der von der Krankheit betroffenen<br />
Versicherten<br />
• Möglichkeiten <strong>zur</strong> Verbesserung der Qualität<br />
der Versorgung<br />
• Verfügbarkeit von evidenzbasierten Leitlinien<br />
• Sektorenübergreifender Behandlungsbedarf<br />
• Beeinflussbarkeit des Krankheitsverl<strong>auf</strong>s durch<br />
Eigeninitiative des Versicherten<br />
• Hoher finanzieller Aufwand der Behandlung
Ausgewählte chronische<br />
Erkrankungen<br />
• Diabetes mellitus Typ l und Typ II<br />
• Koronare Herzkrankheit (KHK)<br />
• Chronische Atemwegserkrankungen<br />
(Asthma / COPD = Chronisch obstruktive<br />
Lungenerkrankung )<br />
• Brustkrebs
Anforderungen an <strong>die</strong><br />
Ausgestaltung der DMPs<br />
• Behandlung nach evidenzbasierten Leitlinien unter<br />
Berücksichtigung des jeweiligen Versorgungssektors<br />
• Qualitätssicherungsmaßnahmen<br />
• Einschreibungsvoraussetzungen für Versicherte<br />
• Schulungen von Leistungserbringern und Patienten<br />
• Dokumentation<br />
• Bewertung der Wirksamkeit und der Kosten<br />
(Evaluation)
Aufgaben koordinierender Arzt<br />
• Information, Beratung und Einschreibung der<br />
Patienten<br />
• Koordination der Behandlung = Lotsenfunktion<br />
• Kontinuierliche Betreuung und Begleitung des<br />
Patienten orientiert an den medizinischen<br />
Vertragsinhalten<br />
• Festlegung der Therapieziele<br />
• Erstellung der Dokumentationen
Aufgaben der 2.Versorgungsstufe<br />
• Mit-/Weiterbehandlung der Patienten unter<br />
Beachtung der medizinischen Versorgungsinhalte<br />
und Kooperationsregeln<br />
• Beachtung der Qualitätsziele einschließlich der<br />
qualitätsgesicherten und wirtschaftlichen<br />
Arzneimitteltherapie<br />
• Rücküberweisung an koordinierenden Arzt unter<br />
zeitnaher Weitergabe therapierelevanter<br />
Informationen (strukturierter Therapieplan)
DMP-Vorteile Patient:<br />
• Interdisziplinäre und sektorenübergreifende<br />
Kooperation der Leistungserbringer<br />
• Frühzeitige Diagnostik <strong>auf</strong>grund kontinuierlicher<br />
Betreuung<br />
• Teilnahmemöglichkeit an qualifizierten Schulungen<br />
• individuell abgestimmte Therapieziele<br />
• kassenindividuelle Bonusregelungen
DMP-Vorteile Arzt<br />
• Optimierung der Zusammenarbeit zwischen<br />
Haus-/Kinderarzt und qualifiziertem Arzt<br />
bzw. sonstigen Leistungserbringern<br />
• zusätzliche außerbudgetäre Vergütung<br />
• regelmäßige Feedbackberichte<br />
• steigende Patientenzufriedenheit durch aktive<br />
Einbindung der Patienten/Erziehungsberechtigten<br />
in Behandlungsverl<strong>auf</strong> (Patientenschulungen).
Hausarztzentrierte Versorgung<br />
gemäß § 73b SGB V<br />
Entwicklung Vertragspartner:<br />
• bis 2004 (Vertragsmonopol bei KV)<br />
• 2004 bis 2009 (unterschiedliche Vertragspartner)<br />
• seit 2009 (de facto Monopol des Hausärzteverbandes)<br />
Entwicklung Vertrag<br />
• Bis 2004 („kann“)<br />
• 2004 bis 2009 („soll“)<br />
• Seit 2009 („muss“)
Hausarztzentrierte Versorgung<br />
• Vollversorgungsverträge<br />
• Add-on-Verträge
Ambulanter Bereich aus<br />
rechtlicher und ökonomischer<br />
Sicht<br />
XV. Qualitätsmanagement und<br />
Qualitätssicherung
Qualität und Qualitätssicherung im<br />
ärztlichen Handeln<br />
• Der ethische Aspekt ärztlichen Handelns verpflichtet jeden Arzt<br />
<strong>zur</strong> sachgerechten, d. h. nach dem jeweiligen Stand der<br />
medizinischen Wissenschaft ausgerichteten Versorgung seiner<br />
Patienten<br />
• Der haftungsrechtliche Aspekt geht aus von einer qualifizierten<br />
Behandlung <strong>auf</strong> der Basis der berufsethischen Verpflichtungen<br />
und der Einhaltung bestimmter anerkannter Standards und<br />
Normen<br />
• Der sozialversicherungsrechtliche Aspekt, der für <strong>die</strong> Leistungen<br />
im Rahmen der GKV Qualität und Qualitätssicherung ausdrücklich<br />
fordert<br />
• Der Aspekt der ökonomischen Praxisführung, da auch<br />
Wirtschaft-lichkeit in der Betriebsführung <strong>auf</strong> Handlungsqualität<br />
beruht
Dimensionen der Qualität<br />
• Strukturqualität<br />
• Prozessqualität<br />
• Ergebnisqualität
Gesetzliche Vorgaben für <strong>die</strong> GKV<br />
• neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden dürfen in der vertragsärztlichen<br />
Versorgung (auch vertragszahnärztlichen Versorgung) nur dann zu Lasten der GKV<br />
erbracht werden, wenn der Gemeinsame Bundesausschuss hierzu eine<br />
entsprechende Empfehlung in den Richtlinien erlassen hat.<br />
• Bereits im Leistungsbereich der GKV erbrachte Leistungen sind vom<br />
Bundesausschuss im gleichen Sinne zu überprüfen.<br />
• Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und <strong>die</strong> KBV können für Leistungen,<br />
<strong>die</strong> wegen der Anforderungen an ihre Ausführungen oder wegen der Neuheit des<br />
Verfahrens besondere Kenntnisse und<br />
Erfahrungen sowie einer besonderen Praxisausstattung bedürfen, in Vereinbarungen<br />
<strong>die</strong> Voraussetzungen für <strong>die</strong> Ausführung und Abrechnung <strong>die</strong>ser Leistungen regeln<br />
(Strukturqualität)<br />
• Die KBV bestimmt durch Richtlinien Verfahren und Maßnahmen <strong>zur</strong><br />
Qualitätssicherung.<br />
• Die KVen prüfen <strong>die</strong> Qualität der erbrachten Leistungen im Einzelfall durch<br />
Stichproben (Auswahl, Umfang und Verfahren werden im Benehmen mit den<br />
Krankenkassen geregelt).
Auswahl von<br />
Qualitätssicherungsbereichen