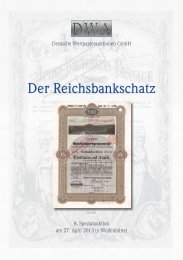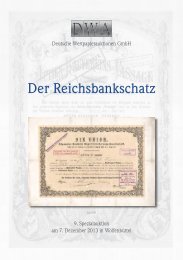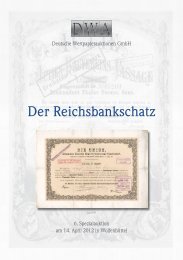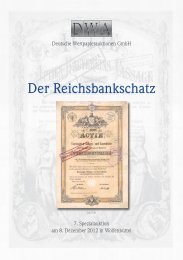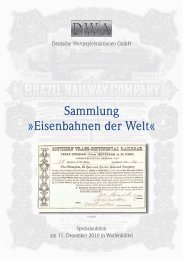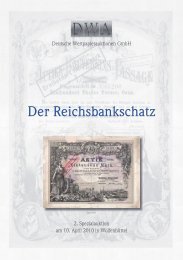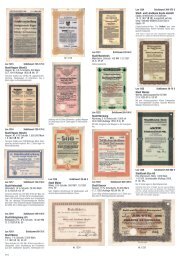Teil 3 - Deutschewertpapierauktionen.de
Teil 3 - Deutschewertpapierauktionen.de
Teil 3 - Deutschewertpapierauktionen.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Los 672 Schätzwert 60-120 €<br />
Kammgarnspinnerei Sche<strong>de</strong>witz AG<br />
Sche<strong>de</strong>witz b. Zwickau, Aktie 1.000 Mark<br />
25.3.1899 . Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 2400,<br />
R 5) EF<br />
Gründung 1839, AG seit 1899. Aufgrund schwerer Bergschä<strong>de</strong>n<br />
durch unter <strong>de</strong>r Fabrik liegen<strong>de</strong> Kohlenbergwerke wur<strong>de</strong><br />
das Werk 1921 nach Silberstraße verlegt. Die Fabrikgebäu<strong>de</strong> in<br />
Sche<strong>de</strong>witz wur<strong>de</strong>n an die Hataz Kleinautomobilwerke AG,<br />
Zwickau, verkauft. 1924 Neubau einer Wollkämmerei. 1929<br />
Fusion mit <strong>de</strong>r Kammgarnspinnerei Silberstraße. Börsennotiz<br />
Berlin und Leipzig. 1946 enteignet, 1954 Sitzverlegung nach<br />
Hamburg. Zuletzt nur noch Verwaltung von Restvermögen, die<br />
HV vom 10.8.1963 beschloss die Auflösung <strong>de</strong>r Gesellschaft.<br />
Los 673 Schätzwert 225-300 €<br />
Kammgarnspinnerei Stöhr & Co. AG<br />
Leipzig, Aktie 20 RM 9.8.1932 (Auflage<br />
7500, R 10) EF<br />
Die 20-RM-Aktien wur<strong>de</strong>n bereits 1936 wie<strong>de</strong>r<br />
eingezogen und vernichtet, lediglich 5 schon altentwertete<br />
Stück blieben im Reichsbankschatz erhalten.<br />
Traditionsreiches Textilunternehmen, Gründung 1880 als<br />
KGaA, AG seit 1911. Eigene Werke in Plagwitz, Markkleeberg<br />
und Wüstegiersdorf. außer<strong>de</strong>m mit Mehrheit beteiligt an: Leipziger<br />
Wollkämmerei AG; C.F. Solbrig Söhne AG, Chemnitz; Elberfel<strong>de</strong>r<br />
Textilwerke AG; Ohligser Leinen- und Baumwollweberei<br />
AG; Konkordia Spinnerei Stöhr & Co. KG, Politz (Su<strong>de</strong>tengau);<br />
Vaterländische Kammgarnspinnerei und Weberei AG, Budapest;<br />
Corona Kammgarnspinnerei R.A.G. Wei<strong>de</strong>nbach (Rumänien).<br />
Bereits 1889 Gründung <strong>de</strong>r Botany Worsted Mills in<br />
New York, welche Kämmerei, Kammgarn- und Streichgarnspinnerei<br />
sowie Herren- und Damenstoffweberei umfasste und sich<br />
zur größten Kammgarnspinnerei <strong>de</strong>r USA entwickelte. 1918<br />
wur<strong>de</strong> diese Beteiligung von <strong>de</strong>n Amerikanern sequestiert,<br />
1923 unbescha<strong>de</strong>t <strong>de</strong>r Freigabefor<strong>de</strong>rungen aus <strong>de</strong>n Hän<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>r Alian Property Custodian zurückerworben. Nach 1945 Sitzverlegung<br />
nach Mönchengladbach, die Stöhr & Co. AG ist bis<br />
heute börsennotiert.<br />
Los 674 Schätzwert 25-75 €<br />
Kammgarnwerke AG<br />
Eupen, Aktie 100 RM Mai 1942 (Auflage<br />
54000, R 5) EF<br />
Zur napoleonischen Zeit am Beginn <strong>de</strong>s 19. Jh. entstand in Eupen<br />
ein praktisch neuer Stadtteil mit damals hochmo<strong>de</strong>rnen<br />
Textilbetrieben. Bereits 1806 wur<strong>de</strong> bei Scheibler die erste mechanische<br />
Spinnmaschine aufgestellt. Bald waren 7.000 <strong>de</strong>r<br />
knapp 10.000 Einwohner von Eupen in <strong>de</strong>r Textilindustrie beschäftigt.<br />
1906 grün<strong>de</strong>ten die <strong>de</strong>utschen Tuchfabrikanten <strong>de</strong>r<br />
Stadt unter Übernahme <strong>de</strong>r Firma Gülcher & von Grand Ry<br />
GmbH die Kammgarnwerke AG, die die Tuchfabriken fortan mit<br />
Garn belieferte. 1932 wur<strong>de</strong> nach <strong>de</strong>m Zusammenbruch <strong>de</strong>s<br />
Nordwolle-Konzerns zu<strong>de</strong>m <strong>de</strong>ssen Tuchfabrik in Langensalza<br />
übernommen (1943 wur<strong>de</strong>n dort alle Textilmaschinen <strong>de</strong>montiert<br />
und und die Fabrik in ein Zweigwerk <strong>de</strong>r Junkers Flugzeugwerke<br />
AG verwan<strong>de</strong>lt; 1968 wur<strong>de</strong> die Kammgarnwerk<br />
Langensalza GmbH unter Bruch entsprechen<strong>de</strong>r Vereinbarungen<br />
mit Belgien in einen VEB umgewan<strong>de</strong>lt; 1992 wur<strong>de</strong>n die<br />
belgischen Alteigentümer dafür mit mehreren Mio. DM entschädigt).<br />
Nach Einstellung <strong>de</strong>r Textilproduktion übernahm die<br />
1909 gegrün<strong>de</strong>te Kabel- und Gummiwerke Eupen GmbH (heute:<br />
Kabelwerk Eupen AG) 1956 die Fabrik für ihre neu gegrün<strong>de</strong>te<br />
Kunststoffrohr-Abteilung.<br />
Los 675 Schätzwert 25-50 €<br />
Kar<strong>de</strong>x AG für Büroartikel<br />
Saarbrücken, Aktie (Interimsschein) 1.000<br />
RM 1.10.1939 (Auflage 250, R 5) EF<br />
Gründung 1922. Herstellung, Vertrieb von und Han<strong>de</strong>l mit Büroartikeln,<br />
insbeson<strong>de</strong>re mit Waren, welche beim Patentamt<br />
mit <strong>de</strong>m Warenzeichen “Kar<strong>de</strong>x” geschützt sind. Verkaufsagen-<br />
Nr. 670 Nr. 673<br />
turen in ganz Europa. Heute ist die Kar<strong>de</strong>x Organisationssysteme<br />
GmbH, Kronberg einer <strong>de</strong>r führen<strong>de</strong>n Anbieter von automatischen<br />
Bereitstellungssystemen für Lager, Betrieb, Verwaltung.<br />
Los 676 Schätzwert 40-60 €<br />
Kathreiner GmbH<br />
Berlin, 8 % <strong>Teil</strong>schuldv. 1.000 RM<br />
1.6.1930 (Auflage 3000, R 8) EF-VF<br />
Sehr schöner G&D-Druck mit Abb. <strong>de</strong>s 1927/28<br />
gebauten Kathreiner-Hochhauses. Es ist eine <strong>de</strong>r<br />
wichtigsten Arbeiten <strong>de</strong>s berühmten Architekten<br />
Bruno Paul (1874-1968), <strong>de</strong>r zuerst beim “Simplicissimus”<br />
als Illustrator arbeitete. Neben <strong>de</strong>r Architektur<br />
war später <strong>de</strong>r Möbelbau eines seiner Lieblingsgebiete<br />
(Mitbegrün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Deutschen Werkstätten<br />
in Hellerau), seit 1907 war er Direktor <strong>de</strong>r<br />
Unterichtsanstalt <strong>de</strong>s Kunstgewerbemuseums, seit<br />
1924 <strong>de</strong>r heutigen Hochschule für bil<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Künste<br />
in Berlin. Paul war außer<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Lehrer <strong>de</strong>s noch<br />
berühmter gewor<strong>de</strong>nen Mies van <strong>de</strong>r Rohe.<br />
Die Firma wur<strong>de</strong> 1829 von Franz Kathreiner in München als<br />
Spezerei- und Ölkleinhan<strong>de</strong>lsgeschäft gegrün<strong>de</strong>t. 1876 Umwandlung<br />
in eine oHG. 1897 Gründung <strong>de</strong>r Kathreiner’s Nachfolger<br />
GmbH. 1928 Gründung <strong>de</strong>r AG, gleichzeitig Einlage <strong>de</strong>r<br />
Kathra GmbH und <strong>de</strong>r Kathra-Teigwarenfabrik Franz Kathreiners<br />
Nachfolger GmbH (Obst- und Gemüsekonserven, Teigwaren).<br />
1971 Verlegung <strong>de</strong>s Betriebes nach Poing (Kreis Ebersberg),<br />
1974 Firmenän<strong>de</strong>rung in Kathreiner AG. 1977 Übernahme<br />
<strong>de</strong>r bisher von <strong>de</strong>r KATRA-Supermärkte GmbH betriebenen<br />
19 Supermärkte, 1978 Übernahme <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>r H.L. Krone<br />
GmbH betriebenen 13 Warenhäuser und und 9 Supermärkte.<br />
Los 677 Schätzwert 50-100 €<br />
Kaufmännischer Verein zu Chemnitz<br />
Chemnitz, Schuldv. 25 Mark 15.7.1907<br />
(R 6) EF<br />
Schönes Kleinformat im Historismus-Stil.<br />
Die kaufmännischen Vereine entstan<strong>de</strong>n überall in Deutschland<br />
als Vereinigung von Handlungsgehilfen zum Zwecke <strong>de</strong>r Fort-<br />
bildung, <strong>de</strong>r Hebung kaufmännischen Wissens und <strong>de</strong>r materiellen<br />
För<strong>de</strong>rung ihrer Mitglie<strong>de</strong>r durch Stellenvermittlung, Unterstützung<br />
und Kranken- und Pensionskassen. Die ältesten<br />
Kaufmännischen Vereine in Deutschland waren: Verein junger<br />
Kaufleute in Stettin (gegrün<strong>de</strong>t 1687), Handlungsdiener-Hilfskasse<br />
Nürnberg (1742), Kaufmännischer Verein Union in<br />
Braunschweig (1818).<br />
Los 678 Schätzwert 30-80 €<br />
Keramag Keramische Werke AG<br />
Meiningen, Aktie 1.000 Mark 25.7.1919<br />
(Auflage 4400, R 2) EF<br />
Großformatig. Großes Firmensignet “KWA” im Unterdruck.<br />
Gründung 1917 als Keramische Werke AG. 1918 Än<strong>de</strong>rung in<br />
“Keramag” Keramische Werke AG. 1926 kaufte die britische<br />
Walker-Familie die Mehrheit <strong>de</strong>r Aktien. 1935 Sitzverlegung<br />
von Meiningen nach Bonn. 1968 Übernahme <strong>de</strong>r Aktienmehrheit<br />
durch ALLIA S.A. Paris. 1998 Sitzverlegung nach Ratingen.<br />
Los 679 Schätzwert 75-125 €<br />
Kerkerbachbahn AG<br />
Kerkerbach, Post Runkel a.d. Lahn, Aktie<br />
400 RM Sept. 1925 (Auflage 4894, R 6)<br />
EF-VF<br />
Gründung 1884. 1000-mm-Schmalspurbahn Dehrn-Kerkerbach-<br />
Heckholzhausen-Hintermeilingen-Mengerskirchen, <strong>de</strong>r Abschnitt<br />
Dehrn-Kerkerbach war durch ein drittes Gleis auch in Normalspur<br />
befahrbar. Anschluss an die Deutsche Reichsbahn in Kerkerbach.<br />
Betriebseröffnung 1886. Sitz bis 1906 in Christianshütte, dann in<br />
Kerkerbach (Oberlahnkreis). Eine reine Güterbahn, wie schon <strong>de</strong>r<br />
Fuhrpark zeigt: 4 Lokomotiven bewegten 2 Personen-, aber bis zu<br />
100 Güterwagen. 1946 Überführung in Gemeineigentum (im<br />
Westen eine Beson<strong>de</strong>rheit <strong>de</strong>r hessischen Lan<strong>de</strong>sverfassung,<br />
1953 wur<strong>de</strong> die Sozialisierung wie<strong>de</strong>r aufgehoben). 1974 Verkauf<br />
<strong>de</strong>s Bahnbetriebes an die Bun<strong>de</strong>sbahn, danach nur noch Vermögensverwaltung.<br />
Sitzverlegungen nach Frankfurt (1977), Hei<strong>de</strong>lberg<br />
(1979) und Mannheim (1980). Das “zweite Leben” als Bauträger-Gesellschaft,<br />
angefacht durch einen beispiellosen Boom<br />
bei Steuersparmo<strong>de</strong>llen, war aber nur von kurzer Dauer: In einem<br />
spektakulären Konkurs ging die Kerkerbachbahn 1984 krachend<br />
unter, <strong>de</strong>r letzte Großaktionär und Vorstand Tom Sieger atmete<br />
<strong>de</strong>swegen einige Jahre gesiebte Luft.<br />
Los 680 Schätzwert 200-250 €<br />
Ketteler-Gesellschaft e.V.<br />
Bad Nauheim, 7 % Obl. 1.000 fl. 1.5.1929<br />
(Auflage nur 50 Stück, R 10) VF-<br />
Katholische Stiftung, benannt nach Wilhelm Emanuel von Ketteler,<br />
<strong>de</strong>r als <strong>de</strong>r Begrün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r katholischen Soziallehre gilt, tätig<br />
als Bischof von Mainz. Er wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Arbeiterbischof genannt.<br />
Los 681 Schätzwert 75-150 €<br />
Kieler Verkehrs-AG<br />
Kiel, Aktie Lit. A 100 RM Mai 1938<br />
(Auflage 1800, R 5) EF<br />
Gründung 1905 als Hafenrundfahrt-AG. 1937 Übernahme <strong>de</strong>r<br />
“Holsteinische Autobus GmbH” und Umfirmierung wie oben.<br />
Nr. 680<br />
1939 Verschmelzung mit <strong>de</strong>r “Neuen Dampfer-Compagnie”,<br />
1942 Übernahme <strong>de</strong>r “Kieler Straßenbahn” mit ihrem 40 km<br />
langen Streckennetz, die mit zu <strong>de</strong>r Zeit rd. 700 Mitarbeitern<br />
<strong>de</strong>r größte Betriebsteil wur<strong>de</strong>. Auf <strong>de</strong>n 94 km langen Omnibusund<br />
Obus-Linien arbeiteten rd. 250 Leute, in <strong>de</strong>r Fahrgastschifffahrt<br />
150 Leute. Außer<strong>de</strong>m an <strong>de</strong>r 1951 gegrün<strong>de</strong>ten Kieler<br />
Ree<strong>de</strong>rei GmbH zu 50 % beteiligt, die <strong>de</strong>n Personenverkehr<br />
Kiel-Korsör (Dänemark) betrieb. Börsennotiz Freiverkehr Hamburg,<br />
Großaktionäre waren die Stadt Kiel (Mehrheit) und früher<br />
auch die Alloka. 2008 in eine GmbH umgewan<strong>de</strong>lt wor<strong>de</strong>n.<br />
Los 682 Schätzwert 20-40 €<br />
Klein, Schanzlin & Becker AG<br />
Frankenthal, 4,5 % Schuldv. 500 RM Nov.<br />
1943 (Auflage 800, R 4) EF<br />
Gründung 1871 als Armaturenfabrik. In <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Jahren<br />
wur<strong>de</strong> das Produktionsprogramm um Dampfmaschinen, Pumpen,<br />
Filterpressen und Kompressoren ergänzt. Seit 1887 AG.<br />
1924-34 Übernahme von Zweigbetrieben in Homburg/Saar,<br />
Nürnberg, Pegnitz, Oschersleben/Bo<strong>de</strong>, Bremen und Leipzig.<br />
1988 Umfirmierung in KSB AG. Mit 35 Produktionsstätten in 19<br />
Län<strong>de</strong>rn heute einer <strong>de</strong>r größten Pumpenhersteller <strong>de</strong>r Welt.<br />
Los 683 Schätzwert 60-120 €<br />
Kleinbahn<br />
Horka-Rothenburg-Priebus AG<br />
Rothenburg O/L., Aktie 100 RM<br />
13.6.1929 (Auflage 5965, R 3) EF<br />
Gründung am 24.1.1907, eingetragen am 30.3.1907. Firma<br />
ab 7.7.1939: Kleinbahn Wehkirch-Rothenburg-Priebus. Strekkenlänge<br />
25,7 km (1933), Spurweite 1.435 mm, Bahnbetrieb<br />
ab 15.12.1907. Die Strecke wur<strong>de</strong> bis zur Wie<strong>de</strong>rvereinigung<br />
als militärische Umgehungsbahn durch NVA und die Sowjetarmee<br />
genutzt.<br />
63
Los 684 Schätzwert 100-250 €<br />
Kleinbahn-AG Heu<strong>de</strong>ber-Mattierzoll<br />
Halberstadt, Aktie Lit. A 1.000 Mark<br />
1.5.1899. Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 565, R 4)<br />
UNC-EF<br />
Das nördliche Harzvorland mit seinen Bo<strong>de</strong>nschätzen (Kalk, Kali,<br />
Braunkohle) und fruchtbaren Bö<strong>de</strong>n (Zuckerrüben, Getrei<strong>de</strong>)<br />
war einst von einem dichten Schienennetz durchzogen, an <strong>de</strong>m<br />
Staats- wie Privatbahnen gleichermaßen Anteil hatten. Die<br />
KHM war eine normalspurige 20,3 km lange Nebenbahn von<br />
Heu<strong>de</strong>ber über Mulmke-Zilly-Dar<strong>de</strong>sheim-Deersaheim-Hessen-Veltheim<br />
nach Mattierzoll. Grün<strong>de</strong>r waren <strong>de</strong>r Staat Preußen,<br />
die Provinz Sachsen, <strong>de</strong>r Landkreis Halberstadt, die Domäne<br />
Mulmke, die Actienzuckerfabrik Hessen und Lenz & Co.<br />
(letztere führten <strong>de</strong>n Bau aus und übernahmen nach Eröffnung<br />
<strong>de</strong>r Bahn am 1.9.1898 zunächst die Betriebsführung). 30 Bedienstete<br />
ließen 3 Lokomotiven, 3 Personen- und 20 Güterwagen<br />
durch die westlichen Ausläufer <strong>de</strong>r Mag<strong>de</strong>burger Bör<strong>de</strong><br />
zuckeln. Im Mattierzoll traf sich die “KHM” mit <strong>de</strong>r von Westen<br />
kommen<strong>de</strong>n Strecke BS-Gliesmaro<strong>de</strong>-Schapen-Rautheim-Hötzum-Salzdahlum-Ahlum-Groß<br />
Denkte-Wittmar-Remlingen-<br />
Semmenstedt-Winnigstedt-Mattierzoll <strong>de</strong>r Braunschweig-<br />
Schöninger Eisenbahn (im Volksmund “Bimmel-Lutjen” genannt).<br />
Sitzverlegungen 1924 nach Hessen (Kr. Wernigero<strong>de</strong>)<br />
und 1931 nach Merseburg (wo dann die Kleinbahnabteilung<br />
<strong>de</strong>r Provinzialverwaltung von Sachsen die Vorstandsgeschäfte<br />
führte). 1943 Umfirmierung in Eisenbahn-AG Heu<strong>de</strong>ber-Mattierzoll.<br />
Laut Reichsbahn-Kursbuch 204 k von 1944 verkehrten<br />
auf <strong>de</strong>r Strecke Heu<strong>de</strong>ber-Hessen vier Zugpaare täglich und<br />
auf <strong>de</strong>r Strecke Hessen-Mattierzoll sogar 10 Zugpaare. Ein beson<strong>de</strong>rs<br />
eindrucksvolles Lehrstück <strong>de</strong>utscher Nachkriegsgeschichte:<br />
Das in die Westzone führen<strong>de</strong> letzte Stück bis Mattierzoll<br />
wur<strong>de</strong> gleich 1945 stillgelegt, die Ostzonen-<strong>Teil</strong>strecke<br />
Heu<strong>de</strong>ber-Hessen 1969. Dennoch wur<strong>de</strong> 1977 <strong>de</strong>r Oberbau<br />
bis Zilly vollständig erneuert, wo im Kriegsfall die vorhan<strong>de</strong>nen<br />
Rampen und die La<strong>de</strong>straße als Entla<strong>de</strong>punkt für Militärfahrzeuge<br />
genutzt wer<strong>de</strong>n sollten. Erst einige Jahre nach <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong><br />
wur<strong>de</strong> 1995 auch diese Reststrecke aufgelassen. Noch<br />
heute quert die Bun<strong>de</strong>sstraße von Wolfenbüttel nach Halber-<br />
stadt die Bahngeleise in Mattierzoll kurz vor <strong>de</strong>r Stelle, wo während<br />
<strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> einer <strong>de</strong>r ersten neuen <strong>de</strong>utsch-<strong>de</strong>utschen<br />
Grenzübergänge entstand. Im Verkehrsmuseum Dres<strong>de</strong>n lebt<br />
die KHM bis heute weiter: Dorthin gelangte 1974 als Museumslok<br />
die 1931 von <strong>de</strong>r Reichsbahn (zuvor Königliche Eisenbahndirektion<br />
Berlin) übernommene und zuletzt 1961 zur<br />
Schleppten<strong>de</strong>rlok umgebaute KHM “2” 89 6009, ursprünglich<br />
aus <strong>de</strong>r preußischen Ten<strong>de</strong>rlokbaureihe T3 mit Achsfolge C n2<br />
(gebaut ab 1882).<br />
Los 685 Schätzwert 75-150 €<br />
Kleinbahn-AG Lüben-Kotzenau<br />
Lüben, Aktie 1.000 Mark 1.7.1921<br />
(Auflage 1304, R 5) EF-VF<br />
Großformat.<br />
Gründung 1914. Bau und Betrieb <strong>de</strong>r normalspurigen Bahn Lüben-Kotzenau<br />
(28 km) nordwestlich von Breslau. 1945 Übernahme<br />
durch die polnische Staatsbahn PKP.<br />
64<br />
Lok Nr. 404 DR 75 6683<br />
Los 686 Schätzwert 150-250 €<br />
Kleinbahn-AG Stendal-Arneburg<br />
Arneburg, Namensaktie Lit. B 300 Mark<br />
10.10.1913 (Kapitalerhöhung für <strong>de</strong>n<br />
Umbau auf Normalspur, Auflage nur 50<br />
Stück, R 7), ausgestellt auf <strong>de</strong>n Packmeister<br />
a.D. Wilhelm Ernst, Arneburg EF-VF<br />
Schöne Jugendstil-Umrahmung.<br />
Gründung 1898 durch <strong>de</strong>n Staat Preußen, die Provinz Sachsen<br />
und <strong>de</strong>n Kreis Stendal. 12,6 km lange Bahn von Stendal nach<br />
Arneburg, eröffnet 1899 in 1.000-mm-Spur, 1913/14 Umspurung<br />
auf Normalspur (1.435 mm). 1924 durch Fusion in <strong>de</strong>r<br />
Stendaler Kleinbahn-AG (vorher Kleinbahn-AG Stendal-Arendsee,<br />
ab 1942 Stendaler Eisenbahn-AG) aufgegangen. 1946<br />
Enteignung und Übernahme durch die Sächsische Provinzbahnen<br />
GmbH, 1948 vom VVB <strong>de</strong>s Verkehrswesens Sachsen-Anhalt<br />
übernommen, ab 1.4.1949 gehörte die Stendaler Eisenbahn<br />
zur Deutschen Reichsbahn. Die Strecke Stendal-Arneburg<br />
wur<strong>de</strong> 1972 für <strong>de</strong>n Gesamtverkehr stillgelegt, aber nicht<br />
für immer: Ein <strong>Teil</strong> <strong>de</strong>r Trasse wur<strong>de</strong> ab 3.1.1977 für die Strekke<br />
Borstel-Nie<strong>de</strong>rgörne benutzt, die als Anschlußbahn für das<br />
nie in Betrieb gegangene Kernkraftwerk Stendal bestimmt war<br />
und bis En<strong>de</strong> 1995 auch Personenverkehr ab Bahnhof Stendal<br />
besaß. Heute ist die Bahn an die Stadt Arneburg verpachtet, sie<br />
wird für Holztransporte zur Zellstoff Stendal GmbH in Nie<strong>de</strong>rgörne<br />
benutzt.<br />
Los 687 Schätzwert 60-120 €<br />
Kleinbahn-AG Stendal-Arneburg<br />
Arneburg, Aktie Lit. A 1.000 Mark<br />
10.10.1913 (Auflage 772, R 3).<br />
Gemeinsame Verbriefung <strong>de</strong>r<br />
Grün<strong>de</strong>remission (472 Stück) und <strong>de</strong>r<br />
Kapitalerhöhung 1913 (300 Stück) zur<br />
Finanzierung <strong>de</strong>r Umspurung EF<br />
I<strong>de</strong>ntische Jugendstil-Gestaltung wie voriges Los.<br />
Los 688 Schätzwert 100-250 €<br />
Kleinbahn-AG Wallwitz-Wettin<br />
Wettin, Aktie 1.000 Mark 3.9.1903.<br />
Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 1040, aber z.T. in<br />
Sammelaktien verbrieft, R 5) EF<br />
Großes farbiges Wettiner Wappen (sogar mit Golddruck),<br />
aparte breite Umrahmung mit Blumenrankwerk<br />
in lila.<br />
Auf <strong>de</strong>r 9,9 km langen normalspurigen Nebenbahn (eröffnet<br />
am 5.7.1903) zuckelten 3 Lokomotiven mit 3 Personen- und<br />
17 Güterwagen hin und her - dafür reichten knapp 20 Mann<br />
Belegschaft. Grün<strong>de</strong>r und Großaktionäre waren <strong>de</strong>r Staat Preußen,<br />
die Provinz Sachsen und <strong>de</strong>r Saalkreis. Seit Anfang <strong>de</strong>r<br />
30er Jahre führte die Kleinbahnabteilung <strong>de</strong>r Provinzialverwaltung<br />
von Sachsen in Merseburg die Vorstandsgeschäfte <strong>de</strong>r<br />
Bahn. Noch 1943 umfirmiert in “Eisenbahn-AG Wallwitz-Wettin”.<br />
1949 in die Deutsche Reichsbahn eingeglie<strong>de</strong>rt. Der Personenverkehr,<br />
<strong>de</strong>r sich schon während <strong>de</strong>r Weltwirtschaftskrise<br />
mehr als gezehntelt hatte (zuletzt wur<strong>de</strong>n nicht einmal mehr<br />
40 Fahrgäste am Tag beför<strong>de</strong>rt) wur<strong>de</strong> bald darauf eingestellt,<br />
<strong>de</strong>r letzte Güterzug rollte 1966 über die Geleise.<br />
Los 689 Schätzwert 10-25 €<br />
Klöckner-Werke AG<br />
Duisburg, 5 % <strong>Teil</strong>schuldv. 500 RM Juli<br />
1939 (Auflage 6000, R 2) EF<br />
Gründung 1897 als Lothringer Hüttenverein Aumetz-Frie<strong>de</strong>,<br />
1903 Umbenennung in Lothringer Hütten- und Bergwerksverein.<br />
1910 Schaffung einer eigenen Kohlebasis durch Erwerb<br />
<strong>de</strong>r Zechen Victor-Ickern in Castrop-Rauxel. 1912 Interessengemeinschaft<br />
mit <strong>de</strong>n Mannstaedt-Werken in Troisdorf und <strong>de</strong>r<br />
Düsseldorfer Eisen- und Drahtindustrie AG, <strong>de</strong>ren Aktienmehrheit<br />
Peter Klöckner inzwischen erworben hatte. Die Werke und<br />
Erzgruben in Lothringen gingen 1918 aufgrund <strong>de</strong>s 1. Weltkrieges<br />
verloren. Die verbliebenen Unternehmen (Hüttenwerk<br />
Haspe, Verarbeitungsbetriebe Troisdorf und Düsseldorf, Werk<br />
Quint bei Trier) faßte Klöckner 1923 in einer einzigen Gesellschaft<br />
als “Klöckner-Werke AG” mit Sitz in Castrop-Rauxel zusammen,<br />
unter Einbeziehung <strong>de</strong>s 1920 erworbenen “Georgs-<br />
Marien-Bergwerks- und Hüttenvereins” in Osnabrück mit <strong>de</strong>r<br />
Zeche Werne. 1938 Sitzverlegung nach Duisburg. 1945 wur<strong>de</strong><br />
die alte Klöckner-Werke AG auf alliierte Anordnung liquidiert,<br />
die Betriebe aber 1952 wie<strong>de</strong>r zusammengefaßt in <strong>de</strong>r “Nordwest<strong>de</strong>utsche<br />
Hütten- und Bergwerksverein AG”, die 1954<br />
wie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n alten Namen “Klöckner-Werke AG” annahm. Im<br />
gleichen Jahr Erwerb <strong>de</strong>r Nord<strong>de</strong>utsche Hütte AG in Bremen<br />
(1959 fusioniert), 1961/62 Errichtung eines neuen Betriebes in<br />
Kehl (Rhein). 1992 Vergleichsverfahren. Gehört heute zum<br />
WCM-Konzern, geblieben sind <strong>de</strong>m früheren Montan-Riesen<br />
nur noch seine Maschinenbau-Aktivitäten (Kunststoff-Maschinen<br />
und Getränkeabfüll-Maschinen).<br />
Los 690 Schätzwert 60-120 €<br />
Klosterbrennerei, Erste Badische Weinund<br />
E<strong>de</strong>lbranntweinbrennerei AG<br />
Emmendingen, Aktie 1.000 RM Dez. 1937<br />
(Auflage 1000, R 5) EF<br />
Gesellschafter <strong>de</strong>r Marabu Brennerei GmbH und <strong>de</strong>r Klosterbrennerei<br />
GmbH in Emmendingen war die jüdische Firma J. M.<br />
Wertheimer & Cie. Im Zuge <strong>de</strong>r Arisierung <strong>de</strong>r Vermögenswerte<br />
dieser Firma wur<strong>de</strong>n 1937 die Brennerei-GmbH-Anteile auf<br />
die zu diesem Zweck neu gegrün<strong>de</strong>te AG übertragen. Die Firmen<br />
produzierten Weinbrän<strong>de</strong>, Schwarzwäl<strong>de</strong>r Kirsch- und<br />
Zwetschenwasser, Himbeergeist und Liköre. Das Restitutionsverfahren<br />
wur<strong>de</strong> 1949 durch Vergleich mit <strong>de</strong>n jüdischen Alteigentümern<br />
abgeschlossen. In <strong>de</strong>n 60er Jahren erscheint Merce<strong>de</strong>s<br />
Bahlsen (aus <strong>de</strong>r Hannoveraner Keks-Dynastie) als<br />
Mehrheitsaktionärin. Mitte <strong>de</strong>r 70er Jahre übernahm die<br />
MAST-JÄGERMEISTER AG aus Wolfenbüttel die Anteile, die Klosterbrennerei<br />
AG trat in Abwicklung, 1976 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Firmensitz<br />
nach Braunschweig verlegt. Die Produkte unter <strong>de</strong>m Markennamen<br />
“Klosterbrennerei” wer<strong>de</strong>n noch heute von <strong>de</strong>r Fa.<br />
Schwarze im westfälischen Oel<strong>de</strong> hergestellt.<br />
Los 691 Schätzwert 25-50 €<br />
Koehlmann-Werke AG<br />
Frankfurt/O<strong>de</strong>r, Aktie 100 RM März 1939<br />
(Auflage 1810, R 3) EF<br />
Gründung 1860 durch Carl August Koehlmann, AG seit 1871<br />
unter <strong>de</strong>r Firma “Stärke-Zuckerfabrik AG vorm. C.A. Koehlmann<br />
& Co.”. Im Werk Frankfurt (O<strong>de</strong>r) Herstellung von Stärkesirup<br />
und Stärkezucker, Stärkefabriken und Kartoffelflockenfabriken<br />
befan<strong>de</strong>n sich in Schnei<strong>de</strong>mühl, Fürstenwal<strong>de</strong> (mit Haferflokkenfabrik),<br />
Wellmitz Kr. Guben (mit Sägewerk), Nechlau bei<br />
Guhrau (mit Flachsaufbereitung), Stolp und Loitz (Peene),<br />
schließlich Braunkohlenbergwerk Grube Humboldt in Spudlow.<br />
Börsennotiz Berlin. Das Fabrikareal “Koehlmannhof” am Kleinen<br />
Hospitalberg war nach <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> eine Industriebrache,<br />
2010 sollten hier dann 25 Mio. € in ein E<strong>de</strong>ka-Center investiert<br />
wer<strong>de</strong>n. Der AG-Mantel wur<strong>de</strong> 1970 nach Berlin (West) verlagert,<br />
1976 erloschen. Nach <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> 1992 Fortsetzung <strong>de</strong>r<br />
Gesellschaft und Nachtragsabwicklung.<br />
Los 692 Schätzwert 25-50 €<br />
Köllmann Werke AG<br />
Leipzig, VZ-Aktie 1.000 RM 1.1.1941<br />
(Auflage 400, R 4) UNC-EF<br />
Gründung 1904 in Leipzig durch Gustav Köllmann. Seit 1907<br />
Zahnrä<strong>de</strong>rfabrik Köllmann GmbH, 1912 in eine AG umgewan<strong>de</strong>lt,<br />
1928 Umfirmierung wie oben. In Leipzig börsennotiert. Die<br />
Fabrik in <strong>de</strong>r Torgauer Str. 74 produzierte mit knapp 500 Mitarbeitern<br />
Zahnrä<strong>de</strong>r, Getriebe für Eisenbahntriebwagen, Hinterachsen<br />
und Wechselgetriebe für die Automobilindustrie sowie<br />
Langfräsmaschinen. 1946 Demontage und Enteignung <strong>de</strong>s<br />
Leipziger Werkes, das in <strong>de</strong>r DDR als VEB Fahrzeuggetriebewerke<br />
Joliot Curio weiterbestand, 1991 als Zahnradwerke<br />
Leipzig GmbH reprivatisiert (seit 1999 Neue Zahnradwerk Leipzig<br />
GmbH). Die AG selbst verlegte ihren Sitz 1949 nach Langenberg/Rhld.<br />
(wo schon seit 1911 die Tochter Köllmann Maschinenbau<br />
GmbH ansässig war) und 1951 nach Düsseldorf.<br />
Einrichtung eines neuen Werkes in Düsseldorf-Heerdt. 1955 Übernahme<br />
durch die Maschinenfabrik Ernst Thielenhaus, die<br />
die Produktion 1964 in einem neuen großen Werk in Wuppertal<br />
konzentrierte. Im Zuge <strong>de</strong>r Neuorganisation <strong>de</strong>r Gruppe<br />
wur<strong>de</strong> die Zahnradfabrik Köllmann GmbH 2002 als Koellmann<br />
Airtec und Koellmann Gear <strong>Teil</strong> <strong>de</strong>r Thielenhaus Technologies<br />
GmbH.<br />
Los 693 Schätzwert 100-150 €<br />
Köllner-Roloff-Werke AG<br />
Leipzig, Aktie 1.000 Mark 10.5.1923<br />
(Format 19 x 26 cm, Auflage insgesamt<br />
6010, R 8) EF-<br />
Gründung 1922 zur Weiterführung <strong>de</strong>r Emil Köllner-Wilh. Roloff-Werke<br />
mbH. Herstellung von Dachpappen und Teerprodukten,<br />
Anlegung und Ausbesserung von geräuschlosen Straßen,<br />
Ausführung von Asphalt-, Pappbedachungs- und Isolierungsarbeiten.<br />
1927 Vergleichsverfahren zur Abwendung <strong>de</strong>s Konkurses,<br />
wobei die Aktionäre leer ausgingen.<br />
Nr. 694
Nr. 695 Nr. 706<br />
Los 694 Schätzwert 100-125 €<br />
Kölner Bürgergesellschaft<br />
Köln, Namensaktie 200 RM 22.4.1932<br />
(Auflage 1080, R 7) EF<br />
Gründung 1863, AG seit 1893. Verwertung und Verwaltung <strong>de</strong>r<br />
Grundstücke Appellhofplatz 28, Burgmauer 31 und Röhrergasse<br />
17a, außer<strong>de</strong>m Betrieb einer Weinhandlung. Die heutigen<br />
Grundstücke Unter Goldschmied / Laurenzplatz 9-17 sind bebaut<br />
mit einem Hotel (Bewirtschaftung 1959 ausgeglie<strong>de</strong>rt in<br />
die Senats Hotel GmbH) nebst Gesellschaftshaus. Bis heute im<br />
Düsseldorfer Freiverkehr börsennotiert.<br />
Los 695 Schätzwert 400-500 €<br />
Kölnische Glas-Versicherungs-AG<br />
Köln a. Rh., Namens-Actie 1.000 Mark<br />
16.4.1901 (Auflage 300, R 10) VF<br />
Von <strong>de</strong>n lediglich 2 im Reichsbankschatz gefun<strong>de</strong>nen<br />
Stücken ist dies das letzte noch verfügbare.<br />
Gründung 1880. Fusionsweise aufgenommen wur<strong>de</strong>n 1924<br />
die Vaterländische Glas-Versicherungs-AG und 1925 die Thüringische<br />
Versicherungsbank AG in Weimar. 1971 auf die Colonia<br />
Versicherung AG verschmolzen.<br />
Los 696 Schätzwert 25-50 €<br />
Kölsch-Fölzer-Werke AG<br />
Siegen, Aktie 300 RM März 1932 (Auflage<br />
10125, R 3) EF<br />
Entstan<strong>de</strong>n durch Fusion <strong>de</strong>r 1862 gegrün<strong>de</strong>ten “Siegen-Lothringer<br />
Werke vorm. H. Fölzer & Söhne AG”, <strong>de</strong>r “Walzengießerei<br />
vorm. Kölsch & Co. AG” in Siegen, <strong>de</strong>r “Heinrich Stähler<br />
oHG” in Wei<strong>de</strong>nau (Sieg) und <strong>de</strong>r “Eiserfel<strong>de</strong>r Hütte AG”, Eiserfeld<br />
(Sieg). 1921 noch Übernahme <strong>de</strong>r “Paul Schütze AG” in<br />
Ludwigshafen, die Anlagen für die chemische Industrie und<br />
Molkereianlagen baute. Hergestellt wur<strong>de</strong>n zuletzt Hüttenwerksanlagen,<br />
Hochöfen, Wasseraufbereitungs- und Abwasserreinigungsanlagen<br />
sowie Offshore-Komponenten für die Ölindustrie.<br />
1983 Konkurs.<br />
Los 697 Schätzwert 100-125 €<br />
König Friedrich August-Hütte<br />
und C. E. Rost & Co. AG<br />
Dölzschen bei Dres<strong>de</strong>n, VZ-Aktie 1.000 RM<br />
Aug. 1932 (Auflage nur 65 Stück, R 6) EF<br />
Nicht entwertet.<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1789 als Hüttenwerk, AG seit 1881. Herstellung von<br />
Gusswaren, Maschinen und Apparaten aller Art. Die Gesellschaft<br />
ist 1922 durch Fusion in <strong>de</strong>n Besitz <strong>de</strong>r Sächsischen<br />
Maschinenfabrik vorm. Rich. Hartmann, Chemnitz, übergegangen<br />
(1928 Rückverwandlung <strong>de</strong>r Hütte in eine eigene AG).<br />
1931 Übernahme <strong>de</strong>s gesamten Betriebes <strong>de</strong>r Dresdner Maschinenfabrik<br />
C. E. Rost & Co. 1934 Erwerb <strong>de</strong>r Gießerei <strong>de</strong>r<br />
Hille-Werke AG, Dres<strong>de</strong>n. Nach Enteignung in <strong>de</strong>r DDR Fortführung<br />
<strong>de</strong>s Werkes als VEB Eisenhammerwerk Dres<strong>de</strong>n-Dölzschen,<br />
Herstellung von Gusserzeugnissen für die Kfz-Produktion.<br />
Nach <strong>de</strong>r Privatisierung 1990 von <strong>de</strong>n ehemaligen Werksangehörigen<br />
von <strong>de</strong>r Treuhand erworben, heute Hersteller von<br />
Gussteilen für <strong>de</strong>n Kanalbau.<br />
Los 698 Schätzwert 150-200 €<br />
Königsbacher Brauerei AG<br />
vorm. Jos. Thillmann<br />
Koblenz, Aktie 1.000 RM 1.2.1928<br />
(Auflage 300, R 7) EF<br />
Gründung 1900 zur Fortführung <strong>de</strong>r schon seit 1689 bestehen<strong>de</strong>n<br />
Bierbrauerei von Jos. Thillmann, zu <strong>de</strong>r neben <strong>de</strong>m 16 ha<br />
großen Brauereiareal direkt am Rhein auch das angrenzen<strong>de</strong><br />
Weingut Königsbach gehört. 1900 Hinzuerwerb <strong>de</strong>r Prümm’schen<br />
Brauerei in Nie<strong>de</strong>rmendig. 1913 Ankauf <strong>de</strong>r Nassauer Union-Brauerei<br />
(1925 mit Ausnahme <strong>de</strong>r Gastwirtschaft und <strong>de</strong>s<br />
Inventars an die Stadt Nassau verkauft), außer<strong>de</strong>m Lohnbrauvertrag<br />
mit <strong>de</strong>r Nassauer Löwenbrauerei (1945 wenige Tage vor<br />
Kriegsen<strong>de</strong> <strong>de</strong>m Erdbo<strong>de</strong>n gleichgemacht). 1937 Beteiligung an<br />
<strong>de</strong>r J. Bubser Brauerei zur Nette in Weissenthurm (durch Bomben<br />
total zerstört). Hinzuerworben wur<strong>de</strong>n die Brauerei Gebr.<br />
Fuchs - Kirchberger Brauhaus, Kirchberg/Hunsrück (1965) und<br />
die Mehrheit an <strong>de</strong>r Hirschbrauerei AG Düsseldorf (1971). 1974<br />
Inbetriebnahme <strong>de</strong>r damals mo<strong>de</strong>rnsten vollautomatischen Faßfüllanlage<br />
in Deutschland. Noch heute bestehen<strong>de</strong> AG.<br />
Los 699 Schätzwert 30-80 €<br />
Königsberger Lagerhaus-AG<br />
Königsberg i.Pr., VZ-Aktie 1.000 Mark<br />
28.7.1920 (Auflage 400, R 5) EF<br />
Sehr <strong>de</strong>korativ mit Wappen und zwei Porträt-Vignetten.<br />
Ohne Lochentwertung.<br />
Gründung 1896 von <strong>de</strong>n vier größten Getrei<strong>de</strong>händlern Königsbergs.<br />
Vor allem russische Getrei<strong>de</strong>-Exporte brachten eine<br />
gute Auslastung; <strong>de</strong>r Getrei<strong>de</strong>speicher direkt am Pregel war<br />
mit einem Fassungsvermögen von 60.000 t <strong>de</strong>r größte Europas.<br />
Börsennotiz Berlin. Letzte Großaktionäre: Deutsche,<br />
Dresdner und Commerzbank.<br />
Los 700 Schätzwert 100-150 €<br />
Königshütter Gaswerk AG<br />
Königshütte O.-S., Aktie 67,50 Zl<br />
10.1.1943 (Ersatzausfertigung, R 7) EF<br />
Hektographierte Ausführung.<br />
Gasversorger <strong>de</strong>r Stadt Königshütte (heute Chorzów) im oberschlesischen<br />
Industrierevier, gegrün<strong>de</strong>t 1920. Die Deutsche<br />
Continental-Gas-Gesellschaft, Dessau war an <strong>de</strong>r AG beteiligt<br />
(1943).<br />
Los 701 Schätzwert 75-150 €<br />
Kohlen-Bahn-AG<br />
Reichenau i.Sa., Aktie 1.000 Mark<br />
10.1.1922 (Auflage 2380, R 4) EF<br />
Gründung 1921 durch einen Bergwerksbesitzer und 5 Fabrikanten<br />
zum Bau <strong>de</strong>r 4 km langen Kohlenbahn Reichenau-Seitendorf<br />
(30 km südlich von Görlitz) in 750-mm-Spur. 8 Mann<br />
Belegschaft bewegten drei Lokomotiven und 45 Kohlenwagen.<br />
Eine Divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong> wur<strong>de</strong> bis zum En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 2. Weltkriegs, in <strong>de</strong>ssen<br />
Folge die Gegend an Polen kam, nie erwirtschaftet. Durch<br />
<strong>de</strong>n Tagebau <strong>de</strong>r Grube Turow hat sich das Gebiet zwischen<br />
Reichenau und Seitendorf inzwischen landschaftlich völlig verän<strong>de</strong>rt.<br />
Los 702 Schätzwert 60-120 €<br />
Kokswerke & Chemische Fabriken AG<br />
Berlin, Aktie 20 RM Juli 1932 (Auflage<br />
50000, R 5) EF<br />
Gründung 1890 als Oberschlesische Kokswerke & Chemische<br />
Fabriken AG, am 30.6.1925 umbenannt wie oben. Am 23.7.1937<br />
Verschmelzung mit <strong>de</strong>r Schering-Kahlbaum AG zur Schering AG.<br />
Bis heute einer <strong>de</strong>r 30 DAX-Werte und einer <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>utendsten<br />
Hersteller von pharmazeutischen Spezialitäten und Substanzen<br />
(am bekanntesten wur<strong>de</strong> “Die Pille”), Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln,<br />
Industriechemikalien uvm. Werke in<br />
Berlin-Wedding, Bergkamen und Wolfenbüttel.<br />
Los 703 Schätzwert 25-50 €<br />
Kollmar & Jourdan AG<br />
Pforzheim, Aktie 100 RM Sept. 1932<br />
(Auflage 6700, R 3) EF<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1898 als “Kollmar & Jourdan AG Uhrkettenfabrik”.<br />
Herstellung von Uhrketten, Uhrgehäusen, Uhrarmbän<strong>de</strong>rn und<br />
Schmuckwaren in Gold, Silber und Doublé. Hauptfabrik in <strong>de</strong>r<br />
Bleichstr. 81 in Pforzheim; die Zweigwerke in Grötzingen, Boxberg<br />
und Neckarbischofsheim wur<strong>de</strong>n 1929/30 in <strong>de</strong>r Weltwirtschaftskrise<br />
geschlossen. 1952/53 wur<strong>de</strong> stolz verkün<strong>de</strong>t<br />
“Trotz 85 % Zerstörung bei <strong>de</strong>r Pforzheimer Katastrophe vom<br />
23.2.1945 Wie<strong>de</strong>raufbau nahezu vollen<strong>de</strong>t. Vom Ausland überallher<br />
Verlangen nach Erzeugnissen mit <strong>de</strong>r Fabrikmarke KJ mit<br />
Pfeil.” Das Wirtschaftswun<strong>de</strong>r währte nicht ewig: 1977 Anschlusskonkurs.<br />
Los 704 Schätzwert 200-400 €<br />
Kommunale Lan<strong>de</strong>sbank in Darmstadt<br />
(Muncipal Bank of the State of Hessen)<br />
Darmstadt, 7 % Gold Bond 500 US-$<br />
1.11.1925 (R 9) VF+<br />
Die Anleihe wur<strong>de</strong> an sich 1956 von <strong>de</strong>r Hessischen<br />
Lan<strong>de</strong>sbank ohne weitere Umschuldung<br />
65
komplett in bar zurückgezahlt. Äußerst seltener<br />
Dollar-Bond; nur 6 Stück wur<strong>de</strong>n im Reichsbankschatz<br />
gefun<strong>de</strong>n. Kleine Sengspur links.<br />
Gegrün<strong>de</strong>t als öffentlich-rechtliches Kreditinstitut im späteren<br />
(ab 1918) Freistaat Hessen-Darmstadt. Mit <strong>de</strong>r Errichtung <strong>de</strong>s<br />
Volksstaats Hessen in <strong>de</strong>r 1940 neu gegrün<strong>de</strong>ten Hessischen<br />
Lan<strong>de</strong>sbank aufgegangen.<br />
Los 705 Schätzwert 40-80 €<br />
Konservenfabrik Joh. Braun AG<br />
Pfed<strong>de</strong>rsheim bei Worms, Aktie 1.000 RM<br />
Juli 1938 (Auflage 260, R 5) EF<br />
Unentwertet.<br />
Gründung 1907 unter Übernahme <strong>de</strong>r seit 1871 bestehen<strong>de</strong>n<br />
Firma Joh. Braun, Konserven und Marmela<strong>de</strong>fabrik, ursprünglich<br />
in Düsseldorf von Johann Braun gegrün<strong>de</strong>t. Dessen Sohn,<br />
Josef Braun, verlegte 1873 die Fabrik nach Mombach bei<br />
Mainz, 1881 von da nach Pfed<strong>de</strong>rsheim bei Worms, wo eine<br />
Malzfabrik erworben wur<strong>de</strong>. 1943 bestan<strong>de</strong>n Werke in Pfed<strong>de</strong>rsheim<br />
und Volkach (Main). Die Produktion in Volkach wur<strong>de</strong><br />
von <strong>de</strong>r Konservenfabrik Joh. Braun GmbH bis 1966 aufrecht<br />
erhalten.<br />
Los 706 Schätzwert 800-1000 €<br />
Kontinentale Öl AG<br />
Berlin, Zwischenschein über nom.<br />
4.500.000 RM auf <strong>de</strong>n Inhaber<br />
auszustellen<strong>de</strong> Stammaktien vom<br />
1.4.1943 (= 5,625 % <strong>de</strong>s Grundkapitals,<br />
ein Unikat, R 12), ausgegeben für die<br />
Reichskreditgesellschaft AG, Berlin VF-F<br />
Maschinenschriftliche<br />
Ausführung,<br />
mit Originalunterschriften<br />
<strong>de</strong>s<br />
Vorstands, u.a.<br />
Karl Blessing<br />
( 1 9 0 0 - 1 9 7 1 ) ,<br />
1937-39 Mitglied<br />
<strong>de</strong>s Reichsbankdirektoriums<br />
und<br />
1958-69 Präsi<strong>de</strong>nt<br />
<strong>de</strong>r DeutschenBun<strong>de</strong>sbank.<br />
Einer <strong>de</strong>r<br />
interessantesten<br />
Los 707 Schätzwert 100-125 €<br />
Korksteinfabrik-AG<br />
vormals Kleiner & Bokmayer<br />
Wien, Aktie 100 RM Dez. 1939 (Auflage<br />
6000, R 8) EF<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1884 als AG für patentierte Korkstein-Fabrikation<br />
und Korksteinbauten vorm. Kleiner & Bokmayer. Werk im nie<strong>de</strong>rösterreichischen<br />
Mödling an <strong>de</strong>r Südbahn. Die Firma erhielt<br />
die Lizenzen für Österreich-Ungarn <strong>de</strong>s Dämmstoffherstellers<br />
Grünzweig & Hartmann in Ludwigshafen a. Rh. Produziert wur-<br />
<strong>de</strong>n “Kabe”-Leichtbaumaterialien und die feuerfesten Materialien<br />
“Thermalit” und “Diatherma”.<br />
Los 708 Schätzwert 30-90 €<br />
Kraftübertragungswerke Rheinfel<strong>de</strong>n<br />
Rheinfel<strong>de</strong>n (Ba<strong>de</strong>n), Aktie 1.000 Mark<br />
Juni 1912 (Auflage 2000, R 5) EF<br />
Faksimile-Unterschrift <strong>de</strong>s Bankiers Carl Fürstenberg<br />
für <strong>de</strong>n AR.<br />
Gründung 1897 zum Bau einer Wasserkraftanlage am Oberrhein.<br />
Die Gesellschaft erlangte großen Ruhm mit <strong>de</strong>r ersten<br />
großtechnischen Verwirklichung <strong>de</strong>r Stromübertragung über<br />
größere Entfernungen. Die Aluminium-Industrie-AG in Neuhausen<br />
kaufte <strong>de</strong>r Gesellschaft für die ganze Dauer <strong>de</strong>r Konzession<br />
gleich die Hälfte ihrer Kapazität ab, weitere Großabnehmer <strong>de</strong>r<br />
chemischen und Textilindustrie sie<strong>de</strong>lten sich an, so dass die<br />
gesamte Kapazität gleich nach Inbetriebnahme <strong>de</strong>s Kraftwerks<br />
ausverkauft war. 1908 wur<strong>de</strong> zusammen mit <strong>de</strong>r Stadt Basel<br />
das Kraftwerk Augst-Wyhlen gebaut. Beteiligungen 1926 am<br />
Rheinwasserkraftwerk Ryburg-Schwörstadt und 1928 beim<br />
Schluchseewerk im Schwarzwald. 1942 Übernahme <strong>de</strong>r Elektrizitätswerk<br />
Zell AG. Weitere Beteiligungen 1965 beim Kernkraftwerk<br />
Obrigheim, 1969 an <strong>de</strong>r Rheinkraftwerk Säckingen<br />
AG und 1973 beim Kernkraftwerk Leibstadt (Schweiz). Mehrheitsaktionär<br />
<strong>de</strong>r bis heute in Berlin, Frankfurt, Zürich und Basel<br />
börsennotierten AG ist die Elektro-Watt AG, Zürich.<br />
Los 710 Schätzwert 20-40 €<br />
Kraftwerk Thüringen AG<br />
Gispersleben, Aktie 1.000 RM Nov. 1942<br />
(Auflage 1300, R 2) EF<br />
Gründung 1901 als Privatunternehmen durch <strong>de</strong>n aus Leipzig<br />
zugezogenen Ingenieur Max Lange. Umwandlung 1907 in eine<br />
GmbH und 1909 in die “Elektrizitätswerk Gispersleben AG”.<br />
1915 Fusion mit <strong>de</strong>r “Elektrizitätswerk Oberweimar Ueberlandzentrale<br />
GmbH”, dabei Umfirmierung wie oben. Neben <strong>de</strong>m<br />
Kohlekraftwerk (das 1918 einen eigenen Gleisanschluß an die<br />
Eisenbahn Erfurt-Nordhausen erhielt) besaß die Ges. auch eine<br />
kleine Wasserkraftanlage. Über 1200 km Hochspannungsleitungen<br />
wur<strong>de</strong>n die Überlandzentrale Saaletal GmbH in Saalfeld,<br />
die Städte Ilmenau, Arnstadt, Weimar und Sömmerda und<br />
Los 709 Schätzwert 75-150 €<br />
Kraftwerk Reckingen AG<br />
Reckingen, 4,5 % Obl. 1.000 Fr.<br />
14.10.1930 (Auflage 15000, R 8) EF<br />
Gründung 1930 je zur Hälfte durch die Lonza Elektrizitätswerke<br />
und Chemische Fabriken AG in Basel und <strong>de</strong>ren <strong>de</strong>utsche<br />
Tochter Lonza-Werke GmbH in Weil am Rhein. Das Rheinkraftwerk<br />
Reckingen wur<strong>de</strong> 1938/41 fertiggestellt. Heutige Aktionäre<br />
sind zu 50 % die EnBW, zu 30 % die AEW Energie AG und<br />
zu 20 % die schweizerische Nordostkraftwerke, bei <strong>de</strong>r auch<br />
Karl Blessing (1900 - 1971) Autographen aus die Betriebsführung liegt.<br />
Straßenbahnhaltestelle in Gera um 1893<br />
<strong>de</strong>m Reichsbankschatz,<br />
dort ein Einzelstück gewesen. Oberfläche<br />
teils verstaubt, mit ein paar Rostspuren.<br />
Gegrün<strong>de</strong>t im März 1941, ausgestattet mit einem auf 99 Jahre<br />
ausgelegten Monopol für ausschließliche Gewinnung, Verarbeitung<br />
und Han<strong>de</strong>l mit Mineralölerzeugnissen in <strong>de</strong>n vom<br />
Deutschen Reich besetzten Gebieten. Am Kapital von 80 Mio.<br />
RM beteiligten sich mit Namensaktien (mit Mehrfachstimmrecht)<br />
die reichseigene, extra zu diesem Zweck gegrün<strong>de</strong>te Borussia<br />
GmbH (30 Mio.), die Preussag (6 Mio.), die Deutsche Erdöl<br />
AG, die Gewerkschaft Elwerath, die Wintershall AG und die<br />
I. G. Farben AG (je 3 Mio.) und die Braunkohle-Benzin AG (2<br />
Mio.) und mit Inhaberaktien (einfaches Stimmrecht) die Deutsche<br />
Bank und die Dresdner Bank (je 10,5 Mio.) sowie die<br />
Reichs-Kredit-Gesellschaft und die Berliner Han<strong>de</strong>ls-Gesellschaft<br />
(je 4,5 Mio.). Im Aufsichtsrat saßen u.a. <strong>de</strong>r Reichswirtschaftsminister<br />
Walther Funk, Hermann J. Abs, Karl Rasche<br />
(Dresdner Bank), August Rosterg (Wintershall)und Carl Schirner<br />
(Deutsche Erdöl-AG). Erste Erwerbungen waren die rumänischen<br />
Erdölfirmen Concordia und Columbia Oil aus französischem<br />
bzw. belgischen Besitz. Außer<strong>de</strong>m verhan<strong>de</strong>lte man mit<br />
<strong>de</strong>r US-amerikanischen Standard Oil über <strong>de</strong>ren ungarische<br />
Petroleumfel<strong>de</strong>r. Für die Übernahme <strong>de</strong>r Erdölquellen im Kaukasus-Gebiet<br />
wur<strong>de</strong> im Aug. 1941 die Tochterfirma Ost Öl<br />
GmbH gegrün<strong>de</strong>t. Der Erwerb von Bohrgeräten, Fahrzeugen<br />
und an<strong>de</strong>ren Betriebsmitteln für 16 Mio. RM zahlte sich hier allerdings<br />
nie aus: Die Offensive <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Wehrmacht blieb<br />
stecken, und die Erdölquellen <strong>de</strong>s Kaukasus kamen nie in <strong>de</strong>utsche<br />
Hand. Für die Inbesitznahme <strong>de</strong>r Erdölanlagen bestan<strong>de</strong>n<br />
als Beuteerfassungstrupps spezielle Wehrmachtseinheiten, so<br />
das Mineralölkommando Nord, das Mineralölkommando Süd<br />
und das Mineralölkommando K für <strong>de</strong>n Kaukasus.<br />
66<br />
Nr. 709<br />
Nr. 711 Nr. 713<br />
über 300 kleinerei Gemein<strong>de</strong>n mit Strom beliefert. Börsennotiz<br />
Berlin und München; Großaktionär war bis in die 30er Jahre<br />
die Elektrizitäts-AG vorm. Schuckert & Co. in Nürnberg (Siemens-Konzern),<br />
später die Thüringenwerk AG in Weimar (33,7<br />
%), die Elikraft AG in Berlin (26,7 %) und die Thür. Elektrizitätsund<br />
Gas-Werke AG in Apolda (27,5 %).<br />
Los 711 Schätzwert 500-625 €<br />
Kraftwerk und Straßenbahn Gera AG<br />
Gera, Aktie (Interims-Schein) 127 x 1.000<br />
RM 20.6.1937 für die AG Sächsische<br />
Werke in Dres<strong>de</strong>n (<strong>de</strong>r ASW-Anteil von 66<br />
% war in einer Urkun<strong>de</strong> mit 50 % sowie<br />
6 “kleineren” Sammelurkun<strong>de</strong>n verbrieft,<br />
R 9) UNC-EF<br />
Einfacher Druck, mit Originalunterschriften. Nur 2<br />
Stück dieses Nominals lagen im Reichsbankschatz.<br />
Die 1892 in 1.000-mm-Spur eröffnete Geraer Straßenbahn ist<br />
nach <strong>de</strong>r Hallenser Straßenbahn die zweitälteste noch heute existieren<strong>de</strong><br />
elektrische Straßenbahn in Deutschland. Gebaut und<br />
betrieben wur<strong>de</strong> sie ursprünglich von <strong>de</strong>r Geraer Straßenbahn-AG<br />
(seit 1911 Geraer Elektrizitätswerk- und Straßenbahn-AG), <strong>de</strong>ren<br />
Konzession von 1891 bis 1951 lief. Eine Kaufabsicht hatte nach
<strong>de</strong>r alten Konzession die Stadt Gera innerhalb von 36 Jahren zu<br />
erklären, was wohl <strong>de</strong>r Grund ist, daß ausgerechnet 1927 die<br />
Konzession nebst E-Werk und Straßenbahn auf diese neue AG<br />
(gegrün<strong>de</strong>t 1925 in Dres<strong>de</strong>n als Gasversorgung Westsachsen AG)<br />
überging. Aktionäre waren hier zu 64 % die lan<strong>de</strong>seigene AG<br />
Sächsische Werke in Dres<strong>de</strong>n und zu 36 % die Stadt Gera. Die<br />
Straßenbahn hatte anfangs 3 Linien, die sich in <strong>de</strong>r Heinrichstraße<br />
trafen, bis heute die zentrale Umsteigestelle <strong>de</strong>s Geraer Nahverkehrs.<br />
Bereits 1892 wur<strong>de</strong> über ein Gütergleis <strong>de</strong>r Preußische<br />
Bahnhof (heute <strong>de</strong>r Hauptbahnhof) angeschlossen. Güterwagen<br />
wur<strong>de</strong>n von hier auf Rollböcken zu <strong>de</strong>n Fabriken in Gleisnähe gefahren,<br />
die Traktion übernahmen Dampflokomotiven. 1896 folgte<br />
ein Gütergleis zum Sächsischen Bahnhof (heute Südbahnhof).<br />
1901 wur<strong>de</strong> im Sü<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Stadt bei Pforten <strong>de</strong>r Bahnhof <strong>de</strong>r Gera-Meuselwitz-Wuitzer<br />
Eisenbahn-AG eröffnet und mit <strong>de</strong>m Straßenbahn<strong>de</strong>pot<br />
Lin<strong>de</strong>nthal verbun<strong>de</strong>n, so daß fortan auch Braunkohle<br />
über die Straßenbahngeleise zu <strong>de</strong>n Fabriken transportiert<br />
wur<strong>de</strong>. Erst 1963 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Güterverkehr vorläufig eingestellt,<br />
weil die letzte dafür noch vorhan<strong>de</strong>ne Lokomotive ihren Geist aufgab,<br />
und 1969 zerstörte ein schweres Unwetter nicht nur die Gera-Meuselwitz-Wuitzer<br />
Eisenbahn, son<strong>de</strong>rn auch die Gleisanlagen<br />
im Pfortener Bahnhof, die danach nicht wie<strong>de</strong>r aufgebaut wur<strong>de</strong>n.<br />
Dennoch wur<strong>de</strong> für kurze Zeit 1982-85 <strong>de</strong>r Güterverkehr <strong>de</strong>r Geraer<br />
Straßenbahn noch einmal aufgenommen. Ein nettes Detail<br />
am Ran<strong>de</strong>: Als 1984 die letzte eingleisige Strecke auf <strong>de</strong>r Sorge<br />
(<strong>de</strong>r Hauptfußgängerzone) zwecks zweigleisigem Ausbau in die<br />
parallel verlaufen<strong>de</strong> Straße “Hinter <strong>de</strong>r Mauer” verlegt wur<strong>de</strong>, benannte<br />
man diese zur Vermeidung politischer Assoziationen um,<br />
sie hieß dann “Am Leumnitzer Tor”. Nach <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> wur<strong>de</strong> die<br />
Straßenbahn umfassend mo<strong>de</strong>rnisiert und umgestaltet, aktuell<br />
wird sogar <strong>de</strong>r Bau einer vierten Linie geplant.<br />
Los 712 Schätzwert 50-80 €<br />
Kreditanstalt <strong>de</strong>r Deutschen eGmbH<br />
Reichenberg/Prag, Sammel-Namen-Anteil<br />
Reihe D 10 x 100 RM 7.12.1940 (R 8) EF<br />
Die 1911 mit Hauptsitz in Prag gegrün<strong>de</strong>te Anstalt entwickelte<br />
sich in <strong>de</strong>r damaligen Tschechoslowakei zum be<strong>de</strong>utendsten<br />
<strong>de</strong>utschen Geldinstitut im böhmisch-mährischen Raum. Mit <strong>de</strong>r<br />
Anglie<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s Su<strong>de</strong>tenlan<strong>de</strong>s an das Deutsche Reich 1928<br />
wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Hauptsitz nach Reichenberg verlegt. Das Institut unterhielt<br />
85 Filialen im Su<strong>de</strong>tenland, in Böhmen und Mähren<br />
(incl. Prag, Budweis, Brünn und Pilsen) , <strong>de</strong>n angrenzen<strong>de</strong>n<br />
Gauen Bayreuth, Nie<strong>de</strong>r-Donau, Ober-Donau und Schlesien sowie<br />
in Zwickau und Zwittau.<br />
Los 713 Schätzwert 500-625 €<br />
Kreis Altenaer Eisenbahn-AG<br />
Lü<strong>de</strong>nscheid, Aktie 2.700 RM 1.3.1943<br />
(R 12), ausgestellt auf das Amt Halver. In<br />
dieser Urkun<strong>de</strong> waren folgen<strong>de</strong> Aktien<br />
zusammengefaßt: 18 Lit. A, 3 Lit. B und 6<br />
Lit. C VF<br />
Originalunterschriften. Unikat aus <strong>de</strong>m Reichsbankschatz.<br />
Zwei Rostfleckchen.<br />
Gründung 1886 in Altena, ab 1905 in Lü<strong>de</strong>nscheid ansässig.<br />
Erste Strecke Altena-Lü<strong>de</strong>nscheid (14,5 km Schmalspur). Bis<br />
1905 wuchs das Streckennetz im Kreis Lü<strong>de</strong>nscheid auf 41<br />
km an, dazu kamen folgen<strong>de</strong> Strecken: Lü<strong>de</strong>nscheid-Augustenthal-Werdohl;<br />
Schalksmühle-Halver; Verbindung Lü<strong>de</strong>nscheid<br />
zum DR-Bahnhof. 1953 Vergleichsverfahren. Strecken<br />
von 1949 bis 1967 bis auf 700 m Restgleis sukzessive stillgelegt.<br />
1976 Umfirmierung in Märkische Eisenbahngesellschaft.<br />
Los 714 Schätzwert 60-120 €<br />
Kreis-Hypothekenbank Lörrach<br />
Lörrach, Ba<strong>de</strong>n, Aktie 100 RM 1.8.1926<br />
(Auflage 5680, R 5) EF-VF<br />
Uralte Regionalbank, gegrün<strong>de</strong>t bereits 1868 durch <strong>de</strong>n Kreisausschuss<br />
<strong>de</strong>s Kreises Lörrach. Börsennotiz: Freiverkehr<br />
Mannheim. 1936 außer<strong>de</strong>m Übernahme eines Reisebüros in<br />
Lörrach. Eine Beteiligung bestand an <strong>de</strong>r AG für Hypothekenverkehr,<br />
Basel. 1953 einer <strong>de</strong>r ersten Bankzusammenbrüche<br />
<strong>de</strong>r jungen Bun<strong>de</strong>srepublik.<br />
Los 715 Schätzwert 100-125 €<br />
Kreiskommunalverband Wolfenbüttel<br />
Wolfenbüttel, 15 % Schuldv. 200.000<br />
Mark 31.7.1923 (Auflage 1500, R 9) EF-<br />
<strong>Teil</strong> einer Anleihe von 500 Mio. M, vermittelt durch<br />
die Braunschweigische Staatsbank. Den rückseitigen<br />
Anleihebedingungen entnehmen wir, dass es<br />
zu <strong>de</strong>r Zeit in Wolfenbüttel noch drei Privatbankhäuser<br />
gab: C. L. Seeliger (heute als einziges übriggeblieben),<br />
A. Fink sowie Carl Fried. Meineke &<br />
Sohn GmbH. Nur 5 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Los 716 Schätzwert 15-30 €<br />
Kreisstadt Plauen i.V.<br />
Plauen i.V., Schuldv. Lit. F 12,50 RM<br />
6.12.1930 (R 4) EF<br />
Ablösungsanleihe.<br />
Los 717 Schätzwert 30-75 €<br />
Krögiser Bank AG<br />
Meißen, Aktie 100 RM 5.7.1937 (Auflage<br />
600, R 4) EF-<br />
Gründung 1863 als Ländlicher Vorschußverein zu Krögis. 1870<br />
in eine AG umgewan<strong>de</strong>lt. Gründungszweck war die Sammlung<br />
<strong>de</strong>r ländlichen Spargel<strong>de</strong>r, die zur Gewährung gesicherter Hypothekenkredite<br />
verwen<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n sollten. 1918 Sitzverlegung<br />
nach Meißen, 1920 umbenannt in Krögiser Bank.1947 Löschung<br />
<strong>de</strong>r AG im Han<strong>de</strong>lsregister.<br />
Los 718 Schätzwert 25-50 €<br />
Kupferwerk Ilsenburg AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 RM Sept. 1934<br />
(Auflage 1000, R 4) EF<br />
Gründung <strong>de</strong>s Ilsenburger Kupferhammers bereits 1595. 1841<br />
Inbetriebnahme einer wasserbetriebenen Walzhütte für Kupfer<br />
und Blei durch die Industriellenfamilie Hirsch. Gründung <strong>de</strong>r AG<br />
1906 unter Übernahme <strong>de</strong>s Kupferwerks in Ilsenburg am Harz<br />
und <strong>de</strong>s Messingwerks bei Eberswal<strong>de</strong> von <strong>de</strong>r oHG Aron<br />
Hirsch & Sohn in Halberstadt. 1918 fusionsweise Übernahme<br />
<strong>de</strong>r Chemische Fabrik Hönningen und vorm. Messingwerk Reinickendorf<br />
R. Sei<strong>de</strong>l AG in Berlin. 1921 Erwerb <strong>de</strong>r Aktienmehrheit<br />
an <strong>de</strong>r Hüttenwerke C. Wilh. Kayser & Co. AG in Berlin<br />
(heute als Hüttenwerke Kayser AG in Lünen zur Nord<strong>de</strong>utschen<br />
Affinerie gehörig). 1932 spalteten die Großaktionäre<br />
(Deutsche Bank und Dresdner Bank) die Firma auf: Die “alte”<br />
AG wur<strong>de</strong> umbenannt in Berlin-Ilsenburger Metallwerke AG, ihr<br />
verblieb die Kupferhütte Ilsenburg (in <strong>de</strong>r DDR bis zuletzt die<br />
schlimmste Giftschleu<strong>de</strong>r am Fuße <strong>de</strong>s Harzes), die 1934 in die<br />
Kupferwerke Ilsenburg AG ausgegrün<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>. Das Ilsenburger<br />
Werk ist heute eine Produktionsstätte für Grobbleche <strong>de</strong>r<br />
Salzgitter AG. Der damals wesentlich größere <strong>Teil</strong> <strong>de</strong>s Unternehmens,<br />
die Kupfer- und Messingwerke Finow (Mark), wur<strong>de</strong><br />
nach <strong>de</strong>r Betriebsaufspaltung 1934 später als “Finow Kupferund<br />
Messingwerke AG” eine AEG-Tochter, die <strong>de</strong>n Krieg zwar<br />
völlig unbeschädigt überstand, aber 1945 von <strong>de</strong>n Sowjets<br />
komplett <strong>de</strong>montiert und dann in die Luft gesprengt wur<strong>de</strong>.<br />
Los 719 Schätzwert 100-150 €<br />
Kursächsische Braunkohlenwerke AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark Jan. 1922<br />
(Auflage 1500, R 10) EF-VF<br />
Nur 5 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1921, Betrieb <strong>de</strong>r Braunkohlegrube “Präsi<strong>de</strong>nt” bei<br />
Fürstenberg a.O. (nahe <strong>de</strong>m heutigen Eisenhüttenstadt). Nach<br />
<strong>de</strong>m Konkurs 1927 ging aufgrund von Sicherungsübereignungsverträgen<br />
das gesamte Anlagevermögen an <strong>de</strong>n Großaktionär<br />
“Märkische Elektrizitätswerk AG”.<br />
Los 720 Schätzwert 150-300 €<br />
Kyffhäuser Kleinbahn-AG<br />
Kelbra a. Kyffh., Namens-Aktie 400 RM<br />
25.2.1929 (Blankette, R 12) EF<br />
Nicht lochentwertet (RB). Nur diese eine Blankette<br />
lag im Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1913 als Kyffhäuser Kleinbahn-AG, ab 1943 Kyffhäuser<br />
Eisenbahn-AG. Die Bahn mit einer Länge von knapp 30 km<br />
lag in Thüringen, 50 km nördlich von Erfurt und verband die Orte<br />
Berga-Kelbra-Artern. Großaktionäre 1943 waren mit 33 % <strong>de</strong>r<br />
Staat Preußen und mit 33 % die Provinz Sachsen. 1949 Übernahme<br />
durch die Reichsbahn, 1966 fuhr <strong>de</strong>r letzte Personenzug.<br />
Los 721 Schätzwert 15-30 €<br />
Land Braunschweig<br />
Braunschweig, Schuldv. 50 RM 1.11.1927<br />
(R 5) EF-VF<br />
Anleiheablösungsschuld.<br />
Los 722 Schätzwert 15-30 €<br />
Land Thüringen<br />
Weimar, Schuldv. 100 RM 1.2.1928 (R 5)<br />
EF-<br />
Ablösungsanleihe, mit anhängen<strong>de</strong>m Auslosungsschein.<br />
Recht <strong>de</strong>korativ gestaltet.<br />
Nr. 722<br />
Los 723 Schätzwert 20-40 €<br />
Lan<strong>de</strong>sbank und Girozentrale<br />
Danzig-Westpreußen<br />
Danzig, 4,5 % Pfandbrief 200 RM<br />
25.1.1941 (R 4) EF<br />
Vignette mit Krantor in Danzig.<br />
Gründung 1924 als Danziger Hypothekenbank AG. Im April<br />
1925 fusionsweise Übernahme <strong>de</strong>r Danziger Roggenrentenbank<br />
AG. 1940 im Zuge <strong>de</strong>r Anglie<strong>de</strong>rung an das Deutsche<br />
Reich wur<strong>de</strong> die Gesellschaft in Lan<strong>de</strong>sbank und Girozentrale<br />
Danzig-Westpreußen umbenannt.<br />
Los 724 Schätzwert 15-30 €<br />
Lan<strong>de</strong>sbank und<br />
Girozentrale Westmark<br />
Saarbrücken, 4 % Pfandbrief 500 RM<br />
1.7.1942 (R 4) EF<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1941 unter Übernahme folgen<strong>de</strong>r Institutionen: Hypothekenbank<br />
Saarbrücken AG, Allgemeine Bo<strong>de</strong>nkreditbank,<br />
Deutsche Girozentrale-Deutsche Kommunalbank (Geschäftsstelle<br />
Saarbrücken), Bayerische Gemein<strong>de</strong>bank (Zweigstelle<br />
Kaiserslautern), Pfälzische Wirtschaftsbank, Gem. AG.<br />
Los 725 Schätzwert 30-75 €<br />
Lan<strong>de</strong>sbank Westsachsen AG<br />
Plauen i.V. , Aktie 100 RM Aug. 1927<br />
(Auflage 3200, nach Kapitalschnitt von<br />
1934 und Nennwertvereinheitlichung von<br />
1937 noch 1990, R 2) EF<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1922 in Auerbach i.V. als “Staats- und Bezirksbank<br />
Obervogtland AG”, 1924 umfirmiert wie oben, 1927 Sitzverlegung<br />
nach Plauen. Zweignie<strong>de</strong>rlassungen in Auerbach, Falkenstein,<br />
Klingenthal, Lengenfeld und Oelsnitz. Das Institut stand<br />
<strong>de</strong>r Sächsischen Staatsbank nahe. Als Spätfolge <strong>de</strong>r Bankenkrise<br />
1934 Kapitalschnitt 5:1, wobei <strong>de</strong>r Nennwert <strong>de</strong>r Aktien<br />
auf 20 RM bzw. 200 RM geän<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong>. 1937 durch Überdruck<br />
auf 100-RM-Aktien vereinheitlicht, die auf 200 RM umgestempelten<br />
1.000-RM-Aktien kamen außer Verkehr.<br />
67
Los 726 Schätzwert 25-50 €<br />
Lan<strong>de</strong>sgasversorgung Sachsen AG<br />
Leipzig, Aktie 1.000 RM 1.8.1932<br />
(Auflage 5000, R 3) EF<br />
Gründung 1928, Firmensitz ab 1939 in Markkleeberg. Großaktionäre<br />
(1943): AG Sächsische Werke, Dres<strong>de</strong>n (52,9%), Energie<br />
AG, Leipzig-Markkleeberg (46,1%).<br />
Los 727 Schätzwert 200-250 €<br />
Lan<strong>de</strong>shauptstadt Darmstadt<br />
Darmstadt, 9 % Schuldv. 50.000 Mark<br />
20.1.1923 (Auflage 900, R 10) VF<br />
Sehr schöne Art Deco-Umrandung, Stadtwappen<br />
im Unterdruck. Nur 4 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Los 728 Schätzwert 50-100 €<br />
Lan<strong>de</strong>shauptstadt Darmstadt<br />
Darmstadt, 8 % Schuldv. 2.000 RM<br />
1.4.1926 (Auflage 300, R 6) EF<br />
Großformatiges Papier mit riesigem Wappen im<br />
Unterdruck.<br />
Los 729 Schätzwert 15-30 €<br />
Lan<strong>de</strong>shauptstadt Darmstadt<br />
Darmstadt, Schuldv. 25 RM 1.5.1929 (R 3)<br />
EF<br />
Ablösungsanleihe, Auslosungsschein anhängend.<br />
68<br />
Los 730 Schätzwert 400-500 €<br />
Landgesellschaft<br />
Eigene Scholle GmbH<br />
Frankfurt a. O., Anteilschein 5.000 Mark<br />
18.10.1912. Grün<strong>de</strong>remission (R 11),<br />
ausgestellt auf <strong>de</strong>n Gutsbesitzer<br />
Dschenkig, Tzschetzschnow VF+<br />
Originalunterschriften. Zuvor unbekannt gewesen,<br />
nur 2 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Ursprünglich gegrün<strong>de</strong>t 1910 zwecks Bau und Verwaltung <strong>de</strong>r<br />
Arbeiterwohnungen <strong>de</strong>r Grube Ilse bei Senftenberg (Nie<strong>de</strong>rlausitz),<br />
einer <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>utendsten Braunkohlengruben <strong>de</strong>s Reviers,<br />
und weiterer Betriebe. Der Nationalsozialismus bediente sich<br />
dann dieser Landgesellschaft für seine Zwecke, was ihr eine überaus<br />
wichtige und facettenreiche Geschichte bescherte: Nach<br />
<strong>de</strong>r “Machtergreifung” verfügte das Deutsche Reich über 53,4 %<br />
<strong>de</strong>s knapp 4,2 Mio. RM betragen<strong>de</strong>n Stammkapitals, 24,3 % besaß<br />
<strong>de</strong>r Provinzialverband <strong>de</strong>r Provinz Bran<strong>de</strong>nburg, 1,1 % das<br />
Stift Neuzelle. Der Rest verteilte sich auf 58 Landkreise sowie<br />
141 Banken, Firmen und Privatpersonen. Gegenstand <strong>de</strong>s Unternehmens<br />
war nach einer Satzungsän<strong>de</strong>rung 1938 “die Neubildung<br />
<strong>de</strong>utschen Bauerntums nach Maßgabe <strong>de</strong>r Gesetze und <strong>de</strong>r<br />
Richtlinien <strong>de</strong>r Reichsregierung”. Bereits ab 1934 wur<strong>de</strong>n jährlich<br />
etwa ein dutzend Landgüter erworben, auch aus jüdischem<br />
Besitz, mit Flächen von 3.000 - 5.000 ha pro Jahr. Diese wur<strong>de</strong>n<br />
dann für die Ansiedlung von Neubauern unter Fe<strong>de</strong>rführung <strong>de</strong>s<br />
“Rasse- und Siedlungshauptamtes <strong>de</strong>r SS” parzelliert. Wie das<br />
geschah, erläutert beispielhaft <strong>de</strong>r Geschäftsbericht 1938 für die<br />
Neubauernsiedlung Mehrow (Kreis Nie<strong>de</strong>rbarnim, zuvor ein hoch<br />
verschul<strong>de</strong>tes Rittergut <strong>de</strong>r Besitzerin Anna Bothe): “Die Aufteilung<br />
erfolgt, wie alle Siedlungen, durch die Gesellschaft nach <strong>de</strong>n<br />
Richtlinien für die Neubildung <strong>de</strong>utschen Bauerntums, die Auswahl<br />
<strong>de</strong>r Neubauern unter Beachtung <strong>de</strong>r Richtlinien <strong>de</strong>s Reichsnährstan<strong>de</strong>s<br />
von <strong>de</strong>r SS bzw. SA. Die ausgewählten SS-Männer<br />
erhalten zur Bestreitung <strong>de</strong>r Anzahlung und <strong>de</strong>r Beschaffung <strong>de</strong>s<br />
Inventars zusätzliche Mittel <strong>de</strong>r SS aus <strong>de</strong>n Mitteln <strong>de</strong>s Rasseund<br />
Siedlungsamtes, die SA-Männer Mittel aus <strong>de</strong>m Dankopfer<br />
<strong>de</strong>r Nation. Bei <strong>de</strong>r Planung und Ausgestaltung <strong>de</strong>r Neubauerndörfer<br />
sind die Wünsche und Vorschläge <strong>de</strong>r SS bzw. <strong>de</strong>r SA<br />
weitgehend berücksichtigt wor<strong>de</strong>n.” Ein <strong>Teil</strong> dieser Mustersiedlungen<br />
steht heute unter Denkmalschutz. Ein weiteres Tätigkeitsgebiet<br />
<strong>de</strong>r Landgesellschaft waren Aufträge <strong>de</strong>r Wehrmacht zur<br />
Beschaffung von Übungsplatzgelän<strong>de</strong>n.<br />
Los 731 Schätzwert 300-375 €<br />
Landgesellschaft<br />
Eigene Scholle GmbH<br />
Frankfurt a. O., Anteilschein 2.200 RM<br />
21.12.1926 (R 10), ausgestellt auf<br />
Fräulein Margarete Delbrück, Berlin VF+<br />
Originalunterschriften. Zuvor unbekannter Jahrgang,<br />
nur 3 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
I<strong>de</strong>ntische Gestaltung wie voriges Los.<br />
Los 732 Schätzwert 300-375 €<br />
Landkraftwerke Leipzig AG<br />
Kulkwitz bei Leipzig, Global-Aktie 500 x<br />
1.000 RM 1.4.1941, verbriefte die 3,1 %-<br />
Anteile <strong>de</strong>r Kreis-Kommunalverbän<strong>de</strong><br />
Merseburg bzw. Querfurt (R 9) VF<br />
Maschinenschriftliche Ausfertigung mit Originalunterschriften.<br />
Bei Neustückelung <strong>de</strong>s Aktienkapi-<br />
Nr. 730 Nr. 732<br />
tals 1941 wur<strong>de</strong>n die 15250 Stück 1.000-RM-Aktien<br />
nicht einzeln gedruckt, son<strong>de</strong>rn in 9 unterschiedlich<br />
großen Global-Aktien verbrieft. Im<br />
Reichsbankschatz lagen sämtliche Global-Aktien,<br />
außer die Urkun<strong>de</strong> über die Stück 1860 Aktien<br />
(11,6 %) die <strong>de</strong>r Elektrowerke AG in Berlin gehörten.<br />
Hier angeboten das letzte noch verfügbare<br />
Stück.<br />
Gründung 1910 zwecks Stromversorgung <strong>de</strong>r Leipziger Außenbahn-AG<br />
und <strong>de</strong>r benachbarten preußischen Ortschaften.<br />
Bald darauf wur<strong>de</strong>n auch die (sächsischen) Amtshauptmannschaften<br />
Leipzig, Borna, Grimma und Rochlitz sowie die (preußischen)<br />
Kreise Delitzsch, Merseburg, Torgau, Querfort und Ekkartsberga<br />
als Stromabnehmer gewonnen. Die im Kraftwerk<br />
Kulkwitz verstromte Braunkohle gewann die Ges. im eigenen<br />
Tagebau (Carolaschacht, König-Albert-Schacht). Anfang <strong>de</strong>r<br />
1930er Jahre wur<strong>de</strong> die Energie AG Leipzig (Enag) <strong>de</strong>r Hauptstromabnehmer<br />
zur Weiterverteilung. 1937 Einglie<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r<br />
Leipziger Braunkohlenwerke AG in Kulkwitz, nach<strong>de</strong>m <strong>de</strong>ren AK<br />
schrittweise zu 100 % übernommen wor<strong>de</strong>n war. Börsennotiz<br />
Berlin, Dres<strong>de</strong>n und Leipzig, größter Einzelaktionär war die AG<br />
Sächsische Werke (30,5 %).<br />
Los 733 Schätzwert 30-90 €<br />
Landshuter Keks- und<br />
Nahrungsmittelfabrik AG<br />
Landshut, Bayern, Aktie 1.000 Mark<br />
30.9.1920 (Auflage 1900, R 2) EF<br />
Großes Hochformat, feine Zierumrandung.<br />
Gründung 1912 als “Landshuter Bisquit- & Keksfabrik H.L.<br />
Klein AG”. 1918 übernahm die Kaiser-Otto AG Nahrungsmittelfabriken,<br />
Heilbronn die Aktienmehrheit, zugleich umbenannt in<br />
“Landshuter Keks- und Nahrungsmittelfabrik AG” und 1925 in<br />
“Landshuter Keks- und Schokola<strong>de</strong>nfabrik AG”. Hergestellt<br />
wur<strong>de</strong>n Back-, Teig- und Zuckerwaren aller Art sowie Schokola<strong>de</strong><br />
unter <strong>de</strong>r Marke “Zugspitze”. Notiert im Freiverkehr München,<br />
letzter Großaktionär war <strong>de</strong>r Zwiebackfabrikant Carl<br />
Brandt. 1951 umgewan<strong>de</strong>lt in die “C.& F. Brandt Schokola<strong>de</strong>nfabrik<br />
“Zugspitze” GmbH”. Heute ist das Landshuter Werk eine<br />
wichtige Produktionsstätte <strong>de</strong>r Brandt Zwieback Schokola<strong>de</strong>n<br />
GmbH + Co. KG, Hagen.<br />
Los 734 Schätzwert 200-250 €<br />
Landshuter Kunstmühle<br />
C. A. Meyer’s Nachfolger AG<br />
Landshut, Aktie 1.000 Mark 1.6.1922<br />
(Auflage 1700, R 8) EF<br />
Bereits 1489 wird am Landshuter Hammerbach eine Papiermühle<br />
gebaut. 1871 erwerben Christian Meyer und Viktoria<br />
Leinfel<strong>de</strong>r die Papiermühle, brechen sie sogleich ab und errichten<br />
an <strong>de</strong>r Stelle die noch heute stehen<strong>de</strong> fünfstöckige Getrei<strong>de</strong>mühle.<br />
1898 nach <strong>de</strong>m Tod von Christian Meyer Umwandlung<br />
in eine AG. 1936 und 1970 wird die Mühle jeweils<br />
total umgebaut und erneuert. 1985 Spezialisierung auf die Bio-<br />
Vermahlung, 1996 als erste Mühle in ganz Europa nach <strong>de</strong>r<br />
EG-Öko-Audit-Verordnung zertifiziert. Noch heute bestehen<strong>de</strong><br />
AG, <strong>de</strong>ren Aktien gesuchte Liebhaberstücke im Nebenwertemarkt<br />
sind.<br />
Los 735 Schätzwert 25-75 €<br />
Langbein-Pfanhauser Werke AG<br />
Leipzig, Aktie 1.000 Mark 3.6.1920<br />
(Auflage 750, R 4) EF<br />
Gründung 1907 durch Fusion <strong>de</strong>r Dr. G. Langbein & Co. in<br />
Leipzig (gegr. 1881) mit Filialen in Berlin, Solingen, Wien, Mailand<br />
und Brüssel mit <strong>de</strong>r Firma Wilh. Pfanhauser in Wien (gegr.<br />
1873). Fabriken für Galvanotechnik und Elektrochemie sowie<br />
Dynamo- und Maschinenbau in Leipzig und Oerlikon/Schweiz.<br />
Seinerzeit in Leipzig börsennotiert. 1948 in <strong>de</strong>r DDR enteignet,
daraufhin Sitzverlegungen nach Düsseldorf (1951), Neuss<br />
(1953) und zurück nach Düsseldorf (1999). 2001 aufnehmen<strong>de</strong><br />
Gesellschaft bei <strong>de</strong>r Fusion mit <strong>de</strong>r Vereinigte Deutsche Nikkel<br />
AG, <strong>de</strong>r Hindrichs-Auffermann AG und <strong>de</strong>r DOAG AG, zugleich<br />
Umfirmierung in VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke<br />
AG. 2005 Eröffnung <strong>de</strong>s Insolvenzverfahrens.<br />
Los 736 Schätzwert 20-40 €<br />
Lapp-Finze Eisenwarenfabriken-AG<br />
Kalsdorf bei Graz, Aktie 1.000 RM Aug.<br />
1939 (Auflage 1400, R 5) EF<br />
Gründung 1912 durch Umwandlung <strong>de</strong>r Firma Adolf Finze &<br />
Co. k.k. priv. Metall-, und Eisenwaren-, Schrauben-, Nieten-,<br />
Draht- und Drahtstifte-Fabrik. 1939 umbenannt wie oben.<br />
1979 Übernahme durch <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Dachfensterhersteller<br />
Roto Frank AG, Leinfel<strong>de</strong>n-Echterdingen.<br />
Los 737 Schätzwert 20-50 €<br />
Lebrecht Müllers Erben AG<br />
Litzmannstadt, Aktie 1.000 RM März<br />
1942 (Auflage 2400, R 4) EF<br />
Unentwertet.<br />
Gründung 1870, lt. Hauptversammlung vom 23.12.1941 wur<strong>de</strong><br />
die Satzung <strong>de</strong>m <strong>de</strong>utschen Aktiengesetz angepaßt und neu<br />
gefaßt. Herstellung und Vertrieb sowie die Ausrüstung von Textilerzeugnissen<br />
aller Art. Haupterzeugnisse: Baumwoll-, und<br />
kunstsei<strong>de</strong>ne Gewebe.<br />
Los 738 Schätzwert 25-50 €<br />
Lech-Elektrizitätswerke AG<br />
Augsburg, Aktie 1.000 RM Dez. 1929<br />
(Auflage 38500, R 3) EF<br />
Bei <strong>de</strong>r Gründung 1903 durch die Elektrizitäts-AG W. Lahmeyer<br />
& Co. brachten diese ihre von 1896 datieren<strong>de</strong> Konzessionsverträge<br />
mit <strong>de</strong>m Bayerischen Staat zur Ausnutzung <strong>de</strong>r Lechwasserkräfte<br />
unterhalb von Ausgburg bis zur Donau ein, außer<strong>de</strong>m<br />
das Wasserkraftwerk Gersthofen zur öffentlichen Stromversorgung<br />
<strong>de</strong>r Stadt Augsburg mit Umgebung. 1904 wur<strong>de</strong> in<br />
Gersthofen zusätzlich ein Dampfkraftwerk errichtet. Im Laufe<br />
<strong>de</strong>r Zeit kamen sechs weitere Wasserkraftwerke am Lech und<br />
<strong>de</strong>r Unteren Iller hinzu. 1913 Vertrag mit <strong>de</strong>m Bayerischen Staat<br />
über die öffentliche Stromversorgung im Überlandgebiet <strong>de</strong>s<br />
Regierungsbezirks Schwaben und eines <strong>Teil</strong>s von Oberbayern<br />
(Versorgung von 627 Gemein<strong>de</strong>n und 38 städtischen Elektrizitätswerken).<br />
Ab 1933 Verbundbetrieb mit <strong>de</strong>m Rheinisch-Westfälischen<br />
Elektrizitätswerk über die 100 kV-Leitung Meitingen-<br />
Hoheneck. Der bis heute börsennotierte regional be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Energieversorger<br />
gehört mehrheitlich <strong>de</strong>m RWE-Konzern, eine<br />
kleinere Beteiligung hält <strong>de</strong>r Bezirk Schwaben.<br />
Los 739 Schätzwert 30-75 €<br />
Le<strong>de</strong>rer-Bräu AG<br />
Nürnberg, VZ-Aktie A 500 RM Jan. 1930<br />
(Auflage 2250, R 5) EF<br />
Die Braustätte in <strong>de</strong>r Bärenschanzstr. 48 existiert schon seit<br />
1575, im Jahr 1890 von <strong>de</strong>r Bierbrauereigesellschaft vormals<br />
Gebrü<strong>de</strong>r Le<strong>de</strong>rer AG übernommen. 1928 Umfirmierung in Le<strong>de</strong>rer-Bräu<br />
AG. 1919/20 Lohnsudvertrag mit <strong>de</strong>r Genossenschaftsbrauerei<br />
für Nürnberg, Fürth und Umgebung. Ferner übernommen<br />
die Brauerei Güttinger in Lauf (1921), die Brauereien<br />
Finkler & Lehner in Gunzenhausen (1922), die Brauerei<br />
Schübel in Rückersdorf (1924), die Brauerei Gloßner in Wengen<br />
(1927), die Brauerei Dietrich Müller in Hersbruck (1929) sowie<br />
nach und nach die Brauerei Humbser-Geismann AG in Fürth. 52<br />
eigene Wirtschaften. Börsennotiz München. 1972 Mega-Fusion<br />
mit sechs weiteren Brauereien zur Patrizier-Bräu AG.<br />
Los 740 Schätzwert 50-100 €<br />
Leerer Heringsfischerei AG<br />
Leer i. Ostfr., Aktie 1.000 RM Juni 1942<br />
(Auflage 400, R 5) EF<br />
Gründung 1905, Seefischfang mit anfänglich 5 Stahldampfloggern.<br />
Börsennotiz: Freiverkehr Hamburg und Bremen. 1957<br />
Zusammenarbeit mit <strong>de</strong>r Em<strong>de</strong>r Heringsfischerei und <strong>de</strong>r Gesellschaft<br />
Großer Kurfürst, 1961 Umwandlung in eine gemeinsame<br />
GmbH. 1969 En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Fangfahrten und Sitzverlegung<br />
nach Bremerhaven, 1976 Liqiudation.<br />
Los 741 Schätzwert 100-200 €<br />
Leipziger Baumwollweberei<br />
Leipzig, Aktie 1.000 Mark 1.5.1888<br />
(Auflage 300, R 5) EF<br />
Gründung 1886. Die Rohweberei ist hervorgegangen aus <strong>de</strong>r<br />
En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 18. Jh. von Gebr. Krause geschaffenen und von C.M.<br />
Riedig erweiterten Betriebsanlage. Der Betrieb wur<strong>de</strong> 1929<br />
stillgelegt, jedoch Anfang 1931 wie<strong>de</strong>r aufgenommen. 1947 in<br />
Baumwollweberei Wolkenburg umbenannt. 1953 verstaatlicht.<br />
1964 VEB Malitex Hohenstein-Ernsthal, 1990 Malitex GmbH,<br />
1991 Schließung <strong>de</strong>s Werkes Wolkenburg.<br />
Los 742 Schätzwert 15-30 €<br />
Leipziger Bierbrauerei zu Reudnitz<br />
Riebeck & Co. AG<br />
Leipzig, Aktie 1.000 RM 1.8.1933<br />
(Auflage 7000, R 2) EF<br />
Die Brauerei grün<strong>de</strong>te 1862 Adolf Schrö<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r damals noch<br />
selbständigen Vorortgemein<strong>de</strong> Reudnitz. 1871 wur<strong>de</strong> das konkursreife<br />
Unternehmen an einige Leipziger Bürger unter Führung<br />
<strong>de</strong>s Industriellen Carl Adolf Riebeck veräußert und 1887 in eine<br />
AG umgewan<strong>de</strong>lt. Die Brauerei in <strong>de</strong>r Mühlstr. 13 wur<strong>de</strong> nun sehr<br />
expansiv geführt, bis zum Ausbruch <strong>de</strong>s 1. Weltkrieges hatte sich<br />
<strong>de</strong>r Absatz auf 400.000 Hektoliter jährlich mehr als verdoppelt.<br />
1912 Errichtung eines Zweigbetriebes in Berlin durch Anpachtung<br />
<strong>de</strong>r Germaniabrauerei in <strong>de</strong>r Frankfurter Allee 53/55. 1938<br />
Umfirmierung in Riebeck-Brauerei AG. Inzwischen mit in <strong>de</strong>r Spitze<br />
2 Mio. Hektoliter im Jahr Ausstoß <strong>de</strong>r größte mittel<strong>de</strong>utsche<br />
Brauerei-Konzern und die viertgrößte Brauerei <strong>de</strong>s Deutschen<br />
Reichs. Eigene Braustätten in Leipzig, Erfurt, Altenburg i.Th., Gera<br />
und Gräfenthal (Thür.) sowie Mehrheitsbeteiligungen an weiteren<br />
19 Brauereien (die größte Beteiligung 1943 war die an <strong>de</strong>r<br />
Actien-Brauerei Neustadt-Mag<strong>de</strong>burg). Börsennotiz Berlin und<br />
Leipzig. 1946 enteignet und weitergeführt als VEB Lan<strong>de</strong>s-Brauerei<br />
Leipzig, ab 1959 mit weiteren Betrieben vereinigt zur VEB<br />
Sachsen-Bräu Leipzig, ab 1968 VEB Getränkekombinat Leipzig.<br />
Die AG wur<strong>de</strong> nach <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> reaktiviert, wobei sich auch die<br />
Familie Oetker (Ra<strong>de</strong>berger) engagierte. Dennoch kam die Brauerei<br />
nach <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> zunächst zum Getränkeriesen Brau und<br />
Brunnen, nach <strong>de</strong>ssen Sturz 2005 als “Leipziger Brauhaus zu<br />
Reudnitz GmbH” aber schließlich doch zur Ra<strong>de</strong>berger-Gruppe.<br />
Los 743 Schätzwert 200-250 €<br />
Leipziger Bierbrauerei zu Reudnitz<br />
Riebeck & Co. AG<br />
Leipzig, 5 % <strong>Teil</strong>schuldv. 100 RM Dez.<br />
1936 (Auflage 5010, R 9) EF<br />
Originalunterschriften. Nur 8 Stück lagen im<br />
Reichsbankschatz.<br />
I<strong>de</strong>ntische Gestaltung wie fplgen<strong>de</strong>s Los.<br />
Nr. 742 Nr. 744<br />
Das Leipziger Brauhaus zu Reudnitz in <strong>de</strong>r Mühlstraße<br />
Nr. 745 Nr. 748<br />
Los 744 Schätzwert 300-375 €<br />
Leipziger Bierbrauerei zu Reudnitz<br />
Riebeck & Co. AG<br />
Leipzig, 5 % <strong>Teil</strong>schuldv. 1.000 RM Dez.<br />
1936 (Auflage 3600, R 10) EF-<br />
Originalunterschriften. Zuvor völlig unbekannt gewesen!<br />
Von <strong>de</strong>n lediglich 3 im Reichsbankschatz<br />
gefun<strong>de</strong>nen Stücken das allerletzte noch verfügbare.<br />
Los 745 Schätzwert 225-300 €<br />
Leipziger Han<strong>de</strong>ls- und Verkehrs-<br />
Bank AG vorm.<br />
Leipziger Central-Viehmarkts-Bank<br />
Leipzig, Aktie 1.000 Mark 21.3.1923<br />
(Auflage 62000, R 9) EF<br />
Großformat.<br />
Gründung 1867 als Pfaffendorfer Han<strong>de</strong>lsverein A. Klarner &<br />
Co. KG, seit 1877 Genossenschaftsbank und seit 1891 AG als<br />
“Leipziger Central-Viehmarkts-Bank”. 1919 umbenannt in<br />
“Leipziger Han<strong>de</strong>ls- und Verkehrsbank”, ab 1941 nur noch<br />
kurz “Han<strong>de</strong>lsbank”. Das Institut (geschäftsansässig Leipzig C<br />
1, Kurprinzstr. 9) beschäftigte zuletzt ca. 130 Mitarbeiter und<br />
war in Leipzig auch börsennotiert.<br />
Los 746 Schätzwert 150-250 €<br />
Leipziger Messe- und Ausstellungs-AG<br />
Leipzig, Aktie 1.000 RM 15.2.1925<br />
(Auflage 650, nach diversen<br />
Kapitalmaßnahmen nur noch 45 Stück,<br />
die sämtlich im Reichsbankschatz lagen,<br />
R 7) UNC-EF<br />
Faksimile-Unterschrift u.a. von Oberbürgermeister<br />
(1918-30) Dr. Karl Wilhelm August Rothe für das<br />
Aufsichtsrats-Präsidium. Sämtliche Aktienausgaben<br />
<strong>de</strong>r Leipziger Messe waren zuvor völlig unbekannt<br />
gewesen!<br />
Gründung 1923 zwecks “För<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Leipziger Messe mit<br />
<strong>de</strong>m gemeinnützigen Ziel <strong>de</strong>r Hebung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Warenausfuhr<br />
durch Beschaffung und Vermietung von Räumen und<br />
Plätzen zur Ausstellung von Industrie-Erzeugnissen.” Die Weltwirtschaftskrise<br />
traf die Leipziger Messe so hart, daß sie 1933<br />
ihre Grundstücke, sonstige Sachanlagen und das Umlaufvermögen<br />
(soweit nicht für Durchführung <strong>de</strong>s Messebetriebes unbedingt<br />
erfor<strong>de</strong>rlich) an das Leipziger Messamt verkaufen<br />
musste, das im Gegenzug nom. 3,85 Mio. Aktien unentgeltlich<br />
für eine Kapitalherabsetzung auf nur noch o,4 Mio. RM zur Verfügung<br />
stellte und außer<strong>de</strong>m auf die Erfüllung <strong>de</strong>r bestehen<strong>de</strong>n<br />
For<strong>de</strong>rungen verzichtete. Der Messe- und Ausstellungs-AG<br />
69
lieb fortan mit knapp 50 Mitarbeitern nur noch die Verwaltung<br />
und Vermietung <strong>de</strong>r Meßräume in <strong>de</strong>n jetzt verkauften Objekten.<br />
Aktionäre waren nunmehr das Leipziger Messamt (ca. 90<br />
%) und die Hamburg-Amerika-Linie (HAPAG, ca. 9 %). Zuletzt<br />
wur<strong>de</strong> das Reichsmesseamt Leipzig alleiniger Aktionär. 1951<br />
Löschung <strong>de</strong>r AG im Han<strong>de</strong>lsregister. Die Leipziger Messe dagegen<br />
bestand als Frühjahrs- und Herbstmesse fort und entwickelte<br />
sich zu DDR-Zeiten trotz Kaltem Krieg zur wichtigsten<br />
Kontakt-Plattform im Ost-West-Han<strong>de</strong>l.<br />
Los 747 Schätzwert 175-300 €<br />
Leipziger Messe- und Ausstellungs-AG<br />
Leipzig, Aktie 10.000 RM 15.2.1925<br />
(Auflage 700, nach Kapitalherabsetzung<br />
und Neuausgabe 1933 nur noch 35<br />
Stück, die sämtlich im Reichsbankschatz<br />
lagen, R 7) UNC<br />
Faksimile-Unterschrift u.a. von Oberbürgermeister<br />
(1918-30) Dr. Karl Wilhelm August Rothe für das<br />
Aufsichtsrats-Präsidium.<br />
Los 748 Schätzwert 300-375 €<br />
Leipziger Messe- und Ausstellungs-AG<br />
Leipzig, Aktie 10.000 RM Nov. 1941<br />
(Auflage nur 20 Stück, die sämtlich im<br />
Reichsbankschatz lagen, R 8) UNC<br />
Los 749 Schätzwert 200-250 €<br />
Leipziger Pianofortefabrik<br />
Gebr. Zimmermann AG<br />
Leipzig, Aktie 20 RM Mai 1925 (Auflage<br />
21000, R 8) EF-VF<br />
Sehr <strong>de</strong>korativ, drei Vignetten mit Klavieren und<br />
Konzertflügel.<br />
Gründung 1895. 1926 Anglie<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r “Ludwig Hupfeld AG”<br />
mit Werken in Dres<strong>de</strong>n, Böhlitz-Ehrenberg, Johanngeorgenstadt<br />
und Gotha, anschließend Umfirmierung in “Leipziger Pianoforte-<br />
und Phonolafabriken Hupfeld - Gebr. Zimmermann<br />
AG”. Weiter umfirmiert 1935 in Hupfeld - Gebr. Zimmermann<br />
AG und 1938 in Hupfeld-Zimmermann AG. Börsennotiz Berlin<br />
und Leipzig. 1946 enteignet, zu DDR-Zeiten <strong>Teil</strong> <strong>de</strong>r sog. “Pianounion”.<br />
Nach <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> wird <strong>de</strong>r Betrieb in Böhlitz-Ehrenberg<br />
als Pianofortefabrik Leipzig GmbH & Co. KG reprivatisiert,<br />
das traditionsreiche ehemalige Hupfeld-Werk in Seifhennersdorf<br />
wird von <strong>de</strong>r Berliner Bechstein-Gruppe übernommen.<br />
70<br />
Nor<strong>de</strong>ingang Leipziger Messe um 1980<br />
Los 750 Schätzwert 225-300 €<br />
Leipziger Pianoforte- und<br />
Phonolafabriken<br />
Hupfeld - Gebr. Zimmermann AG<br />
Leipzig, Aktie 100 RM 7.1.1927 (Auflage<br />
6800, R 10) VF<br />
Sehr <strong>de</strong>korativ, zwei Vignetten mit Klavier und<br />
Konzertflügel sowie zwei Vignetten mit Zimmermann-<br />
bzw. Hupfeld-Logo. Zuvor völlig unbekannt<br />
gewesene Ausgabe, lediglich 4 Stück wur<strong>de</strong>n im<br />
Reichsbankschatz gefun<strong>de</strong>n.<br />
Los 751 Schätzwert 30-90 €<br />
Leipziger Stahlfe<strong>de</strong>rfabrik<br />
Herm. Müller AG<br />
Leipzig-Lin<strong>de</strong>nau, Aktie 1.000 RM Okt.<br />
1922. Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 4500, R 3) EF<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1890, AG seit 27.9.1922. Herstellung und Vetrieb<br />
von Schreibfe<strong>de</strong>rn, Füllhalterfe<strong>de</strong>rn und Schreibutensilien aller<br />
Art. Firma nach <strong>de</strong>m Krieg nicht verlagert. 1950 ist die MEWA<br />
Vereinigung volkseigener Betriebe <strong>de</strong>r Metallwarenindustrie in<br />
Zwickau zum Treuhän<strong>de</strong>r bestellt.<br />
Los 752 Schätzwert 60-120 €<br />
Leipziger Westend-Baugesellschaft<br />
Schleussig, Aktie 1.000 Mark 1.7.1888.<br />
Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 1650, R 3) EF-VF<br />
Mit Originalunterschriften.<br />
Gründung 1888. Mit Straßen und Eisenbahngleisen erschloss<br />
die Gesellschaft ihre rd. 50 ha Bauland für Industrie, Mietwohnungs-<br />
und Siedlungsbau im Stadtteil Plagwitz. Außer<strong>de</strong>m Betrieb<br />
eines Mörtelwerkes, von Sand- und Kiesgruben und eines<br />
Fuhrgeschäftes in Leipzig-Lin<strong>de</strong>nau. Beteiligung an <strong>de</strong>r “Leipziger<br />
Ro<strong>de</strong>lbahn GmbH” (die seit 1993 als Museumsfeldbahn betriebene<br />
Kiesbahn Leipzig-Lin<strong>de</strong>nau). Firmenmantel 1989 verlagert<br />
nach Berlin (West) und Abwicklung, 1991 Hauptversammlung,<br />
1998 Leipziger Westend-Baugesellschaft AG i.A., Leipzig.<br />
Los 753 Schätzwert 25-75 €<br />
Leonhard Tietz AG<br />
Köln, VZ-Aktie 1.000 Mark 1.2.1921<br />
(Auflage 5000, nach Umstellung auf 100<br />
RM noch 2000 Stück, R 5. Die VZ-Aktien<br />
waren im Besitz eines Konsortiums, <strong>de</strong>m<br />
die Hausbanken und die Familie Tietz<br />
angehörten. Sie hatten einen 7 % nach -<br />
zahlbaren Divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n-Vorzug und 10faches,<br />
später sogar 30-faches Stimmrecht.<br />
1937 Umwandlung in Stammaktien) EF<br />
Faksimile-Unterschrift von Gen.-Dir. Alfr. Leonh.<br />
Tietz. Wirtschaftshistorisch be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>s Stück,<br />
zeitweise einer <strong>de</strong>r 30 großen DAX-Werte. Zuvor<br />
völlig unbekannt gewesene Emission.<br />
Gründung <strong>de</strong>r Einzelfirma Leonhard Tietz 1879 in Stralsund als<br />
Kurz-, Weiß- und Wollwarengeschäft. Durch feste niedrige Preise<br />
gewann das Geschäft so viele Kun<strong>de</strong>n, daß es innerhalb weniger<br />
Jahre dreimal vergrößert wer<strong>de</strong>n mußte. 1889 Gründung<br />
<strong>de</strong>r ersten Filiale in Elberfeld, danach schlagartige Expansion<br />
vor allem im west<strong>de</strong>utschen Raum, ab 1929/30 auch in Schlesien<br />
und <strong>de</strong>m Frankfurter Raum. Seit 1905 “Leonhard Tietz<br />
AG”, 1933/36 umbenannt in West<strong>de</strong>utsche Kaufhof AG. Der<br />
Kaufhof hatte jetzt über 13.000 Mitarbeiter, Großaktionäre waren<br />
zu dieser Zeit die Commerzbank, die Dresdner und die<br />
Deutsche Bank. 1945 waren lediglich 3 von 41 Filialen einigermaßen<br />
unzerstört, doch es folgte ein gewaltiger Wie<strong>de</strong>raufbau<br />
zum später zweitgrößten <strong>de</strong>utschen Kaufhauskonzern.<br />
1988 Einstieg bei Jet-Reisen und <strong>de</strong>r Media-Markt-Gruppe.<br />
1996 auf Wunsch <strong>de</strong>s späteren Großaktionärs Metro Verschmelzung<br />
mit <strong>de</strong>r ASKO und <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Metro-Aktivitäten<br />
zur heutigen METRO AG (Sitz Düsseldorf).<br />
Los 754 Schätzwert 25-50 €<br />
Leopold David & Co. AG<br />
Altona, Aktie 1.000 Mark Juni 1922<br />
(Auflage 1000, R 4) EF<br />
Gründung 1895, AG seit 1921 unter <strong>de</strong>r Firma Weinimport- und<br />
Kommissions-AG, Altona. Im Mai 1922 umbenannt wie oben.<br />
Import und Export von Weinen und Spirituosen sowie Han<strong>de</strong>l mit<br />
diesen Waren, ferner Betrieb <strong>de</strong>s Lager-, Transport- und Speditionsgeschäfts.<br />
Los 755 Schätzwert 200-250 €<br />
Leykam-Josefsthal<br />
AG für Papier- und Druck-Industrie<br />
Graz, Sammelaktie 100 x 1.000 RM<br />
25.9.1943 (Auflage nur 10 Stück, R 9)<br />
VF+<br />
Seit mehr als 400 Jahren wird am Standort Gratwein Papier erzeugt.<br />
1793 erwarb Andreas Leykam die Papiermühle und<br />
baute sie zum be<strong>de</strong>utendsten Fabrikbetrieb in <strong>de</strong>r ganzen<br />
Steiermark aus. 1870 Umwandlung in eine AG. Mit Abstand<br />
größtes Unternehmen <strong>de</strong>r Papier- und Zellulose-Industrie in <strong>de</strong>r<br />
Monarchie. Hauptwerke: Gratwein bei Graz, Josefsthal bei Laibach<br />
und Zwischenwässern in Krain. 1952 umfirmiert in Leykam-Josefsthal<br />
AG für Papier- und Zellstoff-Industrie. Die Aktien<br />
notierten in Wien, Berlin, Dres<strong>de</strong>n und Frankfurt a.M. 1974<br />
Fusion mit <strong>de</strong>r Mürztaler Holzstoff- und Papierfabriks-AG Bruck<br />
zur “Leykam Mürztaler Papier und Zellstoff AG”. Mehrheitsaktionär<br />
war über ein Jahrhun<strong>de</strong>rt lang die Creditanstalt-Bankverein<br />
gewesen, die 1988 ihre Anteile an die Koninklijke Ne<strong>de</strong>rlandse<br />
Papierfabrieken (KNP) verkaufte. KNP LEYKAM Gratkorn<br />
wur<strong>de</strong> dann 1998 vom finnischen Papierkonzern Sappi übernommen.<br />
Heute eines <strong>de</strong>r 7 europäischen Sappi-Werke.<br />
Nr. 750 Nr. 755<br />
Los 756 Schätzwert 200-250 €<br />
Lin<strong>de</strong>ner Aktien-Brauerei<br />
Hannover-Lin<strong>de</strong>n, Aktie 1.000 Mark<br />
1.3.1922 (Auflage erst 11000, zuletzt als<br />
200-RM-Aktie nur noch insgesamt 359<br />
Stück, R 7) EF-<br />
Gründung 1832 als Lagerbier-Brauerei, AG seit 1871. Nach vollständigem<br />
Umbau 1897/98 und 1908-12 eine <strong>de</strong>r größten<br />
Brauereien Deutschlands mit einer für die damalige Zeit mehr<br />
als beachtlichen Produktionsfähigkeit von 350.000 hl im Jahr.<br />
1904 Ankauf <strong>de</strong>r Weizenbierbrauerei von Jos. Hösel in Lin<strong>de</strong>n,<br />
1908 Erwerb <strong>de</strong>r Ostero<strong>de</strong>r Stadtbierbrauerei GmbH. 1909 Beteiligung<br />
bei <strong>de</strong>r Brauerei H. Langkopf GmbH in Peine (diese verkaufte<br />
danach nur noch Lin<strong>de</strong>ner Bier und wur<strong>de</strong> im Gegenzug<br />
- so ist das mit <strong>de</strong>r Malzfabrik Langkopf bis heute! - Malzlieferant).<br />
1917 Übernahme <strong>de</strong>r Germania-Brauerei GmbH in Hannover<br />
(gemeinsam mit <strong>de</strong>r Städtischen Lagerbierbrauerei und <strong>de</strong>r<br />
Vereinsbrauerei Herrenhausen). 1918 Beteiligung bei <strong>de</strong>r Bürgerliches<br />
Brauhaus AG. Außer<strong>de</strong>m beteiligt bei <strong>de</strong>r A. Schilling<br />
AG Brauerei und Mineralwasserfabrik in Celle. 1921 Fusion mit<br />
<strong>de</strong>r Schloß-Brauerei Schöneberg AG in Berlin (1926 wie<strong>de</strong>r ausgeglie<strong>de</strong>rt<br />
und verkauft). 1927 Erwerb <strong>de</strong>s Hofbrauhauses Hannover<br />
(Hinüberstr. 8). 1934 Verkauf <strong>de</strong>r Beteiligung an <strong>de</strong>r Kaiser-Brauerei<br />
AG in Hannover-Ricklingen. 1968 kam per Betriebsüberlassungsvertrag<br />
mit <strong>de</strong>m heutigen Großaktionär Brauereigil<strong>de</strong><br />
Hannover AG zur Braustätte Lin<strong>de</strong>n die Gil<strong>de</strong>-Brauerei<br />
hinzu - bei<strong>de</strong> für sich waren zu dieser Zeit schon die größten<br />
Brauereien in Nie<strong>de</strong>rsachsen. Umfirmiert 1968 in Lin<strong>de</strong>ner Gil<strong>de</strong>-Bräu<br />
AG und 1988 in Gil<strong>de</strong> Brauerei AG. Zum Konzern <strong>de</strong>r bis<br />
zuletzt in Hannover börsennotierten AG gehörte, neben <strong>de</strong>m Hofbrauhaus<br />
Wolters AG in Braunschweig (gegr. 1627, ab Okt.<br />
2006 privatisiert und eigenständig) vor allem die nach <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong><br />
auf <strong>de</strong>r grünen Wiese neu gebaute Hasserö<strong>de</strong>r Brauerei in<br />
Wernigero<strong>de</strong>/Harz, die in weniger als 10 Jahren zur viertgrößten<br />
<strong>de</strong>utschen Biermarke wur<strong>de</strong>. Dies weckte die Begehrlichkeit <strong>de</strong>s<br />
belgischen Interbrew-Konzerns (heute als InBev <strong>de</strong>r weltgrößte<br />
Brauereikonzern), <strong>de</strong>r sich nach einer emotional geführten Übernahmeschlacht<br />
2002 die Lin<strong>de</strong>ner Gil<strong>de</strong>-Brauerei einverleibte.<br />
Los 757 Schätzwert 20-40 €<br />
Lingner-Werke AG<br />
Dres<strong>de</strong>n, Aktie 1.000 RM 1.4.1928<br />
(Auflage 5000, R 2) EF<br />
Gründung 1911. Hervorgegangen aus <strong>de</strong>r 1888 gegrün<strong>de</strong>ten Firma<br />
Lingner & Kraft. Herstellung chemischer, pharmazeutischer,<br />
kosmetischer und technischer Artikel, von Nahrungs- und Genußmitteln<br />
sowie Seifen. Erzeugnisse u.a. das bekannte Odol Mundwasser<br />
(erstmals 1892 unter <strong>de</strong>r Firma Dresdner Chemisches Laboratorium<br />
Lingner GmbH auf <strong>de</strong>m Markt) und die Odol Zahnpasta.<br />
1938 Sitzverlegung nach Berlin. In <strong>de</strong>r DDR wur<strong>de</strong> die Tradition<br />
im Dresdner VEB Elbe-Chemie fortgesetzt. Heute die Firma<br />
Lingner + Fischer, zugehörig zum Konzern GlaxoSmithCline.
Los 758 Schätzwert 50-100 €<br />
Linke-Hofmann-Werke AG<br />
Breslau, Aktie 1.000 RM Mai 1942<br />
(Auflage 2750, R 5) EF<br />
1839 erhält Gottfried Linke in Breslau seinen ersten Auftrag für<br />
<strong>de</strong>n Bau von 100 offenen Güterwagen. Das Werk wächst rasend<br />
schnell. 1912 wird die Linke KG mit <strong>de</strong>r 1871 gegrün<strong>de</strong>ten “Breslauer<br />
AG für Eisenbahn-Wagenbau” zur Linke-Hofmann-Werke<br />
AG vereinigt, 1928 Fusion mit <strong>de</strong>r Waggon- und Maschinenfabrik<br />
AG vorm. Busch in Bautzen zur “Linke-Hofmann-Busch AG”.<br />
1934 Neugründung <strong>de</strong>r AG und Übernahme <strong>de</strong>r Werke Breslau<br />
und Warmbrunn <strong>de</strong>r Linke-Hofmann-Busch AG. Erzeugnisse: Güter-<br />
und Spezialwagen, Personen- und Straßenbahnwagen, Triebwagen,<br />
Schlaf-, Speise und Salonwagen, Omnibusaufbauten.<br />
1936 Beteiligung an <strong>de</strong>r Gründung <strong>de</strong>r Schlesische Flugzeug-Reparaturwerft<br />
GmbH durch Einbringung <strong>de</strong>s Werkes Pöpelwitz<br />
(1938 abgestoßen). Danach verzweigte sich die Firmengeschichte:<br />
In <strong>de</strong>m Breslauer Werk nahm man nach <strong>de</strong>m 2. WK <strong>de</strong>n Lokomotivbau<br />
wie<strong>de</strong>r auf: die polnische Firma Fabryka Wagonów PA-<br />
FAWAG lieferte fortan Fahrzeuge für die PKP. Dieses Werk in Wroclaw<br />
wur<strong>de</strong> 1997 von Adtranz, Berlin (ab 2000/01: Bombardier),<br />
übernommen. Gefertigt wur<strong>de</strong>n hier jetzt u.a. die Lokomotivkästen<br />
für die Deutsche Bun<strong>de</strong>sbahn. Doch auch in West<strong>de</strong>utschland<br />
ging die Firmengeschichte weiter: Die später zum Salzgitter-Konzern<br />
gehören<strong>de</strong> Linke-Hofmann-Werke AG wur<strong>de</strong> zunächst 1948<br />
nach Düsseldorf verlagert und 1955 in eine GmbH umgewan<strong>de</strong>lt.<br />
Auf einem 123 ha großen Areal in Salzgitter-Watenstedt (in direkter<br />
Nachbarschaft <strong>de</strong>s Salzgitter-Stahlwerkes) entsteht ab 1950<br />
eine <strong>de</strong>r größten Produktionsstätten für Schienenfahrzeuge in<br />
Deutschland. 1994/97 übernimmt <strong>de</strong>r französische Konkurrent<br />
Alsthom die LHB-Geschäftsanteile. 1998 Umfirmierung <strong>de</strong>r Linke-<br />
Hofmann-Busch GmbH in ALSTOM LHB GmbH.<br />
Los 759 Schätzwert 175-300 €<br />
Lippische Zuckerfabrik<br />
Lage, Namensaktie Lit. B 250 Mark<br />
20.4.1886. Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 500,<br />
R 6) VF<br />
Dekorativ, sogar mit Golddruck.<br />
Gründung 1883 zum Betrieb einer Rübenzuckerfabrik, errichtet<br />
1884 durch die Braunschweigische Maschinenbauanstalt.<br />
1985 wur<strong>de</strong> die Lippe-Weser-Zucker AG von <strong>de</strong>r Kölner Firma<br />
Pfeifer + Langen KG übernommen (Diamant Zucker). Das Werk<br />
Lage erzeugt heute aus etwa 7000 ha Anbaufläche jährlich<br />
70.000 t Raffina<strong>de</strong> und Weißzucker sowie Flüssigzucker,<br />
Mischsirup, Invertzucker und Zuckerkulör.<br />
Los 760 Schätzwert 20-40 €<br />
LIPSIA Chemische Fabrik Mügeln AG<br />
Leipzig, Aktie 100 RM 14.4.1927 (Auflage<br />
2240, R 2) EF<br />
Gründung 1898 zur Ausbeutung <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Mügelnschen Gegend<br />
vorhan<strong>de</strong>nen Kalklager zur Herstellung chemischer Produkte.<br />
In <strong>de</strong>r DDR als VEB Chemische Fabrik Lipsia weitergeführt.<br />
Die AG selbst wur<strong>de</strong> nach <strong>de</strong>m Krieg nicht verlagert.<br />
Los 761 Schätzwert 30-75 €<br />
Löwenbräu München<br />
München, Aktie 100 RM März 1942<br />
(Auflage 14000, R 4) EF<br />
Mit Löwen im Unterdruck.<br />
Die Braustätte selbst, urkundlich seit 1383 nachgewiesen, ist<br />
eine <strong>de</strong>r überhaupt ältesten Brauereien <strong>de</strong>r Welt. Gründung <strong>de</strong>r<br />
AG 1872 unter Übernahme <strong>de</strong>r Ludw. Brey’schen Bierbrauerei<br />
zum Löwenbräu (Nymphenburger Str. 4). Übernommen wur<strong>de</strong>n<br />
später auch die Aktienbrauerei zum Bayer. Löwen vorm. A. Mathäser<br />
(1907), die Unionsbrauerei Schülein & Co. AG sowie das<br />
Bürgerliche Brauhaus München (1921), die Weinmiller’sche<br />
Brauerei in Aichach (1926), die Tölzer Aktienbrauerei AG (1927)<br />
und die Gräfl. Toerring’sche Brauerei in Inning (1928). Außer<strong>de</strong>m<br />
besaß <strong>de</strong>r Löwenbräu über 300 Wirtschafts- und Restaurations-Anwesen<br />
sowie ein Torfwerk in Feilnbach. Ab 1922 Interessengemeinschaft<br />
mit <strong>de</strong>r Spaten-Franziskaner-Leistbräu<br />
AG. 1982 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r nicht betriebsnotwendige Grundbesitz in<br />
die “Monachia Grundstücks-AG” ausgegrün<strong>de</strong>t (später ein Gemeinschaftsunternehmen<br />
von Hochtief und <strong>de</strong>r Allianz-Versicherung).<br />
Jahrzehntelang war die Familie von Finck Großaktionär<br />
gewesen; in <strong>de</strong>n 90er Jahren ging die Aktienmehrheit dann<br />
an die Gabriel Sedlmayr Spaten-Franziskaner-Bräu KGaA die<br />
<strong>de</strong>n letzten freien Aktionären <strong>de</strong>s Löwenbräu ein Abfindungsangebot<br />
machte.<br />
Los 762 Schätzwert 200-250 €<br />
Logierhaus-BERNER-AG (LOBEAG)<br />
Berlin, Aktie Reihe B 200 RM 3.3.1927<br />
(Auflage 100, R 11) VF<br />
Aktien dieser Ges. waren zuvor völlig unbekannt.<br />
Von <strong>de</strong>n lediglich 2 im Reichsbankschatz gefun<strong>de</strong>nen<br />
Stücken ist dies das letzte noch verfügbare.<br />
Abheftlochung am unteren Rand.<br />
Gründung 1924 durch <strong>de</strong>n Touristik-Pionier Conrad Berner.<br />
Zweck: Schaffung von Logiermöglichkeiten an stark besuchten<br />
Reiseplätzen im In- und Ausland, Veranstaltung von Gesellschafts-<br />
und Pauschalreisen. Die Ges. betrieb ein Reisebüro in<br />
Berlin-Charlottenburg (Kantstr. 135) sowie ein eigenes Logierhaus<br />
in Pörtschach am Wörthersee. Vertretungen in Ragusa<br />
(Dalmatien), Florenz, Rom, Neapel, Palermo, Cairo etc. Zwar<br />
ahnte Berners Konzept die Zukunft <strong>de</strong>s von einem Anbieter organisierten<br />
Pauschalurlaubs sehr weise voraus. Aber nach <strong>de</strong>m<br />
2. Weltkrieg hatten die Deutschen zunächst an<strong>de</strong>re Interessen<br />
als Reisen. Die AG wur<strong>de</strong> abgewickelt und 1969 gelöscht.<br />
Los 763 Schätzwert 400-500 €<br />
Lohmann & Stolterfoht AG<br />
Witten a. d. Ruhr, Aktie 1.000 Mark 1.3.1920.<br />
Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 2000, R 11) VF<br />
Zuvor ganz unbekannt gewesen. Von <strong>de</strong>n ohnehin<br />
nur 2 im Reichsbankschatz gefun<strong>de</strong>nen Stücken<br />
ist dies das letzte noch verfügbare.<br />
Eisengießerei, gegrün<strong>de</strong>t 1884, AG seit 1919. Anfertigung, Erwerb<br />
und Vertrieb aller Arten von Maschinellen Anlagen und<br />
Triebwerken sowie <strong>de</strong>r Erwerb von Roh-, Halb- und Ganzfabrikaten<br />
zur Fertigstellung von Maschinen und Maschinenteilen<br />
zum Zwecke <strong>de</strong>r Weiterveräußerung. Es bestan<strong>de</strong>n Zweignie<strong>de</strong>rlassungen<br />
in Köln und Hamburg. Heute sind die Einzelmarken<br />
Bosch Automation, Brueninghaus Hydromatik, Indramat,<br />
Lohmann + Stolterfoht, Mecman, Rexroth Hydraulics and Star<br />
zur Marke Rexroth im Bosch-Konzern verschmolzen.<br />
Los 764 Schätzwert 25-50 €<br />
Losenhausenwerk<br />
Düsseldorfer Maschinenbau AG<br />
Düsseldorf-Grafenberg, Aktie 100 RM<br />
Nov. 1935 (Auflage 1000, R 4) EF<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1897 unter Übernahme <strong>de</strong>r seit 1880 bestehen<strong>de</strong>n<br />
Firma J. Losenhausen, Düsseldorf als Düsseldorfer Maschinen-<br />
bau-AG vorm. J. Losenhausen, 1926 umbenannt wie oben. Herstellung<br />
von Werkstoff- und Baustoff-Prüfmaschinen, Waggon-,<br />
Auto- und Fuhrwerkswaagen, Spezialwaagen. Die Abt. Kranbau<br />
wur<strong>de</strong> 1934 an die Schenck & Liebe-Harkort AG in Düsseldorf<br />
übertragen. Das Unternehmen Losenhausen erfand im Jahr<br />
1934 die erste Bo<strong>de</strong>nverdichtungsmaschine (“Vibromax”).<br />
Los 765 Schätzwert 200-250 €<br />
Lothringer Brauerei AG<br />
Metz-Vorbrücken, Aktie 5.000 RM<br />
1.10.1942 (R 8) UNC<br />
Zuvor völlig unbekannt gewesene Ausgabe!<br />
Gründung 1888, 1889 in Betrieb genommen. Ein jährlicher<br />
Ausstoß von 80.000 hl und einige rentable Wirtschaftsanwesen<br />
reichten in <strong>de</strong>n meisten Jahren für eine sehr gute Divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />
von 15 %.<br />
Los 766 Schätzwert 25-50 €<br />
Lozalit AG<br />
Höhr-Grenzhausen, Aktie 1.000 RM Juli<br />
1938 (Auflage 900, R 3) EF<br />
Gründung 1928, Firmensitz 1929 bis 1932 in Essen, danach in<br />
Höhr-Grenzhausen. Firma ab 1936: Lozalit AG. Firmenzweck:<br />
Gewerbsmäßige Ausnutzung von chemischen und technischen<br />
Verfahren aller Art sowie Herstellung und Han<strong>de</strong>l mit entsprechen<strong>de</strong>n<br />
Erzeugnissen. Großaktionär (1943): Sassoon Banking<br />
Corp. London (ca. 49 %).<br />
Los 767 Schätzwert 75-100 €<br />
Ludwig Wagner AG<br />
Leipzig C 1, Aktie 100 RM 23.12.1929<br />
(Auflage 150, R 7) EF<br />
Gründung im Sept. 1922. Herstellung und Vertrieb von Schriften<br />
und Messinglinien, Fortführung <strong>de</strong>r Firmen Ludwig Wagner<br />
und Gebrü<strong>de</strong>r Brandt in Lepzig. 1954 nach Berlin (West) verlagert,<br />
1956 nach Ingolstadt, ab 1959 GmbH. Der Betrieb selbst<br />
wur<strong>de</strong> 1951 vereinigt mit <strong>de</strong>r Schelter & Giesecke AG, Leipzig<br />
und <strong>de</strong>r Schriftguß AG, Dres<strong>de</strong>n zum VEB Typoart, Dres<strong>de</strong>n.<br />
Min<strong>de</strong>stgebot: 80 %<br />
vom unteren Schätzwert<br />
Nr. 762 Nr. 763<br />
Nr. 767<br />
Los 768 Schätzwert 100-125 €<br />
Ludwigshafener Walzmühle<br />
Ludwigshafen a.Rh., Aktie 300 RM Mai<br />
1931 (Auflage 7200, R 7) EF<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1894 mit Sitz in Mannheim unter Übernahme <strong>de</strong>r<br />
Kunstmühle <strong>de</strong>r Firma Kaufmann, Straus & Co. in Ludwigshafen<br />
(Weizen- und Roggenmühle, Hartgrieß- und Graupenfabrik),<br />
unmittelbar am Rheinufer und <strong>de</strong>r Eisenbahn gelegen.<br />
1905 durch Brand fast völlig zerstört, dann mit wesentlicher<br />
Kapazitätserweiterung als mo<strong>de</strong>rnste Mühle wie<strong>de</strong>raufgebaut.<br />
Die Uferfrontseite wur<strong>de</strong> dabei wegen <strong>de</strong>r Sichtbeziehung zum<br />
Mannheimer Schloß beson<strong>de</strong>rs aufwändig gestaltet. 1931 Sitzverlegung<br />
nach Ludwigshafen. 1945 bei Bombenangriffen erneut<br />
zerstört, Wie<strong>de</strong>raufbau 1951 abgeschlossen. 1970 in eine<br />
GmbH umgewan<strong>de</strong>lt. Bis dahin Börsennotiz Mannheim bzw.<br />
Frankfurt; neben <strong>de</strong>r jahrzehntelang beteiligten Rhenania<br />
Schifffahrts- und Speditions-Ges. in Mannheim erscheint in<br />
<strong>de</strong>n 1930er Jahren die Südzucker als Mehrheitsaktionär, zuletzt<br />
besaß die Bremer Rolandmühle mehr als 25 %. Die einst<br />
größte und mo<strong>de</strong>rnste Mühle Europas wur<strong>de</strong> 1985 stillgelegt.<br />
In <strong>de</strong>m mit großem Aufwand umgebauten Gebäu<strong>de</strong>komplex eröffnete<br />
1998 ein Einkaufs- und Kinocenter, das heute <strong>de</strong>r Metro-Gruppe<br />
gehört.<br />
Los 769 Schätzwert 50-100 €<br />
Lugauer Kammgarn-Spinnerei<br />
vorm. F. Hey AG<br />
Lugau (Erzgeb.), Aktie 500 RM<br />
16.12.1941 (Auflage 900, R 5) EF<br />
Hergestellt wur<strong>de</strong>n Garne aus reiner Wolle, Mischgarne und<br />
Zellwollgarne. Die Fabrik wur<strong>de</strong> nach 1945 enteignet, die AG<br />
selbst verlegte auf Betreiben <strong>de</strong>s Großaktionärs (Glanzstoff AG<br />
Wuppertal-Elberfeld) 1964 ihren Sitz nach Dettingen a.Erms<br />
und trat dort in Abwicklung.<br />
71
Los 770 Schätzwert 200-250 €<br />
M. Melliand Chemische Fabrik AG<br />
Mannheim, Aktie 1.000 Mark Okt. 1923<br />
(Auflage 25000, R 12) VF<br />
Einzelstück aus <strong>de</strong>m Reichsbankschatz, nur ein<br />
einziges weiteres unentwertetes Stück ist bekannt.<br />
Leichter Rostfleck und Verfärbungen links.<br />
Gründung 1921. Herstellung chemischer Produkte insbeson<strong>de</strong>re<br />
für die Textilindustrie. Ab 1923 gab die Firma für ihre Kun<strong>de</strong>n<br />
die sehr aufwändig produzierten “Melliands Textilberichte”<br />
heraus. 1925 Beschluß <strong>de</strong>r Auflösung und Liquidation.<br />
Los 771 Schätzwert 25-50 €<br />
M. Pech AG für sanitären Bedarf<br />
Berlin, Aktie 10 x 1.000 Mark 20.10.1923<br />
(R 3) EF<br />
Gründung 1906, Sitz bis 1910 in Düsseldorf. Fabrikation von<br />
sanitären, chirurgischen und medizinischen Artikeln, Einrichtung<br />
von Krankenhäusern und Kliniken. 1925 hatte die Gesellschaft<br />
28 Filialen u.a. in Köln, Düsseldorf, Dres<strong>de</strong>n, Breslau,<br />
Mag<strong>de</strong>burg, Mannheim und Berlin.<br />
Los 772 Schätzwert 60-120 €<br />
Mälzerei Wre<strong>de</strong> AG<br />
Köthen in Anhalt, Aktie 100 RM Jan. 1942<br />
(Auflage 300, R 5) EF<br />
Gründung 1865, AG seit 1889. Malzfabriken in Köthen, Oschersleben<br />
(vorm. Malzfabrik Heinrich Bormann, 1924 erworben),<br />
Giersleben (seit 1932 stillgelegt, Vorbesitzer war die<br />
Schlegel-Scharpenseel-Brauerei AG in Bochum) und Wegeleben<br />
im Ostharz (1937 Übernahme <strong>de</strong>r Malzfabrik Wegeleben<br />
GmbH). Ferner mehrheitlich beteiligt bei <strong>de</strong>r Malzfabrik Rheinpfalz<br />
AG in Pfungstadt (Hessen) mit Werken in Bruchsal (vorm.<br />
Moritz & Söhne) und Kirchheim/Teck (vorm. Gebr. Hammel).<br />
Börsennotiz Berlin. Nach Enteignung <strong>de</strong>r vier Werke in <strong>de</strong>r Ostzone<br />
beschränkte sich die Tätigkeit auf die Verwaltung <strong>de</strong>r<br />
Rheinpfalz-Beteiligung, <strong>de</strong>r Sitz <strong>de</strong>r AG wur<strong>de</strong> nach Hamburg<br />
(1951) bzw. Frankfurt/Main (1952) verlegt. Ab 1966 GmbH.<br />
Los 773 Schätzwert 30-80 €<br />
Märkisches Elektricitätswerk AG<br />
Berlin, Namens-Aktie 10.000 RM Juli<br />
1928 (Auflage 2000, R 5) EF<br />
Gründung 1900 durch die A.E.G. als erstes Überlandwerk in<br />
<strong>de</strong>r Provinz Bran<strong>de</strong>nburg, wo es etwa 100 örtliche Elektrizitätswerke<br />
gab. In Finow bei Eberswal<strong>de</strong> wur<strong>de</strong> am Hohenzollernkanal<br />
nach Plänen von Prof. Klingenberg ein Steinkohlen-Kraftwerk<br />
errichtet. 1916 erwarb die Provinz Bran<strong>de</strong>nburg die Aktienmehrheit.<br />
1931 brachte <strong>de</strong>r Freistaat Mecklenburg-Schwerin<br />
seine Lan<strong>de</strong>selektrizitätswerke ein. 1934 schließlich wur<strong>de</strong><br />
72<br />
die Ueberlandzentrale Pommern eingeglie<strong>de</strong>rt. Damit versorgte<br />
das MEW 6.412 Städte und Gemein<strong>de</strong>n in ganz Bran<strong>de</strong>nburg,<br />
Mecklenburg und Pommern sowie <strong>de</strong>n Kreis Lüneburg rechts<br />
<strong>de</strong>r Elbe.<br />
Los 774 Schätzwert 200-250 €<br />
MAG Maschinenfabrik AG Geislingen<br />
Hei<strong>de</strong>lberg, Aktie 20 RM 2.2.1925<br />
(Auflage 5760, R 10) VF<br />
Nur 3 Stück lagen im Reichsbankschatz. Mittig leicht<br />
durchgerostete Rostspur von einer Steckna<strong>de</strong>l.<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1883 nach Übernahme <strong>de</strong>r Industrie-Gesellschaft<br />
Geislingen (gegrün<strong>de</strong>t 1850 durch Daniel Straub). Bis 1913 firmierte<br />
die Gesellschaft als Maschinenfabrik Geislingen. Sitz <strong>de</strong>r<br />
Gesellschaft bis zum 2.2.1925 in Geislingen. Maschinenfabrikation.<br />
Hergestellt wur<strong>de</strong>n u.a. Wasserturbinen, Universalmühlen,<br />
Steinschrotmühlen und Tafelwagen. Der kaufmännische Betrieb<br />
wur<strong>de</strong> nach Hei<strong>de</strong>lberg verlegt, da die Fabrikation <strong>de</strong>s Unternehmens<br />
fortan in Anlehnung an die Schnellpressenfabrik Hei<strong>de</strong>lberg<br />
(heute “Hei<strong>de</strong>lberger Druckmaschinen AG”) geschah. 1929<br />
Übernahme durch die Schnellpressenfabrik Hei<strong>de</strong>lberg im Wege<br />
<strong>de</strong>r Verschmelzung (Aktientausch 1:1). Nach <strong>de</strong>m Kriege fortgesetzter<br />
grosszügiger Ausbau <strong>de</strong>r Werksanlagen in Geislingen.<br />
Los 775 Schätzwert 200-250 €<br />
Mag<strong>de</strong>burger Bank AG<br />
Mag<strong>de</strong>burg, Aktienanteilschein 5<br />
Goldmark 5.3.1925 (R 10) EF<br />
Maschinenschriftliche Ausführung, mit Originalunterschriften.<br />
Zuvor völlig unbekannt gewesen, nur<br />
3 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1922 unter Übernahme <strong>de</strong>r seit 1880 bestehen<strong>de</strong>n<br />
Mag<strong>de</strong>burger Creditbank (geschäftsansässig Otto v. Guerikkestr.<br />
100). Nach <strong>de</strong>r Inflation war die Kapital<strong>de</strong>cke so dünn<br />
(Kapitalumstellung 400:1), daß die Bank eine Anlehnung an einen<br />
größeren Konzern o<strong>de</strong>r eine Fusion anstrebte. Nach<strong>de</strong>m<br />
entsprechen<strong>de</strong> Verhandlungen ergebnislos verlaufen waren,<br />
trat die AG 1925 in Liquidation.<br />
Los 776 Schätzwert 60-120 €<br />
Mag<strong>de</strong>burger Bau- und Credit-Bank<br />
Mag<strong>de</strong>burg, Aktie 100 RM 12.9.1928<br />
(Auflage 2000, R 6) VF<br />
Gegrün<strong>de</strong>t im Dez. 1871. Zweck war Kauf und Verkauf, Parcellirung<br />
und Bebauung von Grundstücken. Die Gesellschaft besaß<br />
eine Thonwaaren-Fabrik in Mag<strong>de</strong>burg, eine Ziegelei bei<br />
Schönebeck und einen Bauhof in Neustadt-Mag<strong>de</strong>burg. Spezialität<br />
war die Erbauung von Beamten- und Arbeiter-Wohnungen<br />
für industrielle Großkun<strong>de</strong>n. Die Ges. befand sich nach<br />
Aufhebung <strong>de</strong>s Konkursverfahrens 1933 in Liquidation. 1937<br />
wur<strong>de</strong> erneut ein Konkursverfahren eröffnet.<br />
Los 777 Schätzwert 225-300 €<br />
Mag<strong>de</strong>burger Kabelwerke AG<br />
vorm. Carl Mühlstephan<br />
Mag<strong>de</strong>burg, Aktie 1.000 Mark 26.1.1922.<br />
Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 5500, R 9) VF+.<br />
Großes Querformat, schöne Umrahmung mit sakralem<br />
Ornamentfries. Aktien dieser Ges. waren<br />
zuvor vollkommen unbekannt, nur 6 Stück wur<strong>de</strong>n<br />
im Reichsbankschatz gefun<strong>de</strong>n.<br />
Schon vor <strong>de</strong>r Jahrhun<strong>de</strong>rtwen<strong>de</strong> grün<strong>de</strong>te Carl Mühl-Stephan<br />
seine Mag<strong>de</strong>burger Hanf- und Drahttaufabrik in <strong>de</strong>r Gr. Wasserturmstraße.<br />
Hergestellt wur<strong>de</strong>n Drahtseile für Bergwerke,<br />
Dampfpflüge, Aufzüge, Kräne, Transmissionen und Seilbahnen<br />
sowie Hanfseile für Aufzüge, Transmissionen und Schiffahrt.<br />
1922 wur<strong>de</strong> die Fabrik, zu <strong>de</strong>r auch eine Drahtfeinzieherei und<br />
Verzinkerei gehörte, durch Vermittlung jüdischer Geschäftsleute<br />
aus Berlin und Pirmasens in eine AG eingebracht. Schon<br />
kurz nach <strong>de</strong>r Gründung waren die Initiatoren und <strong>de</strong>r Vorbesitzer<br />
Mühlstephan, <strong>de</strong>r als Gegenwert für die eingebrachte Fabrik<br />
2/3 <strong>de</strong>r Aktien erhalten hatte, hoffnungslos zerstritten.<br />
Man prozessierte miteinan<strong>de</strong>r, blockierte sich gegenseitig die<br />
HV-Beschlüsse, und schließlich kam es zu <strong>de</strong>r einmalig kuriosen<br />
Situation, daß im Sommer 1923 noch eine Kapitalerhöhung<br />
von 5,5 Mio. auf 100 Mio. M beschlossen wur<strong>de</strong>, obwohl<br />
bereits das Konkursverfahren eröffnet war. Die Streitigkeiten<br />
bekamen <strong>de</strong>r AG schlecht: 1927 als vermögenslos von Amts<br />
wegen gelöscht. Das Werk wur<strong>de</strong> später als Zweigwerk <strong>de</strong>r<br />
Puth KG aus Blankenstein-Ruhr weitergeführt, spezialisiert auf<br />
Feuerlöschbedarf. Hermann Becker (geb. 1879), Grün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r in<br />
Mag<strong>de</strong>burg bis heute bestehen<strong>de</strong>n Firma Seil-Becker, machte<br />
bei Carl Mühlstephan sen. eine Seilerlehre und arbeitete dort<br />
1914-18 als Geselle, ehe er sich selbständig machte.<br />
Los 778 Schätzwert 100-150 €<br />
Mag<strong>de</strong>burger Viehmarkt-Bank AG<br />
Mag<strong>de</strong>burg, Aktie 1.000 RM 19.4.1938<br />
(Auflage 100, R 6) EF<br />
Gründung 1893 zur Hebung <strong>de</strong>r Geschäftsverbindungen zwischen<br />
Schlachtviehkäufern und Händlern, außer<strong>de</strong>m Betrieb<br />
<strong>de</strong>r Schlachtviehversicherung und von Bankgeschäften. Das<br />
Kapital hielten 1943 fast ausschließlich die Fleischer von Mag<strong>de</strong>burg.<br />
Nach <strong>de</strong>m Krieg nicht verlagert, laut Handbuch geschlossen.<br />
Los 779 Schätzwert 20-50 €<br />
Main-Kraftwerke AG<br />
Frankfurt a.M., Aktie 1.000 RM Dez. 1929<br />
(Auflage 21100, R 2) EF<br />
Dekorative Guillochenumrandung.<br />
Nr. 774 Nr. 777<br />
Gründung 1911. Hauptgrün<strong>de</strong>r waren die “Felten und Guilleaume-Lahmeyerwerke<br />
AG”, Köln und die “Elektrizitäts-AG vorm.<br />
W. Lahmeyer & Co.”, Frankfurt nach <strong>de</strong>m bewährten Muster,<br />
dass durch Gründung von Kraftwerksbetrieben die eigenen elektrotechnischen<br />
Erzeugnisse mehr Absatz fan<strong>de</strong>n. Später<br />
kam (<strong>de</strong>r noch heutige) Großaktionär RWE dazu. Die Gesellschaft<br />
belieferte in <strong>de</strong>r sehr industriereichen Umgebung Frankfurts<br />
fast 400 Gemein<strong>de</strong>n mit über 300.000 Einwohnern mit Energie.<br />
Börsennotiz Frankfurt.<br />
Los 780 Schätzwert 25-50 €<br />
Mainzer Aktien-Bierbrauerei<br />
Mainz, 5 % <strong>Teil</strong>schuldv. 1.000 RM April<br />
1938 (Auflage 1605, R 4) EF<br />
Originalunterschriften.<br />
Gründung 1859 als “Brey’sche Actien-Bierbrauerei”, 1872<br />
Umfirmierung wie oben. 1917/18 Erwerb <strong>de</strong>r Brauereien Jean<br />
Rühl in Worms, Taunusbrauerei Biebrich, Ferd. Nachbauer in<br />
Kastel, Gebr. Becker in Gonsenheim und Fr. Kurz in Weilburg.<br />
1968 erwarb die Frankfurter Binding-Brauerei (Oetker-Konzern)<br />
die Aktienmehrheit und pachtete 1972 <strong>de</strong>n Betrieb. Im<br />
gleichen Jahr, auf Betreiben <strong>de</strong>s Großaktionärs, Fusion mit <strong>de</strong>r<br />
Brauerei Schrempp AG in Karlsruhe, <strong>de</strong>r Aktienbrauerei Eisenach<br />
in Bad Hersfeld, <strong>de</strong>r Brauerei Heinrich Fels GmbH in<br />
Karlsruhe und <strong>de</strong>r Hofbrauhaus Nicolay AG in Hanau. Seit<strong>de</strong>m<br />
eine reine Grundstücksverwaltung mit Mehrheitsbeteiligungen<br />
an <strong>de</strong>r Allgäuer Brauhaus AG in Kempten, <strong>de</strong>r Bayerische Brauerei<br />
Schuck-Jaenisch GmbH in Kaiserslautern, <strong>de</strong>r Erbacher<br />
Brauhaus Jakob Wörner & Söhne KG in Erbach und <strong>de</strong>r Selters<br />
Mineralquelle Augusta Victoria GmbH in Löhnberg.<br />
Los 781 Schätzwert 125-175 €<br />
Malzfabrik Etgersleben AG<br />
Etgersleben, Actie 1.000 Mark 17.6.1898.<br />
Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 350, R 10) VF<br />
Einzelstück aus <strong>de</strong>m Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1898 als Malzfabrik Etgersleben AG. 1914 Übernahme<br />
<strong>de</strong>r Malzfabrik Blanke & Schmidt in Mag<strong>de</strong>burg-Buckau.<br />
Seit 1916 auch Gemüsetrocknung. 1917/18 Übernahme <strong>de</strong>r<br />
Malzfabriken J. Eisenberg in Erfurt und Umfirmierung in Malzfabriken<br />
J. Eisenberg & Etgersleben AG. 1941 erneute Umfirmierung<br />
in Vereinigte Malzfabriken Erfurt & Etgersleben AG.<br />
Börsennotiz: Freiverkehr Leipzig.<br />
Los 782 Schätzwert 30-75 €<br />
Malzfabriken Langensalza<br />
und Wolff Söhne Erfurt AG<br />
Erfurt, Aktie 100 RM Febr. 1942 (Auflage<br />
1000, R 4, kompletter Neudruck <strong>de</strong>s<br />
Aktienkapitals, R 4) EF<br />
Gründung 1872 als Aktien Malzfabrik Langensalza. 1915/16<br />
Erwerb <strong>de</strong>r Anlagen <strong>de</strong>r in Konkurs geratenen Mittel<strong>de</strong>utschen<br />
Malzfabrik in Langensalza, wo danach Hafernährmittel herge-
stellt wur<strong>de</strong>n. 1921 Übernahme <strong>de</strong>r Malzfabrik Hermann Wolff<br />
& Söhne in Erfurt und Umfirmierung in Aktien Malzfabrik Langensalza<br />
und Hermann Wolff & Söhne AG (1927 erneute Umfirmierung<br />
in Malzfabriken Langensalza und Wolff Söhne Erfurt<br />
AG). 1928/29 verhob man sich in <strong>de</strong>r Weltwirtschaftskrise an<br />
<strong>de</strong>m kreditfinanzierten Kauf <strong>de</strong>r Aktienmehrheit <strong>de</strong>s lokalen<br />
Erzkonkurrenten Malzfabriken J. Eisenberg & Etgersleben von<br />
<strong>de</strong>r Commerzbank und <strong>de</strong>m Bankhaus A. E. Wassermann für<br />
2,4 Mio. RM: 1932 wur<strong>de</strong>n diese Aktien <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Banken<br />
gegen For<strong>de</strong>rungsverzicht zurückübertragen, außer<strong>de</strong>m mußten<br />
<strong>de</strong>n Banken noch 1,2 Mio. RM “Abfindung” gezahlt wer<strong>de</strong>n.<br />
Nach 1945 enteignet.<br />
Los 783 Schätzwert 100-150 €<br />
Manganbergwerk<br />
“Vereinigte Julian & Finsterthal”<br />
Hannover, Namens-Anteilschein 1 Anteil<br />
1.12.1918 (Auflage 1000, R 7) VF+<br />
Sehr schöne Gestaltung mit Farnen im Unterdruck.<br />
In <strong>de</strong>r Umgebung <strong>de</strong>s westthüringischen Kurortes Schmalkal<strong>de</strong>n<br />
wur<strong>de</strong>n seit jeher Vorkommen von Brauneisenstein und<br />
Schwerspat gefun<strong>de</strong>n und ausgebeutet. Im Jahr 1921 stan<strong>de</strong>n<br />
im Revier Schmalkal<strong>de</strong>n vor allem zwei Unternehmen in aktiver<br />
För<strong>de</strong>rung: Die in 1.000 Kuxen geteilte Stahlberger Gewerkschaft<br />
(manganhaltiger Brauneisenstein) sowie die hun<strong>de</strong>rtteilige<br />
Gewerkschaft Mommel mit ihren drei Gruben Mommel und<br />
Achenbach bei Herges - Vogtei sowie Klinge bei Lautenbach.<br />
Das Manganbergwerk “Vereinigte Julian & Finsterthal” war eine<br />
Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit 3.500 Anteilen. Ob<br />
dieses Unternehmen jeweils in aktive För<strong>de</strong>rung gelangt ist,<br />
ließ sich nicht herausfin<strong>de</strong>n.<br />
Los 784 Schätzwert 150-250 €<br />
Mannheimer Milchzentrale AG<br />
Mannheim, Namens-Aktie 200 Mark Mai<br />
1914. Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 150, R 6),<br />
ausgestellt auf die Stadtgemein<strong>de</strong> Mannheim,<br />
1915 übertragen auf <strong>de</strong>n Badischen<br />
Frauenverein Zweigverein Mannheim UNC-EF<br />
Großformatiges Papier mit schöner Umrahmung<br />
im Historismus-Stil. Einer <strong>de</strong>r interessantesten<br />
Mannheimer Regionalwerte.<br />
Die 1911 als Genosschenschaft gegrün<strong>de</strong>te Milchzentrale errichtete<br />
1912 auf einem über 27.000 qm großen Grundstück in<br />
<strong>de</strong>r Mannheimer Innenstadt (Viehhofstr. 50) eine hochmo<strong>de</strong>rne<br />
neue Molkerei, die später in <strong>de</strong>r Spitze bis zu 500 Mitarbeiter<br />
beschäftigte. 1914 in eine AG umgewan<strong>de</strong>lt. „Die Gesellschaft<br />
dient <strong>de</strong>m gemeinnützigen Zwecke, <strong>de</strong>n Bewohnern <strong>de</strong>r Stadt<br />
Mannheim, insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>n min<strong>de</strong>rbemittelten Volksklassen,<br />
möglichst gute und billige Milch und Milchprodukte zu verschaffen.“<br />
Die in <strong>de</strong>m Unternehmen stark engagierte Stadt<br />
Mannheim besaß das Bestellungsrecht für zwei <strong>de</strong>r drei Vorstandsmitglie<strong>de</strong>r.<br />
Aktionäre waren zu Beginn <strong>de</strong>r 1960er Jahre<br />
die Milcherzeugergenossenschaft Mannheim eGmbH (35 %),<br />
die Stadt Mannheim (32 %), die Landw. Genossenschaftsberatung<br />
GmbH, Karlsruhe (14 %), die Raiffeisen-Zentralkasse<br />
Rheinpfalz eGmbH, Ludwigshafen (12 %) und <strong>de</strong>r Milchhändlerverein<br />
Mannheim e.V. (7 %). 1967 Übernahme <strong>de</strong>r Hei<strong>de</strong>lberger<br />
Milchversorgung GmbH und Umfirmierung in „Milchzentrale<br />
Mannheim-Hei<strong>de</strong>lberg AG“. Neben <strong>de</strong>m Hauptwerk in<br />
Mannheim bestan<strong>de</strong>n nun Zweigbetriebe in Hei<strong>de</strong>lberg, Schefflenz,<br />
Osterburken, Tauberbischofsheim und Wertheim. Ab 1983<br />
verstärkte Zusammenarbeit mit <strong>de</strong>r Milchzentrale Karlsruhe<br />
GmbH und erneute Umfirmierung in „Milchzentrale Nordba<strong>de</strong>n<br />
AG“. 1984 Übernahme <strong>de</strong>r Frischdienst-Zentrale Kurpfalz<br />
GmbH. In Betrieb waren nun noch die Werke Mannheim und<br />
Schefflenz, die zusammen ca. 100 Mio. kg Milch im Jahr verarbeiteten.<br />
Inzwischen hatte die Milcherzeugergenossenschaft<br />
Mannheim-Hei<strong>de</strong>lberg eG ihren Anteil auf 98,1 % ausgebaut.<br />
Noch 1998 - <strong>de</strong>r Jahresumsatz lag inzwischen über 200 Mio.<br />
DM - wur<strong>de</strong> das Mannheimer Werk für die Herstellung von Molkereifrischprodukten<br />
vollständig automatisiert, während sich<br />
das Werk Schefflenz auf die Herstellung von Frischkäse spezialisierte.<br />
Der Konkurrenz <strong>de</strong>r Nahrungsmittel-Multis wie Danone<br />
o<strong>de</strong>r Unilever vermochten die Mannheimer auf die Dauer aber<br />
nicht standzuhalten: Die zuletzt noch 70 Mitarbeiter dort verloren<br />
nach <strong>de</strong>r Produktionseinstellung 2001 ihre Arbeit, das Werk<br />
Schefflenz mit 35 Beschäftigten wur<strong>de</strong> an die holländische<br />
Campina Melkunie verkauft. Seither befin<strong>de</strong>t sich die AG in Liquidation,<br />
die ständig drohen<strong>de</strong> Insolvenzgefahr wur<strong>de</strong> erst<br />
2007 mit <strong>de</strong>m Verkauf <strong>de</strong>s früheren Werksgelän<strong>de</strong>s in <strong>de</strong>r<br />
Mannheimer Innenstadt für 10 Mio. Euro gebannt.<br />
Los 785 Schätzwert 30-75 €<br />
Marathon-Werke AG<br />
Chemnitz, Aktie 100 RM 23.6.1939<br />
(Auflage 500, R 5) EF<br />
Gründung am 11.11.1872 als Deutsche Werkzeugmaschinen-<br />
Fabrik vorm. Son<strong>de</strong>rmann & Stier AG, am 26.10.1912 geän<strong>de</strong>rt<br />
in Son<strong>de</strong>rmann & Stier AG, ab 9.3.1938 Marathon-Werke<br />
AG. Herstellung von Werkzeugmaschinen, insbeson<strong>de</strong>re von<br />
Präzisions-Drehbänken. 1929 wur<strong>de</strong> die Abt. Werkzeugmaschinen<br />
<strong>de</strong>n Deutschen Niles-Werken, Berlin-Weißensee, angeglie<strong>de</strong>rt.<br />
Im gleichen Jahr wur<strong>de</strong> die Abt. Textilmaschinen<br />
von <strong>de</strong>r Schubert & Salzer Maschinenfabrik AG, Chemnitz, übernommen.<br />
Ab 1936/37 Wie<strong>de</strong>raufnahme <strong>de</strong>r Produktion.<br />
Los 786 Schätzwert 25-50 €<br />
Marschel Frank Sachs AG<br />
Chemnitz, Aktie 1.000 RM 7.12.1927<br />
(Auflage 7920, R 3) EF<br />
Bei <strong>de</strong>r Gründung 1921 wur<strong>de</strong>n die Betriebe <strong>de</strong>r jüdischen Textilunternehmer<br />
Marschel, Frank und Sachs in dieser AG zusammengefasst.<br />
Neben <strong>de</strong>m Marschelwerk und <strong>de</strong>m Frankwerk<br />
in Chemnitz waren dies das Sachswerk in Böhringen,<br />
Spinnereien in Mag<strong>de</strong>burg und Wilischthal, ein Werk in Zschopau<br />
sowie weitere kleinere Betriebe. Mit über 6.000 Beschäftigten<br />
(davon allein 2.500 im Marschelwerk) war die Firma <strong>de</strong>r<br />
grösste integrierte Trikotagenhersteller Kontinentaleuropas.<br />
1933 mussten die jüdischen Hauptaktionäre ihre Vorstandsund<br />
Aufsichtsratsposten räumen, 1938 war die “Arisierung”<br />
<strong>de</strong>r AG unter Fe<strong>de</strong>rführung <strong>de</strong>r Deutschen Bank auch kapitalmäßig<br />
abgeschlossen, zugleich dann Umfirmierung in Mafrasa<br />
AG. In <strong>de</strong>r DDR dann enteignet, später war <strong>de</strong>r VEB Trikotex <strong>de</strong>r<br />
grösste Trikotagenhersteller <strong>de</strong>r DDR und wur<strong>de</strong> nach <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong><br />
vom west<strong>de</strong>utschen Konkurrenten Schiesser übernommen.<br />
Die AG selbst erwachte nach <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> zur Geltendmachung<br />
von Restitutionsansprüchen ebenfalls wie<strong>de</strong>r zum Leben: 1995<br />
Beschluß <strong>de</strong>r Fortsetzung <strong>de</strong>r Gesellschaft als Mafrasa Textilwerke<br />
AG, Chemnitz.<br />
Los 787 Schätzwert 75-100 €<br />
Maschinen- und Armaturenfabrik<br />
vorm. H. Breuer & Co.<br />
Höchst a. M., 5 % Genußrechtsurkun<strong>de</strong><br />
100 RM 1.10.1927 (R 8) EF<br />
Wertpapiere dieser interessanten Ges. waren zuvor<br />
völlig unbekannt.<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1872 als Armaturenfabrik von H. Breuer & Co. in<br />
Höchst, 1896 unter Einschluß <strong>de</strong>r früheren Deutsche Wasserwerks-Gesellschaft<br />
Umwandlung in eine AG. Hergestellt wur<strong>de</strong>n<br />
zunächst Armaturen wie Schieber für Gas-, Wasser-, Ka-<br />
nal- und Dampfleitungen. Im Laufe <strong>de</strong>r Jahre wur<strong>de</strong> das Fertigungsprogramm<br />
erweitert um Rangierlokomotiven, Pumpen,<br />
Wasserturbinen sowie luft- und wassergekühlte Motoren (beson<strong>de</strong>rs<br />
bekannt wur<strong>de</strong>n 2-Zylin<strong>de</strong>r-Zweitaktmotoren in Magirus-Tragkraftspritzen<br />
und 2-Zylin<strong>de</strong>r-Boxermotoren für Stromaggregate<br />
<strong>de</strong>r Wehrmacht, aber auch Flugzeug-, Stern- und<br />
Dieselmotoren wur<strong>de</strong>n produziert). 1923 Aktien-Umtausch-Angebot<br />
<strong>de</strong>r Bu<strong>de</strong>rus’schen Eisenwerke an die Breuer-Aktionäre<br />
(3 Breuer-Aktien : 2 Bu<strong>de</strong>rus-Aktien). 1930 wur<strong>de</strong> noch <strong>de</strong>r<br />
Betrieb <strong>de</strong>r Geigerschen Fabrik GmbH in Karlsruhe übernommen<br />
(tätig auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>r Städteentwässerung und Abwasserverwertung).<br />
Kurz vor Kriegsen<strong>de</strong> übernahmen die<br />
Breuerwerke 1943 von ihrer Mutter Bu<strong>de</strong>rus auch noch ein<br />
Werk in Hirzenhain, wo zuvor Öfen und Ba<strong>de</strong>wannen hergestellt<br />
wor<strong>de</strong>n waren, um dort mit Zwangsarbeitern insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>n<br />
Panzerkampfwagen VI Tiger zu produzieren. Die Breuerwerke,<br />
inzwischen eine GmbH, wur<strong>de</strong>n 1969 von Kraus-Maffei in<br />
München übernommen.<br />
Der Panzerwagen VI Tiger<br />
Los 788 Schätzwert 75-150 €<br />
Maschinenbau-AG<br />
vorm. Beck & Henkel<br />
Kassel, Aktie 100 RM Sept. 1940 (Auflage<br />
400, R 7) EF<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1878 durch Carl Beck, <strong>de</strong>n Sohn eines Zündholzfabrikanten,<br />
und <strong>de</strong>n Ingenieur Gustav Henkel. Beck hatte bereits<br />
einige Jahre in <strong>de</strong>n USA in St. Louis eine Zündholzfabrik betrieben<br />
und konstruierte nun Zündholzmaschinen, die er sogar<br />
nach Schwe<strong>de</strong>n in’s Mutterland <strong>de</strong>s Zündholzes zu exportieren<br />
vermochte. Auch die erste südamerikanische Zündholzfabrik in<br />
Caracas wur<strong>de</strong> 1881 von Beck & Henkel erbaut, womit auch<br />
die erste Dampfmaschine nach Venezuela kam. 1888 expandierte<br />
die Firma mit <strong>de</strong>r Lieferung von 60 dampfmaschinenbetriebenen<br />
Portalkränen an <strong>de</strong>n Hamburger Hafen so stark, daß<br />
1889 die Umwandlung in eine AG möglich wur<strong>de</strong>. 1891 Erwerb<br />
<strong>de</strong>r Gießerei Theodorshütte zu Bre<strong>de</strong>lar i.W. (nach <strong>de</strong>r Weltwirtschaftskrise<br />
1932 stillgelegt). Die Fabrik in <strong>de</strong>r Wolfhager<br />
Str. 40 produzierte nun Krane, Aufzüge, Einrichtungen für<br />
Schlachthöfe (B&H war <strong>de</strong>r führen<strong>de</strong> europäische Schlachthofausstatter),<br />
Tierkörperverwertung und Abwasser-Kläranlagen<br />
sowie Düngerpressen. Die Aktien notierten in Frankfurt, 1939<br />
“Wechsel in <strong>de</strong>r Aktienmehrheit <strong>de</strong>r Gesellschaft”. 1964 Einrichtung<br />
eines Zweigwerkes in Gu<strong>de</strong>nsberg und Aufnahme <strong>de</strong>r<br />
Fertigung von Rolltreppen. 1969 Umwandlung in eine GmbH<br />
und vollständige Verlagerung <strong>de</strong>r Produktion nach Gu<strong>de</strong>nsberg.<br />
Das Kasseler Werksgelän<strong>de</strong> Wolfhager Straße/Westring übernahm<br />
<strong>de</strong>r Rüstungsproduzent Wegmann. Heute ist B&H ein <strong>Teil</strong><br />
<strong>de</strong>s Rheinmetall-Konzerns.<br />
Nr. 789<br />
Los 789 Schätzwert 30-60 €<br />
Maschinenbau-Anstalt Humboldt<br />
(überdruckt Humboldt-Deutzmotoren AG)<br />
Köln-Kalk, Aktie 100 RM März 1927<br />
(Auflage 63750, ab Febr. 1928 unter<br />
11000, R 6) EF<br />
Bei <strong>de</strong>r Neustückelung <strong>de</strong>s Kapitals im Febr. 1928<br />
wur<strong>de</strong>n für die (neu) 11000 Stück 100-RM-Aktien<br />
sowohl Urkun<strong>de</strong>n neu gedruckt wie auch Urkun<strong>de</strong>n<br />
vom März 1927 weiter verwen<strong>de</strong>t; die Aufteilung<br />
läßt sich nicht eruieren.<br />
Gründung 1856 (Maschinenfabrik für <strong>de</strong>n Bergbau “Sivers &<br />
Co.”), seit 1884 AG. 1930 Fusion mit <strong>de</strong>r Motorenfabrik Deutz<br />
AG (gegrün<strong>de</strong>t 1864 von N. A. Otto und E. Langen als erste Motorenfabrik<br />
<strong>de</strong>r Welt) und <strong>de</strong>r Motorenfabrik Oberursel AG zur<br />
Humboldt-Deutzmotoren-AG. 1936 Übernahme <strong>de</strong>r Magirus<br />
AG in Ulm (gegrün<strong>de</strong>t 1864 als Spezialfabrik für Feuerwehrgeräte,<br />
ab 1918 auch Fahrzeugbau).1938 Interessengemeinschaft<br />
mit <strong>de</strong>r Klöckner-Werke AG in Duisburg und Umfirmierung<br />
in Klöckner-Humboldt-Deutz AG. Übernahme <strong>de</strong>r Vereinigte<br />
West<strong>de</strong>utsche Waggonfabriken AG (1959), <strong>de</strong>r Maschinenfabrik<br />
Fahr AG, Gottmadingen (1961) und <strong>de</strong>r WEDAG Westfalia<br />
Dinnendahl Gröppel AG, Bochum (1969). Die 1974 begonnene<br />
Kooperation mit FIAT bei Nutzfahrzeugen führte 1975 zur<br />
Gründung <strong>de</strong>s Gemeinschaftsunternehmens IVECO (1982 ganz<br />
an FIAT übergegangen). Neben Motoren wur<strong>de</strong>n Gasturbinen,<br />
Luftfahrtantriebe, Traktoren, Mähdrescher und Industrieanlagen<br />
hergestellt. Nach einer existenzbedrohen<strong>de</strong>n Krise in <strong>de</strong>n<br />
90er Jahre blieb <strong>de</strong>r (bis heute als Deutz AG börsennotierten)<br />
KHD nur noch das Motorenwerk in Köln-Deutz.<br />
Los 790 Schätzwert 25-50 €<br />
Maschinenbaugesellschaft Karlsruhe<br />
Karlsruhe , Aktie 100 RM Okt. 1927<br />
(Auflage 27400, kpl. Aktienneudruck nach<br />
Kapitalherabsetzung, R 4) EF<br />
Ungewöhnliche Gestaltung mit stilisierter Werksansicht.<br />
Einer <strong>de</strong>r ersten <strong>de</strong>utschen Lokomotivhersteller! Ursprung <strong>de</strong>s<br />
Unternehmens ist eine 1833 von Jakob Friedrich Messmer eröffnete<br />
und 1836 von Emil Keßler und Theodor Martiensen übernommene<br />
mechanische Werkstätte. En<strong>de</strong> 1841, kurz nach<br />
Eröffnung <strong>de</strong>r ersten badischen Eisenbahnstrecke, wur<strong>de</strong> die<br />
erste Dampflokomotive “Ba<strong>de</strong>nia” an die Badischen Staatseisenbahnen<br />
abgeliefert. 1842 wur<strong>de</strong> Emil Keßler Alleininhaber<br />
<strong>de</strong>r Fabrik, 1846 grün<strong>de</strong>te er als zweites Unternehmen die (als<br />
AG bis heute bestehen<strong>de</strong>) Maschinenfabrik Esslingen. 1847<br />
ging das Bankhaus Haber, <strong>de</strong>r Geldgeber Keßlers, in Konkurs.<br />
Kredite waren plötzlich zurückzuzahlen, Keßler verlor die Kontrolle<br />
über die Lokomotivfabrik, die 1851 liquidiert und 1852<br />
wegen ihrer strategischen Be<strong>de</strong>utung von <strong>de</strong>r badischen<br />
Staatsregierung übernommen wur<strong>de</strong>. Mit finanzieller Hilfe <strong>de</strong>s<br />
Frankfurter Bankhauses Bethmann grün<strong>de</strong>te Emil Keßler 1852<br />
in Karlsruhe ein neues Unternehmen, die “Maschinenbau-Gesellschaft<br />
Carlsruhe”, die <strong>de</strong>n Lokomotivbau wie<strong>de</strong>r aufnahm.<br />
Sie gehörte stets zu <strong>de</strong>n kleineren Herstellern. Hauptabnehmer<br />
waren die Badischen Staatsbahnen und die Königlich Hannöverschen<br />
Staatseisenbahnen, vor ihrer Verstaatlichung durch<br />
das Königreich Preußen auch die Bergisch-Märkische Eisenbahn,<br />
die Cöln-Min<strong>de</strong>ner Eisenbahn und die Rheinische Eisenbahn.<br />
1904 wur<strong>de</strong> das Werk verlegt von <strong>de</strong>r Beiertheimer Allee<br />
in die Carl-Metz-Straße, zuletzt rd. 121000 qm großes Werksgelän<strong>de</strong><br />
an <strong>de</strong>r Wattstraße in unmittelbarer Nähe <strong>de</strong>s Hauptgüterbahnhofs.<br />
Neben Lokomotiven wur<strong>de</strong>n dort Dampfmaschinen,<br />
Kessel, hydraulische Maschinen, Kältemaschinen, Dieselmotoren,<br />
Traktoren und Eisenbahnbedarfsartikel aller Art gefertigt.<br />
Mit <strong>de</strong>r Motorenwerke Mannheim AG vorm. Benz Abt. stationärer<br />
Motorenbau bestand eine Interessengemeinschaft<br />
zwecks gemeinsamer Herstellung von Motorpfer<strong>de</strong>n und<br />
Gross-Diesel-Motoren. Ab 1925 folgte eine Absatzkrise, nach<strong>de</strong>m<br />
die Reichsbahn jahrelang keine neuen Dampflokomotiven<br />
mehr bestellt hatte. Die Umstellung auf <strong>de</strong>n Bau von Diesellokomotiven<br />
scheiterte, 1929 ging die in Berlin, Frankfurt und<br />
Mannheim börsennotierte AG in freiwillige Liquidation. Die Reste<br />
<strong>de</strong>s Lokomotivbaus erwarb die Hohenzollern AG in Düsseldorf.<br />
1842-1928 hatten 2.370 Lokomotiven die Fabrik in<br />
Karlsruhe verlassen, die so namhafte Ingenieure wie Niklaus<br />
Riggenbach (<strong>de</strong>n Erfin<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Zahnradbahn), Carl Benz, Gottlieb<br />
Daimler und Wilhelm Maybach beschäftigt hatte.<br />
Los 791 Schätzwert 500-625 €<br />
Maschinenfabrik AG<br />
vorm. Wagner & Co.<br />
Cöthen, VZ-Aktie 1.000 Mark 1.6.1918<br />
(Auflage 415, R 10) VF+<br />
Zuvor völlig unbekannte Ausgabe, von <strong>de</strong>n lediglich<br />
4 im Reichsbankschatz gefun<strong>de</strong>nen Stücken<br />
ist dies das allerletzte noch verfügbare.<br />
Bereits 1856 entstand direkt am Bahnhof Köthen eine Herzogliche<br />
Eisengießerei, die 1859 vom Berliner Fabrikanten Rudolph<br />
Dinglinger übernommen wur<strong>de</strong>. Sein Vorfahr war kein Geringerer<br />
als <strong>de</strong>r Emailleur Georg Friedrich Dinglinger, Bru<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s sächsischen<br />
Hofgoldschmieds Johann Melcior Dinglinger, <strong>de</strong>ren Schaffen<br />
das Grüne Gewölbe in Dres<strong>de</strong>n die be<strong>de</strong>utendsten Stücke aus<br />
<strong>de</strong>r Zeit August <strong>de</strong>s Starken verdankt. Direkt angrenzend grün<strong>de</strong>te<br />
1860 Carl Thiel die älteste Maschinenfabrik <strong>de</strong>r Stadt. Nach Übernahme<br />
<strong>de</strong>r Betriebe durch Julius Wagner erfolgte 1890 die<br />
73
Gründung dieser AG. Die Fabrik mit 5 massiven Hallen direkt am<br />
Bahnhof Köthen besaß eine Lokomotivreparaturwerkstatt und fabrizierte<br />
Maschinen und Apparate für Papier- und Zellulosefabriken<br />
sowie Dampfkessel. In großem Umfang wur<strong>de</strong> auch Rohguss<br />
an an<strong>de</strong>re Fabriken geliefert, wobei Stücke bis zum Einzelgewicht<br />
von 40 t gegossen wer<strong>de</strong>n konnten. Großaktionär war zuletzt <strong>de</strong>r<br />
Jakob-Michael-Konzern, Börsennotiz Berlin und Freiverkehr Mag<strong>de</strong>burg.<br />
1932 Entwicklung <strong>de</strong>r Papierstoffzentrifuge “Erkensator”,<br />
zu <strong>de</strong>ren Produktion die Fabrikanlagen <strong>de</strong>r Banning & Seybold<br />
Maschinenbau in Düren übernommen wur<strong>de</strong>n. 1935 Verkauf <strong>de</strong>r<br />
Köthener Fabrikanlagen an die JUNKERSWERKE, <strong>de</strong>swegen erhielt<br />
Köthen 1937 eine Garnison, einen Flugplatz und eine Fliegertechnische<br />
Vorschule. Als Ersatz erwarb die Maschinenfabrik<br />
Wagner eine Maschinenfabrik in Herischdorf i. Riesengeb., wohin<br />
<strong>de</strong>r Firmensitz verlegt wur<strong>de</strong>, nebst Erwerb <strong>de</strong>r Fabrikanlagen <strong>de</strong>r<br />
1854 gegr. Füllnerwerke in Bad Warmbrunn (Verkäufer war die<br />
Linke-Hofmann-Buschwerke AG), wohin die Produktionsanlagen<br />
aus Köthen weitgehend überführt wur<strong>de</strong>n. Kurz darauf auch Erwerb<br />
<strong>de</strong>s ehemaligen Eisenhüttenwerkes “Marienhütte” in Kotzenau,<br />
wo die nach Verkauf <strong>de</strong>r Köthener Anlagen fehlen<strong>de</strong> Graugießerei<br />
neu eingerichtet wur<strong>de</strong>. 1939 Umfirmierung in Maschinenfabriken<br />
Wagner-Dörries AG, gleichzeitig Verkauf <strong>de</strong>r Papiermaschinenaktivitäten<br />
mit <strong>de</strong>n Werken Banning & Seybold (Düren)<br />
und Füllnerwerk (Bad Warmbrunn). Das AG-Handbuch spricht von<br />
einem “einschnei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Wechsel <strong>de</strong>s Aufgabengebietes”, was<br />
konkret hieß: In <strong>de</strong>m stark erweiterten Werk in Herischdorf wur<strong>de</strong>n<br />
nun Geschütze hergestellt, u.a. die 15-cm-Schwere Feldhaubitze<br />
18 (Nachbau einer Rheinetall-Krupp-Entwicklung). Erneute<br />
Umbenennung 1942 in Dörries-Füllner Maschinenfabriken AG mit<br />
Sitz in Bad Warmbrunn. Der Ort heißt nach <strong>de</strong>m Krieg jetzt Cieplice<br />
Slaskie-Zdroj, die Fabrik wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>n Polen übernomen. Die<br />
seinerzeit von <strong>de</strong>r Junkers Motorenbau GmbH übernommene ehemalige<br />
Wagner-Fabrik am Bahnhof in Köthen wur<strong>de</strong> ab 1951<br />
vom VEB ABUS För<strong>de</strong>ranlagenbau genutzt und erst im Sommer<br />
2007 abgerissen.<br />
Los 792 Schätzwert 75-150 €<br />
Maschinenfabrik Carl Zangs AG<br />
(Herm. Schroers Nachf.)<br />
Krefeld, Aktie 1.000 Mark von 1920.<br />
Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 4000, R 3) EF<br />
Großformat. Umrandung mit Elementen <strong>de</strong>s Jugendstils.<br />
Gründung unter Übernahme <strong>de</strong>r Herm. Schroers Maschinenfabrik<br />
Krefeld (1875 Gründung). Produktion von Webstühlen, Vorbereitungs-<br />
und Hilfsmaschinen für komplette Webereieinrichtungen.<br />
Los 793 Schätzwert 125-200 €<br />
Maschinenfabrik Esslingen<br />
Esslingen, Aktie 1.000 Mark 5.3.1908<br />
(Auflage 1100, R 6) VF+<br />
Gründung 1846, eingetragen 1866. Anfänglich auf Lokomotiven,<br />
Waggons und sonstige Eisenbahnrequisiten sowie Dampfmaschinen<br />
und Eisenkonstruktionen aller Art spezialisiert. En<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s 19. Jh. konnten mit 2500 Arbeitern knapp 100 Lokomotiven<br />
im Jahr abgeliefert wer<strong>de</strong>n. Später auch Fabrikation<br />
von Zahnrad- und Seilbahnen, Straßenwalzen, Eis- und Kühlmaschinen,<br />
Gasmotoren, Pumpwerken, Transmissionen, Dynamomaschinen,<br />
Elektromotoren, Kranen und Transportanlagen.<br />
Das 1897 übernommene (und 1928 an die AEG verkaufte) elektrotechnische<br />
Zweigwerk in Cannstadt plante und baute<br />
auch komplette Elektrizitätswerke. In diesem Zusammenhang<br />
bestan<strong>de</strong>n Beteiligungen bei <strong>de</strong>n Elektrizitätswerken in Esslingen,<br />
Urach, Freu<strong>de</strong>nstadt, Tuttlingen, Metzingen und Böblingen<br />
(später in <strong>de</strong>r 100 %igen Tochter “Württ. Gesellschaft für Elektrizitäts-Werke”<br />
zusammengefaßt). 1908 Errichtung eines neuen<br />
Werkes auf einem 250.000 m◊ großen Areal bei Mettingen,<br />
das Esslinger Fabrikareal wur<strong>de</strong> 1912 geräumt und verkauft.<br />
Das über Jahrzehnte bestehen<strong>de</strong> Zweigwerk im italienischen<br />
Saronno wur<strong>de</strong> im 1. Weltkrieg verkauft (Zahlung war “ein Jahr<br />
nach Frie<strong>de</strong>nsschluß” vereinbart). In <strong>de</strong>n 20er Jahren erwarb<br />
die Gutehoffnungshütte (GHH) die Aktienmehrheit, die 1965 an<br />
die Daimler-Benz AG weitergegeben wur<strong>de</strong>. Daimler war für<br />
seine eigene Produktion vor allem an <strong>de</strong>n Fabrikanlagen und<br />
<strong>de</strong>r Gießerei interessiert und pachtete diese, nach<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Bereich<br />
Maschinenbau an die GHH verkauft wor<strong>de</strong>n war. Auch <strong>de</strong>r<br />
Schienenfahrzeugbau wur<strong>de</strong> eingestellt, <strong>de</strong> letzte Lokomotive<br />
verließ das Werk am 21.10.1966. Noch wesentlich erweitert<br />
wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Werksbesitz 1983 durch verschmelzen<strong>de</strong> Übernahme<br />
<strong>de</strong>r “Württ. Baumwoll-Spinnerei und -Weberei” bei Esslingen<br />
a.N. und <strong>de</strong>r “Maschinen- und Werkzeugbau Zuffenhausen<br />
AG”. Bis 2004 (dann Umwandlung in eine AG & Co. oHG) als<br />
74<br />
Gelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Maschinenfabrik AG vorm. Wagner & Co. in Cöthen ca. 1920<br />
reine Immobiliengesellschaft börsennotiert gewesen, heute <strong>de</strong>r<br />
DaimlerChrysler Immobilien (DCI) zugeordnet.<br />
Los 794 Schätzwert 30-75 €<br />
Maschinenfabrik Kappel AG<br />
Chemnitz, Aktie 1.000 RM 27.1.1938<br />
(Auflage 464, R 4) EF<br />
Gründung 1860 in Kändler bei Chemnitz durch <strong>de</strong>n Fabrikanten<br />
Albert Voigt, 1867 Verlegung <strong>de</strong>r Fabrik nach Kappel, seit<br />
1872 AG als “Sächsische Stickmaschinenfabrik”, ab 1888 Firmenname<br />
wie oben. Hergestellt wur<strong>de</strong>n mit bis zu 1.500 Beschäftigten<br />
Stickmaschinen, Tüllwebstühle, Wirkmaschinen,<br />
Sägegatter- und Holzbearbeitungs-Maschinen, Motoren für<br />
Gas-, Benzin- und Rohölbetrieb, Werkzeugmaschinen sowie<br />
Schreibmaschinen. Zweck praktischer Anwendung wur<strong>de</strong> in<br />
Plauen eine eigene Stickerei betrieben, außer<strong>de</strong>m lange Zeit<br />
Alleinaktionär bei <strong>de</strong>r Sächsische Tüllfabrik AG. Börsennotiz<br />
Berlin, Dres<strong>de</strong>n und Freiverkehr Chemnitz. Im Sog <strong>de</strong>r Weltwirtschaftskrise<br />
1931 in Vergleich gegangen, als Auffanggesellschaft<br />
wur<strong>de</strong> 1932 die Maschinenfabrik Kappel GmbH gegrün<strong>de</strong>t,<br />
seit 1938 betrieb nach einer starken Aufwärtsentwikklung<br />
die AG das Geschäft wie<strong>de</strong>r selber. 1945 <strong>de</strong>montiert,<br />
Nr. 791<br />
1946 enteignet, 1951 im VEB Schleifmaschinenbau aufgegangen.<br />
1990 Gründung <strong>de</strong>s Schleifmaschinenwerks Chemnitz auf<br />
<strong>de</strong>m ehem. Kappel-Gelän<strong>de</strong>, 1995 von <strong>de</strong>r Hamburger Körber-<br />
Gruppe übernommen.<br />
Los 795 Schätzwert 30-90 €<br />
Maschinenfabrik<br />
vorm. Georg Dorst AG<br />
Oberlind-Sonneberg, Aktie 1.000 Mark<br />
23.5.1921 (Auflage 500, R 5) EF<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1891 (Schmie<strong>de</strong> bereits 1867) durch die Familie<br />
<strong>de</strong>s bekannten Dramatikers Tankred Dorst. Herstellung von<br />
Maschinen für die feinkeramische, chemische, Farben-, Bleistift<br />
und Glasindustrie. Ab 1948 VEB Thuringia Sonneberg.<br />
Los 796 Schätzwert 25-50 €<br />
Max Kohl AG<br />
Chemnitz, Aktie 200 RM Mai 1940<br />
(Auflage 4650, R 3) EF<br />
Gründung 1908. Hergestellt wur<strong>de</strong>n Einrichtungen physikalischer<br />
und chemischer Lehrzimmer für Schulen, Hörsäle und<br />
Laboratorien sowie Meßapparate für Textilfabriken. Börsennotiz<br />
Leipzig. Nach <strong>de</strong>m Krieg nicht verlagert, enteignet, gehörte zu:<br />
Mechanik, Vereinigung volkseigener Betriebe, Zweigbetrieb<br />
Max Kohl. 1949 zusammen mit Richter-Lehrgeräten als Buchungsmaschinenwerk<br />
Karl-Marx-Stadt gegrün<strong>de</strong>t, es war das<br />
DDR-Leitunternehmen für Unterrichtsmittel-Exporte. Der Imund<br />
Export von Unterrichtsmitteln unterstand direkt <strong>de</strong>m Ministerium<br />
für Volksbildung Margot Honecker.<br />
Los 797 Schätzwert 275-350 €<br />
Mech. Baumwoll-<br />
Spinnerei & Weberei Bayreuth<br />
Bayreuth, Aktie 100 RM März 1942<br />
(Auflage 1050, R 9) VF<br />
Zuvor völlig unbekannt gewesene Ausgabe. Von<br />
<strong>de</strong>n lediglich 6 dann im Reichsbankschatz gefun<strong>de</strong>nen<br />
Stücken ist dies das letzte noch verfügbare!<br />
Gründung 1853 als “Mech. Baumwollen-Spinnerei zu Bayreuth”,<br />
1877 Bau einer zweiten Spinnerei. 1886 nach Errichtung<br />
einer mechanischen Weberei umbenannt wie oben. 1924<br />
Erwerb <strong>de</strong>r Langheinrich’schen Papierfabrik, 1929 Erwerb <strong>de</strong>r<br />
stillgelegten Flachsspinnerei in Laineck bei Bayreuth und Umrüstung<br />
zu einer mo<strong>de</strong>rnen Weberei. Die noch hoch heute bestehen<strong>de</strong><br />
AG (<strong>de</strong>ren Aktien bei Valora zu Liebhaberpreisen gehan<strong>de</strong>lt<br />
wer<strong>de</strong>n) gehört seit geraumer Zeit zum Claas E. Daun-<br />
Textilkonzern.<br />
Los 798 Schätzwert 75-150 €<br />
Mechanische Baumwoll-<br />
Spinnerei & Weberei<br />
Kaufbeuren, Aktie 2.000 Mark 6.5.1922<br />
(Auflage 600, R 7) EF-VF<br />
Gründung bereits 1838, AG seit 1858. Begünstigt durch die<br />
Wasserkraft an <strong>de</strong>r Iller mit zwei Turbinen blühte <strong>de</strong>r Betrieb<br />
immer weiter auf, in <strong>de</strong>r Spitze waren fast 2.000 Webstühle installiert.<br />
1882 Übernahme <strong>de</strong>r früheren Sandholzschen Baumwollespinnerei<br />
u. Weberei in Kempten. 1950 Umfirmierung in<br />
“Th. Momm & Co. Baumwollspinnerei und Weberei AG” (das<br />
AR-Mitglied Herbert W. Momm war <strong>Teil</strong>haber beim Bankhaus<br />
Delbrück von <strong>de</strong>r Heydt & Co., Köln), 1954-56 Bau eines eigenen<br />
Wasserkraftwerkes an <strong>de</strong>r Wertach, 1857/59 zweiter Weberei-Neubau.<br />
1971 Umfirmierung in “Spinnerei und Weberei<br />
Momm AG”, seit 1976 per Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag<br />
an die Spinnerei und Weberei Pfersee, Augsburg<br />
gebun<strong>de</strong>n. Mit Traumdivi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n von 50 % die Errtragsperle<br />
<strong>de</strong>s Pfersee-Kolbermoor-Konzerns. In <strong>de</strong>n 90er Jahren in eine<br />
KG umgewan<strong>de</strong>lt.<br />
Min<strong>de</strong>stgebot: 80 %<br />
vom unteren Schätzwert<br />
Nr. 812
Los 799 Schätzwert 150-250 €<br />
Mechanische Baumwoll-<br />
Spinnerei & Weberei<br />
Kaufbeuren, Aktie 2.000 Mark 16.5.1923<br />
(Auflage 3900, R 8) VF<br />
Zuvor völlig unbekannt gewesener Jahrgang dieses<br />
be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n Textilbetriebes.<br />
Los 800 Schätzwert 10-25 €<br />
Mechanische Treibriemenweberei<br />
und Seilfabrik Gustav Kunz AG<br />
Treuen i.Sa., Aktie Lit. A 100 RM<br />
15.8.1933 (Auflage 11310, R 1) EF<br />
Gründung 1894 unter Übernahme <strong>de</strong>r seit 1868 bestehen<strong>de</strong>n<br />
Firma Gustav Kunz. Herstellung von gewebten Kamelhaartreibriemen,<br />
Baumwollriemen, Transportbän<strong>de</strong>rn, Sei<strong>de</strong>nriemen, Filtertüchern<br />
und Segeltuchen sowie Seilen aus Draht und Hanf.<br />
Während <strong>de</strong>s 2. WK Umstellung auf Rüstungsproduktion. In <strong>de</strong>r<br />
DDR Betriebsfortsetzung als VEB Mechanische Triebriemenwebereien<br />
und Seilfabrik Treuen, später auf VEB Vowetex Plauen<br />
verschmolzen.<br />
Los 801 Schätzwert 100-200 €<br />
Mechanische Weberei Ravensberg AG<br />
Schil<strong>de</strong>sche bei Bielefeld, Aktie 1.000<br />
Mark 1.6.1891. Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage<br />
1000, R 5) VF+<br />
Äußerst <strong>de</strong>korativ, große Firmenansicht.<br />
Gründung 1891. Herstellung von Leinen, Frottierwäsche,<br />
Baumwollgeweben. 1939 Erwerb <strong>de</strong>r Baumwollweberei in Hannover-Vahrenwald.<br />
1961 Fusion mit <strong>de</strong>r Bielefel<strong>de</strong>r AG für Mechan.<br />
Webereien zur Bielefel<strong>de</strong>r Webereien AG (später BIEWAG).<br />
Nr. 802<br />
Nr. 797 Nr. 799<br />
Los 802 Schätzwert 60-120 €<br />
Mechanische Weberei Sorau<br />
vorm. F. A. Martin & Co.<br />
Sorau, Aktie 1.000 Mark 25.10.1886.<br />
Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 1500, R 3) VF+<br />
Hochformat, hübsche Rankwerk-Umrahmung.<br />
Gründung bereits 1835 als Leinen- und Jacquard-Weberei für<br />
Tischwäsche und Handtücher. AG seit 1886. Neben <strong>de</strong>r Weberei<br />
auch Betrieb <strong>de</strong>r “Braunkohlengrube Martin” (verkauft<br />
1918) nebst Ziegelei (verkauft 1919) in Kunzendorf. Börsennotiz<br />
Berlin, Großaktionär war die Dresdner Bank.<br />
Los 803 Schätzwert 25-50 €<br />
Mecklenburg-Schwerinscher<br />
Domanialkapitalfonds<br />
Schwerin i.M., 4 % Rentenpfandbrief<br />
5.000 Mark 9.12.1919 (R 3) EF<br />
Ausgegeben nach Gesetz vom 3.7.1919, betreffend<br />
die Errichtung eines Siedlungsamtes für<br />
Mecklenburg-Schwerin.<br />
Los 804 Schätzwert 80-185 €<br />
Mecklenburgische Friedrich Wilhelm<br />
Eisenbahn-Gesellschaft<br />
Neustrelitz, Prior.-St.-Actie 1.000 Mark<br />
1.4.1907 (Auflage 611, R 4) EF<br />
Konzessioniert 1889 als Neustrelitz-Wesenberg-Mirower Eisenbahn,<br />
1894 Fusion mit <strong>de</strong>r Blankensee-Wol<strong>de</strong>gk-Strasburger<br />
Eisenbahn zur Mecklenburgische Friedrich Wilhelm Eisenbahn.<br />
Neben <strong>de</strong>n 83 km langen Hauptlinien auch Betrieb <strong>de</strong>r<br />
Hafenbahnen in Neustrelitz und Mirow. Zusätzlich gebaut wur<strong>de</strong><br />
1910 die 19 km lange Nebenbahn Thuwow-Feldberg und<br />
1917 zu militärischen Zwecken ein 10 km langer Abzweig von<br />
Mirow zum Müritzsee. Gesamtbahnlänge 112 km in Normalspur.<br />
In Buschhof Anschluß an die Prignitzer Eisenbahn, in<br />
Strasburg in <strong>de</strong>r Uckermark an die preuß. Staatsbahn. Mit 11<br />
Lokomotiven, 15 Personenwagen und über 100 Güterwagen<br />
wur<strong>de</strong>n pro Jahr im Schnitt 1/2 Mio. Passagiere und 1/2 Mio.<br />
t Güter beför<strong>de</strong>rt. Börsennotiz Berlin. Letzte Großaktionäre waren<br />
das Land Mecklenburg (35 %) und die Commerzbank (21<br />
%). In <strong>de</strong>r letzten größeren Verstaatlichungswelle zum<br />
1.1.1941 auf die Deutsche Reichsbahn übergegangen.<br />
Los 805 Schätzwert 75-150 €<br />
Meichsner Moda AG<br />
Chemnitz, Aktie 1.000 Mark Aug. 1922<br />
(Auflage 2000, R 6) EF-VF<br />
Gründung 1922. Herstellung und Vertrieb von Strumpfwaren.<br />
Bis 1941 Meichsner Moda AG in Abwicklung, dann Firmenän<strong>de</strong>rung<br />
in Strumpf- und Wirkwaren-Han<strong>de</strong>ls-AG. Von <strong>de</strong>n Nazi-<br />
’s “entju<strong>de</strong>t”, da Max Moda und Herr Bernstein Ju<strong>de</strong>n waren,<br />
wur<strong>de</strong>n sie vom Reich ausgebürgert und enteignet. 1946 umfirmiert<br />
in Alt-chemnitzer Strumpffabrik AG, 1953 in I<strong>de</strong>al-Werke,<br />
Altchemnitzer Strumpffabrik.<br />
Los 806 Schätzwert 150-200 €<br />
Memeler Aktien-Brauerei & Destillation<br />
Memel, Aktie 100 Thaler 15.9.1871.<br />
Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 1500, R 10) VF<br />
Einzelstück aus <strong>de</strong>m Reichsbankschatz. Randschä<strong>de</strong>n<br />
fachgerecht restauriert.<br />
Die 1871 gegrün<strong>de</strong>te AG führte die seit 1784 bestehen<strong>de</strong><br />
Reincke’sche Brauerei und das Destillationsgeschäft sowie die<br />
Preuss’sche Brauerei fort. Dazu heißt es auf <strong>de</strong>r Erklärtafel vor<br />
<strong>de</strong>r Brauerei in <strong>de</strong>r Mühlendammstr. 23/25: “Die älteste litauische<br />
Brauerei Svyturys (= Leuchttum) wur<strong>de</strong> 1784 gegrün<strong>de</strong>t.<br />
Der Grün<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r Memeler Kaufmann J. W. Reincke, wollte <strong>de</strong>n<br />
Menschen in <strong>de</strong>r Küstenregion ein Bier anbieten, das sie mit<br />
Stolz sowohl ihren Gästen ausschenken, wie auch selbst genießen<br />
konnten.” Das <strong>de</strong>r Destillation angeglie<strong>de</strong>rte kleine<br />
Weingeschäft wur<strong>de</strong> 1914 zu einer Groß-Weinkellerei erweitert.<br />
1923 nach <strong>de</strong>r Annektion <strong>de</strong>s Memellan<strong>de</strong>s durch Litauen<br />
Umstellung <strong>de</strong>s Nennwertes auf 30 Litas. Noch in <strong>de</strong>n 1930er<br />
Jahren setzte die Brauerei nicht mehr als 20.000 hl Bier jährlich<br />
ab und hatte zu<strong>de</strong>m jüdische Großaktionäre, so daß uns<br />
bisher nach <strong>de</strong>r 1940 erfolgten Übertragung <strong>de</strong>s Betriebes auf<br />
die Memeler Ostquell-Brauerei GmbH die Firmengeschichte zu<br />
En<strong>de</strong> zu sein schien. Umso größer war unsere Überraschuung<br />
im Frühjahr 2006, als wir bei einem Rundgang durch das frühere<br />
Memel (heute Klaipeda) vor <strong>de</strong>r Svyturis-Brauerei stan<strong>de</strong>n,<br />
die ausweislich einer großen Hinweistafel mit geschichtlichen<br />
Details frühere die Memeler Aktien-Brauerei war! Svyturis<br />
(= Leuchtturm) ist heute die größte Brauerei in Litauen mit<br />
10 Biersorten und braut als einzige Brauerei <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s auch<br />
in westlicher Lizenz (Carlsberg).<br />
Los 807 Schätzwert 75-150 €<br />
Merseburger Überlandbahnen-AG<br />
Merseburg, Aktie 1.000 Mark Juni 1913.<br />
Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 1300, R 2) EF<br />
Großformatiges Papier, sehr <strong>de</strong>korativ verziert.<br />
Gründung 1913 durch die Disconto-Gesellschaft und die AEG.<br />
Die Ingangsetzung <strong>de</strong>s Unternehmens wur<strong>de</strong> durch <strong>de</strong>n 1.<br />
Weltkrieg um einige Jahre verzögert. Erst 1918 wur<strong>de</strong> als<br />
Keimzelle <strong>de</strong>r meterspurigen Überlandstraßenbahn von <strong>de</strong>r<br />
AEG gepachtet die von ihr erbaute und 1902 eröffnete 11,2 km<br />
lange Strecke Halle-Merseburg, die später 1932 käuflich erworben<br />
wur<strong>de</strong>. Dazu kamen von Merseburg aus die 1918/19<br />
eröffneten Strecken nach Mücheln (17,4 km) und Bad Dürrenberg<br />
(10,5 km). Je über 30 Trieb- und Beiwagen befuhren die<br />
Strecken. Außer<strong>de</strong>m Betrieb <strong>de</strong>s Elektrizitätswerkes für die Gemein<strong>de</strong><br />
Ammendorf und Beteiligung an <strong>de</strong>r Merseburger Omnibus-Verkehr<br />
GmbH. Eine 1932 geplante Fusion mit <strong>de</strong>r Halle-Hettstedter<br />
Eisenbahn und <strong>de</strong>r Halleschen Straßenbahn zur<br />
“Saale-Verkehrsgesellschaft” kam nicht zustan<strong>de</strong>. Die Aktienmehrheit<br />
lag zuletzt bei Stadt und Kreis Merseburg, die AEG<br />
war weiter mit 25,4 % beteiligt; 7,9 % lagen bei verschie<strong>de</strong>nen<br />
Braunkohlen-Unternehmungen <strong>de</strong>s Merseburger Reviers.<br />
1948 in Volkseigentum überführt. 1951 wur<strong>de</strong> die Fusionsi<strong>de</strong>e<br />
von 1932 durch die Zwangsvereinigung mit <strong>de</strong>r Straßenbahn<br />
Halle dann doch noch Wirklichkeit.<br />
Los 808 Schätzwert 25-50 €<br />
Metall-, Walz- und Plattierwerke<br />
Hindrichs-Auffermann AG<br />
Wuppertal-Oberbarmen, Aktie 1.000 RM<br />
Dez. 1941 (Auflage 1028, R 3) EF<br />
Gründung am 25.8.1908 als “Munitionsmaterial- und Metallwerke<br />
Hindrichs-Auffermann AG” durch Zusammenschluß <strong>de</strong>r<br />
Gebr. Hindrichs in Barmen (gegr. 1824) mit <strong>de</strong>r J. D. Auffermann<br />
GmbH in Beyenburg (bis 1811 zurückgehend). 1922<br />
Umfirmierung wie oben. Verarbeitet wur<strong>de</strong>n insbeson<strong>de</strong>re Nikkel,<br />
Kupfer und Messing zu Halb- und Fertigerzeugnissen.<br />
1966 Umfirmierung in “Hindrichs-Auffermann AG”, 1996/98<br />
Sitzverlegung von Düsseldorf nach Wuppertal. Das angestammte<br />
Geschäft wur<strong>de</strong> auf die Hindrichs-Auffermann Metallverarbeitungs-GmbH<br />
in Ennepetal übertragen, die AG war bis<br />
zur Vollfusion zur “neuen” VDN im Deutsche-Nickel-Konzern<br />
Führungsgesellschaft für <strong>de</strong>n Bereich Tapeten und Wandbekleidung.<br />
Los 809 Schätzwert 75-150 €<br />
Metall-Industrie Schönebeck AG<br />
Schönebeck a.E., Aktie 1.000 Mark<br />
15.12.1920 (Auflage 250, R 8) VF<br />
Vorher nicht bekannt gewesener Jahrgang. Randschä<strong>de</strong>n<br />
fachgerecht restauriert.<br />
Gründung 1897 als Fahrradwerke Weltrad vorm. Hoyer &<br />
Glahn, die seit 1885 bestand. Ab 1900 Firmenname Metall-Industrie<br />
Schönebeck AG. Eine <strong>de</strong>r größten <strong>de</strong>utschen Fahrrad-<br />
Fabriken, die die Fahrrä<strong>de</strong>rmarke Original Weltrad produzierte.<br />
Es war wohl das erste Werk, das die autogene Schweißung in<br />
größtem Maßstab anfing. Seit 1929/30 auch Fabrikation von<br />
Kin<strong>de</strong>rwagen und Sportgeräten. 1936-1945 in die Rüstungsproduktion<br />
eingebun<strong>de</strong>n, u.a. wur<strong>de</strong>n Maschinengewehrteile<br />
und -lafetten gebaut. Nach <strong>de</strong>m 2. Weltkrieg in <strong>de</strong>r DDR enteignet<br />
und ab 1952 als VEB Traktorenwerk Schönebeck weiter<br />
geführt, ab 1990 als Landtechnik Schönebeck GmbH bekannt,<br />
ab 1999 Doppstadt GmbH, Schönebeck.<br />
75
Los 810 Schätzwert 225-300 €<br />
Metallpapier-<br />
Bronzefarben-Blattmetallwerke AG<br />
München, Aktie 1.000 Mark 22.10.1910<br />
(Auflage 1500, R 8) VF+<br />
Dekoratives Hochformat, mit Münchner Kindl im<br />
Unterdruck.<br />
Gründung 1910 (vorher GmbH), Werke in München, Stockdorf,<br />
Grubmühl, Nürnberg, Fürth, Augsburg, Marktschorgast, Berneck<br />
und (seit 1937) Wasserburg bei Günzburg (Donau). Als<br />
Hersteller von Aluminium- und Zinkfolien, Kupfer- und Messingbän<strong>de</strong>rn,<br />
Bronze- und Aluminiumpulver, Blattmetall sowie<br />
Gold- und Silberpapieren damals das führen<strong>de</strong> Unternehmen<br />
seiner Art in <strong>de</strong>r ganzen Welt. Zuletzt Werke in München (Aluminiumfolien<br />
und Metallpaier), Grubmühl (Kupfer- und Messingfolien)<br />
und Fürth (Blattmetall). In <strong>de</strong>n 70er Jahren schrittweise<br />
Stilllegung aller Werke, danach nur noch Verwaltung <strong>de</strong>s<br />
wertvollen Grundbesitzes in München. Zuletzt ein Skandal-Papier,<br />
die Börsenzulassung in München wur<strong>de</strong> wegen dauern<strong>de</strong>r<br />
Nichtvorlage <strong>de</strong>r Jahresabschlüsse 1986 wi<strong>de</strong>rrufen, im gleichen<br />
Jahr Konkurs.<br />
Los 811 Schätzwert 75-125 €<br />
Metallpapier-<br />
Bronzefarben-Blattmetallwerke AG<br />
München, Aktie 1.000 Mark 15.11.1921<br />
(Auflage 4000, R 6) EF<br />
I<strong>de</strong>ntische Gestaltung wie voriges Los.<br />
Los 812 Schätzwert 400-500 €<br />
Metallpapier-<br />
Bronzefarben-Blattmetallwerke AG<br />
München, Aktie 1.000 Mark 22.4.1922<br />
(Auflage 450, R 11) VF+<br />
Von dieser zuvor völlig unbekannten Emission<br />
wur<strong>de</strong>n lediglich 2 Stück im Reichsbankschatz gefun<strong>de</strong>n!<br />
Los 813 Schätzwert 25-50 €<br />
Metzeler Gummiwerke AG<br />
München, Aktie 1.000 RM 9.5.1940<br />
(Auflage 800, R 4) EF<br />
Gründung 1863 durch Robert Friedrich Metzeler, seit 1901 AG<br />
Metzeler & Co., 1933 umbenannt in Metzeler Gummiwerke AG,<br />
1965 in Metzeler AG. Das Werk in <strong>de</strong>r Westendstr. 131-133 fabrizierte<br />
Bereifung für Motorrad, Auto, Lastwagen und Gespannwagen<br />
sowie technische und chirurgische Artikel aus<br />
Weichkautschuk. Später Übernahme <strong>de</strong>r Westland Gummiwerke<br />
GmbH in Lindau (technische Gummiwaren, Sohlenmaterial)<br />
sowie Errichtung eines Schaumstoffwerkes in Memmingen,<br />
weiterhin wur<strong>de</strong> das Produktionsprogramm erweitert um Farben,<br />
Lacke und Freizeitartikel (Luftmatratzen, Schlauchboote,<br />
Tauchausrüstungen, Faltboote, Fiberglas-Kajaks, Skier) sowie<br />
Verpackungsfolien und Wursthüllen. 1974 übernimmt die Bayer<br />
AG handstreichartig die drei Betriebsgesellschaften Metzeler<br />
Kautschuk AG in München, Metzeler Schaum GmbH in Memmingen<br />
sowie Metzeler Isobau GmbH in Bad Wildungen und<br />
Mannheim. Es folgt ein <strong>de</strong>saströser Streit zwischen Altaktionären,<br />
<strong>de</strong>r Bayer AG und <strong>de</strong>m Bun<strong>de</strong>skartellamt, im Jahr darauf<br />
verschwin<strong>de</strong>t die Metzeler AG aus <strong>de</strong>n Börsenhandbüchern.<br />
1978 Umstrukturierung mit Ausglie<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Metzeler Automotive<br />
Profile Systems, Lindau (Marktführer bei Automobilka-<br />
76<br />
rosserie-Dichtungen) sowie Verlegung <strong>de</strong>r Reifenproduktion<br />
vom Münchener Werk ins Werk Breuberg im O<strong>de</strong>nwald, wo fortan<br />
nur noch Motorradreifen hergestellt wer<strong>de</strong>n. 1986 wird die<br />
Metzeler Kautschuk GmbH von <strong>de</strong>r Pirelli-Gruppe übernommen.<br />
Los 814 Schätzwert 25-50 €<br />
Mickoleit & Co. Metallwarenfabrik AG<br />
Berlin, Aktie 100 RM Jan. 1926 (Auflage<br />
520, R 4) EF-VF<br />
Gründung 1923. Han<strong>de</strong>l mit allen im Baugewerbe und seinen<br />
Nebenbetrieben vorkommen<strong>de</strong>n Baustoffen und die Finanzierung<br />
<strong>de</strong>rartiger Lieferungsaufträge. 1934 umbenannt in “Ekmo”<br />
Bauhan<strong>de</strong>ls-AG. 1951 aufgelöst.<br />
Los 815 Schätzwert 20-40 €<br />
Minimax AG<br />
Berlin, Aktie 100 RM Sept. 1938 (Auflage<br />
8000, R 2) EF<br />
Firmensignet im Unterdruck.<br />
Gründung 1922, hervorgegangen aus <strong>de</strong>r 1901 gegrün<strong>de</strong>ten<br />
Excelsior-Feuerlöschergesellschaft mbH Berlin. Herstellung von<br />
Handfeuerlöschern, Großlöschgeräten, ortsfesten Schaumund<br />
Kohlensäurelöschanlagen. 1948 nach Frankfurt/M., 1955<br />
nach Stuttgart verlegt.<br />
Los 816 Schätzwert 300-375 €<br />
Mittel<strong>de</strong>utsche Hafen-AG<br />
Halle/Saale, Aktie 80.000 RM Nov. 1934<br />
(Auflage nur 23 Stück, R 8), ausgestellt<br />
auf die Stadt Halle UNC<br />
Der 1857 eröffnete städtische Sophienhafen, <strong>de</strong>n lediglich<br />
Schiffe bis zu 400 BRT anlaufen konnten, erwies sich zunehmend<br />
als ungeeignet. Erstmals 1916 erwog man <strong>de</strong>shalb <strong>de</strong>n<br />
Bau eines neuen Hafens. 1919 veröffentlichte das städtische<br />
Tiefbauamt konkrete Planungen, 1923 beschloss <strong>de</strong>r hallesche<br />
Stadtrat <strong>de</strong>n Neubau eines Hafens im Nor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Stadt für<br />
Schiffe bis 1.000 BRT. In die zusammen mit <strong>de</strong>m Provinzialverband<br />
Sachsen 1929 neu gegrün<strong>de</strong>te Mittel<strong>de</strong>utsche Hafen-AG<br />
brachte die Stadt Halle die bisherigen Umschlaganlagen ein sowie<br />
insgesamt knapp 600.000 qm Grund und Bo<strong>de</strong>n in Seeben,<br />
Halle und Trotha. Schnell entwickelte sich <strong>de</strong>r Hafen Halle-Trotha<br />
dann zum größten Umschlagplatz an <strong>de</strong>r Saale. 1946 auf<br />
Anordnung <strong>de</strong>r SMAD enteignet, 1950 an die Deutsche Schifffahrts-<br />
und Umschlagbetriebszentrale übergegangen, 1957 mit<br />
<strong>de</strong>n Häfen Dessau-Wallwitzhafen, Aken (Elbe) und Klein-Wittenberg<br />
zum VEB Binnenhäfen “Saale” vereinigt, seit 1980 VEB<br />
Binnenhäfen “Mittelelbe”. Seit <strong>de</strong>n 1970er Jahren sanken nach<br />
zuvor rasantem Anstieg die Umschlagzahlen kontinuierlich, weil<br />
<strong>de</strong>r Staat in die Saaleschifffahrt nicht mehr investierte. Schiffe<br />
legten kaum noch an, <strong>de</strong>r Hafen wur<strong>de</strong> vornehmlich als Lagerplatz<br />
für Braunkohle genutzt, die Anlagen verfielen zusehends.<br />
1993 bekam die Stadt Halle <strong>de</strong>n Hafen Halle-Trotha zurückübertragen<br />
und grün<strong>de</strong>te die Hafen Halle GmbH als Betreibergesellschaft.<br />
Heute ist <strong>de</strong>r Hafen ein mo<strong>de</strong>rnes Güterverkehrszentrum,<br />
vor allem aber für <strong>de</strong>n Umschlag Straße/Schiene. Die<br />
Saaleschifffahrt liegt dagegen weiter darnie<strong>de</strong>r, da sog. “Europakähne”<br />
<strong>de</strong>n Fluss nicht befahren können.<br />
Los 817 Schätzwert 150-200 €<br />
Mittel<strong>de</strong>utsche Kunststeinund<br />
Marmorindustrie AG<br />
Kassel, Aktie Lit. B 20 RM 20.8.1924<br />
(Auflage 1152, R 9) EF<br />
Nur 8 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Die in Oberelsungen (Bez. Cassel) ansässige AG übernahm<br />
zwei Werke einer gleichnamigen GmbH. Das Werk I, an <strong>de</strong>r<br />
Straße Oberelsungen-Zierenberg gelegen, produzierte Kunstmarmorplatten,<br />
Terrazzoplatten, Grab<strong>de</strong>nkmäler und Kunststeine.<br />
Das Werk II, <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Stadt Kassel gehören<strong>de</strong>n Losse-Werk<br />
angeglie<strong>de</strong>rt, verarbeitete die dort anfallen<strong>de</strong>n Schlackenrükkstän<strong>de</strong><br />
zu Schlackensteinen. In <strong>de</strong>r Weltwirtschaftskrise ging<br />
die AG ein.<br />
Los 818 Schätzwert 200-250 €<br />
Mittel<strong>de</strong>utsche Kunststein-<br />
und Marmorindustrie AG<br />
Cassel, Aktie Lit. B 100 RM 20.8.1924<br />
(Auflage 240, R 10) EF<br />
Von diesem zuvor ganz unbekannten Wert wur<strong>de</strong>n<br />
lediglich 4 Stück im Reichsbankschatz gefun<strong>de</strong>n.<br />
Los 819 Schätzwert 300-375 €<br />
Mittel<strong>de</strong>utsches Kraftwerk<br />
Mag<strong>de</strong>burg AG<br />
Mag<strong>de</strong>burg, Interimsschein 499.000 RM<br />
11.5.1938 (R 12) für die Deutsche<br />
Continental-Gas-Gesellschaft, Dessau, die<br />
sich mit insgesamt 2,999 Mio. RM am<br />
Kapital von 10 Mio. RM beteiligt hatte F<br />
Maschinenschriftliche Ausführung auf einem Geschäftsbriefbogen<br />
<strong>de</strong>r Gesellschaft, Originalunterschriften.<br />
Ein Unikat aus <strong>de</strong>m Reichsbankschatz.<br />
<strong>Teil</strong>s in das Druckbild reichen<strong>de</strong> Fehlstellen am<br />
linken und oberen Rand fachgerecht ergänzt.<br />
Nr. 816 Nr. 818<br />
Gründung 1929 zum Bau <strong>de</strong>s Dampfkraftwerks Mag<strong>de</strong>burg-<br />
Rothensee auf <strong>de</strong>m Gelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Mittellandkanalhafens. Aktionäre<br />
waren die Elektrowerke AG in Berlin (50,01 %), die Stadt<br />
Mag<strong>de</strong>burg (20 %) und die Deutsche Contigas (29,99 %). Mitte<br />
1939 wur<strong>de</strong> das Kraftwerk für 30 Jahre an die Elektrowerke<br />
AG verpachtet. Auch damals gab es schon ein bißchen Finanzakrobatik:<br />
Eine 1930 in <strong>de</strong>n USA aufgelegte Anleihe von 4<br />
Mio. $ konnte bei Fälligkeit 1934 wegen <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Devisenbestimmungen<br />
nicht zurückgezahlt wer<strong>de</strong>n. Kurzerhand<br />
nahm die Ges. dann in <strong>de</strong>r Schweiz ein Franken-Darlehen auf,<br />
kaufte damit <strong>de</strong>n größten <strong>Teil</strong> <strong>de</strong>r Dollaranleihe (übrig blieben<br />
nur 145.050 $) freihändig am Markt zu Kursen weit unter pari<br />
zurück und machte so einen sehr netten Extra-Gewinn.<br />
Los 820 Schätzwert 300-375 €<br />
Mitteleuropäische Versicherungs-AG<br />
Köln, Namensaktie 1.000 Mark Juni 1917.<br />
Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 2000, R 9) VF<br />
Gründung 1917 durch die Agrippina-Versicherung und <strong>de</strong>n<br />
Kölner Lloyd als Transportversicherer. Es kann spekuliert wer<strong>de</strong>n,<br />
daß <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Versicherungen dieses Geschäft gegen<br />
En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 1. Weltkrieges zu unsicher wur<strong>de</strong> und sie es <strong>de</strong>shalb<br />
in eine eigenständige Gesellschaft auslagerten, zumal sie <strong>de</strong>ren<br />
Aktien dann auch außenstehen<strong>de</strong>n Aktionären anboten und<br />
nur jeweils gut 25 % behielten. Später wur<strong>de</strong> das Transport-<br />
Versicherungs-Geschäft unter <strong>de</strong>n drei Gesellschaften, die in<br />
Personalunion geführt wur<strong>de</strong>n, gemeinsam verwaltet und aufgeteilt.<br />
Die „Mitteleuropäische“ betrieb zu<strong>de</strong>m auch Rückversicherungsgeschäft<br />
vor allem in <strong>de</strong>r Kraftfahrzeug-Kaskoversicherung<br />
und <strong>de</strong>r Maschinenversicherung. 1960 auf die Agrippina<br />
Versicherungs-AG verschmolzen.<br />
Los 821 Schätzwert 100-125 €<br />
Mitteleuropäische Versicherungs-AG<br />
Köln, Namensaktie 1.000 Mark Juni 1921<br />
(Auflage 1000, R 8) EF<br />
I<strong>de</strong>ntische Gestaltung wie voriges Los.<br />
Los 822 Schätzwert 50-100 €<br />
MODENA AG für modische<br />
Band- und Sei<strong>de</strong>nwaren<br />
Berlin-Köln, Aktie 1.000 RM Aug. 1941<br />
(Auflage 300, R 5) EF<br />
Gründung 1922 als Gebr. Bing Soehne AG, Sitz bis 1938 in<br />
Köln, dann in Berlin. 1940 Namensän<strong>de</strong>rung in Mo<strong>de</strong>na AG für
modische Band- und Sei<strong>de</strong>nwaren. Herstellung von und Han<strong>de</strong>l<br />
mit Textil- und Mo<strong>de</strong>waren aller Art. Haupterzeugnisse:<br />
Samt- und Sei<strong>de</strong>nbän<strong>de</strong>r, Stoffe, Schals, Tücher, Hut- und Klei<strong>de</strong>rschmuck.<br />
1948 verlagert nach Köln, 1953 umfirmiert in<br />
Mo<strong>de</strong>na vorm. Gebr. Bing Söhne AG für modische Band- und<br />
Sei<strong>de</strong>nwaren, Köln, ab 1958 GmbH.<br />
Los 823 Schätzwert 50-100 €<br />
Moll-Werke AG<br />
Chemnitz, Aktie 1.000 Mark Sept. 1923<br />
(Auflage 73000, R 5) EF<br />
Gründung 1916 in Wolkenstein. Hergestellt wur<strong>de</strong>n Automobile<br />
6/30 PS und “Mollmobile” 4 PS, ferner eiserne Transportfässer<br />
und Transportgeräte, schmie<strong>de</strong>eiserne Radiatoren, Sauerstoff,<br />
Metallknöpfe aller Art. Die Gesellschaft besaß Werke in<br />
Scharfenstein i.Sa. (mit eigenen grösseren Anlagen für Sauerstoff-Erzeugung<br />
und Acetylen-Bereitung), Tannenberg i.Erzgeb.,<br />
Oberlichtenau bei Chemnitz. Der Betrieb Annaberg wur<strong>de</strong><br />
1923 abgetrennt und zusammen mit <strong>de</strong>r Firma “Ras-Werke<br />
GmbH” in eine GmbH umgewan<strong>de</strong>lt. Über das Vermögen <strong>de</strong>r<br />
Gesellschaft wur<strong>de</strong> 1925 das Konkursverfahren eröffnet.<br />
Los 824 Schätzwert 50-100 €<br />
Montanum AG für Berg- u.<br />
Hüttenerzeugnisse und Metalle<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark 14.9.1923<br />
(Auflage 30000, R 7) EF<br />
Gründung 1922. Han<strong>de</strong>l mit Berg- und Hüttenprodukten sowie<br />
Metallen und Metallwaren aller Art. Der GV vom 12.4.1924<br />
wur<strong>de</strong> Mitteilung gemäß § 240 HGB (Verlust <strong>de</strong>r Hälfte <strong>de</strong>s Aktienkapitals).<br />
1927 war die AG nichtig.<br />
Los 825 Schätzwert 25-75 €<br />
Moritz Krause AG<br />
Chemnitz, Aktie 1.000 Mark 1.1.1913.<br />
Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 600, R 4) EF<br />
Gründung 1913 zu Fortführung <strong>de</strong>r Firmen “Moritz Krause” und<br />
“Verkaufsstelle <strong>de</strong>r vereinigten Sandwerke Moritz Krause”. Neben<br />
Abbau von Sand auch Ausführung von Tiefbauarbeiten.<br />
1955 verlagert nach Hamburg, ab 1957 GmbH.<br />
Los 826 Schätzwert 300-375 €<br />
Moritzkirchengemein<strong>de</strong><br />
Zwickau, 4 % Handdarlehnsschein 500<br />
Mark 6.4.1894 (R 11), ausgegeben für<br />
Herrn Generaldirektor Ferdinand Gerold in<br />
Zwickau VF+<br />
1925 in 12,50 RM Ablösungsanleihe umgewan<strong>de</strong>lt.<br />
Originalunterschriften <strong>de</strong>s Kirchenvorstan<strong>de</strong>s.<br />
Zuvor völlig unbekannt gewesen, von <strong>de</strong>n lediglich<br />
2 im Reichsbankschatz gefun<strong>de</strong>nen Stücken ist<br />
dies das letzte verfügbare.<br />
Schon 1212 ist die Moritzkirche erstmals urkundlich erwähnt.<br />
Namensgeber ist <strong>de</strong>r spätere Schutzpatron <strong>de</strong>r Stadt Zwickau,<br />
<strong>de</strong>r Hl. Mauritius. Zerstört wur<strong>de</strong> die Kirche 1430 im Hussitenkrieg<br />
und erneut 1632 im Dreißigjährigen Krieg. Erst 1680<br />
wur<strong>de</strong> sie als schlichte kleine Saalkirche wie<strong>de</strong>r aufgebaut. Im<br />
19. Jh. verfünffachte sich im Zuge <strong>de</strong>r Industrialisierung die<br />
Einwohnerzahl <strong>de</strong>r Stadt Zwickau und entsprechend die Zahl<br />
<strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>mitglie<strong>de</strong>r. Als Ersatz für die alte, zu klein gewor<strong>de</strong>ne<br />
Kirche baute man 1892/93 nach einem <strong>de</strong>utschlandweiten<br />
Architektenwettbewerb die neue Moritzkirche als dreischiffigen<br />
Zentralbau im Stil <strong>de</strong>s Historismus. Zwickauer Bürger<br />
streckten <strong>de</strong>r Kirchengemein<strong>de</strong> einen <strong>Teil</strong> <strong>de</strong>r Baukosten von<br />
400.000 M darlehnsweise vor.<br />
Die 1892 eingeweihte Moritzkirche<br />
Los 827 Schätzwert 20-50 €<br />
Mühle Rüningen AG<br />
Rüningen b.Braunschw., Aktie 1.000 RM<br />
März 1929 (Auflage 2950, R 2) EF<br />
Gründung 1898 zur Fortführung <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>lsmühle <strong>de</strong>r oHG<br />
Berkenbusch & Co. Die Weizenmühle an <strong>de</strong>r Berkenbuschstraße<br />
in Rüningen geht auf eine bereits im 12. Jh. urkundlich erwähnte<br />
Wassermühle an <strong>de</strong>r Oker zurück. In ihrer heutigen<br />
Form wur<strong>de</strong> sie 1893-95 als erste mit Plansichtern ausgestattete<br />
Großmühle erbaut (nach<strong>de</strong>m die weltweit führen<strong>de</strong>n Mühlenbauanstalten<br />
ebenfalls in Braunschweig ansässig waren,<br />
wur<strong>de</strong>n neueste Technologien immer beson<strong>de</strong>rs gern hier vor<br />
Ort ausprobiert). Daneben war bis in die 50er Jahre eine Roggenmühle<br />
in Lehndorf in Betrieb. Im Jahr 2000 übernahm die<br />
Firmengruppe Werhahn die Aktienmehrheit und wan<strong>de</strong>lte das<br />
Unternehmen in eine Kommanditgesellschaft um (Einstellung<br />
<strong>de</strong>r Börsennotiz in Hannover im Juni 2000). Die letzten freien<br />
Aktionäre wur<strong>de</strong>n zu Kommanditisten o<strong>de</strong>r in bar abgefun<strong>de</strong>n.<br />
Los 828 Schätzwert 75-125 €<br />
Mühlenwerke Guhrau AG<br />
Guhrau, Bez. Breslau, Aktie 100 RM Okt.<br />
1927 (R 6) EF<br />
Gründung 1922. Betrieb einer Mühle, einer Bäckerei, eines<br />
Han<strong>de</strong>lsgeschäfts mit Müllerei-Erzeugnissen, Futter- und Düngemitteln,<br />
Sämereien und Kohlen.<br />
Nr. 828<br />
Los 829 Schätzwert 100-150 €<br />
Müllheim-Ba<strong>de</strong>nweiler Eisenbahn-AG<br />
Müllheim i.B., Genussrechts-Urkun<strong>de</strong> 100<br />
RM 1.12.1925 (R 9) EF-VF<br />
Nur ein Stück lag im Reichsbankschatz.<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1894 durch <strong>de</strong>n Bahnkonzern Vering & Waechter<br />
zum Bau und Betrieb <strong>de</strong>r 7,6 km langen 1000-mm-Schmalspurbahn<br />
als Verbindung vom Staatsbahnhof Müllheim zu <strong>de</strong>m<br />
Kurort Ba<strong>de</strong>nweiler in Ba<strong>de</strong>n. Anschließend ging die Betriebsführung<br />
an die Deutsche Eisenbahn-Betriebs-Gesellschaft.<br />
1913/14 Elektrifizierung <strong>de</strong>r Strecke, zugleich Übernahme <strong>de</strong>r<br />
Betriebsführung in Eigenregie. Das Passagieraufkommen stieg<br />
über die Jahre ständig an bis auf 700.000 Fahrgäste im Jahr<br />
1953. Trotz<strong>de</strong>m wur<strong>de</strong> die Bahn am 22.5.1955 stillgelegt,<br />
nach<strong>de</strong>m sie nur zwei Monate zuvor auf die Mittelbadische Eisenbahnen<br />
AG, Lahr übergegangen war.<br />
Los 830 Schätzwert 60-120 €<br />
Münchener<br />
Export-Malzfabrik München AG<br />
München, Aktie 1.000 Mark 1.5.1906<br />
(Auflage 250, R 5) EF-VF<br />
Großformatig, <strong>de</strong>korativ mit Jugendstilornamenten<br />
und Frauenköpfen.<br />
Gründung 1901 zwecks Übernahme <strong>de</strong>r Malzfabrik von Max<br />
Weisenfeld an <strong>de</strong>r Tegernseer Landstraße. Übernahme <strong>de</strong>r<br />
Malzfabrik August Forster in Memmingen 1906 und <strong>de</strong>r Vereinsmälzerei<br />
München 1908. Gründung <strong>de</strong>r Kapuziner Malzkaffeefabrik<br />
1918. Börsennotiz München und Frankfurt. 1959<br />
Umwandlung auf <strong>de</strong>n Hauptaktionär und Fortführung als Firma<br />
“Ernst Habermann vorm. Südbayerische Malzfabrik”.<br />
Los 831 Schätzwert 50-100 €<br />
Münchener Wohnungsfürsorge<br />
und Baubank AG<br />
München, Aktie Lit. B 200 RM 30.6.1925<br />
(Auflage 250, R 5) EF-VF<br />
Gründung Dez. 1924 durch Baugenossenschaften und Gewerkschaften.<br />
Bis 1930: Münchener Wohnungsfürsorge und<br />
Baubank AG, bis 1938: Münchener Wohnungsfürsorge AG, bis<br />
1939: Müwag Münchener Wohnungsfürsorge AG, danach<br />
“Neue Heimat” Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft<br />
<strong>de</strong>r DAF im Gau München-Oberbayern, AG. 1955<br />
Einglie<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Neuen Heimat in <strong>de</strong>n Neue Heimat-Konzern.<br />
1986 verkaufte <strong>de</strong>r DGB das gewerkschaftseigene Wohnungsbauunternehmen<br />
zum symbolischen Preis von einer Mark an<br />
<strong>de</strong>n Berliner Bäckerei-Unternehmer Horst Schiesser. Der Sanierungsplan<br />
Schiessers wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>n Banken nicht akzeptiert,<br />
daher kaufte <strong>de</strong>r DGB die Neue Heimat am 12.11.1986<br />
für eine Mark von Schiesser zurück.<br />
Los 832 Schätzwert 25-50 €<br />
Mundlos AG<br />
Mag<strong>de</strong>burg, Aktie 1.000 Mark 13.8.1920.<br />
Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 3000, R 2) EF<br />
Großformatig. Feine Zierumrandung.<br />
Gründung 1863 als “H. Mund & Co., AG seit 1920. Herstellung<br />
von Nähmaschinen für Haushalt, Gewerbe und Industrie sowie<br />
Spezial-Nähmaschinen. Eine <strong>de</strong>r ältesten Nähmaschinenfabriken,<br />
die die Universal-Zickzack-Nähmaschine erfand. Export in<br />
die ganze Welt. Großaktionär Emil Köster AG, Berlin. Etwa 1000<br />
Arbeiter und ca. 110 Beamte waren bei Mundlos beschäftigt.<br />
In guten Jahren wur<strong>de</strong>n bis zu 100.000 Nähmaschien hergestellt.<br />
Börsennotiz Berlin und Freiverkehr Mag<strong>de</strong>burg. Während<br />
eines Bombenangriffs wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r größte <strong>Teil</strong> <strong>de</strong>r Fabrikanlagen<br />
und das firmeneigene Museum zerstört, was erhalten blieb,<br />
wur<strong>de</strong> als Reparaturleistung in die Sowjetunion transportiert.<br />
Nach <strong>de</strong>m Krieg nicht verlagert.<br />
Los 833 Schätzwert 25-50 €<br />
Nähmaschinenfabrik Adolf Knoch AG<br />
Saalfeld, Aktie 1.000 RM 1.1.1942<br />
(Auflage 940, R 5) EF<br />
Mit kleinem Nähmaschinen-Signet.<br />
Gründung 1860 durch <strong>de</strong>n Handwerker Adolf Knoch (1834-<br />
1897) als älteste Nähmaschinenfabrik in Mittel<strong>de</strong>utschland. AG<br />
seit 1908. 1931 Übernahme <strong>de</strong>r Marken und Vertriebsrechte<br />
<strong>de</strong>r Nähmaschinen- und Fahrrä<strong>de</strong>rfabrik Bernhard Stoewer AG<br />
in Stettin. Die AG wur<strong>de</strong> 1949 verlagert nach Frankfurt/Main,<br />
1969 nach Abwicklung gelöscht. Der Betrieb wur<strong>de</strong> 1947 enteignet<br />
und als “VEB Nähmaschinenfabrik Textima” weitergeführt.<br />
Die Nähmaschinenfabrikation wur<strong>de</strong> 1969 eingestellt,<br />
danach nutzte <strong>de</strong>r VEB Carl Zeiss Jena die Fabrik für die Herstellung<br />
von Photoobjektiven, Komponenten für Bandspeicher<br />
und Elektronik.<br />
Los 834 Schätzwert 15-30 €<br />
Nassauische Lan<strong>de</strong>sbank<br />
Wiesba<strong>de</strong>n, 7 % Gold-Pfandbrief 500<br />
Goldmark 1.4.1927 (Auflage 1000, R 8) EF<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1840 als Lan<strong>de</strong>skreditkasse für das Herzogtum<br />
Nassau, ab 1849 Nassauische Lan<strong>de</strong>sbank. Als Nassau 1866<br />
nach Preußen einverleibt wur<strong>de</strong>, hat man aus verfassungsrechtlichen<br />
Grün<strong>de</strong>n das Sparkassengeschäfts in <strong>de</strong>r in Personalunion<br />
geführten (bis heute bestehen<strong>de</strong>n) Nassauischen<br />
Sparkasse verselbständigt. Die Nassauische Lan<strong>de</strong>sbank ging<br />
1953 in <strong>de</strong>r Hessischen Lan<strong>de</strong>sbank auf (heute Lan<strong>de</strong>sbank<br />
Hessen-Thüringen).<br />
77
Nr. 835 Nr. 851<br />
Los 835 Schätzwert 400-500 €<br />
Nationale Automobil-Gesellschaft AG<br />
Berlin, Aktie 50 RM Dez. 1942 (Auflage<br />
nur 20 Stück, R 8) UNC-<br />
Zuvor unbekannt gewesene Emission!<br />
Gründung 1912 durch die AEG als “Neue Automobil-Gesellschaft<br />
AG” auf <strong>de</strong>m AEG-Betriebsgelän<strong>de</strong> in Berlin-Oberschönewei<strong>de</strong>.<br />
Hergestellt wur<strong>de</strong>n PKW (das bekannteste NAG-Auto<br />
war <strong>de</strong>r “Puck”), LKW und Omnibusse. Selbst die Kaiserin ließ<br />
sich ausschließlich in NAG-Wagen chauffieren. Während <strong>de</strong>s 1.<br />
Weltkrieges auch Bau von Benz-Flugzeugmotoren. Ab 1919<br />
Mitglied <strong>de</strong>r Gemeinschaft <strong>de</strong>utscher Automobilfabriken<br />
(G.d.A.) mit Brennabor, Hansa und Hansa-Lloyd, die u.a. am<br />
Kapitalmarkt gemeinsame Anleihen auflegte. 1927 gegen Gewährung<br />
eigener Aktien Übernahme <strong>de</strong>s Automobilwerkes <strong>de</strong>r<br />
Siemens-Schuckert-Werke, wo die Protos-Wagen hergestellt<br />
wur<strong>de</strong>n. Im gleichen Jahr Fusion mit <strong>de</strong>r Prestowerke AG in<br />
Chemnitz und Übernahme <strong>de</strong>r Dux-Automobilwerke. 1933 Übertragung<br />
<strong>de</strong>s Nutzfahrzeuggeschäfts auf eine gemeinsame<br />
Tochter mit <strong>de</strong>r Automobilwerke H. Büssing AG in Braunschweig<br />
(heute ein Werk <strong>de</strong>r MAN). Noch 1932 konstruierte<br />
Henze einen großen V-8 mit Frontantrieb, doch ein Jahr später<br />
wur<strong>de</strong> die PKW-Produktion eingestellt.<br />
Los 836 Schätzwert 15-30 €<br />
Natronzellstoff- und Papierfabriken AG<br />
Berlin, 4,5 % <strong>Teil</strong>schuldv. 1.000 RM Okt.<br />
1941 (Auflage 2250, R 3) EF<br />
Gründung 1905 als Allgemeine Petroleum-Industrie AG (später<br />
Allgemeine Industrie-AG), 1918 umfirmiert wie oben anläßlich<br />
<strong>de</strong>r Übernahme <strong>de</strong>r Altdamm-Stahlhammer Holzstoff- und Papierfabrik<br />
AG. Herstellung von Natronzellstoff, Natronkraftpapier,<br />
Sackpapier und Bitumenpapier in <strong>de</strong>n Werken Altdamm<br />
(Pommern), Krappitz (Oberschlesien), Goslar-Oker (ehem. Papierfabrik<br />
Oker AG in Oker am Harz, 1927 fusioniert) und Priebus<br />
(ehem. Papierfabrik Priebus GmbH). 1938 erwarb die Zellstofffabrik<br />
Waldhof (später PWA, heute Svenska Cellulosa) im<br />
Zuge <strong>de</strong>r “Arisierung” die Natronag-Aktienmehrheit. 1939 Rükkglie<strong>de</strong>rung<br />
<strong>de</strong>s seit 1922 als polnische AG geführten oberschlesischen<br />
Werkes Stahlhammer und Übernahme <strong>de</strong>r Papierfabrik<br />
Frantschach (Kärnten). 1945 verlagert nach Mannheim-Waldhof,<br />
1976 in eine GmbH umgewan<strong>de</strong>lt. Bereits seit<br />
<strong>de</strong>r Gründung 1918 bestand im Werk Oker eine Füllmaschinen-Abteilung,<br />
die sich im Laufe <strong>de</strong>r Zeit zu einem be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n<br />
Anbieter auf <strong>de</strong>m Spezialgebiet <strong>de</strong>r Sackbefüllungssysteme<br />
entwickelte. Die Maschinenbau-Aktivitäten wur<strong>de</strong>n 1992<br />
aus <strong>de</strong>m papierverarbeiten<strong>de</strong>n NATRONAG-Konzern ausgeglie<strong>de</strong>rt<br />
und an die Maschinenfabrik KNAUP in Salzgitter übertragen,<br />
die ohnehin seit 40 Jahren mit <strong>de</strong>r Fertigung betraut war,<br />
2001 dann Übernahme durch <strong>de</strong>n Wägetechnik-Spezialisten<br />
Librawerk in Braunschweig.<br />
78<br />
Werbeanzeige für <strong>de</strong>n “Darling” um 1910<br />
Los 837 Schätzwert 60-120 €<br />
Neckarwerke AG<br />
Esslingen, Aktie 1.000 Mark 1.10.1911<br />
(Auflage 2500, R 3) EF-VF<br />
Großformatig, schöne Randbordüre in leuchten<strong>de</strong>n<br />
Farben.<br />
Gründung 1905 unter Übernahme einer 1899-1904 von Heinrich<br />
Mayer in Altbach errichteten “Kraftcentrale für die Überland-Stromversorgung”.<br />
1997 Fusion mit <strong>de</strong>n Technischen<br />
Werken <strong>de</strong>r Stadt Stuttgart AG, Sitzverlegung nach Stuttgart und<br />
Umfirmierung in “Neckarwerke Stuttgart AG”. Großaktionäre<br />
sind die Lan<strong>de</strong>shauptstadt Stuttgart, <strong>de</strong>r Neckar-Elektrizitätsverband<br />
und die EnBW. Direkt versorgt wer<strong>de</strong>n jetzt 124 Städte<br />
und Gemein<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Mitte Ba<strong>de</strong>n-Württembergs (darunter<br />
Stuttgart, Esslingen, Ludwigsburg, Böblingen und Göppingen).<br />
Los 838 Schätzwert 15-30 €<br />
Neckarwerke AG<br />
Esslingen, 5 % <strong>Teil</strong>schuldv. 500 RM Dez.<br />
1936 (Auflage 3200, R 4) EF<br />
Originalunterschriften.<br />
Los 839 Schätzwert 75-150 €<br />
Neisser Kreisbahn-AG<br />
Neisse, Aktie 1.000 Mark 1.1.1913.<br />
Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 3340, R 5) EF<br />
Großformat, Originalsignaturen für <strong>de</strong>n Vorstand.<br />
Gründung 1910 durch <strong>de</strong>n Preußischen Staat, <strong>de</strong>n Kreis Neisse<br />
und die Städte Neisse, Steinau und Wei<strong>de</strong>nau sowie sechzehn<br />
Gemein<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>r Baufirma Lenz & Co. GmbH. Strecken<br />
Neisse-Steinau (21 km) und Neisse-Wei<strong>de</strong>nau (19 km) südlich<br />
von Breslau. 1945 kamen die Strecken zur polnischen Staatsbahn<br />
PKP. Der Personenverkehr wur<strong>de</strong> 1966 eingestellt, <strong>de</strong>r<br />
Güterverkehr 1971.<br />
Los 840 Schätzwert 20-50 €<br />
Neu-Westend<br />
AG für Grundstücksverwertung<br />
Charlottenburg, Aktie 1.000 Mark<br />
4.2.1904. Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 8000, R 2)<br />
EF-VF<br />
Mit Faksimileunterschrift vom Bankier Max Steinthal<br />
für <strong>de</strong>n Aufsichtsrat. Dekorativer G & D-Druck.<br />
Umrandung mit Elementen <strong>de</strong>s Jugendstils.<br />
Gründung 1904 durch die Deutsche Bank. Die Gesellschaft erschloss<br />
die Gegend zwischen Kaiserdamm, Kantstraße und Königsweg.<br />
Den U-Bahn-Anschluss ließ sie auf eigene Kosten ausführen,<br />
um die Attraktivität <strong>de</strong>r Wohnlage zu erhöhen. Börsennotiz<br />
Berlin. Ab 1918 in Liquidation, bei <strong>de</strong>r Abwicklung konnte immerhin<br />
das Doppelte <strong>de</strong>s Nennwertes ausgeschüttet wer<strong>de</strong>n.<br />
Los 841 Schätzwert 75-100 €<br />
Neue Augsburger Kattunfabrik<br />
Augsburg, Aktie 100 RM Okt. 1941<br />
(Auflage 1304, R 8) VF+<br />
Nur 9 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Die Gesellschaft geht auf die älteste Augsburger Textilfabrik zurück,<br />
eine 1702 von Johannes Apfel gegrün<strong>de</strong>te Kattundruckerei.<br />
1880 Umwandlung in eine AG, die Augsburger Kattunfabrik,<br />
welche aber bereits 1885 liquidiert und als Neue Augsburger<br />
Kattunfabrik neu gegrün<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>. Die später als NAK-<br />
Stoffe firmieren<strong>de</strong> führen<strong>de</strong> Stoffdruckerei Deutschlands ging<br />
1996 in Anschlußkonkurs.<br />
Los 842 Schätzwert 10-25 €<br />
Neue Bo<strong>de</strong>n-AG<br />
Berlin, 4 % <strong>Teil</strong>schuldv. 100 Mark Juni<br />
1901 (Auflage 16136, R 3) EF-VF<br />
Gründung 1893 als “Neue Berliner Baugesellschaft”. 1901<br />
umbenannt wie oben nach Fusion mit <strong>de</strong>r “Deutsche Grundschuld-Bank”.<br />
1927 erwarb <strong>de</strong>r Industrielle und notorische Aktienspekulant<br />
JACOB SCHAPIRO die Aktienmehrheit. Ihm gehörte<br />
nicht nur seit 1923 die Mehrheit beim Autohersteller<br />
NSU, er beherrschte auch Cyclon, Schebera, Hansa und die<br />
Fahrzeugfabrik Eisenach (Dixi), selbst für die Fusion von Daimler<br />
und Benz war Schapiro die Ursache (ihm gehörten zeitweise<br />
60 % <strong>de</strong>r Benz-Aktien, doch Benz-Finanzvorstand Wilhelm<br />
Kissel manövrierte ihn aus und zwang ihn zum Verkauf <strong>de</strong>r Aktienmehrheit<br />
an die Deutsche Bank, die schon die Daimler-Motorengesellschaft<br />
beherrschte und bei<strong>de</strong> Firmen dann fusionierte).<br />
Seinen Firmen entzog Schapiro alle Mittel, um damit<br />
private Spekulationen zu finanzieren (u.a. erwarb er noch am<br />
22.2.1929 in <strong>de</strong>r Zwangsversteigerung <strong>de</strong>n berühmten Sportpalast<br />
und verpachtete ihn anschließend an <strong>de</strong>n Vorsitzen<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>s Trabrennvereins Berlin-Ruhleben). Sein Imperium brach<br />
gleich zu Beginn <strong>de</strong>r Weltwirtschaftskrise 1929 zusammen. Die<br />
Fahrzeugfabrik Eisenach wur<strong>de</strong> an BMW verkauft, NSU ging an<br />
die Dresdner Bank und FIAT. Die bis dahin kerngesun<strong>de</strong> Neue<br />
Bo<strong>de</strong>n-AG, <strong>de</strong>r Schapiro Vermögen fast in Höhe <strong>de</strong>r gesamten<br />
Bilanzsumme (16 Mio. M) entzogen hatte, ging am 11.11.1932<br />
in Vergleich und am 7.3.1933 in Konkurs.<br />
Los 843 Schätzwert 25-50 €<br />
Neue Flöther Landmaschinen AG<br />
Gassen N.-L., Aktie 100 RM 24.9.1936<br />
(Auflage 500, R 4) EF<br />
Gründung 1889 als Maschinenbau-Anstalt und Eisengiesserei<br />
vormals Th. Flöther zur Übernahme <strong>de</strong>r schon seit 1856 bestehen<strong>de</strong>n<br />
Fabriken von Th. Flöther in Gassen und Breslau nebst einem<br />
Anteil an <strong>de</strong>r Braunkohlengrube Antonie in Zilmsdorf bei<br />
Teuplitz N.-L. Fabrikation industrieller, insbeson<strong>de</strong>re landwirtschaftlicher<br />
Maschinen und Geräte, Lokomobilen und Dampfdreschmaschinen.<br />
Als Opfer <strong>de</strong>r Weltwirtschaftskrise Anfang <strong>de</strong>r<br />
1930er Jahre in Liquidation gegangen. 1936 erwarb die 1933<br />
gegrün<strong>de</strong>te “Neue Flöther Landmaschinen AG” die Anlagen und<br />
Grundstücke <strong>de</strong>r Th. Flöther Maschinenbau AG i.L. und produzierte<br />
dort weiter. 1939 ging <strong>de</strong>r Fabrikationsbetrieb über auf die<br />
Firma Hermann Raussendorf, Abteilung Flöther-Werk Gassen.1945<br />
kam Gassen (das heutige Jasien) an Polen, und damit<br />
auch die Landmaschinenfabrik, die als “Fabryka Maszyn Budowlanych<br />
ZREMB” weitergeführt wur<strong>de</strong>. Einige Sammler hüten<br />
alte Flöther-Lokomobile, die noch heute funktionsfähig sind.<br />
Los 844 Schätzwert 150-200 €<br />
Neue Leipziger Brotfabrik<br />
Otto Treydte AG<br />
Leipzig, Aktie 5.000 Mark 11.5.1923<br />
(Auflage 2000, R 8) EF<br />
1925 umgestellt auf 100 RM.<br />
Gründung im März 1923. Herstellung, Kauf und Vertrieb von<br />
Brot und an<strong>de</strong>ren Backwaren. 1934 Beschluß <strong>de</strong>r Auflösung<br />
<strong>de</strong>r Gesellschaft.<br />
Los 845 Schätzwert 20-40 €<br />
Neusiedler AG für Papierfabrikation<br />
Wien, Aktie 100 RM Sept. 1939 (Auflage<br />
30000, R 4) EF<br />
Gründung bereits 1863. Die AG besaß sechs Papier- und Zellstofffabriken<br />
in Nie<strong>de</strong>rösterreich und <strong>de</strong>r Steiermark. Alleinaktionärin<br />
<strong>de</strong>r AG <strong>de</strong>r Papierfabrik Schlöglmühl und <strong>de</strong>r Theresienthaler<br />
Papierfabrik AG (die bei<strong>de</strong> 1939 auf Neusiedler verschmolzen<br />
wur<strong>de</strong>n) sowie <strong>de</strong>r AG Lokalbahn Payerbach-Hirschwang.<br />
Beschäftigt wur<strong>de</strong>n rd. 2.500 Mitarbeiter. 2000 Übernahme<br />
durch die südafrikanische MONDI Group, 2004 Umbenennung<br />
in Mondi Business Paper.<br />
Min<strong>de</strong>stgebot: 80 %<br />
vom unteren Schätzwert
Los 846 Schätzwert 30-75 €<br />
Neußer Papier- und<br />
Pergamentpapierfabrik AG<br />
Neuss am Rhein, Aktie 1.000 RM<br />
15.7.1929 (Auflage 1000, R 4) EF<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1878. Produziert wur<strong>de</strong>n Rohpappe, Sei<strong>de</strong>n- und<br />
Toilettenpapier. 1928 Aufnahme <strong>de</strong>r Fabrikation von Balatum<br />
(als günstige Konkurrenz zum Linoleum ein preiswerter Fußbo<strong>de</strong>nbelag,<br />
bestehend aus einer mit Ölfarbe bedruckten Wollfilzpappe).<br />
1939 Ankauf <strong>de</strong>r Tapetenfabrik Hösel, Bez. Düsseldorf<br />
(1964 wie<strong>de</strong>r verkauft). 1942 umbenannt in Balatum AG.<br />
1961/62 Bau einer Linoleumfabrik. 1965 erneut umfirmiert in<br />
Deutsche Balamundi AG. Großaktionär war mit 90 % eine belgische<br />
Gruppe. Zuletzt rd. 600 Beschäftigte. 1977 Fusion mit<br />
<strong>de</strong>r Balamo Deutschland GmbH (Neuss). Balatum wur<strong>de</strong> Anfang<br />
<strong>de</strong>r 1970er Jahre durch die haltbareren und noch preiswerteren<br />
PVC-Beläge verdrängt, seither in Neuss dann Produktion<br />
von Teppichbö<strong>de</strong>n, Na<strong>de</strong>lfilzen und PVC-Belägen.<br />
Los 847 Schätzwert 20-75 €<br />
Nie<strong>de</strong>rbarnimer Eisenbahn-AG<br />
Berlin-Wilhelmsruh, Aktie 100 RM Okt.<br />
1940 (Auflage 10000, R 2) EF<br />
Gründung 1900 als “Reinickendorf-Liebenwal<strong>de</strong>-Groß-Schönebekker<br />
Eisenbahn-AG”. Normalspurige Bahn Reinickendorf-Basdorf-<br />
Liebenwal<strong>de</strong> (37,9 km) mit Verzweigung Basdorf-Groß-Schönebeck<br />
(24 km) sowie Tegel-Friedrichsfel<strong>de</strong> (26 km). Im Juli 1925 Erwerb<br />
<strong>de</strong>r Industriebahn Tegl-Friedrichsfel<strong>de</strong>. Ab Nov. 1925 Nie<strong>de</strong>rbarnimer<br />
Eisenbahn-AG. Nach <strong>de</strong>m Krieg wur<strong>de</strong> die Bahn vom<br />
Schicksal hin und her geworfen, dabei passierte folgen<strong>de</strong>s: Da sie<br />
teils im West- und teils im Ostsektor von Berlin lag, hatten die Alliierten<br />
etwas gegen eine Enteignung. Also kam es zu einer Übergabe-Vereinbarung<br />
mit <strong>de</strong>r Reichsbahn, in <strong>de</strong>r alles bis auf die letzte<br />
Ölkanne genau aufgeführt wur<strong>de</strong>. Auch stand die Klausel darin, daß<br />
nach <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rvereinigung Deutschlands alles im übergebenen<br />
Zustand wie<strong>de</strong>r zurückzuübertragen an die Privatbahn sei. Die<br />
Chefetage <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>sbahn schäumte vor Wut, als ihr dieser Vertrag<br />
nach <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> präsentiert wur<strong>de</strong> und verweigerte die Erfüllung.<br />
Es half nichts, die Prozesse gingen zu Gunsten <strong>de</strong>r Bahn aus,<br />
heute fährt sie wie<strong>de</strong>r als Privatbahn (und ist zu<strong>de</strong>m Heimat <strong>de</strong>r<br />
Berliner Eisenbahnfreun<strong>de</strong> e.V., bei <strong>de</strong>nen wir 1998 auf <strong>de</strong>m Bahnhof<br />
Basdorf ein unvergeßliches Sommerfest feiern durften).<br />
Los 848 Schätzwert 30-75 €<br />
Nie<strong>de</strong>rlausitzer Bank AG<br />
Cottbus, Aktie 1.000 RM März 1927<br />
(Auflage 700, R 5) EF-VF<br />
Gründung 1901 als “Nie<strong>de</strong>rlausitzer Kredit- und Sparbank AG”.<br />
Filialen in Crossen, Forst, Frankfurt (O<strong>de</strong>r), Guben, Küstrin, Lübben,<br />
Sagan, Sommerfeld, Sorau und Weißwasser. Großaktionär<br />
war die Deutsche Bank. Laut Handbuch von 1953: erloschen.<br />
Los 849 Schätzwert 30-80 €<br />
Nie<strong>de</strong>rlausitzer Kohlenwerke AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark 17.7.1905<br />
(Auflage 2000, R 2) VF<br />
Dekorativ, mit Hermes-Vignette in allen vier Ecken.<br />
Gründung 1882 mit Sitz in Fürstenberg a.O., zur vorteilhafteren<br />
Gestaltung <strong>de</strong>s Brikettvertriebs. 1902 Sitzverlegung nach Berlin<br />
(Potsdamerstr. 127/128). Die Ges. besaß 8 Braunkohlen-Tagebaue<br />
im Senftenberger Revier, 2 Tiefbaue im Spremberger<br />
Revier und 3 Tage- bzw. Tiefbaue im Borna-Leipziger Revier,<br />
dazu 16 Brikettfabriken und 4 Ziegeleien, beschäftigt waren bis<br />
zu 6.000 Menschen. 1919 Beitritt zum ostelbischen sowie zum<br />
mittel<strong>de</strong>utschen Braunkohlensyndikat, die für die angeschlossenen<br />
Werke <strong>de</strong>n kompletten Verkauf übernahmen und Produktionsquoten<br />
vergaben. Die in Berlin börsennotierte AG erwirtschaftete<br />
regelmäßig zweistellige Divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n, Großaktionär<br />
war <strong>de</strong>r Petschek-Konzern in Aussig (<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Weltwirt-<br />
schaftskrise dann in <strong>de</strong>rbe Schwierigkeiten kam). Seit 1939 in<br />
Liquidation.<br />
Los 850 Schätzwert 150-200 €<br />
Nie<strong>de</strong>rsächsische Montan-AG<br />
Berlin, Aktie 2.000 Mark 5.10.1923 (R 10)<br />
EF-VF<br />
Nur 2 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Erwerb von Montangerechtsamen insbeson<strong>de</strong>re für Erdöle und<br />
Erze. Ölexploration auf einem Gelän<strong>de</strong> in Nienhagen/Wietze bei<br />
Hannover, auf <strong>de</strong>m 1925 mit Bohrungen begonnen wer<strong>de</strong>n<br />
sollte. 1928 gelöscht.<br />
Los 851 Schätzwert 400-500 €<br />
Nienburger Eisengiesserei<br />
und Maschinenfabrik<br />
Nienburg a. S., Aktie 1.000 Mark<br />
1.11.1919 (Auflage 188, R 10) VF<br />
Zuvor völlig unbekannt gewesen, nur 4 Stück wur<strong>de</strong>n<br />
im Reichsbankschatz gefun<strong>de</strong>n.<br />
Gründung 1872 in Mag<strong>de</strong>burg unter <strong>de</strong>r Firma Nienburger Eisengiesserei<br />
und Maschinenfabrik, Sitz ab 1874 in Nienburg, zeitweilig<br />
auch in Berlin. 1923 umbenannt in Nienburger Maschinenfabrik.<br />
Spezialitäten: Ziegel- und Brikettmaschinen, Dampfmaschinen, komplette<br />
Anlagen von Dampfziegeleien, Cementfabriken, Kokereien,<br />
Kohlen<strong>de</strong>stillationen, Guss aller Arten. 1929 mangels Sanierungsmöglichkeiten<br />
in Liquidation gegangen, die Fabrikationsunterlagen<br />
(Patente, Mo<strong>de</strong>lle, Zeichnungen) gingen in <strong>de</strong>n Besitz <strong>de</strong>r Sächsischen<br />
Maschinenfabrik vorm. Richard Hartmann in Chemnitz über.<br />
Los 852 Schätzwert 100-150 €<br />
Nienburger Eisengiesserei<br />
und Maschinenfabrik<br />
Nienburg a. S., Aktie 1.000 Mark<br />
10.1.1922 (Auflage 2400, R 8) EF-VF<br />
Geschichte siehe voriges Los.<br />
Nr. 852<br />
Los 853 Schätzwert 20-75 €<br />
Nitritfabrik AG<br />
Cöpenick, Aktie 1.000 Mark 20.3.1923<br />
(Auflage 15000, R 2) VF<br />
Mit Umstellung 1933.<br />
Gründung 1906 unter Übernahme einer gleichnamigen GmbH.<br />
Die Fabrik an <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong>nschloßstraße zu bei<strong>de</strong>n Seiten eines<br />
Stichkanals <strong>de</strong>r Spree beschäftigte auf ihrem Fabrikareal von<br />
knapp 60.000 qm etwa 200 Arbeiter. Hergestellt wur<strong>de</strong>n Ameisensäure,<br />
Tannin, Gallus- und Pyrogallussäure, Perborat, Wasserstoffsuperoxyd,<br />
Borax, Bromsalze und organische Präparate<br />
für phamazeutische und photographische Zwecke. 1922 Gründung<br />
<strong>de</strong>r “Orgacid” Chemische Fabrik GmbH & Co. zur Herstellung<br />
von Oxalsäure und <strong>de</strong>ren Salzen gemeinsam mit <strong>de</strong>m Auer-Konzern<br />
(<strong>de</strong>r seinen Anteil ein Jahr später in Aktien <strong>de</strong>r Nitritfabrik<br />
AG tauschte). Großaktionär war die Familie von Gwinner<br />
(Arthur von Gwinner war bis zu seinem Tod 1919 Vorstandssprecher<br />
<strong>de</strong>r Deutschen Bank). Das Kapital <strong>de</strong>r bis 1926 in Berlin<br />
börsennotierten AG mußte zwecks Sanierung 1926 im Verhältnis<br />
5:1 (mit anschließen<strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>raufstockung auf 2 Mio.<br />
RM) und 1931 erneut 2:1 auf 1 Mio. RM zusammengelegt wer<strong>de</strong>n,<br />
1951 Umstellung 20:1 auf 50.000 DM. 1945 wur<strong>de</strong> die<br />
Köpenicker Fabrik erst vollständig durch die Russen <strong>de</strong>montiert<br />
und dann in Volkseigentum überführt, weshalb die AG ihren Sitz<br />
1949 nach Schleissheim und 1956 weiter nach Feldkirchen bei<br />
München verlegte. 1957 Umwandlung in eine GmbH & Co. KG.<br />
Los 854 Schätzwert 400-500 €<br />
Nordböhmische Elektrizitätswerke AG<br />
Bo<strong>de</strong>nbach, Zwischenschein 1.100 x<br />
1.000 RM 22.4.1941 (eingezahlt zu 25 %<br />
plus volles Agio, R 12), ausgegeben an die<br />
Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft in<br />
Dessau VF<br />
Bei <strong>de</strong>r 1941er Kapitalerhöhung um 2,5 Mio. RM<br />
über nahm Contigas 44 % <strong>de</strong>r neuen Aktien. Maschinenschriftliche<br />
Ausfertigung mit Originalunter-<br />
Nr. 854 Nr. 879<br />
schriften. Ein Unikat aus <strong>de</strong>m Reichsbankschatz.<br />
Kleinere Randschä<strong>de</strong>n oben fachgerecht restauriert.<br />
Gründung 1911 als GmbH für die Stromversorgung <strong>de</strong>s Bezirks<br />
Türmitz, AG seit 1915. Im gleichen Jahr Übernahme <strong>de</strong>r Steinkohlenbergwerke<br />
<strong>de</strong>r Gräfin Silva-Tarouca in und um Türmitz<br />
zur Versorgung <strong>de</strong>s Kohlekraftwerks <strong>de</strong>r eigenen Überlandzentrale.<br />
1923 fusionsweise Übernahme <strong>de</strong>r Siemens Elektrische<br />
Betriebe Ges. mbH in Turn-Teplitz, dadurch Ausweitung <strong>de</strong>s<br />
Versorgungsgebietes auch auf Teplitz, Dux und Oberleutensdorf,<br />
1926/28 auch auf Tetschen, Deutsch-Gabel, Böhmisch-<br />
Leipa, Auscha, Leitmeritz und Lobositz durch Übernahme weiterer<br />
regionaler Versorger. Großaktionäre 1943: Deutsche Continental-Gas-Ges.<br />
(rd. 42 %), Reichsgau Su<strong>de</strong>tenland, Schweizerische<br />
Ges. für elektrische Industrie.<br />
Los 855 Schätzwert 75-125 €<br />
Nord<strong>de</strong>utsche Hefeindustrie AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 RM Dez. 1942<br />
(Auflage 9400, R 7) EF<br />
Gründung 1909 in Werl als F. Wulf AG. Herstellung von Hefe,<br />
Spiritus, Likören, Branntwein, Weinbrand, Fruchtsäften und<br />
Mühlenfabrikaten. Betriebe in Dessau, Dres<strong>de</strong>n, Stettin, Tilsit,<br />
Hamburg und Werl. In die Deutsche Hefewerke GmbH umgewan<strong>de</strong>lt,<br />
einer <strong>de</strong>r größten Hefehersteller Europas.<br />
Los 856 Schätzwert 25-50 €<br />
Nord<strong>de</strong>utsche Hochseefischerei AG<br />
Wesermün<strong>de</strong>-G., Aktie 1.000 RM<br />
27.3.1940 (Auflage 750, R 4) EF<br />
Gründung 1907. 1935 Übernahme <strong>de</strong>r Deutsche Fischerei AG.<br />
Die Fangflotte erreichte bis zum Kriegsbeginn 23 Schiffe. 1968<br />
Übernahme <strong>de</strong>r Bremen-Vegesacker Fischerei GmbH. 1970<br />
Vercharterung <strong>de</strong>r gesamten Flotte (15 Schiffe) an die Nordsee<br />
Deutsche Hochseefischerei GmbH. 1977 Rückzug aus <strong>de</strong>m<br />
Fischfanggeschäft. 1979 Umfirmierung in Project Carries AG<br />
und Sitzverlegung von Bremerhaven nach Leer/Ostfriesland.<br />
Seit<strong>de</strong>m Wahrnehmung von Geschäftsführungsaufgaben als<br />
Komplementär für Ree<strong>de</strong>reien <strong>de</strong>s neuen Schiffstyps Project<br />
Carrier. 1982 Sitzverlegung nach Bad Schwartau. 1985 Umbenennung<br />
in Hansa-Linie AG und Sitzverlegung nach Bremen,<br />
79
1989 Umbenennung in MAMMOET-HANSA-Linie AG, 1994<br />
Sitzverlegung nach Rostock, seit 1995 als Ree<strong>de</strong>rei Hansa AG<br />
und seit 2007 als INTERHANSA Ree<strong>de</strong>rei AG firmierend. Eigene<br />
Umsätze erzielt die AG nicht mehr, wesentliches Aktivum<br />
waren bis zum Verkauf 2008/2009 Beteiligungen an <strong>de</strong>r Hugo<br />
Stinnes Linien GmbH (100 %, Liniendienste nach Mexico und<br />
Südafrika) und <strong>de</strong>r Deutsche SeeHansa AG (50 %, Emissionshaus<br />
für Schiffsbeteiligungen gemeinsam mit Salomon Brothers).<br />
Für die ganz wenigen übrig gebliebenen Kleinaktionäre<br />
ließ <strong>de</strong>r zypriotische Großaktionär 2008 einen squeeze-out beschließen.<br />
Los 857 Schätzwert 75-150 €<br />
Nord<strong>de</strong>utsche<br />
Portland-Cement-Fabrik Misburg<br />
Hannover, Aktie 1.000 Mark 26.11.1904<br />
(Auflage 400, R 5) VF+<br />
Gründung 1898. Später kontinuierliche Expansion durch Aufkauf<br />
von Konkurrenten: Misburger Portland-Cement-Fabrik<br />
Kronsberg AG (1904), Wunstorfer Portlandcementwerke AG<br />
(1929), Portland Alemannia AG in Hannover und Portlandcementwerk<br />
Schwanebeck AG (1930), Portlandcementfabrik Hoiersdorf<br />
GmbH, Portlandzementwerk “Siegfried” Salz<strong>de</strong>rhel<strong>de</strong>n<br />
AG und Vorwohler Portland-Cement-Fabrik AG, Hannover<br />
(1942). Alle diese Beteiligungen sowie die Braunschweiger<br />
Portlandcementwerk AG, Sal<strong>de</strong>r wur<strong>de</strong>n 1950/57 auf die Nordcement<br />
verschmolzen. 1964 Umfirmierung in NORDCEMENT<br />
AG. 1973/75 Erwerb und anschließen<strong>de</strong> Verschmelzung <strong>de</strong>r<br />
Portland-Cementfabrik Har<strong>de</strong>gsen AG. In Betrieb blieben die<br />
Werke Höver (Werk Alemannia), Har<strong>de</strong>gsen und Wunstorf.<br />
Großaktionär war bis in die 70er Jahre die AGIV, danach die<br />
Schweizer Hol<strong>de</strong>rbank (Mehrheit) und mit einer Schachtel die<br />
Hei<strong>de</strong>lberger Zement. Verschmelzung mit <strong>de</strong>r Alsen GmbH und<br />
<strong>de</strong>r Breitenburger Finanzholding GmbH auf die Breitenburger<br />
Portland-Cement-Fabrik und Umbenennung in Alsen AG.<br />
Los 858 Schätzwert 30-60 €<br />
Nord<strong>de</strong>utsche<br />
Portlandcementfabrik Misburg AG<br />
Hannover, 5 % <strong>Teil</strong>schuldv. 500 RM Mai<br />
1939 (Auflage 1000, R 7) EF-<br />
Geschichte siehe voriges Los.<br />
80<br />
Los 859 Schätzwert 150-250 €<br />
Nord<strong>de</strong>utsche Versicherungs-Bank AG<br />
Berlin, Namensaktie 1.000 Mark<br />
9.8.1917 (Auflage 1000, R 8) UNC-EF<br />
Wun<strong>de</strong>rschöne geometrische Umrahmung.<br />
Gründung 1915. Rückversicherung in allen Zweigen, 1919 auch<br />
Aufnahme <strong>de</strong>r direkten Transport-Versicherung. 1925 nach Ablehnung<br />
eines Vergleichsantrages in Anschlußkonkurs gegangen.<br />
Los 860 Schätzwert 40-60 €<br />
Nord<strong>de</strong>utscher Lloyd<br />
Bremen, 4,5 % Genussrechtsurkun<strong>de</strong> 50<br />
RM Mai 1926 (R 8) VF+<br />
Gründung 1857 durch Fusion von vier noch älteren Vorgängergesellschaften.<br />
Zunächst wur<strong>de</strong>n England und New York angelaufen,<br />
bald darauf auch Baltimore und New Orleans. Neben <strong>de</strong>r<br />
Frachtschiffahrt spielte <strong>de</strong>r Passagierverkehr, vor allem die Verschiffung<br />
von Auswan<strong>de</strong>rern, eine große Rolle. Daneben Betätigung<br />
im Bugsierdienst, im Bä<strong>de</strong>rdienst, Betrieb einer Assekuranz<br />
und <strong>de</strong>r bis heute tätigen Schiffsreparatur. 1867 ging <strong>de</strong>r<br />
Lloyd eine weit reichen<strong>de</strong> Partnerschaft mit <strong>de</strong>r Baltimore & Ohio<br />
Railroad ein. In Bremerhaven bestand schon seit 1862 mit<br />
<strong>de</strong>r Geestebahn ein für <strong>de</strong>n Passagierverkehr wichtiger Anschluß.<br />
Seit <strong>de</strong>n 1870er Jahren wur<strong>de</strong>n auch Westindien und<br />
Südamerika angelaufen. Mit fast 100 Schiffen zu dieser Zeit bereits<br />
die viertgrößte Schifffahrtsgesellschaft <strong>de</strong>r Welt. 1885 gewann<br />
<strong>de</strong>r Lloyd die Ausschreibung <strong>de</strong>r Reichspostdampferlinien,<br />
wonach monatlich folgen<strong>de</strong> Linien bedient wur<strong>de</strong>n: 1. Bremerhaven-Belgien/Holland-Genua-Neapel-Port<br />
Said-Suez-A<strong>de</strong>n-<br />
Colombo-Singapur-Hongkong-Shanghai, 2. eine Anschlußlinie<br />
Hongkong-Yokohama-Hiogo-Nagasaki-Shanghai, 3. eine Anschlußlinie<br />
Singapur-Batavia-Neu-Guinea und 4.) Bremerhaven-<br />
Suez-Colombo-A<strong>de</strong>lai<strong>de</strong>-Melbourne-Sidney. Für <strong>de</strong>n regelmäßigen<br />
Linienverkehr zahlte das Reich einen Zuschluß von 4,09<br />
Mio. M jährlich. Neben <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen beför<strong>de</strong>rte <strong>de</strong>r Lloyd auch<br />
belgische, englische und amerikanische Post. 1897 stellte <strong>de</strong>r<br />
Lloyd mit <strong>de</strong>r “Kaiser Wilhelm” das zu dieser Zeit größte und<br />
schnellste Schiff <strong>de</strong>r Welt in Dienst, das auch gleich das “Blaue<br />
Band” für die schnellste Atlantiküberquerung gewann. Es folgte<br />
das “Jahrzehnt <strong>de</strong>r Deutschen” in <strong>de</strong>r Transatlantikschiffahrt, die<br />
nun vom Nord<strong>de</strong>utschen Lloyd und <strong>de</strong>r HAPAG aus Hamburg dominiert<br />
wur<strong>de</strong>. In <strong>de</strong>r gleichen Liga spielten nur noch die Cunard-Line<br />
und die White Star Line aus Großbritannien. Anfang<br />
<strong>de</strong>s 20. Jh. kaufte <strong>de</strong>r New Yorker Finanzier J. P. Morgan eine<br />
Reihe von Ree<strong>de</strong>reien auf, um ein transatlantisches Monopol zu<br />
errichten, was ihm aber nicht gelang. Die HAPAG und <strong>de</strong>r Lloyd<br />
machten Morgan, <strong>de</strong>r auch die Baltimore & Ohio RR beherrschte,<br />
daraufhin ein Angebot, <strong>de</strong>n Markt unter sich aufzuteilen. Dieses<br />
Abkommen bestand bis 1912. Bei Beginn <strong>de</strong>s 1. Weltkrieges<br />
1914 besaß <strong>de</strong>r Lloyd eine Tonnage von über 900.000 BRT<br />
und beschäftigte über 22.000 Menschen. 1917 beschlagnahmten<br />
die USA bereits die Hafenanlagen <strong>de</strong>s Lloyd in Hoboken und<br />
alle dort aufliegen<strong>de</strong>n Dampfer, praktisch <strong>de</strong>r gesamte Rest <strong>de</strong>r<br />
Flotte ging durch <strong>de</strong>n Versailler Vertrag verloren. mit nur 57.000<br />
BRT, alles nur kleine Dampfer, musste <strong>de</strong>r Lloyd praktisch von<br />
vorn beginnen. 1920 Gründung <strong>de</strong>r Lloyd Luftverkehr, 1923 mit<br />
entsprechen<strong>de</strong>n HAPAG-Aktivitäten zur Deutschen Aero Lloyd<br />
zusammengeführt, also eine Keimzelle <strong>de</strong>r 1926 gegrün<strong>de</strong>ten<br />
Deutschen Luft Hansa. Die Weltwirtschaftskrise erzwang 1930<br />
einen Unionsvertrag mit <strong>de</strong>m Hamburger Erzrivalen HAPAG, <strong>de</strong>r<br />
1935 zu einer Betriebsgemeinschaft erweitert wur<strong>de</strong>. Bei Ausbruch<br />
<strong>de</strong>s 2. Weltkrieges hatte sich <strong>de</strong>r Lloyd wie<strong>de</strong>r bis auf eine<br />
Tonnage von rd. 600.000 BRT hochgearbeitet und beschäftigte<br />
über 12.000 Mitarbeiter. Wie<strong>de</strong>rum gingen im Krieg sämtliche<br />
Schiffe verloren bzw. wur<strong>de</strong>n anschließend von <strong>de</strong>n Alliierten<br />
beschlagnahmt. Erneut musste <strong>de</strong>r Lloyd 1945 mit 350 Mitarbeitern<br />
ganz von vorn anfangen. Bis 1970, <strong>de</strong>m Jahr <strong>de</strong>r Fusion,<br />
erreichte er wie<strong>de</strong>r 390.000 BRT und stand damit an 16.<br />
Stelle <strong>de</strong>r Weltrangliste. Die HAPAG kam mit 410.000 BRT auf<br />
Platz 9. Dann en<strong>de</strong>ten 113 Jahre Eigenständigkeit <strong>de</strong>s Nord<strong>de</strong>utschen<br />
Lloyd mit <strong>de</strong>r Fusion zur HAPAG-LLOYD AG. 1981<br />
wird mit <strong>de</strong>r “Frankfurt Express” das größte Containerschiff <strong>de</strong>r<br />
Welt in Dienst gestellt. 1998 übernimmt die Preussag (heute<br />
TUI) die Aktienmehrheit und verleibt sich Hapag-Lloyd 2002 per<br />
Squeeze-Out <strong>de</strong>r Kleinaktionäre ganz ein. Mit <strong>de</strong>r 2005 erfolgten<br />
Übernahme <strong>de</strong>r kanadischen CP Ships gehört Hapag-Lloyd<br />
zu <strong>de</strong>n 5 größten Ree<strong>de</strong>reien <strong>de</strong>r Welt. Aktuell zwingt <strong>de</strong>r Druck<br />
<strong>de</strong>r eigenen Aktionäre die TUI, Hapag-Lloyd zum Verkauf zu stellen.<br />
Statt <strong>de</strong>r Abgabe an einen Konkurrenten scheint im Moment<br />
ein (erneuter) Börsengang von Hapag-Lloyd wahrscheinlich.<br />
I<strong>de</strong>ntische Gestaltung wie voriges Los.<br />
Los 861 Schätzwert 200-250 €<br />
Nord<strong>de</strong>utscher Lloyd<br />
Bremen, 4,5 % Genussrechtsurkun<strong>de</strong> 500<br />
RM Mai 1926 (R 10) VF+<br />
Nur 5 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Los 862 Schätzwert 75-150 €<br />
Nordhäuser Tabakfabriken AG<br />
Nordhausen, Aktie 1.000 Mark Juli 1920<br />
(Auflage 10000, R 5) EF-VF<br />
Die AG entstand 1919 durch Zusammenschluß von 10 Nordhäuser<br />
Firmen dieser Branche (u.a. Fa. Hanewacker, Kneiff).<br />
Unter ihrem Dach arbeiteten 10 Kautabakfabriken, eine Rauchtabakfabrik<br />
und eine Zigarrenfabrik in Nordhausen sowie 5 Zigarrenfilialbetriebe<br />
auf <strong>de</strong>m Eichsfeld. Im Juli 1946 wur<strong>de</strong>n die<br />
Betriebe vom Land Thüringen enteignet, womit sich ihr Schikksal<br />
von <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r AG löste: Die NORTAK entwickelte sich zu<br />
DDR-Zeiten zu einem großen Zigarettenhersteller. 1990 übernahm<br />
die Reemtsma-Gruppe diesen per Wie<strong>de</strong>rvereinigung<br />
hinzugekommenen Wettbewerber, 2002 wur<strong>de</strong>n die NORTAK-<br />
Betriebe stillgelegt. Die alte AG dagegen verlegte 1950 ihren<br />
Sitz nach Düsseldorf. Die geplante Wie<strong>de</strong>raufnahme einer Produktion<br />
im Westen konnte nie realisiert wer<strong>de</strong>n, doch blieb <strong>de</strong>r<br />
AG-Mantel die ganze Zeit im Düsseldorfer Freiverkehr notiert.<br />
Seine be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Fotokunstsammlung brachte 2003/04 <strong>de</strong>r<br />
Großaktionär Clemens Ved<strong>de</strong>r in die AG ein, die bei <strong>de</strong>r Gelegenheit<br />
in “Camera Work AG” umfirmierte. Der Sitz wur<strong>de</strong> nach<br />
Hamburg verlegt, in einer ehemals von Jil San<strong>de</strong>r bewohnten<br />
Villa eröffnete man neue Ausstellungsräume. Nach Bill Gates<br />
und Getty Images verfügt Camera Work heute über <strong>de</strong>n weltweit<br />
drittgrößten Bestand an Photorechten und veranstaltet be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong><br />
Ausstellungen. Der Börsenkurs einer 5-DM-Aktie übersteigt<br />
inzwischen atemberauben<strong>de</strong> 5.000 €.<br />
Los 863 Schätzwert 20-75 €<br />
Nordhausen-Wernigero<strong>de</strong>r<br />
Eisenbahn-Gesellschaft<br />
Wernigero<strong>de</strong>, Aktie 100 RM Jan. 1925<br />
(Auflage 8250, R 2) EF<br />
Blindprägesiegel mit Dampflok.<br />
Gründung 1896. Die berühmte “Harzquerbahn”, bis heute<br />
weitgehend im Dampfbetrieb in Aktion. 1000-mm-Schmalspurbahn<br />
Nordhausen-Eisfel<strong>de</strong>r Talmühle-Sorge-Drei Annen-<br />
Hohne-Wernigero<strong>de</strong> (62 km) mit Abzweig von Drei Annen-Hohne<br />
auf <strong>de</strong>n Brocken (19 km). 1949 Übernahme durch die Deutsche<br />
Reichsbahn. Seit <strong>de</strong>r “Wen<strong>de</strong>” Betrieb durch die landkreiseigene<br />
“Harzer Schmalspurbahnen GmbH”.<br />
Los 864 Schätzwert 80-185 €<br />
Nordpark Terrain-AG<br />
Berlin, Aktie 2.000 Mark 28.1.1904.<br />
Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 1400, R 4) VF<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1903 zum Zwecke <strong>de</strong>s Erwerbes, <strong>de</strong>r Verwaltung<br />
und Verwertung von Grundstücken. Die Gesellschaft besaß<br />
zwei Terrains im Berliner Bezirk Wedding an <strong>de</strong>r Müllerstraße<br />
gelegen.<br />
Los 865 Schätzwert 25-50 €<br />
NSU Werke AG<br />
Neckarsulm, Aktie 100 RM Okt. 1941<br />
(Auflage 4000, R 2) EF<br />
Gründung 1884 als “Neckarsulmer Strickmaschinenfabrik”.<br />
1969 Verschmelzung mit <strong>de</strong>r Auto-Union GmbH zur Audi NSU<br />
Auto Union AG.<br />
Los 866 Schätzwert 125-175 €<br />
Obercasseler Brauerei-AG<br />
Obercassel bei Bonn, Aktie 100 RM Jan.<br />
1933 (Auflage 375, R 10) VF<br />
Einzelstück aus <strong>de</strong>m Reichsbankschatz. Fleckig.<br />
Gründung 1876 als Brauerei von Hubert Dreesen, AG seit 1888<br />
als Obercasseler Bierbrauerei-Gesellschaft, 1899 Umfirmierung<br />
wie oben. Gebraut wur<strong>de</strong> Bier unter <strong>de</strong>n Marken “Drachenfels”<br />
und “Obag”. Eigene Gastwirtschaften in Bonn und<br />
Siegburg. Mit Divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n von 15 % und mehr Anfang <strong>de</strong>s Jahrhun<strong>de</strong>rts<br />
eine <strong>de</strong>r am besten rentieren<strong>de</strong>n Brauereien. 1972 in<br />
die Oberkasseler Brauerei GmbH umgewan<strong>de</strong>lt.<br />
Nr. 859 Nr. 861 Nr. 863 Nr. 867
Los 867 Schätzwert 200-250 €<br />
Oberhausener Baugesellschaft<br />
auf Aktien<br />
Oberhausen (Rhld.), Aktie 200 Goldmark<br />
1.12.1924. Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 120, R 9)<br />
VF+<br />
Zuvor ganz unbekannt gewesen!<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1924 durch die Stadtgemein<strong>de</strong> Oberhausen und<br />
verschie<strong>de</strong>ne Unternehmen zur Errichtung gesun<strong>de</strong>r Kleinwohnungen<br />
für min<strong>de</strong>rbemittelte Volkskreise zwecks Lin<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r<br />
Wohnungsnot und Schaffung von Arbeitsgelegenheit für Erwerbslose.<br />
Als Sacheinlage brachten die Ziegelwerke Oberhausen<br />
GmbH Stück 1 Mio. Ziegel ein, die Erwerbs- u. Betriebsgesellschaft<br />
für industrielle Unternehmungen GmbH ein Grundstück<br />
in <strong>de</strong>r Grösse von 7,60 a. Bereits nach 12 Jahren, also<br />
1936 wur<strong>de</strong> die Gesellschaft wie<strong>de</strong>r aufgelöst.<br />
Los 868 Schätzwert 75-150 €<br />
Oberlausitzer Zuckerfabrik AG<br />
Löbau i.Sa., Aktie 20 RM 28.7.1926<br />
(Auflage 17428, R 7) EF<br />
Gründung 1883. Herstellung, Erwerb, Verarbeitung und Verkauf<br />
von Zucker sowie Betrieb <strong>de</strong>r Landwirtschaft. Haupterzeugnisse<br />
waren Weißzucker, Melasse sowie Naß- und Trockenschnitzel.<br />
Großaktionär war die Süd<strong>de</strong>utsche Zucker-AG in Mannheim.<br />
In <strong>de</strong>r DDR als Zuckerfabrik Löbau VEB weiter geführt.<br />
Nach 1990 von <strong>de</strong>r Südzucker AG übernommen, diese schließt<br />
das Werk En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Kampagne 2002.<br />
Los 869 Schätzwert 30-90 €<br />
Oberrheinische Immobilien AG<br />
Freiburg i.Br., Aktie 10.000 Mark 15.6.1923.<br />
Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 2500, R 4) EF<br />
Gründung 1923. Immobilienverwaltung. 1926 Auflösungsbeschluss.<br />
Bis 1943 war die Gesellschaft noch nicht abgewickelt.<br />
Großaktionär (1943): Die Stumm-Gruppe.<br />
Los 870 Schätzwert 25-50 €<br />
O<strong>de</strong>nwäl<strong>de</strong>r Hartstein-Industrie AG<br />
Darmstadt, Aktie 400 RM 1.1.1939<br />
(Auflage 3300, R 3) UNC-EF.<br />
Gründung 1898 in Ober-Ramstadt, seit 1907 in Darmstadt ansässig.<br />
Produktion von Schotter und Pflastermaterial sowie von<br />
Gehwegplatten und Betonrandsteinen. Heute O<strong>de</strong>nwäl<strong>de</strong>r Hartstein-Industrie<br />
GmbH, Hanau (OHI). Die Tochtergesellschaft <strong>de</strong>r<br />
OHI, die GBRE (Groß-Bieberau - Reinheimer Eisenbahn GmbH)<br />
betreibt die Eisenbahnstrecke Reinheim - Groß-Bieberau.<br />
Los 871 Schätzwert 200-250 €<br />
Oel-, Kali- und Kohlen-<br />
Bohrgesellschaft Esperke<br />
Berlin, Anteil-Schein 1/1.000 1.3.1906<br />
(R 9), ausgestellt auf General-Intendant<br />
Kammerherr L. v. Ra<strong>de</strong>tzky-Mikulicz,<br />
Ol<strong>de</strong>nburg i/Gr VF<br />
Aparte Blätter- und Blüten-Umrandung. Zuvor völlig<br />
unbekannt gewesener Bergwerks-Anteil, nur<br />
10 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Bohrgesellschaft belegen in <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> Esperke, Kreis Neustadt<br />
am Rübenberge Regierungsbezirk Lüneburg.<br />
Los 872 Schätzwert 100-150 €<br />
Oeynhauser Maschinenfabrik AG<br />
Bad Oeynhausen, Aktie 1.000 Mark<br />
18.10.1921 (Auflage 3000, R 7) EF-VF<br />
Nur 5 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Bei <strong>de</strong>r Gründung 1920 wur<strong>de</strong> die “Oma Oeynhauser Maschinenfabrik<br />
Schulze & Co. KG” eingebracht, die vornehmlich landwirtschaftliche<br />
Maschinen und Fahrzeuge herstellte. 1927, im<br />
Jahr <strong>de</strong>r Sitzverlegung nach Berlin, saß auch Fabrikdirektor Fritz<br />
Windhoff aus Rheine im Aufsichtsrat (die Windhoff AG ist heute<br />
börsennotiert). In <strong>de</strong>r Weltwirtschaftskrise untergegangen.<br />
Los 873 Schätzwert 75-150 €<br />
Ol<strong>de</strong>nburg-Portugiesische<br />
Dampfschiffs-Rhe<strong>de</strong>rei<br />
Ol<strong>de</strong>nburg, Actie V. Ausg. 1.000 Mark<br />
19.4.1900 (Auflage 400, R 5) EF<br />
Hochformat, hübscher Druck mit großer Ree<strong>de</strong>rei-<br />
Flagge.<br />
Gründung 1883. Liniendienst mit (vor <strong>de</strong>m ersten Weltkrieg) 20<br />
Dampfern von Hamburg, Bremen, Amsterdam und Rotterdam<br />
nach Portugal, Spanien, Marokko und <strong>de</strong>n Kanarischen Inseln<br />
(von wo als Rückfracht in großem Umfang Bananen und Tomaten<br />
mitgenommen wur<strong>de</strong>n). Später kamen als Abfahrtshäfen<br />
auch noch Danzig, Gdingen und Stettin hinzu. 1915 Sitzverlegung<br />
nach Hamburg, dort auch börsennotiert. Die O.P.D.G. gehörte<br />
zuletzt zum HANIEL-Konzern. 1951 in eine Kommanditgesellschaft<br />
umgewan<strong>de</strong>lt.<br />
Los 874 Schätzwert 30-80 €<br />
Ol<strong>de</strong>nburger Versicherungs-Ges.<br />
Ol<strong>de</strong>nburg i.O., Aktie 100 RM 15.9.1928<br />
(Auflage 10000, R 4) EF<br />
Sehr schöne Umrandung.<br />
Gründung 1857. Versicherte alles, was versichert wer<strong>de</strong>n kann:<br />
Feuer-, Mietverlust-, Betriebsunterbrechung-, Transport-, Gepäck-,<br />
Einbruchdiebstahl-, Gas-, Leitungswasser-, Aufruhr-, Valoren-,<br />
Luftfahrt-, Film- und Sturmscha<strong>de</strong>n-Versicherung. 1964<br />
Übernahme <strong>de</strong>s Versicherungsbestan<strong>de</strong>s durch die Aachener<br />
und Münchener Feuer-Versicherungs-Gesellschaft.<br />
Los 875 Schätzwert 400-500 €<br />
Ol<strong>de</strong>nburgische Glashütte<br />
Ol<strong>de</strong>nburg, Actie 1.000 Mark 7.11.1885.<br />
Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 500, R 7) EF-VF<br />
Ausgesprochen <strong>de</strong>korative Umrahmung. Wie auch<br />
das folgen<strong>de</strong> Los zuvor völlig unbekannt gewesen!<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1885. Herstellung aller Sorten von Wein-, Bier- und<br />
Mineralwasserflaschen. Das zuletzt 137.000 qm große Betriebsgelän<strong>de</strong>,<br />
auf <strong>de</strong>m anfangs 500-600 Mitarbeiter beschäftig waren,<br />
prägte maßgeblich die Entwicklung <strong>de</strong>s Stadtteils Osternburg<br />
zum typischen Industrie- und Arbeiterviertel. Das Werk lag<br />
direkt an <strong>de</strong>r auch für Seeschiffe befahrbaren Hunte und verfügte<br />
über einen eigenen Hafen. 1907 Beteiligung an <strong>de</strong>r “Ges. zum<br />
Erwerb <strong>de</strong>r Owens’schen Patente”, womit die industrielle Flaschenproduktion<br />
möglich wur<strong>de</strong>. 1908 Ankauf <strong>de</strong>r Flaschenfabrik<br />
A. Lagershausen in Stadthagen, 1909 Erwerb <strong>de</strong>r Glashütte<br />
Hildburghausen, 1913 Erwerb <strong>de</strong>r Glashütte L. Reppert Sohn<br />
GmbH in Friedrichsthal (Saar). Nunmehr betrug die Gesamtproduktionskapazität<br />
aller Werke 60 Mio. Flaschen jährlich. 1942/44<br />
Verkauf <strong>de</strong>r Werke Hildburghausen und Friedrichsthal und Konzentration<br />
<strong>de</strong>r Produktion in Ol<strong>de</strong>nburg. Börsennotiz bis 1942 in<br />
Hamburg, ab 1949 in Bremen. 1957, inzwischen war die Ol<strong>de</strong>nburgische<br />
Glashütte die mo<strong>de</strong>rnste Hohlglashütte <strong>de</strong>s ganzen<br />
europäischen Kontinents, von <strong>de</strong>r Gerresheimer Glas AG übernommen<br />
wor<strong>de</strong>n. 1983 wur<strong>de</strong> das Werk geschlossen.<br />
Los 876 Schätzwert 400-500 €<br />
Ol<strong>de</strong>nburgische Glashütte<br />
Ol<strong>de</strong>nburg, Aktie 1.000 Mark 1.8.1913<br />
(Auflage 500, Kapitalerhöhung zum<br />
Erwerb <strong>de</strong>r Glashütte L. Reppert Sohn<br />
GmbH in Friedrichsthal/Saar, R 9) EF-VF<br />
I<strong>de</strong>ntische Gestaltung wie voriges Los. Ein paar<br />
unauffällige Rostfleckchen.<br />
Los 877 Schätzwert 200-250 €<br />
Optische Werke Rü<strong>de</strong>rsdorf AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark Aug. 1923<br />
(Auflage 2500, R 8) VF+<br />
Ausdrucksstarke Farbgebung. Aktien dieser be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n<br />
Ges. waren zuvor völlig unbekannt.<br />
Gründung im Jan. 1922 in Bremen unter Mitwirkung <strong>de</strong>s Bankhauses<br />
J. F. Schrö<strong>de</strong>r KGaA als Optische Werke AG. Im März<br />
1922 Umfirmierung wie oben und Sitzverlegung nach Berlin.<br />
Die Firma stellte nach 1919 und 1920 von Hugo Hahn (später<br />
als Vorstand tätig) erworbenen Patenten die RüO-Optik und <strong>de</strong>n<br />
Rüo-Tele-Anastigmat her. Für Fotolaien: Ein Anastigmat ist ein<br />
Nr. 875 Nr. 883<br />
aus min<strong>de</strong>stens drei Linsen bestehen<strong>de</strong>s Linsensystem, das einen<br />
früher berüchtigten Abbildungsfehler, die Punktlosigkeit (Astigmatismus)<br />
vermei<strong>de</strong>t. Im Nov. 1925 unter Geschäftsaufsicht<br />
gestellt (im Febr. 1926 wie<strong>de</strong>r aufgehoben). Danach nur<br />
noch Verwaltung <strong>de</strong>s Betriebsgrundstücks, das operative Geschäft<br />
wur<strong>de</strong> auf die Rüo Optik GmbH übertragen. 1932 ist die<br />
AG erloschen. Noch heute wer<strong>de</strong>n Rüo Anastigmaten auf ebay<br />
unter Sammlern hoch gehan<strong>de</strong>lt.<br />
Los 878 Schätzwert 75-150 €<br />
Osnabrücker Ziegelwerke AG<br />
Osnabrück, Aktie 100 RM 11.5.1934<br />
(kompletter Neudruck wegen<br />
Neustückelung, Auflage 1000, R 7) EF<br />
Mit drei Liquidationsstempeln <strong>de</strong>r Dresdner Bank.<br />
Gründung 1899, Sitz bis 1915 in Hellern, dann in Osnabrück.<br />
1919 aufgekauft durch die Hellern’sche Ziegelindustrie G. O.<br />
Kramer & Co. GmbH (gegr. 1872) und mit dieser anschließend<br />
fusioniert. 1920 Erwerb <strong>de</strong>r Ziegelwerk GmbH Lüstringen. In<br />
Betrieb waren zuletzt zwei Werke in Hellern und eines in Lüstringen.<br />
1938 in Liquidation gegangen.<br />
Los 879 Schätzwert 500-625 €<br />
OSRAM GmbH KG<br />
Berlin, 7 % Gold Bond Lit. B 500 US $<br />
2.12.1925 (Auflage 1575, R 8) VF+<br />
Zweisprachig englisch/<strong>de</strong>utsch. Tolle Vignette mit<br />
einer fast originalgroßen Glühlampe. Mit Restkupons<br />
ab 1945.<br />
“Wüßt nicht, was sie Besseres erfin<strong>de</strong>n könnten, als daß Lichter<br />
ohne Putzen brennten.” (Johann Wolfgang von Goethe, um<br />
1800). Um 1826 kam dann die Gasbeleuchtung auf. 1886 erfand<br />
<strong>de</strong>r österreichische Chemiker und Ingenieur Auer von<br />
Welsbach das Gasglühlicht. 1901 präsentierte die Auergesellschaft<br />
Glühlampen mit Osmium-Glühfä<strong>de</strong>n. Schon 1880 hatte<br />
Siemens & Halske die Entwicklung einer Glühlampe mit Kohlefä<strong>de</strong>n<br />
erfolgreich abgeschlossen und 1882 die älteste <strong>de</strong>utsche<br />
Glühlampenfabrik eröffnet. Das Warenzeichen OSRAM<br />
wur<strong>de</strong> ursprünglich 1906 von <strong>de</strong>r Auergesellschaft angemel<strong>de</strong>t.<br />
Es ist ein Kunstwort aus <strong>de</strong>n früher gängigen Glühwen<strong>de</strong>l-<br />
Materialien OSmium und WolfRAM. Am 1.7.1919 legten Siemens<br />
& Halske, die AEG und die Auergesellschaft ihre Glühlampenproduktion<br />
in <strong>de</strong>r neu gegrün<strong>de</strong>ten OSRAM GmbH KG<br />
zusammen. Seit 1978 ist Siemens Alleingesellschafter, Firmensitz<br />
ist München. Heute erwirtschaftet OSRAM mit 43.500 Mitarbeitern<br />
in 46 Werken (verteilt auf 17 Län<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Er<strong>de</strong>) einen<br />
Jahresumsatz von 4,6 Mrd. Euro.<br />
81
Los 880 Schätzwert 400-500 €<br />
OSRAM GmbH KG<br />
Berlin, 7 % Gold Bond 1.000 US $<br />
2.12.1925 (Auflage 3425, R 8) VF+<br />
Zweisprachig englisch/<strong>de</strong>utsch. I<strong>de</strong>ntische Gestaltung<br />
wie voriges Los. Mit Restkupons ab 1944.<br />
“<br />
Los 881 Schätzwert 300-375 €<br />
Ost-Afrikanische Plantagen-<br />
Gesellschaft Kilwa-Südland GmbH<br />
Berlin, 8 % Namens-<strong>Teil</strong>schuldv. 1.000<br />
Mark Juli 1913 (Auflage 250, R 8),<br />
ausgestellt auf und als Geschäftsführer in<br />
Faksimile unterschrieben von Dr. J. V.<br />
Lehmkuhl EF+<br />
<strong>Teil</strong> einer Anleihe von insgesamt 250.000 Mark,<br />
wobei 1914 zuerst nur 79.000 Mark plaziert wer<strong>de</strong>n<br />
konnten. Dekorativer G&D-Druck mit zwei<br />
kleinen Vignetten in <strong>de</strong>r Umrandung: links ein<br />
Schwarzafrikaner, rechts Palmen. Zuvor völlig unbekannt<br />
gewesener Kolonialwert!<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1908 mit einem Kapital von 404.000 Mark für <strong>de</strong>n<br />
Anbau von Sisalhanf, Kautschuk und Baumwolle in Lindi,<br />
Deutsch-Ostafrika. Die Ges. besaß eine Sisalagaven-Plantage<br />
mit eigener Hafenanlage am Mkoes-See im Bezirk Lindi, ca.<br />
3250 ha groß. Die Plantage besaß ein Wasserwerk und war über<br />
eine Feldbahn an das Netz <strong>de</strong>r Deutsch-Ostafrikanischen<br />
Eisenbahn-Ges. angeschlossen.<br />
Los 882 Schätzwert 25-50 €<br />
Ostbayerische Stromversorgung AG<br />
München, 8 % Schuldv. 500 RM<br />
31.5.1926 (Auflage 2000, R 5) EF<br />
<strong>Teil</strong> einer Anleihe von 3,5 Mio. RM auf Feingoldbasis<br />
unter <strong>de</strong>r Garantie <strong>de</strong>r Kreisgemein<strong>de</strong> Nie<strong>de</strong>rbayern.<br />
82<br />
OsramHöfe im ehemaligen Osram-Werk B, <strong>de</strong>n früheren Bergmann-Elektrizitäts-Werken, Seestr. 64<br />
Gründung 1923 unter Übernahme <strong>de</strong>s “Bayerischen Elektrizitäts-Wirtschafts-Verban<strong>de</strong>s<br />
eGmbH” (gegr. 1919) in München,<br />
1934 Sitzverlegung nach Landshut (Isar). Versorgung von Nie<strong>de</strong>rbayern<br />
und <strong>de</strong>s östlichen Reg.-bez. Oberbayern. Neben <strong>de</strong>r<br />
Eigenerzeugung in einem Diesel- und vier Wasserkraftwerken<br />
hauptsächlich Strombezug von <strong>de</strong>r Bayernwerk AG. Außer<strong>de</strong>m<br />
Beteiligung an <strong>de</strong>r “Kraftwerk am Höllenstein AG” in Straubing.<br />
1944 Fusion mit <strong>de</strong>r Oberpfalzwerke AG für Elektrizitätsversorgung<br />
in Regensburg (gegr. 1908 als “Bayerische Überland-<br />
Centrale AG, Haidhof”) zur Energieversorgung Oberbayern AG.<br />
Vereint versorgte man ein Drittel <strong>de</strong>r Staatsfläche Bayerns mit<br />
fast 17.000 Ortschaften. Großaktionär war das Bayernwerk<br />
(2000 mit <strong>de</strong>r PreußenElektra zur E.ON Energie AG verschmolzen),<br />
2001 in <strong>de</strong>r E.ON Bayern AG aufgegangen.<br />
Los 883 Schätzwert 200-250 €<br />
Ostmark Versicherungs-AG<br />
Wien, Sammel-Namensaktie 5 x 100 RM<br />
Juli 1941 (R 9) EF-VF<br />
Nur 8 Stück lagen im Reichsbankschatz. Rostfleckig.<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1898 als N.-Ö. Lan<strong>de</strong>sversicherungsanstalten, AG<br />
seit 1922 unter <strong>de</strong>r Firma Versicherungsanstalt <strong>de</strong>r österreichischen<br />
Bun<strong>de</strong>slän<strong>de</strong>r, Versicherungs-AG. 1938 umbenannt<br />
in Ostmark Versicherungs-AG. 1999 in <strong>de</strong>r UNIQA Versicherungen<br />
AG aufgegangen.<br />
Los 884 Schätzwert 60-120 €<br />
Ostsachsen-Bank AG<br />
Neugersdorf, Sa., Aktie 1.000 RM<br />
16.7.1925 (Auflage 250, R 5) EF<br />
Das 1924 gegrün<strong>de</strong>te Institut mit Verwaltungssitz in Neugersdorf<br />
führte Bankgeschäften aller Art aus, insbeson<strong>de</strong>re die Übernahme<br />
von Haftungen und Garantien für Dritte. Die Gesellschaft<br />
stand in Arbeitsgemeinschaft mit <strong>de</strong>r Girozentrale Sachsen. Die<br />
Bank wur<strong>de</strong> vermutlich 1945 geschlossen.<br />
Nr. 885<br />
Los 885 Schätzwert 25-50 €<br />
Ottensener Eisenwerk AG<br />
Altona-Ottensen, Aktie 100 RM Okt. 1929<br />
(Auflage 7085, R 3) EF<br />
Gründung 1889 als Ottensener Eisenwerk vorm. Pommée &<br />
Ahrens unter Übernahme <strong>de</strong>r seit 1880 bestehen<strong>de</strong>n Firma<br />
Pommée & Nicolay (1885 umbenannt in Pommée & Ahrens).<br />
Seit 1907 Ottensener Eisenwerk AG. Dampfkessel- und Maschinenfabrik,<br />
Bau von Heizungsanlagen, Betrieb einer Schiffswerft.<br />
Nach Produktionsen<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n 1970er Jahren Verkauf<br />
<strong>de</strong>s Firmengelän<strong>de</strong>s, auf <strong>de</strong>m sich heute <strong>de</strong>r Phoenixhof mit<br />
Lä<strong>de</strong>n, Gastronomie und Büros befin<strong>de</strong>t.<br />
Los 886 Schätzwert 200-250 €<br />
Otto Hammer<br />
AG für Holz- und Bauindustrie<br />
Chemnitz, Aktie 20 RM März 1927<br />
(Auflage 2125, R 11) VF<br />
Hübsche Umrahmung in Form eines barocken Bil<strong>de</strong>rrahmens.<br />
Zuvor gänzlich unbekannt gewesen,<br />
von <strong>de</strong>n lediglich 2 im Reichsbankschatz gefun<strong>de</strong>nen<br />
Stücken ist dies das letzte noch verfügbare.<br />
Ein paar Rostspuren von Büroklammern.<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1921 zur Weiterführung <strong>de</strong>r gleichnamigen Einzelfirma.<br />
Ausführung von Hoch- und Tiefbauten, Holzhan<strong>de</strong>l- und<br />
Bearbeitung, Han<strong>de</strong>l mit Brennstoffen je<strong>de</strong>r Art. Hauptwerk in<br />
Chemnitz (Beyerstr. 38), Zweigwerke in Dittersbach bei Neuhausen<br />
(Bez. Dres<strong>de</strong>n) und in Frie<strong>de</strong>bach bei Sayda (Erzgeb.),<br />
wo hölzerne Küchengeräte und Spielwaren hergestellt wur<strong>de</strong>n.<br />
1926 in Liquiditätsschwierigkeiten geraten, 1928 aufgelöst.<br />
Los 887 Schätzwert 75-150 €<br />
Pa<strong>de</strong>rborner Elektricitätswerk<br />
und Straßenbahn-AG<br />
Pa<strong>de</strong>rborn, Namensaktie 1.000 Mark<br />
9.1.1909. Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 1200,<br />
R 3) EF<br />
Faksimile-Unterschrift Hugo Stinnes für <strong>de</strong>n Aufsichtsrat.<br />
Gründung 1909 zur Versorgung von Stadt und Kreis Pa<strong>de</strong>rborn,<br />
Kreis Büren und Freistaat Lippe mit elektrischer Energie.<br />
41 Städte und Landgemein<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n aus <strong>de</strong>m Kraftwerk Pa<strong>de</strong>rborn<br />
versorgt, das 1927 mit <strong>de</strong>m RWE-Fernleitungsnetz zusammengeschaltet<br />
wur<strong>de</strong>. Das Straßenbahnnetz in 1.000mm-Spur<br />
glie<strong>de</strong>rte sich in das auf preußischem Gebiet liegen<strong>de</strong><br />
Pa<strong>de</strong>rborner Netz (zus. 25 km) und das im Fürstentum Lippe<br />
gelegene Detmol<strong>de</strong>r Netz (zus. 54 km). Bei<strong>de</strong> Netze hatten<br />
seit 1920 in Schlangen Verbindung. Gleich bei <strong>de</strong>r Gründung<br />
1909 wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>r Westfälische Kleinbahnen AG die 8,2 km<br />
lange Strecke Pa<strong>de</strong>rborn-Neuhaus-Sennelager übernommen<br />
(3,7 km langer Anzweig nach Elsen 1913 eröffnet), 1911 ging<br />
die 13,6 km lange Strecke Pa<strong>de</strong>rborn-Bad Lippspringe-<br />
Schlangen in Betrieb. Das Detmol<strong>de</strong>r Netz wur<strong>de</strong> 1918 übernommen<br />
von <strong>de</strong>r Lippischen Elektricitäts-AG (<strong>de</strong>ren Aktien man<br />
ohnehin zu 100 % besaß). Es bestand aus <strong>de</strong>n Strecken Detmold-Berlebeck-Johannaberg<br />
(8 km, eröffnet 1900/03), Detmold-Hei<strong>de</strong>nol<strong>de</strong>ndorf-Pivitsheite<br />
(6,8 km, eröffnet 1926/28),<br />
Schlangen-Externsteine-Horn (12,7 km, eröffnet 1923), Horn-<br />
Detmold (9 km, eröffnet 1920) und Horn-Bad Meinberg-Blomberg<br />
(eröffnet 1924/26). Damit betrieb die Gesellschaft mit über<br />
200 Mitarbeitern das grösste Überlandstrassenbahnnetz<br />
Deutschlands. Mit 2 Lokomotiven, knapp 40 Triebwagen<br />
und ca. 70 Beiwagen wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n 20er Jahren fast 5 Mio.<br />
Fahrgäste im Jahr beför<strong>de</strong>rt. Aktionäre waren 1940 das RWE<br />
(39,6 %), die Stadt Pa<strong>de</strong>rborn (35,7 %) und <strong>de</strong>r Staat Lippe mit<br />
Kommunalverbän<strong>de</strong>n (24,7 %). Dass nach <strong>de</strong>m Krieg die Verkehrszahlen<br />
mit jährlich bis zu 12 Mio. Fahrgästen (an Spit-<br />
Nr. 886 Nr. 891<br />
zentagen fast 100.000 an einem einzigen Tag!) zunächst neue<br />
Höchstwerte erklommen, hielt <strong>de</strong>n Siegeszug <strong>de</strong>s Straßenverkehrs<br />
nicht lange auf: Das Detmol<strong>de</strong>r Netz wur<strong>de</strong> schon 1954,<br />
das Pa<strong>de</strong>rborner Netz 1963 stillgelegt. Heute betreibt die 1980<br />
in PESAG umbenannte AG neben <strong>de</strong>r Energieversorgung <strong>de</strong>n<br />
öffentlichen Personenverkehr <strong>de</strong>r Stadt Pa<strong>de</strong>rborn mit 70 Omnibussen<br />
auf 32 Linien mit 847 km Streckenlänge. Die Zahl <strong>de</strong>r<br />
Fahrgäste stieg inzwischen auf 15 Mio. im Jahr. Mehrheitsaktionär<br />
wur<strong>de</strong> nach <strong>de</strong>m Krieg die PreußenElektra in Hannover<br />
(heute E.ON Energie AG). 2003 mit <strong>de</strong>n Energiewerken Wesertal<br />
und <strong>de</strong>m Elektrizitätswerk Min<strong>de</strong>n-Ravensburg zur E.ON<br />
Westfalen-Weser AG fusioniert.<br />
I<strong>de</strong>ntische Gestaltung wie folgen<strong>de</strong>s Los.<br />
Los 888 Schätzwert 150-250 €<br />
Pa<strong>de</strong>rborner Elektricitätswerk<br />
und Straßenbahn-AG<br />
Pa<strong>de</strong>rborn, Namensaktie 1.000 Mark<br />
29.3.1913 (Auflage 200, R 6) UNC<br />
Großformatiges Papier, <strong>de</strong>korativ gestaltet. Sämtliche<br />
Aktienausgaben <strong>de</strong>r PESAG waren zuvor völlig<br />
unbekannt!<br />
Los 889 Schätzwert 30-80 €<br />
Papier- und<br />
Tapetenfabrik Bammental AG<br />
Bammental (Ba<strong>de</strong>n), Aktie 100 RM Aug.<br />
1932 (Auflage 4400, R 5) EF<br />
Gründung als AG 1895, hervorgegangen aus <strong>de</strong>r 1838 durch<br />
die Gebr. Scherer in Hei<strong>de</strong>lberg gegrün<strong>de</strong>ten Papierfabrik,<br />
1862/63 Übersiedlung nach Bammental. 1934 Insolvenzantrag,<br />
Verpachtung <strong>de</strong>r Betriebe an die Gebr. Ditzel AG, Meckesheim.<br />
Nr. 890
Los 890 Schätzwert 75-125 €<br />
Papierfabrik Baienfurt<br />
Baienfurt (Wttbg.), Aktie 1.000 RM Jan.<br />
1928 (Auflage 3000, R 7) EF<br />
Gründung 1871 am Unterlauf <strong>de</strong>r Wolfegger Ach. Zwei Jahre<br />
später wur<strong>de</strong> das erste Tapeten- und Packpapier ausgeliefert.<br />
1883 wur<strong>de</strong> die Zellstoffproduktion aufgenommen. Im Jahr<br />
1926 lief in Baienfurt <strong>de</strong>r erste Karton von <strong>de</strong>r Maschine. 1968<br />
wur<strong>de</strong> die Fabrik in <strong>de</strong>n Feldmühle-Konzern integriert, 1990 übernahm<br />
<strong>de</strong>r Schwedische Stora-Konzern die Feldmühle AG.<br />
Los 891 Schätzwert 200-250 €<br />
Papierfabrik Krappitz AG<br />
Berlin, Aktie 100 RM Dez. 1924 (R 9) EF-VF<br />
Gründung 1905, Holzschleifereien, Papierfabriken und Holzverarbeitung.<br />
Die Gesellschaft war bis 1921 in Krappitz O.S., danach<br />
in Berlin-Wilmersdorf ansässig. Der größte <strong>Teil</strong> <strong>de</strong>s Kapitals<br />
war im Besitz <strong>de</strong>r zum Konzern <strong>de</strong>r Zellstoff-Fabrik Waldhof<br />
gehörigen Natronzellstoff- und Papierfabriken AG, Berlin.<br />
1953 als vermögenslose Gesellschaft gelöscht (Amtsgericht<br />
Charlottenburg).<br />
Los 892 Schätzwert 15-30 €<br />
Papierfabrik Limmritz-Steina AG<br />
Steina-Saalbach, Aktie 100 RM<br />
22.4.1927 (Auflage 2720, R 2) EF<br />
Gründung 1872 als “Holzstoff- und Holzpappenfabrik Limmritz-<br />
Steina” mit Sitz in Döbeln. 1880 Sitzverlegung nach Steina-<br />
Saalbach, 1927 Umfirmierung wie oben. 1909 Ankauf <strong>de</strong>r Papier-<br />
und Pappenfabrik Herm. Ehlert in Technitz. 200-300 Mitarbeiter<br />
hatten die drei Werke Steina-Saalbach (Wasser- und<br />
Dampfkraftanlage mit Holzschleiferei und Papierfabrik sowie<br />
einer Gastwirtschaft), Limmritz (Wasserkraftanlage mit Holzschleiferei)<br />
und Technitz (Wasser- und Dampfkraftanlage mit<br />
Papierfabrik. Börsennotiz Chemnitz und Leipzig. Nach 1945<br />
enteignet. 1963 beschloß eine a.o. HV Sitzverlegung nach<br />
Würzburg und die Auflösung <strong>de</strong>r Gesellschaft. Die Liquidation<br />
dauert bis heute an.<br />
Los 893 Schätzwert 15-30 €<br />
Papierfabriken<br />
Pötschmühle-Steyrermühl AG<br />
Wettern, Aktie 1.000 RM Sept. 1941<br />
(Auflage 6750, R 4) EF<br />
Bereits 1872 wur<strong>de</strong> in Steyrermühl die “Steyrermühl Papierfabriks-<br />
und Verlagsgesellschaft” gegrün<strong>de</strong>t. 1941 erfolgte die<br />
Fusion mit <strong>de</strong>r 1929 gegrün<strong>de</strong>ten Papierfabrik Pötschmühle<br />
AG in Wettern bei Krummau a.d. Moldau und die Gesellschaft<br />
wur<strong>de</strong> wie oben umbenannt. Die Anlagen zählten seinerzeit zu<br />
<strong>de</strong>n größten in Mitteleuropa.<br />
Los 894 Schätzwert 75-150 €<br />
Passage-Kaufhaus AG<br />
Saarbrücken, Aktie 200 RM 1.2.1936<br />
(Auflage 1000, R 7) EF-VF<br />
Lochentwertet. Zuvor ganz unbekannt gewesen!<br />
Gründung 1919 mit einem Kapital von 5 Mio. M durch <strong>de</strong>n Kölner<br />
Kaufhausmagnaten Alfred Leonhard Tietz, <strong>de</strong>r auch <strong>de</strong>m<br />
Aufsichtsrat <strong>de</strong>r Passage-Kaufhaus vorsaß. Nach <strong>de</strong>r Annektion<br />
<strong>de</strong>s Saarlan<strong>de</strong>s durch die Franzosen 1923 Kapitalumstellung<br />
von 30 Mio. M auf 3 Mio. Francs, 1935 erneut auf 1,5<br />
Mio. RM (1941 Kapitalberichtigung auf 2,75 Mio. RM). Beteiligungen<br />
an <strong>de</strong>r Neunkirchener Kaufhaus AG (67,5 %) und <strong>de</strong>r<br />
Anker-Kaufstätte GmbH in Mannheim (25 %, Rest beim Großaktionär<br />
Kaufhof). Das Stammhaus Bahnhofstraße 82-100<br />
wur<strong>de</strong> durch Kriegsweinwirkungen fast völlig zerstört und im<br />
Juni 1946 mit gera<strong>de</strong> einmal 600 m◊ Verkaufsfläche wie<strong>de</strong>reröffnet.<br />
1965 waren es dann nach mehreren Erweiterungen<br />
wie<strong>de</strong>r 12.670 m◊. Börsennotiz im Telefonverkehr Saarbrükken.<br />
Über 90 % <strong>de</strong>r Aktien besaß die Kaufhof AG, auf die die<br />
Passage-Kaufhaus AG dann 1972 verschmolzen wur<strong>de</strong>.<br />
Los 895 Schätzwert 75-150 €<br />
Paul Märksch AG<br />
Dres<strong>de</strong>n, Namensaktie 1.000 RM<br />
1.12.1928 (Auflage nur 70 Stück, R 7)<br />
EF-VF<br />
Die Wäscherei und Färberei Märksch wur<strong>de</strong> 1881 vom Färbermeister<br />
Paul Märksch gegrün<strong>de</strong>t. 1906 erwarb das Familienunternehmen<br />
ein Grundstück am Pohlandplatz (Schandauer<br />
Str. 44/46) und ließ hier ein nach mo<strong>de</strong>rnsten Gesichstpunkten<br />
ausgestattetes Produktionsgebäu<strong>de</strong> errichten (Färberei, Reinigung<br />
von Textilien bis hin zu Teppichen, Möbeln usw.) 1921/22<br />
in eine AG umgewan<strong>de</strong>lt. Beim Luftangriff am 13./14.2.1945<br />
zu 80 % zerstört, doch schon 1946 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Betrieb wie<strong>de</strong>r<br />
aufgenommen. 1961 mußte eine staatliche Beteiligung aufgenommen<br />
wer<strong>de</strong>n, 1972 zwangsverstaatlicht und als VEB<br />
Dresdner Chemischreinigung fortgeführt. 1978 <strong>de</strong>m Textilkombinat<br />
Purotex angeschlossen. 1990 wur<strong>de</strong> das Kombinat Purotex<br />
aufgelöst, <strong>de</strong>r Betrieb in <strong>de</strong>r Schandauer Straße wur<strong>de</strong><br />
nach 84 Jahren geschlossen.<br />
Los 896 Schätzwert 30-90 €<br />
Paul Wagenmann AG<br />
Mützen- und Stoffhutfabrik<br />
Stuttgart, Aktie Lit. C 10.000 Mark Mai<br />
1925 (Auflage 300, R 5) EF-VF<br />
Schöne Zierumrandung mit stilisierten Papageien.<br />
Gründung 1923. Herstellung und Vertrieb von Mützen und Hütten<br />
aus Stoff o<strong>de</strong>r Le<strong>de</strong>r. Betrieb 1938 durch Kauf im Wege <strong>de</strong>r<br />
Arisierung auf Hehner & Beck übergegangen. Vorgang <strong>de</strong>r Arisierung<br />
im Handbuch <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Aktiengesellschaften,<br />
Jahrgänge 1941, 1942 und 1943, festgehalten: eine <strong>de</strong>r fünf<br />
Gesellschaften, die dort offen als arisiert bezeichnet wer<strong>de</strong>n.<br />
Los 897 Schätzwert 25-50 €<br />
Peniger Maschinenfabrik<br />
und Unruh & Liebig AG<br />
Leipzig, Aktie 1.000 RM Febr. 1938<br />
(Auflage 500, R 4) EF<br />
Gründung 1890 in Berlin. Noch im gleichen Jahr Sitzverlegung<br />
nach Penig i.Sa. 1899 Ankauf <strong>de</strong>r Maschinen-Fabrik von Unruh<br />
& Liebig in Leipzig-Plagwitz. Herstellung von Aufzügen, Kranen,<br />
Transportanlagen, Zahnrä<strong>de</strong>rn, Präzisionsgetrieben. Am<br />
6.12.1937 umbenannt in Peniger Maschinenfabrik und Unruh<br />
& Liebig AG mit Sitz in Leipzig. 1954 VEB Schwermaschinenbau<br />
SM Kirow (TAKRAF), nach <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rvereinigung 1990<br />
entflochten, 1994 privatisiert. Heute als KIROW Leipzig AG<br />
Weltmarktführer beim Bau von Eisenbahnkränen.<br />
Los 898 Schätzwert 25-50 €<br />
Pfälzische Hypothekenbank<br />
Ludwigshafen a.Rh., Aktie 1.000 RM Mai<br />
1929 (Auflage 2000, R 3) EF<br />
Beson<strong>de</strong>rs aufwändige Gestaltung mit geflügelten<br />
Löwen, Münchener Kindl und weinumrankten<br />
Säulen.<br />
Gründung 1892. Die Gründung <strong>de</strong>r Bank bil<strong>de</strong>te <strong>de</strong>n Abschluss<br />
langjähriger Bestrebungen nach Errichtung eines Bo<strong>de</strong>nkredit-<br />
Institutes, das <strong>de</strong>n pfälzischen Verhältnissen beson<strong>de</strong>re Rechnung<br />
tragen sollte. 1990 auf Betreiben <strong>de</strong>s gemeinsamen<br />
Großaktionärs Dresdner Bank Verschmelzung mit <strong>de</strong>r 1868 in<br />
Meiningen gegrün<strong>de</strong>ten Deutschen Hypothekenbank.<br />
Los 899 Schätzwert 10-25 €<br />
Philipp Holzmann AG<br />
Frankfurt a.M., Aktie 1.000 RM 29.8.1941<br />
(Auflage 13890, R 1) UNC.<br />
Faksimile H. J. Abs als AR-Vorsitzen<strong>de</strong>r. Der erfolgreichste<br />
<strong>de</strong>utsche Bankier Abs war lange Zeit<br />
Finanzberater von Konrad A<strong>de</strong>nauer.<br />
Die AG geht auf ein 1849 von Johann Philipp Holzmann (1805-<br />
70) in Frankfurt gegrün<strong>de</strong>tes Baugeschäft mit angeglie<strong>de</strong>rter<br />
Holzschnei<strong>de</strong>rei zurück, welches 1872 zunächst KG wur<strong>de</strong>, Kapitalgeber<br />
war die Internationale Bau- und Eisenbahnbaugesellschaft.<br />
Durch Verschmelzung mit dieser Firma entstand<br />
1917 die Philipp Holzmann AG. Zunächst kleine Hochbauausführungen.<br />
Einen Namen machte sich Holzmann dann vor allem<br />
mit umfangreichen Erdarbeiten für die damals entstehen<strong>de</strong><br />
Main-Neckar-Bahn. Nach <strong>de</strong>m Krieg zum zweitgrößten<br />
<strong>de</strong>utschen Baukonzern aufgestiegen. Trotz (o<strong>de</strong>r wegen?) <strong>de</strong>s<br />
Großaktionärs Deutsche Bank, <strong>de</strong>r jahrzehntelang <strong>de</strong>n AR-Vorsitzen<strong>de</strong>n<br />
stellte, in <strong>de</strong>n 90er Jahren zum Sanierungsfall gewor<strong>de</strong>n.<br />
An <strong>de</strong>n am En<strong>de</strong> doch vergeblichen Rettungsversuchen<br />
verbrannte sich auch Bun<strong>de</strong>skanzler Schrö<strong>de</strong>r die Finger.<br />
Los 900 Schätzwert 25-50 €<br />
Pittler Werkzeugmaschinenfabrik AG<br />
Leipzig, Aktie 1.000 RM Mai 1928<br />
(Auflage 3500, R 3) EF<br />
Gründung 1889 in Leipzig-Wahren, AG seit 1895 als “Leipziger<br />
Werkzeugmaschinenfabrik vorm. W. von Pittler AG”. 1928 Erwerb<br />
<strong>de</strong>r Aktienmehrheit <strong>de</strong>r Mag<strong>de</strong>burger Werkzeugmaschinenfabrik<br />
AG. 1945 völlige Demontage <strong>de</strong>r Betriebe in Leipzig<br />
und Übergabe <strong>de</strong>r Werksanlagen durch die Amerikaner an<br />
Fremdarbeiter. Im Nov. 1945 wur<strong>de</strong> bei <strong>de</strong>r Nassovia Maschinenfabrik<br />
Hanns Fickert in Langen für Reparaturen an Pittler-<br />
Drehmaschinen <strong>de</strong>r “Nassovia-Pittler-Dienst” eingerichtet,<br />
nach<strong>de</strong>m wesentliche Know-How-Träger nach West<strong>de</strong>utschland<br />
gegangen waren. 1948 Sitzverlegung von Leipzig nach<br />
Langen und Beschluß, hier ein neues Werk zu bauen (Fertigungsbeginn<br />
1950). Ab 1982 Kooperation mit <strong>de</strong>r Gil<strong>de</strong>meister<br />
AG in Bielefeld. Jahrzehntelang war die Deutsche Bank Mehrheitsaktionär<br />
(und die Dresdner Bank hielt eine Schachtelbeteiligung),<br />
in <strong>de</strong>n 1980er Jahren ging die Aktienmehrheit dann an<br />
die Gebrü<strong>de</strong>r Rothenberger aus Frankfurt/M. Der Erwerb <strong>de</strong>r<br />
traditionsreichen Maschinenfabrik Werner & Kolb GmbH in Berlin<br />
im Jahr 1990 und 1991 noch <strong>de</strong>r Leipziger Drehmaschinen<br />
GmbH in Leipzig war <strong>de</strong>r Anfang vom En<strong>de</strong>: Weil sich die Neuerwerbungen<br />
als schlußendlich nicht sanierungsfähig erwiesen,<br />
ging Pittler 1997 selbst in Konkurs.<br />
Los 901 Schätzwert 200-250 €<br />
Plauener Spitzenfabrik AG<br />
Plauen i.V., Aktie 1.000 RM 23.3.1929<br />
(R 9) EF-VF<br />
Nur 8 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gründung am 29.11.1897. Spitzen- und Stickereifabrikation,<br />
Plauener Spitze auch heute noch bekannt und beliebt. Werke in<br />
Plauen und Pausa. 1911 Ankauf <strong>de</strong>r Stickerei Seydler & Bäkkermann<br />
in Plauen. 1931 insolvent.<br />
Los 902 Schätzwert 200-250 €<br />
Pössnecker Bankverein eGmbH,<br />
Abteilung <strong>de</strong>r Thüringischen<br />
Lan<strong>de</strong>sbank AG<br />
Pößneck, 4 % Schuldschein 3.091,55<br />
Mark 8.10.1918 (R 12) VF<br />
Großes Hochformat mit sehr hübscher Umrahmung,<br />
Originalunterschriften. Ein Unikat aus <strong>de</strong>m<br />
Reichsbankschatz.<br />
Neben <strong>de</strong>r Hauptstelle in Pößneck besaß <strong>de</strong>r Bankverein auch<br />
eine Filiale in Saalfeld (Saale). 1918 übernommen wor<strong>de</strong>n<br />
durch die 1908 gegrün<strong>de</strong>te Thüringische Lan<strong>de</strong>sbank AG (hervorgegangen<br />
aus <strong>de</strong>m Vorschuss- und Sparverein zu Weimar<br />
eGmbH), die dann in Thüringen in rascher Folge weitere genossenschaftliche<br />
Gewerbebanken und auch einige Privatbankhäuser<br />
übernahm, so daß sie am En<strong>de</strong> an 30 Orten, darunter<br />
allen größeren Städten Thüringens, vertreten war.<br />
Los 903 Schätzwert 100-150 €<br />
Polkwitz-Raudtener<br />
Kleinbahn-Gesellschaft<br />
Berlin, Aktie Lit. B 1.000 Mark 2.4.1900.<br />
Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 350, R 7) VF-F<br />
Nur 3 Stück lagen im Reichsbankschatz. Verlaufene<br />
Rostflecken.<br />
Gründung 1899, eröffnet 1900. Die 17 km lange Strecke verlief<br />
nordwestlich von Breslau. Später umbenannt in “Heerwegen-Raudtener<br />
Kleinbahn”. Nach 1945 Übernahme durch die<br />
polnische Staatsbahn PKP.<br />
Los 904 Schätzwert 150-200 €<br />
Pongs Spinnerei und Weberei AG<br />
Gladbach-Rheydt, Aktie 1.000 RM Dez.<br />
1929 (Auflage 700, R 9) EF<br />
Gründung 1889 in O<strong>de</strong>nkirchen als “Vereinigte vorm. Pongs’sche<br />
Spinnereien etc.” zwecks Übernahme und Fortführung<br />
<strong>de</strong>r Fabriketablissements <strong>de</strong>r oHG Cornelius Pongs zu O<strong>de</strong>nkir-<br />
83
chen und J. Pongs jun. zu Neuwerk bei M.Gladbach. 1900 umfirmiert<br />
in “Pongs Spinnereien und Webereien AG”. Das Werk<br />
O<strong>de</strong>nkirchen wur<strong>de</strong> 1928 stillgelegt und die Produktion in<br />
M.Gladbach-Neuwerk konzentriert, <strong>de</strong>shalb 1929 Umfirmierung<br />
in “Pongs Spinnerei und Weberei AG” und Sitzverlegung<br />
nach Gladbach-Rheydt. Börsennotiert in Berlin, die Aktienmehrheit<br />
besaß zuletzt die Deutsche Baumwoll AG (Debag) in<br />
Mülheim/Ruhr, Holdingges. <strong>de</strong>r Hammersen-Dierig-Gruppe. In<br />
<strong>de</strong>r Weltwirtschaftskrise 1931 dann Stilllegung <strong>de</strong>s Betriebes<br />
und Liquidation <strong>de</strong>r AG.<br />
Los 905 Schätzwert 15-30 €<br />
Poppe & Wirth AG<br />
Berlin, Aktie 100 RM April 1928 (Auflage<br />
2000, R 2) EF<br />
Gründung 1868 in Berlin, AG seit 1910. 1951 Sitzverlegung<br />
nach Bedburg, 1955 verlagert nach Köln. Han<strong>de</strong>l mit Wachstuch,<br />
Fußbo<strong>de</strong>n-, Tisch- und Wandbelägen, Orientteppichen<br />
und Gardinen. Geschäfte in Köln, Berlin und Stuttgart. 1982<br />
Firma erloschen, 1999 erwarb die Hometrend Inku GmbH die<br />
Firmen <strong>de</strong>r Gruppe Poppe + Wirth GmbH & Co. KG und brachte<br />
sie 2000 in Poppe + Wirth GmbH ein. 2004 wur<strong>de</strong> die Tochtergesellschaft<br />
auf die Hometrend Inku GmbH, Leinfel<strong>de</strong>n-Echterdingen<br />
verschmolzen.<br />
Los 906 Schätzwert 20-50 €<br />
Portland Cementfabrik Hemmoor<br />
Hemmoor a.d.Oste, Aktie 100 RM Mai<br />
1942 (Auflage 2000, R 3) EF<br />
Gründung als Kalkfabrik 1862, AG seit 1882. Seit 1936 auch<br />
an <strong>de</strong>r Portlandcementfabrik Germania in Hannover beteiligt.<br />
Börsennotiz Berlin, Hamburg, Hannover. 1968 Umfirmierung in<br />
Hemmoor Zement AG. 1972 Abschluß eines Beherrschungsvertrages<br />
mit <strong>de</strong>m Großaktionär Alsen-Breitenburger Zementund<br />
Kalkwerke. 1983 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Betrieb stillgelegt.<br />
Los 907 Schätzwert 75-125 €<br />
Portland Cementwerk<br />
Schwanebeck AG<br />
Berlin, Aktie 100 RM Okt. 1928 (Auflage<br />
4800, R 6) EF<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1906 unter Übernahme <strong>de</strong>r seit 1897 bestehen<strong>de</strong>n<br />
oHG Portland-Cementwerk. Großaktionär: Nord<strong>de</strong>utsche Portlandcementfabrik<br />
Misdorf, Hannover. Firmenmantel: 1949 verlagert<br />
nach Hannover, ab 1953 GmbH.<br />
Los 908 Schätzwert 50-100 €<br />
Portland-Cement- und Kalkwerke<br />
“Stadt Oppeln” AG<br />
Oppeln, Aktie 100 RM Dez. 1941 (Auflage<br />
400, R 7) EF-<br />
Gründung 1906, die neu erbaute Fabrik im oberschlesischen<br />
Oppeln ging im Nov. 1908 in Betrieb. Über die Brokau-Groschowitzer<br />
Bahn konnte <strong>de</strong>r Zement direkt in <strong>de</strong>n Oppelner O<strong>de</strong>r-Ha-<br />
84<br />
fen transportiert wer<strong>de</strong>n. 1912 Ankauf <strong>de</strong>r Graf Tschierschky-<br />
Renard’schen Kalkwerke bei Gross-Strehlitz. 1928 Erwerb <strong>de</strong>s<br />
Kalkwerks Keltsch. 1938 Umfirmierung in Portland-Cementund<br />
Kalkwerke “Stadt Oppeln” AG. Großaktionär war zuletzt die<br />
O.M.Z. Vereinigte Ost- und Mittel<strong>de</strong>utsche Zement AG. Börsennotiz:<br />
Freiverkehr Breslau. Nach 1945 Sitzverlegung nach Lautenthal<br />
(Harz), Abwickler war <strong>de</strong>r Kalkwerksbesitzer Dr. Konrad<br />
Mälzig, 1958 wur<strong>de</strong> die Ges. aufgelöst.<br />
Los 909 Schätzwert 30-90 €<br />
Portland-Cementwerk Saxonia AG<br />
vorm. Heinr. Laas Söhne<br />
Glöthe, Aktie 1.000 Mark 13.3.1899.<br />
Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 2000, R 2) EF<br />
Sehr <strong>de</strong>korativ, großes Wappen im Unterdruck.<br />
Von <strong>de</strong>r Vorgängerfirma wur<strong>de</strong> bereits seit 1864 ein Kalkwerk<br />
und eine Ziegelei betrieben, seit 1889 auch Fabrikation von<br />
Portland-Cement. AG seit 1899. In Berlin börsennotierte Familiengesellschaft.<br />
Nach 1946 VEB Zementwerk Bernburg, nach<br />
<strong>de</strong>r Privatisierung 1990 von <strong>de</strong>r Woermann Bauchemie GmbH<br />
& Co. KG, zugehörig zur Schwenk Zement KG in Ulm, erworben,<br />
2003 an Degussa weiter gegeben.<br />
Los 910 Schätzwert 20-40 €<br />
Portland-Zementwerke<br />
Dyckerhoff-Wicking AG<br />
Mainz-Amöneburg, Aktie 1.000 RM Dez.<br />
1935 (Auflage 17750, R 1) EF<br />
Große Abb. <strong>de</strong>s Firmensignets.<br />
Das Unternehmen entstand 1931 aus <strong>de</strong>r Fusion <strong>de</strong>r 1864 als<br />
oHG gegrün<strong>de</strong>ten Firma “Dyckerhoff & Söhne” mit <strong>de</strong>r 1890<br />
gegrün<strong>de</strong>ten “Wicking’sche Portland-Cement- und Wasserkalkwerke<br />
AG” in Münster. Nach <strong>de</strong>m Krieg zweitgrößter <strong>de</strong>utscher<br />
Zementproduzent. Ab 2001 übernahm <strong>de</strong>r italienische<br />
Zementkonzern Buzzi Unicem Stück für Stück von <strong>de</strong>n Familienaktionären<br />
die Aktienmehrheit.<br />
Los 911 Schätzwert 200-250 €<br />
Porzellanfabrik Fraureuth AG<br />
Fraureuth, Aktie 1.000 Mark 15.11.1921<br />
(Auflage 1000, R 10) VF<br />
Schöne Umrahmung und Unterdruck mit Perlenmuster.<br />
Nur 2 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
1866 grün<strong>de</strong>ten Georg Bruno Foedisch und Arwed Gustav von<br />
Römer in einer ehemaligen Wollkämmerei in Fraureuth die Porzellanmanufaktur<br />
Römer & Foedisch mit anfangs 60 Beschäftigten.<br />
1879, die Fabrik hatte inzwischen rd. 450 Beschäftigte,<br />
errang das Porzellan “Kobaltblau mit Gold” auf <strong>de</strong>r Internationalen<br />
Ausstellung im australischen Sidney die Goldmedaille.<br />
1888 wur<strong>de</strong> die Fabrik bei <strong>de</strong>r Deutschen Kunstgewerbeausstellung<br />
in München mit <strong>de</strong>m ersten Preis ausgezeichnet. 1891<br />
(<strong>de</strong>r Firmengrün<strong>de</strong>r Bruno Foedisch war 1888 jung verstorben)<br />
erfolgte die Überführung <strong>de</strong>s Betriebes in die Porzellanfabrik<br />
Fraureuth AG. 1917 wur<strong>de</strong> in Dres<strong>de</strong>n eine Porzellanmalerei<br />
errichtet, eine weitere Malerei in Lichte übertrug Gemäl<strong>de</strong>kopien<br />
auf Porzellanplatten. 1919 erwarb man dazu die bereits<br />
1764 gegrün<strong>de</strong>te Porzellanfabrik Wallendorf i. Th. mit ihren<br />
hervorragen<strong>de</strong>n Porzellanmalern, wohin die Abteilung für<br />
Kunst- und Luxus-Porzellan verlegt wur<strong>de</strong>. 1920 wur<strong>de</strong> ein<br />
Zweigbetrieb in Gräfenthal errichtet. Mit 1500 Beschäftigten<br />
war Fraureuth damals eine <strong>de</strong>r größten und mo<strong>de</strong>rnsten Porzellanfabriken<br />
im ganzen Deutschen Reich. Ihre Blütezeit mit<br />
einigen grandiosen Dekoren erlebte die Fabrik nach <strong>de</strong>m 1.<br />
Weltkrieg. Die Innovationsfreudigkeit, die sich in dieser Zeit<br />
auch in einer ganzen Salve von Kapitalerhöhungen ausdrückte,<br />
trug aber auch <strong>de</strong>n Kern <strong>de</strong>s Untergangs in sich: Hohe Investitionen<br />
in eine zukunftsweisen<strong>de</strong>, aber noch nicht ausgereifte<br />
neue Technologie <strong>de</strong>r Porzellanherstellung zeigten nicht <strong>de</strong>n<br />
gewünschten Erfolg. Die neuen Tunnelöfen produzierten übermäßig<br />
viel Ausschuß und zwangen die AG schließlich im Juli<br />
1926 in <strong>de</strong>n Konkurs. Der 1927 als Auffanggesellschaft gegrün<strong>de</strong>ten<br />
“Fraureuther Porzellanfabrik AG” gelang es nicht<br />
mehr, die Produktion wie<strong>de</strong>r aufzunehmen. Noch bis in die<br />
1950er Jahre warben an<strong>de</strong>re Porzellanfabriken mit Zusätzen<br />
wie “Fraureuth” o<strong>de</strong>r “Mo<strong>de</strong>ll Fraureuth”. Doch heute kennt<br />
kaum noch jemand diese einstmals hoch be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Manufaktur.<br />
Wichtige Belegstücke fin<strong>de</strong>n sich heute in privaten<br />
Sammlungen, aber auch im Porzellanmuseum <strong>de</strong>r Porzellanfabrik<br />
Lorenz Hutschenreuther. Auf <strong>de</strong>m riesigen ehemaligen<br />
Werksgelän<strong>de</strong> in Fraureuth arbeitet heute die “Spin<strong>de</strong>l- und<br />
Lagerungstechnik Fraureuth GmbH”.<br />
Los 912 Schätzwert 60-120 €<br />
Porzellanfabrik Günthersfeld AG<br />
Gehren, Aktie 1.000 Mark 4.8.1902.<br />
Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 650, R 4) EF<br />
Hervorgegangen aus <strong>de</strong>r 1884 gegrün<strong>de</strong>ten Porzellanfabrik Th.<br />
Degenring. Seit 1902 AG und Exportfirma für Gebrauchsporzellan.<br />
1929 Umstellung auf Spezial-Hartsteingut (vor allem<br />
Salbendosen). 1936 Zahlungseinstellung und Vergleichsverfahren<br />
infolge erhelblicher Verluste von ausländischen Außenstän<strong>de</strong>n<br />
und Währungsverlusten.<br />
Los 913 Schätzwert 15-30 €<br />
Porzellanfabrik Königszelt<br />
Königszelt i. Schles., 4,5 % Genussrechts -<br />
urkun<strong>de</strong> 100 RM 1.6.1926 (R 6) EF<br />
Gründung 1860 durch August Rappsilber, AG seit 1887. Die Firma<br />
beschäftigte ca. 1.000 Mitarbeiter und verfügte über 14<br />
Porzellanbrennöfen und eine Tunnelofenanlage; hergestellt wur<strong>de</strong><br />
Haushalts- und Zierporzellan. 1905 Erwerb <strong>de</strong>r Aktienmehrheit<br />
<strong>de</strong>r Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther in Selb. Börsennotiz<br />
Berlin. Vor En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 2. Weltkrieges gehörte die Aktienmehrheit<br />
<strong>de</strong>r Porzellanfabrik Königszelt <strong>de</strong>r Porzellanfabrik Kahla<br />
in Thüringen. 1945 wur<strong>de</strong> die Fabrik von Polen übernommen<br />
und die Arbeiter mußten Königszelt verlassen. Im Ge<strong>de</strong>nken an<br />
die ehemalige Zusammenarbeit und <strong>de</strong>r Entwicklung <strong>de</strong>s Dekors<br />
“Indisch Blau” wur<strong>de</strong> eine Fabrikmarke Königszelt Bayern<br />
aufgelegt. Die Porzellanfabrik in Königszelt/Schlesien gibt es<br />
heute noch. Unmittelbar hinterm Bahnhof steht heute noch die<br />
alte Fabrik. Sie heißt heute “Karolina”.<br />
Los 914 Schätzwert 60-120 €<br />
Porzellanfabrik Waldsassen<br />
Bareuther & Co. AG<br />
Waldsassen, Aktie 1.000 Mark 3.1.1921<br />
(Auflage 700, R 5) EF-VF<br />
Das Unternehmen geht auf einen 1866 errichteten Porzellanbrennofen<br />
und Ziegelringofen zurück. In die 1904 gegrün<strong>de</strong>te<br />
AG brachten Oskar Bareuther und Ernst Ploss ihre direkt am<br />
Bahnhof in Waldsassen gelegene Fabrik ein. Damals in Leipzig,<br />
nach <strong>de</strong>m Krieg dann in München börsennotiert. 1993 Fusion<br />
mit <strong>de</strong>r in Waldsassen (seit 1898) ansässigen Porzellanfabrik<br />
Gareis, Kühnl & Cie. 1994 Produktionsen<strong>de</strong>. Der Aktienmantel<br />
ist Gegenstand von Spekulationen, da die Gesellschaft noch ein<br />
Grundstück von 65.000 qm besitzt.<br />
Los 915 Schätzwert 150-250 €<br />
Preussisch-Rheinische Dampfschifffahrt<br />
Köln, Namensaktie 1.200 Mark 1.3.1922<br />
(Auflage 3458, R 7), ausgestellt auf<br />
Deichmann & Co. in Köln VF-F<br />
Originalunterschrift <strong>de</strong>s Bankiers W. Th. v. Deichmann<br />
als AR-Vorsitzen<strong>de</strong>r. Drei Rostflecken und<br />
Papier unten etwas mürbe wegen Wasserkontakt.<br />
Gründung 1826. Personen- und Güterbeför<strong>de</strong>rung auf <strong>de</strong>m<br />
Rhein und seinen Nebenflüssen. Lange Zeit <strong>de</strong>r Erz-Konkurrent<br />
<strong>de</strong>r “Dampfschifffahrts-Gesellschaft für <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>r- und Mittelrhein”,<br />
im Jahr 1967 wur<strong>de</strong>n bei<strong>de</strong> Unternehmen zur “KÖLN-<br />
DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG” fusioniert.<br />
Los 916 Schätzwert 100-200 €<br />
Preußische National<br />
Versicherungs Gesellschaft<br />
Stettin, Namens-Actie 400 Thaler<br />
1.1.1846. Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 5000, R 3)<br />
VF-<br />
Großformat. Mit Originalunterschriften, äußerst<br />
<strong>de</strong>korativ mit prächtigem Adler und vier run<strong>de</strong>n<br />
Vignetten in <strong>de</strong>n Ecken. Ausgestellt auf Herren<br />
Metzenthin & Co. in Stettin.<br />
Stettiner Kaufleute grün<strong>de</strong>ten das Unternehmen als älteste privatwirtschaftliche<br />
Versicherung Pommerns. 1919 Umfirmierung<br />
in “National” Allgemeine Versicherungs-AG. Als Tochtergesellschaften<br />
wur<strong>de</strong>n 1879 die Stettiner Rückversicherungs-<br />
AG und 1924 die “National” Lebensversicherungs-AG gegrün<strong>de</strong>t.<br />
Seit 1930 Interessengemeinschaft mit <strong>de</strong>r Colonia-Versicherung<br />
mit Überkreuzbeteiligung. Bemerkenswerterweise<br />
kam die Gesellschaft seit ihrer Gründung ohne je<strong>de</strong> Kapitalerhöhung<br />
aus und überstand auch die Inflationszeit völlig unbescha<strong>de</strong>t.<br />
Nach <strong>de</strong>m Krieg Sitzverlegung zunächst nach Lübeck,<br />
dann Verschmelzung mit <strong>de</strong>r Colonia-Versicherung.
Los 917 Schätzwert 125-250 €<br />
Prignitzer Eisenbahn-Gesellschaft<br />
Perleberg, Actie 1.000 Mark 28.11.1894<br />
(Auflage 360, R 4) EF<br />
Konzessioniert wur<strong>de</strong> die Prignitzer Eisenbahn 1884 für <strong>de</strong>n<br />
Bau und Betrieb <strong>de</strong>r 45 km langen Nebenbahn von Perleberg<br />
über Pritzwalk nach Wittstock (Dosse). 1895 wur<strong>de</strong> die Bahn<br />
von Wittstock (Dosse) aus um weitere 16,5 km bis zur preußisch-mecklenburgischen<br />
Grenze verlängert. Auf preußischer<br />
Seite schloß daran das 1,8 km lange Gleis zum Bahnhof<br />
Buschhof an, wo Anschluß an das Netz <strong>de</strong>r Mecklenburgischen<br />
Friedrich-Wilhelm-Eisenbahn bestand. 1900 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Prignitzer<br />
Eisenbahn auch die Betriebsführung <strong>de</strong>r Ostprignitzer<br />
Kreiskleinbahnen (29 km normalspurige Kleinbahnen und 70<br />
km Schmalspurbahnen in 750-mm-Spur) sowie <strong>de</strong>r Westprignitzer<br />
Kreiskleinbahnen (63 km Normalspur und 31 km<br />
Schmalspur) übertragen. 1932 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Betrieb <strong>de</strong>r Wittenberge-Perleberger<br />
Eisenbahn, <strong>de</strong>ren Eigentümer die Stadtgemein<strong>de</strong><br />
Perleberg war, mit <strong>de</strong>r Prignitzer Eisenbahn zusammengelegt.<br />
Großaktionäre waren zuletzt das Land Preußen<br />
(13,83 %), die Provinz Bran<strong>de</strong>nburg (9,6 %), die Kreise Ostund<br />
West-Prignitz (20,6 %) sowie eine Reihe nahe <strong>de</strong>r Strecke<br />
liegen<strong>de</strong>r Städte (23,5 %). Die Vorzugs-Stammaktien waren in<br />
Berlin börsennotiert. Als in dieser Beziehung absolute Ausnahmeerscheinung<br />
unter <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Klein- und Nebenbahnen<br />
war die Prignitzer Eisenbahn ungewöhnlich rentabel und völlig<br />
schul<strong>de</strong>nfrei und erzielte Betriebsgewinne von bis zu 25 % vom<br />
Umsatz, und zwar nach Steuern! Entsprechend konnten bis Anfang<br />
<strong>de</strong>r 40er Jahre kontinuierlich Divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n bis zu 7,5 % gezahlt<br />
wer<strong>de</strong>n. Im Zuge <strong>de</strong>r letzten großen Eisenbahn-Verstaatlichungswelle<br />
1941 als Ganzes ohne Abwicklung auf das Deutsche<br />
Reich (Reichseisenbahnvermögen) übergegangen.<br />
Schienenbus <strong>de</strong>r Prignitzer Eisenbahn<br />
Los 918 Schätzwert 200-250 €<br />
Prometheus-Werke AG<br />
Hannover, Aktie Serie B 10.000 Mark<br />
März 1923. Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 1000,<br />
R 9) VF<br />
Großes Hochformat, Unterdruck mit Feuerstelle im<br />
Haus, auf <strong>de</strong>n griechischen Gott <strong>de</strong>s Hausfeuers<br />
Prometheus hinweisend. Aktien dieser interessanten<br />
Ges. waren zuvor völlig unbekannt gewesen!<br />
Links Rostspur von Büroklammer.<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1923 zur Übernahme und Weiterführung <strong>de</strong>r Fabrik<br />
<strong>de</strong>r Prometheus-Werke GmbH in Hannover (Engelbosteler<br />
Damm 73). In <strong>de</strong>n zwei Hallen mit Gleisanschluss wur<strong>de</strong>n zunächst<br />
Artikel in Metall und Holz hergestellt. 1938 wur<strong>de</strong> die<br />
Auflösung <strong>de</strong>r AG beschlossen, dieser Beschluss aber 1940<br />
auf Veranlassung <strong>de</strong>r Hauptaktionäre Bo<strong>de</strong>-Panzer Geldschrankenfabriken<br />
AG bzw. Fabrikant Hermann Bo<strong>de</strong>, Hannover,<br />
wie<strong>de</strong>r aufgehoben. Die Fabrikgebäu<strong>de</strong> wur<strong>de</strong>n danach zur<br />
Nutzung für eigene Produktionszwecke an die BODE-PANZER<br />
Geldschrankfabriken AG verpachtet. 1942 umbenannt in Bo<strong>de</strong>-<br />
Grundstücksverwaltungs-AG. 1958 auf <strong>de</strong>n Hauptaktionär verschmolzen.<br />
Los 919 Schätzwert 75-150 €<br />
Provi<strong>de</strong>ntia<br />
AG für Braunkohlen-Industrie<br />
Döbern, Aktie 1.000 Mark 30.3.1922<br />
(Auflage 22000, R 7) EF<br />
Betrieb von Braunkohlengruben. 1928 als Gesellschafter <strong>de</strong>m<br />
Ostelbischen Braunkohlensyndikat beigetreten. 1933 in Konkurs.<br />
Los 920 Schätzwert 75-100 €<br />
Provinzialverband <strong>de</strong>r Provinz Sachsen<br />
Merseburg, 6/16 % Schuldv. 20.000 Mark<br />
1.8.1923 (R 10) EF-VF<br />
<strong>Teil</strong> einer Anleihe in Höhe von 1 Milliar<strong>de</strong> Mark.<br />
Nur 3 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Die Provinz Sachsen wur<strong>de</strong> nach <strong>de</strong>m Sieg über Napoleon<br />
1815 gebil<strong>de</strong>t aus <strong>de</strong>m preußischen Herzogtum Mag<strong>de</strong>burg,<br />
<strong>de</strong>r preußischen Altmark und aus Gebieten <strong>de</strong>s ehemaligen Königreichs<br />
Westfalen. Sie lag zwischen <strong>de</strong>n ehemaligen Königreichen<br />
Hannover und Sachsen und hatte bereits ungefähr<br />
<strong>de</strong>n Zuschnitt <strong>de</strong>s heutigen Bun<strong>de</strong>slan<strong>de</strong>s Sachsen-Anhalt.<br />
Provinzhauptstadt war Mag<strong>de</strong>burg. Unter allen 10 preußischen<br />
Provinzen war die Provinz Sachsen die reichste.<br />
Los 921 Schätzwert 10-20 €<br />
Provinzialverband von Hannover<br />
Hannover, Schuldv. 25 RM 10.12.1927<br />
(Ablösungsanleihe, R 5) EF<br />
Auslosungsschein anhängend. Mit hannöverschem<br />
Provinzwappen.<br />
Los 922 Schätzwert 50-100 €<br />
R. Dolberg AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 RM 9.6.1927 (Auflage<br />
900, R 5) EF<br />
1876 Familiengründung, ab 1899 AG als “R. Dolberg Maschinen-<br />
und Feldbahn-Fabrik”, Sitz bis 1924 in Hamburg, 1924<br />
Sitzverlegung nach Berlin und Umfirmierung in “R. Dolberg<br />
AG”. Herstellung von Maschinen und Fahrzeugen für Feld-,<br />
Klein- und Normalbahnen. 1936 fusionsweise Aufnahme <strong>de</strong>r<br />
Tochterges. “Leipziger & Co., Feld- und Industriebahnwerke<br />
GmbH” in Berlin. Im Aufsichtsrat saßen u.a. Oscar R. Henschel<br />
und an<strong>de</strong>re Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Direktoriums <strong>de</strong>r Henschel & Sohn<br />
GmbH (Henschel war neben <strong>de</strong>r Fa. Otto Wolff Großaktionär). In<br />
<strong>de</strong>n 1950er Jahren zur “Dolberg Glaser & Pflaum” in Dortmund<br />
vereinigt, 1960 von KRUPP übernommen wor<strong>de</strong>n und als<br />
Krupp-Dolberg fortgeführt.<br />
Los 923 Schätzwert 25-50 €<br />
R. Stock & Co. Spiralbohrer-,<br />
Werkzeug- und Maschinenfabrik AG<br />
Berlin, Aktie 100 RM Febr. 1934 (Auflage<br />
5000, R 4) EF<br />
Gründung 1907 unter Übernahme <strong>de</strong>r Abteilung Spiralbohrer-<br />
Werke R. Stock & Co. <strong>de</strong>r Deutsche Telephon Werke GmbH.<br />
Hergestellt wur<strong>de</strong>n in einem neu erbauten Werk in Berlin-Marienfel<strong>de</strong><br />
Werkzeuge für die Metallbearbeitung, insbeson<strong>de</strong>re<br />
Spezial-Werkzeuge für <strong>de</strong>n Lokomotivbau. Mit <strong>de</strong>r Übernahme<br />
<strong>de</strong>r benachbarten Hartex GmbH Maschinen- und Werkzeugfabrik<br />
erweiterte sich das Produktionsprogramm um Schleifmaschinen.<br />
1937/38 zu<strong>de</strong>m Übernahme <strong>de</strong>r Frankfurter Präzisions-Werkzeuge-Fabrik<br />
Günther & Kleinmond in Frankfurt-Rö<strong>de</strong>lheim.<br />
1938/39 Übernahme aller Aktien <strong>de</strong>r AG Vulkan in<br />
Köln-Ehrenfeld. Zweigwerke bestan<strong>de</strong>n außer<strong>de</strong>m in Stolberg<br />
(Harz) und Güntersberge (Ostharz) sowie Königsee (Thüringen).<br />
Die bei<strong>de</strong>n ersten wur<strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>m Krieg enteignet, das letztere<br />
in eine Sowjetische AG umgewan<strong>de</strong>lt. Das 1943/44 bei einem<br />
Fliegerangriff ohnehin weitgehend zerstörte Hauptwerk in<br />
Marienfel<strong>de</strong> wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>n Sowjets vollständig <strong>de</strong>montiert.<br />
1951/52 war <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>raufbau abgeschlossen, das Werk beschäftigte<br />
nun wie<strong>de</strong>r rd. 750 Mitarbeiter. Großaktionär <strong>de</strong>r in<br />
Frankfurt/Main bzw. Berlin börsennotierten AG war die Elektrische<br />
Licht- und Kraftanlagen AG (Elikraft) in Berlin, von <strong>de</strong>r<br />
1956 <strong>de</strong>r US-amerikanische Wettbewerber Union Twist Drill Co.<br />
(<strong>de</strong>r größte amerikanische Werkzeughersteller) aus Athol,<br />
Mass. 94 % <strong>de</strong>r Stock-Aktien erwarb. 1968 verkaufte UTD das<br />
Aktienpaket an die Fritz Werner Verwaltungs-GmbH, zugleich<br />
umbenannt in R. Stock AG, 1969 Verlegung <strong>de</strong>r Produktion in<br />
das Werk <strong>de</strong>r Fritz Werner Werkzeugmaschinen GmbH. 1976<br />
übernahmen die Saarbergwerke, die einen eigenen Werkzeugmaschinenbereich<br />
aufbauen wollten, 99 % <strong>de</strong>r Stock-Aktien.<br />
Dieses Abenteuer been<strong>de</strong>te Saaberg 1986 und verkaufte Stock<br />
an die Gottlieb Gühring KG in Albstadt-Ebingen. Erst 1990 wur<strong>de</strong><br />
dann auch die Börsennotiz eingestellt. Die R. Stock AG ist<br />
noch heute ein führen<strong>de</strong>r Hersteller von Bohrern, Fräs- und<br />
Reibwerkzeugen und produziert noch immer in Marienfel<strong>de</strong><br />
(Lenge<strong>de</strong>r Str. 29-35).<br />
Los 924 Schätzwert 100-125 €<br />
Ra<strong>de</strong>berger Bank AG<br />
Ra<strong>de</strong>berg, VZ-Namensaktie 100 Goldmark<br />
15.7.1924 (Blankette, R 10) EF<br />
Nur 5 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1859 als Genossenschaft, AG seit 29.6.1922. Betrieb<br />
von Bankgeschäften aller Art, namentlich für die Kreise<br />
<strong>de</strong>s Mittelstan<strong>de</strong>s. 1946 enteignet.<br />
Los 925 Schätzwert 75-120 €<br />
Radiumbad<br />
Oberschlema-Schneeberg GmbH<br />
Radiumbad Oberschlema,<br />
Namensanteilschein Lit. 1b 2 x 50 RM<br />
1.8.1926 (R 6) EF<br />
Gründung 1915, 1918 wur<strong>de</strong> das Radiumbad eröffnet, welches<br />
das be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>ste Radiumbad <strong>de</strong>r Welt war und bis zu<br />
jährlich 17.000 Kurgäste zählen konnte. Nach <strong>de</strong>r russischen<br />
Besetzung mußte 1946 <strong>de</strong>r Kurbetrieb eingestellt wer<strong>de</strong>n, da<br />
die russische AG WISMUT hier die größten Uranlagerstätten<br />
Europas ent<strong>de</strong>ckte und rigoros ausbeutete. 1952 wur<strong>de</strong> die<br />
Radiumbadgesellschaft liquidiert, das be<strong>de</strong>utete das En<strong>de</strong> für<br />
das Bad und das Kurviertel von Oberschlema. Seit 1999 gibt es<br />
in Schlema ein Besucherbergwerk.<br />
Los 926 Schätzwert 50-100 €<br />
Rauchwaren-Lagerhaus-AG<br />
Leipzig, Aktie 1.000 RM 5.6.1928<br />
(Auflage 180, R 5) EF<br />
Gründung 1926 nach Übernahme <strong>de</strong>r Firma Rauchwarenlagerhaus<br />
GmbH. Die AG führte u.a. die Rauchwarenversteigerungen<br />
für die Sowjetrepublik durch. Ab 1933 “Furtransit” Rauchwaren-Lagerhaus-AG.<br />
1942 besaß die Gesellschaft die Grundstücke<br />
Nikolaistr. 36 und Brühl 62. Am Brühl ließen sich in <strong>de</strong>r<br />
zweiten Hälfte <strong>de</strong>s 19.Jds Zahlreiche Rauchwarenhändler nie<strong>de</strong>r,<br />
die <strong>de</strong>n Ruf Leipzigs als Zentrum <strong>de</strong>s Pelzhan<strong>de</strong>ls begrün<strong>de</strong>ten.<br />
In <strong>de</strong>n 20er Jahren wur<strong>de</strong> ein Drittel aller Pelze <strong>de</strong>r<br />
Weltproduktion am Brühl verkauft. Beim Bombenangriff vom<br />
4.12.1943 wur<strong>de</strong>n große <strong>Teil</strong>e <strong>de</strong>s Brühls, vor allem die westliche<br />
Nordseite und die mittlere Südseite, komplett zerstört.<br />
1951 wur<strong>de</strong> die Gesellschaft aufgelöst.<br />
Los 927 Schätzwert 60-120 €<br />
Ravensberger Spinnerei<br />
Bielefeld, Aktie 1.200 Mark 4.5.1923<br />
(Auflage 1500, R 5) EF.<br />
Äußerst <strong>de</strong>korative Aktiengestaltung mit großer<br />
Fabrikansicht und floralen Motiven.<br />
Gründung 1855. Einst die größte Flachsspinnerei <strong>de</strong>s Kontinents<br />
mit Flachs- und Werggarnspinnereien in Bielefeld und<br />
Wolfenbüttel (1995 nie<strong>de</strong>rgebrannt) und Bleichanlage in Ummeln.<br />
1988 in Konkurs gegangen, 1994 als “Ravensberger<br />
Bau-Beteiligungen AG” reaktiviert, zugleich Sitzverlegung zunächst<br />
nach Grünwald, 1998 nach München und 1999 nach<br />
Berlin. Bis heute börsennotiert, gera<strong>de</strong> wird wie<strong>de</strong>r einmal versucht,<br />
<strong>de</strong>n Börsenmantel zu reaktivieren.<br />
Los 928 Schätzwert 25-50 €<br />
Ravia-Spoer AG<br />
Barleben bei Mag<strong>de</strong>burg, Aktie 1.000 RM<br />
Nov. 1934. Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 700, R 3)<br />
EF<br />
Gründung 1934 nach Übernahme <strong>de</strong>r Schokola<strong>de</strong>nfabrik Gebrü<strong>de</strong>r<br />
Spoer. Hergestellt wur<strong>de</strong>n Kakao, Schokola<strong>de</strong>n-, Back-,<br />
Teig- und Zuckerwaren, Kunsthonig. Die Zuckerfabrik Holland<br />
GmbH zu Köthen brachte ebenfalls ihre Schokola<strong>de</strong>nfabrik,<br />
Maschinen und Außenstän<strong>de</strong> ein, wofür sie Aktien im Wert von<br />
340.000 RM erhielt. Nach 1949: Industrie-Werke Sachsen-Anhalt<br />
Ravia-Spoer.<br />
85
Los 929 Schätzwert 50-100 €<br />
Reichelbräu AG<br />
Kulmbach, Aktie 1.000 RM 12.12.1930<br />
(Auflage 1100, R 5) EF<br />
Gründung 1895 unter Übernahme <strong>de</strong>r Export-Bierbrauerei J.<br />
W. Reichel (Lichtenfelser Str. 7 im Westen <strong>de</strong>r Stadt). 1930<br />
wur<strong>de</strong> außer<strong>de</strong>m die Kulmbacher Rizzi-Bräu AG angeglie<strong>de</strong>rt,<br />
außer<strong>de</strong>m Erwerb <strong>de</strong>r Markgrafenbräu GmbH. Börsennotiz damals<br />
Berlin, München, Breslau, Dres<strong>de</strong>n/Leipzig. Beteiligung<br />
an <strong>de</strong>r Kulmbacher Rizzibräu AG, <strong>de</strong>r Markgrafenbräu GmbH in<br />
Kulmbach und <strong>de</strong>r Biergroßhandlung Konrad Kißling in Breslau.<br />
1997 Übernahme <strong>de</strong>r Erste Kulmbacher Actienbrauerei AG (E-<br />
KU) und zugleich Umfirmierung in Kulmbacher Brauerei AG.<br />
Heute die letzte noch börsennotierte Brauerei aus <strong>de</strong>r Welthauptstadt<br />
<strong>de</strong>s Bieres.<br />
Los 930 Schätzwert 30-90 €<br />
Reichenbacher Bank AG<br />
Reichenbach i.V., Aktie Lit. A 20 RM<br />
3.11.1924 (Auflage 2000, R 4) EF<br />
Traumhafte Gestaltung im Art déco mit Abb. von<br />
Hermes sowie Stadtwappen.<br />
Gründung 1923 durch ortsansässige Textilunternehmer und<br />
Kaufleute (Hauptgeschäft in <strong>de</strong>r Bahnhofstr. 105). Die Bank<br />
stand von Anfang an in enger Verbindung zur Girozentrale<br />
Sachsen und damit zum Sparkassenlager. Bei Gründung waren<br />
die Aktien 5-fach überzeichnet. Bis zuletzt wur<strong>de</strong>n Divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n<br />
von 7 bzw. 10 % erwirtschaftet. Nach 1945 enteignet. 2006<br />
entstand die “Reichenbacher Bank” auf ungewöhnliche Weise<br />
neu: Heute ist es eine 170 m lange Bank aus Lärchenholzbohlen<br />
am Rosensee auf <strong>de</strong>r 4. Sächsischen Lan<strong>de</strong>sgartenschau<br />
in Oschatz, mit <strong>de</strong>r sich traditionsgemäß die Stadt Reichenbach<br />
i.V. als Ausrichter <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>sgartenschau 2009 präsentierte.<br />
Los 931 Schätzwert 75-100 €<br />
Reichenberg-Maffersdorfer<br />
und Gablonzer Brauereien AG<br />
Maffersdorf, Aktie 50 RM Dez. 1940<br />
(Auflage 2000, R 9) EF<br />
Nur 5 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1872, AG seit 1908. Brauereien in Maffersdorf<br />
(vorm. Reichenberger Bierbrauerei und Malzfabrik in Maffersdorf<br />
Frank & Co., Ausstoß rd. 125.000 hl) und Sei<strong>de</strong>nschwanz<br />
bei Gablonz (vorm. Gablonzer Brauerei von Medinger & Co.,<br />
Ausstoß rd. 55.000 hl).<br />
86<br />
Nr. 932<br />
Los 932 Schätzwert 30-60 €<br />
Reichmannsdorfer Goldbergbau AG<br />
Hannover, Aktie Lit. B Gr. A 1.000 Mark<br />
Juni 1923 (R 6) VF<br />
Gründung März 1923 zum Erwerb und Betrieb <strong>de</strong>s Bergwerks<br />
“Mit Gebet und Arbeit” bei Reichmannsdorf (Sachsen-Meiningen).<br />
Han<strong>de</strong>l mit bergbaulichen Produkten.<br />
Los 933 Schätzwert 15-30 €<br />
Reichswerke AG für Berg- und<br />
Hüttenbetriebe “Hermann Göring”<br />
Berlin, 4 % <strong>Teil</strong>schuldv. 1.000 RM Sept.<br />
1943 (Auflage 75000, R 3) EF<br />
Faksimilesignatur von Paul Pleiger, einem <strong>de</strong>r einflußreichsten<br />
Staatsunternehmer <strong>de</strong>s Dritten Reiches,<br />
1949 im Nürnberger Prozeß zu 15 Jahren<br />
Freiheitsstrafe verurteilt.<br />
Gründung <strong>de</strong>r “Reichswerke” 1937 im Rahmen <strong>de</strong>r Autarkie-Bestrebungen<br />
im Dritten Reich. Zweck: Planung und Errichtung von<br />
Eisenhüttenwerken zunächst in Ba<strong>de</strong>n, Franken und im Salzgittergebiet.<br />
1950 umfirmiert in AG für Berg- und Hüttenbetriebe,<br />
1953 aufgelöst, 1961 umfirmiert in Salzgitter AG. Das heutige<br />
Gesicht <strong>de</strong>r Region Salzgitter mit einer großen Zahl (heute alle<br />
stillgelegter) Eisenerzgruben und <strong>de</strong>m Stahlwerk <strong>de</strong>r heutigen<br />
Salzgitter AG ist vor allem von diesem Unternehmen geprägt.<br />
Los 934 Schätzwert 30-75 €<br />
Reiniger, Gebbert & Schall AG<br />
Erlangen, Aktie 100 RM Jan. 1928<br />
(Auflage 10000 später auf 15000 erhöht,<br />
R 3) EF<br />
Gründung 1907 in Berlin zur Fortführung <strong>de</strong>r 1886 gegrün<strong>de</strong>ten<br />
Firma Reiniger, Gebbert & Schall in Erlangen (Herstellung<br />
von Röntgenapparaten, elektro-diagnostischen, elektro-therapeutischen<br />
und elektro<strong>de</strong>ntalen Apparaten, elektr. Haarschnei<strong>de</strong>maschinen<br />
sowie elektr. Apparaten für die Viehbetäubung).<br />
1920 Sitzverlegung von Berlin nach Erlangen. Eine Vielzahl von<br />
Beteiligungen wur<strong>de</strong> 1920/21 an die Zwischenholding Inag Industrie-Unternehmungen<br />
AG abgegeben, an <strong>de</strong>r man maßgeblich<br />
beteiligt bliebt. Direkte 100-%-Beteiligungen bestan<strong>de</strong>n<br />
zunächst weiter an <strong>de</strong>r Veifa-Werke AG in Frankfurt a.M. und<br />
<strong>de</strong>r Phönix Röntgenröhrenfabriken AG in Rudolstadt. Im Jan.<br />
1925 kam es zu einer Interessengemeinschaft mit <strong>de</strong>r Siemens<br />
& Halske AG, die in diesem Zusammenhang auch die Aktienmehrheit<br />
<strong>de</strong>s in Frankfurt börsennotierten Erlanger Unternehmens<br />
erwarb. 1932 Umfirmierung in Siemens-Reiniger-<br />
Werke AG, zugleich vollständige Einglie<strong>de</strong>rung von <strong>de</strong>r Rudolstädter<br />
Phönix-Fabrik sowie Verlagerung <strong>de</strong>r gesamten medizintechnischen<br />
Produktion <strong>de</strong>r Siemens & Halske AG von Berlin<br />
nach Erlangen. 1938 Markteinführung <strong>de</strong>s Schirmbildverfahrens<br />
für Röntgenreihenuntersuchungen. 1966 fusionierten die<br />
Siemens & Halske AG, die Siemens-Schuckertwerke AG und<br />
die Siemens-Reiniger-Werke AG zur heutigen SIEMENS AG.<br />
Dort bil<strong>de</strong>t die ehemalige Reiniger, Gebbert & Schall AG heute<br />
<strong>de</strong>n Kern <strong>de</strong>s Bereichs Medizintechnik.<br />
Los 935 Schätzwert 100-150 €<br />
Remag AG<br />
Ludwigshafen a. Rh., Aktie 1.000 RM Nov.<br />
1935 (Auflage 500, R 8) EF<br />
Bereits 1833 wur<strong>de</strong> die Fa. Wolf-Netter gegrün<strong>de</strong>t, die sich im<br />
Han<strong>de</strong>l mit Bergwerksprodukten, Metallen, Metallwaren, Eisen,<br />
Stahl, Eisen- und Stahlwaren, Chemikalien, sanitären und verwandten<br />
Produkten betätigte. Anläßlich <strong>de</strong>r “Arisierung” <strong>de</strong>r<br />
Firma 1933 Gründung <strong>de</strong>r Remag AG vorm. Wolf Netter, 1935<br />
umbenannt in Remag AG. 1948/49 Vergrößerung <strong>de</strong>s Lagers<br />
in <strong>de</strong>r Mannheimer Rhenaniastraße, 1951 Einrichtung eines<br />
Grobeisenlagers mit eigenem Gleisanschluß bei <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlassung<br />
München. Heute hat die REMAG ihren Sitz in Mannheim,<br />
abgeboten wer<strong>de</strong>n Stähle, Bleche, Rohre und Profile in <strong>de</strong>n<br />
Nie<strong>de</strong>rlassungen Mannheim, Bayern, Soest sowie bei <strong>de</strong>r Tochter<br />
Hagmeyer in Geislingen und Göppingen.<br />
Los 936 Schätzwert 25-50 €<br />
Reußengrube AG<br />
Kretzschwitz bei Gera, Aktie 100 RM<br />
22.8.1924 (Auflage 4100, R 3) EF<br />
Gründung 1890 unter <strong>de</strong>r Firma Reussengrube AG, Erdfarbenund<br />
Verblendsteinfabrik, 1920 umbenannt in Reussengrube<br />
AG. Hergestellt wur<strong>de</strong>n Dachziegeln und feine Tonwaren, seit<br />
1916 ausschließlich Dachsteine.<br />
Los 937 Schätzwert 25-50 €<br />
Reußische Elektrizitäts-Gesellschaft AG<br />
Gera (Reuß), Aktie 1.000 Mark 11.4.1923.<br />
Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 10000, R 3) EF<br />
Gründung 1923. Zweck: Ausnutzung <strong>de</strong>r Licht- und Krafttechnik,<br />
insbeson<strong>de</strong>re Einrichtung, Betrieb und Verwertung elektrischer<br />
Anlagen. Im Okt. 1925 wur<strong>de</strong> das Konkursverfahren eröffnet,<br />
die Aktionäre gingen leer aus.<br />
Los 938 Schätzwert 30-60 €<br />
Rhein-Mainische Handwerksbau-AG<br />
Frankfurt a.M., Namensaktie 200 RM<br />
5.6.1937 (Auflage 1500, R 4) EF<br />
Gründung im Juni 1936 als Rhein-Mainische Handwerksbau<br />
AG, ab 1941: Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft <strong>de</strong>s Hessischen<br />
Handwerks AG. Grundbesitz 1943: 284 Wohnungen in<br />
Wiesba<strong>de</strong>n, Darmstadt, Rothenbergen, Marburg und Nie<strong>de</strong>rlahnstein,<br />
weitere 168 waren 1943 im Bau, weitere 398 in Vorbereitung.<br />
Heute besitzt die GWH Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft<br />
mbH Hessen, eine Tochter <strong>de</strong>r Helaba, ca. 36.500<br />
Wohnungen.<br />
Los 939 Schätzwert 75-150 €<br />
Rhein-Sieg Eisenbahn-AG<br />
Beuel a. Rhein, Aktie 1.200 Mark<br />
22.11.1922 (Auflage 1290, R 5) EF-VF<br />
Gründung 1869 als Brölthaler Eisenbahn AG, 1921 umbenannt<br />
wie oben (wohl hauptsächlich um eine weitere Verwechslung<br />
mit <strong>de</strong>r Brohlthal-Eisenbahn zu vermei<strong>de</strong>n). Hauptsächlich zum<br />
Abtransport von Steinen aus <strong>de</strong>n Steinbrüchen <strong>de</strong>s Westerwal<strong>de</strong>s<br />
hinunter zum Rhein (mit einem gewissen zusätzlichen Güter-<br />
und Personenverkehr) wur<strong>de</strong>n mit einer Gesamtlänge von<br />
88 km folgen<strong>de</strong> 785-mm-Schmalspurstrecken gebaut und betrieben:<br />
Hennef-Ruppichteroth (1862-1954), Ruppichteroth-<br />
Waldbröl (1870-1953), Hennef-Beuel (1891-1967), Hennef-<br />
Asbach (1892-1959/67), Nie<strong>de</strong>rplei-Rostingen (1901-<br />
1952/67) und Nie<strong>de</strong>rpleis-Siegburg (1899-1955). Hinzu kam<br />
die 1903 übernommene und bis 1950 betriebene Heisterbacher<br />
TalbahnNie<strong>de</strong>rdollendorf-Grengelsbitze. Das letzte Strekkenstück<br />
wur<strong>de</strong> 1967 stillgelegt. Die letzte erhaltene Dampflok<br />
<strong>de</strong>s “Bähnchens” steht heute im Asbacher Museum.<br />
Los 940 Schätzwert 25-50 €<br />
Rheinborn AG<br />
(Rheinisch-Bornesischer- Han<strong>de</strong>lsverein)<br />
Barmen, VZ-Aktie 100 RM 1.7.1929<br />
(Auflage 2704, R 4) EF<br />
Gründung 1882 als Rheinisch-Bornesischer Han<strong>de</strong>ls-Verein<br />
AG. Unter <strong>de</strong>n Grün<strong>de</strong>rn war u.a. Theodor Keetman (1836-<br />
1907), Grün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Duisburger Maschinenbau-AG, <strong>de</strong>r späteren<br />
Mannesmann-DEMAG. 1925 Umbenennung wie oben.<br />
1937 Sitzverlegung nach Köln. Die Ges. betrieb Außenhan<strong>de</strong>l<br />
mit <strong>de</strong>n Gebieten Nie<strong>de</strong>rländisch-Ostindiens und besaß eigene<br />
Filialen auf Sumatra, Nias und Borneo. 1940 wur<strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>r<br />
Kriegserklärung Deutschlands an die Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong> die Nie<strong>de</strong>rlassungen<br />
in Nie<strong>de</strong>rländisch-Ostindien beschlagnahmt. Der<br />
Betrieb ruhte danach, und 1955 wur<strong>de</strong> die Ges. aufgelöst.<br />
Los 941 Schätzwert 200-250 €<br />
Rheinisch-Hessische<br />
Treibriemen-Fabrik AG<br />
Kassel, VZ-Aktie 100 RM 3.1.1925<br />
(Auflage 750, R 12) VF+<br />
Ein Unikat aus <strong>de</strong>m Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1921. Fabrikation von Le<strong>de</strong>r und Le<strong>de</strong>rwaren mit<br />
Werken in Kassel und Gassen N.-L. Bereits 1926 wie<strong>de</strong>r in Liquidation<br />
getreten.<br />
Los 942 Schätzwert 75-150 €<br />
Rheinisch-Westfälische<br />
Bo<strong>de</strong>n-Credit-Bank<br />
Köln, Actie Ser. B 1.000 Mark 1.12.1895<br />
(Auflage 4000, R 2) VF<br />
Traumhafte Gestaltung mit Abb. <strong>de</strong>r Germania,<br />
welche zwei Wappenschil<strong>de</strong> in ihren Hän<strong>de</strong>n hält.<br />
Gründung 1894 durch Banken und Industrielle unter Führung<br />
<strong>de</strong>s A. Schaaffhausen’schen Bankvereins. Stammsitz war in<br />
Köln, Unter Sachsenhausen 2. Zweck war zunächst die För<strong>de</strong>-
ung <strong>de</strong>s Bo<strong>de</strong>nkredits in Rheinland und Westfalen, nach <strong>de</strong>r<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rtwen<strong>de</strong> <strong>de</strong>hnte die Bank ihre Geschäftstätigkeit<br />
auch auf die übrigen preußischen und <strong>de</strong>utschen Gebiete aus<br />
und errichtete in Berlin (Französische Str. 53/55) eine Zweignie<strong>de</strong>rlassung.<br />
Beliehen wur<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>r Bank ländliche Grundstücke<br />
mit 2/3, städtische Grundstücke mit 1/2 bis 6/10 (man<br />
beachte die Geringschätzung städtischer Immobilien!) sowie<br />
Weinberge und Wäl<strong>de</strong>r mit 1/3 <strong>de</strong>s ermittelten Wertes. Börsennotiz<br />
Berlin und Köln. Maßgeblichen Einfluß hatte (zunächst<br />
indirekt über die Colonia-Versicherungen und die Kölnische<br />
Rück) jahrzehntelang das Kölner Bankhaus Sal. Oppenheim jr.<br />
& Cie. AR-Vorsitzen<strong>de</strong>r wur<strong>de</strong> nach <strong>de</strong>m Krieg Dr. h.c. Robert<br />
Pferdmenges, bekannt als <strong>de</strong>r “Bankier A<strong>de</strong>nauers”. Der Klüngel<br />
funktionierte: A<strong>de</strong>nauers Sohn Max, Oberstadtdirektor a.D.,<br />
fand in <strong>de</strong>n 60er Jahren dann als Rheinbo<strong>de</strong>n-Vorstand ein<br />
Auskommen. 1989 Umfirmierung in Rheinbo<strong>de</strong>n Hypothekenbank<br />
AG. 1999/2000 ging die Aktienmehrheit auf die Allgemeine<br />
Hypothekenbank AG in Frankfurt/Main und damit indirekt<br />
an das BHW. Die bei<strong>de</strong>n Banken wur<strong>de</strong>n zur AHBR fusioniert,<br />
und die machte <strong>de</strong>r Gewerkschaftsholding seit<strong>de</strong>m nur<br />
Kopfschmerzen: Wegen fehlgeschlagener Zinsspekulationen<br />
entstan<strong>de</strong>n Milliar<strong>de</strong>nverluste, und 2005 beim Verkauf an <strong>de</strong>n<br />
texanischen Finanzhai “Lone Star” mussten die Gewerkschaften<br />
sogar noch ein paar hun<strong>de</strong>rt Millionen Euro Mitgift extra<br />
lockermachen. Seit 2007 als Coralcredit Bank AG für gewerbliche<br />
Immobilienfinanzierung im Kernmarkt Deutschland tätig.<br />
Los 943 Schätzwert 30-80 €<br />
Rheinisch-Westfälische Kalkwerke<br />
Dornap, Aktie 1.000 Mark Febr. 1920<br />
(Auflage 4500, R 2) EF<br />
Großformatig, mit wun<strong>de</strong>rschöner Umrahmung im<br />
Historismus-Stil.<br />
Gründung 1887 als “Dornap-Angerthaler AG für Kalkstein- und<br />
Kalkindustrie”, 1888 umbenannt wie oben. Ausbeutung von<br />
Kalkstein- und Dolomitfel<strong>de</strong>rn im ganzen nie<strong>de</strong>rrheinisch-westfälischen<br />
Industriegebiet. Die Steinbrüche in Dornap, Hochdahl,<br />
Nean<strong>de</strong>rthal, Gruiten, Elberfeld, Wülfrath, Barmen-Rittershausen,<br />
Hofermühle, Ober-Hagen, Letmathe und Hönnethal waren<br />
durch fast 30 km lange normal- und schmalspurige Werkseisenbahnen<br />
verbun<strong>de</strong>n. Beliefert wur<strong>de</strong>n vor allem die nie<strong>de</strong>rrheinisch-westfälischen<br />
Eisen- und Stahlwerke mit Hüttenkalk,<br />
folgerichtig wur<strong>de</strong> die RWK in <strong>de</strong>n 30er Jahren <strong>Teil</strong> <strong>de</strong>r Vereinigten<br />
Stahlwerke. Nach Beschlagnahme durch die Alliierten<br />
wur<strong>de</strong> das Betriebsvermögen bei Entflechtung <strong>de</strong>r Vereinigte<br />
Stahlwerke 1953 auf eine neu gegrün<strong>de</strong>te AG gleichen Namens<br />
übertragen. Maßgebliche Aktionäre waren dann lange<br />
Zeit die Stahlwerke an <strong>de</strong>r Ruhr als Hauptabnehmer (zuletzt die<br />
Hoesch-Werke AG mit über 75 %), heute gehört die 1999 in<br />
RWK Kalk AG umbenannte Ges. zum britischen Baustoffkonzern<br />
Readymix.<br />
Los 944 Schätzwert 150-250 €<br />
Rheinische Chamotte- & Dinas-Werke<br />
Eschweiler, Aktie 1.000 Mark 1.11.1895.<br />
Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 2200, R 6) EF-VF<br />
Originalunterschriften.<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1869 in Ottweiler. 1895 Fusion <strong>de</strong>r einzelnen Werke:<br />
Ottweiler Chamotte- und Thonwarenfabriken vorm. Louis<br />
Jochum u. Bendorfer AG für feuerfeste Produkte vorm. Th. Neizert<br />
& Co. (gegr. 1842 als erste Fabrik Europas, die feuerfeste<br />
Steine herstellte) sowie durch Übernahme sämtlicher Anteile<br />
<strong>de</strong>r Firma Lütgen-Borgmann, GmbH in Berlin und Eschweiler,<br />
ferner beteiligt bei Westerwäl<strong>de</strong>r Chamottewerke, GmbH in Siebershahn.<br />
Betriebsabteilungen in Bendorf, Mehlem, Ottweiler<br />
und Filiale in Berlin. 1968 wird Rhein-Dinas vom Wiesba<strong>de</strong>ner<br />
Didier-Konzern übernommen. 1995 wird das Werk Bendorf <strong>de</strong>r<br />
Didier-Werke trotz schwarzer Zahlen zwecks Kapazitätsbereinigung<br />
geschlossen.<br />
Los 945 Schätzwert 30-90 €<br />
Rheinische Elektrizitäts-AG<br />
Mannheim, Aktie 1.000 Mark 29.12.1919<br />
(Auflage 5000, R 2) EF<br />
Großformatig, sehr <strong>de</strong>korativ mit schöner breiten<br />
Umrahmung im Historismus-Stil.<br />
Gründung 1897 als Rheinische Schuckert-Gesellschaft für elektrische<br />
Industrie AG durch die Elektrizitäts-AG vorm. Schukkert<br />
& Co. in Nürnberg. Schnell übernahm die Gesellschaft eine<br />
führen<strong>de</strong> Rolle in <strong>de</strong>r Stromversorgung Südwest<strong>de</strong>utschlands<br />
und <strong>de</strong>s Rheinlan<strong>de</strong>s. 1917 Umfirmierung in “Rheinische<br />
Elektrizitäts-AG”. In Berlin, Frankfurt und Mannheim börsennotiert.<br />
1940 wur<strong>de</strong> das jahrzehntelang wichtigste Aktivum erworben:<br />
die Schnellpressenfabrik AG Hei<strong>de</strong>lberg (heute Hei<strong>de</strong>lberger<br />
Druckmaschinen). Später wur<strong>de</strong> die Rheinelektra eine<br />
wichtige Zwischenholding im RWE-Konzern. 1997 mit <strong>de</strong>r in<br />
gleicher Funktion tätigen Lahmeyer AG, Frankfurt/M. verschmolzen.<br />
Los 946 Schätzwert 20-50 €<br />
Rheinische Hypothekenbank<br />
Mannheim, Aktie 100 RM Juni 1928 (R 1) EF<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1871 durch die Rheinische Creditbank in Mannheim<br />
(welche später in <strong>de</strong>r Deutschen Bank aufging). Nach <strong>de</strong>r<br />
1886 erfolgten Gründung <strong>de</strong>r Pfälzischen Hypothekenbank in<br />
Ludwigshafen lange Zeit weitgehen<strong>de</strong> Personalunion in <strong>de</strong>n<br />
Verwaltungsorganen. 1935 Verschmelzung mit <strong>de</strong>r bis 1866<br />
zurückreichen<strong>de</strong>n Berliner Hypothekenbank. 1974 Verschmelzung<br />
mit <strong>de</strong>r West<strong>de</strong>utschen Bo<strong>de</strong>nkreditanstalt, Köln und Sitzverlegung<br />
nach Frankfurt/Main (Großaktionär ist inzwischen die<br />
Commerzbank). 2002 bei <strong>de</strong>r Verschmelzung <strong>de</strong>r Hypothekenbank-Töchter<br />
<strong>de</strong>r Deutschen, Dresdner und Commerzbank in<br />
<strong>de</strong>r EUROHYPO aufgegangen.<br />
Los 947 Schätzwert 20-50 €<br />
Rheinische Metallwaaren-<br />
und Maschinenfabrik<br />
Düsseldorf, Aktie 100 RM Dez. 1928<br />
(Auflage 7767, R 2) EF<br />
Firmenlogo im Unterdruck. Schrift teilweise im Art<br />
Deko gestaltet. Gedruckt von <strong>de</strong>r Graph. Anstalt<br />
<strong>de</strong>r Fried. Krupp AG.<br />
Gründung 1889 unter Übernahme <strong>de</strong>r Rather Metallwerke<br />
vorm. Ehrhardt & Heise und eines Schießplatzes bei Unterlüß.<br />
Anfangs Herstellung kleinkalibriger Geschosse. Nach <strong>de</strong>r Jahrhun<strong>de</strong>rtwen<strong>de</strong><br />
in rascher Folge Übernahme benachbarter Munitions-<br />
und Maschinenfabriken. Im thüringischen Sömmerda<br />
wur<strong>de</strong> außer<strong>de</strong>m ein Werk für Schreib- und Rechenmaschinen<br />
betrieben. Nach En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 1. Weltkriegs Aufnahme <strong>de</strong>s Lokomotiv-<br />
und Waggonbaus (1925 stillgelegt, statt<strong>de</strong>ssen Geschütz-<br />
und Munitionsfabrikation für Reichswehr und Reichsmarine,<br />
Großaktionäre waren zu dieser Zeit Fried. Krupp und<br />
die VIAG). 1935 Verschmelzung mit <strong>de</strong>r A. Borsig Maschinenbau-AG<br />
in Berlin-Tegel und Umfirmierung in Rheinmetall-Borsig<br />
AG. Im 3. Reich in die Reichswerke “Hermann Göring” eingebun<strong>de</strong>n.<br />
Nach <strong>de</strong>m Krieg verkaufte die bun<strong>de</strong>seigene Bank<br />
<strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Luftfahrt AG i.L. ihre Mehrheitsbeteiligung an die<br />
Röchling’sche Eisen- und Stahlwerke GmbH, Völklingen.<br />
Gleichzeitig wur<strong>de</strong> die Borsig AG an die AG für Bergbau- und<br />
Hüttenbetriebe, Salzgitter veräußert (später dann an Babcock<br />
gegangen). Die noch heute börsennotierte Rheinmetall ist tätig<br />
in <strong>de</strong>n Sparten Maschinenbau, Wehrtechnik und Automobilzulieferer<br />
(Vergaser von Pierburg).<br />
Los 948 Schätzwert 25-50 €<br />
Rheinische Möbelstoff-Weberei<br />
vorm. Dahl & Hunsche AG<br />
Wuppertal-Barmen, Aktie 1.000 RM Sept.<br />
1938 (Auflage 450, R 5) EF<br />
Gründung 1898 unter Übernahme <strong>de</strong>r Firma Dahl & Hunsche.<br />
Herstellung von Moketts, Decken, Frises, Gobelins, Patentstoffen,<br />
Teppich-Velours in Werken in Barmen und Burscheid. Fast<br />
100 % Beteiligung an <strong>de</strong>r Teppichmanufaktur A.-Beuel. Börsennotiz<br />
Hamburg und Bremen, Freiverkehr Berlin und Düsseldorf.<br />
Los 949 Schätzwert 125-250 €<br />
Rheinische Schuckert-Gesellschaft<br />
für elektrische Industrie AG<br />
Mannheim, Namensaktie Ser. B 1.000<br />
Mark 1.5.1900 (Auflage 1000, R 5),<br />
ausgestellt auf W. H. La<strong>de</strong>nburg & Söhne,<br />
Mannheim VF+<br />
Swastika (damals noch als Glückssymbole angesehen)<br />
im Unterdruck.<br />
Gründung 1897 als Rheinische Schuckert-Gesellschaft für elektrische<br />
Industrie AG durch die Elektrizitäts-AG vorm. Schukkert<br />
& Co. in Nürnberg. Schnell übernahm die Gesellschaft eine<br />
führen<strong>de</strong> Rolle in <strong>de</strong>r Stromversorgung Südwest<strong>de</strong>utschlands<br />
und <strong>de</strong>s Rheinlan<strong>de</strong>s. 1917 Umfirmierung in “Rheinische<br />
Elektrizitäts-AG”. In Berlin, Frankfurt und Mannheim börsennotiert.<br />
1940 wur<strong>de</strong> das jahrzehntelang wichtigste Aktivum erworben:<br />
die Schnellpressenfabrik AG Hei<strong>de</strong>lberg (heute Hei<strong>de</strong>lberger<br />
Druckmaschinen). Später wur<strong>de</strong> die Rheinelektra eine<br />
wichtige Zwischenholding im RWE-Konzern. 1997 mit <strong>de</strong>r in<br />
gleicher Funktion tätigen Lahmeyer AG, Frankfurt/M. verschmolzen.<br />
Los 950 Schätzwert 20-40 €<br />
Rheinische Spiegelglasfabrik<br />
Eckamp bei Ratingen, Aktie 1.000 Mark<br />
24.10.1922 (Auflage 16000, R 1) EF-<br />
Feine Zierumrandung. Vielen Sammlern bereits als<br />
Blankette bekannt.<br />
Gründung 1889. Herstellung von Spiegel- und Fensterglas.<br />
Nach 1945 als “Glasfabrik Eckamp-Altwasser AG” firmierend.<br />
Börsennotiz Berlin und Düsseldorf.<br />
Los 951 Schätzwert 30-60 €<br />
Rheinische Stahlwerke<br />
Duisburg-Mei<strong>de</strong>rich, Aktie 1.000 Mark<br />
Febr. 1910 (Auflage 5000, R 2) EF<br />
Gründung 1870 durch <strong>de</strong>utsche, belgische und französische<br />
Aktionäre mit 1 Mio. F Kapital als “S.A. <strong>de</strong>s Aciéries Rhénanes<br />
à Mei<strong>de</strong>rich” mit juristischem Sitz in Paris. In Mei<strong>de</strong>rich wur<strong>de</strong><br />
eine Bessemer-Stahlgießerei und eine Fabrik für feuerfestes<br />
Material errichtet. 1872 Sitzverlegung nach Mei<strong>de</strong>rich, 1878<br />
Sanierung und komplette Neuausgabe <strong>de</strong>r Aktien. 1881 Inbetriebnahme<br />
eines neuen Schienenwalzwerkes und Ankauf <strong>de</strong>r<br />
Eisenerzgrube Lacheberg in Nassau. 1882 gemeinsam mit <strong>de</strong>r<br />
Saarbrücker Firma Gebr. Röchling Ankauf umfangreicher Minette-Konzessionen<br />
in Lothringen. 1886 Beteiligung an Stahlwerken<br />
in Südrussland, endlich 1889 Errichtung <strong>de</strong>s ersten eigenen<br />
Hochofens. 1900 mit Übernahme <strong>de</strong>r “Gewerkschaft Centrum”<br />
Schaffung einer eigenen Kohlebasis, später Erwerb weiterer<br />
großer Bergwerke. 1904 Übernahme <strong>de</strong>r “Duisburger Eisen-<br />
und Stahlwerke”, 1922 Verschmelzung mit <strong>de</strong>r traditionsreichen,<br />
bereits 1856 gegrün<strong>de</strong>ten Arenberg’schen AG für<br />
Bergbau und Hüttenbetrieb. 1926 wur<strong>de</strong>n die Hütten- und<br />
Stahlwerke und die Erzgruben in die Vereinigte Stahlwerke AG<br />
eingebracht, nicht aber die Kohlenbergwerke, die erst 1952 im<br />
Zuge <strong>de</strong>r alliierten Entflechtungsmaßnahmen in die Arenberg<br />
Bergbau-GmbH ausgeglie<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong>n. Bis zur kürzlichen Einglie<strong>de</strong>rung<br />
in die Thyssen AG firmierte die alte, bis dahin immer<br />
noch börsennotierte Rheinstahl zuletzt als Thyssen Industrie AG.<br />
Los 952 Schätzwert 125-250 €<br />
Rheinische Wasserwerks-Gesellschaft<br />
Bonn, Actie 600 Mark 30.4.1879.<br />
Grün<strong>de</strong>remission im Umtausch <strong>de</strong>r zuvor<br />
umlaufen<strong>de</strong>n Interimsscheine (Auflage<br />
3750, R 5) VF+<br />
Gründung 1872 in Bonn auf Initiative von König Wilhelm von<br />
Preußen als “Rheinische Wasserwerksgesellschaft”. Bis zur<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rtwen<strong>de</strong> beschäftigte man sich mit Planung, Bau<br />
und Betrieb von Wasserwerken, später auch von Gaswerken.<br />
1902 Sitzverlegung nach Köln-Deutz. Danach erfolgte schwerpunktmäßig<br />
<strong>de</strong>r Ausbau <strong>de</strong>r Gas- und Wasserversorgung <strong>de</strong>s<br />
rechtsrheinischen Kölner Raumes. 1929/30 übernahm die<br />
Thüringer Gas AG in Leipzig die Aktienmehrheit, bei <strong>de</strong>r Gelegenheit<br />
auch Umfirmierung in “Rheinische Ernergie AG”. 1957<br />
gab die ThüGa die Aktienmehrheit an das RWE ab, behielt aber<br />
noch bis 2001 eine Beteiligung von 40 %. 2002 ging als Kartellauflage<br />
das Versorgungsgeschäft im Kölner Raum an das<br />
RWE, die rhenag versorgt jetzt rd. 100.000 Einwohner entlang<br />
<strong>de</strong>r Sieg im Bergischen Land und im Westerwald. Nach Abfindung<br />
<strong>de</strong>r Kleinaktionäre hält heute das RWE 2/3 und die Rhein-<br />
Energie AG in Köln 1/3 <strong>de</strong>r Anteile.<br />
Los 953 Schätzwert 25-50 €<br />
Rheinische Zellwolle AG<br />
Siegburg, Namensaktie 1.000 RM Juli<br />
1939 (Auflage 3000, R 4) EF<br />
Gründung 1936 im Rahmen <strong>de</strong>r Autarkiebestrebungen im Dritten<br />
Reich zur Erzeugung von Zellwolle und sonstigen synthetischen<br />
Textilrohstoffen. 1938 Sitzverlegung nach Siegburg. Umbenannt<br />
1950 in Chemie-Faser AG und 1955 in Phrix-Werke<br />
AG. En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r 60er Jahre (Hauptaktionär war neben <strong>de</strong>r BASF<br />
auch Dow Chemical) brach die Firma zusammen.<br />
Min<strong>de</strong>stgebot: 80 %<br />
vom unteren Schätzwert<br />
87
Los 954 Schätzwert 20-50 €<br />
Rhenser Mineralbrunnen<br />
Fritz Meyer & Co. AG<br />
Rhens a.Rh., Aktie 100 RM 12.6.1928<br />
(Auflage 5625, R 2) EF<br />
Gründung 1883 als oHG, 1922 Umwandlung in die “Rhenser<br />
Mineralbrunnen Fritz Meyer & Co. AG”. Schon damals einer <strong>de</strong>r<br />
be<strong>de</strong>utendsten <strong>de</strong>utschen Mineralbrunnen. 1918-25 kamen<br />
die noch heute bestehen<strong>de</strong>n Zweigbetriebe Grauhof bei Goslar<br />
(Harzer Grauhof-Brunnen), Aumühle (Fürst Bismarck Mineralbrunnen)<br />
und Selters a.d.Lahn dazu. Weiter übernommen wur<strong>de</strong>n<br />
1936 die Neue Selterser Mineralquelle AG in Stockhausen<br />
(Lahn) und 1991 die Rietenauer Mineralquellen. 2001 Verlegung<br />
<strong>de</strong>s Verwaltungssitzes nach Mainz. Im Laufe <strong>de</strong>r Jahrzehnte<br />
übernahm <strong>de</strong>r Schweizer Nestlé-Konzern die Mehrheit<br />
an <strong>de</strong>r in Frankfurt börsennotierten AG und schluckte sie<br />
schließlich 2002 durch “Squeeze-Out” vollständig.<br />
Los 955 Schätzwert 300-400 €<br />
Rhume-Mühle<br />
Northeim, Namensaktie 1.000 Mark<br />
1.4.1889 (Auflage 728, R 9) VF-F<br />
Aktien dieser interessanten Mühle waren zuvor<br />
völlig unbekannt. Papiermürbigkeiten durch Wassereinfluß<br />
an <strong>de</strong>n Rän<strong>de</strong>rn fachgerecht restauriert.<br />
Die Geschichte <strong>de</strong>r Mühle beginnt bereits um das Jahr 1000,<br />
als das Kloster St. Blasien gegrün<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong> und sie in <strong>de</strong>ssen<br />
Besitz kam. 1322, inzwischen die Bannmühle <strong>de</strong>r Grafen von<br />
Northeim und <strong>de</strong>s Stifts St. Blasii, wur<strong>de</strong> für die Mühle die<br />
durch Northeim fließen<strong>de</strong> Rhume im Rhumekanal kanalisiert.<br />
1863 verkaufte die Königl. Klosterkammer zu Hannover die<br />
Mühle an eine neu gegrün<strong>de</strong>te Aktiengesellschaft. 1864 vollständiger<br />
Neubau <strong>de</strong>r Mühle durch die AG als stattliche vierstöckige<br />
Industriemühle, 1878 Errichtung <strong>de</strong>s Speichergebäu<strong>de</strong>s,<br />
danach mehrfach renoviert und mo<strong>de</strong>rnisiert. Zum Antrieb<br />
<strong>de</strong>r Mahlgänge wur<strong>de</strong>n die Wasserrä<strong>de</strong>r abgeworfen und statt<br />
<strong>de</strong>ssen sechs Turbinen eingebaut. Auf <strong>de</strong>m riesigen Mühlenareal<br />
wur<strong>de</strong> 1932 das Gustav-Wegner-Stadion von Eintracht<br />
Northeim errichtet. 1957 wegen Rückgang <strong>de</strong>r Graupen- und<br />
Grützemüllerei Umstellung dieses Betriebszweiges auf Futtermittelherstellung<br />
(die gemeinsam mit weiteren Gesellschaftern<br />
dafür gegrün<strong>de</strong>te GmbH stellte <strong>de</strong>n Betrieb aber bereits 1961<br />
wie<strong>de</strong>r ein). In <strong>de</strong>n 1950er Jahren wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>m Bau eines<br />
neuen Wasserkraftwerkes begonnen, das die Hälfte <strong>de</strong>s produzierten<br />
Stroms in das öffentliche Netz einspeiste. Großaktionär<br />
<strong>de</strong>r im Freiverkehr Hannover börsennotierten AG war zuletzt die<br />
Bremer Rolandmühle GmbH. Nach einem katastrophalen Geschäftsjahr<br />
1966 mit ruinösen Preisen und Trockenheit, die das<br />
Wasserkraftwerk schwer traf, wur<strong>de</strong> die Mühle stillgelegt und<br />
die AG verschwand. Pfingsten 1968 vernichtete ein verheeren<strong>de</strong>s<br />
Großfeuer das Hauptgebäu<strong>de</strong>. Als die Decken einstürzten,<br />
stieg eine 200 m hohe Funkenfontäne gen Himmel. Der Feuerwehreinsatz<br />
war dramatisch, da im Getrei<strong>de</strong> gelagerte Beutel<br />
mit <strong>de</strong>m Insektizid Phosphorwasserstoff bei Kontakt mit Luft<br />
und Wasser ein tödliches Gas bil<strong>de</strong>n konnten. Noch heute wird<br />
ein <strong>Teil</strong> <strong>de</strong>s erhalten gebliebenen Speichergebäu<strong>de</strong>s zum Trokknen<br />
und Lagern von Getrei<strong>de</strong> genutzt, und das Kraftwerk am<br />
Beginn <strong>de</strong>s Rhumekanals produziert immer noch Strom.<br />
Los 956 Schätzwert 100-180 €<br />
Ri-Ri-Werk Reißverschluß-AG<br />
Wuppertal-Wichlinghausen, Aktie 20.000<br />
RM von 1940 (nicht datiert). Grün<strong>de</strong>raktie<br />
(R 9) EF<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1927 als Ri-Ri-Werk Patentverschluß GmbH (Ri-Ri<br />
= Rippen und Rillen), AG seit 1940 mit einem Kapital von<br />
1250.000 RM. Seine erste Fabrik eröffnete Othmar Winterhalter<br />
(1889-1961) geboren in Tablat bei St. Gallen, in Wuppertal.<br />
1928 erfolgten die ersten RiRi-Ableger in Luxemburg, Mailand<br />
und in St. Gallen. 1929 schaffte Winterhalter mit einem neuen<br />
Spritzgussverfahren <strong>de</strong>finitiv <strong>de</strong>n Durchbruch. Die neuen Fertigungstechniken<br />
wur<strong>de</strong>n auch an die Väter <strong>de</strong>r ersten Reissver-<br />
88<br />
schlüsse nach Amerika zurückverkauft, <strong>de</strong>r Schweizer kassierte<br />
nun praktisch bei je<strong>de</strong>m Reissverschluß, <strong>de</strong>r verkauft wur<strong>de</strong>.<br />
Der geniale Tüfftler Winterhalter aber starb 1961 in <strong>de</strong>r “Klapsmühle,<br />
bei Professor Binswanger in <strong>de</strong>r Klinik Bellevue zu Konstanz”.<br />
Los 957 Schätzwert 200-250 €<br />
Riesaer Bank AG<br />
Riesa, Aktie 20 Goldmark 27.6.1924<br />
(Auflage 5000, R 10) EF-<br />
Aktien dieser Regionalbank waren zuvor völlig unbekannt<br />
gewesen. Nur 4 Stück wur<strong>de</strong>n im Reichsbankschatz<br />
gefun<strong>de</strong>n.<br />
Gründung 1903. Übernahme <strong>de</strong>s Spar- und Vorschuß-Vereins<br />
zu Ostrau i.Sa. im Jahr 1918. Börsennotiz: Freiverkehr Leipzig.<br />
Zweignie<strong>de</strong>rlassung in Ostrau, Geschäftsstelle in Riesa-Gröba<br />
sowie Kassenstellen in Elsterwerda und Stauchitz. Seit ihrem<br />
Bestehen verwaltete die Bank auch die Verkaufsstelle <strong>de</strong>r Ziegel-Verkaufs-Vereinigung<br />
Nordsachsen in Riesa, <strong>de</strong>r 26 Werke<br />
angehörten. Aufgrund <strong>de</strong>r Verordnung vom 14.8.1945 erfolgte<br />
die Abwicklung durch die Sächsische Lan<strong>de</strong>sbank.<br />
Los 958 Schätzwert 60-120 €<br />
Rockstroh-Werke AG<br />
Hei<strong>de</strong>nau bei Dres<strong>de</strong>n, Aktie 1.000 Mark<br />
1.4.1920 (Auflage 1250, R 5) VF<br />
Defekte Ecken.<br />
Gründung Mai 1900 unter <strong>de</strong>r Firma Maschinenfabrik Rokkstroh<br />
& Schnei<strong>de</strong>r Nachf. AG. Hergestellt wur<strong>de</strong>n Werkzeugund<br />
Druckmaschinen, Tiegeldruckpressen, Schnellpressen,<br />
Prägepressen. Zweigbüros mit Reparaturwerkstätten in Berlin,<br />
Hamburg, Leipzig, Wien und Zürich. Börsennotiz Dres<strong>de</strong>n.<br />
1919 Umbenennung in Rockstroh-Werke AG. Die Ges. existierte<br />
bis nach <strong>de</strong>m 2. Weltkrieg.<br />
Los 959 Schätzwert 100-150 €<br />
Römhildt AG<br />
Weimar, Aktie 1.000 Mark 31.1.1921<br />
(Auflage 2400, R 8) EF-VF<br />
Gründung 1845, AG seit 1891 (Firma bis 1911: Römhildt-Pianofortefabrik<br />
AG, 1911-18 Römhildt-Heilbrunn Söhne AG).<br />
Nr. 955 Nr. 957<br />
1899 Neubau <strong>de</strong>r Fabrik in Weimar, Hinterm Bahnhof 12, 1910<br />
Errichtung eines großen Erweiterungsbaus. Filialen in Berlin<br />
und Hamburg. Börsennotiz: Freiverkehr Leipzig. 1930 Verkauf<br />
eines <strong>Teil</strong>s <strong>de</strong>s Fabrikgrundstücks in Weimar und Abtretung eines<br />
<strong>Teil</strong>s <strong>de</strong>r Produktion an die Pianofortefabrik A. Herrmann<br />
AG in Sangerhausen. 1931 Konkurs.<br />
Los 960 Schätzwert 15-30 €<br />
Rombacher Hüttenwerke<br />
Hannover, 4,5 % Genußschein 40 RM<br />
Jan. 1926 (R 5) EF<br />
Gründung 1888, bis 1926 Rombacher Hüttenwerke. 1926 übernahmen<br />
die Kokswerke und Chemische Fabriken AG in Berlin<br />
(später die Schering AG) zwecks Sanierung die Rombacher<br />
Hüttenwerke und firmierten sie in die (neue) Concordia Bergbau-<br />
AG um. 1968 Stilllegung <strong>de</strong>r Schachtanlagen. Nach<strong>de</strong>m das Unternehmen<br />
schon immer auch starke Interessen in <strong>de</strong>r Chemieindustrie<br />
gehabt hatte, wur<strong>de</strong> 1976 in Concordia-Chemie AG<br />
umfirmiert. Letzter Namenswechsel dann 1991 in Concordia<br />
Bau und Bo<strong>de</strong>n AG, nach<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Immobilien-Spekulant Minninger<br />
Firmenmantel und Börsennotiz übernommen hatte.<br />
Los 961 Schätzwert 75-150 €<br />
Rositzer Zucker-Raffinerie<br />
Rositz S.-A., Aktie 1.000 Mark März 1920<br />
(Auflage 3000, R 6) VF<br />
Die 1871 erbaute Rübenzuckerfabrik war damals die erste in<br />
ganz Deutschland mit einer elektrischen Beleuchtung <strong>de</strong>s Betriebes.<br />
Sie ging aber bereits 1874 in Konkurs. 1882 entstand<br />
in <strong>de</strong>r alten Rübenzuckerfabrik nunmehr eine Zuckerraffinerie.<br />
Die Anlagen hatten schließlich eine Produktionsfähigkeit von<br />
1,5 Mio. Zentner Zucker jährlich und 750 Beschäftigte. 1922<br />
Vertrag mit <strong>de</strong>r Zuckerraffinerie Halle und <strong>de</strong>n Zuckerfabriken<br />
<strong>de</strong>r Mittel<strong>de</strong>utschen Zuckervereinigung, worin sich letztere verpflichteten,<br />
ihren Rohzucker ausschließlich in <strong>de</strong>n Raffinerien<br />
Halle und Rositz verarbeiten zu lassen. Börsennotiz Berlin,<br />
Hamburg und Leipzig. 1946 wur<strong>de</strong> die Fabrik enteignet und<br />
1956 auf die Verarbeitung von Rohrzucker aus Kuba zu Weißzucker<br />
umgestellt. Zuletzt ein Betriebsteil <strong>de</strong>s VEB Zuckerfabrik<br />
Delitzsch. 1965 Einstellung <strong>de</strong>r Produktion, neben <strong>de</strong>r Abpakkung<br />
von Zucker in Kleinmengen wur<strong>de</strong>n nunmehr Verpackun-<br />
gen und Packhilfsmittel produziert. Letzterer Geschäftsbereich<br />
wur<strong>de</strong> nach <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> privatisiert und gehört heute zur Thüringer<br />
Fiber-Trommel GmbH, die immer noch in <strong>de</strong>r 1995 mustergültig<br />
restaurierten unter Denkmalschutz stehen<strong>de</strong>n alten<br />
Zuckerraffinerie ansässig ist (neben einem Betrieb, <strong>de</strong>r Türen<br />
und Fenster produziert).<br />
Los 962 Schätzwert 150-250 €<br />
Rostocker Actien-Zuckerfabrik<br />
Rostock, Namens-Actie 3. Em. 1.000<br />
Mark 22.11.1893 (Auflage 200, R 7) VF<br />
Pro Aktie galt eine Rübenanbaupflicht von 120 Ruten<br />
(später Ablieferungspflicht von min<strong>de</strong>stens 50<br />
Doppelzentnern Rüben pro Aktie). Großformatiges<br />
Papier, <strong>de</strong>korativ, mit zwei Vignetten von Merkur<br />
und Industria. Originalsignaturen.<br />
Gründung 1884. Die Fabrik lag in <strong>de</strong>r Neubran<strong>de</strong>nburger Straße<br />
an <strong>de</strong>r Ober-Warnow und war mit <strong>de</strong>m Fluss durch einen<br />
Kanal verbun<strong>de</strong>n. Mit einer jährlichen Rübenverarbeitung von<br />
über 1 Mio. Zentner eine <strong>de</strong>r damals ganz großen Fabriken. In<br />
<strong>de</strong>n etwa 25 Fabrikgebäu<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n zu DDR-Zeiten dann<br />
chemische und pharmazeutische Erzeugnisse produziert. Nach<br />
<strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> wur<strong>de</strong>n die Gebäu<strong>de</strong> abgerissen, bis auf zwei, die<br />
<strong>de</strong>r alternativen Kulturszene als “Alte Zuckerfabrik” seit 2006<br />
als Probe- und Veranstaltungsräume dienen.<br />
Los 963 Schätzwert 30-60 €<br />
Rotophot AG<br />
für graphische Industrie<br />
Berlin, Aktie 1.000 RM 26.9.1933<br />
(Auflage 280, R 5) EF<br />
Gründung 1912 unter Übernahme <strong>de</strong>r seit 1900 bestehen<strong>de</strong>n<br />
Rotophot GmbH. Erzeugnisse: Illustrierte Zeitschriften, Werbedrucksachen,<br />
Kalen<strong>de</strong>r usw. Der Betrieb befand sich bis 1949<br />
in <strong>de</strong>r Alexandrinenstraße 110. 1950 Berliner Wertpapierbereinigung,<br />
1954 verlagert nach Coburg, 1955 von Amts wegen<br />
gelöscht.<br />
Los 964 Schätzwert 75-125 €<br />
Rudolf Lauche AG<br />
Leipzig, Aktie 10.000 Mark Jan. 1923<br />
(Auflage 749, R 7) EF<br />
Großformatiges Papier, sehr <strong>de</strong>korativ verziert.<br />
Gründung 1891, AG ab 1922. Bis Juli 1922: AG für aromatische<br />
Erzeugnisse, Berlin, danach Rudolf Lauche AG, Leipzig.
Hergestellt wur<strong>de</strong>n ätherische Öle und Essenzen, Fruchtextrakte,<br />
Riechstoffe, chemische und technische Produkte aller Art.<br />
1949 enteignet.<br />
Los 965 Schätzwert 15-30 €<br />
Rudolph Karstadt AG<br />
Berlin, Aktie 100 RM Juni 1942 (Auflage<br />
9378, R 1) EF<br />
Rudolph Karstadt grün<strong>de</strong>te 1881 in Wismar sein erstes Tuch-,<br />
Manufaktur- und Confections-Geschäft. Nach stürmischer Expansion<br />
(inzwischen gab es 35 Karstadt-Häuser in Nord<strong>de</strong>utschland)<br />
1920 Gründung <strong>de</strong>r Rudolph Karstadt AG mit Sitz<br />
in Hamburg. Im gleichen Jahr Übernahme <strong>de</strong>s Warenhausunternehmens<br />
Theodor Althoff in Münster (19 Häuser in West<strong>de</strong>utschland,<br />
zurückgehend bis 1885 auf ein Kurz-, Weiß- und<br />
Wollwarengeschäft in Dülmen). Das starke Bestreben nach Eigenfertigung<br />
zeigt sich in <strong>de</strong>r gleichzeitigen Übernahme <strong>de</strong>r<br />
Baumwollspinnerei und Weberei S. A. Weyl & Sohn und <strong>de</strong>r<br />
Buntweberei Gebr. Braunschweig (bei<strong>de</strong> in Bocholt), <strong>de</strong>r Gardinenfabrik<br />
Fränkel & Hering in Auerbach und <strong>de</strong>r Papiergroßhandlung<br />
Walter Klestadt in Essen, ferner übernommen 1925<br />
die Engelhardt Blaudruckerei und Leinenfärberei in Kassel.<br />
Weitere Beteiligungen an Pelzwaren-, Parfümerie-, Seifen-,<br />
Koffer-, Schuh- Hut- und Blechwarenfabriken. 1969 Sitzverlegung<br />
nach Essen. 1999 Fusion mit <strong>de</strong>m Versandhaus Quelle<br />
zur Karstadt Quelle AG. Ab 2007 firmierte die Holding <strong>de</strong>s KarstadtQuelle-Konzerns<br />
unter <strong>de</strong>m Namen Arcandor AG (arc be<strong>de</strong>utet<br />
in vielen Sprachen Bogen, das aus <strong>de</strong>m Lateinischen<br />
abgeleitete candor be<strong>de</strong>utet u.a. glänzend und in <strong>de</strong>r Silbe dor<br />
ist auf französisch Gold enthalten = Arcandor spannt einen Bogen<br />
in die goldglänzen<strong>de</strong> Zukunft). Im Juni 2009 Eröffnung <strong>de</strong>s<br />
Insolvenzverfahrens.<br />
Los 966 Schätzwert 60-75 €<br />
Ruhlandwerk AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark Jan. 1923<br />
(Auflage 2000, R 9) VF<br />
Faksimilesignaturen <strong>de</strong>r Grün<strong>de</strong>r Georg Nathan<br />
und Hugo Bieber. Umgestellt auf 20 RM. Nur 6<br />
Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Waggonbauanstalt, gegrün<strong>de</strong>t 1922 unter <strong>de</strong>r Firma Ruhlandwerk<br />
Maschinenfabrik Georg Nathan u. Hugo Bieber AG, 1923<br />
umbenannt in Ruhlandwerk AG. Lieferung und Bearbeitung von<br />
Eisenbahnmaterialien je<strong>de</strong>r Art. Zweignie<strong>de</strong>rlassung und Fabrik<br />
in Rathenow. 1924 erlitt die Gesellschaft Verluste durch Ausbleiben<br />
<strong>de</strong>r Aufträge seitens <strong>de</strong>r Reichsbahn und wur<strong>de</strong> 1925<br />
saniert unter <strong>de</strong>r Führung <strong>de</strong>r Permutit AG. 1930 umbenannt in<br />
Rathenower Grundstücks-AG. 1934 wur<strong>de</strong> die Gesellschaft<br />
aufgelöst. Die Fabrik bestand weiter, im 2. WK als Wehrmachtszulieferer,<br />
in <strong>de</strong>r DDR als VEB Ruhlandwerk mit <strong>de</strong>n Betrieben<br />
Havelhütte und Motorenwerke in Rathenow.<br />
Los 967 Schätzwert 75-150 €<br />
Ruhrgas AG (Ruhr Gas Corporation)<br />
Essen, 6,5 % Bond 1.000 $ 1.10.1928<br />
(R 8) VF<br />
Allegorischer Stahlstich.<br />
Gründung 1926 als AG für Kohleverwertung, Grün<strong>de</strong>r waren<br />
fast alle <strong>de</strong>r im Rheinisch-Westfälischen Kohlensyndikat ver-<br />
einigten Zechen. 1928 in Ruhrgas umfirmiert. Die Gesellschaft<br />
ermöglichte eine wirtschaftliche Nutzung <strong>de</strong>r riesigen Mengen<br />
an Kokereigas (seinerzeit 2 Mrd. cbm im Jahr), welches in Ringleitungen<br />
gesammelt und an die Abnehmer weiterverteilt wur<strong>de</strong>.<br />
Neben <strong>de</strong>n Sammelleitungen waren mit Dortmund-Siegen-<br />
Nie<strong>de</strong>rschel<strong>de</strong>n-Wissen, Hamm-Hannover und Duisburg-Köln<br />
auch bereits Ferngasleitungen in Betrieb.<br />
Los 968 Schätzwert 30-80 €<br />
Runge-Werke AG<br />
Spandau, Aktie 1.000 Mark 12.12.1922<br />
(Auflage 13000, R 5) EF<br />
Großformatiges Papier.<br />
Gründung 1916. Herstellung von Zwischenprodukten für die<br />
Kautschukwarenfabrikation, insbeson<strong>de</strong>re von Kautschuk-Regeneraten.<br />
Der Preissturz auf <strong>de</strong>m Kautschukmarkt führte<br />
1928 zu einem Zwangsvergleich.<br />
Los 969 Schätzwert 300-375 €<br />
S. Aston Maschinenfabrik AG<br />
Burg b/M., Aktie 10.000 Mark 20.10.1923.<br />
Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 10000, R 9) EF-.<br />
Sehr hübsch, mit eindrucksvollen Art-Deko-Elementen.<br />
Aktien dieser be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n Ges. waren<br />
zuvor völlig unbekannt! Bei uns erstmals überhaupt<br />
angeboten.<br />
1810 erwarb Johann Gottlob Nathusius mit <strong>de</strong>m säkularisierten<br />
Klostergut Althal<strong>de</strong>nsleben auch das Schloß Hundisburg.<br />
1814 richtete er hier einen Kupferhammer und eine Eisengie-<br />
ßerei ein, die Räume <strong>de</strong>s Schlosses wur<strong>de</strong>n für <strong>de</strong>n Betrieb einer<br />
Maschinenfabrik (hydraulische Pressen für Zuckerfabriken,<br />
Landwirtschaftsmaschinen, später auch Dampfmaschinen)<br />
zweckentfrem<strong>de</strong>t. Es war dies die überhaupt erste Maschinenfabrik<br />
in Nord<strong>de</strong>utschland. Da England industriell damals führend<br />
war, wur<strong>de</strong>n 1816 in Südwales 12 Former und Schlosser<br />
angeworben, darunter die Brü<strong>de</strong>r Samuel (1792-1848) und<br />
Georg Aston. Als die Nathusius’sche Fabrik 1819 fallierte, gingen<br />
die englischen Arbeiter in ihre Heimat zurück, nur die Astons<br />
blieben. Sie vertraten in Mag<strong>de</strong>burg und Umgebung englische<br />
Hersteller von Maschinen für Zuckerfabriken bzw.<br />
schürften in Zorge im Harz nach Eisenerz. 1823 erhielt Samuel<br />
Aston in Mag<strong>de</strong>burg das Bürgerrecht und grün<strong>de</strong>te hier (Knochenhauerufer<br />
19, später Trönsberg 49) eine eigene Maschinenfabrik.<br />
Hergestellt wur<strong>de</strong>n Betriebs-Dampfmaschinen, hydraulische<br />
Pressen sowie Maschinen und Apparate für die Zukkerindustrie.<br />
1829 trat Georg Aston seinem Bru<strong>de</strong>r Samuel als<br />
<strong>Teil</strong>haber zur Seite, starb aber schon 1834. 1840 verkaufte Samuel<br />
das Unternehmen an <strong>de</strong>n Grafen Heinrich zu Stolberg-<br />
Wernigero<strong>de</strong> (womit die zeitweise überrragen<strong>de</strong> Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r<br />
Gräfl. Stolberg’schen Maschinenfabrik für die Zuckerindustrie<br />
begrün<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>). Nach <strong>de</strong>m Verkauf grün<strong>de</strong>te Samuel Aston<br />
in Burg bei Mag<strong>de</strong>burg erneut eine mo<strong>de</strong>rne Maschinenfabrik<br />
an Stelle <strong>de</strong>r alten Ölmühle am Vogelgesang. 1844 wur<strong>de</strong> zusätzlich<br />
eine Weberei für die Produktion von Orleans und an<strong>de</strong>ren<br />
Stoffen errichtet. Es war dies in Preußen die überhaupt<br />
allererste mit eisernen Webstühlen und Dampfkraft ausgerüstete<br />
Weberei. Samuel Aston wur<strong>de</strong> 1848 ein Opfer <strong>de</strong>r Cholera.<br />
Seine Schwester Fanny und sein Sohn Georg führten die<br />
Fabrik weiter, sie blieb bis in’s 20 Jh. im Besitz <strong>de</strong>r Familie.<br />
1923, genau ein Jahrhun<strong>de</strong>rt nach <strong>de</strong>r Gründung, in eine AG<br />
umgewan<strong>de</strong>lt. Hergestellt wur<strong>de</strong>n nun insbeson<strong>de</strong>re Maschinen<br />
für die Stärkefabrikation und komplette Stärkefabrikseinrichtungen,<br />
Ölmühlen und Olivenpressen sowie komplette Ölgewinnungsanlagen,<br />
Maschinen und komplette Einrichtungen<br />
für die Fabrikation von Münzen und Medaillen, Spezialwerkzeugmaschinen<br />
für Lokomotivbau, Isolierrohre und Gussbearbeitungsmaschinen.<br />
Mehrheitsaktionär war die zum BARMAT-<br />
Konzern gehören<strong>de</strong> Berlin-Burger Eisenwerk AG. 1925 in Konkurs<br />
gegangen. An die Aston’sche Fabrik erinnert in Burg noch<br />
heute <strong>de</strong>r eindrucksvolle 1851 errichtete Fabrikschornstein,<br />
<strong>de</strong>r 2018 ein zentrales Gestaltungselement <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>sgartenschau<br />
wer<strong>de</strong>n soll.<br />
Los 970 Schätzwert 150-200 €<br />
S.D. Fürst Max Egon zu Fürstenberg<br />
Donaueschingen, 4,5 % <strong>Teil</strong>schuldv. 500<br />
Mark Sept. 1913 (Auflage 6000, R 9) EF-VF<br />
Faksimile-Unterschrift Gwinner für die Deutsche<br />
Bank. Einzelstück aus <strong>de</strong>m Reichsbankschatz.<br />
<strong>Teil</strong> einer für die damalige Zeit ausgesprochen großen Anleihe<br />
von 22 Mio. Mark, aufgelegt durch Vermittlung <strong>de</strong>r Deutschen<br />
Bank. Als Sicherheit waren an landwirtschaftlichem Gelän<strong>de</strong><br />
5.569 ha und an Forsten 25.046 ha verhaftet.<br />
Nr. 969 Nr. 972<br />
Los 971 Schätzwert 125-200 €<br />
Saccharin-Fabrik AG<br />
vorm. Fahlberg, List & Co.<br />
Mag<strong>de</strong>burg-Südost, 4,5 % <strong>Teil</strong>schuldv.<br />
500 Mark Jan. 1920 (Auflage 700, R 7) EF<br />
Originalunterschriften.<br />
Gründung 1902 als “Saccharin-Fabrik AG vorm. Fahlberg, List &<br />
Co.” unter Übernahme <strong>de</strong>r seit 1886 bestehen<strong>de</strong>n Fabrik von Dr.<br />
Constantin Fahlberg, <strong>de</strong>m Ent<strong>de</strong>cker <strong>de</strong>s Süßstoffs Saccharin.<br />
Fahlberg, geb. 22.12.1850 im russischen Tambow, erhielt<br />
1868/69 seine erste wissenschaftliche Ausbildung an <strong>de</strong>r Polytechnischen<br />
Schule in Moskau. Anschließend führte er in Berlin<br />
erste Zuckeruntersuchungen durch und studierte dann Chemie in<br />
Wiesba<strong>de</strong>n und Leipzig. Fahlberg promovierte 1873 in Leipzig<br />
und war danach für kurze Zeit Direktor <strong>de</strong>r “Chemische Laboratorien<br />
Unterharz”. Dieses nur wenige Monate kurze Gastspiel sollte<br />
sich <strong>de</strong>nnoch später als ausschlaggebend bei <strong>de</strong>r Standortwahl<br />
für eine Fabrik erweisen. 1874 ging Fahlberg nach New York und<br />
eröffnete dort ein Zucker-Labor, 1878 habilitierte er sich an <strong>de</strong>r<br />
John Hopkins Universität in Baltimore, wo er als Gast von Ira Remsen<br />
an <strong>de</strong>ssen Chemischem Institut Zucker-Analysen durchführte.<br />
Auf Vorarbeiten von Remsen aufbauend fand er bei <strong>de</strong>r Oxidation<br />
von o-Toluensulfamid eher zufällig <strong>de</strong>n künstlichen Süßstoff<br />
Saccharin, 500mal stärker als herkömmlicher Zucker. Besuche<br />
bei seinem Onkel Adolph List in Leipzig 1882 und 1884 gaben<br />
<strong>de</strong>n Anstoß zur industriellen Nutzung <strong>de</strong>r Ent<strong>de</strong>ckung. 1885 begann<br />
die Versuchsproduktion in New York, am 18.11.1885 erhielt<br />
Fahlberg das Deutsche Reichspatent für <strong>de</strong>n Süßstoff Saccharin.<br />
Im April 1886 wur<strong>de</strong> die Kommanditgesellschaft Fahlberg, List &<br />
Co. in Leipzig mit Sitz in Salbke bei Mag<strong>de</strong>burg gegrün<strong>de</strong>t. Am<br />
9.3.1887 nahm die Fabrik die Produktion auf. Bis zur Jahrhun<strong>de</strong>rtwen<strong>de</strong><br />
wuchs das Geschäft beständig, dann wirkte sich die<br />
Konkurrenz <strong>de</strong>r Zuckerindustrie negativ aus. Deren Lobby setzte<br />
in Deutschland 1902 sogar ein gesetzliches Süßstoffverbot durch<br />
(das wegen Versorgungsmängeln mit Zucker erst im 1. Weltkrieg<br />
wie<strong>de</strong>r aufgehoben wur<strong>de</strong>). Auf das Verbot reagierte Fahlberg mit<br />
<strong>de</strong>r Umwandlung in eine AG, um mit neuem Kapital die Produktionspalette<br />
erweitern zu können. Neues Haupterzeugnis wur<strong>de</strong><br />
zunächst Schwefelsäure. Die gravieren<strong>de</strong>n Probleme gingen an<br />
Fahlberg nicht spurlos vorbei: 1906 verließ er nach schwerer Erkrankung<br />
die Firma, 1910 starb er im hessischen Nassau. Doch<br />
sein Nachfolger August Klages führte das Werk mit Tatkraft fort:<br />
1912 Anglie<strong>de</strong>rung einer pharmazeutischen Abteilung, 1921 Erwerb<br />
<strong>de</strong>r benachbarten Metallhütte Mag<strong>de</strong>burg GmbH, außer<strong>de</strong>m<br />
Errichtung eines Betriebes für Pflanzenschutzmittel. 1926 Übernahme<br />
<strong>de</strong>r Mittel<strong>de</strong>utsche Superphosphatwerke GmbH mit Werken<br />
in Köthen und Do<strong>de</strong>rdorf, außer<strong>de</strong>m Neubau einer Superphosphatfabrik<br />
auf <strong>de</strong>m Gelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Glashütte A. Grafe Nachf. in<br />
Westerhüsen. 1932 Umfirmierung in Fahlberg-List AG Chemische<br />
Fabriken. Kurz vor <strong>de</strong>m Rückzug <strong>de</strong>r britischen Truppen und <strong>de</strong>m<br />
Einrücken <strong>de</strong>r Sowjets wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r gesamte Vorstand 1945 von <strong>de</strong>r<br />
britischen Militärregierung in die britische Zone zwangsevakuiert.<br />
89
Der von Kriegsschä<strong>de</strong>n fast völlig verschont gebliebene Mag<strong>de</strong>burger<br />
Betrieb wur<strong>de</strong> am 1.7.1946 entschädigungslos in Volkseigentum<br />
überführt. Die AG verlegte 1950 ihren juristischen Sitz<br />
nach Hamburg und erwarb die “Dr. Goeze & Co. GmbH” in Wolfenbüttel<br />
(sogleich umfirmiert in Fahlberg-List GmbH), wo nach<br />
<strong>de</strong>n Fahlberg-List-Patenten weiter Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel<br />
hergestellt wur<strong>de</strong>n. Die Tochter in Wolfenbüttel,<br />
wo auch die Schering AG ein großes Werk für Pflanzenschutzmittel<br />
unterhielt (heute Bayer Crop Science) wur<strong>de</strong> 1969<br />
verkauft. 1976 Sitzverlegung nach Düsseldorf, wo die AG noch<br />
heute mit diversen kleineren Beteiligungen besteht. Am Stammsitz<br />
in Mag<strong>de</strong>burg zählte das Werk als VEB Fahlberg-List, seit<br />
1979 <strong>Teil</strong> <strong>de</strong>s Kombinats Agrochemie Piesteritz, zu <strong>de</strong>n wichtigsten<br />
Arzneimittelwerken <strong>de</strong>r DDR und bediente auch Abnehmer in<br />
<strong>de</strong>r Sowjetunion, <strong>de</strong>r Tschechoslowakei und Polen. Nach <strong>de</strong>r<br />
Wen<strong>de</strong> 1992 privatisiert. Der Käufer, die Pharmafirma Salutas (eine<br />
Tochter <strong>de</strong>r HEXAL AG in Holzkirchen) führte eine pharmazeutische<br />
Auftragsproduktion fort und baute kurz darauf in Barleben<br />
nahe <strong>de</strong>r A 2 ein riesiges neues Pharma- und Logistikzentrum,<br />
das seit 1995 im Vollbetrieb arbeitet. Über 1.300 Mitarbeiter verarbeiten<br />
300 pharmazeutische Wirkstoffe zu über 10.000 verschie<strong>de</strong>nen<br />
Substanzen. 2005 wur<strong>de</strong> Hexal vom Schweizer Sandoz-Konzern<br />
übernommen, <strong>de</strong>m weltweit zweitgrößten Generika-<br />
Herstellen. Im Investitionplan <strong>de</strong>s Unternehmens stand Barleben<br />
danach an <strong>de</strong>r Spitze: Seit 2007 wird die Produktionskapazität auf<br />
jährlich 10 Milliar<strong>de</strong>n Tabletten und Kapseln ausgebaut.<br />
Los 972 Schätzwert 175-300 €<br />
Saccharin-Fabrik AG<br />
vorm. Fahlberg, List & Co.<br />
Mag<strong>de</strong>burg-Südost, Aktie 1.000 Mark<br />
12.6.1920 (Auflage 7500, R 7) VF<br />
Zwei Randvignetten mit Signet: Frau mit Handspiegel<br />
zwischen <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Türmen <strong>de</strong>s Mag<strong>de</strong>burger<br />
Doms. Aktien dieser be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n AG aus<br />
<strong>de</strong>r Vor-RM-Zeit waren zuvor völlig unbekannt!<br />
Geschichte siehe voriges Los.<br />
Los 973 Schätzwert 150-250 €<br />
Saccharin-Fabrik AG<br />
vorm. Fahlberg, List & Co.<br />
Mag<strong>de</strong>burg-Südost, Aktie 1.000 Mark<br />
10.6.1921 (Auflage 15000, R 7) VF+<br />
I<strong>de</strong>ntische Gestaltung wie voriges Los.<br />
Los 974 Schätzwert 150-250 €<br />
Saccharin-Fabrik AG<br />
vorm. Fahlberg, List & Co.<br />
Mag<strong>de</strong>burg-Südost, Aktie 1.000 Mark<br />
1.12.1922 (Auflage 20000, R 7) EF<br />
Ebenfalls i<strong>de</strong>ntisch gestaltet.<br />
Los 975 Schätzwert 150-200 €<br />
Sächsisch-Thürinigische AG<br />
für Licht- und Kraftanlagen<br />
Erfurt, Actie 1.000 Mark 30.4.1899.<br />
Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 200, R 7) EF<br />
Die 1898/99 gegrün<strong>de</strong>te Gesellschaft errichtete die Gasanstalt<br />
in Frankenhausen am Kyffhäuser. Nach<strong>de</strong>m das Gaswerk 1909<br />
90<br />
Werksgelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Fahlberg-List 1966<br />
zu recht unvorteilhaften Bedingungen an die Stadt Frankenhausen<br />
verkauft wor<strong>de</strong>n war,trat die AG 1910 in Liquidation.<br />
Nach zwei früheren Quoten von 40 % und 13 % erhielten die<br />
Aktionäre am 16.8.1917 die Schlußquote mit 18,2 %.<br />
Los 976 Schätzwert 10-25 €<br />
Sächsische Bo<strong>de</strong>ncreditanstalt<br />
Dres<strong>de</strong>n, Konvolut Gold-Hypothekenpfandbriefe<br />
(je 2 Stück) 500 Goldmark und<br />
1.000 Goldmark 29.2.1928 (Text <strong>de</strong>utsch<br />
und holländisch) sowie 2.000 Goldmark<br />
1.11.1928 (Text <strong>de</strong>utsch, englisch und<br />
spanisch). Schönes Dokument zur<br />
Refinanzierung <strong>de</strong>utscher Banken im<br />
Ausland. Insgesamt 6 Stücke UNC-EF<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1895 unter maßgeblicher Beteiligung <strong>de</strong>r Dresdner<br />
Bank und <strong>de</strong>s angesehenen Privatbankhauses Gebr. Arnhold (bei<br />
<strong>de</strong>nen später auch immer die Aktienmehrheit lag). 1930 Fusion<br />
mit <strong>de</strong>r Leipziger Hypothekenbank. 1949 Verlegung <strong>de</strong>s juristischen<br />
Sitzes nach Berlin (als Berliner Altbank) und <strong>de</strong>r Verwaltung<br />
nach Köln. 1960 Verlegung <strong>de</strong>s Verwaltungssitzes nach<br />
Frankfurt/Main und Wie<strong>de</strong>raufnahme <strong>de</strong>s Neugeschäfts. Zu dieser<br />
Zeit besaßen die Commerzbank und die Dresdner Bank je eine<br />
Schachtelbeteiligung. Nach Übernahme <strong>de</strong>r Aktienmehrheit<br />
durch die Dresdner Bank 1972 Verschmelzung mit <strong>de</strong>ren Realkredit-Tochter<br />
Deutsche Hypothekenbank Bremen. Schlußendlich,<br />
wie alle Hypothekenbanktöchter <strong>de</strong>r drei Großbanken, in <strong>de</strong>r<br />
heute zur Commerzbank gehören<strong>de</strong>n EuroHypo aufgegangen.<br />
Los 977 Schätzwert 150-200 €<br />
Sächsische Broncewarenfabrik AG<br />
Wurzen, Aktie 1.200 Mark 1.6.1922<br />
(Kapitalerhöhung unter Führung <strong>de</strong>r<br />
Darmstädter Bank, Auflage 885, R 10)<br />
EF-VF<br />
Gegrün<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong> die Fabrik in bester Innenstadtlage von Wurzen<br />
bereits 1862, Umwandlung in eine AG 1889. Mit rd. 500<br />
Arbeitern wur<strong>de</strong>n Lampen für Gas- und elektrische Beleuchtung<br />
sowie Heizkörperverkleidungen hergestellt. Die Aktien waren<br />
in Leipzig und Dres<strong>de</strong>n börsennotiert. 1933 Konkurs.<br />
Los 978 Schätzwert 200-250 €<br />
Sächsische Getrei<strong>de</strong> Kreditbank AG<br />
Dres<strong>de</strong>n, Aktie 10.000 Mark Aug. 1923.<br />
Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 20000, R 9) EF<br />
Nur 5 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1923. Zweck: Unter Ausschluß <strong>de</strong>s Eigenhan<strong>de</strong>ls mit<br />
Getrei<strong>de</strong> aller Art die För<strong>de</strong>rung und Finanzierung von Geschäften<br />
in landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Bedarfstoffen,<br />
Bankgeschäfte aller Art.<br />
Los 979 Schätzwert 25-50 €<br />
Sächsische Gußstahl-Werke Döhlen AG<br />
Freital, Aktie 100 RM März 1931 (Auflage<br />
2500, R 3) EF<br />
Gründung 1855, ab 1862 AG. Die Gräflich Einsie<strong>de</strong>lschen Eisenwerke<br />
in Berggießhübel wur<strong>de</strong>n 1871 übernommen. Im<br />
Laufe <strong>de</strong>r Jahre mehrere Übernahmen. 1943 Werke in Freital-<br />
Döhlen, Cainsdorf und Pirna. 1949 Sitzverlagerung nach Düsseldorf,<br />
ab 1955 GmbH.<br />
Los 980 Schätzwert 100-225 €<br />
Sächsische Industriebahnen-<br />
Gesellschaft AG<br />
Dres<strong>de</strong>n, VZ-Aktie 1.000 Mark Juli 1909 (im<br />
Text “Vorzugs-Aktie” nicht überstempelt.<br />
Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 800, R 4) EF<br />
1940 wur<strong>de</strong>n die Vorzugsaktien in Stammaktien<br />
umgewan<strong>de</strong>lt. Breite Jugendstil-Umrahmung. Mit<br />
Faksimile-Unterschrift <strong>de</strong>s Deutsche-Bank-Vorstands<br />
Paul Millington Herrmann.<br />
Gründung 1905 durch die Dresdner Filialen <strong>de</strong>r Deutschen<br />
Bank und <strong>de</strong>r Allgemeinen Deutschen Credit-Anstalt zum Bau<br />
<strong>de</strong>r eingleisigen 10,3 km langen Normalspurbahn von Mittweida<br />
über Neudörfchen nach Dreiwer<strong>de</strong>n und Ringethal (die nur<br />
für <strong>de</strong>n Güterverkehr projektierte sog. Zschopauthalbahn). Die<br />
Baukosten von rd. 2,5 Mio. M wur<strong>de</strong>n finanziert durch 1 Mio.<br />
M Aktienkapital (in 200 Stamm- und 800 Vorzugsaktien) und<br />
eine 1911 begebene Anleihe von 1,3 Mio. M (abgesichert auf<br />
<strong>de</strong>r Mittweidaer Gütereisenbahn). Betriebsführung und Bereitstellung<br />
<strong>de</strong>s rollen<strong>de</strong>n Materials durch die Sächsischen Staatseisenbahnen<br />
(später die Reichsbahn-Direktion Dres<strong>de</strong>n). Laut<br />
Konzession <strong>de</strong>r Sächsischen Regierung vom 13.10.1906 sollte<br />
die Bahnanlage nach 90 Jahren entschädigungslos in das<br />
Eigentum <strong>de</strong>s Sächsischen Staatsfiskus übergehen. Bekanntlich<br />
beschleunigte die politische Entwicklung nach 1945 diese<br />
Vermögensübertragung ein wenig.<br />
Nr. 981<br />
Los 981 Schätzwert 50-100 €<br />
Sächsische Industriebahnen-<br />
Gesellschaft AG<br />
Dres<strong>de</strong>n, Genußrechtsurkun<strong>de</strong> 50 RM<br />
Jan. 1926 (Auflage ca. 410, R 5) EF<br />
Ausgegeben an die Gläubiger einer 1911 begebenen<br />
Anleihe von 1,3 Mio. M (bedingungsgemäß zu<br />
tilgen bis 1967) bei <strong>de</strong>ren RM-Umwertung 1926.<br />
Geschichte siehe voriges Los.<br />
Los 982 Schätzwert 30-50 €<br />
Sächsische Lan<strong>de</strong>spfandbriefanstalt<br />
Dres<strong>de</strong>n, 4,5 % Schuldv. Serie IV 3.000<br />
RM Juni 1934 (R 10) EF<br />
Ausgegeben im Umtausch gegen die 6 % Goldbonds<br />
<strong>de</strong>r Saxon State Mortgage Institution mit<br />
Laufzeit bis zum 15.9.1947.<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1925 durch Gesetz als Anstalt öffentlichen Rechts.<br />
Los 983 Schätzwert 125-200 €<br />
Sächsische Le<strong>de</strong>rindustrie-Gesellschaft<br />
(vormals Daniel Beck)<br />
Döbeln, Namens-Genuss-Schein<br />
31.7.1883 (Auflage 3500, R 7) EF<br />
Die Genuss-Scheine wur<strong>de</strong>n durch die Herren<br />
Gebr. Arnhold in Dres<strong>de</strong>n à 75 Mark per Stück<br />
übernommen. Sehr schöne Umrahmung im Historismus-Stil<br />
mit Engeln und Putten.<br />
Die Gesellschaft übernahm am 22.1.1872 die Le<strong>de</strong>rmanufactur<br />
und Lackle<strong>de</strong>r-Fabrik <strong>de</strong>r Herren Gebr. Beck in Döbeln.<br />
Los 984 Schätzwert 30-90 €<br />
Sächsische Malzfabrik<br />
Dres<strong>de</strong>n-Plauen, Aktie 100 RM 1.3.1929<br />
(Auflage 500, R 4) EF<br />
Gründung 1889. In <strong>de</strong>r Fabrik in Dres<strong>de</strong>n-Plauen auf einem ca.<br />
14.000 qm großen Grundstück wur<strong>de</strong> mit ca. 60 Mitarbeitern<br />
reine Lohnmälzerei betrieben. Eigenes großes Anschlussgleis<br />
an die Staatsbahn. Börsennotiz Dres<strong>de</strong>n. 1949 nicht verlagert.<br />
Min<strong>de</strong>stgebot: 80 %<br />
vom unteren Schätzwert
Los 985 Schätzwert 40-75 €<br />
Sächsische Maschinenfabrik<br />
vorm. Rich. Hartmann AG<br />
Chemnitz, 4,5 % <strong>Teil</strong>schuldv. Serie A.<br />
1.000 Mark Jan. 1901 (Blankette, R 7) EF<br />
Großformatiges Papier, sehr <strong>de</strong>korativ verziert.<br />
Nicht ausgegeben, aber Umstellungsstempel auf<br />
150 RM.<br />
Gründung 1870 unter Übernahme <strong>de</strong>r seit 1837 bestehen<strong>de</strong>n<br />
Richard Hartmann Maschinenfabrik als “Sächsische Maschinenfabrik<br />
vorm. Rich. Hartmann AG”, Chemnitz. Die Gesellschaft<br />
trat 1930 in Abwicklung. Nachfolgegesellschaft war die<br />
“Sächsische Textilmaschinenfabrik vorm. Rich. Hartmann AG”.<br />
Starke Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg. Durch die im Rahmen<br />
<strong>de</strong>r Reparationsleistungen an die Sowjetunion abzugeben<strong>de</strong>n<br />
Anlagen verblieb nur rund ein Zehntel <strong>de</strong>r Anlagen für<br />
<strong>de</strong>n Neustart als VEB Spinnereimaschinenbau im Jahre 1946.<br />
Dieser Betrieb wur<strong>de</strong> 1990 durch die Treuhandgesellschaft liquidiert,<br />
womit auch die Reste <strong>de</strong>r traditionsreichen Firma endgültig<br />
verschwan<strong>de</strong>n.<br />
Los 986 Schätzwert 20-50 €<br />
Sächsische Textilmaschinenfabrik<br />
vorm. Rich. Hartmann AG<br />
Chemnitz, Aktie 1.000 RM 15.11.1935<br />
(Auflage 1500, R 3) EF<br />
Abb. Firmensignet Arbeiter mit Vorschlaghammer,<br />
vom Zahnrad umran<strong>de</strong>t.<br />
Los 987 Schätzwert 50-100 €<br />
Sächsische Versicherungs-AG<br />
Dres<strong>de</strong>n, Namensaktie 500 RM Sept.<br />
1928 (Auflage 666, R 5) EF<br />
Gründung 1863 als “Sächsische Rückversicherungs-Gesellschaft”<br />
durch die “Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft für<br />
See-, Fluß- und Landtransport” in Dres<strong>de</strong>n. Zweck: Rück-Versicherung<br />
in allen Zweigen, Versicherung gegen die Gefahren<br />
<strong>de</strong>s Transportes und Versicherung gegen die Gefahren <strong>de</strong>s Aufruhrs<br />
und <strong>de</strong>r Plün<strong>de</strong>rung.<br />
Los 988 Schätzwert 25-50 €<br />
Sächsische Werkzeugmaschinenfabrik<br />
Bernhard Escher AG<br />
Chemnitz, Aktie 100 RM 1.12.1941<br />
(Auflage 2000, R 3) EF<br />
Gründung 1874, AG seit 1907. Hergestellt wur<strong>de</strong>n Hochleistungs-Werkzeugmaschinen<br />
sowie Son<strong>de</strong>rmaschinen für Mo-<br />
torrad-, Auto- und Textilmaschinenbau. Der Betrieb wur<strong>de</strong><br />
1945 <strong>de</strong>montiert, die AG stand bis 1948 unter Zwangsverwaltung.<br />
1946-50 wur<strong>de</strong> die Fabrik neu aufgebaut. Interessanterweise<br />
bestand die AG in <strong>de</strong>r DDR weiter: 1948 wur<strong>de</strong> das Kapital<br />
1:1 von RM auf DM umgestellt, die alten Aktien blieben bis<br />
1960 (in <strong>de</strong>m Jahr fand in Karl-Marx-Stadt die letzte nachgewiesene<br />
Hauptversammlung statt) gültig!<br />
Los 989 Schätzwert 60-120 €<br />
Sächsische Wollwaaren-Druckfabrik<br />
AG vorm. Oschatz & Co.<br />
Schönhei<strong>de</strong> i. Erzgeb., Aktie 1.000 Mark<br />
Dez. 1921 (Auflage 500, R 4) EF<br />
Gründung 1900 mit Übernahme <strong>de</strong>r Firma Oschatz & Co. Betrieb<br />
einer Wollwaren-Druckfabrik, Färberei und Weberei. Großaktionär:<br />
Mechanische Weberei AG Zittau.<br />
Los 990 Schätzwert 15-30 €<br />
Salaman<strong>de</strong>r AG<br />
Kornwestheim, Aktie 1.000 RM Juli 1930<br />
(Auflage 32000, R 1) EF<br />
G&D-Druck, kleine Vignette mit <strong>de</strong>m bekannten<br />
“Lurchi”.<br />
Gründung 1891, AG seit 1916 als “J. Sigle & Cie. Schuhfabriken<br />
AG”, 1930 nach Verschmelzung mit zwei Tochtergesellschaften<br />
Umfirmierung wie oben. Noch heute börsennotierte<br />
sehr be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Schuhfirma mit eigenen Lä<strong>de</strong>n in allen größeren<br />
<strong>de</strong>utschen Städten.<br />
Los 991 Schätzwert 50-100 €<br />
Saline Ludwigshalle AG<br />
Bad Wimpfen a.N., Aktie 100 RM Okt.<br />
1941 (Auflage 3000, R 5) EF<br />
Schon immer traten im Neckartal zwischen Heilbronn und Mosbach<br />
Salzquellen an <strong>de</strong>r Oberfläche aus, die schon in grauer<br />
Vorzeit zum Salzsie<strong>de</strong>n benutzt wur<strong>de</strong>n und die Besiedlung <strong>de</strong>r<br />
Gegend sehr för<strong>de</strong>rten. Lange verarbeiteten die Sie<strong>de</strong>betriebe<br />
nur oberflächlich austreten<strong>de</strong> Sole, bis Bergrat Bilfinger 1816<br />
in Jagstfeld ein unterirdisches Salzlager in 150 m Tiefe ent<strong>de</strong>ckte.<br />
1817 grün<strong>de</strong>ten Bürger unter Führung <strong>de</strong>r Familie<br />
Merkle die Saline Ludwigshalle, die schon 1818 das Wimpfener<br />
Salzlager ent<strong>de</strong>ckte. Außer<strong>de</strong>m wur<strong>de</strong> 1820 das Offenauer<br />
Salzlager gefun<strong>de</strong>n. Die Gründung gleich mehrerer Salinen<br />
auf engstem Raum hing mit <strong>de</strong>n gera<strong>de</strong> stattgefun<strong>de</strong>nen territorialen<br />
Umwälzungen im Südwesten und <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Kleinstaaterei<br />
zusammen: Jagstfeld und Offenau gehörten zum Königreich<br />
Württemberg, das Wimpfener Salz wur<strong>de</strong> im Großherzogtum<br />
Hessen gewonnen. Den Bohrungen <strong>de</strong>s Großherzogtums<br />
Ba<strong>de</strong>n bei Heinsheim, Neckarmühlbach und Haßmersheim<br />
war dagegen zunächst kein Erfolg beschie<strong>de</strong>n. Die Saline<br />
Ludwigshalle wur<strong>de</strong> bereits 1821 in eine AG umgewan<strong>de</strong>lt. Sie<br />
bil<strong>de</strong>te zusammen mit <strong>de</strong>r Rappenauer Ludwigssaline, <strong>de</strong>r Saline<br />
Clemenshall in Offenau und <strong>de</strong>r Saline Friedrichshall in<br />
Jagstfeld <strong>de</strong>n “Verein <strong>de</strong>r Neckarsalinen”, <strong>de</strong>r 1867 durch<br />
Preisabsprachen mit französischen Salinen das erste internationale<br />
Kartell <strong>de</strong>r Wirtschaftsgeschichte bil<strong>de</strong>te. Ludwigshalle<br />
blieb bis 1921 eine reine Saline, dann auch Gründung einer<br />
Abteilung Chemische Fabrik (Flußsäure, flußsaure Salze). Das<br />
erste Produkt - und übrigens noch heute im Programm! - war<br />
Kryolith, ein Schmelzflussmittel für die aufstreben<strong>de</strong> Aluminiumindustrie.<br />
Damals im Freiverkehr Stuttgart börsennotiert.<br />
1973 erwarb <strong>de</strong>r belgische Solvay-Konzern das gesamte Aktienkapital.<br />
1982 Einglie<strong>de</strong>rung in die ebenfalls zu Solvay gehören<strong>de</strong><br />
Kali-Chemie AG, Hannover. Heute ist Wimpfen mit rd.<br />
350 Beschäftigten ein Werk <strong>de</strong>r Solvay Fluor GmbH.<br />
Los 992 Schätzwert 300-375 €<br />
Salzwe<strong>de</strong>ler Kleinbahn GmbH<br />
Salzwe<strong>de</strong>l, 4,5 % <strong>Teil</strong>schuldv. 500 Mark<br />
Dez. 1902 (Auflage 100, R 8) EF-VF<br />
Die Anleihe von 150.000 M vermittelte das Salzwe<strong>de</strong>ler<br />
Privatbankhaus M. Nelke Wwe. Hypothekarisch<br />
abgesichert an zweiter Rangstelle auf <strong>de</strong>r<br />
gesamten 31,3 km langen Bahnstrecke Salzwe<strong>de</strong>l-Diesdorf.<br />
Großformatiges, <strong>de</strong>koratives Stück<br />
mit Originalunterschriften und Abb. einer Dampflok,<br />
außer<strong>de</strong>m ist im Unterdruck großflächig <strong>de</strong>r<br />
Götterbote Hermes vor einem fahren<strong>de</strong>n Zug.<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1899 zum Bau <strong>de</strong>r 30 km langen meterspurigen<br />
Schmalspurbahn Salzwe<strong>de</strong>l-Diesdorf, die <strong>de</strong>n ländlichen Raum<br />
<strong>de</strong>r Altmark südlich von Salzwe<strong>de</strong>l erschließen sollte. Ausgangspunkt<br />
war <strong>de</strong>r Bahnhof Salzwe<strong>de</strong>l-Neustadt gegenüber<br />
<strong>de</strong>m Staatsbahnhof (mit <strong>de</strong>r 1889 erbauten Staatsbahnstrecke<br />
nach Oebisfel<strong>de</strong>). In Diesdorf bestand später Anschluß an normalspurige<br />
Strecken <strong>de</strong>r Kleinbahn-AG Bismark-Gar<strong>de</strong>legen<br />
nach Beetzendorf (ab 1903) und nach Wittingen in <strong>de</strong>r Provinz<br />
Hannover (ab 1909). Ferner bestand in Salzwe<strong>de</strong>l ein Pfer<strong>de</strong>bahn-Anschlußgleis<br />
zur Zuckerfabrik. 1921 Zusammenschluß<br />
mit <strong>de</strong>r Salzwe<strong>de</strong>ler Kleinbahn Südost GmbH, welche 1901 abzweigend<br />
vom Haltepunkt Salzwe<strong>de</strong>l-Altpervertor eine 14 km<br />
lange Zweigbahn über Mahlsdorf nach Jeggeleben/Winterfeld<br />
erbaut hatte (am Zielbahnhof bestand wie<strong>de</strong>rum Anschluß an<br />
die Strecke Kalbe-Beetzendorf <strong>de</strong>r Kleinbahn-AG Bismark-Gar<strong>de</strong>legen).<br />
Zur weiteren Erhöhung <strong>de</strong>r Wirtschaftlichkeit wur<strong>de</strong>n<br />
bei<strong>de</strong> Strecken 1926/27 auf Regelspur umgebaut. Nach <strong>de</strong>m<br />
2. Weltkrieg zunächst <strong>de</strong>r Sächsische Provinzbahnen GmbH<br />
zugeteilt, 1949 an die Deutsche Reichsbahn übergegangen.<br />
Der Güterverkehr wur<strong>de</strong> auf bei<strong>de</strong>n Strecken 1994 eingestellt.<br />
Der Personenverkehr war auf <strong>de</strong>r Südoststrecke bereits 1980<br />
eingestellt wor<strong>de</strong>n, auf <strong>de</strong>r Stammstrecke Salzwe<strong>de</strong>l-Diesdorf<br />
fuhr nach zeitweiliger Unterbrechung 1995 <strong>de</strong>r letzte Zug.<br />
Los 993 Schätzwert 75-150 €<br />
Salzwe<strong>de</strong>ler Kleinbahn GmbH<br />
Salzwe<strong>de</strong>l, Geschäftsanteilschein o.N.<br />
1.4.1903 (Blankette, R 5) EF<br />
Tolle Gestaltung, Eisenbahn und Götterbote Hermes<br />
im Unterdruck.<br />
Geschichte siehe voriges Los.<br />
Los 994 Schätzwert 200-250 €<br />
Salzwe<strong>de</strong>ler Kleinbahnen GmbH<br />
Salzwe<strong>de</strong>l, Geschäftsanteilschein 300 RM<br />
20.3.1935 (<strong>Teil</strong>blankette, R 10) UNC<br />
Nur 3 Stück waren im Reichsbankschatz gefun<strong>de</strong>n<br />
wor<strong>de</strong>n, dies ist jetzt das letzte noch verfügbare!<br />
I<strong>de</strong>ntische Gestaltung wie folgen<strong>de</strong>s Los.<br />
Die Salzwe<strong>de</strong>ler Kleinbahn, das “Ferkeltaxi” 1993<br />
Los 995 Schätzwert 250-600 €<br />
Salzwe<strong>de</strong>ler Kleinbahnen GmbH<br />
Salzwe<strong>de</strong>l, Geschäftsanteilschein 500 RM<br />
20.3.1935, ausgestellt auf Zahnarzt Dr.<br />
Gustav Wulsch, Salzwe<strong>de</strong>l und Dipl. Ing.<br />
Helmut Wulsch, Salzwe<strong>de</strong>l (R 12) EF-VF<br />
Nur dieses eine ausgestellte Stück lag im Reichsbankschatz.<br />
Los 996 Schätzwert 40-60 €<br />
Saphir-Werke AG<br />
München, Actie 1.000 Mark Juni 1923<br />
(Auflage 50000, R 8) EF-VF<br />
Mit Abb. eines Saphirs. Nur 9 Stück lagen im<br />
Reichsbankschatz.<br />
Hervorgegangen aus <strong>de</strong>r “Vereinigte Münchener Fettraffinerien<br />
und Margarinefabriken Saphir”. Bereits 1925 wur<strong>de</strong> die AG<br />
wie<strong>de</strong>r aufgelöst, die Aktionäre gingen leer aus.<br />
Los 997 Schätzwert 200-250 €<br />
Sartorius-Werke (und vorm. Göttinger<br />
Präzisionswaagenfabrik GmbH) AG<br />
Göttingen, Aktie 200 RM Juli 1941<br />
(Auflage nur 100 Stück, R 9) EF-VF.<br />
Vorkriegsaktien dieses be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n Unternehmens<br />
waren zuvor völlig unbekannt! Nur 8 Stück<br />
wur<strong>de</strong>n im Reichsbankschatz gefun<strong>de</strong>n. Unauffälliger<br />
Rostfleck im oberen Bereich.<br />
Die 1870 in <strong>de</strong>r Groner Straße von Florenz Sartorius (1846-<br />
1925) gegrün<strong>de</strong>te feinmechanische Werkstatt erzielte mit einer<br />
neu konstruierten kurzarmigen Analysenwaage, bei <strong>de</strong>r das damals<br />
noch ganz neuartige Leichtmetall Aluminium verwen<strong>de</strong>t<br />
wur<strong>de</strong>, rasch be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Erfolge. Noch heute ist die Wägetechnik<br />
ein wichtiges Betätigungsfeld <strong>de</strong>s Konzerns. Wenig<br />
später wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Betrieb wegen <strong>de</strong>r dort vorhan<strong>de</strong>nen Wasserkraft<br />
nach Rauschenwasser bei Boven<strong>de</strong>n verlegt. Nach Inbetriebnahme<br />
<strong>de</strong>s Göttinger Elektrizitätswerks zog Sartorius<br />
1899 erneut um, und zwar in die Ween<strong>de</strong>r Landstraße im Nor<strong>de</strong>n<br />
Göttingens. 1906 nahm Florenz Sartorius seine drei Söhne<br />
als <strong>Teil</strong>haber auf, 1914 Umwandlung in eine AG. 1927 begann<br />
die Membranfiltergesellschaft mbH die industrielle Fertigung<br />
von Membranfiltern, basierend auf Forschungen <strong>de</strong>r Göttinger<br />
Chemiker Richard Zsigmondy (<strong>de</strong>r 1925 <strong>de</strong>n Nobelpreis<br />
für Chemie erhielt) und Wilhelm Bachmann. Dies war <strong>de</strong>r Anfang<br />
<strong>de</strong>r heutigen Sparte Biotechnologie, in <strong>de</strong>r die Herstellung<br />
von Filtern immer noch dominiert. 1929 Übernahme <strong>de</strong>r Göttinger<br />
Präzisionswaagenfabrik GmbH. 1990 an die Börse gegangen.<br />
Heute mit über 5.000 Beschäftigten und Produktions-<br />
91
stätten in Europa, Asien und Amerika ein weltweit führen<strong>de</strong>r<br />
Hersteller von Geräten für die biopharmazeutische Industrie,<br />
Laborinstrumenten und Wägetechnik.<br />
Los 998 Schätzwert 200-250 €<br />
Sartorius-Werke (und vorm. Göttinger<br />
Präzisionswaagenfabrik GmbH) AG<br />
Göttingen, Aktie 1.000 RM Juli 1941<br />
(Auflage 580, R 9) EF<br />
Geschichte siehe voriges Los.<br />
Los 999 Schätzwert 15-30 €<br />
Schei<strong>de</strong>man<strong>de</strong>l-Motard-Werke AG<br />
Berlin, Aktie 100 RM April 1941 (Auflage<br />
10800, R 2, kpl. Aktienneudruck wegen<br />
Fusion, wenige Monate später auf 6000<br />
reduziert) EF<br />
Unternehmer aus Landshut (Bayern) und Frankfurt (Main) brachten<br />
bei <strong>de</strong>r Gründung <strong>de</strong>r “AG für chemische Produkte vormals<br />
H. Schei<strong>de</strong>man<strong>de</strong>l” mit Sitz in Landshut drei süd<strong>de</strong>utsche Fabriken<br />
ein, von <strong>de</strong>nen die Schei<strong>de</strong>lmann’sche Kunstdünger- und<br />
chem. Produktenfabrik in Landshut die be<strong>de</strong>utendste war. Hergestellt<br />
wur<strong>de</strong>n vor allem tierische Leime, Futter- und Düngemittel.<br />
Nach Erwerb weiterer Fabriken in Nord<strong>de</strong>utschland 1904<br />
Sitzverlegung nach Berlin. 1937 Verschmelzung zur Schei<strong>de</strong>man<strong>de</strong>l-Motard-Werke<br />
AG. Nach 1945 verblieben die Werke Lüneburg,<br />
Min<strong>de</strong>n und Wiesba<strong>de</strong>n (Leimsektor) sowie Berlin,<br />
Mannheim, Neuss und Offenbach (Fettsektor). 1970 Umfirmierung<br />
in Schei<strong>de</strong>man<strong>de</strong>l AG, 1980 Sitzverlegung nach Wiesba<strong>de</strong>n<br />
und Beherrschungsvertrag mit <strong>de</strong>r Deutsche Gelatine-Fabriken<br />
Stoess & Co.; 1987 Sitzverlegung nach Eberbach/Ba<strong>de</strong>n, 1999<br />
komplett in die Stoess-Gruppe eingeglie<strong>de</strong>rt.<br />
Los 1000 Schätzwert 225-375 €<br />
Schieferbau-AG “Nuttlar”<br />
Nuttlar a.d. Ruhr, Namens-Actie 200<br />
Thaler 30.9.1875 (R 9) EF-<br />
Schöne Zierumrandung mit Rocailles, Originalunterschriften.<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1857 als Geßner & Co. KGaA, 1867 umbenannt in<br />
“Schieferbau-AG Nuttlar”. Ab 1885 Verlagerung <strong>de</strong>r Schiefergewinnung<br />
im Tagebau zum bergmännischen Tiefbau. 1912 Erwerb<br />
<strong>de</strong>r Schiefergrube “Silbacher Bruch” (1940 stillgelegt),<br />
weiter in Betrieb genommen 1919 die Grube “Christine” in Willingen<br />
und 1942 die Grube “Eva” bei Bestwig. Seit 1962 zusätzlich<br />
Betonstein-Fertigung, nach wie vor in Betrieb waren die<br />
Schiefergruben “Ostwig” bei Nuttlar und “Christine” in Willingen.<br />
1971 Umwandlung in die “Schieferbau Schmelzer & Co. KG”.<br />
Los 1001 Schätzwert 50-100 €<br />
Schieferwerke Ausdauer AG<br />
Probstzella, Aktie 1.000 RM April 1929<br />
(Auflage 320, R 6) EF<br />
Gründung 1911 in Saalfeld (Saale) zur Übernahme <strong>de</strong>r vom<br />
Bankier Carl Schmidt in Saalfeld betriebenen Schieferwerke,<br />
1920 Sitzverlegung nach Probstzella. Die Gesellschaft besaß<br />
89 Schieferkonzessionen. 1926 wur<strong>de</strong> sie durch Erwerb von<br />
20 sehr wertvollen Schieferberechtigungen von <strong>de</strong>r Thüringi-<br />
92<br />
Nr. 998 Nr. 1000<br />
schen Schieferbergbaugesellschaft in Reichenbach eines <strong>de</strong>r<br />
be<strong>de</strong>utendsten Unternehmen seiner Branche in Deutschland.<br />
Börsennotiert im Freiverkehr Düsseldorf-Essen. Nach <strong>de</strong>m 2.<br />
WK Sitzverlegung nach Siegen (wo die Großaktionärsfamilie<br />
Giebeler und die AR-Mitglie<strong>de</strong>r schon immer ansässig gewesen<br />
waren), 1951 Umwandlung in eine GmbH, 1955 gem. DM-Bilanzergänzungsgesetz<br />
aufgelöst.<br />
Los 1002 Schätzwert 15-30 €<br />
Schiess AG<br />
Düsseldorf, Aktie 1.000 RM Febr. 1942<br />
(Auflage 2000, R 2) EF<br />
Der Mag<strong>de</strong>burger Ernst Schiess (1840-1915) machte eine<br />
Karriere, wie sie nur in <strong>de</strong>r Grün<strong>de</strong>rzeit möglich war: Nach Besuch<br />
<strong>de</strong>r Technischen Hochschulen in Hannover, Karlsruhe und<br />
Zürich durchlief er Wan<strong>de</strong>rjahre in Deutschland, Belgien und<br />
England. Als Lehrling in Manchester erkannte er, daß die Werkzeugmaschine<br />
als “Mutter aller Maschinen” eine Schlüsselposition<br />
bei <strong>de</strong>r Industrialisierung einnehmen wird - dafür wollte<br />
er eine Fabrik bauen. Der Schwerindustrielle Ernst Poensgen<br />
erkannte das Talent von Schiess und überzeugte ihn davon,<br />
sich in Düsseldorf anzusie<strong>de</strong>ln. So entstand 1866 mit <strong>de</strong>r<br />
“Ernst Schiess Werkzeugmaschinenfabrik und Eisengießerei”<br />
die älteste Werkzeugmaschinenfabrik Deutschlands. 1891 betrieb<br />
Schiess die Gründung <strong>de</strong>r “Vereinigung <strong>de</strong>utscher Werkzeugmaschinenfabriken”<br />
VDM, <strong>de</strong>ren Gründungsvorsitzen<strong>de</strong>r<br />
er wur<strong>de</strong>. 1906 wan<strong>de</strong>lte Schiess sein Unternehmen in eine AG<br />
um, Mitbegrün<strong>de</strong>r war sein Schwiegersohn, <strong>de</strong>r Essener Bankier<br />
Aug. von Waldthausen. 1925 Fusion mit <strong>de</strong>r vormaligen<br />
Defrieswerke AG in Düsseldorf-Heerdt zur Schiess-Defries AG<br />
(ab 1939 wie<strong>de</strong>r Schiess AG). Von 1945-48 Demontage aller<br />
fünf Werke. Der Wie<strong>de</strong>raufbau erfolgte auf einem wesentlich<br />
größeren Gelän<strong>de</strong> im Stadtteil Lörick. In <strong>de</strong>n 1950er Jahren<br />
Gründung von Zweigwerken in New York und Pittsburgh sowie<br />
in Stamford (GB). 1993 vom Bremer Vulkan übernommen und<br />
in Dörries Scharmann AG umfirmiert, 1996 dann mit <strong>de</strong>m Bremer<br />
Vulkan untergegangen. Als Nachfolgegesellschaft wur<strong>de</strong><br />
mit rd. 700 Mitarbeitern in Mönchengladbach die Dörries<br />
Scharmann Technologie GmbH gegrün<strong>de</strong>t.<br />
Los 1003 Schätzwert 50-100 €<br />
Schiffbau-Gesellschaft Unterweser AG<br />
Wesermün<strong>de</strong>-Lehe, Aktie 1.000 RM Sept.<br />
1942 (Auflage 300, R 6) EF<br />
Gründung 1903, AG seit 1921. Damals eine <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>utendsten<br />
Werften Nord<strong>de</strong>utschlands, insbeson<strong>de</strong>re als Fischdampferwerft.<br />
Notierte im Freiverkehr Bremen und Hamburg. 1972 Fusion<br />
mit <strong>de</strong>r F. Schichau GmbH, 1984/85 in <strong>de</strong>n Vulkan-Verbund<br />
eingeglie<strong>de</strong>rt.<br />
Los 1004 Schätzwert 20-40 €<br />
Schimmel & Co. AG<br />
Miltitz b. Leipzig, Aktie 1.000 RM<br />
11.7.1927 (Auflage 5600, R 2) EF<br />
Mit Abb. eines großen Firmensignets (u.a. Löwen<br />
mit Krone). G&D-Druck.<br />
Gründung bereits 1832. AG seit 1927. Herstellung von ätherischen<br />
Ölen, Riechstoffen, chem. u. pharmazeut. Produkten, Extrakten,<br />
Essenzen und Farben. 1929 Kauf <strong>de</strong>r Fa. Anton Deppe<br />
Söhne in Hamburg. 1939 Erwerb <strong>de</strong>r Anlagen <strong>de</strong>r Dekfa-Kulör-<br />
Fabrik in Fre<strong>de</strong>rsdorf bei Berlin. In <strong>de</strong>r DDR <strong>Teil</strong> eines Kombi-<br />
nates, zu <strong>de</strong>m fast alle kosmetischen Betriebe <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s gehörten.<br />
1993 privatisiert als Miltitz Aromatics GmbH mit Sitz in<br />
Wolfen (Sachsen-Anhalt).<br />
Los 1005 Schätzwert 30-80 €<br />
Schleifmittel AG vormals Pike & Escher<br />
Sonneberg i. Thür., Aktie 300 RM Jan.<br />
1934 (Auflage weniger als 204, R 6) EF<br />
Gründung 1923 in Hamburg zur Weiterführung <strong>de</strong>r Geschäfte<br />
von Bösenberg, Trinks & Co. / Pike & Escher GmbH. Herstellung<br />
und Vertrieb von Schleifmitteln und Schleifmaterialien. 1933<br />
Vergleichsverfahren. 1934 Sitzverlegung nach Sonneberg<br />
(Thür.), in Hamburg blieb eine Zweignie<strong>de</strong>rlassung bestehen.<br />
1963 wird die ehemalige Schleifmittel AG am Langen Weg in<br />
Sonneberg <strong>de</strong>m VEB Vereinigte Porzellanwerke angeglie<strong>de</strong>rt<br />
und kurze Zeit später an Ultramöbel abgegeben.<br />
Los 1006 Schätzwert 50-100 €<br />
Schlesische Dach-, Falz-Ziegel-<br />
und Chamotten-Fabrik AG<br />
Görlitz, Aktie 1.000 Mark 1.1.1900.<br />
Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 750, R 6) EF-VF<br />
Großformat. Vignetten mit Dachziegeln in <strong>de</strong>r Umrandung.<br />
1918 Umfirmierung in “Ko<strong>de</strong>rsdorfer Werke AG”. Die noch heute<br />
bestehen<strong>de</strong> Ziegelei lieferte u.a. die einzigartig gefärbten<br />
Ziegelsteine für das <strong>de</strong>swegen so genannte “Rote Rathaus” in<br />
Berlin (<strong>de</strong>r Name bezog sich schon immer auf die Ziegel, nicht<br />
auf die Politik).<br />
Los 1007 Schätzwert 20-50 €<br />
Schlesische Dampfer-Compagnie -<br />
Berliner Lloyd AG<br />
Hamburg, Aktie 300 RM 13.10.1928<br />
(Auflage 4000, R 2) EF<br />
Am 19.8.1932 herabgesetzt auf 100 RM.<br />
Gründung 1887 unter Übernahme <strong>de</strong>r Chr. Priefert’schen Ree<strong>de</strong>rei<br />
in Breslau als AG Schlesische Dampfer-Compagnie. Übernommen<br />
wur<strong>de</strong>n ferner 1899 die Ree<strong>de</strong>rei M. J. Caro & Sohn mit<br />
Packhof- und Bollwerkanlagen, 1900 die Ree<strong>de</strong>rei Vereinigter<br />
Schiffer, 1906 die Breslauer Schiffahrts-AG und 1914 die Frankfurter<br />
Gütereisenbahn-Gesellschaft (sämtlich in Breslau). 1917<br />
Fusion mit <strong>de</strong>r Berliner Lloyd AG, die ihrerseits 1905 die Neue<br />
Berliner Schnelldampfer-Gesellschaft und die Berliner Krangesellschaft<br />
übernommen hatte. Für <strong>de</strong>n Motor- und Schleppkahn-<br />
Verkehr auf Elbe, Saale und O<strong>de</strong>r sowie <strong>de</strong>n märkischen und ostund<br />
west<strong>de</strong>utschen Binnenschiffahrts-Kanälen wur<strong>de</strong>n 1924 die<br />
Anlagen in Hamburg, Breslau, Fürstenberg und Mag<strong>de</strong>burg ausgebaut<br />
und in Breslau <strong>de</strong>r Hafen Pöpelwitz ganz neu gebaut.<br />
1926 Sitzverlegung nach Hamburg. Ab 1929 auch Bewirtschaftung<br />
<strong>de</strong>s Hafens Halle-Trotha. und Gründung <strong>de</strong>r Zwnl. Halle.<br />
1930 Beteiligung bei <strong>de</strong>r Oppelner Hafen AG und Errichtung einer<br />
Zwnl. 1938 im Zusammenhang mit <strong>de</strong>m Bau <strong>de</strong>s Mittellandkanals<br />
Gründung <strong>de</strong>r Zwnl. Braunschweig, Hannover und Köln,<br />
außer<strong>de</strong>m Pachtung <strong>de</strong>r Umschlagsanlagen <strong>de</strong>r Stadt Fallersleben<br />
am Mittellandkanal. 1939 Erwerb <strong>de</strong>r Em<strong>de</strong>r Verkehrsgesellschaft<br />
AG. 1940 Eröffnung <strong>de</strong>r Zwnl. Gleiwitz und Posen. 1941<br />
Übergang <strong>de</strong>r Aktienmehrheit von <strong>de</strong>r HAPAG auf das Reich. Im<br />
und nach <strong>de</strong>m 2. Weltkrieg gingen über 75 % <strong>de</strong>s Fahrzeugbestan<strong>de</strong>s<br />
von früher über 600 Einheiten verloren. Ab 1948 Sperre<br />
im Interzonenverkehr, die Aktivitäten konzentrierten sich dann auf<br />
Hamburg, Fallersleben, Hannover und Braunschweig. Großaktionär<br />
<strong>de</strong>r immer noch in Hamburg und Berlin börsennotierten Ges.<br />
war die AG für Binnenschiffahrt (gegrün<strong>de</strong>t 1941 als Reichswerke<br />
AG für Binnenschiffahrt “Hermann Göring”), die das Aktienpaket<br />
später an die Westfälische Transport-AG in Dortmund (heute<br />
Rhenus-WTAG) verkaufte. 1971 auf die WTAG verschmolzen.<br />
Los 1008 Schätzwert 50-100 €<br />
Schlesische Elektricitäts- und Gas-AG<br />
Breslau, Actie Lit. A 1.200 Mark<br />
31.5.1902 (Auflage 875, zuletzt nur noch<br />
431 Stück, R 5) VF.<br />
Gründung 1872 als Schlesische Gas-AG, 1898 umfirmiert wie<br />
oben. Stromlieferant für die oberschlesischen Berg- und Hüttenwerke<br />
und Bahnhöfe sowie die Städte und Kreise Beuthen,<br />
Hin<strong>de</strong>nburg, Gleiwitz und Schönwald. Bis 1922 versorgte die<br />
Ges. aus ihren bei<strong>de</strong>n Kraftwerken Chorzow und Zaborze das<br />
gesamte Industriegebiet Oberschlesiens im Dreieck Beuthen-<br />
Gleiwitz-Myslowitz. Nach <strong>de</strong>m 1. Weltkrieg kamen <strong>Teil</strong>e Oberschlesiens<br />
zu Polen, weshalb die Anlagen im nun polnischen<br />
<strong>Teil</strong> <strong>de</strong>s Versorgungsgebietes (die für ca. 70 % <strong>de</strong>s Stromabsatzes<br />
stan<strong>de</strong>n) 1922 auf die “Oberschlesische Kraftwerke<br />
Sp.A.” in Kattowitz übertragen wur<strong>de</strong>n (die eine 100 %ige<br />
Tochter blieb), gleichzeitig Sitzverlegung nach Gleiwitz. Börsennotiert<br />
in Berlin und Breslau, Großaktionäre waren zuletzt mit je<br />
25 % die A.E.G. und die Bergwerksverwaltung Oberschlesien<br />
GmbH <strong>de</strong>r Reichswerke Hermann Göring. 1964 verlagert nach<br />
Berlin (West) und in Liquidation gegangen, 1968 nach Abwikklung<br />
gelöscht.<br />
Los 1009 Schätzwert 100-150 €<br />
Schlesische Elektricitäts- und Gas-AG<br />
Breslau, Aktie Lit. B 1.200 Mark Febr.<br />
1922 (Auflage 14000, davon <strong>de</strong>r ganz überwiegen<strong>de</strong><br />
<strong>Teil</strong> En<strong>de</strong> 1942 in Sammelurkun<strong>de</strong>n<br />
zusammengefaßt, R 8) VF.<br />
Geschichte siehe voriges Los.<br />
Nr. 1010
Los 1010 Schätzwert 75-150 €<br />
Schlesische Elektrizitäts- und Gas-AG<br />
Gleiwitz, Sammelaktie 100 x 1.000 RM<br />
Dez. 1942 (Auflage 250, R 5) UNC<br />
Zuvor ganz unbekannt gewesen!<br />
Los 1011 Schätzwert 75-125 €<br />
Schloßfabrik-AG vorm. Wilh. Schulte<br />
Schlagbaum bei Velbert, Aktie 1.000 RM<br />
Mai 1932 (Auflage 1100, R 6) EF<br />
Gründung 1897 als Schloßfabrik-AG vorm. Wilh. Schulte, ab<br />
1938 Schloßfabrik Schulte-Schlagbaum AG. Herstellung von<br />
Tür-, Möbel- und Sicherheitsschlössern. Heute Schulte-<br />
Schlagbaum AG, Velbert (SAG).<br />
Los 1012 Schätzwert 75-100 €<br />
Schmirgelwerke AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark Okt. 1922<br />
(Auflage 6000, R 9) VF-<br />
Nur 6 Stück lagen im Reichsbankschatz. Fleckig.<br />
Gründung 1920, während <strong>de</strong>r Inflationszeit kamen gleich 5 Kapitalerhöhungen!<br />
Das Schleifmittelwerk in <strong>de</strong>r Sedanstraße in<br />
Potsdam wur<strong>de</strong> 1925 wie<strong>de</strong>r stillgelegt. 1931 im Han<strong>de</strong>lsregister<br />
von Amts wegen gelöscht.<br />
Los 1013 Schätzwert 150-250 €<br />
Schnellpressenfabrik AG<br />
Hei<strong>de</strong>lberg, Aktie 100 RM Jan. 1925<br />
(Auflage 11200, R 8) EF+<br />
Gründung 1850, AG seit 1899. Zunächst Produktion vollautomatischer<br />
Buchdruckmaschinen, von <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r berühmte<br />
“Hei<strong>de</strong>lberger Tiegel” Weltgeltung erlangte. Viele dieser Maschinen<br />
sind, vor allem in Schwellen- und Entwicklungslän<strong>de</strong>rn,<br />
bis heute unermüdlich im Einsatz. 1929 Übernahme <strong>de</strong>r<br />
Vereinigten Fabriken C. Maquet AG in Hei<strong>de</strong>lberg sowie <strong>de</strong>r<br />
Mag Maschinenfabrik AG in Geislingen. 1967 Umfirmierung in<br />
Hei<strong>de</strong>lberger Druckmaschinen AG. Jahrzehntelang war das<br />
RWE (früher über die Zwischenholding Lahmeyer) Großaktionär<br />
und konnte beim “weißen Raben” <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen Maschinenbaus<br />
lange Zeit fürstliche Erträge realisieren. Heutzutage immer<br />
noch Weltmarktführer bei Bogendruckmaschinen, aber <strong>de</strong>r<br />
Lack ist etwas angekratzt: Auf <strong>de</strong>m Höhepunkt <strong>de</strong>r Wirtschaftskrise<br />
2008/09 musste Hei<strong>de</strong>ldruck zur Sicherung <strong>de</strong>s<br />
Überlebens Staatshilfe beantragen.<br />
Los 1014 Schätzwert 50-180 €<br />
Schoeller’sche und Eitorfer<br />
Kammgarnspinnerei AG<br />
Breslau, Aktie 1.000 Mark 1.5.1908 (Auflage<br />
6100, R 3, kpl. Aktienneudruck) EF<br />
Bei <strong>de</strong>r Gründung 1901 als “Kammgarnspinnerei und Weberei<br />
Eitorf AG” wur<strong>de</strong> das Werk <strong>de</strong>r in Konkurs gegangenen Kammgarnspinnerei<br />
Eitorf Karl Schäfer & Cie. übernommen, das nach<br />
seiner Errichtung 1888 durch <strong>de</strong>n sächsischen Textilindustriellen<br />
Karl Schäfer schon 1895 durch einen Großbrand weitgehend<br />
zerstört wur<strong>de</strong> (ähnlich schlimme Scha<strong>de</strong>nfeuer suchten<br />
<strong>de</strong>n Eitorfer Betrieb noch zwei weitere Male 1922 und 1928<br />
heim). 1908 Fusion mit <strong>de</strong>r Schoeller’schen Kammgarn-Spinnerei<br />
in Breslau, Sitzverlegung nach Breslau und Umfirmierung<br />
wie oben. Der Breslauer Betrieb war schon 1842 von <strong>de</strong>r<br />
Preussischen Seehandlung mit 3000 Spin<strong>de</strong>ln gegrün<strong>de</strong>t und<br />
1849 an <strong>de</strong>n Geh. Kommerzienrat Leopold Schoeller aus Düren<br />
verkauft wor<strong>de</strong>n. Die ältere Spinnerei mit Kämmerei und<br />
Färberei auf wertvollen Grundstücken an <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r unweit <strong>de</strong>s<br />
Stadtzentrums produzierte hauptsächlich Strickgarne, während<br />
das zweite Werk in Stabelwitz bei Breslau einer Feingarnspinnerei<br />
mo<strong>de</strong>rner Art war. 1925 rechtliche Verselbständigung <strong>de</strong>s<br />
Stabelwitzer Werkes und Verkauf mit Rückpachtung an die Herren<br />
W. und F. Schoeller in Zürich, Umfirmierung <strong>de</strong>r AG in<br />
“Schoeller’sche Kammgarnspinnerei Eitorf AG” und Rückverlegung<br />
<strong>de</strong>s Sitzes nach Eitorf (Sieg). 1945 wur<strong>de</strong>n die Werke in<br />
Eitorf und Breslau durch Kriegseinwirkung völlig zerstört. Der<br />
schlesische Betrieb ging in Folge <strong>de</strong>s Krieges verloren, das Eitorfer<br />
Werke wur<strong>de</strong> 1946-50 wie<strong>de</strong>r aufgebaut. 1971 Übernahme<br />
<strong>de</strong>r Marke “Esslinger Wolle” von <strong>de</strong>r Kammgarnspinnerei<br />
Merkel & Kienlin GmbH in Esslingen a.N. 1979 Umfirmierung<br />
in Schoeller Eitorf AG. Früher Börsennotiz in Freiverkehr<br />
Düsseldorf, gehört heute zur Albers-Gruppe in Zürich. Einer <strong>de</strong>r<br />
allerletzten in Deutschland noch immer produzieren<strong>de</strong>n Textilbetriebe!<br />
Los 1015 Schätzwert 400-500 €<br />
Schöneberg-Frie<strong>de</strong>nauer<br />
Terrain-Gesellschaft<br />
Berlin, Actie 1.000 Mark 26.4.1889.<br />
Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 2000, durch Zuzahlung<br />
1917 in VZ-Aktie umgewan<strong>de</strong>lt VF+<br />
Zunächst Erwerb und Parzellierung größerer Grundstücke in<br />
Schöneberg sowie am Rastatterplatz und an <strong>de</strong>r Grunewaldstraße<br />
in Steglitz. Zur besseren Erschließung <strong>de</strong>r Terrains beteiligte<br />
sich die Ges. auch an <strong>de</strong>r Finanzierung <strong>de</strong>r Schnellbahn<br />
Dahlem-Rastatterplatz-Berlin. 1910 noch Erwerb eines Grundstücks<br />
in Groß-Lichterfel<strong>de</strong> am Bahnhof Botanischer Garten<br />
vom Prinzen zu Stolberg-Wernigero<strong>de</strong>. Sehr ertragreiche, in<br />
Berlin börsennotierte Gesellschaft. Ab 1927 in Liquidation, die<br />
sich bis in die 1930er Jahre hinzog.<br />
Los 1016 Schätzwert 25-50 €<br />
Schönower Immobilien-AG<br />
Berlin, VZ-Aktie 1.000 RM 22.10.1930<br />
(Auflage 500, R 5). 1937 umgewan<strong>de</strong>lt in<br />
Stammaktie, zugleich auf neuen Namen<br />
“Spinnstofffabrik Zehlendorf AG”<br />
umgestempelt UNC-.<br />
Diese AG hat eine beson<strong>de</strong>rs wechselvolle und schillern<strong>de</strong> Geschichte:<br />
Gründung 1886 als Fockendorfer Papierfabrik AG<br />
vormals Drache & Co. in Altenburg (Thüringen). 1899 Sitzverlegung<br />
nach Elberfeld und Umbenennung in Elberfel<strong>de</strong>r Papierfabrik<br />
AG. 1904 erwarb die Ges. in Berlin-Zehlendorf am<br />
Teltowkanal ein Grundstück mit 400 m Kanalfront und errichtete<br />
dort eine weitere Papierfabrik. 1930 umfirmiert wie oben,<br />
nach<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Elberfel<strong>de</strong>r Betrieb in eine neue AG ausgegrün<strong>de</strong>t<br />
wor<strong>de</strong>n war (Elberfel<strong>de</strong>r Papierfabrik AG, an <strong>de</strong>r eine 79 %ige<br />
Beteiligung verblieb). Die Papierfabrik in Zehlendorf wur<strong>de</strong> stillgelegt<br />
und an die Spinnstofffabrik Zehlendorf GmbH verpachtet.<br />
Deren Betrieb wur<strong>de</strong> 1937 dann selbst übernommen, <strong>de</strong>shalb<br />
erneut umfirmiert in Spinnstofffabrik Zehlendorf AG. Beschäftigt<br />
waren jetzt über 2.000 Mitarbeiter. 1945 <strong>de</strong>montiert.<br />
Ab 1950 PERLON-Produktion. 1960 Interessenvertrag mit <strong>de</strong>r<br />
Farbwerke Hoechst AG (in <strong>de</strong>n 1990er Jahren dann in die<br />
Hoechst AG eingeglie<strong>de</strong>rt). 1998 verkaufte die Hoechst AG ihre<br />
Polyesteraktivitäten incl. <strong>de</strong>s Zehlendorfer Werkes an die indonesische<br />
Multikarsa-Gruppe.<br />
Los 1017 Schätzwert 60-120 €<br />
Schornsteinaufsatz- und<br />
Blechwaren-Fabrik J. A. John AG<br />
Ilversgehofen bei Erfurt, Aktie 1.000 Mark<br />
1.1.1902. Grün<strong>de</strong>raktie (Auflage 400, R 4)<br />
EF-VF<br />
Die schon länger bestehen<strong>de</strong> Maschinen- und Blechwarenfabrik<br />
J. A. John wur<strong>de</strong> 1902 in die “Schornsteinaufsatz- und<br />
Blechwaren-Fabrik J. A. John AG” umgewan<strong>de</strong>lt, seit 1911 nur<br />
noch kurz als J. A. John AG firmierend. Grundlage <strong>de</strong>s Unternehmens<br />
waren die Schornsteinaufsätze <strong>de</strong>s genialen Ingenieurs<br />
John, bei <strong>de</strong>nen sich die Auslaßöffnung durch <strong>de</strong>n Wind automatisch<br />
in die windabgewandte Richtung dreht, es kann also<br />
niemals in <strong>de</strong>n Schornstein regnen. Sie sind noch heute in aller<br />
Welt zu fin<strong>de</strong>n (nur in Deutschland nicht, da sind sie feuerpolizeilich<br />
verboten, weil sie ja evtl. einrosten können und sich<br />
dann nicht mehr drehen). Auch die Abteilung für Wäscherei-<br />
Maschinen, Heizungs- und Lüftungs- sowie sonstige gesundheitstechnische<br />
Anlagen hat einen Höhepunkt zu bieten: John<br />
war <strong>de</strong>r Erfin<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Trommelwaschmaschine! Eine weitere<br />
Spezialität waren Anlagen und Apparate für Kellereien. Zuletzt<br />
in Berlin (zuvor auch Dres<strong>de</strong>n) börsennotiert, nach 1945 enteignet<br />
und als VEB weitergeführt, später einer <strong>de</strong>r größten Maschinenbaubetriebe<br />
<strong>de</strong>r DDR.<br />
Los 1018 Schätzwert 20-40 €<br />
J. A. John AG<br />
Erfurt-Ilversgehofen, Aktie 3.000 Mark<br />
6.3.1923 (Auflage 2000, R 2) EF<br />
Dekorativ, schöne Umrahmung im Historismus-<br />
Stil.<br />
Geschichte siehe voriges Los.<br />
Nr. 1015 Nr. 1027<br />
Los 1019 Schätzwert 25-50 €<br />
Schramm Lack- u. Farbenfabriken AG<br />
Offenbach, Aktie 100 RM 5.4.1929<br />
(Auflage 10800, R 2) EF<br />
Gründung 1902 durch Zusammenschluß <strong>de</strong>r Offenbacher Firmen<br />
“Chemische Fabriken in Farben und Firnissen Christoph<br />
Schramm” (gegr. 1810) und “Schramm & Hörner GmbH” (gegr.<br />
1863), Werk Mühlheimer Str. 164 (zuletzt Kettelerstr. 100). Herstellung<br />
von Lacken, Farben, Druckerschwärzen, Ölen und Chemikalien.<br />
1922/23 Verschmelzung mit <strong>de</strong>n “Lackfabriken und<br />
Rivalinwerken” in Friedberg, 1924 Umfirmierung in Schramm &<br />
Megerle Lack- und Farbenfabriken AG, weiter umbenannt 1926<br />
in Schramm Lack- und Farbenfabriken AG, 1977 in Schramm<br />
AG. 1978 Erwerb aller Anteile <strong>de</strong>r Reichhold Chemie GmbH<br />
(Tochter einer gleichnamigen Schweizer AG, die nunmehr die<br />
Schramm-Aktienmehrheit besaß) und zugleich Umfirmierung in<br />
Reichhold Chemie AG. Werke nunmehr in Offenbach, Ritterhu<strong>de</strong>,<br />
Wiesba<strong>de</strong>n und Mannheim. 1982 Liquidationsvergleich. Das<br />
Hauptwerk Offenbach wur<strong>de</strong> an die Weilburger Lackfabrik verkauft.<br />
1984 Reaktivierung <strong>de</strong>s AG-Mantels und Umbenennung in<br />
Beta Systems Computer AG, Sitzverlegung 1989 nach Frankfurt<br />
und 1992 nach Kriftel. 1994 dann endgültig pleite gegangen.<br />
Los 1020 Schätzwert 75-125 €<br />
Schraplauer Kalkwerke AG<br />
Schraplau (Mansfel<strong>de</strong>r Seekreis), Aktie<br />
100 RM 1.3.1940 (Auflage 232, R 8) EF<br />
Schon seit <strong>de</strong>m 17. Jh. war <strong>de</strong>r leicht zu bearbeiten<strong>de</strong> Schraplauer<br />
Muschelkalkstein im Land weit berühmt. Zu Beginn <strong>de</strong>s<br />
20. Jh. existierten in Schraplau ca. 10 Kalkwerke mit 35 Brennöfen.<br />
1909 grün<strong>de</strong>te man auf <strong>de</strong>m Standort <strong>de</strong>s Kalkwerkes<br />
Stecher, wo beson<strong>de</strong>rs viel Kalkstein anstand, unter reger Beteiligung<br />
<strong>de</strong>r örtlichen Bevölkerung die Schraplauer Kalkwerke<br />
AG, bis 1912 mit <strong>de</strong>m juristischen Firmensitz in Halle (Saale),<br />
danach in Schraplau. Bis 1933 in Halle a.S. börsennotiert. In<br />
<strong>de</strong>m Stollensystem <strong>de</strong>r Kalkwerke (Deckname Apatit und<br />
Frosch) wur<strong>de</strong>n im 2. Weltkrieg Flugzeugteile für die Junkers-<br />
Werke produziert (für JU 188 und FW 190). 1945 konfiszierte<br />
die Sowjetische Militäradministration (SMAD) <strong>de</strong>n Betrieb,<br />
1946 wur<strong>de</strong> er <strong>de</strong>r AG zurückgegeben, 1950 als VEB Kalkwerk<br />
Schraplau in Volkseigentum überführt. Ab 1974 mit zuletzt 230<br />
Beschäftigten Betriebsteil IV <strong>de</strong>s VEB Harzer Kalk- und Zementwerke.<br />
Diese wur<strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> als Harzkalk GmbH<br />
reprivatisiert und 1991 von <strong>de</strong>n damals zum Salzgitter-Konzern<br />
(heute zum Haniel-Konzern) gehören<strong>de</strong>n Fels-Werken in Goslar<br />
erworben. Seit Stilllegung <strong>de</strong>r eigenen Brennöfen 1982 bekommt<br />
das Werk, bis heute, gebrannten Kalk aus Rübeland geliefert,<br />
in 5 Güterzügen pro Woche auf <strong>de</strong>r ansonsten stillgelegten<br />
Bahnstrecke Röblingen-Schraplau. Daraus wer<strong>de</strong>n mit<br />
noch 35 Mitarbeitern pro Jahr zunächst 200.000 t Weißfeinkalk<br />
zur Abgasreinigung in Kraftwerken produziert, nach Einsatz<br />
in <strong>de</strong>n Rauchgasreinigungsanlagen geht das Material<br />
nach Schraplau zurück und wird dann zu Stuck-Gips weiterverarbeitet.<br />
Los 1021 Schätzwert 50-80 €<br />
Schraubenfabrik AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark 10.10.1923<br />
(R 10) VF<br />
Nur 5 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
93
Gründung 1923. Der Fabrikationsbetrieb lag in Jöhrstadt im<br />
sächsischen Erzgebirge. Produziert wur<strong>de</strong>n Schrauben, Muttern,<br />
Fassonteile usw. für Industrie und Landwirtschaft.<br />
Los 1022 Schätzwert 75-100 €<br />
Schreberverein<br />
<strong>de</strong>r Ostvorstadt Leipzig C1 e.V.<br />
Leipzig, Namens-Anteilschein B 200 RM<br />
23.5.1934 (R 8) EF<br />
Datum maschinenschriftlich, mit Originalunterschriften.<br />
1864 grün<strong>de</strong>te <strong>de</strong>r Leipziger Schuldirektor Ernst Innozenz<br />
Hauschild <strong>de</strong>n ersten Schreberverein, in<strong>de</strong>m Land für die<br />
sportliche Betätigung <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r gepachtet wur<strong>de</strong>. Der zweite<br />
Verein, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Namen Schrebers trug, war <strong>de</strong>r 1870 gegrün<strong>de</strong>te<br />
“Schreberverein <strong>de</strong>r Ostvorstadt”, 1892 neugegrün<strong>de</strong>t.<br />
Der Verein mit Sitz in <strong>de</strong>r Holsteinstraße existiert heute noch.<br />
Los 1023 Schätzwert 15-30 €<br />
Schriftgiesserei D. Stempel AG<br />
Frankfurt a.M., Aktie 600 RM Juli 1929<br />
(Auflage 5000, R 2) EF<br />
Gründung 1895, AG seit 1905 als Schriftgiesserei D. Stempel<br />
AG. Herstellung von Schriften, Füllmaterial und Messinglinien<br />
für Buchdruckzwecke. 1943 Umfirmierung in D. Stempel AG.<br />
Ein noch lange nach <strong>de</strong>m Krieg erfolgreiches Unternehmen,<br />
doch am En<strong>de</strong> führte das Aussterben <strong>de</strong>r Buchdrucktechnik<br />
doch zum Konkurs.<br />
Los 1024 Schätzwert 125-200 €<br />
Schuhfabrik Manz AG<br />
Bamberg, Aktie 300 RM 28.6.1929<br />
(Auflage 1280, R 8) EF<br />
Das Stammhaus wur<strong>de</strong> 1872 als Schäftefabrik unter <strong>de</strong>r Firma S.<br />
Müller, Bamberg gegrün<strong>de</strong>t. 1887 erwarben Heinrich und Franz<br />
Josef Manz die Firma. 1894 Gründung <strong>de</strong>r mechanischen Schuhfabrik<br />
Manz & Co. 1898 Zusammenlegung <strong>de</strong>r Schäftefabrik und<br />
<strong>de</strong>r mechanischen Schuhfabrik Manz & Co. zur Mechanische<br />
Schuh- und Schäftefabrik Manz AG. 1925 umfirmiert wie oben.<br />
Die Aktien lagen mehrheitlich in Familienbesitz, in <strong>de</strong>n 1960er<br />
Jahren taucht aber auch die Deutsche Bank mit einer Schachtelbeteiligung<br />
auf. Erworben wur<strong>de</strong> 1974 die Schuhmarke Merce<strong>de</strong>s<br />
und 1989 die Fa. Fortuna-Schuhe in Höchstadt/Aisch. Mit rd. 500<br />
Beschäftigten wur<strong>de</strong>n nun über 400.000 Paar Schuhe im Jahr<br />
hergestellt. 1999 in eine GmbH umgewan<strong>de</strong>lt, heute die Manz<br />
Fortuna GmbH mit Sitz in Forchheim.<br />
Los 1025 Schätzwert 200-250 €<br />
Sebnitzer Spar- und Bauverein eGmbH<br />
Sebnitz i. Sa., Anteilschein 200 RM<br />
20.3.1927 (R 10), ausgestellt auf Herrn<br />
Klempnermeister Karl Gustav Poser EF-<br />
Ungewöhnliche schwarz-rote Umrahmung, Originalunterschriften.<br />
Zuvor völlig unbekannt gewesen.<br />
Nur 5 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
94<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1901 nach <strong>de</strong>n Grundsätzen <strong>de</strong>s genossenschaftlichen<br />
Miteinan<strong>de</strong>rs: Selbsthilfe, Selbstbestimmung, Selbstverwaltung<br />
und Selbstverantwortung. Die Genossenschaft überdauerte<br />
die gesamte DDR-Zeit und besteht noch heute als Gemeinnützige<br />
Wohnungsgenossenschaft eG Sebnitz. Angeboten<br />
wer<strong>de</strong>n 1-Raum- bis 4-Raum-Wohnungen von 30 bis 100 qm<br />
in einem ruhigen Wohngebiet nahe beim Stadtzentrum, <strong>de</strong>m<br />
“Knöchel”, am Hainersdorfer Weg und <strong>de</strong>r Gotthelf-May-Straße.<br />
Los 1026 Schätzwert 30-60 €<br />
SECURITAS<br />
Bremer Allgemeine Versicherungs-AG<br />
Bremen, Namensaktie (Interims-Schein)<br />
1.000 RM 24.6.1929 (Auflage 3663, R 2) EF<br />
Gründung 1895 als Securitas Versicherungs-AG, 1920 umbenannt<br />
wie oben, 1931 Übernahme <strong>de</strong>r Roland Versicherungs-<br />
AG in Bremen unter Ausschluss <strong>de</strong>r Liquidation. 2003 verschmolzen<br />
auf die Basler Securitas Versicherungs-AG, Bad<br />
Homburg.<br />
Los 1027 Schätzwert 300-375 €<br />
Sektkellerei Wachenheim AG<br />
Wachenheim (Rheinpfalz), Aktie 300 RM<br />
Sept. 1928 (Auflage 1500, R 9) VF<br />
Zuvor vollkommen unbekannt gewesen, lediglich 6<br />
Stück wur<strong>de</strong>n im Reichsbankschatz gefun<strong>de</strong>n.<br />
Gründung 1888 in Wachenheim an <strong>de</strong>r Weinstrasse als Deutsche<br />
Schaumweinfabrik durch Übernahme <strong>de</strong>r Sektkellerei<br />
Gebr. Böhm. Umbenannt 1913 in Sektkellerei Wachenheim AG<br />
und 1939 in Sektkellerei Schloss Wachenheim AG. 1996 Vergleichsverfahren,<br />
anschließend Übernahme <strong>de</strong>r Aktienmehrheit<br />
durch die Günter Reh AG aus Trier (die seit <strong>de</strong>n 1970er Jahren<br />
unter <strong>de</strong>r Marke Faber Sekt Schaumwein erstmals für breite<br />
Konsumentenschichten erschwinglich gemacht hatte). Anschließend<br />
wur<strong>de</strong> Schloss Wachenheim Dachmarke <strong>de</strong>r ganzen<br />
Reh-Gruppe und ist mit einer Jahresproduktion von 220<br />
Mio. Flaschen Sekt und Schaumwein Weltmarktführer mit einem<br />
Weltmarktanteil von 10 %. In Deutschland steht die Gruppe<br />
mit <strong>de</strong>n Marken Faber, Schloss Wachenheim, Feist Belmont,<br />
Nymphenburg, Schweriner Burggarten und Kleine Reblaus an<br />
dritter Stelle hinter Rotkäppchen-Mumm und Henkell & Söhnlein.<br />
In Frankreich, Polen, Rumänien, <strong>de</strong>r Tschechei und <strong>de</strong>r<br />
Slowakei, wo jeweils eigene Produktionsstätten unterhalten<br />
wer<strong>de</strong>n, ist die bis heute börsennotierte Schloss Wachenheim<br />
AG sogar Marktführer im Schaumweinmarkt.<br />
Los 1028 Schätzwert 40-80 €<br />
Siedlungsgesellschaft Breslau AG<br />
Breslau, Namensaktie Lit. A 2.000 RM<br />
April 1940 (Auflage 227, R 5), ausgestellt<br />
auf die Stadtgemein<strong>de</strong> Breslau EF<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1919 unter Führung <strong>de</strong>r Stadt Breslau unter <strong>de</strong>m<br />
Eindruck <strong>de</strong>s Elends nach <strong>de</strong>m 1. Weltkrieg zwecks Schaffung<br />
gesun<strong>de</strong>r und zweckmäßig eingerichteter Wohnungen für min-<br />
<strong>de</strong>rbemittelte Einzelpersonen und Familien zu billigen Preisen.<br />
Für <strong>de</strong>n umfangreichen Eigenbedarf an Baumaterialien grün<strong>de</strong>te<br />
die Ges. 1921 die Dampfziegelei Neukirch GmbH, die<br />
Holzwerke Breslau GmbH und die AG für Lacke und Farbwaren<br />
“Alfa”. 10 Jahre nach <strong>de</strong>r Gründung betrug <strong>de</strong>r Bestand bereits<br />
rd. 3.500 Wohnungen und 46 Lä<strong>de</strong>n und Werkstätten, vorwiegend<br />
im Stadtteil Pöpelwitz. Bis 1942 war er auf rd. 10.000<br />
Wohnungen und 239 gewerbliche Räume angewachsen. Zum<br />
1.4.1944 übernahm die Ges. zu<strong>de</strong>m die Verwaltung <strong>de</strong>s gesamten<br />
<strong>de</strong>r Hauptstadt Breslau unmittelbar gehören<strong>de</strong>n Wohnhausbesitzes<br />
(rd. 3.200 Wohnungen) und <strong>de</strong>n gesamten Besitz<br />
<strong>de</strong>r Grundstücksverwaltung GmbH mit ca. 800 Wohnungen<br />
und gewerblichen Räumen. Damit bewirtschaftete die Siedlungsgesellschaft<br />
Breslau, die zuletzt zu über 96 % <strong>de</strong>r Stadt<br />
Breslau gehörte, mit rd. 140 Mitarbeitern fast 10 % <strong>de</strong>s gesamten<br />
Wohnungsbestan<strong>de</strong>s <strong>de</strong>r ehemaligen Hauptstadt von<br />
Schlesien, die im 19. Jh. nach Berlin und Hamburg zeitweise<br />
die drittgrößte Stadt in Deutschland gewesen war.<br />
Los 1029 Schätzwert 25-50 €<br />
Sieg-Rheinische Germania-Brauerei AG<br />
Hersel bei Bonn, Aktie 1.000 Mark<br />
10.4.1923 (Auflage 3000, R 3) EF<br />
Großformatig. Feine Zierumrandung.<br />
Gründung 1899 als Germania-Brauerei AG zur Fortführung <strong>de</strong>r<br />
“Frau Gerhard Schumacher Germaniabrauerei” in Hersel mit Filialbrauerei<br />
in Oberpleis, Kreis Sieg. 1922 Fusion mit <strong>de</strong>r Sieg-<br />
Rheinischen Brauerei GmbH in Wissen (Sieg) und Umfirmierung<br />
in “Sieg-Rheinische Germania-Brauerei” AG. 1923 Aufnahme<br />
<strong>de</strong>r Brauerei J. Breuer Söhne in Siegburg. Alle drei Braustätten<br />
in Hersel, Siegburg und Wissen wur<strong>de</strong>n weiterbetrieben, nur die<br />
1926 erworbene Kronenbrauerei Fusshöller & Co. in Eitorf (Sieg)<br />
wur<strong>de</strong> anschließend stillgelegt. Nach<strong>de</strong>m die Schlossbrauerei<br />
Neunkirchen GmbH vorm. Fr. Schmidt in Neunkirchen (Saar) die<br />
Aktienmehrheit erworben hatte, wur<strong>de</strong> 1970 die Zentralverwaltung<br />
dorthin verlegt. Erst 1990 in Liquidation gegangen.<br />
Los 1030 Schätzwert 25-50 €<br />
Siegen-Solinger<br />
Gussstahl-Aktien-Verein<br />
Solingen, Aktie 1.200 Mark Juni 1921<br />
(Auflage 6665, R 4) EF<br />
Gründung 1872. Gussstahlfabriken in Solingen-Wald sowie<br />
(wegen <strong>de</strong>r günstigeren Energiekosten durch die mittel<strong>de</strong>utsche<br />
Braunkohle) in Frankleben und Groß-Kayna bei Merseburg,<br />
wo ein neues Elektrostahlwerk errichtet wur<strong>de</strong>. 1922 Übernahme<br />
<strong>de</strong>r Weyersberg, Kirschbaum & Cie. AG mit 2 Werken<br />
in Solingen und Wald, wo Fahrrä<strong>de</strong>r, Motorrä<strong>de</strong>r, Haarschnei<strong>de</strong>maschinen<br />
und blanke Waffen hergestellt wur<strong>de</strong>n.<br />
1924 Sitzverlegung nach Berlin (dort auch börsennotiert). 1932<br />
als Folge <strong>de</strong>r Weltwirtschaftskrise in Konkurs gegangen.<br />
Los 1031 Schätzwert 60-120 €<br />
Siegener AG für Eisenkonstruktion,<br />
Brückenbau und Verzinkerei<br />
Geisweid, Aktie 1.000 RM Juli 1929<br />
(Auflage 1512, R 5) EF-VF<br />
Gegrün<strong>de</strong>t 1880 als Fa. Reifenrath & Holdinghausen, 1885<br />
Umwandlung in die “Siegener Verzinkerei AG”, 1903 umfirmiert<br />
wie oben. Herstellung von Stahlkonstruktionen für Hoch- und<br />
Brückenbauten, Verzinkung und Verbleiung von Blechen, Fabrikation<br />
schwerer und leichter Blechkonstruktionen wie Rohrleitungen,<br />
Bunker, Boiler, Druckkessel, Wellblechbauten und Wellblechgaragen<br />
sowie “Original Siegener” Pfannenblechen für<br />
Bedachungszwecke. 1969 umbenannt in “Siegener AG Geisweid”.<br />
In vier Werken in Geisweid, Siegen, Ferndorf und Kettwig/Ruhr<br />
waren über 1.500 Mitarbeiter beschäftigt. Stets zu<br />
99 % eine reine Familien-AG, 1972/73 letztmals im AG-Handbuch<br />
aufgeführt.<br />
Los 1032 Schätzwert 100-250 €<br />
Siegener Aktien-Brauerei<br />
Siegen, Aktie 1.000 Mark 21.12.1917<br />
(Auflage 500, R 5) EF+<br />
Schöner G&D-Druck, Zunftzeichen <strong>de</strong>r Brauer in<br />
<strong>de</strong>r Umrahmung.<br />
Gründung 1892. Die Brauerei in <strong>de</strong>r Hagener Straße 12 mit<br />
Nie<strong>de</strong>rlage in Betzdorf hatte einen jährlichen Absatz von<br />
15.000 - 20.000 hl und selten mehr als 20 Mitarbeiter. Außer<strong>de</strong>m<br />
gehörte <strong>de</strong>r AG das Hotel Fürst Moritz sowie Klapperts<br />
Keller, <strong>de</strong>r direkt an das Brauereigebäu<strong>de</strong> anschloß. 1959 Übertragung<br />
<strong>de</strong>s Vermögens auf die Brauerei Bernhard Scha<strong>de</strong>berg<br />
in Krombach („Krombacher“), die inzwischen sämtliche<br />
Aktien besaß.<br />
Los 1033 Schätzwert 60-120 €<br />
Siegener Aktien-Brauerei<br />
Siegen, Aktie 1.000 Mark 31.10.1922<br />
(Auflage 1000, R 3) UNC.<br />
Geschichte siehe voriges Los.<br />
Los 1034 Schätzwert 175-300 €<br />
Siegener Aktien-Brauerei<br />
Siegen, VZ-Aktie 1.000 Mark 31.10.1922<br />
(Auflage nur 100 Stück, R 7) EF+<br />
1939 in eine Stamm-Aktie umgewan<strong>de</strong>lt.
Nr. 1034<br />
Los 1035 Schätzwert 25-50 €<br />
Siegersdorfer Werke<br />
vorm. Fried. Hoffmann AG<br />
Siegersdorf Kr. Bunzlau, Aktie 1.000 RM<br />
19.1.1929 (Auflage 2200, R 4) EF<br />
Gründung 1876, seit 1894 AG. Herstellung von Verblendplatten,<br />
glasierten Spaltplatten, Schamottematerialien, säurefesten<br />
Erzeugnissen. Zweigwerke in Gersdorf und Lauban. Börsennotiz<br />
Berlin und Breslau.<br />
Los 1036 Schätzwert 150-250 €<br />
Siemens & Halske AG +<br />
Siemens-Schuckertwerke GmbH<br />
Berlin/Nürnberg, 6,5 % Gold Debenture<br />
1.000 $ 1.9.1926 (R 6) EF-VF<br />
Orange/schwarzer Stahlstich, Vignette mit Gott<br />
Merkur, Fabrik und Kraftwerk.<br />
Werner von Siemens (1816-1892) gilt als Begrün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Elektrotechnik.<br />
Bereits 1847 grün<strong>de</strong>te er mit <strong>de</strong>m Berliner Uhrmacher<br />
und Maschinenbauer J.G. Halske die “Telegraphenbauanstalt”<br />
mit Sitz in Berlin in <strong>de</strong>r Rechtsform einer oHG. Die Weiterentwicklung<br />
und Verbesserungen <strong>de</strong>r Telegraphen von Samuel<br />
Morse, W.F. Cooke und C. Wheatstone bil<strong>de</strong>ten die Basis<br />
für <strong>de</strong>n weiteren Erfolg <strong>de</strong>s Unternehmens. Wilhelm und Carl<br />
Siemens, die Brü<strong>de</strong>r von Werner Siemens, hatten ganz erheblichen<br />
Anteil am Erfolg <strong>de</strong>r breit gestreuten, außeror<strong>de</strong>ntlichen<br />
Geschäftsaktivitäten, die sich bald auf Europa und Übersee<br />
ausbreiteten und <strong>de</strong>m Namen Siemens zur Weltgeltung verhalfen.<br />
1897, erst 50 Jahre nach Gründung <strong>de</strong>r Berliner “Telegraphenbauanstalt”<br />
und bereits nach <strong>de</strong>m Tod Werner von Siemens’,<br />
wur<strong>de</strong> das Unternehmen unter Führung <strong>de</strong>r Deutschen<br />
Bank in eine AG umgewan<strong>de</strong>lt und an <strong>de</strong>r Börse eingeführt.<br />
Seit 1966 firmiert das Weltunternehmen nach Fusion mit <strong>de</strong>r<br />
Siemens-Schuckertwerke als Siemens AG. Aus jahrzehntelangen<br />
Kämpfen zwischen Siemens & Halske und <strong>de</strong>r A.E.G. unter<br />
Walter Rathenau um die Vorherrschaft auf ihren gemeinsamen<br />
Märkten ging Siemens schließlich als Sieger hervor -<br />
während die AEG letztlich völlig unterging - und ist heute neben<br />
Daimler-Benz <strong>de</strong>r größte <strong>de</strong>utsche Industriekonzern. Zu<br />
<strong>de</strong>n Pionierleistungen <strong>de</strong>r ersten Tage zählt die Verbesserung<br />
<strong>de</strong>s elektrischen Zeigertelegraphen, die Verlegung <strong>de</strong>r ersten<br />
großen unterirdischen Telegraphenleitung Berlin-Frankfurt a.M.<br />
(1848-1849), die Erfindung <strong>de</strong>s Doppel-T-Ankers (1856) und<br />
Dynamos (1866) sowie <strong>de</strong>r Bau <strong>de</strong>r ersten brauchbaren elektrischen<br />
Lokomotive (1879).<br />
Los 1037 Schätzwert 100-250 €<br />
Siemens & Halske AG<br />
Berlin-Siemensstadt, Sammel-VZ-Aktie<br />
100 x 1.000 RM April 1942 (Auflage<br />
1300, R 4) UNC<br />
1941 wur<strong>de</strong> das Kapital erst von 260 Mio. auf 140<br />
Mio. RM herab- und dann wie<strong>de</strong>r auf 400 Mio. RM<br />
heraufgesetzt. Die Aktienurkun<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n komplett<br />
neu gedruckt, für eine alte 700-RM-Aktie gab<br />
es zwei neue 1.000-RM-Aktien. Dekorativ, mit Vignetten<br />
<strong>de</strong>s ersten Zeigertelegraphen, <strong>de</strong>r ersten<br />
Dynamomaschine und Porträt Werner von Siemens<br />
(1816-1892).<br />
Geschichte siehe voriges Los. Bau <strong>de</strong>r ersten brauchbaren elektrischen<br />
Lokomotive (1879).<br />
Los 1038 Schätzwert 25-50 €<br />
Simonius’sche Cellulosefabriken AG<br />
Fockendorf (Thür.), Aktie 100 RM<br />
26.7.1928 (Auflage 1000, R 3) EF<br />
Gründung 1894 unter Übernahme <strong>de</strong>r KG A. Simonius & Co. in<br />
Wangen i.Allgäu. 1926 Sitzverlegung nach Fockendorf. 1935<br />
Umfirmierung in Papierfabrik Fockendorf AG. Auch Besitz <strong>de</strong>s<br />
Braunkohlenwerkes “Grube Augusta”, Pahna bei Fockendorf.<br />
Hergestellt wur<strong>de</strong>n Papier und Holzschliff. Großaktionär: Zellstofffabrik<br />
Waldhof, Mannheim. Börsennotiz Berlin. Betrieb<br />
nach 1946 VEB Zellstoff- und Papierfabrik Trebsen, BT Fokkendorf,<br />
1990 geschlossen.<br />
Los 1039 Schätzwert 25-50 €<br />
Sinalco-AG<br />
Detmold, Aktie 200 RM 1.9.1928 (Auflage<br />
1750, R 2) EF<br />
Dekorative Gestaltung.<br />
Gründung 1902, AG ab 1908 als Franz Hartmann Sinalco AG.<br />
Kontinuierlich verschaffte sich <strong>de</strong>r Hersteller von alkoholfreien<br />
Erfrischungsgetränken mit “Sinalco”, “Sinalco-Spezial” und “Sinalco-Cola”<br />
Weltgeltung. Der Schweizer Großaktionär Sibra-<br />
Holding in Fribourg band Sinalco 1982 mit einem Beherrschungs-<br />
und Gewinnabführungsvertrag, doch die Geschäfte<br />
blieben rückläufig. Schließlich lan<strong>de</strong>te die Marke “Sinalco” bei<br />
<strong>de</strong>r Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG, <strong>de</strong>r Aktienmantel<br />
wur<strong>de</strong> umgetauft 1998 in “DBAG Detmol<strong>de</strong>r Beteiligungs-AG”<br />
und 1999 in “SIBRA Beteiligungs-AG”. 2000 Sitzverlegung von<br />
Detmold nach Bonn zum Sitz <strong>de</strong>s heutigen Großaktionärs IVG,<br />
Firmenzweck ist heute Erwerb von Grundstücken, Immobilien,<br />
Technologie- und Infrastrukturprojekten.<br />
Los 1040 Schätzwert 300-375 €<br />
Sommerfel<strong>de</strong>r Ziegelwerke<br />
Freytag, Roll & Kreutz GmbH<br />
Sommerfeld, Geschäfts-Antheil 1.000<br />
Mark 2.7.1898 (R 9) UNC-<br />
Faksimile-Unterschriften Roll und Th. Freytag. Zuvor<br />
völlig unbekannt gewesen. Nur 7 Stück lagen<br />
im Reichsbankschatz.<br />
Die Stadt Sommerfeld in <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlausitz (heute Lubsko)<br />
wechselte über die Jahrhun<strong>de</strong>rte nicht weniger als sieben Mal<br />
<strong>de</strong>n Lan<strong>de</strong>sherrn zwischen <strong>de</strong>n Lausitzer, Bran<strong>de</strong>nburgischen,<br />
Schlesischen (Schweidnitz-Jauer), böhmischen, preußischen<br />
und zuletzt polnischen Herrschern. 1807 wur<strong>de</strong> Sommerfeld<br />
nach <strong>de</strong>r Städteordnung in Preußen unabhängig, 1815 <strong>de</strong>m<br />
bran<strong>de</strong>nburgischen Kreis Crossen eingeglie<strong>de</strong>rt, blieb aber<br />
stets die größte Stadt in diesem Kreis. Nach <strong>de</strong>r Eröffnung <strong>de</strong>r<br />
Eisenbahn Berlin-Breslau im Jahr 1846, wo Sommerfeld ziemlich<br />
genau auf <strong>de</strong>r Mitte <strong>de</strong>r Strecke lag, sie<strong>de</strong>lten sich in <strong>de</strong>r<br />
2. Hälfte <strong>de</strong>s 19. Jh. mehrere Textilbetriebe und Ziegwelwerke<br />
an, um vom “Grün<strong>de</strong>rboom” 1871/72 profitierte Sommerfeld in<br />
beson<strong>de</strong>rem Maße. Nach <strong>de</strong>m 2. Weltkrieg wur<strong>de</strong> in Lubsko<br />
vor allem die be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Textilindustrie wie<strong>de</strong>r in Gang gebracht.<br />
Mit <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> 1989 kamen dann alle größeren Betriebe<br />
<strong>de</strong>r Stadt zum Erliegen und die Arbeitslosigkeit stieg auf über<br />
40 %.<br />
Los 1041 Schätzwert 20-40 €<br />
Spamer AG<br />
Leipzig, Aktie 1.000 RM 25.1.1933<br />
(Auflage 1400, R 2) EF<br />
G&D-Druck.<br />
Gründung 1847. AG seit 1932. Übernahme und Ausführung aller<br />
Arbeiten <strong>de</strong>s graphischen Gewerbes, insbes. Fortführung<br />
<strong>de</strong>r Spamerschen Buchdruckerei u. <strong>de</strong>r Spamerschen Buchbin<strong>de</strong>rei<br />
in Leipzig. 1949 Verlagerung nach München. 1952 erfolgte<br />
die amtl. Löschung.<br />
Nr. 1044 Nr. 1049<br />
Los 1042 Schätzwert 30-50 €<br />
Sparer-Haus- und Wohnungsgenossenschaft<br />
Mag<strong>de</strong>burg eGmbH<br />
(Sparer-Schutzkasse)<br />
Mag<strong>de</strong>burg, 5 % Namens-<strong>Teil</strong>schuldv.<br />
100 RM 1.4.1941 (Auflage 460, R 7).<br />
Anleihe im Gesamtbetrag von 46.000 RM,<br />
hypothekarisch abgesichert auf <strong>de</strong>m<br />
Grundstück MD-Neustadt, Hohepfortestr.<br />
54/55 EF<br />
Die 1936 gegrün<strong>de</strong>te Wohnungsgenossenschaft besaß Wohnhäuser<br />
in Mag<strong>de</strong>burg (Otto-von-Guericke-Straße, Himmelreichstraße<br />
und Lüneburgerstraße), MD-Neustadt (Wittenbergerstraße<br />
und Hohepfortestraße), MD-Buckau (Schönebeckerstraße)<br />
und Burg bei Mag<strong>de</strong>burg (Clausewitzstraße). Sie finanzierte<br />
sich im wesentlichen durch auf <strong>de</strong>m Grundbesitz abgesicherte<br />
Anleihen, die bei Kleinsparern platziert wur<strong>de</strong>n. 1943<br />
durch Verschmelzung auf die Volksbank Mag<strong>de</strong>burg eGmbH übergegangen.<br />
Los 1043 Schätzwert 60-120 €<br />
Sparerschutzbank Thüringen eGmbH<br />
Weimar, Anteilschein 20 RM 28.11.1927<br />
(R 5) EF<br />
Kreisrun<strong>de</strong> Vignette mit geballter Faust.<br />
Los 1044 Schätzwert 200-250 €<br />
Speditions-Verein Mittelelbische<br />
Hafen- und Lagerhaus-AG<br />
Wallwitzhafen bei Dessau, Aktie 1.000<br />
Mark 8.9.1899. (Blankette <strong>de</strong>r<br />
Grün<strong>de</strong>raktie, R 8) UNC<br />
Als oHG Ziegler, Uhlmann & Co. bestand das Unternehmen<br />
schon seit 1859, AG dann seit 1899. Grün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Hafenplatzes<br />
an <strong>de</strong>r Elbe war die Berlin-Anhaltische Eisenbahngesellschaft,<br />
die 1854 <strong>de</strong>n Bau <strong>de</strong>r Bahnlinie Dessau-Bitterfeld beschlossen<br />
hatte und <strong>de</strong>n Betrieb <strong>de</strong>s Wallwitzhafens an Ziegler,<br />
Uhlmann verpachtete. Bei Bitterfeld und Mul<strong>de</strong>nstein arbeiteten<br />
damals schon 5 große Braunkohlegruben, die einen Gleisanschluß<br />
erhielten und über die neue Bahn (mit einem Anschlußgleis<br />
vom Bahnhof Dessau zur Elbe) nun ihre Kohle<br />
transportieren konnten. Ab 1865 arbeitete im Wallwitzhafen eine<br />
Kohlenrutsche, aus <strong>de</strong>r die Kohle von <strong>de</strong>n Waggons direkt in<br />
Schiffe gela<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n konnte. Schon 1862 war im Wallwitzhafen<br />
von Leipziger Kaufleuten als Konkurrenzunternehmen<br />
<strong>de</strong>r Speditions-Verein gegrün<strong>de</strong>t wor<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r Ziegler, Uhlmann<br />
bald überflügelte und schließlich 1899 im Wege <strong>de</strong>r Fusion in<br />
eine neu gegrün<strong>de</strong>te Aktiengesellschaft “schluckte”. 1921<br />
auch Übernahme <strong>de</strong>r Hallesche Speditionsverein AG zu Halle<br />
(Saale). 1938 Umfirmierung in “Speditions-Verein AG Dessau”.<br />
95
Im 2. Weltkrieg wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Wallwitzhafen zerstört und wur<strong>de</strong><br />
nach einer kurzen Blüte in <strong>de</strong>r Nachkriegszeit (die Wasserwege<br />
funktionierten, während Straßen und Eisenbahnen weitgehend<br />
lahmgelegt waren) Mitte <strong>de</strong>r 1950er Jahre stillgelegt.<br />
Los 1045 Schätzwert 100-125 €<br />
Speditions-Verein Mittelelbische<br />
Hafen- und Lagerhaus-AG<br />
Wallwitzhafen bei Dessau, 4,5 % Partial-<br />
Obl. 300 Mark 24.9.1899 (Blankette, R 9)<br />
EF<br />
Geschichte siehe voriges Los.<br />
Los 1046 Schätzwert 30-90 €<br />
Speditions-Verein AG<br />
Dessau, Aktie 1.000 RM Aug. 1939<br />
(Auflage 1425, R 5) EF<br />
Los 1047 Schätzwert 20-50 €<br />
Spiegelglas Union AG<br />
Fürth i. Bay., Aktie 1.000 RM Mai 1942<br />
(Auflage 1500, R 2) EF<br />
Gründung 1905 unter <strong>de</strong>r Fa. Bayer. Spiegel- u. Spiegelglasfabriken<br />
AG. Später Umfirmierung in Bayer. Spiegel- und Spiegelglasfabriken<br />
Ag vorm. W. Bechmann, vorm. Ed. Kupfer &<br />
Söhne. 1922 Umbenennung in Bayer. Spiegelglasfabriken<br />
Bechmann-Kupfer AG und 1938 in Bayer. Spiegelglasfabriken<br />
AG. 1942 wie oben. 1952 Än<strong>de</strong>rung in Unionglas AG.<br />
Los 1048 Schätzwert 25-50 €<br />
Spinnerei Atzenbach AG<br />
Schopfheim i. Wiesental (Ba<strong>de</strong>n), Aktie<br />
1.000 Mark 20.12.1922. Grün<strong>de</strong>raktie<br />
(Auflage 1000, zuletzt noch 780, R 4) EF<br />
Vor Umwandlung in eine AG 1922 bestand die Spinnerei bereits<br />
seit 1835. Im Jahr 1959 übernahmen die Spinnereien und<br />
Webereien ZELL-SCHÖNAU AG die Aktienmehrheit.<br />
96<br />
Wallwitzhafen<br />
Min<strong>de</strong>stgebot: 80 %<br />
vom unteren Schätzwert<br />
Nr. 1048<br />
Los 1049 Schätzwert 400-500 €<br />
Spinnerei und Weberei Pfersee<br />
Augsburg, Aktie 1.000 Mark 15.3.1922<br />
(Auflage 3000, R 9) VF<br />
Zuvor ganz unbekannt gewesener Jahrgang.<br />
Gründung 1881 als Spinnerei und Buntweberei Pfersee, ab<br />
1922 Spinnerei und Weberei Pfersee. Werke in Pfersee (Spinnerei<br />
und Weberei), Ay (2 Spinnereien, 1 Weberei), Gerlenhofen<br />
(Spinnerei), Zöschlingsweiler (Weberei) und Echenbrunn (Weberei).<br />
Gehörte zu <strong>de</strong>n be<strong>de</strong>utendsten Augsburger Textilbetrieben.<br />
1987 fusionierte die gemeinsame Großaktionärin (Bayerische<br />
Vereinsbank) die Ertragsperle Pfersee mit <strong>de</strong>r todkranken Muttergesellschaft<br />
Spinnerei Kolbermoor AG zur Pfersee-Kolbermoor<br />
AG (Zitat <strong>de</strong>s damaligen Vorstands: Wenn man einen<br />
Kranken und einen Gesun<strong>de</strong>n in ein Bett legt, gibt das nicht automatisch<br />
einen Gesun<strong>de</strong>n). Nach Verkauf <strong>de</strong>r Aktienmehrheit<br />
an <strong>de</strong>n Frankfurter Wisser-Dienstleistungskonzern wur<strong>de</strong> 1993<br />
die eigene Textilproduktion ganz eingestellt und die Pfersee-<br />
Kolbermoor AG zu einer Holding für Textil-, Dienstleistungs- und<br />
Immobilien-Aktivitäten. Die heutige Pfersee-Kolbermoor GmbH<br />
& Co. KG ist die Dachgesellschaft aller operativen Gesellschaften<br />
<strong>de</strong>s Wisser-Konzerns, <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n Hauptgeschäftsfel<strong>de</strong>rn Bewachung,<br />
Sicherheit, Gebäu<strong>de</strong>management, Flughafenabfertigung<br />
und Gartenbau heute über 40.000 Mitarbeiter hat.<br />
Los 1050 Schätzwert 20-75 €<br />
Spinnerei und Weberei Steinen AG<br />
Steinen (Ba<strong>de</strong>n), Aktie 100 RM 17.8.1932<br />
(Auflage 16000, R 3, kpl. Aktienneudruck<br />
nach Kapitalherabsetzung mit<br />
anschließen<strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>raufstockung) EF<br />
Das vormalige Markgräfler Bauerndorf Steinen wur<strong>de</strong> im 19.<br />
und 20. Jh. durch “Basler Herren” industrialisiert, so u.a. Oberst<br />
Geigy und Direktor Köchlin. Bereits 1836 entstand die<br />
Spinnerei und Weberei Steinen als die weitaus be<strong>de</strong>utendste<br />
Fabrik am Ort. 1886 wur<strong>de</strong> die Fabrik eine AG, wobei das Aktienkapital<br />
stets in Schweizer Besitz war (zuletzt bei <strong>de</strong>r<br />
Schoop, Reiff & Co. AG, Zürich). Mit in <strong>de</strong>r Spitze 50.000 Spin<strong>de</strong>ln<br />
in <strong>de</strong>r Spinnerei Steinen und 1.500 Webstühlen in <strong>de</strong>n<br />
bei<strong>de</strong>n Webereien Steinen und Maulburg wur<strong>de</strong>n Rohgewebe<br />
aus Baumwolle und Zellwolle sowie Gewirke aus Nylon und<br />
Perlon in rohweiß und bunt erzeugt. 1962/63 wur<strong>de</strong> nach starken<br />
Umsatzrückgängen über die Hälfte <strong>de</strong>r Kapazität stillgelegt,<br />
die Aktienmehrheit ging an die Merian & Co. GmbH, Höllstein<br />
(Ba<strong>de</strong>n). 1964 wur<strong>de</strong> die AG 1964 in eine GmbH umgewan<strong>de</strong>lt.<br />
Los 1051 Schätzwert 30-60 €<br />
Spinnstofffabrik Zehlendorf AG<br />
Berlin-Zehlendorf, Namensaktie 1.000<br />
RM Sept. 1941 (Auflage 3460, R 3) EF<br />
Gründung 1886 als “Fockendorfer Papierfabrik AG vorm. Drache<br />
& Co.” in Altenburg/Thür. 1899 Sitzverlegung nach Elberfeld<br />
als “Elberfel<strong>de</strong>r Papier-Fabrik-AG”. 1908 Sitzverlegung<br />
nach Zehlendorf. 1945 <strong>de</strong>montiert. Ab 1950 PERLON-Produktion.<br />
1960 Interessenvertrag mit <strong>de</strong>r Farbwerke Hoechst AG (in<br />
<strong>de</strong>n 90er Jahren dann in die Hoechst AG eingeglie<strong>de</strong>rt). 1998<br />
verkaufte die Hoechst AG ihre Polyesteraktivitäten an indonesische<br />
und amerikanische Konzerne.<br />
Los 1052 Schätzwert 60-120 €<br />
Spratt’s AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark 9.8.1917<br />
(Auflage 1200, R 3) EF<br />
Der britische Chemiker Spratt war <strong>de</strong>r erste, <strong>de</strong>r ab Mitte <strong>de</strong>s<br />
19. Jh. auf <strong>de</strong>r Grundlage ernährungswissenschaftlicher Erkenntnisse<br />
Tierfutter herstellte. Bereits 1862 grün<strong>de</strong>te er im<br />
Berliner Wedding eine erste Nie<strong>de</strong>rlassung. Zügige Expansion<br />
führte 1894 zur Neuerrichtung <strong>de</strong>r Fabrik in Rummelsburg<br />
(Hauptstr. 14-15). Umwandlung in eine AG nach <strong>de</strong>utschem<br />
Recht 1901 als Spratt’s Patent AG, wobei die Spratt’s Patent<br />
(Germany) Limited in London gegen Gewährung von Aktien das<br />
gesamte Vermögen ihrer Berliner Zweignie<strong>de</strong>rlassung einbrachte.<br />
Im 1. Weltkrieg wur<strong>de</strong> 1917 die britische Aktienmehrheit als<br />
Feindvermögen beschlagnahmt, das Aktienpaket ging an die<br />
“AG für chemische Produkte vorm. H. Schei<strong>de</strong>man<strong>de</strong>l”, gleichzeitig<br />
Umfirmierung in Spratt’s AG. Auch zu DDR-Zeiten produzierte<br />
<strong>de</strong>r Betrieb zunächst unter <strong>de</strong>m Namen Spratt weiter, ab<br />
1972 dann bis zur Schließung 1992 volkseigener Betrieb für<br />
Futtermittel, in <strong>de</strong>r Bevölkerung allgemein “Hun<strong>de</strong>kuchenfabrik”<br />
genannt. Nach <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> wur<strong>de</strong> 1992 von britischen Geschäftsleuten<br />
unter altem Namen die Spratt’s AG neu gegrün<strong>de</strong>t.<br />
Los 1053 Schätzwert 20-50 €<br />
Sta<strong>de</strong>r Le<strong>de</strong>rfabrik AG<br />
Sta<strong>de</strong>, Aktie 100 RM Mai 1931 (Auflage<br />
7000, R 2) EF<br />
1896 Gründung <strong>de</strong>s Unternehmens unter <strong>de</strong>r Fa. Nord<strong>de</strong>utsche<br />
Le<strong>de</strong>rfabrik GmbH. Bis 1906 Fabrikation von Sohlle<strong>de</strong>r, ab 1907<br />
Vachele<strong>de</strong>r. 1915 Umwandlung in eine AG. 1949 Gründung <strong>de</strong>r<br />
Frankfurter Nie<strong>de</strong>rlassung. 1955 Neubau eines eigenen Hauses<br />
in Köln. Verkaufsstellen in Berlin und Köln. 1960 Liquidation.<br />
Los 1054 Schätzwert 30-60 €<br />
Stadt Alzey<br />
Schuldv. 50 RM 1.10.1930 (R 7) EF-VF<br />
Alzey zählt zu <strong>de</strong>n Nibelungenstädten, da die Stadt im Nibelungenlied<br />
durch die Person Volker von Alzey erwähnt wird.<br />
Los 1055 Schätzwert 20-40 €<br />
Stadt Barmen<br />
Schuldv. 25 RM 20.8.1927 (R 4) EF<br />
Unverzinsliche Ablösungsanleihe. Mit anhängen<strong>de</strong>m<br />
Auslosungsschein.<br />
Los 1056 Schätzwert 75-100 €<br />
Stadt Bautzen<br />
11 % Schuldschein 5.000 Mark<br />
15.4.1923 (Auflage 12000, R 10) EF<br />
<strong>Teil</strong> einer Geldanleihe von 300 Mio. M, für <strong>de</strong>ren<br />
Verzinsung und Rückzahlung die Stadtgemein<strong>de</strong><br />
Bautzen mit ihrem gesamten Vermögen haftete.<br />
Nur 3 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Los 1057 Schätzwert 25-50 €<br />
Stadt Bingen<br />
Schuldv. 25 RM 1.7.1929 (R 5) EF<br />
Ablösungsanleihe, anh. Auslosungsschein. Schöner<br />
Sicherheitsdruck von J.G. König & Ebhardt,<br />
Hannover.<br />
Los 1058 Schätzwert 10-25 €<br />
Stadt Bochum<br />
8 % Schuldv. 1.000 RM 1.2.1929 (R 2)<br />
EF<br />
Goldanleihe.<br />
Los 1059 Schätzwert 50-100 €<br />
Stadt Büdingen<br />
Schuldv. Lit. B 25 RM 1.10.1931 (R 8) EF<br />
Ablösungsanleihe. Mit fast fotographischer Abb.<br />
einer historischen Ansicht <strong>de</strong>r Mühltorbrücke aus<br />
Büdingen.
Los 1060 Schätzwert 100-125 €<br />
Stadt Cassel<br />
10 % Schuldv. 50.000 Mark 1.4.1923 (R<br />
10) EF-VF<br />
Anleihe von 500 Mio. M zur Deckung von Kanalbaukosten.<br />
Schöner Druck mit Prunkwappen. Einzelstück<br />
aus <strong>de</strong>m Reichsbankschatz.<br />
Los 1061 Schätzwert 60-75 €<br />
Stadt Coblenz<br />
10 % Schuldv. 10.000 Mark April 1923<br />
(R 9) EF<br />
Schöner Druck mit Wappen im Unterdruck. Nur 8<br />
Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Los 1062 Schätzwert 30-60 €<br />
Stadt <strong>de</strong>r Volkserhebung Graz<br />
4 % Schuldv. Gruppe B 500 RM 1.7.1940<br />
(R 8) EF<br />
Ausgegeben zum Zweck <strong>de</strong>s Umtausches <strong>de</strong>r 6,5<br />
% Anleihe <strong>de</strong>r Stadt Graz von 1934.<br />
Los 1063 Schätzwert 200-250 €<br />
Stadt Dinkelsbühl<br />
8 % Schuldv. 100 Goldmark 15.4.1926<br />
(R 12) VF<br />
<strong>Teil</strong> einer mit Genehmigung <strong>de</strong>r Regierung von<br />
Mittelfranken aufgenommenen Mini-Anleihe von<br />
lediglich 150.000 Goldmark in Stücken zu 100<br />
und 500 GM. Ein Unikat aus <strong>de</strong>m Reichsbankschatz.<br />
Die damals kreisunmittelbare Stadt im heutigen mittelfränkischen<br />
Landkreis Ansbach ist ein be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r Tourismusort an<br />
<strong>de</strong>r Romantischen Straße.<br />
Los 1064 Schätzwert 10-25 €<br />
Stadt Duisburg<br />
8 % Schuldv. 500 RM 31.5.1928 (R 2)<br />
EF+<br />
Für Beschaffung <strong>de</strong>r Mittel für <strong>de</strong>n Ausbau <strong>de</strong>r<br />
Städtischen Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke,<br />
für <strong>de</strong>n neuen Friedhof, für <strong>de</strong>n Umbau <strong>de</strong>r Düsseldorf-Duisburger<br />
Kleinbahn, für das Wöchnerinnen-<br />
und Säuglingsheim, für Straßenbauten usw.<br />
ausgegeben. Stadtwappen im Unterdruck sowie in<br />
allen vier Ecken.<br />
Los 1065 Schätzwert 15-30 €<br />
Stadt Em<strong>de</strong>n<br />
6 % Schuldv. 500 RM = 179,21 Gramm<br />
Feingold 1.6.1926 (R 4) EF-VF<br />
<strong>Teil</strong> einer Goldanleihe, für die die Stadt mit <strong>de</strong>m<br />
gesamten Vermögen und ihrer Steuerkraft haftet.<br />
Großformatig mit Prunkwappen.<br />
Los 1066 Schätzwert 75-100 €<br />
Stadt Frankfurt a.M.<br />
4 % Schuldv. 2.000 Mark 1.9.1908 (R 9)<br />
EF<br />
Faksimile-Unterschrift OB Adickes. Anleihe von 20<br />
Mio. M (Abt. I) zur Erweiterung <strong>de</strong>r städtischen Elektrizitätswerke<br />
und Bahnbetriebe, zum Ausbau<br />
<strong>de</strong>s Osthafens, zur Verlegung <strong>de</strong>s Zollhofes und<br />
<strong>de</strong>s Hauptsteueramtsgebäu<strong>de</strong>s und zur Erweiterung<br />
<strong>de</strong>r Wasser-, Gas- und Kanalisationswerke.<br />
Nur 6 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Los 1067 Schätzwert 30-50 €<br />
Stadt Frankfurt a.M.<br />
8 % Schuldv. 5.000 Mark 1.2.1923 (R 6) EF<br />
<strong>Teil</strong> einer Anleihe in Höhe von 600 Mio. Mark für<br />
Erstellung von Kleinsiedlungsbauten sowie für<br />
Brücken und sonstige Bauten.<br />
Nr. 1067<br />
Los 1068 Schätzwert 125-200 €<br />
Stadt Frankfurt a.M.<br />
(City of Frankfort-on-Main)<br />
6,5 % Gold Bond 1.000 $ 1.5.1928<br />
(Auflage 6000, R 6) VF<br />
Schöner schwarz/grüner Druck mit allegorischer<br />
Vignette.<br />
Los 1069 Schätzwert 20-40 €<br />
Stadt Freiburg im Breisgau<br />
Schuldv. 50 RM 5.10.1927 (R 4) EF<br />
Mit anh. Auslosungsschein.<br />
Die Ursprünge <strong>de</strong>r Stadt reichen bis ins Jahr 1120 zurück, als<br />
Freiburg von <strong>de</strong>n Zähringer-Herzögen Berthold III und <strong>de</strong>ssen<br />
Bru<strong>de</strong>r und Nachfolger Konrad III als Marktstadt gegrün<strong>de</strong>t<br />
wur<strong>de</strong>. Die Stadt verdankte ihren Wohlstand <strong>de</strong>r günstigen Lage<br />
am Han<strong>de</strong>lsweg von Schwaben über <strong>de</strong>n Schwarzwald und<br />
das Elsass nach Burgund, <strong>de</strong>r eigenen Maß-, Zoll- und Münzhoheit,<br />
<strong>de</strong>m Silberbergbau und <strong>de</strong>r Granatschleiferei.<br />
Nr. 1070<br />
Los 1070 Schätzwert 50-100 €<br />
Stadt Friedberg<br />
Schuldv. 50 RM 30.10.1929 (R 7) EF<br />
Mit Abb. <strong>de</strong>s 600 Jahre alten Adolfsturmes in <strong>de</strong>r<br />
Frie<strong>de</strong>berger Burganlage, <strong>de</strong>m Wahrzeichen <strong>de</strong>r<br />
Stadt. Mit anh. Auslosungsschein.<br />
Los 1071 Schätzwert 200-250 €<br />
Stadt Gera (Reuß)<br />
11 % <strong>Teil</strong>schuldv. 5.000 Mark 31.3.1923<br />
(Auflage 8000, R 9) VF<br />
Als Sicherung <strong>de</strong>r Anleihe diente ein neues städtisches<br />
Gaswerk nebst Grundstück, Gebäu<strong>de</strong> und<br />
Maschinen. Die Anleihe wur<strong>de</strong> abgewickelt von<br />
<strong>de</strong>m Hofbankhaus Gebr. Goldschmidt in Gera. Einzelstück<br />
aus <strong>de</strong>m Reichsbankschatz. Rostfleck von<br />
Büroklammer.<br />
Los 1072 Schätzwert 100-125 €<br />
Stadt Görlitz<br />
10 % Schuldv. 50.000 Mark 1.6.1923 (R<br />
9) VF+<br />
Sehr <strong>de</strong>korative Art Deco-Umrandung in hellblau/dunkelblau,<br />
Wappen im Unterdruck. Nur 6<br />
Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Los 1073 Schätzwert 75-100 €<br />
Stadt Grünberg in Hessen<br />
Schuldv. 12,50 RM 1.9.1929 (R 8) VF<br />
Ablösungsanleihe, mit anh. Auslosungsschein. Mit<br />
schönem Wappen von Grünberg. Nur 13 Stück lagen<br />
im Reichsbankschatz. Rostflecke.<br />
97
Los 1074 Schätzwert 20-40 €<br />
Stadt Hagen (Westf.)<br />
8 % Schuldv. 500 RM 25.8.1928 (Auflage<br />
1000, R 4) EF<br />
Los 1075 Schätzwert 40-60 €<br />
Stadt Halberstadt<br />
10 % Schuldv. 10.000 Mark 3.2.1923 (R<br />
8) EF-VF<br />
<strong>Teil</strong> einer Anleihe von 70 Mio. Mark. Wappen im<br />
Prägesiegel.<br />
Los 1076 Schätzwert 100-125 €<br />
Stadt Hanau a.M.<br />
7 % Schuldv. 100 RM 21.12.1926 (R 9)<br />
EF<br />
Nur 8 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Los 1077 Schätzwert 40-60 €<br />
Stadt Königsberg i.Pr.<br />
8 % Schuldv. 5.000 RM 1.4.1929 (R 6) EF<br />
<strong>Teil</strong> einer Anleihe von insgesamt 9 Mio. RM, eingeteilt<br />
in Schuldverschreibungen zu 5.000, 1.000,<br />
500 und 100 RM.<br />
98<br />
Los 1078 Schätzwert 30-50 €<br />
Stadt Krefeld<br />
5 % <strong>Teil</strong>schuldv. 1.000 Fr. 20.9.1926<br />
(Auflage 3520, R 4) EF<br />
Börsennotiz Zürich und Basel.<br />
Krefeld erhielt 1361 Markt- und 1373 Stadtrecht und entwikkelte<br />
sich später zu einem Zentrum <strong>de</strong>r Textilindustrie am Nie<strong>de</strong>rrhein.<br />
Los 1079 Schätzwert 60-80 €<br />
Stadt Leipzig<br />
5 % Schuldschein 1.000 Mark 1.3.1918<br />
(Auflage 60000, R 9) EF-VF<br />
<strong>Teil</strong> einer Anleihe von 120 Mio. M “zur Deckung<br />
außeror<strong>de</strong>ntlicher Ausgaben aus Anlaß <strong>de</strong>s Krieges<br />
und zur Ausführung städtischer Bauten, insbeson<strong>de</strong>re<br />
<strong>de</strong>r Hochwasserregulierung”. Faksimile-Unterschrift<br />
Oberbürgermeister Dr. Karl Rothe.<br />
Nur 3 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Los 1080 Schätzwert 100-125 €<br />
Stadt Lichtenstein-Callnberg<br />
(Ziegeleianleihe)<br />
8-16 % Schuldschein 50.000 Mark<br />
1.5.1923 (Auflage 974, R 10) EF-VF<br />
Einzelstück aus <strong>de</strong>m Reichsbankschatz.<br />
Los 1081 Schätzwert 80-100 €<br />
Stadt Mag<strong>de</strong>burg<br />
4,5 % Schuldv. 1.000 Mark 1.4.1919<br />
(R 11) EF-VF<br />
Nur 2 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Los 1082 Schätzwert 40-50 €<br />
Stadt Mainz<br />
8 % Schuldv. 2.000 Goldmark 1.5.1926<br />
(Auflage 500, R 6) EF<br />
<strong>Teil</strong> einer Anleihe in Höhe von 3 Mio. Mark.<br />
Los 1083 Schätzwert 30-60 €<br />
Stadt Mannheim<br />
Schuldv. Lit. B 500 RM 1.12.1927 (R 7) EF<br />
Ablösungsanleihe, anhängen<strong>de</strong>r Auslosungsschein.<br />
Los 1084 Schätzwert 100-125 €<br />
Stadt Nordhausen<br />
10 % Schuldv. 10.000 Mark 15.2.1923<br />
(R 9) EF-VF<br />
<strong>Teil</strong> einer Anleihe von insgesamt 100 Mio. Mark.<br />
Los 1085 Schätzwert 30-60 €<br />
Stadt Parchim (Mecklb.)<br />
Schuldv. Lit. A 12,50 RM 20.11.1927<br />
(R 7) EF<br />
Ablösungsanleihe, anhängen<strong>de</strong>r Auslosungsschein.<br />
Von Fachwerkbauten geprägte Kreisstadt im Bezirk Schwerin,<br />
gelegen in hügeligem Moränengelän<strong>de</strong>, an <strong>de</strong>r El<strong>de</strong> mit ca.<br />
20.000 Einwohnern. Erhielt 1225/26 Stadtrecht.<br />
Los 1086 Schätzwert 20-40 €<br />
Stadt Pforzheim<br />
6 % Schuldv. Lit. D 200 RM 15.2.1927<br />
(Auflage 1800, R 4) EF<br />
Dekorativ gestaltet.<br />
Los 1087 Schätzwert 20-40 €<br />
Stadt Solingen<br />
8 % Schuldv. Lit. B 1.000 RM 1.10.1928<br />
(R 3) EF<br />
Los 1088 Schätzwert 30-60 €<br />
Stadt Worms<br />
Schuldv. 200 RM 21.9.1929 (R 6) EF<br />
Im Unterdruck und als Eckvignetten Wormser<br />
Wappen mit Drachen und <strong>de</strong>m Schlüssel <strong>de</strong>s Heiligen<br />
Petrus, <strong>de</strong>m Patron <strong>de</strong>s Wormser Domes. Mit<br />
anh. Auslosungsschein.<br />
Nr. 1081 Nr. 1085 Nr. 1089