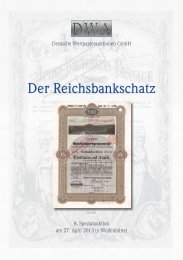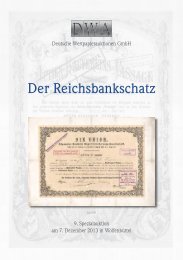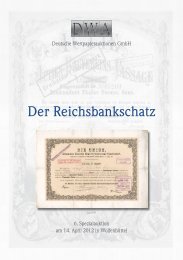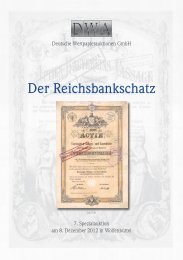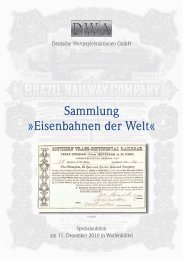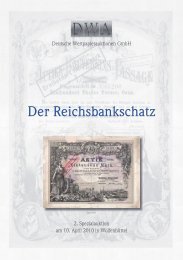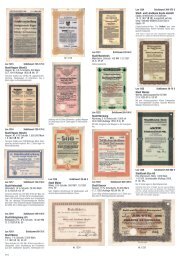Gewerkschaft Westfalen Gladbacher Rückvers.-AG Gladbacher ...
Gewerkschaft Westfalen Gladbacher Rückvers.-AG Gladbacher ...
Gewerkschaft Westfalen Gladbacher Rückvers.-AG Gladbacher ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
fündigen Tiefbohrungen kam der bis auf 600 m abgeteufte<br />
Schacht (untertägig durchschlägig mit Teutonia) 1917 mit 200<br />
Mann Belegschaft in Förderung, gefördert wurde zunächst nur<br />
Steinsalz. Die Kuxe wurden im Freiverkehr Essen-Düsseldorf<br />
und Hannover gehandelt. 1921 bot der Neu-Staßfurt-Konzern<br />
für 1 Wendland-Kux 5 junge Friedrichshall-Aktien und erreichte<br />
damit eine 3/4-Mehrheit. Bereits 1926 wurde die Förderung<br />
eingestellt, 1943 waren die Anlagen abgebrochen. Vor allem<br />
wegen Gorleben sind die Salzstöcke dieser Gegend aber bis<br />
heute bundesweit bekannt.<br />
Los 684 Schätzwert 75-150 €<br />
<strong>Gewerkschaft</strong> <strong>Westfalen</strong><br />
Ahlen, Kuxschein 1 Kux von 10.000<br />
23.6.1910 (R 4) EF<br />
Die Bergwerksgesellschaft <strong>Westfalen</strong> wurde am 15.6.1902 in<br />
Essen gegründet. 1911 Sitzverlegung nach Ahlen. Gerechtsame:<br />
31 preußische Maximalfelder in den Gemeinden Ahlen, Dolberg,<br />
Heeßen, Werries, Haaren, Neu-Ahlen, Beckum-Land,<br />
Beckum-Stadt, Gemmerich, Guissen und Neu-Beckum. Kohlenart<br />
war Fettkohle. Seit 1916 besaß die Bergwerksgesellschaft<br />
Georg von Giesche’s Erben in Breslau 80 % der Kuxe. 1927<br />
ging die Kuxenmehrheit auf die Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft,<br />
Dessau über. 1951 wurde die <strong>Gewerkschaft</strong> <strong>Westfalen</strong><br />
in die Steinkohlenbergwerk <strong>Westfalen</strong> <strong>AG</strong> umgewandelt.<br />
Los 685 Schätzwert 50-175 €<br />
<strong>Gladbacher</strong> <strong>Rückvers</strong>.-<strong>AG</strong><br />
M.-Gladbach, Namensaktie 1.500 Mark<br />
15.8.1877, gedruckt auf weißem Papier.<br />
Gründeraktie (Eintragungs-Certificat,<br />
Auflage 2000, R 5), zunächst mit 20 %<br />
eingezahlt, 1920/23 aus<br />
Gesellschaftsmitteln vollgezahlt, davon<br />
nur 1923 abgestempelt VF-<br />
Aparter Druck mit schöner Umrandung, Originalunterschriften.<br />
Die Gründeraktien gibt es sowohl<br />
auf blaugrauem wie auch auf weißem Papier. Der<br />
Grund dafür ist unbekannt, zumal der Unterschied<br />
quer durch alle Nummernkreise geht. Einschlägige<br />
blaugraue Randverfärbungen an einigen sonst<br />
weißen Aktien lassen vermuten, daß der Grund<br />
chemische Reaktionen im Papier waren. Weiterhin<br />
gibt es Unterschiede bei den Einzahlungsstempeln:<br />
Gar kein Stempel, nur von 1920, nur von<br />
1923 und beide Stempel 1920 + 1923 kommen<br />
vor, je nachdem wann und wie oft die Aktie der Gesellschaft<br />
zur Umschreibung vorlag.<br />
Gründung 1877. Großaktionär war die <strong>Gladbacher</strong> Feuerversicherungs-<strong>AG</strong><br />
(bei der auch die Aachener und Münchener Feuer<br />
engagiert war), beide Gesellschaften wurden in Personalunion<br />
geführt. 1970 auf die Colonia-Versicherung in Köln verschmolzen<br />
(heute AXA-Colonia).<br />
Los 686 Schätzwert 50-100 €<br />
<strong>Gladbacher</strong> Wollindustrie <strong>AG</strong><br />
vorm. L. Josten<br />
M.-Gladbach, Aktie 800 RM Dez. 1925<br />
durch Überdruck geändert in Jan. 1927<br />
(R 5) EF<br />
Gründung 1895 unter Übernahme der seit 1882 bestehenden<br />
Fa. L. Josten in M.Gladbach, Rudolfstraße (Werk I). Hergestellt<br />
wurden von wollene und halbwollene Stoffe für Herren-, Damen-<br />
und Knabenkleidung, Uniformtuche und Wolldecken.<br />
1925/26 Übernahme der <strong>Gladbacher</strong> Textilwerke <strong>AG</strong> vorm.<br />
Schneider & Irmen zu M.Gladbach, deren Betrieb in der Burkgrafenstraße<br />
als Werk II weitergeführt wurde. Nach dem Krieg<br />
wurde die Produktion schließlich im Werk I konzentriert und immer<br />
stärker auf textile Bodenbeläge ausgerichtet. Börsennotiz<br />
in Berlin und Düsseldorf, Großaktionäre waren Dr. Hugo Henkel,<br />
Düsseldorf (40%) und später auch das Kölner Bankhaus Sal.<br />
Oppenheim jr. & Cie. (25 %). Den Aufsichtsratsvorsitz führte<br />
jahrzehntelang der später als “Bankier Adenauers” bekannt gewordene<br />
Kölner Bankier Dr. Robert Pferdmenges. 1970 in eine<br />
GmbH umgewandelt.<br />
Los 687 Schätzwert 20-60 €<br />
<strong>Gladbacher</strong> Wollindustrie <strong>AG</strong><br />
vorm. L. Josten<br />
M.-Gladbach, Aktie 100 RM April 1930<br />
(Auflage 3400, R 3) EF<br />
Mit Faksimile-Unterschrift Rob. Pferdmenges als<br />
AR-Vorsitzender.<br />
Los 688 Schätzwert 30-75 €<br />
Glasfabrik <strong>AG</strong><br />
Brockwitz, Bez. Dresden, Aktie 100 RM<br />
9.2.1933 (Auflage 1500, R 3, kpl.<br />
Aktienneudruck nach Kapitalschnitt) EF+<br />
Gründung 1903. Herstellung von Preßglas, Hohlglas und<br />
Schleifglasartikel. 1922 Erwerb der Abt. Glas der Steingutfabrik<br />
Ag Sörnewitz, 1923 Inbetriebnahme des Werkes Ottendorf-<br />
Okrilla (1929 bereits wieder stillgelegt). 1932 ein spätes Opfer<br />
der Weltwirtschaftskrise: Der Betrieb wurde zahlungsunfähig<br />
und lag fast ein Jahr lang still, anschließend Kapitalzusammenlegung<br />
16:1. Bei der anschließenden erfolgreichen Sanierung<br />
wandelten die Gläubiger (u.a. ADCA und Commerzbank)<br />
ihre Forderungen in Aktien um, die General Mortgage & Credits<br />
Corp. Inc. aus New York, die der <strong>AG</strong> 1929 einen Dollar-Kredit<br />
verschafft hatte, wurde Großaktionär der in Berlin und (bis<br />
1933) Dresden börsennotierten <strong>AG</strong>. Im 2. Weltkrieg Rüstungsproduktion,<br />
1945 demontiert. Nach langjährigem Aufbau Neuformierung<br />
1957 als Institut für Glastechnik Coswig, später<br />
aufgeteilt in VEB Glaswerk Coswig und VEB Glasmaschinen<br />
Coswig. Nach der Wende dieGlamaco Maschinenbau GmbH,<br />
jetzt zu 100% in Schweizer Besitz.<br />
Los 689 Schätzwert 30-75 €<br />
Glasfabrik Alexanderhütte<br />
vorm. J. N. Heinz & Sohn <strong>AG</strong><br />
Alexanderhütte (Oberfranken), Aktie 1.000<br />
Mark 12.6.1923 (Auflage 6800, R 5) EF-<br />
Gründung 1921 zum Fortbetrieb der unter der früheren Firma<br />
J.N. Heinz & Sohn in Alexanderhütte bestandenen Glasfabrik,<br />
Anfertigung von Glaswaren aller Art. 1925 Konkurs.<br />
Los 690 Schätzwert 100-150 €<br />
Glashütte<br />
vormals Gebrüder Siegwart & Cie.<br />
Stolberg bei Aachen, Aktie 1.000 Mark<br />
1.8.1922 (Auflage 2000, R 8) EF<br />
1790 gründete ein Konsortium aus fünf Stolberger Kupfermeistern<br />
eine Glashütte, die zwei Jahre später von den Gebrüdern<br />
Siegwart übernommen wurde, einer ursprünglich aus dem<br />
Schwarzwald stammenden Glasmacher-Dynastie. 1872 in eine<br />
<strong>AG</strong> umgewandelt. Hergestellt wurden Hohl-, Tafel-, Matt-,<br />
Mousselin-, Ornament-, Kathedral- und Drahtglas sowie Säureflaschen.<br />
Die verlustbringende Hohlglasfabriktaion wurde<br />
1909 eingestellt und die Hohlglashütte an die Glashüttenwerk<br />
Union GmbH verkauft. Börsennotiert in Köln. 1928 in Liquidation<br />
gegangen, die Fabrikgebäude mit allen Anlagen wurden<br />
1930 an eine holländische Firma auf Abbruch verkauft.<br />
Los 691 Schätzwert 75-125 €<br />
Glashüttenwerke Holzminden <strong>AG</strong><br />
Holzminden / Weser, Aktie 100 RM<br />
2.1.1941 (Auflage 150, R 6) EF<br />
Gründung 1904 als Biervertrieb vereinigter Brauereien <strong>AG</strong> mit<br />
Sitz in Dresden, die aus der Glashüttenwerke Holzminden<br />
GmbH hervorgegangen ist. 1921 Umbenennung in Glashüttenwerke<br />
Holzminden <strong>AG</strong> und Sitzverlegung dorthin. 1923 Abschluß<br />
einer Interessengemeinschaft mit Unternehmen in<br />
Niederländisch-Indien, wo die Ges. selbst eine Glashütte errichtete.<br />
1959 in eine GmbH & Co. umgewandelt.<br />
Los 692 Schätzwert 30-75 €<br />
Glückauf <strong>AG</strong> für<br />
Braunkohlenverwertung<br />
Lichtenau, Aktie 100 RM Juni 1937<br />
(Auflage 750, R 4) UNC-EF<br />
Gründung 1871, Sitz bis 1913 in Berlin. Bis 1936 waren alle<br />
Schachtanlagen erschöpft; der Abbau auf der neu aufgeschlossenen<br />
Glückaufschachtanlage wurde durch Wassereinbrüche<br />
sehr erschwert, so daß die Gesellschaft 1937 saniert<br />
werden mußte. In diesem Zusammenhang wurden die Aktien<br />
neu ausgedruckt. Börsennotiz Berlin.<br />
Los 693 Schätzwert 75-150 €<br />
Göltzschtalbank <strong>AG</strong><br />
Auerbach (Vogtl.), Aktie 1.000 RM Juli<br />
1933 (Auflage nur 60 Stück, R 6) EF<br />
Gründung 1925 als Auerbacher Stadtbank, ab 1927: Göltzschtalbank<br />
<strong>AG</strong>. Betrieb von Bankgeschäften jeder Art. Die Führung<br />
der Konten der Gesellschaft besorgte aufgrund eines Vertrages<br />
die Girozentrale Sachsen, Zweiganstalt Auerbach. 1935 erfolgte<br />
die Überleitung der Geschäfte der Niederlassung Auerbach<br />
i.Vogt. der Landesbank Westsachsen <strong>AG</strong> auf die mit der Gesellschaft<br />
im Vertragsverhältnis stehende Girozentrale Sachsen<br />
-öffentliche Bankanstalt- Zweiganstalt Auerbach.<br />
Los 694 Schätzwert 50-125 €<br />
Gontard & Henny <strong>AG</strong><br />
Leipzig, Aktie 1.000 Mark 30.1.1922<br />
(Auflage 750, R 5) EF<br />
Gründung 1915. Herstellung und Vertrieb von Seife und anderen<br />
chemischen und technischen Erzeugnissen, insbesondere<br />
die Übernahme und Fortführung der bisher unter der Firma<br />
Gontard & Henny in Leipzig-Plagwitz betriebenen Seifenfabrik.<br />
Los 695 Schätzwert 20-50 €<br />
Gorkauer Societäts-Brauerei <strong>AG</strong><br />
Gorkau Kr. Schweidnitz, Aktie 1.000 Mark<br />
25.10.1921 (Auflage 3000, R 4) EF<br />
Großformatiges Papier, sehr dekorativ gestaltet.<br />
Gründung 1858 als KGaA, <strong>AG</strong> ab 1886. Brauerei, Mälzerei und<br />
Limonadenfabrik. Hinzuerworben wurde die Genossenschaftsbrauerei<br />
Croischwitz (1920), das Waldenburger Brauhaus, die<br />
Stadtbrauerei Neurode und die Kastnersche Lagerbierbrauerei<br />
Habelschwerdt (1921) sowie das Braurecht des Frankensteiner<br />
Brauhauses (1922). Braustätten dann in Gorkau, Waldenburg<br />
und Neurode, Bierniederlagen in ganz Schlesien. Börsennotiz<br />
Breslau und Leipzig, Großaktionär war die Bank für Brauindustrie,<br />
Berlin-Dresden (heute Oetker-Konzern). Die Betriebe lagen<br />
nach 1945 auf polnischem Gebiet, die <strong>AG</strong> wurde im Westen<br />
abgewickelt und 1971 aufgelöst.<br />
Los 696 Schätzwert 175-300 €<br />
Gottfried Lindner <strong>AG</strong><br />
Ammendorf b. Halle a.S., Aktie 1.000<br />
Mark 15.6.1922 (Auflage 8000, R 7) EF<br />
Großes Hochformat, breite Umrahmung. “Ungültig”<br />
perforiert. Schon beim Aktienneudruck 1930<br />
aus dem Verkehr gezogen worden. Dieses Belegexemplar<br />
aus dem Firmenarchiv landete erst später<br />
(Abgabepflicht für alle Wertpapiere in der DDR)<br />
durch Zufall ebenfalls im Reichsbankschatz. Alle<br />
Lindner-Emissionen vor 1930 waren bislang völlig<br />
unbekannt!<br />
Gründung 1823, <strong>AG</strong> seit 1905. Erzeugnisse: Waggons, Straßenbahnwagen,<br />
Omnibusaufbauten, Lastanhänger, Flachsraufmaschinen.<br />
Werke in Ammendorf, Berlin, Dresden, Gaggenau,<br />
Köln, Königsberg, Hamburg und Nürnberg. Der Karosseriebau<br />
wurde 1928 an die Ambi-Budd-Presswerke in Berlin verkauft.<br />
1949 teilte sich die Geschichte: In Nürnberg wurde der zweite<br />
Hauptsitz angemeldet, die Werke Nürnberg, Gaggenau (Baden),<br />
Berlin-Tempelhof und Köln gingen wieder in Betrieb. 1952 Abschluß<br />
eines Pacht- und Lizenzvertrages mit der Waggonfabrik<br />
<strong>AG</strong> in Rastatt, dessen Kündigung 1956 wegen nicht ausreichender<br />
Rentabiliät der Anfang vom Ende war: 1965 kam im<br />
Westen der Konkurs. Das Werk Ammendorf wurde 1949 entschädigungslos<br />
von einer sowjetischen Aktiengesellschaft in<br />
Besitz genommen. Nach der Wende gehörte es zuletzt zur Daimler-Tochter<br />
Adtranz, die dann von Bombardier übernommen<br />
wurde. 2004 kam trotz erbitterter Gegenwehr von Belegschaft<br />
und Landesregierung das Aus auch für das traditionsreiche<br />
Ammendorfer Werk.<br />
59
Los 697 Schätzwert 600-750 €<br />
Gottfried Lindner <strong>AG</strong><br />
Ammendorf b. Halle a.S., Aktie 5.000 Mark<br />
14.4.1923 (Auflage 2000, R 12) VF+<br />
Großes Hochformat, breite Umrahmung. “Ungültig”<br />
perforiert. Schon beim Aktienneudruck 1930<br />
aus dem Verkehr gezogen worden. Dieses Belegexemplar<br />
aus dem Firmenarchiv landete erst später<br />
(Abgabepflicht für alle Wertpapiere in der DDR)<br />
durch Zufall ebenfalls im Reichsbankschatz. Alle<br />
Lindner-Emissionen vor 1930 waren bislang völlig<br />
unbekannt! Dieser Jahrgang ist ein Unikat aus<br />
dem Reichsbankschatz!<br />
Los 698 Schätzwert 800-1000 €<br />
Gottschalk & Co. <strong>AG</strong><br />
Kassel, Aktie 1.000 Mark 5.7.1905.<br />
Gründeraktie (Auflage 1500, R 10) VF<br />
Aktien dieser bedeutenden Textilfirma waren zuvor<br />
völlig unbekannt gewesen. Von der Gründeraktie<br />
wurden nur 3 Stück im Reichsbankschatz gefunden,<br />
dies ist jetzt das allerletzte noch verfügbare.<br />
Moritz Gottschalk und Johannes Coenning gründeten 1881 die<br />
Segeltuch und Schwerweberei Gottschalk. 1884 kauften sie<br />
das Gelände der Casseler Eisengießerei, die sich im damaligen<br />
Seilerweg, der späteren Schlachthofstr., befand. Ein Jahr später<br />
wurden hier Garne, Stoffe, Zelte, wasserdichte Wagendekken<br />
usw. produziert. 1905 Umwandlung in eine <strong>AG</strong> und Kauf<br />
der Weberei Dieterich und Lebon in Eschenstruth, die bis 1959<br />
eine Filiale blieb. 1938 hatten die Nationalsozialisten die Gottschalk<br />
& Co. <strong>AG</strong> enteignet (Moritz Gottschalk war Jude) und<br />
60<br />
Nr. 697 Nr. 714<br />
Nr. 698<br />
“arisiert”. Das Unternehmen wurde mit den Textilwerken Baumann<br />
& Lederer zusammengefasst, die Mehrheit an den neuen<br />
Unternehmen, der Hansa-Schwerweberei, hielt die Kasseler<br />
Industriellenfamilie Henschel. Gottschalk starb 1943 in Berlin.<br />
Seit 1965 ist die Straße in der Kasseler Nordstadt, in der sich<br />
seine Fabrik befand, nach ihm benannt. Gottschalks Enkelin<br />
Leni Frenzel, die nach Kriegsende aus dem Exil zurückkehrte,<br />
erhielt das Unternehmen zurück und baute die Fabrik ab Sommer<br />
1945 neu auf. An drei Standorten in Kassel, Gensungen<br />
und Zierenberg waren 1970 rund 600 Mitarbeiter beschäftigt,<br />
die Segeltuche, kunststoffbeschichtete Gewebe, Markisenstoffe,<br />
Zelte, Planen und Gartenschirme herstellten. 1990 kaufte<br />
die Fuldaer Mehler <strong>AG</strong> die Mehrheit. 1996 gingen zwei Bereiche<br />
der Weberei an das schwedische Unternehmen Borgstena<br />
AB. Ende der 90er Jahre lief die Produktion nach und nach<br />
aus. 2002 kaufte das Land Hessen das Gelände mit Blick auf<br />
die Erweiterung der benachbarten Universität. Während der do-<br />
Ai Wei posiert 2007 in Kassel in der ehemaligen<br />
Gottschalk-Zwirnerei vor Schlafnischen für seine<br />
Documenta-Aktion „Fairytale“<br />
cumenta 12 im Jahr 2007 rückte der chinesische Künstler Ai<br />
Weiwei die Gottschalk-Fabrik auf ungewöhnliche Weise ins<br />
Blickfeld. Er holte 1000 seiner Landsleute nach Kassel, die gemeinsam<br />
das Kunstwerk “Fairytale” (Märchen) schufen. Untergebracht<br />
waren sie in der ehemaligen Gottschalk-Zwirnerei.<br />
Los 699 Schätzwert 225-300 €<br />
Gottschalk & Co. <strong>AG</strong><br />
Kassel, Aktie 1.000 Mark 28.6.1920<br />
(Auflage 1000, R 9) EF-VF<br />
Nennwert 1932 auf 300 RM herabgesetzt.<br />
Los 700 Schätzwert 75-150 €<br />
Graphitwerk Kropfmühl <strong>AG</strong><br />
München, Aktie 100 RM 11.7.1929<br />
(Auflage 1800, R 5) EF<br />
Gegründet 1870, <strong>AG</strong> seit 1916. Die Gesellschaft betreibt das<br />
einzige Bergwerk für makrokristallinen Graphit in der Europäischen<br />
Union. Außerdem Beteiligungen an Graphitbergwerken<br />
in China, Sri Lanka und Zimbabwe. Heute noch international tätiger,<br />
börsennotierter Graphit-Spezialist.<br />
Los 701 Schätzwert 75-150 €<br />
Graphitwerk Kropfmühl <strong>AG</strong><br />
München, Aktie 1.000 RM 11.7.1929<br />
(Auflage 300, R 6) EF<br />
Identische Gestaltung wie voriges Los.<br />
Los 702 Schätzwert 50-125 €<br />
Grevener Baumwoll-Spinnerei <strong>AG</strong><br />
Greven i.W., Aktie 1.000 Mark<br />
15.10.1920 (Auflage 1000, R 4) EF<br />
Bereits 1855 wurde das Unternehmen gegründet, 1899/1900<br />
Umwandlung in eine <strong>AG</strong>. Erzeugt wurden in der Dreicylinderspinnerei<br />
in Greven Rohgarne, Effektgarne und Zwirne in allen<br />
Variationen aus Baumwolle, Zellwolle und Synthetiks. Zudem<br />
wurde in Coesfeld (Westf.) als Zweigbetrieb eine Baumwollbuntweberei<br />
übernommen. In der letzten großen Textilkrise En-<br />
de der 1980er Jahre schloß auch dieser Traditionsbetrieb. Die<br />
Vermögenswerte wurden abgewickelt, 1999 dann Verkauf des<br />
<strong>AG</strong>-Mantels. Heute die GBS Asset Management <strong>AG</strong>. Seit Juli<br />
2008 wieder börsennotiert.<br />
Los 703 Schätzwert 100-175 €<br />
Grosse Leipziger Strassenbahn<br />
Leipzig, Actie 1.000 Mark 10.11.1898<br />
(Auflage 2000, R 5) EF-VF<br />
Großformatiges Papier, dekorativ mit funkensprühendem<br />
geflügelten Rad.<br />
Gründung 1895. Später wurden übernommen: 1896 die Leipziger<br />
Pferde-Eisenbahn-<strong>AG</strong> (gegr. 1872), 1916 die Leipziger<br />
Elektrische Straßenbahn und die Leipziger Allg. Kraft-Omnibus-<br />
Gesellschaft. 1920 ging der Betrieb in Eigenregie der Stadt<br />
Leipzig über, die Aktionäre erhielten eine Abfindung teils in bar,<br />
teils in Leipziger Stadtanleihen.<br />
Los 704 Schätzwert 100-175 €<br />
Große Mühle Oels <strong>AG</strong><br />
Oels i. Schles., Namensaktie 1.000 RM<br />
Febr. 1931 (Auflage 200, R 7) EF<br />
Ausgestellt auf Rittergutsbes. Hugo und Klaus von<br />
Poser, Groß Naedlitz, aus einem alten schlesischen<br />
Adelsgeschlecht.<br />
Gründung 1922 in Breslau unter der Firma Bielschowsky-Weigert-Werke<br />
<strong>AG</strong>. 1930 Fusion mit der Landwirtschaftlichen Produkten-<br />
und Mühlenbetriebs-GmbH und Umbenennung in Große<br />
Mühle Oels <strong>AG</strong>.<br />
Los 705 Schätzwert 20-50 €<br />
Großenhainer Webstuhl-<br />
und Maschinen-Fabrik <strong>AG</strong><br />
Großenhain, Aktie 1.000 RM März 1928<br />
(Auflage 1200, R 3) EF<br />
Gründung 1852 durch Anton Zschille, seit 1872 <strong>AG</strong>. Herstellung<br />
und Vertrieb von Textilmaschinen, insbes. Webstühlen.<br />
1888 Übernahme des Konkurrenzbetriebes May & Kühling in<br />
Chemnitz, welcher 1899 stillgelegt wurde. Börsennotiz Berlin<br />
und Leipzig, zuvor auch Chemnitz und Dresden. Die Firma wurde<br />
nach dem Krieg nicht verlagert.
Los 706 Schätzwert 50-100 €<br />
Großkraftwerk Franken <strong>AG</strong><br />
Nürnberg, Aktie 1.000 RM Mai 1942<br />
(Auflage 10704, R 5) UNC-EF<br />
Gründung 1911 durch die Stadtgemeinden Nürnberg und Fürth<br />
sowie die Elektrizitäts-<strong>AG</strong> vorm. Schuckert & Co. 1913 Inbetriebsetzung<br />
des Dampfkraftwerks Gebersdorf. 1920-22 Ausbau<br />
einer Regnitzwasserkraft in Hausen bei Forchheim (Ofr.).<br />
Ab 1922 enge Zusammenarbeit mit der Rhein-Main-Donau <strong>AG</strong><br />
(u.a. gemeinsame Betriebsführung der RMD-Wasserkraftwerke<br />
Kachlet und Viereth). 1958 Inbetriebnahme des Pumpspeicherwerks<br />
Happurg. 1967 Fertigstellung des Kraftwerks Franken II<br />
in Kriegenbrunn. Stromlieferungen ausschließlich an Weiterverteiler<br />
(u.a. Energie- und Wasserversorgung <strong>AG</strong> sowie Verkehrs-<br />
<strong>AG</strong> Nürnberg und die Stadtwerke Fürth) und industrielle Großkunden.<br />
Mehrheitsaktionär war lange Zeit die Stadt Nürnberg.<br />
2001 in der E.ON Bayern <strong>AG</strong> aufgegangen.<br />
Los 707 Schätzwert 20-50 €<br />
Grosskraftwerk Mannheim <strong>AG</strong><br />
Mannheim, 5 % Teilschuldv. 500 RM<br />
1.4.1940 (Auflage 3000, R 4) EF<br />
Gründung 1921 durch die Stadt Mannheim, die Pfalzwerke,<br />
das Badenwerk, die Neckar-<strong>AG</strong> und die Rhein-Haardt-Bahngesellschaft.<br />
Betrieb eines Großkraftwerks und Abgabe des<br />
Stroms an die Großaktionäre zu Selbstkosten. Seit 1954 mit Inbetriebnahme<br />
des Werk II 600 m stromabwärts vom Stammwerk<br />
auch Stromlieferungen an die Deutsche Bundesbahn.<br />
Weitere Heizkraftwerksblöcke wurden in den 70er und 80er<br />
Jahren in Betrieb genommen. Seit 2002 ist die RWE Power <strong>AG</strong><br />
neuer Großaktionär.<br />
Los 708 Schätzwert 10-40 €<br />
Grün & Bilfinger <strong>AG</strong><br />
Mannheim, Aktie 1.000 RM Aug. 1941<br />
(Auflage 8000, R 1) UNC-EF<br />
Gründung 1880, seit 1906 <strong>AG</strong>. Die “Grünfinger” (so der prägnante<br />
Börsenname) übernahmen 1971 eine Mehrheitsbeteiligung<br />
an der Julius Berger-Bauboag <strong>AG</strong>, Wiesbaden (früher<br />
Berlin), 1975 dann zur Bilfinger + Berger Bau <strong>AG</strong> verschmolzen.<br />
Bis heute eine der drei großen börsennotierten Baufirmen.<br />
Los 709 Schätzwert 300-375 €<br />
Grüner-Bräu <strong>AG</strong><br />
Fürth, Aktie 200 RM 14.12.1936 (Auflage<br />
2250, R 9) UNC<br />
Zuvor völlig unbekannt gewesene Emission.<br />
Gründung 1863, <strong>AG</strong> ab 1896 als Aktienbrauerei Fürth vorm.<br />
Gebr. Grüner, ab 1926 Grüner-Bräu-<strong>AG</strong>. 1936 Übernahme der<br />
<strong>AG</strong> Brauerei Zirndorf bei Nürnberg, 1939/40 der Nürnberger<br />
Eisfabriken Hans Fürsattel. 1969 erwarb die Schickedanz-<br />
Gruppe 25% der Aktienanteile, 1972 wurde die Brauerei in die<br />
Patrizier-Bräu integriert. 1977 Einstellung der Produktion.<br />
1996 in die Tucher Bräu KG eingebracht, jetzt INKA-<strong>AG</strong> für Beteiligungen<br />
(Inselkammer-Gruppe).<br />
Nr. 709<br />
Los 710 Schätzwert 100-150 €<br />
Grünsteinwerke Rentzschmühle <strong>AG</strong><br />
Rentzschmühle, Aktie 100 RM 1.5.1941<br />
(Auflage 112, R 7) VF<br />
Nur 2 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1912 zur Übernahme des 1906 eröffneten Steinbruchbetriebs<br />
von Ing. Oskar Teuschler bei Greiz im Vogtland (3,5<br />
km südlich von Elsterberg) mit eigenem Bahnanschluß an die<br />
“untere Bahn” zwischen Plauen und Greiz. “Grünstein” oder<br />
“Grünporphyr” war die früher übliche Bezeichnung für grüngefärbte<br />
Eruptivgesteine wie Diabas und Diorit aus den selurischdevonischen<br />
Sedimentärschichten. Spezialität des Steinbruchs<br />
waren Rentzschmühler Grünsteine für Haussockel, Brücken und<br />
Ehrenmale (verwendet u.a. beim Bau des Zwickauer Bahnhofs<br />
und der Elstertalbrücke), vor allem aber wurde Schotter für Eisenbahnbauten<br />
im Raum Zwickau und Gera geliefert. Mit 14 Beschäftigten<br />
nahm die Firma ohne jede Ausrüstung nach dem 2.<br />
Weltkrieg den Betrieb wieder auf, wurde 1946 in Volkseigentum<br />
überführt (VEB Grünsteinwerke Rentzschmühle). 1963 Betriebsstilllegung<br />
wegen völlig ungenügender technischer Ausstattung,<br />
1964-67 Neubau einer vollmechanisierten Splitt- und Schotteranlage.<br />
1974 an den VEB Zuschlagstoffe und Natursteine Gera<br />
angegliedert. Nach der Wende übernahm 1990 die Neusser Firma<br />
Werhahn & Nauen (Basalt-Actien-Gesellschaft Linz) den<br />
Steinbruchbetrieb, der heute als einer von vier Produktionsstandorten<br />
zur “Hartsteinwerke Bayern/Thüringen” gehört.<br />
Los 711 Schätzwert 20-40 €<br />
Grund-Bank <strong>AG</strong><br />
Leipzig, Aktie 100 RM April 1936 (Auflage<br />
1000, R 2) EF<br />
Gründung 1931, nur wenige Jahre später wieder liquidiert.<br />
Los 712 Schätzwert 50-100 €<br />
Grundstücks-<strong>AG</strong> am Potsdamer Platz<br />
(Haus Vaterland)<br />
Berlin, Aktie 1.000 RM April 1940<br />
(Auflage 2000, R 5) EF<br />
Gründung 1909, bis 1911 Baugesellschaft am Potsdamer Platz, bis<br />
1937 Bank für Grundbesitz und Handel <strong>AG</strong>. Verwaltung der der Gesellschaft<br />
gehörenden Grundstücke (Vaterland-Gebäude), in dem<br />
u.a. die Universum-Film <strong>AG</strong> mit den „Kammerlichtspielen“ Mieter<br />
waren. Nach dem Krieg ein nutzloses Ruinengrundstück direkt an<br />
der Mauer, wurde nach der Wende das Areal mitten auf dem Pots-<br />
damer Platz Gegenstand heißester Spekulationen - schließlich kam<br />
es in den Besitz des inzwischen in Konkurs gegangenen Bauträgers<br />
Roland Ernst, der zur Erlangung des Grundstücks damals für die<br />
Haus-Vaterland-Aktien über 48.000 DM pro Stück zahlte.<br />
Los 713 Schätzwert 30-75 €<br />
Grundwert <strong>AG</strong><br />
Hamburg, Aktie 1.000 RM 11.5.1928<br />
(Auflage 1100, R 4) EF<br />
Gegründet 1927 durch die Dresdner Bank (bis 1972 mit knapp 95<br />
% Großaktionär) zwecks Erbauung grosser Lichtspieltheater und<br />
Geschäftshäuser. Die Gesellschaft errichtete und betrieb die größten<br />
Filmtheater in Hamburg, München, Ludwigshafen, Nürnberg<br />
und Dresden. Als letztes Bauprojekt wurde 1930 auf einem 1928<br />
erworbenen Grundstück in der Hamburger Dammtorstraße das bekannte<br />
“Deutschlandhaus” errichtet. 1944/45 Zerstörung sämtlicher<br />
Filmtheater bei Luftangriffen, der verbliebene Grundbesitz in<br />
Hamburg wurde durch die britische Militärregierung beschlagnahmt.<br />
1947/48 Einbau eines Behelfstheaters im erhalten gebliebenen<br />
Foyer des Filmtheaters in Nürnberg und erneuter Ausbau<br />
des großen Konzertkaffees im “Pfalzbau” in Ludwigshafen,<br />
1949/50 Umbau des Vordergebäudes des großen Lichtspieltheaters<br />
in München (Sonnenstr. 8) zu Bürozwecken. Der Grundbesitz in<br />
München wurde 1956 und der “Pfalzbau” in Ludwigshafen 1961 (<br />
an die Stadt Ludwigshafen) verkauft. Der verbleibende Grundbesitz<br />
in Nürnberg sowie das “Deutschlandhaus” in Hamburg, Drehbahn<br />
1 III gingen 1972 auf den Großaktionär Dresdner Bank <strong>AG</strong> über, auf<br />
den die Ges. am 31.10.1972 verschmolzen wurde.<br />
Los 714 Schätzwert 600-750 €<br />
Gruppen-Gasund<br />
Elektrizitätswerk Bergstraße <strong>AG</strong><br />
Bensheim, Sammelaktie 10 x 1.000 RM<br />
1.4.1925 (Auflage nur 20 Stück, R 12),<br />
ausgestellt auf die Gemeinde Jugenheim<br />
a.d.B EF-VF<br />
Großes Hochformat, schöne Umrahmung aus<br />
Weinlaub. Diese bislang unbekannt gewesene<br />
Emission ist ein Unikat aus dem Reichsbankschatz.<br />
Gegründet 1886 als “Gaswerk Bensheim <strong>AG</strong>”, umfirmiert 1909<br />
nach Anschluß auch der Gemeinden Auerbach, Zwingenberg,<br />
Alsbach, Jugenheim, Bickenbach und Hähnlein in “Gruppengaswerk<br />
Bergstraße <strong>AG</strong>” und nach Aufnahme auch der Stromversorgung<br />
1914 wie oben. Aktionäre: Die Städte Bensheim<br />
(63,1 %) und Zwingenberg (13,3 %) und die Gemeinden Alsbach<br />
(5,8 %), Bickenbach (5,1 %), Jugenheim (7,9 %), Seeheim<br />
(1,0 %) und Hähnlein (3,9 %). In dieser Struktur besteht<br />
das GGEW noch heute, macht mit ca. 150 Mitarbeitern rd. 160<br />
Mio. € Jahresumsatz und beliefert rd. 140.000 Kunden. Der<br />
Strom wird von der Heag bezogen, Ferngas von der Südhessischen<br />
Gas- und Wasser <strong>AG</strong> in Darmstadt.<br />
Nr. 715<br />
Nr. 722<br />
Los 715 Schätzwert 300-375 €<br />
Gruppengaswerk Bergstraße <strong>AG</strong><br />
Bensheim, Aktie 1.000 Mark 1.4.1911<br />
(Auflage nur 20 Stück, R 9), ausgestellt auf<br />
die Gemeinde Jugenheim (Hessen) EF+<br />
Großes Hochformat mit schöner Umrahmung und<br />
Kapitälchen, Originalunterschriften.<br />
Los 716 Schätzwert 50-125 €<br />
Gummiwerk Sonneberg <strong>AG</strong><br />
Sonneberg, Aktie 1.000 RM Sept. 1927<br />
(Auflage 150, R 5) UNC-EF<br />
Gründung 1925 zur Herstellung und zum Vertrieb von Gummiwaren<br />
aller Art. 1928 wurde bereits das Konkursverfahren eröffnet,<br />
1932 ist die Firma erloschen.<br />
Los 717 Schätzwert 50-125 €<br />
Gummiwerke Becker <strong>AG</strong><br />
Heidenheim a.d.Brenz, Aktie 100 RM<br />
31.3.1943 (Auflage 2368, R 5) UNC<br />
Fortbetrieb der 1906 von Gustav Becker gegründeten Fabrik, in<br />
der Gummiwalzen und technische Gummiwaren hergestellt<br />
wurden. Börsennotiz damals im Freiverkehr Stuttgart. 1951<br />
Neubau einer zweiten Fabrik in der Paulstrasse, 1967 Errichtung<br />
eines Zweigwerkes in Düren. Die auf Gummiwalzen für die<br />
Papierindustrie spezialisierte Firma bewegte sich konsequenterweise<br />
auf ihre Hauptabnehmer zu und baute 1987 sogar ein<br />
Reparaturwerk in Finnland. 1991 in eine GmbH umgewandelt.<br />
Los 718 Schätzwert 20-75 €<br />
Gustav Adolf Weitzel Dampfpflugund<br />
Dampfwalzenunternehmung <strong>AG</strong><br />
Eisleben, Aktie 1.000 Mark 15.6.1923<br />
(R 3) EF<br />
Gründung 1922. Dampfpflüge, Dampfdreschmaschinen und<br />
Dampfstraßenwalzen wurden im Lohnauftrag eingesetzt,<br />
außerdem Übernahme von Straßenbauarbeiten. 1919/20 übernahm<br />
im Zuge ihrer Umstellung auf Friedensarbeiten die Rheinische<br />
Metallwaaren- und Maschinenfabrik in Düsseldorf<br />
(Rheinmetall) eine Beteiligung.<br />
61
Los 719 Schätzwert 10-40 €<br />
H. Berthold Messinglinienfabrik<br />
und Schriftgiesserei <strong>AG</strong><br />
Berlin, Aktie 100 RM 23.6.1932 (Auflage<br />
10670, R 1, kpl. Aktienneudruck) UNC-EF<br />
Gründung 1858, <strong>AG</strong> seit 1896. Erzeugnisse: Schriften und Messinglinien<br />
für Buchdruckzwecke, Bedarfsartikel für das graphische<br />
Gewerbe. Berthold expandierte rasch: Übernommen wurde<br />
1897 die Schriftgießerei Bauer & Co. in Stuttgart und Düsseldorf,<br />
1899 Errichtung einer Fabrik in St. Petersburg, ferner<br />
übernommen 1905 J. H. Rust & Co. in Wien, 1917 Emil Gursch<br />
in Berlin, 1918 die Schriftgießereien Gottgried Böttger, F. A.<br />
Brockhaus, C. F. Rühl in Leipzig und A. Kahle Söhne in Weimar,<br />
1920 Julius Klinkhardt in Leipzig, 1922 C. Kloberg in Leipzig<br />
und 1928 die Schriftgießerei der A.-G. für Schriftgießerei und<br />
Maschinenbau in Offenbach/Main. In Riga bestand bei der H.<br />
Berthold Schriftgießerei H. Leunig & Co. eine 100 %ige Beteiligung,<br />
außerdem mit je 50 % bei der Erste ungarische Schriftgießerei<br />
<strong>AG</strong> in Budapest und der Haas’sche Schriftgießerei <strong>AG</strong><br />
in Münchenstein bei Basel beteiligt. Mit dem Niedergang des<br />
Buchdrucks mußte das Produktionsprogramm ab Ende der 60er<br />
Jahre völlig umgestellt werden: Berthold wurde zum größten<br />
Hersteller von Fotosetzmaschinen in Europa. 1971 umfirmiert in<br />
H. Berthold <strong>AG</strong>, 1979 Umzug in die vormalige Fabrik der Loewe<br />
Opta GmbH in Berlin-Steglitz. Die immensen Entwicklungskosten<br />
der völlig neuen Fotosatz-Technologie (bei der auch schon<br />
Lasertechnik zum Eisantz kam) wurden aber nie wieder eingespielt:<br />
1993 ging die Traditionsfirma in Konkurs.<br />
Los 720 Schätzwert 50-120 €<br />
H. Brüninghaus Söhne <strong>AG</strong><br />
Barmen, Aktie 100 RM 9.7.1927 (Auflage<br />
2600, R 5, kpl. Aktienneudruck) EF<br />
Gründung 1905, Betrieb einer Weberei in Barmen-Rittershausen<br />
(Schwarzbachstr. 9/13). Der Verlust einer großen Beteiligung<br />
in Österreich als Folge des 1. Weltkrieges machte 1919<br />
eine Kapitalherabsetzung erforderlich und schwächte die Firma<br />
dauerhaft. 1929 mußte als Folge hoher Zinslasten bei unzureichender<br />
Beschäftigung der Betrieb eingestellt werden, die <strong>AG</strong><br />
trat in Liquidation.<br />
Los 721 Schätzwert 30-75 €<br />
H. & F. Wihard <strong>AG</strong><br />
Liebau i. Schl., Aktie 500 RM Aug. 1929<br />
(Auflage 3000, R 5) EF<br />
Gründung 1857 als oHG, <strong>AG</strong> seit 1920. Leinenweberei. Erzeugt<br />
wurden Reinleinen, Halbleinen und Mischgewebe. Börsen-Notiz<br />
im Freiverkehr Berlin. Beteiligungen an der Wihardschen<br />
Flachsspinnerei GmbH, Liebau und den Flachswerken Wartheland<br />
<strong>AG</strong>, Wildschütz.<br />
Los 722 Schätzwert 200-250 €<br />
H. Förster & Co. <strong>AG</strong><br />
Leipzig, Aktie 1.000 Mark 25.9.1918.<br />
Gründeraktie (Auflage 750, R 9) VF<br />
Großes Querformat, fast ganzflächiger Unterdruck<br />
eines Flügels mit hochgeklapptem Deckel.<br />
1895 übernehmen die Klavierbauer Eduard Hermann Förster<br />
und Gottwerth Dimler in Leipzig die Klavierfabrik Serbser & Co.<br />
und führen sie als oHG H. Förster & Co. weiter. 1906 Aufnahme<br />
der Produktion pneumatischer Klaviere. 1908 - die Fabrik<br />
beschäftigt inzwischen 120 Arbeiter - Umzug in die neue Klavierfabrik<br />
in der Kohlgartenstr. 52 (außerdem Holzlager und -<br />
trocknung in der Comeniusstraße). 1918 Umwandlung in eine<br />
62<br />
<strong>AG</strong>. 1924 scheidet Hermann Förster aus der Firma aus. Bald<br />
darauf gerät die gesamte deutsche Pianoforteindustrie, deren<br />
unumstrittenes Zentrum die “Musikhauptstadt” Leipzig ist, in<br />
eine existentielle Krise. Das Geschäftsjahr 1928 schließt bei<br />
Förster nach Absatzeinbrüchen mit einem hohen Verlust ab, eine<br />
Produktionsumstellung erscheint nicht möglich. Daraufhin<br />
ziehen sich die Banken aus dem Aufsichtsrat der in Leipzig<br />
börsennotierten <strong>AG</strong> zurück und sperren die Kredite, Förster<br />
muß die Zahlungen einstellen. Während des 1929 beschlossenem<br />
gerichtlichen Vergleichsverfahrens wird der Betrieb fortgeführt,<br />
der Vergleich scheitert aber erneut am Verhalten der<br />
Banken. 1931 Konkurseröffnung mangels Masse abgelehnt.<br />
Los 723 Schätzwert 100-150 €<br />
H. Förster & Co. <strong>AG</strong><br />
Leipzig, Aktie 1.000 Mark 10.10.1923<br />
(Auflage 5000, R 9) EF<br />
Großer Flügel mit hochgeklapptem Deckel im<br />
Unterdruck. Nur 8 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Los 724 Schätzwert 300-375 €<br />
H. Henninger-Reifbräu <strong>AG</strong><br />
Erlangen, Aktie 1.000 Mark 19.1.1922<br />
(Auflage 1400, R 8) VF<br />
Zuvor völlig unbekannt gewesen und die älteste<br />
verfügbare Ausgabe dieser regional jahrzehntelang<br />
bedeutsamen Brauerei.<br />
Gründung des Stammhauses bereits 1690, <strong>AG</strong> ab 1896 als Actienbrauerei<br />
Erlangen vorm. Gebr. Reif. Am 8.4.1905 wurde die<br />
Brauerei H. Henninger in Erlangen erworben, beide Betriebe<br />
vereinigt und die Firma umbenannt in H. Henninger-Reifbräu<br />
<strong>AG</strong>. 1918/19 Verkauf der Mälzerei an die Konsumgenossenschaft<br />
Erlangen. Erwerb der 1. Erlanger Aktienbrauerei vorm.<br />
Karl Niklas. Bis 1972 war die <strong>AG</strong> eigenständig, dann wurde sie<br />
in die neu gegründete “Patrizier-Bräu <strong>AG</strong>” in Nürnberg eingebracht.<br />
Los 725 Schätzwert 450-600 €<br />
H. Schomburg & Söhne <strong>AG</strong><br />
Berlin-Moabit, Aktie 1.000 Mark Okt. 1897.<br />
Gründeraktie (Auflage 1000, R 9) VF<br />
Schöne fast barocke Umrahmung mit Blütenornamentik.<br />
Daß diese zuvor völlig unbekannt gewesenen<br />
Aktien erhalten blieben ist ungewöhnlich, an<br />
sich hätten sie nach der Vollfusion mit der Porzellanfabrik<br />
Kahla 1927 aus dem Verkehr gezogen<br />
werden müssen. Minimale Randschäden perfekt<br />
restauriert.<br />
Ursprung des Unternehmens ist der 1854 gegründete “Thonwaren-<br />
und Braunkohlen-Actien-Verein Großdubrau”, wo einfache<br />
Tonwaren und Ziegel gefertigt wurden. Er nutzte den Umstand,<br />
daß bei dem um 1850 begonnenen Braunkohleabbau<br />
auch Ton- und Kaolinschichten im Erdreich zu Tage tragen. Zu<br />
Ehren der sächsischen Prinzessin Margarethe, einer Tochter des<br />
Königs Johann, erhielt das Werk 1857 den Namen “Margarethenhütte”.<br />
1872 kaufte der Berliner Unternehmer Hermann<br />
Schomburg die Margarethenhütte, 1897 wandelte die Familie<br />
die Firma erneut in eine <strong>AG</strong> um. Schomburg erkannte ungewöhnlich<br />
früh, welche Zukunftsaussichten die Kommunikationsund<br />
Elektrotechnik haben würde und spezialisierte die Fabrik<br />
auf die Herstellung von Isolatoren. Schomburg-Isolatoren wurden<br />
deutschlandweit eingesetzt, so in Telegrafenleitungen des<br />
Reichspostamtes ab 1876 und 1891 in der ersten deutschen<br />
Hochspannungsüberlandleitung von Lauffen am Neckar nach<br />
Frankfurt/Main. An der Wende zum 20. Jh. hatten Schomburg-<br />
Isolatoren Weltgeltung und wurden in aller Herren Länder exportiert.<br />
Der Erfolg gründete auf der technologischen Spitzen-<br />
Elektromast mit Langstab-Isolatoren der<br />
Hermsdorf-Schomburg-Isolatoren GmbH<br />
stellung, die das Werk immer zu verteidigen vermochte. So wurde<br />
1900 das erste Hochspannungs-Prüffeld in Betrieb genommen,<br />
1913 folgte ein 300.000-Volt-Freileitungs-Versuchsfeld,<br />
1921 ging die damals weltweit modernste Tunnelofenhalle mit<br />
zwei 80 m langen gasbeheizten Tunnelöfen in Betrieb. 1921/22<br />
Übernahme von Mehrheitsbeteiligungen an der Tonwarenfabrik<br />
Schwandorf in Bayern und der Porzellanfabrik Josef Schachtel<br />
im schlesischen Sophienau (Kr. Waldenburg). In Roßlau a. Elbe<br />
bestand ein Zweigwerk zur Herstellung von Haushaltsporzellan<br />
(1932 stillgelegt). In der schwierigen Zeit nach dem 1. Weltkrieg<br />
kam es 1922 zu einer Interessengemeinschaft mit dem Hauptkonkurrenten,<br />
der Porzellanfabrik Kahla <strong>AG</strong> und im gleichen<br />
Jahr zur Gründung der HESCHO (Hermsdorf-Schomburg-Isolatoren<br />
GmbH), die in Deutschland sofort Hauptlieferant von Hochspannungsisolatoren<br />
wurde. Die Aktien waren in Berlin börsennotiert,<br />
Großaktionär war seit den 1920er Jahren mit 92 % die<br />
Porzellanfabrik Kahla, was 1927 in der Vollfusion mit Kahla<br />
mündete. Nach dem 2. Weltkrieg wurde die Fabrik von den Russen<br />
vollständig demontiert, die Tunnelofenanlage und das<br />
Hauptfabrikationsgebäude wurden zerstört. Im April 1946 begann<br />
man in der völlig zerstörten Fabrik notdürftig wieder mit<br />
der Herstellung von Gebrauchsgeschirr, bald wurden auch wieder<br />
Isolatoren gefertigt. 1948 Enteignung und Weiterführung als<br />
“VEB Elektroporzellanwerk Margarethenhütte Großdubrau”. Die<br />
ständige Modernisierung des Betriebes war genau zur “Wende”<br />
1989 abgeschlossen, was sich allerdings als Ironie des Schikksals<br />
entpuppte: Mitte 1991 wird der Betrieb von der Treuhandanstalt<br />
geschlossen, am 28.5.1991 verlassen als letzte Lieferung<br />
Ventilableiter für ABB die Margarethenhütte. Eine der ältesten<br />
Fertigungsstätten von technischer Keramik in Deutschland<br />
wird heute vom Förderverein Margarethenhütte Großbubrau e.V.<br />
als Museum unterhalten. Gerade erst am 5.10.2009 öffnete<br />
das Museum für das Publikum.<br />
Los 726 Schätzwert 150-200 €<br />
H. Schomburg & Söhne <strong>AG</strong><br />
Grossdubrau i. Sa., Aktie 1.000 Mark Mai<br />
1923 (Auflage 24500, R 8) EF-VF<br />
Schöne fast barocke Umrahmung mit Blütenornamentik.<br />
Daß diese Aktien erhalten blieben ist ungewöhnlich,<br />
an sich hätten sie nach der Vollfusion<br />
mit der Porzellanfabrik Kahla 1927 aus dem Verkehr<br />
gezogen werden müssen.<br />
Nr. 724 Nr. 725<br />
Los 727 Schätzwert 500-625 €<br />
H. Stodiek & Co. <strong>AG</strong><br />
Bielefeld, Aktie 1.000 Mark Aug. 1902.<br />
Gründeraktie (Auflage 1000, R 8) EF<br />
Dekorative Umrandung im Historismusstil. Originalunterschriften.<br />
Sämtliche Stodiek-Vorkriegsausgaben<br />
waren zuvor völlig unbekannt gewesen!<br />
Gründung 1875 als KG, <strong>AG</strong> seit 1902. Erzeugung von Superphosphat<br />
und Mehrnährstoff-Dünger. Die Werke in Löhne (errichtet<br />
1878) und Kaarst (errichtet 1905) wurden 1951 an die<br />
KG Wilhelm Stodiek GmbH & Co. verpachtet und 1984 auf die<br />
Stodiek Dünger GmbH in Ludwigshafen übertragen. 1998 Reaktivierung<br />
des Börsenmantels, Umfirmierung in “Stodiek Europa<br />
Immobilien <strong>AG</strong>” und Sitzverlegung zum neuen Mehrheitsaktionär<br />
IVG nach Bonn.<br />
Los 728 Schätzwert 225-300 €<br />
H. Stodiek & Co. <strong>AG</strong><br />
Bielefeld, Aktie 500 RM März 1930<br />
(Auflage 3000, R 9) EF-<br />
Los 729 Schätzwert 20-50 €<br />
H. Th. Böhme <strong>AG</strong><br />
Chemnitz, Aktie 1.000 Mark 29.1.1921<br />
(Auflage 2000, R 3) EF-<br />
Großformatig und dekorativ, zwei Vignetten mit<br />
Ansichten der Fabriken in Chemnitz und Oberlichtenau.
Gründung 1881, <strong>AG</strong> seit 1909. Grosshandel mit Drogen, Farben,<br />
Chemikalien, Vegetabilien sowie Kräuterschneiderei. Außerdem<br />
Herstellung von Spezialseifen (hier wurde mit “Fewa” das erste<br />
synthetische Waschmittel der Welt entwickelt und produziert)<br />
und -ölen für die Textil- und Lederindustrie. Mit meist zweistelligen<br />
Dividenden ein hochrentables Unternehmen. Zweigniederlassung<br />
in Hamburg. 1950 Sitzverlegung nach Hamburg (Neuer<br />
Wall 19-23), anschließend in eine GmbH umgewandelt.<br />
Los 730 Schätzwert 600-750 €<br />
Hänsel & Co. <strong>AG</strong><br />
Forst (Lausitz) / Görlitz, Interimsschein<br />
1.522.000 RM aus dem Gründungsjahr<br />
der <strong>AG</strong> 1930, verbriefte den gesamten<br />
knapp 70 %igen Anteil des Aktionärs<br />
Bruno Henschke (R 12) VF+<br />
Mit mehrfachen Originalunterschriften von Heinrich<br />
Otto (Aufsichtsratsvorsitzender, Bankdirektor<br />
aus Görlitz) und Bruno Henschke (Vorstand). Interessant<br />
an der Sammelaktie ist insbesondere, daß<br />
Nennwertveränderungen auf Grund einer Kapitalherabsetzung<br />
1936 sowie einer Kapitalerhöhung<br />
aus Gesellschaftsmitteln 1942 auf der ursprünglichen<br />
Urkunde selbst nachgetragen wurden. Ein<br />
Unikat aus dem Reichsbankschatz.<br />
Gegründet 1923 als “Haargarnspinnerei <strong>AG</strong>” in Konstanz, 1925<br />
Sitzverlegung nach Steißlingen (Baden). 1930 Fusion mit der<br />
oHG Hänsel & Co. in Forst (Lausitz), zugleich Umfirmierung in<br />
Hänsel & Co. <strong>AG</strong> und Sitzverlegung nach Forst. Der Forster Betrieb<br />
war 1908 von Bruno Henschke mit gerade einmal 26 Mitarbeitern<br />
gegründet worden zur Weiterentwicklung der Erfindung<br />
von Oswald Hänsel, Rosshaare zu einem verwebbaren<br />
Faden zu verzwirnen. 1911 zerstörte ein Großbrand das Werk,<br />
doch Henschke machte unbeirrt weiter. Die ab 1927 für das<br />
Schneiderhandwerk erscheinende Werkszeitung “Hänsel-<br />
Echo” erreichte bis Kriegsbeginn 1939 eine reichsweit vertrie-<br />
bene Auflage von 120.000 Exemplaren. Die Hänselwerke<br />
deckten jetzt mit über 2.000 Mitarbeitern die Hälfte des deutschen<br />
Bedarfs an Einlagenstoffen für Herren- und Damen-<br />
Oberbekleidung. Alleinaktionäre waren die beiden Vorstandsmitglieder<br />
Bruno Henschke (knapp 70 %) und Carl Ersel (gut<br />
30 %). Zweigbetriebe bestanden in Franzendorf-Reichenberg<br />
im Sudetengau (Hänsel & Co.) sowie im schlesischen Langenbielau<br />
(Baumwollspinnerei Froehlich). Demontage und Enteignung<br />
machten dem Betrieb in der Lausitz ein Ende, die aus den<br />
Trümmern gegründete Hänselwerk VVEB kam nie richtig in<br />
Gang. Bruno Henschke konnte nach Hamburg fliehen und versuchte<br />
dort 1946 einen Neuanfang, 1948 ging er mit seiner<br />
Firma nach Iserlohn. Er starb 1950. Zwar wurde die Haargarnspinnerei,<br />
der Ursprung des Unternehmens, in den 1970er<br />
Jahren geschlossen, aber mit ständig neu entwickelten verstärkenden<br />
Stoffen gibt es die Hänsel-Textil GmbH mit 250 Mitarbeitern<br />
weltweit (seit 1991 als Teil der Finanzholding Kufner-<br />
Gruppe) bis heute. In Oktober 2008 feierte die Firma ihr 100jähriges<br />
Jubiläum, ein Jahr später war der Insolvenzantrag eine<br />
bittere Zäsur, der Betrieb produziert aber weiter.<br />
Logo der noch heute existierenden<br />
Hänsel Textil GmbH<br />
Los 731 Schätzwert 20-50 €<br />
Hafenmühle in Frankfurt am Main <strong>AG</strong><br />
Frankfurt a.M., Aktie 1.000 RM 22.7.1930<br />
(Auflage 1440, R 5) UNC-EF<br />
Gründung 1868 in Hausen als Mehl- und Brotfabrik der Firma<br />
May & Co., seit 1881 <strong>AG</strong>. 1908 Verkauf des Grundstückes in<br />
Hausen an die Stadt Frankfurt, 1911 Betriebseröffnung der<br />
neuen Mühle im Frankfurter Hafen (Franziusstr. 18-20) und aus<br />
diesem Anlass Umfirmierung in „Hafenmühle“. Großaktionär<br />
war ein Konsortium um das Bankhaus Alwin Steffan. Börsennotiz<br />
Frankfurt. 1964 in eine GmbH umgewandelt. Zusammen<br />
mit den ebenfalls im Osthafen ansässigen Wolff-Mühlenwerken<br />
später Teil der Hildebrandmühlen (Marke “Aurora” mit dem<br />
Sonnenstern) und damit des Konzerns der VK-Mühlen geworden.<br />
In 2010 kamen Schließungsgerüchte auf.<br />
Los 732 Schätzwert 30-75 €<br />
H<strong>AG</strong>EDA Handelsgesellschaft<br />
Deutscher Apotheker <strong>AG</strong><br />
Berlin, Aktie 1.000 RM 2.10.1926<br />
(Auflage 500, R 5) EF<br />
Gründung 1902 als “Einkaufsgenossenschaft der Apothekenbesitzer<br />
Berlins”. 1904 Umwandlung in die “Handelsgesellschaft<br />
deutscher Apotheker mbH”, seit 1921 <strong>AG</strong>. In rascher Folge wurden<br />
im ganzen Reich Zweigniederlassungen errichtet, so 1904 in<br />
München, 1905 in Köln, 1908 in Dresden, 1911 in Breslau und<br />
Hamburg, 1912 in Frankfurt (Main). 1906 Errichtung einer eigenen<br />
Verbandstoff-Fabrik, 1911 einer Fabrik für Ampullen. Gleichzeitig<br />
Ausbau der Abt. Reagenzien und der homöopathischen Abteilung.<br />
1915 Bau einer Salbenfabrik. Ab 1922 auch Herstellung<br />
bakteriologischer Präparate. 1924 Errichtung einer Tabletten-,<br />
Dragier- und Pillenfabrik in Berlin-Reinickendorf. Für den riesigen<br />
Fuhrpark bestand sogar ein eigener Karosseriebaubetrieb (die<br />
1920 gegründete Brandenburgische Automobil-Reparaturwerkstatt<br />
GmbH). 1950 Sitzverlegung nach Köln. Die <strong>AG</strong> ist bis heute<br />
börsennotiert und gehört mit fast 5 Mrd. € Jahresumsatz zu den<br />
führenden deutschen Pharmagroßhändlern. Großaktionär ist mit<br />
über 95 % die Familie Merckle in Blaubeuren.<br />
Los 733 Schätzwert 75-125 €<br />
Hallenbau Land und Stadt <strong>AG</strong><br />
Magdeburg, Aktie 1.000 RM März 1932<br />
(Auflage nur 90 Stück, R 6) VF.<br />
Gründung 1922 zum Bau und Betrieb einer Halle um Ausstellungen<br />
und Versteigerungen von Vieh, landwirtschaftlichen Maschinen,<br />
Geräten und Produkten zu veranstalten. Die Halle wurde<br />
in einer Stahlbetonskelettkonstruktion errichtet. Großaktionär<br />
war zuletzt die Stadt Magdeburg. In den 50er Jahren als Sporthalle<br />
benutzt. Das Gebäude steht heute unter Denkmalschutz<br />
Los 734 Schätzwert 40-80 €<br />
Hallenbau Land und Stadt <strong>AG</strong><br />
Magdeburg, Aktie Reihe A 100 RM<br />
15.5.1939 (Auflage 350, R 5) EF<br />
Identische Gestaltung wie voriges Los.<br />
Los 735 Schätzwert 20-60 €<br />
Hamburg-Amerikanische<br />
Packetfahrt-<strong>AG</strong><br />
Hamburg, Aktie 100 RM Juli 1936<br />
(Auflage 450000, nach tlw. Umtausch in<br />
1.000-RM-Aktien noch 110000, R 2) UNC<br />
Mit HAP<strong>AG</strong>-Flagge.<br />
Gründung 1847. Drei große Segler waren die ersten Fahrzeuge<br />
der Hamburg-Amerika-Linie, die aber bald durch Dampfschiffe<br />
ersetzt wurden. Ende des 19. Jh. war die Flotte auf über 40<br />
Dampfer angewachsen. Befahren wurden die Linien von Hamburg<br />
nach New York, Baltimore, Philadelphia, Boston, Canada,<br />
New Orleans, von Stettin nach New York sowie von Italien nach<br />
New York und nach Argentinien. Verträge sicherten der HAP<strong>AG</strong><br />
die Beförderung der deutschen, englischen, französischen,<br />
amerikanischen und italienischen Post über den Atlantik. Bis in<br />
die 1870er Jahre von eher nur regionaler Bedeutung, doch unter<br />
Albert Ballin (1857-1918), der 1899 Generaldirektor der HA-<br />
P<strong>AG</strong> wurde, entstand ein Unternehmen von weltumspannender<br />
Bedeutung. Seine absolute Blütezeit erreichte es 1914 mit einer<br />
Flotte von 1.360.000 Bruttoregistertonnen, darunter mit den<br />
Dampfern „Imperator“, „Vaterland“ und „Bismarck“ die größten<br />
Schiffe der Welt. Die Folgen des 1. Weltkrieges bedeuteten eine<br />
schwere Zäsur: Aufgrund des Versailler Vertrages musste die<br />
gesamte Flotte an die Entente-Staaten abgeliefert werden. Der<br />
Wiederaufbau war mühsam, erst mit der 1926 erfolgten Übernahme<br />
der Deutsch-Austral-, Kosmos- und Hugo-Stinnes-Linien<br />
kam die HAP<strong>AG</strong> wieder in die Reihe der größten Reedereien<br />
der Welt. 1930 kam mit dem Bremer Erzkonkurrenten,<br />
dem Norddeutschen Lloyd, ein Gemeinschaftsvertrag zustande,<br />
außerdem war die HAP<strong>AG</strong> Hauptvertreter der Deutschen Zeppelin-Reederei<br />
und Generalvertreter für die „Deutsche Lufthansa<br />
<strong>AG</strong>“. 1970 Fusion von HAP<strong>AG</strong> und dem 1857 gegründeten<br />
Norddeutschen Lloyd zur heutigen Hapag-Lloyd <strong>AG</strong>. Nun eine<br />
Tochter der früheren Preussag (heute TUI), tätig in den Bereichen<br />
Seeschifffahrt, Transport, Seehafenbetriebe, Reisebüros,<br />
Flugtouristik. Erst 2005 wurde diese TUI-Sparte durch Kauf der<br />
CP-Ships (Schiffahrtssparte der Canadian Pacific Railway) noch<br />
einmal kräftig gestärkt.<br />
Los 736 Schätzwert 125-175 €<br />
Hamburg-Bremer<br />
Feuer-Versicherungs-Gesellschaft<br />
Hamburg, Namensaktie 100 RM Nov.<br />
1925 (Auflage 15000, R 9) VF-<br />
Nur 8 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1854. Das <strong>Rückvers</strong>icherungsgeschäft wurde 1868<br />
in die Hamburg-Bremer <strong>Rückvers</strong>icherung ausgegliedert (1889<br />
durch Vereinigung rückgängig gemacht, 1892 erneut in eine<br />
eigenständige <strong>AG</strong> ausgegliedert). Von Anfang an Ausrichtung<br />
auf das Auslandsgeschäft mit Geschäftsstellen in Kopenhagen,<br />
Oslo, St. Thomas (Westindien), San Francisco, Hongkong, Habana,<br />
Mexico, London und Chicago. Durch die Erdbeben-Katastrophe<br />
in San Francisco 1906 wurde die Gesellschaft empfindlich<br />
getroffen, die zu regulierenden Schäden überschritten<br />
das Grundkapital. 1968 fusionierte die zu diesem Zeitpunkt älteste<br />
noch bestehende Hamburger Versicherung mit der 1857<br />
gegr. Nord-Deutsche Versicherungs-<strong>AG</strong> zur “Nord-Deutsche<br />
und Hamburg-Bremer Versicherungs-<strong>AG</strong>”. Aus dieser Gesellschaft<br />
wird im Jahr 1975 die Hamburg-Mannheimer Sachversicherungs-<strong>AG</strong>.<br />
Heute ein Unternehmen der ERGO Versicherungsgruppe.<br />
Los 737 Schätzwert 100-150 €<br />
Hamburg-Bremer<br />
Feuer-Versicherungs-Gesellschaft<br />
Hamburg, Namensaktie 1.000 RM Sept.<br />
1929 / 4.7.1933 (R 9) EF<br />
1942 umgestellt auf 500 RM.<br />
Los 738 Schätzwert 100-150 €<br />
Hamburg-Bremer<br />
Feuer-Versicherungs-Gesellschaft<br />
Hamburg, Namensaktie 1.000 RM Sept.<br />
1929 / 3.7.1937 (R 9) EF<br />
1942 umgestellt auf 500 RM.Identische Gestaltung<br />
wie voriges Los.<br />
Los 739 Schätzwert 100-150 €<br />
Hamburg-Bremer<br />
Feuer-Versicherungs-Gesellschaft<br />
Hamburg, Namensaktie 1.000 RM Sept.<br />
1929 / 20.1.1938 (R 9) EF<br />
1942 umgestellt auf 500 RM. Ebenfalls identisch<br />
gestaltet.<br />
Los 740 Schätzwert 75-125 €<br />
Hamburg-Bremer<br />
<strong>Rückvers</strong>icherungs-<strong>AG</strong><br />
Hamburg, Aktie (interim) 1.000 Mark<br />
25.9.1911 (Auflage 1000, R 6) EF<br />
Gegründet 1906 von der Hamburg-Bremer Feuer als Auffanggesellschaft<br />
für die „Hamburg-Bremer Allgemeine Rück“, die<br />
unter den Folgen der Erdbebenkatastrophe in San Francisco<br />
1906 zusammengebrochen war. Börsennotiz: Freiverkehr<br />
Hamburg. 1980 verschmolzen mit der HIR Hamburger Internationale<br />
<strong>Rückvers</strong>icherungs-<strong>AG</strong> (Konzerntochter der früheren<br />
Volksfürsorge Lebensversicherung <strong>AG</strong>); die HIR wurde 1982-<br />
84 “zerlegt”, teilverkauft; der Restmantel ist heute als HIR eine<br />
Chilington-Tochter und im run-off-Bereich tätig.<br />
Los 741 Schätzwert 40-75 €<br />
Hamburg-Bremer<br />
<strong>Rückvers</strong>icherungs-<strong>AG</strong><br />
Hamburg, Namensaktie 100 RM Juli<br />
1928 (Auflage 10000, R 6) EF<br />
Los 742 Schätzwert 100-125 €<br />
Hammerstein & Hofius <strong>AG</strong><br />
Frankfurt a. M., Anteilschein 12 RM<br />
10.2.1925 (R 9) EF-VF<br />
Übernommen wurde eine Fabrik in Lämmerspiel, Kreis Offenbach.<br />
Herstellung von Schrauben und Muttern, seit 1924 auch<br />
Fabrikation von Kopfhörern (Marke Primus). Börsennotiz Frankfurt.<br />
1927 wurde die Gesellschaft aufgelöst, 1928 gelöscht.<br />
Nr. 743<br />
Mindestgebot: 80 %<br />
vom unteren Schätzwert<br />
63
Los 743 Schätzwert 40-80 €<br />
Handels- und Diskont-<strong>AG</strong><br />
Berlin, Aktie 5.000 Mark Febr. 1923<br />
(Auflage 40000, R 5) EF<br />
Gründung 1921 als Deutsch-Niederländische Handels-<strong>AG</strong>.<br />
Ausführung von Bank-, Finanz- und Treuhandgeschäften aller<br />
Art im In- und Ausland, Errichtung und Umwandlung von Industrie-<br />
und Handelsunternehmungen, Vermögensverwaltung.<br />
1930 von Amts wegen gelöscht.<br />
Los 744 Schätzwert 60-80 €<br />
Handels- und Verkehrsbank <strong>AG</strong><br />
Hamburg, Aktie 100 RM April 1925 (R 9) EF<br />
Nur 10 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1897 als „Viehmarktsbank“, 1906 Umfirmierung wie<br />
oben. 1929 Übernahme der Seehandelsbank <strong>AG</strong> in Altona, die<br />
als Filiale weitergeführt wurde. 1951 in Vergleich gegangen<br />
und dann abgewickelt.<br />
Los 745 Schätzwert 60-80 €<br />
Handels- und Verkehrsbank <strong>AG</strong><br />
Hamburg, Sammelaktie 5 x 100 RM April<br />
1925 (R 8) EF-VF<br />
Los 746 Schätzwert 100-125 €<br />
Handels- und Verkehrsbank <strong>AG</strong><br />
Hamburg, Sammelaktie 10 x 100 RM Okt.<br />
1940 (R 7) EF+<br />
Ausgegeben wegen Umwandlung von je fünf 20-<br />
RM-Aktien in eine 100-RM-Aktie.<br />
Los 747 Schätzwert 150-200 €<br />
Handels-<strong>AG</strong><br />
Wien, Aktie 1.000 RM Nov. 1939 (Auflage<br />
800, R 11) VF+<br />
Nur 2 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Die Gesellschaft entstand aus der im Jahr 1780 gegr. Firma<br />
Weiß & Grohmann, ab 1895 <strong>AG</strong> “Handels-<strong>AG</strong> für Warenverkehr”,<br />
später umbenannt in “Handels-<strong>AG</strong>”. Geschäftsansässig<br />
Concordiaplatz 1, später Wien XX, Leystr. 86, in Prag und Preßburg<br />
bestanden früher Repräsentanzen. Vertriebene Waren<br />
hauptsächlich: Knöpfe, Wolle, Seide, Zwirne, Bänder, Litzen,<br />
Seidestoffe, Krawatten, Wirkwaren, Spitzen, Galanterie-, Hartgummi<br />
und Gummiwaren, Parfümerieartikel, Lederwaren,<br />
Spiel-, Papier- und Schreibwaren, in den 1950er Jahren noch<br />
erweitert um Rechen- und Schreibmaschinen, Uhren und<br />
Schirme. In Wien börsennotiert. 1971 in eine Kommanditgesellschaft<br />
umgewandelt.<br />
64<br />
Los 748 Schätzwert 30-75 €<br />
Handels-Kredit <strong>AG</strong><br />
Berlin, Aktie Serie B 200 RM Juli 1940<br />
(Auflage 1000, R 4) UNC-EF<br />
Gegründet 1926 als Elektrizitäts-Kredit <strong>AG</strong>, 1934 umbenannt<br />
wie oben. Finanzierung von Kauf- und Liefergeschäften auf<br />
dem Gebiet der Elektrizität und von Handelsgeschäften aller<br />
Art. 1967 Konkursverfahren, 1972 als Handels-Kredit <strong>AG</strong> i.L.,<br />
Reichelsheim, erloschen.<br />
Los 749 Schätzwert 10-40 €<br />
Handelsbank <strong>AG</strong><br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark 1.7.1923<br />
(Auflage 40000, R 1) EF<br />
Gründung 1893 als Berliner Viehcommissions- und Wechsel-<br />
Bank durch die führenden Berliner Fleischermeister. 1920 Umfirmierung<br />
in Handelsbank <strong>AG</strong>. 1922 wurde die Viehagentur-Abteilung<br />
als “Berliner Viehverkehrs-Bank <strong>AG</strong>” ausgegründet. Letzter<br />
Großaktionär war die Bayer. Hypotheken- & Wechselbank.<br />
1932 im Sog der Weltwirtschaftskrise Zahlungseinstellung,<br />
Zwangsvergleich mit 30 %iger Quotengarantie der (zu dieser<br />
Zeit staatseigenen) Dresdner Bank, anschließend in Liquidation.<br />
Los 750 Schätzwert 50-100 €<br />
Handelsbank in Lübeck<br />
Lübeck, Aktie 1.000 RM April 1941<br />
(Auflage 2000, R 5) EF<br />
Die älteste Lübecker Bank. Gründung 1856 als „Credit- und Versicherungsbank<br />
in Lübeck“, schon 1859 umbenannt in “Commerz-Bank<br />
in Lübeck”. 1937 Zusammenschluß mit der Lübeckischen<br />
Kreditanstalt (Staatsanstalt), 1938 Übernahme des Bankgeschäftes<br />
Alfons Frank & Co. 1940 Umfirmierung zur “Handelsbank<br />
in Lübeck”, um Verwechslungen mit der “großen” Commerzbank<br />
zu vermeiden. 1943 Verschmelzung mit dem Spar- und Vorschuß-<br />
Verein <strong>AG</strong>, Bad Schwartau. Mit 55 Geschäftsstellen die Regionalbank<br />
des Lübecker Raumes einschließlich der Kreise Stormarn,<br />
Ost-Holstein und Herzogtum Lauenburg. Börsennotiz Berlin und<br />
Hamburg. Lange war die Hansestadt Lübeck größter Aktionär, Ende<br />
der 70er Jahre kauften sich die Commezbank (über 25 %) und<br />
die Deutsche Bank (über 50 %) ein. 1988 umbenannt in “Deutsche<br />
Bank Lübeck <strong>AG</strong>”, 2003 nach squeeze-out der letzten Kleinaktionäre<br />
komplett in die Deutsche Bank eingegliedert.<br />
Los 751 Schätzwert 10-30 €<br />
Handelsgesellschaft für Grundbesitz<br />
Berlin, 5 % Genussrechtsurkunde 100 RM<br />
Jan. 1926 (R 4) EF<br />
Gründung 1898. Gehörte zum Einflussbereich der Berliner<br />
Handels-Gesellschaft, bestand bis 1950. Besitztum: über<br />
500.000 qm Grundstücke beiderseits des Hohenzollerndamms,<br />
ferner eine große Zahl von einzelnen Hausgrundstükken<br />
und Beteiligungen an verwandten Unternehmen.<br />
Los 752 Schätzwert 10-50 €<br />
Handelsvereinigung Dietz & Richter -<br />
Gebrüder Lodde <strong>AG</strong><br />
Leipzig, Aktie 100 RM 12.8.1925 (Auflage<br />
2750, R 2) EF<br />
Die Firma Dietz & Richter wurde bereits 1807 gegründet, 1920<br />
Vereinigung mit der Drogengroßhandlung Gebr. Lodde. Großhandel<br />
in Drogen, Chemikalien und Pharmazeutika. 1922 Umwand-<br />
lung in <strong>AG</strong>, zugleich Übernahme der seit 1835 bestehenden Firma<br />
Frölich & Co. in Münster (Westf.), die 1928 eine weitere<br />
Niederlassung in Hagen errichtete. 1934 Übernahme der Firma<br />
C. F. Cyriax & Co. und Pharmagotha in Gotha. Börsennotiz im<br />
Freiverkehr Leipzig. Nach Enteignung der mitteldeutschen Betriebe<br />
1953 Sitzverlegung nach Münster (Westf.). Die Niederlassung<br />
Hagen wurde 1954 im Zuge der vermögensrechtlichen<br />
Auseinandersetzung der Familienaktionäre der Familie Lodde<br />
übertragen. Mehrheitsaktionär ist danach der Apotheker Wiljelm<br />
Flach, später die Pharca GmbH in Essen, die am Ende fast 99 %<br />
der Aktien besitzt (gehört zum Pharmagroßhändler Noweda eG).<br />
Die von rd. 100 Mitarbeitern erzielten Umsätze steigen rasant,<br />
wobei vor allem 1983/84 ein Sprung von 60 auf 93 Mio. DM in-<br />
’s Auge fällt. 1975 vollständig in die Noweda eG eingegliedert.<br />
Los 753 Schätzwert 40-80 €<br />
Handwerksbau <strong>AG</strong> Thüringen<br />
Weimar, Namens-Aktie Ser. 1 200 RM<br />
April 1937 (Auflage 1095, R 5) EF<br />
Gründung 1936 als Wohnungsbaugesellschaft des thüringischen<br />
Handwerks. Die Handwerksbau <strong>AG</strong> Thüringen, Gemeinnützige<br />
Wohnungsgesellschaft, Weimar wurde bis 1990 nicht<br />
verlagert. 1992 Fortsetzung der Gesellschaft als Handwerksbau<br />
<strong>AG</strong> Thüringen Wohnungsgesellschaft, Weimar.<br />
Los 754 Schätzwert 125-200 €<br />
Handwerksbau Rheinpfalz-Saar <strong>AG</strong><br />
Kaiserslautern, Namensaktie 200 RM<br />
4.6.1937 (Auflage 2495, R 7) VF<br />
Mit Rostfleck.<br />
Gründung am 28.8.1936 zum Erwerb von Grundbesitz, Bau<br />
von Häusern zum Zwecke der Vermietung. 1942 hatte die<br />
Gesellschaft einen Wohnungsbestand von 364 Wohneinheiten.<br />
Los 755 Schätzwert 30-75 €<br />
Hanfwerke Füssen-Immenstadt <strong>AG</strong><br />
Füssen, Aktie 1.000 Mark 1.5.1920<br />
(Auflage 10000, R 4, kpl. Aktienneudruck<br />
nach Vollzug der Kapitalumstellung von<br />
Gulden auf Mark und Umfirmierung nach<br />
Übernahme der Mech. Bindfadenfabrik<br />
Immenstadt) EF<br />
Gründung am 2.9.1861 als „Mechanische Seilerwarenfabrik<br />
Füssen“ auf der Basis der Wasserkräfte des Lech. 1920 Umfirmierung<br />
in “Hanfwerke Füssen-Immenstadt <strong>AG</strong>” anlässlich der<br />
Fusion mit der 1855/57 gegründeten „Mechanischen Bindfadenfabrik<br />
Immenstadt“, die auf den Wasserkräften des Großen<br />
und Kleinen Albsees basierte (beide Seen waren übrigens bis zur<br />
Übernahme durch den Freistaat Bayern in den 1950er Jahren<br />
Privatbesitz der HFI). Erzeugnisse: Garne, technische Schnüre,<br />
Bindfaden, Erntebindegarne. Ein bedeutendes Unternehmen: Etwa<br />
die Hälfte der gesamten Produktion der deutschen Hanfspinnereien<br />
und Bindfadenfabriken war hier vereinigt. Nach dem<br />
Krieg wurde das Produktionsprogramm in Füssen um PVC-ummantelte<br />
Leinen sowie Selbstklebebänder erweitert, in Immenstadt<br />
entstand 1961 ein Kunsttoffwerk. Börsennotiz München<br />
und Frankfurt, größter Aktionär mit über 25 % war zuletzt die Hypobank.<br />
1970 erwirbt der Augsburger Maurermeister Hans Glöggler<br />
die Aktienmehrheit, der dabei ist, die größte deutsche Textilgruppe<br />
aufzubauen. Das hochspekulative Kartenhaus Glögglers<br />
stürzte und endete 1976 im Konkurs der Glöggler-Gruppe, anschließend<br />
verschwindet die HFI aus den Handbüchern.<br />
Los 756 Schätzwert 50-100 €<br />
Hanfwerke Oberachern <strong>AG</strong><br />
Oberachern/Baden, Aktie 100 RM<br />
1.11.1942 (R 5) UNC-EF<br />
Gründung 1875 als Hanfspinnerei und Bindfadenfabrik, <strong>AG</strong> seit<br />
1883, bis 1942 als Mechanische Bindfadenfabrik, Oberachern.<br />
Die Produktion sicherte den Unterhalt vieler Hanflieferanten der<br />
Umgebung. Die Waren wurden zum großen Teil nach England<br />
und nach Übersee exportiert. Heute managt und vermietet die<br />
<strong>AG</strong> Immobilien.<br />
Los 757 Schätzwert 75-150 €<br />
Hannoversche Immobilien-Gesellschaft<br />
Hannover, Aktie 1.000 Mark 7.1.1924<br />
(Auflage 1000, R 9) EF-VF<br />
Gründung 1890 durch den Baurat Wallbrecht, der 77 Immobilien<br />
in die Gesellschaft einbrachte, darunter das Geschäftshaus<br />
Continental mit Hotel, das Konzerthaus, das Luisenbad und den<br />
Palmengarten. Seit 1925 in Abwicklung. Die Tochtergesellschaft<br />
Union-Boden betreibt noch heute in Hannover mehrere<br />
Parkhäuser. Börsennotiz Berlin, Hamburg und Hannover. Letzter<br />
Mehrheitsaktionär war mit 59% die Stadt Hannover.<br />
Los 758 Schätzwert 300-375 €<br />
Hannoversche Kolonisationsund<br />
Moorverwertungs-<strong>AG</strong><br />
Berlin / Schwege, Kreis Wittlage,<br />
Interimsschein 726 x 100 RM 28.8.1931<br />
(R 11). Eine 1926 beschlossene, aber erst<br />
viel später in Tranchen durchgeführte<br />
Kapitalerhöhung um 240.000 RM wurde<br />
in 10 Interimsscheinen unterschiedlicher<br />
Stückelung verbrieft VF<br />
Maschinenschriftliche Ausführung, Originalunterschrift.<br />
Seit Beginn des 20. Jh. wird in Hunteburg Kreis Wittlage industriell<br />
Torfmoor abgebaut. Gründung der Hakumag 1909 als
GmbH, 1923 Umwandlung in eine <strong>AG</strong>. Erzeugt wurde mit rd.<br />
150 Beschäftigten Brenntorf, Torfstreu, Düngetorf und Torfbriketts.<br />
Die für die Mitarbeiter errichteten Beamten- und Arbeiterwohnhäuser<br />
sind noch heute als Schwegermoorsiedlung bekannt.<br />
In den 1920er und 1930er Jahren wurden in den Mooren<br />
auch Saisonarbeiter u.a. aus Holland und der Slowakei beschäftigt.<br />
Neben einem Bahnanschluß besaß die Ges. sogar einen<br />
eigenen Hafen an der Hunte. 1953 kamen Isolierplatten<br />
aus Torf zusätzlich ins Produktionsprogramm, außerdem Diversifizierung<br />
in den Maschinenbau mit der Herstellung von Hub-,<br />
Feil- und Sägemaschinen “Renard”. 1955 Verkauf von 181 ha<br />
abgetorftem Gelände an die Hannoversche Siedlungsgesellschaft,<br />
Hannover zur Errichtung von 10 Siedlerstellen für Vertriebene<br />
und Ankauf weiterer 75 ha Hochmoor zur Abtorfung<br />
von Weißtorf. 1965 in eine GmbH umgewandelt.<br />
Los 759 Schätzwert 50-100 €<br />
Hannoversche<br />
Portland-Cementfabrik <strong>AG</strong><br />
Hannover, Aktie 1.000 Mark 4.7.1921<br />
(Auflage 1000, R 5) EF<br />
1873 kauften Friedrich Kuhlemann und Albert Meyerstein eine<br />
auf den reichen Misburger Mergelvorkommen fußende Kalkbrennerei<br />
nördlich der Güterbahn Hannover-Lehrte, 1877 begannen<br />
sie auf dem Gelände den Bau der Hannoverschen Portland-Cementfabrik<br />
(HPC). Es war die erste der später sechs Zementfabriken<br />
im Raum Misburg. 1884 Umwandlung in eine<br />
<strong>AG</strong>. Die Zementfabrik, die durch einen eigenen Stichkanal an<br />
den Mittellandkanal angeschlossen war, produzierte mehr als<br />
ein Jahrhundert lang. 1988 wurde die Klinkerproduktion eingestellt,<br />
der Steinbruch wird seitdem gemeinsam mit der Landeshauptstadt<br />
Hannover renaturiert, das Mahlwerk wurde an<br />
den Großaktionär Teutonia Zementwerk <strong>AG</strong> verpachtet. Über<br />
Generationen im Familienbesitz, 2004 ging dann die Aktienmehrheit<br />
von Teutonia und damit auch von HPC an den HeidelbergCement-Konzern.<br />
Ende 2006 squeeze-out der wenigen<br />
noch verbliebenen Kleinaktionäre.<br />
Los 760 Schätzwert 100-175 €<br />
Hannoversche Waggonfabrik <strong>AG</strong> (Hawa)<br />
Hannover-Linden, Aktie 100 RM<br />
15.3.1926 (R 8) VF<br />
Gründung 1898 als „Hannoversche Holzbearbeitungs- u. Waggonfabriken<br />
(vorm. Max Menzel und Buschbaum & Holland)“.<br />
Herstellung von Eisenbahn- und Strassenbahnwagen: Salon-,<br />
Speise- und D-Zug-Wagen sowie Kesselwagen auf dem<br />
849.000 qm großen Fabrikareal gegenüber dem Bahnhof Linden-Fischerhof.<br />
1920 Fusion mit der Zuckerfabrik Linden. Ab<br />
1921 auch Herstellung von Dreschmaschinen und Automobil-<br />
Karosserien. Ab 1932 in Liquidation, im Juni 1942 nach beendeter<br />
Abwicklung erloschen.<br />
Los 761 Schätzwert 30-75 €<br />
Hans Eitner <strong>AG</strong><br />
Leipzig, Aktie 100 RM 24.8.1938 (Auflage<br />
400, R 5) EF<br />
Gründung 1866, <strong>AG</strong> seit 1922. Betrieb einer Spedition mit eigenen<br />
Lagerhäusern sowie Möbeltransporte, außerdem Großhandel<br />
mit Landesprodukten, Saat- und Speisekartoffeln. Börsen-Notiz:<br />
Freiverkehr Leipzig.<br />
Los 762 Schätzwert 20-60 €<br />
Hans Windhoff<br />
Apparate- und Maschinenfabrik <strong>AG</strong><br />
Berlin, Aktie 1.000 RM Aug. 1942<br />
(Auflage 1500, R 3) EF<br />
Gründung 1907 als GmbH, <strong>AG</strong> seit 1915. Das Werk in Berlin-<br />
Schöneberg (Bülowstraße) produzierte auf den Patenten von<br />
Dipl.-Ing. Hans Windhoff beruhende Kühler, die in Kraftfahrzeugen,<br />
aber auch in Flugzeugen Verwendung fanden. Anfang der<br />
1920er Jahre begann Windhoff mit der Entwicklung eines<br />
Zweitaktmotorrades bei der Tochter Windhoff Motorenbau<br />
GmbH in Johannistal (später Friedenau). Ab 1924 wurden diese<br />
Motorräder in Serie gefertigt und gewannen schon im Mai<br />
1925 beim Avus-Rennen die beiden ersten Plätze. 1928 wurden<br />
auf der Opel-Rennbahn mit Windhoff-Motorrädern zwei<br />
Weltrekorde aufgestellt. Kein Erfolg dagegen war die Entwikklung<br />
großvolumiger Viertakt-Modelle. Auch ein Zweizylinder-<br />
Boxer, der den damaligen BMW-Boxern sehr ähnelte, floppte<br />
am Markt. 1931 stellte Windhoff die Motorrad-Produktion wieder<br />
ein. Nach dem Krieg produzierten die zwei Werke in Friedenau<br />
und Neukölln dann wieder Wasser- und Ölkühler für<br />
PKW, Lastwagen und Diesellokomotiven sowie Anlagen für<br />
Sendestationen, Wärmetauscher für Bootsmotoren und Getriebe<br />
und Lager. 1976 wieder in eine GmbH umgewandelt.<br />
Los 763 Schätzwert 150-200 €<br />
Hansa-Bank Schlesien <strong>AG</strong><br />
Breslau, Aktie Ser. B 100 RM Aug. 1928<br />
(Auflage 2400, R 7) UNC<br />
Aktien dieser Bank waren zuvor völlig unbekannt<br />
gewesen!<br />
Gegründet 1869 als Genossenschaft, 1923 umgewandelt in eine<br />
<strong>AG</strong>. Filialen bestanden in Schweidnitz, Oels und Glatz,<br />
außerdem Depositen-Kassen in Breslau am Hauptbahnhof sowie<br />
am Sonnenplatz. 1943 auf die Mittelschlesische Bank <strong>AG</strong><br />
in Breslau übergegangen.<br />
Los 764 Schätzwert 300-375 €<br />
Hansa-Bank Schlesien <strong>AG</strong><br />
Breslau, Aktie Ser. B 100 RM Mai 1940<br />
(Auflage 600, R 11) VF<br />
Nur 2 Stück lagen im Reichsbankschatz, dies ist<br />
das letzte noch verfügbare. Rostfleck am oberen<br />
Rand.<br />
Los 765 Schätzwert 50-100 €<br />
Hansa-Brauerei <strong>AG</strong><br />
Stendal, Namens-Aktie 100 Goldmark<br />
23.12.1924 (Auflage 1700, R 3) EF<br />
Gründung 1899 als Bergbrauerei <strong>AG</strong> zu Stendal. Produktion<br />
ober- und untergäriger Biere, alkoholfreier Getränke und Eis.<br />
1920 Übernahme der Aktien-Bierbrauerei Bürgerliches Brauhaus<br />
in Stendal, auf deren Gelände die Braustätten konzentriert<br />
wurden. Die alte Bergbrauerei wurde stillgelegt und das Grundstück<br />
an die Stadtgemeinde Stendal verkauft. Bierniederlagen<br />
(1943): Arneburg, Bismarck, Gardelegen, Goldbeck, Oebisfelde,<br />
Osterburg, Schönhausen, Tangerhütte, Tangermünde, Werben.<br />
1950 Hansa-Brauerei Stendal, Hogrefe & Co. KG, 1955<br />
VEB Hansa-Brauerei Stendal, 1990 Hansa-Getränke Stendal<br />
GmbH, 1990 Hansa-Brauerei Stendal GmbH, 1992 Schließung.<br />
Los 766 Schätzwert 75-150 €<br />
Hansa-Brauerei <strong>AG</strong><br />
Stendal, Namensaktie 1.000 Goldmark<br />
23.12.1924 (Auflage 300, R 6) EF-VF<br />
Identische Gestaltung wie voriges Los.<br />
Los 767 Schätzwert 150-250 €<br />
Hansa-Lloyd Werke <strong>AG</strong><br />
Bremen, Genußrechtsurkunde 100 RM<br />
Jan. 1926 (R 6) EF<br />
Gründung 1913 als Hansa Automobilwerke <strong>AG</strong> in Varel. 1914<br />
Übernahme der Norddeutsche Automobil- und Motoren-<strong>AG</strong> in<br />
Bremen. Lange Zeit eine der erfolgreichsten deutschen Automarken.<br />
Der Vertrieb erfolgte in 18 deutschen Großstädten durch<br />
die G.D.A., ein Gemeinschaftsunternehmen von Hansa-Lloyd,<br />
N<strong>AG</strong> und Brennabor. 1930 auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise<br />
in Konkurs gegangen. Marke und Produktionsanlagen<br />
übernahm 1931 der Selfmademan und vorherige Vorstand<br />
Carl Friedrich Wilhelm Borgward, der schon zuvor mit seiner Goliathwerke<br />
Borgward & Co. GmbH die Aktienmehrheit erworben<br />
hatte. Der 1890 in Altona als Sohn eines Kohlenhändlers geborene<br />
Schlosserlehrling hatte 1921 in Bremen eine Kühlerfabrik<br />
gegründet und 1924 mit dem Dreirad-”Blitzkarren” und dem Goliath-Transporter<br />
erste Erfolge im Automobilgeschäft gehabt.<br />
Trotz Weltwirtschaftskrise machte er auch Hansa wieder zu einem<br />
Spitzenunternehmen der Branche und stellte 1949 mit dem<br />
Borgward Hansa die erste deutsche PKW-Nachkriegs-Neukonstruktion<br />
vor. Die 1955 erschienene “Isabella” galt in jener Zeit<br />
als die sportlichste deutsche Limousine. Mit seinen drei Werken<br />
(Goliath, Lloyd und Borgward), in denen 19.000 Leute arbeiteten,<br />
war Borgward damals den Konkurrenten BMW und Porsche<br />
ebenbürtig. Doch in der Automobilflaute 1960/61 wurden nach<br />
einer Überprüfung der Kostenstrukturen die Banken zögerlich -<br />
am 31.1.1961 musste Borgward die Zahlungen einstellen. Ob<br />
das nötig war? Die Gläubiger wurden schließlich zu fast 100 %<br />
befriedigt, aber der “Ein-Mann-Konzern” des Selfmademans<br />
Borgward passte wohl nicht mehr in die Zeit - die Werke wurden<br />
demontiert und nach Mexiko verkauft, Borgward starb am<br />
28.7.1963 an Herzversagen, als der erste Frachter voller Maschinenteile<br />
den Bremer Freihafen verließ.<br />
Los 768 Schätzwert 40-80 €<br />
Hanseatenwerke <strong>AG</strong><br />
Bremen, Aktie 100 RM Aug. 1925<br />
(Auflage maximal 500, R 4) EF<br />
Gründung 1921. Herstellung und Vertrieb von Schokolade, Kakao<br />
und Zuckerwaren aller Art. Noch nach dem 2. Weltkrieg<br />
Nr. 770<br />
Produktion von Schokolade und Pralinen. 1952 in eine GmbH<br />
umgewandelt.<br />
Los 769 Schätzwert 150-200 €<br />
Hanseatische Stuhlrohrfabriken<br />
Rümcker & Ude <strong>AG</strong><br />
Bergedorf-Hamburg, Aktie 100 RM März<br />
1937 (Auflage 200, R 8) VF<br />
Gründung 1860 in Bremen, <strong>AG</strong> seit 1912 durch Übernahme<br />
der Firmen H.W. Rümcker und Rudolf Ude & Co. Sitzverlegung<br />
im Mai 1927 nach Hamburg. Die Gesellschaft verarbeitete vor<br />
allem Peddig-Rohr und Malaccastöcke. 1963 wurde das Vermögen<br />
auf die KG Hamburg-Bergedorfer Stuhlrohrfabrik von<br />
Rud. Sieverts übertragen, die <strong>AG</strong> erlosch im selben Jahr.<br />
Los 770 Schätzwert 720-900 €<br />
Harkort’sche Bergwerke<br />
und chemische Fabriken <strong>AG</strong><br />
Gotha, Aktie 1.200 Mark 31.12.1921<br />
(Auflage 10000, R 10) VF<br />
Nur 3 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1872. Erwerb und Betrieb chemischer Fabriken, insbesondere<br />
der zu Harkorten gelegenen früheren Firma Harkort’s<br />
Erben gehörenden Schwefelsäurefabrik. Ursprünglicher Sitz<br />
der Gesellschaft war Hagen i.W., dann Haspe. 1876 Verpachtung<br />
der chemischen Fabrik und Verlegung des Sitzes nach<br />
Schwelm, wo die Eisen- und Schwefelkies-Zeche Schwelm betrieben<br />
wurde. 1884 wurden sämtliche Kuxe des Goldbergwerks<br />
“Rudaer Zwölf Apostel-<strong>Gewerkschaft</strong>” zu Brad und<br />
Krystor in Siebenbürgen sowie später das “St. Johann Evangelist<br />
Goldbergwerk” Grube Valeamori zu Krystor und das Goldbergwerk<br />
Muszari bei Ruda erworben. Nach Beendigung des 1.<br />
Weltkrieges mußten diese verkauft werden, der gesamte Besitz<br />
ist an eine rumänische <strong>AG</strong> durch Vertrag im Febr. 1921 übergegangen.<br />
1891 Betriebseinstellung der Zeche Schwelm.<br />
1897 Übernahme der chem. Fabrik Harkorten in Haspe. 1918<br />
Erwerb der Chemischen Fabrik Heinrichshall. Die Fabrik Heinrichshall<br />
mit Werk in Pohlitz bei Köstritz fabrizierte Schwefelsäure,<br />
Salzsäure, Glaubersalz, Schwefelnatrium, Antichlor.<br />
1927 erfolgte eine Fusion auf die Sachtleben <strong>AG</strong> für Bergbau<br />
und chemische Industrie, Köln. Die chemischen Produktionsstätten<br />
der Harkortschen Bergwerke wurden daraufhin sämtlich<br />
stillgelegt und veräußert.<br />
Los 771 Schätzwert 225-300 €<br />
Harkort’sche Bergwerke<br />
und chemische Fabriken <strong>AG</strong><br />
Gotha, Aktie 1.200 Mark 29.11.1922<br />
(Auflage 30000, R 8) VF<br />
Identische Gestaltung wie voriges Los.<br />
Los 772 Schätzwert 320-400 €<br />
Harkort’sche Bergwerke<br />
und chemische Fabriken <strong>AG</strong><br />
Gotha, Genußschein 1.200 Mark Juni<br />
1923 (Auflage 62500, R 8) VF<br />
Nur 11 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
65
Nr. 772<br />
Los 773 Schätzwert 600-750 €<br />
Harkort’sche Bergwerke und<br />
chemische Fabriken zu Schwelm<br />
und Harkorten <strong>AG</strong><br />
Gotha, St.-Prior.-Aktie (Ersatzstück) 1.200<br />
Mark 1.7.1906 (Auflage 4618, R 9) VF-<br />
1921 umgewandelt in eine Stamm-Aktie, umgestellt<br />
auf 40 RM. Nur 7 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Los 774 Schätzwert 30-75 €<br />
Hartmann & Braun <strong>AG</strong><br />
Frankfurt a.M., Aktie 1.000 RM 17.4.1942<br />
(Auflage 1586, R 3) EF<br />
Gegründet 1879 von Eugen Hartmann als „optische Anstalt,<br />
physikalisch astronomische Werkstätte“ in Würzburg. 1882 trat<br />
Wunibald Braun, der Bruder Ferdinand Brauns (Erfinder der<br />
Braunschen Röhre, Nobelpreisträger für Physik) als Teilhaber<br />
ein. 1884 erfolgte auf dessen Empfehlung die Verlegung des<br />
Betriebes nach Frankfurt-Bockenheim. Seit 1901 <strong>AG</strong>. Produktionsschwerpunkt<br />
waren elektrische Meßgeräte. Ab 1930 vollzog<br />
man den Schritt von der Meß- zur Regelungstechnik. Nach<br />
dem Krieg folgte die Entwicklung zu einem modernen Unternehmen<br />
der Meß-, Regel- und Automatisierungstechnik. 1981<br />
ging der von der AEG seit 1968 gehaltene Aktienanteil an die<br />
Firma Mannesmann über, die Hartmann & Braun 1995 an das<br />
internationale Unternehmen Elsag Bailey Process Automation<br />
verkaufte. 1999 wurde Hartmann & Braun dann vollständig in<br />
die schwedisch-schweizerische ABB integriert.<br />
Los 775 Schätzwert 50-100 €<br />
Hartstoff-Metall <strong>AG</strong> (Hametag)<br />
Berlin-Cöpenick, Aktie 200 RM 9.12.1924<br />
(Auflage 2450, R 5) EF<br />
Gegründet 1923 zwecks Fabrikation von Hartstoffen aus<br />
Metall- und anderen Pulvern. Hierbei wurden Metallspäne aus<br />
der spanabhebenden Fertigung als Ausgangsprodukt einge-<br />
66<br />
Ehemalige Maschinenhalle der Harkort'schen Fabrik<br />
Nr. 764<br />
setzt. Das Hametag-Verfahren ist eines der ältesten Verfahren<br />
zur Herstellung von Metallpulvern. Die hierfür eingesetzten Wirbelschlagmühlen<br />
führen aufgrund der erheblichen Lärmbelästigung<br />
zu großen Umweltproblemen und werden deshalb zumindest<br />
in den westlichen Ländern nicht mehr eingesetzt.<br />
Los 776 Schätzwert 300-375 €<br />
Hartung <strong>AG</strong> Berliner Eisengiesserei<br />
und Gussstahlfabrik<br />
Berlin-Lichtenberg, Aktie 1.000 Mark<br />
27.10.1920 (Auflage 1400, R 11) VF-F<br />
Faksimile-Unterschrift des Deutsche-Bank-Direktors<br />
Paul Mankiewicz als AR-Vorsitzender. Zuvor<br />
unbekannter Jahrgang, nur 2 Stück lagen im<br />
Reichsbankschatz., dies ist das letzte noch verfügbare.<br />
Fehlstelle rechts oben schön ergänzt.<br />
Erwerb und Fortbetrieb der Berliner Gussstahlfabrik und Eisengiesserei<br />
Hugo Hartung in der Prenzlauer Allee 41. Fabrikation<br />
von Gussartikeln aller Art, 1897 auch Aufnahme der Fahrräderfabrikation.<br />
Von 1913 bis 1935 Firmierung als Hartung <strong>AG</strong><br />
Berliner Eisengießerei und Gußstahlfabrik. 1924 Erwerb der<br />
Aktienmehrheit der Eyth-Lesser Maschinenfabrik <strong>AG</strong> in Brandenburg<br />
a.H., 1936 fusionsweise Übernahme der Otto Jachmann<br />
<strong>AG</strong> Berlin-Borsigwalde (Gummi- und Kabelmaschinen,<br />
Leichtmetallgießerei) und Änderung des Firmennamens in Hartung-Jachmann<br />
<strong>AG</strong>. Großaktionär war die A.E.G.<br />
Los 777 Schätzwert 30-75 €<br />
Hartwig & Vogel <strong>AG</strong><br />
Dresden, Aktie 1.000 RM 18.10.1932<br />
(Auflage 3933, R 3) UNC-EF<br />
Gründung 1910. Erzeugnisse: Schokolade, Kakao, Marzipan,<br />
Konfitüren, Honigkuchen, Zucker- und Teigwaren aller Art, ferner<br />
Handel mit Tee, Kaffee und Tabakwaren, schließlich Betrieb<br />
von Verkaufsautomaten. 1950 verlagert nach Einbeck, 1951<br />
auf die Kant Chocoladenfabrik <strong>AG</strong>, Einbeck, übergegangen.<br />
Neue Firma: Kant-Hartwig & Vogel <strong>AG</strong>, Einbeck, 1957 gelöscht.<br />
Nr. 777<br />
Los 778 Schätzwert 10-40 €<br />
Hauptstadt Breslau<br />
Breslau, 7 % Schuldv. 500 RM Juli 1926<br />
(R 3) EF<br />
Teil einer Anleihe von 10 Mio. RM.<br />
Los 779 Schätzwert 10-30 €<br />
Haus und Heim Wohnungsbau-<strong>AG</strong><br />
Berlin, Aktie 200 RM Aug. 1940 (Auflage<br />
6700, R 3) UNC<br />
Gründung 1903 als „Terraingesellschaft am Neuen Botanischen<br />
Garten <strong>AG</strong>“, ab 1927 “Terrain-<strong>AG</strong> Botanischer Garten-<br />
Zehlendorf-West”, 1938 Umfirmierung wie oben. Von Anfang<br />
an betrieb die Ges. die Bahnanbindung ihrer Terrains: 1909<br />
baute sie an der Wannseebahn die Haltestelle “Botanischer<br />
Garten”, 1928 Bildung eines Konsortiums zwecks Verlängerung<br />
der Dahlemer Schnellbahn, 1929 Verlängerung der U-<br />
Bahn nach Zehlendorf-West. Während die sog. “Arisierungen”<br />
in der Börsenliteratur sonst eher schamhaft verschwiegen wurden,<br />
findet sich hier schon im <strong>AG</strong>-Handbuch 1933 ein entlarvender<br />
Hinweis: “1933 im Zuge der Gleichschaltung vollständiger<br />
Wechsel in der Verwaltung. Die neue Leitung hat das Be-<br />
Nr. 780<br />
Nr. 773<br />
streben, das Unternehmen auf rein nationaler (1934 ersetzt<br />
durch: nationalsozialistischer) Basis weiterzuführen.” Großaktionär<br />
war nun die “Ahag” Allgemeine Häuserbau-<strong>AG</strong>, Berlin;<br />
bei der ganzen Geschichte scheint die reichseigene Gagfah mit<br />
verwickelt gewesen zu sein. Nach dem Krieg vor allem in Lichterfelde<br />
mit Wohnungsneubauten wieder aktiv geworden. Die<br />
noch heute im Berliner Freiverkehr börsennotierte <strong>AG</strong> besitzt<br />
aktuell 203 Wohnungen.<br />
Los 780 Schätzwert 75-125 €<br />
Hausbau <strong>AG</strong> des Handwerks der Ostmark<br />
Arbeitseinsatz-Ges. des Reichsstandes<br />
des Deutschen Handwerks<br />
Wien, Namensaktie 1.000 RM Nov. 1940<br />
(Auflage 500, R 6) EF<br />
Gründung 1938. Bis 1942: Arbeitseinsatzgesellschaft des Bauhandwerks<br />
der Ostmark, danach Einsatz-Gesellschaft des<br />
Reichsstandes des Deutschen Handwerks.<br />
Los 781 Schätzwert 20-40 €<br />
HE<strong>AG</strong> Hannoversche Eisengiesserei<br />
und Maschinenfabrik <strong>AG</strong><br />
Anderten bei Hannover, Genußschein 100<br />
RM Okt. 1933 (R 5) EF<br />
Gründung 1857, <strong>AG</strong> seit 1859 (ab 1930 Namenszusatz „Heag“<br />
Hannoversche Eisengießerei und Maschinenfabrik <strong>AG</strong>). Drei<br />
Abteilungen: Gießerei, Landmaschinenbau (Mäher, Heuwender,<br />
Kartoffelernter, Ackerwagen) und Rohrreinigung (reinigte nach<br />
patentierten Verfahren Rohrleitungsnetze bis 1.000 mm Durchmesser).<br />
Börsennotiz Hannover. 1953 Vergleich, 1955 Anschlußkonkurs.<br />
Los 782 Schätzwert 30-75 €<br />
Hebezeug & Motorenfabrik <strong>AG</strong><br />
Karlsruhe-Bulach, Genußschein<br />
15.12.1926 (R 3) EF<br />
Gegründet 1921 als Labor Apparatebau <strong>AG</strong> mit Sitz in Berlin-<br />
Tempelhof. Bau von Starkstromapparaten und Handel mit diesen.<br />
Beteiligt an der Schindler Aufzügefabrik GmbH, Berlin<br />
(40%). Seit 1933 war der Fabrikationsbetrieb stillgelegt, ein Teil<br />
der Maschinen wurde verkauft. 1950 gelöscht.
Los 783 Schätzwert 100-150 €<br />
Heckert & Co. <strong>AG</strong><br />
Halle a.d. Saale, Aktie 1.000 Mark Aug.<br />
1923 (Auflage 50000, R 8) EF<br />
Nur 12 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gegründet 1921 mit Sitz in Berlin zwecks Herstellung und<br />
Großhandel sämtlicher Erzeugnissen der Glas- und Porzellanindustrie,<br />
insbesondere Pachtung sämtlicher Betriebe der Firma<br />
Heckert & Co. Glasgroßhandlung, Halle a.d.Saale. 1922<br />
Sitzverlegung nach Halle a.d.Saale und gleichzeitig Einrichtung<br />
einer Filiale in Königsberg i.Pr. Ebenfalls 1922 kam es zu Differenzen<br />
in der Verwaltung, die in der Entlassung und kurz darauf<br />
Wiedereinstellung des Vorstands Arno Heckert gipfelten.<br />
Entsprechend sackte der Kurs der in Halle a.S. und Leipzig börsennotierten<br />
<strong>AG</strong> bis Ende 1923 auf nur noch 1,7 % des Nennwertes<br />
ab. 1924 Konkurseröffnung.<br />
Los 784 Schätzwert 40-80 €<br />
Heerbrandt-Werke <strong>AG</strong><br />
Raguhn i.Anh., Aktie 1.000 RM 1.5.1943<br />
(R 5) EF<br />
Gründung 1861, <strong>AG</strong> seit 1897. Bis 1936: Maschinenbau und<br />
Metalltuchfabrik. Bis 1943: Maschinenbau und Metalltuchfabrik<br />
<strong>AG</strong> vorm. Gottl. Heerbrandt, danach Heerbrandt-Werke <strong>AG</strong>.<br />
Fabrikation von gelochten Blechen, Maschinen und Apparaten<br />
(Apparate für die Zuckerindustrie, Filterrohre). 1944/45 Herstellung<br />
von Flugzeugteilen für die Junkers-Werke.<br />
Los 785 Schätzwert 300-375 €<br />
Heidelberger Federhalter-Fabrik<br />
Koch, Weber & Co. <strong>AG</strong><br />
Heidelberg, Aktie 20 RM Jan. 1925<br />
(Auflage 10000, nach Kapitalschnitt 1928<br />
noch 3000, R 11), umnummeriert und mit<br />
Überstempelung “Gültig geblieben ...” VF<br />
Die Heidelberger Federhalterfabrik im Norden von Handschuhsheim<br />
(Dossenheimer Landstr. 98) wurde 1883 gegründet,<br />
1921 wandelten die Besitzer Heinrich Koch und Rudolph<br />
Weber die Firma in eine <strong>AG</strong> um. Mit den Marken Kaweco und<br />
Perkeo machten sie Heidelberg zum Zentrum der deutschen<br />
Füllhalterindustrie. Die Sicherheitshalter, bei denen die Feder<br />
zum Schreiben aus dem Schaft herausgedreht wurde, waren<br />
zunächst mit Federn aus US-amerikanischer Produktion ausgestattet,<br />
nach dem 1. Weltkrieg wurde eine eigene Produktion<br />
von Goldfedern aufgebaut. Kaweco stellte ferner Füllbleistifte,<br />
Tinten, Lederetuis und einen der weltweit ersten Filz- und<br />
Röhrchenschreiber her, beschäftigt waren über 200 Mitarbeiter.<br />
Nach der Hyper-Inflation kam die in Frankfurt/Main börsennotierte<br />
<strong>AG</strong> in Schwierigkeiten, eine 1928 versuchte Sanierung<br />
schlug fehl, 1929 in Konkurs gegangen. Nach Übernahme<br />
durch die “Badische Füllfederfabrik Worringen u. Grube” in<br />
Wiesloch wurden ab 1930 die ersten Kolbenfüllhalter gefertigt<br />
und unter den Namen Dia, Elite, Kadett, Carat und Sport vermarktet.<br />
Nach kriegsbedingten Störungen wurde unter Leitung<br />
von Friedrich Grube 1947 die Produktion wieder voll aufgenommen,<br />
1950 wurde wieder der alte Beschäftigtenstand von<br />
230 Mitarbeitern erreicht. Friedrich Grube starb 1960, seine<br />
Witwe und die Söhne hielten den Niedergang nicht auf und<br />
1970 wurde die Produktion eingestellt. Ein Zweig der Familie<br />
versuchte den Neuanfang und brachte 1972 zur Olympiade in<br />
München den “Sport” mit spezieller Olympiamünze heraus, als<br />
Patronenhalter wurde das Modell zu Werbezwecken u.a. an die<br />
Deutsche Bundespost geliefert. 1981 musste Kaweco endgültig<br />
schließen, doch unter Nutzung der Namensrechte werden<br />
kleinere Auflagen der Kaweco-Federhalter in edleren Materialien<br />
von Dritten bis heute vertrieben.<br />
Los 786 Schätzwert 100-150 €<br />
Heimstättengesellschaft Sachsen<br />
Gemeinnützige Gesellschaft GmbH<br />
Dresden, 5 % Schuldv. 100 RM 1.1.1932<br />
(R 9) VF<br />
Nur 7 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Die Ges. errichtete 1926-1928 entlang der Teplitzer und Dohnaer<br />
Straße die Postsiedlung. Die Ges. ging 1957 in Konkurs,<br />
nicht zuletzt wegen der stark gestiegenen Forderungen. Auf der<br />
Gläubigerversammlung wurde einstimmig beschlossen, das<br />
Vermögen zur Abgeltung der volkseigenen Forderungen in<br />
Volkseigentum zu übertragen.<br />
Los 787 Schätzwert 480-600 €<br />
Heine & Co. <strong>AG</strong><br />
Leipzig, 4,5 % Schuldv. 1.000 Mark Juli<br />
1920 (Auflage 4000, R 11) VF+<br />
Teil einer Anleihe in Höhe von 4 Mio. Mark. Nur 2<br />
Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1911 unter Übernahme der seit 1859 bestehenden<br />
oHG Heine & Co., Leipzig. Als Spezialunternehmen der chemischen<br />
Industrie eine der bekanntesten deutschen Firmen auf<br />
dem Gebiet der natürlichen und künstlichen Riechstoffe sowie<br />
der natürlichen ätherischen Öle und spirituösen Essenzen.<br />
Werke in Leipzig und Riesa-Gröba. Eigene Blumenkulturen auf<br />
75.000 qm Ländereien sowie deutsche und französische Blütenextrakte<br />
dienten der Rohstoffversorgung. Der Firmeninhaber<br />
Heine war einer der Mäzene der Weltsprache Esperanto. Börsennotiz<br />
Berlin und Leipzig. 1954 Umwandlung in eine KG.<br />
1972 verstaatlicht und als VEB Aromatic Leipzig fortgeführt.<br />
Die Gesellschaft wurde 1998 auf die Altaktionäre rückübertragen<br />
und eine Abwesenheitspflegschaft amtlich bestellt; Auszahlung<br />
von Liquidationserlösen.<br />
Nr. 776 Nr. 785<br />
Carl Heine (1819 - 1888)<br />
Los 788 Schätzwert 20-60 €<br />
Heine & Co. <strong>AG</strong><br />
Leipzig, VZ-Aktie 1.000 Mark April 1921<br />
(Auflage 3000, R 2) UNC-EF<br />
Identische Gestaltung wie folgende Lose.<br />
Los 789 Schätzwert 120-150 €<br />
Heine & Co. <strong>AG</strong><br />
Leipzig, VZ-Aktie 1.000 Mark Nov. 1922<br />
(Auflage 3000, R 8) EF<br />
Ohne Stücke-Nr. aber umgestellt auf 17 RM. Nur<br />
15 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Los 790 Schätzwert 100-150 €<br />
Heine & Co. <strong>AG</strong><br />
Leipzig, VZ-Aktie 1.000 Mark Mai 1923<br />
(Auflage 6000, R 8) EF<br />
Ohne Stücke-Nr., aber umgestellt auf 17 RM.<br />
Los 791 Schätzwert 20-50 €<br />
Heinemann’s Büstenfabrik <strong>AG</strong><br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark Febr. 1923<br />
(Auflage 32300, R 4) EF<br />
Kpl. Kuponbogen anhängend.<br />
Gründung 1921 unter Übernahme des Aktienmantels der „Berliner<br />
Papier-Teppich <strong>AG</strong>“. Die <strong>AG</strong> übernahm vom Fabrikanten<br />
Arno Goldstein dessen Fabrik in der Kurstr. 51 (später Lands-<br />
berger Straße). Hergestellt wurden Büsten, Schaufensterpuppen,<br />
Dekorationsutensilien und Ladeneinrichtungen. Das nicht<br />
unbedeutende Unternehmen mit Filialen in Leipzig, Hamburg,<br />
Kopenhagen, Prag, Amsterdam, Budapest, London und Helsinki<br />
war in Hamburg börsennotiert. Ende 1923 umbenannt in<br />
“Heinemanns Vereinigte Fabriken <strong>AG</strong>”. Danach verliert sich die<br />
Spur der <strong>AG</strong>, die Fabrik taucht als “Vereinigte Holz- und Metallbearbeitungsfabriken”<br />
später noch einmal als Phonomöbel-<br />
Hersteller (u.a. für Radio Lloyd) auf.<br />
Los 792 Schätzwert 30-80 €<br />
Heinrich Kaufmann & Söhne<br />
Indiawerk <strong>AG</strong><br />
Solingen, Aktie 1.000 RM 30.1.1928<br />
(Auflage 950, R 3) EF<br />
Gegründet 1927. Firma bis 16.1.1928 Westdeutsche Stahlund<br />
Metallwaren <strong>AG</strong>, dann bis 12.10.1932 Heinrich Kaufmann<br />
& Söhne, Indiawerk <strong>AG</strong>, danach Grundstücks-<strong>AG</strong> Solingen<br />
Rheinstraße.<br />
Los 793 Schätzwert 30-75 €<br />
Herdfabrik Delligsen <strong>AG</strong><br />
Delligsen, Aktie 100 RM Jan. 1934.<br />
Gründeraktie (Auflage 2000, R 5) EF<br />
Gründung Ende 1933 durch die Anleihegläubiger der 1931 in<br />
Konkurs gegangenen Maschinen- und Fahrzeugfabriken Alfeld-Delligsen<br />
<strong>AG</strong> (gegr. 1899 als „Bernburger Maschinenfabrik“,<br />
Sitzverlegung 1915 nach Alfeld und 1923 nach Hannover;<br />
Fabrikationsprogramm: Maschinen für die Papier- und<br />
Chemieindustrie, Herde, Öfen, Waggons). Die ursprünglich<br />
1904 eröffnete Herdfabrik Delligsen verfügte auch über ein<br />
Emaillierwerk, eine Graugießerei und eine Vernickelung. Die<br />
nach dem Einmarsch der Alliierten 1945 stillgelegte Fabrik fiel<br />
der Demontage zum Opfer, lief aber schon Ende 1946 wieder<br />
mit voller Kapazität. Die in Hannover börsennotierte <strong>AG</strong> wurde<br />
1959 insolvent (Eröffnung des Vergleichsverfahrens).<br />
Los 794 Schätzwert 50-120 €<br />
Herdfabrik und Eisengießerei <strong>AG</strong><br />
Herne i.W., Aktie 1.000 Mark Mai 1923.<br />
Gründeraktie (Auflage 6200, nach Kapitalumstellung<br />
1924 noch 4650, R 5) EF<br />
1897 gegründet, seit 1922 <strong>AG</strong>. Herstellung und Verkauf von<br />
Kochherden (Kohle-, Gas- u. Elektroherde), außerdem Herdöfen<br />
und Gaskocher. Nach dem Krieg auch Produktion von Ölöfen und<br />
Kühlschränken. Angesichts des nicht mehr zeitgemäßen Produktionsprogramms<br />
mußte der Betrieb mit zuletzt kaum mehr als<br />
100 Mitarbeitern 1972 schließen, 1975 erlosch die <strong>AG</strong>.<br />
Los 795 Schätzwert 50-120 €<br />
Heringsfischerei Dollart <strong>AG</strong><br />
Emden, Aktie 1.000 Mark Juli 1921<br />
(Auflage 600, R 5) EF<br />
Seefischfang mit 5 Segel- und 2 Dampfloggern, vier Schiffe<br />
gingen im 1. Weltkrieg verloren. Betriebs- und Verwaltungsgemeinschaft<br />
mit der Emder Heringsfischerei und der Großer Kurfürst<br />
Heringsfischerei, mit denen gemeinsam 1930/31 auch<br />
die Flotte der Glückstädter Fischerei <strong>AG</strong> übernommen wurde.<br />
1944 Totalbombenschaden, 1947 Beginn der Wiederaufbauarbeiten.<br />
1950 Verschmelzung mit der Großer Kurfürst Heringsfischerei<br />
<strong>AG</strong>. 1961 in eine GmbH umgewandelt.<br />
67
Los 796 Schätzwert 20-60 €<br />
Hermann Köhler <strong>AG</strong><br />
Altenburg (Thür.), Aktie 1.000 RM Mai<br />
1942 (Auflage 750, R 3) EF<br />
Zwei Vignetten mit Nähmaschinen.<br />
Gründung 1921. Herstellung von Nähmaschinen. 1923 Angliederung<br />
der Möbelfabrik <strong>AG</strong> Pößneck. Börsennotiz: Freiverkehr<br />
Leipzig. 1945 Fusion der Firmen Hermann Köhler <strong>AG</strong>, Dietrich &<br />
Co. und Winselmann zum Nähmaschinenwerk Altenburg. Nach<br />
der Verstaatlichung in der DDR VEB Nähmaschinenwerk Altenburg,<br />
nach der Privatisierung 1990 ALTIN Nähtechnik GmbH.<br />
Los 797 Schätzwert 60-80 €<br />
Hermann Levin GmbH<br />
Göttingen, 4 % Genußrechtsurkunde 100<br />
RM April 1926 (R 10) VF<br />
Original signiert. Nur 2 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Wollmanufaktur, gegründet 1837 von Hermann Levin und August<br />
Böhme. Die Levinsche Tuchfabrik entwickelte sich zum<br />
größten Unternehmen der Stadt vor dem 1. Weltkrieg. Den wirtschaftlichen<br />
Höhepunkt erreichte die Firma 1912. Der Inhaber<br />
war 1924 einer der Mitbegründer der Confag (Confektion) <strong>AG</strong>,<br />
Berlin. 1930 ging die Firma in Liquidation.<br />
Los 798 Schätzwert 30-60 €<br />
Hermann Meyer <strong>AG</strong><br />
Köln, Aktie 1.000 Mark Okt. 1921<br />
(Auflage 20000, R 8) VF-<br />
Gründung 1917. Herstellung von Tuch- und Textilwaren, Großhandel<br />
mit Waren der Tuchmanufaktur und Bekleidungsbranche.<br />
1921 Übernahme der Herrentuchfabrik J. Weber Söhne in<br />
Euskirchen. Zweigniederlassungen in Ober-Mylau i.V. und Euskirchen<br />
Rhld. Notiz im Freiverkehr Berlin, Frankfurt/M., Hamburg<br />
und Köln. Infolge von vielen Insolvenzen anderer Firmen<br />
erlitt die Ges. 1925 erhebliche Verluste. Infolgedessen Beschluss<br />
der Auflösung, 1930 nach erfolgter Abhaltung des<br />
Schlusstermins erloschen.<br />
Los 799 Schätzwert 30-75 €<br />
Hermann Schött <strong>AG</strong><br />
Rheydt, Aktie 100 RM Febr. 1936 (Auflage<br />
erst 5000, später noch 3190, R 5) EF<br />
Eines der weltweit ältesten Unternehmen der graphischen Industrie,<br />
gegründet bereits 1818, <strong>AG</strong> seit 1899. Die Großdrukkerei<br />
beschäftigte zuletzt um die 400 Leute und war auf den<br />
Druck von Zigarrenbanderolen, Zigarrenkistenetiketten, Schokoladeumschläge,<br />
Pralinenpackungen, Plakate, Wein- und Liköretiketten<br />
sowie Faltschachteln aller Art spezialisiert. Börsennotiz:<br />
Freiverkehr Düsseldorf. 1982 Konkurs.<br />
68<br />
Los 800 Schätzwert 50-100 €<br />
Hermes Kreditversicherungsbank <strong>AG</strong><br />
Berlin, Namensaktie 100 RM 25.6.1928<br />
(eingezahlt mit 25 %, Auflage 40000, R 3)<br />
EF<br />
Prägesiegel mit schönem Hermes-Kopf.<br />
Gründung der Hermes Kreditversicherungsbank <strong>AG</strong> 1917 in<br />
Berlin (1937 Umfirmierung Hermes Kreditversicherungs-<strong>AG</strong>)<br />
als Spezialgesellschaft für Kredit-, Kautions- und Vertrauenschadenversicherung.<br />
1924 Fusion mit der Merkur-Kreditversicherungsbank<br />
<strong>AG</strong> in Stuttgart. 1926 machte sich das Deutsche<br />
Reich durch Übernahme weitgehender Haftungen für Exportgeschäfte<br />
zum Träger der neugeschaffenen deutschen Ausfuhr-<br />
Kredit-Versicherung. Mit der Durchführung wurden der Hermes<br />
und die damals noch bestehende Frankfurter Allgemeine Versicherungs-<strong>AG</strong><br />
betraut (letztere verkaufte ihre Kreditversicherungssparte<br />
dann 1929 an den Hermes). 1949 Errichtung eines<br />
Zweitsitzes in Hamburg, wo seitdem und bis heute die<br />
Unternehmensleitung sitzt. Im gleichen Jahr erhielt der Hermes<br />
auch das Mandat der Bundesregierung für die Bearbeitung der<br />
neugeschaffenen Ausfuhr-Garantien des Bundes. Mehrheitsaktionär<br />
des in München und Berlin börsennotierten Hermes war<br />
jahrzehntelang die Münchener Rück. Die Allianz-Versicherung,<br />
die schon immer eine Schachtelbeteiligung besessen hatte,<br />
baute diese zuletzt zur Mehrheit aus und drängte die letzten<br />
freien Aktionäre 2002 per Sqeeze-Out heraus, danach Namensänderung<br />
auf einheitlichen Konzernnamen Euler-Hermes<br />
Kredtitversicherungs-<strong>AG</strong>.<br />
Los 801 Schätzwert 50-100 €<br />
Herrenmühle vormals C. Genz <strong>AG</strong><br />
Heidelberg, Aktie 100 RM 17.10.1933<br />
(Auflage 3300, R 4) EF<br />
Die Ursprünge der Herrenmühle als Wassermühle am Neckar<br />
reichen bis ins 14. Jh. zurück. <strong>AG</strong> seit 1897. Die Getreide-<br />
Mühle arbeitete bis 1926 mit Dampf, dann wurde auf elektrischen<br />
Betrieb umgestellt. Der Betrieb wurde bis zuletzt ständig<br />
modernisiert und erweitert, war aber am Ende kaum noch rentabel.<br />
Deshalb zog der Großaktionär Berliner Handels-Gesellschaft<br />
(später BHF-Bank) die Reißleine: 1962 wurde der Mühlenbetrieb<br />
eingestellt und die <strong>AG</strong> 1964 aufgelöst.<br />
Los 802 Schätzwert 10-30 €<br />
Herrmann-Konzern<br />
<strong>AG</strong> für Industriebeteiligung<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark 7.2.1923<br />
(Auflage 240000, R 4) EF<br />
Mit kpl. anh. Kuponbogen.<br />
Gründung 1921. Zum Konzern gehörten u.a. die Thüringer Uhrenfabrik<br />
Edmund Herrmann<strong>AG</strong> in Kraftsdorf i.Th./Berlin, die<br />
Deutsch-Schweizerischen Uhrenfabriken <strong>AG</strong> in Plauen und die<br />
Chemische Leuchtmittel <strong>AG</strong> in Leipzig. Bis 7.2.1923: Novo-<br />
Fournier-<strong>AG</strong>. 1928 von Amts wegen gelöscht.<br />
Los 803 Schätzwert 75-150 €<br />
Heymann & Felsenburg <strong>AG</strong><br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark 28.1.1922.<br />
Gründeraktie (Auflage 8000, R 6) VF-F<br />
Gründung 1921 u.a. durch Rudolf Karstadt, eingetragen Jan.<br />
1922. Herstellung und Vertrieb von Pelz- und Rauchwaren.<br />
1932 befanden sich über 90 % des AK in der Hand der Rudolf<br />
Karstadt <strong>AG</strong>. 1931 wurde die Gesellschaft aufgelöst.<br />
Los 804 Schätzwert 25-100 €<br />
Heymann & Schmidt<br />
Luxuspapierfabrik <strong>AG</strong><br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark 2.1.1905.<br />
Gründeraktie (Auflage 1500, nach Kapitalherabsetzung<br />
1915 noch 1125, R 3) EF<br />
Großformatiges Papier.<br />
Gegründet zwecks Erwerb und Erweiterung der „Berliner Luxuspapierfabrik<br />
Heymann & Schmidt“ in der Schönhauser Allee<br />
164. Herstellung von Kalendern, Postkarten, Plakaten, Reklameartikeln,<br />
Glückwunschkarten und Verpackungen. Umbenannt<br />
1922 in “Heymann & Schmidt <strong>AG</strong>”. 1933 (inzwischen lag<br />
das Aktienkapital in schwedischen Händen) Stilllegung der Luxuspapierfabrik,<br />
fortan nur noch Verwaltung und Vermietung<br />
der ehemaligen Betriebsgrundstücks. Die Verwaltung befand<br />
sich in Berlin W 8, Unter den Linden 43/45 in den Räumen der<br />
Unionbank. 1941 in “Schönhauser Industriehof Grundstücks-<br />
<strong>AG</strong>” umfirmiert. 1943 wurde das Areal bei einem Luftangriff<br />
völlig zerstört. 1951 Kapitalumstellung von 225.000 RM auf<br />
6.750 DM, Verlegung des Verwaltungssitzes nach Berlin-Steglitz,<br />
1952 Umwandlung in eine GmbH.<br />
Los 805 Schätzwert 40-75 €<br />
Hirsch Kupfer- und Messingwerke <strong>AG</strong><br />
Berlin, Aktie 1.000 RM Juli 1928<br />
(Blankette, R 7) EF<br />
Gründung des Ilsenburger Kupferhammers bereits 1595. 1841<br />
Inbetriebnahme einer wasserbetriebenen Walzhütte für Kupfer<br />
und Blei durch die Industriellenfamilie Hirsch. Gründung der <strong>AG</strong><br />
1906 unter Übernahme des Kupferwerks in Ilsenburg am Harz<br />
und des Messingwerks bei Eberswalde von der oHG Aron<br />
Hirsch & Sohn in Halberstadt. 1918 fusionsweise Übernahme<br />
der Chemische Fabrik Hönningen und vorm. Messingwerk Reinickendorf<br />
R. Seidel <strong>AG</strong> in Berlin. 1921 Erwerb der Aktienmehrheit<br />
an der Hüttenwerke C. Wilh. Kayser & Co. <strong>AG</strong> in Berlin<br />
(heute als Hüttenwerke Kayser <strong>AG</strong> in Lünen zur Norddeutschen<br />
Affinerie gehörig). 1932 spalteten die Großaktionäre<br />
(Deutsche Bank und Dresdner Bank) die Firma auf: Die “alte”<br />
<strong>AG</strong> wurde umbenannt in Berlin-Ilsenburger Metallwerke <strong>AG</strong>, ihr<br />
verblieb die Kupferhütte Ilsenburg (in der DDR bis zuletzt die<br />
schlimmste Giftschleuder am Fuße des Harzes), die 1934 in die<br />
Kupferwerke Ilsenburg <strong>AG</strong> ausgegründet wurde, während die<br />
Berlin-Ilsenburger Metallwerke <strong>AG</strong> 1936 in Liquidation trat.<br />
Das Ilsenburger Werk ist heute eine Produktionsstätte für<br />
Grobbleche der Salzgitter <strong>AG</strong>. Der wesentlich größere Teil des<br />
Unternehmens, die Kupfer- und Messingwerke Finow (Mark),<br />
wurde bei der Betriebsaufspaltung 1934 in die unter altem Namen<br />
neu gegründete “Hirsch Kupfer- und Messingwerke <strong>AG</strong>”<br />
eingebracht, deren Großaktionäre wurden die “alte” Hirsch<br />
Kupfer (jetzt: Berlin-Ilsenburger Metallwerke <strong>AG</strong>) und die Otavi<br />
Minen- und Eisenbahn-Gesellschaft, South West Africa. Das<br />
riesige, 7,7 Mio. qm große Werk hatte 9,3 km Wasserfront am<br />
Oder-Havel-Kanal und am Finowkanal, zwei eigene Bahnhöfe<br />
mit 7,5 km Normalspurbahnen sowie eine 18 km lange<br />
schmalspurige Fabrikbahn. Als AEG-Tochter “Finow Kupferund<br />
Messingwerke <strong>AG</strong>” überstand der Betrieb den Krieg völlig<br />
unbeschädigt und wurde 1945 von der Roten Armee besetzt.<br />
Nach wenigen Tagen begannen die Sowjets mit dem Abtransport<br />
aller Werkseinrichtungen, entfernten die Konstruktionsele-<br />
mente der Werkshallen und sprengten die stehengebliebenen<br />
Mauerstümpfe. Damit erlosch eine weltbekannte, über 250<br />
Jahre alte Produktionsstätte. Die <strong>AG</strong> wurde enteignet. 1947<br />
von der AEG als „Hirsch“ Kupfer- und Messingwerke GmbH in<br />
Hamburg, später Frankfurt/Main für den Bereich Metallhandel<br />
neu gegründet.<br />
Los 806 Schätzwert 25-100 €<br />
Hochofenwerk Lübeck <strong>AG</strong><br />
Lübeck, Aktie 1.000 Mark 1.12.1922<br />
(Auflage 20000, R 1) EF<br />
Großformatig. Schöne Zierumrandung.<br />
Gründung 1905. Herstellung von Roheisen, Betrieb eines Zementwerkes,<br />
Gewinnung und Raffinierung von Kupfer, außerdem<br />
Betonwarenfabrik. Den Aufsichtsrat präsidierte bis Kriegsende<br />
Friedrich Flick. 1954 Umbenennung in Metallhüttenwerke<br />
Lübeck <strong>AG</strong>, bald darauf in eine GmbH umgewandelt und in<br />
Liquidation gegangen. 1959 Übertragung des Vermögens auf<br />
die Hauptgesellschafterin „Gesellschaft für Montaninteressen<br />
mbH“ in Lübeck.<br />
Los 807 Schätzwert 20-50 €<br />
Hochofenwerk Lübeck <strong>AG</strong><br />
Lübeck-Herrenwyk, 5 % Teilschuldv. 500<br />
RM Jan. 1940 (Auflage 1000, R 4) EF<br />
Los 808 Schätzwert 20-60 €<br />
Hochtief <strong>AG</strong> für Hoch- und Tiefbauten<br />
vorm. Gebr. Helfmann<br />
Essen, Aktie 100 RM 20.2.1926 (Auflage<br />
8400, R 2) EF<br />
Gründung 1896 unter Übernahme der Fa. Gebr. Helfmann,<br />
Frankfurt am Main, unter dem Namen <strong>AG</strong> für Hoch- u. Tiefbauten<br />
vorm Gebr. Helfmann. 1924 Namensänderung in Hochtief<br />
<strong>AG</strong> für Hoch- u. Tiefbauten, vorm Gebr. Helfmann. Hochtief ist<br />
heute der größte deutsche Baukonzern.<br />
Nr. 809
Los 809 Schätzwert 10-40 €<br />
Hochtief <strong>AG</strong> für Hoch- und Tiefbauten<br />
vorm. Gebr. Helfmann<br />
Essen, Aktie 1.000 RM 1.10.1940<br />
(Auflage 6827, R 1) UNC-EF<br />
Los 810 Schätzwert 125-200 €<br />
Hofbrauhaus Coburg <strong>AG</strong><br />
Coburg, Aktie Lit. B 100 RM 30.9.1941<br />
(Auflage 1500, R 6) EF+<br />
Die erste bayerische Aktienbrauerei wurde 1858 als Coburger<br />
Bierbrauerei <strong>AG</strong> gegründet. 1912 Umbenennung in Hofbrauhaus<br />
Coburg <strong>AG</strong>. Mit der Teilung Deutschlands 1945 wurde die<br />
Innerdeutsche Grenze bis vor die Tore Coburgs gelegt, wodurch<br />
dem Unternehmen das Hauptabsatzgebiet entzogen wurde.<br />
1950/51 gelang es der Brauerei, den Bierabsatz mit der Einführung<br />
des Spezialbieres „Coburger Grenzfürst“ wieder zu<br />
steigern. Hauptaktionär war die Paulaner-Salvator-Thomasbräu<br />
<strong>AG</strong>, München, mit der das Unternehmen 1980/82 einen Beherrschungs-<br />
und Gewinnabführungsvertrag abschloss. 1993<br />
Umbenennung in Hofbrauhaus Coburg Verwaltungs-<strong>AG</strong>.<br />
1997/98 Verschmelzung mit dem Hauptaktionär.<br />
Los 811 Schätzwert 125-200 €<br />
Hofbrauhaus Wolters <strong>AG</strong><br />
Braunschweig, Aktie 600 RM 3.1.1942<br />
(Auflage 5000, R 6) EF<br />
Das Unternehmen hat zwei Wurzeln: Das Hofbrauhaus selbst<br />
wurde mit Genehmigung des Herzogs von Braunschweig bereits<br />
1627 gegründet. Der Stammsitz in der Güldenstraße, heute<br />
das ”Wirtshaus zur Hanse”, ist eines der wenigen vom Krieg<br />
verschonten prachtvollen Fachwerkhäuser der Stadt (1998 haben<br />
wir in diesen Traditionsräumen übrigens die herrliche Textil-Sammlung<br />
Greissinger versteigert). Die Bierbrauerei Balhorn<br />
(gegr. 1763 in der Broitzemer Straße) wurde 1887 eine <strong>AG</strong>.<br />
1920 fusionierten beide zur “Hofbrauhaus Wolters und Balhorn<br />
<strong>AG</strong>” (der Zusatz “und Balhorn” fiel 1940 weg). Der Braubetrieb<br />
wurde am heutigen Standort an der Wolfenbütteler Straße konzentriert.<br />
Börsennotiz Braunschweig, ab 1934 Hannover. Nach<br />
dem Krieg verkaufte die Erbengemeinschaft Dr. Wolters die Aktienmehrheit<br />
an die Gilde-Brauerei in Hannover, zu deren Konzern<br />
Wolters heute gehört. Der belgisch-brasilianische Braukonzern<br />
InBev (zuvor Interbrew), der Gilde 2003 übernahm,<br />
hatte kein Interesse an der Marke Wolters. Die Brauerei wurde<br />
2006 an regionale Interessenten und ehemalige Mitarbeiter<br />
verkauft, die <strong>AG</strong> firmierte in “HBW Abwicklungs <strong>AG</strong>” um und trat<br />
in Liquidation.<br />
„Haus zur Hanse“ - Hofbrauhaus Wolters ca. 1900<br />
Los 812 Schätzwert 30-75 €<br />
Hoffmann’s Stärkefabriken <strong>AG</strong><br />
Bad Salzuflen, Aktie 1.000 RM März 1938<br />
(Auflage 3939, R 3) EF<br />
Vignette mit dem sich die Pfötchen leckenden<br />
Kätzchen.<br />
Werksgründung 1850, <strong>AG</strong> seit 1887. Herstellung von Stärkeund<br />
Nährmitteln, Haushalts- und Körperpflegeprodukten; jahrzehntelang<br />
bekanntestes Produkt war “Hoffmann’s Gardinenweiß”.<br />
1993 Übernahme durch die britische Chemiefirma<br />
Reckitt & Colman plc, Umbenennung in Reckitt & Colman<br />
Deutschland <strong>AG</strong> und Sitzverlegung nach Hamburg. 2001 Fusion<br />
mit der alteingesessenen Mannheimer Chemiefirma<br />
Benckiser GmbH, Umfirmierung in Reckitt Benckiser Deutschland<br />
<strong>AG</strong> und Sitzverlegung nach Mannheim.<br />
Nr. 812<br />
Los 813 Schätzwert 30-60 €<br />
Hohburger Quarz-Porphyr-Werke <strong>AG</strong><br />
Leipzig, 4,5 % Teilschuldv. 500 RM Aug.<br />
1942 (Auflage nur 80 Stück, R 6) EF<br />
Gründung 1899 unter Übernahme der früher vom Frhr. von<br />
Schönberg auf Thammenhain betriebenen Quarzporphyrbrüche<br />
in den Hohburger Bergen bei Wurzen. Außerdem (von den<br />
Bahnhöfen Collmen-Böhlitz und Seelingstädt ausgehend) Betrieb<br />
einer normalspurigen Privateisenbahn für Personen- und<br />
Güterverkehr.<br />
Los 814 Schätzwert 10-25 €<br />
Hohenlohe-Werke <strong>AG</strong><br />
Hohenlohehütte O.-S., Aktie 1.000 Mark<br />
Juli 1909 (Auflage 8000, R 5) EF-VF<br />
Herausgegeben zum Kauf der restlichen 499 Kuxe<br />
der <strong>Gewerkschaft</strong> Oheim und für in Norwegen erworbene<br />
Bergwerke.<br />
Gründung 1905. Den weitaus größten Teil der Bergwerksanteile,<br />
Bergwerke, Grubenfelder und Anlagen hat die Gesellschaft<br />
vom Fürsten zu Hohenlohe-Oehringen durch Vertrag erworben.<br />
Bedeutende oberschlesische Montangesellschaft aus der<br />
Gruppe der sogenannten “Fürsten-Konzerne”.<br />
Los 815 Schätzwert 50-120 €<br />
Hohlglashüttenwerke Ernst Witter <strong>AG</strong><br />
Unterneubrunn, Aktie 5.000 RM<br />
23.5.1925 (Auflage 120, R 6) EF<br />
Gründung 1906. Betrieb der Glashüttenwerke der Firma Ernst<br />
Witter in Unterneubrunn i.Thür. Haupterzeugnisse: Verpakkungs-<br />
und sonstiges Behälterglas, weiße Flaschen. 1907 Errichtung<br />
der Filiale Bedheim. 1918 Erwerb der Arno Edm.<br />
Kaempfe’schen Hohlglasfabrik in Oelze (Thür.). Die Filiale Arno<br />
Edm. Kaempfe wurde später an die Mitteldeutsche Hohlglasindustrie,<br />
Hermann Bulle, Altenfeld (Thür.) verpachtet.<br />
Los 816 Schätzwert 40-80 €<br />
Holz <strong>AG</strong><br />
Magdeburg, Aktie 5.000 Mark Okt. 1923.<br />
Gründeraktie (Auflage 14000, R 5) Anh.<br />
Kupons. EF<br />
Gründung 1923 zum Zwecke des Holzhandels. Fa. 1929 erloschen.<br />
Los 817 Schätzwert 75-120 €<br />
Holz- u. Kartonagenindustrie-Garagen-<strong>AG</strong><br />
Sebnitz, Aktie 100 RM Juli 1938 (Auflage<br />
nur 50 Stück, R 7) EF<br />
Gründung 1922 als Holz- und Kartonagenindustrie, ab 1938<br />
Holz- u. Kartonagenindustrie-Garagen-<strong>AG</strong>. Herstellung von und<br />
Handel mit allen Waren, die mit Holz oder Pappe in Verbindung<br />
stehen, Betrieb einer Großgarage, Unterhaltung von Tankstellen,<br />
Handel mit Autoölen, Fetten und Reifen. 1995 aufgelöst.<br />
Los 818 Schätzwert 30-75 €<br />
Holzindustrie <strong>AG</strong><br />
Magdeburg, Aktie 1.000 RM 19.11.1929<br />
(Auflage 300, R 4) EF<br />
Nennwert umgestempelt auf 1.700 RM.<br />
Gegründet am 7.8.1929 mit Sitz bis 22.8.1929 in Zwickau,<br />
danach in Magdeburg. Holzhandel und Holzverarbeitung.<br />
Los 819 Schätzwert 20-50 €<br />
Holzindustrie Cordingen <strong>AG</strong><br />
Cordingen bei Walsrode, 4,5 %<br />
Teilschuldv. 1.000 RM Juli 1943 (Auflage<br />
400, R 5) EF<br />
Die Anleihe, von deren Volumen bei Kriegsende<br />
noch 87 % ausstehend waren, wurde 1950 im<br />
Verhältnis 10:1 von RM auf DM umgestellt und bis<br />
1956 komplett zurückgezahlt.<br />
Gründung 1920 als GmbH, 1923 in eine KGaA und 1927 in eine<br />
<strong>AG</strong> umgewandelt. Sitz war zunächst Berlin (Großaktionäre<br />
waren die Spreehof Berliner Handelsstätten-Gesellschaft, Berlin<br />
und Otto Marquardt, Cordingen), 1928 Sitzverlegung nach<br />
Walsrode. Auf einem 100.000 qm großen Areal (davon 40.000<br />
qm überbaut) wurde mit über 200 Beschäftigten eine Sperrholzfabrik<br />
betrieben. 1957 in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt.<br />
Los 820 Schätzwert 300-400 €<br />
Holzkredit <strong>AG</strong><br />
Magdeburg, Aktie 5.000 Mark Aug. 1923<br />
(Auflage 12000, R 9) VF<br />
Nur 6 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gründung im Mai 1923. Kreditgewährung an Werke der Holzindustrie,<br />
Erwerb und Pacht von Holzindustriewerken, An- und<br />
Verkauf von Waldbeständen. 1931 von Amts wegen gelöscht.<br />
Los 821 Schätzwert 75-150 €<br />
Hotel-<strong>AG</strong> Chemnitzer Hof<br />
Chemnitz, VZ-Aktie Lit. C 100 RM<br />
30.6.1931 (Auflage 2000, nach<br />
Kapitalherabsetzungen 1932 und 1935<br />
nur noch 666, R 6) EF-<br />
Sehr dekorativ, mit detaillierter Abb. des Hotels<br />
und seiner Umgebung im Unterdruck.<br />
Gründung 1927 zum Bau und Betrieb des „Chemnitzer Hof“<br />
und eines Weingroßhandels. Als Folge der Weltwirtschaftskrise<br />
1931 in Vergleich gegangen, der aber erfüllt werden konnte.<br />
Später noch mehrere Kapitalschnitte. Dividenden erwirtschaftete<br />
die <strong>AG</strong> nie. Zwischenzeitlich in der DDR ein Haus der Interhotel-Gruppe.<br />
Zur Geltendmachung von Restitutionsansprüchen<br />
wurde die <strong>AG</strong> nach der Wende reaktiviert. Heute ist der<br />
Chemnitzer Hof ein 4-Sterne-Hotel der Guennewig-Gruppe.<br />
Los 822 Schätzwert 50-100 €<br />
Hübler & Co. <strong>AG</strong><br />
Riesa a.d.Elbe, Aktie Lit. B 100 RM<br />
23.2.1925 (Auflage 6000, R 5) EF<br />
Gründung 1923 zur Fortführung des Mühlenwerks von Hübler &<br />
Co. 1938 Umfirmierung in “Mühlenwerke Hübler & Co. <strong>AG</strong>”. Ein<br />
großer Kunde war die 1914 von den Konsumgenossenschaften<br />
gegründete Teigwarenfabrik in Riesa, später die größte Nudelfabrik<br />
der DDR. 1949 enteignet und als VEB fortgeführt. Nach der<br />
Wende 1990 wurde in Riesa das Kraftfutterwerk als viertes<br />
Zweigwerk der Muskator-Werke in Düsseldorf weitergeführt.<br />
Los 823 Schätzwert 25-100 €<br />
Hüttenwerke C. Wilh. Kayser & Co. <strong>AG</strong><br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark Dez. 1919<br />
(Auflage 2000, R 6) EF<br />
Gründung schon 1861 als C. Wilh. Kayser, Ahlemeyer & Co. in<br />
Berlin-Moabit als Metallhüttenwerk zur Verhüttung von Gold-,<br />
Silber- und Bleirückständen, <strong>AG</strong> seit 1911. 1906 Errichtung einer<br />
neuen Fabrik in Oranienburg (Kupfer-, Blei- und Zinnhütte).<br />
1913-16 Bau einer zweiten Fabrik in Lünen bei Dortmund.<br />
1929 Fusion mit der Hüttenwerk Niederschöneweide <strong>AG</strong>.<br />
1948/49 entschädigungslose Enteignung der Werke Oranienburg<br />
und Niederschöneweide sowie der Aluminiumschmelze in<br />
Schönebeck bei Magdeburg. 1955 Sitzverlegung nach Lünen<br />
69
i.W., wo die Ges. eine Sekundär-Kupferhütte betreibt. Bis 2003<br />
börsennotiert, dann drängte der Großaktionär (Norddeutsche<br />
Affinerie, Hamburg) den Streubesitz per squeeze-out heraus.<br />
Los 824 Schätzwert 20-50 €<br />
Hugo Schneider <strong>AG</strong><br />
Leipzig, Aktie 100 RM Aug. 1940 (Auflage<br />
1500, ausgegeben anläßlich des Umtauschs<br />
der früheren 20-RM-Aktien, R 4) UNC-EF<br />
Gründung 1863 als Lampenfabrik Haeckel & Schneider in Paunsdorf<br />
bei Leipzig, 1871 übernahm Hugo Schneider den Betrieb vollständig,<br />
<strong>AG</strong> seit 1899. Die “Hasag” war einer der ältesten Industriebetriebe<br />
in Leipzig. Der ehemals handwerkliche Betrieb, in<br />
dem Lampen hergestellt wurden, entwickelte sich in Leipzig-<br />
Paunsdorf zu einer riesigen Fabrik. 1898 wurde beim Bahnhof<br />
Schönefeld ein eigenes Messingwalzwerk errichtet. Hergestellt<br />
wurden Messing-, Kupfer- und Aluminiumerzeugnisse, Beleuchtungs-,<br />
Heiz- und Kochartikel, Emaillewaren und Isolierflaschen sowie<br />
Autobeleuchtung. 1932 wurde die Glühlampenfabrikation in<br />
Oberweißbach (hervorgegangen aus der Glühlampenfabrik Germania<br />
Eisenach GmbH) in die Hugo Schneider Vereinigte Glühlampenwerke<br />
GmbH ausgegliedert. Die Weltwirtschaftskrise traf die<br />
Hasag schwer und erforderte eine Sanierung mit Kapitalschnitt.<br />
Dann folgte eine sprunghafte Erholung: Die Beschäftigtenzahl, die<br />
1932 auf nur noch gut 1.000 abgesunken war, vervielfachte sich<br />
(auch wegen Eröffnung des zweiten Hauptwerkes in Berlin-Köpenick<br />
im Jahr 1935) in nur drei Jahren auf fast 3.500. Beschäftigung<br />
brachten vor allem umfangreiche Munitionslieferungen an<br />
die Reichswehr (ab 1935 die Wehrmacht). Dirigent dieses Aufschwungs,<br />
der die Hasag bis Ende des 2. Weltkrieges zum größten<br />
Rüstungsbetrieb in Mitteldeutschland und alleinigem Hersteller<br />
von Panzerfäusten machte, war als Betriebsdirektor Wilhelm Renner,<br />
der Vater von Hannelore Kohl. In den 1940er Jahren arbeiteten<br />
zwei Hauptwerke in Leipzig-Paunsdorf und Berlin-Köpenick,<br />
außerdem Betriebsstätten in Altenburg, Meuselwitz,Thermos-Langewiesen,<br />
Glashütte Großbreitenbach, Schwachstromlampenfabriken<br />
Eisenach und Oberweißbach (alle Thüringen) sowie Taucha bei<br />
Leipzig und Rhönglashütte Dernbach. Börsennotiz Berlin und Leipzig,<br />
Mehrheitsaktionär war zuletzt die Dresdner Bank (weshalb die<br />
<strong>AG</strong> noch heute im Verzeichnis des Anteilsbesitzes der Allianz-Versicherung<br />
mit 25,1 % aufgeführt ist). Nach Kriegsende hielt man<br />
sich mit der Herstellung von Kochtöpfen, Milchkannen und Lampen<br />
über Wasser. 1947 wurden alle Maschinen und Anlagen von<br />
den Sowjets als Reparationsleistung demontiert und die Gebäude<br />
anschließend gesprengt. Patente und Markenrechte wurden danach<br />
von anderen DDR-Betrieben genutzt, so z.B. die Wortmarke<br />
HAS<strong>AG</strong> bis 1974 vom VEB Leuchtenbau Leipzig.<br />
Los 825 Schätzwert 275-350 €<br />
Humboldt-Deutzmotoren <strong>AG</strong><br />
Köln, Aktie 1.000 RM Nov. 1936 (Auflage<br />
6500, R 9) EF-VF<br />
Faksimile-Unterschrift Peter Klöckner als AR-Vorsitzender.<br />
Vorher unbekannt gewesene Emission,<br />
nur 6 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1856 (Maschinenfabrik für den Bergbau “Sivers &<br />
Co.”), seit 1884 Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Köln-Kalk.<br />
1930 Fusion mit der Motorenfabrik Deutz <strong>AG</strong> (gegründet 1864<br />
von N.A. Otto und E. Langen als erste Motorenfabrik der Welt) und<br />
der Motorenfabrik Oberursel <strong>AG</strong> zur Humboldt-Deutzmotoren-<strong>AG</strong>.<br />
1936 Übernahme der Magirus <strong>AG</strong> in Ulm (gegründet 1864 als<br />
Spezialfabrik für Feuerwehrgeräte, ab 1918 auch Fahrzeugbau).<br />
1938 Interessengemeinschaft mit der Klöckner-Werke <strong>AG</strong> in Duisburg<br />
und Umfirmierung in Klöckner-Humboldt-Deutz <strong>AG</strong>. Übernahme<br />
der Vereinigte Westdeutsche Waggonfabriken <strong>AG</strong> (1959),<br />
der Maschinenfabrik Fahr <strong>AG</strong>, Gottmadingen (1961) und der WE-<br />
D<strong>AG</strong> Westfalia Dinnendahl Gröppel <strong>AG</strong>, Bochum (1969). Die 1974<br />
begonnene Kooperation mit FIAT bei Nutzfahrzeugen führte 1975<br />
zur Gründung des Gemeinschaftsunternehmens IVECO (1982<br />
ganz an FIAT übergegangen). Neben Motoren wurden Gasturbinen,<br />
Luftfahrtantriebe, Traktoren, Mähdrescher und Industrieanlagen<br />
hergestellt. Nach einer existenzbedrohenden Krise in den<br />
90er Jahre blieb der (bis heute als Deutz <strong>AG</strong> börsennotierten) KHD<br />
nur noch das Motorenwerk in Köln-Deutz.<br />
Los 826 Schätzwert 225-300 €<br />
Hupfeld - Gebr. Zimmermann <strong>AG</strong><br />
Leipzig, Aktie 20 RM 1.12.1935 (Auflage<br />
200, R 10) VF<br />
Nur 4 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1895 als „Leipziger Pianofortefabrik Gebr. Zimmermann<br />
<strong>AG</strong>“, 1926 Angliederung der „Ludwig Hupfeld <strong>AG</strong>“ mit Werken in<br />
Dresden, Böhlitz-Ehrenberg, Johanngeorgenstadt und Gotha, anschließend<br />
Umfirmierung in “Leipziger Pianoforte- und Phonolafabri-<br />
70<br />
ken Hupfeld - Gebr. Zimmermann <strong>AG</strong>”. Das fusionierte Unternehmen<br />
ist mit über 20.000 Instrumenten jährlich nun der größte Hersteller<br />
in ganz Europa. 1929/30 beenden Weltwirtschaftskrise, Schallplatte<br />
und Rundfunk die Ära der bei Hupfeld produzierten elektrischen<br />
Selbstspielinstrumente. Die Klavierproduktion wird in eine Zweigfabrik<br />
verlagert, die Hauptfabriken stellen nunmehr Kinoorgeln, Plattenspieler,<br />
Rundfunkempfänger, Kleinbillards und Wohnmöbel her.<br />
Weiter umfirmiert 1935 wie oben und 1938 in Hupfeld-Zimmermann<br />
<strong>AG</strong>. Börsennotiz Berlin und Leipzig. 1946 enteignet, zu DDR-<br />
Zeiten Teil der sog. “Pianounion”. Nach der Wende wird der Betrieb<br />
in Böhlitz-Ehrenberg als Pianofortefabrik Leipzig GmbH & Co. KG reprivatisiert,<br />
das traditionsreiche ehemalige Hupfeld-Werk in Seifhennersdorf<br />
wird von der Berliner Bechstein-Gruppe übernommen.<br />
Los 827 Schätzwert 10-40 €<br />
Hupfeld - Gebr. Zimmermann <strong>AG</strong><br />
Leipzig, Aktie 100 RM 1.12.1935 (Auflage<br />
3000, R 2) EF<br />
Los 828 Schätzwert 40-80 €<br />
HUTA Hoch- und Tiefbau-<strong>AG</strong><br />
Breslau, Aktie 1.000 RM März 1928<br />
(Auflage 300, R 5) UNC-EF<br />
Gründung 1904 als „Baugesellschaft für Lolat-Eisenbeton<br />
GmbH” in Breslau, <strong>AG</strong> seit 1907. Bedeutendes Bauunternehmen<br />
mit zunächst auch sehr starker Position in Russland sowie<br />
Niederlassungen u.a. in Berlin, Halle, Hannover, Stettin und<br />
Nürnberg. 1917 Umfirmierung in HUTA Hoch- und Tiefbau <strong>AG</strong>.<br />
1946 Sitzverlegung nach Hannover. 1962 Erwerb der Willy Christiansen<br />
KG in Schleswig und der E. Hegerfeld Industriebau KG<br />
in Essen, mit denen 1967 zur HUTA-HEGERFELD <strong>AG</strong> fusioniert<br />
wird, gleichzeitig Sitzverlegung nach Essen. Großaktionäre waren<br />
zu der Zeit das Bankhaus Bass & Herz, Frankfurt/M. und das<br />
Bankhaus I. D. Herstatt KGaA, Köln. Anfang der 70er Jahre ver-<br />
Nr. 829<br />
Nr. 820 Nr. 825<br />
kauften diese Privatbanken jeweils mehr als 25 % an die ADCA<br />
und den Kölner Bau-Tycoon Dr. Renatus Rüger. 1985 Konkurs.<br />
Los 829 Schätzwert 400-500 €<br />
HUTA Hoch- und Tiefbau-<strong>AG</strong><br />
Breslau, VZ-Aktie 50 x 200 RM März<br />
1928 (Interimsschein, R 12), ausgestellt<br />
für die Dresdner Bank Filiale Breslau VF<br />
Maschinenschriftliche Ausführung mit Originalunterschriften.<br />
Es waren überhaupt nur 70 VZ-Aktien<br />
begeben, verbrieft in einer 50er-Sammelurkunde<br />
von 1928 und einer 20er-Sammelurkunde<br />
von 1942. Wie auch das übernächste Los ein Unikat<br />
aus dem Reichsbankschatz.<br />
Los 830 Schätzwert 20-60 €<br />
HUTA Hoch- und Tiefbau-<strong>AG</strong><br />
Breslau, Aktie 1.000 RM März 1935<br />
(Auflage 1200, R 4) UNC-EF<br />
Los 831 Schätzwert 300-375 €<br />
HUTA Hoch- und Tiefbau-<strong>AG</strong><br />
Breslau, VZ-Aktie 20 x 200 RM Sept.<br />
1942 (Interimsschein, R 12), ausgestellt<br />
für die Dresdner Bank Filiale Breslau VF<br />
Maschinenschriftliche Ausführung mit Originalunterschriften.<br />
Es waren überhaupt nur 70 VZ-Aktien<br />
begeben, verbrieft in einer 50er-Sammelurkunde<br />
von 1928 und einer 20er-Sammelurkunde<br />
von 1942.<br />
Los 832 Schätzwert 30-75 €<br />
Hydrometer <strong>AG</strong><br />
Breslau, Aktie 1.000 RM Dez. 1941<br />
(Auflage 344, R 4) EF<br />
Gründung 1912, neben Wassermessern auch Produktion von<br />
Tachometern, amtliche Notiz bis 1928 in Berlin und Frankfurt,<br />
Von der HUTA gebaut: St. Hedwig in Oberursel<br />
Nr. 831<br />
danach im Frankfurter und Breslauer Freiverkehr. 1948 verlagert<br />
nach Kronach/Oberfr., später nach Ansbach, seit 1966<br />
GmbH.<br />
Los 833 Schätzwert 150-200 €<br />
Hypothekenbank in Hamburg (5 Stücke)<br />
Anteilscheine 50 Goldmark, 500<br />
Goldmark, 1.000 Goldmark, 2.000<br />
Goldmark und 5.000 Goldmark<br />
10.12.1926 EF-VF<br />
Gründung 1871 durch Haller Söhne & Co., die Vereinsbank in<br />
Hamburg, die Berliner Handels-Gesellschaft und die Preußische<br />
Hypotheken Versicherungs <strong>AG</strong> zu Berlin. 1971 übernommen<br />
durch die Dresdner Bank <strong>AG</strong>. Seit 1998 in der Deutsche<br />
Hyp Deutsche Hypothekenbank Frankfurt-Hamburg <strong>AG</strong>. Im August<br />
2002 Verschmelzung der Eurohypo <strong>AG</strong> Europäische Hypothekenbank<br />
der Deutschen Bank und der Rheinhyp Rheinische
Hypothekenbank <strong>AG</strong> der Commerzbank, auf die Deutsche Hyp<br />
Deutsche Hypothekenbank Frankfurt-Hamburg <strong>AG</strong>, Frankfurt<br />
a.M., die daraufhin ihre Firma in Eurohyp <strong>AG</strong> geändert hat.<br />
2006 Übernahme durch die Commerzbank, Weiterführung als<br />
eigenständige Rechtspersönlichkeit mit einer eigenen Marke.<br />
Los 834 Schätzwert 30-75 €<br />
Im. Unger <strong>AG</strong><br />
Kirchberg, Aktie 10.000 Mark<br />
18.10.1923. Gründeraktie (Auflage 900,<br />
R 5) EF<br />
Gründung 1923. Betrieb einer Streichgarnspinnerei und Pakkstofffabrik.<br />
Nach dem Krieg nicht verlagert.<br />
Los 835 Schätzwert 225-300 €<br />
Immobiliarkredit-Treuhand <strong>AG</strong><br />
Berlin, Aktie 1.000 RM März 1928<br />
(Auflage nur 25 Stück, R 10) VF<br />
Nur 3 Stück lagen im Reichsbankschatz. Vorher<br />
nicht bekannt gewesen.<br />
Gegründet im Nov. 1927 als Immobiliarkredit-Treuhand <strong>AG</strong>, ab<br />
1929 Immobiliarkredit-<strong>AG</strong>. Im Sept. 1942 Umbenennung in <strong>AG</strong><br />
für Beteiligung und Verwaltung. Die Firma befand sich im sowjetisch<br />
besetzten Gebiet von Berlin, auf Grund § 2 des Löschungsgesetzes<br />
vom 9.10.1934 von Amts wegen am<br />
20.8.1949 gelöscht.<br />
Los 836 Schätzwert 30-75 €<br />
Industrie- und Baustoff-<strong>AG</strong><br />
Rottwerndorf, Bez. Dresden, Aktie 10.000<br />
Mark 16.7.1923 (Auflage 850, R 5) EF<br />
Gründung 1905 als Sandsteinbrüche Rottwerndorf <strong>AG</strong>, ab<br />
1922 Industrie- und Baustoff-<strong>AG</strong>. Ausbeutung der der Gesellschaft<br />
gehörenden Sandsteinbrüche, Handel mit Baustoffen,<br />
Veredlung von Baustoffen. 1943 war der Betrieb stillgelegt, Gebäude<br />
und Fabrikanlagen wurden für Wohnzwecke verwendet.<br />
Los 837 Schätzwert 75-100 €<br />
Industrie-Beteiligungen der früheren<br />
Lothringer Portland-Cement-Werke <strong>AG</strong><br />
Berlin, Aktie 100 RM Mai 1929 (Auflage<br />
500, R 8) EF-VF<br />
Nur 18 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1891 als “Lothr. Portland-Cement-Werke Diesdorf”,<br />
später Sitz in Metz mit Verwaltung in Strassburg. 1911 Fusion<br />
mit der Heminger Portland-Cementwerk <strong>AG</strong> in Saarburg, zugleich<br />
Sitzverlegung nach Strassburg. 1912 Übernahme der<br />
Süddeutschen Cementwerke <strong>AG</strong> in Neunkirchen. Die elsaßlothringischen<br />
Besitzungen im Wert von über 10 Mio. Mark gingen<br />
1919 als Folge des 1. Weltkrieges verloren, wofür die Ges.<br />
1928 vom Reich mit knapp 1 Mio. RM entschädigt wurde. Sitzverlegungen<br />
1920 nach Karlsruhe und 1925 nach Berlin (Behrenstraße<br />
65 beim Bankhaus Gerson Bleichröder), zugleich wie<br />
oben umfirmiert. Einzige unternehmerische Aktivität war eine<br />
1923 eingegangene 50 %ige Beteiligung bei der Gerüstbau L.<br />
Altmann GmbH, Berlin-Charlottenburg. Ab 1934 in Liquidation.<br />
Los 838 Schätzwert 50-100 €<br />
Industriebau <strong>AG</strong><br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark Mai 1923<br />
(Auflage 54000, R 5) VF<br />
1872 gründen Otto Held und August Francke in Berlin eine<br />
Bauunternehmung. Bald werden mehrere hundert Mitarbeiter<br />
beschäftigt, weil man mit der Ausführung bedeutender Bauten<br />
betraut wird: Held & Francke baut das Reichsversicherungsamt<br />
(bis 1887), den Preußischen Landtag (bis 1899), den Berliner<br />
Dom (1894-1900) sowie die Zantrale der Deutschen Bank in<br />
der Mauerstraße. Nach der Umwandlung in eine <strong>AG</strong> im Jahr<br />
1906 kommen weitere Renommier-Aufträge: die Akademie der<br />
Wissenschaften, das Kaiser-Friedrich-Museum, der Marstall,<br />
die Staatsbibliothek, die Zentrale der Elektrischen Hoch- und<br />
Untergrundbahn. 1921 werden die Geschäftsaktivitäten in<br />
Süddeutschland in die “Süddeutsche Held & Francke Bauaktiengesellschaft”<br />
in München mit Ndl. in Stuttgart ausgegründet.<br />
Im Jahr 1927 erwirbt die finanziell schwache Industriebau<br />
<strong>AG</strong> Berlin-Breslau-Kattowitz (gegründet 1911 als „Schlesische<br />
Eisenbetonbau-<strong>AG</strong>“ in Kattowitz und seit 1921 mit Hauptsitz in<br />
Berlin) heimlich die Aktienmehrheit bei Held & Francke, noch<br />
im gleichen Jahr fusionieren beide Firmen. In der Weltwirtschaftskrise<br />
gerät die Firma 1929 an den Rand der Insolvenz,<br />
die 1930er Kapitalerhöhung schafft nicht mehr genug Luft,<br />
1931 lassen die Banken das Berliner Stammhaus fallen und<br />
stützen nur noch die süddeutsche Tochtergesellschaft. Die Aktien<br />
der Süddeutsche Held & Francke Bauaktiengesellschaft<br />
gehen aus der Konkursmasse an die Maffei’sche Erbengemeinschaft.<br />
Das Unternehmen etabliert sich am Markt so gut,<br />
daß 1940 der Namenszusatz “Süddeutsche” entfällt. 1950-65<br />
dehnt sich die Held & Francke <strong>AG</strong> deutschlandweit aus und<br />
baut ein starkes Auslandsgeschäft auf. 1990 erwirbt die Philipp<br />
Holzmann <strong>AG</strong> nahezu alle Aktien. Mit deren Insolvenz im<br />
Jahr 2002 ist auch das Schicksal von H&F endgültig besiegelt.<br />
Los 839 Schätzwert 20-60 €<br />
Industriegas <strong>AG</strong><br />
Berlin, Aktie 1.000 RM Juli 1929 (Auflage<br />
1350, R 4) UNC-EF<br />
Gründung 1922 als „Sächsische Acetylen-<strong>AG</strong>“ in Dresden.<br />
Herstellung von technischen Gasen. 1947 verlagert nach Grevenbroich,<br />
1952 nach Köln, 1957 umfirmiert in IGA Industriegas<br />
GmbH & Co. KG, heute IBG Industrie-Beteiligungs-GmbH &<br />
Co. KG, Köln.<br />
Los 840 Schätzwert 30-75 €<br />
Industriewerke Emil Eisert<br />
und Gebrüder Schweikert <strong>AG</strong><br />
Litzmannstadt, Sammelaktie 10 x 900 RM<br />
17.12.1941 (Auflage 320, R 5) EF<br />
Gegr. 1880, <strong>AG</strong> seit 1922. Anfangs wurden Litzen, Spitzen und<br />
Bänder aller Art hergestellt, seit 1927 auch Strumpfwirkerei für<br />
Damenstrümpfe und Herrensocken der Marke “Turilla”.<br />
Los 841 Schätzwert 20-60 €<br />
Irmscher & Witte Maschinenfabrik <strong>AG</strong><br />
Dresden, Aktie 200 RM Sept. 1940<br />
(Auflage 1300, R 3) UNC-EF<br />
Gründung bereits 1867, <strong>AG</strong> seit 1911 (Firma bis 1937: Dresdner<br />
Strickmaschinenfabrik Irmscher & Witte <strong>AG</strong>). Die Fabrik in<br />
der Tharandter Str. 31-33 produzierte Präzisionsmaschinen sowie<br />
Maschinen der Feinmechanik. Bis 1934 in Dresden börsennotiert.<br />
1952 mit drei weiteren Firmen zum VEB Kupplungswerk-<br />
und Triebswerksbau zusammen geschlossen. Das Werk<br />
war in der DDR das größte seiner Art. Nach dem Zusammenschluß<br />
mit dem Kupplungswerk Freital entstand 1982 der VEB<br />
Kupplungswerk Dresden, aus dem im Mai 1990 die Firma Kupplungswerk<br />
Dresden GmbH hervorging, die im Jan. 1993 zu<br />
KWD Kupplungswerk Dresden GmbH umbenannt wurde.<br />
Los 842 Schätzwert 75-125 €<br />
Isaria Bayerische<br />
<strong>Rückvers</strong>icherungs-<strong>AG</strong><br />
München, Interimschein 10.000 Mark<br />
30.8.1923. Gründeraktie (Auflage<br />
100000, R 6) EF<br />
Die am 28.8.1923 gegründete Gesellschaft betrieb die Rükkversicherung<br />
in allen Versicherungszweigen mit Ausnahme<br />
der Lebensversicherung. Die Aufstellung einer Goldmark-Eröffnungsbilanz<br />
im Jahre 1924 erübrigte sich, da ein Vermögen<br />
nicht ausgewiesen werden konnte. Im Oktober 1925 wurde<br />
seitens des Registergerichts die Nichtigkeit der Gesellschaft<br />
ausgesprochen.<br />
Nr. 836 Nr. 839 Nr. 843<br />
Los 843 Schätzwert 30-75 €<br />
J. Brüning & Sohn <strong>AG</strong><br />
Lüneburg, Aktie 1.000 RM Aug. 1938<br />
(Auflage 2800, R 3) UNC-EF<br />
Gegründet bereits 1848 in Langendiebach (etwas nordöstlich<br />
von Hanau). Betrieb einer Zigarrenkisten- und Zigarrenwickelformen-Fabrik.<br />
1898 Umwandlung in eine <strong>AG</strong>, Sitzverlegungen<br />
1918 nach Berlin (dort auch börsennotiert) und 1921 nach<br />
Potsdam. Die Bedeutung der Firma ist schon aus der großen<br />
Zahl der Zweigwerke zu erkennen: Herbolzheim, Ragnit<br />
(Ostpr.), Lüneburg, Langendiebach, Rehfelde, Leipzig, Hamburg,<br />
Herford, Mannheim, Feuerbach und Berlin. 1922 wurde<br />
von den Brüning-Aktionären in Den Haag die Handelsgesellschaft<br />
“Cuba” gegründet, die als Holding- und Finanzierungsgesellschaft<br />
das gesamte Brüning-Kapital übernahm und später<br />
auch sämtliche zur Verarbeitung notwendigen Rohstoffe lieferte.<br />
Alle Verträge mit der N.V. Cuba wurden 1927 wieder aufgehoben.<br />
1932 wurde der Firmensitz letztmalig verlegt, und<br />
zwar zum Hauptwerk Lüneburg. Neben Zigarrenkisten wurden<br />
nun insbesondere Sperrholz für Schiffsbau, Innenausstattung,<br />
Möbelbau sowie Flugzeugplatten hergestellt. 1967 umgewandelt<br />
in die “Ibus-Werke GmbH”.<br />
Los 844 Schätzwert 50-125 €<br />
J. C. Lutter (Weingroßhandlung) <strong>AG</strong><br />
Berlin, Aktie 5.000 Mark Mai 1923<br />
(Auflage 1200, R 4, nach<br />
Kapitalherabsetzung 1935 noch 712) EF<br />
Gründung 1919 als “Wohnstätte Kurfürstendamm <strong>AG</strong>”, 1921<br />
Übernahme der J. C. Lutter (Weingroßhandlung) GmbH und<br />
Umfirmierung wie oben. Ursprung war die 1811 am Gendarmenmarkt<br />
eröffnete Weinstube Lutter und Wegener, Lutter<br />
wurde 1851 zum Hoflieferanten ernannt. Anfang der 20er Jahre<br />
übernahm das Bankhaus Hardy & Co. die Aktienmehrheit.<br />
Dem AR gehörte zu der Zeit u.a. auch der Oberbürgermeister<br />
a.D. Dr. Brünning an. 1929 Verkauf der verlustträchtigen gastronomischen<br />
Betriebe, 1932 wurde der alte Name “Wohnstätte<br />
Kurfürstendamm <strong>AG</strong>” wieder angenommen. Letzte Großaktionäre<br />
waren erst die Rosenhain GmbH und dann Egon und<br />
Margot Fürstenberg; 1938 Auflösung der <strong>AG</strong> und Abwicklung<br />
durch die Berliner Revisions-<strong>AG</strong> (was eine sog. Arisierung vermuten<br />
läßt). Der Löschungsvermerk von 1941 wurde im Handelsregister<br />
zwecks Nachtragsabwicklung 1956 zurückgenommen.<br />
Das Weinhaus Lutter und Wegener am Gendarmenmarkt,<br />
1944 im Krieg zerstört, eröffnete 1997 neu.<br />
Los 845 Schätzwert 50-125 €<br />
J. C. Pfaff <strong>AG</strong> Möbel und Raumkunst<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark 13.7.1911.<br />
Gründeraktie (Auflage 3500, R 3) EF<br />
Name umgestempelt auf Romanisches Haus <strong>AG</strong>.<br />
Gründung 1911 zur Übernahme der Firma J. C. Pfaff. Firmenzweck:<br />
Tischlerarbeiten aller Art sowie Verwaltung und Verwertung<br />
der Immobile “Romanisches Haus” (Kurfürstendamm 10<br />
und 10a). Im Romanischen Haus befand sich das wohl berühmteste<br />
Café Deutschlands. 1924/25 Totalumbau für das<br />
Café Trumpf und das Gloria-Palast-Kino durch Lessing und<br />
Bremer. 1936 umfirmiert in “Romanisches Haus <strong>AG</strong>”. Das Gebäude<br />
wurde im 2. WK zerstört. Heute steht an dieser Stelle<br />
das Europa-Center. Seit 1956 in Liquidation, 1987 von Amts<br />
wegen gelöscht.<br />
Mindestgebot: 80 %<br />
vom unteren Schätzwert<br />
71
Los 846 Schätzwert 150-200 €<br />
J. C. Richter <strong>AG</strong><br />
Leipzig, Globalurkunde über 9 VZ-Aktien<br />
à 100 RM (es gab insgesamt 100 VZ-Aktien,<br />
R 10) VF<br />
Maschinenschriftliche Ausführung mit Originalunterschriften.<br />
Nur 2 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Uralte, schon 1867 als oHG gegründete Firma, 1913 in eine <strong>AG</strong><br />
umgewandelt. Die Fabrik in Leipzig O 5, Eisenbahnstr. 78 produzierte<br />
Reise-, Schul- und Sportartikel, insbesondere Schulranzen,<br />
Mappen, Rucksäcke, Einkaufstaschen und Papierkörbe.<br />
Börsennotiz: Freiverkehr Leipzig.<br />
Los 847 Schätzwert 10-40 €<br />
J. D. Riedel - E. de Haën <strong>AG</strong><br />
Berlin, Aktie 1.000 RM Juli 1928 (Auflage<br />
5000, R 2) EF<br />
Faksimile-Unterschrift des Deutsche-Bank-Vorstands<br />
Paul Millington Herrmann als AR-Vorsitzender (die<br />
Deutsche Bank war zu der Zeit Großaktionär).<br />
Ursprung ist die 1770 privilegierte Schweizer Apotheke in Berlin,<br />
die 1814 der Apotheker Johann Daniel Riedel übernahm und zu<br />
einer Drogengroßhandlung und chemisch-pharmazeutischen Fabrik<br />
erweiterte. <strong>AG</strong> seit 1905 als J. D. Riedel <strong>AG</strong>. 1912 Bezug des<br />
ganz neu erbauten Werkes am Teltow-Kanal in Berlin-Britz. 1922<br />
Angliederung des Tetralinwerkes in Rodleben/Anhalt (später die<br />
Deutsche Hydrierwerke <strong>AG</strong>). 1928 Verschmelzung mit der „E. de<br />
Haen <strong>AG</strong>“ in Seelze bei Hannover. 1936/37 Übernahme der Chinosolfabrik<br />
<strong>AG</strong> und der Vanillin-Fabrik GmbH in Hamburg. 1948<br />
Sitzverlegung nach Seelze, wo nach der schrittweisen Stilllegung<br />
der Werke in Berlin und Hamburg 1963-73 die Produktion von<br />
Feinchemikalien, Reagenzien, Pharma-Spezialitäten, Riech- und<br />
Geschmackstoffen, Lebensmittelzusatzstoffen und Leuchtpigmenten<br />
konzentriert wurde. Bis in die 90er Jahre über Cassella<br />
zum Hoechst-Konzern gehörig, dann an eine US-Firma verkauft.<br />
Los 848 Schätzwert 10-40 €<br />
J. E. Reinecker <strong>AG</strong><br />
Chemnitz, Aktie 1.000 Mark 23.2.1921<br />
(Auflage 12000, R 1) EF<br />
Gründung 1911 zur Übernahme der Werkzeugmaschinenfabrik von<br />
J. E. Reinecker in Chemnitz-Gablenz. Über 2.400 Mitarbeiter produzierten<br />
vor allem Gewindeschneide- und Bohrwerkzeuge, Fräs- und<br />
Schleifmaschinen, Drehbänke und Maschinen für Zahnräderfabrikation.Börsennotiz<br />
Chemnitz und Berlin.1949 verlagert nach München,<br />
1969 aufgelöst und 1971 Sitzverlegung nach Einsingen bei Ulm (Donau)<br />
und Fortsetzung der Ges. Im selben Jahr noch erloschen.<br />
72<br />
Nr. 849<br />
Los 849 Schätzwert 20-75 €<br />
J. Neumann <strong>AG</strong><br />
(Gildemann Cigarrenfabriken <strong>AG</strong>)<br />
Berlin, VZ-Aktie 200 RM Nov. 1924<br />
(Auflage 1000, R 3) EF<br />
Gründung bereits 1850, seit 1922 <strong>AG</strong> unter dem Namen J.<br />
Neumann <strong>AG</strong>. Hierbei wurde der Aktienmantel der Industriebeteiligungs-<strong>AG</strong><br />
Warstein übernommen. Seit 1941 Gildemann Cigarrenfabriken<br />
<strong>AG</strong>. Die Fabrikation fand in Thüringen, am Eichsfeld<br />
und in Schlesien statt. Insgesamt waren 3000 Mitarbeiter<br />
in 23 mitteldeutschen und 9 schlesischen Betrieben mit einer<br />
Zentralfabrik in Dingelstädt und Wansen (Schles) beschäftigt. Es<br />
wurden auch sämtliche Verpackungs- und Ausstattungsgegenstände<br />
sowie Drucksachen hergestellt. Die Gesellschaft verfügte<br />
1943 über 50 eigene Filialen, dazu eine Anzahl von Verkaufsstellen,<br />
die vertraglich verpflichtet waren, nur Gildemann-<br />
Fabrikate zu führen. Die Werke gingen 1945 verloren, ebenso<br />
das Gildemann Bürohaus in Berlin und 50 firmeneigene Ladengeschäfte<br />
in ganz Deutschland. Die Fabrik in Dingelstädt wurde<br />
zum VEB Gildemann. Es verblieb nur ein kleiner Betrieb in Soltau<br />
mit damals 35 Arbeitnehmern, der 1950 von Helmut Ritter,<br />
dem Inhaber des Unternehmens, wieder eröffnet wurde.<br />
Los 850 Schätzwert 10-40 €<br />
J. P. Bemberg <strong>AG</strong><br />
Wuppertal-Barmen, Aktie 1.000 RM Nov.<br />
1941 (Auflage 5000, R 2) UNC-EF<br />
Gründung 1897 als J. P. Bemberg Baumwoll-Industrie-Gesellschaft,<br />
ab 1903 J. P. Bemberg <strong>AG</strong>. Größter deutscher Produzent<br />
von Kupferseide mit Werken in Wuppertal-Barmen (Kunstseidefabrik)<br />
und Augsburg-Pfersee (Weberei). Weltweit an ähnlichen<br />
Unternehmen beteiligt. 1955 Abschluß eines Organvertrages<br />
mit dem Großaktionär Vereinigte Glanzstoff-Fabriken<br />
<strong>AG</strong>, Wuppertal-Elberfeld. 1961 (Bemberg beschäftigte inzwischen<br />
über 3.000 Mitarbeiter) Neubau einer Perlon-Spinnerei<br />
im Werk Barmen. 1971 auf den Großaktionär Glanzstoff <strong>AG</strong><br />
(heute ENKA/AKZO) verschmolzen.<br />
Los 851 Schätzwert 300-375 €<br />
J. Roth <strong>AG</strong><br />
Berlin, Aktie Lit. A 1.000 Mark Aug. 1923<br />
(Auflage 9000, R 11) VF<br />
Bisher unbekannt gewesene Emission, nur 2<br />
Stück lagen im Reichsbankschatz, dies ist das<br />
letzte noch verfügbare. Fast kpl. Kuponbogen anhängend.<br />
Nr. 852 Nr. 857<br />
Eigentliche Gründung im Jahr 1918. Herstellung von Spezialmaschinen<br />
für die keramische und chemische Industrie und für<br />
die Landwirtschaft, von Hebezeugen und Kränen, Feuerungsanlagen<br />
und Holzbearbeitungsmaschinen. 1922/23 fusionsweise<br />
Übernahme der „Perleberger Maschinenfabrik und Eisengiesserei<br />
<strong>AG</strong>“, zugleich Umstellung des Firmennamens in “J. Roth <strong>AG</strong><br />
Eisengiessereien und Maschinenfabriken” sowie Sitzverlegung<br />
nach Berlin-Tempelhof. Parallel dazu wurde 1923 als Tochtergesellschaft<br />
die “Eisengiesserei und Maschinenfabrik J. Roth<br />
<strong>AG</strong>” mit Sitz in Ludwigshafen neu gegründet. Notierte im Freiverkehr<br />
Berlin und Hamburg. 1924 unter den Einfluss des “Barmat-Konzerns”<br />
gekommen. Mit diesem beschäftigte sich leider<br />
die Berliner Staatsanwaltschaft. Der durch die Ermittlungen bedingte<br />
Entzug der Barmittel trieb diese <strong>AG</strong> 1925 in den Konkurs.<br />
Los 852 Schätzwert 175-300 €<br />
Jätzdorfer Mühle <strong>AG</strong><br />
Jätzdorf bei Ohlau, Aktie 1.000 Mark<br />
29.9.1916 (Auflage 300, R 7) EF<br />
Als <strong>AG</strong> gegründet 1892, ursprünglich errichtet 1854. Zweigniederlassung<br />
in Ohlau. 1899 brannte die Mühle nieder und<br />
wurde wieder aufgebaut. Betriebseröffnung 1900. Die Gesellschaft<br />
gehörte zum Kampffmeyer-Konzern. 1938 ist sie infolge<br />
Umwandlung durch Vermögensübertragung ohne Abwicklung<br />
auf die oHG Schoeller & Co. in Jätzdorf aufgelöst.<br />
Los 853 Schätzwert 25-100 €<br />
Jenaer Elektricitätswerke <strong>AG</strong><br />
Jena, Aktie 1.000 Mark 1.7.1921 (Auflage<br />
2000, R 3) EF<br />
Schöne plastische Umrahmung im Stil gotischer<br />
Maßwerkfenster mit teppichartiger Bordüre.<br />
Bereits 1894 gab es ein Projekt einer vom Weimar-Geraer Bahnhof<br />
(heute Jena-West) ausgehenden schmalspurigen elektrischen<br />
Bahn, das die Stadt Jena aber ablehnte. 1898 unterbreitete<br />
der Berliner Baumeister Becker der Stadt Jena ein Angebot<br />
zum Bau einer elektrischen Bahn zwischen Jena und Apolda sowie<br />
von Elektrizitätswerken in beiden Städten. Nach einer ersten<br />
Absage erhielt die Eisenbahnbau-Gesellschaft Becker & Co.<br />
GmbH von der Stadt Jena 1899 doch die Konzession. Sowohl die<br />
Straßenbahn (mit zunächst 4 Linien und 11 km Betriebslänge)<br />
wie auch das Elektrizitätswerk in Jena wurden 1901 eröffnet. Die<br />
1902 in Berlin gegründete <strong>AG</strong> übernahm von der Initiatorin Bekker<br />
& Co. die Konzession nebst Straßenbahn und das schon in<br />
Betrieb befindliche E-Werk. 1916 Sitzverlegung nach Jena.<br />
1926 Aufnahme der Thüringische Elektricitätsversorgungs-<strong>AG</strong> in<br />
Jena durch Fusion. 1939 erreichte das Jenaer Straßenbahnnetz<br />
seinen dann bis 1963 unveränderten Stand mit den drei Linien<br />
Lobeda-Zwätzen, Mühltal-Jena Ost und Westbahnhof-Saalbahnhof.<br />
Bis zu 4 Mio. Fahrgäste jährlich wurden befördert. Großaktionäre<br />
waren zuletzt die Elektrische Licht- und Kraftanlagen <strong>AG</strong>,<br />
Berlin mit 51,94% und die Stadt Jena mit 41,8%. Zu DDR-Zeiten<br />
wurden die Energieversorgung von Jena und dem Umland<br />
(eigenes Wasserkraftwerk Stadtroda, ansonsten Strombezug<br />
vom Thüringenwerk) und die Straßenbahn in Volkseigentum<br />
überführt. Die Energieversorgung übernahm nach der Wende die<br />
1991 gegründete Stadtwerke Jena-Pößneck GmbH (51 % Stadt<br />
Jena, 49 % Saarberg Fernwärme GmbH). Der Straßenbahnbetrieb<br />
ging an die 1990 gegründete Jenaer Nahverkehrsgesellschaft<br />
(JeNah). Heute verkehren moderne Niederflurzüge auf den<br />
umfassend modernisierten Strecken.<br />
Los 854 Schätzwert 75-125 €<br />
Jenaer Gemeinnützige<br />
Wohnungsfürsorge <strong>AG</strong><br />
Jena, Aktie 1.000 RM Jan. 1937 (Auflage<br />
150, R 6) UNC<br />
Originalunterschriften. Ausgestellt auf Armin<br />
Schmidt, Jena, rückseitig 1939 an die Stadt Jena<br />
übertragen.<br />
Gegründet 1935 zwecks Bau und Betreuung von Kleinwohnungen<br />
im eigenen Namen. In den Jahren 1935-1941 wurden genau<br />
1.000 Wohnungen fertiggestellt. Großaktionäre (1943):<br />
Stadt Jena (50%), Carl Zeiss, Jena (32%), Schott und Genossen,<br />
Jena (18%). Heute die Ernst-Abbe-Siedlung GmbH. Zusammen<br />
mit der Carl-Zeiss-Siedlung GmbH werden über 1.100 Wohnungen<br />
und Gewerbeeinheiten in Jena und Saalfeld verwaltet.<br />
Los 855 Schätzwert 400-500 €<br />
Jenaer Gemeinnützige<br />
Wohnungsfürsorge <strong>AG</strong><br />
Jena, Zwischenschein 10 x 5.000 RM<br />
1.6.1940 (Auflage nur max. 2 Stück, R<br />
12), ausgestellt für die Universitätsstadt<br />
Jena VF<br />
Maschinenschriftliche Ausfertigung mit Originalunterschrift.<br />
Einzelstück aus dem Reichsbankschatz.<br />
Los 856 Schätzwert 30-75 €<br />
Johannes Haag Zentralheizungen <strong>AG</strong><br />
Berlin, Aktie 100 RM Juni 1944 (Auflage<br />
750, R 5) EF<br />
Gründung der Stammfirma bereits1843 in Augsburg, ab 1898<br />
<strong>AG</strong> als “Johannes Haag Maschinen- und Röhrenfabrik <strong>AG</strong>” mit<br />
weiteren Niederlassungen in Berlin, München, Nürnberg, Karlsruhe,<br />
Breslau, Danzig, Königsberg und Wien. Hergestellt wur-
den Heizungs- und Lüftungsanlagen. Großaktionäre waren die<br />
Kgl. Prinzen Konrad und Georg von Bayern, Börsennotiz in<br />
München und Augsburg (1932 eingestellt). 1930 umfirmiert<br />
wie oben, infolge der katastrophalen Lage der Branche in der<br />
Weltwirtschaftskrise 1932 Sitzverlegung nach Berlin und Konzentration<br />
auf die Niederlassungen Berlin, Breslau, Karlsruhe<br />
und Wien (alle übrigen wurden verkauft oder stillgelegt). Großaktionär<br />
1944: S. Kgl. H. Prinz Konrad von Bayern (70 %). 1960<br />
umfirmiert in Johannes Haag <strong>AG</strong>, Berlin (West), 1964 Konkurs.<br />
Los 857 Schätzwert 600-750 €<br />
Julius Berger Tiefbau-<strong>AG</strong><br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark Jan. 1922<br />
(Auflage 24000, R 10) VF+<br />
Faksimile-Unterschrift Julius Berger. Zuvor völlig<br />
unbekannt gewesener Jahrgang, nur 3 Stück wurden<br />
jetzt im Reichsbnkschatz gefunden. Ohne Umstellungsstempel,<br />
schon beim Aktienumtausch<br />
1926 vergessen worden.<br />
Julius Berger (1862 - 1943)<br />
1890 gründete Julius Berger ein Baugeschäft in Zempelburg/Westpreußen,<br />
das 1892 nach Bromberg/Posen verlegt<br />
wurde. 1905 Umwandlung in eine <strong>AG</strong>. Anfangs vor allem Eisenbahnbauten<br />
in den östlichen Provinzen, später auch Ausführung<br />
von Großbauvorhaben im In- und Ausland. Sitzverlegungen<br />
1910 nach Berlin und 1948 nach Wiesbaden. 1969<br />
Fusion mit der Bauboag (die 1890 gegründete vormalige Berlinische<br />
Boden-Gesellschaft). Die Dresdner Bank, die an allen<br />
drei Unternehmen (Julius Berger Tiefbau-<strong>AG</strong>, Bauboag und<br />
Grün & Bilfinger <strong>AG</strong>, Mannheim) beteiligt war, verschaffte 1970<br />
der Grün & Bilfinger <strong>AG</strong> (Börsenname: Grünfinger) eine Mehrheitsbeteiligung<br />
an der Julius Berger Tiefbau-<strong>AG</strong>, 1975 dann<br />
Fusion zur Bilfinger + Berger Bauaktiengesellschaft. Heute der<br />
auch international erfolgreiche zweitgrößte deutsche Baukonzern,<br />
dessen Vorstandsvorsitzender 2011 der frühere hessische<br />
Ministerpräsident Roland Koch wurde.<br />
Los 858 Schätzwert 30-75 €<br />
Julius Berger Tiefbau-<strong>AG</strong><br />
Berlin, Aktie 1.000 RM Aug. 1929<br />
(Auflage 3500, R 3) UNC-EF<br />
Faksimile-Unterschrift Julius Berger.<br />
Los 859 Schätzwert 30-75 €<br />
Julius Langes Leinen-Industrie <strong>AG</strong><br />
Großschönau, Aktie 500 RM 1.8.1933<br />
(Auflage 575, R 4) EF<br />
Gründung 1860 als oHG unter der Firma Jul. Lange, als <strong>AG</strong> ab<br />
1913. Sitz bis 1933 in Waltersdorf bei Zittau. Betrieb aller<br />
Zweige der Textilindustrie.<br />
Los 860 Schätzwert 20-60 €<br />
Julius Römpler <strong>AG</strong><br />
Zeulenroda, Aktie 1.000 RM Juni 1929<br />
(Auflage 1550, R 3) EF<br />
Gründung 1870, <strong>AG</strong> seit 1911. Herstellung und Vertrieb von<br />
gummielastischen und unelastischen Wirk-, Strick- und Webwaren,<br />
von Bandagen, Miedern und Verbandmitteln aller Art.<br />
Verkaufsstelle in Wien, Zweigstelle in Schönlind (Egerland).<br />
1953 Enteignung, danach VEB elastic-mieder Zeulenroda, 1993<br />
Fortsetzung der Gesellschaft als Julius Römpler <strong>AG</strong>, Zeulenroda.<br />
1994 Umwandlung in eine GmbH, 1997 Umfirmierung in EX-<br />
CELLENT DESSOUS GmbH, 2000 Excellent Intimates GmbH.<br />
Los 861 Schätzwert 600-750 €<br />
Julius Sichel & Co. KGaA<br />
Mainz, Aktie 1.000 Mark 19.11.1910<br />
(Auflage 650, R 12) VF<br />
Mit Originalunterschriften. Zuvor völlig unbekannt<br />
gewesene Emission, ein Unikat aus dem Reichsbankschatz.<br />
Die traditionsreiche, bereits 1815 gegründete Firma war mit<br />
Sitz in Mainz und in Luxemburg im Eisenhandel tätig. 1907 von<br />
einer offenen Handelsgesellschaft in eine Kommanditgesellschaft<br />
auf Aktien umgewandelt, die Aktien notierten ab 1922 in<br />
Frankfurt, München und Köln, ferner auch in Genf und Basel.<br />
Einer der damals größten europäischen Eisenhändler mit Beteiligungen<br />
an der Julius Sichel & Co. GmbH (Mainz, München,<br />
Augsburg, Duisburg, Frankfurt/Main, Hamburg), der S. Weil<br />
GmbH (Lahr, München, Stuttgart, Feuerbach), der Paul Richter<br />
GmbH (Mainz, Heilbronn), der Eduard Laeis & Co. GmbH sowie<br />
der Oscar Schneider & Co. GmbH (Trier), der Comptoir des Fers<br />
et Métaux S.A. (Luxemburg), der Quincaillerie d’Esch S.A.<br />
(Esch/Alzette), der Socété Coopérative pour la Fourniture de<br />
Matériaux aux Régions Libérées (Paris). Daneben in den Abnehmerbranchen<br />
Beteiligungen in Sachen Eisenkonstruktionen,<br />
Hoch- und Brückenbau, Waggon- und Maschinenbau u.a.<br />
bei der Gasapparat und Gusswerk <strong>AG</strong> (Mainz), Hein, Lehmann<br />
& Co. <strong>AG</strong> (Düsseldorf-Oberbilk und Berlin-Reinickendorf), Kaltwalzwerk<br />
<strong>AG</strong> (Villingen/Baden), Laeis-Werke <strong>AG</strong> (Trier), Gebrüder<br />
Schöndorff <strong>AG</strong> (Düsseldorf), “Turbo” Maschinenbau <strong>AG</strong><br />
(Überlingen/Bodensee), Lahrer Maschinenbau GmbH (Lahr),<br />
“Bühlag” <strong>AG</strong> für Schrauben- und Maschinen-Industrie (Bühl i.<br />
Baden). Weitere Beteiligungen an der Chemische Fabrik für<br />
Hüttenprodukte <strong>AG</strong> (Düsseldorf-Oberkassel), der Metallchemie<br />
GmbH (Düsseldorf) und der Rheinische Carbidkontor GmbH<br />
(Mainz). Schließlich besaß man auch sämtliche Kuxe der <strong>Gewerkschaft</strong><br />
Maria Glück (Brühl bei Köln) und die Kuxenmehrheit<br />
der <strong>Gewerkschaft</strong> Düren (Düren/Rhld.) sowie eine nennenswerte<br />
Beteiligung bei der Westbank <strong>AG</strong> (Frankfurt/Main, früher<br />
Deutsche Palästina-Bank). 1920 kam es zu einer Überkreuz-<br />
Beteiligung mit der <strong>AG</strong> für Industriewerte “Agfi” im schweizerischen<br />
Luzern. Nach der Inflation geriet die Firma in Kreditschwierigkeiten.<br />
Sinkende Börsenkurse des großen kreditfinanzierten<br />
Beteiligungsportfolios erforderten Nachschüsse, die<br />
man nicht leisten konnte. 1925 insolvent geworden, 1926 Beschluß<br />
der Liquidation, 1932 von Amts wegen gelöscht.<br />
Los 862 Schätzwert 200-250 €<br />
Julius Sichel & Co. KGaA<br />
Mainz, Aktie 1.000 Mark 26.4.1923<br />
(Auflage 300000, R 10) VF<br />
Einzelstück aus dem Reichsbankschatz. Identische<br />
Gestaltung wie voriges Los.<br />
Nr. 860 Nr. 863<br />
Los 863 Schätzwert 125-200 €<br />
Julius Stilke Möbelfabrik <strong>AG</strong><br />
Berlin-Charlottenburg, Aktie 1.000 Mark<br />
9.1.1923 (Auflage 150, R 8) VF<br />
Mit Sägeblatt als Logo.<br />
Gründung 1923. Herstellung von Möbeln und Handel mit Möbeln<br />
jeder Art. 1926 Eröffnung des Konkursverfahrens, 1929<br />
erloschen.<br />
Los 864 Schätzwert 30-75 €<br />
Julius Werthschütz <strong>AG</strong><br />
Ottendorf-Okrilla, Aktie 1.000 RM Jan.<br />
1941 (Auflage 300, R 4) EF<br />
Gründung 1878, <strong>AG</strong> seit 1922. Erzeugnisse: Herstellung von<br />
Möbeln jeder Art, vor allem Schlafzimmer in echt und lackiert.<br />
1948 verlagert nach Bielefeld, 1950 von Amts wegen gelöscht.<br />
Los 865 Schätzwert 10-40 €<br />
Junkers Flugzeug-<br />
und Motorenwerke <strong>AG</strong><br />
Dessau, 4 % Teilschuldv. 500 RM April<br />
1942 (Auflage 20000, R 1) EF<br />
Einer der bedeutendsten deutschen Luftfahrt-Werte.<br />
Mit Faksimile-Unterschrift von Prof. Junkers.<br />
Gründung 1917 als Junkers Fokkerwerke <strong>AG</strong>. Der geniale Luftfahrtpionier<br />
Prof. Hugo Junkers arbeitete zuerst mit Anthony<br />
Herman Gerard Fokker zusammen (Fokker bot bei Ausbruch<br />
des I. Weltkrieges seine Dienste beiden Seiten an; die Deutschen<br />
akzeptierten als erste). 1918 kehrte Fokker nach Holland<br />
zurück. 1919 Umfirmierung in Junkers Flugzeugwerk <strong>AG</strong> und<br />
1936 in Junkers Flugzeug- und Motorenwerke <strong>AG</strong> anläßlich<br />
der Übernahme der Junkers Motorenbau GmbH und der Magdeburger<br />
Werkzeugmaschinenfabrik GmbH. Die Nazis enteigneten<br />
Prof. Junkers 1933 nicht nur, sondern erteilten ihm in<br />
seiner Firma sogar Hausverbot. Die Junkers-Werke wurden im<br />
2. WK dann der wichtigste Flugzeuglieferant für die deutsche<br />
Luftwaffe. Die Werke im Osten wurden nach dem Krieg enteignet.<br />
1958 Sitzverlegung von Dessau nach München, wo Basisforschungen<br />
und Entwicklungen der Luft- und Raumfahrttechnologie<br />
weiterbetrieben wurden. Alleinaktionär war nun die<br />
Flugzeug-Union-Süd GmbH (die wiederum zur Messerschmitt<br />
<strong>AG</strong> in Augsburg gehörte, einem indirekten Vorläufer von Airbus<br />
Industries und damit auch der 2000 gegründeten EADS). Ab<br />
1967 GmbH. 1973 übernommen von der Daimler-Benz Luftund<br />
Raumfahrt Holding <strong>AG</strong>.<br />
Los 866 Schätzwert 20-60 €<br />
Just & Co. <strong>AG</strong><br />
Geraberg i.Thür., VZ-Aktie 100 RM<br />
2.9.1929 (Auflage 600, R 4) EF<br />
Gründung 1874 als oHG. 1879 wird die Bahnlinie Arnstadt-Ilmenau<br />
eröffnet, 1895 baut der Fabrikbesitzer Just auf einem<br />
Grundstück mit großem Waldbestand am Bahnhof Geraberg eine<br />
Kofferfabrik. 1909 Umwandlung in eine GmbH, seit 1923<br />
<strong>AG</strong>. Etwa 300 Mitarbeiter waren mit der Herstellung von Koffern,<br />
Taschen und Lederwaren beschäftigt.<br />
Los 867 Schätzwert 250-400 €<br />
Jute-Spinnerei und Weberei Hansa <strong>AG</strong><br />
Barth in Pommern, Aktie 1.000 Mark Juni<br />
1909. Gründeraktie (Auflage 1000, R 7) VF+<br />
Großformatiges Papier, sehr dekorativ verziert.<br />
Gegr. 1909 als Jute-Spinnerei und Weberei Hansa <strong>AG</strong> in Barth.<br />
Die Ostdeutsche Jutespinnerei & Weberei GmbH in Barth brachte<br />
dabei die ihr gehörigen Grundstücke in die <strong>AG</strong> ein mit sämtlichen<br />
Bestandteilen, Maschinen und Fabrikgebäuden, sämtlichen<br />
Rohrleitungen, Webstühlen Spinnmaschinen und Werkzeugen.<br />
Herstellung von Fabrikaten aller Art aus Jute und ähnlichen<br />
Faserstoffen. 1911 wurde das Konkursverfahren eröffnet.<br />
Los 868 Schätzwert 10-40 €<br />
Kabelwerk Rheydt <strong>AG</strong><br />
Rheydt, Aktie 100 RM Mai 1925 (Auflage<br />
12500, R 2) EF<br />
Gründung 1898. 1936 Übernahme der „Deutsche Kabelwerke<br />
<strong>AG</strong>“ in Berlin. Gehörte als AEG-Kabelwerke Rheydt zuletzt zum<br />
AEG-Konzern. 1992 wurde der Bereich Kabel von der Alcatel<br />
Alsthom übernommen. Im Jahr 2000 wurden dann die Kabelaktivitäten<br />
in die neu gegründete Firma Nexus ausgegliedert,<br />
deren IPO 2001 erfolgte.<br />
Los 869 Schätzwert 30-75 €<br />
Kabelwerk Vacha <strong>AG</strong><br />
Vacha (Rhön), Aktie 300 RM 17.7.1941<br />
(Auflage 900, R 3) UNC-EF<br />
Gründung 1919 als Elektrotechnische Fabrik, <strong>AG</strong>. Herstellung<br />
von isolierten Leitungsdrähten, Kabeln, Kapa-Antennen, Erzeugnissen<br />
gegen Rundfunkstörungen sowie Kapa-Hochfrequenzkabel<br />
für Sende-, Empfangs-. Meß- und Peil-Zwecke.<br />
Betrieb in der DDR enteignet, ab 1946 VEB Kabelwerk Vacha,<br />
1990 Nexans Industries <strong>AG</strong> & Co. KG.<br />
Los 870 Schätzwert 150-250 €<br />
Kaiserhof Hotelbetriebs-<strong>AG</strong> Bärenfels<br />
Bärenfels, Aktie 100 Goldmark Aug. 1924<br />
(Auflage 500, R 6) EF-VF<br />
Gründung 1923. Erwerb und Betrieb von Hotelunternehmungen,<br />
insbesondere der Betrieb des 1905 erbauten Kurheims<br />
73
“Kaiserhof”. Zu DDR-Zeiten FDGB-Ferienheim “Max Niklas”,<br />
dann “Sachsenhof”. Nach der Wende wurden viele Gebäude im<br />
erzgebirgischen Kurort Bärenfels renoviert, aber das ehemalige<br />
Kurheim liegt noch im Dornröschenschlaf.<br />
Los 871 Schätzwert 275-350 €<br />
Kali-, Oel- und Kohlen-<br />
Bohrgesellschaft „Christianshall“<br />
Berlin, Namens-Anteil 1/1.000 12.3.1906<br />
(R 10) EF<br />
Sehr schöne Jugendstilumrandung.<br />
Die Gesellschaft besaß eine Konzession in Garßen bei Celle.<br />
Los 872 Schätzwert 300-375 €<br />
Kali-Bohrgesellschaft „Burghardtshall”<br />
Hannover, Anteilschein 1.7.1905 (Auflage<br />
1000, R 10), ausgestellt auf Otto Dunkel<br />
in Steglitz VF<br />
Schöne Jugendstil-Umrahmung, Originalunterschriften.<br />
Zuvor vollkommen unbekannt gewesener<br />
Kali-Wert, nur 3 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Kleine Randschäden fachgerecht restauriert.<br />
Los 873 Schätzwert 275-350 €<br />
Kali-Bohrgesellschaft Neue Vereinigung<br />
Braunschweig, Namens-Anteil 14.9.1905<br />
(Auflage 1000, R 8), ausgestellt auf den<br />
Dortmunder Bank-Verein VF<br />
Originalunterschriften Otto Schröder und Gerhard<br />
Dietz. Schöne Jugendstilumrandung. Zuvor vollkommen<br />
unbekannt gewesen!<br />
Gegründet Ende 1904. Gerechtsame in den Gemarkungen Gr.<br />
Schwülper und Lagesbüttel im Kreise Gifhorn (etwas nördlich<br />
von Braunschweig), ca. 5 preuss. Maximalfelder. Markscheidend:<br />
<strong>Gewerkschaft</strong> Kronprinz Wilhelm und <strong>Gewerkschaft</strong> Han-<br />
74<br />
nover. Die Tiefbohrung durchteufte bis 500 m jüngere Schichten,<br />
traf aber keine Kalilager an, und wurde dann eingestellt.<br />
Los 874 Schätzwert 10-40 €<br />
Kali-Chemie <strong>AG</strong><br />
Berlin, 5 % Teilschuldv. 1.000 RM Nov.<br />
1939 (Auflage 8400, R 3) EF<br />
Gründung 1896 als Bohrgesellschaft, seit 1899 die „Kaliwerke<br />
Friedrichshall <strong>AG</strong>“ mit Sitz in Hannover (1903-07 Sitz in Berlin,<br />
1907-28 in Sehnde). 1920 Erwerb der Bergwerks-Ges. Glükkauf-Sarstedt<br />
mbH in Sehnde. 1921 Übernahme der <strong>Gewerkschaft</strong>en<br />
Salzbergwerk Neu-Staßfurt I und II und Umfirmierung<br />
in “Kaliwerke Neu-Stassfurt-Friedrichshall <strong>AG</strong>”. 1925 Erwerb<br />
der <strong>Gewerkschaft</strong> Deutschland und Kaliwerkes Ronnenberg I.<br />
1928 Verschmelzung mit der Rhenania-Kunheim Verein Chem.<br />
Fabriken <strong>AG</strong> und Umfirmierung in “Kali-Chemie <strong>AG</strong>”. Werke in<br />
Sehnde und Ronnenburg (Kalibergwerke), Altona (Pharmazeutika),<br />
Brunsbüttelkoog (Rhenania-Phosphat), Heilbronn (Ammoniaksoda),<br />
Hönningen (Bariumcarbonat und Superphosphat), Kanne<br />
in Berlin-Niederschöneweide (Schwefelsäure), Meggen<br />
a.d.Lenne (Schwerspatbergwerk für Werk Hönningen), Oberhausen<br />
und Wohlgelegen bei Mannheim (Schwefelsäure), Stolberg<br />
(Sulfat und Salzsäure) und Brohl (Phonolith-Steinbrüche).<br />
1928-31 Erwerb der Aktienmehrheit der Arienheller Sprudel <strong>AG</strong><br />
in Arienheller-Rheinbrohl, der Peroxydwerk Siesel <strong>AG</strong> in Köln-<br />
Dellbrück und der <strong>AG</strong> Georg Egestorffs Salzwerke und Chemische<br />
Fabriken in Hannover. 1930 Erwerb aller Betriebe der in<br />
Konkurs gegangenen Heyl-Beringer Farbenfabriken <strong>AG</strong> mit Werken<br />
in Berlin-Charlottenburg, Düsseldorf, Rodenkirchen, Andernach,<br />
Zollhaus b. Wiesbaden und Wunsiedel i. Bay. Hier ist also<br />
eine geniale Strategie zu erkennen: Schwächen der Konkurrenz<br />
in der Weltwirtschaftskrise nutzte die Kali-Chemie <strong>AG</strong> ganz gezielt<br />
zum Ausbau einer eigenen überragenden Position.<br />
1937/38 Übernahme der Chemische Fabrik Güstrow <strong>AG</strong>, der<br />
Krause-Medico GmbH in München und der Kohlensäure-Werk<br />
Deutschland <strong>AG</strong>. Sitzverlegungen 1947 nach Sehnde und 1951<br />
nach Hannover. 1960 Übernahme der Rheinische Kohlensäure-<br />
Industrie in Bad Hönningen und der Saline Ludwigshalle <strong>AG</strong> in<br />
Bad Wimpfen sowie Konzentration der Arzneimittelproduktion<br />
der Werke Altona und München im neuen Werk Neustadt a. Rübenberge.<br />
Heute zum belgischen Solvay-Konzern gehörig, seit<br />
1990 besteht zwischen der Solvay Deutschland GmbH und der<br />
in Hannover bis heute börsennotierten Kali-Chemie <strong>AG</strong> ein Beherrschungs-<br />
und Ergebnisabführungsvertrag.<br />
Los 875 Schätzwert 50-120 €<br />
Kaliwerke Benthe <strong>AG</strong><br />
Hannover, Aktie 1.000 Mark 8.9.1923<br />
(Auflage 398000, R 5) EF<br />
Gründung der Kali-Bohrgesellschaft Benthe 1895, Umwandlung<br />
in <strong>Gewerkschaft</strong> Walmont 1897, <strong>AG</strong> seit 1901. Nach einem<br />
Laugeneinbruch ab 1902 nur noch Salinenbetrieb. 1905 wurde<br />
das Aktienkapital um 1.004.000 M auf 2 Mio. M herabgesetzt<br />
durch Ankauf von 4 Aktien und Zusammenlegung der übrigen<br />
im Verh. 3 : 2. Die Dreiviertelmehrheit der Aktien ging Ende<br />
1920 zu 200 % in den Besitz der Alkaliwerke Ronneberg über.<br />
1926 Stillegung der Werke und Auflösung der Gesellschaft.<br />
Nr. 876<br />
Los 876 Schätzwert 50-125 €<br />
Kaliwerke Weimar<br />
Berlin, Anteil-Schein 19.10.1910.<br />
Gründerstück (Auflage 1000, R 3) EF<br />
Die Kaliwerke übernahmen die Ausübung eines Konzessionsvertrages,<br />
den die deutsche Tiefbohr-<strong>AG</strong> 1905 mit der weimarischen<br />
Staatsregierung abgschlossen hatte. Danach wurde<br />
der Gesellschaft das ausschließliche Recht verliehen, innerhalb<br />
eines etwa 250 preußische Maximalfelder großen Gebietes im<br />
Hauptlandesteil im weiteren Umkreis um Weimar auf Kalisalze<br />
zu schürfen und Bergwerkseigentum zu erwerben. Es sind Kalilager<br />
in einer Mächtigkeit bis über 20 m nachgewiesen worden.<br />
Es wurden Carnallite, hochprozentige Sylvinite sowie Hartsalze<br />
festgestellt.<br />
Los 877 Schätzwert 30-75 €<br />
Kalk- und Zementwerke Hansdorf <strong>AG</strong><br />
Hansdorf bei Pakosch, Aktie 10.000 RM<br />
Aug. 1942 (R 5) EF<br />
Im Jahr 1888 von der Gogolin-Gorasdzer Kalk- und Zementwerke<br />
<strong>AG</strong> in Breslau als kleine Kalksteingrube käuflich erworben<br />
und weiter ausgebaut. Hansdorf liegt südlich von Bromberg<br />
und gehört zu Westpreußen. Nach dem 1. Weltkrieg ging<br />
das Werk in polnischen Besitz über. Im Okt. 1939 für den Deutschen<br />
Staat beschlagnahmt und bis zum Verkauf des polnischen<br />
Aktienkapitals kommissarisch verwaltet. Zuletzt Produktion<br />
von Bau- und Düngekalk. Letzter Großaktionär: OMZ Vereinigte<br />
Ost- und Mitteldeutsche Zement <strong>AG</strong>, Oppeln (90%).<br />
Los 878 Schätzwert 150-250 €<br />
Kalker Brauerei-<strong>AG</strong><br />
vormals Jos. Bardenheuer<br />
Kalk, Aktie 1.000 Mark 7.12.1921<br />
(Auflage 650, R 7) VF<br />
Die 1888 gegründete und an den Börsen Köln und Frankfurt<br />
eingeführte <strong>AG</strong> übernahm in Köln-Kalk die Brauerei mit Mälzerei<br />
von Jos. Bardenheuer. Selten mehr als 40.000 hl Bier wurden<br />
im Jahr abgesetzt. Umfirmiert 1938 in Kronenbrauerei <strong>AG</strong><br />
und 1954 in Kölner Mälzerei <strong>AG</strong>. Die Aktienmehrheit hatte inzwischen<br />
von der Dom-Brauerei Carl Funke <strong>AG</strong> in Köln gewechselt<br />
zur Hansa <strong>AG</strong> in Basel. 1963 wurde die Mälzerei eingestellt,<br />
danach fristete die <strong>AG</strong> noch einige Zeit mit der Vermietung<br />
von 158 auf dem Mälzereigelände errichteten Garagen<br />
ihr Leben - immer noch im Freiverkehr Düsseldorf börsennotiert.<br />
Die HV vom 21.3.1968 beschloß die Auflösung.<br />
Los 879 Schätzwert 40-80 €<br />
Kamenzer Bank <strong>AG</strong><br />
Kamenz, Aktie 500 RM 10.3.1933<br />
(Auflage 324, R 5) UNC-EF<br />
Gründung der <strong>AG</strong> 1922, vorher war die Kamenzer Bank eine<br />
Genossenschaftsbank. Seit Februar 1924 Freundschaftsverhältnis<br />
mit der Sächsischen Staatsbank, die bei dieser Gelegenheit<br />
Vorzugs-Aktien der Kamenzer Bank übernahm. 1945 wurde<br />
die Bank durch die Sächsische Landesbank abgewickelt.<br />
Los 880 Schätzwert 125-200 €<br />
Kammgarnspinnerei Kaiserslautern<br />
Kaiserslautern, Aktie 100 RM Dez. 1931<br />
(Auflage 2500, R 7) EF<br />
Gründung 1857, Betrieb einer Wäscherei, Kämmerei und Färberei<br />
sowie einer Wollfettfabrik. Die seit 1922 bestandene<br />
Interessengemeinschaft mit der (in der Weltwirtschaftskrise<br />
spektakulär zusammengebrochenen) Norddeutschen Wollkämmerei-<br />
und Kammgarnspinnerei in Bremen (Nordwolle) riss<br />
Kammgarn Kaiserslautern 1931 fast mit in den Abgrund. Nach<br />
1945 Wiederaufbau des fast völlig zerstörten Betriebes. Börsennotiz<br />
im Freiverkehr Frankfurt, Großaktionär war die J. F.<br />
Adolff <strong>AG</strong> aus Backnang. 1981 Anschlusskonkurs.<br />
Los 881 Schätzwert 30-75 €<br />
Kammgarnspinnerei Meerane<br />
Meerane i.S. , Aktie 100 RM 4.5.1927<br />
(Auflage 4000, R 3) EF<br />
Die seltene Variante der Entwertung durch Stempel<br />
des BAROV (mit dem Bundesadler).<br />
Gründung 1892. Herstellung und Vertrieb von Garnen, Zwirnen<br />
und verwandten Waren. In der DDR ab 1946 bis 1976 als VEB<br />
Kammgarnspinnerei Meerane weitergeführt. 1991 Fortsetzung der<br />
Gesellschaft als Vermögensverwaltung Meerane <strong>AG</strong>, Meerane.<br />
Los 882 Schätzwert 40-75 €<br />
Kammgarnspinnerei Schedewitz <strong>AG</strong><br />
Schedewitz, Aktie 1.000 Mark 21.6.1923<br />
(Auflage 1100, R 7) VF<br />
Gründung 1839, <strong>AG</strong> seit 1899. Aufgrund schwerer Bergschäden<br />
durch unter der Fabrik liegende Kohlenbergwerke wurde<br />
das Werk 1921 nach Silberstraße verlegt. Die Fabrikgebäude in<br />
Schedewitz wurden an die Hataz Kleinautomobilwerke <strong>AG</strong>,<br />
Zwickau, verkauft. 1924 Neubau einer Wollkämmerei. 1929<br />
Fusion mit der Kammgarnspinnerei Silberstraße. Börsennotiz<br />
Berlin und Leipzig. 1946 enteignet, 1954 Sitzverlegung nach<br />
Hamburg. Zuletzt nur noch Verwaltung von Restvermögen, die<br />
HV vom 10.8.1963 beschloss die Auflösung der Gesellschaft.<br />
Los 883 Schätzwert 10-25 €<br />
Kammgarnspinnerei Stöhr & Co. <strong>AG</strong><br />
Leipzig, Aktie 100 RM 1.12.1937 (Auflage<br />
40000, R 2) UNC-EF<br />
Traditionsreiches Textilunternehmen, Gründung 1880 als<br />
KGaA, <strong>AG</strong> seit 1911. Eigene Werke in Plagwitz, Markkleeberg<br />
und Wüstegiersdorf. außerdem mit Mehrheit beteiligt an: Leipziger<br />
Wollkämmerei <strong>AG</strong>; C.F. Solbrig Söhne <strong>AG</strong>, Chemnitz; Elberfelder<br />
Textilwerke <strong>AG</strong>; Ohligser Leinen- und Baumwollweberei<br />
<strong>AG</strong>; Konkordia Spinnerei Stöhr & Co. KG, Politz (Sudetengau);<br />
Vaterländische Kammgarnspinnerei und Weberei <strong>AG</strong>, Budapest;<br />
Corona Kammgarnspinnerei R.A.G. Weidenbach (Rumänien).<br />
Bereits 1889 Gründung der Botany Worsted Mills in
New York, welche Kämmerei, Kammgarn- und Streichgarnspinnerei<br />
sowie Herren- und Damenstoffweberei umfasste und sich<br />
zur größten Kammgarnspinnerei der USA entwickelte. 1918<br />
wurde diese Beteiligung von den Amerikanern sequestiert,<br />
1923 unbeschadet der Freigabeforderungen aus den Händen<br />
der Alian Property Custodian zurückerworben. Nach 1945 Sitzverlegung<br />
nach Mönchengladbach, die Stöhr & Co. <strong>AG</strong> ist bis<br />
heute börsennotiert.<br />
Los 884 Schätzwert 10-40 €<br />
Kammgarnspinnerei zu Leipzig<br />
Leipzig, Aktie 100 RM 15.2.1938 (Auflage<br />
1300, R 2) UNC-EF<br />
Die Gesellschaft wurde um 1830 von dem in Braunschweig geborenen<br />
Baumwollspinnereibesitzer Johann Heinrich Ferdinand<br />
Hartmann (1790-1842) gegründet und war bereits 1842 die<br />
größte Spinnerei Sachsens. Die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft<br />
erfolgte bereits 1836 als „Kammgarnspinnerei zu<br />
Pfaffendorf“. Im Jahr 1862 wurde der ursprüngliche Name in<br />
„Kammgarnspinnerei zu Leipzig“ umgeändert. Ihren Sitz hatte<br />
die <strong>AG</strong> in der Pfaffendorfer Straße 31-33, Leipzig. Geschäftszweck<br />
war der vollstufige Betrieb als Wäscherei, Kämmerei, Färberei,<br />
Spinnerei und Zwirnerei. Die Fabrik, anfänglich mit über<br />
2.700 Spindeln begonnen, arbeitete nun mit fast 66.500 Spinnspindeln,<br />
über 8.000 Zwirnspindeln und beschäftigte um die<br />
950 Mitarbeiter. Der älteste Teil des Spinnereihochbaus wurde<br />
1907 durch einen Neubau ersetzt. 1914 bis 1918 arbeitete die<br />
Gesellschaft für den Heeresbedarf. 1916 zudem Aufnahme der<br />
Fabrikation von Papiergarn. Börsennotiert war die Gesellschaft<br />
in Leipzig. 1950 Sitzverlegung nach Wiesbaden, 1953 nach<br />
Stuttgart und 1966 nach München. Nach der Enteignung zu<br />
Gunsten des Landes Sachsen nur noch Verwaltung des Gesellschaftsvermögens.<br />
Noch heute in Berlin börsennotiert.<br />
Los 885 Schätzwert 150-200 €<br />
Kampnagel <strong>AG</strong> (vormals Nagel & Kaemp)<br />
Hamburg, VZ-Aktie 100 RM Dez. 1941<br />
(Auflage 200, R 8) EF-<br />
Gründung 1865 unter der Firma Nagel & Kaemp, <strong>AG</strong> seit 1889<br />
als Eisenwerk vorm. Nagel & Kaemp <strong>AG</strong>. Hergestellt wurden<br />
Kräne, Transportanlagen, Getriebe und Walfanggeräte. Umbenannt<br />
1934 in Kampnagel <strong>AG</strong> und 1965 in IWT Industriewerke<br />
Transportsysteme <strong>AG</strong>. 1968 Einstellung der Produktion, 1970<br />
Umwandlung in eine GmbH. Die Werkshalle wird seitdem für<br />
kulturelle Veranstaltungen genutzt.<br />
Los 886 Schätzwert 75-150 €<br />
Kant Chocoladenfabrik <strong>AG</strong><br />
Wittenberg, Aktie Lit. A 1.000 RM Nov.<br />
1942 (Auflage 504, R 7) EF<br />
Gründung 1886 in Hamburg als “<strong>AG</strong> für automatischen Verkauf”,<br />
1902 Sitzverlegung nach Berlin, im Mai des gleichen<br />
Jahres Inbetriebnahme der Schokoladenfabrik, 1922/23 Sitzverlegung<br />
nach Wittenberg und Umfirmierung wie oben. Börsennotiz<br />
Hamburg, Großaktionär war die Rabbethge & Giesekke<br />
<strong>AG</strong> in Kleinwanzleben (heute KWS Kleinwanzlebener Saatzucht<br />
<strong>AG</strong> mit Sitz in Einbeck). Der Wittenberger Betrieb wurde<br />
1945 enteignet, 1949/50 Fusion mit der 1910 in Dresden gegründeten<br />
Hartwig & Vogel <strong>AG</strong> (Herstellung von Schokolade<br />
und Zuckerwaren, Handel mit Kaffee, Tee und Tabakwaren),<br />
Sitzverlegung der Kant-Hartwig & Vogel <strong>AG</strong> nach Einbeck und<br />
Neuaufbau eines Produktionsbetriebes, allerdings ohne dauernden<br />
Erfolg: 1957 im Handelsregister gelöscht.<br />
Los 887 Schätzwert 30-75 €<br />
Kaoko-Land- und Minen-Gesellschaft<br />
Berlin, VZ-Anteil Ser. III 10 x 10 RM<br />
12.9.1925 (R 3) EF<br />
Zweisprachig deutsch/englisch.<br />
Bei ihrer Gründung 1895 übernahm die Gesellschaft von dem<br />
Bremer Kaufmann Lüderitz ein etwa 100.000 qkm großes Gebiet<br />
in Deutsch-Südwestafrika mit bedeutenden Erzvorkommen<br />
(Eisenerz, Gold, Kupfer, Zink). Nach dem 1. Weltkrieg Enteignung<br />
des Besitzes durch die Republik Südafrika. Alle bis 1939<br />
unternommenen Anstrengungen, eine Rückgabe zu erreichen,<br />
blieben erfolglos. Eine Entschädigung zahlte das Deutsche<br />
Reich in diesem Fall nicht, trotzdem hatte die Ges. ein ungewöhnlich<br />
zähes Leben: Noch 1976 beschloß eine HV die Sitzverlegung<br />
nach München und die Umwandlung in eine GmbH.<br />
Los 888 Schätzwert 30-60 €<br />
Kardex <strong>AG</strong> für Büroartikel<br />
Saarbrücken, Aktie (Interimsschein) 100<br />
RM 1.3.1937 (Auflage 450, R 4) EF<br />
Auf die Einlage wurden 98,76 Prozent geleistet<br />
durch die Firma Kardex of Canada, Ltd. Tonawanda<br />
(USA).<br />
Gründung 1922. Herstellung, Vertrieb von und Handel mit Büroartikeln,<br />
insbesondere mit Waren, welche beim Patentamt<br />
mit dem Warenzeichen “Kardex” geschützt sind. Verkaufsagenturen<br />
in ganz Europa. Heute ist die Kardex Organisationssysteme<br />
GmbH, Kronberg einer der führenden Anbieter von automatischen<br />
Bereitstellungssystemen für Lager, Betrieb, Verwaltung.<br />
Los 889 Schätzwert 75-150 €<br />
Karlsruher<br />
Lebensversicherungsbank <strong>AG</strong><br />
Karlsruhe, Namens-Aktie 10.000 Mark<br />
Mai 1923 (Auflage 1900, R 5) EF-VF<br />
Hervorgegangen aus der 1835 gegründeten „Allgemeinen Versorgungsanstalt<br />
im Großherzogtum Baden“, die 1903 in<br />
“Karlsruher Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit vormals<br />
Allgemeine Versorgungs-Anstalt” umfirmierte. 1922 Gründung<br />
der Karlsruher Lebensversicherungsbank <strong>AG</strong>, der 1930 der<br />
Versicherungsbestand des Gegenseitigkeitsvereins übertragen<br />
wurde. 1937 Umbenennung in Karlsruher Lebensversicherung<br />
<strong>AG</strong>. Großaktionäre waren zunächst Allianz und Münchener<br />
<strong>Rückvers</strong>icherung. Mit der Umstrukturierung des Allianz-Konzerns<br />
und wechselseitigen Entflechtung gingen die Aktien der<br />
Ges. auf die Münchner <strong>Rückvers</strong>icherung über, die 2006 diese<br />
an die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe verkaufte.<br />
Los 890 Schätzwert 50-125 €<br />
Karlsruher<br />
Lebensversicherungsbank <strong>AG</strong><br />
Karlsruhe, Namens-Aktie 400 RM Juli<br />
1926 (Auflage 3000, R 5) EF-VF<br />
Identische Gestaltung wie voriger Titel.<br />
Los 891 Schätzwert 30-75 €<br />
Kartonpapierfabriken <strong>AG</strong><br />
Groß-Särchen, Kreis Sorau N.-L., Aktie<br />
100 RM Okt. 1942 (Auflage 600, R 4)<br />
UNC-EF<br />
Gründung 1895 unter Übernahme der Firma Groß-Särchener<br />
Holzstoff- und Lederpappenfabriken Kunstmühlen <strong>AG</strong> vorm.<br />
Noack & Brade. Herstellung von Graukarton, Maschinenlederpappe,<br />
Ziehkarton, Faltschachtelkarton, Chromoersatzkarton.<br />
1900 umbenannt in Norddeutsche Lederpappenfabriken <strong>AG</strong>,<br />
1923 in Kartonpapierfabriken <strong>AG</strong>. Die Fabrik hatte einen eigenen<br />
Gleisanschluß an die Eisenbahn Teuplitz - Bad Muskau.<br />
Nach dem Krieg wurde das Gelände als Getreidespeicher benutzt,<br />
heute ist dort ein Wasserkraftwerk.<br />
Los 892 Schätzwert 30-75 €<br />
Kattundruckerei F. Suckert <strong>AG</strong><br />
Langenbielau, Aktie 1.000 RM Dez. 1927<br />
(Auflage 1500, R 3) EF<br />
Gründung 1911. Betrieb einer Kattundruckerei. 1950 verlagert<br />
nach Esslingen, seit 1951 GmbH.<br />
Los 893 Schätzwert 75-125 €<br />
Katz & Michel Textil-<strong>AG</strong><br />
Bielefeld, Namensaktie 1.000 RM o.D.<br />
(Blankette, R 8) EF<br />
Gründung 1922 als “Katz” Textil-<strong>AG</strong>, ab 1928 Katz & Michel<br />
Textil-<strong>AG</strong>. Zweigniederlassungen in Berlin, Chemnitz und Plauen.<br />
Herstellung und Vertrieb von Textilwaren aller Art, Betrieb<br />
einer Damenwäsche-, Bettwäsche und Schürzenfabrik. 1937<br />
erwarben die Familien Banning - Berckemeyer -Terberger<br />
sämtliche Aktien und ändern den Firmennamen in “KAT<strong>AG</strong> <strong>AG</strong>”<br />
um. Durch den Zusammenschluß mit der Firma abz im Jahr<br />
1999 entwickelte sich die KAT<strong>AG</strong> zum größten Verbund der<br />
Textil- und Bekleidungsbranche. Mehr als 400 Handelsunternehmen<br />
mit über 1000 Standorten gehören heute zum Kreis<br />
der KAT<strong>AG</strong> Partnerfirmen in Europa.<br />
Los 894 Schätzwert 10-40 €<br />
Kaufhaus Kortum <strong>AG</strong><br />
Bochum, 4 % Teilschuldv. 1.000 RM<br />
31.12.1935 (Auflage 2900, R 4) EF<br />
Gegründet am 1.1.1921 als Gebrüder Alsberg <strong>AG</strong> mit Sitz in<br />
Köln. Am 27.7.1929 Sitzverlegung nach Bochum. Am<br />
27.6.1933 umbenannt wie oben. Die Gesellschaft besaß<br />
Grundstücke und ein Kaufhaus in Bochum. Einkaufsvereinbarungen<br />
mit der Westdeutsche Kaufhof <strong>AG</strong>, Köln. Das Kaufhaus<br />
Kortum in Bochum wurde bis 1998 baulich modernisiert und<br />
anschließend geschlossen.<br />
Los 895 Schätzwert 100-150 €<br />
Kaufmannshaus <strong>AG</strong> in Hamburg<br />
Hamburg, 4 % Genussrechtsurkunde 100<br />
RM Sept. 1926 (R 6) EF<br />
Gründung 1905 zum Erwerb des Geschäftshauses „Kaufmannshaus“<br />
an der Grossen Bleichen und der Bleichenbrücke.<br />
Gehörte zum Einflußbereich des Bankhauses Münchmeyer. Börsennotiz<br />
Hamburg. 1929 Verschmelzung mit der Maschinenfabrik<br />
Kiessling <strong>AG</strong> in Leipzig als aufnehmender Gesellschaft.<br />
Los 896 Schätzwert 40-75 €<br />
Keilmann & Völcker GmbH<br />
Bernburg, 4,5 % Genußrechtsurkunde<br />
100 RM Okt. 1926 (R 7) EF+<br />
Herstellung von Grauguß aller Art insbesondere Apparatebau<br />
für die chemische Industrie. Die Gesellschaft war eine Tochtergesellschaft<br />
der Burbach-Kaliwerke <strong>AG</strong>.<br />
Los 897 Schätzwert 200-250 €<br />
Kell & Löser <strong>AG</strong> für Hoch- und Tiefbau<br />
Leipzig, Aktie 100 RM 23.7.1925 (Auflage<br />
1250, R 10) EF-VF<br />
Nur 4 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Schon länger als oHG bestehendes Bauunternehmen, seit<br />
1903 <strong>AG</strong>. Zweigniederlassungen in Berlin,. Dresden, Düsseldorf,<br />
Essen, Halle a.S., Hamburg, Plauen, Bremen und Chemnitz.<br />
Börsennotiz: Freiverkehr Leipzig.Gedruckt bei Brockhaus.<br />
Los 898 Schätzwert 70-200 €<br />
Keramag Keramische Werke <strong>AG</strong><br />
Meiningen, Aktie 1.000 Mark 15.2.1923<br />
(Auflage 20000, R 2) VF+<br />
Großformatig.<br />
Gründung 1917 als Keramische Werke <strong>AG</strong>. 1918 Änderung in<br />
„Keramag“ Keramische Werke <strong>AG</strong>. 1926 kaufte die britische<br />
Walker-Familie die Mehrheit der Aktien. 1935 Sitzverlegung<br />
von Meiningen nach Bonn. 1968 Übernahme der Aktienmehrheit<br />
durch ALLIA S.A. Paris. 1998 Sitzverlegung nach Ratingen.<br />
75
Los 899 Schätzwert 300-375 €<br />
Kirchengemeinde Deuben /<br />
Verein “Knabenhort zu Deuben”<br />
Deuben, 3 % Anteilschein 200 Mark<br />
1.7.1906 (Auflage nur 25 Stück, R 11),<br />
ausgestellt auf Frau Oberkonsistorialrat Dr.<br />
Jentsch in Dresden (die Schwägerin des<br />
Deubener Pfarrers Jentsch, der die Initiative<br />
zur Vereinsgründung ergriffen hatte) VF<br />
Hübsche Jugendstilumrahmung, lindgrüner Jugendstil-Unterdruck<br />
mit zwei Knaben, die einen<br />
Baum pflanzen. Zuvor ganz unbekannt gewesen.<br />
Nur 2 Stück lagen im Reichsbankschatz, dies ist<br />
jetzt das letzte noch verfügbare.<br />
Deuben liegt (zwischen Zeitz und Weißenfels) im heutigen Burgenlandkreis<br />
im südlichsten Zipfel von Sachsen-Anhalt. Neben<br />
der Landwirtschaft prägt der Braunkohlenabbau mit Brikettfabrik<br />
und Kraftwerk die Gegend. Die dadurch bedingte Sozialstruktur<br />
bewegte bereits 1904 die Kirchengemeinde Deuben,<br />
den Verein “Knabenhort zu Deuben” zu gründen, um “Schulknaben<br />
während ihrer schulfreien Zeit erziehlich zu beaufsichtigen<br />
und nützlich zu beschäftigen und sie hierdurch an Gehorsam,<br />
Ordnung, fleißige Tätigkeit, Sparsamkeit, christliche Sitten<br />
zu gewöhnen und vor dem Einflusse schlechter Gesellschaft zu<br />
bewahren”. Von dem Berginvalid Friedrich Hermann Grundmann<br />
erwarb der Verein dessen an der Mühlenstraße belegenes<br />
Grundstück und richtete dort den Knabenhort ein. Den<br />
Kaufpreis von 15.000 M lieh die Kirchengemeinde dem Verein.<br />
Sie refinanzierte sich durch Ausgabe dieser mit 3 % verzinslichen<br />
Anteilscheine, die bei der Bevölkerung von Deuben und<br />
in Dresden platziert wurden. Abgesichert wiederum waren die<br />
Anteile durch eine Hypothek auf der Immobilie des Knabenhorts.<br />
Asset Backed Securities im Rahmen einer Private-Public-Partnership<br />
für soziale Zwecke bereits vor über 100 Jahren<br />
- man sage nicht, unsere Vorfahren seien in Finanzfragen<br />
nicht kreativ gewesen.<br />
Los 900 Schätzwert 50-125 €<br />
Klein, Schanzlin & Becker <strong>AG</strong><br />
Frankenthal, Aktie 1.000 RM Dez. 1941<br />
(Auflage 2960, R 5) EF<br />
Gründung 1871 als Armaturenfabrik. In den folgenden Jahren<br />
wurde das Produktionsprogramm um Dampfmaschinen, Pumpen,<br />
Filterpressen und Kompressoren ergänzt. Seit 1887 <strong>AG</strong>.<br />
1924-34 Übernahme von Zweigbetrieben in Homburg/Saar,<br />
Nürnberg, Pegnitz, Oschersleben/Bode, Bremen und Leipzig.<br />
1988 Umfirmierung in KSB <strong>AG</strong>. Mit 35 Produktionsstätten in 19<br />
Ländern heute einer der größten Pumpenhersteller der Welt.<br />
Los 901 Schätzwert 40-75 €<br />
Kleinbahn-<strong>AG</strong> Genthin-Ziesar<br />
Genthin, Aktie 100 RM o.D. nach 1930<br />
(Blankette, R 6) EF<br />
Gründung 1898. Bis 1923: Genthiner Kleinbahn-<strong>AG</strong>, dann<br />
nach Fusion 1930 mit der Ziesaer Kleinbahn <strong>AG</strong> “Kleinbahn <strong>AG</strong><br />
Genthin-Ziesar”. Ab 1942 Genthiner Eisenbahn-<strong>AG</strong>. Gesamtbahnlänge<br />
ca. 154 km rund um Genthin (50 km nordwestlich<br />
von Magdeburg). Aktionäre 1940 waren der Staat Preußen und<br />
die Provinz Sachsen. 1949 Übernahme durch die Deutsche<br />
Reichsbahn, 1967 weitgehende Einstellung des Personenverkehrs,<br />
1999 letzte Fahrt eines Personenzuges im Netz der ehemaligen<br />
Genthiner Kleinbahn.<br />
76<br />
Nr. 901<br />
Los 902 Schätzwert 800-1000 €<br />
Kleinbahn-<strong>AG</strong> Schildau-Mockrehna<br />
Schildau, Kollektiv-Stamm-Aktie 111.000<br />
RM 25.2.1929, ausgestellt auf den<br />
Provinzialverband von Sachsen UNC<br />
Eines von nur zwei überhaupt ausgegebenen<br />
Stücken (das andere lautet auf den Preußischen<br />
Staat).<br />
Schon vor dem 1. Weltkrieg war eine normalspurige Kleinbahn<br />
von Mockrehna (an der Hauptbahn Halle-Falkenberg/Elster<br />
bzw. Leipzig-Cottbus) zu der 11 km entfernten in der damals<br />
preußischen Provinz Sachsen gelegenen Stadt Schildau geplant.<br />
Am 15.9.1919 wurde die Kleinbahn-<strong>AG</strong> Schildau-Mokkrehna<br />
dann durch den Freistaat Preußen, die Provinz Sachsen,<br />
die Stadt Schildau und sechs weitere Gemeinden gegründet.<br />
Eröffnet für den Güterverkehr am 21.6.1921 und den Personenverkehr<br />
am 26.8.1922. Der sehr übersichtliche Fahrzeugpark<br />
umfasste zumeist zwei Dampflokomotiven, zwei Personen-,<br />
einen Pack- und einen Güterwagen, später auch noch<br />
einen Triebwagen. 1942 umfirmiert in “Eisenbahn-<strong>AG</strong> Schildau-Mockrehna”.<br />
Bis 1945/46 Betriebsführung durch die<br />
Kleinbahnabteilung des Provinzialverbandes Sachsen in Merseburg,<br />
dann übergegangen 1947 auf die Sächsische Provinzbahnen<br />
GmbH in Halle a.S. und 1949 auf die Deutsche Reichsbahn.<br />
Am 22.5.1971 wurde der Betrieb eingestellt.<br />
Los 903 Schätzwert 125-250 €<br />
Kleinbahn-<strong>AG</strong> Stendal-Arendsee<br />
Stendal, Namensaktie 200 Mark<br />
1.10.1911. Gründeraktie (Auflage 360,<br />
weitere 140 in einer Sammelaktie<br />
verbrieft, R 4) EF<br />
Hübsche mehrfarbige Jugendstil-Umrahmung mit<br />
Laubranken. Originalunterschriften des Vorstands<br />
und als AR-Vorsitzender von Landrat Wilhelm von<br />
Bismarck (altes Adelsgeschlecht, das schon im 13.<br />
Jh. in Stendal erscheint, bedeutendster Vertreter<br />
Dampflok in Mockrehna um 1968<br />
Nr. 902<br />
war der erste deutsche Reichskanzler Fürst Otto<br />
von Bismarck, der Landrat war ein Cousin von ihm).<br />
Gründung 1906 zum Bau der 48 km langen normalspurigen<br />
Bahn Stendal-Peulingen-Kl. Rossau-Arendsee (eröffnet<br />
1908/09). Gründer waren der Staat Preußen und die Provinz<br />
Sachsen (die jeweils 470 Aktien = 23,37 % des Kapitals zeichneten),<br />
Kreis und Stadt Stendal, die Stadt Arendsee sowie 458<br />
am Bahnbau interessierte Firmen und Privatpersonen. 1915<br />
umbenannt in Stendaler Kleinbahn-<strong>AG</strong>, im gleichen Jahr Baubeginn<br />
für die 22 km lange Zweigbahn von Peulingen nach<br />
Bismark Ost (später Hohenwulsch) an der Hauptbahn Stendal-<br />
Salzwedel. Eröffnet bis Darnewitz 1916, komplett wegen Verzögerung<br />
durch den 1. Weltkrieg erst 1921. Die Betriebsführung<br />
für das gesamte Netz hatte von Anfang an die Kleinbahn-<br />
Nr. 904<br />
abteilung des Provinzialverbandes Sachsen in Merseburg.<br />
Übergänge bestanden in Stendal zur Staatsbahn, in Klein Rossau<br />
kreuzte später die Kleinbahn-<strong>AG</strong> Osterburg-Pretzier, ab<br />
1922 auch in Arendsee zur Staatsbahnstrecke Salzwedel-Wittenberge,<br />
schließlich in Bismark Ost zur Kleinbahn Bismark-<br />
Gardelegen-Wittingen. 1924 fusionsweise Übernahme der<br />
Kleinbahn-<strong>AG</strong> Stendal-Arneburg, wodurch die 1899 eröffnete<br />
13 km lange Strecke Stendal-Arneburg hinzukam. Mit ca. 100<br />
Beschäftigten, 7 Lokomotiven, 14 Personen- und 29 Güterwagen<br />
wurden jährlich etwa 200.000 Fahrgäste und knapp<br />
200.000 t Güter befördert. 1942 umbenannt in Stendaler Eisenbahn-<strong>AG</strong>.<br />
1946 Enteignung und Übernahme durch die<br />
Sächsische Provinzbahnen GmbH, 1948 vom VVB des Verkehrswesens<br />
Sachsen-Anhalt übernommen, ab 1.4.1949 gehörte<br />
die Stendaler Eisenbahn zur Deutschen Reichsbahn. Die<br />
beiden Strecken der alten KB Stendal-Arendsee wurden bereits<br />
1950 bzw. 1951 stillgelegt, die Strecke der alten KB Stendal-<br />
Arneburg erst 1972, aber nicht für immer: Ein Teil der Trasse<br />
wurde ab 3.1.1977 für die Strecke Borstel-Niedergörne benutzt,<br />
die als Anschlußbahn für das nie in Betrieb gegangene<br />
Kernkraftwerk Stendal bestimmt war und bis Ende 1995 auch<br />
Personenverkehr ab Bahnhof Stendal besaß. Heute ist die Bahn<br />
an die Stadt Arneburg verpachtet, sie wird für Holztransporte<br />
zur Zellstoff Stendal GmbH in Niedergörne benutzt.<br />
Los 904 Schätzwert 800-1000 €<br />
Kleinbahn-<strong>AG</strong> Stendal-Arendsee<br />
Stendal, Sammel-Namensaktie 140 x 200<br />
Mark 1.10.1911. Gründeraktie (Unikat,<br />
R 12), ausgestellt auf die Stadtgemeinde<br />
Stendal VF<br />
Gleiche dekorative Gestaltung wie das Los davor,<br />
ebenfalls mit Originalunterschriften des Vorstands<br />
und als AR-Vorsitzender von Landrat Wilhelm von<br />
Bismarck. Randschäden fachgerecht restauriert.<br />
Los 905 Schätzwert 20-50 €<br />
Kleinwohnungsbau Halle <strong>AG</strong><br />
Halle (Saale), Namens-Aktie 100 RM<br />
7.5.1938 (Auflage 930, R 4) EF<br />
Gegründet 1922 unter maßgeblicher Beteiligung der Stadt Halle<br />
a.S. zur Schaffung gesunder Kleinwohnungen in Halle und<br />
Umgebung für die minderbegüterte Bevölkerung. 1925 Anerkennung<br />
der Gemeinnützigkeit. Anfang der 30er Jahre wurden<br />
auf dem Gelände westlich der Merseburger Straße an der Kasseler<br />
Bahn 280 Einfamilienhäuder als Doppelhaushälften errichtet.<br />
Ende 1941 befanden sich 929 Häuser mit 3.486 Woh-
nungen im Bestand. Großaktionäre waren die Stadtgemeinde<br />
Halle, der Wohnungsverein Halle-Süd eGmbH, der Wohnstätten-Spar-<br />
und Bauverein Halle und der I.G.Farben-Konzern mit<br />
dem Ammoniakwerk Merseburg (Leunawerke).<br />
Los 906 Schätzwert 50-100 €<br />
Kleinwohnungsbau Halle <strong>AG</strong><br />
Halle (Saale), Namens-Aktie 1.000 RM<br />
28.9.1939 (Auflage 180, R 5) EF<br />
Los 907 Schätzwert 30-75 €<br />
Köllmann Werke <strong>AG</strong><br />
Leipzig, Aktie 1.000 RM 9.10.1941<br />
(Auflage 400, R 4) UNC-EF<br />
Gründung 1904 in Leipzig durch Gustav Köllmann. Seit 1907<br />
Zahnräderfabrik Köllmann GmbH, 1912 in eine <strong>AG</strong> umgewandelt,<br />
1928 Umfirmierung wie oben. In Leipzig börsennotiert. Die<br />
Fabrik in der Torgauer Str. 74 produzierte mit knapp 500 Mitarbeitern<br />
Zahnräder, Getriebe für Eisenbahntriebwagen, Hinterachsen<br />
und Wechselgetriebe für die Automobilindustrie sowie<br />
Langfräsmaschinen. 1946 Demontage und Enteignung des<br />
Leipziger Werkes, das in der DDR als VEB Fahrzeuggetriebewerke<br />
Joliot Curio weiterbestand, 1991 als Zahnradwerke Leipzig<br />
GmbH reprivatisiert (seit 1999 Neue Zahnradwerk Leipzig<br />
GmbH). Die <strong>AG</strong> selbst verlegte ihren Sitz 1949 nach Langenberg/Rhld.<br />
(wo schon seit 1911 die Tochter Köllmann Maschinenbau<br />
GmbH ansässig war) und 1951 nach Düsseldorf. Einrichtung<br />
eines neuen Werkes in Düsseldorf-Heerdt. 1955 Übernahme<br />
durch die Maschinenfabrik Ernst Thielenhaus, die die<br />
Produktion 1964 in einem neuen großen Werk in Wuppertal<br />
konzentrierte. Im Zuge der Neuorganisation der Gruppe wurde<br />
die Zahnradfabrik Köllmann GmbH 2002 als Koellmann Airtec<br />
und Koellmann Gear Teil der Thielenhaus Technologies GmbH.<br />
Los 908 Schätzwert 10-40 €<br />
Kölnische Gummifäden-Fabrik<br />
vorm. Ferd. Kohlstadt & Co.<br />
Köln, Aktie 1.200 Mark 22.6.1920<br />
(Auflage 1920, R 3) EF<br />
Großes Hochformat, feine Zierumrandung.<br />
Gründung 1843 durch Ferdinand Kohlstand und Marcus Brenner<br />
am Eigelstein 37. Später nach Niehl umgesiedelt, 1864 Erweiterung<br />
des Betriebes und nochmaliger Umzug in die Deutz-<br />
Mülheimer Str. 127-129 (direkt an die Waggonfabrik van der<br />
Zypen angrenzend). Seit 1872 <strong>AG</strong>. 1908 wurden die heute unter<br />
Denkmalschutz stehenden Fabrikgebäude errichtet. Hergestellt<br />
wurden mit in der Spitze 1500 Beschäftigten Gummifäden<br />
für Web- und technische Zwecke, Reklame- und Kinderluftballons,<br />
Lockenwickler, Haushalts- und Operationshandschuhe,<br />
Hygienische Artikeln (sprich: “Lümmeltüten) und<br />
Milchflaschensauger Marke “Mutterglück”. Übernommen wurden<br />
1955 die Standard Gummiwerk Baumgarten & Co. KG in<br />
Köln-Ossendorf und 1959/60 die Dohmen & Wagner Gummiwarenfabrik<br />
GmbH in Heimbach (Eifel). Börsennotiert ursprünglich<br />
in Köln, später Düsseldorf. 1970 Vergleichsverfahren,<br />
1971 Liquidationsbeschluss, 1972 Verkauf der Werke und Anlagen,<br />
1973 Aufhebung des Liquidationsbeschlusses und Fortsetzung<br />
der Gesellschaft. Auf dem 1972 verkauften Gelände<br />
wurde das Berufsbildungszentrum der Stadt Köln eingerichtet.<br />
In der Anlage, die 1984 von der Klöckner-Humboldt-Deutz <strong>AG</strong><br />
übernommen wurde, etablierten sich 1995 nach dem Umzug<br />
des Berufsbildungszentrums in die ehemalige Nixdorf-Fabrik<br />
ca. 200 Künstler und 12 Kleinunternehmen.<br />
Los 909 Schätzwert 20-50 €<br />
Kölnische Gummifäden-Fabrik<br />
vorm. Ferd. Kohlstadt & Co.<br />
Köln, Aktie 100 RM 1.10.1938 (Auflage<br />
900, R 3) EF<br />
Los 910 Schätzwert 50-100 €<br />
König Friedrich August-Hütte<br />
und C. E. Rost & Co. <strong>AG</strong><br />
Dölzschen bei Dresden, VZ-Aktie 100 RM<br />
Aug. 1932 (Auflage 200 nach Kapitalherabsetzung<br />
1933, R 5) EF<br />
Gegründet 1789 als Hüttenwerk, <strong>AG</strong> seit 1881. Herstellung von<br />
Gusswaren, Maschinen und Apparaten aller Art. Die Gesellschaft<br />
ist 1922 durch Fusion in den Besitz der Sächsischen<br />
Maschinenfabrik vorm. Rich. Hartmann, Chemnitz, übergegangen<br />
(1928 Rückverwandlung der Hütte in eine eigene <strong>AG</strong>).<br />
1931 Übernahme des gesamten Betriebes der Dresdner Maschinenfabrik<br />
C. E. Rost & Co. 1934 Erwerb der Gießerei der<br />
Hille-Werke <strong>AG</strong>, Dresden. Nach Enteignung in der DDR Fortführung<br />
des Werkes als VEB Eisenhammerwerk Dresden-Dölzschen,<br />
Herstellung von Gusserzeugnissen für die Kfz-Produktion.<br />
Nach der Privatisierung 1990 von den ehemaligen Werksangehörigen<br />
von der Treuhand erworben, heute Hersteller von<br />
Gussteilen für den Kanalbau.<br />
Los 911 Schätzwert 30-75 €<br />
König Friedrich August-Hütte <strong>AG</strong><br />
Dölzschen-Dresden, Aktie 1.000 RM April<br />
1935 (Auflage 545, R 4) EF<br />
Los 912 Schätzwert 50-125 €<br />
Königsberg-Cranzer<br />
Eisenbahn-Gesellschaft<br />
Königsberg i.Pr., Actie 500 Mark 20.5.1885.<br />
Gründeraktie (Auflage 2884, R 3) EF-VF<br />
Gründung am 13.8.1884 zum Bau der Eisenbahn Königsberg-<br />
Groß Raum-Bad Cranz (28 km) mit Verlängerung nach Cranz-<br />
beek (2 km, eröffnet 1895) und Neukuhren (18 km, eröffnet<br />
1901). Außerdem Bau und Betriebsführung der Groß Raum-Ellerkruger<br />
Kleinbahn GmbH (10 km, eröffnet 1916). Der Königsberger<br />
Nordbahnhof wurde gemeinsam mit der Reichsbahn<br />
und der Samlandbahn genutzt.<br />
Los 913 Schätzwert 75-200 €<br />
Königsberg-Cranzer<br />
Eisenbahn-Gesellschaft<br />
Königsberg i.Pr., Aktie 1.000 Mark<br />
1.3.1900 (Auflage 558, R 4) VF+<br />
Identische Gestaltung wie voriges Los.<br />
Los 914 Schätzwert 50-125 €<br />
Königsberg-Cranzer<br />
Eisenbahn-Gesellschaft<br />
Königsberg i.Pr., Aktie 1.000 Mark<br />
30.11.1920 (Auflage 1000, R 3) EF<br />
Identische Gestaltung wie vorige Lose.<br />
Los 915 Schätzwert 350-450 €<br />
Königsberger Bank <strong>AG</strong><br />
Königsberg i.Pr., Aktie 6.000 Mark<br />
1.6.1923 (Auflage 15000, R 11) VF<br />
Zuvor ganz unbekannt gewesene Emission dieser<br />
Bank. Nur 2 Stück lagen im Reichsbankschatz,<br />
dies ist jetzt das letzte noch verfügbare.<br />
Gründung 1873 als „Genossenschaftliche Grundcreditbank für die<br />
Provinz Preussen“, <strong>AG</strong> seit 1896 als „Grundkredit-Bank“, geschäftsansässig<br />
Kneiph. Langgasse 38. 1920 Umfirmierung wie<br />
oben, gleichzeitig Verzicht auf das Pfandbrief-Privileg. Vom Konkurs<br />
der „Osteuropäischen Bank für Holzhandel“ in Königsberg im<br />
Mai 1924 war die (bis dahin in Berlin und Königsberg börsennotierte)<br />
Königsberger Bank <strong>AG</strong> selbst so stark betroffen, daß sie Vergleich<br />
anmelden und anschließend in Liquidation gehen mußte.<br />
Los 916 Schätzwert 10-40 €<br />
Kötitzer Ledertuch-<br />
und Wachstuch-Werke <strong>AG</strong><br />
Coswig, Bez. Dresden, Aktie 100 RM Juli<br />
1942 (Auflage 5000, R 2, kpl.<br />
Aktienneudruck) EF<br />
Gründung 1897 als „Deutsche Pluviusin <strong>AG</strong>“, umbenannt 1910 in<br />
„Deutsche Kunstleder-<strong>AG</strong>“, ab 1923 Firma wie oben. Herstellung<br />
von Kunstleder, Ledertuch, Wachstuch und Lederersatzprodukten.<br />
Werke in Kötitz, Gummersbach (1910 Übernahme der Kunstleder-<br />
Fabriken Carl Bockhacker, 1918 übernahme der Rheinische Kaliko-<br />
Fabrik C. Bockhammer in Burscheid als Werk II, in der Weltwirtschaftskrise<br />
1930 stillgelegt), Berlin (1927 Übernahme der Ketschendorfer<br />
Kunstlederfabrik <strong>AG</strong>, 1929 stillgelegt), Zweenfurth bei<br />
Leipzig (1929 Übernahme der Kunstlederfabrik Alexander Schumann)<br />
und Siebenlehn bei Nossen. 1938 Gründung der “Göppinger<br />
Kaliko- und Kunstleder-Werke vorm. Netter und Eisig GmbH” in<br />
Göppingen und Eislingen. Börsennotiz Berlin und Dresden/Leipzig.<br />
1946 Enteignung der in der Ostzone liegenden Fabriken Kötitz,<br />
Zweenfurth und Siebenlehn, 1950 Sitzverlegung nach Düsseldorf.<br />
Als einziges Aktivum verblieb die Beteiligung an der Göppinger Kaliko,<br />
die sich 1977 der Großaktionär (Continental-Gummiwerke <strong>AG</strong><br />
in Hannover) einverleibte. Die zugleich beschlossene Auflösung der<br />
<strong>AG</strong> wurde 1978 durch den neuen Großaktionär Adolf Merckle,<br />
Blaubeuren, rückgängig gemacht, außerdem Sitzverlegung nach<br />
Berlin. Ab 1984 Ausbau zu einer Kapitalanlagegesellschaft.<br />
Los 917 Schätzwert 30-75 €<br />
Kollmar & Jourdan <strong>AG</strong><br />
Pforzheim, Aktie 1.000 RM Sept. 1932<br />
(Auflage 1500, R 4) EF<br />
Gegründet 1898 als “Kollmar & Jourdan <strong>AG</strong> Uhrkettenfabrik”.<br />
Herstellung von Uhrketten, Uhrgehäusen, Uhrarmbändern und<br />
Schmuckwaren in Gold, Silber und Doublé. Hauptfabrik in der<br />
Bleichstr. 81 in Pforzheim; die Zweigwerke in Grötzingen, Boxberg<br />
und Neckarbischofsheim wurden 1929/30 in der Weltwirtschaftskrise<br />
geschlossen. 1952/53 wurde stolz verkündet “Trotz 85 %<br />
Zerstörung bei der Pforzheimer Katastrophe vom 23.2.1945<br />
Wiederaufbau nahezu vollendet. Vom Ausland überallher Verlangen<br />
nach Erzeugnissen mit der Fabrikmarke KJ mit Pfeil.” Das<br />
Wirtschaftswunder währte nicht ewig: 1977 Anschlusskonkurs.<br />
Los 918 Schätzwert 30-80 €<br />
Kollnauer<br />
Baumwollspinnerei und Weberei<br />
Kollnau bei Waldkirch, Aktie 100 RM Dez.<br />
1931 (Auflage 12000, R 4) UNC-EF<br />
Begünstigt durch die Wasserkraft der Elz entstand dieser traditionsreiche<br />
Textilbetrieb 1869/70 auf dem Gelände des 1868<br />
stillgelegten großherzoglichen Hüttenwerkes. Erzeugt wurden<br />
Garne und Gewebe aus Baumwolle und Zellwolle, auch Satinund<br />
Damastgewebe sowie Kunstseidengewebe aller Art. Die<br />
<strong>AG</strong> bestand länger als ein Jahrhundert, ehe auch sie Opfer der<br />
Textilkrise wurde: Ende 1988 wurde das Anschlußkonkursverfahren<br />
eröffnet. Die Kollnauer Weberei GmbH als Auffanggesellschaft<br />
konnte die endgültige Betriebsstilllegung nur bis Ende<br />
1990 hinauszögern.<br />
Los 919 Schätzwert 30-75 €<br />
Kommunale Elektricitäts-<br />
Lieferungs-Gesellschaft <strong>AG</strong><br />
Sagan, Aktie 100 RM Mai 1929 (Auflage<br />
4000, R 5) EF<br />
Gründung 1922. 1924 Inbetriebnahme der Wasserkraftanlage<br />
in Greisitz a. Bober. Versorgungsgebiet: Niederschlesien (Kreise<br />
Sprottau, Freystadt, Glogau und Rothenburg). Börsennotiz<br />
Breslau, Großaktionäre: Elektrowerke <strong>AG</strong>, div. Kreise und Stadt<br />
Sagan.<br />
Los 920 Schätzwert 200-250 €<br />
Konditoreneinkauf <strong>AG</strong><br />
Hamburg, Aktie 100 RM Mai 1940<br />
(Auflage nur 40 Stück, R 10) VF<br />
Nur 3 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1916 als Genossenschaft, <strong>AG</strong> ab Nov. 1923. Einund<br />
Verkauf sowie Herstellung von Konditoreibedarfsartikeln.<br />
1971 ist die Gesellschaft in eine GmbH unter der Firma<br />
“Grundstücksgesellschaft Gerstäckerstraße mbH” umgewandelt<br />
worden.<br />
Los 921 Schätzwert 30-75 €<br />
Konservenfabrik Gebr. Grahe <strong>AG</strong><br />
Braunschweig, Aktie 100 RM 15.1.1927/<br />
18.6.1932 (Auflage 2000, R 4) EF<br />
Gründung 1863, <strong>AG</strong> seit 1927. Die traditionsreiche Fabrik als Teil<br />
der damals blühenden Konservenindustrie des Braunschweiger<br />
Landes produzierte Gemüse- und Obstkonserven. Großaktionär<br />
war mit 56 % die Landesgenossenschaftsbank eGmbH, Hannover.<br />
Der Niedergang der Industrie traf in den 1960er Jahren auch<br />
diese Firma: Auf dem 7.500 qm großen Areal Rebenring 46 /<br />
Ecke Hagenring (davon 5.000 qm überbaut) waren zuletzt nur<br />
noch 30 Mitarbeiter beschäftigt. 1965 in Liquidation getreten.<br />
Das Grundstück wurde nach Abriß der Fabrik mit einem modernen<br />
Wohn- und Geschäftshochhaus bebaut.<br />
77
Los 922 Schätzwert 30-75 €<br />
Konservenfabrik Seehausen-Altmark <strong>AG</strong><br />
Seehausen-Altmark, Aktie 100 RM Dez.<br />
1940 (Auflage 1205, R 4) EF<br />
Gründung 1924 durch Übernahme der Konservenfabrik Seehausen<br />
i. Altm. eGmbH. Nach 1948 Betrieb im VEB OGEMA,<br />
Obst- und Gemüseverarbeitung Magdeburg, ab 1975 VEB<br />
OGEMA Stendal. 1990 stillgelegt.<br />
Los 923 Schätzwert 1000-1250 €<br />
Kontinentale Öl <strong>AG</strong><br />
Berlin, Zwischenschein über nom.<br />
4.500.000 RM auf den Inhaber<br />
auszustellende Stammaktien vom<br />
1.4.1943 (= 5,625 % des Grundkapitals,<br />
ein Unikat, R 12), ausgegeben für die<br />
Reichskreditgesellschaft <strong>AG</strong>, Berlin VF-<br />
Maschinenschriftliche Ausführung, mit Originalunterschriften<br />
des Vorstands, u.a. Karl Blessing<br />
(1900-1971), 1937-39<br />
Mitglied des Reichsbankdirektoriums<br />
und 1958-69<br />
Präsident der Deutschen<br />
Bundesbank. Oberfläche<br />
teils angestaubt und mit<br />
Rostflecken, Blessing-<br />
Unterschrift aber klar und<br />
völlig unbeeinträchtigt.<br />
Gegründet im März 1941, ausgestattet<br />
mit einem auf 99 Jahre<br />
ausgelegten Monopol für ausschließliche<br />
Gewinnung, Verarbeitung<br />
und Handel mit Mineralölerzeugnissen<br />
in den vom Deut-<br />
schen Reich besetzten Gebieten. Am Kapital von 80 Mio. RM<br />
beteiligten sich mit Namensaktien (mit Mehrfachstimmrecht)<br />
die reichseigene, extra zu diesem Zweck gegründete Borussia<br />
GmbH (30 Mio.), die Preussag (6 Mio.), die Deutsche Erdöl <strong>AG</strong>,<br />
die <strong>Gewerkschaft</strong> Elwerath, die Wintershall <strong>AG</strong> und die I. G.<br />
Farben <strong>AG</strong> (je 3 Mio.) und die Braunkohle-Benzin <strong>AG</strong> (2 Mio.)<br />
und mit Inhaberaktien (einfaches Stimmrecht) die Deutsche<br />
Bank und die Dresdner Bank (je 10,5 Mio.) sowie die Reichs-<br />
Kredit-Gesellschaft und die Berliner Handels-Gesellschaft (je<br />
4,5 Mio.). Im Aufsichtsrat saßen u.a. der Reichswirtschaftsminister<br />
Walther Funk, Hermann J. Abs, Karl Rasche (Dresdner<br />
Bank), August Rosterg (Wintershall)und Carl Schirner (Deutsche<br />
Erdöl-<strong>AG</strong>). Erste Erwerbungen waren die rumänischen Erdölfirmen<br />
Concordia und Columbia Oil aus französischem bzw.<br />
belgischen Besitz. Außerdem verhandelte man mit der USamerikanischen<br />
Standard Oil über deren ungarische Petroleumfelder.<br />
Für die Übernahme der Erdölquellen im Kaukasus-<br />
Gebiet wurde im Aug. 1941 die Tochterfirma Ost Öl GmbH gegründet.<br />
Der Erwerb von Bohrgeräten, Fahrzeugen und anderen<br />
Betriebsmitteln für 16 Mio. RM zahlte sich hier allerdings<br />
nie aus: Die Offensive der deutschen Wehrmacht blieb stekken,<br />
und die Erdölquellen des Kaukasus kamen nie in deutsche<br />
Hand. Für die Inbesitznahme der Erdölanlagen bestanden als<br />
Beuteerfassungstrupps spezielle Wehrmachtseinheiten, so das<br />
Mineralölkommando Nord, das Mineralölkommando Süd und<br />
das Mineralölkommando K für den Kaukasus.<br />
Los 924 Schätzwert 30-75 €<br />
Kosmos <strong>AG</strong> für auswärtigen Handel<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark 7.8.1924<br />
(Auflage 1000, R 5) EF<br />
Gegründet 1922 für den Handel mit Waren aller Art und Vornahme<br />
von Finanzierungsgeschäften. Sitz war in Berlin W 35,<br />
Genthiner Str. 34.<br />
78<br />
Karl Blessing<br />
(1900 - 1971)<br />
Nr. 915<br />
Los 925 Schätzwert 450-600 €<br />
Kraftverkehr Freistaat Sachsen <strong>AG</strong><br />
Dresden, Aktie 525 x 100 RM Juni 1934<br />
(Interimsschein, R 12), ausgestellt für den<br />
Rat der Stadt Plauen VF+<br />
Maschinenschriftliche Ausführung mit Originalunterschriften.<br />
Ein Unikat aus dem Reichsbankschatz.<br />
Minimale Randschäden fachgerecht restauriert.<br />
Gegründet 1923 unter Weiterführung einer GmbH gleichen Namens<br />
zwecks Betrieb von Kraftfahrzeuglinien mit fahrplanmäßig<br />
geregeltem Verkehr zur Beförderung von Personen und Gütern.<br />
Großaktionäre waren der Freistaat Sachsen, verschiedene<br />
sächsische Städte und die Deutsche Reichsbahn. 1949 als VVB<br />
(L) Kraftverkehr in Volkseigentum überführt.<br />
Los 926 Schätzwert 125-200 €<br />
Kraftwerk am Höllenstein <strong>AG</strong><br />
Straubing, Aktie 100 RM 30.11.1940<br />
(Auflage 800, R 7) EF<br />
Gründung 1923. Betrieb eines Wasserkraftwerkes im Schwarzen<br />
Regen zwischen Viechtach und Kötzting. Großaktionäre<br />
2004: Stadtwerke Straubing (89 %), e.on Bayern (11%).<br />
Los 927 Schätzwert 10-40 €<br />
Kraftwerk Sachsen-Thüringen <strong>AG</strong><br />
Auma, Aktie 100 RM 12.12.1934 (Auflage<br />
3300, kpl. Aktienneudruck nach<br />
Kapitalzusammenlegung, R 2) UNC-EF<br />
Gründung 1914 zur Übernahme der Versorgungsanlagen der<br />
Elektrizitätswerk des Elstertales eGmbH i.L. in Auma. Das Versorgungsgebiet<br />
erstreckte sich hauptsächlich auf Sachsen-<br />
Weimar-Eisenach und auf Teile der angrenzenden Länder<br />
Preußen, Sachsen, Sachsen-Meiningen, Reuß ä.L. j.L. und<br />
Sachsen-Altenburg. Im ganzen wurden 268 Stadt- und Landgemeinden<br />
in Ost-Thüringen mit rd. 141.000 Einwohnern mit<br />
elektrischer Energie versorgt. Zunächst Eigenstromerzeugung<br />
im Dampfkraftwerk Auma, das aber 1932 stillgelegt und (bis<br />
zur endgültigen Außerbetriebnahme 1950) nur noch als Spitzenkraftwerk<br />
vorgehalten wurde. Seitdem Fremdstrombezug<br />
aus den Großkraftwerken Böhlen und Hirschfelde der Thürigische<br />
Landeselektrizitäts-Versorgungs-<strong>AG</strong> “Thüringenwerk” in<br />
Weimar sowie dem Bleilochwerk an der Saaletalsperre (welches<br />
über das Gleichrichterwerk Gräfenwarth der Schleizer<br />
Kleinbahn unmittelbar mit dem 10-kV-Netz der Ges. zusammengeschaltet<br />
werden konnte). Börsennotiz Leipzig, Mehrheitsaktionär<br />
war die Thüringer Gasgesellschaft.<br />
Los 928 Schätzwert 75-150 €<br />
Kraftwerk St. Blasien <strong>AG</strong><br />
St. Blasien, Aktie 1.000 RM 10.10.1933.<br />
Gründeraktie (Auflage 200, R 5) EF<br />
Gründung 1933 durch die Spinnerei St. Blasien <strong>AG</strong> in L., St.<br />
Blasien und Privatpersonen. Die Spinnerei St. Blasien <strong>AG</strong> i.L.<br />
brachte als Sacheinlage in die Gesellschaft Grundstücke und<br />
Gebäude, Wasserrechte, Betriebsanlagen, Transformatorenstationen<br />
und Verteilungsstellen sowie Verträge wegen Lieferung<br />
und Abgabe elektrischen Stromes ein.<br />
Nr. 923<br />
Los 929 Schätzwert 1000-1250 €<br />
Kraftwerk und Straßenbahn Gera <strong>AG</strong><br />
Gera, Interims-Schein über 4.250 Aktien<br />
zu 1.000 RM 20.6.1937 (ein Unikat,<br />
verbriefte 50 % des gesamten Kapitals, R<br />
12), ausgegeben an die <strong>AG</strong> Sächsische<br />
Werke, Dresden EF<br />
Einfacher Druck, mit Originalunterschriften.<br />
Die 1892 in 1.000-mm-Spur eröffnete Geraer Straßenbahn ist<br />
nach der Hallenser Straßenbahn die zweitälteste noch heute<br />
existierende elektrische Straßenbahn in Deutschland. Gebaut<br />
und betrieben wurde sie ursprünglich von der Geraer Straßenbahn-<strong>AG</strong><br />
(seit 1911 Geraer Elektrizitätswerk- und Straßenbahn-<strong>AG</strong>),<br />
deren Konzession von 1891 bis 1951 lief. Eine Kaufabsicht<br />
hatte nach der alten Konzession die Stadt Gera innerhalb<br />
von 36 Jahren zu erklären, was wohl der Grund ist, daß<br />
ausgerechnet 1927 die Konzession nebst E-Werk und Straßenbahn<br />
auf diese neue <strong>AG</strong> (gegründet 1925 in Dresden als<br />
Gasversorgung Westsachsen <strong>AG</strong>) überging. Aktionäre waren<br />
hier zu 64 % die landeseigene <strong>AG</strong> Sächsische Werke in Dresden<br />
und zu 36 % die Stadt Gera. Die Straßenbahn hatte anfangs<br />
3 Linien, die sich in der Heinrichstraße trafen, bis heute<br />
die zentrale Umsteigestelle des Geraer Nahverkehrs. Bereits<br />
1892 wurde über ein Gütergleis der Preußische Bahnhof (heute<br />
der Hauptbahnhof) angeschlossen. Güterwagen wurden von<br />
hier auf Rollböcken zu den Fabriken in Gleisnähe gefahren, die<br />
Traktion übernahmen Dampflokomotiven. 1896 folgte ein Gütergleis<br />
zum Sächsischen Bahnhof (heute Südbahnhof). 1901<br />
wurde im Süden der Stadt bei Pforten der Bahnhof der Gera-<br />
Kraftwerk und Straßenbahn Gera
Meuselwitz-Wuitzer Eisenbahn-<strong>AG</strong> eröffnet und mit dem Straßenbahndepot<br />
Lindenthal verbunden, so daß fortan auch<br />
Braunkohle über die Straßenbahngeleise zu den Fabriken<br />
transportiert wurde. Erst 1963 wurde der Güterverkehr vorläufig<br />
eingestellt, weil die letzte dafür noch vorhandene Lokomotive<br />
ihren Geist aufgab, und 1969 zerstörte ein schweres Unwetter<br />
nicht nur die Gera-Meuselwitz-Wuitzer Eisenbahn, sondern<br />
auch die Gleisanlagen im Pfortener Bahnhof, die danach<br />
nicht wieder aufgebaut wurden. Dennoch wurde für kurze Zeit<br />
1982-85 der Güterverkehr der Geraer Straßenbahn noch einmal<br />
aufgenommen. Ein nettes Detail am Rande: Als 1984 die<br />
letzte eingleisige Strecke auf der Sorge (der Hauptfußgängerzone)<br />
zwecks zweigleisigem Ausbau in die parallel verlaufende<br />
Straße “Hinter der Mauer” verlegt wurde, benannte man diese<br />
zur Vermeidung politischer Assoziationen um, sie hieß dann<br />
“Am Leumnitzer Tor”. Nach der Wende wurde die Straßenbahn<br />
umfassend modernisiert und umgestaltet, aktuell wird sogar<br />
der Bau einer vierten Linie geplant.<br />
Los 930 Schätzwert 10-50 €<br />
Kramsta-Methner u. Frahne <strong>AG</strong><br />
Landeshut i. Schles., Aktie 100 RM Juli<br />
1935 (Auflage 2000, R 2) UNC-EF<br />
G & D-Druck.<br />
Das Unternehmen ist hervorgegangen aus der 1797 gegründeten<br />
Kramsta-Gesellschaft (<strong>AG</strong> seit 1871) und aus der 1852 gegründeten<br />
Textilwerke Methner & Frahne (<strong>AG</strong> seit 1907). 1931<br />
erfolgte der Zusammenschluß beider Firmen zur Ostdeutsche<br />
Textilindustrie <strong>AG</strong>. Diese trat 1933 in Liquidation und gründete<br />
zur Fortführung des Unternehmens die Kramsta-Methner &<br />
Frahne GmbH, die 1935 erneut in die <strong>AG</strong> umgewandelt wurde.<br />
Werke in Merzdorf/Riesengeb. (Flachsfabrik und Grünflachsspinnerei),<br />
Waldenburg (Leinenspinnerei), Landeshut (Leinen,<br />
Halbleinen- und Schwerweberei) und Bolkenhain (Roh- und Gebildweberei).<br />
Börsennotiz Berlin und Breslau. 1948 Sitzverlegung<br />
nach Bielefeld, 1963 Auflösung der Gesellschaft.<br />
Los 931 Schätzwert 150-200 €<br />
Kreditanstalt der Deutschen eGmbH<br />
Reichenberg/Prag, Sammel-Na.-Anteil-<br />
Schein 100 x 100 RM von 1941 (R 10) EF<br />
Nur 3 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Die 1911 mit Hauptsitz in Prag gegründete Anstalt entwickelte<br />
sich in der damaligen Tschechoslowakei zum bedeutendsten<br />
deutschen Geldinstitut im böhmisch-mährischen Raum. Mit der<br />
Angliederung des Sudetenlandes an das Deutsche Reich 1928<br />
wurde der Hauptsitz nach Reichenberg verlegt. Das Institut<br />
unterhielt 85 Filialen im Sudetenland, in Böhmen und Mähren<br />
(incl. Prag, Budweis, Brünn und Pilsen) , den angrenzenden<br />
Gauen Bayreuth, Nieder-Donau, Ober-Donau und Schlesien sowie<br />
in Zwickau und Zwittau.<br />
Los 932 Schätzwert 100-125 €<br />
Kreditanstalt der Deutschen eGmbH<br />
Reichenberg/Prag, Namens-Anteilschein<br />
100 RM 16.4.1942 (R 8) EF<br />
Nur 14 Stück lagen im Reichsbankschatz. Identische<br />
Gestaltung wie voriger Titel.<br />
Nr. 933<br />
Los 933 Schätzwert 100-175 €<br />
Kreditbank Hameln <strong>AG</strong><br />
Hameln, Aktie 1.000 RM Mai 1940<br />
(Auflage 750, R 7) EF<br />
Gründung 1861 als „Credit-Verein zu Hameln eGmbH“, seit<br />
1904 <strong>AG</strong>. 1923 Umfirmierung in „Wirtschaftsbank für Niederdeutschland<br />
<strong>AG</strong>“ und Sitzverlegung nach Hannover (Theaterstr.<br />
8), eine weitere Zweiganstalt bestand in Bielefeld. Anfang der<br />
30er Jahre taucht dann die Niedersächsische Landesbank Girozentrale<br />
als Mehrheitsaktionär auf. Später als Bankhaus Nicolai<br />
& Co. firmierend, nach der Insolvenz 1975 vorübergehend<br />
noch einmal unter die Fittiche der NORD/LB gekommen und<br />
dann übernommen von der Vereins- und Westbank (die 2005<br />
mit ihrem Großaktionär HypoVereinsbank fusioniert wurde).<br />
Kaum zu glauben: Das heutige niedersächsische Filialnetz der<br />
HypoVereinsbank geht auf die Kreditbank Hameln zurück!<br />
Los 934 Schätzwert 30-75 €<br />
Krefelder Teppichfabrik <strong>AG</strong><br />
Krefeld, Aktie 100 RM 31.3.1928 (Auflage<br />
1500, R 5) EF<br />
Gründung 1898 zwecks Übernahme der unter der Firma Joh.<br />
Kneusels & Co. betriebenen Teppich-Knüpferei und Weberei.<br />
1900 Fabrikneubau in Krefeld, Grüner Dyk 68. Auf behördliche<br />
Anordnung 1940 stillgelegt, 1943 Totalzerstörung bei einem<br />
Bombenangriff. Die wiederhergestellten Räumlichkeiten waren ab<br />
1948 vermietet. 1959 Umwandlung in die “Willy Nelsbach KG”.<br />
Los 935 Schätzwert 600-750 €<br />
Kreis Altenaer Schmalspur-<br />
Eisenbahn-Gesellschaft<br />
Oberrahmede, Actie Lit. B 1.000 Mark<br />
15.9.1887. Gründeraktie (Auflage 1000,<br />
davon aber 1943 etwa die Hälfte in<br />
Sammelaktien verbrieft, R 10) VF+<br />
In ausgestellter Form war die Gründeraktie Lit. B<br />
zuvor völlig unbekannt gewesen. Nur 5 Stück lagen<br />
im Reichsbankschatz, dies ist jetzt das allerletzte<br />
noch verfügbare.<br />
Gründung 1886 in Altena, ab 1905 in Lüdenscheid ansässig.<br />
Erste Strecke Altena-Lüdenscheid (14,5 km Schmalspur). Bis<br />
1905 wuchs das Streckennetz im Kreis Lüdenscheid auf 41<br />
km an, dazu kamen folgende Strecken: Lüdenscheid-Augustenthal-Werdohl;<br />
Schalksmühle-Halver; Verbindung Lüdenscheid<br />
zum DR-Bahnhof. 1953 Vergleichsverfahren. Strecken<br />
von 1949 bis 1967 bis auf 700 m Restgleis sukzessive stillgelegt.<br />
1976 Umfirmierung in Märkische Eisenbahngesellschaft.<br />
Alte Lokomotive der<br />
Altenaer Eisenbahn namens „Carl“<br />
Los 936 Schätzwert 600-750 €<br />
Kreis Altenaer Eisenbahn-<strong>AG</strong><br />
Lüdenscheid, Aktie 15.000 RM 11.3.1943<br />
(R 12), ausgestellt auf die Stadt Werdohl.<br />
In dieser Urkunde waren folgende Aktien<br />
zusammengefaßt: 23 Lit. B und 127 Lit. C<br />
zu je 100 RM VF<br />
Originalunterschrift. Einzelstück aus dem Reichsbankschatz.<br />
Zwei kleine Rostflecken.<br />
Los 937 Schätzwert 30-60 €<br />
Kreis Teltow<br />
Berlin, Schuldv. 500 RM 24.5.1927 (R 7) EF<br />
Anh. Auslosungsschein.<br />
Los 938 Schätzwert 10-40 €<br />
Kreisstadt Plauen i.V.<br />
Schuldv. 100 RM 6.12.1930 (R 5) EF<br />
Anh. Auslosungsschein.<br />
Los 939 Schätzwert 75-150 €<br />
Kronos Deutsche<br />
Lebensversicherungs-<strong>AG</strong><br />
Berlin, Namensaktie (Interimsschein) 100<br />
RM Aug. 1925 (Auflage 10000, R 5) EF<br />
Gründung 1922 als Kronos Deutsche Lebensversicherungsbank<br />
<strong>AG</strong>, ab 1926 Mannheimer Lebensversicherungs-Gesellschaft<br />
<strong>AG</strong>. 1950 Berliner Wertpapierbereinigung, ab 1957 2.<br />
Sitz in Mannheim. Heute hat der Mannheim Konzern 2400 Mitarbeiter<br />
und gliedert sich in Personen-, Schaden- und Rükkversicherung.<br />
Los 940 Schätzwert 600-750 €<br />
Kujawischer Bote<br />
Druckerei und Verlag GmbH<br />
Inowrazlaw (Hohensalza), Anteilschein<br />
1.000 Mark 1.7.1897 (R 12)., ausgestellt<br />
auf den Königl. Oberförster Heym, Mirau VF<br />
Originalunterschriften Robert Hensel und Ed. Holke.<br />
Zuvor völlig unbekannt gewesen, ein Unikat<br />
aus dem Reichsbankschatz,<br />
Heinrich Olawski (1840-1922), Drucker und Buchhändler deutscher<br />
Nationalität, gab in Inowrazlaw (Hohensalza) seit 1874<br />
eine deutsche Tageszeitung heraus, den “Kujawischen Boten”,<br />
das erste Tageblatt in Inowrazlaw. 1896 wurde die GmbH gegründet.<br />
Die Regierungs- und Kreisstadt Hohensalza (wie Inowrazlaw<br />
seit 1905 hieß), liegt 30 km südwestlich von Thorn,<br />
im Schnitt der Eisenbahnlinien Posen-Thorn und Hohensalza-<br />
Bromberg, im kujawischen Lande, dem fruchtbarsten Gebiet<br />
des Warthelandes. Am 13.9.1772 ging die Stadt in preußischen<br />
Besitz über, in dem sie bis 1918 verblieb. Von 1939 (in<br />
der Stadt lebten noch etwa 600 Deutsche) bis 1945 gehörte<br />
das Gebiet zum Reichsgau Wartheland. Der “Kujawische Bote”<br />
hieß ab 1940 “Hohensalzaer Zeitung”. 1945 wurde Hohensalza<br />
von der Roten Armee eingenommen und ist seitdem wieder<br />
unter dem alten Namen Inowroclaw polnisch.<br />
Los 941 Schätzwert 30-75 €<br />
Kunstanstalt Etzold & Kießling <strong>AG</strong><br />
Crimmitschau i.Sa., Aktie 1.000 RM<br />
31.8.1942 (Auflage 1175, R 4) UNC-EF<br />
Gründung 1897 unter Übernahme der seit 1867 bestehenden<br />
chromolithographischen Kunstanstalt gleichen Namens. Erzeugnisse:<br />
Werbedrucke, Affichen, Stanzplakate, Markenpakkungen,<br />
Serienbilder. Börsennotiz Berlin, später Leipzig. 1945<br />
wegen dringendem Bedarf zunehmend Faltschachtelproduktion<br />
für die Nahrungsmittel- und Süßwarenindustrie. 1972 Verstaatlichung<br />
als Volkseigener Betrieb, ausschließlich Massenproduktion<br />
von Faltschachteln. 1990 Umwandlung in eine<br />
GmbH, 1992 Privatisierung als Tochtergesellschaft der Alfred<br />
Wall <strong>AG</strong>, Graz/Österr. 2001 wird der amerikanische Konzern<br />
Westvaco alleiniger Gesellschafter der Wall-Gruppe, masterpack<br />
ist als Standort der Wall-Gruppe integriert. 2004 Übernahme<br />
der masterpack Crimmitschau GmbH durch die sächsischen<br />
Mugler-Gruppe mit Sitz in Hohenstein-Ernstthal.<br />
Los 942 Schätzwert 200-250 €<br />
Kunstanstalten May <strong>AG</strong><br />
Dresden, Aktie 1.000 Mark 12.12.1922<br />
(Auflage 4000, R 9) VF-<br />
Einzelstück aus dem Reichsbankschatz. Fehlstelle<br />
am linken Rand.<br />
Gründung 1845/1882, seit 1898 <strong>AG</strong>. Hergestellt wurden Farbendruckbilder<br />
und Kunstblätter, außerdem Verlag von Bilderbüchern.<br />
1914 Umfirmierung in „Kunstanstalten May <strong>AG</strong>“.<br />
1949 Sitzverlegung nach Fürth, später nach Aschaffenburg.<br />
Börsennotiz früher Dresden/Leipzig. Noch heute bestehendes<br />
Unternehmen.<br />
79
Los 943 Schätzwert 20-50 €<br />
Kurmärkische<br />
Zellwolle und Zellulose <strong>AG</strong><br />
Wittenberge Bez. Potsdam, Namensaktie<br />
1.000 RM Jan. 1940 (Auflage 3334, R 4) EF<br />
Gründung 1937 durch mehrere Textilfirmen, die im Gegenzug<br />
als Aktionäre das Recht zum Bezug von Zellwolle im Rahmen<br />
der Kriegsmangelwirtschaft besaßen.<br />
Los 944 Schätzwert 100-125 €<br />
Kursächsische Braunkohlenwerke <strong>AG</strong><br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark Sept. 1923 (R 8)<br />
VF<br />
Nur 19 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1921, Betrieb der Braunkohlegrube „Präsident“ bei<br />
Fürstenberg a.O. (nahe dem heutigen Eisenhüttenstadt). Nach<br />
dem Konkurs 1927 ging aufgrund von Sicherungsübereignungsverträgen<br />
das gesamte Anlagevermögen an den Großaktionär<br />
„Märkische Elektrizitätswerk <strong>AG</strong>“.<br />
Los 945 Schätzwert 10-30 €<br />
Land Sachsen<br />
Dresden, 4,5 % Schuldv. 10.000 RM<br />
28.12.1939 (R 3) EF<br />
Der von Karl d. Gr. unterworfene Sachsenstamm erhielt im 9.<br />
Jh. eine stammeseigene Leitung. Die sächsischen Herzöge (die<br />
Ottonen) brachten es 919-1024 bis an die Spitze des Reiches.<br />
Über Markgrafschaft, Kurfürstentum und Königreich wurde<br />
Sachsen schließlich 1918, nach dem Thronverzicht von König<br />
Friedrich August III., Freistaat. Nach dem 2. Weltkrieg wurde<br />
Sachsen bis zur Aufteilung in Bezirke (1952) schon einmal<br />
Bundesland, wie dann nach der Wiedervereinigung erneut.<br />
Los 946 Schätzwert 30-75 €<br />
Landcredit-Bank Sachsen-Anhalt <strong>AG</strong><br />
Halle a.S., Aktie 1.000 RM Mai 1941<br />
(Auflage 400, R 4) EF<br />
Gründung 1922. Filialen in Stendal, Heiligenstadt, Beetzendorf,<br />
Magdeburg, Salzwedel und Eisleben.<br />
Los 947 Schätzwert 20-50 €<br />
Landesbank und Girozentrale<br />
Danzig-Westpreußen<br />
Danzig, 4,5 % Pfandbrief 100 RM<br />
25.1.1941 (R 5) EF<br />
Gründung 1924 als Danziger Hypothekenbank <strong>AG</strong>. Im April<br />
1925 fusionsweise Übernahme der Danziger Roggenrenten-<br />
80<br />
bank <strong>AG</strong>. 1940 im Zuge der Angliederung an das Deutsche<br />
Reich wurde die Gesellschaft in Landesbank und Girozentrale<br />
Danzig-Westpreußen umbenannt.<br />
Los 948 Schätzwert 10-40 €<br />
Landesbank und Girozentrale Westmark<br />
Saarbrücken, 4 % Pfandbrief 100 RM<br />
1.7.1942 (R 4) EF<br />
Gegründet 1941 unter Übernahme folgender Institutionen: Hypothekenbank<br />
Saarbrücken <strong>AG</strong>, Allgemeine Bodenkreditbank,<br />
Deutsche Girozentrale-Deutsche Kommunalbank (Geschäftsstelle<br />
Saarbrücken), Bayerische Gemeindebank (Zweigstelle<br />
Kaiserslautern), Pfälzische Wirtschaftsbank, Gem. <strong>AG</strong>.<br />
Los 949 Schätzwert 275-350 €<br />
Landesbank Westsachsen <strong>AG</strong><br />
Plauen i.V., Aktie 1.000 RM Aug. 1927 (R 9) EF<br />
Nur 6 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gegründet 1922 in Auerbach i.V. als “Staats- und Bezirksbank<br />
Obervogtland <strong>AG</strong>”, 1924 umfirmiert wie oben, 1927 Sitzverlegung<br />
nach Plauen. Zweigniederlassungen in Auerbach, Falkenstein,<br />
Klingenthal, Lengenfeld und Oelsnitz. Das Institut stand<br />
der Sächsischen Staatsbank nahe. Als Spätfolge der Bankenkrise<br />
1934 Kapitalschnitt 5:1, wobei der Nennwert der Aktien<br />
auf 20 RM bzw. 200 RM geändert wurde. 1937 durch Überdruck<br />
auf 100-RM-Aktien vereinheitlicht, die auf 200 RM umgestempelten<br />
1.000-RM-Aktien kamen außer Verkehr.<br />
Los 950 Schätzwert 600-750 €<br />
Landgesellschaft Eigene Scholle GmbH<br />
Frankfurt a. O., Anteilschein 5.000 Mark<br />
18.10.1912. Gründeremission (R 11),<br />
ausgestellt auf den Gutsbesitzer<br />
Dschenkig, Tzschetzschnow VF<br />
Originalunterschriften. Inwendig Nennwert-Anpassungs-Vermerke<br />
bis 1935. Zuvor unbekannt gewesen,<br />
nur 2 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Ursprünglich gegründet 1910 zwecks Bau und Verwaltung der<br />
Arbeiterwohnungen der Grube Ilse bei Senftenberg (Niederlausitz),<br />
einer der bedeutendsten Braunkohlengruben des Reviers,<br />
und weiterer Betriebe. Der Nationalsozialismus bediente sich<br />
dann dieser Landgesellschaft für seine Zwecke, was ihr eine<br />
überaus wichtige und facettenreiche Geschichte bescherte:<br />
Nach der “Machtergreifung” verfügte das Deutsche Reich über<br />
53,4 % des knapp 4,2 Mio. RM betragenden Stammkapitals,<br />
24,3 % besaß der Provinzialverband der Provinz Brandenburg,<br />
1,1 % das Stift Neuzelle. Der Rest verteilte sich auf 58 Landkreise<br />
sowie 141 Banken, Firmen und Privatpersonen. Gegenstand<br />
des Unternehmens war nach einer Satzungsänderung<br />
1938 “die Neubildung deutschen Bauerntums nach Maßgabe<br />
der Gesetze und der Richtlinien der Reichsregierung”. Bereits<br />
ab 1934 wurden jährlich etwa ein dutzend Landgüter erworben,<br />
auch aus jüdischem Besitz, mit Flächen von 3.000 -<br />
5.000 ha pro Jahr. Diese wurden dann für die Ansiedlung von<br />
Neubauern unter Federführung des “Rasse- und Siedlungshauptamtes<br />
der SS” parzelliert. Wie das geschah, erläutert beispielhaft<br />
der Geschäftsbericht 1938 für die Neubauernsiedlung<br />
Mehrow (Kreis Niederbarnim, zuvor ein hoch verschuldetes Rittergut<br />
der Besitzerin Anna Bothe): “Die Aufteilung erfolgt, wie<br />
alle Siedlungen, durch die Gesellschaft nach den Richtlinien für<br />
die Neubildung deutschen Bauerntums, die Auswahl der Neubauern<br />
unter Beachtung der Richtlinien des Reichsnährstandes<br />
von der SS bzw. SA. Die ausgewählten SS-Männer erhalten zur<br />
Bestreitung der Anzahlung und der Beschaffung des Inventars<br />
zusätzliche Mittel der SS aus den Mitteln des Rasse- und Siedlungsamtes,<br />
die SA-Männer Mittel aus dem Dankopfer der Nation.<br />
Bei der Planung und Ausgestaltung der Neubauerndörfer<br />
sind die Wünsche und Vorschläge der SS bzw. der SA weitgehend<br />
berücksichtigt worden.” Ein Teil dieser Mustersiedlungen<br />
steht heute unter Denkmalschutz. Ein weiteres Tätigkeitsgebiet<br />
der Landgesellschaft waren Aufträge der Wehrmacht zur Beschaffung<br />
von Übungsplatzgeländen.<br />
Los 951 Schätzwert 10-40 €<br />
Landschaftlicher Kredit-Verband<br />
für die Provinz Schleswig-Holstein<br />
Kiel, 5 % Pfandbrief 50 Ztr. Roggen<br />
26.10.1923 (R 5) EF<br />
Gründung 1882. Zunächst tätig als privilegierter Verein, ab<br />
1899 als öffentlich-rechtliche Körperschaft. 1934 Fusion mit<br />
der Schleswig-Holsteinischen Landschaft, 1944 durch Verordnung<br />
aufgelöst.<br />
Los 952 Schätzwert 25-125 €<br />
Langbein-Pfanhauser Werke <strong>AG</strong><br />
Leipzig, Aktie 1.000 Mark 19.8.1907.<br />
Gründeraktie (Auflage 2250, R 2) EF<br />
Gründung 1907 durch Fusion der Dr. G. Langbein & Co. in<br />
Leipzig (gegr. 1881) mit Filialen in Berlin, Solingen, Wien, Mailand<br />
und Brüssel mit der Firma Wilh. Pfanhauser in Wien (gegr.<br />
Nr. 949 Nr. 957<br />
1873). Fabriken für Galvanotechnik und Elektrochemie sowie<br />
Dynamo- und Maschinenbau in Leipzig und Oerlikon/Schweiz.<br />
Seinerzeit in Leipzig börsennotiert. 1948 in der DDR enteignet,<br />
daraufhin Sitzverlegungen nach Düsseldorf (1951), Neuss<br />
(1953) und zurück nach Düsseldorf (1999). 2001 aufnehmende<br />
Gesellschaft bei der Fusion mit der Vereinigte Deutsche<br />
Nickel <strong>AG</strong>, der Hindrichs-Auffermann <strong>AG</strong> und der DO<strong>AG</strong> <strong>AG</strong>, zugleich<br />
Umfirmierung in VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke<br />
<strong>AG</strong>. 2005 Eröffnung des Insolvenzverfahrens.<br />
Los 953 Schätzwert 10-50 €<br />
Langbein-Pfanhauser Werke <strong>AG</strong><br />
Leipzig, Aktie 1.000 Mark 10.1.1923<br />
(Auflage 5700, R 2) EF<br />
Identische Gestaltung wie voriges Los.<br />
Los 954 Schätzwert 10-40 €<br />
Langbein-Pfanhauser Werke <strong>AG</strong><br />
Leipzig, Aktie 100 RM 16.7.1932 (Auflage<br />
2000, R 2) UNC<br />
Los 955 Schätzwert 30-75 €<br />
Leder-<strong>AG</strong><br />
Frankfurt a.M., Aktie 1.000 RM 27.2.1937<br />
(Auflage 500, R 4) EF<br />
Gründung 1923. Produktion von Bodenleder.<br />
Los 956 Schätzwert 500-625 €<br />
Lederfabrik Kühn <strong>AG</strong><br />
Warendorf, Aktie 1.000 Mark 30.11.1922<br />
(Auflage 2000, R 12) VF<br />
Großes Hochformat, sehr hübsche kräftige Umrahmung.<br />
Aktien dieser Ges. waren zuvor völlig unbekannt,<br />
ein Unikat aus dem Reichsbankschatz.<br />
1826 kam das (heute Nordrhein-Westfälische) Landgestüt<br />
nach Warendorf, was einen gesteigerten Bedarf an Lederer-
zeugnissen nach sich zog, der von kleineren ortsansässigen<br />
Betrieben befriedigt wurde. Der Lederfabrikant Paul Kühn wandelte<br />
sein Unternehmen Ende 1921 in eine Aktiengesellschaft<br />
um. Bereits 1926 wieder in Liquidation gegangen.<br />
Los 957 Schätzwert 400-500 €<br />
Lederfabrik vorm. H. Deninger & Co. <strong>AG</strong><br />
Lorsbach im Taunus, Aktie 100 RM April<br />
1928 (Auflage 3200, nach Kapitalherabsetzung<br />
1931 nur noch 640, R 12) VF<br />
Aktien dieser Ges. waren zuvor vollkommen unbekannt,<br />
ein Unikat aus dem Reichsbankschatz.<br />
Zunächst 1850 in der Trutzmühle als Gerberei eingerichtet, ist<br />
dieses Unternehmen der Ursprung der Lederindustrie in Lorsbach.<br />
Ab 1881 wurde, nunmehr in der Rechtsform der KGaA, in<br />
der Trutzmühle die erste Lederfabrik betrieben, die 1891 bereits<br />
120 Beschäftigte hatte und dann in eine <strong>AG</strong> umgewandelt wurde.<br />
Auch in allen anderen Mühlen in Lorsbach (mit Ausnahme<br />
der Erbleihmühle) entstanden in den Folgejahren weitere Lederfabriken.<br />
Grund für diese hohe Konzentration war der Schwarzbach,<br />
der nicht nur Wasserkraft lieferte, sondern dessen aus<br />
dem Taunus kommendes Wasser für Gerbereizwecke auch besonders<br />
geeignet war. Der jüdische Großaktionär dieser in Frankfurt<br />
börsennotierten <strong>AG</strong>, der Frankfurter Dr. Carl Blumenthal,<br />
machte die <strong>AG</strong> den neuen Machthabern mißliebig, 1935 ging sie<br />
in Liquidation. Rationalisierungsfortschritte in den 1950er Jahren<br />
ließen die Lorsbacher Lederindustrie noch einmal bis auf 300<br />
Beschäftigte aufblühen, 1991 schloß dann auch die letzte Lederfabrik<br />
des Ortes. Die Wasserkräfte der früheren Mühlen werden<br />
heute teilweise zur Stromerzeugung genutzt.<br />
Los 958 Schätzwert 30-75 €<br />
Lederwerke Wieman <strong>AG</strong><br />
Hamburg, Aktie 100 RM 11.5.1942<br />
(Auflage 2000, R 3) EF<br />
Gründung 1908. Produktion von Sohlleder alter Grubengerbung<br />
und Vacheleder in Gruben- und gemischter Gerbung, ferner<br />
Oberleder, Fahlleder, Blankleder, Pantinen und Spalte. Heute<br />
Lederwerke Wieman GmbH.<br />
Los 959 Schätzwert 30-80 €<br />
Lehnkering <strong>AG</strong><br />
Duisburg, Aktie 1.000 RM Dez. 1941<br />
(Auflage 3000, R 4) EF<br />
Gründung 1872 als Lehnkering & Cie. in Duisburg, <strong>AG</strong> seit<br />
1907 nach Übernahme der Firma Lehnkering, Otten & Cie. zu<br />
Hagen. Betrieb von Reederei-, Lagerei- und Speditionsgeschäften.<br />
1998 aufgegangen in VTG-Lehnkering <strong>AG</strong>, die ihren<br />
Firmensitz in Duisburg und Hamburg hat (Tochtergesellschaft<br />
der Hapag-Lloyd). 2004 Ausgliederung der Lehnkering GmbH,<br />
Duisburg, tätig in Bereichen Binnenschifffahrt, Road Cargo,<br />
Tank- Gefahrgutlager, Chemieservice.<br />
Los 960 Schätzwert 30-75 €<br />
Leinag Leinenindustrie <strong>AG</strong><br />
Landeshut, Aktie 1.000 RM Juli 1942<br />
(Auflage 1000, R 3) UNC-EF<br />
Gründung 1922 unter der Firma J. Rinkel <strong>AG</strong>, 1938 umbenannt<br />
in Landeshuter Leinen-<strong>AG</strong>, ab 1941 wie oben. Herstellung und<br />
Vertrieb von Spinnstoffen, Gespinsten und Geweben. 1945<br />
umgewandelt in eine GmbH.<br />
Los 961 Schätzwert 75-120 €<br />
Leipnik-Lundenburger Zuckerfabriken-<strong>AG</strong><br />
Wien, Aktie 300 RM Sept. 1940 (Auflage<br />
10000, R 7) EF<br />
Gründung 1867. Herstellung und Vertrieb von Zucker, Betrieb<br />
der Landwirtschaft. 1939 wurde die Satzung dem deutschen<br />
Aktiengesetz angepaßt. Großaktionär. Schoeller & Co., Wien.<br />
Seit 1995 eine Beteiligungsgesellschaft.<br />
Los 962 Schätzwert 75-200 €<br />
Leipziger Aussenbahn <strong>AG</strong><br />
Leipzig, Aktie 1.000 Mark 5.6.1909<br />
(Auflage 1000, R 3) EF<br />
Gründung 1900 zum Bau von Straßenbahnen in der näheren<br />
und weiteren Umgebung von Leipzig. Von der sächsischen Regierung<br />
konzessioniert wurden 1900 die Linien Connewitz-<br />
Oetzsch-Gautzsch-Markkleeberg und Möckern-Wahren-Lützschena<br />
mit Fortsetzung nach Schkeuditz sowie 1905<br />
Leutzsch-Böhlitz-Ehrenberg-Gundorf. Die Betriebsführung oblag<br />
der Grossen Leipziger Straßenbahn, mit der von Anfang an<br />
eine enge Verbindung bestand (u.a. Beteiligung von 30 %). Ab<br />
1902 mit dem Erwerb eines Grundstücks in Gautzsch auch als<br />
Terraingesellschaft tätig. 1910 Beteiligung an der Landkraftwerke<br />
Leipzig <strong>AG</strong> in Kulkwitz, von der auch ein Teil des Fahrstroms<br />
bezogen wurde. Letzte Aktionäre waren in den 40er<br />
Jahren die Reichsmessestadt Leipzig (50 %) sowie die <strong>AG</strong><br />
Sächsische Werke und der Elektrizitätsverband Nordwestsachsen<br />
(je 25 %). 1951 fusioniert auf die Leipziger Verkehrsbetriebe,<br />
1970 im VEB Kombinat Verkehrsbetriebe der Stadt Leipzig<br />
aufgegangen, nach der Wende die Leipziger Verkehrsbetriebe<br />
<strong>AG</strong> (seit 1993 GmbH).<br />
Los 963 Schätzwert 50-125 €<br />
Leipziger Bankverein<br />
Leipzig, Aktie 20 RM Juni 1925 (Auflage<br />
5000, R 5) EF<br />
Gründung 1921. Bank vor allem für den Mittelstand. Börsennotiz:<br />
Freiverkehr Leipzig. 1928 Zahlungseinstellung wegen<br />
unkorrekter Geschäftsführung. 1932 von Amts wegen gelöscht.<br />
Los 964 Schätzwert 30-75 €<br />
Leipziger Baumwollspinnerei<br />
Leipzig, Aktie 100 RM Okt. 1941 (Auflage<br />
5000, R 3) UNC-EF<br />
Gründung 1884. Neben Baumwollgarnen waren Cordzwirne für<br />
Auto- und Fahrradbereifung eine Spezialität. Zu 100 % an der<br />
Leipziger Baumwollweberei in Wolkenburg (Mulde) beteiligt.<br />
Börsennotiz Leipzig. Nach 1945 VEB Leipziger Baumwollspinnerei,<br />
1993 von der Treuhand an einen Kölner Unternehmer verkauft,<br />
ab 2001 Leipziger Baumwollspinnerei Verwaltungsgesellschaft<br />
mbH. Verwaltet wird das Betriebsgelände, heute Arbeitsstätte<br />
für Architekten, Werbegraphiker und Möbeldesigner.<br />
Los 965 Schätzwert 275-350 €<br />
Leipziger Baumwollspinnerei<br />
Leipzig, Global-VZ-Aktie 1.000 RM<br />
12.6.1942 (R 12) EF-VF<br />
Maschinenschriftliche Ausführung, mit Originalunterschriften.<br />
Dividendenzahlungen für 1942,<br />
1943 und 1944 vermerkt. Einzelstück aus dem<br />
Reichsbankschatz.<br />
Nr. 967 Nr. 968<br />
Los 966 Schätzwert 10-50 €<br />
Leipziger Chromo- und Kunstdruck-<br />
Papierfabrik vorm. Gustav Najork <strong>AG</strong><br />
Leipzig, Aktie 100 RM 24.3.1938 (Auflage<br />
1150, R 3) UNC<br />
G & D-Druck.<br />
Gründung 1868, seit 1895 <strong>AG</strong> als Chromo-Papier und Carton-<br />
Fabrik vorm. Gustav Najork <strong>AG</strong>. 1929 Umbenennung in Leipziger<br />
Chromo- und Kunstdruck-Papierfabrik vorm. Gustav Najork<br />
<strong>AG</strong>. Die weißen und farbigen Chromo- und Kunstdruckpapiere<br />
und gestrichenen Offsetpapiere und -kartons aus dieser Fabrik<br />
im berühmten Industriebezirk Plagwitz wurden weltweit exportiert.<br />
Spezialität waren Spielkartenkartons. Börsennotiz Berlin<br />
und Leipzig, Großaktionär war bei Kriegsende die ADCA. 1945<br />
wurden die Werke demontiert.<br />
Los 967 Schätzwert 400-500 €<br />
Leipziger Gummi-Waaren-Fabrik <strong>AG</strong><br />
vorm. Julius Marx, Heine & Co.<br />
Leipzig, Aktie 20 RM 28.2.1925 (Auflage<br />
28750, jedoch bereits 1926 komplett<br />
durch Neudruck ersetzt, R 12) VF<br />
schöne Mäander-Umrahmung. Zuvor ganz unbekannt<br />
gewesene Emission, ein Unikat aus dem<br />
Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1864, <strong>AG</strong> seit 1884. In unmittelbarer Nähe des<br />
Bahnhofs Großzschocher-West (Anton-Zickmantel-Str. 12)<br />
wurde 1906 auf einem 12.150 qm großen Areal ein zweites<br />
Werk errichtet und 1922 die gesamte Produktion dort konzentriert.<br />
Mitte 1925 wurde die Fabrik stillgelegt und nach vier Wochen<br />
mit stark reduziertem Personalstamm wieder mühsam in<br />
Gang gebracht, 1926 Sanierung durch Vergleich und Kapitalschnitt.<br />
Börsennotiz Berlin und Leipzig. Im Nov. 1926 fusionsweise<br />
Übertragung des Vermögens auf die Phil. Penin Gummiwaarenfabrik<br />
<strong>AG</strong>, Leipzig-Plagwitz.<br />
Los 968 Schätzwert 400-500 €<br />
Leipziger Handels- und Verkehrs-<br />
Bank <strong>AG</strong> vorm. Leipziger Central-<br />
Viehmarkts-Bank<br />
Leipzig, Aktie 1.000 Mark 19.12.1922<br />
(Auflage 30000, R 11) VF+<br />
Zuvor völlig unbekannt gewesene Emission. Nur 2<br />
Stück lagen im Reichsbankschatz, dies ist jetzt das<br />
letzte noch verfügbare.<br />
Gründung 1867 als Pfaffendorfer Handelsverein A. Klarner &<br />
Co. KG, seit 1877 Genossenschaftsbank und seit 1891 <strong>AG</strong> als<br />
“Leipziger Central-Viehmarkts-Bank”. 1919 umbenannt in<br />
“Leipziger Handels- und Verkehrsbank”, ab 1941 nur noch<br />
kurz “Handelsbank”. Das Institut (geschäftsansässig Leipzig C<br />
1, Kurprinzstr. 9) beschäftigte zuletzt ca. 130 Mitarbeiter und<br />
war in Leipzig auch börsennotiert.<br />
81
Los 969 Schätzwert 50-125 €<br />
Leipziger Handels-<br />
und Verkehrs-Bank <strong>AG</strong><br />
Leipzig, Aktie 100 RM 22.4.1925 (Auflage<br />
2500, R 5) EF-<br />
Los 970 Schätzwert 20-75 €<br />
Leipziger Immobiliengesellschaft -<br />
Bank für Grundbesitz <strong>AG</strong><br />
Leipzig, Aktie 1.000 RM 10.5.1927<br />
(Auflage 2600, R 3) EF<br />
G & D-Druck.<br />
Entstanden 1921 aus der Fusion der 1896 gegründeten Bank<br />
für Grundbesitz mit der 1872 gegründeten Leipziger Immobiliengesellschaft.<br />
Nach Abwicklung der verlustträchtigen Bankabteilung<br />
bestand zuletzt noch Grundbesitz in Borsdorf und<br />
Leipzig-Wahren. Börsennotiz Leipzig und Berlin.<br />
Los 971 Schätzwert 100-250 €<br />
Leipziger Luftschiffhafen-<br />
und Flugplatz-<strong>AG</strong><br />
Leipzig, Aktie 1.000 Mark 25.3.1913.<br />
Gründeraktie (Auflage 1200, R 3) EF<br />
Hochdekorativ, große Abb. des Luftschiffes “Sachsen”<br />
im Unterdruck.<br />
Zur Errichtung eines Luftschiffhafens mit Luftschiffhalle wurde<br />
der Gesellschaft von der Stadt Leipzig ein großes Areal in<br />
Mockau überlassen. Die feierliche Eröffnung fand am<br />
22.6.1913 mit einem Eröffnungsflug des Luftschiffs „Sachsen“<br />
statt, bei dem auch der König von Sachsen an Bord war. Im 1.<br />
Weltkrieg wurde der Flugplatz vom Militär genutzt und erst<br />
1919 wieder freigegeben. Der Leipziger Luftschiffhafen wurde<br />
zum größten der Welt. Ein Teil der verfügbaren Schuppen war<br />
später an die Germania-Flugzeugwerke GmbH verpachtet.<br />
1924 übernahm die Stadt Leipzig die Aktienmehrheit und<br />
reichte einen Teil der Beteiligung über die Sächsische Flughäfen-Betriebs-GmbH<br />
an den Freistaat Sachsen weiter, Mitte der<br />
1930er Jahre besaß die Stadt dann wieder 93 % der Aktien.<br />
Die Anlage besteht noch heute als Flughafen Leipzig-Mockau.<br />
82<br />
Alte Postkarte von 1917 der Leipziger Luftschiffhafen und Flugplatz <strong>AG</strong><br />
Los 972 Schätzwert 600-750 €<br />
Leipziger Luftschiffhafen<br />
und Flugplatz <strong>AG</strong><br />
Leipzig, Interimsschein über 112 Aktien<br />
zu 500 RM 24.4.1937 (entsprach über 10<br />
% des Kapitals, R 12), ausgestellt auf den<br />
Oberbürgermeister der Stadt Leipzig VF+<br />
Maschinenschriftliche Ausführung mit Originalunterschriften<br />
von Bürgermeister Haake für den AR<br />
und Ing. Aug. Otto Paul Reinsberg als Vorstand. Alle<br />
860 Aktien zu 500 RM waren in 5 unterschiedlich<br />
gestückelten Sammelurkunden für die Stadt<br />
Leipzig verbrieft, die alle 5 im Reichsbankschatz<br />
gefunden wurden, jede für sich somit ein Unikat.<br />
Los 973 Schätzwert 150-250 €<br />
Leipziger Messe- und Ausstellungs-<strong>AG</strong><br />
Leipzig, Aktie 1.000 RM 15.2.1925<br />
(Auflage 650, nach diversen Kapitalmaßnahmen<br />
nur noch 45 Stück, die sämtlich<br />
im Reichsbankschatz lagen, R 7) UNC<br />
Faksimile-Unterschrift u.a. von Oberbürgermeister<br />
(1918-30) Dr. Karl Wilhelm August Rothe für das<br />
Aufsichtsrats-Präsidium. Aktien der seinerzeit bedeutendsten<br />
deutschen Messegesellschaft waren<br />
bislang völlig unbekannt.<br />
Gründung 1923 zwecks „Förderung der Leipziger Messe mit<br />
dem gemeinnützigen Ziel der Hebung der deutschen Warenausfuhr<br />
durch Beschaffung und Vermietung von Räumen und<br />
Plätzen zur Ausstellung von Industrie-Erzeugnissen.“ Die Weltwirtschaftskrise<br />
traf die Leipziger Messe so hart, daß sie 1933<br />
ihre Grundstücke, sonstige Sachanlagen und das Umlaufvermögen<br />
(soweit nicht für Durchführung des Messebetriebes unbedingt<br />
erforderlich) an das Leipziger Messamt verkaufen<br />
musste, das im Gegenzug nom. 3,85 Mio. Aktien unentgeltlich<br />
für eine Kapitalherabsetzung auf nur noch o,4 Mio. RM zur Verfügung<br />
stellte und außerdem auf die Erfüllung der bestehenden<br />
Forderungen verzichtete. Der Messe- und Ausstellungs-<strong>AG</strong><br />
blieb fortan mit knapp 50 Mitarbeitern nur noch die Verwaltung<br />
und Vermietung der Meßräume in den jetzt verkauften Objekten.<br />
Aktionäre waren nunmehr das Leipziger Messamt (ca. 90<br />
%) und die Hamburg-Amerika-Linie (HAP<strong>AG</strong>, ca. 9 %). Zuletzt<br />
wurde das Reichsmesseamt Leipzig alleiniger Aktionär. 1951<br />
Löschung der <strong>AG</strong> im Handelsregister. Die Leipziger Messe dagegen<br />
bestand als Frühjahrs- und Herbstmesse fort und entwickelte<br />
sich zu DDR-Zeiten trotz Kaltem Krieg zur wichtigsten<br />
Kontakt-Plattform im Ost-West-Handel.<br />
Los 974 Schätzwert 300-375 €<br />
Leipziger Messe- und Ausstellungs-<strong>AG</strong><br />
Leipzig, Aktie 10.000 RM Nov. 1941<br />
(Auflage nur 20 Stück, die sämtlich im<br />
Reichsbankschatz lagen, R 8) UNC-<br />
Los 975 Schätzwert 275-350 €<br />
Leipziger Pianofortefabrik<br />
Gebr. Zimmermann <strong>AG</strong><br />
Leipzig, Aktie 1.000 Mark 1.3.1923<br />
(Auflage 9500, R 8) EF-VF<br />
Sehr dekorativ, drei Vignetten mit Klavieren und<br />
Konzertflügel. Nur 11 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Zur Firmengeschichte siehe bitte das Los 826.<br />
Los 976 Schätzwert 275-350 €<br />
Leipziger Pianoforte- und Phonolafabriken<br />
Hupfeld - Gebr. Zimmermann<br />
Leipzig, Aktie 100 RM 7.1.1927 (Auflage<br />
6800, R 10) EF-VF<br />
Sehr dekorativ, zwei Vignetten mit Klavier und<br />
Konzertflügel sowie zwei Vignetten mit Zimmermann-<br />
bzw. Hupfeld-Logo. Nur 4 Stück lagen im<br />
Reichsbankschatz.<br />
Nr. 974 Nr. 976<br />
Los 977 Schätzwert 10-30 €<br />
Leipziger Spitzenfabrik Barth & Co. <strong>AG</strong><br />
Leipzig, Aktie 100 RM 14.1.1933 (Auflage<br />
1500, R 2) EF<br />
Sehr seltene Variante mit dem ovalen BARoV-<br />
Kraftlos-Stempel.<br />
Gründung 1900. Herstellung von Spitzen und anderen Textilerzeugnissen,<br />
Werke in Plagwitz und Lindenau. Börsennotiz Leipzig.<br />
In der DDR bis 1970 VEB Leipziger Spitzenfabrik, dann Bildung eines<br />
Großbetriebes VEB Plauener Spitze aus den Werken Leipzig,<br />
Grimma, Dresden, Auerbach und Plauen. Die Altgesellschaft wurde<br />
1991 nach Hamburg verlegt, 1993 Nachtragsabwicklung,<br />
1998 Leipziger Spitzenfabrik Barth & Co. <strong>AG</strong> i.A., Leipzig.<br />
Los 978 Schätzwert 50-100 €<br />
Leipziger Westend-Baugesellschaft<br />
Leipzig, Aktie 100 RM 7.1.1942 (Auflage<br />
200, R 5) EF<br />
Gründung 1888. Mit Straßen und Eisenbahngleisen erschloss<br />
die Gesellschaft ihre rd. 50 ha Bauland für Industrie, Mietwohnungs-<br />
und Siedlungsbau im Stadtteil Plagwitz. Außerdem Betrieb<br />
eines Mörtelwerkes, von Sand- und Kiesgruben und eines<br />
Fuhrgeschäftes in Leipzig-Lindenau. Beteiligung an der „Leipziger<br />
Rodelbahn GmbH“ (die seit 1993 als Museumsfeldbahn betriebene<br />
Kiesbahn Leipzig-Lindenau). Firmenmantel 1989 verlagert<br />
nach Berlin (West) und Abwicklung, 1991 Hauptversammlung,<br />
1998 Leipziger Westend-Baugesellschaft <strong>AG</strong> i.A., Leipzig.<br />
Los 979 Schätzwert 50-125 €<br />
Leisniger Bank <strong>AG</strong><br />
Leisnig, Aktie 1.000 Mark 3.2.1923<br />
(Auflage 1000, R 5) EF-VF<br />
Gründung 1859 als genossenschaftlicher Vorschußverein, <strong>AG</strong><br />
seit 1886, zunächst als „Vereinsbank zu Leisnig“ firmierend.<br />
Eigene Bankgebäude in Leisnig und Geringswalde. Überkreuzbeteiligung<br />
mit der Leisniger Mühlen <strong>AG</strong>. 1945 auf Grund eines<br />
SMAD-Befehls geschlossen, die Liquidation erfolgte durch die<br />
Sächsische Landesbank.<br />
Los 980 Schätzwert 40-80 €<br />
Leisniger Mühlen <strong>AG</strong><br />
Leisnig, Aktie 1.000 Mark 28.6.1921<br />
(Auflage 200, R 5) EF-<br />
Gründung 1872. Betrieb der an der Mulde gelegenen Obermühle<br />
und Ausnutzung der im Besitz der Gesellschaft befind-
lichen Wasserkräfte, ferner Beteiligung an der Leisniger Bank<br />
und der Berliner Mittelmühlen-GmbH. Zu DDR-Zeiten wurde<br />
die Mühle dann als Futtermittelwerk genutzt.<br />
Los 981 Schätzwert 25-100 €<br />
Leonhard Tietz <strong>AG</strong><br />
Köln, Aktie 100 RM 17.1.1923 (Auflage<br />
50000, R 5; das Ausgabedatum ist<br />
irreführend; tatsächlich wurden die<br />
Stücke aus der Kapitalerhöhung vom<br />
17.1.1923 erst nach der im Aug. 1924<br />
beschlossenen Kapitalumstellung 10:1<br />
auf RM ausgedruckt, und zwar bereits mit<br />
dem umgestellten Nennbetrag) EF<br />
Faksimile-Unterschrift von Gen.-Dir. Alfr. Leonh.<br />
Tietz. Wirtschaftshistorisch bedeutendes Stück,<br />
zeitweise einer der 30 großen DAX-Werte.<br />
Gründung der Einzelfirma Leonhard Tietz 1879 in Stralsund als<br />
Kurz-, Weiß- und Wollwarengeschäft. Durch feste niedrige Preise<br />
gewann das Geschäft so viele Kunden, daß es innerhalb weniger<br />
Jahre dreimal vergrößert werden mußte. 1889 Gründung<br />
der ersten Filiale in Elberfeld, danach schlagartige Expansion<br />
vor allem im westdeutschen Raum, ab 1929/30 auch in Schlesien<br />
und dem Frankfurter Raum. Seit 1905 „Leonhard Tietz<br />
<strong>AG</strong>“, 1933/36 umbenannt in Westdeutsche Kaufhof <strong>AG</strong>. Der<br />
Kaufhof hatte jetzt über 13.000 Mitarbeiter, Großaktionäre waren<br />
zu dieser Zeit die Commerzbank, die Dresdner und die<br />
Deutsche Bank. 1945 waren lediglich 3 von 41 Filialen einigermaßen<br />
unzerstört, doch es folgte ein gewaltiger Wiederaufbau<br />
zum später zweitgrößten deutschen Kaufhauskonzern.<br />
1988 Einstieg bei Jet-Reisen und der Media-Markt-Gruppe.<br />
1996 auf Wunsch des späteren Großaktionärs Metro Verschmelzung<br />
mit der ASKO und den deutschen Metro-Aktivitäten<br />
zur heutigen METRO <strong>AG</strong> (Sitz Düsseldorf).<br />
Los 982 Schätzwert 25-100 €<br />
Leonische Drahtwerke <strong>AG</strong><br />
Nürnberg, Aktie 100 RM Juni 1932<br />
(Auflage 3000, R 4) EF<br />
Die Firma ging hervor aus der in Mittelfranken seit 1700 beheimateten<br />
“leonischen Industrie” (= Herstellung echter, vergoldeter<br />
und versilberter Drähte und Plätte sowie von Goldund<br />
Silbergespinsten). 1917 schlossen sich die Firmen Joh.<br />
Phil. Stieber in Roth sowie die Joh. Balth. Stieber & Sohn GmbH<br />
und die Vereinigte leonische Fabriken in Nürnberg zur “Leoni-<br />
sche Werke Roth-Nürnberg <strong>AG</strong>” zusammen. Heute einer der<br />
weltweit bedeutendsten Draht- und Kabelhersteller, u.a. werden<br />
für alle bedeutenden Automobilhersteller komplette Bordnetze<br />
geliefert. 1999 Umfirmierung in LEONI <strong>AG</strong>, Werke in<br />
Deutschland (Brake, Friesoythe, Kitzingen, Kötzting, Lilienthal,<br />
Lüdenscheid, Neuburg, Rheda-Wiedenbrück, Roth, Weißenburg),<br />
Belgien, Großbritannien, Irland, Italien, Polen, Portugal,<br />
Rumänien, Slowakei, Ukraine, Ungarn, USA, Kanada, Mexiko,<br />
Braslien, Ägypten, Südafrika, Tunesien, Indien und China.<br />
Los 983 Schätzwert 200-250 €<br />
Lerche & Nippert Hoch- und Tiefbau <strong>AG</strong><br />
Berlin, Aktie 20 RM April 1925 (Auflage<br />
11250, R 11) VF<br />
Nur 2 Stück lagen im Reichsbankschatz. Fleckig.<br />
Gründung 1921 als „Allgemeine Hoch- und Tiefbau <strong>AG</strong>“, 1922 Umfirmierung<br />
anläßlich der Übernahme der seit 1908 bestehenden Tiefund<br />
Betonbaufirma Lerche & Nippert. Die Ges. besaß auch eine Ziegelei<br />
in Mühlenbeck, Grundstücke in Waidmannslust, Borgsdorf, Oranienburg<br />
und Hohenneuendorf, ferner eigene Geschäftshäuser in<br />
Berlin (NW 6, Karlstr. 2) und Hameln. 1926 zudem Erwerb der Zweigniederlassung<br />
Hannover der Rheinisch-Westfälische Bauindustrie <strong>AG</strong>,<br />
Düsseldorf. Ausführung von Aufträgen hauptsächlich für Behörden<br />
und gemeinn. Baugesellschaften. Börsennotiz Berlin (bis 1926 amtlich,<br />
danach Freiverkehr). In der Weltwirtschaftskrise blieben die Aufträge<br />
aus, die Banken drehten den Kredithahn zu, 1931 Konkurs.<br />
Los 984 Schätzwert 60-75 €<br />
Lichtenberger Terrain <strong>AG</strong><br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark 20.9.1907<br />
(Blankette der Gründeraktie, R 8) EF<br />
Gründung 1907. Erschließung eines großen Grundstücks in<br />
Lichtenberg. Großaktionär war die Evangelische Kirche. 1936<br />
wurde die Gesellschaft aufgelöst, 1943 erloschen.<br />
Los 985 Schätzwert 600-750 €<br />
Lindener Actien-Brauerei<br />
vormals Brande & Meyer<br />
Hannover, Actie 1.500 Mark 27.12.1897<br />
(Auflage erst 504, zuletzt als 300-RM-Aktie<br />
nur noch insgesamt 94 Stück, R 9) VF<br />
6 Stück hatten im Reichsbankschatz gelegen, dies<br />
ist jetzt das allerletzte noch verfügbare.<br />
Gründung 1832 als Lagerbier-Brauerei, <strong>AG</strong> seit 1871. Nach<br />
vollständigem Umbau 1897/98 und 1908-12 eine der größten<br />
Brauereien Deutschlands mit einer für die damalige Zeit mehr<br />
als beachtlichen Produktionsfähigkeit von 350.000 hl im Jahr.<br />
1904 Ankauf der Weizenbierbrauerei von Jos. Hösel in Linden,<br />
1908 Erwerb der Osteroder Stadtbierbrauerei GmbH. 1909 Beteiligung<br />
bei der Brauerei H. Langkopf GmbH in Peine (diese<br />
verkaufte danach nur noch Lindener Bier und wurde im Gegenzug<br />
- so ist das mit der Malzfabrik Langkopf bis heute! - Malzlieferant).<br />
1917 Übernahme der Germania-Brauerei GmbH in<br />
Hannover (gemeinsam mit der Städtischen Lagerbierbrauerei<br />
und der Vereinsbrauerei Herrenhausen). 1918 Beteiligung bei<br />
der Bürgerliches Brauhaus <strong>AG</strong>. Außerdem beteiligt bei der A.<br />
Schilling <strong>AG</strong> Brauerei und Mineralwasserfabrik in Celle. 1921<br />
Fusion mit der Schloß-Brauerei Schöneberg <strong>AG</strong> in Berlin (1926<br />
wieder ausgegliedert und verkauft). 1927 Erwerb des Hofbrauhauses<br />
Hannover (Hinüberstr. 8). 1934 Verkauf der Beteiligung<br />
an der Kaiser-Brauerei <strong>AG</strong> in Hannover-Ricklingen. 1968 kam<br />
per Betriebsüberlassungsvertrag mit dem heutigen Großaktionär<br />
Brauereigilde Hannover <strong>AG</strong> zur Braustätte Linden die Gilde-<br />
Brauerei hinzu - beide für sich waren zu dieser Zeit schon die<br />
größten Brauereien in Niedersachsen. Umfirmiert 1968 in Lindener<br />
Gilde-Bräu <strong>AG</strong> und 1988 in Gilde Brauerei <strong>AG</strong>. Zum Konzern<br />
der bis zuletzt in Hannover börsennotierten <strong>AG</strong> gehörte,<br />
neben dem Hofbrauhaus Wolters <strong>AG</strong> in Braunschweig (gegr.<br />
1627, ab Okt. 2006 privatisiert und eigenständig) vor allem die<br />
nach der Wende auf der grünen Wiese neu gebaute Hasseröder<br />
Brauerei in Wernigerode/Harz, die in weniger als 10 Jahren<br />
zur viertgrößten deutschen Biermarke wurde. Dies weckte die<br />
Nr. 983 Nr. 992<br />
Begehrlichkeit des belgischen Interbrew-Konzerns (heute als<br />
InBev der weltgrößte Brauereikonzern), der sich nach einer<br />
emotional geführten Übernahmeschlacht 2002 die Lindener<br />
Gilde-Brauerei einverleibte.<br />
Los 986 Schätzwert 300-375 €<br />
Lindener Actien-Brauerei<br />
vormals Brande & Meyer<br />
Hannover, Aktie 1.000 Mark 1.5.1920<br />
(Auflage erst 3024, zuletzt als 200-RM-Aktie<br />
noch insgesamt 359 Stück, R 8) EF-VF<br />
Los 987 Schätzwert 50-100 €<br />
Linke-Hofmann-Werke <strong>AG</strong><br />
Breslau, Aktie 1.000 RM April 1936<br />
(Auflage 1100, R 5) UNC-EF<br />
Faksimilesignatur Otto Steinbrinck (engster Mitarbeiter<br />
von Friedrich Flick beim Aufbau des mäch-<br />
tigsten deutschen schwerindustriellen Konzerns)<br />
als Aufsichtsratvorsitzender.<br />
1839 erhält Gottfried Linke in Breslau seinen ersten Auftrag für<br />
den Bau von 100 offenen Güterwagen. Das Werk wächst rasend<br />
schnell. 1912 wird die Linke KG mit der 1871 gegründeten<br />
„Breslauer <strong>AG</strong> für Eisenbahn-Wagenbau“ zur Linke-Hofmann-<br />
Werke <strong>AG</strong> vereinigt, 1928 Fusion mit der Waggon- und Maschinenfabrik<br />
<strong>AG</strong> vorm. Busch in Bautzen zur “Linke-Hofmann-<br />
Busch <strong>AG</strong>”. 1934 Neugründung der <strong>AG</strong> und Übernahme der<br />
Werke Breslau und Warmbrunn der Linke-Hofmann-Busch <strong>AG</strong>.<br />
Erzeugnisse: Güter- und Spezialwagen, Personen- und Straßenbahnwagen,<br />
Triebwagen, Schlaf-, Speise und Salonwagen, Omnibusaufbauten.<br />
1936 Beteiligung an der Gründung der Schlesische<br />
Flugzeug-Reparaturwerft GmbH durch Einbringung des<br />
Werkes Pöpelwitz (1938 abgestoßen). Danach verzweigte sich<br />
die Firmengeschichte: In dem Breslauer Werk nahm man nach<br />
dem 2. WK den Lokomotivbau wieder auf: die polnische Firma<br />
Fabryka Wagonów PAFAW<strong>AG</strong> lieferte fortan Fahrzeuge für die<br />
PKP. Dieses Werk in Wroclaw wurde 1997 von Adtranz, Berlin<br />
(ab 2000/01: Bombardier), übernommen. Gefertigt wurden hier<br />
jetzt u.a. die Lokomotivkästen für die Deutsche Bundesbahn.<br />
Doch auch in Westdeutschland ging die Firmengeschichte weiter:<br />
Die später zum Salzgitter-Konzern gehörende Linke-Hofmann-Werke<br />
<strong>AG</strong> wurde zunächst 1948 nach Düsseldorf verlagert<br />
und 1955 in eine GmbH umgewandelt. Auf einem 123 ha<br />
großen Areal in Salzgitter-Watenstedt (in direkter Nachbarschaft<br />
des Salzgitter-Stahlwerkes) entsteht ab 1950 eine der größten<br />
Produktionsstätten für Schienenfahrzeuge in Deutschland.<br />
1994/97 übernimmt der französische Konkurrent Alsthom die<br />
LHB-Geschäftsanteile. 1998 Umfirmierung der Linke-Hofmann-<br />
Busch GmbH in ALSTOM LHB GmbH.<br />
Los 988 Schätzwert 10-30 €<br />
LIPSIA Chemische Fabrik<br />
Mügeln, Bez. Leipzig, Aktie 100 RM<br />
1.10.1928 (Auflage 7190, R 2) EF<br />
G & D-Druck.<br />
Gründung 1898 zur Ausbeutung der in der Mügelnschen Gegend<br />
vorhandenen Kalklager zur Herstellung chemischer Produkte.<br />
In der DDR als VEB Chemische Fabrik Lipsia weitergeführt.<br />
Die <strong>AG</strong> selbst wurde nach dem Krieg nicht verlagert.<br />
Los 989 Schätzwert 30-75 €<br />
LIPSIA Chemische Fabrik <strong>AG</strong><br />
Mügeln, Bez. Leipzig, Aktie 1.000 RM<br />
Nov. 1943 (Auflage 700, R 4) UNC-EF<br />
Los 990 Schätzwert 125-200 €<br />
Löwenbrauerei -<br />
Böhmisches Brauhaus <strong>AG</strong><br />
Berlin, Aktie 300 RM März 1927 (Auflage<br />
500, R 6) EF<br />
Bei der Gründung 1870 wurde die A. Knoblauch’sche Lagerbier-<br />
Brauerei in der Landsberger Allee übernommen. Von den in der<br />
Gründerzeit in eine <strong>AG</strong> umgewandelten Berliner Brauereien war<br />
die „Böhmisches Brauhaus Commandit-Gesellschaft auf Actien<br />
A. Knoblauch“ eine der solideren. Auch nach dem Gründerkrach<br />
fiel der Kurs nicht unter den Nennwert und war damit der mit<br />
Abstand höchste aller Berliner Brauereien. 1910 Umfirmierung<br />
in “Böhmisches Brauhaus-<strong>AG</strong>”, 1922 Zusammenschluß mit der<br />
Löwenbrauerei <strong>AG</strong> in Berlin-Hohenschönhausen zur “Löwenbrauerei<br />
- Böhmisches Brauhaus <strong>AG</strong>”. 1927 Fusion mit der<br />
1867 gegründeten Bergschloßbrauerei <strong>AG</strong>, Berlin. 1954/55 Abschluß<br />
eines Organvertrages mit dem Hauptaktionär Schultheiss-Brauerei<br />
<strong>AG</strong> mit 5 % Garantie-Dividende für die freien<br />
Aktionäre. 1975 Verkauf der Betriebsgrundstücke Wissmannstraße/Hasenheide<br />
und Betriebsverlegung in die gepachtete<br />
Braustätte in der Bessemerstr. 84. 1979 auf die Dortmunder<br />
Union-Schultheiss-Brauerei <strong>AG</strong> verschmolzen.<br />
83
Los 991 Schätzwert 75-175 €<br />
Löwenwerke <strong>AG</strong><br />
Heilbronn, Aktie 1.000 RM Mai 1942<br />
(Auflage nur 100 Stück, R 6) EF-VF<br />
Gründung 1897 als “<strong>AG</strong> Bierbrauerei zum Löwen” nach Übernahme<br />
der Werksanlagen von Albert Neuffer vorm. Louis Hentges<br />
in Heilbronn. Neben einer Anzahl von Wirtschaftsanwesen<br />
wurden auch die Brauereien H. Jacob in Heilbronn und die<br />
Krebs’sche Brauerei in Kochendorf geführt. 1920 Firma umbenannt<br />
wie oben und Aufnahme der Produktion von Marmeladen,<br />
Konfitüren, Obst- und Gurkenkonserven und Fruchtsirupen,<br />
ferner Aufbau einer chemischen Abteilung zur Herstellung<br />
von kolloid-chemischen Erzeugnisse. 1957 auf die Allgemeine<br />
Wohnungsbau- und Verwaltungsges. mbH, Freiburg i.B. übergegangen.<br />
Los 992 Schätzwert 200-250 €<br />
Logierhaus-BERNER-<strong>AG</strong> (LOBE<strong>AG</strong>)<br />
Berlin, Aktie Reihe B 100 RM 3.3.1927<br />
(Auflage 200, R 9) Zwei Fehlstellen durch<br />
rostige Büroklammern fachgerecht<br />
restauriert. VF<br />
Nur 6 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1924 durch den Touristik-Pionier Conrad Berner.<br />
Zweck: Schaffung von Logiermöglichkeiten an stark besuchten<br />
Reiseplätzen im In- und Ausland, Veranstaltung von Gesellschafts-<br />
und Pauschalreisen. Die Ges. betrieb ein Reisebüro in<br />
Berlin-Charlottenburg (Kantstr. 135) sowie ein eigenes Logierhaus<br />
in Pörtschach am Wörthersee. Vertretungen in Ragusa<br />
(Dalmatien), Florenz, Rom, Neapel, Palermo, Cairo etc. Zwar<br />
ahnte Berners Konzept die Zukunft des von einem Anbieter organisierten<br />
Pauschalurlaubs sehr weise voraus. Aber nach dem<br />
2. Weltkrieg hatten die Deutschen zunächst andere Interessen<br />
als Reisen. Die <strong>AG</strong> wurde abgewickelt und 1969 gelöscht.<br />
Los 993 Schätzwert 40-80 €<br />
Losenhausenwerk<br />
Düsseldorfer Maschinenbau <strong>AG</strong><br />
Düsseldorf, Aktie 1.000 RM Nov. 1941<br />
(Auflage 1080, R 5) EF-<br />
Gegründet 1897 unter Übernahme der seit 1880 bestehenden<br />
Firma J. Losenhausen, Düsseldorf als Düsseldorfer Maschinenbau-<strong>AG</strong><br />
vorm. J. Losenhausen, 1926 umbenannt wie oben. Herstellung<br />
von Werkstoff- und Baustoff-Prüfmaschinen, Waggon-,<br />
Auto- und Fuhrwerkswaagen, Spezialwaagen. Die Abt. Kranbau<br />
wurde 1934 an die Schenck & Liebe-Harkort <strong>AG</strong> in Düsseldorf<br />
übertragen. Das Unternehmen Losenhausen erfand im Jahr<br />
1934 die erste Bodenverdichtungsmaschine (“Vibromax”).<br />
Los 994 Schätzwert 150-200 €<br />
Lothringer Brauerei <strong>AG</strong><br />
Devant-les-Ponts (Metz), Aktie Serie II.<br />
1.000 Mark 1.1.1890 (Auflage 400, R 8) EF<br />
Dekorative Umrandung im Historismus-Stil. Originalunterschriften.<br />
Gründung 1888, 1889 in Betrieb genommen. Ein jährlicher<br />
Ausstoß von 80.000 hl und einige rentable Wirtschaftsanwesen<br />
reichten in den meisten Jahren für eine sehr gute Dividende<br />
von 15 %.<br />
84<br />
Los 995 Schätzwert 275-350 €<br />
Lothringer Brauerei <strong>AG</strong><br />
Metz-Vorbrücken, Aktie 5.000 RM<br />
1.10.1942 (R 8) EF<br />
Los 996 Schätzwert 30-75 €<br />
Lozalit <strong>AG</strong> Fabrik<br />
Keramisch-Technischer Artikel<br />
Essen, Aktie 1.000 RM Nov. 1929<br />
(Auflage 500, R 4) EF<br />
Gründung 1928, Firmensitz 1929 bis 1932 in Essen, danach in<br />
Höhr-Grenzhausen. Firma ab 1936: Lozalit <strong>AG</strong>. Firmenzweck:<br />
Gewerbsmäßige Ausnutzung von chemischen und technischen<br />
Verfahren aller Art sowie Herstellung und Handel mit entsprechenden<br />
Erzeugnissen. Großaktionär (1943): Sassoon Banking<br />
Corp. London (ca. 49 %).<br />
Los 997 Schätzwert 30-80 €<br />
Ludwigshafener Walzmühle<br />
Ludwigshafen a. Rh., Aktie 1.000 RM Juli<br />
1942 (Auflage 3692, R 3) EF<br />
Gegründet 1894 mit Sitz in Mannheim unter Übernahme der<br />
Kunstmühle der Firma Kaufmann, Straus & Co. in Ludwigshafen<br />
(Weizen- und Roggenmühle, Hartgrieß- und Graupenfabrik).<br />
1905 durch Brand fast völlig zerstört, dann mit wesentlicher<br />
Kapazitätserweiterung als modernste Mühle wiederaufgebaut.<br />
1931 Sitzverlegung nach Ludwigshafen. 1945 bei<br />
Bombenangriffen erneut zerstört, Wiederaufbau 1951 abgeschlossen.<br />
1970 in eine GmbH umgewandelt. Bis dahin Börsennotiz<br />
Mannheim bzw. Frankfurt; neben der jahrzehntelang<br />
beteiligten Rhenania Schifffahrts- und Speditions-Ges. in<br />
Mannheim erscheint in den 30er Jahren die Südzucker als<br />
Mehrheitsaktionär, zuletzt besaß die Bremer Rolandmühle<br />
mehr als 25 %.<br />
Nr. 998<br />
Nr. 995<br />
Los 998 Schätzwert 50-100 €<br />
Lübecker Maschinenbau-Gesellschaft<br />
Lübeck, Aktie (Interimsschein) 1.000<br />
Mark 1.10.1918 (Auflage 3500, R 3) EF<br />
Kapitalerhöhung übernommen von O&K.<br />
Gründung 1873. Die Gesellschaft stellte Fluß-, See- und Trokkenbagger,<br />
Kohlenbagger, Taucherglocken, Dampf- und<br />
Schiffsmaschinen her. Börsennotiz Hamburg und Berlin. Ab<br />
1911 enge Interessengemeinschaft mit der Orenstein & Koppel<br />
<strong>AG</strong> in Berlin, 1948 Fusion. Heute eine der (nicht ganz sorgenfreien)<br />
Maschinen- und Anlagenbau-Töchter des Krupp-<br />
Hoesch-Konzerns.<br />
Los 999 Schätzwert 50-100 €<br />
Lüneburger Wachswerke <strong>AG</strong><br />
Lüneburg, Aktie 1.000 RM 1.6.1942 (R 5) EF<br />
Gründung 1882, <strong>AG</strong> seit 1897 unter der Firma Lüneburger<br />
Wachsbleiche J. Börstling <strong>AG</strong>, 1940 umbenannt wie oben. Betrieb<br />
einer Wachs-, Kerzen- und Bohnerwachsfabrik, Herstellung<br />
sonstiger chemisch-technischer Produkte.<br />
Los 1000 Schätzwert 300-400 €<br />
Luxsche Industriewerke <strong>AG</strong><br />
Ludwigshafen a. Rhein, Aktie 1.000 RM<br />
12.1.1927 (R 10) VF<br />
Dieser hohe Nennwert war zuvor völlig unbekannt.<br />
Nur 3 Stück wurden im Reichsbankschatz gefunden,<br />
dies ist jetzt das allerletzte noch verfügbare.<br />
Kleine Randschäden fachgerecht restauriert.<br />
Gegründet 1898 durch dem genialen Erfinder und Autokonstrukteur<br />
Friedrich Lux. Zweck der Ges. war zunächst die Fabrikation<br />
von Gegenständen für das Gas-, Wasser-, Elektrizitäts- und Heizungsfach,<br />
besonders von Wassermessern. Die Messgeräte für<br />
Gas gewannen wegen der damals eingeführten Gasstraßenbeleuchtung<br />
enorm an Bedeutung. Auf Initiative von Lux entstand<br />
übrigens auch der Stadtteil Ludwigshafen-Süd, um Bürgertum in<br />
der Arbeiterstadt anzusiedeln. In dem neuen Stadtteil ließ Lux eine<br />
Sternwarte bauen, um mittels der Astronomie “die wahre Bildung<br />
des Volkes in allen seinen Schichten” zu fördern. Bereits 1898<br />
baute Friedrich Lux auch Automobile mit Zweizylinder-Boxermotor.<br />
Es folgten einige Fahrzeuge unterschiedlicher Konstruktionen,<br />
auch mit Elektroantrieb. Der Lux-Tonneau hatte einen Zwei-Zylinder-Motor<br />
mit 9 PS, einen Vergaser für Leichtbenzin, einen Kühler<br />
(“der infolge seiner Anbringung in der Fahrbahnnähe gar zu oft<br />
dem endlich laufenden Wagen ein vorzeitiges Halten bereitete”,<br />
wie ein Zeitzeuge bemerkte) und Petrollampen zur Beleuchtung.<br />
Noch 1900 übernahm Lux zusätzlich die Motorfahrzeugfabrik Lud-<br />
Lux Tonneau" mit Zweizylinder-Kontra-Motor von 1900<br />
wigshafen a.Rh., doch schon 1902 wurde der Fahrzeugbau mangels<br />
aussichtsreicher Konzeption wieder eingestellt. Dazwischen<br />
lag 1901 das Ausscheiden von Friedrich Lux aus der Firma nach<br />
einem handfesten Krach mit seinem Aufsichtsrat (Lux wollte lieber<br />
weiter in den Automobilbau investieren, als eine Dividende an die<br />
Aktionäre verteilen). 1929 Liquidationsbeschluss (1943 Liquidation<br />
noch nicht abgeschlossen). Friedrich Lux verstarb 1930.<br />
Los 1001 Schätzwert 300-375 €<br />
M. Melliand Chemische Fabrik <strong>AG</strong><br />
Mannheim, Aktie 1.000 Mark Okt. 1923<br />
(Auflage 25000, R 12) VF<br />
Einzelstück aus dem Reichsbankschatz, nur ein<br />
einziges weiteres unentwertetes Stück ist bekannt.<br />
Leichter Rostfleck und Verfärbungen links.<br />
Gründung 1921. Herstellung chemischer Produkte insbesondere<br />
für die Textilindustrie. Ab 1923 gab die Firma für ihre Kunden<br />
die sehr aufwändig produzierten “Melliands Textilberichte”<br />
heraus. 1925 Beschluß der Auflösung und Liquidation.<br />
Los 1002 Schätzwert 20-50 €<br />
MAB<strong>AG</strong> Maschinen-<br />
und Apparatebau-<strong>AG</strong><br />
Nordhausen, Aktie 1.000 RM Sept. 1940<br />
(Auflage 1000, R 5) EF<br />
Gründung 1923. Fabrikation von Tank-, Ölförderanlagen, Tankwagenaufbauten,<br />
Behälter und Apparate für die chemische Industrie,<br />
stufenlose Getriebe. Großaktionär: Thyssen-Bornemisza.<br />
Pachtung der Maschinenfabriken der Gebhardt & König<br />
Deutsche Schachtbau <strong>AG</strong>, 1940 Erwerb der Grundstücke und<br />
Gebäude der früheren Deutsche Schachtbau <strong>AG</strong>. Nach dem 2.<br />
Weltkrieg Weiterführung als Nordhäuser Gemeinschaftswerk<br />
Maschinen- und Apparatebau GmbH. Spezialisierung auf Tankanlagen<br />
für Öl, Gasöl, Benzin. Die Mutter VEB Schachtbau<br />
Nordhausen wird 1990 von der Treuhandanstalt Berlin übernommen.<br />
1992 Privatisierung durch Bauer Spezialtiefbau<br />
GmbH, Schrobenhausen.<br />
Nr. 1007
Los 1003 Schätzwert 20-50 €<br />
Mädler’sche<br />
Grundstücks-Verwertungs- <strong>AG</strong><br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark Jan. 1923.<br />
Gründeraktie (Auflage 1500, R 3) EF<br />
Gründung 1923. Erwerb und Verwertung der Nachlassgrundstücke<br />
des verstorbenen Rentiers Ferdinand Mädler (Sitz in<br />
Berlin-Friedenau, Elsastr. 4).<br />
Los 1004 Schätzwert 30-75 €<br />
Mälzerei Wrede <strong>AG</strong><br />
Köthen in Anhalt, Aktie 500 RM Jan. 1939<br />
(Auflage 3000, R 3) UNC-EF<br />
Gründung 1865, <strong>AG</strong> seit 1889. Malzfabriken in Köthen,<br />
Oschersleben (vorm. Malzfabrik Heinrich Bormann, 1924 erworben),<br />
Giersleben (seit 1932 stillgelegt, Vorbesitzer war die<br />
Schlegel-Scharpenseel-Brauerei <strong>AG</strong> in Bochum) und Wegeleben<br />
im Ostharz (1937 Übernahme der Malzfabrik Wegeleben<br />
GmbH). Ferner mehrheitlich beteiligt bei der Malzfabrik Rheinpfalz<br />
<strong>AG</strong> in Pfungstadt (Hessen) mit Werken in Bruchsal (vorm.<br />
Moritz & Söhne) und Kirchheim/Teck (vorm. Gebr. Hammel).<br />
Börsennotiz Berlin. Nach Enteignung der vier Werke in der Ostzone<br />
beschränkte sich die Tätigkeit auf die Verwaltung der<br />
Rheinpfalz-Beteiligung, der Sitz der <strong>AG</strong> wurde nach Hamburg<br />
(1951) bzw. Frankfurt/Main (1952) verlegt. Ab 1966 GmbH.<br />
Los 1005 Schätzwert 30-60 €<br />
Märkische Ziegelindustrie <strong>AG</strong><br />
Berlin, Aktie 1.000 RM 3.10.1930<br />
(Auflage 1000, R 4) UNC-EF<br />
1935 auf 800 RM herabgesetzt.<br />
Gegründet 1930 zum Betrieb von Ziegeleien in der Mark Brandenburg.<br />
Übernommen wurde die Ziegelei Schultze & Hübner<br />
GmbH sowie von der Brandenburgischen Bauindustrie <strong>AG</strong> deren<br />
Ziegelei in Päwesin bei Brandenburg a.H. Haupterzeugnisse:<br />
Hintermauerungssteine, Hohlsteine. 1947 verlagert nach<br />
Berlin (West) und Umwandlung in eine GmbH.<br />
Los 1006 Schätzwert 30-75 €<br />
Märkisches Elektricitätswerk <strong>AG</strong><br />
Berlin, Namensaktie 6.000 RM Jan. 1925<br />
(Auflage 4300, R 4) EF<br />
Gründung 1900 durch die A.E.G. als erstes Überlandwerk in<br />
der Provinz Brandenburg, wo es etwa 100 örtliche Elektrizitäts-<br />
werke gab. In Finow bei Eberswalde wurde am Hohenzollernkanal<br />
nach Plänen von Prof. Klingenberg ein Steinkohlen-Kraftwerk<br />
errichtet. 1916 erwarb die Provinz Brandenburg die Aktienmehrheit.<br />
1931 brachte der Freistaat Mecklenburg-Schwerin<br />
seine Landeselektrizitätswerke ein. 1934 schließlich wurde<br />
die Ueberlandzentrale Pommern eingegliedert. Damit versorgte<br />
das MEW 6.412 Städte und Gemeinden in ganz Brandenburg,<br />
Mecklenburg und Pommern sowie den Kreis Lüneburg rechts<br />
der Elbe.<br />
Los 1007 Schätzwert 275-350 €<br />
M<strong>AG</strong> Maschinenfabrik <strong>AG</strong> Geislingen<br />
Heidelberg, Aktie 20 RM 2.2.1925<br />
(Auflage 5760, R 10) VF-F<br />
Nur 3 Stück lagen im Reichsbankschatz. Stockfleckig.<br />
Gegründet 1883 nach Übernahme der Industrie-Gesellschaft<br />
Geislingen (gegründet 1850 durch Daniel Straub). Bis 1913 firmierte<br />
die Gesellschaft als Maschinenfabrik Geislingen. Sitz der<br />
Gesellschaft bis zum 2.2.1925 in Geislingen. Maschinenfabrikation.<br />
Hergestellt wurden u.a. Wasserturbinen, Universalmühlen,<br />
Steinschrotmühlen und Tafelwagen. Der kaufmännische<br />
Betrieb wurde nach Heidelberg verlegt, da die Fabrikation des<br />
Unternehmens fortan in Anlehnung an die Schnellpressenfabrik<br />
Heidelberg (heute “Heidelberger Druckmaschinen <strong>AG</strong>”) geschah.<br />
1929 Übernahme durch die Schnellpressenfabrik Heidelberg<br />
im Wege der Verschmelzung (Aktientausch 1:1). Nach<br />
dem Kriege fortgesetzter grosszügiger Ausbau der Werksanlagen<br />
in Geislingen.<br />
Los 1008 Schätzwert 50-100 €<br />
Magdeburger Allgemeine Lebensund<br />
Rentenversicherungs-<strong>AG</strong><br />
Magdeburg, Namensaktie 1.000 RM<br />
19.11.1928 (Auflage 2700, R 4) EF<br />
Gründung 1923 durch die Magdeburger Feuerversicherung als<br />
“Magdeburger Allgemeine Versicherungs-<strong>AG</strong>”, 1928 umbenannt<br />
wie oben. Bei der Gründung wurde wohl sehr gezielt der<br />
alte Name einer schon 1872 gegründeten gleichnamigen Gesellschaft<br />
wieder verwendet, die 1890 in “Wilhelma in Magdeburg”<br />
Allgemeine Versicherungs-<strong>AG</strong> umfirmiert hatte und seit<br />
1923, eben dem Jahr dieser plagiatorischen Neugründung, zur<br />
Allianz Versicherungs-<strong>AG</strong> gehörte. 1932 fusionsweise Übernahme<br />
der Hovad Lebensversicherungsbank <strong>AG</strong>. 1946 nach<br />
Schließung des Geschäftsbetriebs durch die russische Besatzungsmacht<br />
Sitzverlegung nach Frankfurt (Main). 1959 Sitzverlegung<br />
von Fulda nach Hannover, wohin auch alle anderen<br />
Unternehmen der sog. Magdeburger Versicherungsgruppe gingen,<br />
die dann zum Konzern der Schweizer Rück gehörte.<br />
1985/88 Umfirmierung in Magdeburger Lebensversicherung<br />
<strong>AG</strong>. 1993 nach Übernahme der Magdeburger Versicherungsgruppe<br />
durch die Allianz-Versicherung auf die Vereinte Lebensversicherung<br />
<strong>AG</strong> in München verschmolzen, diese jetzt auf<br />
die Allianz Lebensversicherungs-<strong>AG</strong> in Stuttgart.<br />
Los 1009 Schätzwert 75-120 €<br />
Magdeburger Bank <strong>AG</strong><br />
Magdeburg, Aktie 1.000 Mark März 1923<br />
(Auflage 200000, R 7) EF<br />
Gründung 1922 unter Übernahme der seit 1880 bestehenden<br />
Magdeburger Creditbank (geschäftsansässig Otto v. Guerikkestr.<br />
100). Nach der Inflation war die Kapitaldecke so dünn<br />
(Kapitalumstellung 400:1), daß die Bank eine Anlehnung an einen<br />
größeren Konzern oder eine Fusion anstrebte. Nachdem<br />
entsprechende Verhandlungen ergebnislos verlaufen waren,<br />
trat die <strong>AG</strong> 1925 in Liquidation.<br />
Los 1010 Schätzwert 10-30 €<br />
Magdeburger Bau- und Credit-Bank<br />
Magdeburg, Genußrechtsurkunde 100 RM<br />
1.2.1926 (R 5) EF-<br />
Gegründet im Dez. 1871. Zweck war Kauf und Verkauf, Parcellirung<br />
und Bebauung von Grundstücken. Die Gesellschaft be-<br />
saß eine Thonwaaren-Fabrik in Magdeburg, eine Ziegelei bei<br />
Schönebeck und einen Bauhof in Neustadt-Magdeburg. Spezialität<br />
war die Erbauung von Beamten- und Arbeiter-Wohnungen<br />
für industrielle Großkunden. Die Ges. befand sich nach<br />
Aufhebung des Konkursverfahrens 1933 in Liquidation. 1937<br />
wurde erneut ein Konkursverfahren eröffnet.<br />
Los 1011 Schätzwert 20-75 €<br />
Magdeburger Strassen-<br />
Eisenbahn-Gesellschaft<br />
Magdeburg, Actie Serie B 1.000 Mark<br />
1.10.1898 (Auflage 3600, R 2) EF-VF<br />
Stadtwappen im Unterdruck, Umrahmung im Historismusstil.<br />
Gründung 1876 als Pferdebahn, seit 1886 Dampfbetrieb. 1899<br />
Einführung des elektrischen Betriebes, nachdem im Jahr zuvor<br />
noch das Konkurrenzunternehmen “Magdeburger Trambahn<br />
<strong>AG</strong>” übernommen worden war. Streckenlänge zeitweise über<br />
100 km. In den 1920-er Jahren besaß die Fa. 172 Motorwagen<br />
und 152 Anhängewangen. 1936 waren außerdem 15 Omnibusse<br />
in Betrieb. Börsennotiz Berlin und Magdeburg. 1951 als<br />
VEB Magdeburger Verkehrsbetriebe in Volkseigentum überführt,<br />
nach der Wende 1991 wieder in eine <strong>AG</strong> umgewandelt, 1999 in<br />
die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH umgewandelt.<br />
Los 1012 Schätzwert 25-100 €<br />
Magdeburger Strassen-<br />
Eisenbahn-Gesellschaft<br />
Magdeburg, Actie Serie B 1.000 Mark<br />
1.1.1900 (Auflage 1200, R 3) EF+<br />
Identische Gestaltung wie voriges Los.<br />
Los 1013 Schätzwert 10-40 €<br />
Magdeburger Strassen-<br />
Eisenbahn-Gesellschaft<br />
Magdeburg, Aktie Ser. B 1.000 Mark<br />
13.9.1920 (Auflage 3000, R 2) UNC-EF<br />
Ebenfalls identisch gestaltet.<br />
Los 1014 Schätzwert 40-100 €<br />
Magdeburger Strassen-<br />
Eisenbahn-Gesellschaft<br />
Magdeburg, Aktie Ser. A 500 RM<br />
23.5.1928 (Auflage 1200, R 3). Ein Teil<br />
der 1898er Kapitalerhöhung finanzierte die<br />
Übernahme des Konkurrenz-Unternehmens<br />
„Magdeburger Trambahn <strong>AG</strong>“ UNC<br />
Jetzt völlig neue Gestaltung.<br />
Los 1015 Schätzwert 10-40 €<br />
Main-Kraftwerke <strong>AG</strong><br />
Frankfurt a.M.-Hoechst, 4,5 %<br />
Teilschuldv. 1.000 RM Aug. 1938 (Auflage<br />
5400, R 4) EF<br />
Gründung 1911. Hauptgründer waren die „Felten und Guilleaume-Lahmeyerwerke<br />
<strong>AG</strong>“, Köln und die „Elektrizitäts-<strong>AG</strong><br />
vorm. W. Lahmeyer & Co.“, Frankfurt nach dem bewährten Muster,<br />
dass durch Gründung von Kraftwerksbetrieben die eigenen<br />
elektrotechnischen Erzeugnisse mehr Absatz fanden. Später<br />
kam (der noch heutige) Großaktionär RWE dazu. Die Gesellschaft<br />
belieferte in der sehr industriereichen Umgebung Frankfurts<br />
fast 400 Gemeinden mit über 300.000 Einwohnern mit<br />
Energie. Börsennotiz Frankfurt.<br />
Los 1016 Schätzwert 50-125 €<br />
Mainzer Aktien-Bierbrauerei<br />
Mainz, 5 % Teilschuldv. 200 RM April<br />
1938 (Auflage 590, R 5) EF<br />
Originalunterschriften.<br />
Gründung 1859 als “Brey’sche Actien-Bierbrauerei”, 1872<br />
Umfirmierung wie oben. 1917/18 Erwerb der Brauereien Jean<br />
Rühl in Worms, Taunusbrauerei Biebrich, Ferd. Nachbauer in<br />
Kastel, Gebr. Becker in Gonsenheim und Fr. Kurz in Weilburg.<br />
1968 erwarb die Frankfurter Binding-Brauerei (Oetker-Konzern)<br />
die Aktienmehrheit und pachtete 1972 den Betrieb. Im<br />
gleichen Jahr, auf Betreiben des Großaktionärs, Fusion mit der<br />
Brauerei Schrempp <strong>AG</strong> in Karlsruhe, der Aktienbrauerei Eisenach<br />
in Bad Hersfeld, der Brauerei Heinrich Fels GmbH in<br />
Karlsruhe und der Hofbrauhaus Nicolay <strong>AG</strong> in Hanau. Seitdem<br />
eine reine Grundstücksverwaltung mit Mehrheitsbeteiligungen<br />
an der Allgäuer Brauhaus <strong>AG</strong> in Kempten, der Bayerische Brauerei<br />
Schuck-Jaenisch GmbH in Kaiserslautern, der Erbacher<br />
Brauhaus Jakob Wörner & Söhne KG in Erbach und der Selters<br />
Mineralquelle Augusta Victoria GmbH in Löhnberg.<br />
Los 1017 Schätzwert 75-120 €<br />
Malzfabrik Mellrichstadt<br />
Mellrichstadt, Aktie 100 RM 4.6.1928<br />
(Auflage mit “Gültig”-Überdruck noch 110<br />
Stück, R 8) EF-VF<br />
Nur 14 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1884. Kleine Fabrik mit selten mehr als 50 Mitarbeitern,<br />
erzeugt wurden Braumalze (Pilsener-, Wiener- und<br />
Münchener Darrung), außerdem Handel mit Malz, Getreide,<br />
Nahrungs-, Futter- und Düngemitteln. Bis 1934 in Dresden<br />
börsennotiert. 1935 übernahm die Malzfabrik Meußdoerffer KG<br />
in Kulmbach 80 % des Aktienkapitals. 1945 Beschlagnahme<br />
der Fabrik zur Unterbringung von Flüchtlingen. 1948 wurde der<br />
Betrieb teilweise wieder freigegeben und das seit 1946 bestehende<br />
Mälzungsverbot aufgehoben. Schon 1951 arbeitete die<br />
Malzfabrik wieder mit voller Kapazität. 1961 in eine GmbH umgewandelt.<br />
85
Los 1018 Schätzwert 50-120 €<br />
Malzfabriken J. Eisenberg<br />
& Etgersleben <strong>AG</strong><br />
Erfurt, Aktie 1.000 Mark 31.8.1922<br />
(Auflage 500, R 5) EF<br />
Großformatiges Papier, sehr dekorativ gestaltet.<br />
Gründung 1898 als Malzfabrik Etgersleben <strong>AG</strong>. 1914 Übernahme<br />
der Malzfabrik Blanke & Schmidt in Magdeburg-Buckau.<br />
Seit 1916 auch Gemüsetrocknung. 1917/18 Übernahme der<br />
Malzfabriken J. Eisenberg in Erfurt und Umfirmierung in Malzfabriken<br />
J. Eisenberg & Etgersleben <strong>AG</strong>. 1941 erneute Umfirmierung<br />
in Vereinigte Malzfabriken Erfurt & Etgersleben <strong>AG</strong>.<br />
Börsennotiz: Freiverkehr Leipzig.<br />
Los 1019 Schätzwert 50-100 €<br />
Manganerzwerke <strong>AG</strong><br />
Hamburg, Aktie 1.000 Mark Jan. 1922<br />
(Auflage 6000, R 6) EF<br />
Gegr. 1921 in Hamburg zum Betrieb und Erwerb von Bergwerken,<br />
insbesondere von Manganbergwerken. Ab Sept. 1924 Sitz<br />
in Berlin-Schlachtensee. Im Okt. 1924 Beschluß der Liquidation.<br />
Los 1020 Schätzwert 150-200 €<br />
Manganerzwerke <strong>AG</strong><br />
Hamburg, Sammelaktie 10 x 1.000 Mark<br />
Okt. 1923 (R 8) EF<br />
Los 1021 Schätzwert 75-125 €<br />
Mannheimer Gummifabrik <strong>AG</strong><br />
Mannheim, Aktie 100 RM Aug. 1931 (R 7)<br />
EF<br />
Traditionsreiche Firma, gegründet bereits 1864 als “Mannheimer<br />
Gummi-, Guttapercha- und Asbest-Fabrik <strong>AG</strong>”. Geschäftsansässig<br />
Schwetzinger Str. 117, in Mannheim börsennotiert.<br />
Auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise 1930 durch Forderungsausfälle<br />
und die Krisis auf dem Rohgummimarkt in<br />
Schwierigkeiten geraten, anschließend Vergleichsverfahren mit<br />
Kapitalherabsetzung, außerdem wurde die Asbestfabrik an die<br />
Deutsche Asbestwerke <strong>AG</strong> verkauft. Am 26.9.1932 trat die Belegschaft<br />
in einen unbefristeten Streik. Weil die Ges. deswegen<br />
große Aufträge nicht erfüllen konnte, musste sie einen Monat<br />
später ihre Zahlungen erneut einstellen und wurde im Aug.<br />
1933 aufgelöst.<br />
86<br />
Los 1022 Schätzwert 175-300 €<br />
Mannheimer Milchzentrale <strong>AG</strong><br />
Mannheim, Namensaktie 200 Mark Mai<br />
1914. Gründeraktie (Auflage 150, R 6) EF<br />
Großformatiges Papier mit schöner Umrandung im<br />
Historismus-Stil. Ausgestellt auf die Stadtgemeinde<br />
Mannheim, 1915 übertragen auf den Badischen<br />
Frauenverein.<br />
Gründung 1911, <strong>AG</strong> seit 1914. Das Unternehmen bestand<br />
noch 1961. Später aufgegangen in der Milchzentrale Nordbaden,<br />
Sitz Weinheim. Gehört jetzt zum Danone-Konzern.<br />
Los 1023 Schätzwert 500-625 €<br />
Mannheimer Versicherungsgesellschaft<br />
Mannheim, Aktie 500 RM Aug. 1934<br />
(Auflage 600, R 12), ausgestellt auf Frau<br />
Nanda Vögele, Mannheim VF<br />
Großes Firmenlogo (geflügelter und gekrönter Löwenadler<br />
mit Wappenschild) im Unterdruck. Unikat<br />
aus dem Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1879 mit einem Grundkapital von 2 Mio. M. Gegenstand<br />
ist der unmittelbare<br />
Betrieb aller Versicherungszweige<br />
mit<br />
Ausnahme der Lebensversicherung,<br />
ferner der<br />
Betrieb der <strong>Rückvers</strong>icherung<br />
in allen Zweigen.<br />
1991 Gründung<br />
der Mannheimer Krankenversicherung<br />
<strong>AG</strong>.<br />
1998 neue Konzernstruktur:<br />
Mannheimer<br />
<strong>AG</strong> Holding als Obergesellschaft,<br />
bisherige Mannheimer Versicherung <strong>AG</strong> wird als<br />
Tochter der Holding als Schaden- und Unfallversicherer neu<br />
gegründet.<br />
Los 1024 Schätzwert 50-100 €<br />
Mannheimer Versicherungsgesellschaft<br />
Mannheim, Namens-Aktie 1.000 RM Aug.<br />
1934 (Auflage 3700, R 4), ausgestellt auf<br />
Generaldirektor Dr. Karl Weiß, Mannheim.<br />
UNC-EF<br />
Großes Firmenlogo (geflügelter und gekrönter Löwenadler<br />
mit Wappenschild) im Unterdruck.<br />
Los 1025 Schätzwert 100-125 €<br />
Mansfeld <strong>AG</strong> für Bergbau<br />
und Hüttenbetrieb (3 Stücke)<br />
Eisleben, 4 % Genußrechtsurkunde 200<br />
RM, 4,5 % 500 RM, 4 % 500 RM April<br />
1926 (alles Blanketten) Jeweils mit kpl.<br />
anh. Kupons. EF<br />
Die 1921 gegründete <strong>AG</strong> ging durch Umwandlung aus der<br />
“Mansfeldschen Kupferschiefer bauenden <strong>Gewerkschaft</strong>” hervor.<br />
Die ersten Anfänge des Mansfelder Bergbau reichen bis 1199<br />
zurück. Ursprünglich Besitz der Grafen von Mansfeld, gelangte<br />
der Bergbau nach dem 30-jährigen Krieg in die Hände verschiedener<br />
<strong>Gewerkschaft</strong>en, die sich 1851 zu einem Unternehmen<br />
zusammenschlossen. Neben den 1933 ausgegliederten Bergund<br />
Hüttenwerken wurden betrieben: Die Kupfer- und Messingwerke<br />
Hettstedt, die Hallesche Pfännerschaft (Salzsiederei) und<br />
die Saline Halle, Braunkohlenbergwerke bei Senftenberg und<br />
Merseburg, die Steinkohlenzeche Mansfeld in Bochum-Langendreer,<br />
die Steinkohlenzeche der <strong>Gewerkschaft</strong> Sachsen in Heessen<br />
bei Hamm sowie die Glashütten Senftenberg und Groß-Räschen.<br />
Großaktionäre waren zuletzt die Fa. Otto Wolff und die<br />
Stadt Leipzig. 1948 verlagert nach Hannover, 1967 in eine<br />
GmbH umgewandelt. Sitz der Verwaltung in Bad Salzdetfurth. Die<br />
Betriebsstätten in der DDR waren noch bis zur Wende ein Riesen-Kombinat<br />
mit mehreren zehntausend Beschäftigten.<br />
Los 1026 Schätzwert 30-80 €<br />
Marathon-Werke <strong>AG</strong><br />
Chemnitz, Aktie 1.000 RM 21.4.1941<br />
(Auflage 400, R 4) EF+<br />
Gründung am 11.11.1872 als Deutsche Werkzeugmaschinen-<br />
Fabrik vorm. Sondermann & Stier <strong>AG</strong>, am 26.10.1912 geändert<br />
in Sondermann & Stier <strong>AG</strong>, ab 9.3.1938 Marathon-Werke<br />
<strong>AG</strong>. Herstellung von Werkzeugmaschinen, insbesondere von<br />
Präzisions-Drehbänken. 1929 wurde die Abt. Werkzeugmaschinen<br />
den Deutschen Niles-Werken, Berlin-Weißensee, angegliedert.<br />
Im gleichen Jahr wurde die Abt. Textilmaschinen<br />
von der Schubert & Salzer Maschinenfabrik <strong>AG</strong>, Chemnitz,<br />
übernommen. Ab 1936/37 Wiederaufnahme der Produktion.<br />
Los 1027 Schätzwert 25-100 €<br />
Marienberger Mosaikplattenfabrik <strong>AG</strong><br />
Marienberg, Aktie 1.000 Mark<br />
24.10.1922 (Auflage 750, R 5) EF<br />
Umgestellt auf 200 Goldmark.<br />
1890 gegründet, 1907 in eine <strong>AG</strong> umgewandelt, Börsennotiz<br />
Dresden (später Leipzig). Im Werk Marienberg in Sachsen wur-<br />
Nr. 1023 Nr. 1035<br />
den Steinzeugplatten hergestellt. 1920 kaufte man in Broitzem<br />
bei Braunschweig die seit 1917 stillgelegte Wandfliesenfabrik<br />
Bautler & Co. und produzierte dort fortan glasierte Wandplatten<br />
aller Art. 1934 wurde auch der Firmensitz nach Broitzem verlegt.<br />
Das Werk Marienberg wurde 1946 vollständig demontiert,<br />
deshalb wurde in Broitzem 1955 eine neue Bodenfliesenfabrik<br />
errichtet. Die Firma war zu der Zeit der größte Arbeitgeber im<br />
Landkreis Braunschweig, zahlte kontinuierlich Dividenden von<br />
10 % und besaß bei Wandfliesen in der Bundesrepublik einen<br />
Marktanteil von 14 %. Billigimporte aus Italien und aus der<br />
DDR brachten die Firma in den 60er Jahren in Bedrängnis.<br />
Dem Preisdruck begegnete man fälschlicherweise mit Absenken<br />
der Qualität, der Probelauf einer Anfang 1966 montierten<br />
Fließband-Fertigungsanlage endete als Fiasko, die Banken<br />
drehten schließlich den Geldhahn zu: Am 3.10.1966 Anschlusskonkurs.<br />
Los 1028 Schätzwert 30-75 €<br />
Markiewicz <strong>AG</strong> für Möbel<br />
und Wohnungseinrichtungen<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark Dez. 1921.<br />
Gründeraktie (Auflage 5000, R 4) Anh.<br />
Kupons. EF<br />
Gründung 1921. Herstellung, Vertrieb und Vermietung von Möbeln<br />
und Wohnungseinrichtungen. 1932 aufgelöst.<br />
Los 1029 Schätzwert 75-100 €<br />
Martins & Bloch <strong>AG</strong><br />
Hamburg, Aktie 1.000 Mark Febr. 1922<br />
(Auflage 10000, R 9) VF+<br />
Großes Hochformat, Umrahmung mit Jugendstil-<br />
Elementen. Nur 2 Stück lagen im Reichsbankschatz.
Gründung 1920. Betrieb von Spinnereien und Webereien für Segeltuche,<br />
Jutegewebe, Säcke, Planen und Wolldecken. 1922 Angliederung<br />
der Niedersächsischen Kunstweberei <strong>AG</strong> im Wege der<br />
Fusion. 1923 Fusion mit der Winsener Spinnerei und Weberei<br />
einschließlich des Elektrizitätswerkes, welches die Stadt Winsen<br />
mit Strom versorgte. Im Herbst 1925 in Konkurs gegangen.<br />
Los 1030 Schätzwert 30-60 €<br />
Martins & Bloch <strong>AG</strong><br />
Hamburg, Aktie 20 RM Jan. 1925<br />
(Auflage 12500, R 7) EF<br />
Los 1031 Schätzwert 20-50 €<br />
Maschinen- und Armaturenfabrik<br />
vorm. C. Louis Strube <strong>AG</strong><br />
Magdeburg-Buckau, Namensaktie 1.000<br />
RM 23.9.1937 (Auflage 400, R 4) EF<br />
1942 umgestempelt auf 2.000 RM.<br />
Gründung 1865, <strong>AG</strong> ab 1889. Fabrikation und Handel mit Maschinen,<br />
Armaturen, Pumpen, Metallwaren und allen anderen<br />
verwandten Artikeln. Das Aktienkapital war in Familienbesitz.<br />
1946 in die Industrie-Werke Sachsen-Anhalt, Maschinen- und<br />
Armaturenfabrik vormals C.L.S. Magdeburg-Buckau überführt,<br />
ab 1948 unter “SANAR” Werk Strube-VEB, Mageburg-Buckau.<br />
Los 1032 Schätzwert 10-50 €<br />
Maschinenbau-<strong>AG</strong> Balcke<br />
Bochum, Aktie 1.000 RM Mai 1941<br />
(Auflage 1400, R 2) UNC<br />
Die Balcke & Co., Bochum (gegr. 1894) und die Bettinger &<br />
Balcke GmbH, Frankenthal (gegr. 1898) fusionierten 1905 zur<br />
Maschinenbau-<strong>AG</strong> Balcke, Bochum. 1918 Übernahme der<br />
Westfälische Maschinenbau-Industrie Gustav Moll & Co. <strong>AG</strong>,<br />
Neubeckum. Die Werke Bochum und Neubeckum produzierten<br />
für die Kraft- und Wärmewirtschaft Wasserrückkühlanlagen,<br />
Kühltürme, Wärmetauscher, Wasseraufbereitungsanlagen, Heizungsanlagen,<br />
Gas- und Ölfeuerungen. Das Werk Frankenthal<br />
war auf Pumpen spezialisiert. Börsennotiz Düsseldorf und Berlin,<br />
größter Einzelaktionär war die <strong>Westfalen</strong>bank <strong>AG</strong>. 1972 Fusion<br />
mit der Dürrwerke <strong>AG</strong> (gegr. 1883 als Düsseldorf-Ratinger<br />
Röhrenkesselfabrik Dürr & Co., <strong>AG</strong> seit 1889) zur Balcke-Dürr<br />
<strong>AG</strong> mit Babcock-Borsig als Großaktionär. 2001 mit der Muttergesellschaft<br />
zur Babcock Borsig <strong>AG</strong> (neu) fusioniert, 2002 eine<br />
der spektakulärsten Pleiten des Jahrzehnts.<br />
Los 1033 Schätzwert 20-60 €<br />
Maschinenbau-<strong>AG</strong> Golzern-Grimma<br />
Grimma, Aktie 1.000 RM Juni 1938<br />
(Auflage 820, R 4) UNC-EF<br />
Gründung 1847 als Gottschald & Nötzli <strong>AG</strong>, ab 1872 Maschinenbauanstalt<br />
Golzern vorm. Gottschald & Nötzli, seit 1899<br />
Name wie oben. Herstellung von Maschinen für die chemische<br />
Industrie, Spiritusbrennereien, Raffinerien, Preßhefe-, Öl-, Papier-,<br />
Pappen-, Pulver- und Sprengstoffabriken. Ab 1948 NA-<br />
GEMA Maschinen- und Apparatebau Golzern-Grimma, unterstellt<br />
der VVB N<strong>AG</strong>EMA, Dresden.<br />
Los 1034 Schätzwert 30-75 €<br />
Maschinenbau-<strong>AG</strong><br />
vormals Ehrhardt & Sehmer<br />
Saarbrücken, Aktie 1.000 RM Jan. 1938<br />
(Auflage 830, R 3) EF<br />
1928 wurde die Maschinenbau-<strong>AG</strong> vormals Ehrhardt & Sehner<br />
gegründet nach Übernahme der Anlagen und Gebäude, nicht<br />
aber der Verbindlichkeiten der Firma Maschinenfabrik Ehrhardt<br />
& Sehmer <strong>AG</strong> (gegr. 1876). Herstellung von Groß-Gasmaschinen,<br />
Hochofen- und Stahlwerksgebläsen, Kolben- und Kreiselpumpen,<br />
Dampfmaschinen, Warm- und Kaltwalzwerken,<br />
Blechbearbeitungsmaschinen. Nach schweren Kriegsschäden<br />
Wiederaufbau und mindestens bis 1972, zuletzt als GmbH, bestehend.<br />
Los 1035 Schätzwert 1000-1250 €<br />
Maschinenbau-<strong>AG</strong><br />
vormals Starke & Hoffmann<br />
Hirschberg i. Schlesien, Aktie 1.000 Mark<br />
11.4.1895. Gründeraktie (Auflage 1000,<br />
R 9) VF-F<br />
Phantastisch gestaltet mit ganzflächigen Abbildungen<br />
der Fabrik, Schmied mit Werkzeug, Putti,<br />
Eule, Eichenlaub. Nur 3 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Randschäden und eine 4,5 x 3 cm<br />
große Fehlstelle am oberen Rand fachgerecht restauriert.<br />
Gründung 1895 zur Übernahme der Maschinenfabrik und Brükkenbauanstalt<br />
von Starke & Hoffmann. Bau von Dampfmaschinen,<br />
Turbinen, Dampfkesseln, eisernen Brücken, kompletten Anlagen<br />
von Holzschleifereien und Apparaten für die Papierfabrikation,<br />
Eisenkonstruktionen und Eisenguss. Seit Anfang der 20er<br />
Jahre wurden außerdem Dieselmotoren produziert. Ab 1925 Arbeitsgemeinschaft<br />
mit der <strong>AG</strong> für Eisengießerei und Maschinenfabrikation<br />
vorm. J. C. Freund & Co. in Berlin und Zusammenfassung<br />
der Leitung in der Freund-Starkehoffmann-Maschinen <strong>AG</strong>,<br />
wobei sämtliche Aufträge weiter in den Werkstätten in Hirschberg<br />
ausgeführt wurden. Börsennotiz Berlin. 1936 Konkurs.<br />
Los 1036 Schätzwert 30-80 €<br />
Maschinenbau-<strong>AG</strong><br />
vormals Starke & Hoffmann<br />
Hirschberg i. Schlesien, Aktie 1.000 Mark<br />
27.12.1920 (Auflage 2000, R 4) EF-VF<br />
Großes Querformat, schöne Zierumrahmung.<br />
Los 1037 Schätzwert 30-60 €<br />
Maschinenfabrik Badenia<br />
vorm. Wm. Platz Söhne <strong>AG</strong><br />
Weinheim (Baden), Aktie 20 RM Jan.<br />
1925 (Auflage 120000, R 7) EF<br />
Gründung 1834 durch Wilhelm Platz als Fabrik für Feuerspritzen,<br />
um 1880 begann der Lokomobilbau, <strong>AG</strong> seit 1890. Mit<br />
zeitweise über 2000 Mitarbeitern wurden auf dem riesigen<br />
Werksgelände Stahlbadstraße/Suezkanal/Käsacherweg in<br />
Weinheim Lokomobile, Dampfdreschmaschinen und landwirtschaftliche<br />
Maschinen hergestellt. 1912 begann aufgrund eines<br />
Lizenzabkommens mit Junkers der Bau von stationären<br />
200-PS-Tandemmotoren. 1923 Übernahme der Kosto-Werke<br />
<strong>AG</strong> in Schwerin (vormals Fokker-Flugzeugwerke). 1926 Abschluß<br />
eines Produktionsaufteilungs-Abkommens mit der<br />
Heinrich Lanz <strong>AG</strong> in Mannheim. 1929 wurde die in Frankfurt<br />
und Mannheim börsennotierte <strong>AG</strong> ein Opfer der Weltwirtschaftskrise<br />
und trat in Liquidation. Den Betrieb führte eine<br />
gleichnamige GmbH als Auffanggesellschaft fort.<br />
Los 1038 Schätzwert 150-250 €<br />
Maschinenfabrik Esslingen<br />
Esslingen, Prior.-Actie 1.000 Mark<br />
7.5.1902 (Auflage 500, R 6) VF-<br />
Gründung 1846, eingetragen 1866. Anfänglich auf Lokomotiven,<br />
Waggons und sonstige Eisenbahnrequisiten sowie Dampfmaschinen<br />
und Eisenkonstruktionen aller Art spezialisiert. Ende des 19.<br />
Jh. konnten mit 2500 Arbeitern knapp 100 Lokomotiven im Jahr<br />
abgeliefert werden. Später auch Fabrikation von Zahnrad- und<br />
Seilbahnen, Straßenwalzen, Eis- und Kühlmaschinen, Gasmotoren,<br />
Pumpwerken, Transmissionen, Dynamomaschinen, Elektromotoren,<br />
Kranen und Transportanlagen. Das 1897 übernommene<br />
(und 1928 an die AEG verkaufte) elektrotechnische Zweigwerk in<br />
Cannstadt plante und baute auch komplette Elektrizitätswerke. In<br />
diesem Zusammenhang bestanden Beteiligungen bei den Elektrizitätswerken<br />
in Esslingen, Urach, Freudenstadt, Tuttlingen, Metzingen<br />
und Böblingen (später in der 100 %igen Tochter “Württ.<br />
Gesellschaft für Elektrizitäts-Werke” zusammengefaßt). 1908 Errichtung<br />
eines neuen Werkes auf einem 250.000 m◊ großen<br />
Areal bei Mettingen, das Esslinger Fabrikareal wurde 1912 geräumt<br />
und verkauft. Das über Jahrzehnte bestehende Zweigwerk<br />
im italienischen Saronno wurde im 1. Weltkrieg verkauft (Zahlung<br />
war “ein Jahr nach Friedensschluß” vereinbart). In den 20er Jahren<br />
erwarb die Gutehoffnungshütte (GHH) die Aktienmehrheit, die<br />
1965 an die Daimler-Benz <strong>AG</strong> weitergegeben wurde. Daimler war<br />
für seine eigene Produktion vor allem an den Fabrikanlagen und<br />
der Gießerei interessiert und pachtete diese, nachdem der Bereich<br />
Maschinenbau an die GHH verkauft worden war. Auch der<br />
Schienenfahrzeugbau wurde eingestellt, de letzte Lokomotive verließ<br />
das Werk am 21.10.1966. Noch wesentlich erweitert wurde<br />
der Werksbesitz 1983 durch verschmelzende Übernahme der<br />
“Württ. Baumwoll-Spinnerei und -Weberei” bei Esslingen a.N. und<br />
der “Maschinen- und Werkzeugbau Zuffenhausen <strong>AG</strong>”. Bis 2004<br />
(dann Umwandlung in eine <strong>AG</strong> & Co. oHG) als reine Immobiliengesellschaft<br />
börsennotiert gewesen, heute der DaimlerChrysler<br />
Immobilien (DCI) zugeordnet.<br />
Los 1039 Schätzwert 25-100 €<br />
Maschinenfabrik Esslingen<br />
Esslingen, Aktie 1.000 Mark Dez. 1922<br />
(Auflage 30000, R 3) EF<br />
Identische Gestaltung wie voriges Los.<br />
Los 1040 Schätzwert 30-80 €<br />
Maschinenfabrik Germania<br />
vorm. J. S. Schwalbe & Sohn<br />
Chemnitz, VZ-Aktie 1.000 RM Nov. 1942<br />
(Auflage 315, R 4) EF<br />
Faksimileunterschrift als AR-Vorsitzender: Dr. Carl<br />
Hahn (Vater des späteren VW-Vorstandsvorsitzenden<br />
Prof. Carl Hahn).<br />
Die Fabrik wurde bereits 1811 errichtet, ab 1873 <strong>AG</strong>. Herstellung<br />
von Eis- und Kühlmaschinen, Wasserturbinen, Werkzeugmaschinen,<br />
Kessel aller Art. 1930 wurde die Maschinenbau-<br />
Maschinenfabrik Esslingen<br />
Abteilung der in Liquidation befindlichen Sächsischen Maschinenfabrik<br />
vorm. Richard Hartmann <strong>AG</strong> in Chemnitz eingegliedert.<br />
Wegen der totalen Zerstörung des Stammbetriebes in der<br />
Fabrikstraße durch alliierte Luftangriffe 1945 wurde das<br />
Stammwerk aufgegeben und das bisherige Zweigwerk in Altchemnitz<br />
zum Hauptwerk ausgebaut. 1946 enteignet: VEB Apparate-<br />
und Anlagenbau Germania. Ab 1990 Germania Chemnitz<br />
GmbH, Apparate- und Anlagenbau. Nach dem Verkauf an<br />
ein indisches Unternehmen Gesamtvollstreckung. Neugründung<br />
der Germania am 28.5.1998 unter dem Namen ERMAFA<br />
Apparatebau GmbH.<br />
Los 1041 Schätzwert 30-60 €<br />
Maschinenfabrik Heid <strong>AG</strong><br />
Wien, Aktie 100 RM Dez. 1939 (Auflage<br />
2500, R 5) EF+<br />
Gründung 1883, <strong>AG</strong> seit 1901. Herstellung von Drehmaschinen,<br />
elektromagnetischen Kupplungen, Getreide-Reinigungsmaschinen,<br />
Saatgutbereitern, Silo- und Speichereinrichtungen,<br />
Obst- und Weinpressen etc.<br />
Los 1042 Schätzwert 30-75 €<br />
Maschinenfabrik Hiltmann & Lorenz <strong>AG</strong><br />
Aue, Aktie 1.000 RM 7.1.1942 (Auflage<br />
1110, R 3) UNC-EF<br />
Gründung 1879, <strong>AG</strong> seit 1911. Herstellung und Vertrieb von<br />
Maschinen zur Blech-, Metall- und Holzbearbeitung, speziell<br />
die Herstellung von Spezialpressen. 1943 bestanden Werksanlagen<br />
in Aue und Niederschlema.<br />
Los 1043 Schätzwert 30-75 €<br />
Maschinenfabrik Kappel <strong>AG</strong><br />
Chemnitz, Aktie 100 RM 15.4.1942<br />
(Auflage 750, R 3) UNC-EF<br />
Gründung 1860 in Kändler bei Chemnitz durch den Fabrikanten<br />
Albert Voigt, 1867 Verlegung der Fabrik nach Kappel, seit<br />
1872 <strong>AG</strong> als “Sächsische Stickmaschinenfabrik”, ab 1888 Fir-<br />
87
menname wie oben. Hergestellt wurden mit bis zu 1.500 Beschäftigten<br />
Stickmaschinen, Tüllwebstühle, Wirkmaschinen,<br />
Sägegatter- und Holzbearbeitungs-Maschinen, Motoren für<br />
Gas-, Benzin- und Rohölbetrieb, Werkzeugmaschinen sowie<br />
Schreibmaschinen. Zweck praktischer Anwendung wurde in<br />
Plauen eine eigene Stickerei betrieben, außerdem lange Zeit<br />
Alleinaktionär bei der Sächsische Tüllfabrik <strong>AG</strong>. Börsennotiz<br />
Berlin, Dresden und Freiverkehr Chemnitz. Im Sog der Weltwirtschaftskrise<br />
1931 in Vergleich gegangen, als Auffanggesellschaft<br />
wurde 1932 die Maschinenfabrik Kappel GmbH gegründet,<br />
seit 1938 betrieb nach einer starken Aufwärtsentwicklung<br />
die <strong>AG</strong> das Geschäft wieder selber. 1945 demontiert,<br />
1946 enteignet, 1951 im VEB Schleifmaschinenbau aufgegangen.<br />
1990 Gründung des Schleifmaschinenwerks Chemnitz auf<br />
dem ehem. Kappel-Gelände, 1995 von der Hamburger Körber-<br />
Gruppe übernommen.<br />
Los 1044 Schätzwert 20-60 €<br />
Maschinenfabrik Paschen <strong>AG</strong><br />
Köthen-Anhalt, Aktie 400 RM Aug. 1939<br />
(Auflage 2000, R 3) EF+<br />
Gründung 1897 unter Übernahme der Firma Aug. Paschen Maschinen-<br />
und Werkzeugfabrik in Köthen, bis 1938 lautete der<br />
Name Maschinen- und Werkzeugfabrik <strong>AG</strong> vorm. Aug. Paschen,<br />
danach Maschinenfabrik Paschen <strong>AG</strong>. Herstellung von<br />
Maschinen und Werkzeugen insbes. für die Zucker-, Trokknungs-<br />
und chemische Industrie. Die Ges. besaß in Köthen<br />
am Holländer-Weg ein Fabrikareal von 10.847 qm. Sitz der Geschäftsleitung<br />
befand sich in der Fabrikstr. 23/24 in Köthen.<br />
Los 1045 Schätzwert 10-30 €<br />
Maschinenfabrik Sangerhausen <strong>AG</strong><br />
Sangerhausen, Aktie 100 RM Mai 1933<br />
(Auflage 12000, R 2) UNC-EF<br />
Gründung 1865 als “Eisengießerei und Maschinenfabrik Flügel<br />
& Hornung”. Herstellung von Maschinen und kpl. Einrichtungen<br />
für Rüben- und Rohrzuckerfabriken und Raffinerien. Schon<br />
1850 hatte der Vater des Mitbegründers Julius Hornung in<br />
Frankenhausen eine Zuckerfabrik errichtet, wodurch der Sohn<br />
auf den entstehenden Markt für Zuckerfabriksmaschinen und -<br />
einrichtungen aufmerksam wurde. 1873 Umwandlung in eine<br />
<strong>AG</strong>. Bereits 1895 Gründung eines Zweigwerkes in Budapest<br />
zwecks Erschließung des Marktes in der k.u.k. Monarchie.<br />
1900 Erwerb der Dampfkesselfabrik von F. Schmidt in Halle an<br />
der Saale, die bis zur Stilllegung in der Weltwirtschaftskrise als<br />
Niederlassung fortgeführt wurde. Zur Jahrhundertwende begann<br />
die Deutsche Bank eine Beteiligung aufzubauen, die nach<br />
ständigen Zukäufen (gemeinsam mit dem Berliner Bankhaus<br />
von Goldschmidt-Rothschild & Co., dessen Mitinhaber Ernst<br />
Wallach ab 1922 dem AR vorsaß) in den 1920er Jahren bestimmenden<br />
Einfluß erlangte. Mit 1300 Mitarbeitern war die<br />
Mafa nun der größte Arbeitgeber in Sangerhausen. 1946 beschlagnahmten<br />
die Sowjets den Betrieb und führten ihn als<br />
“Sowjetische Aktiengesellschaft” (S<strong>AG</strong>) weiter, ehe er 1952 der<br />
“VEB Maschinenfabrik Sangerhausen” und schließlich Kombinatsbetrieb<br />
des “VEB Chemieanlagenbau Staßfurt” wurde. Ab<br />
1990 “Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH”, die 1991 von<br />
der Treuhand an die englische Portland Corporation PLC verkauft<br />
wurde. Hauptsächlich wurden nun Anlagen für Umwelttechnik<br />
und Altlastensanierung produziert, u.a. sanierte die<br />
Mafa die Abfalldeponie der ehemaligen Filmfabrik Wolfen, Grube<br />
Johannes (“Silbersee”). Mit Lieferungen für die größte deutsche<br />
Zuckerfabrik “Diamant” in Könnern wurde auch das ursprüngliche<br />
Produktionsprogramm wieder belebt. 1994 dann<br />
der Schock: Verhaftung des Gesellschafters, Gesamtvollstrekkung,<br />
Entlassung der mehr als 1000 Mitarbeiter. 1997 als<br />
“Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH & Co. KG” neu gegründet,<br />
mit anfangs 80 Beschäftigten vor allem Behälterbau. Der<br />
erfolglose Versuch, auch im alten Geschäftsfeld Zuckerfabriksausrüstungen<br />
wieder Fuß zu fassen, führte 2004 erneut zur Insolvenz.<br />
Damit endete die Tradition der Mafa. 2006 wurden die<br />
Werksanlagen abgerissen, auf dem Gelände entstand ein neues<br />
Gewerbegebiet.<br />
88<br />
Los 1046 Schätzwert 25-100 €<br />
Maschinenfabrik vorm. Georg Dorst <strong>AG</strong><br />
Oberlind-Sonneberg, Aktie 1.000 Mark<br />
30.5.1922 (Auflage 1000, R 4) EF<br />
Gegründet 1891 (Schmiede bereits 1867) durch die Familie<br />
des bekannten Dramatikers Tankred Dorst. Herstellung von<br />
Maschinen für die feinkeramische, chemische, Farben-, Bleistift<br />
und Glasindustrie. Ab 1948 VEB Thuringia Sonneberg.<br />
Los 1047 Schätzwert 20-50 €<br />
MATGRA Material-Beschaffungsstelle<br />
für das graphische Gewerbe <strong>AG</strong><br />
Leipzig, Aktie 100 RM 8.1.1925 (Auflage<br />
2000, R 3) EF+<br />
Mit BARoV-Entwertungsstempel (mit Bundesadler).<br />
Gründung 1923. Herstellung und Vertrieb von Bedarfsgegenständen<br />
des graphischen Gewerbes - Buchdruckerei-Waschmittel,<br />
technische Seife, chemische Erzeugnisse. 1951 aufgelöst.<br />
Los 1048 Schätzwert 20-40 €<br />
Max Hahn Chemische Fabrik <strong>AG</strong><br />
Berlin,Aktie 1.000 Mark 1.11.1923 (R 7) EF-VF<br />
Gründung 1913 als „Landhaus-<strong>AG</strong>“, 1921 Umfirmierung in<br />
Max Hahn Chemische Fabrik <strong>AG</strong>. Betrieb einer chemischen Fabrik<br />
für Medikamente und pharmazeutische Präparate. 1927<br />
nach abgelehnter Konkurseröffnung mangels vorhandener<br />
Masse für nichtig erklärt.<br />
Los 1049 Schätzwert 80-100 €<br />
Max Nitzsche & Co. <strong>AG</strong><br />
Obercarsdorf i. Sa., Aktie 100 Goldmark<br />
Juni 1924 (Auflage 1900, R 9) EF<br />
Nur 8 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gründung 1887, <strong>AG</strong> ab 14.12.1923. Herstellung von und Handel<br />
mit Papier und Pappen aller Art. Erzeugnisse: Matrizenpappen,<br />
Dosenfeinpappen und Kistenpappen. Nach dem Krieg<br />
nicht verlagert.<br />
Los 1050 Schätzwert 75-150 €<br />
Mechanische<br />
Netzfabrik und Weberei <strong>AG</strong><br />
Itzehoe, Aktie 1.500 Mark 8.11.1922<br />
(Auflage 1400, R 5) EF<br />
Sehr dekorativ, große Abb. mit Neptun auf Rössern<br />
im Unterdruck. Lochentwertet.<br />
Gründung als kleine Weberei 1873 durch eine Anzahl Itzehoer<br />
Familien mit einem Anfangskapotal von 3.200 Talern. Ständige<br />
Betriebserweiterung mit neuen Netzknüpfmaschinen, 1880<br />
Einstellung der Webwarenherstellung und Spezialisierung auf<br />
Garne und Netze (vor allem Heringsnetze, Ringwaaden, Dorschnetze<br />
und Lachsnetze). 1892 Errichtung einer dreistöckigen<br />
Zwirnerei, 1929 Inbetriebnahme einer Baumwollspinnerei im 7<br />
km entfernten Lockstedter Lager, 1933 Erwerb der in Konkurs<br />
geratenen “Hochsee-Netzwerke <strong>AG</strong>” in Itzehoe und Weiterführung<br />
als Werk B. 1953 Erwerb der “Itzehoer Filetnetzvertrieb<br />
GmbH”. 1954 (die Firma hatte jetzt immerhin 500 Beschäftigte)<br />
umbenannt in “Itzehoer Netzfabrik <strong>AG</strong>”. Das Werk B und die<br />
Spinnerei in Hohenlockstedt wurden 1955 bzw. 1956 stillgelegt<br />
und verkauft. Ab 1963 Aufbau einer Kunststoffabteilung<br />
(Dachrinnen, Fensterprofile, Norm- und Fertigfenster, Rohre).<br />
1969 Umstellung der Netzfabrikation auf Tarnnetze. 1971 umfirmiert<br />
in “INEFA Kunststoffe <strong>AG</strong>”. Börsennotiz Hamburg. Die<br />
Deutsche Bank verkaufte ihre Mehrheitsbeteiligung Anfang der<br />
1970er Jahre an die Hoffmann’s Stärkefabriken <strong>AG</strong>, Bad Salzuflen,<br />
in die die INEFA 1973-78 eingegliedert war. 1979 Errichtung<br />
eines Zweigwerkes für Kunststofffenster in<br />
Hamm/Westf. und Verkauf der Aktienmehrheit an die Protektorwerk<br />
Florenz Maisch GmbH & Co. KG, Gaggenau. 1985 Umwandlung<br />
in eine GmbH, 2002 pleite gegangen.<br />
Los 1051 Schätzwert 80-100 €<br />
Mechanische Plan- und Sackfabrik<br />
Carl Winter <strong>AG</strong><br />
Magdeburg, Aktie 1.000 Mark<br />
23.11.1923 (R 9) EF<br />
Sehr schöne Umrandung mit Garnrollen. Nur 10<br />
Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />
Gründung Febr. 1923 zur Fortführung der Einzelfirma Carl Winter<br />
in Magdeburg. Herstellung von Bindegarnen, Segeltuchen,<br />
Planen, Zelten, Jutewaren, Säcken und Decken. Im Mai 1926<br />
aufgelöst und in Liquidation getreten.<br />
Los 1052 Schätzwert 40-75 €<br />
Mechanische Treibriemenweberei<br />
und Leder-Treibriemenfabrik <strong>AG</strong><br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark Nov. 1922<br />
(Auflage 15500, R 6) EF<br />
Gründung im März 1921 als Pawi Automobil- und Motorenvertriebs-<strong>AG</strong>,<br />
ab Juli 1921 Firma wie oben. Die Fabrik in Berlin-<br />
Tempelhof, Ringbahnstr. 42 stellte Treibriemen und Transportbänder<br />
sowie Fahrradsättel und -taschen her. Börsennotiz:<br />
Freiverkehr Berlin. 1924 in Konkurs gegangen.<br />
Los 1053 Schätzwert 30-60 €<br />
Mechanische Treibriemenweberei<br />
und Seilfabrik Gustav Kunz <strong>AG</strong><br />
Treuen i.Sa., Aktie 100 RM 23.3.1927<br />
(Blankette, R 6) EF<br />
Gründung 1894 unter Übernahme der seit 1868 bestehenden Firma<br />
Gustav Kunz. Herstellung von gewebten Kamelhaartreibriemen,<br />
Baumwollriemen, Transportbändern, Seidenriemen, Filtertüchern<br />
und Segeltuchen sowie Seilen aus Draht und Hanf.Während<br />
des 2. WK Umstellung auf Rüstungsproduktion. In der DDR Betriebsfortsetzung<br />
als VEB Mechanische Triebriemenwebereien und<br />
Seilfabrik Treuen, später auf VEB Vowetex Plauen verschmolzen.<br />
Los 1054 Schätzwert 20-60 €<br />
Mechanische Weberei Sorau<br />
vormals F. A. Martin & Co.<br />
Sorau N.-L., Aktie 1.000 Mark 1.4.1921<br />
(Auflage 3000, R 2) EF<br />
Schöne Rankwerk-Umrahmung.<br />
Gründung bereits 1835 als Leinen- und Jacquard-Weberei für<br />
Tischwäsche und Handtücher. <strong>AG</strong> seit 1886. Neben der Weberei<br />
auch Betrieb der „Braunkohlengrube Martin“ (verkauft<br />
1918) nebst Ziegelei (verkauft 1919) in Kunzendorf. Börsennotiz<br />
Berlin, Großaktionär war die Dresdner Bank.<br />
Los 1055 Schätzwert 100-175 €<br />
Mechanische Weberei zu Linden<br />
Hannover-Linden, Aktie 200 RM Febr.<br />
1927 (Auflage 18500, R 7) EF<br />
Wunderschöne Gestaltung, ganzflächige Ansicht<br />
des riesigen Werkes im Unterdruck, mit der Stadt<br />
Hannover im Hintergrund.<br />
Gründung 1858 unter Übernahme der seit 1837 bestehenden<br />
Mechanischen Weberei zu Linden. Produziert wurden: Im Werk<br />
Linden Velvets, insbesondere „Lindener Samt“, Velveton, „Lindener<br />
Leder“, Rippensamt und Cords; im Werk Oggersheim<br />
Rohgewebe, deren Weiterbearbeitung durch das Werk Linden<br />
erfolgte. Beteiligungen an Rheinische Velvetfabrik <strong>AG</strong> Hannover,<br />
Zellwolle Lenzing <strong>AG</strong> Lenzing, Thüringische Zellwolle <strong>AG</strong><br />
Schwarza. 1954 in Konkurs gegangen.<br />
Los 1056 Schätzwert 50-120 €<br />
Mechanische Weberei zu Linden<br />
Hannover-Linden, Aktie 100 RM März<br />
1934 (Auflage 470, kpl. Aktienneudruck,<br />
R 5) EF-VF