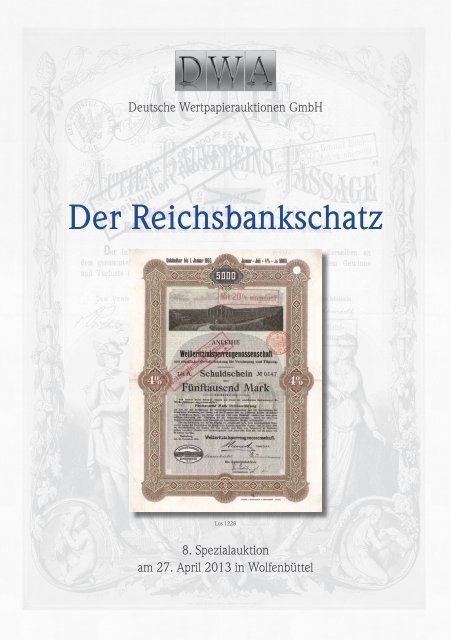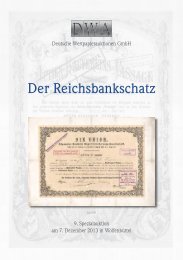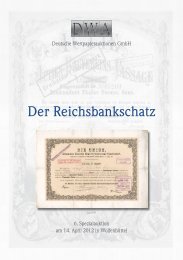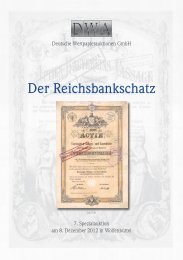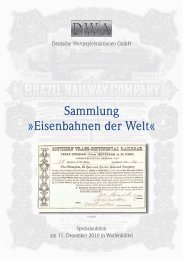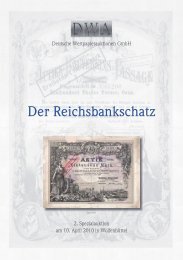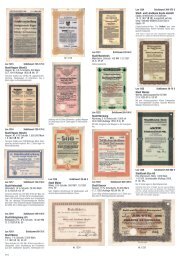Der Reichsbankschatz - DWA - Deutsche Wertpapierauktionen GmbH
Der Reichsbankschatz - DWA - Deutsche Wertpapierauktionen GmbH
Der Reichsbankschatz - DWA - Deutsche Wertpapierauktionen GmbH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Deutsche</strong> <strong>Wertpapierauktionen</strong> <strong>GmbH</strong><br />
<strong>Der</strong> <strong>Reichsbankschatz</strong><br />
Los 1228<br />
8. Spezialauktion<br />
am 27. April 2013 in Wolfenbüttel
Programm<br />
Anreise<br />
Auktionsort<br />
Zentrum für Historische Wertpapiere<br />
Salzbergstraße 2<br />
D-38302 Wolfenbüttel<br />
Programm<br />
Freitag, 26. April 2013<br />
9 - 18 Uhr Tag der offenen Tür beim<br />
Benecke und Rehse Wertpapierantiquariat<br />
18.30 Uhr Sammlertreffen in der Gaststätte<br />
»Zum Eichenwald«<br />
Braunschweig-Mascherode<br />
Salzdahlumer Straße 313<br />
Sonnabend, 27. April 2013<br />
8 - 11 Uhr Vorbesichtigung der<br />
Auktionslose<br />
11.00 Uhr 8. Spezial-Auktion<br />
»<strong>Der</strong> <strong>Reichsbankschatz</strong>«<br />
Übernachtungen<br />
Arcadia Hotel (4 Sterne)<br />
ehemals PLAY OFF<br />
Salzdahlumer Straße 137<br />
38126 Braunschweig-Südstadt<br />
(ca. 5 km vom Veranstaltungsort entfernt)<br />
Telefon 0531 - 26310<br />
Fax 0531 - 67119<br />
eMail info.braunschweig@ahmm.de<br />
Web www.arcardia-hotel.de<br />
Sonderpreis für unsere Auktionsbesucher:<br />
50 E pro Zimmer/Nacht<br />
(EZ oder DZ, plus Frühstück p.P. 15 E)<br />
kostenfrei: Parkplatz sowie Nutzung<br />
von Sauna und Fitnessräumen<br />
… von der A 2 kommend:<br />
am Kreuz Braunschweig-Nord auf die<br />
A 391 Richtung Salzgitter/Kassel<br />
… von der A 7 kommend:<br />
am Salzgitter-Dreieck auf die A 39<br />
Richtung Braunschweig/Berlin<br />
in beiden Fällen dann weiter:<br />
– am Dreieck Braunschweig-Südwest<br />
einordnen auf die A 39 Richtung Berlin<br />
– am Kreuz Braunschweig-Süd rechts<br />
ausfahren auf die A 395 Richtung<br />
Wolfenbüttel/Bad Harzburg/Goslar<br />
– 3. Ausfahrt Stöckheim/Mascherode<br />
(nach dem Lärmschutzwall auf der<br />
rechten Seite) ausfahren, am Ende der<br />
Ausfahrtrampe links fahren Richtung<br />
Mascherode<br />
Fragen zur<br />
Auktion?<br />
Michael Weingarten, Tel. 05331-9755-33<br />
Kurt Arendts, Tel. 05331-9755-22<br />
Michael Rösler, Tel. 05331-9755-21<br />
Immer einen Besuch wert:<br />
<strong>Der</strong> Harz<br />
wenn Sie jetzt erst zum Hotel wollen:<br />
– in Mascherode am Kreisverkehr<br />
3. Abbie gung ausfahren Richtung<br />
Braunschweig-Heidberg (nach 30 m<br />
kommen Sie jetzt am »Eichenwald«<br />
vorbei, wo Freitag Sammlertreffen ist)<br />
– aus Mascherode herausfahren, die<br />
Straße schlängelt sich durch ein Wäldchen,<br />
nach ca. 1,5 km ist links das<br />
Hotel (rechts liegt eine Star-Tankstelle,<br />
hat meist sehr günstige Spritpreise)<br />
wenn Sie jetzt direkt zu unserem<br />
Firmensitz wollen:<br />
– in Mascherode am Kreisverkehr<br />
1. Abbiegung rechts fahren Richtung<br />
Salzdahlum<br />
– in Salzdahlum 100 m nach dem Ortseingangsschild<br />
links abbiegen Richtung<br />
Sickte<br />
– nach ca. 700 m auf der Landstraße<br />
fahren Sie geradeaus direkt auf unser<br />
Firmengelände<br />
wenn Sie vom Hotel zu unserem<br />
Firmensitz wollen:<br />
zurückfahren Richtung Mascherode, dort<br />
geradeaus durchfahren, in Salzdahlum<br />
s.o.<br />
wenn Sie mit der Bahn anreisen:<br />
Zielbahnhof: Braunschweig-Hbf., von dort<br />
mit dem Taxi (zum Hotel ca. 8 Min., zu<br />
unserem Firmensitz ca. 15 Min.)<br />
Die Reservierung machen wir gern für<br />
Sie, bitte rufen Sie uns an!<br />
Mindestgebot: 80 % vom unteren Schätzpreis
Ein unenTbehrliches<br />
Nachschlagewerk<br />
suppes-special<br />
„<strong>Der</strong> Reichsbank-Schatz“<br />
Die endgültige Übersicht aller im<br />
Reichsbank-Schatz vorhandenen<br />
Papiere!<br />
15.000 Listungen*<br />
mit nützlichen, noch nie<br />
veröffentlichten Detail-Angaben!<br />
49,– €<br />
Best.-Nr. 187887<br />
Dieses Kennzeichen sagt, ob auch<br />
nicht entwertete Stücke bekannt<br />
Firmenname Ausgabeort Art Nennwert Datum Auflage Schatz Erh. Jahr<br />
A. & W. Willmann AG Luthrötha bei Sagan Aktie 1.000 Mark 2.1.1913 550 9 III/IV 2009<br />
A. & W. Willmann AG Luthrötha bei Sagan Aktie 1.000 Mark 1.1.1922 1.000 9 III/IV 2009<br />
A. Busse & Co. AG Berlin Aktie 1.000 Mark 1.4.1900 6.000 6 III 2009<br />
A. Doehner AG Chemnitz Aktie 100 RM 25.4.1925 2.000 1.250 II 2003<br />
A. Erlenwein & Cremer AG Uerdingen Aktie 100 RM 28.6.1929 90 20 II/III 2009<br />
A. Erlenwein & Cremer AG Uerdingen Aktie 1.000 RM 28.6.1929 91 90 II 2008<br />
A. Frohmuth Holzwaren- und Holzstoff-Fabrik AG Mellenbach Aktie 1.000 Mark 15.12.1923 10.000 165 II/III 2006<br />
A. Glaser Nachfl. AG Penig Aktie 100 RM 1.6.1932 1.920 1.500 II 2003<br />
A. Grubitz Dampfseifenfabrik AG Potsdam Aktie 1.000 Mark 20.7.1923 5.000 30 II/III 2008<br />
A. Grubitz Dampfseifenfabrik AG Potsdam Aktie 1.000 Mark 10.8.1923 5.000 13 II/III 2009<br />
A. Hagedorn & Co. Celluloid- und Korkwaren-Fabrik AG Osnabrück Aktie 1.000 Mark 28.2.2007 1.000 58 III 2008<br />
A. Ludwig Steinmetz AG Remscheid Aktie 100 RM März 1938 2 III/IV 2009<br />
A. Prang Dampf- und Wassermühlenwerke AG Gumbinnen Aktie 100 RM Sept. 1927 8.000 3 III/IV 2009<br />
A. Riebeck‘sche Montanwerke AG Halle a/S. Aktie 1.000 Mark Jan. 1899 2.000 1 IV 2009<br />
A. Riebeck‘sche Montanwerke AG Halle a/S. Aktie 1.000 Mark Febr. 1909 3.000 1 IV 2009<br />
A. Riebeck‘sche Montanwerke AG Halle a/S. Aktie 1.000 Mark April 1911 7.000 3 IV 2009<br />
A. Riebeck‘sche Montanwerke AG Halle a/S. Aktie 1.000 Mark April 1912 6.500 1 IV 2009<br />
A. Riebeck‘sche Montanwerke AG Halle a/S. 4,5 % Schuldv. 1.000 Mark Okt. 1920 5 IV 2009<br />
A. Riebeck‘sche Montanwerke AG Halle (Saale) Aktie 200 RM Aug. 1943 2.760 900 II/III 2006<br />
A. Riebeck‘sche Montanwerke AG Halle (Saale) Aktie 1000 RM Aug. 1943 73.620 5.000 II/III 2006<br />
. Th. Meiflner AG Stadtilm Aktie 100 RM 26.2.1925 6.400 33 III 2008<br />
. Zalewski AG Honnef am Rhein Aktie Lit. A 100 RM 3.12.1925 1.700 44 III 2008<br />
Zalewski AG Honnef am Rhein Aktie Lit. C 100 RM 30.9.1940 1.960 8 III 2009<br />
chener Kleinbahn-Gesellschaft Aachen Actie 1.200 Mark 5.6.1896 1.500 500 III/IV 2005<br />
hener Kleinbahn-Gesellschaft Aachen Aktie 2.000 Mark 4.6.1907 1.000 600 III 2005<br />
hener Kleinbahn-Gesellschaft Aachen Aktie 2.000 Mark 1.10.1912 500 400 II/III 2005<br />
ener Lederfabrik AG Aachen Aktie 200 RM 3.6.1929 1.740 210 III 2006<br />
ner Rückversicherungs-Gesellschaft Aachen Namens-Actie 400 Thaler 28.5.1853 3.000 600 IV 2006<br />
ner Rückversicherungs-Gesellschaft Aachen Namens-Actie 1.200 Mark 15.11.1895 3.000 750 III 2006<br />
er Rückversicherungs-Gesellschaft Aachen Namens-Aktie 1.200 Mark 1.1.1921 4.000 1.050 III/IV 2006<br />
er Rückversicherungs-Gesellschaft Aachen Namens-Aktie 1.200 Mark 6.3.1923 15.000 3.000 III/IV 2006<br />
r Stahlwaarenfabrik Fafnir-Werke AG Aachen Aktie 1.000 Mark 1.4.1912 800 3 IV 2009<br />
Thermalwasser Kaiserbrunnen AG Aachen Aktie 100 RM März 1929 250 8 II/III 2009<br />
Diese Stückzahl lag im Reichsbank-Schatz<br />
Benecke<br />
&<br />
Rehse<br />
* außer Pfandbriefe u.ä.<br />
Erhaltung<br />
Auktion im Jahr<br />
Aktien-Gesellschaft für Historische Wertpapiere<br />
– Wertpapierantiquariat –<br />
Salzbergstraße 2 · 38302 Wolfenbüttel<br />
Telefon 05331.975521 · Telefax 05331.975555
Los 4 Schätzwert 50-150 €<br />
Aachener Kleinbahn-Gesellschaft<br />
Aachen, Actie 1.200 Mark 5.6.1896<br />
(Auflage 1500, R 4) EF-VF<br />
Geschichte siehe voriges Los.<br />
Los 1 Schätzwert 30-60 €<br />
A. Frohmuth Holzwaren- und<br />
Holzstoff-Fabrik AG<br />
Mellenbach, Aktie 1.000 Mark<br />
15.12.1923. Gründeraktie (Auflage<br />
10000, R 5) EF<br />
Gegründet zur Weiterführung der Fabrik der Fa. Alfred Frohmuth.<br />
Nach der Inflation kam die Firma in’s Straucheln: 1926<br />
verschaffte ein Zwangsvergleich noch einmal kurz Luft, aber<br />
schon 1929 ließ sich der Konkurs doch nicht mehr vermeiden.<br />
Los 2 Schätzwert 30-60 €<br />
A. Riebeck’sche Montanwerke AG<br />
Halle (Saale), Aktie 200 RM Aug. 1943<br />
(Auflage 2760, R 3) EF<br />
Das von Kommerzienrat Riebeck begründete Unternehmen wurde<br />
1883 im Zuge der Auseinandersetzung unter seinen Erben eine<br />
AG, 1888 übernahm ein Bankenkonsortium alle Aktien.<br />
Grundlage des Unternehmens waren Dutzende von Braunkohlengruben<br />
(teils Tiefbau, teils Tagebau) im Oberröblinger, Zeitz-Weissenfelser<br />
und im Halle’schen Bezirk. Ein weiterer wichtiger Geschäftszweig<br />
war die Verarbeitung des in Schwelereien gewonnenen<br />
Teers auf Mineralöle und Paraffin. Im Laufe der Jahre wurden<br />
eine Reihe benachbarter Bergwerksunternehmen übernommen.<br />
1923 weitere Ausdehnung des Bergwerksbesitzes mit dem<br />
Erwerb der Gewerkschaft Messel bei Darmstadt (1954 als “Paraffin-<br />
und Mineralölwerk Messel” ausgegliedert, 1959 an die<br />
schwedische Ytong AB verkauft; der ehemalige Braunkohlentagebau<br />
Grube Messel gehört heute übrigens als überragender<br />
Fossilien-Fundort zum Weltkulturerbe). Ebenfalls 1923 Übernahme<br />
wesentlicher Mineralöl-Interessen aus dem Stinnes-Einflussbereich,<br />
in diesem Zusammenhang für kurze Zeit Umfirmierung<br />
in “Hugo Stinnes-Riebeck Montan- und Oelwerke AG”. 1926 Abschluss<br />
eines Interessenvertrages mit der I.G. Farbenindustrie<br />
AG, wonach jeder Aktionär seine Aktien 2:1 in I.G. Farben-Aktien<br />
tauschen konnte (diese Klausel war übrigens noch bis Ende der<br />
80er Jahre Gegenstand vielbeachteter Prozesse zwischen beiden<br />
Gesellschaften). 1931 übernahmen die Rheinischen Stahlwerke<br />
ein großes Paket Riebeck-Aktien von der I. G. Farben und waren<br />
dann mit 87 % Mehrheitsaktionär. 1945 zu Gunsten des Landes<br />
Sachsen-Anhalt enteignet. Nach dem Krieg lagen neben geringfügigem<br />
Streubesitz die Riebeck-Aktien wieder bei I. G. Farben<br />
(rd. 50 %) und Rheinstahl (rd. 40 %). 1966 Sitzverlegung von<br />
Halle (Saale) nach Frankfurt (Main),<br />
Los 3 Schätzwert 80-185 €<br />
Aachener und Burtscheider<br />
Pferdeeisenbahn-Gesellschaft<br />
Berlin, Aktie 500 Mark 15.6.1881<br />
(Auflage 1400, R 4) VF-<br />
Gründung 1880 als Aachener und Burtscheider Pferdeeisenbahn,<br />
Dampfbetrieb ab 1884, elektrischer Betrieb ab 1895.<br />
Zeitweise über 200 km Betriebslänge. 1894 Umfirmierung in<br />
Aachener Kleinbahn, seit 1942 (die bis heute börsennotierte)<br />
Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs-AG. Großaktionäre<br />
sind seit langer Zeit Stadt und Landkreis Aachen.<br />
Los 5 Schätzwert 50-125 €<br />
Aafa-Film AG<br />
Berlin, Aktie 100 RM 29.4.1933 (Auflage<br />
4000, R 5) EF<br />
Gründung 1920 als Radio-Film AG, Firma 1921-25 Aafa-Althoff-Ambos-Film<br />
AG. Herstellung und Verleih von Filmen, Betrieb<br />
von Lichtspieltheatern. Börsennotiz: Freiverkehr Hannover.<br />
Die Gesellschaft produzierte eine große Menge an Filmen in<br />
der Stummfilm-Ära, vor allem im Filmwerk Staaken. Darunter<br />
waren auch Produktionen mit Filmgrößen wie Leni Riefenstahl<br />
(z.B. Stürme über dem Montblanc). <strong>Der</strong> Film “Kunterbunt” wurde<br />
1932 von der Zensur mit Jugendverbot belegt. 1934 ging<br />
die Gesellschaft in Konkurs, vermutlich unter dem Druck der<br />
Nationalsozialisten.<br />
Los 6 Schätzwert 175-300 €<br />
Actien-Bierbrauerei in Essen a. d. Ruhr<br />
Essen, Prior.-Stamm-Actie 2.000 Mark<br />
31.12.1897 (Auflage nur 90 Stück, R 6)<br />
UNC-EF<br />
Mit Originalunterschriften (u.a. Carl Funke als AR-<br />
Vorsitzender).<br />
Gründung 1872. Übernommen wurden später die Phönix-<br />
Brauerei <strong>GmbH</strong> in Essen (1931), die Kronen-Brauerei AG in Essen-Borbeck<br />
(1932), die Dortmunder Stifts-Brauerei Carl Funke<br />
AG (1936). 1939 Erwerb der Aktienmehrheit bei der Dom-<br />
Brauerei Carl Funke AG und der Hitdorfer Brauerei AG in Köln-<br />
Hitdorf, gleichzeitig Umfirmierung in Essener Aktien-Brauerei<br />
Carl Funke AG. 1963 erneute Umfirmierung in Stern-Brauerei<br />
Carl Funke AG. 1969 Erwerb der Brauerei zum Schiff J. Peter<br />
Wahl <strong>GmbH</strong> in Kaufbeuren. 1998 Sitzverlegung nach Köln, umfirmiert<br />
in Dom-Brauerei AG, Spezialitäten sind DOM Kölsch<br />
und Rats Kölsch. Bis 1934 in Essen, danach in Düsseldorf börsennotiert.<br />
Seit 2008 nach Insolvenz als <strong>GmbH</strong> weitergeführt.<br />
Los 8 Schätzwert 250-400 €<br />
Actien-Brauerei Feldschlösschen<br />
Minden, Actie Lit. A 1.000 Mark<br />
25.3.1898 (Auflage 300, R 7) VF<br />
Originalunterschriften.<br />
1865 Gründung der Brauerei Brettholz & Denkmann. AG seit<br />
1888. 1918 Ankauf der Mindener Stiftsbrauerei, 1922 Erwerb<br />
des Braukontingents der Kronenbrauerei Bückeburg. 1924 Ankauf<br />
der Städt. Brauerei Hempel & Co. in Stadthagen. Neben<br />
verschiedenen Wirtschaftsanwesen gehörte der Gesellschaft<br />
auch die Tonhalle in Minden. Die Aktien notierten seit 1890 bei<br />
äußerst sporadischen Umsätzen an der Börse Hannover, später<br />
im ungeregelten Freiverkehr Düsseldorf. Großaktionär war zuletzt<br />
mit über 98 % die Berliner Schultheiss-Brauerei AG. 1978<br />
auf die Dortmunder Union-Schultheiss-Brauerei AG (1988 umbenannt<br />
in Brau und Brunnen AG, seit 2004 Teil der Radeberger<br />
Gruppe) verschmolzen.<br />
Los 9 Schätzwert 60-120 €<br />
Actien-Brauerei Ohligs<br />
Ohligs, 6 % Teilschuldv. 1.000 Goldmark<br />
20.5.1926 (Auflage 1000, R 5) VF<br />
Gründung 1899 durch die Brauerei C. Beckmann in Solingen,<br />
die für die ersten 10 Jahre auch eine Dividendengarantie abgab.<br />
Neben der Brauerei und Mälzerei auch Eisfabrikation, außerdem<br />
Wirtschaftsanwesen in Köln, Düsseldorf und Solingen-<br />
Ohligs. 1972 Fusion mit der schon 1753 gegründeten Brauerei<br />
Beckmann AG in Solingen, 1973 Umfirmierung in Aktien-<br />
Brauerei Beckmann AG. 1991 Einstellung des Braubetriebes<br />
und erneute Umfirmierung in Beckmann Beteiligungs-AG,<br />
1996 Sitzverlegung nach Düsseldorf. Zuletzt an etwa 10 Autohäusern<br />
in Bielefeld, Oberhausen, Duisburg, Ansbach, Gera sowie<br />
in Frankreich beteiligt.<br />
Los 11 Schätzwert 75-150 €<br />
Aeternitas AG für naturwissen schaft -<br />
liche u. medizinische Dauerpräparate<br />
Berlin-Dahlem, Aktie 1.000 RM Sept.<br />
1928 (Auflage 150, R 7) EF<br />
Vorher nicht bekannt gewesen.<br />
Gründung 1927 zur Verwertung des von Prof. Hochstetter und<br />
Dr. Gustav Schmeidel in Wien erfundenen Verfahrens zur Dauerkonservierung<br />
von Menschen, Tieren und Pflanzen. Aeternitas,<br />
lateinisch = Ewigkeit. Das Geschäft mit der Ewigkeit hielt<br />
nicht ewig, im Febr. 1934 wurde die Firma gelöscht.<br />
Los 12 Schätzwert 75-150 €<br />
AG Breslauer Zoologischer Garten<br />
Breslau, Aktie 1.000 RM Juli 1938<br />
(Auflage 202, R 5) EF<br />
Kleiner Tigerkopf im Unterdruck.<br />
Nach dem großen Erfolg bei der Gründung des Berliner Zoos<br />
kam 1858 auch in Breslau der Wunsch nach einem eigenen<br />
Tiergarten auf. Unter Führung des damaligen Oberbürgermeisters<br />
Geheimrat Dr. Elwanger nahm eine Gruppe von Interessenten<br />
im Febr. 1863 die ersten Vorarbeiten zu ihrem Vorhaben<br />
auf. Nachdem ein Grundkapital von 30.000 Thalern, eingeteilt<br />
in 600 Aktien à 50 Thaler gezeichnet wurde, konstituierte sich<br />
die AG Breslauere Zoologischer Garten am 10.Juli 1865. <strong>Der</strong><br />
Zoo war sehr beliebt, die Besucherzahler waren hoch (an einem<br />
verbilligten Sonntag kamen 6000 Personen). Auf Grund der Folgen<br />
des Ersten Weltkrieges mußte der Zoo im Jahr 1921 für<br />
mehrere Jahre geschlossen werden. Bis 1927 wurde er als<br />
Konzertgarten geführt. Durch finanziele Unterstützungen konnte<br />
der Tierbestand 1927 stark erweitert werden, so daß bei Wiedereröffnung<br />
ca. 1850 Tiere in 480 Arten gezeigt werden konnten.<br />
Bei der Sanierung im Jahr 1937 zeichneten die Stadt Breslau<br />
und die Provinz Schlesien den größten Teil einer Kapitalerhöhung,<br />
mit der der Zoo sogar erweitert und mit einer Robbenund<br />
Bären sowie einer Pavian-Freianlage ausgebaut werden<br />
konnte. Während des Zweiten Weltkrieges wurden zahlreiche<br />
Tiere aus anderen deutschen Zoos nach Breslau evakuiert. In<br />
den letzten Monaten des Krieges litt Breslau unter den Folgen<br />
der Bombenangriffe. Nur 70% des Tierbestandes überlebte den<br />
Krieg. Anfang Juni 1945 erhielt der damalige Direktor Dr.<br />
Schlött die Anweisung, alle noch im Zoo befindlichen Tiere nach<br />
Polen in die Städte Lodz, Posen, Warschau und Krakau zu transportieren.<br />
1948 wurde der Zoo wiedereröffnet als Miejski Ogrod<br />
Zoologiczny, Wroclaw. Seit 1952 ist der Zoo in der Hand der<br />
Stadt, die ihn mit staatlicher Unterstützung betreibt.<br />
Nr. 4<br />
Los 7 Schätzwert 100-200 €<br />
Actien-Bierbrauerei in Essen a. d. Ruhr<br />
Essen, Aktie 1.000 Mark 3.3.1908<br />
(Auflage 500, R 5) EF<br />
Mit Originalunterschriften (u.a. Carl Funke).<br />
Los 10 Schätzwert 30-60 €<br />
Aelteste Volkstedter Porzellanfabrik AG<br />
Rudolstadt-Volkstedt, Aktie 100 RM März<br />
1933 (Auflage 6330, R 4) EF<br />
Gründung 1898. 1936 Vergleichsverfahren infolge Verschlechterung<br />
der Geschäftslage auf den Auslandsmärkten. 1937<br />
Gründung der Auffanggesellschaft “Thüringische Porzellan-<br />
Manufaktur vorm. Aelteste Volkstedter <strong>GmbH</strong>”. 1972 VEB Aelteste<br />
Volkstedter Porzellanmanufaktur, nach 1990 Aelteste<br />
Volkstedter Porzellanmanufaktur <strong>GmbH</strong>.<br />
Los 13 Schätzwert 60-120 €<br />
AG Eintracht Braunkohlenwerke<br />
und Briketfabriken<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark Juni 1900<br />
(Auflage 1000, R 3) VF<br />
Gründung 1887 unter Übernahme der früheren Gewerkschaft<br />
Eintracht I (letztere gegründet 1881 auf dem verliehenen Bergwerk<br />
Gustav Ferdinand bei Bennfeld im Mansfelder Seekreis).<br />
Zunächst Erwerb der Grube Louise bei Domsdorf (Kreis Liebenwerda),<br />
hinzu kamen 1883 die Grube Emilie in Hennersdorf<br />
und 1886 die Grube Henriette in Sallgast. 1887 Umwandlung<br />
in eine AG, danach 1892 Erwerb der Kohlenfelder in Welzow<br />
und Aufschluß der Grube Clara-Welzow. Hier entstanden die<br />
2
Hauptbetriebe, deshalb 1905 Sitzverlegung nach Neu-Welzow,<br />
N.-L. Zuletzt waren mit über 3.000 Mann Belegschaft in Betrieb<br />
in der Niederlausitz die Gruben Clara in Welzow (Kr.<br />
Spremberg), Henriette (1932 wegen Erschöpfung der Vorräte<br />
stillgelegt) und Louise in Domsdorf b. Beutersitz sowie in der O-<br />
berlausitz die Grube Werminghoff (Kreis Hoyerswerda) und Clara<br />
III bei Zeißholz (1934 wegen Erschöpfung der Vorräte stillgelegt).<br />
Außerdem Betrieb von 9 Brikettfabriken. Die zuletzt<br />
zum tschechischen Petschek-Konzern gehörende Gesellschaft<br />
wurde 1939 auf Beschluß des Treuhänders des Reichswirtschaftsministers<br />
aufgelöst, den Aktionären wurde von Bankseite<br />
ein Ankaufsangebot zu 185% gemacht (Börsennotiz bis dahin<br />
Berlin und Leipzig).<br />
Los 16 Schätzwert 75-125 €<br />
AG Ferd. Lipfert<br />
Annaberg, Erzgeb., Aktie 100 RM Dez.<br />
1937 (Auflage 200, R 6) EF<br />
Gründung 1923. Ausführung von Bankgeschäften aller Art, insbesondere<br />
Übernahme von Haftungen und Garantien für Dritte.<br />
1925 wurde mit der Girozentrale Sachsen -öffentliche Bankanstalt-<br />
Dresden (heute Landesbank Sachsen) der Ausbau zu einer<br />
Zweiganstalt der Girozentrale unter voller Wahrung der wirtschaftlichen<br />
und rechtlichen Selbständigkeit der Bank vereinbart.<br />
Los 14 Schätzwert 225-300 €<br />
AG “Ems”<br />
Emden, Actie 1.000 Mark 1.6.1908<br />
(Auflage 350, R 7) EF<br />
Gründung 1843 als Dampfschiffsgesellschaft Concordia, 1889<br />
Umwandlung in die Actien-Gesellschaft “Ems”. Fährverbindungen<br />
Emden-Borkum, Borkum-Helgoland, Borkum-Norderney,<br />
Borkum-Delzijl, Norderney-Helgoland. 2 der 5 Personendampfer<br />
gingen im 2. Weltkrieg verloren. 1949 Neubau einer Großgarage<br />
bei der Abfahrtstelle in Emden-Außenhafen, nachdem<br />
sich der Fährverkehr nach Borkum immer mehr zum wirtschaftlichen<br />
Rückgrat der AG entwickelte. Außerdem besitzt die<br />
AG “Ems” die “Borkumer Kleinbahn- und Dampfschiffahrt AG”<br />
(heute eine <strong>GmbH</strong>), das Inselhotel VierJahresZeiten auf Borkum<br />
sowie Mehrheitsbeteiligungen an der Ostfriesische Lufttransport<br />
<strong>GmbH</strong> (22 Flugzeuge) und der Ostsee-Flug Rügen <strong>GmbH</strong>.<br />
Los 17 Schätzwert 75-125 €<br />
AG für Biervertrieb<br />
Berlin, Aktie 1.000 RM Jan. 1928 (Auflage<br />
150, R 6) EF<br />
Die 1900 gegründete AG übernahm die Berliner Generalvertretung<br />
der Pilsener Genossenschaftsbrauerei. Über vier Töchter-<br />
<strong>GmbH</strong>’s, Bierimport und Biervertrieb in Kannen und Flaschen.<br />
Als Alleinaktionär ist 1950 ein Mr. Arthur Kallman aus New York<br />
angegeben. 1953 nach Abschluß der Abwicklung gelöscht.<br />
Los 18 Schätzwert 50-150 €<br />
AG für Elektrizitäts-Industrie<br />
Hamburg, Aktie 1.000 Mark Sept. 1913.<br />
Gründeraktie (Auflage 1000, R 3) EF<br />
Gründung am 18.9.1912. Handel mit Erzeugnissen der Elektrizitätsindustrie.<br />
1929/30 übernahm die Gesellschaft die <strong>Deutsche</strong><br />
Leuchtröhren <strong>GmbH</strong> in Berlin. 1931 Umbennung in Agelindus<br />
AG, Hamburg. Niederlassungen in Berlin, Dresden,<br />
Frankfurt a.M., Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München,<br />
Nürnberg, Stuttgart. 1938 Sitzverlegung nach Berlin, Wilhelmstrasse<br />
6. Haupttätigkeit: mietweise Lieferung von Glühlampen<br />
und Lichtreklame-Anlagen. Betrieb während des Krieges ausgebombt<br />
und stillgelegt.<br />
Gegründet 1921 durch die <strong>Deutsche</strong> Continental-Gas-Gesellschaft<br />
als STASSFURTER EISENBAHNGESELLSCHAFT AG mit<br />
Sitz in Stassfurt. 1923 umfirmiert in Niederrheinische Elektrobank<br />
AG, ohne dass zunächst ein Geschäftsbetrieb aufgenommen<br />
wurde, zugleich Sitzverlegung nach Rheydt (in Rheydt betrieb<br />
die Contigas nach Erwerb der Werke von der Stadtgemeinde<br />
die Strom- und Wasserversorgung und war außerdem<br />
an der Elektrotechnischen Fabrik vorm. Max Schorch beteiligt).<br />
1926 Sitzverlegung zum Alleinaktionär nach Dessau und erneut<br />
umfirmiert in “Vereinigte Elektrizitäts- und Gaswerke Mitteldeutschlands<br />
AG”. Die Ges. hielt nun jeweils 100 %ige Beteiligungen<br />
an der Gewerkschaft Bornsdorf (Braunkohlenbergbau,<br />
rugender Betrieb), der Herzberger Licht- und Kraftwerke<br />
<strong>GmbH</strong> in Herzberg/Harz und der Berlin-Anhaltisches Handelskontor<br />
für Gas- und Elektrizitätswerke <strong>GmbH</strong>. Letzte Umfirmierung<br />
in “AG für Grundstücks- und Industriewerte” dann 1938.<br />
Los 21 Schätzwert 75-125 €<br />
AG für hygienischen Lehrbedarf<br />
Dresden, Sammelaktie 500 RM o.D. (R 6)<br />
EF-VF<br />
Ausgegeben wohl nach 1943.<br />
Gegründet 1923 zwecks Fortführung der Lehrmittelwerkstätten<br />
des <strong>Deutsche</strong>n Hygiene-Museums <strong>GmbH</strong> und des Pathoplastischen<br />
Instituts <strong>GmbH</strong> in Dresden. Die Gründung des <strong>Deutsche</strong>n<br />
Hygiene-Museums (1912) geht auf die Initiative des Dresdner<br />
Industriellen und Odol-Fabrikanten Karl August Lingner (1861-<br />
1916) zurück. Lingner war 1911 einer der Mitgestalter der I.<br />
Internationalen Hygiene-Ausstellung, zu der über 5 Mio. Besucher<br />
nach Dresden gekommen waren. Immer auf dem neuesten<br />
Stand der Wissenschaft, trug das Museum während der<br />
Weimarer Republik mit seinen allgemeinverständlichen Präsentationsformen<br />
maßgeblich zu einer Demokratisierung des<br />
Gesundheitswesens bei. Nach 1933 wurde das volksaufklärerische<br />
Gedankengut des Museums in den Dienst der nationalsozialistischen<br />
Rassenideologie gestellt. Während der DDR-Zeit<br />
nahm das Museum eine vergleichbare Aufgabe wahr, wie in der<br />
BRD die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.<br />
Los 22 Schätzwert 25-50 €<br />
AG für Industrie-Unternehmungen<br />
am Friedrichshain<br />
Berlin, Aktie 100 RM Berlin April 1930<br />
(Auflage 12500, R 2, nach Kapital -<br />
herabsetzung 1937 noch 5000) EF<br />
Gründung 1868 als Aktien-Brauerei Friedrichshain. 1920 Verkauf<br />
der Brauerei unter Ausschluß des Grundbesitzes an die<br />
Löwenbrauerei AG in Berlin-Hohenschönhausen gegen 2,7<br />
Mio. M in bar und 1,2 Mio. M in Löwenbrauerei-Aktien (mit 7,5<br />
% Dividendengarantie für 8 Jahre), zugleich Umfirmierung in<br />
“AG für Brauereiunternehmungen”. Erneute Umbenennung<br />
1926 in AG für Industrie-Unternehmungen am Friedrichshain<br />
und 1934 (auf Verlangen des Registergerichts) in AG für<br />
Grundstücksverwaltung am Friedrichshain. 1935/36 Verkauf<br />
des Grundstücks Am Friedrichshain 16-23, 1937 Verkauf des<br />
letzten bebauten Grundstücks in Berlin-Grunewald. 1960 wegen<br />
Nichtaufstellung einer DM-Eröffnungsbilanz aufgelöst.<br />
Los 23 Schätzwert 600-750 €<br />
AG für Korbwaarenindustrie<br />
vormals Amédée Hourdeaux<br />
Lichtenfels, Aktie 1.000 Mark 30.1.1890.<br />
Gründeraktie (Auflage 500, R 10) EF-VF<br />
Originalunterschriften Amédée Hourdeaux und Georg<br />
Saussenthaler für den Vorstand sowie Kommerzienrat<br />
Dr. Gustav Strupp (Bank für Thüringen<br />
vorm. B. M. Strupp) als AR-Vorsitzender. Sämtliche<br />
Vorkriegs-Ausgaben dieser Ges. waren bislang vollkommen<br />
unbekannt. Diese nach der Inflation zunächst<br />
auf 60 RM umgestellten Aktien wurden 1928<br />
an sich komplett in neue Stücke zu 100 und 1.000<br />
RM getauscht. Nur 5 Stück lagen im <strong>Reichsbankschatz</strong>,<br />
dies ist jetzt das letzte noch verfügbare.<br />
Kinderwagen von 1957 der Hourdeaux-<br />
Bergmann AG<br />
Aus dem im 18. Jh. noch zunftmäßig organisierten Handwerk<br />
der Weißkorbmacher entwickelte sich im Obermaingebiet eine<br />
vielfältige Korbindustrie, seit 1825 ein lizenzpflichtiges Gewerbe.<br />
In manchen Orten war 1/3 der gesamten Bevölkerung in der<br />
Korbmacherei beschäftigt. Davon zeugt noch heute das <strong>Deutsche</strong><br />
Korbmuseum in Michelau. Für den Absatz sorgten Korbhändler<br />
mit einem weltweiten Absatznetz selbst bis nach Amerika,<br />
Australien und Südafrika. Die wichtigsten Korbhandelshäuser<br />
wurden in Lichtenfels ansässig, wobei interessanter Weise<br />
nahezu alle der wohlhabenden Korbhandelsherren keine Einheimischen<br />
waren, sondern Zugewanderte wie der Franzose Amédée<br />
Hourdeaux. Er wandelte seine Firma 1890 in die “AG für<br />
Korbwaarenindustrie vormals Amédée Hourdeaux” um, und<br />
Los 15 Schätzwert 200-250 €<br />
AG “Ems”<br />
Emden, Actie 1.000 Mark 20.5.1922<br />
(Auflage 350, R 7) EF<br />
Los 19 Schätzwert 30-80 €<br />
AG für Gas und Elektrizität<br />
Breslau, Aktie 1.000 RM März 1940<br />
(Auflage 600, R 4) UNC-EF<br />
Gasversorger, gegründet 1887 in Solingen, Sitz zeitweilig in<br />
Köln, Breslau, ab 1943 Berlin. 1961 verlagert nach Bad Oeynhausen,<br />
1972 erloschen.<br />
Los 20 Schätzwert 400-500 €<br />
AG für Grundstücksund<br />
Industriewerte<br />
Dessau, Interimsschein über 1.000 Aktien<br />
zu 500 RM und 500 Aktien zu 1.000 RM<br />
vom 31.3.1939 (verbriefte 100 % des<br />
Kapitals, R 12), ausgegeben an den<br />
Alleinaktionär <strong>Deutsche</strong> Continental-Gas-<br />
Gesellschaft, Dessau F<br />
Maschinenschriftliche Ausführung auf Firmenbriefbogen,<br />
mit Originalunterschriften.<br />
Nr. 23<br />
3
zwar mit Hilfe der Bank für Thüringen vorm. B. M. Strupp in Meiningen<br />
und des Dresdner Bankhauses Gebr. Arnhold. 1908 mit<br />
dem Erwerb der Kinderwagen- und Holzwarenfabrik <strong>GmbH</strong> i.L.<br />
in Wasungen (1910 stillgelegt) Einstieg auch in die Produktion.<br />
1909 Fusion mit dem Mitbewerber Bergmann & Co. in Hirschaid<br />
und Lichtenfels, deshalb Umfirmierung in “AG für Korbwaren-<br />
und Kinderwagen-Industrie Hourdeaux-Bergmann”.<br />
Hergestellt wurden jetzt Kinder-, Puppen- & Stubenwagen, Holzwaren<br />
wie z.B. Kinderstühle, ferner Puppensportwagen, Schlitten,<br />
Korbwaren und Korbmöbel, Polstermöbel. 1921 Interessengemeinschaft<br />
mit der Bing-Werke AG in Nürnberg und Ausgliederung<br />
der Korbwarenabteilung in das Gemeinschaftsunternehmen<br />
Hourdeaux-Bing <strong>GmbH</strong> (1931/38 nach dem Zusammenbruch<br />
der Bing-Werke wieder zurück eingegliedert). 1924<br />
Börseneinführung in Berlin (nach dem Krieg dann in München<br />
notiert). 1943 bestanden Werke in Lichtenfels, Seubelsdorf, Hirschaid<br />
und Zapfendorf. Dann mußte das Werk Hirschaid auf höheren<br />
Befehl zur Rüstungsproduktion der Firma Kugelfischer in<br />
Schweinfurt zur Verfügung gestellt werden. 1952 Umfirmierung<br />
in Hourdeaux-Bergmann AG sowie Verlegung der Holzwarenfertigung<br />
von Seubelsdorf nach Hirschaid und Umsiedlung der Polstermöbelfertigung<br />
vom Werk Lichtenfels nach Seubelsdorf.<br />
Nach einem erneuten Aufschwung, der die Beschäftigtenzahl<br />
auf über 1.000 brachte, musste 1971 die Produktion eingestellt<br />
werden. Danach nur noch Verpachtung und schrittweise Verwertung<br />
der Grundstücke, der Sitz wurde nach Köln verlegt.<br />
1978 wurde die AG aufgelöst.<br />
Richter im Besitz der Vereinigte <strong>Deutsche</strong> Metallwerke AG<br />
(VDM AG), heute mgvv ag.<br />
Los 27 Schätzwert 275-350 €<br />
AG für Steinindustrie<br />
Rengsdorf bei Neuwied, Aktie 1.000 RM<br />
15.11.1929 (Auflage nur 30 Stück, R 9) VF<br />
Interessante Gestaltung im geometrischen Art Déco.<br />
Stücke dieser Ges. waren zuvor unbekannt gewesen!<br />
Kleine Randschäden fachgerecht restauriert.<br />
leichter interessieren konnte. Immerhin wurden ab 1892 bis<br />
zum 1. Weltkrieg ca. 300 Kleinbahnen gegründet. 1/3 davon<br />
baute die Lenz & Co. <strong>GmbH</strong>, deren Hausbank die BHG war.<br />
Nach Fusionen mit der Allg. <strong>Deutsche</strong>n Eisenbahn-Ges. (1927),<br />
der Westdeutschen Eisenbahn-Ged. (1928) und der <strong>Deutsche</strong>n<br />
Eisenbahn-Ges. AG (1929) gehörten 102 Bahnen mit 4.100<br />
km Gesamtlänge über Betriebsführungsverträge zum Konzern,<br />
außerdem war die AGV Aktionärin dutzender weiterer Kleinbahnen.<br />
1949 Sitzverlegung nach Hamburg, 1954 nach Frankfurt.<br />
1973 Fusion mit der ALOKA Allgemeine Organisations- und<br />
Kapitalbeteiligungs-AG (früher: Allgemeine Lokal- und Straßenbahn<br />
AG) zur AG für Industrie und Verkehrswesen, kurz AGIV.<br />
Mit der BHF-Bank als Großaktionär jahrzehntelang eine Holding<br />
mit Beteiligungen im Maschinenbau-, Eisenbahn-, Verkehrs-,<br />
Energie- und Immobilienbereich. Ab 2000 Verkauf aller übrigen<br />
Aktivitäten und 2003 Verschmelzung mit der HBAG Real Estate<br />
AG (ehemals Kühltransit AG) zur “neuen” AGIV, danach ausschließlich<br />
im Immobiliengeschäft tätig. Ende 2004 endet die<br />
einst glorreiche Firmengeschichte mit dem Insolvenzantrag.<br />
Ehrendfeld und Köln-Müngersdorf (Herbrandwerk) sowie Bautzen<br />
(Busch-Werke) wurden Güter-, Personen- und Straßenbahnwagen,<br />
Triebwagen, Dampf-, Diesel- und E-Lokomotiven,<br />
Dieselmotoren und Dampfkesselanlagen hergestellt, im (1934<br />
verkauften) Werk Warmbrunn bei Hirschberg (Füllnerwerk) Maschinen<br />
für Papierherstellung und -verarbeitung. 1934 wurde<br />
das operative Geschäft in die neugegründete Linke-Hofmann-<br />
Werke AG ausgegliedert (nach 1945 nach Salzgitter verlagert,<br />
heute Alsthom), die AG für Waggonbau-Werte wurde nach Verwertung<br />
des Restvermögens 1943 gelöscht.<br />
Los 31 Schätzwert 25-50 €<br />
AG für Webwaren und Bekleidung<br />
Breslau, Aktie 1.000 RM Juli 1940<br />
(Auflage 800, R 3) EF<br />
Gegründet 1921. Hergestellt und verkauft wurde Herrenoberbekleidung.<br />
1947 verlagert nach Herford, 1952 erloschen.<br />
Los 24 Schätzwert 20-40 €<br />
AG für Kraftstoff-Anlagen<br />
Dresden, 4 % Teilschuldv. 10.000 RM<br />
Nov. 1941 (Auflage 750 in 15 Serien zu<br />
50, R 4) EF<br />
Gründung 1940 durch die <strong>Deutsche</strong> Revisions- und Treuhand<br />
AG und die Garantie-Abwicklungsges. mbH (beide Berlin) und<br />
die Sächsische Staatsbank, die Sächsische Bank und die Industriefinanzierungs-Ges.<br />
mbH (alle Dresden) zur Errichtung von<br />
Anlagen für die Erzeugung von Kraftstoff. Die staatlich gelenkte<br />
Finanzierungsgesellschaft mit 150 Mio. RM Aktienkapital<br />
und 205 Mio. RM in drei Anleihen übernahm Beteiligungen bei<br />
den rechtlich selbständigen Hydrierwerks-Betreiberfirmen. Hintergrund<br />
war der kriegsbedingt immense Bedarf an synthetischem<br />
Kraftstoff, nachdem dem <strong>Deutsche</strong>n Reich nur in Rumänien<br />
eigene Erdölreserven zugänglich waren, und auch das<br />
nur bedingt. Deshalb entschied man sich etwa 1935 zum Bau<br />
von Hydrierwerken, in denen durch Hochdrucksynthese Benzin<br />
aus Kohle gewonnen wurde. Zur Anwendung kamen zwei Verfahren:<br />
Das Verfahren Bergius (der dafür 1931 den Chemie-<br />
Nobelpreis erhalten hatte) und das Fischer-Tropsch-Verfahren.<br />
Die größten Anlagen mit 400.000 t Jahreskapazität standen in<br />
Leuna-Merseburg, Pölitz bei Stettin (Bergius) sowie Schwarzheide<br />
(FT). Nach dem Krieg wurde die Technologie wegen des<br />
billigen Rohöls bedeutungslos, wurde aber in den 1970er Jahren<br />
in Südafrika wieder aufgegriffen (Anlagen Sasol 1 bis 3),<br />
nachdem gegen das Land wegen der Apartheid-Politik ein Ö-<br />
lembargo verhängt worden war.<br />
Los 25 Schätzwert 50-100 €<br />
AG für Licht- und Kraftversorgung<br />
München, Aktie 100 RM Aug. 1929<br />
(Auflage 3300, R 4) EF<br />
Gründung 1904 als AG Gaswerk Volkach, ab 1913 AG für<br />
Licht- und Kraftversorgung Dresden, 1919 Sitzverlegung nach<br />
München. Die 1923 gegründete Fränkische Licht- und Kraftversorgung<br />
AG, Bamberg, war die erste von zuletzt 15 größeren<br />
Beteiligungen (außer der Frankenluk auch beim Fränkischen<br />
Überlandwerk und der Württ. Elektrizitäts-AG). Unmittelbar<br />
wurden mit Schwerpunkt in der Pfalz über 1.000 Orte mit<br />
Strom und fast 200 Orte mit Gas versorgt. Börsennotiz München,<br />
1978 mit dem Großaktionär ThüGa fusioniert.<br />
Tagebau der AG für Steinindustrie<br />
Bei der Gründung 1921 durch Hermann und Robert Tedden mit<br />
Sitz in Rengsdorf, Kreis Neuwied (bis 1938, danach in Oberhausen,<br />
ab 1949 Neuwied) sicherte man sich erste Abbaurechte<br />
an enormen Vorkommen von Bims, Kies und Lava im<br />
Neuwieder Becken und in der Vordereifel, die die bis heute bestehende<br />
AG aus heutiger Sicht für noch einmal 80 Jahre beschäftigen<br />
können. Zunächst Bimsgewinnung auf einem vom<br />
Fürsten zu Wied gepachteten Gelände, 1922 Errichtung einer<br />
Bimssteinfabrik beim Bahnhof Neuwied und Erwerb der<br />
Schwemmsteinfabrik auf dem Werftgelände in Bendorf. 1931<br />
Beginn der Produktion von Hohlblocksteinen. 1942/43 kriegsbedingte<br />
Betriebsstilllegung. Die Gründer Hermann und Robert<br />
Tedden scheiden 1949 aus Altersgründen aus, Friedrich Wilhelm<br />
7. Fürst zu Wied wird Hauptaktionär. Ab 1969, nach Abbau<br />
und Rekultivierung aller rechtsrheinischen Flächen, wird<br />
massiv in neue Vorkommen in der Vordereifel investiert. 1992<br />
Erwerb eines Perlite-Vorkommens in Marokko. 2009 verkauft<br />
das Fürstenhaus die Aktienmehrheit an Erwin Hassel. Ein noch<br />
heute bedeutender Hersteller von Bau- und Zuschlagstoffen<br />
insbesondere für wärme- und schalldämmende Bausteine.<br />
Los 28 Schätzwert 20-50 €<br />
AG für Verkehrswesen<br />
Berlin, Aktie 1.000 RM Mai 1929 (Auflage<br />
20000, R 3) EF<br />
Schöner G&D-Druck, Flügelrad-Vignette.<br />
Gründung 1901 durch die BHG unter Carl Fürstenberg (als<br />
BHF-Bank noch bis 1999 Großaktionär der AGIV) und die Privatbanken<br />
Rob. Warschauer & Co. (Berlin) sowie den A. Schaafhausen’schen<br />
Bankverein (Köln). Grundlegende Idee war, die<br />
im einzelnen eher unverkäuflichen Kleinbahnaktien in eine Holding<br />
einzubringen, für die man das anlagesuchende Publikum<br />
Los 29 Schätzwert 75-100 €<br />
AG für Verwertung<br />
von Kartoffelfabrikaten<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark Mai 1923<br />
(Auflage 18000, R 8) EF<br />
Gründung 1912 zwecks Übernahme und Fortführung der Geschäftsbetriebe<br />
der “Verwertungsstelle für Kartoffelfabrikate<br />
mbH” in Berlin und der “Fabriken für Kartoffelfabrikate Frankfurt<br />
a.O. und Wronke <strong>GmbH</strong> i.L.”. Herstellung und Verwertung<br />
von Kartoffelmehl, Stärke, Sirup, Bonbonzucker, Dextrin und<br />
anderen Kartoffelfabrikaten. Fabriken zuletzt in Frankfurt a.O.,<br />
Zörbig und Rosenig, während die Fabriken in Wronke, Bronislaw<br />
und Birnbaum als Folge des 1. Weltkrieges 1919/20 an eine<br />
zu diesem Zweck neu gegründete poln. AG abgegeben werden<br />
mussten. Ab 1921 in Berlin börsennotiert. Ende 1925 nach<br />
erheblichen Verlusten in Liquidation gegangen.<br />
Los 30 Schätzwert 30-75 €<br />
AG für Waggonbau-Werte<br />
Berlin, Aktie 100 RM Juli 1934 (Auflage<br />
2195, R 4) EF<br />
Gründung 1871 als “Breslauer AG für Eisenbahn-Wagenbau”,<br />
bis 1934 als Linke-Hofmann-Busch-Werke AG firmierend. In<br />
den Werken Breslau (Linke-Werk und Hofmann-Werk), Köln-<br />
Los 32 Schätzwert 20-50 €<br />
AG für Zellstoffund<br />
Papierfabrikation<br />
Aschaffenburg, Aktie 1.000 Mark<br />
12.5.1917 (Auflage 10500, R 2) EF<br />
Großformatig. Umrandung mit keltischem Flechtband.<br />
Gründung 1872 als AG für Maschinenpapier-Fabrikation. Papierfabriken<br />
in Aschaffenburg und Memel. Ihren Holzbedarf<br />
deckte die Gesellschaft aus mehreren eigenen Waldgütern in<br />
Deutschland und Österreich-Ungarn, vor allem aber in Russland<br />
in den Gouvernements Pskow, Nowgorod und Oleniz. 1936 umfirmiert<br />
in Aschaffenburger Zellstoffwerke AG. 1970 Fusion mit<br />
der Zellstofffabrik Waldhof (gegr. 1884) zur PWA Papierwerke<br />
Waldhof-Aschaffenburg AG mit Sitz in München. 1998 vom<br />
schwedischen Konkurrenten Svenska Cellulosa AB übernommen<br />
und in SCA Hygiene Products AG umfirmiert. Das Werk A-<br />
schaffenburg-Stockstadt firmierte ab 1999 unter Modo Paper<br />
<strong>GmbH</strong>. 2000: Übernahme des Modo-Konzerns durch die finnische<br />
Metsä-Serla. Es entstand die größte Feinpapiergruppe in<br />
Europa. 2001: Umfirmierung des Mutterkonzerns in M-real und<br />
des Werkes Aschaffenburg-Stockstadt in M-real <strong>GmbH</strong>.<br />
Los 33 Schätzwert 125-250 €<br />
AG Gaswerk Bensheim<br />
Bensheim, Aktie 1.000 Mark Juni 1887.<br />
Gründeraktie (Auflage 180, R 5) EF-<br />
Gegründet 1886 als “Gaswerk Bensheim AG”, umfirmiert 1909<br />
nach Anschluß auch der Gemeinden Auerbach, Zwingenberg,<br />
Alsbach, Jugenheim, Bickenbach und Hähnlein in “Gruppengaswerk<br />
Bergstraße AG” und nach Aufnahme auch der Stromversorgung<br />
1914 in ”Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße<br />
AG”. Aktionäre: Die Städte Bensheim (63,1 %) und<br />
Zwingenberg (13,3 %) und die Gemeinden Alsbach (5,8 %),<br />
Bickenbach (5,1 %), Jugenheim (7,9 %), Seeheim (1,0 %) und<br />
Hähnlein (3,9 %). In dieser Struktur besteht das GGEW noch<br />
heute, macht mit ca. 150 Mitarbeitern rd. 160 Mio. € Jahresumsatz<br />
und beliefert rd. 140.000 Kunden. <strong>Der</strong> Strom wird von<br />
der Heag bezogen, Ferngas von der Südhessischen Gas- und<br />
Wasser AG in Darmstadt.<br />
Los 26 Schätzwert 125-200 €<br />
AG für Metallindustrie<br />
vormals Gustav Richter<br />
Pforzheim, Aktie 1.000 Mark 17.10.1899.<br />
Gründeraktie (Auflage 400, R 6) EF<br />
Gründung 1899 in Pforzheim zwecks Fortführung des Betriebes<br />
der Fa. Gustav Richter Tubenfabrik. Herstellung von Tuben,<br />
Tubenhütchen, Spritzkorken und Dosen. 1920 Sitzverlegung<br />
nach Karlsruhe. 1955 AG für Metallindustrie vorm. Gustav<br />
Nr. 27<br />
Nr. 37<br />
4
Nr. 33<br />
Los 34 Schätzwert 80-185 €<br />
AG Gesellschaft für<br />
Markt- & Kühlhallen<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark 1.4.1893<br />
(Auflage 1000, R 5) VF<br />
Originalsignaturen.<br />
Gründung 1890 in Berlin, dann 1895-1909 in München ansässig,<br />
1909 Sitzverlegung nach Hamburg. An der Gründung war<br />
Dr. Carl von Linde maßgeblich beteiligt. Die Gesellschaft besaß<br />
zunächst Kühlhäuser und Eisfabriken in Hamburg und Berlin,<br />
heute ist sie der größte deutsche Kühlhausbetreiber und Marktführer<br />
im Bereich der Tiefkühllogistik. Neben der Zentrale im<br />
Norden von München gibt es heute 26 MUK-Niederlassungen.<br />
Dr. Carl von Linde 1872<br />
Los 35 Schätzwert 75-150 €<br />
AG Gesellschaft für<br />
Markt- & Kühlhallen<br />
München, Aktie 1.000 Mark 27.4.1899<br />
(Auflage 1500, R 4) EF-VF<br />
Für den Aufsichtsrat<br />
unterschrieb die Aktie<br />
original der seinerzeitige<br />
Vorsitzende<br />
Dr. Carl von<br />
Linde (*1842 in<br />
Berndorf/Oberfranken,<br />
+1934 in München).<br />
Linde entwikkelte<br />
1873-76 die<br />
Ammoniak-Kompressionskältema-<br />
schine und gründete<br />
1879 die “Gesellschaft<br />
für Linde’s<br />
Eismaschinen”, die heutige Linde AG. 1895 gelang<br />
es ihm, Luft in kontinuierlichem Betrieb zu<br />
verflüssigen, woraus die weitere bedeutende<br />
Sparte “Technische Gase” seiner Firma entstand.<br />
Ein wichtiger Industrie-Autograph.<br />
Identische Gestaltung wie voriger Titel.<br />
Los 36 Schätzwert 60-120 €<br />
AG Gesellschaft für<br />
Markt- & Kühlhallen<br />
Hamburg, Aktie 1.000 Mark 2.12.1922<br />
(Auflage 8000, R 10) EF<br />
Großformatig, dekorative Ornamentumrandung. E-<br />
benfalls mit Originalunterschriften, für den Aufsichtsrat:<br />
Prof. Dr. Carl von Linde.<br />
Los 37 Schätzwert 125-250 €<br />
AG Glashüttenwerke “Adlerhütten”<br />
Penzig bei Görlitz, Aktie 1.000 Mark<br />
1.6.1900 (Auflage 1000, R 5) VF<br />
Sehr großformatig, mit prächtiger Umrahmung im<br />
Historismus-Stil in kräftigen Farben. Originalunterschriften.<br />
Wie auch das folgende Los ein zuvor völlig<br />
unbekannt gewesener Jahrgang!<br />
Nach Inbetriebnahme der Eisenbahn Kohlfurt-Görlitz im Jahr<br />
1846 siedelte sich 1858 in Penzig (13 km nördlich von Görlitz am<br />
Ostufer der Lausitzer Neisse, aber stadtrechtlich zu Görlitz gehörend,<br />
heute Piensk) die erste von später insgesamt 8 Glashütten<br />
an, begünstigt durch die nahe gelegenen Rohstoffvorkommen<br />
(Sand aus der Görlitzer Heide und reichlich Braunkohle). Die Einwohnerzahl<br />
des einstigen Bauerndorfes Penzig verzehnfachte<br />
sich dadurch bis zur Jahrhundertwende auf ca. 7.000. Die größte<br />
Penziger Glashütte war die 1887 gegründete und 1896 in eine<br />
AG umgewandelte “Adlerhütte”, mit 1200 Beschäftigten genauso<br />
gross wie Osram im benachbarten Weißwasser. Sie stellte<br />
zunächst Medizingläser her, ab 1900 auch Hohl-, Press- und<br />
Schleifglas. Eine besondere Spezialität waren Konservengläser,<br />
von denen riesige Mengen die Fabrik verließen (der Schlüssel<br />
zum späteren Interesse der Fa. Weck). Börsennotiz in Berlin und<br />
Breslau, Großaktionär waren die von Poncet Glashüttenwerke AG,<br />
Friedrichshain N.L. Beteiligt an der <strong>Deutsche</strong>n Luxor Prismen Ges.<br />
mbH, Berlin-Weisensee und der Adler Glashüttenwerke Verkaufsgesellschaft<br />
in Oeflingen (Baden). 1944 wurde in der Adlerhütte<br />
der erste Tonfilm über die Glasherstellung gedreht (der heute im<br />
Hessischen Glasmuseum in Immenhausen bei Kassel aufbewahrt<br />
wird). Gegen Ende des 2. Weltkrieges wurde Penzig weitgehend<br />
zerstört. Nach Vertreibung der deutschen Bewohner bauten die<br />
Polen drei der zerstörten Glashütten wieder auf. Piensk wurde erneut<br />
ein bedeutender Standort der Glasproduktion. Die AG selbst,<br />
ihres Werkes in Penzig verlustig gegangen, verlegte 1949 ihren<br />
Sitz nach Fürstenhagen bei Kassel. 1951 Umwandlung in <strong>GmbH</strong>.<br />
1958 in der Fa. J. Weck u. Co. KG aufgegangen, die mit ihren Einmachgläsern<br />
(“Einwecken”) eine heute verloren gegangene Haushaltstradition<br />
mit ihrem Namen prägte.<br />
Nr. 41 Nr. 46<br />
Los 39 Schätzwert 125-200 €<br />
AG Isselburger Hütte<br />
vorm. Johann Nering Bögel & Cie.<br />
Isselburg, Aktie 1.000 Mark 7.3.1906<br />
(Auflage 125, R 6) EF<br />
Faksimile-Unterschrift J.D. Nering-Bögel.<br />
Gegründet 1794 als Eisenhütte Minerva, AG ab 1874 als AG Isselburger<br />
Hütte vorm. Johann Nering Bögel & Cie., ab<br />
1.7.1939 Klöckner-Humboldt-Deutz Isselburger Hütte AG. Motorenguß,<br />
Bearbeitung von Eisen- und Stahlguß, Bau von Verbrennungsmotoren.<br />
1988 wurde das Werk Isselburg an die<br />
niederländische Gießereigruppe VGN verkauft. Heute Isselburg<br />
Guss und Bearbeitung <strong>GmbH</strong>.<br />
Anstrichfarben, Dichtungsmitteln und Dachpappen (Werk HH-<br />
Eidelstedt, Ottensener Str. 2-4) sowie von Nähr-, Stärkungsund<br />
Entfettungsmitteln, insbesondere Kindernährzucker in der<br />
Nährmittelfabrik München <strong>GmbH</strong>, Berlin-Spandau. 1951 Auflösungsbeschluß,<br />
1952 Vergleich, 1956 Fortsetzungsbeschluß.<br />
Sitzverlegungen 1959 nach Hamburg und 1975 nach Köln. E-<br />
benfalls 1975 Produktionseinstellung, fortan nur noch Verwaltung<br />
des Fabrikareals in Hamburg sowie von Gewerbeimmobilien<br />
in Köln, Berlin und Wuppertal. Seit 1990 fokussierte sich<br />
die immer noch börsennotierte Jeserich AG auf Logistikimmobilien<br />
und Gewerbeparks. Nach größeren Mietausfällen 2004<br />
insolvent geworden.<br />
Los 41 Schätzwert 300-500 €<br />
AG Norddeutsche Steingutfabrik<br />
Grohn bei Vegesack, Actie 1.000 Mark Mai<br />
1899 (Auflage nur 40 Stück, R 8) VF<br />
Gründung 1869 in Lesum. Auf dem 120.000 qm großen<br />
Werksgelände zwischen dem Bahnhof Grohn-Vegesack und<br />
der Lesummündung werden glasierte Wand- und Bodenfliesen<br />
hergestellt, bis 1890 auch Haushaltsgeschirr. 1920 Übernahme<br />
der benachbarten Mitbewerber Steingutfabrik Witteberg AG<br />
in Farge und Grohner Wandplattenfabrik AG. Die in Bremen,<br />
Berlin und Hamburg börsennotierte AG ist noch heute eines der<br />
erfolgreichsten Unternehmen seiner Branche.<br />
Los 42 Schätzwert 100-200 €<br />
AG Norddeutsche Steingutfabrik<br />
Grohn bei Vegesack, Actie 1.000 Mark<br />
1.10.1905 (Auflage 200, R 5) VF<br />
Gründung 1869 in Lesum. Auf dem 120.000 qm großen<br />
Werksgelände zwischen dem Bahnhof Grohn-Vegesack und<br />
der Lesummündung werden glasierte Wand- und Bodenfliesen<br />
hergestellt, bis 1890 auch Haushaltsgeschirr. 1920 Übernah-<br />
Nr. 36<br />
Los 38 Schätzwert 50-175 €<br />
AG Glashüttenwerke “Adlerhütten”<br />
Penzig bei Görlitz, Aktie 1.000 Mark<br />
1.7.1901 (Auflage 500, R 4) VF<br />
Originalunterschriften.<br />
Los 40 Schätzwert 25-50 €<br />
AG Johannes Jeserich<br />
Berlin-Charlottenburg, Aktie 100 RM Okt.<br />
1936 (Auflage 3000, R 3, kpl. Aktien-<br />
Neudruck) EF+<br />
Gründung 1862, Umwandlung 1888 in die “AG für Asphaltierung<br />
und Dachbedeckung vorm. Johannes Jeserich”, seit 1913<br />
kurz “AG Johannes Jeserich”. Straßen- und Straßendeckenbau<br />
(Niederlassungen in Berlin-Charlottenburg, Königsberg i.Pr.,<br />
Breslau, Stettin und Posen), Herstellung von Rostschutz- und<br />
me der benachbarten Mitbewerber Steingutfabrik Witteberg AG<br />
in Farge und Grohner Wandplattenfabrik AG. Die in Bremen,<br />
Berlin und Hamburg börsennotierte AG ist noch heute eines der<br />
erfolgreichsten Unternehmen seiner Branche.<br />
Mindestgebot: 80 %<br />
vom unteren Schätzwert<br />
5
Los 43 Schätzwert 125-200 €<br />
AG Portland-Cementwerk Berka a. Ilm<br />
Bad Berka, 5,5 % Teilschuldv. 1.000 Mark<br />
2.1.1918 (Auflage 600, R 7) EF-<br />
1926 aufgewertet auf 120 RM.<br />
Bereits 1899 trafen sich 30 finanzkräftige lokale Investoren unter<br />
Führung des Weimarer Bankhauses Elkan im Hotel “Russischer<br />
Hof” in Weimar, um das Projekt zu diskutieren. 1901<br />
wurde die AG gegründet, noch im gleichen Jahr ging das Zementwerk<br />
nahe dem Haltepunkt Schloßberg der Weimar-Berkaer<br />
Bahn mit 77 Arbeitern und 10 Angestellten in Betrieb. <strong>Der</strong><br />
dort bis zu 80 m hoch anstehende Muschelkalkstein wurde<br />
nördlich der Ilm an der Rauschenburg abgebaut und per Seilbahn<br />
in das 80 m tiefer liegende Zementwerk geschafft. <strong>Der</strong><br />
notwendige Mergelton kam per Kippwagen aus einer Tongrube<br />
im Ilmtal. Außerdem betrieb die Ges. ab 1908 auch eine Ueberlandzentrale<br />
und versorgte den bekannten Kurort Bad Berka<br />
bei Weimar und umliegende Ortschaften mit elektrischer E-<br />
nergie. Technische Probleme beeinträchtigten das relativ kleine<br />
Werk immer wieder, das schließlich nur noch saisonal produzierte<br />
und 1939 vorläufig ganz stillgelegt wurde; die Gebäude<br />
wurden zu Lagerzwecken an die Wehrmacht vermietet. 1946<br />
wurde die Zementproduktion wieder aufgenommen, 1948 enteignet<br />
und als VEB Zementwerk Bad Berka der VVB Zement<br />
Halle unterstellt (1964 Anschluss an den VEB Zementwerke<br />
Göschnitz und 1968 an den VEB Zementwerke Karsdorf). Gegen<br />
eine 1961 geplante Werkserweiterung liefen wegen der<br />
erhöhten Staubbelastung der Luft vor allem die örtlichen Kureinrichtungen<br />
Sturm und setzten sich auch durch: Statt Zement<br />
wurden in dem Werk an der Ilm ab 1971 Dämmstoffe (Mineralwolle)<br />
produziert. Nach der Wende 1991 zunächst als “Vereinigte<br />
Dämmstoffwerke und Mineralwolle <strong>GmbH</strong>” tätig. <strong>Der</strong><br />
Gesamtvollstreckung 1993 folgte eine Neugründung als Berkatherm<br />
<strong>GmbH</strong> (ab 1994 Thüringer Dämmstoffwerke <strong>GmbH</strong>).<br />
Nach Investitionen von über 30 Mio. DM mit rd. 160 Mitarbeitern<br />
am Markt sehr erfolgreich, 1999 durch die österreichische<br />
Heraklith-Gruppe übernommwn worden.<br />
Los 45 Schätzwert 20-40 €<br />
AG Schwabenbräu<br />
Düsseldorf, Aktie 100 RM Jan. 1929<br />
(Auflage 3000, R 2) EF<br />
Mit Firmensignet.<br />
Gründung 1875 zum Fortbetrieb der seit 1823 bestehenden<br />
“Brauerei-Gesellschaft Schwabenbräu Kels & Wiedemeyer”<br />
(die in der Münster Straße gelegene Brauerei existierte schon<br />
seit 1755). Übernommen wurden ferner die Alemannia-Brauerei<br />
in Rheydt und die Gambrinus-Brauerei in Moers (1905), die<br />
Adler-Brauerei in Düsseldorf (1918), die Brauerei Tivoli in Krefeld<br />
(1921) sowie die bis heute für ihr Altbier weit bekannte<br />
Brauerei Schlösser <strong>GmbH</strong> in Düsseldorf (1929). Ferner besaß<br />
die AG das Hotel “Fürstenhof” am Kölner Dom. Bis 1944 in Berlin,<br />
ab 1948 in Düsseldorf börsennotiert. 1967 Eingliederung in<br />
den DUB-Konzern (heute Brau und Brunnen AG).<br />
Los 46 Schätzwert 500-625 €<br />
AG Thonwerke Kandern<br />
Kandern, Namensaktie 1.000 Mark<br />
1.7.1899 (Auflage nur 82 Stück, R 9),<br />
ausgestellt auf den seinerzeitigen<br />
Vorstand der Gesellschaft A. Dewitz EF-<br />
Großformatiges Papier, sehr dekorativ verziert.<br />
Gründung 1889, hervorgegangen aus der schon seit 1837 im<br />
badischen Kandern bestehenden Firma Wolman, Dewitz & Co. In<br />
zwei Werken in Kandern mit rd. 150 Mann Belegschaft wurden in<br />
drei Brennöfen Dachziegel aller Art und Backsteine hergestellt.<br />
Großaktionär war mit zuletzt über 80 % die Badische Bank,<br />
Karlsruhe. 1954 Umwandlung in die Tonwerke Kandern Georg<br />
Gott <strong>GmbH</strong>. 1998 schließlich wurde der Betrieb stillgelegt.<br />
Los 48 Schätzwert 150-250 €<br />
AG Vereinigte Gaswerke<br />
Augsburg, Aktie 4. Em. 1.000 Mark<br />
11.3.1910 (Auflage 1000, R 6) EF-<br />
Originalunterschrift Gust. Riedinger (aus der Familie<br />
der Textilfabrikanten) für den Vorsitzenden.<br />
Wertpapiere dieser einstmals bedeutenden Ges.<br />
waren zuvor vollkommen unbekannt!<br />
Nach der Gründung 1883 durch Augsburger Kaufleute und Industrielle<br />
wurden 24 Gasanstalten erbaut oder erworben (Asch,<br />
Baja, Bozen, Chrudim, Donzdorf, Göggingen, Grosswardein,<br />
Gunzenhausen, Isola, Kalisch, Königenhof, Langenschwalbach,<br />
Neusatz, Osiwecim, Parenzo, Petrikau, Pirano, Rovigo, Sennheim,<br />
Stuhlweissenburg, Szczakowa, Tomaschow, Warnsdorf)<br />
sowie 7 Elektrizitätswerke (Chrudim, Gunzenhausen, St. Joachimstal,<br />
Königswart, Langenschwalbach, Lussin, Pirano), außerdem<br />
Betrieb der elektrischen Strassenbahn Pirano-Portorose-Santa<br />
Lucia im Südwesten des heutigen Slowenien. Ab 1910<br />
in Augsburg börsennotiert. Als Folge des 1. Weltkrieges gingen<br />
die meisten Werke verloren, der Rest bis auf das 1911 in Betrieb<br />
genommene Gaswerk Göggingen wurde später verkauft. 1937<br />
Sitzverlegung nach München, nachdem die AG für Licht- und<br />
Kraftversorgung die Aktienmehrheit erworben hatte. Diese stellte<br />
im Rahmen eines Beratungs- und Betriebsführungsvertrages<br />
auch den Vorstand und die leitenden Angestellten, die AG selbst<br />
hatte nur noch 16 Beschäftigte im Gaswerk Göggingen (Bayerstr.<br />
135, Einstellung der Eigenerzeugung 1951 nach Anschluss<br />
an das Ferngasnetz, heute ist auf dem Gelände die Erdgas<br />
Schwaben ansässig). 1979 aufgegangen in der Thüga.<br />
Das Gaswerk in Göggingen (mit zwei Gasbehältern)<br />
keller in der Chemnitzer Straße lieferte Biersorten wie Pilsperle,<br />
Kernbräu und Lagerkeller Kulm. Ab 1911 auch kgl. sächsischer<br />
Hoflieferant. 1920 wurde der Betrieb für 15 Jahre an die<br />
Schloßbrauerei Niederporytz e<strong>GmbH</strong> verpachtet. Wegen unzureichender<br />
Erträge führten beide Brauereien danach lange Prozesse,<br />
die Vertragskündigung 1938 zog einen erneuten Prozeß<br />
nach sich. Später firmierte die Brauerei als “Falkenbrauerei<br />
<strong>GmbH</strong>” (Marke Bärenbräu). 1980 nach Fertigstellung der neuen<br />
Großbrauerei in Dresden-Coschütz endgültig stillgelegt.<br />
Los 51 Schätzwert 125-200 €<br />
Aktien-Brauerei Cöthen AG<br />
Cöthen, VZ-Aktie 25.000 Mark 11.8.1923<br />
(Auflage 140, R 7) EF-<br />
Gründung 1861, AG 1883 (ABC). In der Brauerei in der Stiftstr.<br />
7 wurden untergärige Biere (Cöthener Pilsener und Cöthener<br />
Meisterbräu), obergäriges Cöthener Malzbier, alkoholfreie Getränke,<br />
Eis und Futtermittel produziert. Großaktionär war die<br />
Engelhardt-Brauerei AG, Berlin. 2003 zog die Köthener Brauerei<br />
<strong>GmbH</strong>, die im Jahr 1992 aus der ehemaligen Brauerei Köthen<br />
entstand, aus den historischen Gemäuern um, in ein modernes,<br />
neu gebautes Logistikzentrum. Neben dem Köthener<br />
und dem Hubertus Sortiment vertreibt die Köthener Brauerei<br />
auch das neue Köthener Brauhaus Premium Pils.<br />
Los 44 Schätzwert 175-300 €<br />
AG Reederei “Norden-Frisia”<br />
Norderney, Aktie 1.000 Mark 1.12.1917<br />
(Auflage 322, R 7) VF+<br />
Minimale Randeinrisse fachgerecht restauriert,<br />
insgesamt weit über Durchschnitt erhalten.<br />
1871 Gründung der Dampfschiffs-Reederei “Norden” als Partenreederei,<br />
1872 Eröffnung des Sommerverkehrs auf der Linie<br />
Norddeich-Norderney, ab 1888 auch fahrplanmäßige Verbindung<br />
Norddeich-Juist. Die Hotels “Fährhaus” und “Norddeich”<br />
in Norddeich gehörten ebenfalls der Reederei. 1898 Bau<br />
einer Pferdeeisenbahn zwischen der Juister Landungsbrücke<br />
und dem Inselbahnhof, 1899 wird die Bahn motorisiert. 1906<br />
erscheint mit der Dampfschiffs-Reederei “Frisia” ein Konkurrent<br />
auf der Linie Norddeich-Norderney, 1917 fusionieren beide<br />
Linien zur “AG Reederei Norden-Frisia”, nachdem die Reederei<br />
“Norden” 1910 in eine AG umgewandelt worden war.<br />
1920 Fusion mit der AG Reederei “Juist”, die erst 1908 aus der<br />
Reederei “Norden” ausgegliedert worden war. 1931 Inbetriebnahme<br />
der ersten Großgarage in Norddeich. 1969 Gründung<br />
der FRISIA Luftverkehr <strong>GmbH</strong> für Flüge zwischen dem Festland<br />
und den Nordseeinseln.<br />
Los 47 Schätzwert 75-150 €<br />
AG Tonwerke Kandern<br />
Kandern, Namensaktie 1.000 Mark<br />
15.12.1921 (Auflage 400, R 7) EF-<br />
Großformatiges Papier, sehr dekorativ gestaltet.<br />
Nr. 48<br />
Los 49 Schätzwert 30-75 €<br />
Aktien-Bierbrauerei Mittweida<br />
Mittweida, Aktie 100 RM 7.5.1930<br />
(Auflage 2950, R 3, kompletter<br />
Aktienneudruck) UNC-EF<br />
Im Unterdruck Ansicht einer Oase mit zwei Löwen<br />
an der Tränke.<br />
Gründung 1900 unter Übernahme der 1874 errichteten Brauerei<br />
von Keilhauer & Liebers in der Bahnhofstr. 15; eine Niederlage<br />
bestand in Chemnitz. <strong>Der</strong> kleine Betrieb (mit ca. 50<br />
Mitarbeitern wurden knapp 40.000 hl jährlich gebraut) war mit<br />
oft zweistelligen Dividenden hochrentabel. 1953 verstaatlicht<br />
und als “VEB Mittweidaer Löwenbräu” fortgeführt, 1968 Anschluß<br />
an das Getränkekombinat Karl-Marx-Stadt. Dem Mittweidaer<br />
Betrieb zugeordnet wurden 1981 auch die Brauereien<br />
Penig und Hartmannsdorf sowie die Erfrischungsgetränke<br />
Burgstadt. 1994 wurde die inzwischen unter Denkmalschutz<br />
stehende Mittweidaer Löwenbräu <strong>GmbH</strong> als letzte sächsische<br />
Brauerei wieder privatisiert.<br />
Los 50 Schätzwert 125-200 €<br />
Aktien-Bierbrauerei zum Lagerkeller<br />
Dresden, VZ-Aktie 1.000 Mark Sept. 1921<br />
(Auflage 150, R 6) EF-VF<br />
1872 Gründung als Actien-Bierbrauerei zum Plauenschen Lagerkeller<br />
(1919 umbenannt wie oben). <strong>Der</strong> Plauensche Lager-<br />
Los 52 Schätzwert 20-40 €<br />
Aktien-Maschinenfabrik<br />
“Kyffhäuserhütte” vormals Paul Reuß<br />
Artern, Aktie 100 RM 20.9.1941 (Auflage<br />
1300, R 3) EF<br />
Gründung 1881, AG seit 1897. Die Gesellschaft stellte landwirtschaftliche<br />
Maschinen her (Milch-Separatoren, Dämpfapparate,<br />
Lupinen-Entbitterungs-Anlagen, Kartoffel-Waschmaschinen,<br />
Schrotmühlen, Jaucheschleudern und -pumpen).<br />
1910 Aufnahme der Produktion von Motoren durch Fusion mit<br />
der Ergon-Kosmos AG in Karlsruhe. 1912 Angliederung der<br />
Ruhrwerke Motoren- und Dampfkesselfabrik AG in Duisburg.<br />
1937/38 Erweiterung bzw. Errichtung von Filialen in Elbing und<br />
Nürnberg. Börsennotiz Berlin und Halle, später Leipzig. Zu<br />
DDR-Zeiten war die Kyffhäuserhütte der größte Hersteller von<br />
Molkereimaschinen. Nach der Wende von der Treuhandanstalt<br />
privatisiert, bald darauf stillgelegt: 2200 Menschen wurden arbeitslos.<br />
Los 53 Schätzwert 100-200 €<br />
Aktien-Ziegelei Langensalza AG<br />
Langensalza, Aktie 1.000 Mark 29.1.1891<br />
(überdruckt 4.6.1923; Auflage 387, R 5) EF<br />
Sehr dekorative Umrahmung im Historismus-Stil.<br />
Über ein halbes Jahrhundert lang backte der Betrieb im Tal der<br />
Unstrut (knapp 30 km nordwestlich von Erfurt) tagein, tagaus<br />
nichts als Ziegel. Besonderen Ehrgeiz kann der Chronist dem<br />
Vorstand Kurt Petersilie nicht bescheinigen: 100.000 Mark<br />
6
Jahresumsatz durfte man schon als Spitzenwert betrachten.<br />
Meist reichte es dennoch zu einer Dividende. Nach 1945 dann<br />
enteignet.<br />
Los 54 Schätzwert 30-50 €<br />
Albingia-Keks-Werke<br />
Bolle & Heinrich AG<br />
Schönebeck-Elbe, Aktie 1.000 Mark Juni<br />
1923 (Auflage 21000, R 6) EF<br />
Gründung 1923 unter Übernahme und Fortführung des von der<br />
oHG Albingia-Keks-Werke Bolle & Heinrich betriebenen Handelsgeschäftes.<br />
1925 bereits Konkurs.<br />
Los 55 Schätzwert 75-125 €<br />
Alfred Gutmann AG<br />
für Maschinenbau<br />
Hamburg, Aktie 1.000 RM Mai 1931<br />
(Auflage 354, R 6) EF<br />
Gründung 1898 unter Übernahme der 1885 gegründeten Firma<br />
Alfred Gutman, Altona-Ottensen. Erzeugnisse: Sandstrahlgebläse<br />
für alle Zweige der Industrie, Formmaschinen, Kupolöfen,<br />
Misch- und Mahlmühlen, Begichtungsanlagen, Aufzüge,<br />
Hebezeuge, Schmelzöfen, Zerkleinerungsmaschinen, Wasserfilter.<br />
Ab 1998 mehrfacher Besitzerwechsel, zuletzt, 2004 an<br />
die Wheelabrator mit Sitz in Köln. Die letzten Produktionsstandorte<br />
der vormaligen Alfred Gutmann Ges. für Maschinenbau<br />
<strong>GmbH</strong> wurden 2006 geschlossen.<br />
Los 57 Schätzwert 25-50 €<br />
Allgemeine Baugesellschaft<br />
Lenz & Co. (Kolonial-Gesellschaft)<br />
Berlin, Anteil 1.000 RM Jan. 1933<br />
(Auflage 1800, R 3) EF<br />
1881 Gründung der Baufirma Friedrich Lenz. Ausführung von<br />
Hoch- und Tiefbauarbeiten, insbesondere Ausbau des deutschen<br />
Eisenbahnnetzes, vor allem in Pommern und Mecklenburg.<br />
1892 Umwandlung in Lenz & Co. <strong>GmbH</strong>. 1901 Gründung<br />
der AG für Verkehrswesen in Berlin als Finanzierungsgesellschaft<br />
der Firma Lenz & Co. <strong>GmbH</strong>, gleichzeitig Sitzverlegung<br />
von Stettin nach Berlin. Als 1904 große Tiefbauten, vorwiegend<br />
Eisenbahnbauten in den deutschen Kolonien in Afrika, begonnen<br />
wurden, gründete die AG für Verkehrswesen 1905 die<br />
<strong>Deutsche</strong> Kolonial-Eisenbahnbau- und Betriebsgesellschaft.<br />
Diese teilte sich mit der Lenz & Co. <strong>GmbH</strong> die Tätigkeit in den<br />
Kolonien. Von den insgesamt 4.348 km fertiggestellten afrikanischen<br />
Bahnen wurden allein 1.702 km von diesen beiden<br />
Gesellschaften erstellt. Mit dem Ende der Kolonialtätigkeit<br />
durch den 1. Weltkrieg verlagerten sich die Interessen wieder<br />
nach Deutschland. 1927 änderte die <strong>Deutsche</strong> Kolonial-Eisenbahnbau<br />
ihren Namen in Allgemeine Baugesellschaft Lenz &<br />
Co. (Kolonial-Gesellschaft) und übernahm das Personal sowie<br />
den gesamten Bestand an Bauaufträgen der Lenz & Co <strong>GmbH</strong>.<br />
1947 Umwandlung in Allgemeine Baugesellschaft Lenz & Co.<br />
AG. 1948 Sitzverlegung nach Hamburg. 1952 Umbenennung<br />
in Lenz-Bau AG. 1976 in Konkurs.<br />
Los 58 Schätzwert 200-250 €<br />
Allgemeine <strong>Deutsche</strong> Credit-Anstalt<br />
Leipzig, Aktie Lit. B 100 RM 8.3.1928<br />
(Auflage 20000, R 9) EF<br />
Zuvor ganz unbekannt gewesener Jahrgang, nur 7<br />
schon alt entwertete Stücke lagen im <strong>Reichsbankschatz</strong>.<br />
Die ADCA entstand 1858 nach dem Vorbild des französischen<br />
Credit Mobilier auf Initiative seinerzeit maßgeblicher Kaufleute<br />
und Politiker wie Gustav Harkort und A. Dufour-Feronce. Sie<br />
war die erste Aktienbank moderner Prägung in ganz Deutschland.<br />
Anfangs stand das Gründungs- und Beteiligungsgeschäft<br />
im Vordergrund. So gehörte die ADCA z.B. zu den Mitgründern<br />
der Lübecker Handelsbank (heute <strong>Deutsche</strong> Bank Lübeck) und<br />
der Schweizerischen Creditanstalt in Zürich. Bis nach der Jahrhundertwende<br />
dehnte sie sich durch stetige Übernahme anderer<br />
Institute soweit aus, dass sie zu den Großbanken gezählt<br />
wurde. Nach 1945 wurde der ADCA ihre schwerpunktmäßige<br />
Betätigung in Mitteldeutschland zum Verhängnis. Erst 1964<br />
konnte, aufbauend auf der einzig verbliebenen Berliner Niederlassung,<br />
ein Neuanfang versucht werden. Nach glückloser Entwicklung<br />
und mehrfachem Aktionärswechsel (u.a. Wells Fargo<br />
und die NORD/LB) wurde die ADCA schließlich Anfang der<br />
1990er Jahre von der niederländischen Rabobank übernommen<br />
und entsprechend umbenannt.<br />
Los 59 Schätzwert 40-80 €<br />
Allgemeine <strong>Deutsche</strong> Credit-Anstalt<br />
Leipzig, Aktie Lit. B 100 RM 4.6.1932<br />
(Blankette, R 5) EF<br />
Geschichte siehe voriges Los.<br />
Los 60 Schätzwert 75-125 €<br />
Allgemeine <strong>Deutsche</strong> Ziegel-AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 RM März 1933<br />
(Auflage 150, R 7) EF<br />
Gründung im Aug. 1929. Herstellung und Vetrieb von Ziegeleierzeugnissen.<br />
3 Ziegeleien in Weseram und Götz bei Brandenburg<br />
und in Nitzow bei Havelberg. Ab 1937 in stiller Abwicklung.<br />
Los 61 Schätzwert 75-125 €<br />
Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft<br />
Berlin, 7 % Gold Debenture 500 $<br />
15.1.1925 (R 5) VF<br />
Olivgrün/schwarzer Stahlstich, allegorische Vignette<br />
mit Elektromotor.<br />
Allgemeine <strong>Deutsche</strong> Credit-Anstalt um 1935<br />
Gründung 1883 durch Emil Rathenau als “<strong>Deutsche</strong> Edison-<br />
Gesellschaft für angewandte Elektricität”, 1887 Umfirmierung<br />
in AEG. Beim Besuch der Weltausstellung in Philadelphia lernte<br />
Emil Rathenau die epochemachenden Erfindungen von Thomas<br />
A. Edison kennen. Es gelang ihm, die Patente für Deutschland<br />
zu erwerben. Zu Recht wird Rathenau als der Begründer<br />
der elektrischen Großindustrie in Deutschland bezeichnet. Was<br />
mit der Herstellung von Glühlampen begann, entwickelte sich<br />
bald zu einem Unternehmen, das auf allen Gebieten der Elektrotechnik<br />
eine führende Rolle spielte - lange blieb der Wettstreit<br />
mit Siemens & Halske um den ersten Platz unentschieden.<br />
<strong>Der</strong> Niedergang nach dem 2. Weltkrieg mündete schließlich<br />
1985 in der Mehrheitsübernahme durch den Daimler-<br />
Benz-Konzern, der unter dem Vorstandsvorsitzenden Edzard<br />
Reuter (Sohn des legendären Berliner Nachkriegs-OB) vom<br />
Aufbau eines umfassenden Technologiekonzerns als Welt-AG<br />
träumte. Als auch dieser Traum ausgeträumt war, löste Daimler-Benz<br />
(nun unter Reuters Nachfolger Jürgen Schrempp) die<br />
AEG 1996 auf.<br />
Los 62 Schätzwert 225-375 €<br />
Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft<br />
Berlin, Sammelaktie 1.000 x 1.000 RM<br />
März 1943 (R 7) UNC<br />
Geschichte siehe voriges Los.<br />
Los 63 Schätzwert 75-125 €<br />
Allgemeine Elementar-Versicherung<br />
Wien, Aktie 300 RM Sept. 1940 (Auflage<br />
20000, R 6) EF<br />
Gründung 1898 zum Zwecke, dem 1896 gegründeten Versicherungsverband<br />
österr. und ung. Industrieller Rückendeckung<br />
zu gewähren. 1901 wurde die Transportversicherung, 1902<br />
und 1903 die Unfall- und Haftpflicht und 1909 die Versicherung<br />
gegen Einbruchdiebstahl und die Versicherung von Renn-<br />
, Luxus- und höherwertigen Pferden aufgenommen. Ab 1921<br />
Anglo-Elementar-Versicherungs-AG, ab 1939 Allgemeine Elementar<br />
Versicherungs-AG, seit 1946 wie vorher. 1997 endgültige<br />
Eingliederung in den Allianz-Konzern (Allianz Elementar<br />
Versicherungs-AG, Wien).<br />
Los 64 Schätzwert 125-250 €<br />
Allgemeine Gold- &<br />
Silber-Scheide-Anstalt<br />
Pforzheim, (Interims)-Namens-Actie 500<br />
Mark 1.4.1897 (Auflage 500, R 5) UNC-<br />
Blumenrankwerk-Umrahmung, Originalunterschriften,<br />
u.a. Ferd. Kiehnle als Vorsitzender des<br />
Aufsichtsrates und Carl Mondon als Direktor.<br />
Gründung 1891 in Pforzheim, bis heute das Zentrum der deutschen<br />
Schmuck- und Uhrenindustrie. Das Werk in der Kanzler-<br />
Los 56 Schätzwert 75-125 €<br />
Allgemeine Baugenossenschaft<br />
Stettin e<strong>GmbH</strong><br />
Stettin, 4,5 % Teilschuldv. 100 Mark Sept.<br />
1912 (Auflage 2121, R 7) EF-.<br />
<strong>Der</strong> Baugenossenschaft gehörten in Stettin Wohnhäuser am<br />
Hans-Hoffmann-, Graßmann-, Lorenz- und Hildebrandt-Weg.<br />
Nr. 58 Nr. 62<br />
7
die “freiwillige Gleichschaltung”, der Stahlhelm<br />
wurde in die Sturmabteilungen (SA) als so genannte<br />
SA Reserve I eingegliedert. Das Stahlhelmheim<br />
wurde bis 1945 von der SA genutzt. Nach Ende<br />
des II. WK übernehm der Freie <strong>Deutsche</strong> Gewerkschaftsbund<br />
(FDGB) das Objekt und betrieb es als<br />
Erholungsheim. Seit 1989 steht es leer.<br />
Umwandlung der Gewerkschaft Zeche Anhalt in eine AG (Anhaltische<br />
Kohlenwerke). 1908 Sitzverlegung von Frose nach<br />
Halle a.S. und 1940 nach Berlin. Die Betriebe in der Sowjetzone<br />
wurden nach 1945 entschädigungslos enteignet. 1950 verlagert<br />
nach Berlin (West), 1983 umgewandelt in AK-Vermögensverwaltungs-<strong>GmbH</strong>,<br />
Berlin (West), heute mit Geschäftssitz<br />
in Düsseldorf.<br />
Identische Gestaltung wie folgendes Los.<br />
strasse wurde im Laufe der Zeit zu einer der führenden Scheideanstalten<br />
in Europa ausgebaut. Neben der Scheidung von<br />
gold- und silberhaltigen Barren und dem Verkauf von Feingold<br />
und Feinsilber sind auch die für die Schmuckwarenfabrikation<br />
erforderlichen Chemikalien und Edelmetall-Legierungen im<br />
Lieferprogramm. Bis hin nach Thailand werden vor allem Goldschmiedewerkstätten<br />
beliefert. Daneben auch eigene Kupfer-<br />
Elektrolyse sowie Aufbereitung von und Handel mit Basismetallen<br />
aller Art. In den 60er Jahren begann der Frankfurter Konkurrent<br />
Degussa die im Frankfurter Telefonverkehr notierten A-<br />
gosi-Aktien aufzukaufen und besaß zuletzt über 90 %. 2002<br />
ging das Aktienpaket an die belgische Umicore-Gruppe.<br />
Los 65 Schätzwert 25-50 €<br />
Allgemeine Lokalbahnund<br />
Kraftwerke-AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 RM Jan. 1942 (Auflage<br />
6000, R 3) EF+<br />
<strong>Der</strong> 1880 gegründeten “<strong>Deutsche</strong> Lokal- und Strassenbahn-Gesellschaft”<br />
gelang ein atemberaubender Aufstieg: Alles begann<br />
mit der gerade einmal 6 km langen Pferdebahn Mönchengladbach-Rheydt,<br />
am Ende war die 1890 in “Allgemeine Lokal- und<br />
Straßenbahn-Gesellschaft” umbenannte Firma der größte deutsche<br />
Straßenbahn-Konzern. Die Beteiligungen reichten von der<br />
Zugspitzbahn bis zu den Verkehrsbetrieben Danzig-Gotenhafen.<br />
1890 übernahm die AEG die Mehrheit, um sich bei der Umstellung<br />
der bis dahin pferde- oder dampfbetriebenen Bahnen auf<br />
elektrischen Antrieb einen bedeutenden Absatz der eigenen Produkte<br />
zu sichern. 1923 Umfirmierung in Allgemeine Lokalbahnund<br />
Kraftwerke AG. Sitzverlegungen 1949 nach Hannover und<br />
1954 nach Frankfurt/Main. 1974 Aufnahme der AG für Verkehrswesen<br />
und Verschmelzung zur AGIV, einer Verkehrs-, Bauund<br />
Maschinenbau-Holding, die bis zu ihrer Zerschlagung 2002<br />
mehrheitlich der BHF-Bank gehörte.<br />
Los 66 Schätzwert 150-250 €<br />
Allgemeine Speditions-Gesellschaft AG<br />
Duisburg, Aktie 1.000 Mark 1.1.1916<br />
(Auflage 300, R 7) EF-VF<br />
Gründung 1910 unter Übernahme der Firma Aug. Heuser<br />
<strong>GmbH</strong>, Duisburg. Schifffahrt sowie Spedition und Lagereibetrieb.<br />
Gehörte zur Bayerischen Rheinschiffahrtsgruppe (Rhenania-Konzern).<br />
Heute gehört Rhenania zur Wicaton Gruppe.<br />
Los 67 Schätzwert 150-200 €<br />
Allgemeine Wohnungs- und Spar -<br />
genossenschaft zu Kassel e<strong>GmbH</strong><br />
Kassel, 6 % Schuldv. Reihe A 1.000 RM<br />
1.1.1928 (R 10) VF<br />
Nur 2 Stück lagen im <strong>Reichsbankschatz</strong>. Randschäden<br />
fachgerecht restauriert.<br />
Gründung 1902. Aufgegangen in der Vereinigte Wohnstätten<br />
1889 eG, Kassel.<br />
Los 68 Schätzwert 75-150 €<br />
Alsterthal-Terrain-AG<br />
Wellingsbüttel, Aktie 1.000 Mark<br />
15.11.1912. Gründeraktie (Auflage 4000,<br />
R 5) EF-VF<br />
Aparte Gestaltung, viele Liquidationsstempel der<br />
Vereinsbank in Hamburg.<br />
Die Gesellschaft besaß in Wellingsbüttel, Poppenbüttel und Sasel<br />
fast 4 Mio. qm Land mit 3,2 km Frontlänge zur Alster. Zur<br />
besseren Erschließung ihrer Terrains ließ die Gesellschaft die<br />
preußische Staatsbahn Blankenese-Altona-Hamburg auf eigene<br />
Kosten bis nach Poppenbüttel verlängern.<br />
Los 69 Schätzwert 30-60 €<br />
Altmärkischer Heimstättenverein e.V.<br />
Stendal, 4 % Teilschuldv. 500 RM Sept.<br />
1936 (Auflage 160, R 6) VF+<br />
Für die Anleihe über 80.000 RM wurde eine Hypothek<br />
auf das Grundstück in Arendsee, Holzung, die<br />
Sandberge und Hofraum am See (Stahlhelmheim)<br />
aufgenommen. <strong>Der</strong> Stahlhelm war ein paramilitärisch<br />
organisierter Wehrverband im <strong>Deutsche</strong>n<br />
Reich, der kurz nach Ende des I. WK von dem Reserveoffizier<br />
Franz Seldte in Magdeburg gegründet<br />
worden war. <strong>Der</strong> Stahlhelm galt als bewaffneter<br />
Arm der DNVP. Er verstand sich als Personalreserve<br />
der Reichswehr, die durch den Versailler Vertrag<br />
auf 100.000 Mann beschränkt war. 1934 erfolgte<br />
Los 70 Schätzwert 25-50 €<br />
Amperwerke Elektricitäts-AG<br />
München, Aktie 1.000 Mark 10.10.1923<br />
(Auflage 20000, R 1) EF<br />
Gründung 1908 unter Übernahme der “Industrielle Unternehmungen<br />
<strong>GmbH</strong>” und der “Süddeutsche Wasserwerke AG”. Zwei<br />
Wasserkraftwerke und ein Dampfkraftwerk versorgten damals<br />
24 Ortschaften mit rd. 3.000 Stromkunden. 1909/10 Inbetriebnahme<br />
der Wasserkraftwerke Unterbruck und Kranzberg,<br />
1923 Gründung der “Neue Amperkraftwerke AG, München”<br />
zum Bau des Wasserkraftwerks Haag. Diese AG ging 1932 e-<br />
benso wie die “Bayerische Überlandzentrale AG, München”<br />
durch Fusion in den Amperwerken auf, deren Großaktionär die<br />
Gesellschaft für elektrische Unternehmungen (Gesfürel) in Berlin<br />
war. 1955 Fusion mit der Isarwerke AG (gegr. 1921) zur I-<br />
sar-Amperwerke AG. 1954-56 Ausbau der Dampfkraftwerke<br />
Höllriegelskreuth und Zolling-Anglberg. Ferner gingen in Betrieb<br />
das Dampfkraftwerk Irsching (1969), das Kernkraftwerk<br />
Essenbach bei Landshut (1977, mit Partner Bayernwerk) das<br />
Kernkraftwerk Isar I (1979) und das Kernkraftwerk Isar II<br />
(1988). Zunächst über 3/4, später noch knapp 50 % des Kapitals<br />
der Isar-Amperwerke hielten die Isarwerke <strong>GmbH</strong> (die wiederum<br />
zu 45 % dem Bankhaus Merck, Finck & Co. in München,<br />
zu 25 % dem RWE und zu 10 % der Allianz-Versicherung<br />
gehörten). Im Jahr 2000 fusionierten das Bayernwerk und die<br />
PreußenElektra zur E.ON Energie AG. Diese besaß nun direkt<br />
und indirekt eine Dreiviertelmehrheit der Isar-Amperwerke AG,<br />
die 2001 in E.ON Bayern AG umbenannt wurde. Gleichzeitig<br />
wurden die bisherigen großen Bayernwerk-Beteiligungen (u.a.<br />
Überlandwerk Unterfranken, Energieversorgung Ostbayern, E-<br />
nergieversorgung Oberfranken, Großkraftwerk Nürnberg u.a.)<br />
in die E.ON Bayern AG eingebracht.<br />
Los 71 Schätzwert 75-150 €<br />
Andreae-Noris Zahn AG<br />
Frankfurt a. M., Aktie 100 RM 19.6.1928<br />
(Auflage 7000, R 6) EF<br />
Die 1923 gegründete J.M. Andreae AG geht auf eine vor über<br />
150 Jahren in der Frankfurter Innenstadt von Johann Matthias<br />
Andreae eröffnete “Material- und Farbwaaren-Handlung” zurück.<br />
Sein Geschäftshaus kaufte er von der Dame Melber, einer<br />
Tante von Johann Wolfgang von Goethe. Aus der Fusion mit der<br />
Nürnberger Handelsgesellschaft Noris Zahn & Cie. entstand<br />
dann das noch heute als ANZAG börsennotierte Pharmagroßhandels-Unternehmen.<br />
Los 72 Schätzwert 50-175 €<br />
Anhaltische Kohlenwerke<br />
Frose in Anhalt, VZ-Aktie 1.000 Mark<br />
22.5.1902 (Auflage 1000, R 4) VF-<br />
1867 wurden die Abbaurechte für die Froser Kohlenfelder<br />
durch das Bergamt zu Bernburg verliehen, es folgte die Gründung<br />
der Froser Braunkohlen-Bergbau AG mit der Braunkohlengrube<br />
Ludwig (später Umwandlung in Zeche Anhalt). 1881<br />
Werksruine der Anhaltischen Kohlenwerke 2009<br />
Los 73 Schätzwert 300-375 €<br />
Anhaltische Kohlenwerke<br />
Frose in Anhalt, VZ-Actie 1.000 Mark<br />
22.5.1902 / 6.4.1936 (Auflage 1000, R 12)<br />
VF<br />
1936 als Ersatz für die beschädigte und eingezogene<br />
Vz-Aktie mit gleicher Nummer ausgefertigt.<br />
Mit angeheftetem Vermerk „Diese VZ-Aktie ist<br />
trotz des Fehlens der ... Unterschrift des Kontrollbeamten<br />
am 16.4.36 von der Dreimännerkommission<br />
für lieferbar erklärt worden.“ Ein Unikat<br />
aus dem <strong>Reichsbankschatz</strong>.<br />
Los 74 Schätzwert 50-100 €<br />
Anhaltische Kohlenwerke<br />
Halle (Saale), Sammelaktie 10 x 1.000<br />
RM 5.12.1944 (R 6) EF<br />
Maschinenschriftliche Ausfertigung.<br />
Los 75 Schätzwert 300-375 €<br />
Annaburger Steingutfabrik AG<br />
Annaburg, Actie 1.000 Mark Juli 1895.<br />
Gründeraktie (Auflage 1000, R 10) VF-F<br />
Mit kleiner Abb. des Werkes aus der Vogelperspektive.<br />
Originalunterschriften. Zuvor völlig unbekannt<br />
gewesen, nur 4 Stück lagen im <strong>Reichsbankschatz</strong>.<br />
Papier ganzflächig angeschmutzt.<br />
Bereits 1874 nahm die Steingutmanufaktur in Annaburg (Kreis<br />
Torgau) ihren ersten Rundofen in Betrieb, hergestellt wurden<br />
vornehmlich Küchengarnituren. 1883 übernahm Adolph Hekkmann<br />
die Manufaktur mit 10 Mitarbeitern. Unter seiner Leitung<br />
nahm das Werk (zu dem auch ein Zweigbetrieb in Magdeburg-Neustadt<br />
gehörte) einen enormen Aufschwung. Zwölf<br />
Jahre später bei Umwandlung in eine AG im Jahr 1895 (mit<br />
Börseneinführung in Berlin) waren nicht mehr 10, sondern bereits<br />
325 Mitarbeiter beschäftigt. Auf dem riesigen Werksareal<br />
von 220.000 qm waren nun 12 Brennöfen in Betrieb, in denen<br />
hochwertige Steingutgeschirre, Kunsttöpfereien und Plastiken<br />
gebrannt wurden. Bis 1906 (in diesem Jahr wurde das Werk<br />
durch einen Brand teilweise zerstört) wuchs die Belegschaft<br />
weiter auf rd. 600 Leute. Danach folgte ein Auf und Ab in Inflation,<br />
Weltwirtschaftskrise und Krieg. Während des 2. Weltkrieges<br />
wurde die Produktion mit Kriegsgefangenen aufrecht<br />
erhalten. <strong>Der</strong> Großaktionär und Vorstand Hans Untucht beging<br />
am 9.7.1945 Selbstmord. In der Folge wurde das Werk enteignet<br />
und 1948 der VVB der Bau- und Baustoffindustrie Sachsen-Anhalt<br />
zugeschlagen, später ab 1970 zum VEB Porzellankombinat<br />
Colditz gehörig. Ab 1990 von der Treuhandanstalt als<br />
“Annaburg Porzellan <strong>GmbH</strong>” geführt, 1992 an die CERAPLAN<br />
<strong>GmbH</strong> verkauft. Heute der einzige noch produzierende Geschirrporzellan-Hersteller<br />
in Sachsen-Anhalt, spezialisiert auf<br />
den Bedarf von Hotellerie und Gastronomie.<br />
8
Los 76 Schätzwert 30-60 €<br />
ANNAWERK Schamotte- und Tonwarenfabrik<br />
AG vormals J. R. Geith<br />
Oeslau bei Coburg, Aktie Lit. A 1.000 RM<br />
3.10.1941 (Auflage 500, R 5) EF<br />
Gründung 1899 unter Übernahme der seit 1857 bestehenden<br />
Firma J.R. Geith. Herstellung von Schamotte, Porzellan und<br />
Steingut für sanitäre Spülwaren, Steinzeugtöpfe und -röhren,<br />
Dachziegeln, Klinkern und Leichtbauplatten. Börsennotiz Leipzig,<br />
Berlin und Frankfurt. Großaktionär: <strong>Deutsche</strong> Steinzeug,<br />
Mannheim-Friedrichsfeld (heute Friatec). Nicht ohne Ironie ist<br />
eine Meldung im Jahr 1939: “Ein Teil der Fabrik für feuerfeste<br />
Erzeugnisse (ausgerechnet!) durch Brandunglück vernichtet.”<br />
Los 77 Schätzwert 400-500 €<br />
Annweiler Email- u. Metall-Werke<br />
vorm. Franz Ullrich Söhne<br />
Annweiler, Aktie 100 RM 1.2.1939<br />
(Auflage nur 80 Stück, R 11) VF+<br />
Vorher nicht bekannt gewesen, nur 2 Stück lagen<br />
im <strong>Reichsbankschatz</strong> (das erste wurde 2009 für<br />
580 Euro versteigert, somit das letzte zur Verfügung<br />
stehende Stück).<br />
Gründung 1897 als “Annweiler Emaillirwerke vorm. Franz Ullrich<br />
Söhne”, 1909 umbenannt wie oben. Auf dem über<br />
200.000 qm großen Werksareal in Annweiler (Pfalz) befand<br />
sich ein Stanzwerk mit Glühanlagen, ein Emaillierwerk und eine<br />
Aluminiumwarenfabrik, außerdem wurde in Bellheim eine<br />
Verzinkerei betrieben. Die Firma produzierte mit ca. 500 Mitarbeitern<br />
Haus-und Küchergeräte sowie Stahlgeschirr, im 2.<br />
Weltkrieg ab 1939 aber auch Eierhandgranaten. Alliierte Bombenangriffe<br />
zerstörten deshalb 1944 nicht nur die Werksanlagen,<br />
sondern auch große Teile des kleinen, heute rd. 7.000<br />
Einwohner zählenden Landstädtchens Annweiler am Trifels.<br />
1954 Stilllegung des Bellheimer Werkes, zugleich umbenannt<br />
in “Annweiler Email- und Metallwerke Ullrich AG”. 1972/73<br />
letztmals im AG-Handbuch verzeichnet. Heute ein Standort der<br />
voestalpine HTI zur Herstellung von Präzisionsstahl- und Aluminiumrohrprodukten<br />
für Automobilindustrie und Maschinenbau.<br />
Nr. 75 Nr. 77<br />
schen und war zu 100 % im Familienbesitz. Die europaweit<br />
größte Fabrik für Gebäck- und Schokoladenformen aus Weißblech<br />
beschäftigte bis zu 900 Arbeiter. Das Werk wurde in der<br />
DDR vom Kombinat NAGEMA übernommen (nach 1990 geschlossen).<br />
Los 79 Schätzwert 100-125 €<br />
Arca-Regler AG<br />
Berlin, Aktie (Zwischenschein) 90 x 200<br />
RM 8.5.1943 (R 10) VF-<br />
Maschinenschriftliche Ausfertigung. Originalunterschrift<br />
des Vorstandes: Regierungsbaurat a.D. Erwin<br />
Koehnhorn, Berlin-Steglitz. Nur 6 Stück lagen<br />
im <strong>Reichsbankschatz</strong>. Fleckig.<br />
1917 entwickelt RagnAR CArlstedt das Ursprungspatent für das<br />
Düse-Prallplatte-System in Schweden. Ein Jahr später Gründung<br />
der Firma in Schweden, 1922 in Berlin. Großaktionär 1942<br />
waren die Mannesmannröhren-Werke AG mit 33%. Nach dem<br />
Krieg 1949 als ARCA Regler <strong>GmbH</strong> in Tönisvorst am Niederrhein<br />
von Dr. Ing. Ludwig Kaspers und Adolf Paulsen neugegründet.<br />
Heute ein Familienunternehmen von Weltruf mit ca. 500 Mitarbeitern.<br />
Einsatzgebiete sind Kraftwerke, Chemieanlagen, Pharmazie-<br />
und Lebensmittelproduktionen sowie Stahlwerke.<br />
Los 81 Schätzwert 200-275 €<br />
Arn. Georg AG<br />
Neuwied, Aktie 1.000 RM Okt. 1942<br />
(Auflage nur 100 Stück, R 10) VF<br />
Zuvor unbekannt gewesen, nur 5 Stück lagen im<br />
<strong>Reichsbankschatz</strong>. Sengfleck und linke Seite leicht<br />
angeschmutzt.<br />
Gründung 1877 als Einzelfirma. 1919 Umwandlung in eine AG,<br />
zugleich Zukauf von Gelände, Errichtung weiterer großer Fabrikhallen<br />
und Einrichtung einer Maschinenfabrik mit den modernsten<br />
Maschinen. Hergestellt wurden Eisenkonstruktionen<br />
aller Art, Wellblechbauten, Gittermaste, Stahlhäuser, Garagen,<br />
Stahltore etc., außerdem Lohnverzinkung. 1949 fusionsweise<br />
Übernahme der Norddeutsche Eisen-Schramm Kompressoren-<br />
AG (gegr. 1923 als Norddeutsche Eisengesellschaft AG bzw.<br />
Schramm Kompressoren- und Baumaschinen <strong>GmbH</strong>), die für<br />
Arn. Georg in Berlin als Werksvertretung fungierte. 1993/94<br />
wurden Stahlbau und Verzinkerei, die zuletzt rd. 50 bzw. 25<br />
Mio. DM Jahresumsatz machten, in Tochter-<strong>GmbH</strong>’s ausgegliedert.<br />
Seitdem nur noch Vermögens-, Beteiligigungs- und<br />
Grundstücksverwaltung. Bis heute im Freiverkehr Düsseldorf<br />
börsennotiert, Großaktionär ist der Fürst zu Wied.<br />
Los 82 Schätzwert 75-125 €<br />
Arthur Trägner & Co. Maschinenbau-AG<br />
Chemnitz, Aktie 1.000 Mark 19.12.1922<br />
(Auflage 6000, R 7) EF-VF<br />
Gründung als AG 1921 zur Fortführung der Werkzeugmaschinenfabrik<br />
der Firma Trägner & Co.; Interessengemeinschaft mit<br />
der Werkzeugmaschinenfabrik Union (vorm. Diehl). 1925 in Liquidation.<br />
Los 84 Schätzwert 25-50 €<br />
Askaniawerke AG vormals<br />
Centralwerkstatt-Dessau und<br />
Carl Bamberg-Friedenau<br />
Dessau, Aktie 100 RM Okt. 1932 (Auflage<br />
1300, R 3) EF<br />
Gründung 1921 durch Zusammenschluss der Central-Werkstatt<br />
Dessau der <strong>Deutsche</strong>n Continental-Gas-Gesellschaft und<br />
der Firma Karl Bamberg in Berlin-Friedenau (1871 von Carl<br />
Bamberg, Sohn eines Uhrmachers und Schüler von Carl Zeiss,<br />
gegründete Manufaktur für Präzisionsgeräte für Marine, Observatorien<br />
etc.). Hergestellt wurden feinmechanische und optische<br />
Instrumente, Registrierinstrumente für Gas, Wasser und<br />
Elektrizität, astronomische, nautische und kinotechnische Apparate,<br />
Feldstecher, Gaskocher, Gasherde, Heizöfen und Warmwasserapparate.<br />
Die Askaniawerke waren der bedeutendste<br />
deutsche Hersteller von Luftfahrt- und Navigationsinstrumenten.<br />
Aus der Kinosparte ist erwähnenswert, daß z.B. der Film<br />
“<strong>Der</strong> Blaue Engel” mit Marlene Dietrich mit einer Askania-Filmkamera<br />
gedreht wurde. Zwischen 1922 und 1927 außerdem<br />
an der Anhaltische Fahrzeugwerke AG beteiligt (eine der Keimzellen<br />
der Opel-Automobilproduktion). Zur Bearbeitung des a-<br />
merikansichen Ölmarktes wurde 1929 in Houston (Texas) die<br />
American Askania-Corp. errichtet. 1937 wurde die Gasgerätefabrik<br />
in Dessau an die Junkers & Co. <strong>GmbH</strong> verkauft. In Berlin<br />
börsennotiert, Großaktionäre waren die Contigas (51 %), Fabrikbes.<br />
Paul Bamberg (17 %) und die Charlottenburger Wasser-<br />
und Industriewerke (8 %). 1947 als Askaniawerke AG Bodenseewerk<br />
Überlingen in die Westzonen verlagert, 1949 in eine<br />
<strong>GmbH</strong> umgewandelt, 1971 vollständig von SIEMENS übernommen<br />
worden. 2006 wurde in Berlin-Friedenau nahe dem<br />
alten Stammsitz die Askania AG neu gegründet. Sie fertigt mechanische<br />
Armbanduhren auf Basis historischer Vorlagen. Im<br />
Zweigwerk Rathenow (vormals Rathenower Optische Werke)<br />
werden Mikroskope hergestellt.<br />
Los 85 Schätzwert 30-75 €<br />
Asphaltwerke R. Tagmann AG<br />
Leipzig, Aktie 100 RM Febr. 1933 (Auflage<br />
450, R 4) EF<br />
Gründung 1885 als Leipziger Asphaltwerk R. Tagmann, seit<br />
1923 AG als Asphaltwerke R. Tagmann AG. 1934 umfirmiert in<br />
R. Tagmann Straßenbau-AG. Überregional tätiger Straßenbaubetrieb<br />
mit Filialen in Berlin, Breslau, Erfurt, Kiel, Königsberg<br />
i.Pr., München, Nürnberg, Rostock, Schneidemühl und Weimar.<br />
Los 80 Schätzwert 20-40 €<br />
Armaturen- und Maschinenfabrik AG<br />
vormals J. A. Hilpert<br />
Nürnberg, Aktie 100 RM 4.7.1935<br />
(Auflage 5200, R 2) EF<br />
Gründung 1889 zur Übernahme der seit 1857 bestehenden<br />
Fa. J. A. Hilpert in Nürnberg (1939 Umfirmierung in Amag-Hilpert-Pegnitzhütte<br />
AG). 1891 Errichtung einer Gießerei in Pegnitz,<br />
1896 Ankauf der Kelsenschen Armaturenfabriken in Wien<br />
und Pest (1918 mit der Wiener Niederlassung der Fa. Bopp &<br />
Reuther, Mannheim, in einer eigenen AG verselbständigt). Produziert<br />
wurden im Werk Nürnberg Kreiselpumpen, Säurepumpen<br />
und Säurearmaturen, im Werk Pegnitz Armaturen aller Art.<br />
1959 Umwandlung auf die Großaktionärin Klein, Schanzlin &<br />
Becker AG in Frankenthal.<br />
Los 86 Schätzwert 75-125 €<br />
Auerswald & Sauerbrunn AG<br />
Lössnitz (Erzgeb.), Aktie 100 RM<br />
17.12.1934 (R 7) EF<br />
Gegründet 1921 zum Betrieb einer Schuhfabrik. 1930 wurde<br />
die Schuhfabrikation aufgegeben und die AG als Grundstücksgesellschaft<br />
weitergeführt. 1941 sollte über Auflösung beschlossen<br />
werden.<br />
Los 78 Schätzwert 60-120 €<br />
Anton Reiche AG<br />
Dresden, Namensaktie 1.000 Mark<br />
28.12.1912. Gründeraktie (Auflage 2750,<br />
R 4) EF<br />
Großformatiges Papier, dekorativ gestaltet.<br />
Gründung Dez. 1912 zur Weiterführung der gleichnamigen<br />
Schokoladenformen-, Blechemballagen- und Blechplakatfabrik.<br />
Ferner Vertrieb von Kunstharzgegenständen und Maschinen.<br />
Die Ges. besaß Grundstücke in Dresden, Plauen und Dölz-<br />
Nr. 81<br />
Los 83 Schätzwert 75-125 €<br />
ARWIES Wiesbadener<br />
Schokoladenwerke AG<br />
Wiesbaden-Biebrich, VZ-Aktie 5 RM<br />
1.10.1925 (Auflage 1000, R 8) EF<br />
Gründung im März 1922 zum Erwerb und Fortbetrieb des unter<br />
der Firma Aug. Reith, Wiesbaden betriebenen Fabrikationsgeschäftes.<br />
1932 wurde der Betrieb nach mehrmaligen erfolglosen<br />
Sanierungen stillgelegt.<br />
Los 87 Schätzwert 150-250 €<br />
Aufsicht Revisions-AG<br />
Berlin, Namensaktie 1.000 Mark<br />
2.1.1916. Gründeraktie (Auflage 200, ab<br />
1924 nach Umstellung auf 50 RM nur<br />
noch 100 Stück, R 6) EF-VF<br />
Dekorativ, farbiges Siegel mit Adler über Büchern.<br />
Mit Original-Unterschrift des Mitbegründers und<br />
9
Nathan Marx in Stettin und Änderung in “Aurag” Ausrüstungs-<br />
AG für baumwollene Gewebe vormals Nathan Marx. Zweigniederlassung<br />
in Berlin.<br />
Los 93 Schätzwert 30-90 €<br />
Badische Gas- und<br />
Elektrizitätsversorgung AG<br />
Lörrach, Aktie 1.000 RM 5.12.1933<br />
(Auflage 1680, R 4) EF<br />
Gegründet 1923. Gas- und Stromversorger für den Raum Lörrach.<br />
Jüngst schloss sich die Gesellschaft mit anderen südbadischen<br />
Energieversorgern zu badenova AG & Co. KG mit Sitz<br />
in Freiburg zusammen.<br />
Los 96 Schätzwert 40-50 €<br />
Bank für Handel und Filmindustrie AG<br />
München, Aktie Lit. A 1.000 Mark<br />
29.3.1923. Gründeraktie (R 8) EF<br />
Nur 11 Stück lagen im <strong>Reichsbankschatz</strong>.<br />
Gründung im März 1923, im Januar 1925 in Liquidation.<br />
Zweck: Beleihung und Bevorschussung von Waren, Beteiligungen<br />
an Geschäften und Unternehmungen, Förderung des Exund<br />
Imports, Kreditgewährung an die Filmindustrie.<br />
AR-Vorsitzenden Albrecht Graf zu Stolberg-Wernigerode.<br />
Gründung 1915. Eines der ersten Wirtschaftsprüfungs-Unternehmen<br />
als AG. 1926 umbenannt in “Treuhandgesellschaft für<br />
Kommunale Unternehmungen AG”, gleichzeitig übernahm die<br />
<strong>Deutsche</strong> Landesbankenzentrale AG (ein Vorläufer des <strong>Deutsche</strong>n<br />
Sparkassen- und Giroverbandes) die Aktienmehrheit,<br />
anschließend war die <strong>Deutsche</strong> Revisions- und Treuhand-AG<br />
Alleinaktionär. Geprüft wurden vorzugsweise Unternehmen und<br />
Betriebe der Kommunen sowie anderer öffentlich-rechtlicher<br />
Körperschaften. Kapital auf DM umgestellt, aber seit Ende des<br />
2. Weltkrieges inaktiv.<br />
Los 88 Schätzwert 60-120 €<br />
August Hübsch AG<br />
Chemnitz, Aktie 1.000 Mark 18.7.1921.<br />
Gründeraktie (Auflage 3000, R 5) EF<br />
Gründung 1857, als AG ab 1921. Herstellung und Vertrieb von<br />
Möbelstoffen und anderen Erzeugnissen der Textilindustrie. Die<br />
Aktien waren in Familienbesitz. 1992 Fortsetzung der Gesellschaft<br />
und Abwicklung.<br />
Los 91 Schätzwert 125-250 €<br />
Bad-Wildunger<br />
Heilquellen-AG Königsquelle<br />
Bad Wildungen, Aktie 1.000 Mark 30.9.1907.<br />
Gründeraktie (Auflage 500, R 5) EF<br />
Die Gesellschaft geht zurück auf die 1869 von dem Wildunger<br />
Arzt Dr. Carl Rörig entdeckte Königsquelle. Rörig vermarktete<br />
seine Entdeckung und begründete so den Kurort Bad Wildungen.<br />
Er baute ein Sanatorium und zog einen Flaschenversand<br />
des Heilwassers auf. 1907 gingen Bauten und Betrieb an die<br />
neu gegründete AG über. Im 2. Weltkrieg war das Sanatorium<br />
Lazarett, nach der Besetzung wurde es von der amerikanischen<br />
Militärpolizei genutzt. 1953 Übernahme durch das<br />
Staatsbad. 1962 Einstellung des Flaschenversands, 1968 blieb<br />
nur noch das Sanatorium stehen, das aber 2006 der Landesgartenschau<br />
weichen mußte und dann auch abgerissen wurde.<br />
Los 94 Schätzwert 100-125 €<br />
Badische Motor-Lokomotivwerke AG<br />
Mosbach, Aktie 1.000 Mark 1.10.1921<br />
(Auflage 10000, R 9) VF<br />
Nur 4 Stück lagen im <strong>Reichsbankschatz</strong>.<br />
Ursprung ist eine 1913 in Mosbach als Steinmetz & Gmeinder<br />
KG begründete Fabrik (ab 1916 Anton Gmeinder & Cie.), die<br />
bereits 1919 die ersten Lokomotiven mit Benzol-Motor auslieferte.<br />
Hergestellt wurden ferner Motorfahrzeuge und Eisenbahnmaterial<br />
aller Art. 1921 Einbringung der Aktivitäten in die<br />
neu gegründete Badische Motor-Lokomotivwerke AG. Gemeinsam<br />
mit der Maschinenbau-Gesellschaft Karlsruhe und der<br />
Motorenwerke Mannheim kommt es zur Gründung der MBG<br />
Motor-Lokomotiv-Verkaufs-Ges. Baden mbH. 1925 geht die AG<br />
in Konkurs. Nachfolger wird die Gmeinder & Co. <strong>GmbH</strong>, die Anton<br />
Gmeinder mit Unterstützung von Carl und Hermann Kaelble<br />
gründet. Die Fertigung von Feldbahn- und Normalspur-Lokomotiven<br />
sowie Grubenlokomotiven wird weiter ausgebaut.<br />
1932 wird Gmeinder zum Hauptlieferanten der Standard-Rangierlokomotiven<br />
der <strong>Deutsche</strong>n Reichsbahn. Später werden für<br />
die <strong>Deutsche</strong> Bundesbahn Rangierlokomotiven der Baureihe V<br />
60 gebaut, außerdem einige Dieseltriebwagen wie der WEG T<br />
23 und 24. 1996 Neugründung als “Gmeinder Lokomotivenund<br />
Maschinenfabrik <strong>GmbH</strong>”, 2004 Ausgliederung des Lokomotivenbaus<br />
in Mosbach an die “Gmeinder Lokomotivenfabrik<br />
<strong>GmbH</strong>”, deren alleiniger Gesellschafter heute die LBBW Venture<br />
Capital <strong>GmbH</strong> ist.<br />
Los 97 Schätzwert 75-150 €<br />
Bank für Handel und Grundbesitz AG<br />
Leipzig, Aktie Reihe A 1.000 Mark<br />
30.7.1923 (Auflage nach Kapitalumstellung<br />
2000, R 7) EF<br />
Herrliche Umrahmung im geometrischen Jugendstil.<br />
Gründung 1902 als “Spar- und Darlehnskasse der Hausbesitzer<br />
e<strong>GmbH</strong>”, 1910 Umbenennung in Leipziger Hausbesitzer-<br />
Bank, AG seit 1923. Die Bank hielt Anteile am Leipziger Hypothekenverein,<br />
an der Wechsel- und Kreditgenossenschaft für<br />
Handwerk und Mittelstand e<strong>GmbH</strong> und der Gesellschaft für<br />
Haus und Boden mbH. Zwischen der Bank und diesen Unternehmen<br />
bestand Personalunion. Auf Grund der Verordnung ü-<br />
ber die Gründung der Sächsischen Landesbank und die Abwicklung<br />
der bisher bestehenden Banken und Geldinstitute<br />
vom 14.8.1945 erlosch die Bank am 29.5.1947.<br />
Los 89 Schätzwert 25-50 €<br />
August Schmits<br />
Kohlengroßhandlung AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 RM 13.12.1927<br />
(Auflage 300, R 5) EF<br />
Nennwert 1941 auf 1.800 RM heraufgesetzt.<br />
Gegründet 1923 unter Übernahme der Beußeleck Grundstükks-AG.<br />
Vertrieb von Brennstoffen aller Art und deren Nebenerzeugnissen,<br />
hauptsächlich Handel mit Braunkohle und Briketts.<br />
Großaktionär (1943): Ilse, Bergbau AG. 1952 als vermögenslose<br />
Gesellschaft von Amts wegen gelöscht.<br />
Los 90 Schätzwert 20-50 €<br />
Aurag Ausrüstungs-AG<br />
für baumwollene Gewebe<br />
Stettin, Aktie 10.000 Mark 7.6.1923.<br />
Gründeraktie (Auflage 2400, R 2) EF<br />
1924 Umstellung auf 250 RM und 1928 auf 500<br />
RM.<br />
Gründung 1923. Herstellung u. Vertrieb von Textilwaren u. anderen<br />
Waren. Im Juni 1923 Übernahme des Geschäfts der Fa.<br />
Los 92 Schätzwert 60-120 €<br />
Badische Bank<br />
Mannheim, Actie 350 Gulden = 200<br />
Thaler 1.10.1871. Gründeraktie (Auflage<br />
15000, R 1) EF-VF<br />
Äußerst dekoratives Stück mit allegorischer Umrandung,<br />
Originalunterschriften.<br />
Ursprünglich errichtet 1870 als Badische Bank in Mannheim,<br />
eine Privatbank mit Notenbank-Privileg (auf das erst 1931 verzichtet<br />
wurde). Seit 1923 Vertrauensbank des Badischen Staates,<br />
der 1931 durch Übernahme eines größeren, bis dahin von<br />
der <strong>Deutsche</strong>n Bank gehaltenen Aktienpaketes auch Mehrheitsaktionär<br />
wurde. 1932 Sitzverlegung nach Karlsruhe, weitere<br />
Niederlassungen bestanden in Freiburg i.B. (seit 1937, e-<br />
hem. Bankgeschäft Carl Trautwein), Pforzheim (seit 1935/36,<br />
ehem. Bankhaus Carl Schmitt & Cie. sowie der Pforzheimer<br />
Bankverein) und zeitweise Straßburg (Elsaß). 1977 mit der<br />
Württembergischen Bank (früher: Württ. Notenbank) und der<br />
Handelsbank Heilbronn AG zur Baden-Württembergische Bank<br />
AG fusioniert. Auf Betreiben der baden-württembergischen<br />
Landesregierung unter Erwin Teufel übernahm die öffentlichrechtliche<br />
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) 2001 die<br />
Aktienmehrheit der BW-Bank. Danach wurden die Kleinaktionäre<br />
per Squeeze-out rausgeworfen und die BW-Bank als unselbständige<br />
Anstalt ab 1.8.2005 vollständig in die LBBW integriert.<br />
Los 95 Schätzwert 50-100 €<br />
Bank für Brau-Industrie<br />
Berlin-Dresden, 6,5 % Teilschuldv. 500<br />
RM 9.7.1928 (Auflage 900, R 6) EF<br />
Gründung 1899. Beteiligungen u.a. an der Dortmunder Ritterbrauerei,<br />
der Berliner Engelhardt-Brauerei, der Radeberger Exportbierbrauerei<br />
und der Schöfferhof-Binding-Brauerei. Ende<br />
1950 Sitzverlegung nach Frankfurt/Main. Gehörte dann als<br />
“Frankfurter Bankgesellschaft gegr. 1899 AG” zum Oetker-<br />
Konzern, schließlich mit der ebenfalls Oetker gehörenden Bielefelder<br />
Lampe-Bank fusioniert.<br />
Los 98 Schätzwert 75-125 €<br />
Bank für Handel und Verkehr AG<br />
Chemnitz, Aktie 1.000 RM 3.5.1943<br />
(Auflage 200, R 6) EF<br />
1883 als Chemnitzer Viehmarktsbank e<strong>GmbH</strong> gegründet, AG<br />
seit 1917. Bankgeschäfte insbesondere zur Förderung des Mittelstands.<br />
Börsennotiz Leipzig. 1963 Abwicklung von Westvermögen<br />
durch die Preußische Staatsbank (Seehandlung), Berlin<br />
(West).<br />
Los 99 Schätzwert 75-125 €<br />
Bank für Kommunalwirtschaft AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 RM Mai 1932 (Auflage<br />
500, R 6) EF<br />
Gründung 1924 in Berlin. Betrieb von Bankgeschäften aller Art.<br />
Ab 1934 Universum-Bank AG, Sitz bis 1935 in Münster, dann<br />
wieder in Berlin. 1931 erweiterte die Bank ihr Geschäftsfeld,<br />
10
schen Adler-, Ahrensburger-, Pestalozzistraße und Lämmersieth,<br />
fertiggestellt. 1942 Umbenennung in Bau-Verein zu Hamburg<br />
AG. Heute konzentriert sich das Tätigkeitsgebiet auf die<br />
Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in etablierten Lagen,<br />
Erstellung von Neubauten, vorrangig aber Privatisierung, Altbausanierung<br />
und städtebauliche Fortentwicklung sowie Revitalisierung<br />
von Büro- und Geschäftshäusern. <strong>Der</strong> Objektbestand<br />
der Gesellschaft von heute rd. 4.000 Wohneinheiten setzt sich<br />
hauptsächlich aus traditionellen Wohnanlagen zusammen, die<br />
in den 20er und 30er Jahren sowie nach dem 2. Weltkrieg errichtet<br />
wurden. Seit 1998 börsennotiert. Hauptaktionär war zunächst<br />
die (inzwischen insolvente) Wünsche AG, heute liegen ü-<br />
ber 90 % der Aktien bei der TAG Tegernsee Immobilien AG.<br />
sie widmete sich verstärkt dem Geld- und Kreditverkehr katholischer<br />
Orden und Genossenschaften und katholisch-kirchlicher<br />
Institute. 1937 in Liquidation.<br />
Nr. 100 Nr. 105<br />
Los 100 Schätzwert 300-375 €<br />
Bank für Landwirtschaft AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark 10.1.1922<br />
(Auflage 110000, R 10) VF<br />
Mit Getreideähren in der Umrandung. Hätte an<br />
sich schon beim Aktienumtausch 1925, spätestens<br />
aber beim kpl. Neudruck 1938 umgetauscht<br />
werden müssen. Einzelstück aus dem <strong>Reichsbankschatz</strong>,<br />
vorher nur 2 x katalogisiert.<br />
Eine von der Geschichte her sehr interessante und bis heute bestehende<br />
Bank: Gegründet 1908 als “Kaliwerke Ummendorf-Eilsleben<br />
AG”. 1923 in der ersten großen Kalikrise komplette Umstrukturierung<br />
und Umfirmierung wie oben. 1924 dann Übernahme<br />
der Potsdamer Creditbank. 1925 wurden 24 Zweigniederlassungen<br />
unterhalten. 1950 Neugründung als Westdeutsche Bank<br />
für Landwirtschaft AG in Köln (der Zusatz “Westdeutsche” fällt<br />
1958 wieder fort). Nach Fusionen mit der Getreide-Kreditbank<br />
AG in Hamburg (1961) und der Kreditbank für Gartenbau und<br />
Landwirtschaft KGaA (1963) dann 1970 Umfirmierung in Handels-<br />
und Privatbank AG mit Sitz in Köln. 1981 steigt die Amsterdam-Rotterdam<br />
Bank N.V. als Aktionär ein, 1986 Umfirmierung<br />
in Amro Handelsbank AG (heute ABN-AMRO Bank AG).<br />
Los 101 Schätzwert 150-200 €<br />
Bankverein Artern<br />
Spröngerts, Büchner & Co. AG<br />
Artern, Aktie 1.000 RM Juni 1940<br />
(Auflage 700, R 8) EF-<br />
Gründung 1862 als Arterner Darlehns-Verein, ab 1895 Bankverein<br />
Artern, Spröngerts, Büchner & Co. KGaA. Abteilungen in<br />
Rossleben a.U., Rossla a.Harz, Nebra a.Unstrut, Allstedt i.Thür.<br />
und Sangerhausen. 1940 wurde die bisherige KGaA in eine reine<br />
AG umgewandelt. 1950-1986 treuhändische Verwaltung<br />
und Abwicklung des Westvermögens in Mülheim a.d.R.<br />
Steinbrüche (Basalt-Steinbrüche im Westerwald, in der Pfalz, in<br />
der Eifel und in Mitteldeutschland, Grauwackebrüche in den<br />
Kreisen Gummersbach und Olpe, Diorit- und Melaphyr-Steinbrüche<br />
in der Pfalz, Granit-Steinbrüche in Sachsen). Mehr als<br />
ein Dutzend Beteiligungen an anderen Steinbrüchen und Wegebaugesellschaften<br />
in Deutschland, Holland und Schweden,<br />
außerdem gehörten der Basalt-AG über 90 % der Aktien der<br />
Rhein-Sieg Eisenbahn-AG in Beuel. Börsennotiz Berlin und<br />
Köln. 1967 Abschluß eines Gewinngemeinschaftsvertrages mit<br />
der Strabag Bau-AG sowie Erwerb der Aktienmehrheit der Dolerit-Basalt<br />
AG in Köln. Heute mit der Werhahn-Gruppe als Alleinaktionär<br />
Marktführer in Deutschland als Produzent von<br />
Baustoffen.<br />
Los 104 Schätzwert 25-50 €<br />
Bau- und Finanz-AG des<br />
Schlesischen Handwerks<br />
Breslau, Namensaktie 200 RM 27.6.1939<br />
(Auflage 2375, R 2) EF<br />
Ausgestellt auf das Baugeschäft Richard Stenzel<br />
in Gottesberg.<br />
1933 gegründet zum Bau und zur Betreuung von Kleinwohnungen.<br />
1943 Umfirmierung in Schlesische Wohnstätten AG.<br />
5, sowie mit dem Rat der Stadt Leipzig (1911 für seine Rechnung<br />
vom Westdeutschen Bankverein AG zu Hagen erworben)<br />
für die Grundstücke Brühl 57 und Parkstraße 4. Äußerer Anlaß<br />
für die Gründung des Unternehmens war die Tatsache, daß das<br />
Grundstück Brühl 57 schon seit 1908 eine Baulücke war, was<br />
die Stadt Leipzig dazu bewog, die Grundstücke Brühl 55 und<br />
57 zur Verlängerung der Nikolaistraße nach Norden zu verwenden,<br />
so daß sich seit 1912 Nikolaistraße und Brühl kreuzen.<br />
Ende Okt. 1912 wurde mit dem Abbruch der alten Gebäude begonnen,<br />
genau ein Jahr später konnte der neue Gebäudekomplex<br />
schon eröffnet werden. 1916 umbenannt in “Park-Hotel<br />
AG”. Börsennotiz Freiverkehr Leipzig und Köln. Großaktionär<br />
war zuletzt die Stadt Leipzig. Nach dem Krieg nicht verlagert.<br />
1992 zwecks Mobilisierung der wertvollen Innenstadtgrundstücke<br />
Fortsetzung der Gesellschaft und Abwicklung als Park-<br />
Hotel AG i.L. Das prachtvolle, auf der Aktie im Unterdruck groß<br />
abgebildete Eckgebäude Brühl/Nikolaistraße überstand den 2.<br />
Weltkrieg einigermaßen unbeschädigt. Im Laden im Erdgeschoß<br />
(auf der Aktie ebenfalls zu erkennen) befand sich zu<br />
DDR-Zeiten der Staatliche Kunsthandel mit einem Münzgeschäft,<br />
nach der Wende wurde das Ladenlokal für einige Jahre<br />
von der Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn genutzt.<br />
Los 108 Schätzwert 75-100 €<br />
Baugenossenschaft des<br />
Leipziger Mietervereins e<strong>GmbH</strong><br />
Leipzig, 6 % Na.-Schuldv. 100 RM<br />
3.1.1927 (R 8) EF-<br />
Dekorativ mit Gebäude-Vignette.<br />
Gegründet 1899. Gehört heute zur Baugenossenschaft Leipzig eG.<br />
Los 109 Schätzwert 75-125 €<br />
Baugenossenschaft<br />
Dresden-Land e<strong>GmbH</strong><br />
Dresden, Namens-Anteil o.N. 30.12.1942<br />
(R 6) EF<br />
Originalunterschriften.<br />
Als eines der ersten Projekte erschloß die Genossenschaft mit<br />
nach einheitlichem Konzept errichteten Reihen- und Doppelhäusern<br />
in Niedersedlitz den Rosenweg im Zusammenhang mit<br />
dem Bau der sog. “Blumensiedlung”, womit an die einst in den<br />
östlichen Dresdner Vororten zahlreich ansässigen Gärtnereien<br />
erinnert werden sollte. Ein weiteres großes Vorhaben war<br />
1919/20 die Wohnsiedlung in der Talstraße in Dresden-Cossebaude.<br />
<strong>Der</strong> teilweise wegweisende Baustil dieser Genossenschaft<br />
ist auch in einigen Architekturzeitschriften besprochen.<br />
Los 102 Schätzwert 25-50 €<br />
Bartsch, Quilitz & Co. AG<br />
Berlin, Aktie 100 RM Okt. 1926 (Auflage<br />
8400, R 4) EF<br />
Gegründet 1919, AG seit 1921. Herstellung von Flaschen und<br />
Gläsern aller Art für pharmazeutische und chemische Zwecke,<br />
Apotheken, Krankenhaus- und Sanitätsbedarf, von Laboratoriums-Apparaten<br />
und Geräten aller Art für chemische Fabriken,<br />
Wissenschaft und Untersuchungszwecke. 1934 ging die Glashütte<br />
vollständig auf die Bartsch, Quilitz & Co. AG über. Ab<br />
1952 <strong>GmbH</strong>.<br />
Los 103 Schätzwert 30-60 €<br />
Basalt-AG<br />
Linz a. Rhein, 8 % Teilschuldv. 1.000 Gold -<br />
mark 14.11.1924 (Auflage 3000, R 6) EF<br />
Gründung 1888 in Köln mit der Filiale Basalt-Maatschappij in<br />
Rotterdam, 1892 Sitzverlegung nach Linz am Rhein. Die Gesellschaft<br />
beschäftigte über 4.000 Arbeiter und besaß rd. 80<br />
Los 105 Schätzwert 275-350 €<br />
Bau- und Wirtschafts AG<br />
Bausparkasse Mainz<br />
Mainz, Aktie 1.000 RM o.D. (ca. Aug.<br />
1932, Auflage 150, R 9) VF<br />
Sehr schöne Art-Deko-Umrahmung. Zuvor unbekannte<br />
Ausgabe, nur 7 Stück lagen im <strong>Reichsbankschatz</strong>.<br />
Kleiner Rostfleck am oberen Rand.<br />
Bei der Gründung 1930 wurde der Vertragsbestand von sieben<br />
älteren Bausparkassen übernommen. <strong>Der</strong> neue Firmenname<br />
“Bausparkasse Mainz AG” wurde 1934 angenommen. Noch<br />
heute als AG bestehende Bausparkasse.<br />
Los 106 Schätzwert 75-150 €<br />
Bau-AG Brühl<br />
Leipzig, Aktie 1.000 Mark 1.7.1912.<br />
Gründeraktie (Auflage 1300, R 3) EF-VF<br />
Gegründet im März 1912. Zweck: Verwertung der Besitzungen<br />
Brühl 57 und 59 sowie Parkstraße 4 und 5 durch entsprechende<br />
Bebauung mit einem Hotel, Läden etc. Initiator der Gesellschaft,<br />
an der sich auch vermögende Privatmänner aus Bochum,<br />
Letmathe, Halle a.S. und der Graf von der Schulenburg<br />
(Rittergut Emden, Krs. Neuhaldensleben) interessierten, war<br />
der Leipziger Kaufmann Adolph Kirschberg. Er brachte die<br />
Rechte aus zwei Grundstückskaufverträgen ein: Mit den Erben<br />
Kratzsch/Bässler für die Grundstücke Brühl 59 und Parkstraße<br />
Los 107 Schätzwert 150-250 €<br />
Bau-Verein zu Hamburg (vorm. Bauund<br />
Spar-Verein zu Hamburg) AG<br />
Hamburg, Namensaktie 1.000 Mark<br />
2.1.1906 (Auflage 500, R 7), ausgestellt<br />
auf Senator Dr. Heinr. Traun zu Hamburg,<br />
der die Aktie als Vorstand auch in<br />
Faksimile unterschrieb EF<br />
Gegründet 1903 zur Fortführung der seit 1892 bestehenden<br />
Bau- und Sparverein zu Hamburg e<strong>GmbH</strong>. Firmenzweck war die<br />
Beschaffung gesunder, billiger Wohnungen für weniger Bemittelte,<br />
durch Vermietung von Wohnungen und durch Ermöglichung<br />
des allmählichen Erwerbs von Einzelwohnungen zur Verbesserung<br />
der Hamburger Wohnungsverhältnisse. 1922 wurden<br />
Neubauten mit 265 Wohnungen in Barmbeck, belegen zwi-<br />
Los 110 Schätzwert 100-150 €<br />
Baugenossenschaft Glauchau e<strong>GmbH</strong><br />
Glauchau, 4 % Na.-Teilschuldv. 100 Mark<br />
6.4.1913 (R 8) EF<br />
Nur 12 Stück lagen im <strong>Reichsbankschatz</strong>.<br />
Gründung 1910. U.a. wurde eine Gartenstadtsiedlung errichtet.<br />
11
Weberei Bamberg AG” zur Baumwollindustrie Erlangen-Bamberg<br />
AG. Spinnereien und Webereien in Erlangen, Wangen (mit<br />
Ausrüstungsbetrieb) und Bamberg, außerdem Webereien in<br />
Schwarzenbach (Saale) und Zeil (Main). Zuletzt als ERBA firmierend<br />
und erst vor wenigen Jahren in Konkurs gegangen.<br />
Los 111 Schätzwert 125-180 €<br />
Baugenossenschaft Grünhain e<strong>GmbH</strong><br />
Grünhain, Namens-Anteil 200 Mark<br />
6.8.1908 (R 8) EF<br />
Originalunterschriften. Nur 12 Stück lagen im<br />
<strong>Reichsbankschatz</strong>.<br />
Los 112 Schätzwert 25-50 €<br />
Baugesellschaft für die<br />
Residenzstadt Dresden AG<br />
Dresden, Aktie 1.000 RM Okt. 1941<br />
(Auflage 2100, kpl. Aktienneudruck, R 3) EF<br />
Gründung 1885 als “Baubank für die Residenzstadt Dresden”,<br />
1935 Umfirmierung wie oben. Umfangreicher innerstädtischer<br />
Grundbesitz u.a. an der König-Johann-Straße (13 Grundstükke),<br />
der Schießgasse (7 Grundstücke), der Moritzstraße (6<br />
Grundstücke) und am Altmarkt (2 Grundstücke). Bis 1934 in<br />
Dresden, dann in Leipzig börsennotiert.<br />
Los 114 Schätzwert 100-200 €<br />
Baumwollspinnerei Germania<br />
Epe i. Westfalen, Aktie 1.000 Mark<br />
1.6.1898. Gründeraktie (Auflage 1200,<br />
R 4) EF-VF<br />
Hochdekorativ verzierter G&D-Druck.<br />
Gründung 1897 unter der Firma Baumwollspinnerei Germania.<br />
Vollstufiger Betrieb, neben zwei Baumwollspinnereien waren<br />
auch Zwirnerei, Weberei, Färberei, Bleicherei und Schlichterei<br />
vorhanden. 1992 Einstellung des operativen Geschäftes, ab<br />
1993 Vermögensverwaltung. Neben der Vermietung der Gewerbeimmobilien<br />
(ehemalige Textilfabrik) in Gronau plante man<br />
auch Investments in “Sozialimmobilien” für Senioren. Darlehensverluste<br />
in Millionenhöhe und reihenweise Insolvenzen<br />
größerer Mieter machten die noch heute in Düsseldorf börsennotierte<br />
Germania-Epe AG zum Pennystock.<br />
Los 115 Schätzwert 200-250 €<br />
Baumwollspinnerei Gronau<br />
Gronau i.W., Aktie 1.000 Mark<br />
31.12.1910 (Auflage 250, R 10) EF-VF<br />
Abb. einer Kardiermaschine in der Umrahmung.<br />
Nur 3 Stück lagen im <strong>Reichsbankschatz</strong>.<br />
Eine Gründung holländischer Geschäftsleute (1890). 1898 Errichtung<br />
eines zweiten und 1911 eines dritten Werkes. 1947<br />
Fusion mit der benachbarten “Westfälische Baumwollspinnerei”.<br />
1987 Übernahme der “Textilwerke Ahaus AG”. <strong>Der</strong> Dauerkrise<br />
der deutschen Textilindustrie hat dieses Unternehmen<br />
noch mit am längsten getrotzt - doch im Mai 1999 kam auch<br />
hier das Insolvenzverfahren.<br />
grünen Wiese errichtet. Arbeitskräfte waren in der armen, sonst<br />
kaum industrialisierten Gegend leicht zu erhalten. Nach und<br />
nach entwickelte sich der Kolbermoor-Konzern zu einer der<br />
größten Textilgruppen in Deutschland, deren Blütezeit in den<br />
20er/30er Jahren des 20. Jahrhunderts lag: In diese Zeit fällt<br />
auch der Kauf der wertvollen Töchter (Baumwollspinnerei Unterhausen,<br />
Spinnerei und Weberei Kempten, Spinnerei und Weberei<br />
Momm/Kaufbeuren und Spinnerei und Weberei Pfersee in<br />
Augsburg). Den ersten Textilkrisen noch ohne Rückgriff auf stille<br />
Reserven trotzend, wurde die vor allem auf Handstrickgarn<br />
spezialisierte Spinnerei Anfang der 80er Jahre langsam ein Sanierungsfall<br />
- was die Firmenleitung dank excellenter Erträge<br />
der viel größeren Tochtergesellschaften lange kaschierte und<br />
der Großaktionär Bayerische Vereinsbank nicht wahrhaben<br />
wollte. Die 1987 als Rettungsversuch unternommene Fusion<br />
mit der bedeutendsten Tochter zur Pfersee-Kolbermoor AG und<br />
eine komplette Betriebsumstellung wurde ein Fiasko: <strong>Der</strong> gerade<br />
erst für zig Millionen völlig neu eingerichtete und noch um<br />
eine Weberei erweiterte Betrieb in Kolbermoor mußte nach<br />
kaum mehr als einem Jahr Betriebszeit stillgelegt werden. Die<br />
BV verkaufte bald darauf ihre Aktienmehrheit an die Frankfurter<br />
Wisser-Dienstleistungsgruppe, die ein Auge auf den immens<br />
wertvollen Grundbesitz von Pfersee-Kolbermoor geworfen hatte.<br />
Außerdem konnte man noch für viel Geld die Wasserkraftwerke<br />
versilbern: Aus historischen Gründen war die Spinnerei<br />
Kolbermoor nämlich auch Energieversorgungsunternehmen für<br />
die ganze Stadt Kolbermoor, und auf die Gelegenheit hatten die<br />
Isar-Amperwerke schon lange gewartet. Heute eine reine Vermögensverwaltungs-,<br />
Immobilien- und Dienstleistungsholding.<br />
Die Baumwollspinnerei Mittweida im Zschopautal<br />
Los 118 Schätzwert 200-250 €<br />
Baumwollspinnerei Mittweida<br />
Mittweida, Actie 1.000 Mark 1.3.1895<br />
(Blankette, R 8) EF-VF<br />
Nur 17 Stück lagen im Reichsbanktresor, davon<br />
nur 5 ausgestellt, der Rest Blanketten.<br />
Gründung 1884. Zuletzt besaß die Gesellschaft 5 Spinnereien<br />
mit etwa 160.000 Spinn- und Zwirnspindeln, 3 Wasserkraftturbinen<br />
und Dampfanlagen sowie eine Mehrheitsbeteiligung an der<br />
Baumwollweberei Mittweida. Im 2. Weltkrieg wurde die Hälfte<br />
des Werkes demontiert, auf der freigewordenen Fläche wurde eine<br />
Kriegsproduktion der Lorenzwerke AG Berlin (Funkgeräte) eingerichtet.<br />
In Leipzig börsennotiert. Nach 1945 als VEB Baumwollspinnerei<br />
weitergeführt, angegliedert wurden 1951 Weißthaler<br />
Spinnerei als Werk 2 und 1964 die Baumwollspinnerei Riesa<br />
als Werk 3. Zur Wende waren etwa 1.000 Mitarbeiter beschäftigt.<br />
1995 als Sächsische Baumwollspinnerei <strong>GmbH</strong> reprivatisiert,<br />
mit Werken in Mittweida, Venusberg und Hohenfichte einer<br />
der letzten heute noch produzierenden Textilbetriebe der Region.<br />
Identische Gestaltung wie folgendes Los.<br />
Los 119 Schätzwert 350-450 €<br />
Baumwollspinnerei Mittweida<br />
Mittweida, Aktie 1.000 Mark 11.10.1919<br />
(Auflage 1500, R 10) VF+<br />
Zuvor ganz unbekannter Jahrgang, nur 5 Stück lagen<br />
im <strong>Reichsbankschatz</strong>.<br />
Los 113 Schätzwert 75-150 €<br />
Baumwollspinnerei Erlangen<br />
Erlangen, Aktie 1.000 Mark 9.4.1906<br />
(Auflage 400, R 5) EF<br />
Gründung 1880 als “Spinnerei und Weberei Erlangen”. Herstellung<br />
von Garnen, Zwirnen und Geweben aus Baumwolle,<br />
Zellwolle und Kunstseide. 1927 Fusion mit der “Oberfränkisches<br />
Textilwerk AG” und der “Mech. Baumwoll-Spinnerei und<br />
Los 116 Schätzwert 125-250 €<br />
Baumwollspinnerei Kolbermoor<br />
München und Kolbermoor, Aktie 1.000 Mark<br />
9.12.1922 (Auflage 17000, R 6) EF-VF<br />
<strong>Der</strong> größere Teil dieser Kapitalerhöhung wurde bei<br />
einem Bankenkonsortium zum Schutz gegen Überfremdung<br />
gesperrt gehalten. Hochdekorativ mit<br />
zwei Fabrikansichten in der floralen Umrandung.<br />
Gründung 1862 als AG Baumwoll-Spinnerei Kolbermoor. Wie<br />
viele andere Textilbetriebe dieser Zeit wurde das Werk auf der<br />
Los 117 Schätzwert 75-150 €<br />
Baumwollspinnerei Lengenfeld i.V. AG<br />
Lengenfeld i.V., Aktie 1.000 Mark<br />
1.10.1906 (Auflage 1200, R 3) EF<br />
Dekorative Gestaltung im Jugendstil.<br />
Gründung 1906. Betrieb einer Baum- u. Zellwoll-Spinnerei und<br />
Zwirnerei. 1942 Stilllegung der Spinnerei und Umstellung der<br />
Produktion auf andere Erzeugnisse. U.a. an der Sächs. Zellwolle<br />
AG in Plauen beteiligt. Inhaberwertpapiere seit 1994 kraftlos.<br />
Los 120 Schätzwert 15-30 €<br />
Baumwollspinnerei Mittweida<br />
Mittweida, Aktie 100 RM Jan. 1942<br />
(Auflage 2500, R 2) EF<br />
Los 121 Schätzwert 75-150 €<br />
Baumwollspinnerei Speyer AG<br />
Speyer, Aktie 1.000 RM 1.9.1936 (Auflage<br />
250, R 8) EF<br />
Gründung 1889. Herstellung von Baumwoll- und Zellwollgarnen<br />
sowie Zwirnen und Papiergarnen. 1931 erwarb die “Vereinigte<br />
Textilwerke Wagner & Moras AG”, Zittau i.Sa. die Aktienmehrheit<br />
und pachtete den Betrieb für wenige Monate, bis<br />
sie noch im gleichen Jahr in der Weltwirtschaftskrise 1931 zusammenbrach<br />
und die Aktien wieder in andere Hände gingen.<br />
Noch 1963/65 wurde eine völlig neue Spinnerei gebaut, zwei<br />
Jahre später 1967 erzwang die erste Textilkrise die Liquidation<br />
der AG. Börsennotiz bis 1955 im Frankfurter Freiverkehr, danach<br />
in München. Mehrheitsaktionär war die Bayerische<br />
Staatsbank in München. 1970 abgewickelt.<br />
Nr. 115 Nr. 119<br />
Mindestgebot: 80 %<br />
vom unteren Schätzwert<br />
12
1970 wird die Brauerei stillgelegt und die Produktion der weiter<br />
vertriebenen Marke “Storchen” in drei Braustätten der Eichbaum-Gruppe<br />
verlagert. 1971 durch Fusion in der Eichbaum-<br />
Werger-Brauereien AG aufgegangen.<br />
dustriellenfamilie Quandt ein. In den folgenden Jahrzehnten<br />
blühte BMW zu einem weltweit führenden Premium-Hersteller<br />
auf.<br />
Los 122 Schätzwert 75-150 €<br />
Baumwollspinnerei und Warperei<br />
Furth (vormals H. C. Müller)<br />
Furth bei Chemnitz, Aktie 1.000 Mark<br />
3.5.1921 (Auflage 1000, R 5) EF<br />
Gegründet 1888 nach Übernahme der Spinnerei und Zwirnerei<br />
H. C. Müller. 1943 waren 21.540 Spindeln (einschließlich 4420<br />
Zwirnspindeln) in Betrieb. 1993 Fortsetzung der Gesellschaft,<br />
1994 aufgelöst, 1998 Baumwollspinnerei und Warperei Furth<br />
AG i.L., Chemnitz.<br />
Gegründet 1897 als Bavaria Brauerei AG in Altona. 1922 Fusion<br />
mit der 1863 gegründeten Actien-Bierbrauerei in Hamburg-St.<br />
Pauli und Umbenennung wie oben. 1917-27 Übernahme<br />
diverser Brauereien in Norddeutschland. 1931/32 Sitzverlegung<br />
von Altona nach Hamburg. 1959/60 wurde auf dem<br />
Brauereigelände in Hamburg-St. Pauli ein Mineralbrunnen erbohrt,<br />
der die Voraussetzung für ein Brunnengetränke-Programm<br />
schuf, das seit 1961 unter dem Namen St. Michaelis<br />
vertrieben wird. Ab 1964 eröffnete die damalige Tochtergesellschaft<br />
ASTRA Bowling Betriebs-<strong>GmbH</strong> (die spätere Norddeutsche<br />
Gaststätten <strong>GmbH</strong>) mehrere Bowling-Anlagen im Großraum<br />
Hamburg. 1973 Verlagerung der Harburger Produktion<br />
auf das Hauptbrauhaus in Hamburg-St. Pauli. Neben dem A-<br />
STRA-Pils gehörte auch die Marke Jever zum Programm. Die<br />
Schließung der traditionsreichen, heute zum Holsten-Konzern<br />
gehörenden Brauerei Ende der 90er Jahre war in Hamburg von<br />
erbitterten Auseinandersetzungen begleitet.<br />
Los 127 Schätzwert 30-75 €<br />
Bayerische Elektrizitäts-Werke<br />
München, Aktie 100 RM Nov. 1941<br />
(Auflage 1510, R 5) EF<br />
Gründung 1898. Die Gesellschaft übernahm die der AG für E-<br />
lektricitäts-Anlagen in Köln erteilten Konzessionen und die bereits<br />
errichteten Anlagen für die Versorgung mit elektrischer E-<br />
nergie in einem Teil des Bezirksverbandes Schwaben und Neuburg.<br />
1899 wurde die Konzession zur Versorgung der Stadt<br />
Neu-Ulm (Donau) erworben und ein Kraftwerk an der Iller errichtet.<br />
1902 übernahm dei Gesellschaft das Vermögen der<br />
Bayerischen Elektricitäts-Gesellschaft Helios. Die Städte Freising,<br />
Tauberbischofsheim, Ochsenfurt wurden versorgt. Außerdem<br />
Grundbesitz in Landshut, wo zeitweilig das Zentralbüro<br />
war. Großaktionär 1943: Elektrische Licht- und Kraftanlagen<br />
AG, Berlin. Börsennotiz Berlin und München.<br />
Los 129 Schätzwert 50-100 €<br />
Bayerische Stickstoff-Werke AG<br />
München, Aktie 1.000 Mark Jan. 1914<br />
(Auflage 1400, R 4) EF<br />
Gründung 1908. Angegliedert wurde 1933 die Mitteldeutsche<br />
Stickstoffwerke AG und 1941 die Braunschweigische Harzkalkwerke<br />
<strong>GmbH</strong>. 1978 Umfirmierung in SKW Trostberg AG mit der<br />
VIAG als Großaktionär. Nach der Fusion der SKW Trostberg AG<br />
mit der Degussa-Hüls im Febr. 2001 ist Trostberg heute ein bedeutender<br />
Forschungs- und Produktionsstandort im Degussa-<br />
Konzern.<br />
Die BMW R68 von 1954<br />
Los 123 Schätzwert 200-250 €<br />
Bauverein Kriegerfamilien-Heim mbH<br />
Dresden, Anteilschein 500 Mark<br />
12.1.1942 (Ersatzurkunde auf Vordruck<br />
vom 31.12.1916, R 11), ausgestellt auf<br />
die Dresdner Handelsbank AG EF-VF<br />
Zuvor unbekannt gewesen, nur 2 Stück lagen im<br />
<strong>Reichsbankschatz</strong>.<br />
Zwischen Schützenhof-, Stephan-, Platanen- und Böttgerstraße<br />
wurden nach dem 1. Weltkrieg 121 Wohnungen für Kriegerfamilien<br />
gebaut. In den 1930er Jahren umbenannt in Baugesellschaft<br />
Familien-Heim <strong>GmbH</strong>.<br />
Los 126 Schätzwert 125-250 €<br />
Bayerische Bierbrauerei-Gesellschaft,<br />
vormals H. Schwartz<br />
Speyer, Aktie 1.000 Mark 27.9.1888<br />
(Auflage 400, R 5) VF<br />
Großformatig, sehr dekorativ verziert mit Wappen<br />
und kalligraphierten Initialbuchstaben.<br />
Gründung 1886 als Bayerische Bierbrauerei-Gesellschaft<br />
vorm. H. Schwartz in Speyer. 1914 fusionsweise Übernahme<br />
der Brauerei zum Storchen AG und Umfirmierung in “Brauerei<br />
Schwartz-Storchen AG”. Die beiden Braustätten wurden daraufhin<br />
durch einen unterirdischen Gang verbunden. 1922 Fusion<br />
mit der Brauereigesellschaft zur Sonne vorm. H. Weitz<br />
(diese hatte 1908 schon die AG Speyerer Brauhaus vorm.<br />
Schultz und 1921 die Löwenbrauerei vorm. I. Busch in Annweiler<br />
übernommen). Börsennotiz Mannheim und Frankfurt.<br />
Los 128 Schätzwert 500-625 €<br />
Bayerische Motoren Werke AG<br />
München, 4 % Sammel-Teilschuldv. 200<br />
x 500 RM Sept. 1943 (Auflage nur 20<br />
Stück, R 8) UNC<br />
Ursprung sind die “Gustav Otto Flugmaschinenwerke”, deren<br />
Gründer ein Sohn des Erfinders des Viertaktmotors Nicolaus<br />
August Otto war. Seit 1916 AG als “Bayerische Flugmotorenwerke<br />
AG”. Nach dem verlorenen Weltkrieg gab es keine Nachfrage<br />
nach Flugmotoren mehr, weshalb die BFM anderweitige<br />
Betätigung suchten: 1922 Erwerb der Motorenbau-Sparte von<br />
der Firma Knorr-Bremse und Umfirmierung in “Bayerische Motoren<br />
Werke AG”. 1925/1926 gehörte BMW zu den Gründern<br />
der <strong>Deutsche</strong>n Luft Hansa. 1928 erwarb BMW von der Gothaer<br />
Waggonfabrik die Fahrzeugfabrik Eisenach (Dixi-Werke, gebaut<br />
wurde der 3/15-PS-Dixi-Wagen nach einer Lizenz der Austin<br />
Motor Co.) <strong>Der</strong> im 2. Weltkrieg erneut boomende Bau von Flugmotoren<br />
brachte die Auto- und Motorrad-Sparte ins Hintertreffen,<br />
mit andauernden Folgen nach dem Krieg: 1959 stand<br />
BMW vor der Pleite, der Konkurrent Daimler-Benz legte ein Ü-<br />
bernahmeangebot vor. Als “Weißer Ritter” stieg damals die In-<br />
Los 130 Schätzwert 15-30 €<br />
Bayerischer Sparkassen- und<br />
Giroverband - Bayer. Gemeindebank<br />
München, Schuldv. 25 RM 31.12.1927<br />
(R 4) EF<br />
Bayerische-Kommunal-Sammel-Ablösungsanleihe.<br />
Mit anh. Auslosungsschein.<br />
Die Bayerische Gemeindebank wurde als Girozentrale für Bayerns<br />
Sparkasse 1914 errichtet. 1972 Zusammenschluß mit<br />
der staatlichen Bayerischen Landesbodenkreditanstalt zur Bayerischen<br />
Landesbank. Sie ist die Hausbank des Freistaates<br />
Bayern und Zentralbank für die bayerischen Sparkassen.<br />
Los 124 Schätzwert 75-100 €<br />
Bauverein zur Beschaffung preiswerter<br />
Wohnungen in Leipzig e<strong>GmbH</strong><br />
Leipzig, 4,5 % Na.-Schuldv. 1.000 RM<br />
1.11.1940 (R 10) EF<br />
Nur 2 Stück lagen im <strong>Reichsbankschatz</strong>.<br />
1898 gegründete Baugenossenschaft. 1929 hatte die Genossenschaft<br />
6000 Mitglieder. 1952 Integration in die Arbeiterwohnungsgenossenschaft<br />
(AWG).<br />
Los 125 Schätzwert 25-50 €<br />
Bavaria- und St. Pauli-Brauerei<br />
Hamburg, Aktie 5 x 100 RM Dez. 1941<br />
(Auflage 7000, R 3) UNC-EF<br />
Mit Firmensignet.<br />
Nr. 128 Nr. 164<br />
13
Los 131 Schätzwert 30-60 €<br />
Beamten-Wohnungs-Verein<br />
Neukölln e<strong>GmbH</strong><br />
Berlin-Neukölln, 5,5 % Schuldv. 200<br />
Goldmark 1.9.1936 (R 7) EF<br />
Gründung 1902 von engagierten Lehrern im damaligen Rixdorf.<br />
Bis 1914 Bau von 500 Wohnungen. Nach ersten Erfolgen<br />
in Neukölln weitete sich die Genossenschaft vor allem in den<br />
20er Jahren mit bedeutenden Reformsiedlungen auch auf andere<br />
Bezirke aus. Nachfolgegesellschaft ist der wbv Wohnungsbau-Verein<br />
Neukölln eG.<br />
Los 132 Schätzwert 30-75 €<br />
Becker & Kirsten AG<br />
Dresden, Aktie 1.000 RM Juni 1941<br />
(Auflage 500, R 4) EF<br />
Gegründet 1878, AG seit 1923. Herstellung und Vertrieb von<br />
Drogen, Chemikalien und anderen chemisch-technischen und<br />
pharmazeutischen Erzeugnissen sowie Farben und Großhandel<br />
mit derartigen Produkten. Großaktionär (1943): H.Th. Böhme<br />
AG, Chemnitz. Die Firma wurde nach dem Krieg enteignet.<br />
Los 133 Schätzwert 30-90 €<br />
Bellevue-Immobilien AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 RM Okt. 1928 (Auflage<br />
1500, R 3) EF<br />
Gründung 1926 als “Canada Land Comp. AG”, 1928 Umfirmierung<br />
wie oben. Trotz Weltwirtschaftskrise gelang es 1930,<br />
die Baufinanzierungsmittel für das neunstöckige “Columbushaus”<br />
am Potsdamer Platz zu beschaffen. Die Fertigstellung<br />
dieses nach modernsten Grundsätzen erbauten Bürohochhauses<br />
erfolgte im Frühjahr 1932. Wegen Bombenschäden wurde<br />
das Columbushaus, das sich nunmehr im Ostsektor der Stadt<br />
befand, 1945 abgerissen. Das 1.900 m◊ große Grundstück am<br />
Potsdamer Platz befand sich fortan im Niemandsland der Berliner<br />
Mauer. 1974 wurde die Bellevue-Immobilien-AG im Handelsregister<br />
gelöscht, aber dann 1991 nach der Wiedervereinigung<br />
reaktiviert, nachdem das Grundstück plötzlich immens<br />
wertvoll geworden war (heute steht darauf ein 16-geschossiges<br />
Bürogebäude). Zurückgekommen war der Zipfel Land übrigens<br />
schon in den 80er Jahren als Teil eines Grundstücks-Deals<br />
mit der DDR, damit man entlang der Mauer auf westlichem<br />
Gebiet eine neue Straße bauen konnte. Großaktionär war die<br />
seinerzeit noch zu Delbrück & Co. Privatbankiers gehörende<br />
“Berliner AG für Industriebeteiligungen”.<br />
Nr. 134<br />
Los 134 Schätzwert 60-120 €<br />
Berberich AG<br />
Säckingen a. Rh., Aktie 1.000 RM<br />
28.11.1929. Gründeraktie (Auflage 1200,<br />
R 6) EF<br />
Großes Prägesiegel mit prachtvollem Wappen.<br />
1929 hervorgegangen aus dem Zusammenschluß der Unternehmen<br />
Berberich & Co. oHG (gegr. 1857) und der J. Berberich<br />
Söhne (gegr. 1888) in Säckingen. Die Baumwollweberei<br />
und -druckerei war bis Mitte des 20. Jh. Deutschlands größte<br />
Fahnenfabrik. 1956 kaufte der Hanauer Geschäftemacher Albin<br />
Witter der Familie Berberich 95 % des Aktienkapitals der<br />
inzwischen fast insolventen AG (nom. 1,2 Mio. DM) zum Kurs<br />
von 10 % des Nennwertes ab. Anstatt die Firma zu sanieren<br />
verschleuderte Witter das Anlagevermögen und verkaufte u.a.<br />
das firmeneigene Kraftwerk. Für Löhne und Gehälter war trotzdem<br />
kein Geld mehr da, die Arbeiter und Angestellten erhielten<br />
statt Bargeld aus den unverkauften Restbeständen Naturalleistungen<br />
in Form von Tischdecken, Taschentüchern, Kopftüchern,<br />
Halstüchern und Schürzen. Nachdem die Mitarbeiten<br />
1958 Konkursantrag gestellt hatten, wurde Albin Witter wegen<br />
dringenden Verdachts eines Konkursvergehens verhaftet.<br />
Los 135 Schätzwert 150-250 €<br />
Bergbahn AG St. Anton am Arlberg<br />
Innsbruck, Aktie 100 RM Sept. 1940<br />
(Auflage 500, R 8) UNC<br />
Das Kapital wurde 1939/40 von Schilling auf RM<br />
und dann 1956 wieder 1:4 auf Schilling umgestellt.<br />
Gründung 1937, zunächst konzessioniert für die Seilschwebebahn<br />
von St. Anton am Arlberg auf den Galzig. Die Seilbahn<br />
wurde nach dem System Zuegg-Bleichert erbaut und am<br />
19.12.1937 eröffnet. Die Zahl der Fahrgäste stieg beständig<br />
von rd. 100.000 in den Jahren nach der Eröffnung bis knapp<br />
300.000 in den 1960er Jahren. 1953-60 Errichtung von vier<br />
Skiliften in St. Christoph sowie vom Feldherrnhügel auf den<br />
Galzig. 1962 Verleihung der eisenbahnrechtlichen Konzession<br />
für die Gampbergbahn (Seilbahn von St. Anton a.A. auf den<br />
Gampberg). Zu den Beteiligungen gehört auch ein Anteil von<br />
26 % an der Zugspitzbahn AG, Ehrwald.<br />
Los 136 Schätzwert 75-100 €<br />
Bergbau-AG Fichtelgold<br />
Brandholz, Aktie 1.000 Mark Nov. 1921<br />
(Auflage 3400, R 10) EF<br />
1924 umgestellt auf 20 Gold-Mark. Nur 5 Stück<br />
lagen im <strong>Reichsbankschatz</strong>.<br />
Nr. 135 Nr. 137<br />
Gründung 1920 zur Ausbeutung von Gold-, Silber-, Antimon-,<br />
Arsen- u. Schwefelkiesgruben im Fichtelgebirge, wobei Dir. Otto<br />
Heer in Steinach die ihm gehörenden sämtlichen Kuxe der Gewerkschaften<br />
“Fürstenzeche”, “Schickung Gottes” sowie die<br />
sechs Bergwerke der “Gew. für Antimon- und Goldgewinnung im<br />
Fichtelgebirge” einbrachte. Dazu kamen vier Gold-, Silber- und<br />
Arsen-Gruben im Kreis Löwenberg (Schlesien) und die Manganerzfelder<br />
der sächsischen Gewerkschaft “Adelma” bei Geyer im<br />
Erzgebirge. Weiter hinzuerworben wurde 1922 das Grubenfeld<br />
Markus Röhling unter den erzgebirgischen Städten Annaberg<br />
und Buchholz. Nachweislich bereits im 6. Jh. wurde im Weißmaintal<br />
bei Bad Berneck Waschgold gefunden. Beim Verfolgen<br />
des Waschgoldes im Fluß entdeckten die Bergleute schließlich<br />
die Erzgängen des “Goldberges” bei Goldkronach. <strong>Der</strong> Bergbau<br />
gelangte dort zu einer solchen Blüte, daß Kaiser Otto der Große<br />
968 einen Stamm fränkischer Bergleute nach Goslar verpflanzen<br />
konnte, wo sie das später 1000 Jahre lang betriebene Bergwerk<br />
im Rammelsberg gründeten. Bei Goldkronach unterlag der<br />
Bergbau großen Schwankungen und kam in den Hussittenkriegen<br />
ganz zum Erliegen. 1792 fielen die Fürstentümer Ansbach<br />
und Bayreuth an Preußen, 1793 wurde der Universalgelehrte A-<br />
lexander von Humboldt preußischer Bergbeamter für die Reviere<br />
Goldkronach, Naila und Wunsiedel. Er bereiste das Revier<br />
ausgiebig, steigerte Abbau und Verhüttung erheblich und sammelte<br />
hier für das Berliner Mineralienkabinett. Nach einer weiteren<br />
Periode des Darniederliegens wurde um 1850 der Bergbau<br />
vom Bayerischen Staat auf der Fürstenzeche wieder begonnen,<br />
wo auch ein Stempelpochwerk errichtet wurde. Wegen Unrentabilität<br />
hatten auch diese Aktivitäten nur sehr kurzen Bestand.<br />
Schließlich verzichtete der Staat auf seine Rechte. Die Bergbau-<br />
AG “Fichtelgold” trieb nach ihrer Gründung 1920 die Aufschlußarbeiten<br />
in den Gruben “Fürstenzeche” und “Silberne Rose” voran,<br />
brachte bis März 1922 den 200 m tiefen Ludwig-Wittmann-<br />
Schacht bei Goldmühl nieder (benannt nach dem AR-Vorsitzenden<br />
Kommerzienrat Ludwig Wittmann vom Bankhaus L. Wittmann<br />
& Co. aus Stuttgart, wo der überwiegende Teil des Kapitals<br />
eingeworben worden war), richtete von hier aus auf zwei<br />
Sohlen den Abbau des goldhaltigen “Spiesglasganges” her und<br />
stellte am Schacht ein Krupp’sches Stempelpochwerk auf. Im<br />
Juli 1923 verließen die ersten Goldbarren das Bergwerk. Am<br />
26.8.1925 wurde über das Vermögen der Ges das Konkursverfahren<br />
eröffnet. <strong>Der</strong> 2. Weltkrieg setzte dem Bergbau im Fichtelgebirge<br />
ein endgültiges Ende. <strong>Der</strong> 1981 unternommene Versuch<br />
einer Nürnberger Explorationsfirma, die Förderung der Erze mit<br />
einem Goldgehalt von 11 Gramm pro Tonne wieder aufzunehmen,<br />
scheiterte. Aber noch heute finden in Goldkronach jährliche<br />
Goldsuchertreffen statt und die “<strong>Deutsche</strong> Goldsuchervereinigung<br />
e.V.” hat hier ihren Sitz.<br />
Los 137 Schätzwert 600-750 €<br />
Bergbau-AG Friedrichssegen<br />
Friedrichssegen/Lahn, Aktie 1.000 Mark<br />
5.2.1904 (Gründeraktie, Auflage urspr.<br />
1000, R 10). Ab 1910 VZ-Aktie, ab 1912<br />
mangels erneuter Zuzahlung wieder<br />
Stammaktie VF<br />
Zuvor ganz unbekannte Emission, von den nur<br />
zwei im <strong>Reichsbankschatz</strong> gefundenen Stücken ist<br />
dies das letzte noch verfügbare. Minimale Randschäden<br />
fachgerecht restauriert.<br />
Förderanlagen der Grube Friedrichssegen um 1905<br />
<strong>Der</strong> Abbau von Blei- und Silbererzen im Gebiet von Bad Ems<br />
wurde schon von den Römern betrieben. Vorläufer von Friedrichssegen<br />
sind erstmals 1209 urkundlich erwähnt. Nach einer<br />
1768 vom Mainzer Fürstbischof erteilten Schürferlaubnis<br />
im Lahnsteiner Wald gründete sich erstmals 1853 eine AG unter<br />
der Firma “Ges. des Silber- und Bleibergwerks Friedrichssegen”.<br />
1900 bis 1903 dann eine bergrechtliche Gewerkschaft.<br />
1903 auf Betreiben von Berliner Privatbankiers erneut<br />
in eine AG umgemodelt und in Berlin an die Börse gebracht.<br />
Das auf Silber, Blei, Kupfer, Nickel, Eisen, Mangan, Schwefelkies<br />
und Dachschiefer verliehene Bergwerk Friedrichssegen,<br />
das auch alle diese Mineralien förderte, lag an der Lahn 7 km<br />
von Bad Ems und 10 km von Koblenz entfernt. Gefördert wurde<br />
über den Inneren Schacht mit 195 m Teufe und den Hauptmaschinenschacht<br />
mit 484 m Teufe. Zu den Übertageanlagen<br />
gehörte auch eine Kirche und eine Schule. Die Grubenbahn<br />
zum Bahnhof Friedrichssegen war als kombinierte Adhäsionsund<br />
Zahnradbahn die erste dieser Art in ganz Preußen. Anfang<br />
1907 ferner Ankauf des Blei- und Zinkerzbergwerks Gutehoffnung<br />
der Werlauer Gewerkschaft in St. Goar, das schon fast<br />
100 Jahre in Betrieb war und aus zwei Gangzügen förderte.<br />
<strong>Der</strong> im März 1908 getätigte Kauf des Zinkerzbergwerkes Laura<br />
bei Mehlen (Verkäufer: R. Mannesmann) wurde später wegen<br />
unbefriedigender Erzförderung rückgängig gemacht. Obwohl<br />
die Ges. zu der Zeit schon defizität und chronisch kapitalschwach<br />
war, plante man nahe der Grube Friedrichssegen<br />
noch 1912 die Errichtung einer Zinkhütte und einer Schwefelsäurefabrik.<br />
Ebenfalls 1912 löste man die Grube Friedrichssegen,<br />
deren teure weitere Erschließung nicht mehr finanzierbar<br />
war, in Form einer neuen tausendteiligen Gewerkschaft heraus.<br />
<strong>Der</strong> AG blieb danach nur noch die profitable Grube Werlau. A-<br />
ber zu spät: 1913 ging die AG in Konkurs. Die Zwangsversteigerung<br />
des Bergwerkseigentums (ein erster Termin im Nov.<br />
1914 war mit Rücksicht auf den gerade begonnenen 1. Weltkrieg<br />
abgesagt worden) fand im Okt. 1918 statt. Die Grube<br />
Werlau wurde dann wieder in der Form einer bergrechtlichen<br />
Gewerkschaft betrieben, ging 1934 an die AG für Bergbau,<br />
Blei- und Zinkfabrikation zu Stolberg und in Westfalen (Stolberger<br />
Zink AG) und stellte erst 1961 die Förderung ein. Die immer<br />
noch metallreiche Halde der Grube Friedrichssegen wurde<br />
schließlich von 1950 bis 1957 noch einmal mittels Haldenflotation<br />
ausgebeutet.<br />
Los 138 Schätzwert 500-625 €<br />
Bergbau-AG Friedrichssegen<br />
Friedrichssegen/Lahn, Aktie 1.000 Mark<br />
20.3.1907 (Auflage urspr. 1400, R 10). Ab<br />
1910 Stammaktie und 4:3<br />
zusammengelegt, ab 1912 nach<br />
Zuzahlung dann VZ-Aktie VF<br />
Ebenfalls unbekannt gewesene Emission, auch<br />
dies von den nur drei im <strong>Reichsbankschatz</strong> gefundenen<br />
Stücken das letzte verfügbare.<br />
14
Los 139 Schätzwert 25-50 €<br />
Bergbau-AG Lothringen<br />
Bochum, Genußschein 500 RM Jan. 1934<br />
(Auflage 2000, R 4) EF<br />
Gründung 1872 als Gewerkschaft der Zeche Lothringen u.a.<br />
durch Friedrich Funke und Carl und Friedrich Wilhelm Waldthausen.<br />
1880 Aufnahme der Förderung. 1912 bedeutende<br />
Ausdehnung durch Erwerb der Kuxenmehrheit der Gewerkschaft<br />
Freie Vogel und Unverhofft (1923 dann verschmolzen).<br />
1920 Umwandlung der Gewerkschaft in die Bergbau-AG Lothringen.<br />
Ein sehr interessanter Aspekt ist die “Flucht” der Gesellschaft<br />
vor der französischen Ruhrbesetzung und der Versuch,<br />
die Geschäftsschwerpunkte weiter nach Osten zu verlegen: <strong>Der</strong><br />
Firmensitz wurde 1923 (bis 1932) nach Hannover verlegt. 1924<br />
Beteiligung an der Hannoversche Maschinenbau-AG (Hanomag)<br />
und der Lindener Eisen- und Stahlwerke AG. 1925 Erwerb der<br />
Mathildenhütte AG in Bad Harzburg, der Eisenerzgruben Friedrike<br />
bei Harzburg und Hansa bei Harlingerode (alle drei 1937 an<br />
ein Konsortium aus Krupp und Hoesch verkauft) sowie einer<br />
Flußspatgrube bei Rottleberode (Südharz). Außerdem Gießereibetriebe<br />
und Erzgruben in Blankenburg und Zorge im Harz,<br />
schließlich auch an der Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn-<br />
AG beteiligt. 1933 Sanierung durch Kapitalzusammenlegung<br />
12:1, im Jahr 1936 verkaufte der Großaktionär <strong>Deutsche</strong> Bank<br />
seine Beteiligung an den Wintershall-Konzern, 1956 weiterverkauft<br />
an die ARBED-Tochter Esch weiler Bergwerksverein.<br />
Los 140 Schätzwert 30-40 €<br />
Bergbaugesellschaft “Fichtelgold”<br />
Brandholz / Stuttgart, Namens-<br />
Anteilschein 1 Anteil Febr. 1933 (R 8) VF<br />
Nur 15 Stück lagen im <strong>Reichsbankschatz</strong>. Verfärbt.<br />
Auffanggesellschaft der Bergbau-AG Fichtelgold (siehe Los<br />
136).<br />
für Industrie und Gewerbe, Kühlanlagen, industrielle Separatoren.<br />
1967 umfirmiert in Alfa-Laval Bergedorfer Eisenwerke<br />
<strong>GmbH</strong>, seit 1974 Alfa-Laval <strong>GmbH</strong>, 1991 durch Tetra Pak aufgekauft.<br />
Los 143 Schätzwert 300-375 €<br />
Bergwitzer Braunkohlen AG<br />
Bergwitz, 5 % Teilschuldv. 5.000 Mark<br />
Nov. 1921 (Auflage 400, R 12) VF+<br />
Wunderschöne Mäander-Umrahmung, Schlegel<br />
und Eisen im Unterdruck ausgespart. Zuvor unbekannt<br />
gewesen, ein Unikat aus dem <strong>Reichsbankschatz</strong>.<br />
Bei der Gründung 1905 als “Gniest-Bergwitzer Braunkohlenwerke<br />
zu Wittenberg” wurden die Braunkohlenwerke und<br />
Dampfziegelei Gniest <strong>GmbH</strong> bei Kemberg erworben. Auf einem<br />
400 ha großen Gelände am Rande des Urstromtals der Elbe<br />
wurde ein Braunkohlentagebau betrieben. Bis zu 700 Mitarbeiter<br />
förderten bis in die 1950er Jahre zuletzt über 2 Mio. t<br />
Braunkohle im Jahr. Mehrheitlich beteiligt an der (1935 stillgelegten)<br />
Braunkohlen-Abbaugesellschaft Friedensgrube AG in<br />
Meuselwitz und der Kleinbahn Bergwitz-Kemberg, die vor allem<br />
der Abfuhr der Kohle zur Anhalter Bahn Berlin-Wittenberg-Bitterfeld-Halle-Leipzig<br />
diente. Großaktionäre waren die Dresdner<br />
Bank und die Reichselektrowerke. Seit der Stilllegung Anfang<br />
der 1950er Jahre füllt sich der Tagebau, in dem bis Ende der<br />
1980er Jahre noch bedeutende Funde aus der Bronzezeit gemacht<br />
wurden, mit Wasser. Heute erinnert an die Bergbauperiode<br />
nur noch der im Tagebau entstandene Bergwitzsee.<br />
Los 145 Schätzwert 50-100 €<br />
Berlin-Burger Eisenwerk AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark 9.8.1921<br />
(Auflage 5000, R 7) EF-VF<br />
Jugendstilelemente im Unterdruck.<br />
Gründung 1913 als Herdkessel-Industrie AG, 1916 umbenannt<br />
wie oben anläßlich der Übernahme des Burger Eisenwerks von<br />
F. Angrick. Neben Erzeugnissen der Eisen-, Stahl- und Metallindustrie<br />
wurden von 1923-1927 unter der Marke Be-Be auch<br />
Motorräder hergestellt. Unterstützt durch nicht weniger als 8<br />
Kapitalerhöhungen in nur 7 Jahren fuhr die in Berlin börsennotierte<br />
AG (Mehrheitsaktionär: J. Roth AG Eisengiesserei und<br />
Maschinen-Fabriken, Berlin-Tempelhof) einen beispiellosen Expansionskurs<br />
und entwickelte sich zu einer umfassenden Holding<br />
der Eisen-, Stahl und Metallindustrie. Werke: a) Eisen-,<br />
Stahl- und Walzwerk sowie Maschinenfabrik in Burg bei Magdeburg,<br />
b) Metallwaren- und Blechemballagenfabrik in Heidenau<br />
bei Dresden (früher L. Georg Bierling & Co. AG), c) Maschinen-<br />
und Werkzeugfabrik in Rostock, d) Metallwaren-, Armaturen-<br />
und Badeöfenfabrik in Leipzig-Eutritzsch (früher vereinigte<br />
Jaeger, Rothe & Siemens-Werke AG, e) Ronomit <strong>GmbH</strong><br />
Isolierrohrfabrik in Dresden-Leuben, f) Spezialmaschinenfabrik<br />
S. Aston AG in Burg bei Magdeburg. Ferner beteiligt bei der<br />
Bayerische Eisenhandels-Ges. Ehmer & Co. KG in München, Eisengroßhandlung<br />
Hermann Kramer & Co. KG in Danzig-Langfuhr,<br />
Eisengroßhandlung Gebr. Noether KG in Bruchsal i. Baden,<br />
Eisenhandel-AG in Duisburg, R. Dolberg Maschinen- und Feldbahnfabrik<br />
AG in Berlin, Autosafe AG in Berlin, Steyr-Automobile<br />
<strong>Deutsche</strong> Verkaufs-AG in Berlin, Automat-Industrie <strong>GmbH</strong> in<br />
Wien, Dajac Deutsch-Amerikanische Automobil-Industrie AG in<br />
Berlin, Braunkohlenbergwerk “Luise” AG in Altenweddingen b.<br />
Magdeburg, Stahl- und Eisen-AG in Königsberg i. Pr., “Momentag”<br />
Moment-Büro-Bedarfs-AG in Berlin, Gebr. Voss <strong>GmbH</strong><br />
Heizungsanlagen in Stendal. Das hastig zusammengezimmerte<br />
Firmenimperium war stark fremdfinanziert und zerbrach Anfang<br />
1925, als die Gläubiger nervös wurden. In Folge der<br />
schlechten Konjunktur fand der Konkursverwalter für keines<br />
der Werke einen Käufer; lediglich die Radiatoren-Gießerei in<br />
Burg wurde zur Beschäftigungssicherung von einer stadteigenen<br />
<strong>GmbH</strong> übernommen. Die Werke Burg und Leipzig waren<br />
1929 aus der Konkursmasse entlassen, die Werke Rostock und<br />
Heidenau zwangsversteigert. Das Konkursverfahren dauerte<br />
länger als die kurze, aber intensive Scheinblüte dieses Industriekonglomerats:<br />
Erst 1936 war es nach über 10 Jahren<br />
Dauer beendet.<br />
Los 147 Schätzwert 150-200 €<br />
Berliner Bankverein AG<br />
Berlin, Aktie 20 RM Febr. 1926 (Auflage<br />
10000, R 8) EF<br />
Gegründet 1877 als Berliner Makler-Verein zwecks Betrieb und<br />
Vermittlung von Börsengeschäften. Es war die zweitälteste<br />
deutsche Maklerbank. 1891 außerdem namhafte Beteiligung<br />
an dem Prämien-Vermittlungsgeschäft von Alex. Löwenherz<br />
Nachf. in Berlin. Ferner bis 1917 beim Bankhaus Veit, Selberg<br />
& Co. in Berlin beteiligt. 1904 außerdem Übernahme des Geschäftsbetriebs<br />
des in Liquidation getretenen Börsen-Handels-<br />
Vereins, wobei auch der größte Teil der zuvor dort organisierten<br />
Händler übertrat. Dabei wurde auch der renommierte “Hertelsche<br />
Kursbericht” übernommen, den der Börsen-Handels-Verein<br />
schon bei seiner Gründung 1872 erworben hatte. Verluste<br />
bei Börsenengagements, bei Händlerkrediten und bei den Beteiligungen<br />
zehrten zu Beginn des 1. Weltkrieges Reserven und<br />
Kapital auf. Im Verlauf des Krieges, als sich die Situation nicht<br />
besserte, kam es dann zu einer stillen Liquidation. Im März<br />
1923 erfolgte, nachdem 90 % des Aktienkapitals in andere<br />
Hände übergegangen waren, die Umwandlung von einer Maklerbank<br />
in eine normale Geschäftsbank. In dem Zusammenhang<br />
1923 Umfirmierung in “Berliner Bankverein AG”. (Gleichzeitig<br />
gründeten 1923 die früheren Aktionäre zunächst nur aus<br />
Gründen des Namensschutzes eine neue AG namens Berliner<br />
Makler-Verein). <strong>Der</strong> nunmehrige Berliner Bankverein übernahm<br />
1926 im Wege der Fusion noch die Dünger-Kreditbank AG.<br />
Bald darauf zwangen ihn aber immense Kreditverluste in die<br />
1928 dann beschlossene Liquidation. 1929 auch Einstellung<br />
der Börsennotiz in Berlin.<br />
Los 148 Schätzwert 75-150 €<br />
Berliner Dampfmühlen-AG<br />
Berlin, Aktie 100 RM Jan. 1930 (Auflage<br />
1400, R 8) EF<br />
Mit Berliner Bär in der Umrandung.<br />
Gründung 1888 zum Erwerb, Errichtung und Betrieb von Getreidemühlen.<br />
1921 Aufstellung der aus dem Cöpenicker Betrieb<br />
ausgebauten Müllereimaschinen in der Berliner Mühle.<br />
Besitz: Dampfmühle Berlin SO 16, Michaelkirchstr. 22/23 (Getreide-Wäscherei<br />
und Trockenanlage, Getreide-Silos) und Getreidespeicher<br />
Berlin-Cöpenick (Mechanische Förderanlagen).<br />
Lediglich für ein Jahr (1926-27) Zusammenschluß mit der Berliner<br />
Victoriamühle, der Humboldtmühle und der Weizenmühle<br />
Karl Salomon AG in Berlin zu einer “Betriebsgesellschaft Berliner<br />
Mühlen mbH & Co., Berlin”. Börsen-Notiz: Berlin und Köln.<br />
Los 141 Schätzwert 30-75 €<br />
Bergedorf-Geesthachter Eisenbahn-AG<br />
Hamburg, Genußschein Lit. A o. N.<br />
2.5.1931 (Auflage 5400, R 5) EF<br />
Gründung 1905. Strecken (zus. 65 km): Bergedorf-Geesthacht,<br />
Bergedorf-Zollerspieker (Vierländer Eisenbahn), Geesthacht-<br />
Billwerder Moorfleet (Hamburger Marschbahn, 1928 eröffnet).<br />
1921 Übernahme der Billwärder Industriebahn (eröffnet 1907).<br />
1954 Fusion mit den “Verkehrsbetrieben des Kreises Storman”<br />
zur Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG” (VHH). 1965<br />
schließen sich VHH, HHA und die DB zum Hamburger Verkehrsverband<br />
(HVV) zusammen. 2000 Zusammenschluß mit<br />
der “Pinneberger Verkehrsgesellschaft mbH”.<br />
Los 142 Schätzwert 30-90 €<br />
Bergedorfer Eisenwerk AG Astra-Werke<br />
Lohbrügge/Bergedorf, 5 % VZ-Aktie 20.000<br />
RM Sept. 1936 (Auflage 300, R 5) EF<br />
Gegründet 1859, AG seit 1907. Spezialmaschinenbau: Astra-<br />
Molkerei-Maschinen, Alfa-Milchseparatoren, Kältemaschinen<br />
Los 144 Schätzwert 50-80 €<br />
Berlin-Borsigwalder<br />
Metallwerke Löwenberg AG<br />
Borsigwalde, 5 % Teilschuldv. 1.000 Mark<br />
Febr. 1920 (Auflage 2000, R 8) EF<br />
Gründung 1916. Herstellung und Verkauf von Kupfer- und<br />
Messingfabrikaten, u.a. für Schiff- und Lokomotivbau. 1925<br />
Vergleich, Liquidation bis Anfang der 30er Jahre.<br />
Los 146 Schätzwert 75-125 €<br />
Berliner AG für Eisengiesserei<br />
und Maschinenfabrikation<br />
Charlottenburg, Aktie 1.200 Mark Jan.<br />
1923 (Auflage 4500, R 7) EF-VF<br />
Gründung 1871 unter Übernahme der Eisengießerei “J. C.<br />
Freund & Co.”. Durch den Gründerkrach wurde die Gesellschaft<br />
schwer in Mitleidenschaft gezogen: 1881 wurden zwei<br />
alte Aktien zu 600 M in eine neue Aktie zu 300 M zusammengelegt.<br />
Hergestellt wurden Dampfmaschinen, Pumpmaschinen<br />
für Wasserwerke und Kanalisation, Asphaltaufbereitungsmaschinen,<br />
bewegliche Brücken, Motorpflüge und Kältemaschinen.<br />
Ende 1922 wurde noch eine Stahlgießerei in Betrieb genommen.<br />
Während der Inflationszeit brach der Absatz der Gesellschaft<br />
derart ein, daß 1927 die Produktion eingestellt werden<br />
mußte. Bis 1929 in Berlin börsennotiert. 1928/30 Umfirmierung<br />
in Freund-Stahl-AG. Die Ges. hatte eine Stahlsorte von<br />
besonders grosser Streckgrenze erfunden (den Siliciumstahl),<br />
jedoch blieben grössere Aufträge des größten Abnehmers (der<br />
<strong>Deutsche</strong>n Reichsbahn) auf Jahre hinaus aus. Statt dessen<br />
wurde das Verfahren von Konkurrenten kopiert. Ein Finanzkonsortium<br />
unter Führung der <strong>Deutsche</strong>n Bank und Disconto-Gesellschaft<br />
finanzierte der Ges. ihre Patentverletzungsklagen,<br />
verweigerte aber weitere Mittel, nachdem schon 2 Mio. RM in<br />
die Prozesse investiert waren, ehe es zu einer Entscheidung<br />
des Reichsgerichts kam. Schlußendlich gingen die Patente an<br />
das Finanzkonsortium, mit Unterstützung früherer Freund-<br />
Stahl-Mitarbeiter wurden sie von US-Firmen verwendet, die AG<br />
selbst ging 1932 in Liquidation.<br />
Los 149 Schätzwert 50-100 €<br />
Berliner Düngerhandel AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 RM Okt. 1931 (Auflage<br />
140, R 6) EF<br />
Gründung im Mai 1931 durch Zusammenschluß der Firmen<br />
Sarbok & Witzleb, Berlin und der Dungabteilung der Ein- und<br />
Verkaufsgenossenschaft Berliner Melkerei-Besitzer, Berlin.<br />
Zweck: Ein- und Verkauf von Dünger der Berliner Tierhaltungen<br />
und alle hiermit zusammenhängenden Geschäfte. 1943 besaß<br />
das Unternehmen einen Fuhrpark mit 45 Pferden, Umsatz jährlich<br />
etwa 2 Mill. Ztr. Dung aus Berliner Tierhaltungen. 1951 in<br />
eine <strong>GmbH</strong> umgewandelt, die AG ist erloschen.<br />
Los 150 Schätzwert 200-250 €<br />
Berliner Lombardkasse AG<br />
Berlin, Aktie (Zwischenschein) 2 x 1.000<br />
RM Aug. 1931 (R 10), ausgestellt auf<br />
Firma Gebrüder George, Berlin VF+<br />
Hektographierte Ausfertigung auf hellblauem Karton,<br />
rückseitig Dividendenstempel bis 1942 und<br />
15
lung, die 1922 als “Berliner Viehverkehrs-Bank AG” verselbständigt<br />
wurde. 1919/1922 Umfirmierung in “Handelsbank AG in<br />
Berlin”. Großaktionär war zuletzt die Bayerische Hypothekenund<br />
Wechselbank. 1932 in der großen Bankenkrise Zahlungseinstellung,<br />
Zwangsvergleich und Auflösung der Gesellschaft.<br />
Los 157 Schätzwert 100-200 €<br />
Berliner Viehcommissionsund<br />
Wechsel-Bank<br />
Berlin, Namens-Actie 1.000 Mark<br />
15.5.1902 (Auflage 500, R 5) EF-VF<br />
Geschichte und Gestaltung wie voriges Los.<br />
Umschreibungen. Zuvor unbekannt gewesen, nur<br />
3 Stück lagen im <strong>Reichsbankschatz</strong>.<br />
Gründung 1923 als Berliner Makler-Verein AG durch Mitglieder<br />
der Vereinigung von Berliner Banken und Bankiers (Stempelvereinigung)<br />
und der Interessengemeinschaft der Berliner Privatbankfirmen.<br />
Die Gründung erfolgte zunächst lediglich zum<br />
Zwecke des Namensschutzes, nachdem der “alte” 1877 als<br />
zweitälteste deutsche Maklerbank gegründete Berliner Makler-<br />
Verein 1923 in eine normale Geschäftsbank umgewandelt und<br />
in Berliner Bankverein AG umbenannt worden war. Im Juli 1931<br />
äußerte die Interessengemeinschaft der Berliner Privatbankfirmen<br />
den Wunsch, eine Lombardstelle zu schaffen, bei der ihre<br />
Mitglieder gegen Hinterlegung von Wertpapieren Lombardkredit<br />
erhalten konnten. Damit sollte der Abzug von Kundengeldern auf<br />
dem Höhepunkt der damaligen Bankenkrise kompensiert werden<br />
können. Am 31.7.1931 beschloß eine außerordentliche<br />
Hauptversammlung zu diesem Zweck die Erhöhung des Grundkapitals<br />
von 6.000 RM auf 1 Mio. RM, gleichzeitig umbenannt<br />
wie oben. Mit der technischen Durchführung der Geschäfte der<br />
Berliner Lombardkasse AG wurde zunächst die Bank des Berliner<br />
Kassen-Vereins, später die Liquidationskasse AG betraut. Ab<br />
1.5.1938 erfolgte die Geschäftsbesorgung wieder durch Angestellte<br />
der Bank des Berliner Kassen-Vereins (ab 1943: <strong>Deutsche</strong><br />
Reichsbank Wertpapiersammelbank) in der Oberwallstraße.<br />
Damit im Ostsektor Berlins verblieben, wo nach Angaben der<br />
Banken-Kommission sämtliche Geschäftsunterlagen abhanden<br />
kamen. 1951 wurde in Wilmersdorf in der Privatwohnung des<br />
Vorstands Rudolf Kastner eine Verwaltungsstelle eingerichtet.<br />
1959 entsprach die Bankenaufsicht dem Antrag auf Neuzulassung.<br />
1961 Verlegung des Verwaltungssitzes nach<br />
Frankfurt/Main und Umfirmierung in “Lombardkasse AG”. Seitdem<br />
stellt den Aufsichtsratsvorsitzenden die <strong>Deutsche</strong> Bank, die<br />
bis heute wie eh und je mit 17,32 % größter Aktionär ist. Gründung<br />
von Niederlassungen in Düsseldorf (1970), Berlin und Hannover<br />
(1985) sowie München und Stuttgart (1988). 1990 fusionsweise<br />
Übernahme der Liquidations-Casse in Hamburg AG.<br />
Los 151 Schätzwert 15-30 €<br />
Berliner Maschinenbau-AG<br />
vormals L. Schwartzkopff<br />
Berlin, Aktie 1.000 RM Dez. 1932<br />
(Auflage 5375, R 2) EF<br />
Gründung 1852, AG seit 1870. Zunächst Eisengießerei und Maschinenbauanstalt<br />
in der Chausseestraße. <strong>Der</strong> 1866 begonnene<br />
Lokomotivbau war bald der wichtigste Geschäftszweig. 1897<br />
wurde in Wildau mit dem Bau einer neuen Lokomotivfabrik begonnen<br />
(1900 fertiggestellt, ab ca. 1950 “VEB Schwermaschinenbau<br />
Heinrich Rau Wildau”, 1970 als Werk Wildau Teil des<br />
VEB Schwermaschinenbau-Kombinat Ernst Thälmann = SKET<br />
in Magdeburg geworden). Ebenfalls 1897 Beginn der Produktion<br />
der Linotype-Setzmaschine, dann auch Fabrikation von<br />
Druckluftgrubenbahnen und Glasflaschen-Maschinen sowie ab<br />
1926 von Druck- und Papierverarbeitungsmaschinen. 1908 gemeinsam<br />
mit J. A. Maffei, München, Gründung der Maffei-<br />
Schwarzkopff-Werke <strong>GmbH</strong>, die Zentrifugalpumpen, Dampfturbinen<br />
und elektrische Lokomotiven herstellte (die Beteiligung<br />
wurde 1931 an die AEG verkauft). Nach Kriegsende wurden die<br />
schwer beschädigten Werke noch zu 95 % demontiert, der Gesellschaft<br />
blieb im Westen lediglich das Werk Scheringstraße.<br />
Großaktionär war nun die Berliner Handels-Gesellschaft (BHF-<br />
Bank). 1967 wurde die Gesellschaft im Zuge der Förderung des<br />
Berliner Maschinenbaus mit anderen bekannten Fabriken in der<br />
<strong>Deutsche</strong> Industrieanlagen <strong>GmbH</strong> (DIAG) zusammengeschlossen,<br />
die 1976 dann 98 % der Aktien hielt und das gesamte Vermögen<br />
übernahm. Eine der ehedem wichtigsten Firmen der<br />
Berliner Industriegeschichte hörte damit auf zu existieren.<br />
Berliner Wertpapierbereinigung, 1968 umfirmiert in Berliner<br />
Revisions-AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft.<br />
Los 153 Schätzwert 300-375 €<br />
Berliner Schlossbrauerei AG<br />
Berlin-Schöneberg, VZ-Aktie 100 RM<br />
28.5.1934 (Auflage nur 10 Stück, R 10)<br />
EF-VF<br />
Maschinenschriftlich ausgeführt. Originalunterschriften<br />
Erich Niemann für den Aufsichtsrat und<br />
Richard Müller für den Vorstand.<br />
Gründung 1871. Produktion: Helles Bier nach Pilsener Art, dunkles<br />
Bier nach Münchner Art, obergäriges Karamelbier, Exportbier.<br />
1921 durch Fusion auf die Lindener Aktien-Brauerei in<br />
Hannover-Linden übergegangen. Seit 1926 als Schloßbrauerei<br />
AG wieder eine eigenständige AG. 1934 umfirmiert in “Berliner<br />
Schloßbrauerei AG”. Zu dem umfangreichen Gaststätten- und<br />
Hotelbesitz zählten u.a. das Restaurant “Zum Prälaten” in 9<br />
Stadtbahnbogen am Alexanderplatz, das “Prälaten am Zoo”, das<br />
“Cafe Corso”, das Golf-Hotel Berlin-Charlottenburg (Hardenbergstraße<br />
27a/28 und Kantstraße 2 und 2a), das “Prälaten in<br />
Schöneberg” sowie die Goldener Schlüssel Restaurant-Betriebsges.<br />
mbH, die Gaststätten-Gesellschaft Zentrum mbH und die<br />
Friedrichstadt Gaststätten <strong>GmbH</strong> mit dem Spezialausschank<br />
“Bärenschänke” in der Friedrichstr. 124 sowie die Kronprinzengarten<br />
Bornstedt bei Potsdam <strong>GmbH</strong>. 1960 Übernahme durch<br />
die Berliner Kindl Brauerei AG und Weiterführung als Bärenbier-<br />
Brauerei mit 300.000 hl Absatz. 1975 Schließung der Braustätte,<br />
Weiterführung der Marke Bärenpils durch die Kindl-Brauerei.<br />
Los 154 Schätzwert 15-30 €<br />
Berliner Städtische<br />
Elektrizitätswerke AG (BEWAG)<br />
Berlin, 6,5 % Debenture 1.000 $<br />
1.2.1929 (R 1) EF<br />
Grün/schwarzer Stahlstich mit allegorischer Vignette.<br />
Gründung 1923 zur Versorgung Berlins mit Elektrizität und<br />
Wärme. Kraftwerke: Klingenberg, West, Charlottenburg, Moabit,<br />
Rummelsburg, Oberspree, Spandau, Steglitz und Weißensee.<br />
1931 - die Stadt Berlin hatte gerade wieder einmal riesige<br />
Haushaltslöcher zu stopfen - ging die Konzession an die von<br />
der Privatwirtschaft getragene und finanzierte Berliner Kraftund<br />
Licht-AG (Bekula) über. Die Betriebsführung behielt die BE-<br />
WAG. 2001 übernahm der schwedische Energiekonzern Vattenfeld<br />
die Aktienmehrheit. 2002 Zusammenschluss mit der<br />
hamburgischen HEW, der Lausitzer LAUBAG und der mitteldeutschen<br />
VEAG zur Vattenfall Europe AG, die sich damit als<br />
“vierte Kraft” in der deutschen Stromversorgung etablierte.<br />
2005 squeeze-out der letzten Kleinaktionäre der bis dahin börsennotierten<br />
früheren Bewag.<br />
Los 155 Schätzwert 150-250 €<br />
Berliner Terrain- und Bau-AG<br />
Berlin, Aktie 1.200 Mark 15.12.1903.<br />
Gründeraktie (Auflage 1875, R 7) VF+<br />
Im Unterdruck fotographische Abb. von Stadtvillen.<br />
Bei der Gründung 1903 brachte die Allgemeine Berliner Omnibus-AG<br />
vier Grundstücke (Kurfürsten-, Froben-, Bülowstraße<br />
und Kottbuser Damm) als Sacheinlage ein. Mit der Parzellierung<br />
und Veräußerung von Grundstücken in Steglitz, Zehlendorf,<br />
Reinickendorf, Wittenau und am Hohenzollerndamm war<br />
die Gesellschaft nicht sonderlich erfolgreich. Sie erlitt außerdem<br />
große Forderungsverluste bei der Passage-Kaufhaus-AG.<br />
Es folgten 1912 und 1914 Sanierungsversuche. Nach der Inflation<br />
konnte 1924 das Kapital nur im extrem schlechten Verhältnis<br />
60:1 umgestellt werden. 1936 wurde bei dieser in Berlin<br />
börsennotierten AG die Eröffnung des Konkursverfahrens<br />
mangels Masse abgewiesen.<br />
Los 156 Schätzwert 125-250 €<br />
Berliner Viehcommissionsund<br />
Wechsel-Bank<br />
Berlin, Namens-Actie 1.000 Mark 15.7.1893.<br />
Gründeraktie (Auflage 600, R 5) VF<br />
Initiatoren waren führende Leute des Berliner Fleischergewerbes.<br />
Neben dem insbesondere für diese Berufsgruppe betriebenen<br />
Bankgeschäft (in der Königstraße und auf dem Städt.<br />
Vieh- und Schlachthof) besaß die Bank eine Viehagentur-Abtei-<br />
Los 158 Schätzwert 25-50 €<br />
Berliner Wäschefabrik AG<br />
vorm. Gebr. Ritter<br />
Berlin, Aktie 1.000 RM Juli 1929 (Auflage<br />
1160, R 3) EF<br />
Gegründet 1858, AG seit 1907. Herstellung von Herrenwäsche,<br />
insbesondere von Oberhemden und Schlafanzügen. Betriebseinstellung<br />
in Folge der Weltwirtschaftskreise, 1935 umbenannt<br />
in “Grundstücksgesellschaft Gerichtstraße 27 AG”. 1937<br />
Konkurseröffnung, 1944 in Abwicklung getreten.<br />
Los 159 Schätzwert 30-75 €<br />
Bernburger Saalmühlen<br />
Bernburg, Aktie 100 RM März 1928<br />
(Auflage 2000, R 3) EF<br />
Gründung 1887, Betrieb der von der damaligen Anhaltischen<br />
Finanz-Direktion gepachteten Saalemühlen. Börsennotiz Halle/Leipzig,<br />
letzter Großaktionär war die Stadtmühle Alsleben<br />
AG. Die Bernburger Mühle beherbergt heute ein Wasserkraftwerk.<br />
Los 160 Schätzwert 300-375 €<br />
Beton- und Tiefbau Mast mit<br />
Basbecker Baustoffindustrie AG<br />
Berlin, Aktie 500 RM Mai 1942 (Auflage<br />
nur 10 Stück, R 12) VF-<br />
Aktien dieser Ges. waren zuvor vollkommen unbekannt<br />
gewesen. Ein Unikat aus dem <strong>Reichsbankschatz</strong>.<br />
Links leicht wasserfleckig, Rostspur.<br />
Gründung 1922 im heutigen Landkreis Cuxhaven als Basbekker<br />
Tonwerke, ab 1929 Basbecker Portland Zement- und Tonwerke<br />
AG. Herstellung und Vertrieb von Tonwaren aller Art<br />
(Mauersteine, Dachziegel, Drainröhren u.dergl.). 1938 Verschmelzung<br />
mit der 1905 gegr. Beton- und Tiefbaugesellschaft<br />
Mast mbH in Berlin. Heute Beton- und Tiefbau Mast Hermann<br />
Hein AG, Berlin. <strong>Der</strong> Ursprungsbetrieb in Basbeck nahm seine<br />
Tätigkeit 1948 unter dem Namen “Basbecker Baustoffindustrie,<br />
Zweigniederlassung der Beton- und Tiefbau Mast AG”<br />
wieder auf, in den 1960er Jahren Stilllegung. Heute ist das A-<br />
real ein Wohngebiet.<br />
Los 152 Schätzwert 60-120 €<br />
Berliner Revisions-AG<br />
Berlin, Namensaktie 100 RM 5.6.1928.<br />
Gründeraktie (Auflage 500, R 5),<br />
ausgestellt auf Eduard Schlüter, Berlin<br />
Frohnau, Vorstandsmitglied der Ges. EF<br />
Gründung 1927. Übernahme und Ausführung von Bücher- und<br />
Steuerrevisionen, die Erledigung aller Steuerangelegenheiten,<br />
Überprüfung und Beglaubigung von Bilanzen und Gesellschaftsgründungen,<br />
auch treuhänderische Funktionen. 1950<br />
Nr. 155 Nr. 160<br />
16
Los 161 Schätzwert 20-40 €<br />
Bezirksverband für den<br />
Regierungsbezirk Kassel<br />
Kassel, 8 % Schuldv. 500 RM 1.10.1928<br />
(R 4) EF-VF<br />
Los 164 Schätzwert 400-500 €<br />
Bitterfelder Actien-Bierbrauerei<br />
vormals A. Brömme<br />
Bitterfeld, Actie 1.000 Mark 20.4.1891.<br />
Gründeraktie (Auflage 400, R 9) VF<br />
Hübsche Ornament-Umrahmung, zwei Brömme-<br />
Originalunterschriften. Nur 3 Stück lagen im<br />
<strong>Reichsbankschatz</strong>.<br />
Gründung 1880 durch den Brauereibesitzer Albert Brömme,<br />
seit 1891 AG. Die Brauerei lag an der Inn. Zörbiger Straße 25,<br />
auch eigene Mälzerei. 1920 Erwerb der Uhlemann’schen<br />
Dampfbierbrauerei in Delitzsch. Ab 1946 Aktienbrauerei, 1972<br />
als Werk Brauerei Bitterfeld zum VEB Getränkekombinat Dessau<br />
gekommen. 1990 als Brauerei Bitterfeld reprivatisiert, aber<br />
ohne anhaltenden Erfolg: 1995 Einstellung der Produktion, wenig<br />
später wurde die Brauerei abgerissen.<br />
Los 167 Schätzwert 30-80 €<br />
Blödner & Vierschrodt Gummiwarenfabrik<br />
u. Hanfschlauchweberei AG<br />
Gotha, VZ-Aktie 1.000 RM Dez. 1932<br />
(Auflage 200, R 5) EF<br />
Gegründet am 16.3.1878 als oHG, 1922 umgewandelt in eine<br />
AG. Betrieb einer Gummiwarenfabrik und Hanfschlauchweberei.<br />
Haupterzeugnisse Wasser-, Bier-, Weinschläuche, Maschinenschläuche,<br />
Konservenringe, sämtliche technische Gummiwaren<br />
in Natur- und Kunstkautschuk, außerdem Feuerwehrschläuche.<br />
Nach 1945 neben mehreren anderen Firmen in der<br />
VEB Gummiwerke (“Kowalit”) aufgegangen. Nach 1990 von der<br />
Phoenix AG übernommen.<br />
Bei der Gründung 1870 wurde die ein Jahr zuvor errichtete A.<br />
Knoblauch’sche Lagerbier-Brauerei in der Landsberger Allee<br />
11/13 übernommen. Von den in der Gründerzeit in eine AG umgewandelten<br />
Berliner Brauereien war dies eine der solideren.<br />
Auch nach dem Gründerkrach fiel der Kurs nicht unter den<br />
Nennwert und war damit der mit Abstand höchste aller Berliner<br />
Brauereien. 1897 Errichtung einer Mälzerei auf dem angrenzenden<br />
Grundstück Friedenstr. 89. Ferner erworben wurden<br />
1908 die ehemals Westphalsche Brauerei in Zossen und 1911<br />
die Exportbierbrauerei in Ketzin. 1910 Umfirmierung in “Böhmisches<br />
Brauhaus-AG”. 1922 Zusammenschluß mit der Löwenbrauerei<br />
AG in Berlin-Hohenschönhausen zur “Löwenbrauerei -<br />
Böhmisches Brauhaus AG”. 1927 Fusion mit der 1867 gegründeten<br />
Bergschloßbrauerei AG in Berlin-Neukölln. 1954/55 Abschluß<br />
eines Organvertrages mit dem neuen Hauptaktionär<br />
Schultheiss-Brauerei AG mit 5 % Garantie-Dividende für die<br />
freien Aktionäre. 1975 Verkauf der Betriebsgrundstücke Wissmannstraße/Hasenheide<br />
und Betriebsverlegung in die gepachtete<br />
Braustätte in der Bessemerstr. 84. 1979 auf die Dortmunder<br />
Union-Schultheiss-Brauerei AG verschmolzen.<br />
Los 162 Schätzwert 30-50 €<br />
Bezirksverband Oberschwäbische<br />
Elektrizitätswerke<br />
Biberach, 7 % Teilschuldv. 2.000 RM Jan.<br />
1927 (Auflage 1500, R 6) EF-<br />
Gemeinsame Anleihe der öffentlichen Stromversorgungsunternehmen<br />
der Städte/Landkreise Balingen, Biberach, Blaubeuren,<br />
Ehingen, Laupheim, Leutkirch, Münsingen, Ravensburg,<br />
Reutlingen, Rietlingen, Saulgau, Tettnang, Urach, Waldsee und<br />
Wangen.<br />
Los 165 Schätzwert 150-250 €<br />
Bitterfelder Louisen-Grube<br />
Kohlenwerk- und Ziegelei-AG<br />
Bitterfeld, St.-Prior.-Actie Lit. B 200<br />
Thaler = 600 Mark 23.10.1874 (Auflage<br />
150, R 5) VF+<br />
Hübsche Girlanden-Umrahmung. Zuvor ganz unbekannter<br />
Jahrgang.<br />
Gründung 1873. Die Gesellschaft übernahm von der Firma Keferstein,<br />
Köppen & Co. die auf der Sandersdorfer Flur gelegenen<br />
Braunkohle- und Tonfelder. Braunkohlenabbau auf den<br />
Gruben Louise und Karl Ferdinand, außerdem Betrieb einer<br />
Ziegelei, die zuletzt 3 Mio. Mauersteine jährlich produzierte.<br />
1910 nahm die Ges. 2,5 Mio. Mark in die Hand (das 4-fache<br />
des Aktienkapitals zu dieser Zeit!) und erwarb von Lehmann &<br />
Kühle in Bitterfeld die Grube Vergißmeinnicht. Nach 1945 enteignet<br />
worden.<br />
Los 168 Schätzwert 125-175 €<br />
Boden-AG Steglitz<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark Juni 1909<br />
(Auflage 1200, R 8) VF<br />
1918 umgewandelt in Vorzugsaktie, 1924 herabgesetzt<br />
auf 100 RM. Nur 12 Stück lagen im<br />
<strong>Reichsbankschatz</strong>. Links Rostfleck.<br />
Neben der Tätigkeit als Terraingesellschaft auch Darlehns- und<br />
Diskont-Geschäft. Auf einem der ursprünglich von dieser Gesellschaft<br />
erschlossenen Grundstücke steht heute übrigens die<br />
Hauptverwaltung der BfA. Die Gesellschaft besaß bei Kriegsende<br />
noch drei Häuser in Neukölln und Pankow.<br />
Los 169 Schätzwert 125-200 €<br />
Bodenbank-AG<br />
Görlitz, Aktie Reihe C 1.000 Mark<br />
2.9.1923 (R 8) EF<br />
Gründung 1923 zwecks Betrieb eines Bankgeschäftes speziell<br />
für die Interessen der städtischen und ländlichen Grund- und<br />
Bodenbesitzer. 1926 Sitzverlegung nach Berlin. 1931 von Amts<br />
wegen für nichtig erklärt.<br />
Los 171 Schätzwert 100-300 €<br />
Böhmisches Brauhaus Commandit-<br />
Gesellschaft auf Actien A. Knoblauch<br />
Berlin, Namens-Actie 200 Thaler<br />
25.6.1870. Gründeraktie (Auflage 3000,<br />
R 4, aber später fast die Hälfte in neu<br />
gedruckte RM-Aktien getauscht), ausgestellt<br />
auf Otto Hochheimer in Berlin VF<br />
Ebenfalls mit Originalunterschrift Armand<br />
Knoblauch als persönlich haftender Gesellschafter.<br />
Von den knapp 500 Aktien aus dem Reichsbank-Schatz<br />
waren nur 36 Stück in sammelwürdiger<br />
und restaurierungsfähiger Erhaltung.<br />
Los 172 Schätzwert 150-250 €<br />
Bohr-Brunnenbau- und<br />
Wasserversorgungs-AG<br />
Grünberg i. Schl., Aktie 1.000 Mark<br />
31.12.1919 (Auflage nur 100 Stück, R 6) EF<br />
Gründung der Maschinenfabrik und Brunnenbau-Anstalt 1907<br />
in Bremen als “Bohr-Brunnenbau- und Wasserversorgungs-AG<br />
vorm. L. Otten” mit Zweigniederlassung in Berlin. 1919 Sitzverlegung<br />
nach Grünberg in Schlesien. Bau von Brunnen und<br />
Wasserversorgungsanlagen, Fabrikation von Pumpen, Enteisenungs-<br />
und Filtrationsanlagen. 1950 verlagert nach Berlin, dort<br />
noch heute als Bohr-, Brunnenbau- und Wasserversorgungs-<br />
AG mit dem Arbeitsschwerpunkt Baugrunduntersuchung und<br />
Grundwasserhaushalt tätig.<br />
Alte Briefmarke<br />
Los 163 Schätzwert 75-150 €<br />
Bibliographisches Institut AG<br />
Leipzig, Aktie 1.000 Mark 21.4.1915.<br />
Gründeraktie (Auflage 4500, R 2) EF<br />
Fortführung der traditionsreichen, seit 1826 bestehenden Firma<br />
Bibliographisches Institut Meyer in Leipzig. Herausgabe von<br />
Lexika, Wörterbüchern, Atlanten und Landkarten. 1953 Sitzverlegung<br />
nach Mannheim, 1984 Fusion mit der F. A. Brockhaus<br />
<strong>GmbH</strong>, Wiesbaden. Marken: Brockhaus, Duden und Meyer. Seit<br />
1989/90 auch wieder Zusammenarbeit mit dem ehemaligen<br />
Stammhaus in Leipzig.<br />
Los 166 Schätzwert 60-120 €<br />
Bleiindustrie-AG<br />
vormals Jung & Lindig<br />
Freiberg, Aktie 1.000 Mark 1.2.1908<br />
(Auflage 500, R 4) EF-VF<br />
Großformatiges Papier, original signiert von Lindig.<br />
Gegründet 1896. Hergestellt wurden mit rd. 250 Beschäftigten<br />
Walzblei, Bleirohre und Bleiapparate für die chemische Industrie.<br />
Zweigfabriken im oberschlesischen Friedrichshütte, Eidelstedt<br />
bei Hamburg und Klostergrab (Böhmen). Börsennotiz<br />
Dresden. 1947 Sitzverlegung nach Hamburg-Eidelstedt und<br />
Umfirmierung in eine <strong>GmbH</strong>. 2000 Fusion mit der über 100<br />
Jahre alten Metallwerke Goslar und der Neue Apparatebau<br />
Goslar (vormals Bleiwerk Goslar) zur JL Goslar. <strong>Der</strong> dortige Geschäftsbereich<br />
Strahlenschutz fertigt u.a. die weitbekannten<br />
Castor-Behälter.<br />
Los 170 Schätzwert 250-500 €<br />
Böhmisches Brauhaus Commandit-<br />
Gesellschaft auf Actien A. Knoblauch<br />
Berlin, Namens-Actie 200 Thaler<br />
25.6.1870, ausgestellt auf C. A. F.<br />
Kahlbaum in Berlin (die spätere SCHERING<br />
AG). Gründeraktie (Auflage 3000, R 11,<br />
aber später fast die Hälfte in neu<br />
gedruckte RM-Aktien getauscht) VF<br />
Herrliche Gestaltung mit Abbildung des Brauerei-<br />
Gebäudes. Mit Originalunterschrift Armand<br />
Knoblauch als persönlich haftender Gesellschafter.<br />
Ausgestellt auf C. A. F. Kahlbaum wurden ü-<br />
berhaupt nur 2 Stück gefunden.<br />
Los 173 Schätzwert 100-125 €<br />
Bohrgesellschaft Bergfrei<br />
Berlin, Namens-Anteil 3/1.000 20.8.1908<br />
(Auflage 1000, R 9) EF<br />
Nur 8 Stück lagen im <strong>Reichsbankschatz</strong>.<br />
Gründung 1905. Bohrungen auf Kali bei Lauterbach in Hessen<br />
blieben ohne Erfolg.<br />
Altes Werbeplakat der Bitterfelder Brauerei<br />
Nr. 170 Nr. 172<br />
17
Los 174 Schätzwert 75-150 €<br />
Bohrgesellschaft Heinrichshall<br />
[Berlin], Namens-Anteil 1/1.000<br />
13.6.1906 (Auflage 1000, R 7) EF<br />
Gründung 1905. Sitz in Magdeburg. Gerechtsame: 15000<br />
Morgen in den Gemeinden Brome, Zicherie, Croya und Voitze<br />
Provinz Hannover, benachbart mit Bismarckhall und Centrum.<br />
Die Bohrungen auf Kali in Brome (südl. Lüneburger Heide bei<br />
Wittingen) blieben ohne Erfolg.<br />
Los 175 Schätzwert 75-150 €<br />
Bohrgesellschaft Nordstern<br />
Berlin, Namens-Anteil 1/1.000 25.4.1908<br />
(Auflage 1000, R 7) EF-VF<br />
Gründung 1905 durch das Berliner Bankhaus Max Ulrich & Co.<br />
Zweck: Gerechtsame auf Kali-, Stein- und beibrechende Salze,<br />
auf Kohlen und andere Mineralien zu erwerben und durch Bohrung<br />
aufzuschließen. In der nördlichsten Ausdehnung des<br />
Ruhrreviers wurde bereits 1857 Schacht 1 im Feld Blücher III<br />
abgeteuft, 1860 ersoffen, 1865 gesümpft, 1866 umbenannt in<br />
Nordstern, 1868 Förderbeginn. 1982 durchschlägig mit Zollverein,<br />
seit 1983 Verbundbergwerk Nordstern-Zollverein, 1993<br />
endgültig stillgelegt. Nachnutzung als Standort der Bundesgartenschau<br />
(“Nordstern-Park”).<br />
Los 176 Schätzwert 75-150 €<br />
Bohrgesellschaft Philippshall<br />
Magdeburg, Namens-Anteil 1/1.000<br />
25.8.1907 (Auflage 1000, R 6) EF-<br />
Großformatiges Papier. Sehr dekorative Umrandung,<br />
Hammer und Schlegel in allen vier Ecken.<br />
Kalibohrgesellschaft, verliehene Konzession in Bermuthshain<br />
(Vogelsberg) in Hessen. Die Bohrungen hatten aber keinen Erfolg.<br />
Los 177 Schätzwert 600-750 €<br />
Bohrgesellschaft<br />
“Vereinigte Ridderburg”<br />
Recklinghausen, Antheilschein über 1 Anteil<br />
2.1.1872 (Auflage 1000, R 10), ausgestellt<br />
auf Gebr. Steinberg in Münster VF<br />
Sehr hübsche Umrahmung mit Lochblechmäandern,<br />
Hammer und Schlegel in allen vier Ecken, o-<br />
ben und unten Wappen mit “Glückauf!”. Vier Originalunterschriften.<br />
Zuvor völlig unbekannt gewesener<br />
Bergwerksanteil, nur 3 Stück wurden jetzt im<br />
<strong>Reichsbankschatz</strong> gefunden.<br />
Bohrgesellschaften suchten die Vorkommen auf und waren<br />
Vorläufer späterer Bergwerke, wenn eine Fündigkeit eintrat.<br />
Unter der Stadt Recklinghausen wurde von 1874 bis 2001<br />
Steinkohle abgebaut, was im Stadtgebiet Bergsenkungen bis<br />
zu 11 m mit sich brachte. Größere Zechenstandorte waren neben<br />
König-Ludwig 1/2/6 und 4/5 vor allem Recklinghausen I<br />
und II. Diese früheren Clerget-Schächte (von den Bergleuten<br />
bald “Klärchen” gerufen) begann 1869 die belgische “Société<br />
Civile Belge des Charbonnages d’Herne-Bochum” abzuteufen.<br />
<strong>Der</strong> deutsch-französische Krieg 1870/71 unterbrach diese Arbeiten,<br />
dafür engangierten sich wie z.B. bei “Vereinigte Ridderburg”<br />
vermehrt deutsche Investoren. Ende 1871 wurden die<br />
Arbeiten am Clerget-Schacht wieder aufgenommen, 1873<br />
wurde in einer Teufe von 225 m die Steinkohle erreicht. 1889<br />
wurde das Bergwerk von der Harpener Bergbau AG übernommen.<br />
1974 Stilllegung der Zeche, das Baufeld kam zum Bergwerk<br />
Ewald der Ruhrkohle AG und wurde 1988 abgeworfen.<br />
Zuletzt arbeitete unter Recklinghausen das Bergwerk<br />
Ewald/Hugo (zuvor Ewald/Schlägel & Eisen). Noch heute betreibt<br />
hier die DSK <strong>Deutsche</strong> Steinkohle-AG an der Wanner<br />
Straße ein Trainingsbergwerk.<br />
Los 178 Schätzwert 25-50 €<br />
Bonner Portland-Zementwerk AG<br />
Oberkassel (Siegkreis), Aktie 1.000 RM<br />
Febr. 1944 (Auflage 1000, R 3) EF<br />
Gründung 1856 als Bonner Bergwerks- und Hütten-Verein AG,<br />
1938 Umbenennung in Bonner Portland-Zementwerk AG, seit<br />
1966 Bonner Zementwerk AG. Mehrheitsaktionär waren die<br />
Dyckerhoff-Zementwerke in Wiesbaden; 1985 mit Dyckerhoff<br />
verschmolzen.<br />
Los 179 Schätzwert 150-200 €<br />
Brackweder Metallwerk AG<br />
Brackwede, Aktie Ser. B 10.000 Mark<br />
1.10.1923 (Auflage 50000, R 8) EF<br />
Nur 11 Stück lagen im <strong>Reichsbankschatz</strong>.<br />
Gründung 1923. Herstellung von Teilen für Fahrräder. Schon<br />
1924 wieder in Konkurs.<br />
Los 180 Schätzwert 25-50 €<br />
Brandenburgische Parzellierungs-AG<br />
Berlin, Aktie 100 RM Juni 1928.<br />
Gründeraktie (Auflage 750, R 3) EF<br />
Gründung 1928. Parzellierung von Grundstücken in der Provinz<br />
Brandenburg sowie die Vermittlung von Grundstücksgeschäften<br />
aller Art. 1937 wurde die Gesellschaft aufgelöst.<br />
Nr. 177 Nr. 197<br />
Los 182 Schätzwert 75-150 €<br />
Brauerei Bergschlößchen <strong>GmbH</strong><br />
Sagan, Anteilschein 500 RM Dez. 1937<br />
(R 7) EF<br />
Gründung als AG im Nov. 1923 zum Betrieb von Brauereien mit<br />
den erforderlichen Hilfs- und Nebenbetrieben, insbesondere<br />
Erwerb und Fortbetrieb der bisherigen Genossenschaftsbrauerei<br />
in Sagan. Bierniederlagen in Ost- und Westpreußen. Von<br />
1937 bis 1945: Brauerei Bergschlößchen <strong>GmbH</strong>.<br />
Los 181 Schätzwert 30-90 €<br />
Brandenburgische Städtebahn-AG<br />
Berlin, Aktie Lit. B 1.000 Mark 18.6.1923<br />
(Auflage 77724, R 2) EF<br />
Die Bahn wurde bereits im 19. Jh. als Teil eines aus militärstrategischen<br />
Gründen den Großraum Berlin großzügig umrundenden<br />
Eisenbahnringes konzipiert. Gegründet am 2.3.1901 in<br />
Berlin durch die Vereinigte Eisenbahnbau- und Betriebs-Gesellschaft,<br />
den Königlich Preussischen Fiskus, die Provinz Brandenburg,<br />
die Kreise Zauch-Belzig, Westhavelland, Ruppin und<br />
die Stadtgemeinde Brandenburg. Sitz ab 1914 in Brandenburg<br />
a.H., seit 1921 wieder in Berlin. Normalspurige 125 km lange<br />
Nebenbahn von Treuenbrietzen über Belzig, Brandenburg, Rathenow<br />
nach Neustadt a.D., Betriebseröffnung am 1.4.1904.<br />
Betriebsführung zunächst durch die Vereinigte Eisenbahnbauund<br />
Betriebs-Gesellschaft, ab 1.4.1914 führte die Gesellschaft<br />
den Betrieb selbst. Die Bahn verband die von Berlin ausgehenden<br />
Hauptstrecken nach Hamburg, Stendal, Magdeburg und<br />
Dessau miteinander und war eine der bedeutendsten deutschen<br />
Privatbahnen. Obwohl sich bei Ende des 2. Weltkrieges<br />
ohnehin über 95 % der Aktien im Besitz der öffentlichen Hand<br />
befanden, wurde die Bahn enteignet und ging 1949 in die Verwaltung<br />
der <strong>Deutsche</strong>n Reichsbahn über. In den 1960er Jahren<br />
forderte die UdSSR von der DDR einen weiteren Ausbau,<br />
um der Tschechoslowakei für den Güterverkehr einen Berlin<br />
umfahrenden Zugang zum Rostocker Hafen zu verschaffen. Ab<br />
1998 wurde die Bahn abschnittsweise stillgelegt, bis auf den<br />
37 km langen Abschnitt Brandenburg-Rathenow, der 2003-05<br />
für 55 Mio. Euro aufwändig saniert wurde und heute von Regionalzügen<br />
der Ostseeland Verkehr <strong>GmbH</strong> befahren wird. Dabei<br />
kam es zu einem bemerkenswerten Schildbürgerstreich der<br />
Bürokratie: Auch der Abschnitt Rathenow-Neustadt wurde, einschließlich<br />
der Neubauten der Brücken, für zig Millionen saniert,<br />
aber schon am 31.5.2006 nach nur 11-monatiger Betriebszeit<br />
wieder stillgelegt. Die AG selbst war übrigens schon<br />
1959 als vermögenslose Gesellschaft vom Amtsgericht Berlin-<br />
Charlottenburg gelöscht worden.<br />
Nr. 182<br />
Los 183 Schätzwert 125-200 €<br />
Brauerei Cluss<br />
Heilbronn a.N., Aktie 1.000 RM Aug. 1929<br />
(Auflage 650, R 7) EF-VF<br />
Gründung 1865, ab 1898 AG. Seinerzeit die größte Brauerei<br />
des württembergischen Unterlandes. Mehrheitsaktionär war<br />
zwischenzeitlich die später in der Baden-Württembergischen<br />
Bank aufgegangene Handels- und Gewerbebank Heilbronn AG<br />
(über 50 %). 1988 zur Cluss-Wulle AG fusioniert, gehört heute<br />
über die Dinkelacker AG in Stuttgart zur Münchener Spaten-<br />
Franziskaner-Bräu.<br />
Los 184 Schätzwert 20-75 €<br />
Brauerei Schwartz-Storchen AG<br />
Speyer, Aktie 1.000 Mark 1.4.1922<br />
(Auflage 5000, R 2) EF-VF<br />
Großformatig.<br />
Gründung 1886 als Bayerische Bierbrauerei-Gesellschaft<br />
vorm. H. Schwartz in Speyer. 1914 fusionsweise Übernahme<br />
der Brauerei zum Storchen AG und Umfirmierung in “Brauerei<br />
Schwartz-Storchen AG”. Die beiden Braustätten wurden daraufhin<br />
durch einen unterirdischen Gang verbunden. 1922 Fusion<br />
mit der Brauereigesellschaft zur Sonne vorm. H. Weitz<br />
(diese hatte 1908 schon die AG Speyerer Brauhaus vorm.<br />
Schultz und 1921 die Löwenbrauerei vorm. I. Busch in Annweiler<br />
übernommen). Börsennotiz Mannheim und Frankfurt.<br />
1970 wird die Brauerei stillgelegt und die Produktion der weiter<br />
vertriebenen Marke “Storchen” in drei Braustätten der Eichbaum-Gruppe<br />
verlagert. 1971 durch Fusion in der Eichbaum-<br />
Werger-Brauereien AG aufgegangen.<br />
18
Los 188 Schätzwert 500-625 €<br />
Braunkohlen-Abbaugesellschaft<br />
Friedensgrube<br />
Meuselwitz, Aktie 300 Mark 2.2.1882<br />
(Auflage 1285, R 9) VF<br />
Zuvor unbekannt gewesen, nur 7 Stück lagen im<br />
<strong>Reichsbankschatz</strong>. Kleine Randschäden fachgerecht<br />
restauriert.<br />
bäude übernommen (heute Sitz des Oberlandesgerichts). 1936<br />
Eingliederung der Hannoversche Bodenkredit-Bank in Hildesheim<br />
(vorher zur gewerkschaftseigenen Bank der deutschen<br />
Arbeit, der späteren BfG gehörig). Großaktionär war zu dieser<br />
Zeit die Braunschweigische Staatsbank mit ca. 60 %. 1996<br />
Verschmelzung mit der 1868 gegründeten Berliner Hypotheken-<br />
und Pfandbriefbank AG zur “Berlin-Hannoversche Hypothekenbank”.<br />
Großaktionäre sind jetzt die Bankgesellschaft<br />
Berlin (87,7 %) und die NORD/LB (10 %).<br />
Los 185 Schätzwert 150-200 €<br />
Brauerei-Gesellschaft<br />
zur Löwenburg vormals Karl Diehl<br />
Zweibrücken, Actie 1.000 Mark<br />
24.12.1896 (Auflage 300, R 8) VF-F<br />
Einzelstück aus dem <strong>Reichsbankschatz</strong>.<br />
Gründung 1887. 1906 Erwerb der Carl Mayer’schen Brauerei<br />
in Zweibrücken und sämtlicher Aktien der Zweibrücker Exportbrauerei.<br />
Nach der Jahrhundertwende konnte überhaupt nur in<br />
drei Jahren eine magere Dividende von 2 % erwirtschaftet werden,<br />
ansonsten gab es nix. Kein Wunder, daß man 1920 die<br />
Auflösung der Gesellschaft beschloß.<br />
Los 186 Schätzwert 30-90 €<br />
Braunkohlen- und Briket-Industrie AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark Dez. 1911<br />
(Auflage 2000, R 3) VF<br />
Vorliegende Kapitalerhöhung diente zum Aufbau<br />
des fünften Werks (Marie-Anne bei Kleinleipisch).<br />
Gründung 1900. In kurzer Zeit entwickelte sich die “Bubiag” zu<br />
einem der bedeutendsten Bergbaubetriebe der Niederlausitz.<br />
Großaktionär war die Schaffgotsch Bergwerksges. in Gleiwitz.<br />
1947 wurden die Tagebaue und Brikettfabriken Marie-Anne bei<br />
Kleinleipisch (heute ein Stadtteil von Lauchhammer) und Karl<br />
Büren entschädigungslos enteignet. Es verblieb der Gesellschaft<br />
das Braunkohlenbergwerk der 1923 erworbenen Gewerkschaft<br />
Frielendorf im Bezirk Kassel. 1947 Sitzverlegung<br />
nach München, Verwaltung in Hannoversch-Münden. 1951<br />
wurde die Majorität an der traditionsreichen “Elektrische Lichtund<br />
Kraftanlagen AG” übernommen. 1970 Verschmelzung der<br />
Bubiag mit der Elikraft.<br />
Bereits 1670 war bei Meuselwitz im Dreiländereck der heutigen<br />
Bundesländer Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen Braunkohle<br />
gefunden worden. Gegründet wurde die Friedensgrube<br />
1871, eingetragen 1876. Betrieb eines Braunkohlenbergwerks<br />
auf ca. 300 ha Abbaugerechtsame. In Betrieb waren der Schenken-,<br />
der Alfreds-, der Karls-, der Kiefern- und der Ottoschacht.<br />
Oberirdisch war außerdem eine Brikettfabrik in Betrieb. Seine<br />
Glanzzeit hatte das Unternehmen 1921 mit 500 Beschäftigten<br />
und einer Jahresförderung von rd. 400.000 t Braunkohle. Damit<br />
stand die Friedensgrube unter den 14 Bergwerken des<br />
Meuselwitz-Rositzer Reviers an 8. Stelle. Die Aktien waren in<br />
Leipzig börsennotiert, Großaktionäre mit je fast 50% waren die<br />
Bergwitzer Braunkohlenwerke AG und die Braunschweigischen<br />
Kohlenbergwerke. Teils der Erschöpfung der Lagerstätten, teils<br />
den Folgen der Weltwirtschaftskrise geschuldet wurde die Förderung<br />
zwischen 1927 und 1935 auf allen Schächten eingestellt,<br />
nachdem schon seit 1927 mit den Kostenstrukturen eines<br />
Tiefbaubetriebes in Konkurrenz zu den Tagebaubetrieben<br />
nicht mehr rentabel gearbeitet werden konnte.<br />
Los 189 Schätzwert 30-75 €<br />
Braunkohlenabbau-Verein<br />
zum Fortschritt<br />
Meuselwitz, Aktie 100 RM 30.11.1928<br />
(Auflage 6395, R 5) EF<br />
Gründung 1858. Betrieb von Braunkohlenbergbau im Heinrichund<br />
Wilhelmschacht sowie im Germania-Bergwerk. Neben den<br />
Tief- und Tagebauen auch Betrieb von Brikettfabriken und Ziegeleien<br />
sowie einer Landwirtschaft. Ab 1899 in großem Stil<br />
Hinzuerwerb weiterer Kohlenfelder. Die Gesellschaft gehörte<br />
der Mitteldeutschen Braunkohlen-Syndikat <strong>GmbH</strong> in Leipzig<br />
sowie der Kohlenhandelsgesellschaft Riebeck-Meuselwitz an.<br />
Börsennotiz Leipzig, mit meist zweistelligen Dividenden hoch<br />
rentabel. 1947 Enteignung durch das Land Thüringen, weshalb<br />
der Firmensitz 1949 nach Rheine (Westf.) und 1958 nach Kassel<br />
(zur mit 95 % beteiligten Wintershall AG) verlegt wurde. Seit<br />
1968 in Liquidation.<br />
Los 190 Schätzwert 30-80 €<br />
Braunschweig-Hannoversche<br />
Hypothekenbank<br />
Braunschweig, Aktie 1.200 Mark<br />
2.1.1911 (Auflage 2000, R 2) EF<br />
Das einzige Realkreditinstitut, das es in Braunschweig je gab,<br />
wurde 1871 gegründet - als eine der wenigen grundsoliden<br />
Neugründungen im Boom der ansonsten hochspekulativen<br />
“Gründerzeit” (auch während des Gründerkrachs sank der Aktienkurs<br />
der in Berlin, Hannover und Braunschweig notierten<br />
“Braunen Hanne” kaum unter pari). Zunächst wurde am Bankplatz<br />
das vorher der Braunschweigischen Bank gehörige Ge-<br />
Los 191 Schätzwert 200-250 €<br />
Braunschweig-Schöninger<br />
Eisenbahn-AG<br />
Braunschweig, Actie 1.000 Mark<br />
27.2.1901. Gründeraktie (Auflage 3950,<br />
R 8) VF<br />
Schöner G&D-Druck, mit Originalunterschriften.<br />
Gründung 1901. Vollspurige Nebeneisenbahnen Schöningen-<br />
Hötzum-Braunschweig Bahnhof (Nord-Ost) und Hötzum-Mattierzoll<br />
(Gesamtlänge 73,6 km). Gründer waren der Herzoglich-<br />
Braunschweigische Staat, die Westdeutsche Eisenbahn-Gesellschaft<br />
und die Actien-Zuckerfabrik Rautheim. Die Aktionäre<br />
hatten denkbar wenig Freude an der Bahn: In dem dreiviertel<br />
Jahrhundert des Bestehens reichte es nur vier Mal zu einer Dividende<br />
von 1 bzw. 2 %. 1950-71 sukzessive eingestellt, 1974<br />
Umwandlung in die “BSE Verwaltungs- und Beteiligungsges.<br />
mbH”. Börsennotiz bis 1934 in Braunschweig, danach im Freiverkehr<br />
Hannover. Reste der Bahnanlagen sind noch bei Riddagshausen<br />
und über Hötzum bis Schöningen zu finden, auch<br />
die meisten der alten Bahnhöfe stehen noch (und das heutige<br />
Betriebsgelände der AG Hist, das früher zur Zuckerfabrik Salzdahlum<br />
gehörte, hatte einen eigenen Gleisanschluß der BSE ...)<br />
Los 192 Schätzwert 25-50 €<br />
Braunschweigische AG<br />
für Jute- und Flachs-Industrie<br />
Braunschweig, Aktie 1.000 RM Juli 1942<br />
(Auflage 1748, R 3) EF<br />
Gründung 1868 als erste Jute-Spinnerei und Weberei auf dem<br />
europäischen Kontinent, außerdem bedeutende Sacknäherei.<br />
Bereits 1874 beschäftigte der Betrieb 400 Leute. 1920 wurde<br />
die riesige Fabrik an der Spinnerstraße (von der heute nur noch<br />
das imponierende, fast 15 m hohe Eingangsportal steht) durch<br />
einen Brand völlig zerstört: 2400 Braunschweiger wurden von<br />
heute auf morgen arbeitslos. Auch die Zweigwerke Potsdam-<br />
Babelsberg und Vechelde mußten 1926 wegen Arbeitsmangel<br />
stillgelegt werden. 1932 Verschmelzung mit der “<strong>Deutsche</strong> Jute-Spinnerei<br />
und -Weberei” in Meißen, deren Aktien aus dem<br />
Besitz der Darmstädter und National-Bank übernommen wurden.<br />
1944 wurden die Braunschweiger Werksanlagen bei einem<br />
Bombenangriff erneut schwer beschädigt, nur ein ganz<br />
bescheidener Neubeginn gelang nach dem Krieg; über die<br />
bauliche Nutzung des Trümmergeländes wird in Braunschweig<br />
bis heute diskutiert. Das Werk Meißen, in seiner Größe Braunschweig<br />
ebenbürtig, wurde nach 1945 enteignet. 1990 erwarben<br />
die Brüder Rothenberger aus Frankfurt die Aktienmehrheit,<br />
danach Umbenennung in “Rothenberger AG” und Sitzverlegung<br />
nach Frankfurt/Main. Noch heute börsennotiert.<br />
Los 193 Schätzwert 60-120 €<br />
Braunschweigische Kohlen-Bergwerke<br />
Helmstedt, Aktie 1.200 Mark 26.10.1915<br />
(Auflage 3925, R 2) EF<br />
Gründung 1873 zum Erwerb der früher braunschweigisch-fiskalischen<br />
Braunkohlengruben “Prinz Wilhelm”, “Trendelbusch”<br />
und “Treue”. 1895/96 wurden die Kohlenfelder “Joseph” und<br />
“Otto” sowie “Glück auf” und “Friedrich” hinzuerworben. Langfristige<br />
Verträge mit der “Ueberland-Zentrale Helmstedt AG”<br />
(ÜZH) führten 1913 zum Erwerb des gesamten ÜZH-Aktienkapitals<br />
durch die BKB. 1928 Erwerb der Kuxe der Jacobsgrube<br />
bei Stassfurt. Zunächst als Pächterin betrieben die BKB auch<br />
die Gruben- und Brikettfabrikbetriebe der Harbker Kohlenwerke<br />
AG und der Norddeutschen Braunkohlenwerke; 1936 wurden<br />
diese Gesellschaften auf die BKB verschmolzen. Mitten durch<br />
diese Grubenfelder hindurch ging nach 1945 die Zonengrenze<br />
und führte später zu so kuriosen Dingen wie einer zwischenstaatlichen<br />
deutsch-deutschen Vereinbarung über den Abbau<br />
der “Grenzpfeilerkohle”. 1954 wurde das Kraftwerk Offleben in<br />
Betrieb genommen und immer weiter ausgebaut, ab 1963 der<br />
Tagebau Alversdorf aufgeschlossen, stillgelegt wurden die Tagebaue<br />
Wulfersdorf und Victoria (1952), die Brikettfabrik Trendelbusch<br />
(1959), das Schwelwerk Offleben (1967) und die Ziegelei<br />
Alversdorf (1968). In eine existenzbedrohende Krise geriet<br />
das Unternehmen in den 80er Jahren durch die Auseinandersetzungen<br />
um das neue Kraftwerk Buschhaus. Heute ist das<br />
Auslaufen der Braunkohleförderung absehbar, statt dessen suchen<br />
die BKB neben der Stromversorgung neue Standbeine in<br />
der Entsorgungswirtschaft (Müllverbrennung) etc. Aufgrund historisch<br />
gewachsener Strukturen lagen jahrzehntelang je 49,86<br />
% des Kapitals bei der PreußenElektra (später VEBA) und der E-<br />
lektrowerke AG (später VIAG). Heute ist die e.on AG Alleinaktionärin,<br />
nachdem die letzte Handvoll freier Aktionäre 2002 per<br />
squeeze-out herausgedrängt wurde.<br />
Los 194 Schätzwert 20-40 €<br />
Bremen-Mindener Schiffahrt AG<br />
Bremen, Aktie 1.000 RM Dez. 1939<br />
(Auflage 3979, R 3) EF+<br />
Gründung 1886 als “Bremer Schleppschifffahrts-Gesellschaft”<br />
für die Schiffahrt auf der Weser und den mit ihr in Verbindung<br />
stehenden Flüssen und Kanälen. 1939 Verschmelzung mit der<br />
“Mindener Schleppschiffahrts-Gesellschaft” und Umfirmierung<br />
wie oben, im gleichen Jahr Übernahme der Lagerhäuser und<br />
Anlagen am Fuldahafen in Kassel. <strong>Der</strong> überwiegende Teil der<br />
zuletzt aus rd. 250 Binnenschiffen bestehenden Flotte ging im<br />
2. Weltkrieg verloren, auch die Lagerkapazitäten im Kasseler<br />
Fuldahafen wurden zerstört. Nach Neuaufbau und Modernisierung<br />
wurde 1965 schließlich ein großer Teil der Kahnflotte verkauft.<br />
1971 übergegangen an die zum Stinnes-Konzern gehörende<br />
Fendel Schiffahrts-AG in Mannheim.<br />
Los 195 Schätzwert 150-250 €<br />
Bremer Pferde-Bahn<br />
Bremen, Actie 1.200 Mark 16.11.1886.<br />
Gründeraktie (Auflage 165, R 7) EF-VF<br />
Mit Abb. des Pferdebahnwagens No. 8 (auf später<br />
ausgegebenen Aktien nach der Elektrifizierung<br />
dann durch eine “Elektrische” ersetzt).<br />
Los 187 Schätzwert 30-80 €<br />
Braunkohlen- und Briketwerk<br />
Berggeist AG<br />
Brühl, Aktie 1.000 Mark 9.5.1908.<br />
Gründeraktie (Auflage 1500, R 3) EF-VF<br />
Mit Hammerschlegel in allen vier Ecken, Berggeist<br />
als Bergmann mit Grubenlicht im Unterdruck.<br />
Bei der Gründung 1908 brachte die Zuckerfabrik Brühl AG das<br />
ihr gehörende Braunkohlenwerk Berggeist ein. 1910/11 Ankauf<br />
der markscheidenden Konzession Hedwig, 1913/14 der<br />
Konzessionen Katharinenberg, Müllersgrube, Raymannsgrube<br />
und Hültersberg. 1914/15 Erwerb der Braunkohlen-Brikettwerke<br />
Lucretia <strong>GmbH</strong> in Badorf. Ende 1920 übernahm zur Sicherung<br />
ihrer Brennstoffversorgung die Rheinische Metallwaarenund<br />
Maschinenfabrik in Düsseldorf (Rheinmetall) die Berggeist-<br />
Aktienmehrheit. Später ging die Majorität an die Bank für Industrie<br />
und Verwaltung AG in Berlin, auf die Berggeist 1937 verschmolzen<br />
wurde.<br />
Nr. 188 Nr. 201<br />
19
und wurde 1898 um 300 Aktien aufgestockt. Da<br />
der gesamte Aktiendruck aber erst 1900 nach Volleinzahlung<br />
der Aktien erfolgte, lassen sich die beiden<br />
Emissionen praktisch gar nicht unterscheiden.<br />
Gründung 1896, Betriebsbeginn 1901/02. Die schmalspurige<br />
Nebenbahn (1.000-mm-Spur) führte von Brohl am Rhein hinauf<br />
in die Eifel über Niederzissen und Weibern bis nach Kempenich.<br />
Die 23,8 km lange Bahn überwand dabei einen Höhenunterschied<br />
von fast 400 m, beim Bahnhof Engeln sogar im Zahnstangenbetrieb.<br />
Alleiniger Aktionär war die Westdeutsche Eisenbahn-Ges.<br />
in Köln. Als weit über die Grenzen der Region bekannte<br />
Museumsbahn noch heute in Betrieb, sogar an der Autobahn<br />
stehen große Hinweisschilder auf die Brohlthal-Bahn.<br />
Vegesack um 1900<br />
Gründung 1876 (Neuausgabe der Aktien 1886). Eröffnet am<br />
4.6.1876 als Pferdebahn, elektrischer Betrieb ab 1.5.1892.<br />
Normalspurige Strecken von zus. 67 km Länge. Noch heute als<br />
Bremer Strassenbahn AG börsennotiert.<br />
Los 196 Schätzwert 30-90 €<br />
Bremer Silberwarenfabrik AG<br />
Bremen, Aktie 1.000 RM Aug. 1928<br />
(Auflage 240, R 5) EF<br />
Gründung 1905, mit dem Großaktionär Wilkens & Söhne AG<br />
1969 Verschmelzung zur Wilkens Bremer Silberwaren AG. Das<br />
ehemalige Betriebsgelände der BSF ist heute Teil des Mercedes-Werks.<br />
Heute existiert nur noch der Mantel und wird unter<br />
der alten WKN an der Börse gehandelt.<br />
Los 197 Schätzwert 450-750 €<br />
Bremer Vulkan<br />
Schiffbau und Maschinenfabrik<br />
Vegesack, Actie 1.000 Mark März 1900<br />
(Auflage 500, R 8) VF+<br />
Gründung 1893 unter Übernahme der Fa. Johann Lange in<br />
Grohn bei Vegesack. 1898 Verlegung der Werft auf ein 33 ha<br />
großes Gelände am rechten Weserufer in den Bezirken Vegesack<br />
und Fähr-Lobbendorf mit 1,3 km Wasserfront. Bis zur<br />
Jahrhundertwende erfolgte fast jedes Jahr eine Kapitalerhöhung<br />
- zunächst ohne großen Effekt, doch später wurden Dividenden<br />
bis zu 20 % verdient. <strong>Der</strong> Glanz verblaßte in der Werftenkrise<br />
der 1970er Jahre: Zuletzt wurde der Bremer Vulkan<br />
das Instrument der Werftenpolitik des Bremer Senats unter der<br />
hochqualifizierten Führung eines vormaligen Senatsdirektor als<br />
Vorstandsvorsitzendem - trotzdem (oder gerade deswegen?)<br />
ein krachender Zusammenbruch mit Milliardenverlusten. Auch<br />
die immensen Fördergelder für die nach der Wende zusätzlich<br />
noch übernommenen ostdeutschen Werften wurden in Bremen<br />
noch “verzockt”, ehe man das Schiff sinken ließ.<br />
Los 199 Schätzwert 60-120 €<br />
Bremer Woll-Kämmerei<br />
Bremen / Blumenthal, Aktie 1.000 Mark<br />
1.1.1907 (R 3) EF-VF<br />
Gründung 1883. Werk in Bremen-Blumenthal, außerdem 1932<br />
Übernahme einer 45-%-Beteiligung bei der Gründung der<br />
Hamburger Wollkämmerei <strong>GmbH</strong> in Hamburg-Wilhelmsburg.<br />
Das Werk erlitt so gut wie keine Kriegsschäden, wurde allerdings<br />
nach dem Einmarsch der Alliierten größtenteils von der<br />
US-Besatzung genutzt und erst im März 1947 wieder freigegeben.<br />
Nachdem im Laufe der Jahrzehnte alle deutschen Konkurrenten<br />
(Nordwolle, Bremer Wollwäscherei, Kämmerei Döhren)<br />
aufgeben mussten, ist die noch heute börsennotierte Bremer<br />
Woll-Kämmerei das größe Unternehmen seiner Branche in<br />
ganz Europa. Kürzlich auch erhebliche Investitionen in Australien,<br />
mit denen man den Woll-Erzeugern räumlich näherrückte<br />
- im Gegenzug beteiligte sich ein australischer Wollkonzern mit<br />
einem größeren Anteil an der Bremer Wolle.<br />
Los 200 Schätzwert 50-80 €<br />
Briefumschlagfabrik Hansa AG<br />
Danzig, Aktie 100 Danziger Gulden April<br />
1925 (Auflage 482, R 6) EF<br />
Schönes großes Löwen-Logo im Unterdruck.<br />
Herstellung von Briefumschlägen und Briefpapier aller Art sowie<br />
von Selbstklebe-Postkarten. Laut HV vom 21.6.1941 wurde<br />
die Satzung neu gefaßt.<br />
Los 201 Schätzwert 200-250 €<br />
Brikettwerke Friedland AG<br />
Friedland, Aktie 1.000 Mark 24.4.1922.<br />
Gründeraktie (Auflage 10000, R 10) VF+<br />
Aktien dieser Ges. waren zuvor völlig unbekannt,<br />
von den nur 3 im <strong>Reichsbankschatz</strong> gefundenen<br />
Stücken ist dies das allerletzte noch verfügbare.<br />
Gegründet zur Errichtung und zum Betrieb eines Brikettwerkes<br />
in Friedland in Mecklenburg. 1927 in Liquidation gegangen, AG<br />
1931 gelöscht.<br />
Los 203 Schätzwert 15-30 €<br />
Brown, Boveri & Cie AG<br />
Mannheim, Aktie 1.000 RM Jan. 1934<br />
(Auflage 10000, R 2) EF<br />
G & D-Druck.<br />
Gründung 1900 durch die Schweizer BBC. Das breite Produktionsprogramm<br />
umfasste im Laufe der Geschichte u.a. Dampfturbinen<br />
und Verdichter sowie den Bau kompletter Kraftwerke,<br />
Hoch- und Niederspannungsschaltanlagen, elektrische Bahnen<br />
aller Art (incl. Seil- und Schwebebahnen), Signalanlagen, Triebwagen,<br />
Lokomotiven, Oberleitungs-Omnibusse, elektrische<br />
Ausrüstungen für Werkzeugmaschinen, Hebezeug- und Transportanlagen,<br />
Bagger, Abraum-Förderbrücken sowie Dreh-,<br />
Hub- und Klappbrücken. Seit dem Zusammenschluss der<br />
Schweizer BBC mit dem schwedischen Asea-Konzern im Jahr<br />
1988 als Asea Brown Boveri AG (ABB) firmierend und innerhalb<br />
des Konzerns mit Produktionsstandorten in 9 Ländern (davon<br />
44 allein in Deutschland) die weltweit größte Einzelgesellschaft.<br />
Bis heute an sechs deutschen Börsen notiert.<br />
Los 204 Schätzwert 50-100 €<br />
Brüder Reininghaus<br />
AG für Brauerei und Spiritus-Industrie<br />
Graz, Aktie 1.000 RM März 1942 (Auflage<br />
31250, R 7) EF<br />
Gründung 1853, AG seit 1903. Die Firma geht auf ein bereits<br />
1696 von Lorenz Schaupp am derzeitigen Betriebsstandort errichtetes<br />
Brauhaus zurück. 1935 Erwerb von Beteiligungen an<br />
der Gösser Brauerei AG und der Ersten Grazer Actien-Brauerei<br />
(1944 auf Reininghaus fusioniert). Börsennotiz in Wien, seit<br />
1960/61 auch Frankfurt/Main, München und Düsseldorf. Heute<br />
Brau-AG.<br />
Gründung 1904 zur Übernahme des Brauerei- und Wirtschaftsbetriebes<br />
von Wilh. Loeschigk in Nordhausen, Hallesche<br />
Str. 32. Außerdem wurde 1919 die Brauerei Ziegler in Sondershausen<br />
angekauft und gleich darauf stillgelegt. Knapp<br />
20.000 hl Roland-Bräu und Diadem-Pilsener jährlich betrug<br />
der Ausstoß. Die Brauerei am Taschenberg überlebte auch die<br />
DDR mit “Nordquell” und “Roland Bräu” und rettete sich nach<br />
der Wende in die Reprivatisierung (woran wir allerdings ungute<br />
Erinnerungen haben, denn die neuen Eigentümer ersteigerten<br />
vor Jahren auf unserer Auktion eine Historische Aktie vom<br />
Bürgerlichen Brauhaus; bezahlt haben sie die bis heute nicht).<br />
Im Jan. 2007 schloß sich ein Investoren-Konsortium für den<br />
Abriß und kompletten Neubau der Brauerei am traditionellen<br />
Standort zusammen, die Mitte 2008 als “Bürgerliches Brauhaus”<br />
ihren Betrieb dann wieder aufnehmen soll.<br />
Los 207 Schätzwert 30-75 €<br />
Bürgerliches Brauhaus AG<br />
Saalfeld (Saale), Aktie 1.000 RM Nov. 1925.<br />
Gründeraktie (Auflage 2400, R 3) EF<br />
Gründung 1892 als Privatbrauerei durch die Familie Gütermann,<br />
die in der Pößnecker Straße 35 nahe beim Bahnhof auf<br />
einem 218.000 qm großen Areal eine neue Brauerei errichtete<br />
und dort das “Bürgerbräu” braute. Zuvor war in Saalfeld in<br />
kommunalen Brauhäusern gebraut worden. Ein Filialbetrieb mit<br />
eigener Brauerei bestand in Schmiedefeld (Rennsteig). 1918<br />
Übernahme des einzigen Lokalrivalen “Vereinigte Dampfbierbrauerei<br />
Saalfeld”. <strong>Der</strong>en Brauerei wurde sofort stillgelegt, die<br />
Mälzerei dagegen noch bis 1952 weiter betrieben. Umgewandelt<br />
1908 in eine <strong>GmbH</strong> und 1925 in eine AG (letzter Großaktionär<br />
war die Leipziger Riebeck-Brauerei), mit der ebenfalls<br />
zum Riebeck-Konzern gehörenden Brauerei Hack AG in Meiningen<br />
wurde 1926 ein Interessengemeinschaftsvertrag geschlossen.<br />
Seit 1948 VEB, 1990 von der Treuhandanstalt in die<br />
“Bürgerliches Brauhaus Saalfeld <strong>GmbH</strong>” umgewandelt, 1991<br />
von privaten Investoren übernommen, die in die maroden Gebäude<br />
und Anlagen dann über 7 Mio. € investierten (eine<br />
Schachtelbeteiligung übernahm u.a. die Kulmbacher Brauerei<br />
AG). Heute mit der Marke “Saalfelder” regional sehr erfolgreich.<br />
Los 205 Schätzwert 30-90 €<br />
Brunsviga-Maschinenwerke<br />
Grimme, Natalis & Co. AG<br />
Braunschweig, Aktie 1.000 RM Nov. 1941<br />
(Auflage 920, R 3) UNC-EF<br />
Vignette mit Abb. einer Brunsviga-Rechenmaschine.<br />
Gegründet 1871 als KGaA , AG seit 1921. Die Firma lautete bis<br />
1927 Grimme, Natalis und Co. AG. Zweck: Herstellung von Maschinen<br />
und Apparaten oder Teilen derselben und der Handel<br />
damit. Erzeugnisse waren die noch heute bekannten Rechenund<br />
Addiermaschinen “Brunsviga”. Im Jan. 1959 erfolgte die<br />
Umwandlung auf die Olympia Werke AG.<br />
Los 198 Schätzwert 300-500 €<br />
Bremer Vulkan<br />
Schiffbau und Maschinenfabrik<br />
Vegesack, Actie 1.000 Mark Aug. 1900<br />
(Auflage 1000, R 6) EF-<br />
Geschichte siehe voriges Los.<br />
Los 202 Schätzwert 30-80 €<br />
Brohlthal-Eisenbahn-Gesellschaft<br />
Köln, Aktie 1.000 Mark 1.6.1900 (Auflage<br />
3700, R 2) EF-<br />
Schöne Umrandung im Historismusstil. Das Kapital<br />
betrug ursprünglich 3,4 Mio. M in 3.400 Aktien<br />
Los 206 Schätzwert 150-250 €<br />
Bürgerliches Brauhaus AG<br />
Nordhausen, Namensaktie 200 Mark<br />
1.4.1905. Gründeraktie (Auflage 750, R 7)<br />
VF<br />
Äußerst dekorativ, mit postkartengroßer Abb. von<br />
Brauerei und Biergarten.<br />
Los 208 Schätzwert 200-250 €<br />
Bürgerliches Brauhaus Ravensburg AG<br />
Ravensburg, Aktie 1.000 Mark Jan. 1923<br />
(Auflage 3300, R 8) EF-VF<br />
Gründung 1903 zum Erwerb und Fortbetrieb der früher im Besitz<br />
der Firma Mogger & Ruile in Ravensburg befindlich gewesenen<br />
Bierbrauerei. Hinzuerworben wurden die Brauerei des<br />
Johann Schuler (1904), die Brauerei nebst Mälzerei “Zur Räuberhöhle”<br />
in Ravensburg (1907), die Bergbrauerei bei Frie-<br />
20
drichshafen (1909), die Brauerei “Zum Schützen” in Meersburg<br />
(1927) und die Gambrinusbrauerei in Weingarten (1930). Vom<br />
Mehrheitsaktionär Inselbrauerei Lindau AG wurde 1972 deren<br />
Brauereibetrieb übernommen, zugleich Umfirmierung in “Bürgerliches<br />
Brauhaus Ravensburg-Lindau AG”. Die noch heute<br />
börsennotierte AG machte bis zur Stilllegung der Brauerei Ende<br />
2000 mit ca. 70 Mitarbeitern rd. 10 Mio. € Jahresumsatz,<br />
davon fast 1/3 aus Vermietung und Verpachtung. Heute werden<br />
die meisten Umsätze mit der Aufstellung von Geldspiel- und<br />
Unterhaltungsgeräten sowie dem Betrieb von Spielhallen erzielt.<br />
Los 209 Schätzwert 75-125 €<br />
Bürstenfabrik Emil Kränzlein AG<br />
Erlangen, Aktie 1.000 RM Nov. 1929<br />
(Auflage 185, R 8) EF<br />
Gründung 1872, AG seit 1896. Fabrikation von Bürsten für Toilette<br />
und Haushalt, Zahn- und Nagelbürsten, Rasierpinseln.<br />
1922 Erwerb einer stillgelegten Brauerei und Ausbau derselben<br />
zu Arbeitsräumen, ferner Angliederung der Borstenzurichterei<br />
Heidecker in Neustadt a.A. 1995/2000 völlige Umstrukturierung<br />
und in Cranz net. AG umfirmiert. Zweck ist nunmehr die<br />
Beteiligung an anderen Unternehmen (u.a. Halle plastic <strong>GmbH</strong><br />
und Thermoplast Schwarzhausen <strong>GmbH</strong>). Zuletzt umfirmiert in<br />
Hench-Thermoplast AG. Bis heute in Frankfurt und München<br />
börsennotiert, allerdings nähert sich der Kurs langsam der<br />
Nulllinie.<br />
Los 212 Schätzwert 25-50 €<br />
C. F. Heyde Chemische Fabrik AG<br />
Berlin-Britz, Aktie 100 RM 14.7.1932<br />
(Auflage 1100, R 3) EF+<br />
Schöne Jugendstil-Umrandung.<br />
Gegründet 1876 durch Carl Friedrich Heyde, AG seit 1922.<br />
Herstellung und Vertrieb von Farben und Lacken und Linoleumkitten.<br />
1960 umgewandelt in eine <strong>GmbH</strong>.<br />
Ehemalige Werkshalle von Capito & Klein in Benrath am Rhein<br />
börsennotierten Gesellschaft ist heute eine indirekte Beteiligung<br />
am Otto Versand in Hamburg, umgekehrt ist die Otto AG für Beteiligungen<br />
mit über 96 % Großaktionär.<br />
schon die Bereiche Alcatel Air Navigation Systems und SEL Verteidigungssysteme<br />
übernommen hatte.<br />
Los 210 Schätzwert 25-50 €<br />
Büttner-Werke AG<br />
Uerdingen am Rhein, Aktie 1.000 RM Juli<br />
1929 (Auflage 1000, R 4) UNC-EF<br />
Gründung 1874 als “Rheinische Dampfkessel- und Maschinenfabrik<br />
Büttner <strong>GmbH</strong>”, AG unter obigem Namen seit 1920.<br />
Herstellung von Maschinen und Anlagen zum Trocknen, Kühlen,<br />
Zerkleinern, Sichten, Mischen und Entstauben. 1929 Abtretung<br />
des Dampfkesselbaus an L. & C. Steinmüller in Gummersbach.<br />
Börsennotiz: Berlin und Freiverkehr Düsseldorf.<br />
1969 verschmolzen auf die Büttner-Schilde-Haas AG (BSH).<br />
Umfirmiert 1977 in BABCOCK-BSH AG, 1995 Umwandlung in<br />
die BABCOCK-BSH <strong>GmbH</strong>. Nach dem Zusammenbruch des<br />
Babcock-Konzerns 2002 übernommen durch die Firma Grenzebach,<br />
danach Grenzebach BSH <strong>GmbH</strong>, Bad Hersfeld.<br />
Los 211 Schätzwert 25-50 €<br />
Busch-Jaeger<br />
Lüdenscheider Metallwerke AG<br />
Lüdenscheid, Aktie 100 RM Juni 1940<br />
(Auflage 400, R 4) UNC-EF<br />
Gründung 1911 als F. W. Busch AG unter Übernahme der seit<br />
1892 betriebenen Busch’schen Fabrik. 1926 Fusion mit der<br />
Gebr. Jaeger in Schalksmühle zur “Vereinigte elektrotechnische<br />
Fabriken F.W. Busch und Gebr. Jaeger AG”. 1932 Fusion mit<br />
der Lüdenscheider Metallwerke AG vorm. Jul. Fischer & Basse<br />
zur “Busch-Jaeger Lüdenscheider Metallwerke AG”. Neben E-<br />
lektro-Installationsmaterial aller Art (Werke Lüdenscheid und<br />
Schalksmühle i.W.) auch (im Werk Aue i.W.) Herstellung von<br />
Porzellan für technische Zwecke und von Kunstharz-Erzeugnissen.1953<br />
mit der Dürener Metallwerke AG (gegr. 1885 als “Dürener<br />
Phosphorbronce-Fabrik & Metallgießerei Hupertz et Banning”,<br />
AG seit 1901) zur “Busch-Jaeger Dürener Metallwerke<br />
AG” fusionert. Neben der Rheinmetall-Borsig AG war jahrzehntelang<br />
der Industrielle Günther Quandt beteiligt (zuletzt über die<br />
Altana). 1974 wurden die inzwischen in Tochter-<strong>GmbH</strong>’s eingebrachten<br />
Metallwerke in Lüdenscheid und Düren veräußert und<br />
die Ges. in Busch-Jaeger Gesellschaft für Industriebeteiligungen<br />
AG umbenannt (als Zwischenholding u.a. für die Beteiligungen<br />
an der Milupa AG, der Byk Gulden Lomberg Chem. Fabrik<br />
<strong>GmbH</strong> und der Mouson Cosmetic <strong>GmbH</strong>). Gleichzeitig Sitzverlegung<br />
nach Frankfurt/M. und in die VARTA AG (ab 1977 in<br />
die Altana) eingegliedert.<br />
Los 213 Schätzwert 50-100 €<br />
C. H. F. Müller AG<br />
Hamburg, Aktie 1.000 RM Sept. 1942<br />
(Auflage 1499, R 5) EF<br />
Gründung 1927 als “Röntgen- und Radioröhrenwerke AG”, einen<br />
Monat nach der Gründung Erwerb der schon seit 1865 bestehenden<br />
Firma C. H. F. Müller (“Röntgen-Müller”) und Umfirmierung<br />
wie oben. Das Werk in der Röntgenstr. 24/26 in Hamburg-Fuhlsbüttel<br />
produzierte Röntgen- und sonstige elektrotechnische<br />
und medizinische Erzeugnisse. Sitz der Zentralverwaltung<br />
war Berlin, Charitestr. 3. Großaktionär war der holländische<br />
Philips-Konzern. 1960 Umwandlung in eine <strong>GmbH</strong>, heute<br />
die Philips Industrial X-Ray <strong>GmbH</strong>.<br />
Los 214 Schätzwert 75-125 €<br />
C. J. Vogel Draht- und Kabelwerke AG<br />
Berlin, 7 % Obl. 1.000 hfl. 1.4.1928 (R 6) EF<br />
Zweisprachig.<br />
Gründung 1858 in Berlin als C. J. Vogel Telegraphendrahtfabrik.<br />
Seit 1897 AG (Fabrik isolierter Drähte zu elektrischen Zwecken<br />
AG), 1899 Betriebsverlegung nach Adlershof. 1945/46 als “VEB<br />
Kabelwerk Köpenick” in Volkseigentum überführt. 1965 Verschmelzung<br />
mit der nunmehr in Köln (vorher Apolda) ansässigen<br />
“Thüringische Elektrizitäts- und Gaswerke AG”. Sitzverlegungen<br />
1969 nach Köln, 1982 nach Hannover. 1998/99 Umfirmierung<br />
in C. J. Vogel AG für Beteiligungen und weitere Sitzverlegung<br />
nach Hamburg. Einziges Aktivum der immer noch<br />
Los 215 Schätzwert 60-120 €<br />
C. L. Senger Sohn AG<br />
Krefeld (Rhld.), Aktie 1.000 Mark 1.1.1914.<br />
Gründeraktie (Auflage 296, R 5) EF<br />
Gründung am 9.7.1912. Betrieb von Geschäften der Textil-Industrie,<br />
mittelbare oder unmittelbare Beteiligung an Unternehmen<br />
gleicher oder verwandter Art. Gleich nach der Gründung wird die<br />
Existenz der Firma durch andauernde Färberstreiks gefährdet.<br />
Los 216 Schätzwert 200-250 €<br />
C. Lorenz AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 RM 20.9.1928<br />
(Auflage 2700, R 9) EF<br />
Zuvor ganz unbekannt gewesene Emission.<br />
1880 gründete Carl Lorenz in Berlin eine Telegraphenbauanstalt.<br />
Die Herstellung von Morseapparaten und Streckenläutwerken für<br />
die Eisenbahn wuchs bald rasant, doch nur 10 Jahre nach der<br />
Gründung starb Lorenz. Seine Witwe verkaufte das Unternehmen,<br />
das dann 1906 in die “C. Lorenz AG, Telephon- und Telegraphenwerke<br />
Eisenbahnsignal-Bauanstalt” umgewandelt wurde. Ab<br />
1908 werden auch drahtlose Sendeanlagen für Marine und Heer<br />
gebaut, 1909 richtet die Firma eine Versuchsfunkstelle in Eberswalde<br />
ein (aus der ab 1919 probeweise auch Rundfunk gesendet<br />
wird), 1917 wird der neue Firmenkomplex in Tempelhof bezogen.<br />
1922 werden die ersten Rundfunksender und -Empfänger hergestellt,<br />
1940 erfolgt zur Verstärkung dieses Bereiches die Übernahme<br />
des Konkurrenten G. Schaub Apparatebau <strong>GmbH</strong> in Pfornheim.<br />
Schon 1930 hatte zuvor die International Telephone & Telegraph<br />
Corporation (ITT) in New York die Aktienmehrheit erworben<br />
und hielt schließlich 98 %. 1956-1958 verschmelzen die Standard<br />
Elektrizitäts-Gesellschaft AG, die C. Lorenz AG, die Mix & Genest<br />
AG, die Telephonfabrik Berliner AG, die Süddeutsche Apparate-Fabrik<br />
<strong>GmbH</strong> und die G. Schaub Apparatebau-<strong>GmbH</strong> zur Standard<br />
Elektrik Lorenz AG (SEL). Diese steigt mit der Übernahme der<br />
Graetz KG 1961 auch in die Fernsehgeräteproduktion ein. 1987<br />
verkauf ITT die Beteiligung an die französische Cie. Générale d’Electricité<br />
(CGE), die zusammen mit eigenen Telekommunikationsaktivitäten<br />
daraus die Alcatel N.V. formt. 1993 wird die Standard<br />
Elektrik Lorenz AG umbenannt in Alcatel SEL AG. Nach der Fusion<br />
von Alcatel und Lucent Technologies 2006 ermeute Umfirmierung<br />
in Alcatel-Lucent Deutschland AG. <strong>Der</strong> Bereich Bahnsicherungstechnik,<br />
der über ein Jahrhundert lang Stellwerke, Signale, Weichenantriebe<br />
und Zugbeeinflussungssysteme geliefert hatte, wird<br />
2007 an den Thales-Konzern verkauft, der zuvor 1996 auch<br />
Nr. 216 Nr. 219<br />
Los 217 Schätzwert 30-80 €<br />
C. Lorenz AG<br />
Berlin, 4 % Teilschuldv. Lit. A 5.000 RM<br />
März 1943 (Auflage 450, R 4) EF<br />
Geschichte siehe voriges Los.<br />
Los 218 Schätzwert 75-100 €<br />
C. W. Emmrich Nachf.<br />
& Franz Wiegand AG<br />
Leipzig, VZ-Aktie 1.000 Mark 6.5.1922<br />
(Blankette, R 9) EF<br />
Gründung 1921 als Maschinen- und Armaturenfabrik AG. Herstellung<br />
von Staufferbüchsen, Maschinen und Armaturen sowie<br />
Holzbearbeitung. 1926 in Liquidation.<br />
Los 219 Schätzwert 300-375 €<br />
Capito & Klein AG<br />
Benrath am Rhein, Aktie 1.000 Mark Feb.<br />
1921 (Auflage nicht ermittelbar, da lt.<br />
Handbuch 1921 gar keine<br />
Kapitalveränderung, R 10) VF<br />
Zuvor ganz unbekannt gewesen, nur 3 Stück wurden<br />
im <strong>Reichsbankschatz</strong> gefunden.<br />
21
Gründung 1876 als oHG, seit 1906 AG. Betrieben wurde am<br />
Bahnhof Benrath ein Feinblechwalzwerk, das über fünf Blechstraßen<br />
verfügte. Seinerzeit eines der bedeutendsten deutschen<br />
Unternehmen dieser Branche. In Berlin börsennotiert.<br />
1938 Betriebsüberlassungsvertrag mit der Fried. Krupp AG<br />
(1953 wieder aufgelöst). 1962 Übertragung des Vermögens<br />
unter Ausschluss der Liquidation auf die Hauptgesellschafterin<br />
“Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation AG”. Die Feinblechfertigung<br />
im Walzwerk I an der Benrather Telleringstraße wurde<br />
erst 1976 eingestellt. Erst im Juli 2010 fiel das Walzwerk<br />
der Abrissbirne zum Opfer.<br />
Los 220 Schätzwert 75-150 €<br />
Capito & Klein AG<br />
Benrath am Rhein, Aktie 1.000 Mark Okt.<br />
1922 (Auflage 15000, R 7) EF-VF<br />
Geschichte und Gestaltung wie voriges Los.<br />
Los 221 Schätzwert 50-80 €<br />
Carl Dürfeld AG<br />
Chemnitz, Aktie 100 RM März 1930<br />
(Auflage 1200, R 6) EF<br />
Gründung 1907. Die Weberei speziell für Möbelstoffe in der<br />
Röslerstr. 27 besaß ca. 300 Webstühle und beschäftigte knapp<br />
300 Leute. Börsennotiz in Leipzig, Dresden und Chemnitz. Die<br />
Übernahme des Betriebes der Chemnitzer Teppichfabrik Oscar<br />
Kohorn & Co. im Jahr 1930 konnte die in der Weltwirtschaftskrise<br />
chronisch unterbeschäftigte Weberei nicht mehr retten:<br />
Die AG ging in Liquidation und ist 1934 erloschen.<br />
Los 222 Schätzwert 20-40 €<br />
Carl Ernst & Co. AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark Aug. 1923<br />
(Auflage 7000, R 4) EF<br />
Gründung 1899. Herstellung und Vertrieb von Luxuspapieren,<br />
Papierwaren, Artikeln für photographische Zwecke. 1925 Auflösung<br />
der Gesellschaft und damit in Liquidation.<br />
Werbeanzeige für einen Tresor<br />
der Carl Kästner AG von 1895<br />
Los 223 Schätzwert 75-125 €<br />
Carl Kästner AG<br />
Leipzig, Aktie 20 RM 13.5.1925 (Auflage<br />
1350, R 6) EF<br />
Gründung 1823 durch den Schlossermeister Carl Kästner. Seit<br />
1900 AG unter Übernahme der “Lipsia-Fahrrad-Industrie-AG”.<br />
Die Fabrik in der Berliner Str. 69 stellte Geldschränke und Tresoranlagen<br />
her. Bis 1927 in Berlin und Leipzig amtlich notiert.<br />
Die Olsen-Bande spezialisierte sich auf Geldschränke der fiktiven<br />
Firma Franz Jäger, Berlin. In Wahrheit aber spielten in den<br />
meisten Olsenbande-Filmen Geldschränke von Carl Kästner<br />
mit, der mit seinen Produkten vor dem Krieg Weltruf genoss!<br />
Los 224 Schätzwert 200-250 €<br />
Carl Kästner AG<br />
Leipzig, VZ-Aktie Lit. B 20 RM 5.11.1927<br />
(Auflage 450, R 9) EF<br />
Die Vorzugsaktien waren zuvor unbekannt, nur 7<br />
Stück wurden im <strong>Reichsbankschatz</strong> gefunden.<br />
Geschichte siehe voriges Los.<br />
Los 225 Schätzwert 50-100 €<br />
Carl Prinz AG für Metallwaren<br />
Solingen-Wald, Aktie 1.000 RM Febr.<br />
1942 (Auflage 900, R 5) EF<br />
Gründung 1913 durch Albert Prinz (1886-1966) zur Fortführung<br />
der von seinem Vater Carl Friedrich Prinz übernommenen<br />
Firma Carl Prinz vorm. Hermes & Zeyen <strong>GmbH</strong>. Albert Prinz war<br />
auch Mitbegründer des Felgenherstellers Kronprinz AG in Solingen-Ohligs<br />
(später Mannesmann-Kronprinz). Haupterzeugnisse:<br />
Preß-, Stanz- und Ziehteile, Bestecke aller Art, Koch- und Bratgeschirre,<br />
Haushaltsgeräte. In Langenfeld (Rhld.) bestand ein<br />
Zweigwerk. 1961 Abkürzung des Firmennamens auf Carl Prinz<br />
AG. Die Aktienmehrheit lag bei der Familie Prinz, aber die Aktien<br />
notierten auch im Düsseldorfer Freiverkehr. Zuletzt noch<br />
knapp 400 Beschäftigte. 1979 in eine <strong>GmbH</strong> umgewandelt.<br />
Los 226 Schätzwert 40-75 €<br />
Carl Weber & Co. <strong>GmbH</strong><br />
Oerlinghausen bei Bielefeld, 4,5 %<br />
Teilschuldv. 500 RM Juni 1943 (Auflage<br />
300, R 6) UNC-EF.<br />
Wertpapiere dieser Jahrhunderte alten Textilfirma<br />
waren zuvor völlig unbekannt.<br />
Gründung ca. 1684, <strong>GmbH</strong> seit 1908. Flachsspinnerei, Leinenweberei,<br />
Bleiche und Ausrüstumg. Erzeugt wurden Bielefelder<br />
Nr. 223 Nr. 236<br />
Leinen, Tischzeug, Taschentücher und Bettwäsche. 1969<br />
schlossen sich die Bielefelder Webereien AG sowie die Leinenwebereien<br />
A.W. Kisker und Carl Weber & Co. <strong>GmbH</strong> in der Bielefelder<br />
Textilwerke <strong>GmbH</strong> zusammen.<br />
Los 227 Schätzwert 30-75 €<br />
Carlshütte AG<br />
Eisengießerei und Maschinenbau<br />
Waldenburg-Altwasser i.Schl., Aktie 20<br />
RM Juni 1932 (R 4) EF<br />
Gründung 1821, 1837 Beginn des Maschinenbaus. Als AG<br />
1890 in Breslau, ab 1892 in Altwasser. Hauptsächlich Bau von<br />
Bergwerksmaschinen und -anlagen (Waldenburg-Altwasser),<br />
Kranen und Hebezeugen sowie Baggern (Ober-Salzbrunn).<br />
1923 Vereinigung mit dem Waldenburger Werk der Wilhelmshütte.<br />
1934 Übernahme durch die neugegründete <strong>GmbH</strong>, die<br />
im Aufbereitungsfach in Interessengemeinschaft mit Klöckner-<br />
Humboldt-Deutz steht. 1935 wurde die AG aufgelöst, an der<br />
<strong>GmbH</strong> beteiligt sich die Humboldt-Deutzmotoren maßgeblich.<br />
1940-41 wird die Beteiligung von Klöckner-Humboldt-Deutz an<br />
der Carlshütte veräußert.<br />
Los 228 Schätzwert 150-250 €<br />
Central-Ausschuss für die Innere<br />
Mission der <strong>Deutsche</strong>n<br />
Evangelischen Kirche (Protestant<br />
Church in Germany Welfare Institut)<br />
New York, 7 % Gold Bond 500 $<br />
1.10.1926 (R 6) EF-<br />
Teil einer in den USA aufgelegten Anleihe von 5 Mio.<br />
US-$. Dieser Dollar-Bond war zuvor unbekannt!<br />
Die Anfänge der sozialen Arbeit der „Inneren Mission“ liegen<br />
zwischen 1810 und 1848, als in Preußen eine neue Armut<br />
durch Arbeitslosigkeit, Invalidität, Krankheit und Alter in Folge<br />
der Frühindustrialisierung zu Tage trat. Nach der Märzrevolution<br />
1848, die die Kirchenoberen als „Gottlosigkeit“ mißbilligten,<br />
entstanden die ersten Einrichtungen der Inneren Mission, bei<br />
denen im Unterschied zur bisherigen Armenpflege soziale und<br />
kulturelle Zuwendung verbunden wurde mit dem Versuch der<br />
Re-Christianisierung und der Stabilisierung der Gesellschaft.<br />
Mit dem ersten Evangelischen Kirchentag in Wittenberg am<br />
21./22.9.1848 beginnt die Geschichte der organisierten Diakonie.<br />
<strong>Der</strong> Hamburger Pfarrer und Anstaltsleiter des „Rauhen Hauses“<br />
Johann Hinrich Wichern regt als neues Netzwerk protestantischer<br />
Sozial- und Kulturarbeit ein Koordinierungsgremium<br />
für die zahlreichen christlichen Initiativen und Vereine an. So<br />
konstituierte sich, getragen von Protestanten aus Wissenschaft<br />
und Rechtspflege, Theologen sowie höheren Staatsbeamten der<br />
preußischen Ministerial-Bürokratie, am 9.1.1849 der erste<br />
„Central-Ausschuss der Inneren Mission der deutschen evangelischen<br />
Kirche“ mit Sitz in Hamburg und Berlin. Trotz eines Erlasses<br />
des Evangelischen Oberkirchenrates in Berlin, der den<br />
Geistlichen jedes sozialpolitische Engagement untersagte, bekräftigte<br />
der Central-Ausschuß 1896 sein Anliegen, als überparteiliche<br />
Instanz auf die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen<br />
einzuwirken. 1899 machte der Ausschuß seine Arbeitsgebiete,<br />
Vereine, Konferenzen und organisatorischen Grundlagen<br />
erstmals in einer „Statistik der Inneren Mission der deutschen<br />
evangelischen Kirche“ öffentlich. Als Folge von 1. Weltkrieg, Inflation<br />
und später Weltwirtschaftskrise plagten den Central-<br />
Ausschuss immer größer werdende Geldnöte, die 1926 zur Aufnahme<br />
einer Anleihe von 5 Mio. $ in den USA führten. Doch nur<br />
wenig später spitzte sich die finanzielle und innere Krise noch<br />
zu, als 1931 die zum Central-Ausschuß gehörende Bausparkasse<br />
„Devaheim“ Konkurs anmelden mußte. Nach 1945 kam<br />
es zu einer Doppelgleisigkeit mit dem neu ins Leben gerufenen<br />
„Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland“, das bald<br />
ein kirchenpolitischer Machtfaktor wurde und die Arbeit der Inneren<br />
Mission mit dem Central-Ausschuß West mit Sitz in Bethel<br />
und dem Central-Ausschuß Ost mit Sitz in Ost-Berlin in den<br />
Schatten stellte. Ab 1957 ruhten die Organe des Central-Ausschusses.<br />
Mit Gründung des „Diakonischen Werkes der EKD“<br />
1975 wurde das Hilfswerk aufgelöst und die Innere Mission der<br />
Evangelischen Kirche auf eine neue Grundlage gestellt.<br />
Los 229 Schätzwert 60-120 €<br />
Charlottenburger Wasserwerke<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark 15.5.1888<br />
(Auflage 1000, R 4) VF-F<br />
Gründung 1878 unter Übernahme des auf fiskalischem Gelände<br />
liegenden Wasserwerks am Teufelssee. Später Errichtung<br />
der eigenen Wasserwerke Beelitzhof (am Wannsee), Jungfernheide,<br />
Johannisthal und Tiefwerder. Die Wasserwerke am Teufelssee<br />
und in der Jungfernheide wurden 1906 an die Stadt<br />
Charlottenburg verkauft. 1920 Umfirmierung in Charlottenburger<br />
Wasser- und Industriewerke AG. Die Gesellschaft belieferte<br />
im Westen und Süden von Groß-Berlin etwa 20 % der Berliner<br />
Gesamtbevölkerung mit Wasser. Die Konzessions-Verträge, vor<br />
der Bildung Groß-Berlins vor allem mit den Umland-Gemeinden<br />
geschlossen, hatten eine Laufzeit teilweise bis zum Jahr 2000.<br />
Immer wieder gab es aber Streit wegen ständiger Versuche, die<br />
Wasserversorgung zu kommunalisieren, aber auch wegen der<br />
Wasserpreise. Dieser Streit wurde beendet durch Ablösung der<br />
insgesamt 23 Konzessions-Verträge, an deren Stelle ab<br />
1.10.1935 der “Vertrag über die einheitliche Bewirtschaftung<br />
der Wasserversorgung Groß-Berlins” trat, der auch eine Dividendengarantie<br />
beinhaltete. Zwischen der Gesellschaft und<br />
Gross-Berlin wurde am 31.12.1947 ein Übertragungsvertrag<br />
für sämtliche Aktiven und Passiven geschlossen. Die Aktionäre<br />
erhielten 60 % des RM-Aktiennennwertes per 1957 in DM<br />
ausgezahlt. Für die Restansprüche, insbesondere hinsichtlich<br />
des Ostvermögens, wurden (noch heute börsennotierte) Anteilscheine<br />
ausgegeben. Die Aktien der Gesellschaft waren an den<br />
Börsen von Berlin und Amsterdam notiert.<br />
Los 230 Schätzwert 30-75 €<br />
Chemische Düngerfabrik Rendsburg<br />
Rendsburg, Aktie 100 RM 30.6.1932<br />
(Auflage 4000, R 3) EF<br />
Die 1876 gegründete AG besaß an der Kieler Str. 73 c ein riesiges,<br />
über 500.000 qm großes Werksareal mit Schwefelsäurefabrik,<br />
Superphosphatfabrik, knochenverarbeitungs- und<br />
22
Leimfabrik, außerdem Thomasschlackenmüllerei. Eine reine<br />
Familien-AG mit zuletzt rd. 300 Beschäftigten, Großaktionäre<br />
waren Dir. Herm. Eggers (ca. 60 %, Vorstand) und Konsul Thomas<br />
Entz (ca. 15 %, AR-Vorsitzender). Nach dem Tod von Eggers<br />
verkauften seine Erben die Aktienmehrheit an die BASF, in<br />
die das Unternehmen 1967 vollständig eingegliedert wurde.<br />
Los 234 Schätzwert 25-50 €<br />
Chemische Werke Albert<br />
Mainz-Amöneburg, Aktie 1.000 RM Sept.<br />
1941 (Auflage 3550, R 3) EF<br />
Geschichte siehe voriges Los.<br />
Nr. 238<br />
blenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs-AG”. Heute werden 217<br />
Stadt- und Landgemeinden in der Stadt Koblenz, dem Landkreis<br />
Mayen-Koblenz und dem Westerwaldkreis mit Strom versorgt.<br />
Großaktionäre sind das RWE (über 50 %) und die Stadt<br />
Koblenz (40 %).<br />
Los 231 Schätzwert 30-75 €<br />
Chemische Fabrik in Billwärder<br />
vorm. Hell & Sthamer AG<br />
Hamburg, Aktie 1.000 RM Sept. 1929<br />
(Auflage 500, R 4) EF<br />
Bereits 1846 wurde das Stammhaus als “Kampfer- und Salmiakfabrik<br />
von A. L. W. Jacobi” gegründet. 1865 Firmenänderung<br />
in Hell & Sthamer, 1889 Umwandlung in eine AG. Produziert<br />
wurden auf dem 94.000 qm großen Fabrikareal in HH-Billbrook,<br />
Billbrookdeich 28 mit rd. 350 Mitarbeitern Schwerchemikalien<br />
(u.a. Kali- und Natronsalpeter, Borax und Borsäure, Arseniate,<br />
Chromalaun, Chromoxyde, Natronwasserglas, xantogensaures<br />
Kali, Schwefel, Phosphor, Thioharnstoff, Schwefelkohlenstoff),<br />
Schädlingsbekämpfungs- und Pflanzenschutzmittel. 1927 Ü-<br />
bernahme der “Jan” Kemisk Fabrik im norwegischen Frederiksstad,<br />
die Phosphor herstellte (bereits 1930 wieder verkauft).<br />
Das Werk Billbrook erlitt im 2. Weltkrieg erhebliche Schäden,<br />
erst 1950 konnte wieder halbwegs normal produziert werden.<br />
Vor 1945 in Hamburg börsennotiert, Großaktionär war früher<br />
der Michael-Konzern, zuletzt die Dr. Jacob Chemische Fabrik<br />
<strong>GmbH</strong>, Kreuznach. 1962 Umwandlung in eine <strong>GmbH</strong>.<br />
Los 235 Schätzwert 100-150 €<br />
Chemnitzer Actien-Spinnerei<br />
Chemnitz, Aktie 1.000 Mark 2.5.1922<br />
(Auflage 9700, R 8) EF-VF<br />
Altes, bereits 1857 gegründetes Textilunternehmen, das in Alt-<br />
Chemnitz zwei Spinnereien neu errichtete. Hergestellt wurden<br />
Garne und Zwirne, außerdem auf weiteren Verarbeitungsstufen<br />
vorzugsweise Unterwäsche. Bereits 1913 wurde wegen aufgelaufener<br />
Verluste eine Sanierung mit einem Kapitalschnitt 5:1<br />
erforderlich, dessen Durchführung sich wegen kriegsbedingter<br />
Pausen bis 1919 hinzog. Eine ungezügelte Beteiligungspolitik<br />
in den 1920er Jahren hatte erneut hohe Verluste zur Folge und<br />
erzwang schließlich 1929 die Liquidation dieser in Leipzig und<br />
Dresden börsennotierten AG.<br />
Los 236 Schätzwert 300-375 €<br />
Chemnitzer Actien-Spinnerei<br />
Chemnitz, Aktie 5.000 Mark 27.4.1923<br />
(Auflage 2200, R 10) VF+<br />
Zuvor ganz unbekannte Ausgabe, nur 4 Stück lagen<br />
im <strong>Reichsbankschatz</strong>.<br />
Los 239 Schätzwert 60-120 €<br />
Christoph Walter AG<br />
Mühlhausen i. Thür., Aktie 1.000 Mark<br />
27.11.1916. Gründeraktie (Auflage 1200,<br />
R 4) EF<br />
Gegründet 1916 unter Übernahme des seit 1830 bestehenden<br />
Spinnereiunternehmens Christoph Walter <strong>GmbH</strong>, Mühlhausen<br />
(Thür.), Dachrieden und Beyrode. Herstellung von Hand- und<br />
Maschinenstrickgarnen. Im 2. Weltkrieg Einbeziehung in die<br />
Rüstungsproduktion. Im Lager Dachrieden der Kammgarnspinnerei<br />
befand sich eine Station für Säuglinge von “Ostarbeiterinnen”.<br />
Firma nicht verlagert.<br />
Los 242 Schätzwert 75-150 €<br />
Collet & Engelhard<br />
Werkzeugmaschinenfabrik AG<br />
Offenbach a. M., Aktie 1.000 RM Febr.<br />
1942 (Auflage 1276, R 7) VF<br />
Gründung 1862 als eine der ersten deutschen Werkzeugmaschinen-Fabriken,<br />
die Weltausstellung in Paris 1867 brachte<br />
ihr die Bronzemedaille. AG seit 1913. Ab 1936 war der Raketenpionier<br />
und Enkel Adam Opels, Fritz von Opel, im Aufsichtsrat.<br />
1971 Schließung des Betriebes.<br />
Los 232 Schätzwert 150-200 €<br />
Chemische Fabrik v. Westernhagen AG<br />
Hannover, Aktie 5.000 Mark Juli 1923.<br />
Gründeraktie (Auflage 6000, R 8) EF<br />
Aktien dieser Ges. waren zuvor unbekannt.<br />
Gegründet 1923 zur Übernahme der Chem. Fabrik v. Westernhagen<br />
& Co. <strong>GmbH</strong>. Hergestellt wurden Waschmitteln aller Art.<br />
Bereits 1924 wieder in Liquidation gegangen.<br />
Los 237 Schätzwert 200-250 €<br />
Chemnitzer Wirkwarenfabrik AG<br />
vorm. Weicker & Hempfing<br />
Chemnitz, Aktie 300 RM Aug. 1929<br />
(Auflage 3100, R 9) VF<br />
Nur 7 Stück lagen im <strong>Reichsbankschatz</strong>, vorher<br />
nicht bekannt gewesen.<br />
Gründung 1922. Die zunächst auch betriebene Trikotagen- und<br />
Wäschefabrikation wurde später eingestellt, zuletzt nur noch<br />
Strumpffabrikation. Eines der zahllosen Opfer der Weltwirtschaftskrise:<br />
Ende 1930 wurde der Betrieb stillgelegt, ein Konkursantrag<br />
im Nov. 1932 wurde mangels Masse abgelehnt.<br />
Das Fabrikareal Annaberger Str. 91 wurde später von der Firma<br />
Liebold & Reißig Strumpfappretur weitergenutzt.<br />
Los 238 Schätzwert 75-150 €<br />
Chr. Prinzler & Söhne AG<br />
Halle a.d.S.-Büschdorf, Aktie 1.000 Mark<br />
1.5.1919. Gründeraktie (Auflage 300, R 4) EF<br />
Gründung 1889, AG seit 1918. Betrieb einer Eisengießerei und<br />
Maschinenfabrik. Eine reine Familien-AG der Famile Eberhardt.<br />
Nach dem Krieg nicht verlagert.<br />
Los 240 Schätzwert 50-100 €<br />
Claudius Peters AG<br />
Hamburg, Aktie 1.000 RM Sept. 1933.<br />
Gründeraktie (Auflage 300, R 5) EF<br />
Das 1906 von Claudius Peters gegründete technische Büro<br />
und Spezial-Maschinenvertriebsgeschäft wurde 1933 in eine<br />
AG umgewandelt. Spezialisiert auf Maschinen und Anlagen für<br />
die Zement-, Kalk- und chemische Industrie (vor allem im Bereich<br />
Materialfördertechnik), den Bergbau sowie Ölgewinnungsanlagen,<br />
die mit rd. 150 Mitarbeitern teils in der heute in<br />
Buxtehude befindlichen Produktionsstätte selbst, teils bei Unterlieferanten<br />
produziert werden. Nach mehr als einem halben<br />
Jahrhundert Zugehörigkeit zum Konzern Babcock International<br />
2002 durch die britische Ingenieurfirma Langley Holding übernommen<br />
und in eine <strong>GmbH</strong> umgewandelt worden.<br />
Los 241 Schätzwert 30-90 €<br />
Coblenzer Strassenbahn-Gesellschaft<br />
Koblenz, Aktie 1.000 Mark 18.4.1912<br />
(Auflage 1000, R 3) EF<br />
Gründung 1886. Zunächst Pferdebahnbetrieb, später 51 km e-<br />
lektrifizierte Strecken mit 11 Linien. Außerdem Betrieb der<br />
Standseilbahn Laubach-Rittersturz. 1939 Umfirmierung in “Ko-<br />
Los 243 Schätzwert 150-200 €<br />
Commerz- und Privat-Bank AG<br />
Jamaica, N.Y., Namenskreditbrief 1.400<br />
RM 29.11.1938 (R 10) EF-VF<br />
Ausgestellt auf John Budelmann, Kaufmann in Jamaica,<br />
N.Y.<br />
Gründung 1870 in Hamburg als “Commerz- und Disconto-<br />
Bank”, 1920 Umfirmierung wie oben wegen Fusion mit der<br />
Mitteldeutschen Privatbank in Magdeburg. 1929 Angliederung<br />
der Mitteldeutschen Creditbank in Berlin und Frankfurt/Main.<br />
1932 Übernahme des Barmer Bank-Vereins. Die Bank besaß<br />
jetzt reichsweit über 400 Geschäftsstellen. 1940 Abkürzung<br />
Los 233 Schätzwert 25-50 €<br />
Chemische Werke<br />
vorm. H. & E. Albert<br />
Amöneburg bei Biebrich a.Rh., Aktie<br />
1.000 Mark 23.7.1895. Gründeraktie<br />
(Auflage 10000, R 2) VF<br />
Dekorative Umrandung. Mit Firmensignet. Fleckig.<br />
Die erste Albert’sche Fabrik in Amöneburg bei Wiesbaden-Biebrich<br />
(später nach Mainz-Kastel eingemeindet) wurde bereits<br />
1858 errichtet, 1895 wurde das Unternehmen in eine AG umgewandelt.<br />
Zunächst Produktion von Thomasphosphatmehl<br />
und anderen Düngemitteln, später kamen Lack-Kunstharze,<br />
Säuren aller Art, Insektizide und Pharmazeutika hinzu. Heute<br />
gehört das Unternehmen als “Werk Albert” zur Hoechst AG.<br />
Nr. 237 Nr. 255<br />
23
der Firmierung auf “Commerzbank AG”. 1952 auf alliierte Anordnung<br />
in drei Nachfolgebanken zerschlagen, die 1958 unter<br />
gleichzeitiger Sitzverlegung nach Düsseldorf wieder zusammengeführt<br />
wurden, weitere Hauptverwaltungen verblieben in<br />
Frankfurt/Main und Hamburg. Erst 1990 Verlegung des juristischen<br />
Sitzes nach Frankfurt/Main. 1993 Fusion mit der bis dahin<br />
getrennt geführten Berliner Commerzbank AG. Nach Übernahme<br />
des jahrzehntelangen Erzkonkurrenten Dresdner Bank<br />
seit 2008 die Nr. 2 im deutschen Bankgewerbe.<br />
heim die “Benz & Cie. Rheinische Gasmotorenfabrik”. Trotz der<br />
räumlichen Nähe sind sich die beiden Auto-Pioniere zeitlebens<br />
nie persönlich begegnet. Ihre Firmen, die beiden ältesten Automobilfabriken<br />
der Welt, wurden 1926 zur Daimler-Benz AG verschmolzen.<br />
1999 Fusion mit der Nr. 3 am US-Automobilmarkt<br />
zur DaimlerChrysler AG, Trennung von Chrysler im August<br />
2007 und Umbenennung in Daimler AG.<br />
Los 244 Schätzwert 10-20 €<br />
Commerzbank AG<br />
Hamburg, Aktie 1.000 RM Juni 1941<br />
(Auflage 90000, R 1) EF<br />
G & D-Druck.<br />
Geschichte siehe voriges Los.<br />
Los 245 Schätzwert 25-50 €<br />
Concordia Spinnerei und Weberei<br />
zu Marklissa und Bunzlau<br />
Marklissa, Aktie 1.000 RM Juni 1938<br />
(Auflage 2196, R 3) EF<br />
Gründung 1888 unter Übernahme der Firma Gebr. Woller in Marklissa<br />
und Bunzlau. In den Werken Marklissa, Bunzlau und Friedersdorf<br />
wurden Web-, Strick-, Handarbeits- und Fantasiegarne<br />
sowie Stoffe aus Kunstseide, Zellwolle und Wolle für Damen- und<br />
Herrenkleidung, Futter und Wäsche hergestellt. Beteiligungen<br />
bestanden u.a. an: Schlesische Zellwolle Hirschberg, Thüringische<br />
Zellwolle Schwarza, Zellwolle und Zellue Küstrin, Spinnstofffabrik<br />
Zehlendorf Berlin, Wotirag Berlin. 1950 verlagert nach<br />
Wassenberg bei Aachen, 1995 nach Berlin und umfirmiert in<br />
Concordia Industrie Holding AG. Seit 2001 als Valarte Group AG<br />
tätig, Produktion von hochwertiger Damenmode (ST. EMILE).<br />
Denkwürdiges spielte sich zu dieser Zeit hier ab: 1899 beantragte<br />
die Arbeiterschaft beim Spinner- und Fabrikanten-Verein<br />
Crimmitschau die Herabsetzung der täglichen Arbeitszeit von<br />
12 auf 10 Stunden. Als dies 1901/02 in Meerane und<br />
Forst/Lausitz erreicht war, die Crimmitschauer Fabrikanten a-<br />
ber weiter ablehnten, kam es zu einem gewaltigen Arbeitskampf,<br />
der 1903 in der Aufforderung des Fabrikantenverbandes<br />
an seine Mitglieder gipfelte, sämtlichen Arbeitern zu kündigen.<br />
Dies zu tun weigerte sich die Tricotagen-Fabrik, die ohnehin<br />
nur 10 Stunden/Tag arbeiten ließ, woraufhin ihr der Verband<br />
eine Klage wegen nicht statutengerechten Verhaltens androhte.<br />
Im August/September werden 7.000 Arbeiter gekündigt,<br />
es kommt zu Streiks und Massenaussperrungen, Clara<br />
Zetkin ruft im Odeum zur (tatsächlich dann europaweiten) Unterstützung<br />
der Streikenden auf. Am 10.12.1903 hält August<br />
Los 249 Schätzwert 75-150 €<br />
Curabank AG<br />
Berlin, Aktie 100 RM 1.1.1924 (Auflage<br />
2250, R 7) EF-VF<br />
Gründung 1920 als Cura-Privatbank AG, 1923 umbenannt wie<br />
oben. Spezialisiert auf Bevorschussung von Entschädigungsansprüchen<br />
gegen Versicherungsgesellschaften sowie Warenlombardkredite.<br />
Die Bank war außerdem beteiligt an einem Unternehmen,<br />
das sich mit der Herstellung eines Mittels gegen<br />
Malaria befasste. Die große Bankenkrise nach dem Zusammenbruch<br />
der DANAT-Bank überlebte die Curabank nicht:<br />
1931 erloschen.<br />
Los 250 Schätzwert 50-100 €<br />
Curt Kuhn & Co. AG<br />
Elbing, Aktie 10.000 Mark Okt. 1923.<br />
Gründeraktie (Auflage 20000, R 7) EF<br />
Kleinformat.<br />
Gründung im Juni 1923 zwecks Übernahme und Weiterführung<br />
der Fleischwarenfabrik von Curt Kuhn in Elbing (dem heutigen<br />
Elblag). Bereits 1925 wurde das Konkursverfahren eröffnet.<br />
Los 253 Schätzwert 20-40 €<br />
Dampfschifffahrts-Gesellschaft<br />
“Neptun”<br />
Bremen, Aktie 1.000 RM Nov. 1940<br />
(Auflage 1000, R 2) EF+<br />
Gründung 1873 mit einer Flotte von 5 Schiffen für die Skandinavien-Fahrt.<br />
Später auch Verbindungen nach Holland, Riga,<br />
Spanien und Portugal, 1889 Aufnahme des unmittelbaren<br />
Rhein-See-Verkehrs ab Köln. Die auf 76 Schiffe angewachsene<br />
Flotte ging als Folge des 1. Weltkrieges weitgehend verloren.<br />
In der Weltwirtschaftskrise 1930 erwarb der Norddeutsche<br />
Lloyd die Aktienmehrheit (zuletzt 98 %). Von der wiederaufgebauten<br />
Flotte beließen die Alliierten nach dem 2. Weltkrieg der<br />
“Neptun” wieder nur 16 ältere Dampfer und 4 Leichter. Bis<br />
1972 konnte die Flotte ein drittes Mal auf dann 25 Schiffe neu<br />
aufgebaut werden. Neben der Linienschiffahrt in Europa, nach<br />
Westafrika und Übersee spezialisierte sich die Ges. ab 1970<br />
besonders auf Flüssiggastanker und die Meeresforschung zur<br />
Auffindung unterseeischer Rohstoffvorkommen. Inzwischen<br />
hatten die Commerzbank AG in Hamburg und die Persil <strong>GmbH</strong><br />
in Düsseldorf (später Henkel) je eine Schachtel von über 25 %<br />
erworben, Anfang der 70er Jahre kam die Bremer Landesbank<br />
mit einer weiteren Schachtel hinzu. 1973/74 erwarb die Sloman-Gruppe<br />
über 75 % der Aktien, zugleich Umfirmierung in<br />
SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG. Noch heute in Bremen und<br />
Hamburg börsennotiert.<br />
August Bebel (1840-1913) - Begründer der<br />
sozialdemokratischen Arbeiterbewegung<br />
Los 246 Schätzwert 30-90 €<br />
Corona Fahrradwerke<br />
und Metallindustrie AG<br />
Brandenburg a.H. , Aktie 1.000 Mark Mai<br />
1923 (Auflage 15500, R 4) EF<br />
Großformatiges Papier, sehr dekorativ gestaltet.<br />
Die 1896 als Corona Fahrrad-Fabrik vormals Ad. Schmidt AG<br />
gegründete Gesellschaft war sowohl in der Fahrradproduktion<br />
tätig als auch in der Herstellung von Fahrradteilen, Motor-Zweirädern<br />
und Automobilen. 1930 Interessengemeinschaftsvertrag<br />
mit der Brennabor-Werke AG in Brandburg a.H. 1931 traten<br />
hohe Verluste auf. Auch die Ausstellung eines Besserungsscheines<br />
seitens des Hauptgläubigers konnte die Firma nicht<br />
mehr retten. Heute Verwendung des Markennamens Corona<br />
für die Fahrräder durch Peugeot.<br />
Los 247 Schätzwert 300-375 €<br />
Crimmitschauer Tricotagen-Fabrik <strong>GmbH</strong><br />
Leitelshain, Anteil-Schein 5.000 Mark<br />
1.8.1901. Gründeranteil (Auflage nur 48<br />
Stück, R 8), ausgestellt auf und als<br />
Geschäftsführer original unterschrieben<br />
von Hermann Fiedler in Leitelshain VF<br />
Hochdekorative Umrahmung im Historismus-Stil<br />
mit Putten. Originalunterschriften Schönherr und<br />
Fiedler.<br />
Gegründet 1901 in Crimmitschau, damals mit fast 100 Textilbetrieben<br />
eine der Hochburgen der deutschen Textilindustrie.<br />
Bebel zum Crimmitschauer Streik und der Behördenwillkür eine<br />
große Rede im Reichstag. So hat der Große Streik ungeahnte<br />
Folgen: Zwar brach er am 17.1.1904 zusammen, doch<br />
im Ergebnis sah sich die Reichsregierung veranlaßt, die Arbeitszeit<br />
gesetzlich zu regeln. Das entsprechende Gesetz trat<br />
am 1.1.1908 in Kraft. 1925 sind von 27.000 Einwohnern in<br />
Crimmitschau immer noch 12.000 in der Textilindustrie beschäftigt.<br />
Ihr fortschrittliches Verhalten im Streik nützte der Trikotagenfabrik<br />
(Betrieb: Leitelshain, Amselstr. 19) später nichts:<br />
Nach 1945 wie fast alle anderen Betriebe der Stadt auch in<br />
Volkseigentum überführt.<br />
Los 248 Schätzwert 300-375 €<br />
Crimmitschauer Tricotagen-Fabrik <strong>GmbH</strong><br />
Crimmitschau-Leitelshain, Anteil-Schein<br />
6.000 Goldmark 15.8.1934 (R 11), ausgestellt<br />
auf Frau Helene Zinkel, Rudolstadt VF+<br />
Hochdekorative Umrahmung im Historismus-Stil<br />
mit Putten. Originalunterschriften Meyer und Fritzsche.<br />
Von diesem Jahrgang lagen nur 2 Stück im<br />
<strong>Reichsbankschatz</strong>.<br />
Los 251 Schätzwert 75-150 €<br />
Dachschiefer-Bergwerke<br />
Charlottenburg-Blücher in Gotha<br />
Bacharach, Kuxschein 1/1.000 9.10.1907<br />
(Auflage 1000, R 7) EF-VF<br />
Im Laufe der Jahrhunderte hat es rund 1300 Schiefergruben in<br />
der Region auf dem Kauber Schieferzug, der den Rhein zwischen<br />
Bacharach und Oberwesel in westöstlicher Richtung<br />
durchzieht, gegeben. Mit dem Einzug des Kunstschiefers Mitte<br />
der 60er Jahre des 20. Jh. begann der Niedergang der Schiefergruben.<br />
Los 252 Schätzwert 20-40 €<br />
Daimler-Benz AG<br />
Stuttgart, Aktie 1.000 RM Nov. 1940<br />
(Auflage 11066, R 2) EF<br />
Gottlieb Daimler errichtete 1882 eine kleine Versuchswerkstatt<br />
in Cannstadt, erhielt 1883 das Patent für den ersten schnelllaufenden<br />
Verbrennungsmotor und gründete 1890 die “Daimler-Motoren-Gesellschaft”.<br />
Carl Benz gründete 1883 in Mann-<br />
Los 254 Schätzwert 75-150 €<br />
Dampfziegelei Schmiedeberg AG<br />
Bad Schmiedeberg, VZ-Aktie 1.000 Mark<br />
16.2.1923 (Auflage 500, R 7), umgestellt<br />
erst auf 10 RM und 1929 auf 100 RM EF<br />
Großformatig, schöne kräftige Umrahmung.<br />
Gründung im Febr. 1922 zur Errichtung einer Dampfziegelei auf<br />
dem Gelände der abgebrannten ehemaligen Schmiedeberger<br />
Verblendwerke vorm. Heymann & Co. in der Dübener Heide<br />
(zwischen Dessau und Torgau). Hergestellt wurden Mauerziegel<br />
und Dachziegel aller Art. 1926 umbenannt in “Schmiedeberger<br />
Klinker- und Dachsteinwerke AG”. 1929 vollständige Erneuerung<br />
der Ziegeleimaschinenanlage. Das Kapital wurde nach diversen<br />
Wandlungen schließlich 1931 eingeteilt in 750 Aktien<br />
zu 100 RM. Zu diesem Zweck wurden in bunter Mischung<br />
Stücke der Emissionen 11/1922, 2/1923 und 3/1924 entsprechend<br />
überstempelt. Die reine Familien-AG (vom Kapital hielten<br />
Ing. W. Eichberg und Marianne Schmidt je 3/7 und Karl<br />
Schmidt 1/7) ging in der DDR schließlich im VEB Steinzeugwerk<br />
Bad Schmiedeberg auf (dem 1968 auch der VEB Baustoffkombinat<br />
Bitterfeld angeschlossen wurde). Nach der Wende<br />
stillgelegt. Das ehemalige Ziegeleigebäude wird heute als<br />
Ausstellungshalle genutzt.<br />
Los 255 Schätzwert 300-375 €<br />
Dampfziegelei Schmiedeberg AG<br />
Bad Schmiedeberg, Aktie 1.000 Mark<br />
8.3.1924 (Auflage 18000, R 10),<br />
umgestellt erst auf 20 RM und 1929 auf<br />
100 RM EF<br />
Zuvor ganz unbekannt gewesen, von den lediglich<br />
3 im <strong>Reichsbankschatz</strong> gefundenen Stücken ist<br />
dies das allerletzte noch verfügbare.<br />
Geschichte siehe voriges Los.<br />
Mindestgebot: 80 %<br />
vom unteren Schätzwert<br />
24
Gründung 1855 als älteste Gasgesellschaft Deutschlands. Seit<br />
1886 auch in der Elektrizitätswirtschaft tätig. In Dessau wurde<br />
die nach Berlin älteste Elektrizitäts-Zentrale in Deutschland errichtet.<br />
1946 Sitzverlegung nach Düsseldorf, 1979 Umfirmierung<br />
in CONTIGAS <strong>Deutsche</strong> Energie AG, eine noch heute börsennotierte<br />
Holding für vielfältige Beteiligungen an Energieversorgungsunternehmen.<br />
1988 Sitzverlegung nach München.<br />
Los 264 Schätzwert 300-375 €<br />
<strong>Deutsche</strong> Continental-Gas-Gesellschaft<br />
Dessau, Aktie 80 RM März 1925 (Auflage<br />
30000, R 10) EF-VF<br />
Hochdekorativer G & D-Druck mit Abb. von stilisierten<br />
Lampen, Putten, Greifen und Rocailles. Die<br />
80-RM-Aktien wurden bereits 1929 in solche zu<br />
400 RM umgetauscht. Lediglich 3 danach nicht<br />
vernichtete Exemplare blieben im <strong>Reichsbankschatz</strong><br />
erhalten.<br />
Geschichte siehe voriges Los.<br />
Los 256 Schätzwert 200-250 €<br />
David Richter AG<br />
Chemnitz, Aktie 1.000 Mark 5.8.1922<br />
(Auflage 3000, R 8) VF+<br />
Tolle Gestaltung in der Art eines Teppichs, mit Umrahmung<br />
im Historismus-Stil. Für die Zeit ungewöhnlich<br />
großformatig (28,5 x 35 cm). Zuvor völlig<br />
unbekannt gewesen!<br />
Um 1860 erringt Chemnitz Weltruf als Zentrum der Textilindustrie<br />
und des Maschinenbaus. Die Tradition des Chemnitzer Textilmaschinenbaus<br />
geht mit der Fertigung von Krempel- und<br />
Spinnmaschinen durch die Gebr. Bernhard bereits bis 1789 zurück!<br />
1887 gründet Abraham David Richter eine Strumpfmaschinenfabrik,<br />
1907 Umwandlung in die David Richter AG. Die<br />
DARAG zählte nun zu den fünf bedeutendsten Industriebetrieben<br />
in Chemnitz. Interessanterweise war die Ges. sowohl in der Herstellung<br />
von Textilmaschinen wie auch in der Textilproduktion<br />
selbst tätig: Das Werk Annaberger und Sedanstraße in Chemnitz<br />
besaß zum einen eine Maschinenfabrik, wo Strumpfmaschinen<br />
System “Cotton”, Fersen-, Spitzen- und Tüllmaschinen hergestellt<br />
wurden. Zum anderen wurden in einer Tüllfabrik Baumwoll-<br />
und Seidentülle hergestellt. 1939 wurde auch der schon<br />
früher betriebene Bau von Werkzeugmaschinen wieder aufgenommen.<br />
Ab 1942 liefert die DARAG vornehmlich Revolverdrehmaschinen<br />
und Waffen, 1945 wird der Betrieb durch Luftangriffe<br />
und Demontage zerstört, 1946 ist er einer der ersten Chemnitzer<br />
Betriebe, der die Produktion wieder aufnimmt. 1954 auf<br />
Antrag der Belegschaft in Volkseigentum überführt (VEB Tüllmaschinenbau<br />
Karl-Marx-Stadt, ab 1963 VEB Nähwirkmaschinenbau<br />
Malimo, ab 1985 VEB Textimaforschung im Kombinat Textima<br />
Karl-Marx-Stadt). 1991 als Textimaforschung Malimo Chemnitz<br />
+ Malimo Maschinenbau <strong>GmbH</strong> reprivatisiert. 1992 von Karl<br />
Mayer übernommen und mit der Kändler Textilmaschinenbau zur<br />
KARL MAYER MALIMO Textilmaschinenfabrik <strong>GmbH</strong> verschmolzen.<br />
<strong>Der</strong> Betrieb in Chemnitz in der Mauersberger Str. 2 ist heute<br />
eines der modernsten Unternehmen der Branche.<br />
Los 257 Schätzwert 75-150 €<br />
Delitzscher Kleinbahn-AG<br />
Delitzsch, Aktie 1.000 RM 25.2.1929<br />
(Auflage 164, R 6, weitere 2808 waren in<br />
vier Sammelurkunden verbrieft) EF<br />
Gründung 1911 als Neue Kleinbahn-AG Crensitz-Crostitz mit Sitz<br />
in Halle (Saale). Name 1914-1927 Crostitzer Kleinbahn AG mit<br />
Sitz in Großerositz, umbenannt 1927 in Delitzscher Kleinbahn-AG<br />
und 1942 in Delitzscher Eisenbahn-AG. Normalspurige Nebenbahn<br />
Crensitz-Crostitz-Rackwitz-Delitzsch (35 km). Strecken<br />
1933: Crensitz-Crostitz (3,9 km, eröffnet 1902), Crostitz-Rackwitz<br />
(6,8 km, eröffnet 1915) und Rackwitz-Delitzsch (24 km, eröffnet<br />
1929). Mit dem Einmarsch der Amerikaner am 20.4.1945 wurde<br />
der Kleinbahnbetrieb eingestellt, aber bereits am 12.5.1945 in<br />
Maßen wieder aufgenommen. 1946 Unterstellung unter die direkte<br />
Aufsicht des Präsidenten der Provinz Sachsen, später unter<br />
die Reichsbahn. 1972 Einstellung des Betriebes.<br />
Los 258 Schätzwert 60-120 €<br />
Dessauer Strassenbahn-Gesellschaft<br />
Dessau, Actie 1.000 Mark 22.6.1900<br />
(Auflage 1300, R 2) EF-VF<br />
Großformatiges, dekoratives Papier. Originalunterschriften.<br />
Nr. 256 Nr. 264<br />
Gründung 1894. Auf den 12,8 km langen normalspurigen<br />
Strecken beförderten 20 Triebwagen und knapp 40 Beiwagen<br />
bis zu 3 Mio. Fahrgäste im Jahr. Offenbar als Referenz an den<br />
Großaktionär (<strong>Deutsche</strong> Continental-Gas-Gesellschaft) bis<br />
1901 mit Gasmotorbetrieb, erst danach elektrifiziert.<br />
Los 259 Schätzwert 20-40 €<br />
Deutsch-Atlantische<br />
Telegraphengesellschaft<br />
Berlin, 4 % Genussrechts-Urkunde A 100<br />
RM 1.3.1926 (R 4) EF<br />
Gründung 1899 in Köln (Sitz 1924-1950 zwischenzeitlich in<br />
Berlin). 1900 wurde das erste Nordamerikakabel Emden-Azoren-New<br />
York verlegt. 1905 wurde von der <strong>Deutsche</strong>n Seetelegraphengesellschaft<br />
das Kabel Emden-Vigo (Spanien) übernommen.<br />
<strong>Der</strong> gesamte Besitz ging bis auf kurze Kabelstümpfe<br />
in der Nordsee in Folge des Versailler Vertrages verloren. Die<br />
danach mühsam wieder in Gang gebrachten Kabel wurden bei<br />
Ausbruch des 2. Weltkrieges von den Alliierten erneut getrennt.<br />
1952 konnte der Betrieb auf dem Emden-Vigo-Kabel und dem<br />
Azorenkabel wieder aufgenommen werden. Nach dem ersten<br />
Schritt 1966 durch Drittel-Beteiligung an der Computer <strong>GmbH</strong><br />
in Lintorf wurde die Datenverarbeitung bald der wichtigere Geschäftszweig.<br />
1987 mit der zur Quandt-Familie gehörenden<br />
ALTANA als übernehmender Gesellschaft verschmolzen.<br />
Los 260 Schätzwert 50-100 €<br />
<strong>Deutsche</strong> Asphalt-AG der<br />
Limmer und Vorwohler Grubenfelder<br />
Braunschweig, Aktie 100 RM Aug. 1937<br />
(Auflage 200, R 7) VF+<br />
Vorher nicht bekannt gewesen.<br />
Gründung 1873, seither kontinuierlicher Aufkauf von Konkurrenz-Firmen.<br />
Asphalt-Gruben bei Eschershausen und Hannover.<br />
Gehört über die Braunschweig <strong>GmbH</strong> zur heutigen<br />
NORD/LB (vorm. Braunschweigische Staatsbank).<br />
Nr. 261<br />
Los 261 Schätzwert 30-80 €<br />
<strong>Deutsche</strong> Bank<br />
und Disconto-Gesellschaft<br />
Berlin, Aktie 100 RM März 1932<br />
(Blankette, R 3) EF<br />
Die <strong>Deutsche</strong> Bank wurde 1870 gegründet, die traditionsreiche<br />
“Direction der Disconto-Gesellschaft” in Berlin bereits 1851. Beide<br />
Banken fusionierten 1929 auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise.<br />
<strong>Der</strong> dabei angenommene neue Name wurde schon<br />
1937 wieder schlicht auf “<strong>Deutsche</strong> Bank” verkürzt. Nach dem 2.<br />
Weltkrieges wurde die Hauptniederlassung in Berlin auf alliierte<br />
Anordnung stillgelegt, die Niederlassungen in der russischen Zone<br />
wurden enteignet. In Westdeutschland ordneten die Alliierten<br />
die Zerschlagung der <strong>Deutsche</strong>n Bank an, 1952 wurden aufgrund<br />
des Großbankengesetzes drei Nachfolgeinstitute ausgegründet:<br />
Norddeutsche Bank AG in Hamburg, Rheinisch-Westfälische<br />
Bank AG (ab 1956 <strong>Deutsche</strong> Bank AG West) in Düsseldorf<br />
und Süddeutsche Bank AG in München. Auf hartnäckiges Betreiben<br />
von Hermann Josef Abs 1956 im Wege der Verschmelzung<br />
wieder vereinigt. Nach der Wende 1990 auch Verschmelzung mit<br />
der 100%igen Tochter <strong>Deutsche</strong> Bank Berlin AG, 1999 Übernahme<br />
der US-amerikanischen Bankers Trust und Übertragung des<br />
Teilbereiches Privat- und Geschäftskunden auf die <strong>Deutsche</strong><br />
Bank 24 AG - was aber bald wieder rückgängig gemacht wurde.<br />
Los 262 Schätzwert 125-200 €<br />
<strong>Deutsche</strong> Bergin-AG für Holzhydrolyse<br />
Heidelberg, Aktie 1.000 RM 29.10.1934<br />
(Auflage 857, R 7) EF<br />
Vorher nicht bekannt gewesen.<br />
Gründung 1920 in Berlin als <strong>Deutsche</strong> Bergin-AG für Kohleund<br />
Erdölchemie. Ab 1924 Sitz in Mannheim. Name ab 1932:<br />
<strong>Deutsche</strong> Bergin-AG für Holzhydrolyse. 1916 begannen unter<br />
Friedrich Bergius, dem Forschungsleiter und Vorstandsmitglied<br />
der Th. Goldschmidt AG groß angelegte Versuche im Werk<br />
Mannheim-Rheinau zur Kohlehydrierung (Gewinnung von Benzin<br />
aus Kohle). Die Versuche schlugen fehl, Bergius verbrauchte<br />
rund 5 Mio. Goldmark. 1919 trennte sich Bergius von seinem<br />
ehemaligen Gönner Karl Goldschmidt und gründete die<br />
<strong>Deutsche</strong> Bergin AG, wo er seit 1924 mit der Zuckergewinnung<br />
aus Holz experimentiert. Erzeugnisse: Holzzucker, Traubenzukker,<br />
Nähr- und Futterhefe sowie Lignin. 1931 erhielt Bergius<br />
den Nobelpreis. Aber die Gesellschaft macht Verluste infolge<br />
des geringen Produktionsumsatzes. 1938 Sanierung durch Kapitalherabsetzung.<br />
Im Febr. 1945 erhebliche Schäden durch<br />
Fliegerangriffe, aber im Dez. 1946 Aufnahme der Zellstoffverarbeitung<br />
und 1949 der Holzverarbeitung. 1956 wurde die<br />
Umwandlung der AG in eine <strong>GmbH</strong> unter der Firma “Rheinauer<br />
Holzhydrolyse <strong>GmbH</strong>” mit Sitz in Mannheim beschlossen.<br />
Los 263 Schätzwert 75-150 €<br />
<strong>Deutsche</strong> Continental-Gas-Gesellschaft<br />
Dessau, Actie 1.200 Mark 2.1.1901<br />
(Auflage 2500, R 2) VF-<br />
Hochdekorativer G & D-Druck mit Abb. von stilisierten<br />
Lampen, Putten, Greifen und Rocailles.<br />
Los 265 Schätzwert 10-25 €<br />
<strong>Deutsche</strong> Continental-Gas-Gesellschaft<br />
Dessau, Aktie 1.000 RM Okt. 1942 (R 2)<br />
UNC-EF<br />
G&D-Druck.<br />
Los 266 Schätzwert 20-40 €<br />
<strong>Deutsche</strong> Dampfschifffahrts-<br />
Gesellschaft Hansa<br />
Bremen, Aktie 100 RM Juli 1933 (Auflage<br />
23000, R 1) UNC-EF<br />
Kleine Vignette mit Reederei-Flagge.<br />
Gründung 1881 durch Bremer Kaufleute für die Große Fahrt<br />
nach Ostindien, die Mittelmeerfahrt und die Ostseefahrt. 1898<br />
konnten Pläne für regelmäßige Liniendienste nach Portugal,<br />
zum La Plata, in den Golf von Mexico und nach Ostindien verwirklicht<br />
werden. Nach 1900 besaß die Ges. mit 80 Schiffen<br />
die größte Frachtschiffsflotte der Welt! Alles ging als Folge des<br />
1. Weltkriegs verloren. Nach erfolgreichem Wiederaufbau stand<br />
die Reederei nach dem 2. Weltkrieg erneut vor dem Nichts,<br />
wieder ging sie aller ihrer 53 Frachtschiffe verlustig. Erneut gelang<br />
der Wiederaufbau, aber nicht von Dauer: Finanziell zu sehr<br />
geschwächt ging die AG nach mehrfachem Auf und Ab letztendlich<br />
1980 doch in Konkurs.<br />
Los 267 Schätzwert 40-75 €<br />
<strong>Deutsche</strong> Destillerie AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark Febr. 1923<br />
(Auflage 32850, R 5) VF<br />
Gründung 1922. Herstellung von Likören, Weinbrand und Spirituosen,<br />
außerdem Weinhandel. 1924 Konkurs.<br />
Los 268 Schätzwert 30-75 €<br />
<strong>Deutsche</strong> Effecten- und Wechsel-Bank<br />
Frankfurt a.M., Aktie Lit. E 1.000 RM<br />
15.5.1929 (Auflage 5000, R 5) EF<br />
Hervorgegangen aus dem seit 1821 bestehenden Bankhaus<br />
L.A. Hahn. Seit 1872 AG als <strong>Deutsche</strong> Effecten- und Wechsel-<br />
Bank. 1929 Fusion mit der <strong>Deutsche</strong>n Vereinsbank. 1969 Ü-<br />
bertragung des Bankgeschäftes auf die neugegründete Effectenbank-Warburg<br />
AG und Umfirmierung in <strong>Deutsche</strong> Effecten-<br />
25
und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG. 2000 Sitzverlegung<br />
nach Jena, heute als Tochtergesellschaft der von Lothar Späth<br />
geführten JENOPTIK eine Holdinggesellschaft für deren Beteiligungen<br />
an jungen Technologie-Firmen.<br />
Städtische Gasanstalt am Stralauer Platz um 1900<br />
der westliche (GASAG) und der östliche (zuletzt Berliner Erdgas<br />
AG) Teil wieder getrennte Wege, ehe sie nach der Wende 1993<br />
erneut zusammengeführt wurden.<br />
Los 276 Schätzwert 20-75 €<br />
<strong>Deutsche</strong> Grundcredit-Bank<br />
Gotha, Communal-Schuldv. Lit. L 200.000<br />
Mark 1.6.1923 (R 9) VF<br />
Gründung 1867 mit Herzogl. Sachsen-Coburg-Gothaischer<br />
Landesherrlicher Bestätigung. 1921 Übernahme der Schwarzburgischen<br />
Hypothekenbank in Sondershausen. Die Pfandbriefe<br />
notierten an allen großen deutschen Börsen.<br />
Los 269 Schätzwert 25-50 €<br />
<strong>Deutsche</strong> Fensterglas-AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 Mark Nov. 1922<br />
(Auflage 38000, R 5) VF+<br />
Gründung 1909. Handel mit Flachglas. 1927 unter Geschäftsaufsicht,<br />
1928 Beschluß der Liquidation.<br />
Los 270 Schätzwert 75-125 €<br />
<strong>Deutsche</strong> Gartenbau-Kredit AG<br />
Berlin-Charlottenburg, Aktie 1.000 RM<br />
Dez. 1941 (Auflage 650, R 7) EF<br />
Gründung 1925, vom Reichsministerium für Ernährung und<br />
Landwirtschaft als Entschuldungsstelle für den gesamten deutschen<br />
Erwerbsgartenbau bestellt. In der Spitze hatte die Bank<br />
über 60 Mitarbeiter. Mehrere interessante Beteiligungen, u.a.<br />
an der “Frühgemüsebau Achern <strong>GmbH</strong>” (Achern/Baden) und an<br />
der “<strong>Deutsche</strong> Spargelhochzucht <strong>GmbH</strong>” (Osterburg-Altmark).<br />
Los 271 Schätzwert 200-250 €<br />
<strong>Deutsche</strong> Gasgesellschaft AG<br />
Berlin, 4,5 % Teilschuldv. 1.000 Mark Juli<br />
1919 (Auflage 13500, R 8) UNC-EF<br />
Schöner Sicherheitsdruck mit Originalunterschriften.<br />
Wertpapiere dieser Ges. waren zuvor unbekannt.<br />
Bereits 1825 erhielt die britische Imperial Continental Gas Association<br />
die Konzession, die Straßen der preußischen und später<br />
gesamtdeutschen Hauptstadt Berlin zu beleuchten. Nach<br />
Bau der ersten Gaserleuchtungsanstalt in der Gitschiner Straße<br />
brannten 1826 erstmals Gaslaternen in der Straße Unter den<br />
Linden bis zur Schlossbrücke. 1847 nahmen die Städtischen<br />
Gaswerke die Produktion auf, da der Konzessionsvertrag mit der<br />
ICGA der Stadt Berlin ab diesem Jahr das Recht einräumte, die<br />
öffentliche Beleuchtung selbst zu übernehmen. Daraus entstand<br />
1912 die “Städtische Gaswerke AG”, damals der größte<br />
Gasversorger in ganz Europa (nach Gründung von Gross-Berlin<br />
1923 neu gegründet als Städtische Gaswerke AG - Gasag,<br />
1937 in einen Eigenbetrieb der Stadt umgewandelt). In den Berlin<br />
umgebenden Städten und Gemeinden (Gross-Berlin entstand<br />
bekanntlich erst 1920) blieb die ICGA aber weiter tätig.<br />
1918 übernahm die “<strong>Deutsche</strong> Gasgesellschaft AG” (gegründet<br />
1899 als Gaswerk Grünau (Mark) AG und 1918 entsprechend<br />
umfirmiert) den größten Teil der Grossberliner Gasversorgungsaktivitäten<br />
vom Liquidator der Imperial Continental Gas Ass.<br />
zum Preis von 75,45 Mio. Mark, nachdem der 1. Weltkrieg das<br />
Verhältnis zum (als Feindvermögen behandelten) Konzessionsnehmer<br />
irreparabel gestört hatte. Aktionäre der <strong>Deutsche</strong>n Gasgesellschaft<br />
waren die Kreise Teltow und Niederbarnim sowie<br />
die Städte Schöneberg und Wilmersdorf, die als industriellen<br />
Partner die <strong>Deutsche</strong> Continental-Gas-Gesellschaft, Dessau,<br />
mit einem Minderheitsanteil mit an Bord nahmen. Zu den von<br />
der ICGA übernommenen Gaswerken Mariendorf, Schöneberg,<br />
Gitschiner Straße, Holzmarktstraße und Grünau wurde noch das<br />
Gaswerk Hohenschönhausen hinzuerworben. Auch nach dem<br />
Entstehen von Gross-Berlin blieb die <strong>Deutsche</strong> Gasgesellschaft<br />
in ihrem Konzessionsgebiet unabhängig von der Gasag weiter<br />
tätig. Das lag auch daran, daß der Betrieb ihrer Gaswerke von<br />
Anfang an mit einer Laufzeit bis 1969 der Gasbetriebsgesellschaft<br />
AG in Berlin-Mariendorf übertragen war, deren Aktien zu<br />
2/3 die Contigas besaß. Nur die Aktionärsstruktur der Dt. Gasgesellschaft<br />
änderte sich: 45 % besaß jetzt die Stadt Berlin, je<br />
rd. 27 % der Kreis Teltow und die Contigas. Erst 1940 waren<br />
sämtliche Aktien auf die Stadt Berlin übergegangen und die<br />
<strong>Deutsche</strong> Gasgesellschaft wurde in den städtischen Eigenbetrieb<br />
Gasag eingegliedert. Nach der Teilung von Berlin gingen<br />
Los 272 Schätzwert 300-375 €<br />
<strong>Deutsche</strong> Gasgesellschaft AG<br />
Berlin, 4,5 % Teilschuldv. 5.000 Mark Juli<br />
1919 (Auflage 2500, R 9) EF<br />
Sicherheitsdruck mit Originalunterschriften.<br />
Geschichte und Gestaltung wie voriges Los.<br />
Nr. 274<br />
Los 273 Schätzwert 50-100 €<br />
<strong>Deutsche</strong> Gasolin AG<br />
Berlin, Aktie 100 RM 6.10.1942 (Auflage<br />
22245, R 5) EF<br />
Gründung 1920, die AG übernahm dabei die <strong>Deutsche</strong><br />
Schmiermittel <strong>GmbH</strong> in Frankfurt/Main. Bis 1922: Olea Mineralölwerke<br />
AG, bis 1925 Oleawerke AG für Mineralöl-Industrie<br />
mit Sitz in Halle (Saale), dann bis 1926 Hugo Stinnes-Riebeck<br />
Oel-AG. Destillation und Raffination von Mineralölen, Braunund<br />
Steinkohlenteer und Fabrikation von Schmiermitteln. Börsennotiz<br />
Frankfurt. Großaktionär war die Hugo Stinnes - Riebeck<br />
Montan- und Oelwerke AG. 1950 Berliner Wertpapierbereinigung<br />
und Übernahme durch die Aral AG.<br />
Los 274 Schätzwert 300-375 €<br />
<strong>Deutsche</strong> Girozentrale<br />
-<strong>Deutsche</strong> Kommunalbank-<br />
Berlin, 4 % Sammelschuldv. Lit. E 10.000<br />
x 100 RM 1.7.1942 (R 12) EF<br />
Ein Unikat aus dem <strong>Reichsbankschatz</strong>.<br />
Gegründet wurde die <strong>Deutsche</strong> Girozentrale 1918 als Bankanstalt<br />
des <strong>Deutsche</strong>n Zentralgiroverbandes für den zentralen<br />
Geldausgleich und den Anschluss der Sparkassenorganisation<br />
an den Geld- und Kapitalmarkt, zehn Jahre nachdem bei den<br />
Sparkassen der Giroverkehr Einzug gehalten hatte. 1919 übernahm<br />
die DGZ auch die “Geldvermittlungsstelle der deutschen<br />
Städte” und erhielt das Recht, zur Refinanzierung ihrer langfristigen<br />
Kommunalkredite die “<strong>Deutsche</strong>n Kommunal-Anleihen”<br />
aufzulegen. Die Bezeichnung der <strong>Deutsche</strong>n Girozentrale wurde<br />
deshalb 1921 um den Zusatz “<strong>Deutsche</strong> Kommunalbank”<br />
ergänzt. Im sowjetisch besetzten Sektor von Berlin liegend,<br />
wurde die DGZ 1945 zunächst geschlossen, 1947 mit Einschränkungen<br />
in Düsseldorf reaktiviert, 1954 nahm sie ihre<br />
volle Geschäftstätigkeit wieder auf. 1965 Verlegung des Hauptsitzes<br />
nach Frankfurt/Main, 1999 Fusion mit der DekaBank<br />
<strong>GmbH</strong> zur “DekaBank <strong>Deutsche</strong> Girozentrale”.<br />
Los 275 Schätzwert 200-250 €<br />
<strong>Deutsche</strong> Girozentrale<br />
-<strong>Deutsche</strong> Kommunalbank-<br />
Berlin, Sammelschuldv. Lit. D 2.000 x 500<br />
RM = 1.000.000 RM 1.7.1942 (R 9) UNC<br />
Geschichte und Gestaltung wie voriges Los.<br />
Los 277 Schätzwert 50-100 €<br />
<strong>Deutsche</strong> Holzwirtschaftsbank AG<br />
Berlin, Aktie 100 RM Nov. 1931 (Auflage<br />
7500, R 5) EF<br />
Gründung 1923 als Spezialfinanzierungsinstitut für die Forstwirtschaft<br />
unter Fortführung des Betriebes der Genossenschaftsbank<br />
des Stralauer Stadtviertels zu Berlin e<strong>GmbH</strong>.<br />
Mehrheitsaktionär war die <strong>Deutsche</strong> Rentenbank-Kreditanstalt.<br />
Seit 1933 in Liquidation.<br />
Los 278 Schätzwert 200-250 €<br />
<strong>Deutsche</strong> Industriebank<br />
Berlin, 4% Sammel-Schuldv. 5.000.000 RM<br />
März 1944 (Auflage nur 20 Stück, R 8).<br />
Gestückelt im einzelnen in 1000 x 500 RM,<br />
2500 x 1.000 RM, 400 x 5.000 RM EF-VF<br />
Hektographierter Vordruck, Stückenummern maschinenschriftlich<br />
ergänzt, mit Originalunterschriften.<br />
4 Seiten Anleihebedingungen auf zwei separaten<br />
Blättern angeheftet.<br />
Nr. 278<br />
26
Gründung 1924 als “Bank für deutsche Industrie-Obligationen”<br />
als Finanzier für die im Rahmen des Dawes-Plans belastete<br />
deutsche Industrie. 1939 Umfirmierung in <strong>Deutsche</strong> Industriebank.<br />
Zweck war nun die Gewährung lang- und mittelfristiger<br />
Kredite vor allem an Klein- und Mittelbetriebe. 1974/75 Fusion<br />
mit der 1949 in Düsseldorf gegründeten Industriekreditbank AG.<br />
1993 hatte die BHF-Bank einen 10 %-Anteil, den später die Allianz<br />
übernahm. 2001 übernahm die staatseigene Kreditanstalt<br />
für Wiederaufbau (KfW) die Anteile von Allianz und Münchener<br />
Rück übernommen, was ihr übel bekam: <strong>Der</strong> Beinahe-Zusammenbruch<br />
der IKB in der Finanzkrise 2008 belastete auch die<br />
KfW schwer. 2008 Übernahme der KfW-Anteile in Höhe von<br />
90,8 % durch den amerikanischen Finanzinvestor Lone Star.<br />
Los 279 Schätzwert 100-150 €<br />
<strong>Deutsche</strong> Länderbank AG<br />
Berlin, Aktie 1.000 RM Nov. 1942<br />
(Blankette, R 9) EF<br />
Nur 10 Stück lagen im <strong>Reichsbankschatz</strong>.<br />
Gründung 1909 als Kolonialbank AG, 1922 umbenannt wie o-<br />
ben. Ihr Bankgebäude Unter den Linden 82 besaß die Bank ü-<br />
ber ihre Tochtergesellschaft Fugger Grundstücks-AG. 1924<br />
wurde die Badische Anilin- & Soda-Fabrik (BASF) größter Aktionär<br />
und damit später der I.G. Farben-Konzern. Das erklärt,<br />
warum die außerordentliche verschwiegene Bank neben der<br />
<strong>Deutsche</strong>n Bank eine der beiden Hausbanken von I.G. Farben<br />
war. 1945 Schließung der Bank durch die russische Besatzungsmacht.<br />
1953 Errichtung eines zweiten Firmensitzes in<br />
Frankfurt/Main und bis 1960 vorübergehend als Westdeutsche<br />
Handelsbank AG firmierend. Alleinaktionärin wird 1965 die<br />
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich, nach Übernahme des<br />
I.G. Farben-Ablegers Interhandel AG, Basel. Die SBG gibt 1969<br />
erst 75 % und 1980 auch den Rest der Länderbank-Aktien an<br />
die Dresdner Bank ab, die danach 1981 die traditionsreiche<br />
Privatbank Hardy & Co. <strong>GmbH</strong> auf die Länderbank verschmilzt.<br />
Das Bäumchen-wechsel-Dich-Spiel endet 1986, als die Länderbank<br />
an die SBG zurückverkauft wird und in “Schweizerische<br />
Bankgesellschaft (Deutschland) AG” umfirmiert. Um aber<br />
die Verwirrung komplett zu machen: Unter dem Namen “<strong>Deutsche</strong><br />
Länderbank” betreibt die Dresdner Bank weiterhin einige<br />
Niederlassungen in Berlin.<br />
Los 280 Schätzwert 75-100 €<br />
<strong>Deutsche</strong> Nähfaden-AG<br />
Hamburg, Aktie Lit. A 20 Goldmark<br />
3.7.1924 (Auflage 9750, R 8) EF<br />
Nur 11 Stück lagen im <strong>Reichsbankschatz</strong>.<br />
Gründung 1922, bereits 1925 wieder in Konkurs. Börsennotiz:<br />
Freiverkehr Hamburg.<br />
dann das Magnetkieserz im Tagebau abgebaut. Etliche Jahre<br />
später wurde der Nickelgehalt des Erzes entdeckt, danach wurde<br />
von wechselnden Besitzern mehr als ein halbes Jahrhundert<br />
lang Nickelerz im Untertagebau gefördert. Die Gründung dieser<br />
AG im Jahr 1934 fällt schon in die Endzeit dieses Bergbaus.<br />
Ausgebeutet wurden die Felder des “Nickelerz-Bergwerks<br />
Compagnie Feld” in den Gemarkungen Horbach, Innerurbeg,<br />
Ruchenschwand und Wittenschwand und des Bergwerks<br />
“Schwarzwälder Nickelkompagnie” in den Gemarkungen Todtmoos-Weg,<br />
Vordertodtmoos und Todtmoos-Schwarzenbach.<br />
Schon 1937 wurden angesichts mannigfacher technischer<br />
Schwierigkeiten und sinkender Erzpreise die Gruben endgültig<br />
aufgegeben und die AG ging in Liquidation. 1988 begannen<br />
dann im Hoffnungsstollen in Todtmoos die Arbeiten zur Einrichtung<br />
des schließlich 2000 eröffneten Schaubergwerks als<br />
Zeugnis des früheren Nickelerzabbaus.<br />
Nr. 283 Nr. 284<br />
Los 282 Schätzwert 20-40 €<br />
<strong>Deutsche</strong> Niles Werke AG<br />
Berlin, 4,5 % Teilschuldv. 500 RM April<br />
1942 (Auflage 2000, R 3) EF<br />
Gründung 1898 als “<strong>Deutsche</strong> Niles-Werkzeugmaschinen-Fabrik”,<br />
seit 1915 “Maschinenfabrik Oberschöneweide AG” (das<br />
Werk Oberschöneweide wurde später an die AEG veräußert<br />
und die Produktion nach Weissensee verlagert). Werkzeugmaschinenfabriken<br />
(Drehbänke, Fräsmaschinen, Schleifmaschinen,<br />
Pressluftwerkzeuge) in Berlin-Weißensee und Siegmar-<br />
Schönau. Die Firma bestand bis Kriegsende als AG und arbeitete<br />
auch in der DDR als VEB weiter. 1990 wurde das VEB<br />
Werkzeugmaschinenkombinat 7. Oktober Berlin aufgelöst.<br />
1993 wurde NILES privatisiert und von der Fritz Werner Werkzeugmaschinen<br />
AG, Berlin-Marienfelde, übernommen. 1995<br />
Fusion zur FRITZ Werner & Niles Werkzeugmaschinen AG,<br />
1996 Konkursantrag. 1997 wurde die Niles Werkzeugmaschinen<br />
<strong>GmbH</strong> von dem Unternehmen Kapp <strong>GmbH</strong> Werkzeugmaschinenfabrik,<br />
Coburg übernommen. Produktionsstandort ist<br />
seit 2000 Berlin-Falkenberg im Bezirk Lichtenberg an der<br />
Grenze zu Marzahn-Hellersdorf, wo eine der modernsten Fertigungsstätten<br />
für den Werkzeugmaschinenbau errichtet wurde.<br />
Los 283 Schätzwert 1200-1500 €<br />
<strong>Deutsche</strong> Reichsbank<br />
Berlin, Sammelanteilschein<br />
(Gesamturkunde) 2.000 x 100 RM<br />
12.5.1944, ausgegeben an die <strong>Deutsche</strong><br />
Golddiskontbank, Berlin (R 12) EF<br />
Maschinenschriftliche Ausführung auf Sicherheitsunterdruck,<br />
gedruckt auf dem bekannten Reichsbank-Sicherheitspapier<br />
mit der (beabsichtigten)<br />
dunklen Einfärbung links. Originalunterschriften<br />
des Reichsbankpräsidenten<br />
Walther Funk<br />
(1890-1960, bis<br />
1939 Reichswirtschaftsminister<br />
und<br />
als Reichsbankpräsident<br />
Nachfolger von<br />
Hjalmar Schacht, gehörte<br />
1946 im Nürnberger<br />
Prozess zu<br />
den 24 angeklagten<br />
Hauptkriegsverbrechern<br />
und wurde zu<br />
Walther Funk (1890 - 1960),<br />
Reichsbankpräsident<br />
lebenslanger Haft<br />
verurteilt) und des<br />
Reichsbankvizepräsidenten Emil Puhl (1889-<br />
1962, wegen seiner herausragenden Rolle bei der<br />
Verwertung des SS-Raubgoldes 1947 im Wilhelmstraßen-Prozeß<br />
zu 5 Jahren Haft verurteilt, 1949<br />
vorzeitig entlassen, danach Leiter der Auslandsabteilung<br />
bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich<br />
in Basel und Vorstandsmitglied der<br />
Hamburger Kreditbank, einem der Nachfolgeinstitute<br />
der Dresdner Bank, 1952-57 Mitglied des<br />
Zentralbeirats der Dresdner Bank). Historisch<br />
hochbedeutendes Unikat aus dem <strong>Reichsbankschatz</strong>.<br />
Rostspur von Büroklammer links oben.<br />
Die <strong>Deutsche</strong> Reichsbank, geschaffen durch das Bankgesetz<br />
vom 14.3.1875, ging aus der Preußischen Bank hervor, die ursprünglich<br />
unter dem Namen Königliche Giro- und Lehnbank in<br />
Berlin im Jahre 1765 von Friedrich dem Großen gegründet<br />
worden war. Zunächst war die Reichsbank keine Staatsanstalt<br />
und ausschließlich im Besitz von Privatkapital. Dennoch war sie<br />
keine gewöhnliche Aktiengesellschaft: Sie war nicht im Handelsregister<br />
eingetragen, sondern durch Gesetz gegründet, die<br />
Befugnisse der Generalversammlung waren eingeschränkt. Die<br />
Anteilseigner wählten einen Zentralausschuss, der wiederum<br />
drei Deputierte bestimmte, die eine fortlaufende Kontrolle über<br />
die Verwaltung der Bank zu führen hatten. Leitung und Aufsicht<br />
der Bank übte das Reich aus. Diese Funktion beschränkte das<br />
Gesetz über die Autonomie der Reichsbank vom 26.5.1922 auf<br />
das reine Aufsichtsrecht. Die Leitung stand von da an ausschließlich<br />
dem Reichsbankdirektorium zu, dessen Präsident<br />
auf Vorschlag des Reichsrats vom Reichspräsidenten auf Lebenszeit<br />
ernannt wurde. Diese Autonomie hörte de facto schon<br />
vorher, de jure am 30.1.1937 auf, als sich Hitler das Reichsbankdirektorium<br />
direkt unterstellte. Bis zuletzt hatte die Bank<br />
aber private Anteilseigner. Nach 1945 wurden die Reichsbank-<br />
Anteilscheine in Bundesbank-Genussscheine umgetauscht.<br />
Los 284 Schätzwert 1200-1500 €<br />
<strong>Deutsche</strong> Reichsbank<br />
Berlin, Gesamturkunde für 5000 Anteile á<br />
100 RM 12.5.1944 (R 12), ausgestellt auf<br />
die <strong>Deutsche</strong> Golddiskontbank, Berlin VF+<br />
Maschinenschriftliche Ausführung auf Sicherheitsunterdruck,<br />
gedruckt auf dem bekannten Reichsbank-Sicherheitspapier<br />
mit der (beabsichtigten)<br />
dunklen Einfärbung links. Originalunterschriften<br />
des Reichsbankpräsidenten Walther Funk<br />
des Reichsbankvizepräsidenten Emil Puhl. In dieser<br />
Stückelung ein (bei Peus nicht katalogisiert gewesenes)<br />
Unikat aus dem <strong>Reichsbankschatz</strong>.<br />
Los 281 Schätzwert 60-120 €<br />
<strong>Deutsche</strong> Nickel-Bergwerk AG<br />
Wittenschwand (Schwarzwald), Aktie<br />
1.000 RM 25.9.1934. Gründeraktie<br />
(Auflage 150, R 5) EF<br />
Bereits 1798 fanden zwei Bewohner von Todtmoos im Südschwarzwald<br />
Erze auf ihren Wiesen. Einige Jahre lang wurde<br />
Gebäude der <strong>Deutsche</strong>n Reichsbank um 1900<br />
Los 285 Schätzwert 30-75 €<br />
<strong>Deutsche</strong> Steinindustrie AG<br />
Reichenbach i.Odenw., Aktie 100 RM Nov.<br />
1929 (Auflage 480, R 4) EF<br />
Gründung 1889 in Ludwigshafen (Rhein) mit Betrieben in Ludwigshafen<br />
und Reichenbach (Odw.). 1899 Umwandlung in die<br />
27