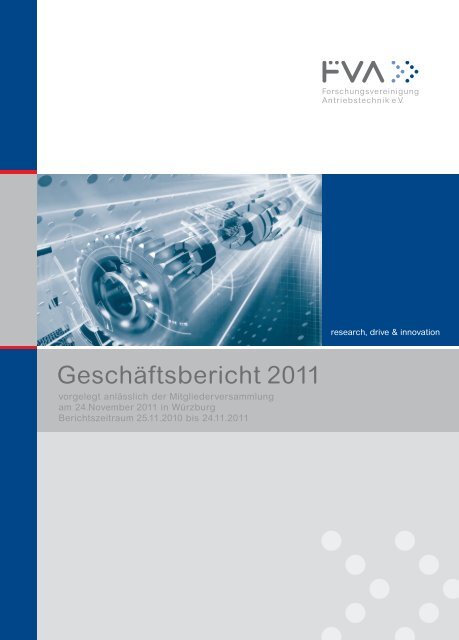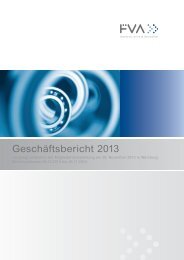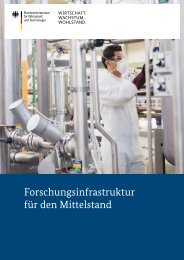Geschäftsbericht 2011 - FVA
Geschäftsbericht 2011 - FVA
Geschäftsbericht 2011 - FVA
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong><br />
vorgelegt anlässlich der Mitgliederversammlung<br />
am 24.November <strong>2011</strong> in Würzburg<br />
Berichtszeitraum 25.11.2010 bis 24.11.<strong>2011</strong><br />
research, drive & innovation
Inhalt<br />
<strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong><br />
Vorwort 4<br />
Mitgliederentwicklung 8<br />
Überblick über das laufende Forschungsprogramm 10<br />
<strong>FVA</strong>-Gremienarbeit 24<br />
Kenntnistransfer und Weiterbildung 28<br />
Hans Winter Preis 33<br />
E-MOTIVE 34<br />
Windkraft in der Antriebstechnik 38<br />
SoftwareService 40<br />
Finanzierung des Forschungsprogramms 42<br />
Anlagen<br />
Anlage 1 <strong>FVA</strong>-Forschungsvorhaben 44<br />
Anlage 2 FKM-Forschungshefte 67<br />
Anlage 3 Abkürzungen 69<br />
Anlage 4 Mitgliederverzeichnis 70<br />
Inhalt<br />
3
4<br />
Vorwort<br />
Vorwort<br />
Liebe Mitglieder,<br />
die Industrielle Gemeinschaftsfor-<br />
Dr. Michael Paul<br />
Vorsitzender<br />
des Vorstands<br />
der <strong>FVA</strong><br />
Dr. Toni Weiß<br />
schung (IGF) bringt schnell effiziente<br />
und praxisnahe Forschungsergebnisse<br />
hervor. Ein zentraler Baustein der<br />
<strong>FVA</strong>-Tätigkeit im Rahmen der IGF ist<br />
das von unseren Mitgliedern und der<br />
Wissenschaft eingebrachte Spezialistenwissen<br />
einerseits und die konkreten<br />
Fragestellungen andererseits.<br />
Mit Ihrer aktiven Mitarbeit garantieren<br />
Sie, dass die Ergebnisse der Forschungsarbeit<br />
anwendungsgerecht<br />
und gut verwertbar sind.<br />
Mitgliederentwicklung<br />
Uns freut es, dass der Kreis des<br />
<strong>FVA</strong>-Netzwerks sich auch dieses Jahr<br />
erweitert hat. Gerne heißen wir unsere<br />
15 neuen Mitglieder willkommen<br />
(s. S. 8). Jedes Mitgliedsunternehmen<br />
bringt die ihm eigenen Kompetenzen<br />
und Erfahrungen in das Netzwerk ein<br />
Vorsitzender des<br />
Wissenschaftlichen<br />
Beirats der <strong>FVA</strong><br />
und stellt somit eine Bereicherung für<br />
alle dar. Verstärkt kommen unsere<br />
Neumitglieder aus dem Bereich der<br />
elektrischen Antriebstechnik und der<br />
Batterietechnik und verbreitern somit<br />
das gemeinsame Forschungsportfolio.<br />
Mit Ihren Beiträgen garantieren Sie<br />
als Mitglieder eine solide Eigenmittelbasis<br />
für die vorwettbewerbliche Gemeinschaftsforschung.<br />
So profitieren<br />
alle Mitglieder vom Innovationsnetzwerk<br />
der <strong>FVA</strong>, welches weltweit seinesgleichen<br />
sucht.<br />
Gremienarbeit<br />
Die 213 laufenden Forschungsvorhaben<br />
in der <strong>FVA</strong> werden derzeit in<br />
24 Arbeitskreisen koordiniert und vorangebracht.<br />
Unser besonderer Dank<br />
geht deswegen an die Obleute in den<br />
Arbeitskreisen und die Projektleiter<br />
in den Arbeitsgruppen, die sich das<br />
Jahr über mit großem Einsatz für die<br />
Hartmut Rauen<br />
Geschäftsführer<br />
Forschungsvereinigung<br />
Antriebstechnik e.V.<br />
Bernhard Hagemann<br />
stellv. Geschäftsführer<br />
Forschungsvereinigung<br />
Antriebstechnik e.V.<br />
IGF engagieren. Gemeinsam mit den<br />
Mitgliedern der Arbeitskreise und<br />
-gruppen erarbeiten sie Themenvorschläge<br />
für künftige Vorhaben, die<br />
vom Wissenschaftlichen Beirat, in<br />
dem alle <strong>FVA</strong>-Mitglieder vertreten<br />
sind, bewertet und priorisiert werden.<br />
Auf diese Weise ist sichergestellt,<br />
dass die Interessen aller Mitglieder<br />
entscheiden, welche Forschungsvorhaben<br />
in die Umsetzung gehen.<br />
Forschungsprogramm<br />
Einen guten Überblick über das<br />
weiterangewachsene Forschungsprogramm<br />
gibt Ihnen die Gesamtaufstellung<br />
aller Vorhaben (Anlage 1, s. S. 44).<br />
Sieben Vorhaben stellen wir Ihnen in<br />
diesem <strong>Geschäftsbericht</strong> vertieft vor.
Entwicklung der Fördermittel in Mio. Euro pro Jahr CO 2-Forschungsprogramm<br />
Hans Winter Preis<br />
In der <strong>FVA</strong> arbeiten die besten For-<br />
scher aus Industrie und Wissenschaft<br />
zusammen. Die 213 laufenden Vorhaben<br />
der Industriellen Gemeinschaftsforschung<br />
fördern die Innovationsfähigkeit<br />
der Industrie im Bereich der<br />
Antriebstechnik und sind an den<br />
wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen<br />
ein wichtiger Beitrag zur<br />
Ausbildung von Jungingenieuren in<br />
und für die Branche. Bei ihrer jährlich<br />
stattfindenden Informationstagung<br />
setzt die <strong>FVA</strong> deswegen bewusst ein<br />
Zeichen für den Elitegedanken durch<br />
die Vergabe eines Wissenschaftspreises.<br />
Der Hans Winter Preis würdigt<br />
unter anderem den wissenschaftlichen<br />
Gehalt – im Sinne eines Erkenntniszugewinns<br />
– und den Praxisbezug<br />
der vorgestellten Forschungsergebnisse.<br />
Zuletzt ging der Hans Winter<br />
Preis an Dr. Colin Kern (s. S. 33).<br />
Technologietransfer – Seminare<br />
und Kongresse<br />
Auch über die Erstausbildung<br />
hinaus steigt der Bedarf an Weiterbildungsangeboten<br />
für Ingenieure und<br />
Techniker stetig. Das Netzwerk der<br />
<strong>FVA</strong> mit seinen 300 Wissenschaftlern<br />
und 1.700 Industrieexperten bietet<br />
die Chance für die gewünschten Themen<br />
die erfahrensten Trainer aus beiden<br />
Bereichen zu gewinnen. Dies bildet<br />
die Basis für die außerordentliche<br />
Qualität der Seminare und Anwendungsschulungen.<br />
Außerdem baut<br />
die <strong>FVA</strong> kontinuierlich ihr Kongressangebot<br />
aus. Dort können sich die<br />
Kunden unserer Mitglieder ein sehr<br />
gutes Bild über die Leistungsfähigkeit<br />
der <strong>FVA</strong>-Firmen machen. Deswegen<br />
wenden sich die Kongressangebote<br />
bewusst an die gesamte Branche<br />
der Antriebstechnik. Die gute Beteiligung<br />
und hohe Nachfrage zeigen,<br />
E-MOTIVE<br />
Stiftung Industrieforschung<br />
AVIF<br />
AiF-Wettbewerb<br />
AiF-Normal<br />
wie wichtig den Firmen und Teilnehmern<br />
diese Branchentreffs sind. So<br />
hat sich die <strong>FVA</strong> als einzigartige Kommunikations-<br />
und Vernetzungsplattform<br />
für den Bereich Antriebstechnik<br />
etabliert. Im Berichtszeitraum haben<br />
diesmal vier Kongresse stattgefunden:<br />
Der erste GETLUB-Kongress (Dezember<br />
2010), GETPRO (März <strong>2011</strong>), das<br />
E-MOTIVE Expertenforum und SIMPEP<br />
(beide September <strong>2011</strong>).<br />
<strong>FVA</strong>-Software<br />
Eine weitere Form proaktiven Wissenstransfers,<br />
die von den Mitgliedsfirmen<br />
stark nachgefragt wird, ist die<br />
<strong>FVA</strong>-Software. Die hierfür gegründete<br />
<strong>FVA</strong> GmbH entwickelt sich sehr positiv.<br />
Um der steigenden Nachfrage an Serviceleistungen<br />
entgegen zu kommen<br />
und die Qualität der Produkte weiterzuentwickeln,<br />
hat die <strong>FVA</strong> GmbH zur<br />
Jahresmitte in München eine Zweig-<br />
5
6<br />
Vorwort<br />
stelle eröffnet. Diese soll in den<br />
nächsten Jahren als zentraler Stützpunkt<br />
ausgebaut werden.<br />
Elektromobilität<br />
Die Relevanz der gemeinsamen<br />
E-MOTIVE Initiative von <strong>FVA</strong> und FVV<br />
(Forschungsvereinigung Verbrennungskraftmaschinen)<br />
zur Elektromobilität<br />
für die Zukunftsfähigkeit der<br />
Branche zeigt sich immer stärker. Die<br />
projektbegleitenden Ausschüsse der<br />
E-MOTIVE Forschungshaben sind der<br />
Ort, wo alle Beteiligten entlang der<br />
gesamten Wertschöpfungskette zusammen<br />
kommen. Forschungsvorhaben<br />
wie beispielsweise „Bestimmung<br />
eines optimalen Spannungsbereichs<br />
für zukünftige Hybrid- und Elektrofahrzeuge“<br />
tragen dazu bei, frühzeitig<br />
Standards zu entwickeln und Nachwuchsingenieure<br />
für Zukunftsmärkte<br />
auszubilden. So ist E-MOTIVE die<br />
tragende Plattform für die Elektrifizierung<br />
des Antriebsstrangs.<br />
Um die Bedürfnisse der Industrie<br />
noch stärker zu berücksichtigen, haben<br />
<strong>FVA</strong> und FVV im September <strong>2011</strong><br />
ein gemeinsames E-MOTIVE Board<br />
aus hochrangigen Fachvertretern der<br />
Mitgliedsunternehmen gegründet.<br />
Das Gremium soll neue Projekte zur<br />
Elektrifizierung des Antriebsstrangs<br />
mit initiieren, bewerten und resultierende<br />
Empfehlungen an den jeweiligen<br />
Wissenschaftlichen Beirat weiterleiten.<br />
Da viele Board-Mitglieder auch<br />
in der von der Bundesregierung eingerichteten<br />
Nationalen Plattform Elektromobilität<br />
(NPE) aktiv sind, können<br />
die Arbeitsgruppenergebnisse der<br />
NPE zielgerichtet einfließen.<br />
Erfreulich sind in diesem Zusammenhang<br />
Ankündigungen aus dem Bundesministerium<br />
für Wirtschaft und Technologie<br />
(BMWi), in den kommenden Jahren<br />
Fördermittel der industriellen Gemeinschaftsforschung<br />
für Forschungsvorhaben<br />
zur Elektromobilität aufzustocken.<br />
<strong>FVA</strong> und FVV könnten als die<br />
aktivsten Forschungsvereinigungen auf<br />
dem Gebiet davon langfristig profitieren.<br />
Windenergieanlagen<br />
Die insgesamt 14 <strong>FVA</strong>-Projekte<br />
mit direktem Bezug zur Windindustrie<br />
unterstreichen, wie sehr auch dieser<br />
Zukunftsmarkt in der <strong>FVA</strong>-Arbeit präsent<br />
ist (s. S. 38 f). Folgerichtig hat<br />
der <strong>FVA</strong>-Vorstand auf seiner Herbstsitzung<br />
<strong>2011</strong> beschlossen, die <strong>FVA</strong>-<br />
Mitgliedschaft auch für Windanlagenherstellern<br />
zu öffnen und die wertschöpfungskettenübergreifende<br />
Zusammenarbeit zu ermöglichen.<br />
Forschungsmittel<br />
Die Situation der Forschungsmittel<br />
entwickelt sich auch Geschäftsjahr<br />
<strong>2011</strong> weiter positiv. Durch die gute<br />
Unterstützung durch die Industrie<br />
und der Partner an den Hochschulinstituten<br />
bei der Ausarbeitung der<br />
Forschungsanträge konnte die Partizipation<br />
an den Fördermitteln, die im<br />
Wettbewerbsverfahren der AiF vergeben<br />
werden, auf 5,7 Millionen Euro<br />
gesteigert werden. Dies bedeutet für<br />
das Geschäftsjahr <strong>2011</strong>, dass auf<br />
rund 4,3 Millionen Euro, die seitens<br />
der Industrie für Forschungsvorhaben<br />
im Rahmen der Industriellen Gemeinschaftsforschung<br />
investiert werden,<br />
rund 8,3 Millionen Euro Fördermittel<br />
kommen (s.Grafik). Im Vergleich zum<br />
Vorjahr ist das Fördervolumen um<br />
ca. 7 % gestiegen.<br />
Dank<br />
Unser Dank geht selbstverständlich<br />
in erster Linie an unsere Mitgliedsfirmen.<br />
Die engagierte Mitarbeit<br />
der Mitglieder geben der Arbeit ein<br />
<strong>FVA</strong> ein eigenes Profil und eine klare,<br />
zukunftsorientierte Ausrichtung.<br />
Unser Dank gilt ebenso den vielen<br />
Studenten, Wissenschaftlichen Mitarbeitern<br />
und Professoren, die in unserem<br />
Gebiet forschen. Darüber hinaus<br />
danken wir dem Bundesministerium<br />
für Wirtschaft und Technologie (BMWi)<br />
und der Arbeitsgemeinschaft industrieller<br />
Forschungsvereinigungen<br />
für die kontinuierliche Förderung der<br />
Industriellen Gemeinschaftsforschung.<br />
Last but not least dem VDMA für die<br />
nachhaltige Unterstützung.<br />
Unseren Partnern und allen im<br />
<strong>FVA</strong>-Netzwerk wünschen wir ein gutes<br />
Jahr 2012. Wir freuen uns darauf weiterhin<br />
ergebnisorientiert mit all unseren<br />
Partnern zusammenzuarbeiten.
Dr. Michael Paul<br />
Vorsitzender des Vorstands der <strong>FVA</strong><br />
Dr. Toni Weiß<br />
Vorsitzender des wissenschaftlichen<br />
Beirats der <strong>FVA</strong><br />
Hartmut Rauen<br />
Geschäftsführer Forschungsvereinigung<br />
Antriebstechnik e.V.<br />
Bernhard Hagemann<br />
stellv. Geschäftsführer Forschungsvereinigung<br />
Antriebstechnik e.V.<br />
7
8<br />
Mitgliederentwicklung<br />
Mitgliederentwicklung<br />
Mitgliederentwicklung<br />
*Stand September <strong>2011</strong><br />
221 Mitgliedsfirmen
Die positive Mitgliederentwicklung<br />
im Laufe des vergangenen Geschäftsjahrs<br />
unterstreicht die Attraktivität<br />
des <strong>FVA</strong>-Netzwerks. Bei den Betrieben<br />
der Branche Antriebstechnik<br />
wächst das Bewusstsein für die Vorteile<br />
der vorwettbewerblichen Industriellen<br />
Gemeinschaftsforschung<br />
weiterhin. Im ersten Jahrzehnt dieses<br />
Jahrtausends ist die Zahl der <strong>FVA</strong>-<br />
Mitglieder im Jahresdurchschnitt um<br />
zehn Mitglieder gestiegen.<br />
EINTRITT FIRMENNAME<br />
seit 01.11.2010 ThyssenKrupp Presta München/Esslingen GmbH<br />
seit 01.01.<strong>2011</strong> LMT FETTE Werkzeugtechnik GmbH & Co. KG<br />
seit 01.01.<strong>2011</strong> Schmidhauser AG / CH<br />
seit 01.01.<strong>2011</strong> GKN Driveline International GmbH<br />
seit 01.01.<strong>2011</strong> SB LiMotive Germany GmbH<br />
seit 01.01.<strong>2011</strong> SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS PAMPUS GmbH<br />
seit 01.01.<strong>2011</strong> HEAD acoustics GmbH<br />
seit 01.02.<strong>2011</strong> Bonfiglioli Vectron GmbH<br />
seit 01.03.<strong>2011</strong> OVALO GmbH<br />
seit 01.03.<strong>2011</strong> LTi DRIVES GmbH<br />
seit 01.03.<strong>2011</strong> A.T. Süd GmbH<br />
seit 01.03.<strong>2011</strong> Getriebetechnik Magdeburg GmbH<br />
seit 01.05.<strong>2011</strong> Voith Hydro Holding GmbH & Co. KG<br />
seit 01.07.<strong>2011</strong> Hartmut Stelter Zahnradfabrik GmbH & Co. KG<br />
seit 01.07.<strong>2011</strong> NKE AUSTRIA GmbH<br />
Neue Mitglieder seit der letzten Mitgliederversammlung<br />
(Stand: 123 Mitglieder im Jahr 2000,<br />
208 Mitglieder im Jahr 2010). Über<br />
den Berichtszeitraum (01.11.2010 bis<br />
30.09.<strong>2011</strong>) haben sich 15 Betriebe<br />
aus der Antriebstechnik für eine <strong>FVA</strong>-<br />
Mitgliedschaft entschieden (s. Tabelle).<br />
Die <strong>FVA</strong> hat aktuell 221 Mitglieder<br />
(Stand 30.09.<strong>2011</strong>) und ist somit für<br />
die Forschung in der Branche die<br />
zentrale Kommunikationsplattform in<br />
Wissenschaft und Technik.<br />
Die Qualität der praxisorientierten<br />
Forschungsarbeit profitiert vom<br />
Wachstum des Netzwerks, da die<br />
<strong>FVA</strong>-Mitgliedsfirmen ihr Industrie-<br />
Know-how gezielt in die Arbeitskreise<br />
einbringen. Die Firmenstruktur<br />
der <strong>FVA</strong>-Mitglieder weist eine vertikale<br />
(Zulieferer, Systemzulieferer, Endproduzent)<br />
sowie eine horizontale<br />
Struktur (Wettbewerber untereinander)<br />
auf und ist die maßgebliche Erfolgsbasis<br />
für eine übergreifende, systemorientierte<br />
Forschung.<br />
9
10<br />
Das laufende Forschungsprogramm<br />
Überblick über das laufende<br />
Forschungsprogramm<br />
Nachfolgend wird über ausgewählte Forschungsvorhaben berichtet:<br />
Axiale Öldurchflussmengen<br />
<strong>FVA</strong>-Nr. 474 II<br />
Optimale Schmierstoffversorgung<br />
von Wälzlagern ist der Schlüssel zu<br />
hohem Wirkungsgrad der Lagerung<br />
bei gleichzeitig bestmöglicher Lagerkühlung.<br />
Eine durch Ölmangel induzierte<br />
Temperaturerhöhung reduziert<br />
die Schmierfilmdicke im Kontakt und<br />
erhöht dadurch die Gefahr von vorzeitigem<br />
Verschleiß sowie Ermüdung im<br />
Wälzlager. Des Weiteren dient die Ölversorgung<br />
des Wälzlagers der Abfuhr<br />
von Verschleiß- und Fremdpartikeln<br />
aus dem Kontakt. In der Praxis wird<br />
dem Lager aus diesen Gründen häufig<br />
ein größerer Ölvolumenstrom angeboten<br />
als nötig ist. Eine Überversorgung<br />
mit Schmierstoff führt allerdings zu<br />
ungewollten Reibverlusten durch Planschen.<br />
Ölumlaufschmierungen ließen<br />
sich erheblich kleiner dimensionieren<br />
als zurzeit üblich, wenn die den Lagern<br />
zugeführten Ölvolumenströme auf eine<br />
optimale Mindestölmenge begrenzt<br />
würden. Grundvoraussetzung hierfür<br />
ist die genaue Kenntnis des axialen<br />
Öldurchflusses am Wälzlager. Im hier<br />
vorgestellten Forschungsvorhaben 474<br />
II wurde diese Thematik mit Hilfe von<br />
experimentellen Untersuchungen am<br />
Prüfstand, sowie über Simulation und<br />
Berechnung des axialen Öldurchflusses<br />
umfassend bearbeitet. Hauptaugenmerk<br />
lag dabei auf den Wälzlager-<br />
Bild 1: axialer Öldurchfluss<br />
an verschiedenen Wälzlagertypen<br />
typen Rillenkugel-, Zylinderrollen-, Kegelrollen-,<br />
Vier-Punkt- und Schrägkugellager<br />
mit den Bohrungsdurchmessern<br />
80, 100 und 150mm. Bei den Messungen<br />
am eigens für diese Thematik konstruierten<br />
Prüfstand war es möglich,<br />
die Lager teilweise bis weit oberhalb<br />
der durch die Hersteller angegebenen<br />
Grenzdrehzahlen zu betreiben. Neben<br />
der Drehzahlvariation bilden die Radiallast,<br />
der Ölzuführstrom, die Wellenschrägstellung,<br />
die Schmierstoffviskosität<br />
sowie die Wahl des axialen Überlaufs<br />
die am Prüfstand einstellbaren<br />
Betriebsparameter. Das Messergebnis<br />
enthält den direkten axialen Öldurchfluss<br />
am Prüflager in l/min in Abhängigkeit<br />
der gewählten Betriebsbedingungen.<br />
Abb. 1 zeigt eine Übersicht<br />
über das Durchflussverhalten von verschiedenen<br />
Wälzlagertypen mit dem<br />
Bohrungsdurchmesser 80 mm.<br />
AK Wälzlager<br />
Die Positionierung des axialen Überlaufs<br />
ist in Abb. 2 dargestellt. Wie die<br />
Messkurven verdeutlichen, beeinflussen<br />
die unterschiedlichen Lagergeometrien<br />
deutlich das Durchflussverhalten.<br />
Weitergehende Messungen ergaben<br />
bei bestimmten Betriebsbedingungen<br />
ein nahezu vollständiges Absperren<br />
des Prüflagers gegenüber<br />
dem zugeführten Öl. Unzureichende<br />
Kühlung und potentielle Mangelschmierung<br />
können die Folgen sein. Ein weiterer<br />
Schwerpunkt der Prüfstandsarbeiten<br />
war die Untersuchung der Aufteilung<br />
des Ölstromes bei zwei in Reihe<br />
positionierten Lagern mit mittiger Ölzufuhr.<br />
Bei der Ölversorgung konkurrierende<br />
Wälzlager wie z.B. die häufig<br />
verwendete Paarung von Vier-Punktund<br />
Zylinderrollenlager sind Kerngegenstand<br />
dieser Messungen. Im Zuge<br />
der theoretischen Arbeiten wurden
Dr. Jörg Weber, Schaeffler Technologies GmbH & Co.KG<br />
Obmann des Arbeitskreises Wälzlager<br />
CFD-Simulationen zur Ölverteilung im<br />
Zuführraum sowie zu Planschverlusten<br />
durchgeführt. Abb. 3 zeigt exemplarisch<br />
die Ölverteilung im Umfeld des<br />
Prüflagers. Die Simulationen lieferten<br />
die notwendigen Voraussetzungen zur<br />
Entwicklung eines technisch-mathematischen<br />
Modells des axialen Öldurchflusses.<br />
Mit Hilfe des Modells<br />
wird mit Abschluss des Forschungsvorhabens<br />
ein umfangreiches Anwenderprogramm<br />
zur Verfügung gestellt<br />
(siehe Abb. 4), welches es erlaubt den<br />
Öldurchfluss bei verschiedenen Betriebsparametern<br />
berechnen zu lassen.<br />
Die Berechnungsergebnisse wurden<br />
bereits erfolgreich mit den experimentell<br />
ermittelten Daten validiert.<br />
Wälzlager tragen im erheblichen Maße dazu bei, die<br />
Wirkungsgrade von Maschinen zu erhöhen, den CO 2-Ausstoß<br />
zu vermindern und wirken sich daher positiv auf den<br />
Klimawandel aus. Die Verbesserung der Wirkungsgrade von<br />
modernen Maschinen ist in der Regel mit einer Steigerung<br />
der Leistungsdichte verbunden. Deshalb ist es wichtig<br />
die Einsatzgrenzen von Wälzlagern zu kennen, um einen<br />
ausfallfreien Betrieb zu gewährleisten. Das Vorhaben<br />
„Axiale Öldurchflussmengen“ hat hierzu einen wesentlichen<br />
Beitrag geleistet. Es ist jetzt u.a. möglich den Öldurchfluss<br />
von verschiedenen Lagerbauarten vorhersagen zu können.<br />
Dieses Wissen hilft den Mitgliedsfirmen den Ölkreislauf ihrer<br />
Maschinen und Anlagen besser zu dimensionieren und damit<br />
auch wettbewerbsfähigere Produkte anbieten zu können.<br />
Bild 2: Schematische Darstellung des Prüfaufbaus Bild 3: CFD Simulation - Ölverteilung im Lagerumfeld<br />
Bild 4: Anwenderprogramm zur Berechnung des axialen Öldurchflusses<br />
11
12<br />
Das laufende Forschungsprogramm<br />
Hypoid-Fressen<br />
<strong>FVA</strong>-Nr. 519<br />
Motivation und Ziel des Vorhabens<br />
Aufgrund der fatalen Auswirkungen<br />
eines Fressschadens (Bild 1) und der<br />
daraus resultierenden Folgeschäden<br />
auf die Lebensdauer eines Getriebes<br />
hat die optimale Auslegung des tribologischen<br />
Systems aus Verzahnung<br />
und Schmierstoff zur Vermeidung von<br />
Fressern eine große Bedeutung bei<br />
der Getriebeentwicklung.<br />
Da die bislang zur Verfügung stehenden<br />
Methoden zur Auslegung und<br />
Nachrechnung von Zahnrädern hinsichtlich<br />
der Fresstragfähigkeit alle<br />
über spezifische Nachteile verfügen,<br />
sollte im Forschungsvorhaben Nr. 519<br />
„Hypoid-Fressen“ [1] auf Basis systematischer<br />
experimenteller Untersuchungen<br />
ein neues, einheitliches Berechnungsverfahren<br />
zur Berechnung<br />
der Fresstragfähigkeit entwickelt werden.<br />
Dieses sollte zum Einen als<br />
lokales Rechenverfahren auf Basis<br />
einer Zahnkon-taktanalyse, zum Anderen<br />
als einfaches, normfähiges<br />
Rechenverfahren angewendet werden<br />
können.<br />
Experimentelle Untersuchungen<br />
Bei den experimentellen Unter-<br />
suchungen zur Fresstragfähigkeit wurden<br />
die Parameter Achsversetzung,<br />
Einlauf, Ease-Off-Auslegung (Tragbildgröße<br />
und -lage) sowie Treibrich-<br />
tung untersucht. Es zeigte sich, dass<br />
die Fresstragfähigkeit, wie erwartet,<br />
mit zunehmender Achsversetzung<br />
abnimmt, was in der größer werdenden<br />
Gleitgeschwindigkeit begründet<br />
ist. Auch der Einlauf- bzw. Glättungszustand<br />
der Flanken hat einen großen<br />
Einfluss: Die Fresstragfähigkeit nicht<br />
eingelaufener Flanken sank auf bis<br />
zu 25% der Fresstragfähigkeit gut<br />
eingelaufener Verzahnungen. Aus<br />
den Versuchen zum Einfluss der Tragbildgröße<br />
und -lage ließ sich ableiten,<br />
dass die Pressungsverteilung auf<br />
der Flanke so ausgeprägt sein sollte,<br />
dass Bereiche mit hohen Gleitgeschwindigkeiten<br />
möglichst entlastet<br />
sind. Der Einfluss der Treibrichtung<br />
ist von der Achsversetzung abhängig:<br />
Während bei Kegelrädern die<br />
AK Schmierstoffe und Tribologie<br />
Bild 1: Fresser an einer Hypoidverzahnung (links: Ritzel, rechts: Tellerrad)<br />
Treibrichtung „Rad treibt Ritzel“ die<br />
Fresstragfähigkeit deutlich reduziert,<br />
ist dieser Effekt bei den achsversetzten<br />
Prüfverzahnungen nicht erkennbar,<br />
was an der bei Hypoidverzahnungen<br />
über der gesamten Flanke<br />
hohen Gleitgeschwindigkeit und der<br />
damit verbundenen Lage der minimalen<br />
Fresssicherheit in der Mitte der<br />
Flanke liegt.<br />
Rechenverfahren<br />
Auf Basis der in den experimen-<br />
tellen Untersuchungen zur Fresstragfähigkeit<br />
gewonnenen Erkenntnisse<br />
wurde ein neues Rechenverfahren zur<br />
Berechnung der Fresstragfähigkeit<br />
von Kegelrad- und Hypoidgetrieben<br />
entwickelt. Dieses berechnet auf Basis<br />
des neuen lokalen Reibungszahl-
Dr. Arthur Wetzel, ZF Friedrichshafen AG<br />
Obmann des AK Schmierstoffe und Tribologie<br />
ansatzes und modifizierter Einflussfaktoren<br />
zur Berücksichtigung der<br />
Treibart sowie des Einlaufzustands<br />
der Oberflächen eine lokale Fresssicherheit.<br />
Das Rechenverfahren kann sowohl<br />
als lokales Verfahren auf Basis einer<br />
Zahnkontaktanalyse unter Last (z.B.<br />
mit BECAL), als auch als einfaches,<br />
normfähiges Verfahren auf Basis einer<br />
Ersatz-Stirnradverzahnung angewendet<br />
werden. Im Falle der Anwendung<br />
bei einer Zahnkontaktanalyse<br />
wird mit den lokalen Beanspruchungen<br />
eine lokale Kontakttemperatur<br />
bestimmt, die einer ebenfalls lokal<br />
berechneten Grenztemperatur gegenüber<br />
gestellt wird (Bild 2). Bei der<br />
Anwendung als einfaches, normfähiges<br />
Rechenverfahren werden die<br />
maßgeblichen Beanspruchungen in<br />
guter Näherung an einer Ersatz-Stirn-<br />
Kegelradgetriebe und Hypoidgetriebe finden sich in einem<br />
breiten Anwendungsgebiet, vom Schiffsgetriebe, über Bahnund<br />
PKW-Getriebe. Bedingt durch den sehr speziellen tribologischen<br />
Kontakt sind Hypoidverzahnung fressgefährdet.<br />
Wurden in der Vergangenheit die Verzahnungen nach DIN<br />
3390/3391 fresssicher ausgelegt, so konnte es trotzdem in<br />
der Praxis zu Fresserscheinungen kommen. Im Rahmen dieses<br />
Projekts wurden verbesserte Verfahren für die Berechnung<br />
der Fresstragfähigkeit von Kegelrad- und Hypoidgetrieben<br />
entwickelt. Erkenntnisse aus begleitenden experimentellen<br />
Untersuchungen sind in die Berechnungsmethoden eingeflossen.<br />
Durch die wesentlich verbesserte Berechnung der<br />
Fresstragfähigkeit dieser kritischen Verzahnungen wird der<br />
Konstrukteur in die Lage versetzt so auszulegen, dass Fressschäden<br />
künftig nicht mehr vorkommen sollten.<br />
Bild 2: Exemplarischer Vergleich der berechneten lokalen Fresssicherheit mit dem<br />
Schadensbild an einer Kegelradverzahnung<br />
radverzahnung berechnet und damit<br />
ebenfalls eine lokale Fresssicherheit<br />
über der Eingriffsstrecke ermittelt.<br />
Mit beiden Verfahren ergab die Nachrechnung<br />
von Schadensfällen aus<br />
den Versuchen und Praxisanwendungen<br />
zutreffende Ergebnisse.<br />
Auch der Vergleich der beiden Verfahren<br />
miteinander ergab eine gute<br />
Übereinstimmung (Bild 3).<br />
Bild 3: Vergleich der an der Ersatzverzahnung<br />
(norm.) berechneten mit der anhand<br />
einer ZKA ermittelten Fresssicherheit<br />
13
14<br />
Das laufende Forschungsprogramm<br />
Flankentragfähigkeit Werkstofftiefe<br />
<strong>FVA</strong>-Nr. 556 AK Werkstoffe<br />
Die Zahnflankentragfähigkeit stellt<br />
bei einsatzgehärteten Stirnrädern<br />
eine die Lebensdauer bestimmende<br />
Größe dar. Bisherige Untersuchungen<br />
führten zu Empfehlungen und Berechnungsverfahren,<br />
die eine Optimierung<br />
der Wärmebehandlung ermöglichen.<br />
Schwerpunkt dieser Untersuchungen<br />
bildete dabei die Schadensart Grübchenbildung.<br />
In der Praxis treten bei<br />
hoch belasteten Zahnradstufen jedoch<br />
auch Schäden durch Flankenbruch<br />
auf, bei denen von einer primären<br />
Rissentstehung in größeren Werkstofftiefen<br />
ausgegangen wird.<br />
Im Rahmen von umfangreichen<br />
systematischen experimentellen Untersuchungen<br />
wurde die Tragfähigkeit<br />
hinsichtlich der Schadensart Flankenbruch<br />
an Prüfverzahnungen vom Typ<br />
67 / 69 (Normalmodul mn = 3 mm,<br />
Achsabstand a = 200 mm) aus den<br />
Einsatzstählen 20MnCr5 und 18CrNi-<br />
Mo7-6 untersucht. Aus den Ergebnissen<br />
konnten werkstoffspezifische<br />
Wöhlerdiagramme hinsichtlich der<br />
Schadensart Flankenbruch mit einem<br />
Zeit- und einem Dauerfestigkeitsbereich<br />
abgeleitet werden (siehe Bild 1).<br />
Neben den Einstufenuntersuchungen<br />
wurden weiterhin Untersuchungen<br />
zum Einfluss von Überlasten durchgeführt.<br />
Diese zeigten, dass auch bei<br />
der Schadensart Flankenbruch eine<br />
Art Schadenslinie vorliegt, deren<br />
Überschreitung die Dauerfestigkeit<br />
mindern kann. Ergänzende Untersuchungen<br />
zum Einfluss des Eingriffswinkels,<br />
der Einsatzhärtungstiefe und<br />
der Verzahnungsgeometrie lieferten<br />
weitere Erkenntnisse hinsichtlich der<br />
Schadensart Flankenbruch.<br />
Im Rahmen der theoretischen Arbeiten<br />
wurde eine höherwertige Beurteilungsmöglichkeit<br />
für Schäden an<br />
und insbesondere unterhalb der Bauteiloberfläche<br />
nach dem FZG-Modell<br />
für Stirnradflankenbruch vorgestellt<br />
und erweitert. Mit Hilfe dieser Modellvorstellungen<br />
ist eine Beurteilung von<br />
Schäden, deren Schadensausgang<br />
auch unterhalb der Bauteiloberfläche<br />
liegen kann, möglich. Ausgehend von<br />
diesen Modellvorstellungen wurde<br />
weiterhin ein praxisorientierter Beurteilungsansatz<br />
zur Abschätzung der<br />
Gefährdung einer Zahnradstufe hinsichtlich<br />
Flankenbruch entwickelt und<br />
abgeleitet, mit dem bereits in der<br />
Getriebeauslegungsphase eine entsprechende<br />
Abschätzung möglich ist.<br />
In Bild 2 ist eine exemplarische Nachrechnung<br />
eines Flankenbruchs, der<br />
im Rahmen der experimentellen Untersuchungen<br />
belegt wurde, mit beiden<br />
Beurteilungsverfahren dargestellt.<br />
Erkennbar ist, dass zwischen Experiment<br />
und Berechnung sowohl die<br />
Gefährdung hinsichtlich Flankenbruch<br />
als auch die Tiefenlage des Schadensausgangsortes<br />
gut korrelieren.<br />
Der praxisorientierte Beurteilungsansatz<br />
wurde zur Verifizierung und<br />
Überprüfung weiterhin in dem Berechnungstool<br />
„Werkstoffgefährdung<br />
Flankenbruch WgFb“ umgesetzt.<br />
Insgesamt kann festgehalten werden,<br />
dass die Ergebnisse des vorliegenden<br />
Forschungsvorhabens umfangreiche<br />
neue Erkenntnisse hinsichtlich<br />
der Schadensart Flankenbruch<br />
(Schadenscharakteristik,<br />
Schadensentwicklung und auch zur<br />
Vermeidung dieser Schadensart) erbracht<br />
haben. Mit Hilfe des abgeleiteten<br />
praxisorientierten Berechnungsansatzes<br />
können in der Getriebeauslegung<br />
nun auch Anforderungen zur<br />
Vermeidung von Schäden mit Schadensausgang<br />
unterhalb der Bauteiloberfläche<br />
berücksichtigt werden,<br />
was in dieser Form bisher nicht oder<br />
nur stark eingeschränkt möglich war.<br />
Somit leisten die Ergebnisse des<br />
vorliegenden Forschungsvorhabens<br />
einen wichtigen Beitrag zur sicheren<br />
und beanspruchungsgerechten Auslegung<br />
von Getrieben in der industriellen<br />
Anwendung.
Christoph Lehne, Leiter Wärmebehandlung Siemens AG<br />
Obmann des AK Werkstoffe<br />
Der projektbegleitende Ausschuss „Werkstoffe“<br />
charakterisiert und erforscht Werkstoffzustände und Werkstoffbelastungen,<br />
sowie thermische und thermochemische<br />
Prozesse, die gezielt diese Werkstoffeigenschaften beeinflussen<br />
und/oder ändern. Im Vorhaben „Flankentragfähigkeit<br />
Werkstofftiefe“ wird die lokale Beanspruchung des Werkstoffes<br />
der lokalen Beanspruchbarkeit gegenübergestellt.<br />
Aus dieser Gegenüberstellung wird eine Werkstoff-<br />
Anstrengung oder (als Kehrwert) eine Werkstoff-Sicherheit<br />
abgeleitet, die lokal eine Risikoabschätzung gegen<br />
Flankenbruch zulässt.<br />
Bild 1: Wöhlerdiagramm hinsichtlich Flankenbruch<br />
für eine Ausfallwahrscheinlichkeit<br />
von 50 % für den Einsatzstahl 18CrNiMo7-6<br />
sowie exemplarische Schadensbilder<br />
Bild 2: Exemplarische Nachrechnung<br />
eines Flankenbruchs aus den experimentellen<br />
Untersuchungen mit den in <strong>FVA</strong> 556<br />
belegten Beurteilungsverfahren<br />
15
16<br />
Das laufende Forschungsprogramm<br />
<strong>FVA</strong> – RWDR-Dynamik<br />
<strong>FVA</strong>-Nr. 574<br />
Radialwellendichtringe (Simmerringe)<br />
unterliegen einer Vielzahl von<br />
Belastungen. Daher ist es bei der<br />
Auslegung von dynamischen Dichtungen<br />
wichtig, die richtige Geometrie<br />
und den richtigen Dichtwerkstoff zu<br />
wählen. Fehler im Dichtringdesign<br />
können fatale Konsequenzen für das<br />
Dichtsystem und die umgebende<br />
Umwelt haben. Bereits kleine<br />
Abweichungen von der optimalen<br />
Auslegung entscheiden darüber, ob<br />
ein Dichtsystem funktioniert oder<br />
nicht. Zur Reduzierung der Fehleranfälligkeit<br />
von RWDR-Systemen und<br />
deren Optimierung müssen die Dichtungen<br />
analysierbar sein. Die hochtechnisierte<br />
Industrie erwartet heute<br />
von Dichtsystemen, dass diese die<br />
Lebensdauer des abzudichtenden<br />
Aggregats überdauern und nicht<br />
mehr getauscht werden müssen. Fällt<br />
ein Dichtsystem vor Erreichen der<br />
Systemlebensdauer aus, bringt das<br />
lange Ausfallzeiten mit sich, was wiederum<br />
hohe Kosten verursacht. Die<br />
hohen Ansprüche der Anwender und<br />
die Vielfalt der Einsatzgebiete und<br />
der verfügbaren Werkstoffe machen<br />
die Prüfstandanalyse von RWDR-<br />
Systemen heute sehr zeit- und kostenaufwendig.<br />
Trotz des hohen Entwicklungsstandes<br />
und umfassenden Fachwissens<br />
über aktuelle RWDR-Systeme ist der<br />
eigentliche Dichtmechanismus noch<br />
immer nicht abschließend geklärt. Gerade<br />
die in dem Dichtsystem ablaufenden<br />
dynamischen Vorgänge und<br />
Bild 1: Dynamik im RWDR-System Bild 2: 3D – Berechnungsmodell<br />
AK Dichtungstechnik<br />
deren Auswirkungen auf den Dichtkontakt<br />
werfen Fragen auf, die noch<br />
umfassend erforscht werden müssen.<br />
Zum Verständnis der Vorgänge im<br />
Dichtkontakt müssen die darauf wirkenden<br />
Einflüsse separiert und in ihrer<br />
Wirkweise durch Prüfstandarbeiten<br />
untersucht werden. Zur Eindämmung<br />
der Prüfkosten wird nun seit<br />
fast zwei Jahrzehnten intensiv an der<br />
rechnergestützten Simulation von<br />
Elastomerbauteilen gearbeitet. Heute<br />
steht dem Entwickler die Rechnertechnik<br />
zur Verfügung, um auch komplexere<br />
Geometrien, wie die eines Radialwellendichtrings,<br />
zu berechnen.<br />
Das Know How bei der Berechnung<br />
von dynamisch belasteten Elastomerbauteilen<br />
liegt in der Abbildung<br />
des Werkstoffs in der Simulationsumgebung.<br />
Die verwendeten Daten entscheiden<br />
maßgeblich über die Qualität<br />
der Berechnungsergebnisse und<br />
müssen für jeden Anwendungsfall<br />
unterschiedlich ermittelt werden.<br />
Vor allem die Elastomertemperatur,<br />
der Alterungszustand und der Belastungsfall<br />
sind entscheidend für den<br />
Datensatz. Da nicht automatisch davon<br />
ausgegangen werden darf, dass<br />
ein Berechnungsmodell die Realität<br />
abbildet, müssen die Simulationsergebnisse<br />
mit Verifizierungsunter-
Dr. Eberhard Bock, Manager Sealing Technology Automotive Industry, Innovationscenter<br />
Freudenberg Sealing Technologies GmbH & Co.KG<br />
Obmann des AK Dichtungstechnik<br />
suchungen mit den Prüfstandergebnisse<br />
verglichen und bewertet werden.<br />
Eine Möglichkeit der Modellprüfung<br />
besteht in der Ermittlung der<br />
Grenzfrequenz, ab der ein Folgefähigkeitsverlust<br />
auftritt. Dabei wird<br />
der Dichtring durch die harmonisch<br />
schwingende Welle ausgelenkt und<br />
muss dieser, um die Dichtfunktion zu<br />
erhalten, folgen. Stimmt die Frequenz<br />
im Modell und am Prüfstand überein,<br />
kann davon ausgegangen werden,<br />
dass das Modell das reale Bauteilverhalten<br />
simulieren kann.<br />
Im Rahmen des <strong>FVA</strong>-Vorhabens<br />
574 „Berechnung und Prognose des<br />
dynamischen Verhaltens von Radialwellendichtringen<br />
(RWDR) - RWDR-<br />
Dynamik“, konnten verschiedene Berechnungsmodelle<br />
entwickelt werden,<br />
die die Systemdynamik unter thermischer,<br />
chemischer und mechanischer<br />
Belastung des Elastomerwerkstoffs<br />
simulieren. Im Laufe des Vorhabens<br />
stellte sich heraus, dass 3 Modelle<br />
Simmerringe müssen in einem immer schwieriger werdenden<br />
Umfeld zuverlässig funktionieren und die hohen Erwartungen<br />
der Anwender hinsichtlich Funktion und Lebensdauer<br />
erfüllen. Häufig setzt der Entwickler wegen Masse und Trägheit<br />
auf höhere Drehzahl und geringeren Wellendurchmesser.<br />
Gleichzeitig soll der Simmerring weniger Reibverluste<br />
erzeugen, was durch eine geringere Anpresskraft der Dichtlippe<br />
an die Welle erreicht werden kann. Im Falle eines<br />
Wellenschlags resultiert daraus eine höhere radiale Beschleunigung<br />
der Wellenoberfläche, der die Dichtlippe trotz<br />
geringerer Anpresskraft folgen muss. Tut sie das nicht, so<br />
entsteht ein Spalt zwischen Dichtlippe und Wellenoberfläche<br />
und das System wird undicht. Dies ist nur ein einzelnes<br />
Beispiel, das den Wunsch nach einer möglichst genauen<br />
und realistischen Simulation des Simmerring-Verhaltens<br />
wachsen lässt, um schneller und präziser entwickeln zu<br />
können. Deshalb hatten <strong>FVA</strong>-Beirat und Vorstand beschlossen,<br />
das Projekt RWDR-Dynamik zur Förderung einzureichen.<br />
Die Ergebnisse zeigen: Das war gut so!<br />
(Probenmodell, 2D-RWDR-Modell,<br />
3D-Modell) benötigt werden, um grundlegende<br />
Simulationen von RWDR-<br />
Systemen durchführen zu können.<br />
Mit Abschluss des Projektes<br />
stehen die Grundlagenfunktionen zur<br />
Berechnung von komplexen Elastomerbauteilen<br />
zur Verfügung. Die Er-<br />
gebnisse des <strong>FVA</strong> Vorhabens zeigen<br />
das Potential der Finiten Element-<br />
Berechnung für Elastomerbauteile.<br />
Die entwickelten Modelle und Verifizierungsmethoden<br />
stellen einen vielversprechenden<br />
Schritt zur Reduzierung<br />
von Prüfstandversuchen in der<br />
Dynamikanalyse von RWDR-Systemen<br />
dar und sollten weiterverfolgt werden.<br />
Bild 3: Modellverifizierung durch Folgefähigkeitsverlust: Simulation l., Versuch r.<br />
17
18<br />
Das laufende Forschungsprogramm<br />
Erhöhung der Produktivität der Entwicklung<br />
durch Open Innovation<br />
<strong>FVA</strong>-Nr. 590 II<br />
Eine der Methoden, die im Rahmen<br />
einer Open-Innovation-Strategie<br />
Anwendung finden, ist „Broadcast<br />
Search“. Sie basiert auf der Ausschreibung<br />
technischer Probleme an<br />
eine große internationale Gruppe externe<br />
Akteuren aus verschiedenen<br />
Disziplinen in Form eines offenen<br />
Aufrufs zur Mitwirkung („Request for<br />
Proposal“ (RFP) genannt). Diese externen<br />
Akteure („Solution Provider“)<br />
treten in einen Wettbewerb zur Lösung<br />
des Problems, d.h. in der Regel wird<br />
nur der beste oder passendste<br />
Lösungsvorschlag belohnt.<br />
Der Hebeleffekt von Broadcast<br />
Search beruht dabei vor allem auf<br />
der Erweiterung der Spannbreite der<br />
Ideen- und Lösungsfindung. Diese<br />
Methode hat sich in der chemischen,<br />
der IT- und der Konsumgüterindustrie<br />
in Bezug auf die Relation von eingesetzten<br />
Ressourcen (Zeit, F&E-Budget)<br />
und erzieltem Ergebnis als hoch<br />
effizient erwiesen.<br />
Jedoch gab es bislang nur wenige<br />
Erfahrungen mit dieser Methode im<br />
deutschen mittelständischen Maschinen-<br />
und Anlagenbau und der Antriebstechnik.<br />
Im Projekt <strong>FVA</strong> 590 II<br />
wurde deshalb zusammen mit dem<br />
Lehrstuhl Technologie- und Innovationsmanagement<br />
der RWTH Aachen<br />
in einer Pilotstudie der Frage nachgegangen,<br />
ob Broadcast Search in der<br />
Antriebstechnik funktioniert und Nutzen<br />
stiften kann.<br />
Dazu wurden mit dem Netzwerk<br />
der <strong>FVA</strong> fünf technische Problemstellungen<br />
als RFP formuliert, die verschiedene<br />
Problemklassen abdeckten:<br />
Ein eher offenes forschungsorientiertes<br />
Problem, zwei konkrete Entwicklungsaufgaben<br />
und zwei prozesstechnische<br />
Verfahrensprobleme.<br />
Nach einem intensiven Screening-<br />
Prozess wurde als Open-Innovation-<br />
Plattform für die Problemausschreibung<br />
das Unternehmen NineSigma<br />
gewählt. Abb. 1 zeigt den Prozess.<br />
Insgesamt gingen auf die fünf<br />
Ausschreibungen (RFP) 95 Lösungsvorschläge<br />
ein, meist mit hohem Ausarbeitungsniveau.<br />
Die durchschnittlichen<br />
Ausschreibungskosten lagen<br />
bei ca. 18.000€/RFP, der Prozess<br />
dauerte inklusive der Bewertung der<br />
eingereichten Lösungen 100 Werktage.<br />
Dabei entfielen aber lediglich<br />
30-35 Tage auf die Lösungssuche,<br />
AK Innovationsmanagement<br />
der Rest wurde für die Formulierung<br />
der Fragestellung, die Bewertung und<br />
Koordination benötigt.<br />
Die Bewertung der Lösungsvorschläge<br />
zeigt, dass Broadcast Search<br />
grundsätzlich geeignet ist, technische<br />
Problemstellungen im Maschinen-<br />
und Anlagenbau zu lösen. Die<br />
Ausschreibungen haben Lösungsvorschläge<br />
generiert, die von Fachexperten<br />
als lösungsrelevant und neu<br />
bewertet wurden. Abb. 2 verdeutlicht<br />
für vier der RFPs diese Effektivität<br />
von Open Innovation: Mehr als 60%<br />
der eingereichten Lösungsansätze<br />
waren für die Projektpartner (radikal)<br />
neu. Darüber hinaus lernten die Unternehmen<br />
73 neue mögliche Kooperationspartner<br />
kennen.<br />
Das Projekt zeigte aber auch, dass<br />
Open Innovation mittels Broadcast<br />
Search neue Projektstrukturen in den<br />
Unternehmen und der <strong>FVA</strong> benötigt:<br />
Klassische Entwicklungsorganisationen<br />
sind nicht auf die schnelle<br />
Durchführung von Broadcast Search<br />
ausgerichtet. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor<br />
ist die Etablierung eines<br />
Prozesspromotors, der als Champion<br />
die Open-Innovation-Projekte koordiniert<br />
und vorantreibt.
Dr. Bruno J. Scherb<br />
Zentrales Innovationsmanagement Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG<br />
Obmann des AK Innovationsmanagement<br />
Die rechtlichen Rahmenbedingungen<br />
lassen sich alle beherrschen,<br />
verlangen aber neue Kompetenzen<br />
der Patent- und Rechtsabteilung<br />
beim Umgang mit den externen<br />
Wissen.<br />
Für Herausforderungen im vorwettbewerblichen<br />
Bereich auf Ebene<br />
einer Arbeitsgruppe in der <strong>FVA</strong> ist<br />
die Methode zu komplex und schwer<br />
zu koordinieren. Unternehmensspezifische<br />
Aufgaben funktionieren<br />
einfacher und besser.<br />
Trotz dieser Herausforderungen<br />
zeigen die Ergebnisse des Projekts<br />
aber, dass Open Innovation und Broadcast<br />
Search ein wichtiges Instrumentarium<br />
erfolgreichen Innovationsmanagement<br />
ist.<br />
„Why Go Outside?“ Zunehmender Innovationsdruck<br />
bedeutet: „Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern<br />
dorthin, wo kein Weg ist und hinterlasse eine Spur.“<br />
Mit den Erfahrungen aus der Chemie-, Pharma und IT-<br />
Industrie sind wir keine völlig neuen Wege gegangen – wohl<br />
hinterlassen die Ergebnisse eine deutliche Spur. Es konnte<br />
gezeigt werden, dass die Open Innovation Methode Broadcast<br />
Search auch im Bereich der Antriebstechnik eine Steigerung<br />
der Effizienz und Effektivität durch Rückgriff auf<br />
externes Wissen ermöglicht und für die Lösung technisch<br />
komplexer Problemstellungen geeignet ist.<br />
Bild 1: Ablaufschritte von Broadcast Search<br />
Bild 2: Effektivität von Broadcast Search<br />
19
20<br />
Das laufende Forschungsprogramm<br />
Bestimmung der örtlichen Fresstragfähigkeit:<br />
Einfluss von Schräg- und Hochverzahnungen<br />
<strong>FVA</strong>-Nr. 598 I<br />
Stirnradverzahnungen werden in<br />
den verschiedensten Baugrößen (Bild<br />
1) eingesetzt und finden z. B. in Personenkraftwagen,<br />
Windkraftanlagen<br />
und vielen weiteren Anwendungen ihren<br />
Einsatz. Durch eine sichere Auslegung<br />
von Verzahnungen und durch<br />
die Wahl geeigneter Schmierstoffe<br />
können Fressschäden vermieden<br />
werden. Die Fresstragfähigkeitsberechnungen<br />
nach DIN 3990 Teil 4<br />
oder ISO/TR 13989 haben über eine<br />
sehr lange Zeit in der Praxis ihre<br />
Tauglichkeit bewiesen. Bei hohen Anforderungen<br />
bezüglich Laufruhe und<br />
Geräuschverhalten werden zunehmend<br />
Schrägverzahnungen, insbesondere<br />
in Verbindung mit Hochverzahnungen<br />
eingesetzt, die teilweise<br />
Bild 1: Größenvergleich<br />
der Versuchsverzahnungen<br />
Fressschäden aufweisen, die nach<br />
den genannten Tragfähigkeitsberechnungen<br />
nicht auftreten dürften.<br />
Erschwerend kommt hinzu, dass<br />
Verzahnungen mit niedrigeren Sicherheiten<br />
gegen Fressen und höheren<br />
berechneten Temperaturen teilweise<br />
keine Fressschäden aufweisen.<br />
Die Erforschung der örtlichen<br />
Fresstragfähigkeit steht im Fokus des<br />
Forschungsvorhabens. Insbesondere<br />
sind hierbei Schräg- und Hochverzahnungen<br />
von Interesse. Ausgehend<br />
von bekannten Berechnungsverfahren<br />
werden neue Ansätze entwickelt, mit<br />
denen für jeden einzelnen Punkt auf<br />
einer Zahnflanke die Fresssicherheit<br />
berechnet werden kann. Dazu ist es<br />
notwendig, genauere Reibungszahlen<br />
als bisher zu ermitteln und daraus<br />
die Temperaturen auf der Zahnflanke<br />
und die Verlustleistungen abzuleiten.<br />
Es werden für ausgewählte raue<br />
Zahnflankenkontakte lokal aufgelöst<br />
die Druck-, Schmierspalthöhen-,<br />
Reibungs- und die Temperaturverteilungen<br />
im Fluid sowie an den<br />
Zahnflankenoberflächen mittels der<br />
Thermo-Elastohydrodynamik (TEHD)<br />
für Flüssigkeits- und Mischreibung<br />
berechnet (Bild 3). Mit Kenntnis dieser<br />
lokalen thermischen Beanspruchung<br />
in jedem einzelnen lokalen<br />
AK Stirnräder<br />
Punkt auf der Zahnflanke kann nun<br />
die Reaktionskinetik des Schmierstoffs<br />
als Grundlage eines Versagenskriteriums<br />
genauer beschrieben werden.<br />
Eine wichtige Eingangsgröße für<br />
die Temperaturberechnung ist neben<br />
der Gleitgeschwindigkeit die Lastverteilung<br />
auf der Zahnflanke. Daher<br />
werden für die Betriebspunkte, an<br />
denen an den Versuchsverzahnungen<br />
Fressschäden aufgetretenen sind,<br />
jeweils die zugehörigen örtlichen Linienlasten<br />
mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode<br />
(FEM) berechnet.<br />
Des Weiteren wird zur Validierung der<br />
Temperaturberechnung eine Messung<br />
der Temperatur im Zahnkontakt mit<br />
Hilfe von tribologisch optimierten<br />
Dünnschichtsensoren, welche aus<br />
einer Isolations-, einer Sensorund<br />
einer Verschleißschutzschicht<br />
bestehen, durchgeführt.<br />
Damit es ebenso möglich ist, den<br />
Größeneinfluss auf die Fresstragfähigkeit<br />
zu ermitteln beziehungsweise<br />
zu kontrollieren, werden 36 Fressversuche<br />
sowohl an einem Standardprüfstand<br />
(Achsabstand a = 91,5 mm)<br />
als auch an einem Großgetriebeprüfstand<br />
(a = 447,3 mm) durchgeführt.<br />
Bild 1 zeigt einen Größenvergleich<br />
der verwendeten Versuchsverzahn-
Dr.-Ing. Christoph Sundermann<br />
Renk Aktiengesellschaft, Leiter Konstruktion Industriegetriebe<br />
Obmann des AK Stirnräder<br />
ungen. Der Großgetriebeprüfstand<br />
der Ruhr-Universität Bochum (Bild 2)<br />
ist aktuell ebenfalls für Versuche zur<br />
Flankentragfähigkeit von Großgetrieben<br />
(AK Werkstoffe) im Einsatz.<br />
Bild 2: Großgetriebeprüfstand<br />
der Ruhr-Universität Bochum<br />
Bild 3: Exemplarische Druck- und<br />
Temperaturverteilung im Zahnkontakt<br />
einer Schrägverzahnung<br />
Durch die Arbeiten im Forschungsvorhaben „Örtliche<br />
Fresstragfähigkeit“ wird eine optimierte Berechnungsmethode<br />
zur Bestimmung der Fresstragfähigkeit von Stirnrädern –<br />
speziell für Schräg- und Hochverzahnungen – zur Verfügung<br />
stehen. Die von den Forschungsstellen in Magdeburg und<br />
Bochum durchgeführten TEHD-Simulationen und Großgetriebeversuche<br />
ermöglichen außerdem eine Absicherung der<br />
Ergebnisse für große Baugrößen, deren Bedeutung durch<br />
die steigende Nachfrage – speziell im Bereich der Windkraftgetriebe<br />
– stetig zunimmt.<br />
Druckverteilung Temperaturverteilung<br />
21
22<br />
Das laufende Forschungsprogramm<br />
Benchmarkstudie „Anti-Fretting-Coatings“<br />
<strong>FVA</strong>-Nr. 624<br />
Reibdauerermüdung und Schwingungsverschleiß,<br />
im Allg. auch als<br />
Fretting bezeichnet, sind bekannte<br />
Schadensursachen bei einer Vielzahl<br />
von gefügten Maschinenelementen.<br />
Dabei wird die Werkstoffermüdung infolge<br />
dynamischer Betriebsbelastung<br />
durch eine überlagerte tribologische<br />
Schädigung der gefügten Oberflächen<br />
beschleunigt. Dies kann zu einem<br />
frühzeitigen Versagen des Bauteils<br />
aber auch zu einer Verschiebung der<br />
Dauerfestigkeitsgrenze zu deutlich<br />
größeren LW als 107 führen. Eine zweite<br />
Form der Schädigung sind starke<br />
Passungsrostspuren (beispielsweise<br />
bei Wälzlagersitzen), die von vielen<br />
Kunden nicht akzeptiert bzw. als<br />
potentielle Ausfallursache interpretiert<br />
werden. Im <strong>FVA</strong>-Vorhaben 624 wurde<br />
ein Vergleich gängiger Oberflächenbehandlungsverfahren<br />
zur Vermeidung<br />
Bild 1: Versuchskonfiguration –<br />
Rahmenkonzept<br />
von Tribokorrosionsschäden durchgeführt.<br />
Dazu wurden für typische reibschlüssige<br />
und zugleich durch Reibkorrosion<br />
gefährdete Verbindungselemente<br />
mit 2 Prüfstandskonzepten (Bild<br />
1) verschiedene existierende Abhilfemaßnahmen<br />
auf ihre Wirkung hinsichtlich<br />
der Reibdauerfestigkeit sowie der<br />
tribologischen Eigenschaften evaluiert.<br />
Die Reibwertuntersuchungen zur<br />
Ermittlung der zeitlich tribologischen<br />
Veränderung des Systems erfolgten<br />
im Stirnflächenkontakt mit einem standardisierten<br />
Torsionsprüfverfahren.<br />
Die Versuchsergebnisse zeigen, dass<br />
die geprüften Gleitlacke über die komplette<br />
Versuchsdauer schädigungsfreie<br />
Kontaktflächen aufweisen (Bild 2).<br />
Die verwendeten Pasten verhindern<br />
ebenfalls eine Schädigung des Kontaktbereichs,<br />
allerdings nur solange<br />
ein intakter Schmierfilm existiert.<br />
AK Welle-Nabe-Verbindungen<br />
Die geprüften Hartschichten mit großer<br />
Schichtdicke (Molybdän und Chrom<br />
Carbid) weisen zwar einen Oberflächenverschleiß<br />
auf, verhindern aber<br />
eine Schädigung des Substrats. Bei<br />
den Festigkeitsuntersuchungen wurden<br />
Pressverbindungen (PV) im Zeitfestigkeitsbereich<br />
mit einem konstanten<br />
Umlaufbiegemoment belastet. Beschichtungen<br />
bzw. Oberflächenbehandlungen<br />
führten unter gleich bleibender<br />
äußerer Belastung zu unterschiedlich<br />
langen Lebensdauern der<br />
Verbindung in Bezug auf die unbeschichtete<br />
Referenz (Bild 3). Die Versuchsergebnisse<br />
zeigen, dass die<br />
geprüfte Hartschicht Chrom Carbid<br />
sowie die thermochemische Behandlung<br />
mittels Gasnitrieren die Festigkeit<br />
der Welle eminent steigern, die weiche<br />
Phosphatschicht dagegen nur eine<br />
geringe Verbesserung bewirkt.<br />
Bild 2: Kontaktflächen nach dem Versuch mit 50 MPa Fugendruck (oben)<br />
sowie beispielhafte Darstellung der Verschleißtiefe (unten)
Dr.-Ing. Georges Romanos, Henkel AG & Co. KGaA<br />
Obmann des AK Welle-Nabe-Verbindungen 23<br />
Auf Basis der vorliegenden Versuchsergebnisse<br />
wurde ein physikalisch<br />
begründetes Kriterium der akkumulierten<br />
spezifischen Reibarbeit<br />
definiert, welches die Schädigung der<br />
Oberfläche unter verschiedenen<br />
Randbedingungen wie Schlupfamplitude,<br />
Flächenpressung usw. allgemeingültig<br />
beschreibt. Bild 4 zeigt hierzu<br />
den Reibwertverlauf über der akkumulierten<br />
spezifischen Reibarbeit für die<br />
Zink-Beschichtung. Der linear-logarithmische<br />
Anstieg des Reibwertes in den<br />
ausgewiesenen Schädigungsphasen<br />
ist gut zu erkennen. Das anschließende<br />
Abknicken der Anstiegsgeraden<br />
stellt dabei jeweils den Zeitpunkt des<br />
Schädigungsmaximums zwischen der<br />
Zink-Schicht bzw. dem Substrat und<br />
dem Gegenkörper – die stationäre<br />
Phase – dar. Das Grenzkriterium kann<br />
in Abhängigkeit der Kontaktpartner<br />
Gegenwerkstoff / Schicht (relevant<br />
für optische Schädigung) Wfric,krit,opt Gegenwerkstoff / Substrat (relevant<br />
für Festigkeit) Wfric,krit,LC bestimmt werden. Diese Grenzwerte<br />
sollen zukünftig in eine Richtlinie zur<br />
betriebsfesten Auslegung von frettinggefährdeten<br />
Kontaktflächen einfließen.<br />
Für die Verallgemeinerung und Verifizierung<br />
dieses Kriteriums sind weitere<br />
Untersuchungen ausgewählter Beschichtungen<br />
unter Variation der Parameter<br />
(Gegenwerkstoff, Umgebungsmedium,<br />
Umgebungstemperatur,<br />
Oberflächenparameter sowie Belastung)<br />
zwingend notwendig. Dazu ist<br />
ein Fortsetzungsvorhaben geplant.<br />
Die <strong>FVA</strong> kann als starke Gemeinschaft die industrielle<br />
Forschung gezielt im Hinblick auf unmittelbare Bedürfnisse<br />
der Praxis unterstützen und vorantreiben. Ein gutes Beispiel<br />
dafür ist das durch Eigenmittel finanzierte Vorhaben Benchmark<br />
Fretting. Es bildet den Stand der Technik für Abhilfemaßnahmen<br />
gegen Oberflächenschäden durch Mikroschlupf<br />
ab. Die Untersuchungen decken Betriebsverhältnisse eines<br />
weiten Anwendungsbereichs ab, von Wälzlagerringen bis zu<br />
momentübertragenden Querpressverbänden. Der Anwender<br />
erhält belastbare Aussagen über die grundsätzliche Eignung<br />
von Beschichtungen, Wärmebehandlungen oder Montagepasten.<br />
Die Verallgemeinerung des erarbeiteten Bewertungsansatzes<br />
für weitere Parameter auch mit dem Ziel, die<br />
Lebensdauer solcher Maßnahmen unter instationären<br />
Reibbedingungen vorauszusagen, muss in einem mittelfristig<br />
angelegten Anschlussvorhaben verfolgt werden.<br />
Bild 3: Ergebnisse der Zeitfestigkeitsversuche bei Ûb=210 und 350 MPa für ausgewählte<br />
Beschichtungen im Vergleich zur unbeschichteten Referenz für die Kontaktpaarung<br />
16MnCr5E (Nabe) vs. 34CrNiMo6 +QT (Welle, beschichtet)<br />
Bild 4: Maximaler Reibwert je Schwingspiel über der akkumulierten Reibarbeit für<br />
die Kontaktpaarung 16MnCr5E vs. 34CrNiMo6 +QT mit Zink-Beschichtung
24<br />
Gremienarbeit<br />
<strong>FVA</strong>-Gremienarbeit<br />
Der Wissenschaftliche Beirat der <strong>FVA</strong> zu Gast<br />
bei der Siemens AG in Bocholt
Die <strong>FVA</strong> gilt als international führen-<br />
des Innovationsnetzwerk der Antriebstechnik.<br />
Die derzeit 221 Mitgliedsfirmen<br />
sind mit insgesamt 1.700 Mitarbeitern<br />
in den <strong>FVA</strong>-Gremien aktiv. Rund 300<br />
Wissenschaftler aus ca. 50 Instituten,<br />
den besten in ihrem Fachgebiet, führen<br />
gemeinsam laufend über 200 Forschungsprojekte<br />
und Studien durch.<br />
Diese Industrielle Gemeinschaftsforschung<br />
ist vorwettbewerblich, branchenübergreifend<br />
und praxisnah.<br />
Wissenschaftlicher Beirat<br />
Der Wissenschaftliche Beirat setzt<br />
sich zusammen aus den Forschungsund<br />
Entwicklungsleitern bzw. den technischen<br />
Geschäftsführern der <strong>FVA</strong>-<br />
Mitgliedsunternehmen. Das Gremium<br />
bündelt mit seinen derzeit 221 Mitgliedern<br />
das Expertenwissen der gesamten<br />
<strong>FVA</strong>. Die Hauptaufgabe des Wissenschaftlichen<br />
Beirats besteht in der<br />
Priorisierung der Forschungsprojekte.<br />
Die eingebrachten Themenvorschläge<br />
und Forschungsanträge werden nach<br />
übergreifenden Gesichtspunkten ausgewählt.<br />
Die Arbeit dieses Gremiums<br />
gewährleistet, dass die Forschungsarbeit<br />
in der <strong>FVA</strong> anwendungsnah und<br />
auf die Bedürfnisse der Mitgliedsfirmen<br />
ausgerichtet ist. Dr. Toni Weiß,<br />
RENK Aktiengesellschaft, hat den Vorsitz<br />
des Wissenschaftlichen Beirats inne,<br />
Dr. Franz J. Joachim, ZF Friedrichshafen<br />
AG, ist sein Stellvertreter. Der<br />
Wissenschaftliche Beirat hat in seinen<br />
beiden Sitzungen des Jahres <strong>2011</strong><br />
über insgesamt 62 Anträge und 23<br />
Themenvorschläge entschieden.<br />
Arbeitskreise und -gruppen<br />
Die 24 projektbegleitenden Arbeits-<br />
kreise koordinieren die fachliche<br />
Arbeit der <strong>FVA</strong> nach übergeordneten<br />
Themengebieten. Hier kommen in<br />
Frühjahr- und Herbstsitzungen die<br />
Mitarbeiter der <strong>FVA</strong>-Mitgliedsfirmen<br />
mit Vertretern aus der Wissenschaft<br />
regelmäßig zusammen. Darüber<br />
hinaus arbeiten Vertreter aus Industrie<br />
und Forschungsinstituten in rund 150<br />
Arbeitsgruppen zusammen und erarbeiten<br />
Ergebnisse zum Nutzen der gesamten<br />
Branche. Über die Jahrzehnte<br />
hat sich diese Art gemeinsam zu<br />
forschen sehr bewährt. Bei dieser Zusammenarbeit<br />
handelt es sich um eine<br />
Form des kontinuierlichen Kenntnistransfers<br />
auf sehr hohem Niveau.<br />
Arbeitskreise der <strong>FVA</strong><br />
1. Berechnung und Simulation<br />
2. Dichtungstechnik<br />
3. Elektrische Energie-<br />
Speichertechnik<br />
4. Fertigungstechnik<br />
5. Freiläufe<br />
6. Geräusche<br />
7. Geregelte E-Antriebe<br />
8. Gleitlager<br />
9. Innovationsmanagement<br />
10. Kegelräder<br />
11. Kostenmanagement<br />
12. Mechatronik<br />
13. Messtechnik<br />
14. Nichtschaltbare Kupplungen<br />
15. Schaltbare Kupplungen<br />
und Bremsen<br />
16. Schmierstoffe und Tribologie<br />
17. Schneckengetriebe<br />
18. Sensorik für Antriebssysteme<br />
19. Stirnräder<br />
20. Stufenlose Getriebe<br />
21. Synchronisierungen<br />
22. Wälzlager<br />
23. Welle-Nabe-Verbindungen<br />
24. Werkstoffe<br />
25
26<br />
Gremienarbeit<br />
Vorstand<br />
Der Vorstand bestimmt das <strong>FVA</strong>-<br />
Forschungsprogramm unter strategischen<br />
Gesichtspunkten. Wichtige Beurteilungskriterien<br />
sind dabei die fachlichen<br />
Begutachtungen und die finanzielle<br />
Machbarkeit unter Berücksichtigung<br />
des Proporzes der Mitgliederstruktur<br />
und der Schwerpunkte unserer<br />
Forschungspartner. Außerdem bringt<br />
der Vorstand wichtige Aspekte der industriellen<br />
Gemeinschaftsforschung in<br />
den politischen Raum ein und platziert<br />
diese in der Öffentlichkeit. Dr. Michael<br />
Paul, ZF Friedrichshafen AG, ist der gewählte<br />
Vorsitzende des 12-köpfigen <strong>FVA</strong>-<br />
Vorstands. Sein Stellvertreter ist seit der<br />
Mitgliederversammlung 2010 Dr. Christian<br />
Schliephack, Reintjes GmbH.<br />
DER VORSTAND DER <strong>FVA</strong><br />
Dr.-Ing. Michael Paul, ZF Friedrichshafen AG<br />
Vorsitzender des Vorstandes der <strong>FVA</strong><br />
Dr.-Ing. Christian Schliephack, REINTJES GmbH<br />
Stellv. Vorsitzender des Vorstandes der <strong>FVA</strong><br />
Dr.-Ing. Heinz-Peter Ehren, Siemens AG<br />
Dr.-Ing. Arbogast Grunau, Schaeffler KG<br />
Dr.-Ing. Martin Kapp, KAPP GmbH<br />
Dr.-Ing. Lutz Lindemann, Fuchs Europe Schmierstoffe GmbH<br />
Dipl.-Ing. Frank Maier, Lenze SE<br />
Dipl.-Ing. (FH) Kurt Maute, DAIMLER AG<br />
Dr.-Ing. Jörg Plester, VOLKSWAGEN AG<br />
Dr.-Ing. Uwe Tessmann, Heidelberger Druckmaschinen AG<br />
Dr.-Ing. Toni Weiß, RENK Aktiengesellschaft<br />
Dr.-Ing. E.h. Manfred Wittenstein, WITTENSTEIN AG
Im <strong>Geschäftsbericht</strong> 2010 haben<br />
sich Dr. Michael Paul, ZF Friedrichshafen<br />
AG und Dr. Toni Weiß, Renk Aktiengesellschaft<br />
als neue Vorsitzende<br />
des Vorstandes respektive des Wissenschaftlichen<br />
Beirates vorgestellt.<br />
Dieses Jahr setzen zwei weitere Vorstandsmitglieder<br />
die Reihe fort.<br />
Dr. Christian Schliephack, Reintjes<br />
GmbH, vertritt die Antriebstechnik<br />
in Wasserfahrzeugen und ist seit <strong>2011</strong><br />
stellvertretender Vorsitzender des<br />
<strong>FVA</strong>-Vorstandes.<br />
Dr. Frank Maier, Lenze SE, ist seit<br />
<strong>2011</strong> für die mechatronische Antriebstechnik<br />
im <strong>FVA</strong>-Vorstand zuständig.<br />
Im Leben gilt: „Wer nicht weitergeht, fällt zurück.“<br />
Die aktive Mitarbeit in der Industriellen Gemeinschaftsforschung<br />
der <strong>FVA</strong> ist für die Weiterentwicklung der<br />
Antriebstechnik, auch für Anwendungen im maritimen<br />
Bereich, die optimale Basis, um unsere Technologieführerschaft<br />
bezüglich Wirkungsgrad, Zuverlässigkeit<br />
und Langlebigkeit immer weiter auszubauen.<br />
VITA Dr.-Ing. Christian Schliephack<br />
Geb. 1951 in Hamburg, studierte Schiffsmaschinenbau an der Techn.<br />
Universität Hannover und arbeitete als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am<br />
Institut für Wärmekraftanlagen und Schiffsmaschinen an der Techn.<br />
Universität Hamburg-Harburg. Im Anschluss an die Promotion erfolgte<br />
eine mehrjährige Berufstätigkeit bei Blohm & Voss in Hamburg, 1991<br />
Wechsel zur Renk AG, wo er 2003 die Leitung des Renk-Werkes Rheine<br />
übernahm. Seit 2006 ist er Geschäftsführer des Schiffsgetriebeherstellers<br />
REINTJES in Hameln. Er war von 1991 bis 2003 Leiter des <strong>FVA</strong> Arbeitskreises<br />
Gleitlager. Seit 2007 ist er Mitglied des Vorstandes der <strong>FVA</strong>.<br />
VITA Dipl.-Ing. Frank Maier<br />
Die Zukunft des deutschen Maschinenbaus beruht<br />
auf seiner Innovationskraft. Innovation aber entsteht<br />
maßgeblich durch die Vernetzung von Ideenträgern.<br />
Die <strong>FVA</strong> ist die führende Plattform, in der Industrie<br />
und Wissenschaft Ideen einbringen und gemeinsam<br />
verwirklichen, um die mechatronische Integration der<br />
Antriebstechnik vorantreiben.<br />
Seit Oktober 2009 ist Frank Maier Mitglied des Vorstands<br />
der Lenze SE. Der 47-Jährige ist seit 2005 beim Spezialisten für<br />
Antriebs- und Automatisierungstechnik und war zuletzt Geschäftsführer<br />
der Lenze Automation GmbH. Im Vorstand verantwortet er u.a.<br />
die Bereiche Forschung & Entwicklung, Innovation und Prozesse.<br />
Frank Maier ist verheiratet und hat eine Tochter.<br />
Seit 1.1.<strong>2011</strong> ist er Mitglied des <strong>FVA</strong>-Vorstandes.<br />
27
28<br />
Kenntnistransfer und Weiterbildung<br />
Kenntnistransfer und Weiterbildung
Die <strong>FVA</strong> betreibt seit mehr als<br />
vierzig Jahren Industrielle Gemeinschaftsforschung<br />
(IGF). Die Stärke<br />
der IGF liegt im engen Zusammenwirken<br />
von Praxis erfahrenen Industrievertretern<br />
und wissenschaftlichen<br />
Mitarbeitern der Forschungsinstitute.<br />
Die aktive Begleitung der Forschungsprojekte<br />
seitens der <strong>FVA</strong>-Mitglieder<br />
gewährleistet einen intensiven Austausch<br />
zwischen Industrie und Wissenschaft<br />
und bietet die erste und<br />
wichtigste Basis für einen schnellen<br />
Kenntnistransfer in die Mitgliedsfirmen.<br />
Die auf diese Weise stattfindende<br />
kontinuierliche Weiterbildung der<br />
Mitarbeiter bildet die Innovationsbasis<br />
für die firmenspezifischen Produktentwicklungen<br />
unserer Mitglieder. Derzeit<br />
arbeiten ca. 1700 Industrieexperten<br />
in den verschiedenen <strong>FVA</strong>-Gremien<br />
(s. Kapitel zur <strong>FVA</strong>-Gremienarbeit).<br />
Darüber hinaus bietet die <strong>FVA</strong> gezielte<br />
Weiterbildungsangebote wie Seminare,<br />
Anwendungsschulungen und<br />
Kongresse an. Diese bündeln jeweils<br />
aktuelle Forschungsergebnisse mit<br />
Vorträgen von Industrieexperten.<br />
Im Zuge eines Technologietransfers<br />
„der kürzesten Wege“ ist in den<br />
letzten Jahren ein weiteres Element<br />
hinzugekommen: Die Entwicklung<br />
einer integrierten Plattform von Softwaretools<br />
zur Berechnung von antriebstechnischen<br />
Elementen anhand<br />
der <strong>FVA</strong>-Workbench (s. Kapitel zum<br />
<strong>FVA</strong>-SoftwareService). Für Hersteller<br />
antriebstechnischer Produkte eröffnet<br />
die deutliche Erhöhung der Transfergeschwindigkeit<br />
durch Software-<br />
lösungen eine große Chance. Schneller<br />
Technologietransfer aus der Wissenschaft<br />
in die Firmen bereitet schnelleren<br />
Innovationszyklen den Weg.<br />
Diese wiederum unterstützen die<br />
<strong>FVA</strong>-Mitglieder darin, im internationalen<br />
Wettbewerb zu bestehen. Außerdem<br />
besteht über ein online basiertes<br />
Forschungsinformationssystem für<br />
alle Mitarbeiter der <strong>FVA</strong>-Mitgliedsfirmen<br />
jederzeit Zugriff auf sämtliche<br />
Forschungsergebnisse und alle<br />
laufenden Projekte.<br />
<strong>FVA</strong>-Seminare<br />
Der Bedarf an Weiterbildungsangeboten<br />
für Techniker und Ingenieure<br />
steigt stetig. Das Innovationsnetzwerk<br />
der <strong>FVA</strong> bietet die Chance für die gewünschten<br />
Themen die erfahrensten<br />
Trainer aus Industrie und Wissenschaft<br />
zu gewinnen. Dies bildet die Basis für<br />
die außerordentliche Qualität der Seminare<br />
und Anwendungsschulungen.<br />
Im Bereich der Seminare wurden<br />
folgende Themenfelder besonders<br />
nachgefragt:<br />
Verzahnungstechnologie<br />
für Stirnräder<br />
Grundlagen der Dichtungstechnik<br />
Zahnradschäden und deren<br />
Einflussgrößen<br />
Von hohem Interesse für die<br />
Mitarbeiter der <strong>FVA</strong>-Mitglieder sind<br />
die Anwendungsschulungen zur <strong>FVA</strong>-<br />
Workbench und zu den einzelnen<br />
Softwaretools, wie beispielsweise:<br />
Getriebeauslegung<br />
Geometrie und Tragfähigkeit<br />
von Stirnrädern<br />
Kegelräder und konische<br />
Verzahnungen<br />
Planeten- und Umlaufgetriebe<br />
29
30<br />
Kenntnistransfer und Weiterbildung<br />
<strong>FVA</strong>-Kongresse<br />
Mit ihren Kongressangeboten wendet sich die <strong>FVA</strong> seit fünf Jahren bewusst<br />
auch über die eigenen Mitglieder hinaus an die gesamte Branche der Antriebstechnik.<br />
Auf diese Weise hat sich die <strong>FVA</strong> als einzigartige Kommunikationsund<br />
Vernetzungsplattform für den Bereich Antriebstechnik etabliert. Die Kongress<br />
begleitenden Fachausstellungen werden für Firmenpräsentationen gerne wahrgenommen.<br />
Im Berichtszeitraum ist erstmals der Kongress für Schmierstoffe<br />
und Tribologie GETLUB hinzugekommen.<br />
Kongress für Schmierstoffe und Tribologie<br />
www.getlub.de<br />
Mehr als 130 Entwickler aus 60 Unternehmen und rund 10 Forschungsinstituten<br />
vertieften am 15./16. Dezember 2010 ihr Fachwissen über Schmierstoffe beim<br />
ersten GETLUB-Kongress in Würzburg. Das Thema „Der Schmierstoff als Konstruktionselement“<br />
brachte Konstrukteure, Anwender und Hersteller zusammen, um sich über die Optimierung von<br />
geschmierten Systemen auszutauschen. Dr. Lutz Lindemann, Mitglied des Vorstands der Fuchs<br />
Petrolub AG und Vertreter der Schmierstoffindustrie im <strong>FVA</strong>-Vorstand, eröffnete als Hauptredner<br />
den ersten GETLUB-Kongress. Sein Eindruck: „Nirgendwo sonst ist an einem Ort so viel<br />
Fachkompetenz in Sachen Getriebe vereint.“<br />
Der nächste GETLUB-Kongress findet am 28./29. März 2012 in Würzburg statt<br />
3. Kongress zur Getriebeproduktion<br />
www.getpro.de<br />
Über 300 Spezialisten aus der Getriebeentwicklung trafen sich am 29./30. März<br />
<strong>2011</strong> in Würzburg zum dritten GETPRO-Kongress. Für die Teilnehmer war es ein<br />
Branchentreff besonderer Art. Entwickler aus 150 Industriebetrieben und Forschungseinrichtungen<br />
bauten ihre Branchenkontakte aus und profitierten von den rund 40 Fachvorträgen rund um die<br />
integrierte Welt der Zahnradgetriebe mitsamt ihrer Komponenten. 25 Firmen präsentierten sich in<br />
der Kongress begleitenden Ausstellung vor Ort:<br />
„Als Aussteller beim GETPRO-Kongress hat man die einzigartige Gelegenheit,<br />
intensiv in den Austausch mit den Nutzern und potenziellen Anwendern unserer Produkte<br />
einzusteigen“, unterstreicht Dominik Dapprich, Stresstech GmbH. „Eine so hohe Dichte<br />
an richtigen Ansprechpartnern gibt es sonst nirgends.“
4. Expertenforum Elektrische Fahrzeugantriebe<br />
www.e-motive.net<br />
Das seit 2008 jährlich stattfindende E-MOTIVE Expertenforum Elektrische Fahrzeugantriebe<br />
ist eine Technologietransfer-Plattform, die darauf abzielt, aus dem Hype-Thema<br />
Elektromobilität Wirklichkeit zu machen. 260 Teilnehmer aus mehr als 110 Unternehmen und 24<br />
Forschungsinstituten kamen zum 4. E-MOTIVE Expertenforum am 7./8. September <strong>2011</strong> in der Hochschulstadt<br />
Aachen zusammen. Impulse für den Branchenaustausch boten die vierzig Vorträge zu<br />
E-Fahrzeugkonzepten und zur Großserienfertigung von Komponenten von Elektroantrieben, die sich<br />
unter anderem aus den E-MOTIVE-Forschungsprojekten der <strong>FVA</strong> speisten. Der Fokus der E-MOTIVE-<br />
Forschung liegt in den Bereichen der elektrischen, mechanischen und mechatronischen Antriebstechnik.<br />
„Der Maschinen- und Anlagenbau ist Impulsgeber bei der Entwicklung von elektromobilen Innovationen,<br />
z. B. durch die industrielle Gemeinschaftsforschung der Forschungsvereinigungen“, unterstreicht<br />
Dr. Michael Paul, Mitglied des Vorstands der ZF Friedrichshafen AG und <strong>FVA</strong>-Vorstandsvorsitzender.<br />
www.simpep.de<br />
3. Kongress für Simulation<br />
im Produktentstehungsprozess<br />
Entwickler und Entscheidungsträger aus 40 Unternehmen und 20 Forschungsinstituten<br />
reflektierten beim dritten SIMPEP-Kongress am 29./30. September <strong>2011</strong> in<br />
Veitshöchheim die Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten der multiphysikalischen Berechnungs-<br />
und Simulationssoftware. 40 Vorträge boten den 90 Teilnehmern wichtige Impulse zum Thema<br />
Simulation im Produktentstehungsprozess. Dr. Thomas Berger, Leiter Vorentwicklung Längsgetriebe<br />
bei BMW, stellte zum Beispiel die Simulation in der Antriebsentwicklung bei BMW vor. Aus seiner<br />
Sicht brachte der SIMPEP-Kongress den Mehrwert, „dass sich hier Experten unterschiedlichster<br />
Simulationsdisziplinen treffen und Simulationswerkzeuge produkt- und domainübergreifend im Fokus<br />
stehen.“ Die Teilnahme diente den Anwesenden dazu, Trends und Entwicklungen frühzeitig zu erkennen<br />
und Netzwerkkontakte auszubauen. So spielte z. B. auch im Produktentstehungsprozess neuer Mobilitätstechnologien,<br />
wie z. B. elektrischer Antriebe für E-Autos, Simulation eine zentrale Rolle.<br />
31
32<br />
Kenntnistransfer und Weiterbildung<br />
<strong>FVA</strong>-Informationstagung<br />
2010 kamen über 530 Teilnehmer<br />
aus Industrie und Forschung zur <strong>FVA</strong>-<br />
Informationstagung. Diese jährlich stattfindende<br />
Wissenschaftstagung der<br />
Antriebstechnik-Branche ist der Höhepunkt<br />
des <strong>FVA</strong>-Jahres.<br />
Das hochqualifizierte Publikum<br />
schätzt an der <strong>FVA</strong>-Informationstagung<br />
insbesondere die Vielfalt exklusiver<br />
Forschungsergebnisse. Seit 2010 findet<br />
das Programm der Tagung in<br />
parallelen Sessions statt. Auch <strong>2011</strong><br />
präsentieren 30 Forschungsinstitute<br />
an den beiden Kongresstagen in ca.<br />
40 Vorträgen aus den <strong>FVA</strong>-Projekten.<br />
Ein weiterer Schwerpunkt neben der<br />
klassischen Antriebstechnik liegt auf<br />
den elektrischen Antrieben.<br />
Fachausstellung<br />
Seit zehn Jahren wird die <strong>FVA</strong>-<br />
Informationstagung durch eine begleitende<br />
Fachausstellung ergänzt.<br />
Rund 25 Aussteller schätzen die hohe<br />
Qualität der Fachkontakte, die dieser<br />
Kongress bietet. Neben Kunden- und<br />
Lieferantenkontakten ist insbesondere<br />
der direkte Kontakt zu praxisnah ausgebildeten<br />
Nachwuchsingenieuren für<br />
die ausstellenden Firmen wichtig.<br />
Plattform für Vernetzung<br />
Viele Mitglieder kommen zur <strong>FVA</strong>-<br />
Informationstagung, um neue Kontakte<br />
zu knüpfen und bestehende zu vertiefen.<br />
„Für mich ist dies der Branchentreff<br />
überhaupt. Über die aktuellen<br />
Forschungsergbnisse hinaus ersparen<br />
mir die zwei Tage hier ca. zehn<br />
Dienstreisen“, so ein Teilnehmer der<br />
<strong>FVA</strong>-Informationstagung 2010.<br />
Für Neumitglieder bieten die beiden<br />
Kongresstage ein sehr gutes Umfeld,<br />
um sich in das <strong>FVA</strong>-Netzwerk zu<br />
integrieren und sich einen Überblick<br />
über die Breite der Angebote zu<br />
verschaffen.<br />
Software-Beratung<br />
So stellt z. B. der <strong>FVA</strong>-Software-<br />
Service im Rahmen der Veranstaltung<br />
die <strong>FVA</strong>-Workbench und einzelne Softwaretools<br />
vor. An den Ständen stehen<br />
die Software-Entwickler den Teilnehmern<br />
für Einzelgespräche zur Verfügung.<br />
Lösungen für auftretende Fragestellungen<br />
sind so schnell erarbeitet.
Hans Winter Preis<br />
Herr Dipl.-Ing. Colin Kern ist der Preisträger des<br />
Hans Winter Preis <strong>2011</strong>, den die Forschungsvereinigung<br />
Antriebstechnik e.V. alljährlich verleiht.<br />
Im Anschluss an das Studium des Maschinenbaus<br />
an der TU Chemnitz untersuchte Herr Kern<br />
als Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Institutes<br />
für Konstruktions- und Antriebstechnik (IKAT)<br />
unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Erhard Leidich<br />
die Entwicklung experimentell abgesicherter Auslegungswerkzeuge<br />
für thermisch und mechanisch hochbelastete, kunststoffbeschichtete<br />
Mehrflächen- und Radialkippsegmentlager (<strong>FVA</strong> 314 II-III). Die Vorgehensweise<br />
und Ergebnisse zu diesen Vorhaben sind in den Abschlussberichten<br />
dargestellt und bilden die Grundlage seiner Dissertationsschrift<br />
„Betriebsverhalten von thermisch und mechanisch hoch<br />
beanspruchten kunststoffbeschichteten Radial-Mehrflächengleitlagern“<br />
(TU Chemnitz, <strong>2011</strong>).<br />
<strong>FVA</strong>-Wissenschaftspreis<br />
Alljährlich vergibt die <strong>FVA</strong> seit dem Jahr 2000 bei ihrer Informationstagung<br />
den Hans Winter Preis. Er ist mit 3.000 Euro dotiert.<br />
Der Preisverleihung zugrundegelegt ist die Bewertung der vorgestellten<br />
<strong>FVA</strong>-Projekte durch das Fachpublikum der Tagung.<br />
Bewertet werden:<br />
Wissenschaftlicher Gehalt (Erkenntniserweiterung)<br />
Nutzbarkeit der Ergebnisse für die Praxis (Praxisbezug)<br />
Vorbereitung und Darstellung (Vortrag und Manuskript)<br />
Auf der Informationstagung 2010 erhielt der Vortrag zum Forschungsvorhaben<br />
„Mehrflächengleitlager“ die beste Note.<br />
Prämiertes Vorhaben:<br />
Mehrflächengleitlager<br />
Die betriebssichere Auslegung von<br />
Mehrflächengleitlagern erfordert die<br />
zuverlässige Vorhersage kritischer<br />
Lagerkennwerte und des Betriebsverhaltens.<br />
Die Zielstellung der Vorhaben<br />
314/II und III bestand im Nachweis<br />
der technischen Umsetzbarkeit der<br />
Substitution des etablierten Weißmetalls<br />
als Laufschicht durch neuartige<br />
Kunststoffschichten möglichst im<br />
gesamten bisherigen Betriebsbereich.<br />
Mittels aufwändiger tribologischer<br />
Tests wurden drei Kunststoffen<br />
vorausgewählt. Das Referenzmaterial<br />
bildete eine Zinnbasislegierung. Die<br />
Applikation der Schichtvarianten erfolgte<br />
für die Bauteilversuche in Mehrflächengleitlagern<br />
verschiedener Bohrungsformen.<br />
Diese Prüflager wurden<br />
einem vergleichenden Standardversuchsprogramm<br />
unterzogen. Die darin<br />
enthaltenen Versuchsschritte reichten<br />
von der Ermittlung statischer Lagerkennwerte<br />
über Dauer- und Mischreibungsversuche<br />
bis hin zur Bestimmung<br />
des Notlaufverhaltens. In Vorbereitung<br />
des Versuchsprogrammes<br />
wurde ein am IKAT TU Chemnitz vorhandener<br />
Turbinenlagerprüfstand neu<br />
konditioniert, so dass z. B. Messungen<br />
von Schmierfilmdruck und Wel-<br />
lenverlagerung durchgeführt werden<br />
konnten. Als Ergebnis wird festgehalten,<br />
dass mit allen Versuchen signifikante<br />
Unterschiede in den Lagerkennwerten<br />
und im Betriebsverhalten<br />
ermittelt werden konnten. Die an den<br />
kunststoffbeschichteten Lagern abweichenden<br />
Lagerkennwerte sind mit<br />
einer Vielzahl von kausalen Zusammenhängen<br />
erklärbar. Zu den schichtdickenabhängigen<br />
Haupteinflüssen<br />
gehören die wärmeisolierende Wirkung<br />
und besonders die Nachgiebigkeit<br />
der Kunststofflaufschicht, die ein<br />
elastohydrodynamisches Verhalten<br />
bereits bei kleineren Sommerfeldzahlen<br />
bewirken kann. Ferner wirken sich<br />
oberflächenabhängige Faktoren wie<br />
Welligkeit und Rauheit der Lauffläche<br />
und ein verändertes Benetzungverhalten<br />
von Kunststoffen auf die Eigenschaften<br />
aus. Die Versuchsreihen haben<br />
durchweg positive Beurteilungen<br />
der Lagerkennwerte im untersuchten<br />
Betriebsbereich der neuen Lagervarianten<br />
ergeben. Die neuartigen Laufschichtvarianten<br />
erfüllten die hohen<br />
tribologischen und thermischen Anforderungen.<br />
Einzelne Abweichungen<br />
der ermittelten Kennwerte können im<br />
Zusammenhang mit bereits verfügbaren<br />
physikalischen Modellen (z. B.<br />
EHD) beschrieben und rechnerisch<br />
nachvollzogen (Kopplung FEM-<br />
ALP3T) werden.<br />
Für die Überführung der Ergebnisse<br />
in die Serienproduktion ist es entscheidend,<br />
die Technologie der<br />
Schichtaufbringung und der erforderlichen<br />
Schichthöhe speziell für Gleitlageranwendungen<br />
zu optimieren.<br />
33
34<br />
E-MOTIVE Initiative<br />
E-MOTIVE:<br />
Forschung zur elektrischen Antriebstechnik<br />
E-MOTIVE Forschung<br />
Die ersten E-MOTIVE Forschungs-<br />
projekte zum Thema Elektro- und Hybridfahrzeuge<br />
im Rahmen des CO2-<br />
Emissionsforschungsprogramms und<br />
der Konjunkturförderung liefen im<br />
September <strong>2011</strong> aus. Auf vorrangig<br />
themengebündelten projektbegleitenden<br />
Ausschusssitzungen fanden die<br />
entsprechenden Abschlusstagungen<br />
statt, und neun Projektergebnisse werden<br />
im Paket auf der <strong>FVA</strong>-Informationstagung<br />
am 24. November <strong>2011</strong> in<br />
Würzburg vorgestellt. Der Projektcluster<br />
E-Antrieb.NET zur Entwicklungsund<br />
Produktionsumgebung für elektrische<br />
Antriebsstränge befindet sich seit<br />
1. Oktober 2010 in der Projektphase I,<br />
mit Laufzeitende am 30. September<br />
2012. Eine weitere zweijährige Projektphase<br />
soll sich anschließend besonders<br />
der Entwicklung von Herstellprozessen<br />
widmen. Die aktuelle Gesamtübersicht<br />
mit Angaben zu geplanten Nachfolgeprojekten<br />
ist im Anhang unter „Forschungsprojekte<br />
im Bereich E-MOTIVE“<br />
beigefügt.<br />
E-MOTIVE Board<br />
Anfang September richtete die<br />
<strong>FVA</strong> gemeinsam mit der ForschungsvereinigungVerbrennungskraftmaschinen<br />
(FVV) das E-MOTIVE Board ein.<br />
Die Boardmitglieder sind hochrangige<br />
Fachvertreter der Mitgliedsunternehmen.<br />
Das Gremium soll neue Projekte<br />
zur Elektrifizierung des Antriebsstrangs<br />
mit initiieren, bewerten und<br />
resultierende Empfehlungen an den<br />
Wissenschaftlichen Beirat der jeweiligen<br />
Forschungsvereinigung weiter-
Dr. Walter Begemann, Projektleiter E-MOTIVE<br />
leiten. Da viele Boardmitglieder auch<br />
in der Nationalen Plattform Elektromobilität<br />
(NPE) aktiv sind, können die<br />
NPE-Arbeitsgruppenergebnisse zielgerichtet<br />
in die Arbeit von E-MOTIVE<br />
einfließen. Erfreulich sind in diesem<br />
Zusammenhang Ankündigungen aus<br />
dem Bundesministerium für Wirtschaft<br />
und Technologie (BMWi), die Industrielle<br />
Gemeinschaftsforschung in den<br />
kommenden Jahren gegebenenfalls<br />
für Förderprojekte zur Elektromobilität<br />
aufzustocken. <strong>FVA</strong> und FVV könnten<br />
als die aktivsten Forschungsvereini-<br />
E-MOTIVE hat durch Gemeinschaftsforschung,<br />
Fachtagungen und Messeauftritte rasch hohe Anerkennung<br />
in Industrie, Forschung und Politik erlangt. Mit dem Forum<br />
E-MOTIVE im VDMA wird die erarbeitete Basis insbesondere<br />
zu wichtigen Fragen der Produktionstechnik über Aktivitäten<br />
beteiligter Fachverbände hervorragend erweitert.<br />
gungen auf dem Gebiet davon langfristig<br />
profitieren.<br />
4. E-MOTIVE Expertenforum<br />
Die Produktionstechnik im Bereich<br />
Batterie und E-Maschine war einer der<br />
Schwerpunkte des Expertenforums<br />
Elektrische Fahrzeugantriebe am 7./8.<br />
September in Aachen. Im Mittelpunkt<br />
der diesjährigen Tagung standen<br />
sich abzeichnende Wege zur Serienfertigung.<br />
Die Themen betrafen Werkstoffentwicklungen,<br />
die Fertigungs-<br />
technik sowie Komponentenentwicklungen<br />
und Fahrzeugkonzepte mit übergeordneten<br />
Systemanforderungen.<br />
In mehr als 40 Vorträgen und Diskussionen<br />
tauschten sich 260 Akteure der<br />
Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsbereiche<br />
aus Automobil- und<br />
Zulieferindustrie, Maschinenbau sowie<br />
Elektrotechnik aus. Eine begleitende<br />
Fachausstellung und Testfahrten mit<br />
Elektrofahrzeugen rundeten das vielfältige<br />
Programm ab. Am 12./13. September<br />
2012 findet das 5. E-MOTIVE<br />
Expertenforum in Stuttgart statt.<br />
35
36<br />
E-MOTIVE Initiative<br />
Forum E-MOTIVE im VDMA:<br />
gebündelte Kompetenz<br />
Messeaktivitäten Polit. Interessenvertretung<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
NPE, Verbände, Wissenschaft<br />
Gemeinschaftsforschung Produkttechnologie<br />
VDMA Forum für Elektromobilität<br />
VDMA-Foren VDMA<br />
VDMA-<br />
Fachverbände und Landesverbände<br />
Arbeitsgemeinschaften
Bernhard Hagemann, Leiter Forum E-MOTIVE<br />
Studie Elektromobilität<br />
Um die Geschäftsperspektiven<br />
und Herausforderungen für den Maschinen-<br />
und Anlagenbau auszuloten,<br />
war zu Jahresbeginn bereits die<br />
gemeinsame Studie von VDMA und<br />
Strategieberatung Roland Berger<br />
„E-Mobility – Chancen und Risiken für<br />
den deutschen Maschinen- und Anlagenbau“<br />
initiiert und auf dem VDMA-<br />
Kongress Intelligenter Produzieren im<br />
Mai vorgestellt worden. So wird sich<br />
zum Beispiel bei den Anlagen zur Batteriezellenproduktion<br />
ein beträchtlicher<br />
neuer Markt entwickeln von bis<br />
zu 4,8 Mrd. Euro im Jahr 2020, den<br />
deutsche Unternehmen erschließen<br />
können. Der Maschinenbau wird<br />
künftig erheblich dazu beitragen, Fertigungstechnologien<br />
für Elektromotoren<br />
und Batterien zu optimieren, um<br />
Kosten zu senken und hohe Qualitätsstandards<br />
zu erreichen. Die Studie ist<br />
als Download über die <strong>FVA</strong>-Homepage<br />
unter E-MOTIVE verfügbar.<br />
Das Forum E-MOTIVE im VDMA verfolgt das Grundkonzept,<br />
Synergien branchenübergreifend nutzbar<br />
zu machen. Es befasst sich intensiv mit der Entwicklung<br />
von Komponenten für E-Fahrzeuge, der dazu erforderlichen<br />
Produktionstechnik und auch mit den Kompetenzen<br />
des Maschinenbaus, die Lösungsansätze zur Infrastruktur<br />
für die Elektromobilität bieten.<br />
Veranstaltungen des Forum<br />
E-MOTIVE<br />
Die bisherigen E-MOTIVE Aktivitäten der<br />
Forschungsvereinigungen <strong>FVA</strong> und FVV<br />
wurden im Frühjahr <strong>2011</strong> gemeinsam mit<br />
den themennah agierenden Fachverbänden<br />
im VDMA zum Forum E-MOTIVE<br />
im VDMA erweitert. Damit soll u. a. verstärkt<br />
die Produktionstechnik zur Elektromobilität<br />
mit Veranstaltungen und Arbeitskreisen<br />
befördert werden. Den Auftakt<br />
gab im März die <strong>FVA</strong>-Tagung „Produktionstechnik<br />
für die Elektromobilität“<br />
mit 120 Teilnehmern. Eine entsprechend<br />
hohe Beteiligung hatte der Infotag „Elektromobilität<br />
und die Montage- und Handhabungstechnik“<br />
im Mai. Ende September<br />
unterstützte die <strong>FVA</strong> als Partner die<br />
erste internationale Konferenz „Electric<br />
Drives Production“ in Nürnberg. Schließlich<br />
fand im Oktober eine E-MOTIVE Veranstaltung<br />
zur Batterieproduktion mit<br />
Gründung eines VDMA-Industriearbeitskreises<br />
statt. Am 29.11.<strong>2011</strong> findet eine<br />
gemeinsam mit der Deutschen Kommission<br />
Elektrotechnik veranstaltete Fachtagung<br />
„Infrastruktur Elektromobilität –<br />
Ein neues Geschäftsfeld für den Maschinen-<br />
und Anlagenbau“ statt.<br />
Internationale Leitmesse<br />
MobiliTec<br />
<strong>FVA</strong> und VDMA waren als ideelle<br />
Träger der Leitmesse MobiliTec auch<br />
<strong>2011</strong> wieder mit einem E-MOTIVE Gemeinschaftsstand<br />
auf der HANNOVER<br />
MESSE vertreten. Hersteller von Fahrzeugen<br />
und mobilen Maschinen, Unternehmen<br />
der Zulieferindustrie, dem<br />
Maschinen- und Anlagenbau sowie<br />
der Elektrotechnik präsentierten zukunftsweisende<br />
Mobilitätstechnologien.<br />
Auf dem direkt angeschlossenen Anwenderforum<br />
stellte die Industrie ihre<br />
Entwicklungen über Vorträge messebegleitend<br />
vor.<br />
Mehr als 46.000 Personen mit<br />
einem Fachbesucheranteil von über<br />
90% besuchten die MobiliTec. Entsprechend<br />
waren die am E-MOTIVE<br />
Gemeinschaftsstand beteiligten Firmen<br />
mit den Kontakten und dem Ausstellungsumfeld<br />
sehr zufrieden und<br />
planen auch vom 23.-27. April 2012<br />
wieder dabei zu sein. Ausstellerinformationen<br />
zur MobiliTec 2012 finden<br />
sich auf der <strong>FVA</strong>-Homepage unter<br />
E-MOTIVE (www.e-motive.net).<br />
37
38<br />
Windkraft in der Antriebstechnik<br />
Windkraft in der Antriebstechnik<br />
VDMA Arbeitsgemeinschaft<br />
Windenergie-Zulieferindustrie<br />
(AG WIZU)<br />
Da der VDMA die gesamte Wertschöpfungskette<br />
der Windenergieindustrie<br />
abbildet, wurde für die Zulieferunternehmen<br />
der Windindustrie die<br />
VDMA Arbeitsgemeinschaft Windenergie-Zulieferindustrie<br />
(AG WIZU) gegründet.<br />
Sie hat derzeit über 90 Mitglieder<br />
und ist in verschiedene Arbeitskreise,<br />
wie Marktbeobachtung, Antriebstechnik<br />
für Windenergieanlagen<br />
(ANT-WEA), Off-Shore, Messekonzeption/Öffentlichkeitsarbeit<br />
untergliedert.<br />
Arbeitskreis Antriebstechnik<br />
für Windenergieanlagen<br />
(ANT-WEA)<br />
Unter dem Vorsitz von Dr. Frank D.<br />
Krull, Eickhoff Antriebstechnik, wurde<br />
dieser Arbeitskreis im April 2010 reaktiviert<br />
und neu ausgerichtet. An der Sitzung<br />
nahmen 50 Vertreter von Komponentenlieferanten<br />
für die Windenergie<br />
teil. Neben Informationen aus den Bereichen<br />
nationaler/internationaler Normung,<br />
Forschung und Öffentlichkeitsarbeit<br />
haben sich zwei Schwerpunktthemen<br />
herausgebildet, die in separaten Arbeitskreisen<br />
behandelt werden.
<strong>FVA</strong>-Forschungsvorhaben<br />
mit Bezug zur Windindustrie<br />
In der <strong>FVA</strong> werden zu wichtigen<br />
Komponenten des Antriebsstranges<br />
wie Getriebe, Zahnräder, Wälzlager,<br />
Wellen, Öl, usw. Forschungsvorhaben<br />
initiiert. Aktuell sind hier aus<br />
den Arbeitskreisen Berechnung und<br />
Simulation, Meßtechnik, Schmierstoffe<br />
und Tribologie, Wälzlager und<br />
Welle-Nabe-Verbindung folgende<br />
laufenden und geplanten Vorhaben<br />
beispielhaft zu nennen:<br />
Arbeitskreis Planetenträger<br />
Im Arbeitskreis Planetenträger<br />
wird eine Richtlinie für den Festigkeitsnachweis<br />
von Planetenträgern<br />
für Windkraftgetriebe aus sprödem<br />
Gusseisen (GJS700) erarbeitet.<br />
Ziel ist eine allgemeingültige Richtlinie,<br />
die auch von Zertifizierungsgesellschaften<br />
anerkannt wird.<br />
Arbeitskreis Cold Climate<br />
Version (CCV)<br />
Ziel ist ein VDMA-Einheitsblatt zu<br />
erarbeiten, das die unterschiedlichen<br />
Anforderungen aus Spezifikationen<br />
und von Zertifizierungsstellen an<br />
Windenergieanlagen im Einsatz bei<br />
extrem kalten Temperaturen (-40 °C)<br />
zusammenfasst und vereinheitlicht.<br />
Von den Anlagen- und Komponentenherstellern<br />
sowie Zertifizierern sind<br />
Themenfelder abgesteckt und inhaltli-<br />
T1011 "Ermittlung der Betriebszustände und damit den Belastungen,<br />
die auf Getriebe von Windkraftanlagen wirken" (BuS)<br />
T1198 "Entwicklung eines Verfahrens zur betriebsfesten Auslegung von<br />
Planetenträgern aus sprödem GJS 700" (BuS)<br />
541/II "Berücksichtigung von Teillasten bei der Berechnung der Wälzlager-<br />
Lebensdauer insbesondere für Windkraftgetriebe" (WL/BuS)<br />
645/I "Untersuchung der Messunsicherheiten bei der mobilen Lasermessung"<br />
(MT)<br />
643 "Entwicklung einer <strong>FVA</strong>-Prüfmethode zur Beurteilung von Ölen für<br />
Getriebe im Hinblick auf Ermündung von Wälzlagern" (ST)<br />
431/II "Einfluss von Stillstandszeiten in feuchter Umgebung und Schmierfettzusammensetzung<br />
auf die Gebrauchsdauer von Wälzlagern" (ST)<br />
627/I "Einfluss von instationären Betriebszuständen zur Graufleckenbildung<br />
in Wälzlagern" (ST)<br />
502/II "Einfluss der gebrauchsbedingten Veränderungen auf die Filtrierbarkeit<br />
hochviskoser Getriebeöle" (ST)<br />
482/III "Graufleckentragfähigkeit einsatzgehärteter Stirnräder bei kleinen<br />
Umfangsgeschwindigkeiten" (ST)<br />
488/II "Einfluss unterschiedlicher Wassergehalte in Ölen auf die<br />
Ermüdungslebensdauer von Wälzlagern und die Grübchentragfähigkeit<br />
einsatzgehärteter Stirnräder" (ST)<br />
504/II "Wälzlagerermüdung bei Mischreibung in Abhängigkeit vom<br />
Schmierstoff" (ST)<br />
589/I "Bewertung von Schwingungsanregung hinsichtlich möglicher<br />
Schädigung an Wälzlagern unter Einbeziehung der Umgebungskonstruktion"<br />
(WL)<br />
T1197 "Berechnung von großen Wellen oder wellenartigen Bauteilen<br />
(nach DIN 743) unter Verwendung des Konzeptes der örtlichen Spannung"<br />
(WNV)<br />
Abgeschlossen ist das Vorhaben aus dem Arbeitskreis Innovationsmanagement:<br />
656 "Handlungsempfehlungen für die deutschen Komponenten- und<br />
Systemlieferanten für Windenergieanlagen in der VR China"<br />
che Schwerpunkte entwickelt worden,<br />
die in folgenden Arbeitsgruppen behandelt<br />
werden: CCV1 – Öl, Hydraulik,<br />
CCV2 – Sensorik, Elektronik, Kabel,<br />
Generatoren, CCV3 – Hauptlager,<br />
Drehverbindungen, CCV4 – Getriebe,<br />
Zahnräder, CCV5 – Bremsen, Kupplungen,<br />
CCV6 – Anlagenhersteller,<br />
CCV7 – Strukturkomponenten und die<br />
Ad-Hoc-Arbeitsgruppe "Ölfragen".<br />
39
40<br />
<strong>FVA</strong>-SoftwareService<br />
<strong>FVA</strong>-SoftwareService<br />
<strong>FVA</strong>-Workbench fördert den technologischen<br />
Vorsprung der Branche<br />
Das Ziel der Forschungsvereinigung<br />
Antriebstechnik (<strong>FVA</strong>) ist, dass die<br />
Ergebnisse aus der Gemeinschaftsforschung<br />
schnell in die Produktentwicklung<br />
einfließen. Besonders im Zeitalter<br />
der Informationstechnologie stellen<br />
digital zur Verfügung gestellte Forschungsergebnisse<br />
einen unschätzbaren<br />
Wert für die Unternehmen dar.<br />
Zu diesem Zweck hat die <strong>FVA</strong> eine<br />
spezielle Software entwickelt und<br />
bietet u.a. in diesem Bereich Weiterbildungen<br />
an.<br />
Innovationsbasis<br />
für die Produktentwicklung<br />
Seit nunmehr 40 Jahren realisiert<br />
die <strong>FVA</strong> durch ihre Gemeinschaftsforschungsprojekte<br />
die Innovationsbasis<br />
für firmenspezifische Weiterentwicklungen.<br />
Zudem stellt die <strong>FVA</strong> die<br />
Anwendungsgebiete der <strong>FVA</strong>-Workbench in der Antriebstechnik<br />
neusten Erkenntnisse bzw. Algorithmen<br />
als Softwaretools zur Verfügung,<br />
die sich mit der erweiterten Berechnung<br />
von antriebstechnischen Elementen<br />
beschäftigen.<br />
Die Nutzung einzelner spezialisierter<br />
Tools genügt heute aber nicht mehr<br />
den Anforderungen eines modernen<br />
IT-gestützten Produktentwicklungsprozesses.<br />
Infolgedessen hat die <strong>FVA</strong><br />
schon 2005 begonnen die zentrale<br />
Berechnungsplattform „<strong>FVA</strong>-Workbench“<br />
zu entwickeln. Diese Plattform<br />
erfüllt die aktuellen Anforderungen an<br />
Datenkonsistenz, Datendurchgängigkeit,<br />
Benutzerführung und Effizienz<br />
in einem modernen CAE-Umfeld.<br />
Transfergeschwindigkeit<br />
als Wettbewerbsvorteil<br />
Die Ergebnisse aus der aktuellsten<br />
Forschung können so direkt in den<br />
Produktentwicklungsprozess einfließen.<br />
Die Zeitspanne zwischen der Veröffentlichung<br />
neuer Forschungsergebnisse<br />
und deren Umsetzung in Produkte<br />
wird dabei signifikant verkürzt.<br />
Dies bedeutet für die Branche einen<br />
unschätzbaren wirtschaftlichen Vorsprung,<br />
der nicht zuletzt dabei hilft,<br />
sich auch zukünftig im internationalen<br />
Wettbewerb erfolgreich zu behaupten.<br />
Eine Vielzahl von Funktionen unterstützt<br />
den Anwender seine Berechnungsprozesse<br />
zu automatisieren bzw.<br />
zu optimieren. Zudem lassen sich die<br />
Berechnungszeiten mit der <strong>FVA</strong>-Workbench<br />
aufgrund der einheitlichen<br />
Vorgehensweise für die verschiedenen<br />
Module bedeutend minimieren – von<br />
mehreren Manntagen auf wenige<br />
Stunden. Dadurch kann bei gleichem<br />
Aufwand wesentlich mehr Varianten<br />
berechnet bzw. miteinander verglichen<br />
werden. Folglich hat sich die <strong>FVA</strong>-<br />
Workbench in der Antriebstechnik
Dr. Günter Berger<br />
Vice President Engineering and Product Management<br />
Bosch Rexroth AG<br />
branchenweit als unverzichtbares<br />
Werkzeug etabliert. Seit 2010 nutzen<br />
mittlerweile 83 Mitgliedsfirmen die<br />
<strong>FVA</strong>-Workbench mit den verschiedenen<br />
Lizenztypen in ihren Unternehmen.<br />
Weiterhin ist eine kontinuierlich wachsende<br />
Nachfrage der <strong>FVA</strong>-Workbench und<br />
in diesen Zusammenhang auch bei den<br />
Seminaren zu verzeichnen. Der Ausbau<br />
und die Weiterentwicklung werden in den<br />
nächsten Jahren aktiv vorangetrieben.<br />
Service und Weiterentwicklung<br />
Neben der bewährten Software<br />
steht mit der 2010 gegründeten <strong>FVA</strong><br />
GmbH nun auch ein starkes Team zur<br />
Verfügung, das ein umfangreiches<br />
stetig wachsendes Weiterbildungsprogramm<br />
anbietet und durch die Vernetzung<br />
mit den führenden Köpfen der<br />
Branche ein einzigartiges Dienstleistungsportfolio<br />
zur Verfügung stellt. Um<br />
die weiteren Entwicklungen der <strong>FVA</strong>-<br />
Software langfristig auf eine möglichst<br />
sichere Basis zu stellen, hat die <strong>FVA</strong><br />
die Softwareentwicklung, deren Wartung<br />
und Support in einer eigenen Einheit,<br />
der <strong>FVA</strong> GmbH, gebündelt. Mit der Eröffnung<br />
der neuen Zweigstelle am 06.<br />
September <strong>2011</strong> in München wird das<br />
Erfolgskonzept fortgeschrieben. Weitere<br />
Zweigstellen in der Nähe von strategisch<br />
wichtigen Forschungspartnern<br />
(wie hier die TU München) sind geplant.<br />
Auf diese Weise können die<br />
<strong>FVA</strong>-Potenziale einer vernetzten und<br />
Durch die <strong>FVA</strong>-Workbench können wir die neuesten Forschungsergebnisse<br />
der <strong>FVA</strong> direkt in unsere Produktentwicklung<br />
fließen lassen. Über die <strong>FVA</strong>-Workbench ist unsere<br />
Entwicklung direkt mit den führenden Forschungseinrichtungen<br />
in der Antriebstechnik vernetzt und kann so den Knowhow<br />
Transfer von der Forschung in die Praxis beschleunigt<br />
umsetzen. Seit 2007 sind wir aktiv an der Entwicklung der<br />
<strong>FVA</strong>-Workbench beteiligt und konnten die speziellen Anforderungen<br />
aus der Praxis einfließen lassen. Für die sehr gute<br />
Zusammenarbeit mit der <strong>FVA</strong> und den Forschungsstellen<br />
bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich.<br />
domainübergreifenden Entwicklung<br />
optimal zum technologischen Vorsprung<br />
der Branche genutzt werden.<br />
Die Zukunft<br />
Die Entwicklung der <strong>FVA</strong>-Workbench<br />
hat mittlerweile eine Dimension<br />
angenommen, die es notwendig<br />
macht, die Entwicklungen noch enger<br />
aufeinander abzustimmen. Auf Basis<br />
der <strong>FVA</strong>-Roadmap aus dem Jahre<br />
2007 wurde eine Roadmap, in Zusammenarbeit<br />
mit den Anwendern, für<br />
die <strong>FVA</strong>-Workbench entwickelt und<br />
detailliert. Die kontinuierliche Weiterentwicklung<br />
wird zukünftig in Zusammenarbeit<br />
mit den unterschiedlichen<br />
Gremien der <strong>FVA</strong> erfolgen und ermög-<br />
licht, dass die notwendigen Aktivitäten<br />
auf Basis der Roadmap aufeinander<br />
abgestimmt werden. Folglich kann<br />
die <strong>FVA</strong> trotz vielfältiger Aktivitäten<br />
in den verschiedenen Gremien ihre<br />
gesamte Forschungspotenz bündeln<br />
und auf diese Weise das Gesamtsystem<br />
massiv vorantreiben.<br />
Unser Ziel ist es, die Forschungsergebnisse<br />
der <strong>FVA</strong> schnell und effizient<br />
in der Praxis nutzbar zu machen. Das<br />
Mittel der Zukunft in diesem Bereich<br />
ist der proaktive Wissenstransfer, der<br />
durch die Serviceleistungen der <strong>FVA</strong><br />
GmbH unterstützt bzw. forciert wird.<br />
Auf diese Weise schaffen wir es den<br />
technologischen Vorsprung unserer<br />
Mitglieder zu sichern und auszubauen.<br />
Die <strong>FVA</strong>-Workbench wird branchenweit eingesetzt und kontinuierlich durch neueste<br />
Forschungsergebnisse erweitert.<br />
41
42<br />
4,3<br />
Finanzierung der Gemeinschaftsforschung<br />
Finanzierung der Gemeinschaftsforschung<br />
Mio Euro pro Jahr Industriemittel<br />
IGF Mittel<br />
Stiftungsmittel<br />
<strong>FVA</strong>-Gemeinschaftsforschung<br />
auf einen Blick<br />
Die Industrielle Gemeinschaftsforschung<br />
der <strong>FVA</strong> bietet den <strong>FVA</strong>-<br />
Mitgliedern eine optimale Grundlage<br />
für die firmeneigene Forschung und<br />
Entwicklung. Die Mitgliedsfirmen teilen<br />
sich die anfallenden Kosten und<br />
darüber hinaus werden die über die<br />
Mitgliedsbeiträge eingehenden industrieeigenen<br />
Forschungsmittel durch<br />
die Akquise wertvoller Fördergelder<br />
von Bund und Stiftungen verdoppelt.<br />
Geschäftsjahr 2010<br />
Die Ausgaben der <strong>FVA</strong> für die Finanzierung<br />
der Forschungsvorhaben<br />
beliefen sich im Geschäftsjahr 2010<br />
auf ca. 9,8 Millionen Euro. Mit diesen<br />
Mitteln wurden die Forschungsprojekte<br />
an den Hochschulinstituten finanziert.<br />
Im Leistungsumfang enthalten<br />
sind die Durchführung der Forschungsvorhaben<br />
und der allgemeine<br />
Technologietransfer. Von den 9,8 Millionen<br />
Euro kamen ca. 5,4 Millionen<br />
Euro aus der öffentlichen Hand, ca.<br />
4,3 Millionen Euro waren Industriemittel<br />
ergänzt durch ca. 0,1 Millionen<br />
Euro Stiftungsgelder. Die verausgabten<br />
Industriemittel beinhalteten auch<br />
indirekte Forschungsaufwendungen,<br />
z.B. Mitgliedsbeiträge bei Einrichtungen<br />
wie der Arbeitsgemeinschaft industrieller<br />
Forschungsgemeinschaften<br />
(AiF) und deckten die Kosten der Vorbereitung<br />
von Forschungsvorhaben<br />
ab, die gemeinsam mit der Wissen-
schaft erfolgte. Die Verwaltungsaufwendungen<br />
der <strong>FVA</strong> beliefen sich für<br />
das Geschäftsjahr 2010 auf ca.<br />
0,6 Millionen Euro.<br />
Geschäftsjahr <strong>2011</strong><br />
Entsprechend der Ertragslage und<br />
der bewilligten Finanzierung von<br />
Forschungsvorhaben ist für das<br />
Geschäftsjahr <strong>2011</strong> von Zahlungen in<br />
Höhe von ca. 10,5 Millionen Euro auszugehen.<br />
Hiervon sind 5,9 Millionen<br />
Euro öffentliche Gelder, also Mittel,<br />
die über das Bundesministerium für<br />
Wirtschaft (BMWi) bzw. die AiF zur<br />
Verfügung gestellt werden, rund<br />
0,3 Millionen Euro Stiftungsmittel und<br />
ca. 4,3 Millionen Euro Industriemittel.<br />
Letztere teilen sich auf der Ausgabenseite<br />
wie folgt auf: 3,1 Millionen<br />
Euro für Forschungsvorhaben und<br />
1,2 Millionen Euro für den allgemeinen<br />
Technologietransfer. Die Ausgaben für<br />
den allgemeinen Technologietransfer<br />
beinhalten die projektbezogenen<br />
Verwaltungsausgaben, wie z. B. den<br />
AiF-Mitgliedsbeitrag. Im Geschäftsjahr<br />
<strong>2011</strong> belaufen sich die Verwaltungsaufwendungen<br />
der <strong>FVA</strong> voraussichtlich<br />
auf rund 0,7 Millionen Euro.<br />
Vorhabenbezogene Aufwendungen<br />
2010 und <strong>2011</strong><br />
Das Vorhaben bezogene Engagement<br />
der <strong>FVA</strong>-Mitglieder geht weit<br />
über das Bezahlen von Beiträgen<br />
hinaus und ist für die Industrielle Gemeinschaftsforschung<br />
von sehr hoher<br />
Bedeutung. Sowohl die Industrie als<br />
auch der Fachverband Antriebstechnik<br />
im VDMA bringen sich durch vorha-<br />
benbezogene Aufwendungen in die<br />
Arbeit der <strong>FVA</strong> aktiv ein. Hierbei handelt<br />
es sich um ein wesentliches Element<br />
der seit Januar 2005 wirksamen<br />
Förderrichtlinie für die Industrielle<br />
Gemeinschaftsforschung. Der Beitrag<br />
dieser kostenlos erbrachten Leistungen<br />
für konkrete Forschungsvorhaben<br />
lagen für das Jahr 2010 bei 6 Millionen<br />
Euro (Vorjahr: 5,7 Millionen Euro).<br />
Die seitens der Industrie erbrachten<br />
Dienst- und Sachleistungen bestehen<br />
unter anderem in der Projektbegleitung,<br />
kostenlosen Forschungs- und<br />
Entwicklungsarbeiten, Überlassung<br />
von Geräten oder Materialien zur<br />
Durchführung einzelner Forschungsvorhaben<br />
oder auch Geldleistungen.<br />
Für das Geschäftsjahr <strong>2011</strong> werden<br />
ebenfalls vorhabenbezogene Aufwendungen<br />
im Gegenwert von ca.<br />
6 Millionen Euro erwartet.<br />
Sonderforschungsprogramme<br />
Sonderforschungsprogramms Projekte Laufzeit bis Fördersumme<br />
CO2 Emissionsforschung<br />
inkl. Low Friction Powertrain<br />
37 01.10.2008-30.09.2012 9,7<br />
Konjunkturpaket II<br />
Antriebskonzepte für Elektro-<br />
6 01.04.2010-30.09.<strong>2011</strong><br />
und Hybridfahrzeuge 1,4<br />
AiF-Leittechnologien für KMU /<br />
E-Antrieb.NET<br />
7 01.10.2010-30.09.2012 1,9<br />
Gesamt 13<br />
Die von der öffentlichen Hand geförderten<br />
<strong>FVA</strong>-Projekte werden über<br />
die AiF im Rahmen des Programms<br />
zur Förderung der Industriellen Ge-<br />
meinschaftsforschung und -entwicklung<br />
(IGF) vom Bundesministerium für<br />
Wirtschaft und Technologie (BMWi)<br />
aufgrund eines Beschlusses des<br />
Deutschen Bundestages gefördert.<br />
Mio. Euro<br />
43
36<br />
Anlage 1 Forschungsvorhaben<br />
<strong>FVA</strong>-Forschungsvorhaben<br />
Stand: 15. Oktober <strong>2011</strong><br />
<strong>FVA</strong>-Nr. Thema Status<br />
AK Berechnung und Simulation<br />
Obmann: Leimann, Hansen Transmissions International N.V.<br />
Themenvorschläge<br />
T 1229 Erweiterte Leistungsfähigkeit von Wellen-Lager-Berechnungen mit dem Modul geplant<br />
Anträge<br />
WELLAG<br />
T 1011 Ermittlung der Betriebszustände und damit den Belastungen, die auf Getriebe von geplant<br />
Windkraftanlagen wirken<br />
T 1173 Tragfähigkeit von Stirnrädern unter Gesichtspunkten einer geplant<br />
modifizierten Überlebenswahrscheinlichkeit<br />
T 1198 Entwicklung eines Verfahrens zur betriebsfesten Auslegung von geplant<br />
Planetenträgern aus sprödem GJS 700 unter der Berücksichtigung<br />
des höchst beanspruchten Volumens und bruchmechanischer Zusammenhänge<br />
T 1225 Experimentelle Untersuchung der Verlustleistung von Stirnradverzahnungen geplant<br />
30 VIII Integration des Ritzelkorrekturprogramms (RIKOR J) in die <strong>FVA</strong>-Workbench geplant<br />
127 IX Verifikation der Zahnkontaktanalyse für Innenverzahnungen unter<br />
Berücksichtigung der lastbedingten realen Verlagerungen<br />
geplant<br />
481 III Softwaretechnische Realisierung einer Programmumgebung zur Rädertriebsimulation geplant<br />
484 IV Realitätsnahe Berücksichtigung des elastischen Umfeldes auf den Zahneingriff mittels FEM geplant<br />
487 IV Neue Kennwerte zur rechnerischen Beurteilung des Anregungsverhaltens von Verzahnungen geplant<br />
541 II Berücksichtigung von Teillasten bei der Berechnung der Wälzlager-<br />
Lebensdauer insbesondere für Windkraftgetriebe<br />
geplant<br />
554II Verkürztes Testverfahren für Getriebe und Antriebselemente zur<br />
Bestätigung der Betriebsfestigkeit der Bauteile<br />
geplant<br />
Vorhaben<br />
30 VII Erweiterung des <strong>FVA</strong>-Programmes Ritzelkorrektur (RIKOR) laufend<br />
69 IV Überarbeitete Programmversion WTplus 2.0 zur Verlustleistungs- und laufend<br />
Wärmehaushaltsberechnung
Anlage 1 Forschungsvorhaben<br />
<strong>FVA</strong>-Nr. Thema Status<br />
69 V Validierung des Programmsystems WTplus 2.0; FH 959, IB 69 V abgeschlossen<br />
96 XVI Erweiterung der Systemgrenzen des Schwingungssimulationsprogramms DRESP laufend<br />
96 XVII Systematik zur Validierung und Optimierung von Schwingungssimulationsmodellen in der laufend<br />
Antriebstechnik<br />
96 XVIII Funktionale Erweiterung von DRESP zur durchgängigen Verwendbarkeit laufend<br />
127 V Integration des Geometrieteils der Stirnradkette; Implementierung einer FE- laufend<br />
Schnittstelle (NASTRAN) in die <strong>FVA</strong>-Workbench Rev. 1.0<br />
127 VI Studie zur Einbindung des Programms Z88 in die FE-Stirnradkette laufend<br />
127 VIII Erweiterung der FE-basierten Zahnkontaktanalyse zur Berechnung von Innenverzahnungen laufend<br />
328 IV Bestimmung von Verzahnungskorrekturen und Lagerkräften in Planetengetrieben<br />
für Lastkollektive; FH 989 und 990, IB 328 IV<br />
abgeschlossen<br />
364 III Erweiterung der <strong>FVA</strong> Programme RIKOR und LAGER2 zur Bestimmung<br />
der Lebensdauer von Wälzlagern in Industriegetrieben; FH 971, IB 364 III<br />
abgeschlossen<br />
364 IV Erweiterung von LAGER2 zur Dimensionierung von Wälzlagern in Industriegetrieben:<br />
Verlustleistung und Betriebstemperatur<br />
laufend<br />
481 II Softwaretechnische Realisierung einer Programmumgebung zur Rädertriebsimulation;<br />
FH 964, IB 481 II<br />
abgeschlossen<br />
484 I FE-Berechnung beliebiger evolventischer Zahnlücken mit frei wählbarer Zahnfußausrundung laufend<br />
484 II Implementierung eines modifizierten FE-Solvers Z88 in STIRAK zur<br />
Optimierung der Einflusszahlenberechnung hinsichtlich Rechengeschwindigkeit<br />
und Modellabbildungsgenauigkeit<br />
laufend<br />
484 III Untersuchung des Einflusses von asymmetrischen Zahnlückengeometrien auf das<br />
Laufverhalten von Stirnrad-Verzahnungen<br />
laufend<br />
485 III Weiterentwicklung einer geführten Lebensdauerberechnung für Komponenten der<br />
Antriebstechnik mit Vernetzung zur <strong>FVA</strong>-Software<br />
laufend<br />
485 IV Integration der Software "Lebensdauerabschätzung plus III" in die <strong>FVA</strong>-Workbench laufend<br />
487 III Neue Kennwerte zur rechnerischen Beurteilung des Anregungsverhaltens<br />
von Verzahnungen; FH 983, IB 487 III<br />
abgeschlossen<br />
541 I Berücksichtigung von Betriebszuständen, Sonderereignissen und Überlasten bei der<br />
Berechnung der Wälzlager-Lebensdauer in Windenergieanlagen und Großgetrieben;<br />
FH 967, IB 541 I<br />
abgeschlossen<br />
37
38<br />
Anlage 1 Forschungsvorhaben<br />
<strong>FVA</strong>-Nr. Thema Status<br />
554 I Verkürztes Testverfahren für Getriebe und Antriebselemente zur Bestätigung abgeschlossen<br />
der Betriebsfestigkeit der Bauteile (Raffung); FH 978, IB 554 I<br />
555 VI Erweiterung der <strong>FVA</strong>-Workbench bzgl. des DRESP-Postprozessors laufend<br />
555 XI Spezifikation Erweiterung der Sicherheitsmechanismen abgeschlossen<br />
563 I Vereinheitlichung von Pulsatorversuchen Merkblatt 0/5 laufend<br />
571 I LAstverteilung PLAnetenStufe (LAPLAS) in der <strong>FVA</strong>-Workbench; FH 992, IB 571 I abgeschlossen<br />
584 I Berechnung der Getriebetemperatur für instationäre Zustände laufend<br />
592 I Validierung und Untersuchung von Anwendungsgrenzen des <strong>FVA</strong> Getriebeprogramms abgeschlossen<br />
RIKOR anhand von Verformungsmessungen; FH 987, IB 592 I<br />
609 I Berücksichtigung des Einflusses von Flankenkorrekturen auf die Last-, Pressungs- und<br />
Zahnfußspannungsverteilung von Stirnradverzahnungen<br />
laufend<br />
AK Dichtungstechnik<br />
Obmann: Dr. Bock, Freudenberg Sealing Technologies GmbH & Co. KG<br />
Anträge<br />
T 1158 Entwicklung eines Berechnungsmodells zur Simulation der Reibung im RWDR-Dichtsystem geplant<br />
T 1171 Gestaltung von Lastkollektiven zur Prüfung von Radial-Wellendichtringen (RWDR) geplant<br />
T 1185 Radialwellendichtungen bei hoher Drehdynamik - ständiges wechselndes<br />
ruckartiges Beschleunigen<br />
geplant<br />
T 1187 Bei schnell rotierendem Gehäuse betriebssicher abdichten - umlaufende Dichtung geplant<br />
T 1220 Designrichtlinien für nachgiebige Gehäuse im Dichtbereich um die zulässigen<br />
Einsatzgrenzen für die eingesetzte Dichtungsart nicht zu überschreiten<br />
geplant<br />
T 1236 3D-Oberflächenkennwerte für Dichtflächen geplant<br />
415 III Dichtungsalterung in synthetischen Getriebeölen geplant<br />
551 II Vergleichende Dichtheits-Prüfungen unter Schmutzbeaufschlagung geplant<br />
574 II Wechselwirkungsverhalten der Systemparameter im RWDR-System geplant<br />
578 II RWDR Reibungs- und Verschleißprüfung an Elastomeren für Dichtungsanwendungen geplant<br />
Vorhaben<br />
419 II Ermittlung von Anpassungsfaktoren zur Auslegung von flüssig abgedichteten laufend<br />
Flächendichtstellen<br />
546 I Innovative Flächendichtsysteme für unebene, raue und verwindungsweiche abgeschlossen<br />
Gehäusetrennstellen; FH 976, IB 546 I
Anlage 1 Forschungsvorhaben<br />
<strong>FVA</strong>-Nr. Thema Status<br />
570 I Einfluss der Fertigungsparameter von weich bearbeiteten Wellen auf die Dichtfunktion laufend<br />
von Elastomerdichtungen<br />
573 I Abdichtung von Fließfetten laufend<br />
574 I Berechnung und Prognose des dynamischen Verhaltens von abgeschlossen<br />
Radialwellendichtringen (RWDR); FH 974, IB 574 I<br />
578 I Vergleichende Reibungs- und Verschleißuntersuchungen durch Experiment abgeschlossen<br />
und Simulation an Elastomeren für Dichtungsanwendungen in der<br />
Antriebstechnik; FH 979, IB 578 I<br />
617 I Rechnerische Abschätzung der Dichtgüte von Radial-Wellendichtungen durch Kenntnis der<br />
Systemparametereinflüsse<br />
laufend<br />
AK Fertigungstechnik<br />
Obmann: Dr. Klaiber, SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG<br />
Themenvorschläge<br />
T 1244 Hocheffiziente Kühlschmierstoffzufuhr beim Verzahnungsschleifen geplant<br />
Anträge<br />
T 1191 Produktivitätssteigerung beim Fräsen großmoduliger Verzahnungen mit geplant<br />
Hart-Metall-Wendeschneidplatten<br />
T 1195 Untersuchung des Einsatzverhaltens fertigwälzgefräster Stirnräder geplant<br />
T 1239 Einfluss der Oberflächenstruktur beim 5-Achs-Fräsen von Verzahnungen auf<br />
das Einsatzverhalten<br />
geplant<br />
T 1240 Ressourceneffizienz alternativer Fertigungsverfahren durch Charakterisierung von<br />
Oberflächenstrukturen<br />
geplant<br />
523 II Prozessauslegung für die Schneidkantenpräparation von Trockenräumwerkzeugen mit<br />
angepasster Spanungsdicke<br />
geplant<br />
576 II Technologische Untersuchung des Wälzfräsens von Großverzahnungen<br />
mit Werkzeugen aus PM-HSS (pulvermetallurgische Hochleistungs-Schnellarbeitsstähle)<br />
geplant<br />
581 II Hochleistungswälzfräsen mit Hartmetallwerkzeugen geplant<br />
Vorhaben<br />
329 V Steigerung der Wirtschaftlichkeit beim Verzahnungsschleifen einsatzgehärteter Stirnräder laufend<br />
- Abrichtwerkzeuge und -strategien<br />
444 IV Wiederaufbereitung von PM-HSS-Werkzeugen zum Hochleistungswälzfräsen laufend<br />
529 II Abricht- und Bearbeitungsstrategien beim Verzahnungshonen mit keramisch<br />
gebundenen Werkzeugen; FH 958, IB 529 II<br />
abgeschlossen<br />
39
40<br />
Anlage 1 Forschungsvorhaben<br />
<strong>FVA</strong>-Nr. Thema Status<br />
576 I Technologische Untersuchungen des Wälzfräsens im zweiten Schnitt am Beispiel abgeschlossen<br />
von Großverzahnungen; FH 955, IB 576 I<br />
581 I PM-HSS Wälzfräsen mit Hochschnittgeschwindigkeitsbereich (200-300 m/min) abgeschlossen<br />
(T1062); FH 975, IB 581 I<br />
594 I Verfahrensanweisung Barkhausen-Verfahren laufend<br />
642 I Eigenschaftsanalyse bei unformintegrierter Prozesskette zur Verzahnungsherstellung laufend<br />
647 I Verfahrensvergleich Wälzschleifen und Profilschleifen zur Feinbearbeitung laufend<br />
von Verzahnungen im Modulbereich größer 6 mm<br />
654 I Profilschleifen von Verzahnungen mit höchsten Oberflächenqualitäten (Superfinishing) laufend<br />
661 I Wälzschälen von Innenverzahnungen laufend<br />
AK Freiläufe<br />
Obmann: Ploetz, Schaeffler Technologies GmbH & Co.KG<br />
Anträge<br />
T 1211 Schraubverbindungen an Freiläufen geplant<br />
T 1234 Freilauf Lebensdauer - kombinierte Radial- und Drehmomentbelastung geplant<br />
Vorhaben<br />
517 I Einfluss des Schmierstoffs auf die Schaltgüte und Schaltsicherheit von abgeschlossen<br />
reibschlüssigen Freiläufen, FH 922, IB 517 I<br />
601 I Räumliche Lastverteilung in Freiläufen laufend<br />
646 I Ermittlung der für die Funktion von reibschlüssigen Freiläufen notwendigen laufend<br />
(minimalen und maximalen) Anfederkräfte unter Berücksichtigung sämtlicher von<br />
der Feder zu erfüllenden Aufgaben<br />
653 I Axiale Belastbarkeit der Freiläufe laufend<br />
AK Geräusche<br />
Obmann: Ziegler, Voith Turbo GmbH & Co.KG<br />
Anträge<br />
T 1142 Entwicklung der psychoakustischen Analysen von Luftschall und Übertragung auf geplant<br />
Körperschallsignale in der Antriebstechnik<br />
T 1216 Modellbildung zur NVH Simulation eines E-MOTIVE Antriebsstrangs geplant<br />
T 1217 Multisensorische Wahrnehmung und Bewertung von E-Fahrzeugen im realen Kontext geplant
Anlage 1 Forschungsvorhaben<br />
<strong>FVA</strong>-Nr. Thema Status<br />
T 1218 Geräuschoptimale Korrektur für Getriebebetrieb im Hauptresonanzbereich geplant<br />
bei elektrischen Fahrzeugantrieben<br />
292 III Anregungsoptimierter Planetenradsatz mit ANPLAopt: Messung und Berechnung geplant<br />
338 VI Anregungsoptimierte Flankenkorrektur durch topologische Korrekturen geplant<br />
Vorhaben<br />
292 II Software zur Optimierung des Anregungsverhaltens eines Planetenradsatzes; abgeschlossen<br />
FH 968, IB 292 II<br />
309 III Akustisches Verhalten von hochdrehenden, spielarmen Servomotor-Getriebe Einheiten laufend<br />
507 II Reduktion der Geräuschabstrahlung von Getriebegehäusen durch die Entkopplung<br />
der Wandung von der Rahmenstruktur<br />
laufend<br />
565 I Untersuchung des Drehzahleinflusses auf das Geräusch- und Schwingungsverhaltens<br />
von Getrieben<br />
laufend<br />
565 II Untersuchung des Drehzahleinflusses auf das Geräusch- und Schwingungsverhalten<br />
von mehrstufigen Getrieben unter Berücksichtigung der Kopplung der Getriebestufen<br />
laufend<br />
587 I Prognosemethodik für die Schwingungsanregung von Getrieben an der Schnittstelle<br />
Getriebefundament, FH 980, IB 587 I<br />
abgeschlossen<br />
AK Geregelte E-Antriebe<br />
Obmann: Dr. Zwanziger, Siemens AG<br />
Anträge<br />
T 1087 Antriebsbasierte Verfügbarkeitsdiagnose von Maschinen (phänomenologischer Ansatz) geplant<br />
T 1143 Steigerung der Energieeffizienz elektrischer Antriebe Optimierungspotentiale<br />
durch Einsatz neuer Materialien<br />
geplant<br />
T 1184 Chancen und Anforderungen für den Einsatz von Schwungradspeichern bei<br />
stationären Schnellladestationen für Elektro-Fahrzeuge<br />
geplant<br />
T 1221 Auswahlkriterien für eine energieeffiziente elektrische Antriebstechnik geplant<br />
557 II Sicherstellung der EMV-Anforderungen bei der Integration elektrischer<br />
Antriebssysteme in mobilen Systemen durch geeignete Modelle und Methoden<br />
geplant<br />
Vorhaben<br />
445 III 3D-Linearantriebssystem: Modulares Linearantriebssystem für räumlich gekrümmte Bahnen laufend<br />
und Mehrfahrzeugbetrieb - Anschlussvorhaben: Betrieb mehrerer Fahrzeuge, sensorloses<br />
Positionieren und Entwicklung neuer Streckenabschnitte<br />
557 I Werkzeuge und Methoden zur Erreichung von elektromagnetischer Verträglichkeit<br />
(EMV) für Elektrische Antriebssysteme; FH 954, IB 557 I<br />
abgeschlossen<br />
41
42<br />
Anlage 1 Forschungsvorhaben<br />
<strong>FVA</strong>-Nr. Thema Status<br />
664 I Universelles Werkzeug zur Steigerung der Energieeffizienz von technischen Prozessen laufend<br />
am Beispiel eines Prozesskühlsystems mit elektrischer Antriebstechnik<br />
665 I Online-Identifikation und Beobachtung von Systemparametern elektrischer Antriebssysteme laufend<br />
zur Nachführung von regelungstechnisch relevanten Parametern<br />
AK Gleitlager<br />
Obmann: Schmitz, RENK AKTIENGESELLSCHAFT<br />
Anträge<br />
T 1193 Einfluss der Ölzufuhr auf die hydraulischen, energetischen und mechanischen geplant<br />
Vorgänge in schnell laufenden und hoch belasteten Radialkippsegmentlagern<br />
314 IV Untersuchungen zum Betriebsverhalten Dünnschichtpolymerlaufschichten geplant<br />
in Mehrflächengleitlagern<br />
383 V Ermüdungslebensdauerprognose von Verbundlagern geplant<br />
FVV Berechnung und experimentelle Bestimmung der frequenzabhängigen dynamischen geplant<br />
T 0110 Eigenschaften von Radialkippsegmentlagern unter Berücksichtigung von Trägheits- und<br />
Vorhaben<br />
Abstützungseinflüssen<br />
91 V Benetzungsverhalten von Gleitlager-Schmierstoff/Werkstoff-Kombinationen laufend<br />
314 II Entwicklung experimentell abgesicherter Auslegungswerkzeuge für thermisch und abgeschlossen<br />
mechanisch hochbelastete, kunststoffbeschichtete Mehrflächen- und<br />
Radialkippsegmentlager; FH 965, IB 314 II<br />
314 III Untersuchungen zum Betriebsverhalten kunststoffbeschichteter Mehrflächengleitlager laufend<br />
383 III Langzeiteignungs- und Verarbeitungsprozessoptimierung einer neuentwickelten,<br />
hochbelastbaren Gleitlagerlegierung<br />
laufend<br />
383 IV Entwicklung einer hochfesten Gleitlagerlegierung, die den heute weltweit verfügbaren<br />
Legierungen hinsichtlich Belastbarkeit und Ermüdungsfestigkeit um 20% überlegen ist<br />
laufend<br />
531 I Aufbau eines Hochleistungs-Gleitlagerprüfstandes zur Ermittlung von tribologischen<br />
Kenngrößen bei hohen Lasten und höchsten Umfangsgeschwindigkeiten<br />
laufend<br />
532 I Regenerierung des Radialgleitlager-Berechnungsprogramm ALP3T (Version 4.2) und<br />
des Rotordynamikprogramms SR3 (Version 2.2) und Integration der Programme in die<br />
<strong>FVA</strong>-Workbench<br />
laufend<br />
542 I Lebensdauerkriterien innovativer Werkstoffe für hochtourige und hochbelastete Gleitlager laufend
Anlage 1 Forschungsvorhaben<br />
<strong>FVA</strong>-Nr. Thema Status<br />
577 I Verbesserung eines Radialgleitlager-Berechnungsprogrammes laufend<br />
622 I Verknüpfung des Programms ALP3T mit SIMPACK zur MKS-Simulation von Antriebssystemen laufend<br />
mit Gleitlagern<br />
FVV 1016 Einsatzgrenzen von hydrodynamischen Weißmetallgleitlagern infolge von Verschleiß laufend<br />
AK Innovationsmanagement<br />
Obmann: Dr. Scherb, Schaeffler Technologies GmbH & Co KG<br />
Themenvorschläge<br />
T 1213 Branchenspezifische Technologie-Datenbank für die <strong>FVA</strong> geplant<br />
Anträge<br />
T 1214 Methode und Anwendung von Cross Industry Innovation (CII) zur Generierung radikaler geplant<br />
Innovationsimpulse für deutsche Unternehmen der Antriebstechnik<br />
T 1237 Intelligente Wissensspeicherung und effiziente Wissensfindung als neue Kernkompetenz: geplant<br />
Anforderungen an Wissensmanagement 2.0 (nicht nur) für einen funktionierenden<br />
Wissenstransfer in den Forschungsvereinigungen und an die Mitgliedsunternehmen<br />
590 III Analyse der Effizienz von Open Innovation und alternativen Strategien der Zusammenarbeit<br />
in der F&E<br />
geplant<br />
Vorhaben<br />
590 II Einsatzbedingungen und Methoden von Open Innovation in der Antriebstechnik;<br />
FH 969, IB 590 II<br />
abgeschlossen<br />
621 I Auswirkungen der Innovationsfähigkeit Chinas auf deutsche Unternehmen<br />
der Antriebstechnik; FH 960, IB 621 I<br />
abgeschlossen<br />
656 I Handlungsempfehlungen für die deutschen Komponenten- und Systemlieferanten für<br />
Windenergieanlagen in der VR China<br />
laufend<br />
AK Kegelräder<br />
Obmann: Dr. Thomas, Voith Turbo GmbH & CO. KG<br />
Themenvorschläge<br />
T 1235 Einfluss der Treibrichtung auf die Flankentragfähigkeit von Stirnräder, Kegelrad- und geplant<br />
Hypoidverzahnung<br />
43
44<br />
Anlage 1 Forschungsvorhaben<br />
<strong>FVA</strong>-Nr. Thema Status<br />
Anträge<br />
492 III Entwicklung einer Prüfvorschrift für die Einflankenwälzprüfung basierend auf Ringversuchen geplant<br />
513 II Untersuchung verschiedener Gefüge in der Randschicht einsatzgehärteter Proben und<br />
Zahnräder bezüglich der Festigkeitseigenschaften<br />
geplant<br />
Vorhaben<br />
49 XI Erweiterung des <strong>FVA</strong>- Kegelradnormprogramms KNplus laufend<br />
223 VI Effiziente und nutzerfreundliche Modellierung des Umfeldes der abgeschlossen<br />
Kegelradverzahnung in BECAL; FH 938, IB 223 VI+VII<br />
223 VII Berücksichtigung von Lastkollektiven bei der genauen Analyse der abgeschlossen<br />
Kegelradbeanspruchung mit BECAL; FH 938, IB 223 VI+VII<br />
223 IX Berechnung der Zahnfuß-, Grübchen und Fresstragfähigkeit von Kegelrad- und laufend<br />
Hypoidverzahnungen in BECAL<br />
223 X Validierung des <strong>FVA</strong>-Workbench BECAL-Plug-In laufend<br />
392 III Beanspruchung und Tragfähigkeit von Plankerbverzahnung mit dezentralen Verschraubungen laufend<br />
456 II BECAL-Erweiterung: Flankenspiel und Ziehbarkeit; FH 923, IB 456 II abgeschlossen<br />
492 II Neue Prüfstrategie für die Einflankenwälzprüfung - Berücksichtigung<br />
lastbedingter Radsatzverlagerung<br />
laufend<br />
516 I Bestimmung der Graufleckentragfähigkeit von Kegelrad- und Hypoidverzahnungen laufend<br />
569 I Automatisierte, sichere Auslegung und Variationsrechnung von Kegelradverzahnungen laufend<br />
586 I Versuche zur Tragfähigkeit von Kegelrad- und Hypoidverzahnungen bei<br />
Lastkollektivbelastung<br />
laufend<br />
604 I Erzeugung allgemeiner Flankengeometrien laufend<br />
AK Kostenmanagement<br />
Obmann: Walter, GETRAG Getriebe- und Zahnradfabrik Hermann Hagenmeyer GmbH & Cie.KG<br />
Anträge<br />
T 1106 Konzeptentwicklung für eine Auslastungskennzahl für die Produktentwicklung - KapaPro geplant<br />
T 1121 Produktpiraterie in der Antriebstechnik - Anti-Piraterie-Audit und technische Schutzmaßnahmen geplant
Anlage 1 Forschungsvorhaben<br />
<strong>FVA</strong>-Nr. Thema Status<br />
Vorhaben<br />
596 I Ganzheitliche Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von qualitätsbezogenen Maßnahmen abgeschlossen<br />
unter Berücksichtigung von Risikoaspekten; FH 972, IB 596 I<br />
623 I Literaturrecherche/-studie Kurzkalkulation laufend<br />
659 I Entwicklung eines Prognose- und Entscheidungsmodells für Markt- und Kosteneffekte von<br />
Modularisierungskonzepten<br />
laufend<br />
AK Mechatronik<br />
Obmann: Prof. Wolf, Robert Bosch GmbH<br />
Anträge<br />
T 1108 Analyse und Optimierung von Gehäusetechnologien für Halbleiter in hochintegrierten geplant<br />
Umrichteranwendungen<br />
T 1144 Bestimmung und Bewertung optimaler Topologien für hybride industrielle Antriebssysteme geplant<br />
mit Rekuperation<br />
461 II Methoden des Temperaturmanagements in elektrischen Maschinen und Leistungsumrichtern geplant<br />
Vorhaben<br />
618 I Raffungsmodelle für die Qualifikation mechatronischer Systeme und Komponenten laufend<br />
AK Messtechnik<br />
Obmann: Schmidt, ZF Friedrichshafen AG<br />
Anträge<br />
T 1147 Zerstörungsfreie Schleifbranderkennung mittels Photothermik geplant<br />
T 1165 Prozessfähigkeitsnachweis für F&E geplant<br />
T 1194 Hochgenaues, optisches Messsystem zur schnellen Messung kleinster Zahnradgeometrien geplant<br />
491 II Ermittlung einer aufgabenspezifischen Messunsicherheit von 3D-Verzahnungsmessungen geplant<br />
602 II Kapazitive Energie- und Datenübertragung geplant<br />
Vorhaben<br />
495 II Ausarbeitung einer <strong>FVA</strong>-Richtlinie aus den Erkenntnissen des Vorhabens 495 I abgeschlossen<br />
"Schwingungsanalyse"<br />
495 III Ermittlung schädigungsrelevanter Schwingungsbelastungen aus abgeschlossen<br />
Beschleunigungsmessdaten; FH 977, IB 495 III<br />
45
46<br />
Anlage 1 Forschungsvorhaben<br />
<strong>FVA</strong>-Nr. Thema Status<br />
567 II Entwicklung von Verfahren zur Eignungsprüfung von Messgeräten für die Mikroverzahnungsmessung laufend<br />
602 I Ermittlung der Potenziale kapazitiver Telemetriesysteme zur berührungslosen laufend<br />
Signalübertragung von bewegten Antriebskomponenten<br />
645 I Untersuchung der Messunsicherheiten bei der mobilen Lasermessung laufend<br />
AK Nichtschaltbare Kupplungen<br />
Obmann: Kamps, Stromag AG<br />
Themenvorschläge<br />
T 1227 Bestimmung von Auslegungsparametern für dynamisch belastete geplant<br />
Anträge<br />
Elastomer-Metall-Verbindungen<br />
T 1192 Probekörperdesign für hochpräzise Zug-/Druckmessungen geplant<br />
T 1200 Systemverhalten von Kupplungen bei hoch dynamischen Vorgängen geplant<br />
T 1228 Ermittlung von Modellparametern zwecks Abbildung verlagerungsfähiger geplant<br />
Mitnehmerverzahnungen in MKS-Antriebssystemen<br />
434 III Methode zur Ermittlung von Modellparametern zwecks Abbildung verlagerungsfähiger geplant<br />
Mitnehmerverzahnungen in der Simulation von Antriebssystemen<br />
439 II Grundlegende Untersuchungen zur Rissentstehung in dynamisch beanspruchten geplant<br />
Elastomerbauteilen<br />
505 II Reibkraft- und Verschleißreduzierung im Gelenkwellen-Längenausgleich geplant<br />
548 II Entwicklung von Lasteinleitungskomponenten für Wellenkupplungen in Faserverbundbauweise geplant<br />
Vorhaben<br />
307 IV Verbesserung der Lastverteilung verlagerungsfähiger evolventischer Mitnehmerverzahnungen laufend<br />
435 III Erarbeitung eines Modells zur Prognose der Gebrauchsdauer für dynamisch beanspruchte<br />
Elastomerbauteile unter Berücksichtigung der Belastungsgeschichte<br />
laufend<br />
437 III Erweiterung des Wöhlerlinienkonzeptes für dynamisch auf Drehschub belastete<br />
elastische Kupplungen, für sehr hohe Lastwechselzahlen sowie zur Berechnung des<br />
Temperatureinflusses und der Schadensakkumulation<br />
laufend<br />
440 II Erweiterung, Implementation und Erprobung eines allgemeinen Stoffgesetzes MORPH<br />
für Elastomere sowie dessen Anwendung<br />
laufend<br />
505 I Beanspruchungsgerechte Dimensionierung von Gelenkwellen-Profilverschiebungen<br />
(Längenausgleich)<br />
laufend<br />
588 I Kupplungskennwerte und Kennwertabhängigkeiten von Großkupplungen laufend<br />
613 I Bestimmung der Verlustleistung von verlagerungsfähigen Mitnehmerverzahnungen laufend
Anlage 1 Forschungsvorhaben<br />
<strong>FVA</strong>-Nr. Thema Status<br />
AK Schaltbare Kupplungen und Bremsen<br />
Obmann: Cokdogru, GETRAG Getriebe- und Zahnradfabrik Hermann Hagenmeyer GmbH & Cie.KG<br />
Anträge<br />
T 1196 Methode zur Bestimmung der Leistungsgrenzen trockenlaufender Friktionssysteme mit geplant<br />
organischen, sintermetallischen, keramischen oder kombinierten Friktionswerkstoffen<br />
T 1251 Wirkungsgradverbesserung durch Reduzierung der Schleppverluste an Lamellenkupplungen geplant<br />
401 III Kenngrößen und Belastungsgrenzen von nasslaufenden Lamellenkupplungen unter<br />
Dauerschlupfbeanspruchung<br />
geplant<br />
515 III Untersuchung der Einflussgrößen auf Spontanschäden bei nasslaufenden metallischen<br />
Reibbelägen (Definition Fresstest).<br />
geplant<br />
Vorhaben<br />
413 II Ermittlung der Wärmeübergangszahlen in Lamellenkupplungen und Zusammenstellung abgeschlossen<br />
einer EDV-basierten Stoffdatensammlung; FH 985, IB 413 II<br />
413 III Ermittlung von Wärmeübergangszahlen und Schluckvermögen von Lamellenkupplungen; abgeschlossen<br />
FH 985, IB 413 III<br />
442 III Analyse des Einflusses der Leitstützstruktur organischer Friktionswerkstoffe auf den Reibwert, laufend<br />
die Reibwertstabilität und das Verschleißverhalten organischer Friktionspaarungen<br />
490 III Untersuchung der Einflüsse der physikalisch und chemisch gebundenen Grenzschichten auf laufend<br />
das Reibungsverhalten von nasslaufenden Lamellenkupplungen<br />
490 IV Öleinfluss Reibcharakteristik am Modell nasslaufende Lamellenkupplung; Entwicklung eines laufend<br />
Reibungszahlkurztests<br />
515 II Einflüsse neuartiger Reibbeläge und Öle sowie der Betriebsart auf die Lebensdauer von laufend<br />
Lamellenkupplungen<br />
607 I Kupplungsmodell zur Bearbeitung der Übertragbarkeit tribologischer Prüfergebnisse von laufend<br />
Teilbelag auf Bauteiluntersuchungen<br />
626 I-III Reibwertmaschinen für Nasskupplungssysteme laufend<br />
FVV Wirkungsgradverbesserung durch Reduzierung der Schleppverluste an laufend<br />
1012 Lamellenkupplungen<br />
AK Schmierstoffe und Tribologie<br />
Obmann: Dr. Wetzel, ZF Friedrichshafen AG<br />
Themenvorschläge<br />
T 1166 Verträglichkeit von Ölen mit Getriebelackierungen geplant<br />
T 1215 Untersuchungen zum Einfluss von wasserbasierten Waschmitteln, Kühlschmierstoffen und geplant<br />
Konservierungsmitteln auf die Bauteilfestigkeit von Lagern und Zahnrädern<br />
47
48<br />
Anlage 1 Forschungsvorhaben<br />
<strong>FVA</strong>-Nr. Thema Status<br />
Anträge<br />
T 1123 Entwicklung eines Systems zur Schmierstoffidentifizierung, bestehend aus der geplant<br />
Markierung von Schmierstoffen mit Fluoreszenzfarbstoffen und einem opto-elektronischen<br />
Detektor zur Identifizierung<br />
T 1190 Verträglichkeit von Schmierstoffen und Elastomeren geplant<br />
T 1230 Optimierung der Methodik für Probenvorbereitung und Partikelzählung von hochviskosen<br />
Getriebeölen und ATF's<br />
geplant<br />
327 IV Prognose des Wälzlagerverschleißverhaltens unter Berücksichtigung von<br />
Regenerationszeiten und Schmierungsbedingungen<br />
geplant<br />
488 II Einfluss unterschiedlicher Wassergehalte in Ölen auf die Ermüdungslebensdauer<br />
von Wälzlagern und die Grübchentragfähigkeit einsatzgehärteter Stirnräder<br />
geplant<br />
540 II Stillstehende fettgeschmierte Wälzlager unter dynamischer Belastung geplant<br />
593 II Weiterentwicklung von Magnetabscheidern zur Abtrennung feinster Partikel aus Schmierund<br />
Hydraulikölen unter Berücksichtigung von anwendungsspezifischen Einflussgrößen<br />
geplant<br />
Vorhaben<br />
327 III Einfluss der Wälzlager-Baugröße auf das Verschleißverhalten von Wälzlagern laufend<br />
431 II Einfluss von Stillstandszeiten in feuchter Umgebung und Schmierfettzusammensetzung laufend<br />
auf die Gebrauchsdauer von Wälzlagern<br />
459 II Einfluss der Graufleckigkeit auf die Grübchentragfähigkeit einsatzgehärteter Zahnräder im laufend<br />
Zeit- und Dauerfestigkeitsbereich<br />
482 II Flankentragfähigkeit gerad- und schrägverzahnter Innenverzahnungen unter Berück- laufend<br />
sichtigung anwendungsspezifischer Einflussgrößen<br />
482 III Graufleckentragfähigkeit einsatzgehärteter Stirnräder bei kleinen Umfangsgeschwindigkeiten laufend<br />
502 II Einfluss der gebrauchsbedingten Veränderungen auf die Filtrierbarkeit hochviskoser<br />
Getriebeöle<br />
laufend<br />
504 I Wälzlagerermüdung bei Mischreibung in Abhängigkeit vom Schmierstoff; FH 932, IB 504 I abgeschlossen<br />
518 I Tribologische Kennwertbildung rauer Oberflächen für Gleit- und<br />
Wälzkontakte; FH 929, IB 518 I<br />
abgeschlossen<br />
519 I Bestimmung der Fresstragfähigkeit von Kegelrad- u. Hypoidverzahnungen laufend<br />
534 I Untersuchung des Übergangwiderstands als tribologische Kenngröße für den<br />
Schmierungszustand<br />
laufend<br />
540 I Stillstehende fettgeschmierte Wälzlager unter dynamischer Belastung;<br />
FH 951, IB 540 I<br />
abgeschlossen<br />
552 I Untersuchung zur Schmierung und Tragfähigkeit von Zahnrädern bei Einsatz von<br />
Schmierfetten hoher Konsistenz<br />
laufend<br />
580 I Untersuchung des Schmierfilmaufbaus und der Reibung bei dünnen Schmierfilmen mittels<br />
Interferometrie und FE8-Wälzlagerversuchen<br />
laufend
Anlage 1 Forschungsvorhaben<br />
<strong>FVA</strong>-Nr. Thema Status<br />
583 I Bestimmung und Modellierung der thermophysikalischen Eigenschaften von Schmier- laufend<br />
und Kraftstoffen unter hohen Drücken<br />
585 I Grundlagen zur Reibungsminimierung in geschmierten Kontakten laufend<br />
593 I Entwicklung von Magnetabscheidern zur Abtrennung feinster Partikel aus Schmier- und<br />
Hydraulikölen<br />
laufend<br />
616 I <strong>FVA</strong> Richtlinie Ölprobeentnahme laufend<br />
627 I Einfluss von instationären Betriebszuständen zur Graufleckenbildung in Wälzlagern und<br />
Klärung von Mechanismen<br />
laufend<br />
643 I Entwicklung einer <strong>FVA</strong>-Prüfmethode zur Beurteilung von Ölen für Getriebe im Hinblick<br />
auf Ermündung von Wälzlagern<br />
laufend<br />
662 I Untersuchungen zum Einfluss der Schmierstoffzusammensetzung auf die Risseinleitung<br />
bei Wälzlagern<br />
laufend<br />
AK Schneckengetriebe<br />
Obmann: Dr. Bouché, Getriebebau Nord GmbH & Co KG<br />
Anträge<br />
T 1150 Bestimmung der lastabhängigen und lastunabhängigen Verlustleistungen von geplant<br />
Schneckengetrieben, insbesondere bei Anfahrvorgängen sowie bei Last- und Drehzahlkollektiven<br />
T 1209 Optimale Fertigungsparameter von Schneckenradverzahnungen geplant<br />
320 V Erweiterung SNESYS II (Schneckenradberechnungsprogramm) geplant<br />
522 II Tragfähigkeit und Wirkungsgrad von Schneckengetrieben bei Fettschmierung geplant<br />
559 II Untersuchungen zur Ermittlung der Nahtfestigkeit und Sicherung der Nahtqualität sowie geplant<br />
Vorhaben<br />
Ableitung eines Berechnungsalgorithmus<br />
205 III Metallurgische Optimierung von CuSnNi-Legierungen zur Tragfähigkeitssteigerung von laufend<br />
Schneckengetrieben<br />
320 V Erweiterung SNESYS; FH 966, IB 320 V abgeschlossen<br />
350 II Lebensmittelverträgliche Schmierstoffe in Schneckengetrieben laufend<br />
375 IV Optimierung der Zahnfuß-Tragfähigkeit von Schneckenrädern laufend<br />
452 II Tragbildentwicklung an Schnecken-Schraubradgetrieben laufend<br />
465 I+II Tragfähigkeit von Schneckengetrieben bei Anfahrvorgängen sowie Last- und Drehzahlkollektiven laufend<br />
465 II Tragfähigkeit von Schneckengetrieben bei Anfahrvorgängen sowie Last- und Drehzahlkollektiven laufend<br />
503 II Verschleiß- und Grübchentragfähigkeit von großen Zylinder-Schneckengetrieben mit<br />
optimierter Radbronze<br />
laufend<br />
651 I Integration der Schraubradgetriebe in die <strong>FVA</strong> Workbench laufend<br />
49
50<br />
Anlage 1 Forschungsvorhaben<br />
<strong>FVA</strong>-Nr. Thema Status<br />
AK Sensorik für Antriebssysteme<br />
Obmann: NN<br />
Themenvorschläge<br />
T 1136 Geber zur direkten Erfassung der Drehgeschwindigkeit speziell für Antriebe mit geplant<br />
digitaler Regelung<br />
T 1151 Stromsensoren für Frequenzumrichter - Strommessung mit induktiven Sensoren geplant<br />
Anträge<br />
562 II „Resotorque“ - Drahtlose Drehmomentmessung mit resonanten Oszillatoren geplant<br />
Vorhaben<br />
562 I Energieautarke, kostengünstige, kabellose und robuste Signalgewinnung für Anwendung laufend<br />
der Antriebstechnik<br />
611 I Indikator für Mech. Überlastung, bzw. Lastkollektive. Speichernder "DMS" laufend<br />
644 I Sensoren auf Basis MID (Molded Interconnect Devices) laufend<br />
AK Stirnräder<br />
Obmann: Dr. Sundermann, RENK Aktiengesellschaft<br />
Themenvorschläge<br />
T 1235 Einfluss der Treibrichtung auf die Flankentragfähigkeit von Stirnrädern, Kegelrad- und geplant<br />
Hypoidverzahnungen<br />
T 1243 Lokale Zahnfußtragfähigkeit von Stirnrädern bei Biegewechsellast geplant<br />
T 1245 Analyse des Wärmeverzugsverhaltens wälzgefräster und kaltgewalzter Stirnräder geplant<br />
Anträge<br />
T 968 Studie zur nächsten Generation Toleranznormen für Stirnräder geplant<br />
T 1075 Entwicklung einer Zahnkontaktanalyse zur Berechnung der Tragfähigkeit und geplant<br />
Geräuschanregung von kegeligen Stirnrädern (Beveloidräder)<br />
T 1098 Maschinenelemente aus modifizierten, strahlenvernetzten Kunststoffen geplant<br />
T 1152 Einfluss des Zahnflankenspiels auf die Tragfähigkeit von Stirnrädern geplant<br />
241 X Normberechnung der Geometrie und Tragfähigkeit von asymmetrischen Verzahnungen geplant<br />
286 IV Graufleckigkeit von Großgetrieben geplant<br />
410 III Tribologische Tragfähigkeit (Graufleckigkeit, Verschleiß) kleinmoduliger Zahnräder geplant<br />
538 II Untersuchungen zum Einfluss radialer Schmierölbohrungen auf die Zahnfußtragfähigkeit<br />
außenverzahnter Stirnräder<br />
geplant
Anlage 1 Forschungsvorhaben<br />
<strong>FVA</strong>-Nr. Thema Status<br />
Vorhaben<br />
241 VIII Erweiterung <strong>FVA</strong>-Stirnradprogramm Stplus; FH 973, IB 241 VIII abgeschlossen<br />
241 IX Erweiterung des <strong>FVA</strong>-Stirnradprogramms STplus laufend<br />
284 V Einfluss der Lastverteilung auf die Grübchentragfähigkeit von einsatzgehärteten Stirnrädern laufend<br />
284 IV Einfluss der Stirnkante auf die Tragfähigkeit von Zahnrädern unter Berücksichtigung des<br />
Schrägungswinkels<br />
laufend<br />
410 II Überprüfung der Grübchen- und Zahnfußtragfähigkeit gerad- und schrägverzahnter,<br />
kleinmoduliger Zahnräder und Zusammenfassung von Empfehlungen zum Erreichen<br />
optimaler Tragfähigkeit für Zahnräder mit Modul
52<br />
Anlage 1 Forschungsvorhaben<br />
<strong>FVA</strong>-Nr. Thema Status<br />
Vorhaben<br />
403 III Entwicklung eines verallgemeinerbaren Modells zur Verschleißvorhersage von abgeschlossen<br />
Synchronisierungen, Teil III; FH 981, IB 403 III<br />
403 IV Optimierte Beölung von Synchronisierungen laufend<br />
490 V Untersuchung des Öleinflusses auf die Reibungs- und Verschleißeigenschaften von<br />
Carbon-Synchronisierungen<br />
laufend<br />
575 I Untersuchung der Einflüsse auf das Schleppmoment von Synchronisierungen im<br />
nicht geschalteten Zustand; FH 962, IB 575 I<br />
abgeschlossen<br />
575 II Untersuchung der Einflüsse auf das Schleppmoment von Synchronisierungen im nicht<br />
geschalteten Zustand<br />
laufend<br />
649 I Statische und dynamische Festigkeit von Reibbelägen und deren Prüfung laufend<br />
AK Wälzlager<br />
Obmann: Dr. Weber, Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG<br />
Themenvorschläge<br />
T 1210 Einfluss von Additivkomponenten auf die Lebensdauer von Wälzlagern geplant<br />
T 1222 Einfluss der Lagerinnen- und Aussenringtemperatur auf die Grübchenlebensdauer geplant<br />
von Rollenlagern<br />
T 1223 Ermittlung von Drehzahlgrenzen vorgespannter Zylinderrollenlager geplant<br />
T 1224 Literaturstudie zu Toleranzen auf Abmessungen und Oberflächenbeschaffenheit bei geplant<br />
Wälzlagern<br />
T 1242 Gefügeveränderungen in Wälzlagerringen mit Rissen als Folgeschäden geplant<br />
Anträge<br />
T 1129 Wann ist Wälzlagerschlupf schädlich und führt zum Ausfall des Wälzlagers geplant<br />
432 III Schutzdichtungen für Wälzlager III geplant<br />
479 IV Untersuchungen von konstruktiven Maßnahmen gegen Wandern von Wälzlagerringen geplant<br />
589 II Analyse der Schädigungsmechanismen von Wälzlagern unter externen Vibrationen geplant<br />
Vorhaben<br />
432 II Schutzdichtungen für Wälzlager II laufend<br />
474 II Axiale Öldurchflussmengen durch Wälzlager verschiedener Bauformen laufend<br />
479 II Beanspruchungsgerechte Auslegung von Wälzlagersitzen unter Berücksichtigung abgeschlossen<br />
von Schlupf- und Wandereffekten; FH 956, IB 479 II
Anlage 1 Forschungsvorhaben<br />
<strong>FVA</strong>-Nr. Thema Status<br />
479 III Ringwandern bei Radiallagern unter kombinierten Lasten laufend<br />
493 II Einfluss des Partikelgehalts von Getriebeölen auf den Sekundärverschleiß laufend<br />
496 II Quantifizierung von Leisungsdichtegrenzen von Wälzlagern zur Vermeidung von abgeschlossen<br />
Drehzahlschäden; FH 991, IB 496 II<br />
589 I Bewertung von Schwingungsanregung hinsichtlich möglicher Schädigung an Wälzlagern laufend<br />
unter Einbeziehung der Umgebungskonstruktion<br />
597 I Verschleißmechanismen in langsamlaufenden, vollrolligen Zylinderrollenlagern laufend<br />
625 I Entwicklung von Berechnungsmodulen zur Mehrkörpersimulation von Wälzlagern in Simpack laufend<br />
650 I Untersuchung des Schädigungsmechanismus und der zulässigen Lagerstrombelastung<br />
von (isolierten) Wälzlagern in E-Motoren und Generatoren verursacht durch parasitäre<br />
hochfrequente Lagerströme<br />
laufend<br />
AK Welle-Nabe-Verbindungen<br />
Obmann: Dr. Romanos, Henkel KGaA<br />
Anträge<br />
T 1132 Optimierung des Zahnwellenprofils primär zur Drehmomentübertragung unter geplant<br />
Berücksichtigung wirtschaftlicher Fertigungsmöglichkeiten<br />
T 1197 Wellenberechnung DIN 743 - Berechnung von großen Wellen oder wellenartigen Bauteilen geplant<br />
unter Verwendung des Konzepts der örtlichen Spannung<br />
549 II Fortsetzung zu Gestaltfestigkeit von Pressverbindungen geplant<br />
579 II Kollektivbelastungen bei Welle-Nabe-Verbindungen II geplant<br />
624 II Entwicklung eines Bewertungsverfahrens zur beanspruchungsgerechten geplant<br />
Vorhaben<br />
Auslegung/Auswahl von Anti-Fretting-Coatings<br />
217 V Erstellung des Passfeder-Berechnungsprogramms KeyFit sowie Integration in die <strong>FVA</strong>-Workbench laufend<br />
321 V Untersuchungen zum Einfluss von Kerben auf den Wöhlerlinienverlauf und der Wirkung von laufend<br />
Zugeigenspannungen infolge statischer Maximallast auf die Dauerfestigkeit<br />
390 II Eignung alternativer Beschichtungsverfahren zur Herstellung von Press-Presslöt-Verbindungen laufend<br />
402 III Dauergestaltfestigkeitsuntersuchungen an einsatzgehärteten Passfederverbindungen laufend<br />
467 II Tragfähigkeit von Profilwellen (Zahnwellen-Verbindungen) unter typischen Einsatzbedingungen laufend<br />
566 I Übertragungsfähigkeit von Klemmverbindungen unter besonderer Berücksichtigung abgeschlossen<br />
von plastischen Verformungen; FH 993, IB 566 I<br />
579 I Kollektivbelastungen bei Welle-Nabe-Verbindungen laufend<br />
591 I <strong>FVA</strong>-Berechnungsrichtlinie für Zahnwellen-Verbindungen laufend<br />
600 I Zulässige Flächenpressung bei Passfederverbindungen laufend<br />
53
54<br />
Anlage 1 Forschungsvorhaben<br />
<strong>FVA</strong>-Nr. Thema Status<br />
624 I Benchmarkstudie "Anti-Fretting-Coatings" laufend<br />
658 I Untersuchungen von Pressverbindungen mit gerändelter Welle laufend<br />
AK Werkstoffe<br />
Obmann: Lehne, Siemens AG<br />
Themenvorschläge<br />
T 1247 Wasserstoffaufnahme beim Einsatzhärten geplant<br />
Anträge<br />
T 1246 Einfluss des Abschliffbetrags auf die Zahnflankentragfähigkeit großmoduliger geplant<br />
einsatzgehärteter Zahnräder<br />
482 IV Tribologische Flankentragfähigkeit von nitrierten innen- und außenverzahnten Stirnrädern geplant<br />
bei geringer Umfangsgeschwindigkeit<br />
501 III Vergleichbarkeit von Couponprobe und verzahntem Großgetriebebauteil geplant<br />
513 III Untersuchung verschiedener Gefüge in der Randschicht einsatzgehärteter Proben und geplant<br />
Zahnräder bezüglich der Festigkeitseigenschaften<br />
521 II Tragfähigkeit gestrahlter und gleitgeschliffener Zahnflanken unter besonderer geplant<br />
Berücksichtigung des Randzonen- und des Schmierfilmzustands<br />
615 II Tiefnitrieren von Zahnrädern geplant<br />
Vorhaben<br />
293 III Tragfähigkeitsgewinn durch hochreine Stähle laufend<br />
386 II Ergänzungsvorhaben Produktsicherheit nitrierter Zahnräder laufend<br />
448 II Entwicklung optimierter Werkstoffzustände durch Anwendung einer modifizierten laufend<br />
Prozessführung während des Niederdruckaufkohlens<br />
453 II Einfluss der Schleifbearbeitung auf Randzonenkennwerte und Zahnflankentragfähigkeit laufend<br />
unter besonderer Berücksichtigung einer zusätzlichen Oberflächenbearbeitung<br />
497 I Wärmebehandlungsfreie Fertigung von randschichtgehärteten Bauteilen durch plastische laufend<br />
Randverformung von Werkstoffen mit hohem Gehalt an metastabilem Austenit<br />
501 II Gefügeeinflüsse aus der Einsatzhärtung auf die Zahnfußtragfähigkeit von großmoduligen laufend<br />
Zahnrädern<br />
513 I Carbonitrieren von verzahnten Getriebebauteilen laufend<br />
521 I Steigerung der Zahnflankentragfähigkeit durch Kombination von Strahlbehandlung und laufend<br />
Finishingprozess<br />
539 I Lebensdauer von einsatzgehärteten Getriebewellen bei Kollektivbelastungen laufend<br />
556 I Entwicklung eines erweiterten Berechnungsverfahrens zur Ermittlung optimaler laufend<br />
Zahnflankentragfähigkeit bis in den Bereich großer Werkstofftiefen
<strong>FVA</strong>-Nr. Thema Status<br />
595 I Einfluss des Restaustenits und seiner Eigenschaften auf das Verhalten von laufend<br />
Wälzlagerstählen bei Partikelüberrollung<br />
605 I Untersuchung und Bewertung von alternativen Oberflächenverfestigungsverfahren für laufend<br />
gekerbte Bauteile<br />
610 I Referenzwerte zur Zahnradtragfähigkeit moderner Zahnradstähle im Weltmarkt laufend<br />
- Erweiterte Literaturauswertung und Definition eines Werkstoff-Referenz-Prüfverfahrens<br />
612 I Einfluss von tiefen Temperaturen auf die Festigkeitseigenschaften einsatzgehärteter und laufend<br />
verzahnter Bauteile<br />
615 I Tiefnitrieren von Zahnrädern - Studie laufend<br />
628 I Innovative Konzepte zur Steigerung der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit laufend<br />
hochbeanspruchter Bauteile<br />
660 I Tragfähigkeit und Festigkeitseigenschaften induktionsgehärteter Zahnräder laufend<br />
AG Design for Reliability<br />
T 1173 Tragfähigkeit von Stirnrädern unter Gesichtspunkten einer modifizierten geplant<br />
Überlebenswahrscheinlichkeit<br />
T 1219 Strukturierte Erfassung und Auswertung der Zuverlässigkeit von Methoden geplant<br />
für "Design for Reliability""<br />
AG Gewindeformschrauben<br />
608 I Einfluss von Gußtoleranzen, Betriebstemperatur und -kraft auf die eingebrachte laufend<br />
Vorspannungskraft bzw. den Vorspannkraftverlust an Hand von Untersuchungen an Getriebegehäusen<br />
mit gewindeformenden und metrischen Stahlschrauben<br />
AG Mehrkörpersimulation<br />
603 II Einbinden elastischer FE-Körper in die Mehrkörpersimulation (Praktische Grundlagen, geplant<br />
AG Workbench<br />
Anträge<br />
Methoden und Anwendungen)<br />
T 1229 Erweiterte Leistungsfähigkeit von Welle-Lager-Berechnungen mit dem Modul WELLAG geplant<br />
Vorhaben<br />
777 I Restrukturierung des Stplus Quelltextes und Anpassung an aktuelle Erfordernisse, laufend<br />
Modulerstellung aus STplus und RIKOR<br />
Anlage 1 Forschungsvorhaben<br />
55
56<br />
Anlage 1 Forschungsvorhaben<br />
<strong>FVA</strong>-Nr. Thema Status<br />
Softwarestrategie / Workbench<br />
Vorsitzender: Haefke, <strong>FVA</strong> GmbH<br />
Vorhaben<br />
555 IX Lastkollektive für die <strong>FVA</strong>-Workbench abgeschlossen<br />
555 XIII Datenbankenreorganisation abgeschlossen<br />
555 XIV Logik und Räderketten abgeschlossen<br />
555 XV Usability abgeschlossen<br />
555 XVII Erweiterung Scripting abgeschlossen<br />
555 XVIII Untersuchung von 3D-Visualisierungstoolkits für die <strong>FVA</strong>-Workbench laufend<br />
555 XIX Spezifikation ZIP-Archiv basierte Projektsicherung laufend<br />
555 XX Welleneditor II laufend<br />
555 XXI Spezifikation Usability II laufend<br />
555 XXII Spezifikation Berichterstellung mit MS-Office II laufend<br />
555 XXIII Spezifikation Autom. Berechnungen II laufend<br />
Themen aus der Netzwerkinitiative E-MOTIVE<br />
Kooperationen mit anderen Forschungsvereinigungen<br />
Windenergieanlagen (gemeinsam mit DFMRS bzw. DST)<br />
508 I Simulation, Beobachtung und regelungstechnische Minimierung der dynamischen laufend<br />
Belastungen in Triebsträngen von Windenergieanlagen<br />
Themen aus der Netzwerkinitiative E-MOTIVE: Leittechnologien für KMU/E-Antrieb.NET<br />
Vorhaben<br />
629 I Modellierung von Lithium Ionen Zellen: von der Empirik zum Verständnis laufend<br />
630 I Qualitätssicherung in der Produktion von Lithium-Ionen-Batterien für laufend<br />
Elektromobilitätsanwendungen<br />
631 I Optimierung und Weiterentwicklung hartmagnetischer Werkstoffe hinsichtlich ihrer laufend<br />
Anwendung in elektrischen Antrieben<br />
632 I Steigerung der Drehmomentdichte hocheffizienter Elektromotoren unter Berücksichtigung laufend<br />
ihrer Eignung für hochautomatisierte Serienproduktion<br />
633 I Adaptives Effizienz- und Temperaturmanagement von Antriebssystemen für die Elektrorotraktion laufend<br />
634 I Bewertung der Zuverlässigkeit von Leistungselektronik unter Automotive-Bedingungen laufend<br />
635 I Kühlkonzepte-/Wärmemanagement, PlugIn laufend
Anlage 1 Forschungsvorhaben<br />
<strong>FVA</strong>-Nr. Thema Status<br />
Themen aus der Netzwerkinitiative E-MOTIVE: KoPa II "Antriebskonzepte für Elektro- und Hybridfahrzeuge"<br />
Vorhaben<br />
636 I Weichmagnetische Werkstoffe für die E-Traktion - Optimaler Werkstoffeinsatz und Design laufend<br />
637 I Halbleitertechnologien für schnell taktende, hoch effiziente Stromrichter in Anwendungen<br />
mit extremen, automotiven Umweltbedingungen<br />
laufend<br />
638 I Bestimmung eines optimalen Spannungsbereichs für zukünfitge Hybrid- und Elektrofahrzeuge laufend<br />
639 I Einfluss von Ruhezeiten auf die Lebensdauer von Lithium-Ionen-Batterien laufend<br />
640 I Batteriemanagement und -Diagnose unter thermischen Belastungen laufend<br />
641 I Identifikation optimaler Antriebsstrangkonfigurationen für Elektrofahrzeuge laufend<br />
Themen aus der Netzwerkinitiative E-MOTIVE: Einzelprojekte<br />
Anträge<br />
T 1250 Effizienzsteigerung mobiler Arbeitsmaschinen durch Modellbildung elektrisch hybrider geplant<br />
Antriebsstrangtopologien<br />
T 1252 Definition und Auswahl von spezifikationsrelevanten Prüfungen für die Entwicklung und geplant<br />
Serienüberwachung von Hochleistungspermanentmagneten<br />
636 II Aufbau einer Materialdatenbank unterschiedlicher Elektrobandgüten für den geplant<br />
Einsatz in Kfz-Elektromotoren<br />
641 II EVID2 - Erweiterung der EVID-Methode (Identifikation optimaler geplant<br />
Antriebsstrangkonfigurationen für Elektrofahrzeuge)<br />
<strong>FVA</strong>/FVV CO2-Sonderforschungsprogramm<br />
FVV 965 Ladeluftkühlung durch Nutzung der Abgaswärmeenergie laufend<br />
FVV 1004 Darstellung der Optimierungspotenziale infolge optimierten Thermomanagements laufend<br />
anhand unterschiedlicher Fahrzyklen und Fahrzeuge mit Hilfe eines Auslegungswerkzeugs<br />
für Kühlsysteme unter Einbindung aller Wärmequellen und -senken im Motorraum<br />
FVV 1005 Studie zur Verfügbarkeit von Dimethylether (DME) als alternativer Kraftstoff und seiner<br />
Verwendung in Verbrennungsmotoren<br />
laufend<br />
FVV 1007 Restwärmenutzung durch intelligente Speicher- und Verteilungssysteme laufend<br />
FVV 1008 Innovative Zündsysteme im Cluster; Down-Sizing mit Biokraftstoffen; - Zündung für<br />
Hochaufladung und verdünnte Gemische<br />
laufend<br />
FVV 1009 Studie zur Bewertung verschiedener nachgelagerter Kreisprozesse laufend<br />
FVV 1010 Definition und Auswahl von spezifikationsrelevanten Prüfungen für die Entwicklung und<br />
Serienüberwachung von Hochleistungspermanentmagneten<br />
laufend<br />
FVV 1011 Untersuchung zur optimierten Auslegung von Hybridantriebsträngen unter<br />
realen Fahrbedingungen<br />
laufend<br />
57
58<br />
Anlage 1 Forschungsvorhaben<br />
<strong>FVA</strong>-Nr. Thema Status<br />
FVV 1012 Wirkungsgradverbesserung durch Reduzierung der Schleppverluste an Lamellenkupplungen laufend<br />
FVV 1013 Einfluss der Drehzahl bei der Auslegung der Komponenten elektrischer Antriebe laufend<br />
FVV 1014 Fuel Economy Öle – Nachweis der Betriebssicherheit durch Versuche an Scheiben,<br />
Zahnrädern, Lamellenkupplungen und Synchronisierungen sowie Auswirkung der<br />
Schmierstoffformulierung auf den Getriebewirkungsgrad unter Einbeziehung<br />
bedarfsgerechter Beölung<br />
laufend<br />
FVV 1015 Konzeptstudie Motor B laufend<br />
FVV 1026 Abgaswärmenutzung zur Kühlung der Ladeluft eines aufgeladenen Verbrennungsmotors laufend<br />
FVV 1027 Potenziale von Ladungswechsel-Variabilitäten im Hinblick auf Emission, Dynamik und<br />
Abgastemperaturverhalten beim Pkw-Dieselmotor<br />
laufend<br />
FVV 1037 Schmierölverdünnung durch Biokraftstoffe bei DE Ottomotoren laufend<br />
FVV 1060 Abwärmenutzung (Expansionsmaschine) Analyse und Entwicklung einer Expansionsmaschine<br />
für nachgelagerter Arbeitsprozesse<br />
laufend<br />
<strong>FVA</strong> T 1157 Optimierung und Reibungsreduzierung von Drehdurchführungen geplant<br />
<strong>FVA</strong> 619 Tribologisches Verhalten neuartiger Fuel Economy Öle in Wälzlagern laufend<br />
Cluster Low Friction Powertrain (gemeinsam mit FVV)<br />
<strong>FVA</strong> 582 Bestimmung der Tragfähigkeit von verlustoptimierten Verzahnungen und Untersuchungen zum laufend<br />
Wirkungsgrad und zum Geräuschverhalten von diesen Verzahnungen<br />
<strong>FVA</strong> 583 A1.2 Bestimmung und Modellierung der thermophysikalischen Eigenschaften von Schmier- und laufend<br />
Kraftstoffen unter hohen Drücken<br />
<strong>FVA</strong> 584 G3.1 Berechnung der Getriebetemperatur für instationäre Zustände laufend<br />
<strong>FVA</strong> 585 A1.1 Grundlagen zur Reibungsminimierung in geschmierten Kontakten laufend<br />
FVV 970 A3.1 - Elasto-hydrodynamische Wälz-/Gleitkontakte rauer Oberflächen laufend<br />
FVV 971 A3.2 - Tribologische Charakterisierung rauer Oberflächen laufend<br />
FVV 972 M1.1 - Erarbeitung intelligenter Wärmemanagement Strategien zur Reduktion des<br />
Kraftstoffverbrauchs durch Reibleistungsverminderung bei Motor-Stop-Start und Warmlauf<br />
sowie in der Teillast und durch Verringerung der Öl- und Kühlwasserpumpenleistung<br />
laufend<br />
FVV 973 M1.2 - Grundlegende experimentelle Untersuchungen zur bedarfsgerechten Kolbenkühlung<br />
durch Ölspritzkühlung an der Kolbenunterseite mit Anwendung und Übertragung der<br />
Ergebnisse auf den Vollmotor<br />
laufend<br />
FVV 974 M2.1 - Erarbeitung von Konstruktionsparametern einer reibungsverbesserten Kolbengruppe<br />
zur Reduktion der innermotorischen Verlustleistung mittels eines hybriden Ansatzes aus<br />
Grundlagenuntersuchungen, validierenden Messungen und Simulationen<br />
laufend<br />
FVV 975 M3.1 - Erforschung von reibungsreduzierenden Maßnahmen an Gleitlagern unter<br />
Erhöhung der Lagerlasten auf Werte >150 MPa durch Lagergeometrien, Beschichtungen und<br />
Oberflächenstrukturen<br />
laufend
Anlage 1 Forschungsvorhaben<br />
<strong>FVA</strong>-Nr. Thema Status<br />
FVV 976 M3.2 - Entwicklung einer CAE-gestützten Methodik zur akustischen Optimierung von Kurbeltrieb- laufend<br />
Wälzlagerkonstruktionen im Verbrennungsmotor<br />
FVV 977 M3.4 - Hochlaufsimulation thermomechanisch/elastohydrodynamisch gekoppelter laufend<br />
Tribosysteme im Zeitbereich<br />
FVV 978 M3.5 - Potenzialanalyse zur Reibungsreduktion der Kurbelwellengleitlager mithilfe EHD/MKS- laufend<br />
Simulationstechnik und Komponentenversuch<br />
FVV 979 M3.6 - Grundlagen reibungsarmer Wälzlager - Konzeptionierung & Dimensionierung laufend<br />
FVV 980 A2.1 Simulation Verluste Gesamtantriebsstrang laufend<br />
FVV 981 G 2.1 Wirkungsgradoptimiertes Getriebe laufend<br />
FVV 982 M2.2 Reibungsverluste Kolben / Kolbenring / Liner laufend<br />
FVV 983 M3.3 Energetisch optimierte Ölversorgung von Kurbelwellen-Gleitlagern laufend<br />
Legende Status<br />
geplant Themenvorschläge und Anträge, welche noch nicht vom Vorstand bewilligt/befürwortet wurden<br />
laufend Laufende Vorhaben<br />
abgeschlossen Vorhaben die seit dem letzten <strong>Geschäftsbericht</strong> abgeschlossen wurden<br />
FKM-Forschungshefte<br />
Berichtszeitraum Oktober 2010 bis Oktober <strong>2011</strong><br />
Anlage 2 Forschungshefte<br />
Heft-Nr. FKM-Nr. Kennwort/Beschreibung Berichtsart<br />
310 280 Einsatzhärten und Dauerfestigkeit Abschlussbericht<br />
Einsatzhärten und Dauerfestigkeit<br />
311 287 Fettgefüllte Berührungsfreie Wellendichtungen Abschlussbericht<br />
Berührungsfreie Wellendichtungen mit Fettfüllung<br />
zur Schmutzabdichtung<br />
312 285 Strukturanalyse<br />
Drall- und Mikrostrukturanalyse zur funktionellen<br />
Bewertung von Dichtringgegenlaufflächen<br />
Abschlussbericht<br />
67
Verwendete Abkürzungen<br />
AiF Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke“ e.V.<br />
AK Arbeitskreis<br />
AVIF Forschungsvereinigung der Arbeitsgemeinschaft der Eisen<br />
und Metallverarbeitenden Industrie e.V.<br />
AWT Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlungstechnik<br />
BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung<br />
BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie<br />
DFG Deutsche Forschungsgesellschaft<br />
DIN Deutsches Institut für Normung e.V.<br />
DST Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e.V.<br />
FAT Forschungsvereinigung Automobiltechnik e.V.<br />
FH Forschungsheft<br />
FKM Forschungskuratorium Maschinenbau e.V.<br />
FMS Fachverband der Maschinen - und Stahlbauindustrie<br />
FuE Forschung und Entwicklung<br />
<strong>FVA</strong> Forschungsvereinigung Antriebstechnik e.V.<br />
FVV Forschungsvereinigung Verbrennungskraftmaschinen e.V.<br />
FWF Forschungsvereinigung Werkzeugmaschinen<br />
und Fertigungstechnik e.V.<br />
IB Informationsblatt<br />
ifo Institut für Wirtschaftsforschung<br />
IGF Industrielle Gemeinschaftsforschung<br />
IMU Industrieverband Massivumformung e.V.<br />
ISO International Organization for Standardization<br />
RWDR Radialwellendichtring<br />
TU Technische Universität<br />
VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.<br />
ZUTECH Zunkunfts-Technologien der AiF (Sonderprogramm)<br />
Anlage 3 Abkürzungen<br />
69
70<br />
Anlage 4 Mitgliederverzeichnis<br />
Mitgliederverzeichnis<br />
A<br />
ABM Greiffenberger<br />
Antriebstechnik GmbH<br />
Friedenfelser Str. 24<br />
95615 Marktredwitz<br />
ADDINOL Lube Oil GmbH<br />
Am Haupttor/Gebäude 4609<br />
06237 Leuna<br />
Afton Chemical GmbH<br />
Strassenbahnring 3<br />
20251 Hamburg<br />
AGCO GmbH<br />
Johann-Georg-Fendt-Str. 4<br />
87616 Marktoberdorf<br />
AKB-Antriebstechnik GmbH<br />
Dänischburger Landstr. 77-79<br />
23569 Lübeck<br />
ALD Vacuum Technologies GmbH<br />
Wilhelm-Rohn-Str. 35<br />
63450 Hanau<br />
ANDRITZ HYDRO GmbH<br />
Escher-Wyss-Str. 25<br />
88212 Ravensburg<br />
ASS AG Antriebstechnik<br />
Hauptstr. 50<br />
CH-3186 Düdingen<br />
Christoph Aßmann<br />
Talbotstraße 11<br />
52068 Aachen<br />
ATEK Antriebstechnik<br />
Willi Glapiak GmbH<br />
Peiner Hag 11<br />
25497 Prisdorf<br />
ATLANTA Antriebssysteme<br />
E. Seidenspinner GmbH & Co. KG<br />
Carl-Benz-Str. 16<br />
74321 Bietigheim-Bissingen<br />
Atlas Copco ENERGAS GmbH<br />
Schlehenweg 15<br />
50999 Köln<br />
A. T. Süd GmbH<br />
Rudolf-Diesel Str. 11<br />
85101 Lenting<br />
AUDI AG<br />
August-Horch-Str. 1<br />
85055 Ingolstadt<br />
B<br />
Carl Bechem GmbH<br />
Weststr. 120<br />
58089 Hagen<br />
BASF Personal Care<br />
and Nutrition GmbH<br />
Rheinpromenade 1<br />
40789 Monheim am Rhein<br />
Bauer Gear Motor GmbH<br />
Eberhard-Bauer-Str. 36-60<br />
73734 Esslingen<br />
Bayerische Motoren Werke AG<br />
Petuelring 130, BMW Haus<br />
80807 München<br />
Bockwoldt GmbH & Co. KG<br />
Getriebemotorenwerk<br />
Sehmsdorferstr. 41-53<br />
23843 Bad Oldesloe<br />
Bonfiglioli Vectron GmbH<br />
Europark Fichtenhain B6<br />
47807 Krefeld<br />
Bodycote Wärmebehandlung GmbH<br />
Buchwiesen 6<br />
73061 Ebersbach<br />
BorgWarner<br />
Transmission Systems GmbH<br />
Kurpfalzring 167<br />
69123 Heidelberg<br />
Robert Bosch GmbH<br />
Robert-Bosch-Str. 2<br />
71701 Schwieberdingen<br />
Bosch Rexroth AG<br />
Zum Eisengießer 1<br />
97816 Lohr<br />
BP Europa SE<br />
Max-Born-Str. 2<br />
22761 Hamburg<br />
Brevini Power Transmission SPA<br />
Via Umberto Degola 14<br />
I-42100 Reggio Emilia<br />
Brevini Wind Deutschland GmbH<br />
Justus-von-Liebig-Straße 3<br />
61352 Bad Homburg<br />
Bucyrus Europe GmbH<br />
Industriestr. 1<br />
44534 Lünen<br />
Buderus Edelstahl GmbH<br />
Bruderusstr. 25<br />
35576 Wetzlar<br />
Burka-Kosmos GmbH<br />
Rödelheimer Landstr. 31<br />
60487 Frankfurt
C<br />
Centa Antriebe Kirschey GmbH<br />
Bergische Str. 7<br />
42781 Haan<br />
Claas Industrietechnik GmbH<br />
Halberstädterstr. 15-19<br />
33106 Paderborn<br />
D<br />
Daimler AG<br />
Mercedesstr. 137<br />
70546 Stuttgart<br />
John Deere Werke Mannheim<br />
John-Deere-Str. 90<br />
68163 Mannheim<br />
Demag Cranes & Components GmbH<br />
Ruhrstr. 28<br />
58300 Wetter<br />
DESCH Antriebstechnik<br />
GmbH & Co. KG<br />
Kleinbahnstr. 21<br />
59759 Arnsberg<br />
Deutsche Edelstahlwerke GmbH<br />
Auestr. 4<br />
58452 Witten<br />
DEUTZ AG<br />
Ottostr. 1<br />
51149 Köln-Porz<br />
Diehl Metall Stiftung & Co. KG<br />
Werk Röthenbach<br />
Heinrich-Diehl-Str. 9<br />
90552 Röthenbach<br />
Mineralöl-Raffinerie Dollbergen GmbH<br />
Bahnhofstr. 82<br />
31311 Uetze<br />
Lindauer DORNIER GmbH<br />
Rickenbacherstr. 119<br />
88131 Lindau<br />
Dow Deutschland<br />
Anlagengesellschaft mbH<br />
Am Kronberger Hang 4<br />
65824 Schwalbach<br />
E<br />
Eich Rollenlager GmbH<br />
Weg zum Wasserwerk 16<br />
45525 Hattingen<br />
Eickhoff Maschinenfabrik GmbH<br />
Hunscheidtstr, 176<br />
44789 Bochum<br />
Eisenbeiss GmbH<br />
Lauriacumstr. 2<br />
A-4470 Enns<br />
EJOT GmbH & Co. KG<br />
Industrial fasteners division<br />
Untere Bienhecke<br />
57334 Bad Laasphe<br />
G. Elbe & Sohn GmbH & Co. KG<br />
Gerokstr. 100<br />
74321 Bietigheim-Bissingen<br />
eldec Schwenk Induction GmbH<br />
Otto-Hahn-Str. 14<br />
72280 Dornstetten<br />
ELTRO GmbH<br />
Arnold-Sommerfeld-Ring 3<br />
52499 Baesweiler<br />
Engineering Center Steyr<br />
GmbH & Co. KG<br />
Steyrer Str. 32<br />
A-4300 St. Valentin<br />
ESSO Deutschland GmbH<br />
Caffamacherreihe 5<br />
20355 Hamburg<br />
Eurocopter Deutschland GmbH<br />
Industriestr. 4<br />
86609 Donauwörth<br />
Evonik RohMax Additives GmbH<br />
Kirschenallee<br />
64293 Darmstadt<br />
F<br />
Fässler AG<br />
Ringstr. 20<br />
CH-8600 Dübendorf<br />
FCMD GmbH<br />
Schmiedestr. 5<br />
45527 Hattingen<br />
FIMA Maschinenbau GmbH<br />
Oberfischacher Str. 58<br />
74423 Obersontheim<br />
FLSmidth MAAG Gear AG<br />
Lagerhausstr. 11<br />
CH-8401 Winterthur<br />
Ford-Werke GmbH<br />
Spessartstr.<br />
50725 Köln<br />
FRENCO GmbH<br />
Jakob-Baier-Str. 3<br />
90518 Altdorf<br />
Anlage 4 Mitgliederverzeichnis<br />
Freudenberg Sealing Technologies<br />
GmbH & Co. KG<br />
Höhnerweg 2-4<br />
69469 Weinheim<br />
FUCHS EUROPE Schmierstoffe GmbH<br />
Friesenheimer Str. 19c<br />
68169 Mannheim<br />
71
72<br />
Anlage 4 Mitgliederverzeichnis<br />
Fuchs Lubritech GmbH<br />
Werner-Heisenberg-Straße 1<br />
67661 Kaiserslautern<br />
G<br />
GEA Westfalia Separator<br />
Group GmbH<br />
Werner-Habig-Str. 1<br />
59302 Oelde<br />
Georgsmarienhütte GmbH<br />
Neue Hüttenstr. 1<br />
49124 Georgsmarienhütte<br />
GETRAG Getriebe- und Zahnradfabrik<br />
Hermann Hagenmeyer GmbH & Cie. KG<br />
Hermann-Hagenmeyer-Str.<br />
74199 Untergruppenbach<br />
GETRAG S.p.a.<br />
Via dei Ciclamini 4<br />
I-70026 Modugno (BA)<br />
Getriebebau Nord GmbH & Co. KG<br />
Rudolf-Diesel-Str. 1<br />
22941 Bargteheide<br />
Getriebetechnik Magdeburg GmbH<br />
Steinfeldstraße 14<br />
39179 Barleben<br />
GFC AntriebsSysteme GmbH<br />
Grenzstr. 5<br />
01640 Coswig<br />
GGB Heilbronn GmbH<br />
Ochsenbrunnenstr. 9<br />
74078 Heilbronn<br />
GHH-RAND<br />
Schraubenkompressoren GmbH<br />
Steinbrinkstr. 1<br />
46145 Oberhausen<br />
GKN Driveline International GmbH<br />
Hauptstr. 130<br />
53797 Lohmar<br />
GLEASON-PFAUTER<br />
Maschinenfabrik GmbH<br />
Daimlerstr. 14<br />
71636 Ludwigsburg<br />
GMN Paul Müller Industrie<br />
GmbH & Co. KG<br />
Äußere Bayreuther Str. 230<br />
90411 Nürnberg<br />
Härterei Carl Gommann GmbH<br />
Dreiangelstr. 29<br />
42855 Remscheid<br />
GTL Getriebetechnik Leipzig GmbH<br />
Polygraphstr. 2<br />
04435 Schkeuditz<br />
Güdel AG<br />
Industrie Nord<br />
CH-4900 Langenthal<br />
H<br />
Hanomag Härtecenter GmbH<br />
Merkurstr. 14<br />
30419 Hannover<br />
Hansen Transmissions<br />
International N.V.<br />
Leonardo da Vincilaan 1<br />
B-2650 Edegem<br />
Harmonic Drive AG<br />
Hoenbergstr. 14<br />
65555 Limburg<br />
Harms Lohnhärterei GmbH + Co. KG<br />
Salbker Str. 23<br />
39120 Magdeburg<br />
HEAD acoustics GmbH<br />
Ebertstraße 30a<br />
52134 Herzogenrath<br />
Heidelberger Druckmaschinen AG<br />
Kurfürsten Anlage 52-60<br />
69115 Heidelberg<br />
Henkel AG & Co. KGaA<br />
Gutenbergstr. 3<br />
85748 Garching<br />
Henschel Antriebstechnik GmbH<br />
Henschelplatz 1<br />
34127 Kassel<br />
Hexagon Metrology GmbH<br />
Siegmund-Hiepe-Str. 2-12<br />
35578 Wetzlar<br />
HEYNAU<br />
GearsProductionService GmbH<br />
Tuchwalkerstr. 5<br />
84034 Landshut<br />
HOERBIGER Antriebstechnik<br />
Holding GmbH<br />
Bernbeurenerstr. 13-17<br />
86956 Schongau<br />
Höfler Maschinenbau GmbH<br />
Industriestr. 19<br />
76275 Ettlingen<br />
Hör Technologie GmbH<br />
Dr.-von-Fromm-Str. 5<br />
92637 Weiden<br />
HYDAC FILTERTECHNIK GmbH<br />
Justus-von-Liebig-Str.<br />
66273 Sulzbach<br />
I<br />
IAV GmbH<br />
Kauffahrtei 45<br />
09120 Chemnitz<br />
IMO Holding GmbH<br />
Gewerbepark 16<br />
91350 Gremsdorf<br />
INA - Drives & Mechatronics<br />
GmbH & Co. oHG<br />
Mittelbergstr. 2<br />
98527 Suhl<br />
J<br />
Jahnel-Kestermann Getriebewerke<br />
GmbH<br />
Hunscheidtstr.116<br />
44789 Bochum<br />
Jungheinrich AG<br />
Am Stadtrand 35<br />
22047 Hamburg<br />
K<br />
DR. KAISER DIAMANTWERKZEUGE<br />
GmbH & Co. KG<br />
Am Wasserturm 33 G<br />
29223 Celle
KAPP GmbH<br />
Callenbergerstr. 52<br />
96450 Coburg<br />
Carl u. Wilhelm Keller GmbH & Co. KG<br />
Bonner Str. 38<br />
53842 Troisdorf<br />
KESSLER & Co. GmbH & Co. KG<br />
Hüttlinger Str. 18-20<br />
73453 Abtsgemünd<br />
Klingelnberg AG<br />
Binzmühlstr. 171<br />
CH-8050 Zürich<br />
Klingelnberg GmbH<br />
Peterstr. 45<br />
42499 Hückeswagen<br />
Klüber Lubrication München KG<br />
Geisenhausenerstr. 7<br />
81379 München<br />
K. & A. Knödler GmbH<br />
Schönbuchstr. 1<br />
73760 Ostfildern<br />
Konzelmann GmbH<br />
Lise-Meitner-Str. 15<br />
74369 Löchgau<br />
Kracht GmbH<br />
Gewerbestr. 20<br />
58791 Werdohl<br />
KSB Aktiengesellschaft<br />
Johann-Klein-Str. 9<br />
67227 Frankenthal<br />
KWD Kupplungswerk<br />
Dresden GmbH<br />
Löbtauer Str. 45<br />
01159 Dresden<br />
L<br />
LAIS GmbH<br />
Dorfstraße 3<br />
56322 Spay<br />
Lenze SE<br />
Breslauer Str. 3<br />
32699 Extertal<br />
Liebherr Aerospace<br />
Lindenberg GmbH<br />
Werk Friedrichshafen<br />
Adelheidstr. 40<br />
88046 Friedrichshafen<br />
Linde Material Handling GmbH<br />
Großostheimer Str. 198<br />
63741 Aschaffenburg<br />
LMT FETTE Werkzeugtechnik<br />
GmbH & Co. KG<br />
Grabauer 24<br />
21493 Schwarzenbek<br />
LTi DRIVES GmbH<br />
Gewerbestraße 5-9<br />
35633 Lahnau<br />
LUBRICANT CONSULT GmbH<br />
Gutenbergstr. 13<br />
63477 Maintal<br />
Lubrizol Deutschland GmbH<br />
Billbrookdeich 157<br />
22113 Hamburg<br />
LuK GmbH + Co. KG<br />
Industriestr. 3<br />
77815 Bühl<br />
M<br />
MAG Modul Verzahntechnik GmbH<br />
Marienberger Str. 17<br />
09125 Chemnitz<br />
MAHLE Industriefiltration GmbH<br />
Schleifbachweg 45<br />
74613 Öhringen<br />
Mahr OKM GmbH<br />
Carl-Zeiss-Promenade 10<br />
07745 Jena<br />
MAN Truck & Bus AG<br />
Dachauer Str. 667<br />
80995 München<br />
MAN Diesel & Turbo SE<br />
Steinbrinkstr. 1<br />
46145 Oberhausen<br />
manroland AG<br />
Christian-Pless-Str. 6-30<br />
63069 Offenbach<br />
Chr. Mayr GmbH + Co. KG<br />
Eichenstr. 1<br />
87665 Mauerstetten<br />
Metal Improvement Company, LLC<br />
Otto-Hahn-Str. 3<br />
59423 Unna<br />
Miba Frictec GmbH<br />
Peter-Mitterbauer-Str. 1<br />
A-4661 Roitham<br />
F. Morat & Co. GmbH<br />
Höchst 7a<br />
79871 Eisenbach<br />
Moventas GmbH<br />
Otto-Hahn-Str. 51<br />
42369 Wuppertal<br />
MTU Friedrichshafen GmbH<br />
Maybachplatz 1<br />
88045 Friedrichshafen<br />
N<br />
Neugart GmbH<br />
Keltenstr. 16<br />
77971 Kippenheim<br />
NCTEngineering GmbH<br />
Inselkammerstr. 10<br />
82002 Unterhaching<br />
NKE AUSTRIA GmbH<br />
Im Stadtgut C4<br />
A-4407 Steyr<br />
Niles Werkzeugmaschinen GmbH<br />
Nordring 20<br />
12681 Berlin<br />
O<br />
Anlage 4 Mitgliederverzeichnis<br />
O&K Antriebstechnik GmbH<br />
Nierenhofer Str. 10<br />
45525 Hattingen<br />
OELCHECK GmbH<br />
Kerschelweg 28<br />
83098 Brannenburg<br />
73
74<br />
Anlage 4 Mitgliederverzeichnis<br />
Oerlikon Balzers<br />
Coating Germany GmbH<br />
Am Ockenheimer Graben 41<br />
55411 Bingen<br />
OMS Antriebstechnik<br />
Bahnhofstr. 12<br />
36219 Cornberg<br />
Adam Opel AG<br />
Bahnhofsplatz 1<br />
65428 Rüsselsheim<br />
ORTLINGHAUS-WERKE GMBH<br />
Kenkhauser-Str. 125<br />
42929 Wermelskirchen<br />
OSK - Kiefer GmbH<br />
Göppertshausen 5-6<br />
85238 Petershausen<br />
OSRO SUPER FINISHING GMBH<br />
Saalestr. 16<br />
47800 Krefeld<br />
OVALO GmbH<br />
Anna-Ohl-Straße 2<br />
65555 Limburg<br />
P<br />
Deutsche Pentosin-Werke GmbH<br />
Industriestr. 39-43<br />
22880 Wedel<br />
PerMaGen GmbH<br />
Robert-Bosch-Str. 10<br />
01454 Radeberg<br />
Piller Industrieventilatoren GmbH<br />
Nienhagener Str. 6<br />
37186 Moringen<br />
PIV Drives GmbH<br />
Justus-von-Liebig-Str. 3<br />
61352 Bad Homburg<br />
PlaTeG GmbH<br />
Industriestr. 13<br />
57076 Siegen<br />
Dr.-Ing. h.c. F. Porsche AG<br />
Porschestr. 42<br />
71287 Weissach<br />
Premium Stephan Hameln<br />
Ohsener Str. 79-83<br />
31789 Hameln<br />
pro-beam AG & Co. KGaA<br />
Behringstr. 6<br />
82152 Planegg<br />
PRODAN GmbH<br />
Siedlerstr. 8<br />
71126 Gäufelden<br />
R<br />
Härterei Reese Bochum GmbH<br />
Oberscheidstr. 25<br />
44807 Bochum<br />
REINTJES GmbH<br />
Eugen-Reintjes-Str. 7<br />
31785 Hameln<br />
REINZ-Dichtungs-GmbH<br />
Reinzstr. 3-7<br />
89233 Neu-Ulm<br />
Reishauer AG<br />
Industriestr. 36<br />
CH-8304 Wallisellen-Zürich<br />
RENK Aktiengesellschaft<br />
Gögginger Str. 73<br />
86159 Augsburg<br />
Rhein-Getriebe GmbH<br />
Grünstr. 34<br />
40667 Meerbusch<br />
Ricardo Deutschland GmbH<br />
Güglinstr. 66-70<br />
73529 Schwäbisch Gmünd<br />
RICHARDON GmbH<br />
Friedhofstr. 57<br />
71573 Allmersbach<br />
Rickmeier GmbH<br />
Langenholthauser Str. 20-22<br />
58802 Balve<br />
RINGSPANN GmbH<br />
Schaberweg 30-34<br />
61348 Bad Homburg<br />
Rögelberg Getriebe<br />
GmbH & Co. KG<br />
Am Rögelberg 10<br />
49716 Meppen<br />
Rolls-Royce<br />
Deutschland Ltd. & CO KG<br />
Eschenweg 11, OT Dahlewitz<br />
15827 Blankenfelde-Mahlow<br />
Rolls-Royce Marine AS<br />
dep. Propulsion Ulsteinvik<br />
Sjogata 98<br />
N-6065 Ulsteinvik<br />
Rothe Erde GmbH<br />
Tremoniastr. 5-11<br />
44137 Dortmund<br />
RS Antriebstechnik GmbH<br />
Oberstdorfer Str. 24<br />
87527 Sonthofen<br />
S<br />
SAINT-GOBAIN PERFORMANCE<br />
PLASTICS PAMPUS GmbH<br />
Am Nordkanal 37<br />
47877 Willich<br />
Sanders’ Ijzergieterij<br />
en Machinefabriek B.V.<br />
Wheeweg 24<br />
NL-7471 EW Goor<br />
SB LiMotive Germany GmbH<br />
Kruppstraße 20<br />
70469 Stuttgart<br />
Schaeffler Technologies<br />
GmbH & Co. KG<br />
Industriestr. 1-3<br />
91074 Herzogenaurach<br />
C.H. Schäfer Getriebe GmbH<br />
Hauptstr. 42<br />
01896 Ohorn<br />
Schmidhauser AG<br />
Obere Neustrasse 1<br />
CH-8590 Romanshorn<br />
SCHOTTEL GmbH<br />
Mainzer Str. 99<br />
56322 Spay
SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG<br />
Ernst-Blickle-Str. 42<br />
76646 Bruchsal<br />
Shell Global Solutions<br />
(Deutschland) GmbH<br />
Hohe-Schaar-Str. 36<br />
21107 Hamburg<br />
Siebenhaar Antriebstechnik GmbH<br />
Max-Eyth-Str. 5<br />
34369 Hofgeismar<br />
Siemens AG<br />
Vogelweiherstr. 1-15<br />
90441 Nürnberg<br />
Siemens<br />
Turbomachinery Equipment GmbH<br />
Heßheimer Str. 2<br />
67227 Frankenthal<br />
SKF GmbH<br />
Gunnar-Wester-Str. 12<br />
97421 Schweinfurt<br />
SKF Sealing Solutions GmbH<br />
Düsseldorfer Str. 121<br />
51379 Leverkusen<br />
SMS Siemag AG<br />
Wiesenstr. 30<br />
57271 Hilchenbach<br />
SONA BLW<br />
Präzisionsschmiede GmbH<br />
Frankfurter Ring 227<br />
80807 München<br />
SPN Schwaben Präzision<br />
Fritz Hopf GmbH<br />
Glashütter Str. 2-6<br />
86720 Nördlingen<br />
Hartmut Stelter Zahnradfabrik<br />
GmbH & Co. KG<br />
Bramstedter Kirchweg 49<br />
27211 Bassum<br />
Stiebel-Getriebebau<br />
GmbH & Co. KG<br />
Industriestr. 12<br />
51545 Waldbröl<br />
STIEBER GmbH<br />
Hatschekstr. 36<br />
69126 Heidelberg<br />
STÖBER ANTRIEBSTECHNIK<br />
GmbH & Co. KG<br />
Kieselbronner Str. 12<br />
75177 Pforzheim<br />
Stresstech GmbH<br />
Bahnhofstr. 39<br />
56462 Höhn<br />
Stromag AG<br />
Hansastr. 120<br />
59425 Unna<br />
Stüwe GmbH & Co. KG<br />
Zum Ludwigstal 35<br />
45527 Hattingen<br />
Sulzer Friction Systems<br />
(Germany) GmbH<br />
Bremer Heerstr. 39<br />
28719 Bremen<br />
Sulzer Metaplas GmbH<br />
Am Böttcherberg 30-38<br />
51427 Bergisch Gladbach<br />
SUMITOMO (SHI) CYCLO DRIVE<br />
GERMANY GmbH<br />
Cyclostr. 92<br />
85227 Markt Indersdorf<br />
Sundwiger Messingwerk<br />
GmbH & Co. KG<br />
Hönnetalstr. 110<br />
58675 Hemer<br />
T<br />
TAKRAF GmbH<br />
Bahnhofstr. 26<br />
01979 Lauchhammer<br />
Härterei Technotherm<br />
GmbH & Co. KG<br />
Zillenhardtstraße 31<br />
73037 Göppingen<br />
Thermosensorik GmbH<br />
Am Weichselgarten 7<br />
91058 Erlangen<br />
THIELENHAUS<br />
TECHNOLOGIES GmbH<br />
Schwesterstr. 50<br />
42285 Wuppertal<br />
ThyssenKrupp Fördertechnik GmbH<br />
Ernst-Heckel-Str. 1<br />
66386 St Ingbert<br />
ThyssenKrupp Presta AG<br />
Essanestr. 10<br />
LI-9492 Eschen<br />
ThyssenKrupp Presta<br />
München/Esslingen GmbH<br />
Alleenstrasse 28-30<br />
73730 Esslingen<br />
TOTAL Deutschland GmbH<br />
Schützenstr. 25<br />
10117 Berlin<br />
TSCHAN GmbH<br />
Zweibrücker Str. 104<br />
66538 Neunkirchen<br />
V<br />
VAKOMA GmbH<br />
Olvenstedter Chaussee 9<br />
39110 Magdeburg<br />
Vestas Nacelles Deutschland GmbH<br />
Hafenstr. 31<br />
23568 Lübeck<br />
Voith Hydro Holding GmbH & Co. KG<br />
Alexanderstr. 11<br />
89522 Heidenheim<br />
Voith Turbo GmbH & Co. KG<br />
Alexanderstr. 2<br />
89522 Heidenheim<br />
Voith Turbo BHS Getriebe GmbH<br />
Hans-Böckler-Str. 7<br />
87527 Sonthofen<br />
VOLKSWAGEN AG<br />
Heinrich-Nordhoff-Str.<br />
38440 Wolfsburg<br />
VULKAN Kupplungs- u. Getriebebau<br />
B. Hackforth GmbH & Co. KG<br />
Heerstr. 66<br />
44653 Herne<br />
Anlage 4 Mitgliederverzeichnis<br />
75
76<br />
Anlage 4 Mitgliederverzeichnis<br />
W<br />
WALTER Aktiengesellschaft<br />
Derendinger Str. 53<br />
72072 Tübingen<br />
WELTER zahnrad GmbH<br />
Karl-Kammer-Str. 7<br />
77933 Lahr<br />
WENZEL Präzision GmbH<br />
Im Mittelfeld 1<br />
76135 Karlsruhe<br />
Wichmann GmbH<br />
Dieselstr. 5-7<br />
49076 Osnabrück<br />
Winergy AG<br />
Am Industriepark 2<br />
46562 Voerde<br />
Winterthur Technology GmbH<br />
Hundsschleestr. 10<br />
72766 Reutlingen<br />
WITTENSTEIN alpha GmbH<br />
Walter-Wittenstein-Str. 1<br />
97999 Igersheim<br />
42329 Wuppertal<br />
Z<br />
ZAE - AntriebsSysteme<br />
GmbH & Co. KG<br />
Schützenstr. 105<br />
22761 Hamburg<br />
ZF Friedrichshafen AG<br />
Graf-von-Soden-Platz 1<br />
88046 Friedrichshafen<br />
Ziller GmbH & Co. KG<br />
Reisholzstr. 15<br />
40721 Hilden<br />
Zollern GmbH & Co. KG<br />
Heustr. 1<br />
88518 Herbertingen<br />
© <strong>FVA</strong> Forschungsvereinigung Antriebstechnik e.V.,<br />
jede Art der Vervielfältigung, auch nur auszugsweise,<br />
nur mit Genehmigung der Forschungsvereinigung<br />
Antriebstechnik e.V. gestattet<br />
Bildnachweis: s.1 Deutsche Messe AG I s.3 Renk AG I s.5 Flender AG<br />
s.7 Nordex, <strong>FVA</strong> I s.8 Flender AG I s.24/25 <strong>FVA</strong>, Siemens AG<br />
s.26/27 <strong>FVA</strong> I s.28/29 <strong>FVA</strong> I s.32 <strong>FVA</strong> I s.34/35 <strong>FVA</strong> I s.36/37 <strong>FVA</strong>,<br />
ZF Friedrichshafen AG I s.38 Nordex SE I s.42 Kapp GmbH<br />
s.45 Lenze SE, Gommann, Kapp GmbH I s.68 ZF Friedrichshafen AG,<br />
Nordex, <strong>FVA</strong>, Reintjes GmbH, Kapp GmbH, Lenze SE I s.71 Reintjes<br />
GmbH, Lenze SE, Kapp GmbH I s.76/77 <strong>FVA</strong>, ZF Friedrichshafen AG,<br />
Reintjes GmbH, Kapp GmbH, Lenze SE, GMN Paul Müller Industrie<br />
GmbH&Co.KG
Postfach 71 08 64<br />
60498 Frankfurt<br />
Lyoner Straße 18<br />
60528 Frankfurt<br />
Tel +49 69.66 03-15 15<br />
Fax +49 69.66 03-25 15<br />
info@fva-net.de<br />
www.fva-net.de<br />
research, drive & innovation