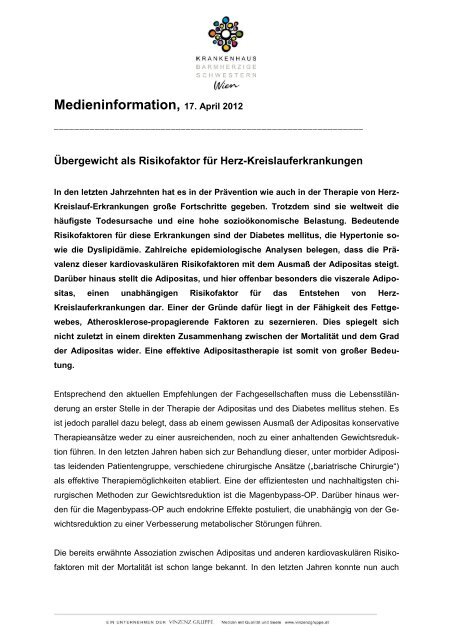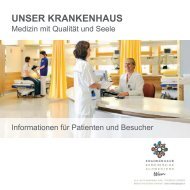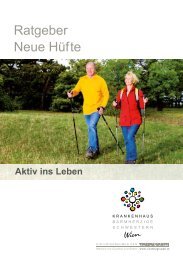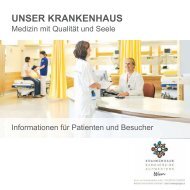Adipositas - Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Wien
Adipositas - Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Wien
Adipositas - Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Wien
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Medieninformation, 17. April 2012<br />
_____________________________________________________________<br />
Übergewicht als Risikofaktor für Herz-Kreislauferkrankungen<br />
In den letzten Jahrzehnten hat es in <strong>der</strong> Prävention wie auch in <strong>der</strong> Therapie von Herz-<br />
Kreislauf-Erkrankungen große Fortschritte gegeben. Trotzdem sind sie weltweit die<br />
häufigste Todesursache und eine hohe sozioökonomische Belastung. Bedeutende<br />
Risikofaktoren für diese Erkrankungen sind <strong>der</strong> Diabetes mellitus, die Hypertonie so-<br />
wie die Dyslipidämie. Zahlreiche epidemiologische Analysen belegen, dass die Prä-<br />
valenz dieser kardiovaskulären Risikofaktoren mit dem Ausmaß <strong>der</strong> <strong>Adipositas</strong> steigt.<br />
Darüber hinaus stellt die <strong>Adipositas</strong>, und hier offenbar beson<strong>der</strong>s die viszerale Adipo-<br />
sitas, einen unabhängigen Risikofaktor für das Entstehen von Herz-<br />
Kreislauferkrankungen dar. Einer <strong>der</strong> Gründe dafür liegt in <strong>der</strong> Fähigkeit des Fettge-<br />
webes, Atherosklerose-propagierende Faktoren zu sezernieren. Dies spiegelt sich<br />
nicht zuletzt in einem direkten Zusammenhang zwischen <strong>der</strong> Mortalität und dem Grad<br />
<strong>der</strong> <strong>Adipositas</strong> wi<strong>der</strong>. Eine effektive <strong>Adipositas</strong>therapie ist somit von großer Bedeu-<br />
tung.<br />
Entsprechend den aktuellen Empfehlungen <strong>der</strong> Fachgesellschaften muss die Lebensstilän-<br />
<strong>der</strong>ung an erster Stelle in <strong>der</strong> Therapie <strong>der</strong> <strong>Adipositas</strong> und des Diabetes mellitus stehen. Es<br />
ist jedoch parallel dazu belegt, dass ab einem gewissen Ausmaß <strong>der</strong> <strong>Adipositas</strong> konservative<br />
Therapieansätze we<strong>der</strong> zu einer ausreichenden, noch zu einer anhaltenden Gewichtsreduk-<br />
tion führen. In den letzten Jahren haben sich zur Behandlung dieser, unter morbi<strong>der</strong> Adiposi-<br />
tas leidenden Patientengruppe, verschiedene chirurgische Ansätze („bariatrische Chirurgie“)<br />
als effektive Therapiemöglichkeiten etabliert. Eine <strong>der</strong> effizientesten und nachhaltigsten chi-<br />
rurgischen Methoden zur Gewichtsreduktion ist die Magenbypass-OP. Darüber hinaus wer-<br />
den für die Magenbypass-OP auch endokrine Effekte postuliert, die unabhängig von <strong>der</strong> Ge-<br />
wichtsreduktion zu einer Verbesserung metabolischer Störungen führen.<br />
Die bereits erwähnte Assoziation zwischen <strong>Adipositas</strong> und an<strong>der</strong>en kardiovaskulären Risiko-<br />
faktoren mit <strong>der</strong> Mortalität ist schon lange bekannt. In den letzten Jahren konnte nun auch
<strong>der</strong> positive Effekt <strong>der</strong> durch chirurgische Maßnahmen unterstützten Gewichtsreduktion im<br />
Rahmen von langjährigen Endpunktstudien belegt werden. So kommt es im Vergleich zu<br />
konventionell behandelten Patientinnen und Patienten in <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> chirurgisch behan-<br />
delten Patientinnen und Patienten zu einer deutlichen Reduktion <strong>der</strong> Inzidenz von Fettstoff-<br />
wechselstörungen, Hypertonie und Diabetes mellitus. Rezenteste Daten zeigen weiters, dass<br />
sich durch den Einsatz chirurgischer Maßnahmen in <strong>der</strong> <strong>Adipositas</strong>therapie die Zahl <strong>der</strong> an<br />
einem Schlaganfall o<strong>der</strong> Herzinfarkt verstorbenen Patientinnen und Patienten halbieren<br />
lässt. Auch kann in <strong>der</strong> chirurgisch behandelten Patientengruppe im Vergleich zu einem kon-<br />
ventionell behandelten Patientenkollektiv eine deutliche Reduktion <strong>der</strong> nicht tödlich verlau-<br />
fenden Herzinfarkte beobachtet werden.<br />
Trotz dieser positiven Aspekte muss abschließend noch auf das perioperative Risiko und die<br />
potentiellen Langzeitkomplikationen bariatrischer Eingriffe hingewiesen werden. Dies wird<br />
durch die Tatsache, dass es sich bei Patientinnen und Patienten mit ausgeprägter <strong>Adipositas</strong><br />
um ein Hochrisikokollektiv handelt, noch aggraviert. Bei dem unumstritten anzustrebenden<br />
Ziel <strong>der</strong> anhaltenden Gewichtsreduktion in <strong>der</strong> Therapie <strong>der</strong> <strong>Adipositas</strong> ist somit ein sorgfälti-<br />
ges Abwägen von Nutzen und Risiko des jeweiligen Therapieansatzes gemeinsam mit <strong>der</strong><br />
Patientin o<strong>der</strong> dem Patienten sowie eine individuell abgestimmte, interdisziplinäre prä-, peri-<br />
und posteroperative Betreuung unerlässlich.<br />
Priv.-Doz. OA Dr. Wolfgang Gartner<br />
FA für Innere Medizin<br />
Ansprechpartnerin für Rückfragen:<br />
Mag. Silke Horcicka<br />
Leiterin Kommunikation<br />
<strong>Krankenhaus</strong> <strong>der</strong> <strong>Barmherzigen</strong> <strong>Schwestern</strong> <strong>Wien</strong><br />
Stumpergasse 13, 1060 <strong>Wien</strong><br />
Tel.: +43 1 599 88 – 3199<br />
Mobil: +43 664 884 93 447<br />
E-Mail: silke.horcicka@bhs.at<br />
Web: www.bhs-wien.at<br />
2/2
Medieninformation, 17. April 2012<br />
___________________________________________________________________<br />
Psychische Komponente <strong>der</strong> <strong>Adipositas</strong><br />
Bei <strong>der</strong> Entstehung von <strong>Adipositas</strong> spielen viele Faktoren eine Rolle. Aus psychologi-<br />
scher Sicht ist <strong>Adipositas</strong> keine rein körperliche Erkrankung. Es gibt eine Reihe an<br />
psychischen Faktoren, die mitbeteiligt sein können.<br />
Die psychische Komponente <strong>der</strong> <strong>Adipositas</strong> kann sehr vielschichtig sein. Im Wesentlichen<br />
werden drei Aspekte unterschieden: psychische Faktoren, die zur Entwicklung <strong>der</strong> <strong>Adipositas</strong><br />
beigetragen haben, psychische Symptome als Folge <strong>der</strong> <strong>Adipositas</strong> wie z.B. depressive Re-<br />
aktionen und psychische Faktoren, die das Essverhalten steuern (z.B. Essen als Mittel zur<br />
Stressbewältigung). Im Vergleich zu normalgewichtigen Menschen findet sich unter adipösen<br />
Menschen eine höhere Anzahl an psychischen Erkrankungen wie z.B. Depressionen und<br />
Angststörungen.<br />
Die psychologische Begutachtung ist ein wichtiger Teil <strong>der</strong> medizinischen Abklärung vor ei-<br />
ner chirurgischen <strong>Adipositas</strong>-Therapie. Im Rahmen <strong>der</strong> klinisch-psychologischen Begutach-<br />
tung kann eine möglicherweise vorliegende unbehandelte psychische Erkrankung diagnosti-<br />
ziert werden und die Patientin o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Patient noch vor <strong>der</strong> Operation zu einer entspre-<br />
chenden Behandlung überwiesen werden.<br />
Eine weitere wesentliche Aufgabe ist die Abklärung von Motivation, Wissen über den geplan-<br />
ten adipositas-chirurgischen Eingriff und Erwartungen an diesen. Unrealistische Erwartungen<br />
wie Gewichtsverlust als alleiniger Problemlöser und fehlendes Wissen über notwendige Ver-<br />
än<strong>der</strong>ungen im Essverhalten können abgeklärt und so die Mitarbeit nach <strong>der</strong> Operation op-<br />
timiert werden. Die Patienten haben durch die psychologische Begutachtung die Möglichkeit,<br />
sich nochmals mit <strong>der</strong> Entscheidung zu einem operativen Eingriff auseinan<strong>der</strong>zusetzen.<br />
Mag. Nina Sulz-Lehar<br />
Klinische Psychologin<br />
Ansprechpartnerin für Rückfragen:<br />
Mag. Silke Horcicka<br />
Leiterin Kommunikation<br />
<strong>Krankenhaus</strong> <strong>der</strong> <strong>Barmherzigen</strong> <strong>Schwestern</strong> <strong>Wien</strong><br />
Stumpergasse 13, 1060 <strong>Wien</strong><br />
Tel.: +43 1 599 88 – 3199<br />
Mobil: +43 664 884 93 447<br />
E-Mail: silke.horcicka@bhs.at<br />
Web: www.bhs-wien.at
Medieninformation, 17. April 2012<br />
___________________________________________________________________<br />
Knochen-, Fett- und Knorpelzellen in Konkurrenz<br />
<strong>Adipositas</strong> beeinflusst den Bewegungsapparat auf verschiedensten Ebenen in unse-<br />
rem Körper. Für Menschen mit krankhaftem Übergewicht bedeutet dies einerseits ein<br />
steigendes Risiko an Osteoporose zu erkranken, an<strong>der</strong>erseits auch eine stärkere Ab-<br />
nützungen <strong>der</strong> Knochen und Gelenke. Im <strong>Krankenhaus</strong> <strong>der</strong> <strong>Barmherzigen</strong> <strong>Schwestern</strong><br />
<strong>Wien</strong> wird dafür die mo<strong>der</strong>ne Analyse „Body Composition“ eingesetzt.<br />
„Die Fett- und Knochenzellen sowie die Knorpelzellen sind in unserem Körper in einem stän-<br />
digen Konkurrenzverhältnis. Je mehr Zellen dabei für die Lagerung von Fett verwendet wer-<br />
den, desto weniger Reserven bleiben für Knochen und Knorpel“, erklärt Prim. Univ.-Prof. Dr.<br />
Heinrich Resch, DVO, das Dilemma unter dem <strong>Adipositas</strong>-Patientinnen und Patienten auf<br />
molekularbiologischer Ebene leiden.<br />
Sowohl die Fett-, als auch die Knochen- und die Knorpelzellen im Körper leiten sich von <strong>der</strong><br />
gleichen multipotenten Stammzelle ab, die die Möglichkeit in sich trägt, sich zu einer dieser<br />
drei Zellen zu entwickeln. Welche es schlussendlich wird, hängt nur zu einem gewissen An-<br />
teil von Signalen innerhalb dieser Zelle ab. Bei einer Überzahl von Fettzellen wird daher die<br />
Bildung von Knochen- und Knorpelzellen gebremst. Der Effekt ist eine Schwächung <strong>der</strong> Mi-<br />
neralisierung des Knochens sowie <strong>der</strong> Stabilität des Knorpels. Auch die Tatsache, dass Fett<br />
ein Östrogenspeicher ist und dadurch vielfach auch schützend wirkt, kann diese Tatsache<br />
nicht min<strong>der</strong>n.<br />
Der Bewegungsapparat von adipösen Menschen leidet zudem unter dem stark erhöhten<br />
Körpergewicht. Knochen und Knorpel die mehr Gewicht zu tragen haben, nützen sich leich-<br />
ter ab und brechen auch leichter. Der Umbau von Muskelmasse zu Fettmasse kommt hier<br />
erschwerend hinzu.
Immer stärker wird „Body Composition“ für <strong>Adipositas</strong>-Patientinnen und Patienten eingesetzt.<br />
Die mo<strong>der</strong>ne Analyse misst das Muskel/Fett- bzw. Knochengewebe im Körper und wird im<br />
<strong>Krankenhaus</strong> <strong>der</strong> <strong>Barmherzigen</strong> <strong>Schwestern</strong> <strong>Wien</strong> angewandt. „Mit ‚Body Composition’ ha-<br />
ben wir heute die Möglichkeit nicht nur das Risiko im Einzelnen zu messen, son<strong>der</strong>n auch<br />
Therapieerfolge zu dokumentieren und so einer Rückfallsrate vorzubeugen“, betont Prof.<br />
Resch die Möglichkeiten <strong>der</strong> neuen Analyse.<br />
Prim. Univ.-Prof. Dr. Heinrich Resch<br />
FA für Innere Medizin, Rheumatologie und Gastroenterologie,<br />
Osteologe DVO<br />
Ansprechpartnerin für Rückfragen:<br />
Mag. Silke Horcicka<br />
Leiterin Kommunikation<br />
<strong>Krankenhaus</strong> <strong>der</strong> <strong>Barmherzigen</strong> <strong>Schwestern</strong> <strong>Wien</strong><br />
Stumpergasse 13, 1060 <strong>Wien</strong><br />
Tel.: +43 1 599 88 – 3199<br />
Mobil: +43 664 884 93 447<br />
E-Mail: silke.horcicka@bhs.at<br />
Web: www.bhs-wien.at<br />
2/2
Medieninformation, 17. April 2012<br />
___________________________________________________________________<br />
Ernährung nach einer magenverkleinernden Operation<br />
Für die <strong>Adipositas</strong>-Chirurgie hat die Diätologie am <strong>Krankenhaus</strong> <strong>der</strong> <strong>Barmherzigen</strong><br />
<strong>Schwestern</strong> <strong>Wien</strong> ein eigenes Programm entwickelt. Bereits vor einer Operation lernen<br />
die Patientinnen und Patienten von den Diätologinnen genau, wie sie danach ihre Er-<br />
nährung umstellen müssen. Direkt nach <strong>der</strong> Operation gibt es ein Spezialessen.<br />
Bereits ein paar Wochen vor einer magenverkleinernden (bariatrischen) Operation haben die<br />
Patientinnen und Patienten den ersten Kontakt mit den Diätologinnen des <strong>Krankenhaus</strong>es.<br />
Sie werden von ihnen vorbereitet, wie sie sich vor <strong>der</strong> Operation ernähren sollen, was sie<br />
direkt nach <strong>der</strong> Operation erwartet und wie sie ihre Ernährung langfristig umstellen müssen.<br />
Extra entwickelt wurde von den Diätologinnen das Essen, das bariatrische Patientinnen und<br />
Patienten in den ersten zwei bis drei Wochen nach einer Operation bekommen: 50 Milliliter<br />
umfasst eine Komponente, diese muss extra fein gemixt sein und soll im Idealfall die Konsis-<br />
tenz von Eiklar haben. Zudem sollte sie auch noch wohlschmeckend und leicht verdaulich<br />
sein. Neben drei Komponenten bei warmen Speisen (Eiweiß, Sättigungsbeilage, Gemüse) ist<br />
die ausreichende Eiweißzufuhr wichtig. Rohes Obst und Gemüse sowie Vollkornprodukte<br />
sind in dieser Zeit tabu.<br />
Die Art <strong>der</strong> Nahrungsaufnahme ist ebenfalls wichtig: Viele kleine Portionen werden langsam<br />
und über den Tag verteilt gegessen. Trotz breiiger Konsistenz sollen die Speisen sehr gut<br />
gekaut werden. Einen wichtigen Punkt betrifft auch das Achten auf das eigene Sättigungsge-<br />
fühl. „Wir sehen, dass es den Patientinnen und Patienten mit dem speziell entwickelten Es-<br />
sen deutlich besser geht als früher mit normalem Kostaufbau“, stellt Diätologin Andrea Müller<br />
fest.<br />
Nach 2 – 3 Wochen erfolgt die schrittweise Umstellung auf eine weiche, stückige Kost und<br />
nach 5 – 6 Wochen können die Patientinnen und Patienten wie<strong>der</strong> normal essen. Hier gelten<br />
die allgemeinen Empfehlungen für eine ausgewogene Ernährung. Nach dieser Zeit ist von<br />
Seiten des <strong>Krankenhaus</strong>es eine ambulante diätologische Nachkontrolle vorgesehen. In die-
sem Zeitraum führen die Patientinnen und Patienten ein Ernährungstagebuch, auf Basis<br />
dessen wird bei <strong>der</strong> Beratung individuell die weitere Vorgehensweise besprochen.<br />
Andrea Müller<br />
Diätologin<br />
Ansprechpartnerin für Rückfragen:<br />
Mag. Silke Horcicka<br />
Leiterin Kommunikation<br />
<strong>Krankenhaus</strong> <strong>der</strong> <strong>Barmherzigen</strong> <strong>Schwestern</strong> <strong>Wien</strong><br />
Stumpergasse 13, 1060 <strong>Wien</strong><br />
Tel.: +43 1 599 88 – 3199<br />
Mobil: +43 664 884 93 447<br />
E-Mail: silke.horcicka@bhs.at<br />
Web: www.bhs-wien.at<br />
2/2
Medieninformation, 17. April 2012<br />
___________________________________________________________________<br />
Mo<strong>der</strong>ne <strong>Adipositas</strong>-Chirurgie<br />
Ab einem Body Mass Index (BMI) von über 40 kg/m 2 bzw. von über 35 kg/m 2 mit ge-<br />
wichtsbedingten Zusatzerkrankungen wie Diabetes mellitus, Bluthochdruck,<br />
Schlafapnoe etc. ist die Operation die beste Therapieoption, die ausschließlich eine<br />
Aufgabe für Spezialzentren mit umfassen<strong>der</strong> Ausrüstung, Fachwissen und disziplin-<br />
übergreifendem Teamgeist ist.<br />
An <strong>der</strong> Abteilung für Chirurgie am <strong>Krankenhaus</strong> <strong>der</strong> <strong>Barmherzigen</strong> <strong>Schwestern</strong> sind mehrere<br />
Experten auf dem Gebiet <strong>Adipositas</strong>-Chirurgie tätig. Unser Ziel ist es, eine möglichst rasche<br />
Mobilisierung <strong>der</strong> Patientinnen und Patienten und damit eine schnelle Erholung nach <strong>der</strong><br />
Operation zu erreichen.<br />
Neueste Technologien im OP<br />
Am <strong>Krankenhaus</strong> <strong>der</strong> <strong>Barmherzigen</strong> <strong>Schwestern</strong> <strong>Wien</strong> kommen die neuesten Technologien<br />
für ein gewebeschonendes Operieren zum Einsatz, wobei unterschiedliche Operationstech-<br />
niken zur Verfügung stehen, die sich vereinfacht in zwei Gruppen aufteilen lassen:<br />
Restriktive Operationsmethoden: Durch die operative Verkleinerung des Magens wird<br />
ein frühes Sättigungsgefühl erzielt, wodurch die Patientinnen und Patienten kleinere<br />
Mengen an Nahrung und damit weniger Kalorien zu sich nehmen.<br />
Malabsorptive Operationsmethoden: Die Verdauungsstrecke für die Nahrung im<br />
Dünndarm wird durch die Operation verkürzt, wodurch <strong>der</strong> Körper die Kalorien nur mehr<br />
teilweise aufnehmen kann.<br />
Die meisten Operationsmethoden kombinieren restriktive und malabsorptive Effekte.<br />
Häufigste Operationsmethoden im Überblick
Verstellbares Magenband: Ein Silikonband wird um den Eingang des Magens gelegt und<br />
mit einer Titandose (unter <strong>der</strong> Haut) verbunden.<br />
Magenschlauch: Dabei handelt es sich um eine schlauchförmige Verkleinerung des Ma-<br />
gens.<br />
Magenbypass: Ein kleiner Vormagen wird gebildet und mit dem Dünndarm verbunden. Auf<br />
diese Weise kann <strong>der</strong> restliche Magen, <strong>der</strong> Zwölffingerdarm und ein Teil des oberen Dünn-<br />
darms umgangen werden.<br />
Die angeführten Operationstechniken werden alle laparoskopisch durchgeführt (d.h. es sind<br />
nur ca. 5 bis 10 Millimeter große Schnitte notwendig, über die die Operationsinstrumente<br />
eingeführt werden können.)<br />
In letzter Zeit kristallisiert sich immer mehr ein individuelles Vorgehen für die Patientinnen<br />
und Patienten bei <strong>der</strong> Wahl <strong>der</strong> Operationsmethode heraus. Es gibt keine Operationsmetho-<br />
de, die für alle Betroffenen gleichermaßen geeignet ist. Erst in Abstimmung mit <strong>der</strong> Patientin<br />
o<strong>der</strong> dem Patienten und den Fachexperten im <strong>Adipositas</strong>-Board kann die geeignete Methode<br />
gefunden werden.<br />
Prim Univ. Prof. Dr. Mag. Alexan<strong>der</strong> Klaus<br />
FA für Chirurgie<br />
Ansprechpartnerin für Rückfragen:<br />
Mag. Silke Horcicka<br />
Leiterin Kommunikation<br />
<strong>Krankenhaus</strong> <strong>der</strong> <strong>Barmherzigen</strong> <strong>Schwestern</strong> <strong>Wien</strong><br />
Stumpergasse 13, 1060 <strong>Wien</strong><br />
Tel.: +43 1 599 88 – 3199<br />
Mobil: +43 664 884 93 447<br />
E-Mail: silke.horcicka@bhs.at<br />
Web: www.bhs-wien.at<br />
2/2
Medieninformation, 17. April 2012<br />
___________________________________________________________________<br />
Bildgewinnung bei <strong>Adipositas</strong><br />
In <strong>der</strong> <strong>Adipositas</strong>-Therapie ist auch die Radiologie vor Herausfor<strong>der</strong>ungen gestellt.<br />
Durch die umfangreiche Körpermasse wird es schwieriger, eine gute diagnostische<br />
Bildqualität zu erzeugen. Das <strong>Krankenhaus</strong> <strong>der</strong> <strong>Barmherzigen</strong> <strong>Schwestern</strong> <strong>Wien</strong> ist in<br />
<strong>der</strong> Radiologie dafür personell und technisch bestens ausgestattet.<br />
Der neue Computertomograph des <strong>Krankenhaus</strong>es ist für Patientinnen und Patienten bis 220<br />
Kilogramm ausgerichtet. Zudem bietet er eine extra-große Öffnung (Gantry) von 78 Zentime-<br />
tern, um kein Beengungsgefühl während <strong>der</strong> Untersuchung aufkommen zu lassen. Auch die<br />
Röntgen-Durchleuchtung ist für übergewichtige Patientinnen und Patienten bis 230 kg ge-<br />
eignet.<br />
Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Schima leitet die Abteilung für Radiologie: „Die erhöhte Strah-<br />
lendosis kann bei <strong>Adipositas</strong>-Patienten zum Thema werden.“ Aus diesem Grund arbeitet das<br />
Spital mit speziellen Dosis-Reduktionsprogrammen, mit denen die eingesetzte Strahlendosis<br />
bei übergewichtigen Menschen um 30 bis 50 Prozent verringert werden kann.<br />
Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Schima, MSc<br />
FA für Radiologie<br />
Ansprechpartnerin für Rückfragen:<br />
Mag. Silke Horcicka<br />
Leiterin Kommunikation<br />
<strong>Krankenhaus</strong> <strong>der</strong> <strong>Barmherzigen</strong> <strong>Schwestern</strong> <strong>Wien</strong><br />
Stumpergasse 13, 1060 <strong>Wien</strong><br />
Tel.: +43 1 599 88 – 3199<br />
Mobil: +43 664 884 93 447<br />
E-Mail: silke.horcicka@bhs.at<br />
Web: www.bhs-wien.at
Medieninformation, 17. April 2012<br />
___________________________________________________________________<br />
<strong>Adipositas</strong> und Anästhesie<br />
<strong>Adipositas</strong> wird mittlerweile als eigenständige Krankheit anerkannt. Die World Health<br />
Organization (WHO) spricht von einer weltweiten Epidemie. Folgeerkrankungen betref-<br />
fen alle Organsysteme und damit steigt das perioperative Morbiditäts- bzw. Letalitäts-<br />
risiko.<br />
Vorbereitung<br />
Welche präoperativen Untersuchungen notwendig sind, unterscheidet sich nicht von den<br />
präoperativen Vorbereitungen bei normalgewichtigen Patienten, son<strong>der</strong>n richtet sich viel-<br />
mehr nach den Beschwerden und Begleiterkrankungen, die anamnestisch erhoben werden.<br />
Die präoperativen Untersuchungen dienen dazu, das individuelle Risiko <strong>der</strong> Patientin o<strong>der</strong><br />
des Patienten einschätzen zu können. Die anästhesiologische Evaluation <strong>der</strong> Begleiterkran-<br />
kungen erfolgt mit beson<strong>der</strong>em Augenmerk auf bestehende Herz- und Lungenfunktionsein-<br />
schränkungen (z. B. Kardiomyopathien, obstruktive Ventilationsstörungen).<br />
Narkose<br />
Indikatoren für eine erschwerte Intubation bei extrem adipösen Patientinnen und Patienten<br />
sind zu erheben, um diesbezüglichen Risiken begegnen zu können. Es besteht bei extrem<br />
adipösen Patientinnen und Patienten eine erhöhte Aspirationsgefahr. Die Narkoseeinleitung<br />
kann zwar konventionell durchgeführt werden, bei zusätzlichen Risikofaktoren wird mit einer<br />
großzügig geplanten fiberoptischen Wachintubation das Risiko minimiert. Dieses Vorgehen<br />
geht mit einer hohen Patientenzufriedenheit und -sicherheit einher.<br />
Die Pharmakokinetik (Medikamentenwirkung) aller eingesetzten Substanzen ist im Vergleich<br />
zu normalgewichtigen Patientinnen und Patienten stark verän<strong>der</strong>t. Speziell angepasstes Mo-<br />
nitoring (z.B. arterielle Blutdruckmessung) erhöht die perioperative Sicherheit und ermöglicht<br />
das Erkennen von kritischen Situationen schon vor Eintritt von Komplikationen.<br />
Bei bariatrischen (bariatrisch = griech. βαρος, báros: Schwere, Gewicht) Operationsverfah-<br />
ren kann die thorakale Peridualanalgesie die pulmonale Funktion verbessern und bietet die<br />
Möglichkeit, den Einsatz von Opioiden soweit als möglich zu meiden. Dies ist beson<strong>der</strong>s
wichtig beim obstruktivem Schlafapnoesyndrom und multimorbiden Patientinnen und Patien-<br />
ten.<br />
Überwachung<br />
Ziel ist ein Höchstmaß an Sicherheit den Patientinnen und Patienten zu bieten und ihn rasch<br />
zu mobilisieren.<br />
In <strong>der</strong> Regel werden die Patientinnen und Patienten zur postoperativen Überwachung <strong>der</strong><br />
respiratorischen Funktion in unserer Intensivstation betreut. Prinzipiell ist zu bedenken, dass<br />
die Patienten eine lange Zeit nach <strong>der</strong> Extubation – in <strong>der</strong> Regel mehrere Stunden - ver-<br />
mehrte Aufmerksamkeit und Unterstützung benötigen und das entsprechende Equipment zur<br />
Atemunterstützung vorhanden sein muss.<br />
Die anästhesiologische Versorgung adipöser und auch morbid-adipöser Patientinnen und<br />
Patienten bei adäquater präoperativer Vorbereitung sowie zielgerichtetem intra- und posto-<br />
perativen Management führt zu vergleichbar guten Ergebnissen wie die operative Versor-<br />
gung Normalgewichtiger. Die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit ermöglicht auch bei<br />
extrem adipösen Patientinnen und Patienten eine Anästhesie mit vertretbarem Risiko.<br />
Prim. Dr. Johann Blasl<br />
FA für Anästhesiologie<br />
Ansprechpartnerin für Rückfragen:<br />
Mag. Silke Horcicka<br />
Leiterin Kommunikation<br />
<strong>Krankenhaus</strong> <strong>der</strong> <strong>Barmherzigen</strong> <strong>Schwestern</strong> <strong>Wien</strong><br />
Stumpergasse 13, 1060 <strong>Wien</strong><br />
Tel.: +43 1 599 88 – 3199<br />
Mobil: +43 664 884 93 447<br />
E-Mail: silke.horcicka@bhs.at<br />
Web: www.bhs-wien.at<br />
2/2
Medieninformation, 17. April 2012<br />
___________________________________________________________________<br />
<strong>Adipositas</strong> ist nicht Übergewicht!<br />
Dennoch werden für Marketing oft beide Begriffe vermischt und Zahlen manipuliert.<br />
<strong>Adipositas</strong> ist definitiv KEINE Essstörung!<br />
Wir unterscheiden 3 Formen von Essstörungen:<br />
- Die Magersucht o<strong>der</strong> Anorexia nervosa. Die PatientInnen sind untergewichtig und<br />
haben einen BMI unter 17,5<br />
- Die Ess-Brechsucht o<strong>der</strong> Bulimia nervosa, bei <strong>der</strong> die Patientinnen meist normal-<br />
gewichtig sind<br />
- Binge Eating disor<strong>der</strong>, bei <strong>der</strong> die PatientInnen meist übergewichtig sind. Bei dieser<br />
Essstörung treten regelmäßige Essanfälle mit Kontrollverlust auf. Im Anschluss erfol-<br />
gen keine kompensatorischen Verhaltensweisen wie Erbrechen, Fasten, Hyperaktivi-<br />
tät o<strong>der</strong> Abführmittelgebrauch.<br />
Die Prävalenz von Binge Eating Disor<strong>der</strong> bei adipösen PatientInnen vor einer bariatri-<br />
schen Operation liegt bei etwa 15 bis 30%!<br />
Für <strong>Adipositas</strong> gibt es eine genetische Prädisposition (Zwillings- und Adoptionsfor-<br />
schung, Microbiom)<br />
<strong>Adipositas</strong> findet sich häufiger bei niedrigem sozialen Status.<br />
<strong>Adipositas</strong> kann auch sekundär im Rahmen internistischer Erkrankungen auftre-<br />
ten wie Schilddrüsenunterfunktion.<br />
Schließlich kann <strong>Adipositas</strong> auch als Nebenwirkung von Medikamenten auftreten,<br />
wie Kortison, Psychopharmaka o<strong>der</strong> Antidiabetika.<br />
Dennoch gibt es eine ausgeprägte Stigmatisierung von adipösen Menschen mit dem<br />
Vorurteil, dass die <strong>Adipositas</strong> ausschließlich eine Folge einer persönlichen Schwäche sei,<br />
die mit vermehrter Nahrungsaufnahme und gleichzeitiger vermin<strong>der</strong>ter körperlicher Aktivi-<br />
tät einhergeht.
Unbestritten stellt die bariatrische Chirurgie eine gute Therapieform dar, wenn die PatientIn-<br />
nen von einem interdisziplinären Team betreut werden, wie es in unserem <strong>Krankenhaus</strong> <strong>der</strong><br />
Fall ist.<br />
Der Beitrag <strong>der</strong> Abteilung für Innere Medizin und Psychosomatik in dem Behandlungspro-<br />
zess ist die ambulante postoperative Nachbetreuung über 12 Monate. Leiterin <strong>der</strong> Nachbe-<br />
treuung ist Frau OÄ. Dr. Eva Müller-Knespel, die Fachärztin für Innere Medizin und Psycho-<br />
therapeutin ist.<br />
Postoperative Nachbetreuung durch III.MED.:<br />
- Psychosomatische Betreuung<br />
- Internistische Kontrolle<br />
<strong>Adipositas</strong>chirurgische Maßnahmen mit erfolgreicher Gewichtsreduktion können aber<br />
psychosoziale Probleme nicht lösen!<br />
Im psychosomatischen Gespräch können unrealistische Erwartungen bezüglich „Ge-<br />
wichtsnormalisierung“ (statt Gewichtsreduktion), Enttäuschungen bezüglich Körperform vor<br />
den nachfolgenden plastischen Korrekturen (beispielsweise von Fettschürzen) besprochen<br />
werden.<br />
Essen hat neben <strong>der</strong> Hungersättigung wichtige an<strong>der</strong>e Funktionen zu erfüllen. Essen hat<br />
eine soziale kommunikative Dimension, dient <strong>der</strong> Affektregulation (Trösten von Kin<strong>der</strong>n mit<br />
Süßigkeiten, Kummerspeck) und kann zur Spannungsregulation benutzt werden.<br />
Wenn das „Ventil“ Essen wegfällt, kann es zum Auftreten vielfältiger neuer Probleme bis hin<br />
zu krankheitsrelevanten Störungen kommen. Diese können bei psychosomatischen ambu-<br />
lanten Kontrollen frühzeitig identifiziert und einer adäquaten Behandlung zugeführt werden.<br />
Die Internistische Kontrolle umfasst eine Beurteilung <strong>der</strong> Stoffwechselsituation, sucht<br />
eventuelle Mangelzustände, evaluiert die Reduktion <strong>der</strong> Risikofaktoren bzw. <strong>der</strong> vorbeste-<br />
henden Krankheiten wie Diabetes mellitus, Hypertonie, Hyperlipidaemie etc.<br />
Im Bedarf steht das gesamte interdisziplinäre Team zur Verfügung, das die PatientIn auch<br />
bisher betreut hat.<br />
Literatur: Herpertz, deZwaan, Zipfel: Handbuch Essstörungen und <strong>Adipositas</strong>, Springer, 2008<br />
Prim. Dr. Peter Weiss<br />
FA für Innere Medizin und Psychotherapeut<br />
Ansprechpartnerin für Rückfragen:<br />
Mag. Silke Horcicka<br />
Leiterin Kommunikation<br />
<strong>Krankenhaus</strong> <strong>der</strong> <strong>Barmherzigen</strong> <strong>Schwestern</strong> <strong>Wien</strong><br />
Stumpergasse 13, 1060 <strong>Wien</strong><br />
Tel.: +43 1 599 88 – 3199<br />
Mobil: +43 664 884 93 447<br />
E-Mail: silke.horcicka@bhs.at<br />
Web: www.bhs-wien.at<br />
2/2
Medieninformation, 17. April 2012<br />
___________________________________________________________________<br />
Begleiten und unterstützen – adipöse Menschen in <strong>der</strong> Pflege<br />
Der tägliche Umgang mit übergewichtigen Menschen im <strong>Krankenhaus</strong> ist nicht erst<br />
durch die <strong>Adipositas</strong>-Therapie präsent. Immer wie<strong>der</strong> werden Patientinnen und Patien-<br />
ten mit Übergewicht in den verschiedenen Fachabteilungen und mit unterschiedlichs-<br />
ten Diagnosen aufgenommen.<br />
Für das Zentrum <strong>der</strong> interdisziplinären <strong>Adipositas</strong>-Therapie im <strong>Krankenhaus</strong> <strong>der</strong> Barmherzi-<br />
gen <strong>Schwestern</strong> <strong>Wien</strong> ist vor allem die bedürfnisgerechte Ausstattung wichtig. Dies betrifft<br />
sowohl Betten, Matratzen, Sessel, Rollstühle, Untersuchungsliegen, Körperwaagen, Adaptie-<br />
rung <strong>der</strong> Sanitärbereiche, aber etwa auch die Anschaffung von passenden Patientenhem-<br />
den. Für adipöse Patientinnen und Patienten kann es sehr kränkend und diskriminierend<br />
sein, wenn kein geeignetes Hemd zur Verfügung steht.<br />
Unterstützung und Begleitung<br />
Bereits vor einer Operation trainieren die <strong>Adipositas</strong>-Patientinnen und Patienten das verän-<br />
<strong>der</strong>te Aufstehen nach <strong>der</strong> Operation. Die erste Mobilisierung erfolgt spätestens am 1. posto-<br />
perativen Tag. Dabei ist wichtig, dass stets mehrere Pflegekräfte anwesend sind, die schwe-<br />
re Patientinnen und Patienten bei Bedarf stützen und unterstützen können.<br />
Regelmäßig werden alle Pflegekräfte im Haus auf spezielle Mobilisationstechniken wie die<br />
Kinästhetik geschult. Der gezielte Einsatz von Spezialbetten um Patientinnen und Patienten<br />
z. B. ohne große Anstrengung in eine sitzende Position bringen zu können, unterstützt die<br />
Menschen in <strong>der</strong> Pflege im Umgang mit <strong>Adipositas</strong>-Patientinnen und Patienten.<br />
Aber nicht nur körperliche Verän<strong>der</strong>ungen beschäftigen Patientinnen und Patienten sowie<br />
Pflegepersonen. Ein großer Schwerpunkt in <strong>der</strong> Pflege ist die psychische Begleitung nach
einer Operation, die Motivation <strong>der</strong> Patientinnen und Patienten und speziell auch ein Ver-<br />
ständnis für die Enttäuschung, wenn die Mahlzeiten in deutlich kleineren Portionen serviert<br />
werden – <strong>der</strong> (bisher gewohnte) Trost durch das Essen fällt weg.<br />
Mag. Beate Czegka, MAS<br />
Pflegedirektorin<br />
Ansprechpartnerin für Rückfragen:<br />
Mag. Silke Horcicka<br />
Leiterin Kommunikation<br />
<strong>Krankenhaus</strong> <strong>der</strong> <strong>Barmherzigen</strong> <strong>Schwestern</strong> <strong>Wien</strong><br />
Stumpergasse 13, 1060 <strong>Wien</strong><br />
Tel.: +43 1 599 88 – 3199<br />
Mobil: +43 664 884 93 447<br />
E-Mail: silke.horcicka@bhs.at<br />
Web: www.bhs-wien.at<br />
2/2
Medieninformation, 17. April 2012<br />
___________________________________________________________________<br />
<strong>Adipositas</strong> – wie viel Bewegung tut gut?<br />
Die Muskulatur ist das größte Organ im menschlichen Körper, das einerseits Glukose<br />
aufnimmt und an<strong>der</strong>erseits Fett verbrennt. Durch den Mangel an Bewegung schwindet<br />
bei übergewichtigen Menschen die Muskelmasse. Aus diesem Grund ist gerade bei<br />
<strong>Adipositas</strong> regelmäßiges Kraft- und Ausdauertraining wichtig und notwendig.<br />
Bewegung fällt übergewichtigen Menschen beson<strong>der</strong>s schwer. Es gibt allerdings keine Body<br />
Mass Indexgrenze (BMI), die ein Training verbieten würde. Voraussetzung ist allerdings eine<br />
Abklärung des kardiovaskulären Risikoprofils und orthopädischer Erkrankungen. Um den<br />
BMI zu senken, ist es wichtig, die Energiezufuhr zu reduzieren. Gleichzeitige Bewegung er-<br />
höht diesen Effekt durch gesteigerten Energieverbrauch. Damit ist regelmäßiges tägliches<br />
Training auch für adipöse Menschen unumgänglich.<br />
Das Physikalische Institut am <strong>Krankenhaus</strong> <strong>der</strong> <strong>Barmherzigen</strong> <strong>Schwestern</strong> <strong>Wien</strong> bietet<br />
zweimal wöchentlich für Patientinnen und Patienten ein <strong>Adipositas</strong>/Diabetes-Gruppen Kraft-<br />
ausdauertraining an. In Zukunft soll das Angebot um eine ambulante Unterwassergymnastik<br />
erweitert werden.<br />
Training als Medikament<br />
Das Training wird hinsichtlich Intensität, Dauer, Häufigkeit und Umfang dabei ähnlich einem<br />
Medikament dosiert, um eine wöchentliche Netto-Trainingszeit (WNTZ) zu erreichen. Diese<br />
wird in Abhängigkeit von Leistungsfähigkeit und Trainingszustand individuell festgelegt.<br />
Übergewichtige Menschen können sowohl Kraft als auch Ausdauer trainieren. Ideal ist für<br />
adipöse Menschen mit einem Kraft(ausdauer)training zu beginnen. Ziel ist dabei die Erhö-<br />
hung <strong>der</strong> Muskelmasse auf Kosten <strong>der</strong> Fettmasse. Beim funktionellen Kraftausdauertraining<br />
werden immer mehrere Muskelgruppen durch eine Übung trainiert.
Gewicht wählen (zB. Hanteln) mit dem 3 – 4 mal 15 – 20 zügige Wie<strong>der</strong>holungen möglich<br />
sind, dazwischen 1 min Pause. Dies sollte 3 – 4 mal die Woche durchgeführt werden.<br />
Die positiven Effekte des Kraft(ausdauer)trainings sind einerseits ein metabolischer Benefit<br />
auf Glukose und Fettstoffwechsel (Reduktion <strong>der</strong> Fettmasse), weiters die Steigerung <strong>der</strong><br />
Muskelmasse und <strong>der</strong> Muskelkraft sowie die Erhaltung <strong>der</strong> Knochendichte (Osteoporoseprä-<br />
vention).<br />
Ausdauertraining erhöht die Fähigkeit länger eine körperliche Tätigkeit durchführen zu kön-<br />
nen, weniger rasch müde zu sein, sich rascher zu erholen. Ideale Sportarten sind schnelle-<br />
res Gehen, Walken, Schwimmen, Aquajogging o<strong>der</strong> Radfahren. Die positiven Auswirkungen<br />
umfassen die Reduktion <strong>der</strong> Fettmasse, die Ökonomisierung <strong>der</strong> Herzarbeit sowie die Stei-<br />
gerung <strong>der</strong> Ausdauerleistungsfähigkeit. Ziel ist es das Ausdauertraining 5 Mal die Woche<br />
durchzuführen.<br />
Trainingsempfehlung für Untrainierte:<br />
Beginn mit schnellerem Gehen im Intervall mit Pausen 3x10 min durch 4-6 Wochen<br />
Steigerung durch Erhöhung <strong>der</strong> Trainingsfrequenz: 4x10 min, 5x10 min, etc.<br />
nach 4-6 Wochen: Schrittweise Erhöhung <strong>der</strong> Trainingsdauer um 5-10 min (alle 4 Wo-<br />
chen)<br />
bis die WNTZ 2-3 Stunden beträgt<br />
danach erst Steigerung <strong>der</strong> Geschwindigkeit<br />
Nach einem adipositas-chirurgischen Eingriff wird <strong>der</strong> Beginn <strong>der</strong> Bewegung individuell fest-<br />
gelegt.<br />
Prim. Dr. Ingrid Heiller<br />
FÄ für Physikalische Medizin<br />
Ansprechpartnerin für Rückfragen:<br />
Mag. Silke Horcicka<br />
Leiterin Kommunikation<br />
<strong>Krankenhaus</strong> <strong>der</strong> <strong>Barmherzigen</strong> <strong>Schwestern</strong> <strong>Wien</strong><br />
Stumpergasse 13, 1060 <strong>Wien</strong><br />
Tel.: +43 1 599 88 – 3199<br />
Mobil: +43 664 884 93 447<br />
E-Mail: silke.horcicka@bhs.at<br />
Web: www.bhs-wien.at<br />
2/2
Medieninformation, 17. April 2012<br />
___________________________________________________________________<br />
Wenn die Haut zu groß ist<br />
<strong>Adipositas</strong>-Patienten nehmen zehn Klei<strong>der</strong>größen und mehr ab, da kann es sein, dass<br />
die Haut mit <strong>der</strong> Rückbildung nicht nachkommt. Wenn die Haut in großen Lappen von<br />
Bauch, Gesäß o<strong>der</strong> Oberarmen hängt, ist eine chirurgische Straffung erfor<strong>der</strong>lich. Ziel<br />
des „Body Lift“ ist es, einerseits eine ästhetische Form zu erreichen, an<strong>der</strong>erseits den<br />
Bewegungsapparat zu erleichtern – und damit die Lebensqualität zu erhöhen.<br />
Prim. Dr. Boris Todoroff leitet die Abteilung für Plastische und Rekonstruktive Chirurgie im<br />
<strong>Krankenhaus</strong> <strong>der</strong> <strong>Barmherzigen</strong> <strong>Schwestern</strong> <strong>Wien</strong> und weiß, warum die Entfernung <strong>der</strong><br />
Hautschürzen wichtig ist: „Wenn man so viele Kilos abgenommen hat, dann bleiben meist<br />
sehr störende und unästhetische Hautlappen zurück, die nur mithilfe eines chirurgischen<br />
Eingriffes entfernt werden können.“ Vor allem wenn sich unter den Hautlappen Entzündun-<br />
gen bilden, ist ein Eingriff indiziert. In einer rund drei- bis vierstündigen Operationen wird die<br />
überschüssige Haut entfernt.<br />
Dass diese aufwendige Operation nur im <strong>Krankenhaus</strong> gemacht werden kann versteht sich<br />
von selbst. „Im <strong>Krankenhaus</strong> haben wir alle Möglichkeiten, die Patientinnen und Patienten<br />
nach dem Eingriff optimal zu betreuen und auch am Wochenende eine nahtlose Versorgung<br />
zu gewährleisten“, so Prim. Todoroff.<br />
Und: Bei einer entsprechenden medizinischen Indikation wird <strong>der</strong> Eingriff von <strong>der</strong> Kranken-<br />
kasse bezahlt. Voraussetzung für den Eingriff ist, dass die Patienten Normalgewicht erreicht<br />
und dieses über einen längeren Zeitraum gehalten haben.<br />
Prim. Dr. Boris Todoroff<br />
FA für Plastische und Rekonstruktive Medizin<br />
Ansprechpartnerin für Rückfragen:<br />
Mag. Silke Horcicka<br />
Leiterin Kommunikation<br />
<strong>Krankenhaus</strong> <strong>der</strong> <strong>Barmherzigen</strong> <strong>Schwestern</strong> <strong>Wien</strong><br />
Stumpergasse 13, 1060 <strong>Wien</strong><br />
Tel.: +43 1 599 88 – 3199<br />
Mobil: +43 664 884 93 447<br />
E-Mail: silke.horcicka@bhs.at<br />
Web: www.bhs-wien.at